Musterlösungen Vieweg-Buch IT-Risiko-Management mit System
|
|
|
- Gottlob Weiner
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Kontrollfragen und Aufgaben zu Kapitel 10 Lösung zu Frage 1 Neben den Risiken sind in einem IT-Sicherheitskonzept beispielsweise folgende Anforderungen zu berücksichtigen: Leistungsvorgaben (z.b. definiert mittels SLA) Qualitätsanforderungen Architektur-Vorgaben Innerbetriebliche Standards Gesetzliche und regulative Vorgaben (Informationenschutz, Bankgeheimnis, Urheberrecht, Basel II usw.) Lösung zu Frage 2 Die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts ist dann nützlich, wenn es bei Prozessen oder IT-Systemen darum geht, mit geeigneten Massnahmen die Risiken auf tragbare Restrisiken zu reduzieren und wenn die Art und Weise der Bewältigung der Risiken aufgezeigt und dokumentiert werden muss. Das Sicherheitskonzept kann sich auf die Sicherheitsaspekte des ganzen Lebenszyklus eines Systems (z.b. Beschaffung, Entwicklung, Einführung, Betrieb und Entsorgung) oder auch nur auf einzelne Phasen (z.b. Entwicklung oder Betrieb) beziehen. Solche phasenspezifischen Sicherheitskonzepte sind dann sinnvoll, wenn einzelne Lebenszyklusphasen (z.b. Entwicklung, Migration und Einführung) in sich stark risikobehaftet sind. Lösung zu Frage 3 Die sechs Kapitel eines IT-Sicherheitskonzepts sind: Kapitel 1: Ausgangslage Kapitel 2: Systembeschreibung und Schutzobjekte H.P. Königs,
2 Kapitel 3: Risikoanalyse Kapitel 4: Anforderungen an Sicherheitsmassnahmen Kapitel 5: Sicherheitsmassnahmenbeschreibung Kapitel 6: Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen Lösung zu Frage 4 In Situationen, in denen die Schutzobjekte nicht in einer bewertbaren Form vorliegen, muss auf die Impakt-Analyse (Schadensausmass-Analyse) vezichtet werden. In solchen Fällen ist es oft sinnvoll, anstelle einer Risikoanalyse eine bewertende Schwachstellenanalyse durchzuführen. Lösung zu Frage 5 Die Schutzobjekte bei CRAMM werden im sog. Asset-Model gemäss folgender Hierarchie verknüpft: Hierarchie der Schutzobjekte-Kategorien Informationen-/Informationsobjekt und für die Informations-Lieferung zuständiger Endbenützer- Service. Software-Objekte Physische Objekte, welche die Informationsobjekte jeweils unterstützen (z.b. Hardware, Netzwerkkomponenten und Betriebssysteme. Anm.: Die Betriebssysteme und ihre Komponenten werden zu den physischen Objekten gezählt) Räume 2 H.P. Königs,
3 Kontrollfragen und Aufgaben zu Kapitel 10 Lösung zu Frage 6 Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) ist eine Bottom-up-Methode; sie zeigt, wo Einzelkomponenten zu Ausfällen und Auswirkungen auf den höheren Ebenen eines ganzen Systems oder Teilsystems führen können. Damit kann sie als Schwachstellenanalyse insbesondere zum Aufzeigen von Single point of Failures dienen. Nach dem What-if -Prinzip (Was ist, wenn?) können auch Massnahmen verifiziert werden, die den Störungs-Einfluss einer kritischen Komponente auf das Gesamtsystem mildern. Lösung zu Frage 7 Rpz = A B E Rpz: Risikoprioritätenzahl A: Auftretenswahrscheinlichkeit (1= gering; 10= hoch) B: Bedeutung (1=geringfügige Auswirkungen; 10=äusserst schwerwiegend Folgen) E: Entdeckungswahrscheinlichkeit (1= hoch; 10 = gering) Die Zuordnung der Risikoprioritätenzahl zu einzelnen Komponenten oder Konfigurationen ermöglicht die quantitative Bewertung der Gesamtzuverlässigkeit einer gewählten Systemvariante. Für jedes System resp. Merkmal werden im Wesentlichen die potenziellen Fehler, die potenziellen Folgen der Fehler, die potenziellen Fehlerursachen sowie die empfohlenen Massnahmen mit Verantwortlichkeitszuordnung registriert. Der derzeitige und der mit Massnahmen verbesserte Zustand werden anhand der oben angegeben Risiko-Parametern bewertet Lösung zu Frage 8 Die Fehlerbaum-Analyse ist eine Top-Down-Methode. Bei dieser Methode werden von einem bestimmten Fehlerereignis dem sog. Top-Ereignis (Top Event) deduktiv die ursächlichen Ereignisse gesucht, die für das Top-Ereignis verantwortlich sind. Die möglichen Ereignisse werden dabei logisch zu einer Baumstruktur 3
4 verknüpft. Der Baum zeigt auf, welche untergeordneten Ereignisse in welcher logischen Verknüpfung ein jeweils übergeordnetes Fehler-Ereignis verursachen. Als quatitative Aussage liefert die Fehlerbaumanalyse insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit des Top-Ereignisses. Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich rechnerisch aus den logischen Verknüpfungen des Baumes und den Wahrscheinlichkeiten der ursächlichen (Basis)-Ereignisse. Lösung zu Frage 9 Die Ereignisbaumanalyse ist eine Bottom-up-Methode; sie liefert die Folgen (Schäden) und deren Wahrscheinlichkeiten aufgrund eines auslösenden Ereignisses. Das auslösende Ereignis kann beispielsweise der Ausfall einer Systemkomponente im System sein. Lösung zu Frage 10 a) Die bereits bekannten Informationen des Falles werden vor allem in die Kapitel 1, 2 und 4 eines Sicherheitskonzepts aufgenommen. Die Ausgangslage in Kapitel 1 soll den allgemeinen Kontext des Sicherheitskonzepts und vor allem Zweck und die Ziele des neuen Teilsystems enthalten. Zum allgemeinen Kontext gehört auch das geschäftliche und organisatorische Umfeld für das neue Teilsystem (z.b. Geschäftsfunktionen, Verantwortlichkeiten, Termine, Eigentums- und Vertragsverhältnisse). Ebenfalls enthält es die Abgrenzungen für die Behandlung des Teilsystems sowie die besonderen Anforderungen und Einschränkungen. In Kapitel 2 wird das neue Teilsystem, wie es sich in das bestehende Gesamtsystem einfügt mit seinen Funktionen beschrieben und dargestellt. Somit enthält Kapitel 2 den für die Risiken spezifischen Kontext für die neuen IT-Risiken. Unter anderem zeigt das Kapitel 2 die Schutzobjekte, für welche die Risiken und allfälligen Massnahmen ermittelt werden. Schliesslich zeigt Kapitel 4 die an die Sicherheitsmassnahmen gerichteten Anforderungen, die sich nicht nur aus den Risiken, sondern auch aus den sonstigen Bedingungen für das IT-System ergeben, z.b. Datenschutz, Allgemeine Geschäftsbedingungen, 4 H.P. Königs,
5 Kontrollfragen und Aufgaben zu Kapitel 10 SSL zur Übertragungschiffrierung, SecurID-Karte zur Autentisierung des Benutzers, Online-Abfragemöglichkeit über 7 x 24 Std. für Umsatz und Kassenbestand. b) Die wesentlichen IT-Gefahren für das neue Teilsystem sind: c) Missbrauch von persönlichen Daten des Käufers (Verletzung Datenschutz) Ausspionieren der unter das Geschäftgeheimnis des Händlers fallenden Informationen (z.b. durch Maskerade eines Händlers oder durch Eindringen auf den PC des Händlers) Versagen von technischen Komponenten Benutzerfehler (menschliches Versagen) Aus der Fallbeschreibung kann geschlossen werden, dass insbesondere für das Systemziel Vertraulichkeit allenfalls hohe Risiken anfallen können. d) Als kostengünstigere Händlerauthentifizierungen können Authentisierverfahren mit Passwort (ggf. auch PIN) oder Passwort mit zusätzlicher Random-Code-Tabelle untersucht werden. e) Risiken für den Händler: Bei schwacher Authentisierung besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit als bei starker Authentisierung, dass die unter Geschäftsgeheimnis stehenden Informationen an die Konkurrenz abfliessen. (Anm.: Mit zusätzlichen Massnahmen kann das Risiko einer schwachen Authentisierung jedoch verringert werden). => Risiko 1 Bei schwacher im Gegensatz zu starker Authentisierung wird auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Informationen von Kunden an Dritte abfliessen. Je öfter dies vorkommt, desto höher wird der Reputationsschaden. => Risiko 2 Risiken für Interpay: Fliessen Informationen an Dritte ab, dann wird der Reputationsschaden für Interpay umso grösser je öfters dies vorkommt. => Risiko 3 5
6 Anhand der Fallbeschreibung können wir diese Risiken gemäss Tabelle 1 für starke und schwache Authentisierung ordinal bewerten: Schwache Starke Authentierung Authentierung R.- Nr. Risiko- Bezeichnung 1 Risiko für Händler Abfluss von Ge- schäfts- Informationen an Konkurrenz 2 Reputationsrisiko für Händler Abfluss von Kunden- Informationen an Dritte 3 Reputationsrisiko für Interpay Abfluss von Kundenoder Geschäftsinformation an Dritte Schaden Schaden mittel mittel mittel mittel gross oft mittel Tabelle 1: Risiken bei starker und schwacher Authentisierung oft oft Abbildung 1: Darstellung der Risiken im Risk Map bei starker und schwacher Authentisierung 6 H.P. Königs,
7 Kontrollfragen und Aufgaben zu Kapitel 10 f) Aufgrund der hohen Massnahmenkosten (hohe Kosten der SecureID-Karte) und der Risiken (z.b. Datenschutzverletzung) müssen die Anforderungen der Interpay modifiziert werden. Folgende Massnahmen tragen den Anforderungen Rechnung: M 1:Anonymisierung der für Werbeaktionen notwendigen Kundendaten. M 2:Passwort mit erzwungener strenger Passwortpolicy (z.b. komplexes Passwort). M 3:Anleitung des Händlers, wie er seinen PC, z.b. mittels Personal Firewall und Virenschutz, vor Angriffen aus dem Internet schützen kann. M 4:Explizite Verantwortlichkeitzuweisung im Vertrag und/oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Händler zur Befolgung der vorgeschriebenen Massnahmen. R.- Nr. (*) 1 Informationen unter Geschäftsgeheimnis des Händlers 2 Kunden- Informationen 3 Dienstleistung der Interpay Ausspionieren der Informationen (z.b. durch Maskerade oder durch Eindringen auf den PC des Händlers) Missbrauch von persönlichen Daten eines Kunden Abfluss von Kunden- oder Geschäftsinformationen an Dritte (*) Risiko-Nummerierung s. Tabelle 1 M2, M3 und M4 M1, M2, M3 und M4 M1, M2, M3 und M4 Schaden mittel klein mittel Restrisiken Schutzobjekte Bedrohungen Massnahmen Tabelle 2: Restrisiken bei modifizierten Anforderungen und Massnahmen 7
8 g) oft oft (*) Risiko-Nummerierung s. Tabelle 1 Abbildung 2: Restrisiken im Risk Map bei modifizierten Anforderungen und Massnahmen h) Durch die Anonymisierung werden Risiken vermieden 8 H.P. Königs,
Sicherheitstechnische Qualifizierung (SQ), Version 9.0
 Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen Atos Worldline GmbH Hahnstraße 25 60528 Frankfurt/Main für das PIN Change-Verfahren Telefonbasierte Self Selected
Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen Atos Worldline GmbH Hahnstraße 25 60528 Frankfurt/Main für das PIN Change-Verfahren Telefonbasierte Self Selected
Folie 1: Fehlerbaumanalyse (FTA) Kurzbeschreibung und Ziel Die Fehlerbaumanalyse im Englischen als Fault Tree Analysis bezeichnet und mit FTA
 Folie 1: Fehlerbaumanalyse (FTA) Kurzbeschreibung und Ziel Die Fehlerbaumanalyse im Englischen als Fault Tree Analysis bezeichnet und mit FTA abgekürzt dient der systematischen Untersuchung von Komponenten
Folie 1: Fehlerbaumanalyse (FTA) Kurzbeschreibung und Ziel Die Fehlerbaumanalyse im Englischen als Fault Tree Analysis bezeichnet und mit FTA abgekürzt dient der systematischen Untersuchung von Komponenten
Pragmatisches Risikomanagement in der pharmazeutischen Herstellung
 Pragmatisches Risikomanagement in der pharmazeutischen Herstellung XIV. Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Plasmapherese e.v 22. November 2014, Leipzig _Eitelstraße 80 _40472 Düsseldorf
Pragmatisches Risikomanagement in der pharmazeutischen Herstellung XIV. Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Plasmapherese e.v 22. November 2014, Leipzig _Eitelstraße 80 _40472 Düsseldorf
statuscheck im Unternehmen
 Studentische Beratungsgesellschaft für Sicherheitsangelegenheiten an der HWR Berlin statuscheck im Unternehmen Mit unserem statuscheck analysieren wir für Sie Schwachstellen, Risiken sowie Kosten und Nutzen
Studentische Beratungsgesellschaft für Sicherheitsangelegenheiten an der HWR Berlin statuscheck im Unternehmen Mit unserem statuscheck analysieren wir für Sie Schwachstellen, Risiken sowie Kosten und Nutzen
Inhalt. Kundenbindung langfristig Erfolge sichern 5 Kundenbindung als Teil Ihrer Unternehmensstrategie 6 Was Kundenorientierung wirklich bedeutet 11
 2 Inhalt Kundenbindung langfristig Erfolge sichern 5 Kundenbindung als Teil Ihrer Unternehmensstrategie 6 Was Kundenorientierung wirklich bedeutet 11 Die Erfolgsfaktoren für Ihre Kundenbindung 17 Diese
2 Inhalt Kundenbindung langfristig Erfolge sichern 5 Kundenbindung als Teil Ihrer Unternehmensstrategie 6 Was Kundenorientierung wirklich bedeutet 11 Die Erfolgsfaktoren für Ihre Kundenbindung 17 Diese
Finanzierung für den Mittelstand. Leitbild. der Abbildung schankz www.fotosearch.de
 Finanzierung für den Mittelstand Leitbild der Abbildung schankz www.fotosearch.de Präambel Die Mitgliedsbanken des Bankenfachverbandes bekennen sich zur Finanzierung des Mittelstands mit vertrauenswürdigen,
Finanzierung für den Mittelstand Leitbild der Abbildung schankz www.fotosearch.de Präambel Die Mitgliedsbanken des Bankenfachverbandes bekennen sich zur Finanzierung des Mittelstands mit vertrauenswürdigen,
Protect 7 Anti-Malware Service. Dokumentation
 Dokumentation Protect 7 Anti-Malware Service 1 Der Anti-Malware Service Der Protect 7 Anti-Malware Service ist eine teilautomatisierte Dienstleistung zum Schutz von Webseiten und Webapplikationen. Der
Dokumentation Protect 7 Anti-Malware Service 1 Der Anti-Malware Service Der Protect 7 Anti-Malware Service ist eine teilautomatisierte Dienstleistung zum Schutz von Webseiten und Webapplikationen. Der
Ordner Berechtigung vergeben Zugriffsrechte unter Windows einrichten
 Ordner Berechtigung vergeben Zugriffsrechte unter Windows einrichten Was sind Berechtigungen? Unter Berechtigungen werden ganz allgemein die Zugriffsrechte auf Dateien und Verzeichnisse (Ordner) verstanden.
Ordner Berechtigung vergeben Zugriffsrechte unter Windows einrichten Was sind Berechtigungen? Unter Berechtigungen werden ganz allgemein die Zugriffsrechte auf Dateien und Verzeichnisse (Ordner) verstanden.
SWOT Analyse zur Unterstützung des Projektmonitorings
 SWOT Analyse zur Unterstützung des Projektmonitorings Alle QaS-Dokumente können auf der QaS-Webseite heruntergeladen werden, http://qas.programkontoret.se Seite 1 Was ist SWOT? SWOT steht für Stärken (Strengths),
SWOT Analyse zur Unterstützung des Projektmonitorings Alle QaS-Dokumente können auf der QaS-Webseite heruntergeladen werden, http://qas.programkontoret.se Seite 1 Was ist SWOT? SWOT steht für Stärken (Strengths),
Mitarbeiterbefragung als PE- und OE-Instrument
 Mitarbeiterbefragung als PE- und OE-Instrument 1. Was nützt die Mitarbeiterbefragung? Eine Mitarbeiterbefragung hat den Sinn, die Sichtweisen der im Unternehmen tätigen Menschen zu erkennen und für die
Mitarbeiterbefragung als PE- und OE-Instrument 1. Was nützt die Mitarbeiterbefragung? Eine Mitarbeiterbefragung hat den Sinn, die Sichtweisen der im Unternehmen tätigen Menschen zu erkennen und für die
Einführung Qualitätsmanagement 2 QM 2
 Einführung Qualitätsmanagement 2 QM 2 Stand: 13.04.2015 Vorlesung 2 Agenda: 1. Reklamationsmanagement (Rekla) 2. Lieferantenbewertung (Lief.bew.) 3. Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse (FMEA) 4. Auditmanagement
Einführung Qualitätsmanagement 2 QM 2 Stand: 13.04.2015 Vorlesung 2 Agenda: 1. Reklamationsmanagement (Rekla) 2. Lieferantenbewertung (Lief.bew.) 3. Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse (FMEA) 4. Auditmanagement
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
 Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB Allgemeines Zusammenarbeit Machen Sie sich ein Bild von unserer Zusammenarbeit. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden den Rahmen, damit Sie und wir zusammen nur
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB Allgemeines Zusammenarbeit Machen Sie sich ein Bild von unserer Zusammenarbeit. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden den Rahmen, damit Sie und wir zusammen nur
Nr. 12-1/Dezember 2005-Januar 2006. A 12041
 Nr. 12-1/Dezember 2005-Januar 2006. A 12041 Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg. Postfach 1820. 53008 Bonn Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg Sparkassen-Finanzgruppe Wenn man sich zur
Nr. 12-1/Dezember 2005-Januar 2006. A 12041 Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg. Postfach 1820. 53008 Bonn Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg Sparkassen-Finanzgruppe Wenn man sich zur
Sicherheitsaspekte der kommunalen Arbeit
 Sicherheitsaspekte der kommunalen Arbeit Was ist machbar, finanzierbar, umzusetzen und unbedingt notwendig? Sicherheit in der Gemeinde Bei der Kommunikation zwischen Behörden oder zwischen Bürgerinnen,
Sicherheitsaspekte der kommunalen Arbeit Was ist machbar, finanzierbar, umzusetzen und unbedingt notwendig? Sicherheit in der Gemeinde Bei der Kommunikation zwischen Behörden oder zwischen Bürgerinnen,
Handbuch zur Installation des Smart Card- Lesegerätes MiniLector USB
 Handbuch zur Installation des Smart Card- Lesegerätes MiniLector USB Microsoft Windows (7, Vista, XP) Version: 1 / Datum: 28.09.2012 www.provinz.bz.it/buergerkarte/ Inhaltsverzeichnis Haftungsausschlussklausel...
Handbuch zur Installation des Smart Card- Lesegerätes MiniLector USB Microsoft Windows (7, Vista, XP) Version: 1 / Datum: 28.09.2012 www.provinz.bz.it/buergerkarte/ Inhaltsverzeichnis Haftungsausschlussklausel...
Gedanken zu: Wildbäche und Murgänge eine Herausforderung für Praxis und Forschung
 Bundesamt für Umwelt BAFU Gedanken zu: Wildbäche und Murgänge eine Herausforderung für Praxis und Forschung Peter Greminger Risikomanagement kann einen Beitrag dazu leisten, bei ungewisser Sachlage best
Bundesamt für Umwelt BAFU Gedanken zu: Wildbäche und Murgänge eine Herausforderung für Praxis und Forschung Peter Greminger Risikomanagement kann einen Beitrag dazu leisten, bei ungewisser Sachlage best
ÜBERGABE DER OPERATIVEN GESCHÄFTSFÜHRUNG VON MARC BRUNNER AN DOMINIK NYFFENEGGER
 GOOD NEWS VON USP ÜBERGABE DER OPERATIVEN GESCHÄFTSFÜHRUNG VON MARC BRUNNER AN DOMINIK NYFFENEGGER In den vergangenen vierzehn Jahren haben wir mit USP Partner AG eine der bedeutendsten Marketingagenturen
GOOD NEWS VON USP ÜBERGABE DER OPERATIVEN GESCHÄFTSFÜHRUNG VON MARC BRUNNER AN DOMINIK NYFFENEGGER In den vergangenen vierzehn Jahren haben wir mit USP Partner AG eine der bedeutendsten Marketingagenturen
Fragen und Antworten zum Thema. Lieferanspruch
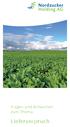 Fragen und Antworten zum Thema Lieferanspruch Was ist der Lieferanspruch und warum tritt er in Kraft? Der Lieferanspruch ist in den Satzungen der Nordzucker Holding AG und der Union-Zucker Südhannover
Fragen und Antworten zum Thema Lieferanspruch Was ist der Lieferanspruch und warum tritt er in Kraft? Der Lieferanspruch ist in den Satzungen der Nordzucker Holding AG und der Union-Zucker Südhannover
DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT
 DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT In 30 Fragen und 5 Tipps zum erfolgreichen Projekt! Beantworten Sie die wichtigsten Fragen rund um Ihr Projekt für Ihren Erfolg und für Ihre Unterstützer. IHR LEITFADEN
DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT In 30 Fragen und 5 Tipps zum erfolgreichen Projekt! Beantworten Sie die wichtigsten Fragen rund um Ihr Projekt für Ihren Erfolg und für Ihre Unterstützer. IHR LEITFADEN
IT-Sicherheitsmanagement bei der Landeshauptstadt München
 IT-Sicherheitsmanagement bei der Landeshauptstadt München 7. Bayerisches Anwenderforum egovernment Schloss Nymphenburg, München 9. Juni 2015 Dr. Michael Bungert Landeshauptstadt München Direktorium Hauptabteilung
IT-Sicherheitsmanagement bei der Landeshauptstadt München 7. Bayerisches Anwenderforum egovernment Schloss Nymphenburg, München 9. Juni 2015 Dr. Michael Bungert Landeshauptstadt München Direktorium Hauptabteilung
Häufig wiederkehrende Fragen zur mündlichen Ergänzungsprüfung im Einzelnen:
 Mündliche Ergänzungsprüfung bei gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsordnungen bis zum 31.12.2006 und für alle Ausbildungsordnungen ab 01.01.2007 Am 13. Dezember 2006 verabschiedete der
Mündliche Ergänzungsprüfung bei gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsordnungen bis zum 31.12.2006 und für alle Ausbildungsordnungen ab 01.01.2007 Am 13. Dezember 2006 verabschiedete der
Sichere E-Mail Anleitung Zertifikate / Schlüssel für Kunden der Sparkasse Germersheim-Kandel. Sichere E-Mail. der
 Sichere E-Mail der Nutzung von Zertifikaten / Schlüsseln zur sicheren Kommunikation per E-Mail mit der Sparkasse Germersheim-Kandel Inhalt: 1. Voraussetzungen... 2 2. Registrierungsprozess... 2 3. Empfang
Sichere E-Mail der Nutzung von Zertifikaten / Schlüsseln zur sicheren Kommunikation per E-Mail mit der Sparkasse Germersheim-Kandel Inhalt: 1. Voraussetzungen... 2 2. Registrierungsprozess... 2 3. Empfang
Bei der Focus Methode handelt es sich um eine Analyse-Methode die der Erkennung und Abstellung von Fehlerzuständen dient.
 Beschreibung der Focus Methode Bei der Focus Methode handelt es sich um eine Analyse-Methode die der Erkennung und Abstellung von Fehlerzuständen dient. 1. F = Failure / Finding An dieser Stelle wird der
Beschreibung der Focus Methode Bei der Focus Methode handelt es sich um eine Analyse-Methode die der Erkennung und Abstellung von Fehlerzuständen dient. 1. F = Failure / Finding An dieser Stelle wird der
I n f o r m a t i o n s s i c h e r h e i t i n G e m e i n d e n B e v ö l k e r u n g s z a h l < 6 000
 Leitfaden I n f o r m a t i o n s s i c h e r h e i t i n G e m e i n d e n B e v ö l k e r u n g s z a h l < 6 000 Inhalt 1 Einleitung... 2 2 Übersicht Dokumente... 2 3 Umsetzung der Anforderungen an
Leitfaden I n f o r m a t i o n s s i c h e r h e i t i n G e m e i n d e n B e v ö l k e r u n g s z a h l < 6 000 Inhalt 1 Einleitung... 2 2 Übersicht Dokumente... 2 3 Umsetzung der Anforderungen an
Freifunk Halle. Förderverein Freifunk Halle e.v. IT Sicherheitskonzept. Registernummer bei der Bundesnetzagentur: 14/234
 IT Sicherheitskonzept Registernummer bei der Bundesnetzagentur: 14/234 1. Geltungsbereich 1.Dieses IT-Sicherheitskonzept gilt strukturell für Systemkomponenten des Freifunknetzes, welche vom selbst betrieben
IT Sicherheitskonzept Registernummer bei der Bundesnetzagentur: 14/234 1. Geltungsbereich 1.Dieses IT-Sicherheitskonzept gilt strukturell für Systemkomponenten des Freifunknetzes, welche vom selbst betrieben
Risikoanalyse im Licht der neuen Medizinprodukterichtlinie
 3. Fms Regionalforum, 23. Mai 2008, Leipzig Risikoanalyse im Licht der neuen Medizinprodukterichtlinie Erfahrungen eines Prüfinstituts zu neuer Qualität & Sicherheit im ingenieurtechnischen Team Bildungsangebote
3. Fms Regionalforum, 23. Mai 2008, Leipzig Risikoanalyse im Licht der neuen Medizinprodukterichtlinie Erfahrungen eines Prüfinstituts zu neuer Qualität & Sicherheit im ingenieurtechnischen Team Bildungsangebote
Widerrufsbelehrung der Free-Linked GmbH. Stand: Juni 2014
 Widerrufsbelehrung der Stand: Juni 2014 www.free-linked.de www.buddy-watcher.de Inhaltsverzeichnis Widerrufsbelehrung Verträge für die Lieferung von Waren... 3 Muster-Widerrufsformular... 5 2 Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung der Stand: Juni 2014 www.free-linked.de www.buddy-watcher.de Inhaltsverzeichnis Widerrufsbelehrung Verträge für die Lieferung von Waren... 3 Muster-Widerrufsformular... 5 2 Widerrufsbelehrung
Leseauszug DGQ-Band 14-26
 Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Anti-Botnet-Beratungszentrum. Windows XP in fünf Schritten absichern
 Windows XP in fünf Schritten absichern Inhalt: 1. Firewall Aktivierung 2. Anwendung eines Anti-Virus Scanner 3. Aktivierung der automatischen Updates 4. Erstellen eines Backup 5. Setzen von sicheren Passwörtern
Windows XP in fünf Schritten absichern Inhalt: 1. Firewall Aktivierung 2. Anwendung eines Anti-Virus Scanner 3. Aktivierung der automatischen Updates 4. Erstellen eines Backup 5. Setzen von sicheren Passwörtern
Eine effiziente GMP-Risikoanalyse für Pharmalieferanten
 Risk Analysis RA2x5 Eine effiziente GMP-Risikoanalyse für Pharmalieferanten Vision Pharma 2012, Karlsruhe, 28. Februar 2012 Thomas Peither, Halfmann Goetsch Peither AG Maas & Peither AG Halfmann Goetsch
Risk Analysis RA2x5 Eine effiziente GMP-Risikoanalyse für Pharmalieferanten Vision Pharma 2012, Karlsruhe, 28. Februar 2012 Thomas Peither, Halfmann Goetsch Peither AG Maas & Peither AG Halfmann Goetsch
Schriftwechsel mit Behörden Ratgeber zum Datenschutz 1
 Datenschutz und Schriftwechsel mit Behörden Ratgeber zum Datenschutz 1 Datenschutz und Herausgeber: Berliner Beauftragter für Datenschutz und Verantwortlich: Volker Brozio Redaktion: Laima Nicolaus An
Datenschutz und Schriftwechsel mit Behörden Ratgeber zum Datenschutz 1 Datenschutz und Herausgeber: Berliner Beauftragter für Datenschutz und Verantwortlich: Volker Brozio Redaktion: Laima Nicolaus An
Requirements Engineering für IT Systeme
 Requirements Engineering für IT Systeme Warum Systemanforderungen mit Unternehmenszielen anfangen Holger Dexel Webinar, 24.06.2013 Agenda Anforderungsdefinitionen Von der Herausforderung zur Lösung - ein
Requirements Engineering für IT Systeme Warum Systemanforderungen mit Unternehmenszielen anfangen Holger Dexel Webinar, 24.06.2013 Agenda Anforderungsdefinitionen Von der Herausforderung zur Lösung - ein
Engagement der Industrie im Bereich Cyber Defense. Blumenthal Bruno Team Leader Information Security RUAG Defence Aarau, 25.
 Engagement der Industrie im Bereich Cyber Defense Blumenthal Bruno Team Leader Information Security RUAG Defence Aarau, 25. April 2012 Cyber Defense = Informationssicherheit 2 Bedrohungen und Risiken Bedrohungen
Engagement der Industrie im Bereich Cyber Defense Blumenthal Bruno Team Leader Information Security RUAG Defence Aarau, 25. April 2012 Cyber Defense = Informationssicherheit 2 Bedrohungen und Risiken Bedrohungen
Risikomanagement in der Praxis Alles Compliance oder was?! 1. IT-Grundschutz-Tag 2014 13.02.2014
 Risikomanagement in der Praxis Alles Compliance oder was?! 1. IT-Grundschutz-Tag 2014 13.02.2014 Risikomanagement Eine Einführung Risikomanagement ist nach der Norm ISO 31000 eine identifiziert, analysiert
Risikomanagement in der Praxis Alles Compliance oder was?! 1. IT-Grundschutz-Tag 2014 13.02.2014 Risikomanagement Eine Einführung Risikomanagement ist nach der Norm ISO 31000 eine identifiziert, analysiert
Fachnachmittag Sexuelle Grenzüberschreitung Impulse zum professionellen Umgang in der Kita Bürgerhaus Zähringen 16. Mai 2013
 Fachnachmittag Sexuelle Grenzüberschreitung Impulse zum professionellen Umgang in der Kita Bürgerhaus Zähringen 16. Mai 2013 Kirstin Lietz, Dipl. Sozialpädagogin (BA) Die Aufgaben der insoweit erfahrenen
Fachnachmittag Sexuelle Grenzüberschreitung Impulse zum professionellen Umgang in der Kita Bürgerhaus Zähringen 16. Mai 2013 Kirstin Lietz, Dipl. Sozialpädagogin (BA) Die Aufgaben der insoweit erfahrenen
Doing Business : China Do s und Don ts
 Dr. Kraus & Partner Werner-von-Siemens-Str. 2-6 76646 Bruchsal Tel: 07251-989034 Fax: 07251-989035 http://www.kraus-und-partner.de Doing Business : China Do s und Don ts China Das Land der Mitte 2 Grundlegende
Dr. Kraus & Partner Werner-von-Siemens-Str. 2-6 76646 Bruchsal Tel: 07251-989034 Fax: 07251-989035 http://www.kraus-und-partner.de Doing Business : China Do s und Don ts China Das Land der Mitte 2 Grundlegende
Xesar. Die vielfältige Sicherheitslösung
 Xesar Die vielfältige Sicherheitslösung Xesar Die professionelle Lösung für Ihr Unternehmen Xesar Sicher und flexibel Xesar ist das vielseitige elektronische Schließsystem aus dem Hause EVVA. Komplexe
Xesar Die vielfältige Sicherheitslösung Xesar Die professionelle Lösung für Ihr Unternehmen Xesar Sicher und flexibel Xesar ist das vielseitige elektronische Schließsystem aus dem Hause EVVA. Komplexe
Zentrum. Zentrum Ideenmanagement. Zentrum Ideenmanagement. Umfrage zur Nutzung von mobilen Endgeräten im Ideenmanagement
 Zentrum Zentrum Ideenmanagement Zentrum Ideenmanagement Expertenkreis Technologie & Software Umfrage zur Nutzung von mobilen Endgeräten im Ideenmanagement Auswertung Fragebogen 2013 In 2011 hat der Expertenkreis
Zentrum Zentrum Ideenmanagement Zentrum Ideenmanagement Expertenkreis Technologie & Software Umfrage zur Nutzung von mobilen Endgeräten im Ideenmanagement Auswertung Fragebogen 2013 In 2011 hat der Expertenkreis
Kriterienkatalog und Vorgehensweise für Bestätigungen und Konformitätsnachweise gemäß Signaturgesetz. datenschutz cert GmbH Version 1.
 Kriterienkatalog und Vorgehensweise für Bestätigungen und Konformitätsnachweise gemäß Signaturgesetz (SigG) datenschutz cert GmbH Version Inhaltsverzeichnis Kriterienkatalog und Vorgehensweise für Bestätigungen
Kriterienkatalog und Vorgehensweise für Bestätigungen und Konformitätsnachweise gemäß Signaturgesetz (SigG) datenschutz cert GmbH Version Inhaltsverzeichnis Kriterienkatalog und Vorgehensweise für Bestätigungen
Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit
 Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit der Arbeitsgruppe Bildung und Training des Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. Seit Dezember
Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit der Arbeitsgruppe Bildung und Training des Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. Seit Dezember
Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements. von Stephanie Wilke am 14.08.08
 Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements von Stephanie Wilke am 14.08.08 Überblick Einleitung Was ist ITIL? Gegenüberstellung der Prozesse Neuer
Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements von Stephanie Wilke am 14.08.08 Überblick Einleitung Was ist ITIL? Gegenüberstellung der Prozesse Neuer
Rudolf Schraml. Beratung und Vertrieb IT-Security und Datenschutz
 Rudolf Schraml Beratung und Vertrieb IT-Security und Datenschutz Effektives IT-Risikomanagement Chance oder Risiko Was vor einiger Zeit nur für die großen Unternehmen galt, ist jetzt auch im Mittelstand
Rudolf Schraml Beratung und Vertrieb IT-Security und Datenschutz Effektives IT-Risikomanagement Chance oder Risiko Was vor einiger Zeit nur für die großen Unternehmen galt, ist jetzt auch im Mittelstand
Würfelt man dabei je genau 10 - mal eine 1, 2, 3, 4, 5 und 6, so beträgt die Anzahl. der verschiedenen Reihenfolgen, in denen man dies tun kann, 60!.
 040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
Taxifahrende Notebooks und andere Normalitäten. Frederik Humpert
 Taxifahrende Notebooks und andere Normalitäten Frederik Humpert Ein paar Zahlen Von September 2004 bis Februar 2005 wurden weltweit 11.300 Laptops 31.400 Handhelds 200.000 Mobiltelefone in Taxis vergessen
Taxifahrende Notebooks und andere Normalitäten Frederik Humpert Ein paar Zahlen Von September 2004 bis Februar 2005 wurden weltweit 11.300 Laptops 31.400 Handhelds 200.000 Mobiltelefone in Taxis vergessen
Microsoft Office 365 Migration Benutzerdaten
 Microsoft Office 365 Migration Benutzerdaten Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Migrieren von Benutzerdaten per Export und Import mit Microsoft Outlook 2010 Es gibt verschiedene Wege Daten aus einem bestehenden
Microsoft Office 365 Migration Benutzerdaten Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Migrieren von Benutzerdaten per Export und Import mit Microsoft Outlook 2010 Es gibt verschiedene Wege Daten aus einem bestehenden
Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet
 Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet Wissen Wichtiges Wissen rund um Pflege Unterstützung Professionelle Beratung Austausch und Kontakt Erfahrungen & Rat mit anderen Angehörigen austauschen
Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet Wissen Wichtiges Wissen rund um Pflege Unterstützung Professionelle Beratung Austausch und Kontakt Erfahrungen & Rat mit anderen Angehörigen austauschen
Business Model Canvas
 Business Model Canvas Business Model Canvas ist ein strategisches Management Tool, mit dem sich neue und bestehende Geschäftsmodelle visualisieren lassen. Demnach setzt sich ein Geschäftsmodell aus neun
Business Model Canvas Business Model Canvas ist ein strategisches Management Tool, mit dem sich neue und bestehende Geschäftsmodelle visualisieren lassen. Demnach setzt sich ein Geschäftsmodell aus neun
Grundlagen des Datenschutzes
 und der IT-Sicherheit Musterlösung zur 7. Übung im SoSe 2009: Vergleich Fehlerbaum und Angriffsbaum 7.1 Fehlerbaum Erstellen Sie eine Fehlerbaum (Fault Tree Analysis) zu dem Fehlerereignis "mangelnde Verfügbarkeit
und der IT-Sicherheit Musterlösung zur 7. Übung im SoSe 2009: Vergleich Fehlerbaum und Angriffsbaum 7.1 Fehlerbaum Erstellen Sie eine Fehlerbaum (Fault Tree Analysis) zu dem Fehlerereignis "mangelnde Verfügbarkeit
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
 Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Anleitung zum DKM-Computercheck Windows Defender aktivieren
 Anleitung zum DKM-Computercheck Windows Defender aktivieren Ziel der Anleitung Sie möchten das Antivirenprogramm Windows Defender auf Ihrem Computer aktivieren, um gegen zukünftige Angriffe besser gewappnet
Anleitung zum DKM-Computercheck Windows Defender aktivieren Ziel der Anleitung Sie möchten das Antivirenprogramm Windows Defender auf Ihrem Computer aktivieren, um gegen zukünftige Angriffe besser gewappnet
Der Kontowecker: Einrichtung
 1. Für die Einrichtung eines Kontoweckers melden Sie sich mit Ihrem Anmeldenamen und Ihrer PIN im Online-Banking an. 2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Service und dann auf Kontowecker 3. Anschließend
1. Für die Einrichtung eines Kontoweckers melden Sie sich mit Ihrem Anmeldenamen und Ihrer PIN im Online-Banking an. 2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Service und dann auf Kontowecker 3. Anschließend
«Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen
 18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
NetVoip Installationsanleitung für Fritzbox Fon5050
 NetVoip Installationsanleitung für Fritzbox Fon5050 Einrichten eines Fritzbox Fon5050 für NETVOIP 1 Erste Inbetriebnahme...3 1.1 Einrichten, Einstecken der Kabel...3 1.2 IP-Adresse des Fritzbox Fon5050...3
NetVoip Installationsanleitung für Fritzbox Fon5050 Einrichten eines Fritzbox Fon5050 für NETVOIP 1 Erste Inbetriebnahme...3 1.1 Einrichten, Einstecken der Kabel...3 1.2 IP-Adresse des Fritzbox Fon5050...3
PDAP7 FMEA Erste Schritte Stand März 2010
 PDAP7 FMEA Erste Schritte Stand März 2010 Dieses Modul bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit Ihre Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalysen zu visualisieren, dokumentieren und deren Termine zu überwachen.
PDAP7 FMEA Erste Schritte Stand März 2010 Dieses Modul bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit Ihre Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalysen zu visualisieren, dokumentieren und deren Termine zu überwachen.
UserManual. Handbuch zur Konfiguration einer FRITZ!Box. Autor: Version: Hansruedi Steiner 2.0, November 2014
 UserManual Handbuch zur Konfiguration einer FRITZ!Box Autor: Version: Hansruedi Steiner 2.0, November 2014 (CHF 2.50/Min) Administration Phone Fax Webseite +41 56 470 46 26 +41 56 470 46 27 www.winet.ch
UserManual Handbuch zur Konfiguration einer FRITZ!Box Autor: Version: Hansruedi Steiner 2.0, November 2014 (CHF 2.50/Min) Administration Phone Fax Webseite +41 56 470 46 26 +41 56 470 46 27 www.winet.ch
BlackBerry Internet Service Einrichtung. auf www.mobilemail.vodafone.at
 BlackBerry Internet Service Einrichtung auf www.mobilemail.vodafone.at INHALT www.mobileemail.vodafone.at S. 2 Der Online Einrichtungsprozess S. 2 Schritt 1: www.mobileemail.vodafone.at S. 3 Schritt 2:
BlackBerry Internet Service Einrichtung auf www.mobilemail.vodafone.at INHALT www.mobileemail.vodafone.at S. 2 Der Online Einrichtungsprozess S. 2 Schritt 1: www.mobileemail.vodafone.at S. 3 Schritt 2:
Fragebogen Weisse Liste-Ärzte
 www.weisse-liste.de Fragebogen Weisse Liste-Ärzte Der Fragebogen ist Teil des Projekts Weisse Liste-Ärzte. DIMENSION: Praxis & Personal trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher trifft überhaupt
www.weisse-liste.de Fragebogen Weisse Liste-Ärzte Der Fragebogen ist Teil des Projekts Weisse Liste-Ärzte. DIMENSION: Praxis & Personal trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher trifft überhaupt
Psychologie im Arbeitsschutz
 Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Aufgabenheft. Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Modul 32701 - Business/IT-Alignment. 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr. Univ.-Prof. Dr. U.
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Aufgabenheft : Termin: Prüfer: Modul 32701 - Business/IT-Alignment 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl Aufbau und Bewertung der Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Aufgabenheft : Termin: Prüfer: Modul 32701 - Business/IT-Alignment 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl Aufbau und Bewertung der Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache
 Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache Das Persönliche Budget mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstbewusstsein! Dieser Text soll den behinderten Menschen in Westfalen-Lippe,
Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache Das Persönliche Budget mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstbewusstsein! Dieser Text soll den behinderten Menschen in Westfalen-Lippe,
WARENWIRT- SCHAFT UND ERP BERATUNG Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung
 WARENWIRT- SCHAFT UND ERP BERATUNG Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung IT-SERVICE Warenwirtschaft (WaWi) und Enterprise Resource Planning (ERP) WaWi und ERP Beratung Kunden erfolgreich beraten und während
WARENWIRT- SCHAFT UND ERP BERATUNG Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung IT-SERVICE Warenwirtschaft (WaWi) und Enterprise Resource Planning (ERP) WaWi und ERP Beratung Kunden erfolgreich beraten und während
Wie Sie beliebig viele PINs, die nur aus Ziffern bestehen dürfen, mit einem beliebigen Kennwort verschlüsseln: Schritt 1
 Wie Sie beliebig viele PINs, die nur aus Ziffern bestehen dürfen, mit einem beliebigen Kennwort verschlüsseln: Schritt 1 Zunächst einmal: Keine Angst, die Beschreibung des Verfahrens sieht komplizierter
Wie Sie beliebig viele PINs, die nur aus Ziffern bestehen dürfen, mit einem beliebigen Kennwort verschlüsseln: Schritt 1 Zunächst einmal: Keine Angst, die Beschreibung des Verfahrens sieht komplizierter
10.3.1.5 Übung - Datensicherung und Wiederherstellung in Windows Vista
 5.0 10.3.1.5 Übung - Datensicherung und Wiederherstellung in Windows Vista Einführung Drucken Sie diese Übung aus und führen Sie sie durch. In dieser Übung werden Sie die Daten sichern. Sie werden auch
5.0 10.3.1.5 Übung - Datensicherung und Wiederherstellung in Windows Vista Einführung Drucken Sie diese Übung aus und führen Sie sie durch. In dieser Übung werden Sie die Daten sichern. Sie werden auch
Name:.. Straße:.. PLZ:. Ort:.. Telefon:.. Email:..
 Crewvertrag I. Schiffsführung Die als Skipper bezeichnete Person ist der Schiffsführer. Skipper PLZ:. Ort:.. Der Skipper führt für alle Teilnehmer eine Sicherheitsbelehrung durch, weist sie in die Besonderheiten
Crewvertrag I. Schiffsführung Die als Skipper bezeichnete Person ist der Schiffsführer. Skipper PLZ:. Ort:.. Der Skipper führt für alle Teilnehmer eine Sicherheitsbelehrung durch, weist sie in die Besonderheiten
Entwicklung des Dentalmarktes in 2010 und Papier versus Plastik.
 Sehr geehrter Teilnehmer, hier lesen Sie die Ergebnisse aus unserer Umfrage: Entwicklung des Dentalmarktes in 2010 und Papier versus Plastik. Für die zahlreiche Teilnahme an dieser Umfrage bedanken wir
Sehr geehrter Teilnehmer, hier lesen Sie die Ergebnisse aus unserer Umfrage: Entwicklung des Dentalmarktes in 2010 und Papier versus Plastik. Für die zahlreiche Teilnahme an dieser Umfrage bedanken wir
Beschreibung des MAP-Tools
 1. Funktionen des MAP-Tool 2. Aufbau des MAP-Tools 3. Arbeiten mit dem MAP-Tool Beschreibung MAP-Tool.doc Erstellt von Thomas Paral 1 Funktionen des MAP-Tool Die Hauptfunktion des MAP-Tools besteht darin,
1. Funktionen des MAP-Tool 2. Aufbau des MAP-Tools 3. Arbeiten mit dem MAP-Tool Beschreibung MAP-Tool.doc Erstellt von Thomas Paral 1 Funktionen des MAP-Tool Die Hauptfunktion des MAP-Tools besteht darin,
Modes And Effect Analysis)
 Gefahrenanalyse mittels FMEA (Failure Modes And Effect Analysis) Vortragender: Holger Sinnerbrink Betreuer: Holger Giese Gefahrenanalyse mittels FMEA Holger Sinnerbrink Seite: 1 Gliederung Motivation Einordnung
Gefahrenanalyse mittels FMEA (Failure Modes And Effect Analysis) Vortragender: Holger Sinnerbrink Betreuer: Holger Giese Gefahrenanalyse mittels FMEA Holger Sinnerbrink Seite: 1 Gliederung Motivation Einordnung
POP Email-Konto auf iphone mit ios 6 einrichten
 POP Email-Konto auf iphone mit ios 6 einrichten Dokumenten-Name POP Email Konto Einrichten auf iphone.doc Version/Datum: Version 1.0, 01.02.2013 Klassifizierung Ersteller Für green.ch AG Kunden Stephan
POP Email-Konto auf iphone mit ios 6 einrichten Dokumenten-Name POP Email Konto Einrichten auf iphone.doc Version/Datum: Version 1.0, 01.02.2013 Klassifizierung Ersteller Für green.ch AG Kunden Stephan
Instruktionsheft für neue Webshop Hamifleurs
 Instruktionsheft für neue Webshop Hamifleurs Instruktionen für neue Webshop Hamifleurs Gehen Sie zu www.hamifleurs.nl. Klicken Sie auf Login Kunden und es erscheint der Bildschirm auf der nächsten Seite.
Instruktionsheft für neue Webshop Hamifleurs Instruktionen für neue Webshop Hamifleurs Gehen Sie zu www.hamifleurs.nl. Klicken Sie auf Login Kunden und es erscheint der Bildschirm auf der nächsten Seite.
Bedienungsanleitung. Matthias Haasler. Version 0.4. für die Arbeit mit der Gemeinde-Homepage der Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof
 Bedienungsanleitung für die Arbeit mit der Gemeinde-Homepage der Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof Matthias Haasler Version 0.4 Webadministrator, email: webadmin@rundkirche.de Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
Bedienungsanleitung für die Arbeit mit der Gemeinde-Homepage der Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof Matthias Haasler Version 0.4 Webadministrator, email: webadmin@rundkirche.de Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
Fragenkatalog zur Bewertung Ihres ERP Geschäftsvorhabens:
 Fragenkatalog zur Bewertung Ihres ERP Geschäftsvorhabens: Der Aufbau eines neuen Geschäftsstandbeins im ERP Markt ist ein langwieriger Prozess welcher von einigen wenigen kritischen Erfolgsfaktoren abhängt.
Fragenkatalog zur Bewertung Ihres ERP Geschäftsvorhabens: Der Aufbau eines neuen Geschäftsstandbeins im ERP Markt ist ein langwieriger Prozess welcher von einigen wenigen kritischen Erfolgsfaktoren abhängt.
GI-Technologien zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): Wissensbasen. Teil 1: Einführung: Wissensbasis und Ontologie.
 GI-Technologien zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): Wissensbasen Teil 1: Einführung: Wissensbasis und Ontologie Was ist eine Wissensbasis? Unterschied zur Datenbank: Datenbank: strukturiert
GI-Technologien zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): Wissensbasen Teil 1: Einführung: Wissensbasis und Ontologie Was ist eine Wissensbasis? Unterschied zur Datenbank: Datenbank: strukturiert
FlowFact Alle Versionen
 Training FlowFact Alle Versionen Stand: 29.09.2005 Rechnung schreiben Einführung Wie Sie inzwischen wissen, können die unterschiedlichsten Daten über verknüpfte Fenster miteinander verbunden werden. Für
Training FlowFact Alle Versionen Stand: 29.09.2005 Rechnung schreiben Einführung Wie Sie inzwischen wissen, können die unterschiedlichsten Daten über verknüpfte Fenster miteinander verbunden werden. Für
Der Prozess Risikomanagement. Seine Integration in das Managementsystem
 SAQ-Jahrestagung 17.6.2003 Dr. J. Liechti, Neosys AG Workshop RiskManagement-Prozess Seite 1 Der Prozess Risikomanagement Seine Integration in das Managementsystem Unterlagen zum Workshop 3 SAQ-Jahrestagung
SAQ-Jahrestagung 17.6.2003 Dr. J. Liechti, Neosys AG Workshop RiskManagement-Prozess Seite 1 Der Prozess Risikomanagement Seine Integration in das Managementsystem Unterlagen zum Workshop 3 SAQ-Jahrestagung
Vernetztes Denken und Handeln. 2.1 Aufbauorganisation. 2.2 Ablauforganisation und Prozesse. 2.3 Optimierung von Arbeitsabläufen.
 2. Vernetztes Denken und Handeln 2 2.1 Aufbauorganisation 2.2 Ablauforganisation und Prozesse 2.3 Optimierung von Arbeitsabläufen 2. Vernetztes Denken und Handeln 3 Ich stelle meine Tätigkeit in den Zusammenhang
2. Vernetztes Denken und Handeln 2 2.1 Aufbauorganisation 2.2 Ablauforganisation und Prozesse 2.3 Optimierung von Arbeitsabläufen 2. Vernetztes Denken und Handeln 3 Ich stelle meine Tätigkeit in den Zusammenhang
Konzentration auf das. Wesentliche.
 Konzentration auf das Wesentliche. Machen Sie Ihre Kanzleiarbeit effizienter. 2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, die Grundlagen Ihres Erfolges als Rechtsanwalt sind Ihre Expertise und Ihre Mandantenorientierung.
Konzentration auf das Wesentliche. Machen Sie Ihre Kanzleiarbeit effizienter. 2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, die Grundlagen Ihres Erfolges als Rechtsanwalt sind Ihre Expertise und Ihre Mandantenorientierung.
GeODin 7 Installationsanleitung
 Um Ihnen den Einstieg in GeODin 7 schneller und leichter zu machen, hier ein paar Hinweise... Bevor Sie anfangen... Schritt 1: Lizenzvereinbarung Für die Installation einer GeODin-Lizenz benötigen Sie
Um Ihnen den Einstieg in GeODin 7 schneller und leichter zu machen, hier ein paar Hinweise... Bevor Sie anfangen... Schritt 1: Lizenzvereinbarung Für die Installation einer GeODin-Lizenz benötigen Sie
Alles auf www.mobilemail.vodafone.at. BlackBerry Internet Service Einrichtung
 Alles auf www.mobilemail.vodafone.at BlackBerry Internet Service Einrichtung Inhalt www.mobileemail.vodafone.at 3 Der Online Einrichtungsprozess 3 Schritt 1: www.mobileemail.vodafone.at 4 Schritt 2: Benutzer
Alles auf www.mobilemail.vodafone.at BlackBerry Internet Service Einrichtung Inhalt www.mobileemail.vodafone.at 3 Der Online Einrichtungsprozess 3 Schritt 1: www.mobileemail.vodafone.at 4 Schritt 2: Benutzer
Informationssicherheitsmanagement
 Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27001 und BSI Grundschutz Karner & Schröppel Partnerschaft Sachverständige für Informationssicherheit und Datenschutz Unser Konzept Informationssicherheit und
Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27001 und BSI Grundschutz Karner & Schröppel Partnerschaft Sachverständige für Informationssicherheit und Datenschutz Unser Konzept Informationssicherheit und
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1
 Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
Agenda: Richard Laqua ISMS Auditor & IT-System-Manager
 ISMS Auditor & IT-System-Manager IT-Sicherheit Inhaltsverzeichnis 1 Ziel der Schulung Werte des Unternehmens Datenschutz und IT-Sicherheit 2 Gesetze und Regelungen Mindestanforderungen der IT-Sicherheit
ISMS Auditor & IT-System-Manager IT-Sicherheit Inhaltsverzeichnis 1 Ziel der Schulung Werte des Unternehmens Datenschutz und IT-Sicherheit 2 Gesetze und Regelungen Mindestanforderungen der IT-Sicherheit
Abituraufgabe zur Stochastik, Hessen 2009, Grundkurs (TR)
 Abituraufgabe zur Stochastik, Hessen 2009, Grundkurs (TR) Eine Firma stellt USB-Sticks her. Sie werden in der Fabrik ungeprüft in Packungen zu je 20 Stück verpackt und an Händler ausgeliefert. 1 Ein Händler
Abituraufgabe zur Stochastik, Hessen 2009, Grundkurs (TR) Eine Firma stellt USB-Sticks her. Sie werden in der Fabrik ungeprüft in Packungen zu je 20 Stück verpackt und an Händler ausgeliefert. 1 Ein Händler
PIERAU PLANUNG GESELLSCHAFT FÜR UNTERNEHMENSBERATUNG
 Übersicht Wer ist? Was macht anders? Wir denken langfristig. Wir individualisieren. Wir sind unabhängig. Wir realisieren. Wir bieten Erfahrung. Für wen arbeitet? Pierau Planung ist eine Gesellschaft für
Übersicht Wer ist? Was macht anders? Wir denken langfristig. Wir individualisieren. Wir sind unabhängig. Wir realisieren. Wir bieten Erfahrung. Für wen arbeitet? Pierau Planung ist eine Gesellschaft für
1. Man schreibe die folgenden Aussagen jeweils in einen normalen Satz um. Zum Beispiel kann man die Aussage:
 Zählen und Zahlbereiche Übungsblatt 1 1. Man schreibe die folgenden Aussagen jeweils in einen normalen Satz um. Zum Beispiel kann man die Aussage: Für alle m, n N gilt m + n = n + m. in den Satz umschreiben:
Zählen und Zahlbereiche Übungsblatt 1 1. Man schreibe die folgenden Aussagen jeweils in einen normalen Satz um. Zum Beispiel kann man die Aussage: Für alle m, n N gilt m + n = n + m. in den Satz umschreiben:
ERP-Evaluation systematisch und sicher zum optimalen ERP-System
 ERP-Evaluation systematisch und sicher zum optimalen ERP-System Risiken minimieren, Chancen nutzen durch ein strukturiertes Vorgehen basierend auf Anforderungen (Requirements Engineering) und Prozessoptimierung
ERP-Evaluation systematisch und sicher zum optimalen ERP-System Risiken minimieren, Chancen nutzen durch ein strukturiertes Vorgehen basierend auf Anforderungen (Requirements Engineering) und Prozessoptimierung
Anleitung OpenCms 8 Webformular Auswertung
 Anleitung OpenCms 8 Webformular Auswertung 1 Erzbistum Köln Webformular Auswertung 15. August 2014 Inhalt 1. Allgemeines zum Webformular Auswertung... 3 2. Verwendung des Webformulars... 4 2.1. Reiter
Anleitung OpenCms 8 Webformular Auswertung 1 Erzbistum Köln Webformular Auswertung 15. August 2014 Inhalt 1. Allgemeines zum Webformular Auswertung... 3 2. Verwendung des Webformulars... 4 2.1. Reiter
Das Erdbeben-Risiko. Markus Weidmann, Büro für Erdwissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, Chur
 Das Erdbeben-Risiko Nicolas Deichmann, Donat Fäh, Domenico Giardini Schweizerischer Erdbebendienst, ETH-Zürich Markus Weidmann, Büro für Erdwissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, Chur 1 Faktenblatt zum
Das Erdbeben-Risiko Nicolas Deichmann, Donat Fäh, Domenico Giardini Schweizerischer Erdbebendienst, ETH-Zürich Markus Weidmann, Büro für Erdwissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, Chur 1 Faktenblatt zum
Agentur für Werbung & Internet. Schritt für Schritt: E-Mail-Konfiguration mit Apple Mail
 Agentur für Werbung & Internet Schritt für Schritt: E-Mail-Konfiguration mit Apple Mail E-Mail-Konfiguration mit Apple Mail Inhalt E-Mail-Konto erstellen 3 Auswahl des Servertyp: POP oder IMAP 4 Konfiguration
Agentur für Werbung & Internet Schritt für Schritt: E-Mail-Konfiguration mit Apple Mail E-Mail-Konfiguration mit Apple Mail Inhalt E-Mail-Konto erstellen 3 Auswahl des Servertyp: POP oder IMAP 4 Konfiguration
Familienunternehmer-Umfrage: Note 4 für Energiepolitik der Bundesregierung 47 Prozent der Unternehmer sehen Energiewende als Chance
 Familienunternehmer-Umfrage: Note 4 für Energiepolitik der Bundesregierung 47 Prozent der Unternehmer sehen Energiewende als Chance Berlin, 24. August 2015. Laut einer Studie des Instituts der deutschen
Familienunternehmer-Umfrage: Note 4 für Energiepolitik der Bundesregierung 47 Prozent der Unternehmer sehen Energiewende als Chance Berlin, 24. August 2015. Laut einer Studie des Instituts der deutschen
Delta Audit - Fragenkatalog ISO 9001:2014 DIS
 QUMedia GbR Eisenbahnstraße 41 79098 Freiburg Tel. 07 61 / 29286-50 Fax 07 61 / 29286-77 E-mail info@qumedia.de www.qumedia.de Delta Audit - Fragenkatalog ISO 9001:2014 DIS Zur Handhabung des Audit - Fragenkatalogs
QUMedia GbR Eisenbahnstraße 41 79098 Freiburg Tel. 07 61 / 29286-50 Fax 07 61 / 29286-77 E-mail info@qumedia.de www.qumedia.de Delta Audit - Fragenkatalog ISO 9001:2014 DIS Zur Handhabung des Audit - Fragenkatalogs
Risikomanagement bei PPP Projekten: Erfahrungen aus Deutschland
 Verein PPP Schweiz Risikomanagement bei PPP Projekten: Erfahrungen aus Deutschland Veranstaltung des Verein PPP Schweiz am14.05.2014 in Bern Vortrag von Peter Walter Landrat a.d., Vorsitzender Verein PPP
Verein PPP Schweiz Risikomanagement bei PPP Projekten: Erfahrungen aus Deutschland Veranstaltung des Verein PPP Schweiz am14.05.2014 in Bern Vortrag von Peter Walter Landrat a.d., Vorsitzender Verein PPP
Mitarbeiterbefragung. 5 zentrale Gründe für Trigon
 Mitarbeiterbefragung 5 zentrale Gründe für Trigon 5 zentrale Gründe für Trigon Der größere Zusammenhang: Unsere Kernkompetenz liegt in der Organisations- und Personalentwicklung. Wir stellen die Querverbindungen
Mitarbeiterbefragung 5 zentrale Gründe für Trigon 5 zentrale Gründe für Trigon Der größere Zusammenhang: Unsere Kernkompetenz liegt in der Organisations- und Personalentwicklung. Wir stellen die Querverbindungen
Updatehinweise für die Version forma 5.5.5
 Updatehinweise für die Version forma 5.5.5 Seit der Version forma 5.5.0 aus 2012 gibt es nur noch eine Office-Version und keine StandAlone-Version mehr. Wenn Sie noch mit der alten Version forma 5.0.x
Updatehinweise für die Version forma 5.5.5 Seit der Version forma 5.5.0 aus 2012 gibt es nur noch eine Office-Version und keine StandAlone-Version mehr. Wenn Sie noch mit der alten Version forma 5.0.x
Rhetorik und Argumentationstheorie. [frederik.gierlinger@univie.ac.at]
![Rhetorik und Argumentationstheorie. [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Rhetorik und Argumentationstheorie. [frederik.gierlinger@univie.ac.at]](/thumbs/38/18012562.jpg) Rhetorik und Argumentationstheorie 1 [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Ablauf der Veranstaltung Termine 1-6 Erarbeitung diverser Grundbegriffe Termine 7-12 Besprechung von philosophischen Aufsätzen Termin
Rhetorik und Argumentationstheorie 1 [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Ablauf der Veranstaltung Termine 1-6 Erarbeitung diverser Grundbegriffe Termine 7-12 Besprechung von philosophischen Aufsätzen Termin
Herzlich willkommen. zur Information Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz / für Kirchgemeinden
 Herzlich willkommen zur Information Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz / für Kirchgemeinden Treier & Partner AG, Unterer Kirchweg 34, 5064 Wittnau Aug. 2012 V1 1 Inhaber Franz Treier Sicherheitsfachmann
Herzlich willkommen zur Information Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz / für Kirchgemeinden Treier & Partner AG, Unterer Kirchweg 34, 5064 Wittnau Aug. 2012 V1 1 Inhaber Franz Treier Sicherheitsfachmann
Änderung der ISO/IEC 17025 Anpassung an ISO 9001: 2000
 Änderung der ISO/IEC 17025 Anpassung an ISO 9001: 2000 Dr. Martin Czaske Sitzung der DKD-FA HF & Optik, GS & NF am 11. bzw. 13. Mai 2004 Änderung der ISO/IEC 17025 Anpassung der ISO/IEC 17025 an ISO 9001:
Änderung der ISO/IEC 17025 Anpassung an ISO 9001: 2000 Dr. Martin Czaske Sitzung der DKD-FA HF & Optik, GS & NF am 11. bzw. 13. Mai 2004 Änderung der ISO/IEC 17025 Anpassung der ISO/IEC 17025 an ISO 9001:
Microsoft Office 365 Outlook 2010 Arbeitsplatz einrichten
 Microsoft Office 365 Outlook 2010 Arbeitsplatz einrichten Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Arbeitsplatzes mit Microsoft Outlook 2010 Mit Outlook können Sie schnell, sicher und komfortabel
Microsoft Office 365 Outlook 2010 Arbeitsplatz einrichten Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Arbeitsplatzes mit Microsoft Outlook 2010 Mit Outlook können Sie schnell, sicher und komfortabel
Was taugt der Wertpapierprospekt für die Anlegerinformation?
 Was taugt der Wertpapierprospekt für die Anlegerinformation? Panel 1 Rahmenbedingungen für Anlegerinformation und Anlegerschutz beim Wertpapiererwerb Verhältnis zu Beratung, Informationsblatt und Investorenpräsentation
Was taugt der Wertpapierprospekt für die Anlegerinformation? Panel 1 Rahmenbedingungen für Anlegerinformation und Anlegerschutz beim Wertpapiererwerb Verhältnis zu Beratung, Informationsblatt und Investorenpräsentation
IT-SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung
 IT-SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung IT-SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN Mehr Sicherheit für ihre Entscheidung Entdecken Sie was IT Sicherheit im Unternehmen bedeutet IT Sicherheit
IT-SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung IT-SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN Mehr Sicherheit für ihre Entscheidung Entdecken Sie was IT Sicherheit im Unternehmen bedeutet IT Sicherheit
