Phasengleichgewicht und Phasenübergänge. Gasförmig
|
|
|
- Käthe Weiner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Phasengleichgewicht und Phasenübergänge Siedetemperatur Flüssig Gasförmig Sublimationstemperatur Schmelztemperatur Fest Aus unserer Erfahrung mit Wasser wissen wir, dass Substanzen ihre Eigenschaften bei bestimmten Temperaturen ändern.
2 Bei der Zuführung von Wärme nimmt die Temperatur bis T m zu. Wenn weiter Energie zugeführt wird, bleibt die Temperatur konstant. Die zusätzliche Energie wird dazu eingesetzt, die Kristallstruktur aufzubrechen. Wir erhitzen weiter, bis der Siedepunkt erreicht T ist. Auch hier wird zusätzliche Wärme zuerst genutzt, um die T b Bindungen zwischen Molekülen aufzubrechen, so dass die Temperatur T m anfangs konstant bleibt. Gas Flüssig Fest Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Phasen
3 Eis, Wasser und Dampf sind Phasen des Wassers. Der Übergang zwischen zwei Phasen ist der Phasenübergang. Die Wärme, die benötigt wird, um den Phasenübergang herbeizuführen, ist in diesem Diagramm definiert als T T b und ΔQ m ' Q 2 & Q 1 T m Fest Flüssig Gas ΔQ b ' Q 4 & Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Es sollte klar sei, dass diese Wärme freigesetzt wird, wenn wir den Prozess umkehren (d.h. die Substanz abkühlen). Die notwendige Energie hat Einheiten von [J kg -1 ] oder [J mol -1 ].
4 Phasenübergänge CO 2 Eis ----->>> Gas Eis >>> Wasser Wasser >>> Wasserdampf Heptadekan Flussigkeit ---->>> Fest
5 Entropieänderungen S C p ' T( MS MT ) p ΔS ' ΔQ rev ' λ T T Phasenänderungen entsprechen einer plötzlichen Veränderung der Ordnung. Dies ist daher eine steile Änderung der Entropie. C p ' ( MH MT ) p C p ' ( δq MT ) p dh ' (δq) p C p ' T( MS MT ) p C p ' T( MS MT ) p T ds ' δq T ΔS ' ΔQ rev T ' λ T λ = Schmelz- oder Verdampfungswärme
6 Wasser Phasenübergang T = 273,15 K Eis Die Fusionsenthalpie ( H fus ) = J mol -1. Die Entropieänderung beim Gefrieren ist die Wärme, die entzogen werden muss, um die Veränderung bei der spezifizierten Temperatur möglich zu machen... ΔS ' δq rev T ' & '&21.99 J mol -1 K -1 ΔG ' ΔH & TΔS '&6007 & (&21.99) ' 0 Equil. Wenn wir jedoch die Temperatur reduzieren, wird G negativ und wir haben einen spontanen Prozess.
7 Herr Lauterburg s Favorite Expt.
8 Zwei Phasen während des Übergangs koexistieren können. Zum Beispiel kommen bei 0EC Eis und Wasser nebeneinander vor. Und natürlich müssen Sie es nicht immer mit derselben chemischen Substanz zu tun haben... Aber wie behandeln wir das? T T b T m Gas Flüssig Fest Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
9 Die Phasenregel Um ein inhomogenes System zu beschreiben, verwenden wir eine Matrixdarstellung. Wir haben n verschiedene Substanzen in f verschiedenen Phasen. Mit m ik bezeichnen wir die Masse der kten Substanz in der iten Phase. k = 1,2,3,4...n i = 1,2,3,4... f N v ' n % 2 & f
10 Das Gleichgewicht für das System wird kontrolliert vom... Minimum der Gibbs`schen freien Energie
11 Wenn wir die Anzahl Gleichungen mit der Anzahl an Unbekannten vergleichen, oft sehen wir, dass wir mehr Unbekannte als Gleichungen haben. Unser System ist (normalerweise) unterbestimmt. Wir können eine bestimmte Anzahl Variablen festlegen und das System auflösen. Wie viel? N v ' n % 2 & f
12 Beispiel 1 N v ' n % 2 & f Flüssigkeit - Eine Substanz (z.b. H 2 O) Eine Phase (f=1) Eine Substanz (n=1) N v = 2
13 Beispiel 2 N ' n % 2 & f v Gasförmig - Zwei Substanzen (z.b. O 2 und N 2 ) Eine Phase (f=1) Zwei Substanzen (n=2) N v = 3 Hier müssen wir (z.b.) den Druck, die Temperatur und das Mischverhältnis festlegen.
14 Beispiel 3 N ' n % 2 & f v Hier brauchen wir nur eine Variable (Temperatur) festzulegen, um das System komplett zu beschreiben. Wasser/Wasserdampf-Mischung Zwei Phasen (f=2) Eine Substanz (n=1) N v = 1 Der Grund ist, dass das System bei einer gewählten Temperatur nur bei einem bestimmten Druck das Phasengleichgewicht erfüllt.
15 Beispiel 4 N ' n % 2 & f v Hier haben wir keine Freiheit! Eis/Wasser/Wasserdampf-Mischung Drei Phasen (f=3) Eine Substanz (n=1) N v = 0 Das heisst, dass das System nur bei einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur existieren kann (im Gleichgewicht natürlich!!!) Dieser Punkt ist als Tripelpunkt bekannt.
16 Zustandsdiagramme p dp/dt = gross D flüssig B fest C TP dp/dt = klein gasförmig Vgl. Beispiel 4. Es gibt drei Phasen. T
17 Zustandsdiagramme p dp/dt = gross D C fest TP flüssig B gasförmig Vgl. Beispiel 3. T hat einen bestimmten Wert, es gibt zwei Phasen (Gas und Flüssigkeit), daher ist der Druck bekannt. dp/dt = klein T
18 Zustandsdiagramme p dp/dt = gross D flüssig B fest C TP gasförmig dp/dt = klein T
19 HeptadekanbitZustandsdiagramme p fest D flüssig B edp/dt = gross C TP gasförmig dp/dt = klein T
20 Zustandsdiagramme p dp/dt = gross D flüssig B fest C TP dp/dt = klein?? gasförmig Let s cook ice... T
21 Phasendiagramme
22 Phasendiagramm für H 2 O
23 Schmelzen von Wassereis Die meisten Substanzen nehmen an Volumen zu, wenn sie schmelzen. Es ist allgemein bekannt, dass Wasser eine Ausnahme bildet. Das Volumen nimmt ab, wenn normales Eis schmilzt und erreicht sein Minimum bei etwa 4EC. Es gibt jedoch sechs andere Arten von Wassereis, die bei hohem Druck hergestellt werden können (sie werden mit den römischen Ziffern I-VII bezeichnet). Eis VII?
24 Clausius-Clapeyron Gleichung Die Clausius-Clapeyron-Gleichung wird benutzt, um die Gleichgewichtskurve zwischen zwei Phasen (z.b. fest und gasförmig) zu definieren, wenn die Temperatur sich ändert. Wenn bei einer bestimmten Temperatur ein Gleichgewicht existiert, wird der Gasdruck häufig als Sättigungsdampfdruck bezeichnet.
25 Die Clausius-Clapeyron-Gleichung wird oft in diesem Zusammenhang benutzt. Die dient auch dazu, Labormessungen auf tiefe Temperaturen zu extrapolieren, wenn keine Daten vorliegen. Lassen Sie uns annehmen, dass wir ein Mol eines Materials haben, wobei der Molanteil X in Phase 1 und der Molanteil 1-X in Phase 2 ist. Die Gibbs`sche freie Energie kann geschrieben werden als G ' XG 1 % (1 & X)G 2 1 -X X Phase 1
26 Die Änderung in der Gibbs`schen freien Energie (im stabilen Gleichgewicht) null sein muss, wenn wir die relative Zusammensetzung nur ein klein wenig verändern. Also können wir schreiben MG ' MXG 1 & MXG 2 ' 0 G 1 (T,p) ' G 2 (T,p) Jetzt führen wir die Definition der Gibbs`schen freien Energie G ' F % pv ' U & TS % pv U 2 & U 1 & T(S 2 & S 1 ) % p(v 2 & V 1 ) ' 0 Temperatur und Druck der beiden Komponenten sind gleich.
27 U 2 & U 1 & T(S 2 & S 1 ) % p(v 2 & V 1 ) ' 0 Jetzt diffenzieren wir im Hinblick auf die Temperatur. d dt (U 2 & U 1 ) & T d dt (S 2 & S 1 ) & (S 2 & S 1 )% (V 2 & V 1 ) dp dt % p d dt (V 2 & V 1 ) ' 0 Beachte hier das Herauskürzen von dt/dt. TdS ' δq du ' δq & pdv Ergebnis: T ds dt ' du dt % p dv dt &(S 2 & S 1 ) % (V 2 & V 1 ) dp dt ' 0
28 &(S 2 & S 1 ) % (V 2 & V 1 ) dp dt ' 0 Umstellen dp dt ' (S & S ) 2 1 (V 2 & V 1 ) ' ΔS ΔV Wir erinnern uns hier, dass die Entropie mit der zugeführten Wärme in Verbindung steht über ΔS ' ΔQ rev T dp dt ' ' λ T λ(t) T(V 2 & V 1 ) Wir können reversibel Wärme zuführen (um Bindungen aufzubrechen) oder Wärme abziehen, wenn die Bindungsenergie Wärme freisetzt. Das ist die Wärme beim Schmelzen oder Sublimieren (abhängig vom Phasenübergang). Das ist die Clausius-Clapeyron-Gleichung.
29
30 dp dt ' λ(t) T(V 2 & V 1 ) Wir wissen vom Wasser, dass die Veränderung im Volumen klein ist, wenn man von Wassereis zu flüssigem Wasser geht. Wenn diese Veränderung stattfindet, muss dp/dt gross sein. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Veränderung im Volumen gross ist, wenn Wassereis direkt in Gas sublimiert. Wenn diese Veränderung stattfindet, muss dp/dt klein sein.
31 dp dt ' λ(t) T(V 2 & V 1 ) Phasendiagramme Fest - Fluessig dv klein, dp/dt gross Fluessig - Gas dv grosser, dp/dt kleiner.
32 dp dt ' λ(t) T(V 2 & V 1 ) Es gibt keine generelle mathematische Beschreibung, wie sich λ für unterschiedliche Substanzen verhält. Lassen Sie uns annehmen, dass 1. das Volumen beim Übergang von Flüssigkeit zu Gas enorm zunimmt 2. das ideale Gasgesetz gilt 3. λ = konstant ist dp s dt ' λ V D = Volumen des Gases TV p s = Sättigungsdruck D
33 dp dt ' λ(t) T(V 2 & V 1 ) Es gibt keine generelle mathematische Beschreibung, wie sich λ für unterschiedliche Substanzen verhält. Lassen Sie uns annehmen, dass 1. das Volumen beim Übergang von Flüssigkeit zu Gas enorm zunimmt 2. das ideale Gasgesetz gilt 3. λ = konstant ist dp s dt ' λ V D = Volumen des Gases p s = Sättigungsdruck dp s dt ' TV D λ ' p λ s TV D RT 2 V D = RT/p s
34 dp s dt ' λ ' p λ s TV D RT 2 dp s p s Umstellen ' λ dt RT 2 Integrieren p s ' p 0 e & λ RT Dies zeigt, dass der Sättigungsdampfdruck exponentiell mit der Temperatur zunimmt. Das gilt für alle Gase.
35 Gleichgewichtsdampfdrucke Es ist zwar nicht perfekt exponentiell (eine gerade Linie), aber ziemlich nahe dran! (Yelle et al., 1995)
36 dp s p s ' λ dt RT 2 λ ' RT 2 d dt (ln p s ) Wir können die Gleichung umstellen, um die experimentelle Bestimmung der Schmelzwärme zu ermöglichen, wenn wir den Dampfdruck bei verschiedenen Temperaturen messen.
37 Zusammenfassung!Substanzen haben unterschiedliche Phasen, die nebeneinander unter Gleichgewichtsbedingungen existieren können.!indem man eine Reihe von Variablen definiert, kann man Lösungen für die thermodynamischen Gleichungen finden. < Die Anzahl der zu definierenden Variablen hängt von der Anzahl der Substanzen und der Anzahl an Phasen im System ab.!phasendiagramme zeigen Gleichgewichtszustände von Substanzen.!Einige Gleichgewichtskurven in diesen Diagrammen können mit Hilfe der Clausius-Clapeyron-Gleichung abgeschätzt werden.
38
Die innere Energie and die Entropie
 Die innere Energie and die Entropie Aber fangen wir mit der Entropie an... Stellen Sie sich ein System vor, das durch die Entropie S, das Volumen V und die Stoffmenge n beschrieben wird. U ' U(S,V,n) Wir
Die innere Energie and die Entropie Aber fangen wir mit der Entropie an... Stellen Sie sich ein System vor, das durch die Entropie S, das Volumen V und die Stoffmenge n beschrieben wird. U ' U(S,V,n) Wir
6.2 Zweiter HS der Thermodynamik
 Die Änderung des Energieinhaltes eines Systems ohne Stoffaustausch kann durch Zu-/Abfuhr von Wärme Q bzw. mechanischer Arbeit W erfolgen Wird die Arbeit reversibel geleistet (Volumenarbeit), so gilt W
Die Änderung des Energieinhaltes eines Systems ohne Stoffaustausch kann durch Zu-/Abfuhr von Wärme Q bzw. mechanischer Arbeit W erfolgen Wird die Arbeit reversibel geleistet (Volumenarbeit), so gilt W
8.4.5 Wasser sieden bei Zimmertemperatur ******
 8.4.5 ****** 1 Motivation Durch Verminderung des Luftdrucks siedet Wasser bei Zimmertemperatur. 2 Experiment Abbildung 1: Ein druckfester Glaskolben ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so dass die Flüsigkeit
8.4.5 ****** 1 Motivation Durch Verminderung des Luftdrucks siedet Wasser bei Zimmertemperatur. 2 Experiment Abbildung 1: Ein druckfester Glaskolben ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so dass die Flüsigkeit
3.4 Änderung des Aggregatzustandes
 34 Änderung des Aggregatzustandes Man unterscheidet 3 Aggregatzustände: Fest Flüssig Gasförmig Temperatur: niedrig mittel hoch Molekülbindung: Gitter lose Bindung keine Bindung schmelzen sieden erstarren
34 Änderung des Aggregatzustandes Man unterscheidet 3 Aggregatzustände: Fest Flüssig Gasförmig Temperatur: niedrig mittel hoch Molekülbindung: Gitter lose Bindung keine Bindung schmelzen sieden erstarren
Wärmelehre Zustandsänderungen ideales Gases
 Wärmelehre Zustandsänderungen ideales Gases p Gas-Gleichung 1.Hauptsatz p V = N k B T U Q W p 1 400 1 isobar 300 200 isochor isotherm 100 p 2 0 2 adiabatisch 0 1 2 3 4 5 V V 2 1 V Bemerkung: Mischung verschiedener
Wärmelehre Zustandsänderungen ideales Gases p Gas-Gleichung 1.Hauptsatz p V = N k B T U Q W p 1 400 1 isobar 300 200 isochor isotherm 100 p 2 0 2 adiabatisch 0 1 2 3 4 5 V V 2 1 V Bemerkung: Mischung verschiedener
Die Carnot-Maschine SCHRITT III. Isotherme Kompression bei einer Temperatur T 2 T 2. Wärmesenke T 2 = konstant. Nicolas Thomas
 Die Carnot-Maschine SCHRITT III Isotherme Kompression bei einer Temperatur T 2 T 2 Wärmesenke T 2 = konstant Die Carnot-Maschine SCHRITT IV Man isoliert das Gas wieder thermisch und drückt den Kolben noch
Die Carnot-Maschine SCHRITT III Isotherme Kompression bei einer Temperatur T 2 T 2 Wärmesenke T 2 = konstant Die Carnot-Maschine SCHRITT IV Man isoliert das Gas wieder thermisch und drückt den Kolben noch
Grundlagen der Physik II
 Grundlagen der Physik II Othmar Marti 12. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 12. 07. 2007 Klausur Die Klausur
Grundlagen der Physik II Othmar Marti 12. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 12. 07. 2007 Klausur Die Klausur
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 6. Vorlesung
 E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 6. Vorlesung 26.04.2018 Heute: - Kondensationskerne - Van der Waals-Gas - 2. Hauptsatz https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 26.04.2018 Prof.
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 6. Vorlesung 26.04.2018 Heute: - Kondensationskerne - Van der Waals-Gas - 2. Hauptsatz https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 26.04.2018 Prof.
Klausur Thermodynamik E2/E2p SoSe 2019 Braun. Formelsammlung Thermodynamik
 Klausur Thermodynamik E2/E2p SoSe 2019 Braun Name: Matrikelnummer: O E2 O E2p (bitte ankreuzen) Die mit Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben sind für E2-Kandidaten vorgesehen - E2p-Kandidaten dürfen diese
Klausur Thermodynamik E2/E2p SoSe 2019 Braun Name: Matrikelnummer: O E2 O E2p (bitte ankreuzen) Die mit Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben sind für E2-Kandidaten vorgesehen - E2p-Kandidaten dürfen diese
Wärmelehre/Thermodynamik. Wintersemester 2007
 Einführung in die Physik I Wärmelehre/Thermodynamik Wintersemester 2007 ladimir Dyakonov #13 am 30.01.2007 Folien im PDF Format unter: htt://www.hysik.uni-wuerzburg.de/ep6/teaching.html Raum E143, Tel.
Einführung in die Physik I Wärmelehre/Thermodynamik Wintersemester 2007 ladimir Dyakonov #13 am 30.01.2007 Folien im PDF Format unter: htt://www.hysik.uni-wuerzburg.de/ep6/teaching.html Raum E143, Tel.
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 6. Vorlesung
 E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 6. Vorlesung 26.04.2018 Heute: - Kondensationskerne - Van der Waals-Gas - 2. Hauptsatz https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 26.04.2018 Prof.
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 6. Vorlesung 26.04.2018 Heute: - Kondensationskerne - Van der Waals-Gas - 2. Hauptsatz https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 26.04.2018 Prof.
11. Der Phasenübergang
 11. Der Phasenübergang - Phasendiagramme, Kritischer Punkt und ripelpunkt - Gibbssche Phasenregel - Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung - Das Phasengleichgewicht - Clausius-Clapeyron-Gleichung - Pictet-routon-Regel,
11. Der Phasenübergang - Phasendiagramme, Kritischer Punkt und ripelpunkt - Gibbssche Phasenregel - Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung - Das Phasengleichgewicht - Clausius-Clapeyron-Gleichung - Pictet-routon-Regel,
a) Welche der folgenden Aussagen treffen nicht zu? (Dies bezieht sind nur auf Aufgabenteil a)
 Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Thermodynamik. Kapitel 4. Nicolas Thomas
 Thermodynamik Kapitel 4 Arbeit und Wärme Länge, x F Kolben Länge, x F Der Kolben wird sehr langsam um die Distanz -dx verschoben. dx Kolben Wieviel Arbeit mussten wir leisten, um den Kolben zu bewegen?
Thermodynamik Kapitel 4 Arbeit und Wärme Länge, x F Kolben Länge, x F Der Kolben wird sehr langsam um die Distanz -dx verschoben. dx Kolben Wieviel Arbeit mussten wir leisten, um den Kolben zu bewegen?
Erreichte Punktzahlen: Die Bearbeitungszeit beträgt 3 Stunden.
 Fakultät für Physik der LMU München Prof. Ilka Brunner Vorlesung T4p, WS08/09 Klausur am 11. Februar 2009 Name: Matrikelnummer: Erreichte Punktzahlen: 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 Hinweise Die Bearbeitungszeit
Fakultät für Physik der LMU München Prof. Ilka Brunner Vorlesung T4p, WS08/09 Klausur am 11. Februar 2009 Name: Matrikelnummer: Erreichte Punktzahlen: 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 Hinweise Die Bearbeitungszeit
Vorlesung Statistische Mechanik: Ising-Modell
 Phasendiagramme Das Phasendiagramm zeigt die Existenzbereiche der Phasen eines Stoffes in Abhängigkeit von thermodynamischen Parametern. Das einfachste Phasendiagramm erhält man für eine symmetrische binäre
Phasendiagramme Das Phasendiagramm zeigt die Existenzbereiche der Phasen eines Stoffes in Abhängigkeit von thermodynamischen Parametern. Das einfachste Phasendiagramm erhält man für eine symmetrische binäre
9. Phasengleichgewichte und Zustandsänderungen 9.1 Einkompentige Systeme
 9. Phasengleichgewichte und Zustandsänderungen 9.1 Einkompentige Systeme Temperaturabhängigkeit der freien Enthalpie dg = d( H TS ) = dh T ds S dt = C P dt TC P T H Da S > 0, nimmt G mit zunehmender Temperatur
9. Phasengleichgewichte und Zustandsänderungen 9.1 Einkompentige Systeme Temperaturabhängigkeit der freien Enthalpie dg = d( H TS ) = dh T ds S dt = C P dt TC P T H Da S > 0, nimmt G mit zunehmender Temperatur
1. Wärme und der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 1.1. Grundlagen
 IV. Wärmelehre 1. Wärme und der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 1.1. Grundlagen Historisch: Wärme als Stoff, der übertragen und in beliebiger Menge erzeugt werden kann. Übertragung: Wärmezufuhr Joulesche
IV. Wärmelehre 1. Wärme und der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 1.1. Grundlagen Historisch: Wärme als Stoff, der übertragen und in beliebiger Menge erzeugt werden kann. Übertragung: Wärmezufuhr Joulesche
Karlsruher Institut für Technologie Festkörperphysik. Übungen zur Theoretischen Physik F SS 10
 Karlsruher Institut für Technologie Institut für Theoretische Festkörperphysik Übungen zur Theoretischen Physik F SS 10 Prof. Dr. G. Schön Lösungsvorschlag zu Blatt 2 Dr. J. Cole 30.04.2010 1. Van-der-Waals
Karlsruher Institut für Technologie Institut für Theoretische Festkörperphysik Übungen zur Theoretischen Physik F SS 10 Prof. Dr. G. Schön Lösungsvorschlag zu Blatt 2 Dr. J. Cole 30.04.2010 1. Van-der-Waals
4. Strukturänderung durch Phasenübergänge
 4. Strukturänderung durch Phasenübergänge Phasendiagramm einer reinen Substanz Druck Phasenänderung durch Variation des Drucks und/oder der Temperatur Klassifizierung Phasenübergänge 1. Art Phasenübergänge
4. Strukturänderung durch Phasenübergänge Phasendiagramm einer reinen Substanz Druck Phasenänderung durch Variation des Drucks und/oder der Temperatur Klassifizierung Phasenübergänge 1. Art Phasenübergänge
Grundlagen der Physik II
 Grundlagen der Physik II Othmar Marti Ulf Wiedwald 16. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 16. 07. 2007
Grundlagen der Physik II Othmar Marti Ulf Wiedwald 16. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 16. 07. 2007
4.6.5 Dritter Hauptsatz der Thermodynamik
 4.6 Hauptsätze der Thermodynamik Entropie S: ds = dq rev T (4.97) Zustandsgröße, die den Grad der Irreversibilität eines Vorgangs angibt. Sie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems. Vorgänge finden
4.6 Hauptsätze der Thermodynamik Entropie S: ds = dq rev T (4.97) Zustandsgröße, die den Grad der Irreversibilität eines Vorgangs angibt. Sie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems. Vorgänge finden
d) Das ideale Gas makroskopisch
 d) Das ideale Gas makroskopisch Beschreibung mit Zustandsgrößen p, V, T Brauchen trotzdem n, R dazu Immer auch Mikroskopische Argumente dazunehmen Annahmen aus mikroskopischer Betrachtung: Moleküle sind
d) Das ideale Gas makroskopisch Beschreibung mit Zustandsgrößen p, V, T Brauchen trotzdem n, R dazu Immer auch Mikroskopische Argumente dazunehmen Annahmen aus mikroskopischer Betrachtung: Moleküle sind
LMPG1 ÜB1 Phasendiagramme & Dampfdruck Lösungen Seite 1 von 6
 LMPG1 ÜB1 Phasendiagramme & Dampfdruck Lösungen Seite 1 von 6 Aufgabe 1: Phasendiagramm reiner Stoffe. Die Abbildung zeigt das allgemeingültige Phasendiagramm reiner Stoffe. a) Beschriften Sie das Diagramm
LMPG1 ÜB1 Phasendiagramme & Dampfdruck Lösungen Seite 1 von 6 Aufgabe 1: Phasendiagramm reiner Stoffe. Die Abbildung zeigt das allgemeingültige Phasendiagramm reiner Stoffe. a) Beschriften Sie das Diagramm
Bekannter Stoff aus dem 1. Semester:
 Bekannter Stoff aus dem 1. Semester: Atombau! Arten der Teilchen! Elemente/Isotope! Kernchemie! Elektronenhülle/Quantenzahlen Chemische Bindung! Zustände der Materie! Ionenbindung! Atombindung! Metallbindung
Bekannter Stoff aus dem 1. Semester: Atombau! Arten der Teilchen! Elemente/Isotope! Kernchemie! Elektronenhülle/Quantenzahlen Chemische Bindung! Zustände der Materie! Ionenbindung! Atombindung! Metallbindung
Wärmelehre/Thermodynamik. Wintersemester 2007
 Einführung in die Physik I Wärmelehre/Thermodynamik Wintersemester 2007 Vladimir Dyakonov #12 am 26.01.2007 Folien im PDF Format unter: http://www.physik.uni-wuerzburg.de/ep6/teaching.html Raum E143, Tel.
Einführung in die Physik I Wärmelehre/Thermodynamik Wintersemester 2007 Vladimir Dyakonov #12 am 26.01.2007 Folien im PDF Format unter: http://www.physik.uni-wuerzburg.de/ep6/teaching.html Raum E143, Tel.
Das Ideale Gas Kinetische Gastheorie (auf atomarer Ebene)
 Das Ideale Gas Kinetische Gastheorie (auf atomarer Ebene) Wir haben gesehen, dass ein sogenanntes 'ideales Gas' durch die Zustandsgleichung pv = νr T [1] beschrieben wird; wir wollen nun verstehen, welchen
Das Ideale Gas Kinetische Gastheorie (auf atomarer Ebene) Wir haben gesehen, dass ein sogenanntes 'ideales Gas' durch die Zustandsgleichung pv = νr T [1] beschrieben wird; wir wollen nun verstehen, welchen
Physik III im Studiengang Elektrotechnik
 hysik III im Studiengang Elektrotechnik - reale Gase, hasenübergänge - rof. Dr. Ulrich Hahn WS 2008/09 reale Gase kleine Temperaturen, hohe Drücke: Moleküle weisen Eigenvolumen auf Moleküle ziehen sich
hysik III im Studiengang Elektrotechnik - reale Gase, hasenübergänge - rof. Dr. Ulrich Hahn WS 2008/09 reale Gase kleine Temperaturen, hohe Drücke: Moleküle weisen Eigenvolumen auf Moleküle ziehen sich
Modul Chemische Thermodynamik: Verdampfungsgleichgewicht
 Modul Chemische hermodynamik: Verdampfungsgleichgewicht M. Broszio, F. Noll, Oktober 2007, Korrekturen September 2008 Lernziele Ziel dieses Versuches ist es einen Einblick in die Beschreibung von Phasengleichgewichten
Modul Chemische hermodynamik: Verdampfungsgleichgewicht M. Broszio, F. Noll, Oktober 2007, Korrekturen September 2008 Lernziele Ziel dieses Versuches ist es einen Einblick in die Beschreibung von Phasengleichgewichten
A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C?
 A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C? (-> Tabelle p) A 1.1 b Wie groß ist der Auftrieb eines Helium (Wasserstoff) gefüllten
A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C? (-> Tabelle p) A 1.1 b Wie groß ist der Auftrieb eines Helium (Wasserstoff) gefüllten
Ferienkurs Experimentalphysik II Elektro- und Thermodynamik. Thermodynamik Teil II. 12. September 2011 Michael Mittermair
 Ferienkurs Experimentalphysik II Elektro- und Thermodynamik Thermodynamik Teil II 12. September 2011 Michael Mittermair Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 3 1.1 Kategorisierung von Systemen..................
Ferienkurs Experimentalphysik II Elektro- und Thermodynamik Thermodynamik Teil II 12. September 2011 Michael Mittermair Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 3 1.1 Kategorisierung von Systemen..................
ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14,
 ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14, 12.02.2016 Aufgabe 1 Kreisprozesse Mit einem Mol eines idealen, monoatomaren Gases (cv = 3/2 R) wird, ausgehend
ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14, 12.02.2016 Aufgabe 1 Kreisprozesse Mit einem Mol eines idealen, monoatomaren Gases (cv = 3/2 R) wird, ausgehend
Versuch Nr. 7. = q + p dv
 Hochschule Augsburg Versuch Nr. 7 Physikalisches Aufbauten 7 a bzw. 27 a Praktikum Spezifische Verdampfungsenthalpie - Dampfdruckkurve 1. Grundlagen_und_Versuchsidee 1.1 Definition der Verdampfungsenthalpie:E
Hochschule Augsburg Versuch Nr. 7 Physikalisches Aufbauten 7 a bzw. 27 a Praktikum Spezifische Verdampfungsenthalpie - Dampfdruckkurve 1. Grundlagen_und_Versuchsidee 1.1 Definition der Verdampfungsenthalpie:E
Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS
 DEPARTMENT FÜR PHYSIK, LMU Statistische Physik für Bachelor Plus WS 2011/12 Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS NAME:... MATRIKEL NR.:... Bitte beachten: Schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Blatt; Schreiben
DEPARTMENT FÜR PHYSIK, LMU Statistische Physik für Bachelor Plus WS 2011/12 Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS NAME:... MATRIKEL NR.:... Bitte beachten: Schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Blatt; Schreiben
9. Thermodynamik. 9.1 Temperatur und thermisches Gleichgewicht 9.2 Thermometer und Temperaturskala. 9.4 Wärmekapazität
 9. Thermodynamik 9.1 Temperatur und thermisches Gleichgewicht 9.2 Thermometer und Temperaturskala 93 9.3 Thermische h Ausdehnung 9.4 Wärmekapazität 9. Thermodynamik Aufgabe: - Temperaturverhalten von Gasen,
9. Thermodynamik 9.1 Temperatur und thermisches Gleichgewicht 9.2 Thermometer und Temperaturskala 93 9.3 Thermische h Ausdehnung 9.4 Wärmekapazität 9. Thermodynamik Aufgabe: - Temperaturverhalten von Gasen,
A 3 Dampfdruckkurve einer leichtflüchtigen Flüssigkeit
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 3 Dampfdruckkurve einer leichtflüchtigen Flüssigkeit Aufgabe: Es ist die Dampfdruckkurve einer leicht flüchtigen Flüssigkeit zu ermitteln
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 3 Dampfdruckkurve einer leichtflüchtigen Flüssigkeit Aufgabe: Es ist die Dampfdruckkurve einer leicht flüchtigen Flüssigkeit zu ermitteln
A 2.6 Wie ist die Zusammensetzung der Flüssigkeit und des Dampfes eines Stickstoff-Sauerstoff-Gemischs
 A 2.1 Bei - 10 o C beträgt der Dampfdruck des Kohlendioxids 26,47 bar, die Dichte der Flüssigkeit 980,8 kg/m 3 und die Dichte des Dampfes 70,5 kg/m 3. Bei - 7,5 o C beträgt der Dampfdruck 28,44 bar. Man
A 2.1 Bei - 10 o C beträgt der Dampfdruck des Kohlendioxids 26,47 bar, die Dichte der Flüssigkeit 980,8 kg/m 3 und die Dichte des Dampfes 70,5 kg/m 3. Bei - 7,5 o C beträgt der Dampfdruck 28,44 bar. Man
Physikalisches Praktikum I
 Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Allgemeine Chemie. SS 2014 Thomas Loerting. Thomas Loerting Allgemeine Chemie
 Allgemeine Chemie SS 2014 Thomas Loerting 1 Inhalt 1 Der Aufbau der Materie (Teil 1) 2 Die chemische Bindung (Teil 2) 3 Die chemische Reaktion (Teil 3) 2 Definitionen von den an einer chemischen Reaktion
Allgemeine Chemie SS 2014 Thomas Loerting 1 Inhalt 1 Der Aufbau der Materie (Teil 1) 2 Die chemische Bindung (Teil 2) 3 Die chemische Reaktion (Teil 3) 2 Definitionen von den an einer chemischen Reaktion
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen!
 1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
Übungen zur Theoretischen Physik F SS Ideales Boltzmann-Gas: ( =25 Punkte, schriftlich)
 Karlsruher Institut für Technologie Institut für Theorie der Kondensierten Materie Übungen zur Theoretischen Physik F SS 2016 Prof. Dr. A. Shnirman Blatt 2 Dr. B. Narozhny, Dipl.-Phys. P. Schad Lösungsvorschlag
Karlsruher Institut für Technologie Institut für Theorie der Kondensierten Materie Übungen zur Theoretischen Physik F SS 2016 Prof. Dr. A. Shnirman Blatt 2 Dr. B. Narozhny, Dipl.-Phys. P. Schad Lösungsvorschlag
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 7. Vorlesung
 E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 7. Vorlesung 30.04.2018 Heute: - 2. Hauptsatz - Boltzmann-Verteilung https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 30.04.2018 Prof. Dr. Jan Lipfert
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 7. Vorlesung 30.04.2018 Heute: - 2. Hauptsatz - Boltzmann-Verteilung https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 30.04.2018 Prof. Dr. Jan Lipfert
Alles was uns umgibt!
 Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?
Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?
O. Sternal, V. Hankele. 5. Thermodynamik
 5. Thermodynamik 5. Thermodynamik 5.1 Temperatur und Wärme Systeme aus vielen Teilchen Quelle: Wikimedia Commons Datei: Translational_motion.gif Versuch: Beschreibe 1 m 3 Luft mit Newton-Mechanik Beschreibe
5. Thermodynamik 5. Thermodynamik 5.1 Temperatur und Wärme Systeme aus vielen Teilchen Quelle: Wikimedia Commons Datei: Translational_motion.gif Versuch: Beschreibe 1 m 3 Luft mit Newton-Mechanik Beschreibe
Grundlagen der Physik II
 Grundlagen der Physik II Othmar Marti 05. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 05. 07. 2007 Klausur Die Klausur
Grundlagen der Physik II Othmar Marti 05. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 05. 07. 2007 Klausur Die Klausur
4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen
 4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen 1. Eigenschaften der Materie in der Gasphase 2. Erster Hauptsatz: Arbeit und Wärme 3. Entropie und Zweiter Hauptsatz der hermodynamik 4. Freie Enthalpie G,
4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen 1. Eigenschaften der Materie in der Gasphase 2. Erster Hauptsatz: Arbeit und Wärme 3. Entropie und Zweiter Hauptsatz der hermodynamik 4. Freie Enthalpie G,
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I Dr. Helge Klemmer
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I 12.12.2014 Gase Flüssigkeiten Feststoffe Wiederholung Teil 2 (05.12.2014) Ideales Gasgesetz: pv Reale Gase: Zwischenmolekularen Wechselwirkungen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I 12.12.2014 Gase Flüssigkeiten Feststoffe Wiederholung Teil 2 (05.12.2014) Ideales Gasgesetz: pv Reale Gase: Zwischenmolekularen Wechselwirkungen
Ferienkurs Experimentalphysik 2 - Donnerstag-Übungsblatt
 1 Aufgabe: Entropieänderung Ferienkurs Experimentalphysik 2 - Donnerstag-Übungsblatt 1 Aufgabe: Entropieänderung a) Ein Kilogramm Wasser bei = C wird in thermischen Kontakt mit einem Wärmereservoir bei
1 Aufgabe: Entropieänderung Ferienkurs Experimentalphysik 2 - Donnerstag-Übungsblatt 1 Aufgabe: Entropieänderung a) Ein Kilogramm Wasser bei = C wird in thermischen Kontakt mit einem Wärmereservoir bei
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 7. Vorlesung
 E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 7. Vorlesung 30.04.2018 Heute: - 2. Hauptsatz - Boltzmann-Verteilung https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 30.04.2018 Prof. Dr. Jan Lipfert
E2: Wärmelehre und Elektromagnetismus 7. Vorlesung 30.04.2018 Heute: - 2. Hauptsatz - Boltzmann-Verteilung https://xkcd.com/1166/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de 30.04.2018 Prof. Dr. Jan Lipfert
Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh - 08
 Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh - 08 Wärmelehre 18.12. 2006 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik Verallgemeinerung der Energieerhaltung von makroskopischen Systemen auf mikroskopische Der erste
Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh - 08 Wärmelehre 18.12. 2006 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik Verallgemeinerung der Energieerhaltung von makroskopischen Systemen auf mikroskopische Der erste
Spezialfälle. BOYLE-MARIOTT`sches Gesetz p V = n R T bei T, n = konstant: p V = const. GAY-LUSSAC`sches Gesetz. bei V, n = konstant: p = const.
 Spezialfälle BOYLE-MARIOTT`sches Gesetz p V = n R T bei T, n = konstant: p V = const. GAY-LUSSAC`sches Gesetz p V = n R T bei V, n = konstant: p = const. T Druck Druck V = const. Volumen T 2 T 1 Temperatur
Spezialfälle BOYLE-MARIOTT`sches Gesetz p V = n R T bei T, n = konstant: p V = const. GAY-LUSSAC`sches Gesetz p V = n R T bei V, n = konstant: p = const. T Druck Druck V = const. Volumen T 2 T 1 Temperatur
Physikalisches Grundpraktikum. Phasenumwandlungen
 Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: http://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/ Kontaktadressen der Praktikumsleiter:
Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: http://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/ Kontaktadressen der Praktikumsleiter:
Die freie Energie wird also bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur minimal
 Die freie Energie wird also bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur minimal 7.2 Die Enthalpie Die Enthalpie H ist definiert als H = U + pv, womit wir für die Änderung erhalten dh = pdv + TdS +
Die freie Energie wird also bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur minimal 7.2 Die Enthalpie Die Enthalpie H ist definiert als H = U + pv, womit wir für die Änderung erhalten dh = pdv + TdS +
Physikalische Umwandlungen reiner Stoffe
 Physikalische Umwandlungen reiner Stoffe Lernziele: Phasendiagramme, die Stabilität von Phasen Phasengrenzen, typische Phasendiagrame Phasenübergänge, die D Gleichgewichtkriterium Die Abhängigkeit der
Physikalische Umwandlungen reiner Stoffe Lernziele: Phasendiagramme, die Stabilität von Phasen Phasengrenzen, typische Phasendiagrame Phasenübergänge, die D Gleichgewichtkriterium Die Abhängigkeit der
Multiple-Choice Test. Alle Fragen können mit Hilfe der Versuchsanleitung richtig gelöst werden.
 PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
Versuch XII. Latente Wärme. Oliver Heinrich. Bernd Kugler Abgabe:
 Versuch XII Latente Wärme Oliver Heinrich oliver.heinrich@uni-ulm.de Bernd Kugler berndkugler@web.de 24.11.2006 1. Abgabe: 13.12.2006 Betreuer: Dominik Schmid-Lorch 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theoretische
Versuch XII Latente Wärme Oliver Heinrich oliver.heinrich@uni-ulm.de Bernd Kugler berndkugler@web.de 24.11.2006 1. Abgabe: 13.12.2006 Betreuer: Dominik Schmid-Lorch 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theoretische
(b) Schritt I: freie adiabatische Expansion, also ist δw = 0, δq = 0 und damit T 2 = T 1. Folglich ist nach 1. Hauptsatz auch U = 0.
 3 Lösungen Lösung zu 65. (a) Siehe Abbildung 1. (b) Schritt I: freie adiabatische Expansion, also ist δw 0, δq 0 und damit. Folglich ist nach 1. Hauptsatz auch U 0. Schritt II: isobare Kompression, also
3 Lösungen Lösung zu 65. (a) Siehe Abbildung 1. (b) Schritt I: freie adiabatische Expansion, also ist δw 0, δq 0 und damit. Folglich ist nach 1. Hauptsatz auch U 0. Schritt II: isobare Kompression, also
Klausur Wärmelehre E2/E2p SoSe 2016 Braun. Formelsammlung Thermodynamik
 Klausur Wärmelehre E2/E2p SoSe 2016 Braun Name: Matrikelnummer: O E2 O E2p (bitte ankreuzen) Die mit Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben sind für E2-Kandidaten vorgesehen - E2p-Kandidaten dürfen diese
Klausur Wärmelehre E2/E2p SoSe 2016 Braun Name: Matrikelnummer: O E2 O E2p (bitte ankreuzen) Die mit Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben sind für E2-Kandidaten vorgesehen - E2p-Kandidaten dürfen diese
Vorlesung 15 II Wärmelehre 15. Wärmetransport und Stoffmischung
 Vorlesung 15 II Wärmelehre 15. Wärmetransport und Stoffmischung a) Wärmestrahlung b) Wärmeleitung c) Wärmeströmung d) Diffusion 16. Phasenübergänge (Verdampfen, Schmelzen, Sublimieren) Versuche: Wärmeleitung
Vorlesung 15 II Wärmelehre 15. Wärmetransport und Stoffmischung a) Wärmestrahlung b) Wärmeleitung c) Wärmeströmung d) Diffusion 16. Phasenübergänge (Verdampfen, Schmelzen, Sublimieren) Versuche: Wärmeleitung
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome
 Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 361 4. Chemische Reaktionen 4.1. Allgemeine Grundlagen (Wiederholung) 4.2. Energieumsätze chemischer
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 361 4. Chemische Reaktionen 4.1. Allgemeine Grundlagen (Wiederholung) 4.2. Energieumsätze chemischer
Aufgaben zur Experimentalphysik II: Thermodynamik
 Aufgaben zur Experimentalphysik II: Thermodynamik Lösungen William Hefter - 5//8 1. 1. Durchmesser der Stahlstange nach T : D s D s (1 + α Stahl T) Durchmesser der Bohrung im Ring nach T : D m D m (1 +
Aufgaben zur Experimentalphysik II: Thermodynamik Lösungen William Hefter - 5//8 1. 1. Durchmesser der Stahlstange nach T : D s D s (1 + α Stahl T) Durchmesser der Bohrung im Ring nach T : D m D m (1 +
! #!! % & ( )! ! +, +,# # !.. +, ) + + /) # %
 ! #! #!! % & ( )!! +, +,# #!.. +, ) + + /)!!.0. #+,)!## 2 +, ) + + 3 4 # )!#!! ), 5 # 6! # &!). ) # )!#! #, () # # ) #!# #. # ) 6 # ) )0 4 )) #, 7) 6!!. )0 +,!# +, 4 / 4, )!#!! ))# 0.(! & ( )!! 8 # ) #+,
! #! #!! % & ( )!! +, +,# #!.. +, ) + + /)!!.0. #+,)!## 2 +, ) + + 3 4 # )!#!! ), 5 # 6! # &!). ) # )!#! #, () # # ) #!# #. # ) 6 # ) )0 4 )) #, 7) 6!!. )0 +,!# +, 4 / 4, )!#!! ))# 0.(! & ( )!! 8 # ) #+,
Zustandsbeschreibungen
 Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik
 Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
8.3 Ausgleichsprozesse in abgeschlossenen und nichtabgeschlossenen Systemen - thermodynamisches Gleichgewicht und thermodynamische Potentiale
 8.3 Ausgleichsprozesse in abgeschlossenen und nichtabgeschlossenen Systemen - thermodynamisches Gleichgewicht und thermodynamische Potentiale Rückschau: Mechanisches Gleichgewicht und Stabilität Ein Körper
8.3 Ausgleichsprozesse in abgeschlossenen und nichtabgeschlossenen Systemen - thermodynamisches Gleichgewicht und thermodynamische Potentiale Rückschau: Mechanisches Gleichgewicht und Stabilität Ein Körper
Berechnung von Zustandsgrößen für ideale Gas im geschlossenen und offenen System
 Was Sie im letzten Lehrabschnitt gelernt haben 1 Einordnen von thermodynamischen Prozessen Berechnung von Zustandsgrößen für ideale Gas im geschlossenen und offenen System Aussage und mathematische Formulierung
Was Sie im letzten Lehrabschnitt gelernt haben 1 Einordnen von thermodynamischen Prozessen Berechnung von Zustandsgrößen für ideale Gas im geschlossenen und offenen System Aussage und mathematische Formulierung
Thermodynamik. Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen.
 Thermodynamik Was ist das? Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen. Gesetze der Thermodynamik Erlauben die Voraussage, ob eine bestimmte
Thermodynamik Was ist das? Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen. Gesetze der Thermodynamik Erlauben die Voraussage, ob eine bestimmte
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik
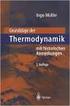 Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Berechnen Sie die Wärmemenge in kj, die erforderlich ist, um 750g H 2 O von
 Aufgabe 1: Berechnen Sie die Wärmemenge in kj, die erforderlich ist, um 750g H O von 0 C bis zum Siedepunkt (100 C) zu erwärmen. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser c = 4.18 J K - 1 g -1. Lösung
Aufgabe 1: Berechnen Sie die Wärmemenge in kj, die erforderlich ist, um 750g H O von 0 C bis zum Siedepunkt (100 C) zu erwärmen. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser c = 4.18 J K - 1 g -1. Lösung
Gefrierpunktserniedrigung
 Gefrierpunktserniedrigung Zur Darstellung der möglichen Phasen einer Substanz wird deren Verhalten bei verschiedenen Drücken und Temperaturen gemessen und in ein Druck-Temperatur- Diagramm eingetragen.
Gefrierpunktserniedrigung Zur Darstellung der möglichen Phasen einer Substanz wird deren Verhalten bei verschiedenen Drücken und Temperaturen gemessen und in ein Druck-Temperatur- Diagramm eingetragen.
Erster und Zweiter Hauptsatz
 PN 1 Einführung in die alphysik für Chemiker und Biologen 26.1.2007 Paul Koza, Nadja Regner, Thorben Cordes, Peter Gilch Lehrstuhl für BioMolekulare Optik Department für Physik Ludwig-Maximilians-Universität
PN 1 Einführung in die alphysik für Chemiker und Biologen 26.1.2007 Paul Koza, Nadja Regner, Thorben Cordes, Peter Gilch Lehrstuhl für BioMolekulare Optik Department für Physik Ludwig-Maximilians-Universität
PN 1 Einführung in die Experimentalphysik für Chemiker und Biologen
 PN 1 Einführung in die Experimentalphysik für Chemiker und Biologen 26.1.2007 Paul Koza, Nadja Regner, Thorben Cordes, Peter Gilch Lehrstuhl für BioMolekulare Optik Department für Physik Ludwig-Maximilians-Universität
PN 1 Einführung in die Experimentalphysik für Chemiker und Biologen 26.1.2007 Paul Koza, Nadja Regner, Thorben Cordes, Peter Gilch Lehrstuhl für BioMolekulare Optik Department für Physik Ludwig-Maximilians-Universität
AC2 ÜB THERMODYNAMIK 2, GLEICHGEWICHTSKONSTANTE Seite 1 von J / mol J K. molk
 Lösung Aufgabe 1: Kc = [HO + ]. [OH - ] a) AC2 ÜB THERMODYNAMIK 2, GLEICHGEWICHTSKONSTANTE Seite 1 von 12 1 H 2 O(l) + + 0 1 H + (aq) + 1 OH - (aq) + 0 f H m -285.8 0 0-229.99 0 [Kj/mol] S m 69.91 0 0-10.75
Lösung Aufgabe 1: Kc = [HO + ]. [OH - ] a) AC2 ÜB THERMODYNAMIK 2, GLEICHGEWICHTSKONSTANTE Seite 1 von 12 1 H 2 O(l) + + 0 1 H + (aq) + 1 OH - (aq) + 0 f H m -285.8 0 0-229.99 0 [Kj/mol] S m 69.91 0 0-10.75
Carnotscher Kreisprozess
 Carnotscher Kreisprozess (idealisierter Kreisprozess) 2 p 1, V 1, T 1 p(v) dv > 0 p 2, V 2, T 1 Expansionsarbeit wird geleistet dq fließt aus Wärmebad zu dq > 0 p 2, V 2, T 1 p(v) dv > 0 p 3, V 3, T 2
Carnotscher Kreisprozess (idealisierter Kreisprozess) 2 p 1, V 1, T 1 p(v) dv > 0 p 2, V 2, T 1 Expansionsarbeit wird geleistet dq fließt aus Wärmebad zu dq > 0 p 2, V 2, T 1 p(v) dv > 0 p 3, V 3, T 2
Dampfdruck von Flüssigkeiten
 Dampfdruck von Flüssigkeiten 1 Dampfdruck von Flüssigkeiten In diesem Versuch werden die Dampfdruckkurven zweier Flüssigkeiten im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und den jeweiligen Siedetemperaturen
Dampfdruck von Flüssigkeiten 1 Dampfdruck von Flüssigkeiten In diesem Versuch werden die Dampfdruckkurven zweier Flüssigkeiten im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und den jeweiligen Siedetemperaturen
Beispielaufgaben IChO 2. Runde 2019 Grundlagen der Thermodynamik, Lösungen. = -0,900 kj/k (21,84 22,15) K / 13,16 g = 0,279 kj / 13,16 g
 Lösung Beispiel 1 Erhaltung der Energie a) ZnSO 4(s) ZnSO 4(aq): Lösungsenthalpie Lsg (ZnSO 4) = -0,900 kj/k (23,52 22,55) K / 1,565 g = -0,873 kj / 1,565 g mit (ZnSO 4) = 161,48 g/mol: Lsg (ZnSO 4) =
Lösung Beispiel 1 Erhaltung der Energie a) ZnSO 4(s) ZnSO 4(aq): Lösungsenthalpie Lsg (ZnSO 4) = -0,900 kj/k (23,52 22,55) K / 1,565 g = -0,873 kj / 1,565 g mit (ZnSO 4) = 161,48 g/mol: Lsg (ZnSO 4) =
Multiple-Choice Test. Alle Fragen können mit Hilfe der Versuchsanleitung richtig gelöst werden.
 PCG-Grundpraktikum Versuch 2- Siedediagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Siedediagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
PCG-Grundpraktikum Versuch 2- Siedediagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Siedediagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
Theorie der Wa rme Musterlo sung 8.
 Theorie der Wa rme Musterlo sung 8. U bung 1. FS 2014 Prof. Renner Wieso trocknet Wa sche an der Wa scheleine? Unter Normalbedingungen (T 300K, p 1bar ist Wasser flu ssig. Trotzdem verdunstet Wasser aus
Theorie der Wa rme Musterlo sung 8. U bung 1. FS 2014 Prof. Renner Wieso trocknet Wa sche an der Wa scheleine? Unter Normalbedingungen (T 300K, p 1bar ist Wasser flu ssig. Trotzdem verdunstet Wasser aus
A 3 Dampfdruckkurve einer leichtflüchtigen Flüssigkeit
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 3 Dampfdruckkurve einer leichtflüchtigen Flüssigkeit Aufgabe: Es ist die Dampfdruckkurve einer leicht flüchtigen Flüssigkeit zu ermitteln
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 3 Dampfdruckkurve einer leichtflüchtigen Flüssigkeit Aufgabe: Es ist die Dampfdruckkurve einer leicht flüchtigen Flüssigkeit zu ermitteln
Antrieb und Wärmebilanz bei Phasenübergängen. Speyer, März 2007
 Antrieb und Wärmebilanz bei Phasenübergängen Speyer, 19-20. März 2007 Michael Pohlig, WHG-Durmersheim michael@pohlig.de Literatur: Physik in der Oberstufe; Duden-PAETEC Schmelzwärme wird auch als Schmelzenergie
Antrieb und Wärmebilanz bei Phasenübergängen Speyer, 19-20. März 2007 Michael Pohlig, WHG-Durmersheim michael@pohlig.de Literatur: Physik in der Oberstufe; Duden-PAETEC Schmelzwärme wird auch als Schmelzenergie
Moderne Theoretische Physik III (Theorie F Statistische Mechanik) SS 17
 Karlsruher Institut für echnologie Institut für heorie der Kondensierten Materie Moderne heoretische Physik III (heorie F Statistische Mechanik) SS 17 Prof. Dr. Alexander Mirlin Blatt 2 PD Dr. Igor Gornyi,
Karlsruher Institut für echnologie Institut für heorie der Kondensierten Materie Moderne heoretische Physik III (heorie F Statistische Mechanik) SS 17 Prof. Dr. Alexander Mirlin Blatt 2 PD Dr. Igor Gornyi,
Physikalische Chemie I
 M.Bredol / MP Physikalische Chemie I / 10.3.16 1 Physikalische Chemie I Nachname orname Matrikel Aufgabe Punkte erreicht Note 1 20 2 20 3 20 4 22 5 18 Summe: 100 1. Gegeben seien 20 g Kohlendioxid, die
M.Bredol / MP Physikalische Chemie I / 10.3.16 1 Physikalische Chemie I Nachname orname Matrikel Aufgabe Punkte erreicht Note 1 20 2 20 3 20 4 22 5 18 Summe: 100 1. Gegeben seien 20 g Kohlendioxid, die
Thermodynamik I PVK - Tag 2. Nicolas Lanzetti
 Thermodynamik I PVK - Tag 2 Nicolas Lanzetti Nicolas Lanzetti 05.01.2016 1 Heutige Themen Carnot; Wirkungsgrad/Leistungsziffer; Entropie; Erzeugte Entropie; Isentroper Wirkungsgrad; Isentrope Prozesse
Thermodynamik I PVK - Tag 2 Nicolas Lanzetti Nicolas Lanzetti 05.01.2016 1 Heutige Themen Carnot; Wirkungsgrad/Leistungsziffer; Entropie; Erzeugte Entropie; Isentroper Wirkungsgrad; Isentrope Prozesse
Die Innere Energie U
 Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Materie ist die Gesamtheit aller Stoffe: Energie bei chemischen Reaktionen:
 A.1.1 1 Stoffbegriff / Materie / Energie Materie ist die Gesamtheit aller Stoffe: Jeder Stoff füllt einen Raum V (Einheit: m³) aus Jeder Stoff besitzt eine Masse m (Einheit: kg) Dichte = Masse / Volumen
A.1.1 1 Stoffbegriff / Materie / Energie Materie ist die Gesamtheit aller Stoffe: Jeder Stoff füllt einen Raum V (Einheit: m³) aus Jeder Stoff besitzt eine Masse m (Einheit: kg) Dichte = Masse / Volumen
TU-München, Musterlösung. Experimentalphysik II - Ferienkurs Andreas Schindewolf
 TU-München, 18.08.2009 Musterlösung Experimentalphysik II - Ferienkurs Andreas Schindewolf 1 Random Kreisprozess a Wärme wird nur im isochoren Prozess ab zugeführt. Hier ist W = 0 und Q ab = nc V t b T
TU-München, 18.08.2009 Musterlösung Experimentalphysik II - Ferienkurs Andreas Schindewolf 1 Random Kreisprozess a Wärme wird nur im isochoren Prozess ab zugeführt. Hier ist W = 0 und Q ab = nc V t b T
Thermodynamik Hauptsatz
 Thermodynamik. Hauptsatz Inhalt Wärmekraftmaschinen / Kälteprozesse. Hauptsatz der Thermodynamik Reversibilität Carnot Prozess Thermodynamische Temperatur Entropie Entropiebilanzen Anergie und Exergie
Thermodynamik. Hauptsatz Inhalt Wärmekraftmaschinen / Kälteprozesse. Hauptsatz der Thermodynamik Reversibilität Carnot Prozess Thermodynamische Temperatur Entropie Entropiebilanzen Anergie und Exergie
6.1 Gleichgewichts- und Stabilitätsbedingungen
 4. Woche 6.1 Gleichgewichts- und Stabilitätsbedingungen 6.1.1 Extremaleigenschaften der Potentiale Die Hauptsätze der Thermodynamik lauten du δq pdv (das Erste) und (das Zweite). Da (für dn 0) δq TdS gilt
4. Woche 6.1 Gleichgewichts- und Stabilitätsbedingungen 6.1.1 Extremaleigenschaften der Potentiale Die Hauptsätze der Thermodynamik lauten du δq pdv (das Erste) und (das Zweite). Da (für dn 0) δq TdS gilt
Phasengleichgewicht. 1. Experimentelle Bestimmung des Dampfdrucks von Methanol als Funktion der Temperatur. A fl. A g
 Physikalisch-Chemische Praktika Phasengleichgewicht Versuch T-2 Aufgaben 1. Experimentelle Bestimmung des Dampfdrucks von Methanol als Funktion der Temperatur. 2. Ermittlung der Phasenumwandlungsenthalpie
Physikalisch-Chemische Praktika Phasengleichgewicht Versuch T-2 Aufgaben 1. Experimentelle Bestimmung des Dampfdrucks von Methanol als Funktion der Temperatur. 2. Ermittlung der Phasenumwandlungsenthalpie
An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung können Sie sich noch erinnern?
 An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung können Sie sich noch erinnern? Temperatur Der nullte Hauptsatz der Thermodynamik: Thermoskop und Thermometer Kelvin, Celsius- und der Fahrenheit-Skala Wärmeausdehnung
An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung können Sie sich noch erinnern? Temperatur Der nullte Hauptsatz der Thermodynamik: Thermoskop und Thermometer Kelvin, Celsius- und der Fahrenheit-Skala Wärmeausdehnung
Physikalische Chemie 1
 Physikalische Chemie 1 Christian Lehmann 31. Januar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 1.1 Teilgebiete der Physikalischen Chemie............... 2 1.1.1 Thermodynamik (Wärmelehre)............... 2 1.1.2
Physikalische Chemie 1 Christian Lehmann 31. Januar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 1.1 Teilgebiete der Physikalischen Chemie............... 2 1.1.1 Thermodynamik (Wärmelehre)............... 2 1.1.2
Thermo Dynamik. Mechanische Bewegung (= Arbeit) Wärme (aus Reaktion) maximale Umsetzung
 Thermo Dynamik Wärme (aus Reaktion) Mechanische Bewegung (= Arbeit) maximale Umsetzung Aussagen der Thermodynamik: Quantifizieren von: Enthalpie-Änderungen Entropie-Änderungen Arbeit, maximale (Gibbs Energie)
Thermo Dynamik Wärme (aus Reaktion) Mechanische Bewegung (= Arbeit) maximale Umsetzung Aussagen der Thermodynamik: Quantifizieren von: Enthalpie-Änderungen Entropie-Änderungen Arbeit, maximale (Gibbs Energie)
Dampfdruck von Flüssigkeiten
 Dampfdruck von Flüssigkeiten 1 Dampfdruck von Flüssigkeiten In diesem Versuch werden die Dampfdruckkurven zweier Flüssigkeiten im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und den jeweiligen Siedetemperaturen
Dampfdruck von Flüssigkeiten 1 Dampfdruck von Flüssigkeiten In diesem Versuch werden die Dampfdruckkurven zweier Flüssigkeiten im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und den jeweiligen Siedetemperaturen
( ) ( ) J =920. c Al. m s c. Ü 8.1 Freier Fall
 Ü 8. Freier Fall Ein Stück Aluminium fällt aus einer Höhe von z = 000 m auf den Erdboden (z = 0). Die Luftreibung wird vernachlässigt und es findet auch kein Energieaustausch mit der Umgebung statt. Beim
Ü 8. Freier Fall Ein Stück Aluminium fällt aus einer Höhe von z = 000 m auf den Erdboden (z = 0). Die Luftreibung wird vernachlässigt und es findet auch kein Energieaustausch mit der Umgebung statt. Beim
Gegenstand der letzten Vorlesung
 Thermodynamik - Wiederholung Gegenstand der letzten Vorlesung Reaktionsenthalpien Satz von Hess adiabatische Zustandsänderungen: ΔQ = 0 Entropie S: Δ S= Δ Q rev (thermodynamische Definition) T 2. Hauptsatz
Thermodynamik - Wiederholung Gegenstand der letzten Vorlesung Reaktionsenthalpien Satz von Hess adiabatische Zustandsänderungen: ΔQ = 0 Entropie S: Δ S= Δ Q rev (thermodynamische Definition) T 2. Hauptsatz
Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik
 Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik "Feuer und Eis" von Guy Respaud 6/14/2013 S.Alexandrova FDIBA 1 Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik Die statistische Physik und die
Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik "Feuer und Eis" von Guy Respaud 6/14/2013 S.Alexandrova FDIBA 1 Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik Die statistische Physik und die
Kapitel IV Wärmelehre und Thermodynamik
 Kapitel IV Wärmelehre und Thermodynamik a) Definitionen b) Temperatur c) Wärme und Wärmekapazität d) Das ideale Gas - makroskopisch e) Das reale Gas / Phasenübergänge f) Das ideale Gas mikroskopisch g)
Kapitel IV Wärmelehre und Thermodynamik a) Definitionen b) Temperatur c) Wärme und Wärmekapazität d) Das ideale Gas - makroskopisch e) Das reale Gas / Phasenübergänge f) Das ideale Gas mikroskopisch g)
Klausur zur Vorlesung Thermodynamik
 Institut für Thermodynamik 23. August 2013 Technische Universität Braunschweig Prof. Dr. Jürgen Köhler Klausur zur Vorlesung Thermodynamik Für alle Aufgaben gilt: Der Rechen- bzw. Gedankengang muss stets
Institut für Thermodynamik 23. August 2013 Technische Universität Braunschweig Prof. Dr. Jürgen Köhler Klausur zur Vorlesung Thermodynamik Für alle Aufgaben gilt: Der Rechen- bzw. Gedankengang muss stets
Formelsammlung Abfallwirtschaft Seite 1/6 Wärmekapazität Prof. Dr. Werner Bidlingmaier & Dr.-Ing. Christian Springer
 Formelsammlung Abfallwirtschaft Seite 1/6 1 Energiebedarf zur Erwärmung von Stoffen Der Energiebetrag, der benötigt wird, um 1 kg einer bestimmten Substanz um 1 C zu erwärmen, wird als die (auch: Spezifische
Formelsammlung Abfallwirtschaft Seite 1/6 1 Energiebedarf zur Erwärmung von Stoffen Der Energiebetrag, der benötigt wird, um 1 kg einer bestimmten Substanz um 1 C zu erwärmen, wird als die (auch: Spezifische
Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung)
 Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
