Klausur zur VWL I (Mikroökonomie) im WS 2002/03 Studiengänge TUM-BWL/MBA
|
|
|
- Johann Lichtenberg
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Klausur zur VWL I (Mikroökonomie) im WS 2002/03 Studiengänge TUM-BWL/MBA Technische Universität München Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Prof. Dr. W. Ried Version D Allgemeine Hinweise Die Unterlagen enthalten einen Fragebogen inkl. Deckblatt (8 Seiten) sowie einen Lösungsbogen. Überprüfen Sie Ihre Unterlagen auf Vollständigkeit! Überprüfen Sie insbesondere, ob die auf dem Lösungsbogen angegebene Version mit derjenigen auf diesem Deckblatt übereinstimmt. Die Verwendung jeglicher Hilfsmittel ausser Schreibmaterial sowie Wörterbüchern für ausländische Studenten ist untersagt. Tragen Sie gleich zu Beginn auf dem Lösungsbogen Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer ein und kreuzen Sie Ihren Studiengang an. Die Klausur Der Fragebogen enthält insgesamt zwölf Aufgaben, darunter sind acht Multiple-Choice (MC) Aufgaben und vier Wahr/Falsch (WF) Aufgaben. Einträge im Lösungsbogen: bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewählten Antworten jeweils gut erkennbar an. Bei MC-Aufgaben ist genau eine Antwort zutreffend. Fehlende, mehrfache oder unzutreffende Antworten ergeben 0 Punkte. Die Antwort ist im Lösungsbogen anzukreuzen. Bei WF-Aufgaben wird jeweils eine Serie von 6 Aussagen aufgelistet. Für jede dieser Aussagen ist Wahr" (W) oder Falsch" (F) an der entsprechenden Stelle im Lösungsbogen anzukreuzen. Fehlende oder falsche Antworten ergeben 0 Punkte. Pro WF-Aufgabe können maximal zwölf Punkte erzielt werden. Für eine richtig beantwortete MC- Aufgabe gibt es jeweils acht Punkte. Bitte vergessen Sie nicht, auf dem Lösungsbogen an der vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Achtung: es ist lediglich der Lösungsbogen abzugeben (Antworten auf dem Fragebogen werden nicht gewertet)! Viel Erfolg!
2 Aufgabe 1 - Wahr/Falsch Aufgabe Betrachten Sie einen Wettbewerbsmarkt für ein Gut. Prüfen Sie für jede der folgenden Aussagen, ob diese WAHR oder FALSCH ist: a) Die Lage der Marktnachfragefunktion hängt von den Preisen komplementärer Güter ab. b) Die Lage der Marktangebotsfunktion hängt vom Preis des Guts ab. c) Die Lage der Marktangebotsfunktion hängt von den Preisen der Produktionsfaktoren ab. d) Bei ihrer Angebotsentscheidung berücksichtigen die Anbieter die jeweilige Nachfrage. e) Die Lage der Marktnachfragefunktion hängt vom Preis des Guts ab. f) Wenn eine gegebene Preiserhöhung unabhängig vom Ausgangspreis stets denselben Nachfragerückgang verursacht, ist die Preiselastizität der Marktnachfrage konstant. Aufgabe 2 - MC-Aufgabe Betrachten Sie ein Individuum, dessen Präferenzen sich auf Weißbier (W) und Schweinshaxen (S) beziehen und streng monoton sind. Zur Auswahl stehen die Güterbündel A = (2W, 2S), B = (4W, 2S), C = (2W, 4S) und D = (3W, 3S). Welche der nachstehenden Aussagen ist falsch? a) D wird stets gegenüber B strikt vorgezogen. b) Alle übrigen Bündel werden stets gegenüber A strikt vorgezogen. c) B wird stets gegenüber A strikt vorgezogen. d) Bei strenger Konvexitat wird D stets gegenüber B und C strikt vorgezogen. e) D wird stets gegenüber A strikt vorgezogen. Aufgabe 3 - MC-Aufgabe Betrachten Sie nochmals ein Individuum, dessen Präferenzen für Weißbier (W) und Schweinshaxen (S) streng monoton sind. Die Grenzrate der Substitution von Schweinshaxen durch Weißbier GRS S,W gibt an, a) auf welche Menge an Schweinshaxen das Individuum maximal zu verzichten bereit ist, wenn es eine kleine Verringerung seiner Weißbiermenge hinnehmen muß. b) wie hoch der relative Preis eines Weißbiers ist. c) auf welche Menge an Weißbier das Individuum für eine kleine Erhöhung der Menge seiner Schweinshaxen maximal zu verzichten bereit ist. d) auf welche Menge an Weißbier das Individuum maximal zu verzichten bereit ist, wenn es eine kleine Verringerung der Menge seiner Schweinshaxen hinnehmen muß. e) auf welche Menge an Schweinshaxen das Individuum für eine kleine Erhöhung seiner Weißbiermenge maximal zu verzichten bereit ist. Aufgabe 4 - MC-Aufgabe Ein Individuum plane, einen Geldbetrag von 50 Euro ausschließlich für den Konsum von Pizza (P) und Rotwein (R) zu verwenden. Der Preis P P der Pizza betrage 10 Euro, der Preis P R eines Viertelliters Rotwein 5 Euro. Welche der nachstehenden Aussagen ist falsch? a) Wenn P R und der zur Verfügung stehende Geldbetrag auf das Doppelte steigen, wird die Budgetmenge größer. b) Wenn P R auf das Doppelte steigt und P P, auf die Hälfte sinkt, bleibt die Budgetmenge unverändert.
3 c) Der relative Preis einer Pizza beträgt 2 Viertelliter Rotwein. d) Das Bündel (3P,4R) gehört zur Budgetmenge. e) Wenn beide Preise und der zur Verfügung stehende Geldbetrag auf das Doppelte steigen, bleibt die Budgetmenge unverändert. Aufgabe 5 - Wahr/Falsch Aufgabe Betrachten Sie einen Konsumenten, dessen Präferenzen monoton sind und dem ein fester Geldbetrag Y > 0 zur Verfügung steht, um den Konsum zweier Güter in den Mengen x 1 und x 2 zu finanzieren, deren positive Preise durch P 1 und P 2 gegeben sind. In der Ausgangslage frage der Konsument positive Mengen beider Güter nach. Prüfen Sie für jede der folgenden Aussagen, ob diese WAHR oder FALSCH ist: a) Wenn das erste Gut inferior ist, wirken Einkommens- und Substitutionseffekt bei einer Erhöhung von P 2 auf die Nachfrage x 1 in dieselbe Richtung. b) Wenn das zweite Gut inferior ist, wirken Einkommens- und Substitutionseffekt bei einer Erhöhung von P 2 auf die Nachfrage x 2 in entgegengesetzter Richtung. c) Wenn der Substitutionseffekt negativ ist, muß die Nachfrage x 1 bei einer Senkung von P 1 zunehmen. d) Wenn der Substitutionseffekt positiv ist, muß die Nachfrage x 2 bei einer Erhöhung von P 1 zunehmen. e) Wenn P 2 steigt und die Nachfrage x 1 zurückgeht, muß das erste Gut normal sein. f) Wenn P 1 steigt und die Nachfrage x 1 zurückgeht, muß das erste Gut normal sein. Aufgabe 6 - MC-Aufgabe Betrachten Sie eine Firma, die unter Einsatz von Arbeit (L) und Kapital (K) ein Gut produzieren kann. a) Wenn das Durchschnittsprodukt eines Faktors maximal wird, muß das zugehörige Grenzprodukt Null betragen. b) Wenn das Grenzprodukt des Faktors Arbeit sinkt, muß auch sein Durchschnittsprodukt abnehmen. c) Wenn an der Stelle (L=100, K=50) das Grenzprodukt jedes Faktors positiv ist, muß die Grenzrate der technischen Substitution positiv sein. d) Bei konstantem Kapitaleinsatz ist es für die Firma unmöglich, technisch effizient zu produzieren. e) Wenn das Durchschnittsprodukt des Faktors Arbeit größer als sein Grenzprodukt ist, muß das Grenzprodukt steigen. Aufgabe 7 - Wahr/Falsch Aufgabe Betrachten Sie eine Firma, die unter Einsatz von Arbeit und Kapital ein Gut herstellen kann. Die Faktorpreise seien konstant und unabhängig von den Entscheidungen der Firma. Prüfen Sie für jede der folgenden Aussagen, ob diese WAHR oder FALSCH ist. Die kurzfristigen Stückkosten der Firma a) steigen stets mit der Ausbringung, wenn das Grenzprodukt des variablen Faktors unter seinem Durchschnittsprodukt liegt. b) sinken stets mit der Ausbringung, wenn die Fixkosten kleiner sind als die variablen Kosten. c) steigen stets mit der Ausbringung, wenn das Durchschnittsprodukt des variablen Faktors sinkt. d) steigen stets mit der Ausbringung, wenn das Grenzprodukt des variablen Faktors sinkt. e) sinken stets mit der Ausbringung, wenn das Grenzprodukt des variablen Faktors über seinem Durchschnittsprodukt liegt. f) sind stets unabhängig von der eingesetzten Menge des fixen Faktors.
4 Aufgabe 8 - MC-Aufgabe Eine Firma produziere ein Gut unter Einsatz mehrerer Produktionsfaktoren. Die Faktorpreise seien konstant und unabhängig von den Entscheidungen der Firma. a) Die kurzfristigen Grenzkosten sind stets höher als die langfristigen Grenzkosten. b) Wenn die kurzfristigen über den langfristigen Stückkosten liegen, sind auch die kurzfristigen Grenzkosten größer als die langfristigen Grenzkosten. c) Die langfristigen Stückkosten sind stets höher als die kurzfristigen Stückkosten. d) Die kurzfristigen Stückkosten sind niemals niedriger als die langfristigen Stückkosten. e) Die kurzfristigen variablen Stückkosten sind niemals niedriger als die langfristigen Stückkosten. Aufgabe 9 - MC-Aufgabe Betrachten Sie die kurzfristige Angebotsentscheidung einer gewinnmaximierenden Firma auf einem Wettbewerbsmarkt, die zum herrschenden Preis P 0 eine positive Menge Q 0 anbietet. Welche der nachstehenden Aussagen ist falsch? a) Bei einer kleinen Erhöhung der Ausbringung sinken stets die durchschnittlichen Fixkosten. b) Bei einer kleinen Erhöhung der Ausbringung steigen stets die Grenzkosten und die variablen Stückkosten c) Bei einer kleinen Erhöhung der Ausbringung steigen stets die Grenzkosten und die Stückkosten. d) Wenn die Firma einen positiven Gewinn erzielt, fällt der Gewinn je Einheit bei der Ausbringung Q 0 nicht maximal aus. e) Der Preis Po deckt wenigstens die variablen Stückkosten. Aufgabe 10 - MC-Aufgabe Betrachten Sie die langfristige Angebotsentscheidung einer gewinnmaximierenden Firma auf einem Wettbewerbsmarkt, die zum herrschenden Preis P 0 eine positive Menge Q 0 anbietet. Dann gilt: a) Die kurzfristigen Stückkosten sind größer als die langfristigen Stückkosten. b) Bei dieser Ausbringung sind die langfristigen Stückkosten minimal. c) Durch eine Anpassung der Kapazität wäre es möglich, zu niedrigeren Stückkosten zu produzieren. d) Bei einer kleinen Erhöhung der Ausbringung steigen die kurzfristigen Stückkosten nicht stärker als die langfristigen Stückkosten. e) Die kurzfristigen Grenzkosten sind gleich den langfristigen Grenzkosten. Aufgabe 11 - Wahr/Falsch Aufgabe
5 Beantworten Sie die nächste Frage mit Bezug auf die Abbildung! Prüfen Sie für jede der folgenden Aussagen, ob diese WAHR oder FALSCH ist. Wenn der Staat auf einem Wettbewerbsmarkt einen Höchstpreis P2 festsetzt, a) sinken die Produktionskosten um E + G b) steigt die Konsumentenrente um B + D c) sinkt die Produzentenrente um B + D d) steigt die Konsumentenrente um B - C e) sinkt die Produzentenrente um B + D + E f) sinkt die gesellschaftliche Wohlfahrt um C + D + F Aufgabe 12 - MC-Aufgabe Eine Lösung im Lösungsbogen ankreuzen Ein gewinnmaximierender Monopolist bietet stets eine Menge an, bei welcher a) der Grenzerlös seinem durchschnittlichen Erlös entspricht b) die Grenzkosten den Stückkosten entsprechen. c) die Preisleastizität der Nachfrage betragsmäßig gleich Eins ist. d) der Preis gerade die Grenzkosten deckt. e) der Preis größer als die Grenzkosten ausfällt.
Klausur Mikroökonomik I. Wichtige Hinweise
 Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 1. Termin Sommersemester 2015 14.07.2015 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 1. Termin Sommersemester 2015 14.07.2015 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Mietinteressent A B C D E F G H Vorbehaltspreis a) Im Wettbewerbsgleichgewicht beträgt der Preis 250.
 Aufgabe 1 Auf einem Wohnungsmarkt werden 5 Wohnungen angeboten. Die folgende Tabelle gibt die Vorbehaltspreise der Mietinteressenten wieder: Mietinteressent A B C D E F G H Vorbehaltspreis 250 320 190
Aufgabe 1 Auf einem Wohnungsmarkt werden 5 Wohnungen angeboten. Die folgende Tabelle gibt die Vorbehaltspreise der Mietinteressenten wieder: Mietinteressent A B C D E F G H Vorbehaltspreis 250 320 190
Klausur Mikroökonomik I. Wichtige Hinweise
 Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 2. Termin Sommersemester 2014 22.09.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 2. Termin Sommersemester 2014 22.09.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Klausur Mikroökonomik I. Wichtige Hinweise
 Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 1. Termin Sommersemester 2014 18.07.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 1. Termin Sommersemester 2014 18.07.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Klausur AVWL 1. Klausurtermin: Ich studiere nach: Bachelor-Prüfungsordnung Diplom-Prüfungsordnung. Bitte beachten Sie:
 Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.07.2014 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.07.2014 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Teilklausur zur Vorlesung Grundlagen der Mikroökonomie Modul VWL I SS 2010,
 Name Matrikel-Nr.: Erreichbare Punkte: 37,5 Vorname Studiengang: Erreichte Punkte: Erstversuch 1. Wdhlg. 2.Wdhlg. Universität Rostock Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für VWL
Name Matrikel-Nr.: Erreichbare Punkte: 37,5 Vorname Studiengang: Erreichte Punkte: Erstversuch 1. Wdhlg. 2.Wdhlg. Universität Rostock Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für VWL
Probeklausur zur Mikroökonomik I
 Prof. Dr. Robert Schwager Sommersemester 2005 Probeklausur zur Mikroökonomik I 08. Juni 2005 Name: Matrikelnr.: Bei Multiple-Choice-Fragen sind die zutreffenden Aussagen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen.
Prof. Dr. Robert Schwager Sommersemester 2005 Probeklausur zur Mikroökonomik I 08. Juni 2005 Name: Matrikelnr.: Bei Multiple-Choice-Fragen sind die zutreffenden Aussagen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen.
Name: Matr.-Nr.: Sitzplatz-Nr.: Modulklausur im Grundstudium (Dipl.) und ersten Studienabschnitt (B.Sc.) (PO 2005, PO 2008) Mikroökonomik I
 Name: Matr.-Nr.: Sitzplatz-Nr.: Modulklausur im Grundstudium (Dipl.) und ersten Studienabschnitt (B.Sc.) (PO 2005, PO 2008) Mikroökonomik I Prof. Dr. P. Michaelis 26. Februar 2014 Dauer: 90 Minuten 5 Leistungspunkte
Name: Matr.-Nr.: Sitzplatz-Nr.: Modulklausur im Grundstudium (Dipl.) und ersten Studienabschnitt (B.Sc.) (PO 2005, PO 2008) Mikroökonomik I Prof. Dr. P. Michaelis 26. Februar 2014 Dauer: 90 Minuten 5 Leistungspunkte
Klausur Mikroökonomik
 Klausur Mikroökonomik Klausurtermin: 24.7.2017 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2:
Klausur Mikroökonomik Klausurtermin: 24.7.2017 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2:
Klausur AVWL 1. Klausurtermin:
 Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.02.2015 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.02.2015 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Klausur zu Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre VWL 1 (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Wintersemester 2006/07 2. Termin: 21.
 Klausur zu Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre VWL 1 (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Wintersemester 2006/07 2. Termin: 21. März 2007 Bearbeitungshinweise 1. Tragen Sie bitte auf jeder Seite
Klausur zu Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre VWL 1 (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Wintersemester 2006/07 2. Termin: 21. März 2007 Bearbeitungshinweise 1. Tragen Sie bitte auf jeder Seite
FB II Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Prof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum:
 Universität Lüneburg rüfer: rof. Dr. Thomas Wein FB II Wirtschafts- und Sozialwissenschaften rof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum: 22.03.06 Wiederholungsklausur Mikroökonomie
Universität Lüneburg rüfer: rof. Dr. Thomas Wein FB II Wirtschafts- und Sozialwissenschaften rof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum: 22.03.06 Wiederholungsklausur Mikroökonomie
VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 4
 Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2010 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 4 1. (a) Sind beide Inputfaktoren variabel, so ist die Kostenfunktion eines Unternehmens durch C(y) = y 2 /2 gegeben.
Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2010 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 4 1. (a) Sind beide Inputfaktoren variabel, so ist die Kostenfunktion eines Unternehmens durch C(y) = y 2 /2 gegeben.
Probeklausur zur Mikroökonomik II
 Prof. Dr. Robert Schwager Wintersemester 2004/2005 Probeklausur zur Mikroökonomik II 08. Dezember 2004 Name: Matrikelnr.: Bei Multiple-Choice-Fragen ist das zutreffende Kästchen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen.
Prof. Dr. Robert Schwager Wintersemester 2004/2005 Probeklausur zur Mikroökonomik II 08. Dezember 2004 Name: Matrikelnr.: Bei Multiple-Choice-Fragen ist das zutreffende Kästchen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen.
Name: Matr.-Nr.: Sitzplatz-Nr.: Modulklausur im Grundstudium (Dipl.) und ersten Studienabschnitt (B.Sc.) (PO 2005, PO 2008) Mikroökonomik I
 Name: Matr.-Nr.: Sitzplatz-Nr.: Modulklausur im Grundstudium (Dipl.) und ersten Studienabschnitt (B.Sc.) (PO 2005, PO 2008) Mikroökonomik I Prof. Dr. P. Michaelis 30. Juli 2014 Dauer: 90 Minuten 5 Leistungspunkte
Name: Matr.-Nr.: Sitzplatz-Nr.: Modulklausur im Grundstudium (Dipl.) und ersten Studienabschnitt (B.Sc.) (PO 2005, PO 2008) Mikroökonomik I Prof. Dr. P. Michaelis 30. Juli 2014 Dauer: 90 Minuten 5 Leistungspunkte
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05. Klausur Mikroökonomik. Matrikelnummer: Studiengang:
 Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Bitte bearbeiten Sie alle zehn
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Bitte bearbeiten Sie alle zehn
Quiz 2. Aufgabe 1. a) Das Angebot und die Nachfrage auf dem Markt für Turnschuhe sei durch folgende Funktionen gegeben:
 Aufgabe 1 a) as Angebot und die Nachfrage auf dem Markt für Turnschuhe sei durch folgende Funktionen gegeben: ( p) = 150 4 p S( p) = 2 p 30 wobei p der Preis für ein Paar Turnschuhe ist. Wie lautet der
Aufgabe 1 a) as Angebot und die Nachfrage auf dem Markt für Turnschuhe sei durch folgende Funktionen gegeben: ( p) = 150 4 p S( p) = 2 p 30 wobei p der Preis für ein Paar Turnschuhe ist. Wie lautet der
Bonus-/Probeklausur VWL I - Mikroökonomie 13. Dezember 2008
 PROF. DR. CLEMENS PUPPE VWL I - Mikroökonomie Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie (VWL I) Wintersemester 2008/2009 Bonus-/Probeklausur VWL I - Mikroökonomie 13. Dezember 2008 Name: Vorname: Matrikelnr.: Hinweise:
PROF. DR. CLEMENS PUPPE VWL I - Mikroökonomie Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie (VWL I) Wintersemester 2008/2009 Bonus-/Probeklausur VWL I - Mikroökonomie 13. Dezember 2008 Name: Vorname: Matrikelnr.: Hinweise:
Klausur Mikroökonomie I Diplom SS 06 Lösungen
 Universität Lüneburg Prüfer: Prof. Dr. Thomas Wein Fakultät II Prof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum: 17.7.2006 Klausur Mikroökonomie I Diplom SS 06 Lösungen 1. Eine neue Erfindung
Universität Lüneburg Prüfer: Prof. Dr. Thomas Wein Fakultät II Prof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum: 17.7.2006 Klausur Mikroökonomie I Diplom SS 06 Lösungen 1. Eine neue Erfindung
Die kurzfristigen Kosten eines Unternehmens (Euro)
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 24 Übersicht Kosten in der
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 24 Übersicht Kosten in der
Klausur: Mikroökonomik A Wintersemester 2010/ Termin
 Mikroökonomik A, Wintersemester 2010/2011 Dr. Stefan Behringer/Dr. Alexander Westkamp Klausur 2. Termin 29.03.2011 Klausur: Mikroökonomik A Wintersemester 2010/2011 2. Termin In dieser Klausur können insgesamt
Mikroökonomik A, Wintersemester 2010/2011 Dr. Stefan Behringer/Dr. Alexander Westkamp Klausur 2. Termin 29.03.2011 Klausur: Mikroökonomik A Wintersemester 2010/2011 2. Termin In dieser Klausur können insgesamt
a) Die Kurve der variablen Durchschnittskosten schneidet die Kurve der totalen Durchschnittskosten in deren Minimum.
 Aufgabe 1 Ein Unternehmen hat positive Fixkosten sowie U-förmige variable Durchschnittskosten AV C(y) und U-förmige totale Durchschnittskosten AC(y). Die Grenzkostenfunktion wird mit M C(y), der Marktpreis
Aufgabe 1 Ein Unternehmen hat positive Fixkosten sowie U-förmige variable Durchschnittskosten AV C(y) und U-förmige totale Durchschnittskosten AC(y). Die Grenzkostenfunktion wird mit M C(y), der Marktpreis
Nachschreibeklausur A Mikroökonomische Theorie I WS 2007/08
 Nachschreibeklausur A Mikroökonomische Theorie I WS 2007/08 Bitte sofort deutlich lesbar eintragen! Matrikelnummer: Platznummer: Prüfer: Prof. Dr. G. Götz Datum: Montag, 05. Mai 2008 Zeit: 18.00 19.30
Nachschreibeklausur A Mikroökonomische Theorie I WS 2007/08 Bitte sofort deutlich lesbar eintragen! Matrikelnummer: Platznummer: Prüfer: Prof. Dr. G. Götz Datum: Montag, 05. Mai 2008 Zeit: 18.00 19.30
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte ( )
 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte (239.255) SS 2008 LVA-Leiter: Andrea Kollmann Einheit 5: Kapitel 4.3-4.4, 6 Administratives Fragen zum IK??? Fragen zum Kurs??? Die Marktnachfrage Die Marktnachfragekurve
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte (239.255) SS 2008 LVA-Leiter: Andrea Kollmann Einheit 5: Kapitel 4.3-4.4, 6 Administratives Fragen zum IK??? Fragen zum Kurs??? Die Marktnachfrage Die Marktnachfragekurve
Übung 3: Unternehmenstheorie
 Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics HS 11 Unternehmenstheorie 1 / 42 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics HS 11 Unternehmenstheorie 1 / 42 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
VWL IV-Klausur zur Veranstaltung Einführung in die Finanzwissenschaft
 VWL IV-Klausur zur Veranstaltung Einführung in die Finanzwissenschaft Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock Lehrstuhl für Finanzwissenschaft Prof. Dr. Robert Fenge Sommersemester
VWL IV-Klausur zur Veranstaltung Einführung in die Finanzwissenschaft Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock Lehrstuhl für Finanzwissenschaft Prof. Dr. Robert Fenge Sommersemester
Klausur AVWL 1. Klausurtermin: Ich studiere nach: Bachelor-Prüfungsordnung Diplom-Prüfungsordnung. Bitte beachten Sie:
 Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 29.09.2014 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 29.09.2014 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Zusammenfassung und Prüfungshinweise zu Abschnitten 2 bis 4
 Zusammenfassung und Prüfungshinweise zu Abschnitten 2 bis 4 Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Mikroökonomie (FS 09) Zusammenfassung 1 / 18 2. Angebot 2.1 Produktionsfunktionen
Zusammenfassung und Prüfungshinweise zu Abschnitten 2 bis 4 Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Mikroökonomie (FS 09) Zusammenfassung 1 / 18 2. Angebot 2.1 Produktionsfunktionen
Intermediate Microeconomics Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 4
 Georg Nöldeke Herbstsemester 2013 Intermediate Microeconomics Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 4 1. Bei p = 20 wird die Menge q = 40 nachgefragt. Da die Marktnachfragefunktion linear ist, entspricht die
Georg Nöldeke Herbstsemester 2013 Intermediate Microeconomics Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 4 1. Bei p = 20 wird die Menge q = 40 nachgefragt. Da die Marktnachfragefunktion linear ist, entspricht die
Zwischenklausur 2006 VWL C. Gruppe B
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Zwischenklausur 006 VWL C Gruppe B Name, Vorname: Fakultät: Matrikelnummer Prüfer: Datum: Anleitung Die Klausur besteht aus
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Zwischenklausur 006 VWL C Gruppe B Name, Vorname: Fakultät: Matrikelnummer Prüfer: Datum: Anleitung Die Klausur besteht aus
Modul "Grundlagen der Finanzwissenschaft und internationale Wirtschaft" Klausur zu Veranstaltung
 Modul "Grundlagen der Finanzwissenschaft und internationale Wirtschaft" Klausur zu Veranstaltung Grundlagen Finanzwissenschaft Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock
Modul "Grundlagen der Finanzwissenschaft und internationale Wirtschaft" Klausur zu Veranstaltung Grundlagen Finanzwissenschaft Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2006/07. Klausur Mikroökonomik. Matrikelnummer: Studiengang:
 Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2006/07 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2006/07 Klausur Mikroökonomik Bitte bearbeiten Sie alle acht
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2006/07 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2006/07 Klausur Mikroökonomik Bitte bearbeiten Sie alle acht
Studiengang (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Sommersemester 2006 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang (Zutreffendes bitte ankreuzen): SozÖk Sozma AÖ WiPäd Wiwi Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Sommersemester 2006 Klausur
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Sommersemester 2006 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang (Zutreffendes bitte ankreuzen): SozÖk Sozma AÖ WiPäd Wiwi Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Sommersemester 2006 Klausur
sie entspricht dem Verhältnis von Input zu Output sie entspricht der Grenzrate der Substitution die Steigung einer Isoquante liegt stets bei 1
 20 Brückenkurs 3. Welche drei Produktionsfunktionen sollten Sie kennen?, und Produktionsfunktion 4. Was ist eine Isoquante? alle Kombinationen von Inputmengen, die den gleichen Output erzeugen sie entspricht
20 Brückenkurs 3. Welche drei Produktionsfunktionen sollten Sie kennen?, und Produktionsfunktion 4. Was ist eine Isoquante? alle Kombinationen von Inputmengen, die den gleichen Output erzeugen sie entspricht
Matr.-Nr. Name: Klausur : VWL A (Mikroökonomische Theorie) (5021) Semester:Sommersemester 2001
 Matr-Nr Name: Klausur : VWL A (Mikroökonomische Theorie) (50) Prüfer: PD Dr Schwager Semester:Sommersemester 00 Es sind keine Hilfsmittel zugelassen! Die Klausur enthält 50 Aufgaben Bitte überprüfen Sie,
Matr-Nr Name: Klausur : VWL A (Mikroökonomische Theorie) (50) Prüfer: PD Dr Schwager Semester:Sommersemester 00 Es sind keine Hilfsmittel zugelassen! Die Klausur enthält 50 Aufgaben Bitte überprüfen Sie,
Lösungsskizze zur Probeklausur Einführung in die Mikroökonomie
 Lösungsskizze zur Probeklausur Einführung in die Mikroökonomie Prof. Dr. Dennis A. V. Dittrich, Universität Erfurt Aufgaben 1. Ein Konsument habe die Nutzenfunktion U(x, y) = x + y. Der Preis von x ist
Lösungsskizze zur Probeklausur Einführung in die Mikroökonomie Prof. Dr. Dennis A. V. Dittrich, Universität Erfurt Aufgaben 1. Ein Konsument habe die Nutzenfunktion U(x, y) = x + y. Der Preis von x ist
Unternehmen und Angebot
 Unternehmen und Angebot Das Angebot der Unternehmen Private Unternehmen produzieren die Güter und verkaufen sie. Marktwirtschaftliche Unternehmen in der Schweiz 21 Unternehmen Beschäftigte Industrie &
Unternehmen und Angebot Das Angebot der Unternehmen Private Unternehmen produzieren die Güter und verkaufen sie. Marktwirtschaftliche Unternehmen in der Schweiz 21 Unternehmen Beschäftigte Industrie &
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2017 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2017 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 5
 Georg Nöldeke Frühjahrssemester 010 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 5 1. Zur Erinnerung: Der gewinnmaximierende Preis ist im Fall konstanter Grenzkosten in der Höhe von c durch die
Georg Nöldeke Frühjahrssemester 010 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 5 1. Zur Erinnerung: Der gewinnmaximierende Preis ist im Fall konstanter Grenzkosten in der Höhe von c durch die
Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit. Lösung zu der Aufgabensammlung. Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung III
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung III Aufgabe 1 Erklären (begründen) Sie, weshalb ein Konsument bei gegebenem
Thema Dokumentart Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung III Aufgabe 1 Erklären (begründen) Sie, weshalb ein Konsument bei gegebenem
Mikroökonomik II Wintersemester 2004/05
 Prof. Dr. Robert Schwager Georg-August-Universität Göttingen Volkswirtschaftliches Seminar Mikroökonomik II Wintersemester 2004/05 Mikroökonomik I: Einzelwirtschaftliche Entscheidungen Entscheidungen einzelner
Prof. Dr. Robert Schwager Georg-August-Universität Göttingen Volkswirtschaftliches Seminar Mikroökonomik II Wintersemester 2004/05 Mikroökonomik I: Einzelwirtschaftliche Entscheidungen Entscheidungen einzelner
Probeklausur zur Mikroökonomik I
 Prof. Dr. Robert Schwager Sommersemester 2004 Probeklausur zur Mikroökonomik I 09. Juni 2004 Name/Kennwort: Bei Multiple-Choice-Fragen ist das zutreffende Kästchen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen. Für eine
Prof. Dr. Robert Schwager Sommersemester 2004 Probeklausur zur Mikroökonomik I 09. Juni 2004 Name/Kennwort: Bei Multiple-Choice-Fragen ist das zutreffende Kästchen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen. Für eine
Übung 4: Gleichgewicht und Effizienz
 Übung 4: Gleichgewicht und Effizienz Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Mikroökonomie Übung 4 (FS 10) Gleichgewicht und Effizienz 1 / 25 Aufgabe 1 Worum geht es? Marktangebotsfunktion
Übung 4: Gleichgewicht und Effizienz Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Mikroökonomie Übung 4 (FS 10) Gleichgewicht und Effizienz 1 / 25 Aufgabe 1 Worum geht es? Marktangebotsfunktion
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Fragen Teil 4 Studiengruppen HA105 HA106 HA200 Prof. Dr. Heinz Grimm WS 2015/16
 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Fragen Teil 4 Studiengruppen HA105 HA106 HA200 Prof. Dr. Heinz Grimm WS 2015/16 Fragen Aufgabe 1: a) Was versteht man unter der Produzentenrente? b) Was versteht man
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Fragen Teil 4 Studiengruppen HA105 HA106 HA200 Prof. Dr. Heinz Grimm WS 2015/16 Fragen Aufgabe 1: a) Was versteht man unter der Produzentenrente? b) Was versteht man
Teilklausur zur Vorlesung Grundlagen der Mikroökonomie Modul VWL I WS 2009/2010,
 Name Matrikel-Nr.: Erreichbare Punkte: 37,5 Vorname Studiengang: Erreichte Punkte: Erstversuch 1. Wdhlg. 2.Wdhlg. Universität Rostock Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für VWL
Name Matrikel-Nr.: Erreichbare Punkte: 37,5 Vorname Studiengang: Erreichte Punkte: Erstversuch 1. Wdhlg. 2.Wdhlg. Universität Rostock Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für VWL
Intermediate Microeconomics Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 5
 Georg Nöldeke Herbstsemester 203 Intermediate Microeconomics Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 5. Hinweis: Der gewinnmaximierende Preis ist im Fall konstanter Grenzkosten in der Höhe von c nach der inversen
Georg Nöldeke Herbstsemester 203 Intermediate Microeconomics Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 5. Hinweis: Der gewinnmaximierende Preis ist im Fall konstanter Grenzkosten in der Höhe von c nach der inversen
Zusammenfassung der Vorlesung und Globalübung Mikroökonomie 2017
 Zusammenfassung der Vorlesung und Globalübung Mikroökonomie 2017 Die Durchnummerierung der Kapitel und Unterkapitel bezieht sich auf das Textbuch Grundzüge der Mikroökonomik von Hal R. Varian, 9. Auflage.
Zusammenfassung der Vorlesung und Globalübung Mikroökonomie 2017 Die Durchnummerierung der Kapitel und Unterkapitel bezieht sich auf das Textbuch Grundzüge der Mikroökonomik von Hal R. Varian, 9. Auflage.
Mikro I Definitionen
 Mikro I: Definitionen Kapitel 2: Grundlage von Angebot und Nachfrage Die Angebotskurve stellt dar, welche Menge eines Gutes die Produzenten zu einem bestimmten Preis zu verkaufen bereit sind, wobei andere
Mikro I: Definitionen Kapitel 2: Grundlage von Angebot und Nachfrage Die Angebotskurve stellt dar, welche Menge eines Gutes die Produzenten zu einem bestimmten Preis zu verkaufen bereit sind, wobei andere
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre ( )
 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (175.067) Wiederholung Vollständige Konkurrenz (Ch.11) Definition von vollständiger Konkurrenz Marktnachfragekurve vs. Nachfragekurve
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (175.067) Wiederholung Vollständige Konkurrenz (Ch.11) Definition von vollständiger Konkurrenz Marktnachfragekurve vs. Nachfragekurve
Einführung in die Mikroökonomie
 Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben 1. Folgende Tabelle gibt die Outputmenge Q in Abhängigkeit von der Anzahl der eingesetzten Arbeiter L an. L 0 1 2 3 4 5 6 Q 0 20 50 90 125 140 150 a) Wie
Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben 1. Folgende Tabelle gibt die Outputmenge Q in Abhängigkeit von der Anzahl der eingesetzten Arbeiter L an. L 0 1 2 3 4 5 6 Q 0 20 50 90 125 140 150 a) Wie
Einführung in die Mikroökonomie
 Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben (6) 1. Erklären Sie jeweils den Unterschied zwischen den folgenden Begriffen: eine Preis-Konsumkurve und eine Nachfragekurve Eine Preis-Konsumkurve bestimmt
Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben (6) 1. Erklären Sie jeweils den Unterschied zwischen den folgenden Begriffen: eine Preis-Konsumkurve und eine Nachfragekurve Eine Preis-Konsumkurve bestimmt
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2005/06. Klausur Mikroökonomik. Matrikelnummer: Studiengang:
 Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2005/06 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2005/06 Klausur Mikroökonomik I Bitte bearbeiten Sie alle acht
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2005/06 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2005/06 Klausur Mikroökonomik I Bitte bearbeiten Sie alle acht
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 6: Die Produktion (Kapitel 6) Einheit 6-1 - Theorie der Firma - I In den letzten beiden Kapiteln: Genaue Betrachtung der Konsumenten (Nachfrageseite). Nun: Genaue Betrachtung
LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 6: Die Produktion (Kapitel 6) Einheit 6-1 - Theorie der Firma - I In den letzten beiden Kapiteln: Genaue Betrachtung der Konsumenten (Nachfrageseite). Nun: Genaue Betrachtung
VO Grundlagen der Mikroökonomie
 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot (Kapitel 8) ZIEL: Vollkommene Wettbewerbsmärkte Die Gewinnmaximierung Grenzerlös,
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot (Kapitel 8) ZIEL: Vollkommene Wettbewerbsmärkte Die Gewinnmaximierung Grenzerlös,
Mikroökonomie: Angebotstheorie. Lösungen zu Aufgabensammlung. Angebotstheorie: Aufgabensammlung I
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: Angebotstheorie Lösungen zu Aufgabensammlung LÖSUNGEN Angebotstheorie: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Was besagt das Ertragsgesetz? Bei zunehmendem Einsatz von einem
Thema Dokumentart Mikroökonomie: Angebotstheorie Lösungen zu Aufgabensammlung LÖSUNGEN Angebotstheorie: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Was besagt das Ertragsgesetz? Bei zunehmendem Einsatz von einem
Übung 4: Gleichgewicht und Effizienz in Wettbewerbsmärkten
 Übung 4: Gleichgewicht und Effizienz in Wettbewerbsmärkten Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics (HS 10) Übung 4 1 / 35 Marktnachfrage und aggregierte
Übung 4: Gleichgewicht und Effizienz in Wettbewerbsmärkten Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics (HS 10) Übung 4 1 / 35 Marktnachfrage und aggregierte
Mikroökonomie: 1. Semester Vollzeit. Lösung zu der Aufgabensammlung. Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung I
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: 1. Semester Vollzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 Bezeichnen Sie die richtigen Aussagen. Das Menschenbild des
Thema Dokumentart Mikroökonomie: 1. Semester Vollzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 Bezeichnen Sie die richtigen Aussagen. Das Menschenbild des
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2016/17 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2016/17 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Klausur zu Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre VWL 1 (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Wintersemester 2006/07 1. Termin: 5.
 Klausur zu Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre VWL 1 (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Wintersemester 2006/07 1. Termin: 5. Februar 2007 Bearbeitungshinweise 1. Tragen Sie bitte auf jeder Seite
Klausur zu Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre VWL 1 (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Wintersemester 2006/07 1. Termin: 5. Februar 2007 Bearbeitungshinweise 1. Tragen Sie bitte auf jeder Seite
Die Produktion eines bestimmten Outputs zu minimalen Kosten
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 20 Übersicht Die Kostenfunktion
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 20 Übersicht Die Kostenfunktion
Abschlußklausur im Fach Grundzüge der Mikroökonomik Studienjahr 2005/2006
 Dr. Werner Klein Januar 2006 St. Kliment-Ohridski-Universität Sofia Universität zu Köln Staatswissenschaftliches Seminar Abschlußklausur im Fach Grundzüge der Mikroökonomik Studienjahr 2005/2006 Diese
Dr. Werner Klein Januar 2006 St. Kliment-Ohridski-Universität Sofia Universität zu Köln Staatswissenschaftliches Seminar Abschlußklausur im Fach Grundzüge der Mikroökonomik Studienjahr 2005/2006 Diese
Mikro I, WS 2013/14. Quiz
 Mikro I, WS 2013/14 Quiz 3 18.12.2013 08.01.2014 Bitte beachten Sie bei den Multiple Choice Aufgaben: Es können bei jeder Aufgabe eine oder mehrere Aussagen richtig sein. Sie erhalten die volle Punktzahl
Mikro I, WS 2013/14 Quiz 3 18.12.2013 08.01.2014 Bitte beachten Sie bei den Multiple Choice Aufgaben: Es können bei jeder Aufgabe eine oder mehrere Aussagen richtig sein. Sie erhalten die volle Punktzahl
Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner, Lineal/Geodreieck, Stifte Bearbeitungszeit: 120 Minuten
 1 Name / Vorname: Matrikelnummer: Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner, Lineal/Geodreieck, Stifte Bearbeitungszeit: 120 Minuten Sofern nicht anders angegeben, runden Sie Ihre Ergebnisse auf
1 Name / Vorname: Matrikelnummer: Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner, Lineal/Geodreieck, Stifte Bearbeitungszeit: 120 Minuten Sofern nicht anders angegeben, runden Sie Ihre Ergebnisse auf
Kosten. Vorlesung Mikroökonomik Marktangebot. Preis. Menge / Zeit. Bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr an?
 Kosten Vorlesung Mikroökonomik 22.11.24 Marktangebot Preis Bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr an? Angebot 1 Oder können die Unternehmen den Preis bei grösserer Produktion senken? Angebot 2
Kosten Vorlesung Mikroökonomik 22.11.24 Marktangebot Preis Bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr an? Angebot 1 Oder können die Unternehmen den Preis bei grösserer Produktion senken? Angebot 2
Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit. Lösung zu der Aufgabensammlung. Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung II
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung II Aufgabe 1 Maschinen (in Stück) 700 600 490 A F 280 B 200 100 10 20
Thema Dokumentart Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung II Aufgabe 1 Maschinen (in Stück) 700 600 490 A F 280 B 200 100 10 20
Ceteris Paribus Der lateinische Ausdruck für andere Dinge gleichbleibend wird als Erinnerung daran verwendet, daß alle anderen als die gerade untersuc
 Definitionen Angebotskurve Ein Graph für die Zuordnungen von Güterpreisen und Angebotsmengen. Quelle: Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1999, Seite 80 Angebotsüberschuß Eine Situation,
Definitionen Angebotskurve Ein Graph für die Zuordnungen von Güterpreisen und Angebotsmengen. Quelle: Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1999, Seite 80 Angebotsüberschuß Eine Situation,
Klausur Mikroökonomik II. Wichtige Hinweise
 Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik II 1. Termin Wintersemester 2013/14 07.02.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte
Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik II 1. Termin Wintersemester 2013/14 07.02.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2015/16 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2015/16 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot
 Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Winter 1 /
Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Winter 1 /
Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot
 Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Winter 1 /
Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Winter 1 /
Klausur Wintersemester Einführung in die Volkswirtschaftslehre (1 1012) Gruppe A
 Otto-von-Guerick-Universität Magdeburg Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur Wintersemester 200612007 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (1 1012) Gruppe A Name, Vorname: Matri kelnummer : Studiengang:
Otto-von-Guerick-Universität Magdeburg Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur Wintersemester 200612007 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (1 1012) Gruppe A Name, Vorname: Matri kelnummer : Studiengang:
Teilklausur zur Vorlesung Grundlagen der Mikroökonomie Modul VWL I WS 2008/09,
 Name Matrikel-Nr.: Erreichbare Punkte: 37,5 Vorname Studiengang: Erreichte Punkte: Erstversuch 1. Wdhlg. 2.Wdhlg. Universität Rostock Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für VWL
Name Matrikel-Nr.: Erreichbare Punkte: 37,5 Vorname Studiengang: Erreichte Punkte: Erstversuch 1. Wdhlg. 2.Wdhlg. Universität Rostock Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für VWL
Mikroökonomie Preisbildung unter vollkommener Konkurrenz Teil 1
 Fernstudium Guide Mikroökonomie Preisbildung unter vollkommener Konkurrenz Teil 1 (Theorie der Marktwirtschaft) Version vom 01.09.2016 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Fernstudium Guide Mikroökonomie Preisbildung unter vollkommener Konkurrenz Teil 1 (Theorie der Marktwirtschaft) Version vom 01.09.2016 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
F E R N U N I V E R S I T Ä T
 Matrikelnummer Name: Vorname: F E R N U N I V E R S I T Ä T Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Modul 3171 Markt und Staat (6 SWS) 1.03.01, 9.00 11.00 Uhr Gesamtpunktzahl: Datum: Note: Unterschrift
Matrikelnummer Name: Vorname: F E R N U N I V E R S I T Ä T Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Modul 3171 Markt und Staat (6 SWS) 1.03.01, 9.00 11.00 Uhr Gesamtpunktzahl: Datum: Note: Unterschrift
UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN
 Art der Prüfung: Kurzklausur für Lehramtsstudierende Termin: Sommersemester 2008 Nachtermin Studiengang: Studierende auf Lehramt, die eine erfolgreiche Teilnahme benötigen; Lehramt Sowi GHR; Lehramt Sowi
Art der Prüfung: Kurzklausur für Lehramtsstudierende Termin: Sommersemester 2008 Nachtermin Studiengang: Studierende auf Lehramt, die eine erfolgreiche Teilnahme benötigen; Lehramt Sowi GHR; Lehramt Sowi
U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r. Prüfungsausschuss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät K L A U S U R A R B E I T
 U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r Prüfungsausschuss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät K L A U S U R A R B E I T im Rahmen der Bachelorprüfung im Studiengang Wirtschaftswissenschaft nach PrO
U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r Prüfungsausschuss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät K L A U S U R A R B E I T im Rahmen der Bachelorprüfung im Studiengang Wirtschaftswissenschaft nach PrO
Klausur zur Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre - VWL I (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Sommersemester Termin: 14.
 Klausur zur Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre - VWL I (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Sommersemester 2003-1. Termin: 14. Juli 2003 Bearbeitungshinweise Tragen Sie bitte zuerst in der Kopfzeile
Klausur zur Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre - VWL I (Prof. Dr. Thomas Straubhaar) Sommersemester 2003-1. Termin: 14. Juli 2003 Bearbeitungshinweise Tragen Sie bitte zuerst in der Kopfzeile
Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang. Aufgabenblatt 5 (KW 46)
 Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang Aufgabenblatt 5 (KW 46) Aufgabe 1: Cournot Wettbewerb (32 Punkte) Man betrachtet einen Markt, auf dem Cournot Wettbewerb stattfindet.
Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang Aufgabenblatt 5 (KW 46) Aufgabe 1: Cournot Wettbewerb (32 Punkte) Man betrachtet einen Markt, auf dem Cournot Wettbewerb stattfindet.
Übung 3: Unternehmenstheorie
 Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics (HS 10) Unternehmenstheorie 1 / 49 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics (HS 10) Unternehmenstheorie 1 / 49 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Finanzwissenschaft Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2012 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Finanzwissenschaft Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2012 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
13. Monopol. Auf dem Markt gibt es nur einen Anbieter. Der Monopolist kann den Marktpreis beeinflussen.
 3. Monool Auf dem Markt gibt es nur einen Anbieter. Der Monoolist kann den Marktreis beeinflussen. Beschränkungen des Monoolisten bei der Gewinnmaimierung technologische Beschränkungen (Kostenfunktion
3. Monool Auf dem Markt gibt es nur einen Anbieter. Der Monoolist kann den Marktreis beeinflussen. Beschränkungen des Monoolisten bei der Gewinnmaimierung technologische Beschränkungen (Kostenfunktion
Das Angebot im Wettbewerbsmarkt
 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Das Angebot im Wettbewerbsmarkt (Kapitel 8) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 27 Produktionstheorie und Gewinnmaximierung Gewinnfunktion
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Das Angebot im Wettbewerbsmarkt (Kapitel 8) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 27 Produktionstheorie und Gewinnmaximierung Gewinnfunktion
Übungsbeispiele für die Klausur Teil II
 Übungsbeispiele für die Klausur Teil II Beispiel 15: Die Produktionstechnologie eines Digitalkameraherstellers sei durch die folgende Tabelle charakterisiert. K bezeichnet den Kapitaleinsatz, L den Arbeitskräfteeinsatz,
Übungsbeispiele für die Klausur Teil II Beispiel 15: Die Produktionstechnologie eines Digitalkameraherstellers sei durch die folgende Tabelle charakterisiert. K bezeichnet den Kapitaleinsatz, L den Arbeitskräfteeinsatz,
Klausur zur Vorlesung Mikroökonomische Theorie I. Bitte sofort deutlich lesbar eintragen! Prüfer: Prof. Dr. G. Götz Datum: 12.
 Klausur zur Vorlesung Mikroökonomische Theorie I Bitte sofort deutlich lesbar eintragen! Platznummer: Prüfer: Prof. Dr. G. Götz Datum: 12. Mai 2010 Zeit: 08:00 10:00 Hilfsmittel: nichtprogr. Taschenrechner
Klausur zur Vorlesung Mikroökonomische Theorie I Bitte sofort deutlich lesbar eintragen! Platznummer: Prüfer: Prof. Dr. G. Götz Datum: 12. Mai 2010 Zeit: 08:00 10:00 Hilfsmittel: nichtprogr. Taschenrechner
Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R
 Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R Bachelor-Modulprüfung 2010/I Einführung in die Volkswirtschaftslehre Prof. Dr. Peter Bofinger
Bitte tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein: Bitte tragen Sie hier Ihre Sitzplatznummer ein: K L A U S U R Bachelor-Modulprüfung 2010/I Einführung in die Volkswirtschaftslehre Prof. Dr. Peter Bofinger
Mikroökonomie I Kapitel 7 Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot WS 2004/2005
 Mikroökonomie I Kapitel 7 Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Vollkommene Wettbewerbsmärkte Die Gewinnmaximierung Grenzerlös, Grenzkosten und die Gewinnmaximierung
Mikroökonomie I Kapitel 7 Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Vollkommene Wettbewerbsmärkte Die Gewinnmaximierung Grenzerlös, Grenzkosten und die Gewinnmaximierung
3. Unternehmenstheorie
 3. Unternehmenstheorie Georg Nöldeke WWZ, Universität Basel Intermediate Microeconomics, HS 11 Unternehmenstheorie 1/97 2 / 97 3.1 Einleitung Als Ziel eines Unternehmens wird die Gewinnmaximierung unterstellt.
3. Unternehmenstheorie Georg Nöldeke WWZ, Universität Basel Intermediate Microeconomics, HS 11 Unternehmenstheorie 1/97 2 / 97 3.1 Einleitung Als Ziel eines Unternehmens wird die Gewinnmaximierung unterstellt.
Mikroökonomie I Kapitel 4 Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage WS 2004/2005
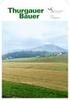 Mikroökonomie I Kapitel 4 Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Die individuelle Nachfrage Einkommens- und Substitutionseffekte Die Marktnachfrage Die
Mikroökonomie I Kapitel 4 Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Die individuelle Nachfrage Einkommens- und Substitutionseffekte Die Marktnachfrage Die
VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 2
 Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2009 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 2 1. (a) Die Grenzprodukte der Produktionsfaktoren sind: MP 1 (x 1, x 2 ) = f(x 1, x 2 ) x 1 MP 2 (x 1, x 2 )
Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2009 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 2 1. (a) Die Grenzprodukte der Produktionsfaktoren sind: MP 1 (x 1, x 2 ) = f(x 1, x 2 ) x 1 MP 2 (x 1, x 2 )
F E R N U N I V E R S I T Ä T
 Matrikelnummer Name: Vorname: F E R N U N I V E R S I T Ä T Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Modul 3171 Markt und Staat (6 SWS) Termin: 1.9.11, 9. 11. Uhr Aufgabe 1 3 Summe Max. Punktzahl
Matrikelnummer Name: Vorname: F E R N U N I V E R S I T Ä T Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Modul 3171 Markt und Staat (6 SWS) Termin: 1.9.11, 9. 11. Uhr Aufgabe 1 3 Summe Max. Punktzahl
VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 1
 Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2009 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt Siehe Abbildung x 2 m p = 25 2 Budgetgerade: { xpx + px 2 2 = m} Budgetmenge: { xpx + px 2 2 m} 0 0 m p = 20 x
Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2009 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt Siehe Abbildung x 2 m p = 25 2 Budgetgerade: { xpx + px 2 2 = m} Budgetmenge: { xpx + px 2 2 m} 0 0 m p = 20 x
Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm.
 Klausuraufgaben für das Mikro 1 Tutorium Sitzung 1 WS 03/04 Aufgabe 1 Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm. WS 04/05 Aufgabe
Klausuraufgaben für das Mikro 1 Tutorium Sitzung 1 WS 03/04 Aufgabe 1 Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm. WS 04/05 Aufgabe
Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung II
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit Aufgabensammlung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung II Aufgabe 1 Maschinen (in Stück) 700 600 490 A F 280 B 200 100 10 20 25 35 40 Spielfilme (in
Thema Dokumentart Mikroökonomie: 2. Semester Teilzeit Aufgabensammlung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung II Aufgabe 1 Maschinen (in Stück) 700 600 490 A F 280 B 200 100 10 20 25 35 40 Spielfilme (in
Veranstaltung VWL I für Bauingenieure an der FH Darmstadt im WS 2005/06 (Dr. Faik) Klausur
 Veranstaltung VWL I für Bauingenieure an der FH Darmstadt im WS 2005/06 (Dr. Faik) Klausur 09.02.2006 BEARBEITER/IN (NAME, VORNAME): MATRIKELNUMMER: Hinweise: Sie haben zur Bearbeitung der Klausur insgesamt
Veranstaltung VWL I für Bauingenieure an der FH Darmstadt im WS 2005/06 (Dr. Faik) Klausur 09.02.2006 BEARBEITER/IN (NAME, VORNAME): MATRIKELNUMMER: Hinweise: Sie haben zur Bearbeitung der Klausur insgesamt
Teil IV: Abweichungen vom Wettbewerbsmarkt und Marktversagen
 Teil IV: Abweichungen vom Wettbewerbsmarkt und Marktversagen 1 Kapitel 11: Monopol Hauptidee: Ein Unternehmen mit Marktmacht nimmt den Marktpreis nicht als gegeben hin. Es maximiert seinen Gewinn indem
Teil IV: Abweichungen vom Wettbewerbsmarkt und Marktversagen 1 Kapitel 11: Monopol Hauptidee: Ein Unternehmen mit Marktmacht nimmt den Marktpreis nicht als gegeben hin. Es maximiert seinen Gewinn indem
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte
 LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 6: Produktionstheorie (Kapitel 6 & 7) Haushaltstheorie versus Produktionstheorie Die Haushaltstheorie beschäftigt sich mit der Konsumentscheidung der Haushalte.
LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 6: Produktionstheorie (Kapitel 6 & 7) Haushaltstheorie versus Produktionstheorie Die Haushaltstheorie beschäftigt sich mit der Konsumentscheidung der Haushalte.
Teilprüfung Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Finanzwissenschaft Prof. Dr. Florian Herold/Dr. Felix Stübben Teilprüfung Einführung in die VWL im WS 2011/12 HINWEIS: Es sind
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Finanzwissenschaft Prof. Dr. Florian Herold/Dr. Felix Stübben Teilprüfung Einführung in die VWL im WS 2011/12 HINWEIS: Es sind
F E R N U N I V E R S I T Ä T
 Matrikelnummer Name: Vorname: F E R N U N I V E R S I T Ä T Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Modul 3171 Markt und Staat (6 SWS) Termin: 19.03.014, 9.00 11.00 Uhr Aufgabe 1 3 Summe Max. Punktzahl
Matrikelnummer Name: Vorname: F E R N U N I V E R S I T Ä T Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Modul 3171 Markt und Staat (6 SWS) Termin: 19.03.014, 9.00 11.00 Uhr Aufgabe 1 3 Summe Max. Punktzahl
Bedeutung. Formel. Budgetbeschränkung: Die Ausgaben für die Güter dürfen das Einkommen. p 1 x 1 + p 2 x 2 m
 Formel p 1 x 1 + p 2 x 2 m p 1 x 1 + p 2 x 2 p 1 ω 1 + p 2 ω 2 OC = dx 2 = p 1 p 2 (x 1,x 2 ) % (y 1,y 2 ) Bedeutung Budgetbeschränkung: Die Ausgaben für die Güter dürfen das Einkommen nicht übersteigen.
Formel p 1 x 1 + p 2 x 2 m p 1 x 1 + p 2 x 2 p 1 ω 1 + p 2 ω 2 OC = dx 2 = p 1 p 2 (x 1,x 2 ) % (y 1,y 2 ) Bedeutung Budgetbeschränkung: Die Ausgaben für die Güter dürfen das Einkommen nicht übersteigen.
Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot
 Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Winter 1 /
Einführung in die Mikroökonomie Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot Winter 1 /
