Brennstoffzellenheizung - die Zukunft im Gebäudebestand?
|
|
|
- Linda Fried
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Brennstoffzellenheizung die Zukunft im Gebäudebestand? SRH Hamm Sebastian Hund, Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeiten Prof. Dr. Claus Wilke Wintersemester 2017/18
2 1. Einleitung S.3 2. Brennstoffzellenheizgeräte die technologische Alternative S.5 3. Heizanlagentechnik im Gebäudebestand S Markübersicht und Potenzial S Voraussetzungen für Brennstoffzellenheizgeräte S.9 4. Beispielhafte Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellenheizgeräten S Annahmen zur Berechnung S Berechnung der Wirtschaftlichkeit S Berechnungsergebnisse S Fazit S Ausblick und Alternativen S.16 Literaturverzeichnis S.18 Selbstständigkeitserklärung S.19 2
3 1. Einleitung Brennstoffzellenheizgeräte erweitern durch verschiedene, seit 2016 in Serie produzierte Geräte die Auswahl an Feuerstätten, die beim Austausch von bestehenden Heizkesseln im Gebäudebestand in Frage kommen. Da Brennstoffzellenheizgeräte neben Wärme auch Strom genieren, sind Brennstoffzellenheizgeräte eine Möglichkeit der KraftWärmekopplung, die durch den niedrigen Gaspreis und den verhältnismäßig hohen Strompreis zu Einsparungen im Haushalt führen können. In Deutschland sind die Mehrzahl der Wohneinheiten Einfamilienhäuser, die in Teilen das Potenzial bieten, mit Brennstoffzellenheizgeräten zu Heizzwecken nachgerüstet bzw. umgerüstet zu werden. Die Mehrzahl der 18 Mio. Wohngebäude in Deutschland sind mit einem Anteil von 65 % Gebäude mit lediglich einer Wohnung. 1 Somit ist auch der Wärmeund Strombedarf ich diesen Gebäuden im Vergleich zum Gesamtmarkt sehr hoch. Des Weiteren sieht das Energiekonzept 2050 der Bundesregierung vor, dass der Primärenergieverbrauch in der Zeit von 2008 bis 2020 um mindestens 20 %, bis 2050 um 50 % vermindert werden soll. 2 Anzunehmende Energiepreissteigerungen, eine weitgehende Importabhängigkeit sowie der Klimawandel, der durch den Ausstoß von Treibhausgasen entsteht, soll hierdurch begrenzt werden. Hierfür müssen in allen Teilen der Energiewirtschaft Effizienzsteigerungen stattfinden. Speziell bei der Gebäudebeheizung und beim Bedarfsstrom ist eine Effizienzsteigerung erstrebenswert, da ein großer Teil der Endenergie in Deutschland im Gebäudebereich benötigt wird. Der Gebäuderelevante Endenergieverbrauch hatte im Jahr 2015 einen Anteil von 35,3 Prozent am gesamten Endenergieverbrauch. 3 Im Gegensatz zum Strom aus Sonne und Wind kann mit Brennstoffzellenheizgeräten stetig Strom ins Netz eingespeist werden. Das sorgt dafür, dass, langfristig betrachtet, solche Systeme smart gesteuert und verbunden werden können, um Netzengpässe auszugleichen. 1 Zensus 2011 Gebäude und Wohnungsbestand in Deutschland, Seite 8 2 Energiekonzept 2050 Bundesregierung Deutschland: (Stand: , 19:20) 3 Energieeffizienz in Zahlen BMWI, Seite 35 3
4 Kraftwärmekopplungssysteme mit vergleichbarer Leistung für den häuslichen Bereich basieren in der Regel auf Verbrennungs oder Stirlingmotoren, die eine geringere Stromausbeute und nur einen sehr engen Leistungsbereich aufweisen. Die Hersteller von Brennstoffzellenheizgeräten versprechen einen hohen ökologischen und ökonomischen Nutzen. Des Weiteren sind in sehr vielen Haushalten in Deutschland sowohl Gasanschlüsse als auch wasserführende Heizsysteme vorhanden, die Voraussetzung für ein Brennstoffzellenheizgerät sind. Das sorgt dafür, dass die Investition für ein Brennstoffzellenheizgerät im Wesentlichen deckungsgleich mit den Investitionen für Installations und Gerätkosten für das Brennstoffzellenheizgerät sind. Da ökonomisch gesehen ein hoher Gesamtwirkungsgrad und ein möglichst ertragreiches KostenNutzen Verhältnis entscheidend ist, wird im Folgenden ein auf dem Markt befindliches Brennstoffzellen Heizgerät auf diese Faktoren hin untersucht. Seit kurzem bieten mehrere Hersteller in Serie gefertigte Brennstoffzellenheizgeräte an, die in Einfamilienhäusern installiert werden können und Wärme und Strom liefern. Um auf technische Daten zurück greifen zu können, beschäftigt sich diese Ausarbeitung mit dem Brennstoffzellenheizgerät Viessmann Vitovalor 300P mit einer thermischen Leitung von bis zu 25,2 kw. Geräte in dieser Leistungsklasse sind gut geeignet, um vorhandene Heizkessel in Ein und Zweifamilienhäusern zu ersetzten. 4
5 2. Brennstoffzellenheizgeräte die technologische Alternative Brennstoffzellen sind hocheffiziente elektrochemische Stromerzeuger, die ohne den Umweg über Wärme direkt die im Brennstoff gespeicherte Chemische Energie in Elektrizität umwandeln. Die Technologie basiert auf der Umkehrung der Wasserelektrolyse d.h. aus den Gasen Wasserstoff und Sauerstoff entsteht unter Abgabe elektrischer Energie als nahezu einziges Reaktionsprodukt Wasser. Sie werden wegen ihrer prinzipiellen Eigenschaften wie z.b. hoher Wirkungsgrad, Schadstoffarmut, modularer Aufbau und ihre sehr gute Eignung zu KraftWärmeKopplung in einem weiten Leistungsbereich von wenigen Watt bis zu einigen Megawatt entwickelt. 4 Es gibt viele verschiedene technische Verfahren und Konzepte, um Brennstoffzellen aufzubauen. Bei der betrachteten Brennstoffzelle handelt es sich um eine Brennstoffzelle auf Basis einer PolymerElektrolytMembran (PEM). Die PEM Technologie hat, verglichen mit verschiedenen Brennstoffzelltypen, einige Vorteile: Mit der Flächenleistung von etwa 0,51,0 W/cm2 (je nach gefordertem Wirkungsgrad) ist die PemTechnologie um das 35 fache kompakter als andere BrennstoffzellenTechniken. 5 Daraus ergibt sich sowohl ein geringeres Einbauvolumen und Gewicht als auch reduzierte Materialkosten für beispielsweise Katalysatoren oder Elektroden. 6 Ein weiterer Vorteil ist, dass PEMBrennstoffzellen bei einer Temperatur unter 100 C arbeiten, sodass bei Raumtemperatur bereits ca. 50% der max. Leistung zur Verfügung stehen und die Aufwärmphase somit nur wenige Minuten dauert. 7 Hieraus ergeben sich sofort verfügbare Leistung durch schnelles An und Abfahren, hohe Lebensdauer durch die verwendeten Baumaterialien, einfache Dichtungstechnik und Nutzung der Kühlkreisläufe der heutigen Verbrennungsmotoren. 8 PEMBrennstoffzellen können über den gesamten Leistungsbereich (Leerlauf bis Volllast) mit hoher Dynamik betrieben werden. Einschränkungen bzgl. des Spannungs oder Lastbereiches aufgrund von Korrosionsprobleme gibt es nicht. Das An und Abfahren kann einfach und schnell erfolgen. Darüber hinaus besteht eine hohe Überlastfähigkeit. 9 4 LedjeffHey 2001, Seite 5 5 ebd. S ebd. S ebd. S ebd. S.67 9 ebd. S. 68 5
6 Vissmann beschreibt den Prozess der Erdgasnutzung in der Brennstoffzelle wie folgt: Der Wasserstoff wird mithilfe eines Katalysators innerhalb eines Gasreformers gewonnen. Ausgangsmaterial ist dabei der emissionsärmste fossile Brennstoff Erdgas. In einem elektrochemischen Prozess wird der vom Ausgangsbrennstoff separierte Wasserstoff gespalten und zeitgleich Sauerstoff zugeführt. Dabei kommt es sowohl zur Strom, als auch zur Wärmeproduktion. Eine Verbrennung wie bei konventionellen Brennwertgeräten findet nicht statt. Der elektrochemische Prozess wird auch als kalte Verbrennung bezeichnet. 10 Auf die weiteren Details der Technik wird in dieser Ausarbeitung nicht weiter eingegangen, da sie für die weiteren Berechnungen nicht notwendig sind. Die untersuchte Brennstoffzelle Vissmann Vitovalor 300P leistet 1kW thermische Dauerleistung und 750W elektrische Leistung. Sie wird immer mit einer Brennwertfeuerstätte kombiniert, die bis zu 24,2kW thermische Leistung liefert. Die geringe thermische Leistung der Brennstoffzelleneinheit hat im Wesentlichen den Vorteil, dass die wärmegeführte Anlage sehr lange Laufzeiten aufweist, auch wenn der Wärmebedarf des Gebäudes gering ist. Dies ist vor allem in der Übergangszeit zwischen der Heizperiode und den Sommermonaten der Fall. 3. Heizanlagentechnik im Gebäudebestand Die Gebäudeklasse mit dem höchsten Anteil in Deutschland sind Einfamilienhäuser. Wie eingehend bereits erwähnt, sind die Mehrzahl der 18 Mio. Wohngebäude in Deutschland mit einem Anteil von 65 % Gebäude mit lediglich einer Wohnung. 11 Wie die folgende Darstellung zeigt, verfügen die meisten Wohngebäude (78,4%) in Deutschland über zentrale Heizungsanlagen und haben damit das Potenzial, durch neue zentrale Heizungsanlagen ausgetauscht zu werden: 10 (Stand: , 16:30) 11 Zensus 2011 Gebäude und Wohnungsbestand in Deutschland, Seite 8 6
7 Quelle: Wie Heizt Deutschland? Juli 2015 DEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.v., Abb. S.13 Wie in der Zeichnung dargestellt, sind die meisten Heizungen in Deutschland Zentralheizungen, die mit Gas oder Öl befeuert werden. Weitere Möglichkeiten, die jedoch einen weitaus geringeren Nutzungsanteil haben, sind Erdgas und Etagenheizungen (6,4%), Fernwärmeheizungen (5,2%) und Einzelheizungen wie z.b. Holz, Pellets und elektrische Speicherheizungen (5,1%). Sonstige Heizsysteme machen einen Anteil von etwa 4,5 % aus. Somit wird deutlich, dass der Großteil der Anlagen Potenzial zur Nachrüstung von Brennstoffzellenheizgeräten hat. Des Weiteren gibt es einen anhaltenden Trend, von Öl zu Erdgas zu wechseln. Wird ein Heizungssystem erneuert, ist dies besonders bei Öl Heizungen häufig mit einem Wechsel des Energieträgers verbunden. Die überwiegende Mehrheit der Heizungsanlagen, die seit 2000 auf Erdgas umgestellt wurden, nutzte zuvor Heizöl als Energieträger. Der Trend weg vom Öl, hin zum Erdgas ist ungebrochen und kann weiter genutzt werden: Etwa 2,5 Millionen der noch mit einer ÖlHeizung beheizten Wohngebäude wären mit wenig Aufwand für einen Anschluss ans Erdgas Netz zu gewinnen. 12 Dies erhöht das Potenzial für Brennstoffzellenheizgeräte weiter, denn hierfür wird ein Erdgasanschluss benötigt. 12 Wie Heizt Deutschland? Juli 2015 DEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.v., Seite 5 7
8 Da die Mehrheit der installierten Heizungsanlagen schon jetzt aus Gasheizungen besteht, bietet sich hierin eine gute Ausgangslage zur Untersuchung. Die Deutsche EnergieAgentur (dena) führte 2010, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, eine Studie zur Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung im Mietwohnungsbestand durch. 13 Die folgende Grafik zeigt den Anteil aller eingesetzten Energieträger der Teilnehmer, die an der denasanierungsstudie teilgenommen haben: Abb: denasanierungsstudie. Teil 1: Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung im Mietwohnungsbestand, Seite 21. Wie in der Grafik zu sehen ist der am weitesten verbreiteten Energieträger für Heizungen bereits jetzt Erdgas. Diese Tatsache ist eine weitere notwendige Voraussetzung zur Nachrüstung von Brennstoffzellenheizgeräten
9 3.1 Markübersicht und Potenzial Wie bereits ausgeführt sind die Potenziale für die Nachrüstung von Brennstoffzellenheizgeräten erheblich. Die klassische Heizungsanlagentechnik hat technisch im Bereich der Wirkungsgrade bereits erhebliche Fortschritte gemacht, im Wesentlichen durch das Nutzen der sogenannten Brennwerttechnik, jedoch sind keine weiteren Wirkungsgradverbesserungen zu erwarten. Auch ein Brennstoffzellenheizgerät erhöht den Gesamtwirkungsgrad nicht, es wird aber neben der Wärmeenergie auch Energie in der höherwertigen Form des elektrischen Stroms erzeugt. 3.2 Vorrausetzungen für Brennstoffzellenheizgeräte Voraussetzung für den Einbau eines Brennstoffzellenheizgeräts im bestehenden Gebäude ist im Wesentlichen das Vorhandensein eines Gasanschlusses, der in den meisten Orten in Deutschland relativ kostengünstig nachgerüstet werden kann, z.b. im Netzgebiet der Westfalen Weser Netz GmbH. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund Des Weiteren ist ein zentrales Wassergeführtes Heizsystem in Form von Heizkörpern, Fußbodenheizungen oder anderen Flächenheizungssystemen wie einer Wand oder Deckenheizung notwendig. Auch das ist in Deutschland die Regel. Seltene Varianten wie z.b. das Nutzen von dezentralen Gasöfen oder zentralen Luftheizungen ist nicht mit einem Brennstoffzellenheizgerät nachrüstbar. 4. Beispielhafte Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellenheizgeräten Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellenheizgeräten basiert auf einem Gebäude, welches die Anforderungen der ersten Wärmeschutzverordnung einhält. Gebäude mussten zum ersten Mal mit der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1979 einen bundeseinheitlichen maximalen Standard für den Wärmebedarf aufweisen, der auch praktisch kontrolliert wurde. Zudem haben sich die 1960er und 1970er Jahre als die stärksten 9
10 Baudekaden hervortreten. 14 Wärmebedarfsberechnung. In diesem Zeitraum gab es jedoch keinen Standard zur Somit beschäftigt sich diese Arbeit mit der wirtschaftlichen Betrachtung von Brennstoffzellenheizgeräten in unsanierten Einfamilienhäusern im energetischen Standard der ersten Wärmeschutzverordnung von 1979 in Deutschland. Die Grundlage für die Berechnung bildet der Jahresendenergiebedarf, der auf Grundlage der DIN und mit Hilfe der in der Energieeinsparverordnung angehängten typologischen Werte ermittelt worden ist. Die Berechnung dieses Wertes erfolgt mithilfe der energetischen Simulation und der Bauberechnungssoftware Energieberater Professionell von Hottgenroth Software Annahmen zur Berechnung Als Beispielgebäude wird ein 91,7qm großes freistehendes eingeschossiges Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1969 betrachtet. Die Wohnfläche entspricht der Größe einer durchschnittlichen Wohneinheit in Deutschland. 17 Dabei ergibt sich ein jährlicher Heizenergiebedarf für Heizwärme und Warmwasser von kwh. (Berechnungsgrundlage in Form des baurechtlichen Berechnungsnachweises siehe Anhang) Der Heizwärmebedarf für das Betrachtete Gebäude liegt bei rund 11 kw. Die Berechnung der Kosten basiert auf der Gesamtbetriebskostenrechnung bestehend aus: 1. Kapitaldienst, Zinsen 2. Nebenkosten Kosten für Wartung und Instandhaltung 3. Brennstoffkosten Zensus 2011 Gebäude und Wohnungsbestand in Deutschland, Seite Deutsches Institut für Normung, Beuth Verlag 06/ Deutsches Institut für Normung, BeuthVerlag 08/ Bautätigkeit und Wohnungen Statistisches Bundesamt, Fachserie 5 Reihe 3, 2016 Seite 6 18 Haustechnik Grundlagen, Planung, Ausführung Volker/Laasch. Seite
11 Die nachfolgende Berechnung ist eine Vergleichsrechnung und beantwortet die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, eine bestehende Altanlage durch eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Brennwertfeuerstätte oder durch ein Brennstoffzellenheizgerät auszutauschen. In der Berechnung finden Fördermittel keine Beachtung, da sie sich oft ändern und somit keine feststehende Größe darstellen. Der betrachtete Zeitraum liegt bei 15 Jahren. Dies ist der Abschreibezeitraum für Kessel laut AfA Tabelle für Anlagegüter Lfd.Nr Kapitaldienst zinsen Der fiktive Zinssatz liegt bei 1,5%. Dies wirkt sich über den betrachteten Zeitraum von 15 Jahren wesentlich auf die entstehenden Kosten aus, ist bei einer Berechnung jedoch unabdingbar. Die Investitionskosten bei einem Austausch durch das Brennstoffzellenheizgerät Viessmann Vitovalor 300P liegen bei rund inkl. aller Nebenkosten. 20 Die Investitionskosten bei einem Austausch durch eine Brennwertfeuerstätte Vitodens 200W liegen bei rund inkl. aller Nebenkosten Nebenkosten Den gängigen Regeln zufolge liegen die Anhaltswerte für die Nebenkosten bei Gasheizungen bei 5 je kw. Damit betragen die jährlichen Nebenkosten für das 19kw Brennwertgerät 95 pro Jahr. Beim Brennstoffzellenheizgerät wird das Sorglospaket des Herstellers Viessmann herangezogen. Mit diesem Wartungsvertrag sichert der Hersteller dem Käufer 10 Jahre Leistungs und Funktionsgarantie zu. Aus den technischen Dokumenten der betrachteten Anlage geht hervor: Wartung im ZweijahresRhythmus Für den GasBrennwertSpitzenlastkessel empfiehlt sich die übliche jährliche Wartung. Die Wartung der Brennstoffzelle ist auf einen Zweijahresturnus ausgelegt. Die Wartungsarbeiten beschränken sich dabei auf den einfachen Austausch des 19 Bundesministerium der Finanzen vom , S Rückfrage beim Werkskundendienst der Firma Viessmann am Rückfrage beim Werkskundendienst der Firma Viessmann am
12 Luft und des Wasserfilters. Die integrierte Entschwefelung des Erdgases für die Brennstoffzelle ist wartungsfrei. 22 Das Sorglospacket der Firma Viessmann kostet jährlich rund 300. Die Annahme für die Berechnung beinhaltet keine Wartungskostensteigerung. 3. Brennstoffkosten Die Brennstoffkosten richten sich nach dem mittleren Gaspreis von 5,79 Cent 23 und einem Strompreis von 28,20 Cent. 24 Annahme für die Berechnung ist keine Brennstoffkostensteigerung. Außerdem wird angenommen, dass das Gebäude von Oktober bis Mai permanent genügend Wärme abnimmt, sodass nur in diesem Zeitraum das Brennstoffzellenheizgerät durchgängig in Betrieb ist. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass der produzierte Strom direkt im Haus anstelle von zugekauftem Strom genutzt wird. Der Hersteller gib für das Brennstoffzellenheizgerät einen Wirkungsgrad von 90% an. Der Wirkungsgrad der Brennwertfeuerstätte liegt bei 95%. Die Brennstoffkosten hängen vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Das Mustergebäude ist im Jahr 1979 gebaut. Die Wärmeverluste über die Gebäudehülle basieren auf der Typologie der ENEV Das Beispielhaus ist eineinhalbgeschossig und hat eine Nutzfläche von 124qm bei einem beheizten Luftvolumen von 295 m3. Der mittlere UWert der Hüllfläche bestehend aus den Einzelwerten von Außenwänden, Dachfläche, oberster Geschossdecke, Kellerdecke und Fenster/Türfläche beträgt 0,823 W/qmK. Bei der Normgerechten Luftwechselrate von 0,7 1/h für Gebäude ohne Dichtheitsprüfung ergibt sich eine Heizlast von ca. 11kW Der Heizwärmebedarf des Gebäudes liegt nach DIN und bei kwh/a. Zusammengesetzt ist der Heizwärmebedarf aus kwh/a Beheizung und einem Wasserwärmebedarf von 1554 kwh/a. Dies deckt sich in etwa mit den Untersuchungen zu mittleren Wohnfläche in Deutschland und dem Heizwärmbedarf nach Rückfrage beim Werkskundendienst der Firma Viessmann am VerivoxVerbraucherpreisindex Gas (Stand 2017) 24 VerivoxVerbraucherpreisindex Strom (Stand 2017) 25 Energieeinsparverordnung
13 Die ab 1968 für den Neubau eingeführte Wärmeschutzverordnung und deren Weiterentwicklung haben zu einem deutlich verminderten spezifischen Heizwärmebedarf geführt, von ca. 170 (kwh/(m²a) nach Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahre 1977 bis auf ca. 70 (kwh/(m²a) nach Einführung der EnEV Berechnung der Wirtschaftlichkeit Die Berechnung der Kosten basiert auf der Gesamtbetriebskostenrechnung nach Volker/Laasch (1999): 1. Kapitaldienst, Zinsen 2. Nebenkosten Kosten für Wartung und Instandhaltung 3. Brennstoffkosten 1. Kapitaldienst Brennstoffzellenheizgerät Investition: ,00 Zinssatz: 1,5% p.a. Zeitraum: 15 Jahre Zinsengesamt: 7006,50 Kapitaldienst inkl. Zinsen ,50 Brennwertfeuerstätte Investition: 8.000,00 Zinssatz: 1,5% p.a. Zeitraum: 15 Jahre Zinsengesamt: 2001,86 Kapitaldienst inkl. Zinsen 10001,86 2. Nebenkosten Kosten für Wartung und Instandhaltung Brennstoffzellenheizgerät Viessmann RundumSorglosPaket 300 /a im betrachteten Zeitraum 4500 Wartung 95 /a Brennwertfeuerstätte im betrachteten Zeitraum (s. Kompetenzzentrum 2007b, 2 3) 13
14 3. Brennstoffkosten Wärmebedarf des Gebäudes nach DIN und bei kwh/a Brennstoffzellenheizgerät Brennwertfeuerstätte Brennstoffzelleneinheit: Wirkungsgrad 90% Elektrische Leitung 750Watt bei 1kW thermischer Leistung Heizperiode 8 Monate entspricht 5760 Betriebsstunden zu 750 Watt elektrische Leistung = 4320 kwh Strom 1000 Watt thermische Leistung = 5760 kwh Wärme. Bei 90 Wirkungsgrad = kwh Erdgaseinsatz Wirkungsgrad 95% Benötigte thermische Leistung 19577kWh Bei 95 Wirkungsgrad = 20555,85 kwh Erdgaseinsatz Kostenbilanz Gasverbrauch * Brennstoffkosten = Kosten 20555,85 kwh * 0,0579 /kwh = 1190,18 /a Spitzenlastkessel im System Wirkungsgrad 95% Thermische Leistung Spitzenlast kwh 5760 kwh = kwh Bei 95 Wirkungsgrad = 14507,85 kwh Erdgaseinsatz Gas Verbrauch Brennstoffzellenheizgerät + Gas Spitzenlastkessel im System = Gesamt Erdgasverbrauch kwh ,85 kwh = 25595,85 kwh Kostenbilanz Gasverbrauch * Brennstoffkosten Erzeugte Strommenge * Strompreis = Kosten 25595,85 kwh * 0,0579 /kwh 4320 kwh * 0,282 /kwh = 263,76 /a 14
15 4.3 Berechnungsergebnis Übersicht der Kosten über 15 Jahre Brennstoffzellenheizgerät ,50 Kapitaldienst inkl. Zinsen 4500,00 Wartungskosten im betrachteten Zeitraum 3956,39 Brennstoffkosten 264,76 /a * 15Jahre Gesamtkosten = ,90 Brennwertfeuerstätte 10001,86 Kapitaldienst inkl. Zinsen 1425,00 Wartungskosten im betrachteten Zeitraum 17852,70 Brennstoffkosten = 1190,18 /a * 15Jahre Gesamtkosten = ,56 Im betrachteten Zeitraum von 15 Jahren ist der Betrieb des Brennstoffzellenheizgerätes in der Gesamtbetrachtung mit ,34 teurer als die Handlungsalternative der Gas Brennwertfeuerstätte. Der Grund dafür liegt im Wesentlichen in den höheren Anschaffungskosten und dem damit verbundenen Kapitaldienst. 5.Fazit Die Investition in ein Brennstoffzellenheizgerät ist im direkten Vergleich mit einer Brennwertfeuerstätte zum heutigen Zeitpunkt nicht die beste Handlungsalternative. Die Berechnung hat nur eine oberflächliche Auflösung, da viele Annahmen getroffen wurden, die in der Praxis sehr individuell sind. Beispielsweise hängt der Wirkungsgrad der Feuerstätte in weiten Teilen vom Heizungssystem und von den tatsächlichen Betriebsstunden der Geräte ab. Eine weitere wichtige Schwäche der Berechnung ist, dass die Wirkungsgrade der Anlagen aus den Datenblättern der Hersteller entnommen wurden. Diese Wirkungsgrade werden höchstwahrscheinlich in der Praxis nicht erreicht. Außerdem werden Brennstoffzellen Heizgeräte zurzeit 27 mit rund durch den Bund gefördert. 27 Stand:
16 In einigen Konstellationen ist es denkbar, dass Brennstoffzellenheizgeräte die bessere Handlungsalternative sind. Dies wäre der Fall bei einem deutlich geringeren Wärmebedarf des Gebäudes oder bei einem längeren Betrachtungszeitraum. Die Haltbarkeit der Geräte ist in der Praxis nicht abzusehen. Die Firma Vissmann spricht von einer umfangreicheren Wartung nach 10 Jahren, die damit verbundenen Kosten sind hierbei jedoch nicht in Erfahrung zu bringen. 6. Ausblicke und Alternativen Langfristig ist davon auszugehen, dass Brennstoffzellenheizgeräte durch weitere Verbreitung der Geräte und eine größere produzierte Stückzahl günstiger und damit Brennstoffzellenheizgeräte attraktiver für Eigentümer von Wohngebäuden werden. Wie sich die Technologie ( ) mit geeigneten Rahmenbedingungen entfalten kann, zeigt die Entwicklung in Japan, wo nach einigen Jahren der Technologieeinführung bereits im Jahr 2011 über BrennstoffzellenGeräte mit einer elektrischen Leistung von etwa 700 Watt installiert wurden. Die japanischen Hersteller werden mit diesen Projekten auch auf den europäischen Markt kommen. Die Ziele des japanischen ENEFarmProjektes, einem Gemeinschaftsprojekt der Fuel Cell Commercialization Conference, sind äußerst ambitioniert. Für 2015 sind Geräte geplant, bis 2030 sogar 2,5 Millionen Geräte 28. Die häufig kritisierte Nutzung von fossilen Brennstoffen wird aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten langfristig weiter sinnvoll bleiben. Vergleichbare KWK Heizsysteme für Ein und Zweifamilienhäuser sind im Wesentlichen Verbrennungsmotoren und Störlingmotoren, die deutlich höhere thermische Leistungen im Verhältnis zur elektrischen Leistung aufweisen. Das kleinste auf dem Markt befindliche Mikro BHKW mit Verbrennungsmotor liefert 2,5 kw thermische Leistung, das sind 2,5 Mal mehr thermische Energie als in dem untersuchten Brennstoffzellenheizgerät. Diese deutliche höhere thermische Leitung muss komplett im Gebäude genutzt werden. Das ist in den Heizmonaten ohne Probleme möglich, wird aber in der Übergangszeit deutlich schwerer als die thermische Leitung von 1kW zu verwenden. Als nicht auf fossilen Brennstoffen basierende Alternative im Gebäudebestand bieten sich z.b. elektrische Luft oder Wasserwärmepumpen an, die mit Photovoltaikanlagen kombiniert werden. 28 Ökologische und ökonomische Analyse von Brennstoffzellen Heizgeräten Heidelberg, Osnabrück, München, Juli 2012, Seite 47 16
17 Grundsätzlich ist das richtige Heizsystem vom Heizungssystem des betrachteten Gebäudes, dem Wärmebedarf und dem Standort des Gebäudes abhängig und sollte in jedem Fall individuell geprüft werden. Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass auch mit in der Gesamtbetrachtung hocheffizienten Brennstoffzellenheizgeräten die Ziele des Bundes für das Jahr 2050 nicht einzuhalten sind, da diese natürlich in ähnlichem Maße CO2 emittieren und Erdgas verbrauchen. Der Weg zu einem langfristig nahezu co2neutralen Gebäudebestand wird nur über eine starke Senkung des Wärmebedarfs und mittels thermischer Sonnenenergie oder regenerativen Stroms in Kombination mit elektrischen Wärmepumpen möglich sein. 17
18 Literaturverzeichnis Bautätigkeit und Wohnungen Statistisches Bundesamt, Fachserie 5 Reihe 3, 2016 Bundesministerium der Finanzen vom dena Studie Sanierungsstudie_Teil_1.pdf Deutsches Institut für Normung, BeuthVerlag 06/2003 Deutsches Institut für Normung, BeuthVerlag 08/2003 DEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.v.: Wie Heizt Deutschland? Juli 2015 Energieeffizienz in Zahlen BMWI Energieeinsparverordnung 2015 Energiekonzept 2050 Bundesregierung Deutschland: Ledjeff Hey, Konstantin: Brennstoffzellen Entwicklung, Technologie, Anwendung. Hüthig Jehle Rehm; 2. Auflage 2001 Ökologische und ökonomische Analyse von Brennstoffzellen Heizgeräten Heidelberg, Osnabrück, München, Juli 2012 VerivoxVerbraucherpreisindex Gas (Stand 2017) VerivoxVerbraucherpreisindex Strom (Stand 2017) Viessmann (Stand: , 16:30) Volger, Karl;/Laasch, Erhard: Haustechnik Grundlagen, Planung, Ausführung. Teubner Verlag Stuttgart, 10. Auflage Werkskundendienst der Firma Viessmann am Zensus 2011: Gebäude und Wohnungsbestand in Deutschland 18
19 Selbstständigkeitserklärung Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende wissenschaftliche von mir selbst verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt worden ist und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind. Paderborn, den
20 Anhang Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit Berechnungen nach DIN und DIN für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit Auftraggeber Aussteller Sebastian Hund GebäudeEnergieberater Sachverständigen für Energieeffizienz (KfW) AloisLödigeStr Paderborn Telefon : Telefax : energie@fragsebastian.de (Datum) (Unterschrift) Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 1
21 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 1. Allgemeine Projektdaten Projekt : Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit Gebäudetyp : Wohngebäude Innentemperatur : normale Innentemperatur Anzahl Vollgeschosse : 1 Anzahl Wohneinheiten : 1 2. Berechnungsgrundlagen Berechnungsverfahren : JahresHeizwärmebedarf des Gebäudes mittels Monatsbilanzierung JahresPrimärenergiebedarf mittels ausführlichem Berechnungsverfahren Rechenprogramm : Energieberater Professional Hottgenroth Software Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm berücksichtigt: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung EnEV) vom 18. November 2013 DIN EN 832 : Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden Berechnung des Heizenergiebedarfs Wohngebäude DIN V : DIN V Ber 1 : DIN V : DIN SPEC /A1: DIN EN ISO : Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden Teil 6 : Berechnung des Jahresheizwärme und des Jahresheizenergiebedarfs Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden Teil 6 : Berechnung des Jahresheizwärme und des Jahresheizenergiebedarfs Berichtigungen zu DIN V 41086: Energetische Bewertung heiz und raumlufttechnischer Anlagen Teil 10 : Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung Energetische Bewertung heiz und raumlufttechnischer Anlagen Teil 10 : Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung; Änderung A1 Wärmeübertragung über das Erdreich Berechnungsverfahren DIN EN ISO 6946 : Bauteile Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient Berechnungsverfahren DIN EN ISO : Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten Teil 1 : Vereinfachtes Verfahren DIN V : Energetische Bewertung heiz und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand Teil 12: Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmung DIN : Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz DIN : Wärmeschutz und EnergieEinsparung in Gebäuden Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung DIN V : DIN : Wärmeschutz und EnergieEinsparung in Gebäuden Teil 4: Wärme und feuchteschutztechnische Bemessungswerte Wärmeschutz im Hochbau Berechnungsverfahren DIN 4108 Bbl 2 : Wärmeschutz und EnergieEinsparung in Gebäuden Wärmebrücken Planungs und Ausführungsbeispiele DIN EN : Baustoffe und produkte Wärme und feuchteschutztechnische Eigenschaften Tabellierte Bemessungswerte Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 2
22 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit Angaben zum Energiebedarfsausweis nach EnEV 3.1 Objektbeschreibung Objekt Geometrische Angaben Gebäude / teil Wärmeübertragende Umfassungsfläche A 328,3 m 2 Straße, HausNr. beheiztes Gebäudevolumen V e 388,5 m 3 PLZ, Ort Verhältnis A/V e 0,85 m 1 Nutzungsart x Wohngebäude Bei Wohngebäuden: Gebäudenutzfläche A N 124,3 m 2 Baujahr 1979 Jahr der baul. Änderung Wohnfläche (Angabe freiwillig) m 2 Beheizung und Warmwasserbereitung Art der Beheizung Art der Warmwasserbereitung Fern/Nahwärme Art der Nutzung erneuerbarer Energien Anteil am Heizwärmebedarf % 3.2 Energiebedarf JahresPrimärenergiebedarf Zulässiger Höchstwert Berechneter Wert 118,83 kwh/m² 131,84 kwh/m² = um 40% erhöhter zulässiger Höchstwert eines gleichartigen neu zu errichtenden Gebäudes Endenergiebedarf nach eingesetzten Energieträgern Energieträger 1 Energieträger 2 Energieträger 3 KraftWärmeKopplun... Hilfsenergie (Strom) JahresEndenergiebedarf (absolut) JahresEndenergiebedarf bezogen auf die Gebäudenutzfläche A N (für Wohngebäude) kwh 370 kwh kwh 180,69 kwh/m² 2,98 kwh/m² kwh/m² die Wohnfläche (für Wohngebäude, die Angabe ist freigestellt) das beheizte Gebäudevolumen (für NichtWohngebäude) 57,82 kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m³ 0,95 kwh/m³ kwh/m³ Hinweis Die angegebenen Werte des JahresPrimärenergiebedarfs und des Endenergiebedarfs sind vornehmlich für die überschlägig vergleichende Beurteilung von Gebäuden und Gebäudeentwürfen vorgesehen. Sie wurden auf der Grundlage von Planungsunterlagen ermittelt. Sie erlauben nur bedingt Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch, weil der Berechnung dieser Werte auch normierte Randbedingungen etwa hinsichtlich des Klimas, der Heizdauer, der Innentemperatur, des Luftwechsels, der solaren und internen Wärmegewinne und des Warmwasserbedarfs zugrunde liegen. Die normierten Randbedingungen sind für die Anlagentechnik in DIN V : Nr. 5 und im Übrigen in DIN V : Anhang D festgelegt. Die Angaben beziehen sich auf Gebäude und sind nur bedingt auf einzelne Wohnungen oder Gebäudeteile übertragbar. Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 3
23 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 3.3 Weitere energiebezogene Merkmale Transmissionswärmeverlust Zulässiger Höchstwert Berechneter Wert 0,56 W/(m²K) 0,82 W/(m²K) = um 40% erhöhter zulässiger Höchstwert eines gleichartigen neu zu errichtenden Gebäudes Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl e P 0,84 Berechnungsblätter sind beigefügt x Die Wärmeabgabe der Wärme und Warmwasserverteilungsleitungen wurde nach Anlage 5 EnEV begrenzt. Berücksichtigung von Wärmebrücken Sommerlicher Wärmeschutz x pauschal mit 0,10 W/(m²K) pauschal mit 0,05 W/(m²K) bei Verwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Bbl. 2: pauschal mit 0,15 W/(m²K) bei überwiegender Innendämmung mit differenziertem Nachweis Berechnungen sind beigefügt Nachweis nicht erforderlich Nachweis der Begrenzung des Sonneneintragskennwerts wurde geführt Berechnungen sind beigefügt das Nichtwohngebäude ist mit Anlagen nach Anlage 2 Nr. 4 EnEV ausgestattet. Die innere Kühllast wird minimiert. Dichtheit und Lüftung Mindestluftwechsel erfolgt durch x ohne Nachweis x Fensterlüftung mit Nachweis nach Anlage 4 Nr. 2 EnEV mechanische Lüftung Messprotokoll ist beigefügt andere Lüftungsart: Einzelnachweise, Ausnahmen und Befreiungen Einzelnachweis nach EnEV wurde geführt für eine Ausnahme nach EnEV wurde zugelassen. Sie betrifft eine Befreiung nach EnEV wurde erteilt. Sie umfasst Nachweise sind beigefügt Bescheide sind beigefügt Verantwortlich für die Angaben Name, Funktion / Firma, Anschrift Sebastian Hund GebäudeEnergieberater Sachverständigen für Energieeffizienz (KfW) AloisLödigeStr Paderborn ggf. Stempel / Firmenzeichen Datum, Unterschrift ggf. Unterschrift Entwurfsverfasser Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 4
24 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 4. Gebäudegeometrie 4.1 Gebäudegeometrie Flächen Nr. Bezeichnung Orientierung Neigung Berechnung Fläche brutto Fläche netto m² m² % 1 Oberste Geschossdecke 0,0 85*0,46 (Grundfl. x Höhenverh.) 39,10 39,10 11,9 2 Dachfläche N 45,0 8,5*3,82 (Breite x Länge) 32,46 30,46 9,3 3 Doppelverglasung Dach N 45,0 2,00 0,6 4 Dachfläche S 45,0 8,5*3,82 (Breite x Länge) 32,46 30,46 9,3 5 Doppelverglasung Dach S 45,0 2,00 0,6 6 Außenwand N 90,0 8,5*2,7 (Breite x Höhe) 22,95 17,95 5,5 7 Wärmeschutzverglasung N 90,0 5,00 1,5 8 Außenwand W 90,0 10*2,7 (Breite x Höhe) + 2,7*(10+4,6)/2 (trapezförmiger Giebel) 46,71 36,71 11,2 9 Wärmeschutzverglasung W 90,0 10,00 3,0 10 Außenwand S 90,0 8,5*2,7 (Breite x Höhe) 22,95 17,95 5,5 11 Wärmeschutzverglasung S 90,0 5,00 1,5 12 Außenwand O 90,0 10*2,7 (Breite x Höhe) + 2,7*(10+4,6)/2 (trapezförmiger Giebel) 46,71 36,71 11,2 13 Wärmeschutzverglasung O 90,0 10,00 3,0 14 Kellerdecke 0,0 8,5*10 (Breite x Länge) 85,00 85,00 25,9 4.2 Gebäudegeometrie Volumen Nr. Bezeichnung Berechnung Volumen brutto Flächenanteil Volumenanteil m³ % 1 Dach (abzgl. Abseiten) 159, ,04 40,9 2 Korpus: Grundfläche x Hoehe 85 * (1*(2,5+0,2)) 229,50 59,1 4.3 Gebäudegeometrie Zusammenfassung Gebäudehüllfläche : 328,34 m² Gebäudevolumen : 388,53 m³ Beheiztes Luftvolumen : 295,29 m³ Gebäudenutzfläche : 124,33 m² A/V e Verhältnis : 0,85 1/m Fensterfläche : 34,00 m² Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 5
25 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 5. JahresHeizwärmebedarfsberechnung 5.1 spezifische Transmissionswärmeverluste der Heizperiode Nr. Bauteil Orientierung Fläche A U i Wert Faktor F x F x * U * A Neigung m² W/(m²K) W/K % 1 Oberste Geschossdecke 0,0 39,10 0,400 0,80 12,51 3,7 2 Dachfläche N 45,0 30,46 0,700 1,00 21,32 6,3 3 Doppelverglasung Dach N 45,0 2,00 2,050 1,00 4,10 1,2 4 Dachfläche S 45,0 30,46 0,700 1,00 21,32 6,3 5 Doppelverglasung Dach S 45,0 2,00 2,050 1,00 4,10 1,2 6 Außenwand N 90,0 17,95 0,800 1,00 14,36 4,2 7 Wärmeschutzverglasung N 90,0 5,00 1,200 1,00 6,00 1,8 8 Außenwand W 90,0 36,71 0,800 1,00 29,37 8,6 9 Wärmeschutzverglasung W 90,0 10,00 1,200 1,00 12,00 3,5 10 Außenwand S 90,0 17,95 0,800 1,00 14,36 4,2 11 Wärmeschutzverglasung S 90,0 5,00 1,200 1,00 6,00 1,8 12 Außenwand O 90,0 36,71 0,800 1,00 29,37 8,6 13 Wärmeschutzverglasung O 90,0 10,00 1,200 1,00 12,00 3,5 14 Kellerdecke 0,0 85,00 0,850 0,70 50,57 14,9 ΣA = 328,34 Σ(F x * U * A) = 237,39 Wärmebrückenzuschlag U U WB = 0,10 W/(m²K) U WB * A = 32,83 W/K 9,6 % Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste 1 Oberste Geschossdecke 3,7 % 2 Dachfläche 12,5 % 3 Doppelverglasung Dach 2,4 % 4 Außenwand 25,7 % 5 Wärmeschutzverglasung 10,6 % 6 Kellerdecke 14,9 % Wärmebrückenzuschlag 9,6 % Lüftungswärmeverluste 20,6 % 5.2 Lüftungsverluste Lüftungswärmeverluste n = 0,70 h 1 70,28 W/K 20,6 % 5.3 Daten transparenter Bauteile Nr. Bezeichnung Orientierung Neigung Fläche brutto m² Faktor Rahmenanteil Faktor Verschattung Faktor Sonnenschutz Faktor Nichtsenkrechter Strahlungseinfall Gesamtenergiedurchlassgrad effektive Kollektorfläche 1 Doppelverglasung Dach N 45,0 2,00 0,70 0,90 1,00 0,9 0,75 0,85 2 Doppelverglasung Dach S 45,0 2,00 0,70 0,90 1,00 0,9 0,75 0,85 m² Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 6
26 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 5.3 Daten transparenter Bauteile (Fortsetzung) Nr. Bezeichnung Orientierung Neigung Fläche brutto m² Faktor Rahmenanteil Faktor Verschattung Faktor Sonnenschutz Faktor Nichtsenkrechter Strahlungseinfall Gesamtenergiedurchlassgrad effektive Kollektorfläche 3 Wärmeschutzverglasung N 90,0 5,00 0,70 0,90 1,00 0,9 0,50 1,42 4 Wärmeschutzverglasung W 90,0 10,00 0,70 0,90 1,00 0,9 0,50 2,84 5 Wärmeschutzverglasung S 90,0 5,00 0,70 0,90 1,00 0,9 0,50 1,42 6 Wärmeschutzverglasung O 90,0 10,00 0,70 0,90 1,00 0,9 0,50 2,84 m² 5.4 Monatsbilanzierung Wärmeverluste in kwh/monat Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Transmissionswärmeverluste Transmissionsverluste Wärmebrückenverluste Summe Lüftungswärmeverluste Lüftungsverluste reduzierte Wärmeverluste durch Nachtabschaltung, senkung reduzierte Wärmeverluste Gesamtwärmeverluste Gesamtwärmeverluste Wärmegewinne in kwh/monat Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Interne Wärmegewinne Interne Wärmegewinne Solare Wärmegewinne Fenster N Fenster S Fenster N Fenster W Fenster S Fenster O Solare Wärmegewinne Gesamtwärmegewinne in kwh/monat Gesamtwärmegewinne Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 7
27 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 5.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung) Heizwärmebedarf in kwh/monat Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ausnutzungsgrad Gewinne 1,000 1,000 0,998 0,958 0,714 0,354 0,000 0,073 0,819 0,990 1,000 1,000 Heizwärmebedarf Heizgrenztemperatur in C und Heiztage Heizgrenztemperatur 16,83 16,75 15,85 14,49 14,27 14,05 14,40 14,78 15,39 16,05 16,93 17,14 Mittl. Außentemperatur: 1,00 1,90 4,70 9,20 14,10 16,70 19,00 18,60 14,30 9,50 4,10 0,90 Heiztage 31,0 28,0 31,0 30,0 16,8 0,0 0,0 0,0 21,9 31,0 30,0 31,0 Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 8
28 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 5.5 Monatsbilanzierung Zusammenfassung Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung kwh Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ergebnisse des Monatsbilanzverfahrens JahresHeizwärmebedarf = kwh/a flächenbezogener JahresHeizwärmebedarf = 144,96 kwh/(m²a) volumenbezogener JahresHeizwärmebedarf = 46,39 kwh/(m³a) Zahl der Heiztage = 250,7 d/a Heizgradtagzahl = Kd/a Heizwärmebedarf Lüftungswärmeverluste Transmissionswärmeverluste Reduzierung der Wärmeverluste (Heizungsunterbrechung, etc.) nutzbare interne Wärmegewinne nutzbare solare Wärmegewinne nicht nutzbare Wärmegewinne Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 9
29 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 6. Anlagenbewertung nach DIN Anlagenbeschreibung Heizung: Erzeugung Verteilung Übergabe Zentrale Wärmeerzeugung Nah oder Fernwärme KraftWärmeKopplung, fossil Auslegungstemperaturen 70/55 C Dämmung der Leitungen: nach EnEV optimierter Betrieb (optimale Heizkurve, hydraul. Abgleich) Umwälzpumpe nicht leistungsgeregelt freie Heizfläche, Anordnung im Außenwandbereich Thermostatventil mit Auslegungsproportionalbereich 2 K Warmwasser: Erzeugung Speicherung Verteilung Zentrale Warmwasserbereitung Nah oder Fernwärme KraftWärmeKopplung, fossil Indirekt beheizter Speicher 180 Liter, Dämmung nach EnEV Dämmung der Leitungen: nach EnEV Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 10
30 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 6.2 Ergebnisse Gebäude/ teil: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Eingaben: A N = 124,3 m² t HP = 251 Tage TRINKWASSER ERWÄRMUNG HEIZUNG LÜFTUNG absoluter Bedarf Q tw = 1554 kwh/a Q h = kwh/a bezogener Bedarf q tw = 12,50 q h = 144,96 Ergebnisse: Deckung von q q h,tw = 5,51 q h,h = 139,45 q h,l = 0,00 h Σ WÄRME Σ HILFS ENERGIE Σ PRIMÄR ENERGIE Q TW,E = Q H,E = Q L,E = 3054 kwh/a kwh/a 0 kwh/a 61 kwh/a 309 kwh/a 0 kwh/a 2248 kwh/a kwh/a 0 kwh/a Q TW,P = Q H,P = Q L,P = ENDENERGIE Q E = kwh/a Σ WÄRME 370 kwh/a Σ HILFSENERGIE PRIMÄRENERGIE Q P = kwh/a Σ PRIMÄRENERGIE q P = 131,84 ANLAGEN AUFWANDSZAHL e P = 0,84 [ ] ENDENERGIE nach eingesetzten Energieträgern Q E,1 = kwh/a Σ KraftWärmeKopplung, fossil Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 11
31 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 6.3 Detailbeschreibung Berechnungsverfahren: Die Berechnung des Primärenergiebedarfs q P und der Anlagenaufwandszahl e P erfolgt nach dem Berechnungsverfahren der DIN : Soweit nicht anders angegeben werden hierbei die von der DIN vorgegebenen Standardwerte für die Berechnungsparameter verwendet. Diese werden nach Abschnitt 5 unter den dort angegebenen Randbedingungen berechnet. Nutzfläche des Gebäudes : 124,3 m² Heizung und Lüftung: Das Gebäude enthält einen Heizungsbereich HeizungsBereich Nr. 1 : Nutzfläche : 124,3 m² Bereich ohne Lüftungsanlage Der Bereich enthält einen ZentralheizungsVerteilstrang ZentralheizungsVerteilstrang Nr. 1 max. Vor/Rücklauftemperatur : 70 / 55 C Außenverteilung (Strangleitungen an den Außenwänden) VerteilLeitungen außerhalb der therm. Hülle, Keller Umwälzpumpe nicht leistungsgeregelt ÜbergabeKomponente : freie Heizfläche, Anordnung im Außenwandbereich Regelung : Thermostatventil mit Auslegungsproportionalbereich 2 K Der Bereich enthält keinen dezentralen Wärmeerzeuger ZentralheizungsGruppe des Bereiches: Die Gruppe enthält keinen Pufferspeicher. Wärmeerzeuger Nr. 1 : WärmeerzeugerTyp : Nah oder Fernwärme Brennstoff : KraftWärmeKopplung, fossil Trinkwarmwasser : Das Gebäude enthält einen Trinkwasserbereich TrinkwasserBereich Nr. 1 : Bezeichnung : E=FW, A=i Nutzfläche : 124,3 m² Die Versorgung des Bereiches erfolgt zentral zentraler TrinkwasserStrang : Lage der Verteilleitungen : innerhalb der thermischen Hülle ohne Zirkulation Standardverrohrung ( keine gemeinsame Installationswand ) Verteilleitungen innerhalb der thermischen Hülle. WarmwasserBereiter : Art : indirekt beheizter Speicher Aufstellort : innerhalb der thermischen Hülle Die Beheizung des Speichers erfolgt durch einen Wärmeerzeuger (monovalent) Wärmeerzeuger Nr. 1 ( monovalent ) : WärmeerzeugerTyp : Nah oder Fernwärme Brennstoff : KraftWärmeKopplung, fossil Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 12
32 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 6.4 Ergebnisse Heizung HeizStrang: Bereich 1 zentral Q h A N ,3 kwh/a m² Wärmebedarf Fläche WÄRME (WE) Rechenvorschrift/Quelle q h q h,tw q h,l q c,e q d q s Σ Heizwärmebedarf aus Berechnungsblatt Trinkwasser aus Berechnungsblatt Lüftung Verluste Übergabe Verluste Verteilung Verluste Speicherung ( q h q h,tw q h,l + q ce + q d + q s ) Dimension + 144,96 5,51 3,30 11,83 154,58 q h 144,96 Q h / A N Erzeuger Erzeuger Erzeuger α g e g WärmeerzeugerDeckungsanteil WärmeerzeugerAufwandszahl 100,00 % 1,01 q E f p q p Σq x (e g,i x α g,i ) Primärenergiefaktor Σq E,i x f p,i 156,13 0,70 109,29 156,13 109,29 Endenergie Primärenergie HILFSENERGIE (HE) (Strom) Rechenvorschrift / Quelle Dimension q ce,he q d,he q s,he Hilfsenergie Übergabe Hilfsenergie Verteilung Hilfsenergie Speicherung + 2,48 Erzeuger Erzeuger Erzeuger α g q g,he α x q g,he WärmeerzeugerDeckungsanteil Hilfsenergie Erzeugung 100,00 % Σq HE,E f p q HE,p (q ce,he + q d,he + q s,he + Σαq g,he ) Primärenergiefaktor Σq HE, E x f p 2,48 2,48 1,80 4,47 4,47 Endenergie Primärenergie Q H,E Σq E x A N Σq HE,E x A N WÄRME HILFS ENERGIE kwh/a kwh/a ENDENERGIE Q H,P (Σq P + Σq HE,P ) x A N kwh/a PRIMÄRENERGIE Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 13
33 Objekt: Präsentationstechniken & wissenschaftliches Arbeit 6.5 Ergebnisse Trinkwassererwärmung TWStrang: Bereich 1 zentral E=FW, A=i Q TW A N ,3 kwh/a m² Wärmebedarf Fläche WÄRME (WE) Rechenvorschrift/Quelle Dimension q TW 12,50 Q TW / A N q TW TrinkwasserWärmebedarf 12,50 q TW,ce q TW,d Verluste Übergabe Verluste Verteilung + 4,59 Heizwärmegutschriften 2,79 q h,tw,d Verteilung q TW,s Verluste Speicherung 4,46 2,72 q h,tw,s Speicherung Σ ( q tw + q TW,ce + q TW,d + q TW,s ) 21,55 5,51 q h,tw Σ q h,tw,d + q h,tw,s Erzeuger Erzeuger Erzeuger α TW,g e TW,g WärmeerzeugerDeckungsanteil WärmeerzeugerAufwandszahl 100,00 % 1,14 q TW,E f PE,i q TW,P Σ q TW x (e TW,g,i x α TW,g,i ) Primärenergiefaktor Σ q TW,E,i x f p,i 24,56 0,70 17,19 24,56 17,19 Endenergie Primärenergie HILFSENERGIE (HE) (Strom) Rechenvorschrift / Quelle Dimension q TW,ce,HE q TW,d,HE q TW,s,HE Hilfsenergie Übergabe Hilfsenergie Verteilung Hilfsenergie Speicherung + 0,09 Erzeuger Erzeuger Erzeuger α TW,g q TW,g,HE α x q g,he WärmeerzeugerDeckungsanteil Hilfsenergie Erzeugung 100,00 % 0,40 0,40 Σ q TW,HE,E f p q TW,HE,P (q TW,ce,HE +q TW,s,HE +q TW,d,HE +Σ α q g,he ) Primärenergiefaktor Σ q TW,HE,E x f p 0,49 0,49 1,80 0,89 0,89 Endenergie Primärenergie Q TW,E Σ q TW,E x A N Σ q TW,HE,E x A N WÄRME HILFS ENERGIE kwh/a kwh/a ENDENERGIE Q TW,P ( Σ q TW,P + Σ q TW,HE,P ) x A N 2248 kwh/a PRIMÄRENERGIE Energieberater Professional Sebastian Hund Seite 14
Energieberatung nach DIN und DIN Objekt: Heidelbergerstraße 43, Brensbach. Heidelbergerstraße Brensbach
 Bärbel Bock IstZustand Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Bärbel Bock IstZustand Heidelbergerstraße 43 64395 Brensbach Auftraggeber Frau Bärbel
Bärbel Bock IstZustand Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Bärbel Bock IstZustand Heidelbergerstraße 43 64395 Brensbach Auftraggeber Frau Bärbel
1. Anlagenbewertung nach DIN Anlagenbeschreibung
 α 1. Anlagenbewertung nach DIN 4701-10 1.1 Anlagenbeschreibung Heizung: Erzeugung Verteilung Übergabe Zentrale Wärmeerzeugung Brennwert-Kessel - 15 kw, Heizöl EL Auslegungstemperaturen 55/45 C Dämmung
α 1. Anlagenbewertung nach DIN 4701-10 1.1 Anlagenbeschreibung Heizung: Erzeugung Verteilung Übergabe Zentrale Wärmeerzeugung Brennwert-Kessel - 15 kw, Heizöl EL Auslegungstemperaturen 55/45 C Dämmung
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung
 Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Bezeichnung Reihenendhaus Nutzungsart Wohngebäude PLZ, Ort 21614 Buxtehude Straße, Haus-Nr. Beispielstraße 3a Baujahr 2003 Jahr
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Bezeichnung Reihenendhaus Nutzungsart Wohngebäude PLZ, Ort 21614 Buxtehude Straße, Haus-Nr. Beispielstraße 3a Baujahr 2003 Jahr
EnEV-Berechnungsnachweis für den Bauantrag. Stefan Holz Energieberatung GmbH unabhängige Energie- und Umweltberatung Sachverständigenbüro
 EnEVBerechnungsnachweis für den Bauantrag für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Gunzenhausen KFW 55 91710 Gunzenhausen Auftraggeber Aussteller Stefan Holz Energieberatung GmbH unabhängige Energie
EnEVBerechnungsnachweis für den Bauantrag für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Gunzenhausen KFW 55 91710 Gunzenhausen Auftraggeber Aussteller Stefan Holz Energieberatung GmbH unabhängige Energie
1. Objektbeschreibung. Datum der Aufstellung: 16. Mai Bezeichnung des Gebäudes oder des Gebäudeteils Nutzungsart Straße und Hausnummer :
 Energiebedarfsausweis nach 13 der Energieeinsparverordnung für den Neubau eines Gebäudes mit normalen Innentemperaturen Nachweis nach Anhang 1 Ziffer 2 der EnEV (Monatsbilanzverfahren) 1. Objektbeschreibung
Energiebedarfsausweis nach 13 der Energieeinsparverordnung für den Neubau eines Gebäudes mit normalen Innentemperaturen Nachweis nach Anhang 1 Ziffer 2 der EnEV (Monatsbilanzverfahren) 1. Objektbeschreibung
Wärmeschutznachweis zum Energieausweis Nr.: NW nach DIN und DIN Pollmann - Energiebedarfsausweis gem.
 α Wärmeschutznachweis zum Energieausweis Nr.: NW-2016-001023301 nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt 16129 Pollmann - Adresse Brahmsstraße 51 47239 Duisburg
α Wärmeschutznachweis zum Energieausweis Nr.: NW-2016-001023301 nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt 16129 Pollmann - Adresse Brahmsstraße 51 47239 Duisburg
Energiebedarfsausweis nach 16 der Energieeinsparverordnung 2007
 - 1 von 7 - - 2 von 7 - - 3 von 7 - Datum der Aufstellung: 16. Mai 2008 Energiebedarfsausweis nach 16 der Energieeinsparverordnung 2007 für den Neubau eines Wohngebäudes Nachweis nach Anlage 1 Ziffer 2
- 1 von 7 - - 2 von 7 - - 3 von 7 - Datum der Aufstellung: 16. Mai 2008 Energiebedarfsausweis nach 16 der Energieeinsparverordnung 2007 für den Neubau eines Wohngebäudes Nachweis nach Anlage 1 Ziffer 2
Wärmschutznachweis nach DIN und DIN Rüsselsheim. Familie Silvia Scherer Reiner Schwob Rüsselsheim. Ingenieurbüro Kühne
 α Wärmschutznachweis nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Scherer/Schwob Adresse Eichengrund 13 65428 Rüsselsheim Auftraggeber Familie Silvia Scherer Reiner
α Wärmschutznachweis nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Scherer/Schwob Adresse Eichengrund 13 65428 Rüsselsheim Auftraggeber Familie Silvia Scherer Reiner
EnEV-Nachweis Störmann Bauträger GmbH Haus 4-ohne Keller-KfW-EH 55. Reckmannnallee / Rhenania Bottrop. Störmann Bauträger GmbH
 Objekt: Reckmannnallee / Rhenania, 46238 Bottrop 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus 4ohne KellerKfWEH 55 EnEVNachweis für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus
Objekt: Reckmannnallee / Rhenania, 46238 Bottrop 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus 4ohne KellerKfWEH 55 EnEVNachweis für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus
Energieberatung nach DIN und DIN Objekt: Buschrosenweg 83-91, Hamburg. Stresemannallee Hamburg
 Objekt: Buschrosenweg 839, 22299 Hamburg Mehrfamilienhaus Bestand Energieberatung nach DIN 4086 und DIN 4700 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Mehrfamilienhaus Bestand Buschrosenweg 839
Objekt: Buschrosenweg 839, 22299 Hamburg Mehrfamilienhaus Bestand Energieberatung nach DIN 4086 und DIN 4700 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Mehrfamilienhaus Bestand Buschrosenweg 839
EnEV-Nachweis Störmann Bauträger GmbH Haus 4-mit Keller-KfW-EH 55. Reckmannnallee / Rhenania Bottrop. Störmann Bauträger GmbH
 Objekt: Reckmannnallee / Rhenania, 46238 Bottrop 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus 4mit KellerKfWEH 55 EnEVNachweis für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus
Objekt: Reckmannnallee / Rhenania, 46238 Bottrop 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus 4mit KellerKfWEH 55 EnEVNachweis für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt 1714354Störmann Bauträger GmbH Haus
EnEV-Berechnungsnachweis für den Bauantrag. Anfelden Oberdachstetten. Anfelden Oberdachstetten
 EnEVBerechnungsnachweis für den Bauantrag für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Neubau Effizienzhaus 40 Anfelden 5 91617 Oberdachstetten Auftraggeber Reiner Krämer Anfelden 32 91617 Oberdachstetten
EnEVBerechnungsnachweis für den Bauantrag für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Neubau Effizienzhaus 40 Anfelden 5 91617 Oberdachstetten Auftraggeber Reiner Krämer Anfelden 32 91617 Oberdachstetten
Energieeinsparnachweis nach ENEV 2009 DIN Umbau einer Feldscheune
 Projekt : Umbau einer Feldscheune, 35274 Kirchhain Energieeinsparnachweis nach ENEV 2009 DIN 4108-6 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Umbau einer Feldscheune Adresse 35274 Kirchhain
Projekt : Umbau einer Feldscheune, 35274 Kirchhain Energieeinsparnachweis nach ENEV 2009 DIN 4108-6 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Umbau einer Feldscheune Adresse 35274 Kirchhain
Energieberatungsbericht
 Projekt: Einfamilienhaus, Medlerstraße 68, 06618 Naumburg Energieberatungsbericht Gebäude: Medlerstraße 68 06618 Naumburg Auftraggeber: Frau Heidemarie Töpp Medlerstraße 68 06618 Naumburg Erstellt von:
Projekt: Einfamilienhaus, Medlerstraße 68, 06618 Naumburg Energieberatungsbericht Gebäude: Medlerstraße 68 06618 Naumburg Auftraggeber: Frau Heidemarie Töpp Medlerstraße 68 06618 Naumburg Erstellt von:
Berechnung DIN und DIN /-12. KWN_Neubau Am Kleinen Wannsee 1A. Objekt: Am Kleinen Wannsee 1A, Berlin
 Berechnung DIN 41086 und DIN 470110/12 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Am Kleinen Wannsee 1A 14109 Berlin Auftraggeber Firma KMD Wohnen am Kleinen Wannsee GmbH Am Kleinen Wannsee 1 14109
Berechnung DIN 41086 und DIN 470110/12 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Am Kleinen Wannsee 1A 14109 Berlin Auftraggeber Firma KMD Wohnen am Kleinen Wannsee GmbH Am Kleinen Wannsee 1 14109
Energieberatung nach DIN und DIN Objekt: Eichenring Ecke Kastanienweg, Schwanebeck. Firma URSUS Development Joachim Loder
 Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Eichenring Ecke Kastanienweg 16341 Schwanebeck Auftraggeber Firma URSUS Development Joachim Loder Haeselerstraße
Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Eichenring Ecke Kastanienweg 16341 Schwanebeck Auftraggeber Firma URSUS Development Joachim Loder Haeselerstraße
Energieberatung nach DIN und DIN
 α Energieberatung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Muster Adresse Auftraggeber Adresse Muster Aussteller Energieberatung-PLUS www.energie-plus.info
α Energieberatung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Muster Adresse Auftraggeber Adresse Muster Aussteller Energieberatung-PLUS www.energie-plus.info
Energieberatung nach DIN und DIN Fam.Haus Sanierung 2-Fam.Haus
 2Fam.Haus Sanierung 2Fam.Haus Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt 2Fam.Haus Sanierung 2Fam.Haus Auftraggeber Aussteller Wohnu. Gewerbebau Fichtel
2Fam.Haus Sanierung 2Fam.Haus Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt 2Fam.Haus Sanierung 2Fam.Haus Auftraggeber Aussteller Wohnu. Gewerbebau Fichtel
EnEV Nachweis - nach DIN und DIN für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - KOPIE. Einfamiliehaus Warratz
 EnEV Nachweis nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Auftraggeber Aussteller Kälberweide 40/1 29439 Seerau i. d. Lucie Herr Holger Warratz Im Rundblick 7 29439
EnEV Nachweis nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Auftraggeber Aussteller Kälberweide 40/1 29439 Seerau i. d. Lucie Herr Holger Warratz Im Rundblick 7 29439
ENERGIEAUSWEISfür Wohngebäude
 ENERGIEAUSWEISfür Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 16.04.2019 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
ENERGIEAUSWEISfür Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 16.04.2019 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung
 Anhang: Muster A und B Muster einer Anlage gemäß 3 Abs. 2 Nr. 6 Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Gebäude / -teil Nutzungsart Wohngebäude PLZ, Ort Straße, Haus-Nr.
Anhang: Muster A und B Muster einer Anlage gemäß 3 Abs. 2 Nr. 6 Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Gebäude / -teil Nutzungsart Wohngebäude PLZ, Ort Straße, Haus-Nr.
Energieberatung nach DIN und DIN vrsz Ingenieurgesellschaft mbh
 Energieberatung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Mehrfamilien Eckhaus, Ellenbeek 35 - Adresse Ellenbeek 35 42489 Wülfrath Auftraggeber HSH Hausverwaltung
Energieberatung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Mehrfamilien Eckhaus, Ellenbeek 35 - Adresse Ellenbeek 35 42489 Wülfrath Auftraggeber HSH Hausverwaltung
Energieberatung nach DIN und DIN Dach, Fenst., HT,Heiz.Pell, WarmW.
 Objekt: Einfamilienhaus saniert Dach, Fenst., HT,Heiz.Pell, WarmW. Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Einfamilienhaus saniert Dach, Fenst.,
Objekt: Einfamilienhaus saniert Dach, Fenst., HT,Heiz.Pell, WarmW. Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Einfamilienhaus saniert Dach, Fenst.,
Transmissionswärmeverluste [W/K] nach DIN
![Transmissionswärmeverluste [W/K] nach DIN Transmissionswärmeverluste [W/K] nach DIN](/thumbs/65/52840703.jpg) Transmissionswärmeverluste [] Spezifische Transmissionswärmeverluste durch die Außenbauteile Nr. Bezeichnung Fläche A m² i durchgangskoeffzient U i W/m²K U i * A i Faktor f - U x A x f i i i Kellerdecke
Transmissionswärmeverluste [] Spezifische Transmissionswärmeverluste durch die Außenbauteile Nr. Bezeichnung Fläche A m² i durchgangskoeffzient U i W/m²K U i * A i Faktor f - U x A x f i i i Kellerdecke
Allgemeine Angaben zum Gebäude
 Allgemeine Angaben zum Gebäude Objekt: Beschreibung: Gebäudetyp: Baujahr: Wohneinheiten: Beheiztes Volumen V e : Musterstr. 1 88888 Musterstadt freistehendes Einfamilienhaus 1950 2 897 m³ Das beheizte
Allgemeine Angaben zum Gebäude Objekt: Beschreibung: Gebäudetyp: Baujahr: Wohneinheiten: Beheiztes Volumen V e : Musterstr. 1 88888 Musterstadt freistehendes Einfamilienhaus 1950 2 897 m³ Das beheizte
Haustechnisches Planungsburo Dipl.-Ing. (TU) Heiner Focke Neundorfer Str Suhl fon fax mail
 Zul.-Nr. Ing.-/Arch.-kammer Thuringen 0150-W-I-05 Anlage wh bottcherstraä e 13 Energieeinsparverordnung Projekt WH Bo ttcherstra e 13 Beschr. Anlage wh bo ttcherstra e 13 Beschr. Das Geba ude ist im Urzustand
Zul.-Nr. Ing.-/Arch.-kammer Thuringen 0150-W-I-05 Anlage wh bottcherstraä e 13 Energieeinsparverordnung Projekt WH Bo ttcherstra e 13 Beschr. Anlage wh bo ttcherstra e 13 Beschr. Das Geba ude ist im Urzustand
Energieberatung nach DIN und DIN Reitenberger, Greuter Straße 25, Horgau Bauabschnitt 1. Firma Reitenberger Bau GmbH
 Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Reitenberger, Greuter Straße 25, Horgau Bauabschnitt 1 Greuter Straße 25 86497 Horgau Auftraggeber Firma
Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Reitenberger, Greuter Straße 25, Horgau Bauabschnitt 1 Greuter Straße 25 86497 Horgau Auftraggeber Firma
Energieberatung nach DIN und DIN KfW 55 Neubau eines Einfamilienhauses
 Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt KfW 55 Neubau eines Einfamilienhauses Basisvariante Bach 18 83527 Haag Auftraggeber Max Mustermann Bach 18
Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt KfW 55 Neubau eines Einfamilienhauses Basisvariante Bach 18 83527 Haag Auftraggeber Max Mustermann Bach 18
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung für ein Gebäude mit normalen Innentemperaturen
 l. Objektbeschreibung Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung für ein Gebäude mit normalen Innentemperaturen Bezeichnung Neubau eines Reihenhauses 02 6022 Südseite Nutzungsart E Wohngebäude
l. Objektbeschreibung Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung für ein Gebäude mit normalen Innentemperaturen Bezeichnung Neubau eines Reihenhauses 02 6022 Südseite Nutzungsart E Wohngebäude
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber: Erstellt von: Herr Rainer Nowotny Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Planungsbüro Baukasten Dipl.-Ing. Architekt (FH) Christian
Energieberatungsbericht Gebäude: Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber: Erstellt von: Herr Rainer Nowotny Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Planungsbüro Baukasten Dipl.-Ing. Architekt (FH) Christian
Energetische Berechnung. nach DIN V /DIN V
 Seite 1 Energetische Berechnung nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10 Neubau EFH Trellert & Wörstenfeld Büro Roeder & Claassen Claassen Wollankstr. 124 13187 Berlin Seite 2 Inhaltsverzeichnis: Deckblatt...1
Seite 1 Energetische Berechnung nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10 Neubau EFH Trellert & Wörstenfeld Büro Roeder & Claassen Claassen Wollankstr. 124 13187 Berlin Seite 2 Inhaltsverzeichnis: Deckblatt...1
Neubaunachweis nach EnEV Ingenieurbüro Dr. Albert
 α Neubaunachweis nach EnEV 2009 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Adresse Auftraggeber Adresse Aussteller Ingenieurbüro Dr. Albert Dr.-Ing. Jörg Albert Adresse Schulte-Marxloh-Str.
α Neubaunachweis nach EnEV 2009 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Adresse Auftraggeber Adresse Aussteller Ingenieurbüro Dr. Albert Dr.-Ing. Jörg Albert Adresse Schulte-Marxloh-Str.
Einsatz Erneuerbarer Energien - EEWärmeG
 Einsatz Erneuerbarer Energien EEWärmeG Auftraggeber B.Schröder und H. Kramer SchultKruseStr.01 18546 Sassnitz Anschrift des Gebäudes Bahnhofstr.11 18609 Ostseebad Binz Gebäudequalität im Vergleich zu EnEV
Einsatz Erneuerbarer Energien EEWärmeG Auftraggeber B.Schröder und H. Kramer SchultKruseStr.01 18546 Sassnitz Anschrift des Gebäudes Bahnhofstr.11 18609 Ostseebad Binz Gebäudequalität im Vergleich zu EnEV
Rechenverfahren im Wohnungsbau
 Technische Universität München Rechenverfahren im Wohnungsbau Dipl.-Ing. Mareike Ettrich Lehrstuhl für Bauphysik, Technische Universität München Bilanzierung des Heizwärmebedarfs Q h H T Q i Q Q s h H
Technische Universität München Rechenverfahren im Wohnungsbau Dipl.-Ing. Mareike Ettrich Lehrstuhl für Bauphysik, Technische Universität München Bilanzierung des Heizwärmebedarfs Q h H T Q i Q Q s h H
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 03.11.2023 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude MFH Kap Zwenkau Leipziger straße, 04442 Zwenkau
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 03.11.2023 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude MFH Kap Zwenkau Leipziger straße, 04442 Zwenkau
Energieberatung nach DIN und DIN Hanf-Faser-Fabrik - Musterhaus. Objekt: Brüssower Allee 90, Prenzlau. Herr Rainer Nowotny
 HanfFaserFabrik Musterhaus Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt HanfFaserFabrik Musterhaus Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber Herr
HanfFaserFabrik Musterhaus Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt HanfFaserFabrik Musterhaus Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber Herr
Wärmschutznachweis nach DIN und DIN Rüsselsheim. Familie Silvia Scherer Reiner Schwob Rüsselsheim. Ingenieurbüro Kühne
 Wärmschutznachweis nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Scherer/Schwob Adresse Eichengrund 13 65428 Rüsselsheim Auftraggeber Familie Silvia Scherer Reiner
Wärmschutznachweis nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Scherer/Schwob Adresse Eichengrund 13 65428 Rüsselsheim Auftraggeber Familie Silvia Scherer Reiner
Gebäudeenergiebewertung mit dem Dachs. Art. Nr.: 07/ Änderungen und Irrtum vorbehalten GEBÄUDEENERGIEBEWERTUNG.
 0 50 100 150 200 250 300 350 GEBÄUDEENERGIEBEWERTUNG MIT DEM 1 2 Inhaltsverzeichnis 1. Gebäudeenergiebewertung mit dem...4 1.1 Eingabehilfe des für die Energieberatung...6 1.2 modernisierung im Vergleich...7
0 50 100 150 200 250 300 350 GEBÄUDEENERGIEBEWERTUNG MIT DEM 1 2 Inhaltsverzeichnis 1. Gebäudeenergiebewertung mit dem...4 1.1 Eingabehilfe des für die Energieberatung...6 1.2 modernisierung im Vergleich...7
ENERGIE BAUPHYSIK TGA
 ENERGIE BAUPHYSIK TGA Prof. Dipl.-Ing. Architektin Susanne Runkel ENERGIE, BAUPHYSIK UND TGA PROGRAMM WS 2016/17 1. 05.10.2016 Einführung, Entwicklung und Hintergrund Bauphysik 2. 12.10.2016 Wärmetransport
ENERGIE BAUPHYSIK TGA Prof. Dipl.-Ing. Architektin Susanne Runkel ENERGIE, BAUPHYSIK UND TGA PROGRAMM WS 2016/17 1. 05.10.2016 Einführung, Entwicklung und Hintergrund Bauphysik 2. 12.10.2016 Wärmetransport
Energiebedarfsberechnung
 Energiebedarfsberechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10/12 Öffentlich Rechtlicher Nachweis Bauvorhaben: Neubau eines Wohnhauses 639 Aussteller: Planungsbüro Dick Ausgestellt am 18.05.2012 Dipl.-Ing.
Energiebedarfsberechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10/12 Öffentlich Rechtlicher Nachweis Bauvorhaben: Neubau eines Wohnhauses 639 Aussteller: Planungsbüro Dick Ausgestellt am 18.05.2012 Dipl.-Ing.
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung
 Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Gebäude / -teil PLZ, Ort Baujahr AZ. des LRA Nutzungsart Wohngebäude Straße, Hausnr. Jahr d. baulichen Änderung Datum d. Baugenehmigung
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Gebäude / -teil PLZ, Ort Baujahr AZ. des LRA Nutzungsart Wohngebäude Straße, Hausnr. Jahr d. baulichen Änderung Datum d. Baugenehmigung
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung
 Anlage 1 Seite 1 Muster A: Gebäude mit normalen Innentemperaturen nach 13 Abs. 1 und 2 EnEV Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Gebäude / -teil Nutzungsart Wohngebäude
Anlage 1 Seite 1 Muster A: Gebäude mit normalen Innentemperaturen nach 13 Abs. 1 und 2 EnEV Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Gebäude / -teil Nutzungsart Wohngebäude
1. Allgemeine Projektdaten. 2. Berechnungsgrundlagen
 1. Allgemeine Projektdaten Projekt : EFH Lichthaus 121 E40 Berlin Baumaßnahme : Neubau eines Gebäudes 21.401 Gebäudetyp : Wohngebäude Innentemperatur : normale Innentemperatur Anzahl Vollgeschosse : 2
1. Allgemeine Projektdaten Projekt : EFH Lichthaus 121 E40 Berlin Baumaßnahme : Neubau eines Gebäudes 21.401 Gebäudetyp : Wohngebäude Innentemperatur : normale Innentemperatur Anzahl Vollgeschosse : 2
Energieeinsparnachweis nach EnEV 2004
 Energieeinsparnachweis nach EnEV 2004 für neu zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Sturm Variante1 Ludwigstrasse 64625 Bensheim Auftraggeber Eheleute Silke und Oliver Sturm Am Oberhof
Energieeinsparnachweis nach EnEV 2004 für neu zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Sturm Variante1 Ludwigstrasse 64625 Bensheim Auftraggeber Eheleute Silke und Oliver Sturm Am Oberhof
1. Erster Schritt: Prüfung der Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens für Wohngebäude nach EnEV
 Berechnungsschritte der Wärmeschutz- und Primärenergienachweise Im folgenden werden die verschiedenen Berechnungsschritte erläutert, die bei der Anwendung des vereinfachten Verfahrens für Wohngebäude nach
Berechnungsschritte der Wärmeschutz- und Primärenergienachweise Im folgenden werden die verschiedenen Berechnungsschritte erläutert, die bei der Anwendung des vereinfachten Verfahrens für Wohngebäude nach
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gültig bis: 09 / 2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche A N Erneuerbare
gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gültig bis: 09 / 2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche A N Erneuerbare
Studie EnEV 2002 BRUCK ZUM GLÜCK GIBT S. Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV
 ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
EnEV-Praxis EnEV-Novelle leicht und verständlich dargestellt
 Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dipl.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis EnEV-Novelle 2004 - leicht und verständlich dargestellt 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage /Bauwerk EnEV-Praxis
Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dipl.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis EnEV-Novelle 2004 - leicht und verständlich dargestellt 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage /Bauwerk EnEV-Praxis
Energieberatung nach DIN und DIN Planen Bauen Wohnen Dipl.-Ing. Jacek Slabko
 Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Effizienzhaus KfW 55 553 Servatiusstr. 112 53175 Bonn Auftraggeber Aussteller Planen Bauen Wohnen Dipl.Ing.
Energieberatung nach DIN 41086 und DIN 470110 für Gebäude mit normalen Innentemperaturen Objekt Effizienzhaus KfW 55 553 Servatiusstr. 112 53175 Bonn Auftraggeber Aussteller Planen Bauen Wohnen Dipl.Ing.
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Musterstrasse 123 12345 Musterhausen Auftraggeber: Frau Mustermann Musterstrasse 123 12345 Musterhausen Erstellt von: Energie-SPAR-Quelle Uwe Hübscher Beraternummer: 172979
Energieberatungsbericht Gebäude: Musterstrasse 123 12345 Musterhausen Auftraggeber: Frau Mustermann Musterstrasse 123 12345 Musterhausen Erstellt von: Energie-SPAR-Quelle Uwe Hübscher Beraternummer: 172979
EnEV-Nachweis. Altbau, KfW Effizienzhaus Denkmal (ab ) nach dem Monatsbilanzverfahren Architekturbüro Bunnemann
 Bauherr: Projekt: EnEVNachweis Altbau, KfW Effizienzhaus Denkmal (ab 01.04.12) nach dem Monatsbilanzverfahren Architekturbüro Bunnemann Strasse: Puschkinstraße 20 Ort: Baujahr: 1520 Sanierung eines denkmalgeschützten
Bauherr: Projekt: EnEVNachweis Altbau, KfW Effizienzhaus Denkmal (ab 01.04.12) nach dem Monatsbilanzverfahren Architekturbüro Bunnemann Strasse: Puschkinstraße 20 Ort: Baujahr: 1520 Sanierung eines denkmalgeschützten
Energieausweis für Wohngebäude
 Energieausweis für Wohngebäude gemäß ÖNORM H 5055 und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik GEBÄUDE Gebäudeart Mehrfamilienreiheneckhaus Erbaut Gebäudezone Bauteil A UFS - WBF
Energieausweis für Wohngebäude gemäß ÖNORM H 5055 und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik GEBÄUDE Gebäudeart Mehrfamilienreiheneckhaus Erbaut Gebäudezone Bauteil A UFS - WBF
Gebäudeaufnahme zur energetischen Bewertung Blatt 1/8
 Gebäudeaufnahme zur energetischen Bewertung Blatt 1/8 Allgemeine Projektdaten Datum: Objekt Bauherr Tel.: Fax: Gemarkung Flurstück Mobil: Email: Gebäudetyp Gebäudeanordnung Bauweise Dämmstandard Einfamilienhaus
Gebäudeaufnahme zur energetischen Bewertung Blatt 1/8 Allgemeine Projektdaten Datum: Objekt Bauherr Tel.: Fax: Gemarkung Flurstück Mobil: Email: Gebäudetyp Gebäudeanordnung Bauweise Dämmstandard Einfamilienhaus
BAUTEIL A. Referenz Gebäüde
 EnEV- Nachweis Projekt : 2014_NB_001 Keckeis Dorfstr. 18, 82110 Germering S e i t e 25 4. Energiebilanz Energiebedarf: Im Folgenden werden alle Energieverluste und Gewinne des Gebäudes dargestellt. ENERGIEBILANZEN
EnEV- Nachweis Projekt : 2014_NB_001 Keckeis Dorfstr. 18, 82110 Germering S e i t e 25 4. Energiebilanz Energiebedarf: Im Folgenden werden alle Energieverluste und Gewinne des Gebäudes dargestellt. ENERGIEBILANZEN
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Auftraggeber: Erstellt von: F.weg 10 a 12345 Berlin Herr Detlef Stumpf F.weg 10 a 12345 Berlin Frank Ludwig Bezirksschornsteinfegermeister Nipkowstr. 34 12489 Berlin Tel.:
Energieberatungsbericht Gebäude: Auftraggeber: Erstellt von: F.weg 10 a 12345 Berlin Herr Detlef Stumpf F.weg 10 a 12345 Berlin Frank Ludwig Bezirksschornsteinfegermeister Nipkowstr. 34 12489 Berlin Tel.:
ENEV-Berechnung nach DIN und DIN TMB Malchow Denkmal - brw+zentral ww. Firma TMB GmbH Jan Steilen. Ing.-Büro für Energieberatung
 ENEV-Berechnung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt TMB Malchow Denkmal - Adresse Mühlenstr. 69-71 17213 Malchow Auftraggeber Firma TMB GmbH Jan Steilen
ENEV-Berechnung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10 - für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt TMB Malchow Denkmal - Adresse Mühlenstr. 69-71 17213 Malchow Auftraggeber Firma TMB GmbH Jan Steilen
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 16.01.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude freistehendes Einfamilienhaus Kreisstraße,
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 16.01.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude freistehendes Einfamilienhaus Kreisstraße,
Informationen zur EnEV-Bewertung Vitovalor 300-P
 Informationen zur EnEV-Bewertung Vitovalor 300-P Allgemeines Die zwei aktuell zulässigen EnEV-Nachweisverfahren für Wohngebäude (DIN V 4701-10, DIN V 18599) enthalten kein Verfahren für die Bewertung von
Informationen zur EnEV-Bewertung Vitovalor 300-P Allgemeines Die zwei aktuell zulässigen EnEV-Nachweisverfahren für Wohngebäude (DIN V 4701-10, DIN V 18599) enthalten kein Verfahren für die Bewertung von
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis) Vom 7. März 2002
 Verkündet im Bundesanzeiger Nr.52 vom 15.März 2002, Seiten 4865 ff. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis) Vom 7. März 2002 Nach 13 Abs. 1 Satz
Verkündet im Bundesanzeiger Nr.52 vom 15.März 2002, Seiten 4865 ff. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis) Vom 7. März 2002 Nach 13 Abs. 1 Satz
Projektbeispiel: Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren
 Projektbeispiel: Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren Baujahr: 1965 Keller: unbeheizt Dachgeschoss: nicht ausgebaut 2 Wohneinheiten je 80m² Ein typisches Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren. Das Projektbeispiel
Projektbeispiel: Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren Baujahr: 1965 Keller: unbeheizt Dachgeschoss: nicht ausgebaut 2 Wohneinheiten je 80m² Ein typisches Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren. Das Projektbeispiel
KfW-Gutachten. Projekt Sanierung ZFH XXXXXXXXXXX. Gebäude Zweifamilienhaus XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
 KfW-Gutachten Projekt Sanierung ZFH XXXXXXXXXXX Gebäude Zweifamilienhaus XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Aussteller Dirk Seidler Beratungsinstitut für Rationelles Bauen Am Fuchsberg 30a 28870 Ottersberg Auftraggeber
KfW-Gutachten Projekt Sanierung ZFH XXXXXXXXXXX Gebäude Zweifamilienhaus XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Aussteller Dirk Seidler Beratungsinstitut für Rationelles Bauen Am Fuchsberg 30a 28870 Ottersberg Auftraggeber
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Heidelbergerstraße 43 64395 Brensbach Auftraggeber: Frau Bärbel Bock Heidelbergerstraße 43 64395 Brensbach Erstellt von: Funkat Haustechnik Karlheinz Funkat Installateur-
Energieberatungsbericht Gebäude: Heidelbergerstraße 43 64395 Brensbach Auftraggeber: Frau Bärbel Bock Heidelbergerstraße 43 64395 Brensbach Erstellt von: Funkat Haustechnik Karlheinz Funkat Installateur-
Entwurf Stand: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis) Vom...
 BMWi: III A 4-10 51 64 / 3 BMVBW: BS 13 830604-4 Entwurf Stand: 30.10.2001 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis) Vom... Nach 13 Abs. 1 Satz 3,
BMWi: III A 4-10 51 64 / 3 BMVBW: BS 13 830604-4 Entwurf Stand: 30.10.2001 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis) Vom... Nach 13 Abs. 1 Satz 3,
Energieeinsparnachweis nach EnEV Petra und Kai Gebhardt. Energie- und Umweltanalytik Kirner. Dipl. Ing. (FH) Siegfried Kirner.
 α Energieeinsparnachweis nach EnEV 2004 - für neu zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Einfamilienhaus Adresse Galgenfeld 5a 84171 Baierbach Auftraggeber Petra und Kai Gebhardt
α Energieeinsparnachweis nach EnEV 2004 - für neu zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Einfamilienhaus Adresse Galgenfeld 5a 84171 Baierbach Auftraggeber Petra und Kai Gebhardt
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig bis: 16.04.2024 1 Hauptnutzung / Straße Mattentwiete 6 PLZ Ort 20457 Hamburg teil Baujahr ganzes 1955 (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger 2003 Baujahr Klimaanlage
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig bis: 16.04.2024 1 Hauptnutzung / Straße Mattentwiete 6 PLZ Ort 20457 Hamburg teil Baujahr ganzes 1955 (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger 2003 Baujahr Klimaanlage
Beispielrechnungen zur Energieeinsparverordnung (EnEV) EnEV-Stand
 Beispielrechnungen zur Energieeinsparverordnung (EnEV) EnEV-Stand 16.11.2001 Gebäudedaten freistehendes Einfamilienhaus Fensterflächenanteil Fassade Nord 15 %, Süd 35 %, Ost/West 20 % Anforderung gemäß
Beispielrechnungen zur Energieeinsparverordnung (EnEV) EnEV-Stand 16.11.2001 Gebäudedaten freistehendes Einfamilienhaus Fensterflächenanteil Fassade Nord 15 %, Süd 35 %, Ost/West 20 % Anforderung gemäß
Gebäudekenndaten für das Monatsbilanzverfahren
 Gebäudekenndaten für das Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 (Juni 2003) Anhang D3 1. Transmissionswärmeverluste H T : 1.1 Berechnung des vorhandenen spezifischen Transmissionswärmeverlustes H T H
Gebäudekenndaten für das Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 (Juni 2003) Anhang D3 1. Transmissionswärmeverluste H T : 1.1 Berechnung des vorhandenen spezifischen Transmissionswärmeverlustes H T H
Heizlast, Heizwärmebedarf und Energieausweis. anhand eines Sanierungsobjekts
 Heizlast, Heizwärmebedarf und Energieausweis anhand eines Sanierungsobjekts Was Sie erwartet Die Heizlast eines Gebäudes Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes Verschiedene Sanierungsvarianten des Gebäudes
Heizlast, Heizwärmebedarf und Energieausweis anhand eines Sanierungsobjekts Was Sie erwartet Die Heizlast eines Gebäudes Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes Verschiedene Sanierungsvarianten des Gebäudes
Arbeitspaket 1: Analyse und Gegenüberstellung von Mustergebäuden bzgl. Energieeffizienz und Umweltbelastung bei Einsatz unterschiedlicher, vorgegebene
 Studie: Energetische, ökologische und ökonomische Aspekte der Fernwärme in der Hansestadt Rostock 24.02.2012 Dipl.-Ing. Martin Theile Prof. Dr.-Ing. Egon Hassel Universität Rostock Lehrstuhl für Technische
Studie: Energetische, ökologische und ökonomische Aspekte der Fernwärme in der Hansestadt Rostock 24.02.2012 Dipl.-Ing. Martin Theile Prof. Dr.-Ing. Egon Hassel Universität Rostock Lehrstuhl für Technische
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
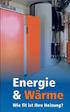 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
EnEV-Nachweis. Neu- u. Altbau, KfW Effizienzhaus 55% nach dem Monatsbilanzverfahren. 58 kwh/(m²a) 41 kwh/(m²a) Endenergiebedarf. Primärenergiebedarf
 EnEV-Nachweis Neu- u. Altbau, KfW Effizienzhaus 55% nach dem Monatsbilanzverfahren Endenergiebedarf 58 kwh/(a) 41 kwh/(a) Primärenergiebedarf 26.06.2014 Unterschrift Allgemein Projekt Projekt Brauereiboulevard
EnEV-Nachweis Neu- u. Altbau, KfW Effizienzhaus 55% nach dem Monatsbilanzverfahren Endenergiebedarf 58 kwh/(a) 41 kwh/(a) Primärenergiebedarf 26.06.2014 Unterschrift Allgemein Projekt Projekt Brauereiboulevard
5 Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude
 18 Energieeinsparverordnung 27 5 Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude 5.1 Allgemeines Die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Anforderungen gelten für zu errichtende Wohngebäude (Neubauten).
18 Energieeinsparverordnung 27 5 Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude 5.1 Allgemeines Die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Anforderungen gelten für zu errichtende Wohngebäude (Neubauten).
EnEV-Praxis 2009 Wohnbau
 Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dr.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis 2009 Wohnbau leicht und verständlich 3., aktualisierte Auflage ~auwerk Inhaltsverzeichnis EnEV-Praxis EnEV 2009 für Wohngebäude -.leicht
Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dr.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis 2009 Wohnbau leicht und verständlich 3., aktualisierte Auflage ~auwerk Inhaltsverzeichnis EnEV-Praxis EnEV 2009 für Wohngebäude -.leicht
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Gemeinde (Lehrer) wohnhaus Haunsfelder Sraße16/17 91804 Mörnsheim Auftraggeber: Marktgemeinde Mörnsheim Kastnerplatz1 91804 Mörnsheim Erstellt von: Johannes Steinhauser
Energieberatungsbericht Gebäude: Gemeinde (Lehrer) wohnhaus Haunsfelder Sraße16/17 91804 Mörnsheim Auftraggeber: Marktgemeinde Mörnsheim Kastnerplatz1 91804 Mörnsheim Erstellt von: Johannes Steinhauser
Berechnungsblätter zum Energieausweis
 Berechnungsblätter zum Energieausweis Objektbeschreibung: Gebäude / teil Straße / HausNr. PLZ / Ort Baujahr MFH Musterstraße1 99425 Weimar 198 Auftraggeber: Name Firma Straße / HausNr. PLZ / Ort Mustermann
Berechnungsblätter zum Energieausweis Objektbeschreibung: Gebäude / teil Straße / HausNr. PLZ / Ort Baujahr MFH Musterstraße1 99425 Weimar 198 Auftraggeber: Name Firma Straße / HausNr. PLZ / Ort Mustermann
Ökologisches und ökonomisches Optimum des künftigen Niedrigstenergiegebäudestandards
 Ökologisches und ökonomisches Optimum des künftigen Niedrigstenergiegebäudestandards (NZEB) Christoph Sprengard 120 Neubau 100 EnEV 2016 KfW-EH 85 H'T ist / H' T REF [%] 80 60 40 20 KfW-EH 70 NZEB, geplant
Ökologisches und ökonomisches Optimum des künftigen Niedrigstenergiegebäudestandards (NZEB) Christoph Sprengard 120 Neubau 100 EnEV 2016 KfW-EH 85 H'T ist / H' T REF [%] 80 60 40 20 KfW-EH 70 NZEB, geplant
Energieausweis für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Energieausweis für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Wickrathberger Str Mönchengladbach. Verkauf - Vermietung
 gültig bis: 23.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1900 Baujahr Anlagentechnik 1995 Anzahl Wohnungen 109 Mehr-Familienwohnhaus Wickrathberger Str. 2+10+12+16 41189 Mönchengladbach
gültig bis: 23.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1900 Baujahr Anlagentechnik 1995 Anzahl Wohnungen 109 Mehr-Familienwohnhaus Wickrathberger Str. 2+10+12+16 41189 Mönchengladbach
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 28.12.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N) Anlass der Austellung des Energieausweises MFH Sternenberg
Gültig bis: 28.12.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N) Anlass der Austellung des Energieausweises MFH Sternenberg
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 Gültig bis: 24.09.2017 1 Gebäude Gebäudetyp Mehrfamilienreihenmittelhaus Adresse Musterstr. 41, 45000 Musterstadt Gebäudeteil Mehrfamilienhaus Baujahr Gebäude 1951 Baujahr Anlagentechnik 1978 Anzahl Wohnungen
Gültig bis: 24.09.2017 1 Gebäude Gebäudetyp Mehrfamilienreihenmittelhaus Adresse Musterstr. 41, 45000 Musterstadt Gebäudeteil Mehrfamilienhaus Baujahr Gebäude 1951 Baujahr Anlagentechnik 1978 Anzahl Wohnungen
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) im Alt- und Neubau
 Die Energieeinsparverordnung (EnEV) im Alt- und Neubau architektur & energie d60 münchen / ebersberg Manfred Giglinger Fachplaner TGA u. Energieberater Natalie Neuhausen Dipl.-Ing. Univ. Architektin, Energieberaterin
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) im Alt- und Neubau architektur & energie d60 münchen / ebersberg Manfred Giglinger Fachplaner TGA u. Energieberater Natalie Neuhausen Dipl.-Ing. Univ. Architektin, Energieberaterin
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Musterstraße 10 80000 Musterort Auftraggeber: Herr Mustermann Musterstraße 10 80000 Musterort Erstellt von: Ladislaus Jocza, Dipl. Ing. (FH) BA Berater Nr. 116842 Meggendorferstr.
Energieberatungsbericht Gebäude: Musterstraße 10 80000 Musterort Auftraggeber: Herr Mustermann Musterstraße 10 80000 Musterort Erstellt von: Ladislaus Jocza, Dipl. Ing. (FH) BA Berater Nr. 116842 Meggendorferstr.
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 24.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien 1999 1999 7 595 m² Gebäudefoto (freiwillig)
Gültig bis: 24.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien 1999 1999 7 595 m² Gebäudefoto (freiwillig)
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: Aushang Sonderzone(n) teil Baujahr foto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger Baujahr Klimaanlage Nettogrundfläche Primärenergiebedarf Gesamtenergieeffizienz Aufteilung Energiebedarf Kühlung einschl.
Gültig bis: Aushang Sonderzone(n) teil Baujahr foto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger Baujahr Klimaanlage Nettogrundfläche Primärenergiebedarf Gesamtenergieeffizienz Aufteilung Energiebedarf Kühlung einschl.
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 01.01.2017 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse freistehendes Einfamilienhaus ABC-Str. 16, 55129 Beispielort Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1981 Baujahr Anlagentechnik 1998 Anzahl Wohnungen 1 Gebäudenutzfläche
Gültig bis: 01.01.2017 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse freistehendes Einfamilienhaus ABC-Str. 16, 55129 Beispielort Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1981 Baujahr Anlagentechnik 1998 Anzahl Wohnungen 1 Gebäudenutzfläche
Energieausweis für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 Energieausweis für Gültig bis: 18.10.2021 1 Gebäude Gebäudetyp Straße PLZ Ort Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Stuttgarter Strasse 27 73760 Ostfildern
Energieausweis für Gültig bis: 18.10.2021 1 Gebäude Gebäudetyp Straße PLZ Ort Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Stuttgarter Strasse 27 73760 Ostfildern
Ernst-Thälmann-Str. 50, Strausberg ganzes Gebäude. Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
 ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11.2013 09.02.2028 Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Wohngebäude Adresse ErnstThälmannStr. 50, 15344 Strausberg ganzes
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11.2013 09.02.2028 Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Wohngebäude Adresse ErnstThälmannStr. 50, 15344 Strausberg ganzes
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 07.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus, Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1965 Baujahr Anlagentechnik 1982, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013 Anzahl Wohnungen 16 Gebäudenutzfläche
Gültig bis: 07.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus, Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1965 Baujahr Anlagentechnik 1982, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013 Anzahl Wohnungen 16 Gebäudenutzfläche
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 28.12.2018 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Zweifamilienhaus Adresse Musterstr. 23, 11111 Musterburg Gebäudeteil Wohngebäude Baujahr Gebäude 1967 Baujahr Anlagentechnik 1985 Anzahl Wohnungen
Gültig bis: 28.12.2018 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Zweifamilienhaus Adresse Musterstr. 23, 11111 Musterburg Gebäudeteil Wohngebäude Baujahr Gebäude 1967 Baujahr Anlagentechnik 1985 Anzahl Wohnungen
Neu zu errichtende Gebäude
 Neu zu errichtende Gebäude 1 Geltungsbereich Gebäude mit normalen Innentemperaturen (Wohngebäude mind. 19 C) Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (Werkstätten usw. 12 C bis 19 C) Ermittlung des Jahresheizwärmebedarfes
Neu zu errichtende Gebäude 1 Geltungsbereich Gebäude mit normalen Innentemperaturen (Wohngebäude mind. 19 C) Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (Werkstätten usw. 12 C bis 19 C) Ermittlung des Jahresheizwärmebedarfes
Wärmeschutznachweis nach EnEV2009
 α Wärmeschutznachweis nach EnEV2009 - für ein Wohngebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Neubau einer Wohnanlage (26WE) mit einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage Adresse Berliner Allee 4
α Wärmeschutznachweis nach EnEV2009 - für ein Wohngebäude mit normalen Innentemperaturen - Projekt Neubau einer Wohnanlage (26WE) mit einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage Adresse Berliner Allee 4
