Studenten erforschen die Sonne Ulrich v. Kusserow
|
|
|
- Adrian Heinrich
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli Studenten erforschen die Sonne Ulrich v. Kusserow Schon seit mehr als einem Jahrzehnt führen Studenten der Bremer Universität im Rahmen ihres physikalischen Fortgeschrittenenpraktikums unter Anleitung von Mitarbeitern der Olbers-Gesellschaft Beobachtungen und Untersuchungen über die magnetische Sonne in der Walter-Stein-Sternwarte durch (siehe Abbildung 1 links). Im Weißlicht, vor allem aber auch im Licht der so genannten H-α-Spektrallinie des Wasserstoffs können von ihnen Strukturen und Entwicklungen solarer Aktivitätsgebiete durch den Einsatz leistungsfähiger Teleskope beobachtet und erforscht werden. Spezielle Filter ermöglichen Aufnahmen mit Digital- oder CCD-Kameras insbesondere von Fleckengruppen, hellen Fackelgebieten und Flares sowie riesiger, langgestreckter Gaswolken auf der hier als Filamente bezeichnet oder über dem Sonnenrand hier als Protuberanzen bezeichnet (siehe Abbildung 1 rechts). Die Abb. 2 und 3 zeigen von Studentengruppen erstellte Poster, auf denen unter anderem auch diese in der Sonnenatmosphäre beobachtbaren typischen Strukturen im Licht der H-α-Linie dargestellt sind. Neben dem Erwerb von Kenntnissen im Umgang mit den Instrumenten, über unterschiedliche Beobachtungstechniken beim Einsatz der Teleskope sowie Kenntnissen über die typischen Sonnenphänomene sollen die Studenten im Rahmen dieses Praktikumsversuchs auch erste physikalisch-theoretische Grundlagen im Bereich der Plasma- und Sonnenphysik erlernen. Wesentliches Hilfsmittel der Astrophysik ist dabei die spektroskopische Analyse der von weit entfernten Himmelskörpern ausgesandten elektromagnetischen Strahlung. Um neben den Studenten aber auch interessierten Amateurastronomen Einblicke in diesen wichtigen Forschungsbereich zu ermöglichen, haben Mitarbeiter der Olbers-Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahren mit Unterstützung auch auswärtiger Sternfreunde ein hochauflösendes Sonnenspektrometer gebaut (siehe Olbers-Nachrichten 4/2012, 2/2013, 4/2013 und im Internet). Mit Hilfe dieses Instruments können wir jetzt einzelne Absorptionslinien aus dem etwa Linien umfassenden Sonnenspektrum genauer vermessen, interessante Sachverhalte analysieren, sich ergebende Fragestellungen beantworten. Etwa 91% der Sonnenmaterie bestehen aus dem Element Wasserstoff. Neben anderen neutralen und elektrisch geladenen Partikeln absorbieren auch diese Atome an verschiedenen Stellen der Sonnenatmosphäre in unterschiedlicher Stärke Licht aus dem kontinuierlichen Spektrum der Sonne. So erscheinen an charakteristischen Stellen je nach Druck-, Temperatur- und Dichteverhältnissen mehr oder weniger dunkle und breite, in Geschwindigkeitsfeldern auf Grund des Dopplereffektes verschobene oder in Magnetfelder in mehrere Komponenten aufgespaltene Absorptionslinien. Abbildung 1: links: Denise Hogrefe und Joschka Braun bei der Beobachtung der Sonne im Licht der H-α-Linie rechts: Aufnahme von solaren Plasmawolken auf der Sonnenscheibe ( Filamente ) und über dem Sonnenrand ( Protuberanzen ) U. v. Kusserow; D. Hogrefe und J. Braun
2 10 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli 2014 Abb. 2: Poster von Denise Hogrefe und Joschka Braun in englischer Sprache
3 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli 2014 Abb. 3: Poster von Hendrik Freiheit und André Fabian Müller in deutscher Sprache 11
4 12 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli 2014 Bekanntlich bewegen sich die in der heißen Atmosphäre der Sonne besonders häufig anzutreffenden ionisierten, das heißt einfach positiv geladenen Wasserstoffatomkerne unter Einwirkung der magnetischen Lorentzkraft auf Spiralbahnen um die solaren Magnetfeldlinien. Dort, wo starke Magnetfelder anzutreffen sind, häufen sich die ionisierten Wasserstoffatome, die durch den Einfang eines Elektrons wieder neutralisiert werden können. Beim dabei erfolgenden Rücksprung der Elektronen von der 3. auf die 2. Bahn des Wasserstoffatoms wird die rote H-α-Linie aus der so genannten Balmer- Serieausgesandt, allerdings häufig nicht unbedingt wieder in Richtung des Beobachters. Das kontinuierliche Sonnenspektrum erscheint deshalb an dieser Stelle mehr oder weniger stark verdunkelt. Aufnahmen von Sonnenphänomenen im Licht der H-α-Wasserstofflinie ermöglichen tiefe Einblicke in die zugrundeliegende Topologie magnetischer Feldstrukturen, in den Verlauf der solaren Magnetfeldlinien in Bereichen der Chromosphäre und niedrigeren Korona der Sonne, wo die Temperaturen der Materie zwischen etwa C und C liegen. Wasserstoff ist ja das hier mit Abstand am häufigsten anzutreffende Atom, und wenn es ionisiert wird, orientiert es sich verstärkt entlang der Magnetfelder, sendet von hier auch die starke Wasserstofflinie aus. Protuberanzen über dem Sonnenrand erscheinen hell, weil sie die H-α-Strahlung emittieren (s. Abb. 1b). Filamente vor der Sonnenscheiben erscheinen demgegenüber dunkler, weil sie das in tieferen Schichten der Sonnenatmosphäre ausgesandte H-α-Licht absorbieren und mehr oder weniger gleichverteilt in alle möglichen Richtungen, aber deutlich weniger genau in Richtung zum Beobachter auf der Erde wieder reemitieren. Nach dem Uwe GROßKOPF, Florian KRAUSE und Ulrich v. KUSSEROW notwendige, vorbereitende und besonders umfangreiche Justierarbeiten durchgeführt hatten (siehe folgenden Artikel von Uwe GROßKOPF) ist es den Studenten Hendrik FREIHEIT und André Fabian MÜLLER jetzt gelungen, die Verschiebung einzelner Spektrallinien des Sonnenspektrums auf Grund des Dopplereffektes anhand der mit unserem Spektrometer gewonnenen Daten nachzuweisen (siehe weiteren Artikel von Hendrik FREIHEIT und André Fabian MÜLLER). Sie können damit größenordnungsmäßig die Rotationsgeschwindigkeit der Sonne abschätzen. Nach Beseitigung technischer Fehlerquellen werden die demnächst bei der Olbers-Gesellschaft forschenden Studenten sehr viel genauere Ergebnisse erzielen. Die Sonne rotiert an ihrem Äquator mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Kilometern pro Sekunde. Vorbereitung der Dopplerverschiebungs-Messung mit dem Olbers-Spektrometer Uwe Großkopf Abb. 4a : Solare Absorptionslinien und Intensitätsverteilung im Bereich der H-α-Linie des Wasserstoffs U. Großkopf, F. Krause und U. v. Kusserow Die Studenten der Universität Bremen nehmen gerne das Angebot an, bei der Olbers-Gesellschaft einen Praktikumsversuch zur Sonnenphysik zu unternehmen. Hier kommt man einmal in ein ganz anderes Labor, in dem es um viel Sonnenschein geht. Bisher haben die Studenten bei uns die Sonne mit unterschiedlichen Teleskopen und Filtern ins Visier genommen und damit die verschiedenen Schichten der Sonnenatmosphäre und ihre Strukturen untersucht, identifiziert und in Zusammenhang mit ihren Kenntnissen zur Sonnenphysik gebracht. Zusätzlich dazu können sie jetzt auch mit unserem neuen 1m-Czerny-Turner-Spektrometer das Sonnenlicht vermessen und die Besonderheiten bei einer Vielzahl von Spektrallinien im Sonnenlicht analysieren, die uns Aufschluss geben über die Beschaffenheit der Sonne. Mit dem Spektrometer lassen sich nun konkrete physikalische Parameter der Sonnenoberfläche quantitativ bestimmen. Zunächst haben wir uns vorgenommen, dass wir und die Studenten die Dopplerverschiebung messen, die durch die Sonnenrotation
5 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli Abb. 4b,c: Uwe Großkopf, Florian Krause und Ulrich v. Kusserow bei Vorbereitungsarbeiten am Spektrometer U. Großkopf, F. Krause und U. v. Kusserow hervorgerufen wird. Später möchten wir dann auch andere Veränderungen an den Spektrallinien detektieren und vermessen, die durch Elementvorkommen, Strukturvariationen, Druck, Temperatur, Ionisationsgrad oder Magnetfelder hervorgerufen werden. Doch jetzt gilt es erst einmal, das Spektrometer optimal einzustellen und die Dopplerverschiebung zu messen. Das Spektrometer ist über einen 15m langen Lichtleiter an den Zeiss-Refraktor in unserer WalterStein-Sternwarte gekoppelt, um eine optische Verbindung zu dem in der Olbers-Bibliothek befindlichen Spektrometer zu schaffen. Wir benutzen teleskopseitig als Haltevorrichtung für den Lichtleiter die Sonnenprojektionsvorrichtung, ersetzen aber die Metall-Projektionsfläche durch eine weiße Kunststofffläche, die Löcher enthält, in die der Lichtleiter geführt wird. Für die Dopplermessung ist es vorteilhaft, mindestens zwei Löcher zu haben, einmal für den linken Sonnenrand und einmal für den rechten Sonnenrand. Die Löcher müssen aber auch wirklich senkrecht zur Projektionsfläche gebohrt sein, denn der Eintrittswinkel darf für den Lichtleiter nicht zu groß sein, sonst kommt im Spektrometer kein Licht an. Das mussten wir neulich mit den Studenten feststellen, so dass wir die Dopplermessung nur mit einer Lochhalterung durchführen konnten, indem wir das Sonnenbild durch Weiterführung des Teleskops entsprechend positionierten. Wollen wir nun über die Dopplermessung die Rotationsgeschwindigkeit der Sonne an deren Äquator ermitteln, müssen wir wissen, wo der Äquator im Sonnenbild verläuft. Wir haben uns da dann an den Sonnenflecken orientiert und auch Satellitenbilder mit eingetragenen Gradnetz zu Rate gezogen. Das Spektrometer muss nun möglichst optimal eingestellt sein. Das bedeutet, dass die Spektrallinien scharf abgebildet werden müssen und auch senkrecht im Bild zu sehen sind. Dafür kann man beim Spektrometer den Eintrittsspalt hin- und herbewegen, wobei der Eintrittsspalt im Brennpunkt des Kollimatorspiegels liegen muss. Außerdem muss man den Lichtkegel des Lichtleiters optimal auf den Spalt abbilden, damit dieser gleichmäßig beleuchtet wird. Dies erreicht man durch Verschieben des Lichtleiters in der spektrometerseitigen Halterung. Das gestaltet sich alles ein wenig schwierig, denn die gekühlte Atik-Kamera, die wir für die Aufnahme der Spektren verwenden, ist keine Videokamera, die Live-Bilder liefert. Die kürzeste Belichtungszeit ist eine Sekunde und das Foto muss dann noch vom Computer ausgelesen werden. Wir können aber wohl auch nur einen Teil des Bildes auslesen, wenn wir diesen vorher markiert haben. Das Spektrometer einstellen können wir aber auch mit unserer DMK 41 Kamera, die Live-Bilder liefert und eigentlich für H-alphaFilme und Fotos oder für Planetenfotos gedacht ist. Als Lichtquelle nimmt man da am besten eine Energiesparlampe (Quecksilberdampf-Lampe), da diese helle Emissionslinien liefert. Die Absorptionslinien des Sonnenspektrums sieht man mit der DMK 41 allerdings auch, aber nur etwas verrauscht. Hat man nun mit der DMK 41 das Spektrometer optimal eingestellt, gibt es noch ein Problem, da wir für die Aufnahme der Spektren die Atik-Kamera nehmen. Die Bildebene der Atik-Kamera liegt aufgrund ihrer anderen Gehäuseabmessungen sicherlich an anderer Stelle. Die Atik-Kamera muss also dementsprechend versetzt montiert werden, die Spektrometereinstellung bleibt aber ansonsten dieselbe. Hier hilft auch eventuell ein Blick in die Datenblätter der Kameras, denn dort steht auch meistens, wie weit der CCD-Chip von der Außenkante entfernt ist. Ist die Atik-Kamera montiert, ist das Spektrometer aufnahmebereit. Allerdings muss noch die USBSchrittmotorsteuerung für die Gitterdrehung an den
6 14 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli 2014 Computer angeschlossen werden. Hinzu kommt aber nun noch, dass die Atik-Kamera eine Schwarz-Weiß Kamera ist, wir das Spektrum also nicht farbig sehen können. Da das Spektrum aufgrund der relativ hohen Auflösung auch noch ziemlich gespreizt ist (ca. 50 cm 80 cm in der Bildebene), hat man kaum Chancen zu erkennen, welchen spektralen Ausschnitt das Spektrometer gerade zeigt. Wir müssen also eigentlich eine komplette Kalibrierkurve aufnehmen, damit wir wissen, bei welcher Gitterstellung (Schrittmotorstellung) wir welchen Ausschnitt des Spektrums sehen. Wir haben uns dann zunächst für einen anderen, leicht abgewandelten Schritt entschieden. Wir haben als Kalibrierlampe eine Neonglimmlampe, von der wir das Spektrum kennen, genommen. Der spektrale Bereich, in dem wir die Dopplerverschiebung messen wollen, liegt bei 630 nm, wo sich zwei Eisenlinien der Sonne und zwei Sauerstofflinien aus der Erdatmosphäre befinden (die Sauerstofflinien unterliegen dann nicht der Dopplerverschiebung, weil sie von der Erdatmosphäre stammen). Die 630 nm liegen auch im spektralen Bereich der Neon-Kalibrierlampe und farblich gesehen sind wir da im roten Spektralbereich. Wir müssen also vor das Teleskop einen roten Filter davor schrauben, dann können wir mit dem Spektrometer nur den roten Spektralbereich detektieren und wissen grob, wo wir sind im Spektrum. Wir nahmen dafür den Energieschutzfilter von der H-alpha-Ausrüstung, dessen Transmissionskurve wir kennen. Die Bandbreite des Filters schließt bekanntlich die H-alpha-Linie mit ein. Das ist eine markante Absorptionslinie bei ca. 656 nm, weil sie verhältnismäßig breit ist. Mit Hilfe der Charakteristik der Transmissionskurve des Filters zusammen lässt sich diese Linie dann auffinden und wir sind dann schon nahe dran an den 630 nm der Eisenlinien. Jetzt lassen wir das Spektrometer an der Stelle im Spektrum stehen und stöpseln unseren Lichtleiter um auf die Neon-Kalibrierlampe. Da sieht man dann auf unserem Bildausschnitt drei Emissionslinien im typischen Abstand. Dieses Trio können wir dann anhand der bekannten Emissionskurve der Neon-Kalibrierlampe identifizieren. Nun müssen wir nur die Gitterstellung so verändern, das im Bild das Quintett derjenigen Emissionslinien erscheint, die um die 630 nm liegen. Dazu müssen wir allerdings vorher wissen, in welcher Richtung wir denn das Gitter drehen müssen, damit wir von 656 nm nach 630 nm gelangen, also zur kurzwelligen Seite. Das hatten wir glücklicherweise schon vorher einmal ausprobiert mit der Neon-Kalibrierlampe ( bei Dieter Goretzki hätten wir das allerdings auch nachlesen können). Wenn wir das Gitter auf diese Weise nun in die richtige Stellung gebracht haben, können wir wieder umstöpseln auf das Teleskop und mit der Dopplermessung beginnen. Die Atik-Kamera muss für die spektrale Aufnahme gekühlt werden, um das Rauschen zu vermindern. Die Temperatur lässt sich mit der Kamerasoftware einstellen. Nach Gebrauch der Kamera sollte man sie per Softwareregulierung allmählich wieder erwärmen lassen. Welche Belichtungszeit wir für die spektralen Aufnahmen benötigen, müssen wir ausprobieren, das kann zwischen 5 30 sec liegen. Für die Aufnahmen müssen die Studenten auch ein wenig Aerobic betreiben, denn der Lichtleiter muss während der Aufnahme ständig geschüttelt werden, um die Lichtmoden zu mischen. Das Schütteln des Lichtleiters bewirkt, dass sich der Krümmungsradius des Lichtleiters ständig ändert und sich so die optischen Wege ständig ändern. Dadurch wird ein störendes Speckle-Muster in der spektralen Aufnahme verhindert. Wir haben die Sonne spektroskopiert Hendrik Freiheit und André Fabian Müller Bei diesem Praktikumsversuch ist es uns gelungen, die Rotationsgeschwindigkeit der Sonne in der Nähe des Äquator, allerdings nicht direkt am Sonnenrand, größenordnungsmäßig zu bestimmen. Hierzu mussten wir uns anhand der Lage der Sonnenfleckenstrukturen auf beiden Hemisphären der Sonne orientieren, wie näherungsweise der Sonnenäquator verläuft. Über einen Lichtleiter wurde das Licht jeweils von Positionen in der Nähe des linken und rechten Sonnenrandes des vom Teleskop auf einen Schirm projizierten Sonnenbildes in den im benachbarten Raum stehenden Spektrografen geleitet. Dieses Gerät spaltet das einfallende Licht wie ein Prisma, allerdings mit sehr viel größerer Auflösung, in seine spektralen Bestandteile auf. Es entstehen Absorptionsspektren vom linken und rechten Sonnenrand (siehe auch Abb. 5b). Diese beiden Spektren wurden mit einer gekühlten CCD-Kamera registriert und auf relative Verschiebung zueinander untersucht. Die Skalierung des Spektrum, also die Wellenlängenzuordnung der einzelnen Absorptionslinien, erfolgte mit Hilfe eines mit einer Neonlampe gewonnenen Vergleichsspektrums (siehe Abb. 5c). Aufgrund der Sonnenrotation tritt der optische Dopplereffekt auf. Die solaren Spektrallinien des sich von uns wegbewegenden rechten Sonnenrandes sind
7 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 246 Juli Abb. 5a: André Fabian Müller und Hendrik Freiheit bei der Vorbesprechung zur Spektralanalyse mit Uwe Großkopf rot-, das heißt zu längeren Wellenlängen hin verschoben. Die des sich auf uns zu bewegenden linken Randes sind demgegenüber blau-, das heißt zu kürzeren Wellenlängen hin verschoben. Wie in unserem Poster (Abb. 3) ersichtlich ist, konnten wir aus der relativen Verschiebung der beiden Spektren zueinander die ungefähre Rotationsgeschwindigkeit der Sonne in Äquatornähe, allerdings leider nicht ganz am Rand berechnen. Die tatsächliche Rotationsgeschwindigkeit beträgt etwa m/s. Unsere Messungen ergaben allerdings einen nur etwa halb so großen Wert. Die deutliche Abweichung lässt sich gut dadurch erklären, dass unsere Messungen nicht genau genug am Sonnenäquator und auch nicht am Sonnenrand erfolgten. Bei zukünftig notwendigen Messreihen müsste die CCD-Kamera darüber hinaus noch stärker gekühlt werden, um durch Unterdrückung des Rauschens die Vergleichbarkeit mit unverschobenen terrestrischen Absorptionslinien zu gewährleisten. Uns hat das Thema dieses Praktikumsversuchs sehr gefallen. Es hat viel Spaß gemacht, einen ersten Einblick in die komplexe Plasmaphysik zu bekommen. Wir haben das erste Mal ein größeres Teleskop eigenständig bedienen können. Trotz schlechter Seeing-Bedingung war es interessant, die unterschiedlichen Sonnenphänomene zu beobachten. Es war spannend, in mühsamer Arbeit selbst Spektren aufzunehmen und auszuwerten. Ein bisschen stolz sind wir darauf, dass wir bei der Olbers-Gesellschaft das erste Mal mit spektroskopischen Methoden nachweisen konnten, dass sich die Sonne tatsächlich dreht. Abb. 5b : In der Intensitätsverteilung erkennbare Dopplerverschiebung der Spektrallinien des neutralen Eisens Abb. 5c: Absorptionsspektrum im Bereich der vermessenen Eisenlinien vom linken Sonnenrand U. v. Kusserow; A. Fabian Müller und H. Freiheit (2)
Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne (mit Lösungen) 1 Einleitung
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne (mit Lösungen) 1 Einleitung
Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Frühjahr 2018
 Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Frühjahr 2018 Aktuelle Themenvorschläge für Bachelor-Arbeiten Adaptive Optik und Bildrekonstruktion Adaptive Optik ist eine Methode, Störungen der Abbildung von kleinräumigen
Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Frühjahr 2018 Aktuelle Themenvorschläge für Bachelor-Arbeiten Adaptive Optik und Bildrekonstruktion Adaptive Optik ist eine Methode, Störungen der Abbildung von kleinräumigen
Die Sonne. das Zentrum unseres Planetensystems. Erich Laager / Bern 1
 Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems Erich Laager 2011 18.09.2012 / Bern 1 Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems 2 Die Bild-Quellen zur Sonne: NASA: 08, 14, 19, 33 ESA / NASA SOHO: 29,
Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems Erich Laager 2011 18.09.2012 / Bern 1 Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems 2 Die Bild-Quellen zur Sonne: NASA: 08, 14, 19, 33 ESA / NASA SOHO: 29,
Die Sonne ein Stern im Detail (2) Die Photosphäre
 Die Sonne ein Stern im Detail (2) Die Photosphäre Plasma der Stoff, aus dem die Sonne ist Ab einer Temperatur von 10000 K liegt die Materie vollständig im Plasmazustand vor. Dieser spezielle 4. Aggregatzustand
Die Sonne ein Stern im Detail (2) Die Photosphäre Plasma der Stoff, aus dem die Sonne ist Ab einer Temperatur von 10000 K liegt die Materie vollständig im Plasmazustand vor. Dieser spezielle 4. Aggregatzustand
Der Bau eines Spektrometers und noch mehr... Aktuelles aus der Sonnen-AG der Olbers-Gesellschaft e.v. Bremen Ulrich v. Kusserow
 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 239 Oktober 2012 4 Der Bau eines Spektrometers und noch mehr... Aktuelles aus der Sonnen-AG der Olbers-Gesellschaft e.v. Bremen Ulrich v. Kusserow Seit vielen Jahren
Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 239 Oktober 2012 4 Der Bau eines Spektrometers und noch mehr... Aktuelles aus der Sonnen-AG der Olbers-Gesellschaft e.v. Bremen Ulrich v. Kusserow Seit vielen Jahren
Spektrallinien im Sonnenspektrum "First Light" des Olbers-Spektrometers Ulrich v. Kusserow
 4 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 243 Oktober 2013 Spektrallinien im Sonnenspektrum "First Light" des Olbers-Spektrometers Ulrich v. Kusserow Sonnenspektrum und CCD-Kamera, so hieß der in den Olbers-Nachrichten
4 Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 243 Oktober 2013 Spektrallinien im Sonnenspektrum "First Light" des Olbers-Spektrometers Ulrich v. Kusserow Sonnenspektrum und CCD-Kamera, so hieß der in den Olbers-Nachrichten
Quasare Hendrik Gross
 Quasare Hendrik Gross Gliederungspunkte 1. Entdeckung und Herkunft 2. Charakteristik eines Quasars 3. Spektroskopie und Rotverschiebung 4. Wie wird ein Quasar erfasst? 5. Funktionsweise eines Radioteleskopes
Quasare Hendrik Gross Gliederungspunkte 1. Entdeckung und Herkunft 2. Charakteristik eines Quasars 3. Spektroskopie und Rotverschiebung 4. Wie wird ein Quasar erfasst? 5. Funktionsweise eines Radioteleskopes
SPEKTRALANALYSE. entwickelt um 1860 von: GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF ( ; dt. Physiker) + ROBERT WILHELM BUNSEN ( ; dt.
 SPEKTRALANALYSE = Gruppe von Untersuchungsmethoden, bei denen das Energiespektrum einer Probe untersucht wird. Man kann daraus schließen, welche Stoffe am Zustandekommen des Spektrums beteiligt waren.
SPEKTRALANALYSE = Gruppe von Untersuchungsmethoden, bei denen das Energiespektrum einer Probe untersucht wird. Man kann daraus schließen, welche Stoffe am Zustandekommen des Spektrums beteiligt waren.
Grundbausteine des Mikrokosmos (5) Die Entdeckung des Wirkungsquantums
 Grundbausteine des Mikrokosmos (5) Die Entdeckung des Wirkungsquantums Ein weiterer Zugang zur Physik der Atome, der sich als fundamental erweisen sollte, ergab sich aus der Analyse der elektromagnetischen
Grundbausteine des Mikrokosmos (5) Die Entdeckung des Wirkungsquantums Ein weiterer Zugang zur Physik der Atome, der sich als fundamental erweisen sollte, ergab sich aus der Analyse der elektromagnetischen
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 5.6: Bestimmung der Balmerserie Gruppe 2, Mittwoch: Patrick Lipinski, Sebastian Schneider Patrick Lipinski, Sebastian Schneider Seite 1 / 5 1.
Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 5.6: Bestimmung der Balmerserie Gruppe 2, Mittwoch: Patrick Lipinski, Sebastian Schneider Patrick Lipinski, Sebastian Schneider Seite 1 / 5 1.
2. Sterne im Hertzsprung-Russell-Diagramm
 2. Sterne im Hertzsprung-Russell-Diagramm Wie entstand die Astrophysik? Sternatmosphäre Planck-Spektrum Spektraltyp und Leuchtkraftklasse HRD Sternpositionen im HRD Die Sterne füllen das Diagramm nicht
2. Sterne im Hertzsprung-Russell-Diagramm Wie entstand die Astrophysik? Sternatmosphäre Planck-Spektrum Spektraltyp und Leuchtkraftklasse HRD Sternpositionen im HRD Die Sterne füllen das Diagramm nicht
A14: Zeeman-Effekt. 1. Übersicht zum Thema und Zusammenfassung der Ziele
 - A 14.1 - A14: Zeeman-Effekt 1. Übersicht zum Thema und Zusammenfassung der Ziele Im Jahre 1896 beobachtete der Holländer Peter Zeeman eine Aufspaltung der Natrium D- Linien in einem Magnetfeld. Dieser
- A 14.1 - A14: Zeeman-Effekt 1. Übersicht zum Thema und Zusammenfassung der Ziele Im Jahre 1896 beobachtete der Holländer Peter Zeeman eine Aufspaltung der Natrium D- Linien in einem Magnetfeld. Dieser
Lösung: a) b = 3, 08 m c) nein
 Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I
 Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 8 Jochen Liske Fachbereich Physik Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Astronomische Nachricht der Woche Astronomische Nachricht der Woche
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 8 Jochen Liske Fachbereich Physik Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Astronomische Nachricht der Woche Astronomische Nachricht der Woche
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Übungsfragen zu den Diagrammen
 Übungsfragen zu den Diagrammen 1. SONNENSPEKTRUM 2500 2000 1500 1000 idealer Schwarzer Körper (Temperatur 5900 K) extraterrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse AM0) terrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse
Übungsfragen zu den Diagrammen 1. SONNENSPEKTRUM 2500 2000 1500 1000 idealer Schwarzer Körper (Temperatur 5900 K) extraterrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse AM0) terrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse
Auflösung optischer Instrumente
 Aufgaben 12 Beugung Auflösung optischer Instrumente Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt
Aufgaben 12 Beugung Auflösung optischer Instrumente Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt
Baader Planetarium GmbH z.hdn.herrn Thomas Baader Zur Sternwarte Mammendorf. Heuweiler, den 7.März Sehr geehrter Herr Baader,
 Martin Federspiel, Weidweg 2, D-79194 Heuweiler Baader Planetarium GmbH z.hdn.herrn Thomas Baader Zur Sternwarte 82291 Mammendorf Geschäftsstelle: Theodor-Fontane-Weg 2 D-79312 Emmendingen Telefon 0 76
Martin Federspiel, Weidweg 2, D-79194 Heuweiler Baader Planetarium GmbH z.hdn.herrn Thomas Baader Zur Sternwarte 82291 Mammendorf Geschäftsstelle: Theodor-Fontane-Weg 2 D-79312 Emmendingen Telefon 0 76
Ph 16/01 G_Online-Ergänzung
 Ph 16/01 G_Online-Ergänzung S. I S. I + II S. II PHYSIK KAI MÜLLER Online-Ergänzung 1 Spektralanalyse für den Hausgebrauch Material Lichtquelle ( Energiesparlampe, LED-Lampe, Kerze (Vorsicht: nichts anbrennen!),
Ph 16/01 G_Online-Ergänzung S. I S. I + II S. II PHYSIK KAI MÜLLER Online-Ergänzung 1 Spektralanalyse für den Hausgebrauch Material Lichtquelle ( Energiesparlampe, LED-Lampe, Kerze (Vorsicht: nichts anbrennen!),
1 Physikalische Grundbegriffe
 1 Physikalische Grundbegriffe Um die Voraussetzungen der physikalischen Kenntnisse in den nächsten Kapiteln zu erfüllen, werden hier die dafür notwendigen Grundbegriffe 1 wie das Atom, das Proton, das
1 Physikalische Grundbegriffe Um die Voraussetzungen der physikalischen Kenntnisse in den nächsten Kapiteln zu erfüllen, werden hier die dafür notwendigen Grundbegriffe 1 wie das Atom, das Proton, das
Abiturprüfung Physik, Grundkurs. Aufgabe: Die Helmholtzspule, die Messung des Erdmagnetfeldes sowie seine Wirkung auf geladene Teilchen
 Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2012 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Die Helmholtzspule, die Messung des Erdmagnetfeldes sowie seine Wirkung auf geladene Teilchen Ein homogenes Magnetfeld in einem
Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2012 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Die Helmholtzspule, die Messung des Erdmagnetfeldes sowie seine Wirkung auf geladene Teilchen Ein homogenes Magnetfeld in einem
Mittel- und Oberstufe - MITTEL:
 Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Versuch 33: Messung mit einer Vakuum-Photozelle Seite 1
 Versuch 33: Messung mit einer Vakuum-Photozelle Seite Aufgabe: Messverfahren: Vorkenntnisse: Lehrinhalt: Bestimmung der Charakteristik einer Photozelle Messung des Photostroms mit Hilfe eines Galvanometers
Versuch 33: Messung mit einer Vakuum-Photozelle Seite Aufgabe: Messverfahren: Vorkenntnisse: Lehrinhalt: Bestimmung der Charakteristik einer Photozelle Messung des Photostroms mit Hilfe eines Galvanometers
Spektren von Himmelskörpern
 Spektren von Himmelskörpern Inkohärente Lichtquellen Tobias Schulte 25.05.2016 1 Gliederung Schwarzkörperstrahlung Spektrum der Sonne Spektralklassen Hertzsprung Russell Diagramm Scheinbare und absolute
Spektren von Himmelskörpern Inkohärente Lichtquellen Tobias Schulte 25.05.2016 1 Gliederung Schwarzkörperstrahlung Spektrum der Sonne Spektralklassen Hertzsprung Russell Diagramm Scheinbare und absolute
Physik Q4 (sp, )
 DIE SONNE Physik Q4 (sp, 10.02.2017) SONNE UND SONNENSYSTEM I Sonne ist von erheblicher Bedeutung als Energiequelle Kernfusion im Innern enthält ca. 99 % der Masse des Sonnensystems da wir sie gut beobachten
DIE SONNE Physik Q4 (sp, 10.02.2017) SONNE UND SONNENSYSTEM I Sonne ist von erheblicher Bedeutung als Energiequelle Kernfusion im Innern enthält ca. 99 % der Masse des Sonnensystems da wir sie gut beobachten
Die Natriumlinie. und Absorption, Emission, Dispersion, Spektren, Resonanz Fluoreszenz, Lumineszenz
 Die Natriumlinie und Absorption, Emission, Dispersion, Spektren, Resonanz Fluoreszenz, Lumineszenz Absorption & Emissionsarten Absorption (Aufnahme von Energie) Atome absorbieren Energien, z.b. Wellenlängen,
Die Natriumlinie und Absorption, Emission, Dispersion, Spektren, Resonanz Fluoreszenz, Lumineszenz Absorption & Emissionsarten Absorption (Aufnahme von Energie) Atome absorbieren Energien, z.b. Wellenlängen,
Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre?
 Spektren 1 Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre? Der UV- und höherenergetische Anteil wird fast
Spektren 1 Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre? Der UV- und höherenergetische Anteil wird fast
Die Sonne ein Feuerball wird untersucht
 Die Sonne ein Feuerball wird untersucht Sonnenforschung in Südniedersachsen Andreas Lagg Max-Planck Planck-Institut für Sonnensystemforschung Katlenburg-Lindau Übersicht: Was wissen wir über die Sonne?
Die Sonne ein Feuerball wird untersucht Sonnenforschung in Südniedersachsen Andreas Lagg Max-Planck Planck-Institut für Sonnensystemforschung Katlenburg-Lindau Übersicht: Was wissen wir über die Sonne?
Labor für Technische Akustik
 Labor für Technische Akustik Kraus Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur optischen Ermittlung der Schallgeschwindigkeit. 1. Versuchsziel In einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Küvette ist eine stehende
Labor für Technische Akustik Kraus Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur optischen Ermittlung der Schallgeschwindigkeit. 1. Versuchsziel In einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Küvette ist eine stehende
Einfaches Spektroskop aus alltäglichen Gegenständen
 Illumina-Chemie.de - Artikel Physik aus alltäglichen Gegenständen Im Folgenden wird der Bau eines sehr einfachen Spektroskops aus alltäglichen Dingen erläutert. Es dient zur Untersuchung von Licht im sichtbaren
Illumina-Chemie.de - Artikel Physik aus alltäglichen Gegenständen Im Folgenden wird der Bau eines sehr einfachen Spektroskops aus alltäglichen Dingen erläutert. Es dient zur Untersuchung von Licht im sichtbaren
7. Das Bohrsche Modell des Wasserstoff-Atoms. 7.1 Stabile Elektronbahnen im Atom
 phys4.08 Page 1 7. Das Bohrsche Modell des Wasserstoff-Atoms 7.1 Stabile Elektronbahnen im Atom Atommodell: positiv geladene Protonen (p + ) und Neutronen (n) im Kern negative geladene Elektronen (e -
phys4.08 Page 1 7. Das Bohrsche Modell des Wasserstoff-Atoms 7.1 Stabile Elektronbahnen im Atom Atommodell: positiv geladene Protonen (p + ) und Neutronen (n) im Kern negative geladene Elektronen (e -
Schwierigkeitsgrad Projekt 3 Die Rotation der Sonne ( 1 ) Grundschule
 Schwierigkeitsgrad Projekt 3 Die Rotation der Sonne ( 1 ) Grundschule - GERÄTE: ein Solarscope eine genau gehende Uhr einen Messschirm Dieses Experiment kann in einem nach Süden gerichteten Raum oder an
Schwierigkeitsgrad Projekt 3 Die Rotation der Sonne ( 1 ) Grundschule - GERÄTE: ein Solarscope eine genau gehende Uhr einen Messschirm Dieses Experiment kann in einem nach Süden gerichteten Raum oder an
Bestimmung der Radialgeschwindigkeit von M31
 Bestimmung der Radialgeschwindigkeit von M31 Gregor Krannich, 22.11.2015 Am 16.11.2015 nahm ich Spektren vom Kernbereich der Andromedagalaxie (M31) und von einem Referenzstern (Zeta Andromedae) auf. Ziel
Bestimmung der Radialgeschwindigkeit von M31 Gregor Krannich, 22.11.2015 Am 16.11.2015 nahm ich Spektren vom Kernbereich der Andromedagalaxie (M31) und von einem Referenzstern (Zeta Andromedae) auf. Ziel
Astronomische Einheit
 Einführung in die Astronomie ii Sommersemester 2016 Musterlösung Nützliche Konstanten Astronomische Einheit Parsec Gravitationskonstante Sonnenmasse Sonnenleuchtkraft Lichtgeschwindigkeit Hubble Konstante
Einführung in die Astronomie ii Sommersemester 2016 Musterlösung Nützliche Konstanten Astronomische Einheit Parsec Gravitationskonstante Sonnenmasse Sonnenleuchtkraft Lichtgeschwindigkeit Hubble Konstante
Technische Raytracer
 University of Applied Sciences 05. Oktober 2016 Technische Raytracer 2 s 2 (1 (n u) 2 ) 3 u 0 = n 1 n 2 u n 4 n 1 n 2 n u 1 n1 n 2 5 Licht und Spektrum 19.23 MM Double Gauss - U.S. Patent 2,532,751 Scale:
University of Applied Sciences 05. Oktober 2016 Technische Raytracer 2 s 2 (1 (n u) 2 ) 3 u 0 = n 1 n 2 u n 4 n 1 n 2 n u 1 n1 n 2 5 Licht und Spektrum 19.23 MM Double Gauss - U.S. Patent 2,532,751 Scale:
Übungsaufgaben zu Interferenz
 Übungsaufgaben zu Interferenz ˆ Aufgabe 1: Interferenzmaxima Natrium der Wellenlänge λ = 589 nm falle senkrecht auf ein quadratisches Beugungsgitter mit der Seitenlänge cm mit 4000 Linien pro Zentimeter.
Übungsaufgaben zu Interferenz ˆ Aufgabe 1: Interferenzmaxima Natrium der Wellenlänge λ = 589 nm falle senkrecht auf ein quadratisches Beugungsgitter mit der Seitenlänge cm mit 4000 Linien pro Zentimeter.
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Beugung. Durchgeführt am Gruppe X. Name 1 und Name 2
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Einführung in die Astronomie
 Einführung in die Astronomie Die Sonne Die Sonne ist ein Durchschnittsstern, wenn wir sie nach Grösse, Leuchtkraft und Lebensalter mit anderen Sternen vergleichen. Viele Eigenschaften der Sonne lassen
Einführung in die Astronomie Die Sonne Die Sonne ist ein Durchschnittsstern, wenn wir sie nach Grösse, Leuchtkraft und Lebensalter mit anderen Sternen vergleichen. Viele Eigenschaften der Sonne lassen
Ausgewählte Beobachtungen Juli bis Dezember (Aktuellstes am Schluß)
 Ausgewählte Beobachtungen Juli bis Dezember 2016 (Aktuellstes am Schluß) Im Text Verwendete Kürzel der Fernrohrkonfiguration Kontinuum (Weißlicht) W1 Refraktor 102 f=714mm Sonnenfilterfolie Kontinuums-
Ausgewählte Beobachtungen Juli bis Dezember 2016 (Aktuellstes am Schluß) Im Text Verwendete Kürzel der Fernrohrkonfiguration Kontinuum (Weißlicht) W1 Refraktor 102 f=714mm Sonnenfilterfolie Kontinuums-
SONNENBEOBACHTUNG. Um die Sonne richtig zu beobachten braucht man geeignete Hilfsmittel
 Um die Sonne richtig zu beobachten braucht man geeignete Hilfsmittel Für das Gefahrlose beobachten reicht keine starke Sonnenbrille oder eine Schweißbrille oder mit Ruß geschwärztes Glas Die Sonnenstrahlung
Um die Sonne richtig zu beobachten braucht man geeignete Hilfsmittel Für das Gefahrlose beobachten reicht keine starke Sonnenbrille oder eine Schweißbrille oder mit Ruß geschwärztes Glas Die Sonnenstrahlung
SS 2015 Supplement to Experimental Physics 2 (LB-Technik) Prof. E. Resconi
 Quantenmechanik des Wasserstoff-Atoms [Kap. 8-10 Haken-Wolf Atom- und Quantenphysik ] - Der Aufbau der Atome Quantenmechanik ==> Atomphysik Niels Bohr, 1913: kritische Entwicklung, die schließlich Plancks
Quantenmechanik des Wasserstoff-Atoms [Kap. 8-10 Haken-Wolf Atom- und Quantenphysik ] - Der Aufbau der Atome Quantenmechanik ==> Atomphysik Niels Bohr, 1913: kritische Entwicklung, die schließlich Plancks
Grundlagen Kreative Fotografie
 123FOTOWORKSHOP KOMPAKT FOTOSCHULE DES SEHENS (HRSG.) Grundlagen Kreative Fotografie Profifotos in 3 Schritten Faszinierende Bildideen und ihre Umsetzung Gemeinsam kreativ sein 19 Wenn Sie also beispielsweise
123FOTOWORKSHOP KOMPAKT FOTOSCHULE DES SEHENS (HRSG.) Grundlagen Kreative Fotografie Profifotos in 3 Schritten Faszinierende Bildideen und ihre Umsetzung Gemeinsam kreativ sein 19 Wenn Sie also beispielsweise
Die Sonne im violetten Kalziumlicht - Einleitung und Allgemeines
 Die Sonne im violetten Kalziumlicht - Einleitung und Allgemeines Joseph Fraunhofer hat 1814 erstmals die solaren Spektrallinien beobachtet und die auffälligsten mit Großbuchstaben durchnummeriert. Die
Die Sonne im violetten Kalziumlicht - Einleitung und Allgemeines Joseph Fraunhofer hat 1814 erstmals die solaren Spektrallinien beobachtet und die auffälligsten mit Großbuchstaben durchnummeriert. Die
Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences. 04. Oktober 2016 HSD. Solarenergie. Die Sonne
 Solarenergie Die Sonne Wärmestrahlung Wärmestrahlung Lichtentstehung Wärme ist Bewegung der Atome Im Festkörper ist die Bewegung Schwingung Diese Schwingungen können selber Photonen aufnehmen und abgeben
Solarenergie Die Sonne Wärmestrahlung Wärmestrahlung Lichtentstehung Wärme ist Bewegung der Atome Im Festkörper ist die Bewegung Schwingung Diese Schwingungen können selber Photonen aufnehmen und abgeben
Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Weisslicht bei 540 nm aufgenommen mit dem TeleVue NP-101 APO Refraktor
 Was ist auf Sonnenbiln sehen? Written by Frt - Last Updated Say, 18 August 2013 14:03 Weisslicht 540 aufgenommen TeleVue NP-101 APO Refraktor 1/5 Was ist auf Sonnenbiln sehen? Written by Frt - Last Updated
Was ist auf Sonnenbiln sehen? Written by Frt - Last Updated Say, 18 August 2013 14:03 Weisslicht 540 aufgenommen TeleVue NP-101 APO Refraktor 1/5 Was ist auf Sonnenbiln sehen? Written by Frt - Last Updated
1. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen
 Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 26..205 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles verboten. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, bei dem Reflexion
Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 26..205 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles verboten. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, bei dem Reflexion
Abiturprüfung Physik, Grundkurs
 Seite 1 von 7 Abiturprüfung 2011 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Der Doppelspalt 1.1 Interferenzen bei Licht In einem ersten Experiment untersucht man Interferenzen von sichtbarem Licht,
Seite 1 von 7 Abiturprüfung 2011 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Der Doppelspalt 1.1 Interferenzen bei Licht In einem ersten Experiment untersucht man Interferenzen von sichtbarem Licht,
Lichtbrechung / Lichtbeugung
 Lichtbrechung / Lichtbeugung 1. Aufgaben 1. Über die Beugung an einem Gitter sind die Wellenlängen ausgewählter Spektrallinien von Quecksilberdampf zu bestimmen. 2. Für ein Prisma ist die Dispersionskurve
Lichtbrechung / Lichtbeugung 1. Aufgaben 1. Über die Beugung an einem Gitter sind die Wellenlängen ausgewählter Spektrallinien von Quecksilberdampf zu bestimmen. 2. Für ein Prisma ist die Dispersionskurve
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern
 Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgabe ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgabe ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Versuchsanleitung. Vergleichen Sie das direkt hinter dem Monochomator und das hinter der Faser gemessene Spektrum. Wie gut ist die Einkoppeleffizienz?
 Versuch 38: Optische und elektrische Eigenschaften von mikrostrukturierten Halbleitern Versuchsanleitung Vorbemerkung: Dieser Versuch bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die gegebenen Proben mit den zur
Versuch 38: Optische und elektrische Eigenschaften von mikrostrukturierten Halbleitern Versuchsanleitung Vorbemerkung: Dieser Versuch bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die gegebenen Proben mit den zur
Gitter. Schriftliche VORbereitung:
 D06a In diesem Versuch untersuchen Sie die physikalischen Eigenschaften eines optischen s. Zu diesen za hlen insbesondere die konstante und das Auflo sungsvermo gen. Schriftliche VORbereitung: Wie entsteht
D06a In diesem Versuch untersuchen Sie die physikalischen Eigenschaften eines optischen s. Zu diesen za hlen insbesondere die konstante und das Auflo sungsvermo gen. Schriftliche VORbereitung: Wie entsteht
Versuch C: Auflösungsvermögen Einleitung
 Versuch C: svermögen Einleitung Das AV wird üblicherweise in Linienpaaren pro mm (Lp/mm) angegeben und ist diejenige Anzahl von Linienpaaren, bei der ein normalsichtiges Auge keinen Kontrastunterschied
Versuch C: svermögen Einleitung Das AV wird üblicherweise in Linienpaaren pro mm (Lp/mm) angegeben und ist diejenige Anzahl von Linienpaaren, bei der ein normalsichtiges Auge keinen Kontrastunterschied
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A3 - Atomspektren - BALMER-Serie» Martin Wolf Betreuer: DP Emmrich Mitarbeiter: Martin Helfrich
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A3 - Atomspektren - BALMER-Serie» Martin Wolf Betreuer: DP Emmrich Mitarbeiter: Martin Helfrich
Das Wasserstoffatom Energiestufen im Atom
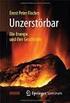 11. 3. Das Wasserstoffatom 11.3.1 Energiestufen im Atom Vorwissen: Hg und Na-Dampflampe liefern ein charakteristisches Spektrum, das entweder mit einem Gitter- oder einem Prismenspektralapparat betrachtet
11. 3. Das Wasserstoffatom 11.3.1 Energiestufen im Atom Vorwissen: Hg und Na-Dampflampe liefern ein charakteristisches Spektrum, das entweder mit einem Gitter- oder einem Prismenspektralapparat betrachtet
Große Teleskope für kleine Wellen
 Große Teleskope für kleine Wellen Deutsche Zusammenfassung der Antrittsvorlesung von Dr. Floris van der Tak, zur Gelegenheit seiner Ernennung als Professor der Submillimeter-Astronomie an der Universität
Große Teleskope für kleine Wellen Deutsche Zusammenfassung der Antrittsvorlesung von Dr. Floris van der Tak, zur Gelegenheit seiner Ernennung als Professor der Submillimeter-Astronomie an der Universität
SONNENBEOBACHTUNG. Um die Sonne richtig zu beobachten braucht man geeignete Hilfsmittel
 Um die Sonne richtig zu beobachten braucht man geeignete Hilfsmittel Für das gefahrlose Beobachten reicht keine starke Sonnenbrille oder eine Schweißbrille oder mit Ruß geschwärztes Glas Die Sonnenstrahlung
Um die Sonne richtig zu beobachten braucht man geeignete Hilfsmittel Für das gefahrlose Beobachten reicht keine starke Sonnenbrille oder eine Schweißbrille oder mit Ruß geschwärztes Glas Die Sonnenstrahlung
P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e
 Praktische Astronomie Sommersemester 08 Klaus Reitberger csaf8510@uibk.ac.at 0516683 P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e von Klaus Reitberger 1 1 Zusammenfassung Ein Teil der Vorlesung
Praktische Astronomie Sommersemester 08 Klaus Reitberger csaf8510@uibk.ac.at 0516683 P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e von Klaus Reitberger 1 1 Zusammenfassung Ein Teil der Vorlesung
Dispersion von Prismen (O2)
 Dispersion von Prismen (O) Ziel des Versuches Für drei Prismen aus verschiedenen Glassorten soll durch die Methode der Minimalablenkung die Dispersion, d. h. die Abhängigkeit der Brechungsindizes von der
Dispersion von Prismen (O) Ziel des Versuches Für drei Prismen aus verschiedenen Glassorten soll durch die Methode der Minimalablenkung die Dispersion, d. h. die Abhängigkeit der Brechungsindizes von der
Abb. A Schematische Darstellung der Sonnenfleckenzyklen Nr
 Der Riesen-Sonnenfleck AR2529 [16. Apr.] Unsere Sonne [1] ist ein heisser Gasball, ohne eine feste Oberfläche. Sie rotiert in 25 Tagen einmal um sich selbst, an den Polen ist diese Rotation etwas langsamer.
Der Riesen-Sonnenfleck AR2529 [16. Apr.] Unsere Sonne [1] ist ein heisser Gasball, ohne eine feste Oberfläche. Sie rotiert in 25 Tagen einmal um sich selbst, an den Polen ist diese Rotation etwas langsamer.
Beobachtung von Sonnenflecken und Bestimmung der Rotationsdauer
 Beobachtung von Sonnenflecken und Bestimmung der Rotationsdauer Zwischenbericht, Stand Okt. 2018 1. Vorüberlegungen Eine schulische Astronomie-AG benötigt natürlich interessante, praktische Aufgaben, damit
Beobachtung von Sonnenflecken und Bestimmung der Rotationsdauer Zwischenbericht, Stand Okt. 2018 1. Vorüberlegungen Eine schulische Astronomie-AG benötigt natürlich interessante, praktische Aufgaben, damit
Wie das unsichtbare Infrarotweltall seine Geheimnisse Preis gibt Cecilia Scorza
 Wie das unsichtbare Infrarotweltall seine Geheimnisse Preis gibt Cecilia Scorza Einen großen Teil ihrer Information über die kosmischen Objekte erhalten die Astronomen im Infrarotbereich, einem Bereich
Wie das unsichtbare Infrarotweltall seine Geheimnisse Preis gibt Cecilia Scorza Einen großen Teil ihrer Information über die kosmischen Objekte erhalten die Astronomen im Infrarotbereich, einem Bereich
Weißes Licht wird farbig
 B1 Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Halogenlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Prisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter dem Prisma
B1 Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Halogenlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Prisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter dem Prisma
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.6: Beugung am Gitter Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1 Bestimmung des Gitters mit der kleinsten Gitterkonstanten
Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.6: Beugung am Gitter Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1 Bestimmung des Gitters mit der kleinsten Gitterkonstanten
Ausgewählte Beobachtungen (Aktuellstes am Schluß)
 Ausgewählte Beobachtungen 2017 (Aktuellstes am Schluß) Im Text Verwendete Kürzel der Fernrohrkonfiguration Kontinuum (Weißlicht) W1 Refraktor 102 f=714mm Sonnenfilterfolie Kontinuums- + Infrarotfilter
Ausgewählte Beobachtungen 2017 (Aktuellstes am Schluß) Im Text Verwendete Kürzel der Fernrohrkonfiguration Kontinuum (Weißlicht) W1 Refraktor 102 f=714mm Sonnenfilterfolie Kontinuums- + Infrarotfilter
Delphinus. Neue Beobachtungen zum Jahreswechsel 2008 und 2009
 Delphinus DeNie's Mitteilungsblatt für visuelle astronomische Beobachtung Nr. 1 Vol. 5-23. Jul. 2010 Die ersten visuellen Beobachtungen vom 30.August 2008 im folgenden: Neue Beobachtungen zum Jahreswechsel
Delphinus DeNie's Mitteilungsblatt für visuelle astronomische Beobachtung Nr. 1 Vol. 5-23. Jul. 2010 Die ersten visuellen Beobachtungen vom 30.August 2008 im folgenden: Neue Beobachtungen zum Jahreswechsel
Natürliches Licht und Farbfilter
 4. Versuchsdurchführung 4.1. Bestimmen der Gitterkonstante abor zum Physikalisches Praktikum Natürliches icht und Farbfilter Die Entfernung zwischen Gitter und Intensitätsmeßgerät beträgt 1,20m. Der Abstand
4. Versuchsdurchführung 4.1. Bestimmen der Gitterkonstante abor zum Physikalisches Praktikum Natürliches icht und Farbfilter Die Entfernung zwischen Gitter und Intensitätsmeßgerät beträgt 1,20m. Der Abstand
10. Der Spin des Elektrons
 10. Elektronspin Page 1 10. Der Spin des Elektrons Beobachtung: Aufspaltung von Spektrallinien in nahe beieinander liegende Doppellinien z.b. die erste Linie der Balmer-Serie (n=3 -> n=2) des Wasserstoff-Atoms
10. Elektronspin Page 1 10. Der Spin des Elektrons Beobachtung: Aufspaltung von Spektrallinien in nahe beieinander liegende Doppellinien z.b. die erste Linie der Balmer-Serie (n=3 -> n=2) des Wasserstoff-Atoms
Merkurtransit 2016. Insgesamt waren vier Fernrohre im Einsatz:
 Merkurtransit 2016 Etwa einmal im Jahrzehnt (zuletzt 2003, dann wieder 2019 und 2032) kann man von Deutschland beobachten, wie der Planet Merkur vor der Sonnenscheibe entlang zieht. Am Montag, 9. Mai 2016,
Merkurtransit 2016 Etwa einmal im Jahrzehnt (zuletzt 2003, dann wieder 2019 und 2032) kann man von Deutschland beobachten, wie der Planet Merkur vor der Sonnenscheibe entlang zieht. Am Montag, 9. Mai 2016,
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern
 Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
PHY. Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop Versuch: 17. Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop
 Testat Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop Versuch: 17 Mo Di Mi Do Fr Datum: Abgabe: Fachrichtung Sem. Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop 1. Aufgabenstellung 1.1. Für eine vorgegebene Wellenlänge
Testat Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop Versuch: 17 Mo Di Mi Do Fr Datum: Abgabe: Fachrichtung Sem. Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop 1. Aufgabenstellung 1.1. Für eine vorgegebene Wellenlänge
Prüfung aus Physik III (PHB3) Freitag 18. Juli 2008
 Fachhochschule München FK06 Sommersemester 2008 Prüfer: Prof. Dr. Maier Zweitprüfer: Prof. Dr. Herberg Prüfung aus Physik III (PHB3) Freitag 18. Juli 2008 Zugelassene Hilfsmittel: Formelsammlung (wird
Fachhochschule München FK06 Sommersemester 2008 Prüfer: Prof. Dr. Maier Zweitprüfer: Prof. Dr. Herberg Prüfung aus Physik III (PHB3) Freitag 18. Juli 2008 Zugelassene Hilfsmittel: Formelsammlung (wird
Physikalisches Praktikum 4. Semester
 Torsten Leddig 11.Mai 2005 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Enenkel Physikalisches Praktikum 4. Semester - Lichtreflexion - 1 Ziel Auseinandersetzung mit den Theorien der Lichtreflexion Experimentelle Anwendung
Torsten Leddig 11.Mai 2005 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Enenkel Physikalisches Praktikum 4. Semester - Lichtreflexion - 1 Ziel Auseinandersetzung mit den Theorien der Lichtreflexion Experimentelle Anwendung
) 2. Für den Kugelradius wird gewählt R K
 Elementare Konstruktion eines Lichtwegs bei ortsabhängigem Brechungsindex 1 Elementare Konstruktion eines Lichtwegs bei ortsabhängigem Brechungsindex Für die wird in der Zeichnung ein Radius r S =1 cm
Elementare Konstruktion eines Lichtwegs bei ortsabhängigem Brechungsindex 1 Elementare Konstruktion eines Lichtwegs bei ortsabhängigem Brechungsindex Für die wird in der Zeichnung ein Radius r S =1 cm
Die Sonne ein Stern im Detail (1)
 Die Sonne ein Stern im Detail (1) Die grundlegenden Parameter der Sonne und wie sie bestimmt werden Größe: Wenn die Entfernung der Erde zur Sonne und ihr scheinbarer Winkelfurchmesser bekannt ist, kann
Die Sonne ein Stern im Detail (1) Die grundlegenden Parameter der Sonne und wie sie bestimmt werden Größe: Wenn die Entfernung der Erde zur Sonne und ihr scheinbarer Winkelfurchmesser bekannt ist, kann
Licht als Teilchenstrahlung
 Der Photoeffekt: die auf die Materie einfallende Strahlung löst ein Elektron aus. Es gibt eine Grenzfrequenz, welche die Strahlung haben muss, um das Atom gerade zu ionisieren. Licht als Teilchenstrahlung
Der Photoeffekt: die auf die Materie einfallende Strahlung löst ein Elektron aus. Es gibt eine Grenzfrequenz, welche die Strahlung haben muss, um das Atom gerade zu ionisieren. Licht als Teilchenstrahlung
Das Atom Aufbau der Materie (Vereinfachtes Bohrsches Atommodell)
 Das Atom Aufbau der Materie (Vereinfachtes Bohrsches Atommodell) Referat von Anna-Lena Butke und Kristina Lechner Übersicht Niels Bohr (Biographie) Das Bohrsche Atommodell Das Spektrum des Wasserstoffatoms
Das Atom Aufbau der Materie (Vereinfachtes Bohrsches Atommodell) Referat von Anna-Lena Butke und Kristina Lechner Übersicht Niels Bohr (Biographie) Das Bohrsche Atommodell Das Spektrum des Wasserstoffatoms
2. Klassenarbeit Thema: Optik
 2. Klassenarbeit Thema: Optik Physik 9d Name: e-mail: 0. Für saubere und übersichtliche Darstellung, klar ersichtliche Rechenwege, Antworten in ganzen Sätzen und Zeichnungen mit spitzem Bleistift erhältst
2. Klassenarbeit Thema: Optik Physik 9d Name: e-mail: 0. Für saubere und übersichtliche Darstellung, klar ersichtliche Rechenwege, Antworten in ganzen Sätzen und Zeichnungen mit spitzem Bleistift erhältst
Physikalisches Praktikum 5. Semester
 Torsten Leddig 03.November 2005 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr. Ziems Physikalisches Praktikum 5. Semester - Spektrograph - 1 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbetrachtung 3 1.1 Prisma...............................................
Torsten Leddig 03.November 2005 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr. Ziems Physikalisches Praktikum 5. Semester - Spektrograph - 1 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbetrachtung 3 1.1 Prisma...............................................
Entstehung des Lichtes und Emissionsspektroskopie
 Entstehung des Lichtes und Emissionsspektroskopie Entstehung des Lichtes Abb. 1 Entstehung des Lichtes Durch Energiezufuhr von Aussen (z.b. Erhitzen) kann die Lage der Elektronen in einem Atom verändert,
Entstehung des Lichtes und Emissionsspektroskopie Entstehung des Lichtes Abb. 1 Entstehung des Lichtes Durch Energiezufuhr von Aussen (z.b. Erhitzen) kann die Lage der Elektronen in einem Atom verändert,
Hallwachs-Experiment. Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe
 Hallwachs-Experiment Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe 20.09.2012 Skizziere das Experiment Notiere und Interpretiere die Beobachtungen Photoeffekt Bestrahlt
Hallwachs-Experiment Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe 20.09.2012 Skizziere das Experiment Notiere und Interpretiere die Beobachtungen Photoeffekt Bestrahlt
Spektroskopie. Einleitung
 Spektroskopie Einleitung Schon der Name Quantenphysik drückt aus, dass auf der Ebene der kleinsten physikalischen Objekte (z.b. Atome, Protonen, Neutronen oder Elektronen), bestimmte physikalische Gröÿen
Spektroskopie Einleitung Schon der Name Quantenphysik drückt aus, dass auf der Ebene der kleinsten physikalischen Objekte (z.b. Atome, Protonen, Neutronen oder Elektronen), bestimmte physikalische Gröÿen
Spektroskopie. Einleitung
 Spektroskopie Einleitung Schon der Name Quantenphysik drückt aus, dass auf der Ebene der kleinsten physikalischen Objekte (z.b. Atome, Protonen, Neutronen oder Elektronen), bestimmte physikalische Gröÿen
Spektroskopie Einleitung Schon der Name Quantenphysik drückt aus, dass auf der Ebene der kleinsten physikalischen Objekte (z.b. Atome, Protonen, Neutronen oder Elektronen), bestimmte physikalische Gröÿen
Abiturprüfung Physik, Grundkurs
 Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer Bedeutung.
Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer Bedeutung.
Physik, grundlegendes Anforderungsniveau
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Die differenzielle Rotation der Sonne
 Die differenzielle Rotation der Sonne Arbeitsgemeinschaft Astronomie der Deutschen Schule Málaga Projekt Jugend forscht 2012 Schule mit besten Aussichten Un colegio que abre horizontes 3 Inhalt 1. Einführung...
Die differenzielle Rotation der Sonne Arbeitsgemeinschaft Astronomie der Deutschen Schule Málaga Projekt Jugend forscht 2012 Schule mit besten Aussichten Un colegio que abre horizontes 3 Inhalt 1. Einführung...
Gymnasium / Realschule. Atomphysik 2. Klasse / G8. Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht)
 Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht) 1. Was versteht man unter einem Elektronenvolt (ev)? 2. Welche physikalische Größe wird in Elektronenvolt gemessen? Definiere diese Größe und gib weitere Einheiten
Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht) 1. Was versteht man unter einem Elektronenvolt (ev)? 2. Welche physikalische Größe wird in Elektronenvolt gemessen? Definiere diese Größe und gib weitere Einheiten
5. Die gelbe Doppellinie der Na-Spektrallampe ist mit dem Gitter (1. und 2. Ordnung) zu messen und mit dem Prisma zu beobachten.
 Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum O Gitter/Prisma Geräte, bei denen man von der spektralen Zerlegung des Lichts (durch Gitter bzw. Prismen) Gebrauch macht, heißen (Gitter-
Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum O Gitter/Prisma Geräte, bei denen man von der spektralen Zerlegung des Lichts (durch Gitter bzw. Prismen) Gebrauch macht, heißen (Gitter-
Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences. 29. September 2015 HSD. Solarenergie. Die Sonne
 Solarenergie Die Sonne Wärmestrahlung Wärmestrahlung Lichtentstehung Wärme ist Bewegung der Atome Im Festkörper ist die Bewegung Schwingung Diese Schwingungen können selber Photonen aufnehmen und abgeben
Solarenergie Die Sonne Wärmestrahlung Wärmestrahlung Lichtentstehung Wärme ist Bewegung der Atome Im Festkörper ist die Bewegung Schwingung Diese Schwingungen können selber Photonen aufnehmen und abgeben
Grundlagen. Dies bedeutet, dass die Elektronenemission unabhängig von der Lichtintensität und unabhängig von der Bestrahlungsdauer. A.
 Grundlagen Die Wissenschaft beschäftigte sich lange mit der Frage um die Natur des Lichts. Einerseits besitzt Licht viele Welleneigenschaften, weshalb es häufig als solche betrachtet wird. Doch andererseits
Grundlagen Die Wissenschaft beschäftigte sich lange mit der Frage um die Natur des Lichts. Einerseits besitzt Licht viele Welleneigenschaften, weshalb es häufig als solche betrachtet wird. Doch andererseits
Alterssichtigkeit und ihre Korrektur (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Alterssichtigkeit und ihre Korrektur (Artikelnr.: P1067000) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Das Auge Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Alterssichtigkeit und ihre Korrektur (Artikelnr.: P1067000) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Das Auge Experiment:
2. Schulaufgabe aus der Physik * Klasse 9b * Gruppe B
 . Schulaufgabe aus der Physik * Klasse b * 0.05.015 Gruppe B Name :.. 1. Paul steht auf einer Brücke und wirft einen Stein mit der Geschwindigkeit 8,0 m/s senkrecht nach oben. x a) Gib die Orts-Funktion
. Schulaufgabe aus der Physik * Klasse b * 0.05.015 Gruppe B Name :.. 1. Paul steht auf einer Brücke und wirft einen Stein mit der Geschwindigkeit 8,0 m/s senkrecht nach oben. x a) Gib die Orts-Funktion
Zusammenfassung. Björn Malte Schäfer & Markus Pössel. Methoden der Astronomie für Nicht-Physiker
 Methoden der Astronomie für Nicht-Physiker Astronomisches Rechen-Institut/Haus der Astronomie 20.10.2016 26.1.2017 Modelle und Beobachtungen Wer astronomische Methoden verstehen will, muss sich sowohl
Methoden der Astronomie für Nicht-Physiker Astronomisches Rechen-Institut/Haus der Astronomie 20.10.2016 26.1.2017 Modelle und Beobachtungen Wer astronomische Methoden verstehen will, muss sich sowohl
Zentralabitur 2008 Physik Schülermaterial Aufgabe II ea Bearbeitungszeit: 300 min
 Thema: Experimente mit Interferometern Im Mittelpunkt der in den Aufgaben 1 und 2 angesprochenen Fragestellungen steht das Michelson-Interferometer. Es werden verschiedene Interferenzversuche mit Mikrowellen
Thema: Experimente mit Interferometern Im Mittelpunkt der in den Aufgaben 1 und 2 angesprochenen Fragestellungen steht das Michelson-Interferometer. Es werden verschiedene Interferenzversuche mit Mikrowellen
Weißes Licht hat viele Farben - Versuchsanleitungen -
 Weißes Licht hat viele Farben - Versuchsanleitungen - Overheadprojektor 2 Pappen Prisma Experiment 1 Weißes Licht enthält viele Farben Bedecken Sie den OH-Projektor so mit Pappe, dass nur ein schmaler
Weißes Licht hat viele Farben - Versuchsanleitungen - Overheadprojektor 2 Pappen Prisma Experiment 1 Weißes Licht enthält viele Farben Bedecken Sie den OH-Projektor so mit Pappe, dass nur ein schmaler
Sterne 16 Sternspektroskopie und Spektralanalyse (Teil 4)
 Sterne 16 Sternspektroskopie und Spektralanalyse (Teil 4) Gesetzmäßigkeiten in der Anordnung der Spektrallinien eines Stoffes? Wasserstoff Johann Jacob Balmer 1825-1898 A=364.4 nm n ganzzahlig > 2 Eine
Sterne 16 Sternspektroskopie und Spektralanalyse (Teil 4) Gesetzmäßigkeiten in der Anordnung der Spektrallinien eines Stoffes? Wasserstoff Johann Jacob Balmer 1825-1898 A=364.4 nm n ganzzahlig > 2 Eine
Versuchsanleitung zu den Experimenten zur Spektroskopie Lichtquellen, Sonnenspektrum, Absorption und Fluoreszenz von Licht
 Versuchsanleitung zu den Experimenten zur Spektroskopie Lichtquellen, Sonnenspektrum, Absorption und Fluoreszenz von Licht In diesem Versuch werden mit Gitterspektrometern zuerst die Spektren verschiedener
Versuchsanleitung zu den Experimenten zur Spektroskopie Lichtquellen, Sonnenspektrum, Absorption und Fluoreszenz von Licht In diesem Versuch werden mit Gitterspektrometern zuerst die Spektren verschiedener
Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik. Vorbereitung. Von Jan Oertlin. 2. Dezember 2009
 Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik Vorbereitung Von Jan Oertlin 2. Dezember 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Brennweitenbestimmung...2 1.1. Kontrolle der Brennweite...2 1.2. Genaue Bestimmung der Brennweite
Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik Vorbereitung Von Jan Oertlin 2. Dezember 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Brennweitenbestimmung...2 1.1. Kontrolle der Brennweite...2 1.2. Genaue Bestimmung der Brennweite
