Der folgende Einführungsbeitrag zur neuen Ausgabe der DIN V entstammt dem Sonderdruck zur DIN V auf CD-ROM:
|
|
|
- Klaudia Burgstaller
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 erwaltungen 02** 17 Der folgende Einführungsbeitrag zur neuen Ausgabe der DIN V entstammt dem Sonderdruck zur DIN V auf CD-ROM: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung Ausgabe 2018 Herausgeber: DIN Information: Einzeplatzversion 375, EUR inkl. MwSt. Inhalt: Die CD enthält die komplette DIN V 18599: (Teile 1 bis 11), Teil 12 Ausgabe , das Beiblatt 1 ( ), das Beiblatt 2 ( ) sowie den Entwurf zum Beiblatt 3 ( ). Weiterhin enthalten ist DIN V Teil 1 bis 11 der Ausgaben und (inkl. Berichtigungen). Mehr Infos und Bestellung:
2 Details zur Neuausgabe der Vornormenreihe DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung Hans Erhorn, Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) Sebastian Edelhoff, Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN) Die Vornormenreihe DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind. Die Vornormenreihe ist dafür geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Die mit der Vornormenreihe DIN V durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, was bedeutet, dass eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen erfolgt. Die Vornormen knüpfen dabei in sinnvoller Weise an bestehende Normen und Berechnungsmethoden an. Die Vornormenreihe DIN V wurde als fünfte Ausgabe im Juli 2018 vom verantwortlichen Gemeinschaftsarbeitsausschuss Energetische Bewertung von Gebäuden der DIN-Normenausschüsse Bauwesen (NABau), Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) und Lichttechnik (FNL) zur überarbeiteten Neuveröffentlichung freigegeben. Der Inhalt wurde in den letzten Jahren von den zuständigen Arbeitsausschüssen der am Gemeinschaftsausschuss beteiligten DIN-Normenausschüsse aktualisiert und an die technischen Entwicklungen angepasst. Die Zeit zwischen der Herausgabe der vierten Ausgabe im Jahr 2016 und der fünften Ausgabe im Jahr 2018 wurde u. a. auch für eine umfängliche Validierung des Normenwerks genutzt. 1
3 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Mit der angestoßenen Novellierung des Energieeinsparrechts ist die Zusammenführung des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zum Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden, kurz Gebäudeenergiegesetz (GEG), vorgesehen. Nach aktuellem Stand (Oktober 2018) ist es vorgesehen, dass das GEG auf die aktuellen Teile 1 bis 11 der Vornormenreihe DIN V mit Ausgabedatum verweist und damit der EnEV- und EEWärmeG-Bezug auf die Ausgabe und die herausgegebenen Berichtigungsblätter zu den Teilen 1, 5, 8 und 9 der Fassung von 2011 ersetzt wird. Das Erscheinungsdatum des Teils 12 (Tabellenverfahren Wohngebäude) liegt prozedurbedingt immer mindestens 6 Monate nach Erscheinen der Teile 1 bis 11, da die Berechnung der Tabellenwerte erst erfolgen kann, wenn an den Normenteilen keine Änderungen mehr vorgenommen werden können. Dies ist auch für die aktuelle Fassung der Norm der Fall, sodass die Neufassung von Teil 12 erst im Jahr 2019 zu erwarten ist. Parallel wird im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ein Tabellenverfahren für einfache Nichtwohngebäude entwickelt, das für die nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) zulässigen Einzonengebäude verwendet werden kann. Auch dieses wird als Normenwerk in 2019 erwartet. DIN V Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Kati Jagnow, Hochschule Magdeburg- Stendal, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Teil 1 der Normenreihe liefert einen Überblick über das Vorgehen bei der Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für die Beheizung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung für Gebäude. Es werden allgemeine Definitionen bereitgestellt, die übergreifend für alle Normteile gelten. Das Grundprinzip der Bilanzierung, das heißt Zonierung und Verrechnung, die gewerkeweise Bilanzierung von der Nutz- zur Endenergie sowie die gewerkeübergreifende Gesamtbilanz von End- und Primärenergie wurden beibehalten. Die Überarbeitung von Teil 1 umfasst im Wesentlichen einen erweiterten Begriff der Endenergie, die Aufnahme des Anwenderstroms in die Bilanzierung, 2
4 eine alternative Darstellung der Energiebilanz, die Aktualisierung der Primärenergiefaktoren und Ergänzungen von CO 2 -Äquivalenten sowie einige Klarstellungen im Bereich der Erhebung geometrischer Daten. Erweiterte Endenergiebilanz Die gesamte Endenergie des Gebäudes Q f ergibt sich aus den von außen zugeführten Mengen Q f,in und den innerhalb der Bilanzgrenzen selbst produzierten oder technisch nutzbar gemachten Mengen (z. B. Photovoltaikstrom, Solarwärme, Erd- oder Umweltwärme von Wärmepumpen). Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Belange zählt dabei nur der erstgenannte Anteil. Im Sektor Niedrigst-, Null- und Plusenergiegebäude interessieren auch die Energieflüsse innerhalb der Bilanzgrenzen. Ergänzend zu der allgemeinen Endenergiebilanz enthält der Anhang F daher auch Berechnungsvorschriften für: die gesamte Endenergie Q f die innerhalb der Bilanzgrenzen nutzbar gemachte oder produzierte Endenergie Q f,prod den Selbstnutzungsanteil der produzierten Endenergien α f,use den Rückspeiseanteil der produzierten Endenergien α f,out den Eigenversorgungsanteil der Endenergien α f,self den Fremdversorgungsanteil der Endenergien α f,in. Die Überarbeitung des Teils 1 umfasst im Wesentlichen einen geänderten Umgang mit den Umweltenergien als Energieträger. Anwendungsstrom Um die Bilanzierung universeller zu gestalten, enthält die Endenergiebilanz auch den Anteil für Anwendungsstrom (bei Wohngebäuden ist dies der Haushaltsstrom). Diese Erweiterung zielt nicht auf EnEV-Nachweise, sondern auf die Bilanzierung von Niedrigst-, Null- und Plusenergiegebäuden ab. Die Größe kann im künftigen energiesparrechtlichen Nachweis optional verwendet werden. Alternative Darstellung der Energiebilanz Ein neuer Anhang E enthält die Darstellung der Energiebilanzierung der Prozessschritte zwischen Nutz- und Endenergie (Übergabe, Verteilung, Speicherung, Erzeugung) mit Aufwandszahlen. Das korrespondiert mit dem Beiblatt 3 (Dokumentation), in dem die Energiebilanz parallel jeweils additiv mit 3
5 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Verlustenergiemengen und multiplikativ mit Aufwandzahlen ausgewiesen wird. Darüber hinaus wird auch beispielhaft eine gemischte Darstellung der Energiebilanz beschrieben, in der additive Größen (Verluste der Übergabe, Verteilung und Speicherung) sowie Aufwandszahlen (Erzeugung) Verwendung finden. Primärenergiefaktoren und CO 2 -Äquivalente Es erfolgte eine Neuordnung der Primärenergiefaktoren passend zur Endenergiebilanz. Es wird unterschieden in Primärenergiefaktoren für Endenergien, die: dem Bilanzraum zugeführt werden (fossile und biogene Brennstoffe, Nahund Fernwärme, Fernkälte, Strom als Netzmix); innerhalb der Bilanzgrenzen nutzbar gemacht werden (Strom aus PV und Windkraft, thermische Umweltenergien, Abwärme aus Prozessen); aus dem Bilanzraum abgeführt werden (Strom, thermische Energie, Abwärme), für die entsprechend ein Verdrängungsmix gilt. Darüber hinaus wurden die Primärenergiefaktoren in Tabelle A.1, insbesondere die von Strom und biogenen Brennstoffen, überarbeitet sowie die Standardwerte für Nah- und Fernwärme aus Heizwerken mit regenerativen Brennstoffen bzw. Energieträgern gestrichen. Ferner erfolgte eine Ergänzung von CO 2 -Äquivalenten in Tabelle A.1, in den Begriffserläuterungen sowie den Berechnungsvorschriften in Abschnitt 5.7 sowie im Anhang A. Geometrische Daten Als Bezugsfläche der Vornorm DIN V gilt weiterhin die Nettogrundfläche A NGF. Da diese Fläche im Wohnungsbau oft nicht bekannt ist, wurden zusätzlich pauschale Umrechnungsformeln ergänzt. Mit diesen kann auf Basis einer bekannten Wohnfläche A Wohn oder der Nutzfläche A N die Nettogrundfläche näherungsweise bestimmt werden. Auch die vormals in der EnEV selbst verankerte Bestimmungsformel für die Nutzfläche A N und das belüftete Volumen V L im Wohnungsbau (jeweils aus dem umbauten Volumen V e ) sind nun im Teil 1 direkt abgebildet und präzisiert. Somit muss die EnEV-Nachfolgeverordnung diese Datenbestimmung nicht mehr regeln. 4
6 DIN V Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Anton Maas, Universität Kassel, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. DIN V bildet die Grundlage der Bilanzierung des Nutzenergiebedarfs für Heizen und Kühlen einer Gebäudezone (Heizwärme- und Kältebedarf). Die wesentlichen Überarbeitungen des Teils 2 der DIN V sind im Folgenden zusammengefasst dargestellt. Transmissionswärmetransferkoeffizienten, Temperatur in angrenzenden Räumen und Temperatur-Korrekturfaktoren Beim vereinfachten Ansatz zur Ermittlung der Temperatur in angrenzenden unbeheizten Zonen mittels F x -Werten (Temperatur-Korrekturfaktoren) werden die Temperatur-Korrekturfaktoren (Tabelle 5) ergänzt um den Fall Wände und Decken zu niedrig beheizten Räumen (Räume mit Innentemperaturen zwischen 12 C und 19 C, z. B. Treppenhäuser). Für Bauteile des unteren Gebäudeabschlusses sind neue Berechnungswerte aufgenommen worden. Ferner wurde der vereinfachte Ansatz für die Bestimmung der mittleren Temperatur in ungekühlten Zonen (Kühlfall) überarbeitet und die Temperatur in einem Keller, an den eine gekühlte Zone angrenzt, festgelegt. Die rechnerische Bewertung der Wärmetransmission über Wärmebrücken wird grundsätzlich neu gestaltet. Außerdem wird ein Transmissionswärmetransferkoeffizient für zweidimensionale Wärmebrücken definiert, der zu den Transmissionswärmesenken und -quellen nach außen addiert wird. Damit ist die Temperaturdifferenz innen/außen entsprechend zugeordnet. Die doppelte Berücksichtigung einer reduzierten Temperaturdifferenz, die bislang fallweise aufgetreten ist, wird damit ausgeschlossen. Die Wärmebrücken werden mittels des Wärmebrückenkorrekturwertes ΔU WB erfasst und in die Bilanz einbezogen. Dieser Wärmebrückenkorrekturwert kann wie bislang pauschal angesetzt oder individuell aus Wärmebrückenkatalogen oder Berechnungen ermittelt werden. Die Vorgehensweise für letztgenannte Fälle wurde in einen neuen Anhang H aufgenommen. Ebenfalls neu aufgenommen ist die Möglichkeit der Anpassung der Wärmebrückenkorrekturwerte analog zur Vorgehensweise bei KfW-Nachweisen. 5
7 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Strahlungswärmequellen und -senken, interne Wärme- und Kältequellen Die Standardwerte für Kennwerte für Gläser und Sonnenschutzvorrichtungen in DIN V sind unter Berücksichtigung der Anhaltswerte für die Bemessung und der Bezeichnungen für Konstruktionsmerkmale der Glastypen aus DIN angepasst. Neu aufgenommen sind Kennwerte für schaltbare Gläser. Der Parameter a, der die Aktivierung des Sonnenschutzes bewertet, kann nun auch für die Bewertung des Kühlfalls bei Wohngebäuden herangezogen werden. Dabei sind die entsprechenden Werte in Tabelle A.4 des Normenblattes für manuellen oder zeitgesteuerten und in Tabelle A.5 für intensitätsgesteuerten Betrieb jeweils für das Sommerhalbjahr heranzuziehen. Heizlast In Anhang B erfolgt eine Anpassung bei der Bestimmung der erforderlichen maximalen Heizleistung unter Berücksichtigung einer mechanischen Lüftungsanlage. Hier wird wie im Fall ohne mechanische Lüftung der Heizleistungsanteil infolge Lüftung mit einem Faktor 0,5 gemindert. Weitere Präzisierungen in diesem Abschnitt betreffen den Abgleich mit den Normenteilen 3 und 6. Temporärer Wärmeschutz Ein neuer informativer Anhang G behandelt die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten für transparente Bauteile mit äußeren und inneren Abschlüssen. Bei Vorhandensein eines Abschlusses (zum Beispiel ein Rollladen) kann der Wert für den Wärmedurchgangskoeffizienten des betreffenden transparenten Bauteils gemäß dem Ansatz in DIN EN ISO korrigiert werden und zur Berechnung des Transmissionswärmestroms als effektiver Wärmedurchgangskoeffizient U tr,eff einfließen. Der zur Berechnung des effektiven Wärmedurchgangskoeffizienten benötigte kombinierte Wärmedurchgangskoeffizient für das transparente Bauteil mit geschlossenem Abschluss U tr,sh wird gemäß DIN EN ISO [4] in Verbindung mit DIN EN bestimmt. Der für das Verfahren weiterhin erforderliche dimensionslose Anteil der akkumulierten Temperaturdifferenz für den Zeitraum mit geschlossenem Abschluss f sh ist in Anhang G aufgenommen. 6
8 DIN V Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung Die Verfasser danken Dipl.-Ing. Heiko Schiller, schiller engineering, Hamburg, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Teil 3 der Normenreihe DIN V beschreibt die Berechnung des Nutzenergiebedarfs für die thermische Luftaufbereitung und des Endenergiebedarfs für die Luftförderung in raumlufttechnischen Geräten mit Schwerpunkt Nichtwohngebäude. Der Nutzenergiebedarf setzt sich zusammen aus dem Energiebedarf für die Funktionen Heizen, Kühlen, Befeuchten, Entfeuchten von Außenluft auf einen definierten Zuluftzustand. Weiterhin wird der Rechengang zur Bestimmung des elektrischen Energiebedarfs von Ventilatoren zur Luftförderung beschrieben. Das Berechnungsverfahren ist auch weiterhin implizit auf Basis von Energiekennwerten aufgebaut. Das bietet den Vorteil, dass das Verfahren auch für Handrechnungen zum Beispiel zur Ergebniskontrolle geeignet ist. Eine einfache Handhabung geht jedoch immer zulasten der Flexibilität. Die aktuelle Überarbeitung des Teils 3 für die 2016er- bzw. 2018er-Ausgabe berücksichtigt die in Teil 7 beschriebene bedarfsabhängige Lüftung (in Abhängigkeit von Präsenz und Raumluftqualität). Zukünftig werden auch Kombinationen aus kühllastabhängig und bedarfsabhängig geregelten Variabel-Volumenstrom-Systemen berechenbar sein. Zudem wird die bedarfsabhängige Lüftung in das Verfahren zur Berechnung des elektrischen Energiebedarfs von Ventilatoren eingearbeitet. DIN V Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung Die Verfasser danken Dr. Jan de Boer, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Teil 4 der Normenreihe DIN V ermöglicht die Ermittlung des Nutz- und Endenergiebedarfs für Beleuchtungszwecke unter Berücksichtigung des künstlichen Beleuchtungssystems, der Tageslichtversorgung, von Beleuchtungskontrollsystemen und der Nutzungsanforderungen. Die Überarbeitung des Normenteils im Bereich Beleuchtung bringt fünf wesentliche Neuerungen: Vereinfachte Bestimmung des mit Tageslicht versorgten Bereichs, Installierte elektrische Leistung (Aktualisierung LED-Daten), 7
9 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Installierte elektrische Leistung (Bewertung vertikaler Beleuchtungsstärken), Tageslichtbewertung (Bewertung Dachoberlichter mit Sonnen- oder Blendschutz), Formblätter (Handrechenverfahren). Tageslichtversorgte Bereiche Zur Ermittlung der mit Tageslicht versorgten Bereiche bei Fassaden waren bis jetzt Informationen über die Geometrie des angrenzenden Raums mit zu berücksichtigen. Vereinfachend können diese Bereiche nun rein aus Geometrieparametern der Fassade selbst abgeleitet werden. Das ermöglicht in der Anwendung des Verfahrens in der Praxis eine vereinfachte und schnellere Spezifikation (zum Beispiel in der Berechnungs- und Nachweissoftware). Aktualisierung LED-Daten Die Effizienzen (Lichtausbeuten) der unterschiedlichen LED-Produkte haben sich seit der Ausgabe 2011 der Vornorm erheblich verbessert. LED-Produkte stellen mittlerweile den Großteil des Marktvolumens in der Allgemeinbeleuchtung dar. Um das Produktportfolio bezüglich des energetischen Verhaltens differenzierter als bisher einstufen zu können, wurden die bisherigen Klassen Ersatzlampen und LEDs in LED-Leuchten weiter unterteilt und mit aktuellen Bewertungsfaktoren (Stand 2018) basierend auf Querauswertungen unterschiedlicher Lampen- und Leuchtenhersteller parametriert. Diese wurden über den Anpassungsfaktor k L in das Tabellenverfahren übernommen. Bewertung vertikaler Beleuchtungsstärken Zur Ermittlung der elektrischen Bewertungsleistung werden in DIN V bisher nur Werte der horizontalen Beleuchtungsstärke berücksichtigt. So wird für die Nutzung in Tabelle 5 von DIN V die Höhe einer horizontalen Nutzebene angegeben. Dagegen werden vertikale Flächen nicht einbezogen. Allerdings werden für zahlreiche Nutzungen, wie zum Beispiel die Beleuchtung von Schulen, Kaufhäusern und Bibliotheken, Anforderungen an die vertikale Beleuchtungsstärke gestellt. In diesen Bereichen der Sehaufgabe kommt es dadurch häufig zu Fehlbeurteilungen der Beleuchtungsverhältnisse und damit zu Fehlplanungen mit unrealistischen Werten des Energiebedarfs. 8
10 Vor diesem Hintergrund wurden die Verfahren zur vereinfachten Ermittlung (Tabellen- und Wirkungsgradverfahren) der erforderlichen elektrischen Bewertungsleistung zum Erreichen bestimmter Beleuchtungsstärken auf horizontalen Flächen auch für die Anwendung auf vertikalen Flächen modifiziert. Es wurde ein zusätzlicher Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung der Beleuchtung vertikaler Flächen k vb eingeführt. Dieser wird in Abhängigkeit vom Verhältnis der horizontalen Flächen mit Regalgängen zu der gesamten Grundfläche des Raums parametriert. In DIN V , Tabelle 5, wurden hierzu für die Nutzungen 6 Einzelhandel, Kaufhaus, 20 Lager, Technik, Archiv, 29 Bibliothek, Freihandbereich, 30 Bibliothek, Magazin und Depot und 41 Lagerhallen und Logistikhallen Richtwerte angegeben. Für die Beleuchtung der vertikalen Tafelfläche in Schulklassenzimmern wird dagegen ein pauschaler auf die Grundfläche bezogener jährlicher Endenergiebedarf Q TB,rel = 1,25 k L in kwh/m 2 a angesetzt. Bewertung Dachoberlichter Bisher wurde für konventionelle Dachoberlichtsysteme ohne Sonnenschutzfunktion in DIN V eine gesamte jährliche relative Nutzbelichtung ermittelt und zur Bewertung des Einflusses der Tageslichtversorgung auf den Endenergiebedarf für Beleuchtung herangezogen. Das Modell wurde strukturell dahingehend erweitert, dass die Einflüsse nun getrennt mit nicht aktiviertem und aktiviertem Sonnenschutz analysiert und optimiert werden können. Hierzu wurde die relative Nutzbelichtung differenziert in eine relative Nutzbelichtung bei Sonnen- oder Blendschutz (nicht aktiviert) und eine relative Nutzbelichtung bei Sonnen- oder Blendschutz (aktiviert). Handrechenverfahren Im informativen Anhang von DIN V wurden Formblätter aufgenommen. Diese ermöglichen eine zügige Abschätzung des Energiebedarfs der Beleuchtung in Form von Handrechnungen. Sie sind beispielsweise für Anwender mit geringen lichttechnischen Kenntnissen oder für die Nutzung in Ausbildung und Lehre geeignet. Mit den Blättern können alle über vertikale Fassaden mit Tageslicht versorgten Bereiche einer Zone in nur einem Berechnungsbereich abgebildet werden. Gegebenenfalls zu beachtende Vereinfachungen ergeben sich durch Pauschalierungen und den Verzicht auf Berechnungsoptionen des Hauptverfahrens. 9
11 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden DIN V Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen und DIN V Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, ITG Dresden, und Jürgen Schilling, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Der Teil 5 der Normenreihe DIN V enthält ein Verfahren zur energetischen Bewertung von Heizsystemen in Gebäuden. Dieses baut auf der vorhandenen Methodik der im Rahmen des EPBD-Mandats erarbeiteten Europäischen Normen sowie der DIN V auf. Das betrifft beispielsweise die anlagentechnischen Bilanzierungsabschnitte Übergabe, Verteilung, Speicherung und Erzeugung. Analoges gilt für Teil 8 der Norm. Die Teile 5 und 8 der Normenreihe DIN V sind überarbeitet und an die neueren technischen Entwicklungen angepasst worden. Die wesentlichen Änderungen betreffen die im Folgenden beschriebenen Punkte: Wärmeübergabe Der durch die Wärmeübergabe an den Raum und die dort vorhandene Regelung verursachte energetische Aufwand wird zukünftig nicht mehr durch Teilnutzungsgrade, sondern durch Temperaturabweichungen beschrieben. Damit wird das Verfahren in der DIN V an die Europäische Norm EN angeglichen. Gas-Sorptionswärmepumpen Der Berechnungsalgorithmus der Vornormenreihe DIN V 18599:2011 baute ausschließlich auf dem gemessenen Jahresnutzungsgrad nach VDI 4650 Blatt 2 auf. In der Neuausgabe wird bei der Berechnung des Jahresnutzungsgrades der Einfluss der Auslastung der Wärmepumpen berücksichtigt. Insbesondere bei den Adsorptionswärmepumpen im kleineren Leistungsbereich kann damit eine bessere Vorhersage der Effizienz der Geräte vorgenommen werden. 10
12 Pellet- und Hackschnitzelkessel Die Standardwerte für Wirkungsgrade, Bereitschaftsverluste und Hilfsenergiebedarf für Pellet- und Hackschnitzelkessel wurden an aktuelle Produktkennwerte angepasst. Damit können zukünftig realistische Bedarfswerte errechnet werden, ohne produktspezifische Kennwerte einzusetzen. Außerdem wurden Kennwerte für Pellet-Brennwertkessel ergänzt. Thermische Solarsysteme Der Bewertungsansatz für thermische Solarsysteme wurde komplett neu gefasst. Ausgehend vom Heizwärmebedarf bei Anlagen mit Heizungsunterstützung und Warmwasserbedarf wird eine typische Dimensionierung für Kollektorfläche und Speichergröße vorgenommen und über den Kollektorwirkungsgrad der Solarertrag ermittelt. Abweichende Kollektorflächen oder Speichergrößen werden über Korrekturfaktoren berücksichtigt und dann der entsprechende Solarertrag bestimmt. Daraus ergibt sich der Energiebedarf für den ergänzenden Wärmeerzeuger. Die Standardwerte der Kollektoreigenschaften werden jetzt zusätzlich zum bisherigen Format auch bruttoflächenbezogen für Kollektoren A bis A+++ angegeben. Elektrische Wärmepumpen Der Berechnungsabschnitt für elektrische Wärmpumpen wurde für eine bessere Verständlichkeit neu strukturiert. Die Neufassung ermöglicht auch die Berechnung leistungsgeregelter Sole-Wasser-Wärmepumpen. Da die monatsmittleren Betriebstemperaturen einer Wärmepumpe bei Fußbodenheizungen mit niedrigen Auslegungstemperaturen außerhalb der Prüfpunkte liegen, ist eine Extrapolation erforderlich. Um eine Überschätzung der Leistungsbeziehungsweise Arbeitszahlen bei dieser Extrapolation zu vermeiden, wird die rechnerische Vorlauftemperatur auf einen Mindestwert von 30 C begrenzt. Elektrische Temperaturhaltebänder Alternativ zu Zirkulationssystemen kann die Temperaturhaltung in Warmwasserverteilsystemen durch elektrische Temperaturhaltebänder (Begleitheizung) vorgenommen werden. Das war auch in der bisherigen DIN V berechenbar. Die Rückwirkungen, die sich auf den Wärmeerzeuger ergeben, können allerdings erst jetzt erfasst werden: Ohne Zirkulation entfällt die ständige Energieentnahme aus dem Speicher und damit das häufige Nachladen. Im Ergebnis sinkt die Rücklauftemperatur aus dem Speicher bei Nachladevorgängen, 11
13 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden gleichzeitig verringert sich die mittlere Temperatur des Wärmeerzeugers im Sommerbetrieb. Wohnungsstationen für Heizung und/oder Warmwasser Der Einsatz von Wohnungsstationen (auch Frischwasserstationen genannt) hat in den letzten Jahren infolge der verstärkten Bemühungen zur Vermeidung von Legionellenwachstum deutlich zugenommen. Um eine Berechnung zu ermöglichen, wurde ein Abschnitt in die Norm aufgenommen, der Angaben zu mittleren Temperaturen im Verteilnetz, rechnerischer Laufzeit der Heizung und Leitungslängen enthält. Wie auch sonst üblich, kann hier mit Standardwerten oder mit produkt- beziehungsweise objektspezifischen Daten gearbeitet werden. Warmwasserverteilnetze Die Standardwerte für die Temperaturen im Verteilnetz und im Warmwasserspeicher sowie für die Laufzeit der Zirkulationspumpe wurden an die jetzt üblichen Betriebsbedingungen angepasst. Durchlauferhitzer Gas-Durchlauferhitzer sind neu in die Bewertung aufgenommen worden. Bei elektrischen Durchlauferhitzern wird in der Neuausgabe nicht mehr nach Baualter differenziert, sondern zwischen elektronisch geregelten und hydraulisch gesteuerten Geräten unterschieden. Da bei elektronisch geregelten Durchlauferhitzern die Leistung stufenlos an den jeweiligen Bedarf angepasst werden kann und die gewünschte gradgenaue Wassertemperatur bereitgestellt wird, ergeben sich hier deutliche energetische Vorteile. Die Norm enthält einen Berechnungsansatz, der mögliche Energieeinsparungen durch eine bauartbedingte Volumenstrombegrenzung quantifiziert, allerdings mit der Einschränkung, dass diese nicht für den öffentlich-rechtlichen Nachweis, sondern nur bei einer Energieberatung berücksichtigt werden dürfen. Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser Systeme zur passiven Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser mittels Wärmeübertrager werden in einigen Ländern wie zum Beispiel den Niederlanden häufig eingesetzt, vor allem, weil sie eine vergleichsweise kosteneffiziente Maßnahme zur Verringerung des Energieverbrauchs sind. Die Neufassung der 12
14 DIN V ermöglicht jetzt auch für Deutschland eine energetische Bewertung. Weitere wesentliche Änderungen Gegenüber der Ausgabe DIN V : wurden darüber hinaus folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufnahme von Standardwerten für den Deckungsanteil und für die direkte und indirekte Wärmeabgabe bei dezentralen und hydraulisch eingebundenen Einzelfeuerstätten; b) Aufteilung der Deckungsanteile bei Kombianlagen für Heizung und Trinkwassererwärmung; c) Beschreibung der Vorgehensweise bei Bestimmung der Leistungszahlen im Teillastbetrieb (analog zu drehzahlgeregelten elektrischen Wärmepumpen); d) die Abfrage nach dem Wasserinhalt des Wärmeerzeugers entfällt; e) Korrektur der Begriffe zur Elektro-Speicherheizung; f) Gleichung zum Kollektorwirkungsgrad ergänzt, damit dieser nicht negativ wird; g) Vereinheitlichung des Belastungsfaktors in Anhang B; h) Ergänzung eines Verfahrens in Abschnitt B.9 des Teils 5 zur Berechnung der maximalen Heizleistung von Wärmepumpen bei Angabe einer Bivalenztemperatur; i) Änderung der Berechnung der maximalen Vorlauftemperatur von Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung; j) Änderung der Standardwerte für die maximale Vorlauftemperatur zur Trinkwarmwasserbereitung; k) Ergänzung einer Beschreibung zur Vorgehensweise bei geregelten gasmotorischen Wärmepumpen; l) Ergänzung eines Berechnungsansatzes für kalte Wärmenetze als Wärmequelle für Wärmepumpen. 13
15 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden DIN V Teil 6: Endenergiebedarf von Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen für den Wohnungsbau Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann, ITG Dresden, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Teil 6 der Normenreihe liefert die Algorithmen und Kennwerte für die Berechnung des Endenergiebedarfs von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau. Die aktuelle Fassung enthält gegenüber der Ausgabe DIN V : einige wesentliche Erweiterungen. Neuer Algorithmus für Teillüftung Der bisher verwendete und pauschal beschriebene Ansatz einer flächenanteiligen Berechnung aller relevanten Energiebedarfswerte führte in der Praxis zu Unklarheiten und Missverständnissen. Mit der Neuausgabe des Teils 6 wird die Teillüftung detailliert und gültig für unterschiedliche Kombinationen, zum Beispiel aus freier Lüftung und ventilatorgestützter Lüftung ventilatorgestützter Lüftung mit und ohne Wärmerückgewinnung ventilatorgestützter Lüftung mit und ohne Bedarfsführung ventilatorgestützter Lüftung mit Heizperioden- und Ganzjahresbetrieb, berechnet. Für die weitere Klarstellung wurde eine Definition der Teillüftung aufgenommen. Umstellung der Berechnung der Wärmeverluste bei der Wärmeübergabe In den Anlagenteilen erfolgt einheitlich die Umstellung der Berechnung der Wärmeverluste bei der Wärmeübergabe auf ein Verfahren unter Berücksichtigung der Temperaturabweichungen im Raum (bisher mit Nutzungsgraden). Diese Umstellung wird im Teil 6 genutzt, um die Zahl der Kennwerte drastisch zu reduzieren und um die Anwendung zu vereinfachen. 14
16 10 Anpassung an Ecodesign-Richtlinie Zur Anpassung an die Ecodesign-Richtlinie werden die Berechnungen für den Energieaufwand der Ventilatoren und für die Berücksichtigung verschiedener Frostschutzstrategien modifiziert. Ventilatoren: Umstellung von bezogener Leistungsaufnahme der Ventilatoren P el,fan auf spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI nach DIN EN Aktualisierung der Standardwerte für DC/EC-Systeme (Berücksichtigung der technologischen Weiterentwicklung) Frostschutzstrategien: Erweiterung für Frostschutz durch Reduzierung des Zuluftvolumenstroms (bisher nur Abschaltung des Zuluftventilators berücksichtigt) Berücksichtigung von Abluft-Zuluft-Wärmepumpen mit einem zweiten Kondensator zur Luftvorwärmung. Erweiterung der Systeme zur Wohnungskühlung Bei der Wohnungskühlung erfolgt lediglich eine moderate Erweiterung (bei gleichzeitiger punktueller Vereinfachung) der bilanzierbaren Systeme. Zum einen werden Systeme zur Luftkühlung mit begrenzter Zulufttemperatur (Kühlgrenze) berücksichtigt, um den Aspekt der thermischen Behaglichkeit besser berücksichtigen zu können. Zum anderen erfolgt die Berechnung der Jahresarbeitszahl von Kompressions-Kältemaschinen unter Berücksichtigung des Baualters, um die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Energieeffizienz erfassen zu können. Überarbeitung des Algorithmus für Abluft-Wärmepumpen In ventilatorgestützten Lüftungssystemen kommen heute Abluft-Wärmepumpen in unterschiedlichsten Konstellationen zum Einsatz. Typisch sind zum Beispiel Abluft-Zuluft-Wärmepumpen Abluft-Wasser-Wärmepumpen zur Heizungsunterstützung Abluft-Wasser-Wärmepumpen zur Trinkwassererwärmung, die gegebenenfalls mit Außenluft als zusätzlicher Wärmequelle und mit Wärmeübertragern kombiniert werden. 15
17 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden Während in den letzten Jahren der Einsatz von ungeregelten, einstufig betriebenen Wärmepumpen überwog, werden zunehmend Lösungen mit leistungsgeregelten Wärmepumpen (oft als Inverterregelung des Verdichters) angeboten. Diese Leistungsregelung der Wärmepumpen wurde erstmalig mit der Normenfassung von 2011 der DIN V erfasst. Durch die technische Weiterentwicklung einerseits und Erfahrungen mit der Anwendung der Norm andererseits erfolgt eine komplette Überarbeitung des Berechnungsansatzes mit folgenden Zielen: Abgleich der Algorithmen mit Teil 5 und Teil 8 nationale und europäische Messwerte als Eingabekenngrößen ermöglichen korrekte Berücksichtigung von drehzahlgeregelten Verdichtern mit variabler Priorität der Wärmenutzung (Zulufterwärmung, wasserbasierte Heizung und Trinkwassererwärmung) Erweiterung der abgebildeten Systeme (zum Beispiel bisher nur Abluft- Zuluft-Wärmepumpe nach Bild 1, neu Abluft-Zuluft-Wärmepumpe mit Außenluft als zusätzliche Wärmequelle nach Bild 2). Die Überarbeitung der Berechnung für die Abluft-Wärmepumpen hat zur Folge, dass die Struktur der Norm im Abschnitt 9 angepasst wird und jetzt stärker auf die vorhandenen Komponenten (Wärmeübertrager, Wärmepumpe, Luftheizung) anstatt auf die Lüftungssysteme ausgerichtet ist. DIN V Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau Die Verfasser danken Dipl.-Ing. Claus Händel, FGK Bietigheim-Bissingen, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Teil 7 der Normenreihe DIN V beschreibt die Berechnung des Endenergiebedarfs für die Raumlufttechnik und Klimakälteerzeugung. Ausgehend vom Nutzenergiebedarf für die Raumkühlung (Teil 2) und die Außenluftaufbereitung (Teil 3) werden Übergabe- und Verteilverluste für die Raum- und RLT-Kühlung sowie die RLT-Heizung berechnet und Randbedingungen für die Komponenten der Raumluft- und Klimakältetechnik definiert. Gegenüber der Ausgabe DIN V : wurden folgende Änderungen in der Neufassung der Norm vorgenommen, wobei anzumerken ist, dass grundsätzlich im Teil 7 keine wesentlichen Neuerungen eingearbeitet wurden, 16
18 sondern im Wesentlichen die Randbedingungen an die veränderte Normen- und Verordnungslage angepasst wurden: Randbedingungen RLT-Geräte und -Systeme Die Schnittstellen für die Lüftungs- und Klimatechnikgeräte und -systeme wurden an die Neufassung der DIN EN aus dem europäischen EPBD- Mandat angepasst. Diese Norm ersetzt die bisherige DIN EN für die Planung und Ausführung der RTL-Anlagen. Die Mindestanforderungen an RLT-Geräte (elektrische Leistungsaufnahme und Wärmerückgewinnung) sind seit dem durch die Ecodesign-Verordnung EU 1253/2014 neu geregelt. Die bisherigen Anforderungen der EnEV ( 15) sind damit in der jetzigen Fassung so nicht mehr umsetzbar. Die Ecodesign-Verordnung hat für die betroffenen Geräte Vorrang. Weitere Details sind in der Neufassung der DIN EN für RLT-Geräte neu spezifiziert worden. Diese Normen geben insbesondere auch eine Klarstellung zu den verschiedenen Arten der spezifischen Leistungsaufnahme der Ventilatoren (SFP intern, zusätzlich und extern), die für die energetische Bewertung eine zentrale Rolle spielen. Klimakälteanlagen Die Standardkennwerte für die Kälteerzeugung wurden überarbeitet und an die Mindestanforderungen der Ecodesign-Verordnung EU 2281/2016 für Kälteerzeuger angepasst. Dazu wurden ergänzende Baualtersfaktoren eingeführt und die Standardwerte um die Niedrig-GWP-Kältemittel R1234ze und R290 erweitert. Die Bewertungsmethodik für die regenerative Kühlung wurde um freie Kühlung mit Kühltürmen im Parallelbetrieb ergänzt. Da es immer wieder Forderungen nach Vereinfachung und Kürzung der Normentexte im Kontext von EnEV und DIN V gab, wurden verschiedene Standardwerte und Tabellenwerte gekürzt und gestrafft. Dies betrifft vor allem die bisher sehr differenzierten Freikühlfaktoren der Kälteerzeugung. Für eine einfachere Festlegung der Referenzkennwerte der Kaltwasserhydraulik wurde das vereinfachte Verfahren aus dem bisherigen Anhang D leicht überarbeitet und als Hauptverfahren spezifiziert. Das ausführliche Verfahren wurde als Alternativverfahren in den Anhang D verschoben. 17
19 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden DIN V Teil 9: End- und primärenergetische Bewertung von Kraft-Wärme-Kopplungs-, Photovoltaik- und Windenergieanlagen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, ITG Dresden, und Jürgen Schilling, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Auch der Teil 9 der Normenreihe DIN V wurde überarbeitet und aktualisiert. Nach längerer Diskussion in einer speziellen Ad-hoc-Gruppe einigte man sich darauf, dass trotz der bekannten Nachteile die bisher zur Brennstoffallokation bei Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)Systemen verwendete Stromgutschriftmethode weiterhin angewendet werden soll. Neuigkeiten gibt es hingegen bei den im Folgenden genannten Punkten. Motorische KWK Aufbauend auf einer umfangreichen Marktübersicht der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch ASUE konnten Standardwerte für den elektrischen und thermischen Wirkungsgrad von motorischen Blockheizkraftwerken BHKW im Leistungsbereich von 20 kw bis 17 MW in die Norm aufgenommen werden. Ferner wurde ein Hinweis zur gewerkeweisen Aufteilung der Endenergie von KWK-Systemen aufgenommen und der Berechnungsansatz für Spitzenlasterzeuger bei KWK-Anlagen konkretisiert. Brennstoffzellen Die Neuausgabe der Norm ermöglicht erstmalig die Berechnung von Brennstoffzellen. Dazu sind die bisher in DIN SPEC veröffentlichten Bewertungsansätze in die Norm integriert worden. Wie bei den anderen KWK-Systemen wird auch hier der für den EnEV-Nachweis erforderliche Primärenergiefaktor unter Berücksichtigung des Spitzenlastkessels ermittelt. Weiterhin können die für die Wirtschaftlichkeitsberechnung wesentlichen Kennwerte (Brennstoffbedarf sowie Strom- und Wärmeerzeugung) bestimmt werden. 18
20 PV-Systeme Der bisherige Berechnungsansatz zur Ermittlung der Stromproduktion von PV-Systemen wurde weiterentwickelt. Die Standardwerte für die PV-Peakleistungskoeffizienten wurden an die technische Entwicklung angepasst, außerdem wird der Einfluss der Alterung der PV-Module (Degradation) jetzt im Berechnungsgang berücksichtigt. Umfangreiche Ergänzungen gibt es auch, um den im Gebäude selbst genutzten Anteil des erzeugten Stromes qualifiziert abzuschätzen. Dazu wurde das von Markus Lichtmeß entwickelte vereinfachte Verfahren zur Bestimmung der Eigenstromnutzung in die Norm aufgenommen. Es berücksichtigt neben dem Stromkonsum innerhalb der Bilanz auch den Haushaltsstrombedarf. Der positive Einfluss eines Batteriespeichers auf die Eigenstromnutzung wird erfasst. Das Verfahren kann zunächst nur für Wohngebäude angewendet werden. Die Berechnung von Nichtwohngebäuden sowie von Power-to-Heat-Lösungen ist (vorerst) nicht möglich. DIN V Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Anton Maas, Universität Kassel, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. In DIN V werden Randbedingungen für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Klimadaten bereitgestellt. Die aufgeführten Nutzungsrandbedingungen können als Grundlagen für den öffentlich-rechtlichen Nachweis herangezogen werden und bieten darüber hinaus Informationen für Anwendungen im Rahmen der Energieberatung. Die Überarbeitung des Teils 10 der DIN V beinhaltet einige inhaltliche Änderungen, welche im Folgenden zusammengefasst dargestellt sind. Nutzungsrandbedingungen Wohngebäude Der Nutzwärmebedarf Trinkwarmwasser wird nicht mehr wie bislang mit festen Werten in Abhängigkeit vom Gebäudetyp (EFH/MFH), sondern in Abhängigkeit von der Größe einer Wohneinheit vorgegeben. Der Wertebereich für q W,b liegt zwischen etwa 8,5 und 13,5 kwh pro m 2 (Nettogrundfläche-NGF) und Jahr. Der in DIN V für die Bewertung von PV-Anlagen beschriebene Anwendungsstrombedarf (ohne Anteile der Hilfs- und Endenergien für die Heizung, Trinkwassererwärmung, Kühlung, Lüftung) wurde neu aufgenommen. Die 19
21 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden ebenfalls für die PV-Bewertung benötigte tägliche Stundenzahl mit relevanter solarer Einstrahlung ist als zusätzlicher Eintrag in Tabelle 8 angegeben. Nutzungsrandbedingungen Nichtwohngebäude Die Nutzungsprofile in DIN V werden um die für DIN V benötigten Angaben des Anpassungsfaktors zur Beleuchtung vertikaler Flächen ergänzt. Weiterhin erfolgen Änderungen in Tabelle 5 und Anhang A bezüglich: der relativen Abwesenheit RLT beim Hotelzimmer (Tabelle 5 und Anhang A) der Zuordnung von Raum-Solltemperaturen bei Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen (Tabelle 5 und Anhang A) der Angaben zum Mindestaußenluftvolumenstrom, zum Mindestaußenluftvolumenstrom Gebäude und zur relativen Abwesenheit RLT bei den Nutzungen Gewerbliche und industrielle Hallen (Nr bis 22.3) und Labor (Tabelle 5 und Anhang A) der Angaben zu Wärmequellen Personen bei den Nutzungen Gewerbliche und industrielle Hallen (Nr bis 22.3). DIN V Teil 11: Gebäudeautomation Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Rainer Hirschberg, Hocheffizienzhausinstitut Wiesbaden, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung der Neuerungen. Der Teil 11 behandelt das Thema Gebäudeautomation. Es werden in diesem Normenteil keine neuen Rechenprozeduren beschrieben, sondern die Regelund Automationseinrichtungen vier Klassen zugeordnet (A bis D). Abhängig von der Ausstattung ergeben sich rechnerisch abweichende Sollwerte bzw. Betriebszeiten der Anlagen. Bei Verwendung der entsprechenden Kennwerte in den Rechenprozeduren der anderen 10 Normenteile ergibt sich dann ein Energiebedarf unter Berücksichtigung der Qualität der Automationskomponenten. Im Betrieb ergeben sich häufig abweichende Bedingungen und ein vom Bedarf abweichender Verbrauch. Ein Teil dieser Bedingungen, die Witterungsbedingungen, sind nicht beeinflussbar. Aber auch der witterungsbereinigte Energieverbrauch einer Anlage kann deutlich höher ausfallen als ihr errechneter Bedarf. Mögliche Ursachen innerhalb der Anlagentechnik sind zu hoch eingestellte Sollwerte, unterlassene Sollwertreduzierungen in Nichtnutzungszeiten, unnötige Fensteröffnungen, fehlerhafte Einstellungen von Komponenten und Armaturen und dergleichen mehr. 20
22 Die Informationen aus Gebäudeautomatisierungs- und Energiemanagementsystemen können für Vorkehrungen und Maßnahmen genutzt werden, mit denen Energieverbräuche, die den Bedarf übersteigen, wirkungsvoll reduziert werden. Die Bewertung solcher Vorkehrungen und Maßnahmen selbst ist indessen nicht Gegenstand der DIN V Dass in der Praxis der witterungsbereinigte Energieverbrauch niedriger als der berechnete Bedarf ausfällt, ist nicht ungewöhnlich. Das ist neben den genannten Ursachen in der Anlagentechnik im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Gebäude andere und in der Summe geringere Nutzungszeiten und Nutzungsanforderungen vorlagen, als sie in der Bedarfsberechnung zugrunde gelegt wurden. Gebäudeautomatisierungs- und Energiemanagementsysteme erlauben die Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs und seiner Änderungen. Im Teil 11 werden Verfahren angegeben, wie diese Möglichkeiten in einem verminderten Bedarf ausgewiesen werden können. Dazu werden die in den einzelnen Vornormenteilen von DIN V beschriebenen Steuer-, Regel- und Automationsfunktionen übersichtsartig zusammengestellt und entsprechend ihren möglichen Auswirkungen auf einen energieeffizienten Gebäudebetrieb bestimmten Automatisierungsgraden zugeordnet. Den Automatisierungsgraden ist eine fiktive Temperaturdifferenz zugeordnet, die bei der Bestimmung der Bilanz-Innentemperatur berücksichtigt wird, sodass der energetische Einfluss in der Bilanz nach Teil 2 ausgewiesen werden kann. In der überarbeiteten Ausgabe des Teils 11 sind zusätzliche Angaben zum elektrischen Hilfsenergieaufwand von Komponenten der Gebäudeautomation enthalten, die dann bei der Gesamtenergiebilanz mitberücksichtigt werden können. DIN V Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude Die Verfasser danken Prof. Dr.-Ing. Rainer Hirschberg, Hocheffizienzhausinstitut Wiesbaden, und Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann, ITG Dresden, für die Unterstützung bei der textlichen Beschreibung dieses neuen Teils. Mit der Ausgabe 2016 der Vornorm DIN V wurde erstmals ein ergänzendes Tabellenverfahren für Wohngebäude veröffentlicht. Beim Tabellenverfahren handelt es sich nicht um neue Berechnungsansätze, sondern es sind alle allgemeinen Berechnungsansätze aus den Teilen 1, 2, 5, 6, 8 und 9 unter Berücksichtigung der Standardwerte aus Teil 10 und der Standardwerte für Anlagenkomponenten und Anlagenteilbereiche in fertig berechnete Tabellen über- 21
23 DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden führt. Das Verfahren entspricht daher dem Ansatz der DIN V : , in dem gleichwertig zwischen Algorithmen und Tabellen gewählt werden kann, um den Energiebedarf zu bestimmen. Bei der Berechnung des Nutzenergiebedarfs kann durch einen vorausschauenden Ansatz für den Energieaufwand der Anlagentechnik eine Iteration vermieden werden. Die Tabellen für Anlagenkomponenten und Anlagenteilbereiche enthalten Aufwandszahlen, die von der mittleren Belastung, der Leistung oder von der Nettogrundfläche abhängen. Für alle Tabellen, die für bestimmte Randbedingungen erstellt sind, sind bei abweichenden Randbedingungen einfache Umrechnungen angegeben. Wie man detailliert von den Gleichungen in den Teilen 1, 2, 5, 6, 8 und 9 zu den zugehörigen Tabellen kommt, ist für jede Tabelle dokumentiert. Damit besteht auch die Möglichkeit, dass Hersteller produktbezogene Tabellen mit von den Standardwerten abweichenden Eingangsdaten erstellen können. Alle Berechnungen werden in Formblättern durchgeführt, sodass das Tabellenverfahren grundsätzlich auch als Handrechenverfahren durchzuführen ist. Das Tabellenverfahren ist ein Monatsbilanzverfahren, das sowohl für Neubauals auch Bestands-Wohngebäude angewendet werden kann. Beim Einsetzen gleicher Randbedingungen weichen die Ergebnisse gegenüber dem EDV-Verfahren nur in einem hinnehmbaren Toleranzbereich ab. Die im EDV-Verfahren möglichen Ansätze für saisonalen Fensterluftwechsel können im Tabellenverfahren einschränkend nicht berücksichtigt werden. Aus dem Bereich der Anlagentechnik sind Absorptions-Kältemaschinen und gasmotorische Wärmepumpen nicht in Tabellen abgebildet. Aufgrund der in Tabellen vorberechneten Aufwandszahlen führen Berechnungen mit gleichen Eingangswerten immer zu gleichen Ergebnissen. Durch die Verwendung von Aufwandszahlen können Berechnungen einfach kontrolliert werden und beim Anwender bildet sich Präsenzwissen. Mit dem Tabellenverfahren kann der energetische Nachweis für Wohngebäude geführt werden, sodass dieses geeignet ist, die Norm DIN V : , die nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, abzulösen. Das Verfahren kann aber auch zur Energieberatung auf der Grundlage von Standardwerten für die Anlagentechnik genutzt werden. Damit ist es in einfacher Form möglich, Ausführungsalternativen miteinander zu vergleichen oder bei Sanierungsmaßnahmen die Einhaltung oder Verbesserung der energetischen Qualität nachzuweisen. 22
Details zur Neuausgabe der DIN V Energetische Bewertung von Gebäuden
 Details zur Neuausgabe der DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden Hans Erhorn, Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP), Stuttgart Dipl.-Ing. Heiko Schiller, schiller engineering, Hamburg Prof.
Details zur Neuausgabe der DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden Hans Erhorn, Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP), Stuttgart Dipl.-Ing. Heiko Schiller, schiller engineering, Hamburg Prof.
Neuerungen der DIN V von Oktober 2016
 Neuerungen der DIN V 18599 von Oktober 2016 Die im Oktober 2016 erschienene Neufassung der DIN V 18599 ersetzt die Ausgabe von Dezember 2011 und die später veröffentlichen Berichtigungsblätter zu den Teilen
Neuerungen der DIN V 18599 von Oktober 2016 Die im Oktober 2016 erschienene Neufassung der DIN V 18599 ersetzt die Ausgabe von Dezember 2011 und die später veröffentlichen Berichtigungsblätter zu den Teilen
2.3 Energetische Bewertung von
 Seite 1 Die Norm DIN V 18599 entstand im Ergebnis der Arbeit eines gemeinsamen Arbeitsausschusses der DIN- Normenausschüsse Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik und Lichttechnik. Die Veröffentlichung der
Seite 1 Die Norm DIN V 18599 entstand im Ergebnis der Arbeit eines gemeinsamen Arbeitsausschusses der DIN- Normenausschüsse Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik und Lichttechnik. Die Veröffentlichung der
EnEV 2016 DIN V CEN EPBD Normen
 EnEV 2016 DIN V 18599 CEN EPBD Normen Neuausgabe 2016 der DIN V 18599 Hans Erhorn Fraunhofer-Institut für Bauphysik Auf Wissen bauen Fraunhofer IBP Meilensteine des energiesparenden Bauens - 8 kwh/m²a
EnEV 2016 DIN V 18599 CEN EPBD Normen Neuausgabe 2016 der DIN V 18599 Hans Erhorn Fraunhofer-Institut für Bauphysik Auf Wissen bauen Fraunhofer IBP Meilensteine des energiesparenden Bauens - 8 kwh/m²a
2 Energie Begriffe und Definitionen Gesetze, Verordnungen und Normen...23
 Teil I Wohngebäude 0 Einleitung Wohngebäude...14 1 Energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden... 15 1.1 Wohnkomfort...16 1.2 Wirtschaftlichkeit...16 1.3 Umwelt...16 2 Energie...17 2.1 Begriffe und
Teil I Wohngebäude 0 Einleitung Wohngebäude...14 1 Energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden... 15 1.1 Wohnkomfort...16 1.2 Wirtschaftlichkeit...16 1.3 Umwelt...16 2 Energie...17 2.1 Begriffe und
DIN V Teil 5 bis Y
 Bau 2011 18.01.2011 DIN V 18 599 Teil 5 bis Y Einbeziehung neuer Techniken bei der Berechnung nach EnEV/DIN V 18599 Dipl.Ing.Jürgen Schilling, Viessmann Werke GmbH & Co.KG, Allendorf/Eder Vorlage 1 07/2006
Bau 2011 18.01.2011 DIN V 18 599 Teil 5 bis Y Einbeziehung neuer Techniken bei der Berechnung nach EnEV/DIN V 18599 Dipl.Ing.Jürgen Schilling, Viessmann Werke GmbH & Co.KG, Allendorf/Eder Vorlage 1 07/2006
EnEV 2016 DIN V CEN EPBD Normen
 EnEV 2016 DIN V 18599 CEN EPBD Normen Neuausgabe 2016 der DIN V 18599 Hans Erhorn/Claus Händel Fraunhofer-Institut für Bauphysik/ Fachverband Gebäude-Klima e.v. Auf Wissen bauen Fraunhofer IBP Meilensteine
EnEV 2016 DIN V 18599 CEN EPBD Normen Neuausgabe 2016 der DIN V 18599 Hans Erhorn/Claus Händel Fraunhofer-Institut für Bauphysik/ Fachverband Gebäude-Klima e.v. Auf Wissen bauen Fraunhofer IBP Meilensteine
Heizen, Kuhlen, Beluften & Beleuchten
 Ruth David Ian de Boer Hans l'rhorn Johann KeiB Lothar Rouvel lleiko Schiller Nina WeiB Martin Wennin«Heizen, Kuhlen, Beluften & Beleuchten Bilanzierungsgrundlagen nach DIN V 18599 Fraunhofer IRB \erhm
Ruth David Ian de Boer Hans l'rhorn Johann KeiB Lothar Rouvel lleiko Schiller Nina WeiB Martin Wennin«Heizen, Kuhlen, Beluften & Beleuchten Bilanzierungsgrundlagen nach DIN V 18599 Fraunhofer IRB \erhm
Informationen zur EnEV-Bewertung Vitovalor 300-P
 Informationen zur EnEV-Bewertung Vitovalor 300-P Allgemeines Die zwei aktuell zulässigen EnEV-Nachweisverfahren für Wohngebäude (DIN V 4701-10, DIN V 18599) enthalten kein Verfahren für die Bewertung von
Informationen zur EnEV-Bewertung Vitovalor 300-P Allgemeines Die zwei aktuell zulässigen EnEV-Nachweisverfahren für Wohngebäude (DIN V 4701-10, DIN V 18599) enthalten kein Verfahren für die Bewertung von
EnEV 2014 und Gebäudeautomation
 und Gebäudeautomation Martin Hardenfels WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 1 Was ist der Unterschied zu den Energie Einspar Verordnungen davor? In der wird erstmals der Automationsgrad des Gebäudes berücksichtigt.
und Gebäudeautomation Martin Hardenfels WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 1 Was ist der Unterschied zu den Energie Einspar Verordnungen davor? In der wird erstmals der Automationsgrad des Gebäudes berücksichtigt.
Berechnung der Energieeffizienz im Nichtwohnungsbau nach EnEV Dr.-Ing. K.-H. Dahlem TU KL, EOR-Forum Dr.-Ing. K.- H.
 Berechnung der Energieeffizienz im Nichtwohnungsbau nach EnEV 2007 Dr.-Ing. K.-H. Dahlem EOR-Forum 2008 TU KL, 12.06.2008 18599_G_1-1 Klimawandel: Die Fieberkurve der Erde Quelle: Die Rheinpfalz, 03. Feb.
Berechnung der Energieeffizienz im Nichtwohnungsbau nach EnEV 2007 Dr.-Ing. K.-H. Dahlem EOR-Forum 2008 TU KL, 12.06.2008 18599_G_1-1 Klimawandel: Die Fieberkurve der Erde Quelle: Die Rheinpfalz, 03. Feb.
Beuth Verlag GmbH Energieversorgung online Paket Bilanzierung und Effizienz Stand:
 DIN 4108-2 2013-02 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz DIN 4108-3 2014-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter
DIN 4108-2 2013-02 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz DIN 4108-3 2014-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter
1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis
 1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis 1 Service und Verzeichnisse 1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis 1.2 Herausgeber und Autoren 1.3 Stichwortverzeichnis 1.4 Vorschriften 2 Grundlegende Anforderungen an die moderne Haustechnik
1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis 1 Service und Verzeichnisse 1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis 1.2 Herausgeber und Autoren 1.3 Stichwortverzeichnis 1.4 Vorschriften 2 Grundlegende Anforderungen an die moderne Haustechnik
Xella Group - Dipl.-Ing. Torsten Schoch. EnEV 2017/EnEV easy und Niedrigstenergiehaus 2021 Konzepte, Ideen und Fahrplan
 Xella Group - Dipl.-Ing. Torsten Schoch EnEV 2017/EnEV easy und Niedrigstenergiehaus 2021 Konzepte, Ideen und Fahrplan 20. März 2017 EnEV 2017 & Niedrigstenergiehaus 2021 Konzepte, Ideen und Fahrplan 1.
Xella Group - Dipl.-Ing. Torsten Schoch EnEV 2017/EnEV easy und Niedrigstenergiehaus 2021 Konzepte, Ideen und Fahrplan 20. März 2017 EnEV 2017 & Niedrigstenergiehaus 2021 Konzepte, Ideen und Fahrplan 1.
EnEV und Energieausweise 2009
 FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com EnEV und Energieausweise 2009 Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com EnEV und Energieausweise 2009 Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Die novellierte DIN V und das vereinfachte Nachweisverfahren
 Die novellierte DIN V 18599 und das vereinfachte Nachweisverfahren Berliner Energietage, 12.4.2016 BMWi-Forum Aktuelle Aspekte der Energieeffizienzstrategie in Gebäuden Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut
Die novellierte DIN V 18599 und das vereinfachte Nachweisverfahren Berliner Energietage, 12.4.2016 BMWi-Forum Aktuelle Aspekte der Energieeffizienzstrategie in Gebäuden Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut
Check-in Energieeffizienz Bilanzierung der Energieverbräuche
 Check-in Energieeffizienz Bilanzierung der Energieverbräuche 17.06.2016 Dipl.-Ing. Architekt Jan Karwatzki, Öko-Zentrum NRW Öko-Zentrum NRW Planen Beraten Qualifizieren Wir sind. Ansprechpartner für alle
Check-in Energieeffizienz Bilanzierung der Energieverbräuche 17.06.2016 Dipl.-Ing. Architekt Jan Karwatzki, Öko-Zentrum NRW Öko-Zentrum NRW Planen Beraten Qualifizieren Wir sind. Ansprechpartner für alle
Energieeffiziente Nichtwohngebäude
 Achim Hamann Energieeffiziente Nichtwohngebäude Grundlagen, Beispiele und Bilanzierungsansätze nach DIN V 18599 Fraunhofer IRB Verlag Inhaltsverzeichnis Vorwort...................... 11 Teil 1: Einführung
Achim Hamann Energieeffiziente Nichtwohngebäude Grundlagen, Beispiele und Bilanzierungsansätze nach DIN V 18599 Fraunhofer IRB Verlag Inhaltsverzeichnis Vorwort...................... 11 Teil 1: Einführung
Bilanzierung in Nichtwohngebäuden Anlagentechnik im Fokus
 2. Energieeffizienz-Experten-Tag Bilanzierung in Nichtwohngebäuden Anlagentechnik im Fokus Berlin, 24.10.2018 Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und
2. Energieeffizienz-Experten-Tag Bilanzierung in Nichtwohngebäuden Anlagentechnik im Fokus Berlin, 24.10.2018 Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gültig bis: 09 / 2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche A N Erneuerbare
gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gültig bis: 09 / 2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche A N Erneuerbare
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung
 Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Bezeichnung Reihenendhaus Nutzungsart Wohngebäude PLZ, Ort 21614 Buxtehude Straße, Haus-Nr. Beispielstraße 3a Baujahr 2003 Jahr
Energiebedarfsausweis nach 13 Energieeinsparverordnung I. Objektbeschreibung Bezeichnung Reihenendhaus Nutzungsart Wohngebäude PLZ, Ort 21614 Buxtehude Straße, Haus-Nr. Beispielstraße 3a Baujahr 2003 Jahr
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 30.09.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) freistehendes Mehrfamilienhaus 1968 2007 40 2.766,0 m² Erneuerbare
Gültig bis: 30.09.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) freistehendes Mehrfamilienhaus 1968 2007 40 2.766,0 m² Erneuerbare
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 30.09.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Plattenmittelbau 1977 2007 80 5.530,8 m² Erneuerbare Energien
Gültig bis: 30.09.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Plattenmittelbau 1977 2007 80 5.530,8 m² Erneuerbare Energien
DIN V : (D)
 DIN V 18599-6:2016-10 (D) Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: Endenergiebedarf
DIN V 18599-6:2016-10 (D) Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: Endenergiebedarf
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
Erarbeitung eines Verfahrens zur energetischen Bewertung von Wärmepumpen für EnEV und DIN V 18599
 Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH Prof. Oschatz Dr. Hartmann Dr. Werdin Prof. Felsmann Erarbeitung eines Verfahrens zur energetischen Bewertung von Wärmepumpen
Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH Prof. Oschatz Dr. Hartmann Dr. Werdin Prof. Felsmann Erarbeitung eines Verfahrens zur energetischen Bewertung von Wärmepumpen
Leitfaden zur Energieausweisberechnung im SOLAR
 Leitfaden zur Energieausweisberechnung im SOLAR P:\ATP\IBK-ATP\GROUPS\TGA\ Energieausweis\Leitfaden_Energieausweis.ppt Dieser Leitfaden bezieht sich auf folgende Version: Durch Updates könnten einige Funktionen
Leitfaden zur Energieausweisberechnung im SOLAR P:\ATP\IBK-ATP\GROUPS\TGA\ Energieausweis\Leitfaden_Energieausweis.ppt Dieser Leitfaden bezieht sich auf folgende Version: Durch Updates könnten einige Funktionen
DIN ENERGIEEINSPARNACHWEIS FÜR NICHTWOHNGEBÄUDE. Neue Nichtwohngebäude: ab 01.Oktober Bestehende Nichtwohngebäude: ab 01.
 Fristen Neue Nichtwohngebäude: ab 01.Oktober 2007 Bestehende Nichtwohngebäude: ab 01. Juli 2009 Gebäude mit mehr als 1000 m² Grundfläche, in den Behörden und sonstige Einrichtungen für eine große Anzahl
Fristen Neue Nichtwohngebäude: ab 01.Oktober 2007 Bestehende Nichtwohngebäude: ab 01. Juli 2009 Gebäude mit mehr als 1000 m² Grundfläche, in den Behörden und sonstige Einrichtungen für eine große Anzahl
Energieberatungsbericht
 Projekt: Einfamilienhaus, Medlerstraße 68, 06618 Naumburg Energieberatungsbericht Gebäude: Medlerstraße 68 06618 Naumburg Auftraggeber: Frau Heidemarie Töpp Medlerstraße 68 06618 Naumburg Erstellt von:
Projekt: Einfamilienhaus, Medlerstraße 68, 06618 Naumburg Energieberatungsbericht Gebäude: Medlerstraße 68 06618 Naumburg Auftraggeber: Frau Heidemarie Töpp Medlerstraße 68 06618 Naumburg Erstellt von:
Energetische Bewertung von Gebäuden
 Dr.-Ing. Kati Jagnow Energetische Bewertung von Gebäuden Änderungen an der DIN V 18599 1 Aktuell: 18.10.2010 2 Hintergrund Bilanzierung eines Reihenhauses durch die kfw (intern) im Rahmen eines Förderantrages
Dr.-Ing. Kati Jagnow Energetische Bewertung von Gebäuden Änderungen an der DIN V 18599 1 Aktuell: 18.10.2010 2 Hintergrund Bilanzierung eines Reihenhauses durch die kfw (intern) im Rahmen eines Förderantrages
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien Lüftung Gebäudefoto (freiwillig) Anlass der
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien Lüftung Gebäudefoto (freiwillig) Anlass der
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 28.12.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N) Anlass der Austellung des Energieausweises MFH Sternenberg
Gültig bis: 28.12.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N) Anlass der Austellung des Energieausweises MFH Sternenberg
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 30.09.2020 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Plattenmittelbau 977 2007 20 8.296,2 m² Erneuerbare Energien
Gültig bis: 30.09.2020 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Plattenmittelbau 977 2007 20 8.296,2 m² Erneuerbare Energien
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 "Gesamtenergieeffizienz" Dieses Gebäudes 125,6 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 30,6 kg/(m²a) EnEV-Anforderungswert Neubau (Vergleichswert) EnEV-Anforderungswert
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 "Gesamtenergieeffizienz" Dieses Gebäudes 125,6 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 30,6 kg/(m²a) EnEV-Anforderungswert Neubau (Vergleichswert) EnEV-Anforderungswert
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 28.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Mehrfamilienhaus Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1898 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Anlagentechnik 1) 1992 Anzahl Wohnungen 10 Gebäudenutzfläche (A N
Gültig bis: 28.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Mehrfamilienhaus Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1898 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Anlagentechnik 1) 1992 Anzahl Wohnungen 10 Gebäudenutzfläche (A N
EnEV-Praxis 2009 Wohnbau
 Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dr.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis 2009 Wohnbau leicht und verständlich 3., aktualisierte Auflage ~auwerk Inhaltsverzeichnis EnEV-Praxis EnEV 2009 für Wohngebäude -.leicht
Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dr.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis 2009 Wohnbau leicht und verständlich 3., aktualisierte Auflage ~auwerk Inhaltsverzeichnis EnEV-Praxis EnEV 2009 für Wohngebäude -.leicht
Niedrigstenergiegebäude, EnEV, EEWärmeG Was bringt das Gebäudeenergiegesetz
 Niedrigstenergiegebäude, EnEV, EEWärmeG Was bringt das Gebäudeenergiegesetz Dipl.-Ing. Architekt Jan Karwatzki, Öko-Zentrum NRW Kommunentagung 2017 05.05.2017 Niedrigstenergiegebäude ab 2020 Vorgaben der
Niedrigstenergiegebäude, EnEV, EEWärmeG Was bringt das Gebäudeenergiegesetz Dipl.-Ing. Architekt Jan Karwatzki, Öko-Zentrum NRW Kommunentagung 2017 05.05.2017 Niedrigstenergiegebäude ab 2020 Vorgaben der
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 2.03.2020 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Bürogebäude 81669 München 1970 Gebäudefoto (freiwillig) Nettogrundfläche
Gültig bis: 2.03.2020 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Bürogebäude 81669 München 1970 Gebäudefoto (freiwillig) Nettogrundfläche
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
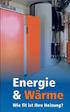 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig : 22.11.2022 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien Lüftung Neue Ortsmitte 2012 1993
Gültig : 22.11.2022 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien Lüftung Neue Ortsmitte 2012 1993
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig bis: 16.04.2024 1 Hauptnutzung / Straße Mattentwiete 6 PLZ Ort 20457 Hamburg teil Baujahr ganzes 1955 (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger 2003 Baujahr Klimaanlage
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig bis: 16.04.2024 1 Hauptnutzung / Straße Mattentwiete 6 PLZ Ort 20457 Hamburg teil Baujahr ganzes 1955 (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger 2003 Baujahr Klimaanlage
Berechnungsablauf nach Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden DI Heidrun Stückler LandesEnergieVerein
 August 2007 Folie 1 Berechnungsablauf nach Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden DI Heidrun Stückler LandesEnergieVerein www.lev.at h.stueckler@lev.at August 2007 Folie 2 Leitfaden energietechnisches
August 2007 Folie 1 Berechnungsablauf nach Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden DI Heidrun Stückler LandesEnergieVerein www.lev.at h.stueckler@lev.at August 2007 Folie 2 Leitfaden energietechnisches
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: Aushang Sonderzone(n) teil Baujahr foto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger Baujahr Klimaanlage Nettogrundfläche Primärenergiebedarf Gesamtenergieeffizienz Aufteilung Energiebedarf Kühlung einschl.
Gültig bis: Aushang Sonderzone(n) teil Baujahr foto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger Baujahr Klimaanlage Nettogrundfläche Primärenergiebedarf Gesamtenergieeffizienz Aufteilung Energiebedarf Kühlung einschl.
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 gemäß den 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 22.05.202 kategorie Adresse teil Schulung, Ausstellung, Museum Alfred-Kärcher-Straße 28-0 36 Winnenden Baujahr Baujahr Wärmeerzeuger ) Baujahr
gemäß den 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig bis: 22.05.202 kategorie Adresse teil Schulung, Ausstellung, Museum Alfred-Kärcher-Straße 28-0 36 Winnenden Baujahr Baujahr Wärmeerzeuger ) Baujahr
1 Einleitung 1. 2 Verordnungstext 4
 1 Einleitung 1 2 Verordnungstext 4 3 Die rechtlichen Auswirkungen der EnEV (Prof. Dr. Bernhard Rauch) 80 3.1 Die öffentlich-rechtlichen Auswirkungen der EnEV als Rechtsverordnung 82 3.1.1 Der Bauherr 84
1 Einleitung 1 2 Verordnungstext 4 3 Die rechtlichen Auswirkungen der EnEV (Prof. Dr. Bernhard Rauch) 80 3.1 Die öffentlich-rechtlichen Auswirkungen der EnEV als Rechtsverordnung 82 3.1.1 Der Bauherr 84
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 17.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Mehrfamilienhaus Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1928 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Anlagentechnik 1) 1994 Anzahl Wohnungen 12 Gebäudenutzfläche (A N
Gültig bis: 17.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Mehrfamilienhaus Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1928 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Anlagentechnik 1) 1994 Anzahl Wohnungen 12 Gebäudenutzfläche (A N
Studie EnEV 2002 BRUCK ZUM GLÜCK GIBT S. Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV
 ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 27.06.2020 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude, temperiert und belüftet Hohe Bleichen 10, 2035 Hamburg Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche
Gültig bis: 27.06.2020 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude, temperiert und belüftet Hohe Bleichen 10, 2035 Hamburg Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 ENERGIEAUSWEIS für Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Energiebedarf Freiherr von Thüngen Straße 4-6, 1477 Brand 2 91 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 5 [kg/(m² a)] 5 1 15 2 25 3 35 4 43 kwh/(m² a) "Gesamtenergieeffizienz"
ENERGIEAUSWEIS für Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Energiebedarf Freiherr von Thüngen Straße 4-6, 1477 Brand 2 91 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 5 [kg/(m² a)] 5 1 15 2 25 3 35 4 43 kwh/(m² a) "Gesamtenergieeffizienz"
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 12.08.2019 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude mit Vollklimaanlage Lange Laube 7, 30159 Hannover Gebäudeteil Baujahr Gebäude Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger Baujahr Klimaanlage
Gültig bis: 12.08.2019 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude mit Vollklimaanlage Lange Laube 7, 30159 Hannover Gebäudeteil Baujahr Gebäude Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger Baujahr Klimaanlage
DIN V : (D)
 DIN V 18599-4:2016-10 (D) Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf
DIN V 18599-4:2016-10 (D) Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf
Das bedarfsgeführte Abluftsystem. 1. Mit oder ohne Lüftungssystem?
 In der EnEV 2016 ist die bedarfsgeführte Lüftungsanlage von Aereco Referenztechnik für die Berechnung gemäß Referenzgebäude. Als feuchtegeführtes Abluftsystem mit oder ohne Abluftewärmenutzung, oder als
In der EnEV 2016 ist die bedarfsgeführte Lüftungsanlage von Aereco Referenztechnik für die Berechnung gemäß Referenzgebäude. Als feuchtegeführtes Abluftsystem mit oder ohne Abluftewärmenutzung, oder als
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber: Erstellt von: Herr Rainer Nowotny Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Planungsbüro Baukasten Dipl.-Ing. Architekt (FH) Christian
Energieberatungsbericht Gebäude: Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber: Erstellt von: Herr Rainer Nowotny Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Planungsbüro Baukasten Dipl.-Ing. Architekt (FH) Christian
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 30.09.2020 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) freistehendes Mehrfamilienhaus 968 2007 32 2.22,8 m² Erneuerbare
Gültig bis: 30.09.2020 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) freistehendes Mehrfamilienhaus 968 2007 32 2.22,8 m² Erneuerbare
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 31.12.2017 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Platteneckbau Othrichstr. 7-11, 39128 Magdeburg WI 169 1980
Gültig bis: 31.12.2017 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Platteneckbau Othrichstr. 7-11, 39128 Magdeburg WI 169 1980
Energieausweis für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Energieausweis für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Anlass der Ausstellung des Energieausweises
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 07.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus, Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1965 Baujahr Anlagentechnik 1982, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013 Anzahl Wohnungen 16 Gebäudenutzfläche
Gültig bis: 07.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus, Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1965 Baujahr Anlagentechnik 1982, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013 Anzahl Wohnungen 16 Gebäudenutzfläche
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 Gültig : 1.11.225 1 Adresse teil Baujahr Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien 214 214 214 1.168 m² foto (freiwillig) Lüftung RLT-Anlage Anlass der Ausstellung
Gültig : 1.11.225 1 Adresse teil Baujahr Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien 214 214 214 1.168 m² foto (freiwillig) Lüftung RLT-Anlage Anlass der Ausstellung
Planungs-Leitfaden zur Erarbeitung von Nachweisen und Energieausweisen nach EnEV unter Anwendung der DIN V 18599
 Planungs-Leitfaden zur Erarbeitung von Nachweisen und Energieausweisen nach EnEV unter Anwendung der DIN V 18599 Berlin, den 20.11.2007 Dr. Dieter Thiel +49 (0) 221-5741 5741-323 dieter.thiel@schmidtreuter.de
Planungs-Leitfaden zur Erarbeitung von Nachweisen und Energieausweisen nach EnEV unter Anwendung der DIN V 18599 Berlin, den 20.11.2007 Dr. Dieter Thiel +49 (0) 221-5741 5741-323 dieter.thiel@schmidtreuter.de
Bürogebäude nach EnEV Columbusstraße 1, Bremerhaven. Fernwärme, Abwärme, Umweltenergie (Kälte) Fensterlüftung, bereichsweise RLT-Anlage
 ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig : 1 19.04.202 Gebäude Hauptnutzung/ Bürogebäude nach EnEV 2009 Adresse Columbusstraße 1, 2770 Bremerhaven Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1)
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig : 1 19.04.202 Gebäude Hauptnutzung/ Bürogebäude nach EnEV 2009 Adresse Columbusstraße 1, 2770 Bremerhaven Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1)
Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe)
 Gesetzlicher Prüfungsverband Gültig bis: Seite 1 von 5 Gebäude Gebäudetyp MFH Adresse Waldstrasse 115, Stuttgart 61-151 Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1990 Baujahr Anlagetechnik 1990 Gebäudefoto (freiwillig)
Gesetzlicher Prüfungsverband Gültig bis: Seite 1 von 5 Gebäude Gebäudetyp MFH Adresse Waldstrasse 115, Stuttgart 61-151 Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1990 Baujahr Anlagetechnik 1990 Gebäudefoto (freiwillig)
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig : 29.4.224 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude Zeppelinstr. 2, 8225 Gilching Gebäudeteil Baujahr Gebäude 25 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger 1) 25 Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche
Gültig : 29.4.224 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude Zeppelinstr. 2, 8225 Gilching Gebäudeteil Baujahr Gebäude 25 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Wärmeerzeuger 1) 25 Baujahr Klimaanlage 1) Nettogrundfläche
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 31.12.2017 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Musterstraße 1, 12345 ABC-Stadt Gebäudeteil Einfamilienhaus Baujahr Gebäude 1960 Baujahr Anlagentechnik 1989 Anzahl Wohnungen
Gültig bis: 31.12.2017 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Musterstraße 1, 12345 ABC-Stadt Gebäudeteil Einfamilienhaus Baujahr Gebäude 1960 Baujahr Anlagentechnik 1989 Anzahl Wohnungen
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 12.9.225 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Büro 212 212 Gebäudefoto (freiwillig) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien
Gültig bis: 12.9.225 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Büro 212 212 Gebäudefoto (freiwillig) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 2.11.217 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Nichtwohngebäude Zur Wetterwarte, Haus 18 119 Dresden Gebäudeteil Baujahr Gebäude 194 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Anlagentechnik 1985 Anzahl Wohnungen
Gültig bis: 2.11.217 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Nichtwohngebäude Zur Wetterwarte, Haus 18 119 Dresden Gebäudeteil Baujahr Gebäude 194 Gebäudefoto (freiwillig) Baujahr Anlagentechnik 1985 Anzahl Wohnungen
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 24.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien 1999 1999 7 595 m² Gebäudefoto (freiwillig)
Gültig bis: 24.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien 1999 1999 7 595 m² Gebäudefoto (freiwillig)
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 24.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Mehrfamilienhaus, Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) 1994 1994 46 2.233,2 m² Erneuerbare Energien Lüftung
Gültig bis: 24.04.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Mehrfamilienhaus, Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) 1994 1994 46 2.233,2 m² Erneuerbare Energien Lüftung
Workshop Februar 2007, Graz 1
 Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden DI LandesEnergieVerein www.lev.at h.stueckler@lev.at Folie 1 Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden technischer Anhang zur OIB Richtlinie
Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden DI LandesEnergieVerein www.lev.at h.stueckler@lev.at Folie 1 Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden technischer Anhang zur OIB Richtlinie
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 gemäß den 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig : 3.07.2020 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude Heidenkampsweg 73-79, 20097 Hamburg Gebäudeteil Baujahr Gebäude 992 Gebäudefoto (freiwillig)
gemäß den 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig : 3.07.2020 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Bürogebäude Heidenkampsweg 73-79, 20097 Hamburg Gebäudeteil Baujahr Gebäude 992 Gebäudefoto (freiwillig)
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 27.01.2025 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Wohnen mit Gewerbe im Erdgeschoss 2014 2014 Gebäudefoto (freiwillig) Nettogrundfläche
Gültig bis: 27.01.2025 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) Wohnen mit Gewerbe im Erdgeschoss 2014 2014 Gebäudefoto (freiwillig) Nettogrundfläche
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 gemäß den 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig : 7.06.2023 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Logistikhalle Rudolf-Diesel-Straße 4 3423 Kassel-Fuldabrück Gebäudeteil Baujahr Gebäude 20 Gebäudefoto (freiwillig)
gemäß den 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gültig : 7.06.2023 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Logistikhalle Rudolf-Diesel-Straße 4 3423 Kassel-Fuldabrück Gebäudeteil Baujahr Gebäude 20 Gebäudefoto (freiwillig)
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig : 24.10.2020 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Verwaltungsgebäude größer 3500 qm NGF Landsberger Straße 392-410 81241 München Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage
Gültig : 24.10.2020 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Verwaltungsgebäude größer 3500 qm NGF Landsberger Straße 392-410 81241 München Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 3.9.223 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Einzelhandel/Arztpraxen Arnulfstr. 199, 8634 München Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) 197 213 213 Gebäudefoto
Gültig bis: 3.9.223 1 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Einzelhandel/Arztpraxen Arnulfstr. 199, 8634 München Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger 1) Baujahr Klimaanlage 1) 197 213 213 Gebäudefoto
ENERGIEAUSWEISfür Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 23.09.2019 1 Hauptnutzung / Adresse Nichtwohngebäude Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart teil Baujahr saniert in 1997 Baujahr Wärmeerzeuger Fernwärme Baujahr Klimaanlage - - - Nettogrundfläche
Gültig bis: 23.09.2019 1 Hauptnutzung / Adresse Nichtwohngebäude Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart teil Baujahr saniert in 1997 Baujahr Wärmeerzeuger Fernwärme Baujahr Klimaanlage - - - Nettogrundfläche
Bürogebäude mit Vollklimaanlage Darmstädter Landstraße Frankfurt/Main. Modernisierung (Änderung/Erweiterung)
 ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig bis: 1 3.4.224 Gebäude Hauptnutzung/ Bürogebäude mit Vollklimaanlage Darmstädter Landstraße 125 658 Frankfurt/Main Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude Gültig bis: 1 3.4.224 Gebäude Hauptnutzung/ Bürogebäude mit Vollklimaanlage Darmstädter Landstraße 125 658 Frankfurt/Main Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig : 0.06.2020 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger ) Baujahr Klimaanlage ) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien Bürogebäude Anckelmannplatz, 20597 Hamburg
Gültig : 0.06.2020 Gebäude Hauptnutzung/ Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Wärmeerzeuger ) Baujahr Klimaanlage ) Nettogrundfläche 2) Erneuerbare Energien Bürogebäude Anckelmannplatz, 20597 Hamburg
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 Gültig bis: 29.06.2018 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Mehrfamilienhaus Danziger Straße 2-12, Wilhelmsbader Str. 2, a-d 63477 Maintal -- Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen
Gültig bis: 29.06.2018 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Mehrfamilienhaus Danziger Straße 2-12, Wilhelmsbader Str. 2, a-d 63477 Maintal -- Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen
