Seminar SS Meilensteine der Softwaretechnik - Ausgewählte Turing-Preisträger. Joachim Steinmetz
|
|
|
- Irmela Fuhrmann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Seminar SS 2012 Meilensteine der Softwaretechnik - Ausgewählte Turing-Preisträger Joachim Steinmetz Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik TU Braunschweig Joachim Steinmetz Seminar MDS 1
2 Allgemeine Informationen Joachim Steinmetz Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik Mühlenpfordtstraße 23, Zimmer Sprechstunde: nach Vereinbarung Webseite zum Seminar: Joachim Steinmetz Seminar MDS 2
3 Überblick 1. Seminar 2. Organisatorisches 3. Literaturarbeit 4. Ausarbeitung 5. Begutachtung anderer Arbeiten 6. Präsentation 7. Themen 8. Zusammenfassung Joachim Steinmetz Seminar MDS 3
4 Seminar Seminar Lernziele (MHB) Selbstständige Einarbeitung, Aufbereitung und Präsentation eines Themas. Feststellung der Wirkung des eigenen Vortrags auf andere Studierende. Erlernen von Schlüsselqualifikationen, wie etwa der Präsentationstechnik und Verfeinerung rhetorischer Fähigkeiten. Leistungsnachweis Notenvergabe nach Qualität der Ausarbeitung und des Vortrags Joachim Steinmetz Seminar MDS 4
5 Seminar Meilensteine der Softwaretechnik - Ausgewählte Turing-Preisträger Seit 46 Jahren wird jährlich der Turing Award für ausgezeichnete Leistungen in der Informatik von der ACM verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung in der Informatik und deren Themen sind die historischen Meilensteine der Informatik. Das Seminar beschäftigt sich mit zwölf ausgewählten Turing-Preisträger und ihren herausragenden Leistungen in der Softwaretechnik. Joachim Steinmetz Seminar MDS 5
6 Seminar Einzelthemen - Überblick Alan Turing - Turingmaschine Donald Knuth - The Art of Computer Programming (+ TeX) John Backus - Fortran Edsger W. Dijkstra - ALGOL (+ Dijkstra s Algorithmus) Niklaus Wirth - Pascal John McCarthy - Lisp Joachim Steinmetz Seminar MDS 6
7 Seminar Einzelthemen - Überblick (2) Kristen Nygaard/Ole J. Dahl - Simula Alan Kay - Smalltalk Barbara Liskov - OOP Tony Hoare - CSP (+ Hoare Kalkül) Robin Milner - CCS (+ ML) Amir Pnueli - LTL Joachim Steinmetz Seminar MDS 7
8 Fragestellungen Seminar Welche Forschungsschwerpunkte gehören zu dem Turingpreisträger? Welche (historischen) Ursprünge haben die ausgezeichneten Leistungen des Turingpreisträgers? Was sind die elementaren Bausteine der entwickleten Sprachen/Konzepte/Spezifikationen? Welche Beispiele werden zur Illustration betrachtet? Gibt es vergleichbare oder gegensätzliche Ansätze? Welche Werkzeuge benutzen die Konzepte des Turingpreisträgers? Joachim Steinmetz Seminar MDS 8
9 Fragestellungen (2) Seminar Welche Konzepte bauen auf die ausgezeichneten Leistungen auf (inkl. Werkzeuge+Beispiele)? Wie ist die Nutzbarkeit der ausgezeichneten Leistung zu bewerten? Können mit dem Konzept Probleme zufriedenstellend gelöst werden? Welche Vorteile hat der Ansatz? Welche Probleme bringt er mit sich? Welches sind in der Zukunft weiteren Arbeiten an diesem Thema? Joachim Steinmetz Seminar MDS 9
10 Organisatorisches Erfolgreiche Teilnahme Seiten Ausarbeitung zu Ihrem Thema Entwurf eines Posters Minuten Vortrag (plus Diskussion) Begutachtung von zwei anderen Ausarbeitungen Anwesenheit bei allen Veranstaltungen Einhaltung sämtlicher Abgabefristen Joachim Steinmetz Seminar MDS 10
11 Organisatorisches Zeitplan Abgabe Gliederung der Ausarbeitung: 14. Mai 2012 Abgabe erste Version der Ausarbeitung: 18. Juni 2012 Abgabe der Begutachtungen: 2. Juli 2012 Abgabe endgültige Version der Ausarbeitung: 7. Juli 2012 Abgabe der Präsentation: 48 Stunden vor dem Vortrag Seminar als Blockveranstaltung Freitag, , 09:00h - 13:45h, IZ 349, (Themen 1-6) Freitag, , 09:00h - 13:45h, IZ 349, (Themen 7-12) Joachim Steinmetz Seminar MDS 11
12 Literatur Literaturarbeit Literaturreferenz ist Startpunkt. Außerdem eigene Literaturrecherche: WWW, z.b. Google Scholar, Citeseer,... WWW-Bibliotheken, z.b., ACM Digital Library, IEEE Computer Society Library, Springer-Verlag,... Uni-Bibliothek Joachim Steinmetz Seminar MDS 12
13 Literaturarbeit Arten von Quellen Wissenschaftliche Monographien (Bücher) Artikel in Zeitschriften bzw. Journale Artikel in Konferenzbänden Technische Berichte Joachim Steinmetz Seminar MDS 13
14 Literaturarbeit Internet-Quellen Probleme: Verfasser, Titel, Erscheinsjahr häufig nicht vorhanden. Informationen sind ungefiltert. Kein Verleger, Lektor oder Gutachter prüft es auf Richtigkeit und Qualtität. Internetliteraturstellen können wieder verschwinden. Wikipedia kann ein guter Anfang für Ihre Literaturrecherche sein, aber nicht das Ende! Joachim Steinmetz Seminar MDS 14
15 Ausarbeitung Ausarbeitung - Formales Seiten deutsch oder englisch Formatvorlage Springer LNCS (Link auf Webseite) Termine Abgabe der ersten Version: 18. Juni 2012 per Abgabe der endgültigen Version: 9. Juli 2012 per Joachim Steinmetz Seminar MDS 15
16 Ausarbeitung Inhalt der Ausarbeitung Basics Forschungsschwerpunkte des Turingpreisträger Ursprünge der ausgezeichneten Leistungen Elementare Bausteine Beispiele + Werkzeuge Vergleichbare oder gegensätzliche Ansätze Joachim Steinmetz Seminar MDS 16
17 Ausarbeitung Inhalt der Ausarbeitung (2) Erweiterungen und Nutzbarkeit Aufbauende Konzepte (inkl. Werkzeuge+Beispiele) Bewertung der Nutzbarkeit der ausgezeichneten Leistung Praxistauglichkeit Vorteile Nachteile, Probleme und mögliche Lösungen Zukünftige Arbeiten Joachim Steinmetz Seminar MDS 17
18 Ausarbeitung Aufbau der Ausarbeitung 1. Titelblatt/Titelzeile mit Titel, Autorenname, Matrikelnummer, Art der Arbeit, Ort und Datum 2. Zusammenfassung (abstract) 3. Einleitung 4. Hauptteil 5. Zusammenfassung und Ausblick 6. Literaturverzeichnis 7. ggf. Anhang Joachim Steinmetz Seminar MDS 18
19 Ausarbeitung Gliederung Folgen Sie dem generellen Aufbau der Ausarbeitung. Strukturieren Sie den Hauptteil in zusammenhängende Teile. Wählen Sie aussagekräftige Überschriften Achten Sie auf eine nachvollziehbare Struktur. Verwenden Sie nicht zu viele Gliederungsebenen. Schreiben Sie zu jedem Abschnitt kurz den beabsichtigten Inhalt auf (1-2 Sätze). Abgabe der Gliederung 15. Mai 2012 per Joachim Steinmetz Seminar MDS 19
20 Ausarbeitung Struktur einer Einleitung Einführung in das Thema Motivation (warum ist die Arbeit wichtig?) Ziele (welches Problem wird gelöst?) Lösungsansatz Gliederung des Dokuments (1 Absatz) Joachim Steinmetz Seminar MDS 20
21 Ausarbeitung Schreibstil Ein Gedanke - ein Satz. Ein Sinnzusammenhang - ein Absatz. Kurze Sätze, keine Verschachtelungen, keine Zusätze Dinge beim Namen nennen, klare Begriffe, ggf. Fremdworte erläutern, Begriffe konsistent verwenden Auf Sinnzusammenhänge und Übergänge achten. Joachim Steinmetz Seminar MDS 21
22 Zitate Ausarbeitung Referenz auf Originalquellen intellektuelle Ehrlichkeit Abgrenzung zur eigenen Arbeit Absicherung der eigenen Argumente Kein blindes Zitieren (Zitate lesen!) Plagiat durch mangelhaftes Zitieren. Literaturangaben sollen Auffinden der Quellen möglichst einfach machen. Verwendung von LaTeX und BibTeX Joachim Steinmetz Seminar MDS 22
23 Zitate (2) Ausarbeitung Gängige Varianten für Zitate: Nummern Anfänge von Verfassernamen und Erscheinungsjahr vollständige Verfassernamen, ohne oder mit Erscheinungsjahr Joachim Steinmetz Seminar MDS 23
24 Ausarbeitung Referenzen Vollständige Quellenangaben: Author(en) Titel Als was erschienen? (Buch, Zeitschriftenartikel, Konferenzbeitrag,technischer Bericht, Diplomarbeit, etc. ) ggf. Seitenzahlen Erscheinungsjahr, -monat und -ort Verlag zusätzliche Informationen nach Bedarf Joachim Steinmetz Seminar MDS 24
25 Begutachtung anderer Arbeiten Begutachtung Jeder Teilnehmer bekommt 2 Ausarbeitungen zur Begutachtung Gutachten maximal 2 Seiten LNCS Seien Sie konstruktiv! Machen Sie Verbesserungsvorschläge! Zuordnung der Gutachter zu Themen: siehe Webseite Termine Ausgabe der zu begutachtenden Arbeiten: 19. Juni 2012 per Abgabe der Gutachen: 2. Juli 2012 per Joachim Steinmetz Seminar MDS 25
26 Begutachtung anderer Arbeiten Aufbau des Gutachtens Kurze Inhaltsangabe Positive Aspekte Negative Aspekte Verbesserungsvorschläge Kleinere Anmerkungen (Tippfehler, Formulierungen,... ) Joachim Steinmetz Seminar MDS 26
27 Ziele der Präsentation Präsentation Halten Sie das Publikum wach und aufmerksam. Zuhörer sollen einige zentrale Ideen mitnehmen Lust auf den Inhalt bekommen einen guten Eindruck vom Vortragenden bekommen Zuhörer sollen nicht den vollen Inhalt meines Papiers kennen lernen unvorstellbar schwierige Teile sehen Joachim Steinmetz Seminar MDS 27
28 Präsentation Wichtige Aspekte Thema/Ziel: Was will ich darstellen, wie will ich es darstellen? Zielgruppe: Den Vortrag auf die Zuhörer abstimmen Inhalt: Der Zuhörer darf mit Informationen nicht überladen werden, Inhalt anpassen, sich auf die wesentlichen Dinge beschränken Mediennutzung Zeitrahmen einhalten Auftreten/Kleidung Joachim Steinmetz Seminar MDS 28
29 Präsentation Aufbau einer Präsentation 1. Motivation (worum geht es? Ziel/Fragestellung/Problem?) 2. Gliederung (was werde ich sagen?) 3. Hauptteil (nachvollziehbare Reihenfolge finden) 4. Zusammenfassung und Ausblick Joachim Steinmetz Seminar MDS 29
30 Präsentation Präsentationstechnik Publikum durch den Vortrag führen (wo bin ich gerade?) Erinnern statt voraussetzen Langsam sprechen, Pausen machen Kontakt zum Publikum halten Natürlich und freundlich bleiben Frei sprechen, nicht vorlesen/auswendig lernen Offene Körperhaltung Probevortrag macht den Meister! Joachim Steinmetz Seminar MDS 30
31 Foliengestaltung Präsentation Folien sollen Zuhörer beim Verfolgen des Vortrages unterstützen. Lesbar und übersichtlich Aussagekräftige Überschriften Stichworte statt ganzer Sätze 1 Thema/Folie Joachim Steinmetz Seminar MDS 31
32 Foliengestaltung (2) Präsentation Verwenden Sie Grafiken. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Animationen sollten sparsam eingesetzt werden. Schriftgröße mind. 20pt. Klare Farben verwenden. Heller Hintergrund. Auf ausreichenden Kontrast achten. Joachim Steinmetz Seminar MDS 32
33 Präsentation Lampenfieber Gehört dazu. Gute Vorbereitung hilft. Probevortrag halten. Einstimmen, Seminarraum vorher besuchen. Joachim Steinmetz Seminar MDS 33
34 Themen Themen Thema: Alan Turing - Turingmaschine Bearbeiter: Saskia Bellekom Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Hopcroft, John E.; Motwani Rajeev; Ullman, Jeffrey D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. 2. Auflage. Addison-Wesley, 2000, ISBN Wiener, Oswald; Bonik, Manuel; Hödicke, Robert: Eine elementare Einführung in die Theorie der Turing-Maschinen, Springer, 1998 Joachim Steinmetz Seminar MDS 34
35 Themen Themen Thema: Donald Knuth - The Art of Computer Programming (+ TeX) Bearbeiter: Alexander Scholz Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Knuth, Donald E.: The Art of Computer Programming, Volumes 1 4, Addison-Wesley Professional, 1997 Knuth, Donald E.: The TeXbook, Addison-Wesley, 1984 Joachim Steinmetz Seminar MDS 35
36 Themen Themen Thema: John Backus - Fortran Bearbeiter: Uwe Lesta Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Backus, John: Can Programming be liberated from the von Neumann Stype? - A Functional Style and its Algebra of Programs, ACM Turing Award Lecture, 1977 Akin, John E.: Object-oriented programming via Fortran 90/95, Cambridge Univ. Press, 2003, ISBN Joachim Steinmetz Seminar MDS 36
37 Themen Themen Thema: Edsger W. Dijkstra - ALGOL (+ Dijkstra s Algorithmus) Bearbeiter: Samy Elshamy Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Dijkstra, Edsger W.: A note on two problems in connexion with graphs. In: Numerische Mathematik. 1 (1959), S de Beer, H.T.: The History of the ALGOL Effort (M.Sc. thesis, TU Eindhoven) Joachim Steinmetz Seminar MDS 37
38 Themen Themen Thema: Niklaus Wirth - Pascal Bearbeiter: Matthias Lorenz Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Wirth, Nikolaus: The Programming Language Pascal. Acta Informatica 1(1971), pp Jensen, Kathleen; Wirth, Nikolaus: Pascal User Manual and Report. ISO Pascal Standard. Broschiert, 266 Seiten, Springer-Verlag, 4th ed. 1991, ISBN Joachim Steinmetz Seminar MDS 38
39 Themen Themen Thema: John McCarthy - Lisp Bearbeiter: Dominik Drescher Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Bothner, Peter P.; Kähler, Wolf-Michael: Programmieren in LISP : eine elementare und anwendungsorientierte Einführung, Vieweg, 1993 McCarthy, John: History of Lisp, online available : Joachim Steinmetz Seminar MDS 39
40 Themen Themen Thema: Kristen Nygaard/Ole J. Dahl - Simula Bearbeiter: Adrian Steinhauer Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Dahl, Ole-Johan; Nygaard, Kristen: Simula An Algol-based Simulation Language. CACM, 9(9): , Lamprecht, Günther: Einführung in die Programmiersprache SIMULA: Anleitung zum Selbststudium, Vieweg, 1988, ISBN: Joachim Steinmetz Seminar MDS 40
41 Themen Themen Thema: Alan Kay - Smalltalk Bearbeiter: Marc Aurel Kastner Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Goldberg, Adele; Robson, David: Smalltalk-80 : the language and its implementation, Addison-Wesley, 1983 Brauer, Johannes: Grundkurs Smalltalk - Objektorientierung von Anfang an: eine Einführung in die Programmierung, Vieweg+Teubner Verlag/GWV Fachverlage GmbH, 2009 Joachim Steinmetz Seminar MDS 41
42 Themen Themen Thema: Barbara Liskov - OOP Bearbeiter: Leonie Breitmoser Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Liskov, Barbara; Guttag, John: Abstraction and Specification in Program Development, MIT Press, 1989 Liskov, Barbara; Guttag, John: Program development in Java: abstraction, specification, and object-oriented design, Addison-Wesley, 2001 Joachim Steinmetz Seminar MDS 42
43 Themen Themen Thema: Tony Hoare - CSP (+ Hoare Kalkül) Bearbeiter: Stefan Kolatzki Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Hoare, C. A. R.: An axiomatic basis for computer programming, in Communications of the ACM. 12(10): , Oktober 1969 Tennent, R.D.: Specifying Software: A Hands-On Introduction, Cambridge University Press, 2002 Hoare, C. A. R.: Communicating Sequential Processes, Prentice Hall International, 1985 Joachim Steinmetz Seminar MDS 43
44 Themen Themen Thema: Robin Milner - CCS (+ ML) Bearbeiter: Jochen Kamischke Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Milner, Robin: A Calculus of Communicating Systems, Springer Verlag, 1980 Smolka, Gert: Programmierung - eine Einführung in die Informatik mit Standard ML, Oldenbourg, 2008 Joachim Steinmetz Seminar MDS 44
45 Themen Themen Thema: Amir Pnueli - LTL Bearbeiter: Christopher Lippert Betreuer: Joachim Steinmetz Literatur: Manna, Zohar; Pnueli A.: The Temporal Logic of Reactive and Concurrent Systems: Specification, Springer, 1992 Kröger, Fred: Temporal Logic of programs, Springer, 1987 Galton, Antony: Temporal logics and their applications, Acad. Press, 1987 Joachim Steinmetz Seminar MDS 45
46 Zusammenfassung Kontakt Joachim Steinmetz Sprechstunde nach Vereinbarung Joachim Steinmetz Seminar MDS 46
47 Zusammenfassung Erinnerung: Zeitplan Abgabe Gliederung der Ausarbeitung: 14. Mai 2012 Abgabe erste Version der Ausarbeitung: 18. Juni 2012 Abgabe der Begutachtungen: 2. Juli 2012 Abgabe endgültige Version der Ausarbeitung: 7. Juli 2012 Abgabe der Präsentation: 48 Stunden vor dem Vortrag Seminar als Blockveranstaltung: Freitag, , 09:00h - 13:45h, IZ 349, (Themen 1-6) Freitag, , 09:00h - 13:45h, IZ 349, (Themen 7-12) Joachim Steinmetz Seminar MDS 47
Moderne Programmierparadigmen
 Moderne Programmierparadigmen Seminar Softwaretechnik WS 2010/2011 Dr.-Ing. Ina Schaefer Software Systems Engineering TU Braunschweig Ina Schaefer Seminar MPP 1 Allgemeine Informationen Dr.-Ing Ina Schaefer
Moderne Programmierparadigmen Seminar Softwaretechnik WS 2010/2011 Dr.-Ing. Ina Schaefer Software Systems Engineering TU Braunschweig Ina Schaefer Seminar MPP 1 Allgemeine Informationen Dr.-Ing Ina Schaefer
Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik. Prof. Dr. Stefan Voß. Universität Hamburg Institut für Wirtschaftsinformatik
 Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Stefan Voß Universität Hamburg Institut für Wirtschaftsinformatik Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik - Seminar Prof. Dr. Stefan Voß Universität
Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Stefan Voß Universität Hamburg Institut für Wirtschaftsinformatik Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik - Seminar Prof. Dr. Stefan Voß Universität
Software Engineering & Software Performance Engineering
 Software Engineering & Software Performance Engineering Seminar Vorlage AG Software Engineering AG Software Engineering Seminarleitung: Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring (wha) Betreuung:
Software Engineering & Software Performance Engineering Seminar Vorlage AG Software Engineering AG Software Engineering Seminarleitung: Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring (wha) Betreuung:
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme
 Seminar Programmierung und Reaktive Systeme Qualitätssicherung Softwareintensiver Eingebetteter Systeme Betreuer: Sascha Lity, Hauke Baller in Kooperation mit dem Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme Qualitätssicherung Softwareintensiver Eingebetteter Systeme Betreuer: Sascha Lity, Hauke Baller in Kooperation mit dem Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik
Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik. Universität Hamburg Institut für Wirtschaftsinformatik
 Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Stefan Voß Universität Hamburg Institut für Wirtschaftsinformatik Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik - Prof. Dr. Stefan Voß Universität
Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Stefan Voß Universität Hamburg Institut für Wirtschaftsinformatik Kernveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik - Prof. Dr. Stefan Voß Universität
Einführung in die Theoretische Informatik
 Einführung in die Theoretische Informatik Stefan Rass System Security Research Group (syssec), Institute of Applied Informatics Alpen-Adria Universität Klagenfurt {stefan.rass}@aau.at 2017 WS 2017-09-29
Einführung in die Theoretische Informatik Stefan Rass System Security Research Group (syssec), Institute of Applied Informatics Alpen-Adria Universität Klagenfurt {stefan.rass}@aau.at 2017 WS 2017-09-29
Seminararbeitstechniken. Proseminar Algorithmen der Verkehrssimulation WS 05/06 Michael Moltenbrey, Dirk Pflüger
 Seminararbeitstechniken Proseminar Algorithmen der Verkehrssimulation WS 05/06 Michael Moltenbrey, Dirk Pflüger Gliederung Organisatorisches Wie bearbeite ich ein Thema? Wie baue ich einen Vortrag auf?
Seminararbeitstechniken Proseminar Algorithmen der Verkehrssimulation WS 05/06 Michael Moltenbrey, Dirk Pflüger Gliederung Organisatorisches Wie bearbeite ich ein Thema? Wie baue ich einen Vortrag auf?
Seminar Kommunikation und Multimedia
 Seminar Kommunikation und Multimedia Real-Time Sensor Networks Advanced Real-Time Sensor Networks Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund Technische Universität Braunschweig 27.10.2008 IBR, TU
Seminar Kommunikation und Multimedia Real-Time Sensor Networks Advanced Real-Time Sensor Networks Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund Technische Universität Braunschweig 27.10.2008 IBR, TU
Wissenschaftliches Arbeiten
 Wissenschaftliches Arbeiten Schriftliche Ausarbeitungen Guido de Melo Seite 2 Ablauf von Seminaren Blockseminar Themenvergabe Recherche Ausarbeitung Review Vortrag/Präsentation Seite 3 Lernziele Eigenständige
Wissenschaftliches Arbeiten Schriftliche Ausarbeitungen Guido de Melo Seite 2 Ablauf von Seminaren Blockseminar Themenvergabe Recherche Ausarbeitung Review Vortrag/Präsentation Seite 3 Lernziele Eigenständige
Telepräsenz und virtuelle Realität
 Seminar Telepräsenz und virtuelle Realität Was kommt nach Second Life? WS 2007/2008 Fakultät für Informatik Institut für Technische Informatik Lehrstuhl für Intelligente Sensor-Aktor-Systeme (ISAS) Dipl.-Ing.
Seminar Telepräsenz und virtuelle Realität Was kommt nach Second Life? WS 2007/2008 Fakultät für Informatik Institut für Technische Informatik Lehrstuhl für Intelligente Sensor-Aktor-Systeme (ISAS) Dipl.-Ing.
Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten
 Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten Einleitung und Recherche Thomas Beckers, Sebastian Dungs, Norbert Fuhr, Matthias Jordan, Sascha Kriewel, Marc Lechtenfeld, Vu Tran Sommersemester 2013 Einführung
Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten Einleitung und Recherche Thomas Beckers, Sebastian Dungs, Norbert Fuhr, Matthias Jordan, Sascha Kriewel, Marc Lechtenfeld, Vu Tran Sommersemester 2013 Einführung
Organisatorisches. Software Engineering 1 WS 2012/13. Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer. Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik TU Braunschweig
 Organisatorisches Software Engineering 1 WS 2012/13 Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik TU Braunschweig Ina Schaefer SE 1 - WS 2012/13 1 Allgemeine Informationen
Organisatorisches Software Engineering 1 WS 2012/13 Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik TU Braunschweig Ina Schaefer SE 1 - WS 2012/13 1 Allgemeine Informationen
Hinweise zum Verfassen einer Hausarbeit
 Hinweise zum Verfassen einer Hausarbeit 1. Umfang 2. Format 3. Aufbau 3.1. Titelblatt 3.2. Inhaltsverzeichnis 3.3. Einleitung 3.4. Hauptkapitel 3.5. Zusammenfassung 3.6. Literaturverzeichnis 4. Quellenangaben
Hinweise zum Verfassen einer Hausarbeit 1. Umfang 2. Format 3. Aufbau 3.1. Titelblatt 3.2. Inhaltsverzeichnis 3.3. Einleitung 3.4. Hauptkapitel 3.5. Zusammenfassung 3.6. Literaturverzeichnis 4. Quellenangaben
Tipps für einen guten Seminarbeitrag
 Seminar "Ausgewählte Themen aus der Computergrafik und Visualisierung" 13.06.2012 Tipps für einen guten Seminarbeitrag Prof. Dr. Heike Leitte, Anja Schäfer, Julia Portl CoVis, IWR Heidelberg, Germany Based
Seminar "Ausgewählte Themen aus der Computergrafik und Visualisierung" 13.06.2012 Tipps für einen guten Seminarbeitrag Prof. Dr. Heike Leitte, Anja Schäfer, Julia Portl CoVis, IWR Heidelberg, Germany Based
Wie schreibt man eine Ausarbeitung?
 Wie schreibt man eine Ausarbeitung? Holger Karl Holger.karl@upb.de Computer Networks Group Universität Paderborn Übersicht Ziel einer Ausarbeitung Struktur Sprache Korrektes Zitieren Weitere Informationen
Wie schreibt man eine Ausarbeitung? Holger Karl Holger.karl@upb.de Computer Networks Group Universität Paderborn Übersicht Ziel einer Ausarbeitung Struktur Sprache Korrektes Zitieren Weitere Informationen
Illustrative Visualisierung
 Seminar Illustrative Visualisierung Dr. Kai Lawonn, Prof. Bernhard Preim Institut für Simulation und Graphik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 1/16 Seminarleiter Kai Lawonn lawonn@isg.cs.uni-magdeburg.de
Seminar Illustrative Visualisierung Dr. Kai Lawonn, Prof. Bernhard Preim Institut für Simulation und Graphik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 1/16 Seminarleiter Kai Lawonn lawonn@isg.cs.uni-magdeburg.de
Proseminar Programming Languages from Hell
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN LEHRSTUHL SPRACHEN UND BESCHREIBUNGSSTRUKTUREN Proseminar Programming Languages from Hell Organisatorisches Andrea Flexeder Sommersemester 2010 Andrea Flexeder (TUM) Proseminar
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN LEHRSTUHL SPRACHEN UND BESCHREIBUNGSSTRUKTUREN Proseminar Programming Languages from Hell Organisatorisches Andrea Flexeder Sommersemester 2010 Andrea Flexeder (TUM) Proseminar
Pioniere der Informatik
 Pioniere der Informatik Seminar im Wintersemester 2009/10 Martin Lange Institut für Informatik, LMU München 20. Oktober 2009 Pioniere der Informatik, M. Lange, IFI/LMU: Organisatorisches 1 Termine Seminar
Pioniere der Informatik Seminar im Wintersemester 2009/10 Martin Lange Institut für Informatik, LMU München 20. Oktober 2009 Pioniere der Informatik, M. Lange, IFI/LMU: Organisatorisches 1 Termine Seminar
Vortragstechnik. Prof. Dr. Thomas Ludwig. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Informatik Abteilung für parallele und verteilte Systeme
 Vortragstechnik Prof. Dr. Thomas Ludwig Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Informatik Abteilung für parallele und verteilte Systeme Email : t.ludwig@computer.org Die Folien dieses Vortrags
Vortragstechnik Prof. Dr. Thomas Ludwig Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Informatik Abteilung für parallele und verteilte Systeme Email : t.ludwig@computer.org Die Folien dieses Vortrags
Konzepte von Betriebssystem-Komponenten: Effiziente Manycore-Systeme
 Konzepte von Betriebssystem-Komponenten: Effiziente Manycore-Systeme Florian Schmaus, Stefan Reif Lehrstuhl für Informatik 4 Verteilte Systeme und Betriebssysteme Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Konzepte von Betriebssystem-Komponenten: Effiziente Manycore-Systeme Florian Schmaus, Stefan Reif Lehrstuhl für Informatik 4 Verteilte Systeme und Betriebssysteme Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Diskrete Strukturen WS 2010/11. Ernst W. Mayr. Wintersemester 2010/11. Fakultät für Informatik TU München
 WS 2010/11 Diskrete Strukturen Ernst W. Mayr Fakultät für Informatik TU München http://www14.in.tum.de/lehre/2010ws/ds/ Wintersemester 2010/11 Diskrete Strukturen Kapitel 0 Organisatorisches Vorlesungen:
WS 2010/11 Diskrete Strukturen Ernst W. Mayr Fakultät für Informatik TU München http://www14.in.tum.de/lehre/2010ws/ds/ Wintersemester 2010/11 Diskrete Strukturen Kapitel 0 Organisatorisches Vorlesungen:
Wie schreibe ich eine Seminarausarbeitung?
 Wie schreibe ich eine Seminarausarbeitung? Felix Freiling Freiling, Konferenzseminar, 6.10.2009 pi1.informatik.uni-mannheim.de Seite 1 Motivation Sie wollen den Seminarschein erhalten Sie haben einen oder
Wie schreibe ich eine Seminarausarbeitung? Felix Freiling Freiling, Konferenzseminar, 6.10.2009 pi1.informatik.uni-mannheim.de Seite 1 Motivation Sie wollen den Seminarschein erhalten Sie haben einen oder
Patrick Scharpfenecker May 23, Proseminar Algorithmen Organisatorisches & Themen
 Patrick Scharpfenecker May 23, 2015 Proseminar Algorithmen Organisatorisches & Themen Page 2 Proseminar Algorithmen Organisatorisches & Themen Scharpfenecker May 23, 2015 Allgemeines Was ist ein Seminar?
Patrick Scharpfenecker May 23, 2015 Proseminar Algorithmen Organisatorisches & Themen Page 2 Proseminar Algorithmen Organisatorisches & Themen Scharpfenecker May 23, 2015 Allgemeines Was ist ein Seminar?
Prof. Dr. Thomas Ludwig
 Vortragstechnik Prof. Dr. Thomas Ludwig Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Informatik Abteilung für parallele und verteilte Systeme Email : t.ludwig@computer.org Gliederung Einarbeitung,
Vortragstechnik Prof. Dr. Thomas Ludwig Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Informatik Abteilung für parallele und verteilte Systeme Email : t.ludwig@computer.org Gliederung Einarbeitung,
Software-Engineering Seminar, Summer AG Softech FB Informatik TU Kaiserslautern
 Software-Engineering Seminar, Summer 2016 AG Softech FB Informatik TU Kaiserslautern Studenten Fragen: Studienfach? Software-Entwicklung 3 gehört? Erfahrungen in Programmierung mit Nebenläufigkeit? Zum
Software-Engineering Seminar, Summer 2016 AG Softech FB Informatik TU Kaiserslautern Studenten Fragen: Studienfach? Software-Entwicklung 3 gehört? Erfahrungen in Programmierung mit Nebenläufigkeit? Zum
Rahmenbedingungen für Erhalt und Benotung eines Seminarscheines
 Rahmenbedingungen für Erhalt und Benotung eines Seminarscheines in der AG Visualisierung Otto von Guericke Universität Magdeburg AG Visualisierung 1/12 1. Bearbeitung eines Themas ORGANISATORISCHES Allgemein
Rahmenbedingungen für Erhalt und Benotung eines Seminarscheines in der AG Visualisierung Otto von Guericke Universität Magdeburg AG Visualisierung 1/12 1. Bearbeitung eines Themas ORGANISATORISCHES Allgemein
Vorlesung Formale Aspekte der Software-Sicherheit und Kryptographie Sommersemester 2015 Universität Duisburg-Essen
 Vorlesung Formale Aspekte der Software-Sicherheit und Kryptographie Sommersemester 2015 Universität Duisburg-Essen Prof. Barbara König Übungsleitung: Sebastian Küpper Barbara König Form. Asp. der Software-Sicherheit
Vorlesung Formale Aspekte der Software-Sicherheit und Kryptographie Sommersemester 2015 Universität Duisburg-Essen Prof. Barbara König Übungsleitung: Sebastian Küpper Barbara König Form. Asp. der Software-Sicherheit
Vorlesung Automaten und Formale Sprachen alias Theoretische Informatik Sommersemester 2015
 Vorlesung Automaten und Formale Sprachen alias Theoretische Informatik Sommersemester 2015 Prof. Barbara König Übungsleitung: Jan Stückrath Barbara König Automaten und Formale Sprachen 1 Das heutige Programm:
Vorlesung Automaten und Formale Sprachen alias Theoretische Informatik Sommersemester 2015 Prof. Barbara König Übungsleitung: Jan Stückrath Barbara König Automaten und Formale Sprachen 1 Das heutige Programm:
Titel der Bachelorarbeit
 Titel der Bachelorarbeit von Johanna Musterfrau Bachelorarbeit in Physik vorgelegt dem Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik (FB 08) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 1. April 2012 1.
Titel der Bachelorarbeit von Johanna Musterfrau Bachelorarbeit in Physik vorgelegt dem Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik (FB 08) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 1. April 2012 1.
Deductive Software Verification The KeY Book Haupt- und Proseminar in SoSe 2017
 Deductive Software Verification The KeY Book Haupt- und Proseminar in SoSe 2017 Bernhard Beckert 02.05.17 INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK, KIT KIT âăş Die ForschungsuniversitÃd t in der Helmholtz-Gemeinschaft
Deductive Software Verification The KeY Book Haupt- und Proseminar in SoSe 2017 Bernhard Beckert 02.05.17 INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK, KIT KIT âăş Die ForschungsuniversitÃd t in der Helmholtz-Gemeinschaft
Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten
 Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik Prof. Dr. Thomas Bienengräber Dipl.-Hdl. Verena Ulber Dipl.-Hdl. Gabriele Viedenz 6. Juni 2011 Agenda 1
Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik Prof. Dr. Thomas Bienengräber Dipl.-Hdl. Verena Ulber Dipl.-Hdl. Gabriele Viedenz 6. Juni 2011 Agenda 1
PS Diskurse über Informatik: Selbstbild vs. Fremdbild. Einführung Quellen- und Diskursanalyse, wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren
 PS Diskurse über Informatik: Selbstbild vs. Fremdbild Einführung Quellen- und Diskursanalyse, wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren Jörg pohle@informatik.hu-berlin.de http://waste.informatik.hu-berlin.de/lehre/ss09/diskurse/
PS Diskurse über Informatik: Selbstbild vs. Fremdbild Einführung Quellen- und Diskursanalyse, wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren Jörg pohle@informatik.hu-berlin.de http://waste.informatik.hu-berlin.de/lehre/ss09/diskurse/
Liste MI / Liste I Programmieren in C++
 Liste MI / Liste I Programmieren in C++ Fachhochschule Wiesbaden, FB Design Informatik Medien Studiengang Medieninformatik WS 2007/2008 Kapitel 1-4 1 Ziele Kennenlernen einer weiteren objektorientierten
Liste MI / Liste I Programmieren in C++ Fachhochschule Wiesbaden, FB Design Informatik Medien Studiengang Medieninformatik WS 2007/2008 Kapitel 1-4 1 Ziele Kennenlernen einer weiteren objektorientierten
Tipps zum Halten von Vorträgen
 Tipps zum Halten von Vorträgen Stefan Thater FR4.7 Allgemeine Linguistik (Computerlinguistik) Universität des Saarlandes 2011-10-31 Sinn und Zweck von Seminaren In Seminaren soll das wissenschaftliche
Tipps zum Halten von Vorträgen Stefan Thater FR4.7 Allgemeine Linguistik (Computerlinguistik) Universität des Saarlandes 2011-10-31 Sinn und Zweck von Seminaren In Seminaren soll das wissenschaftliche
Vorlesung Modellierung nebenläufiger Systeme Sommersemester 2014 Universität Duisburg-Essen
 Vorlesung Modellierung nebenläufiger Systeme Sommersemester 2014 Universität Duisburg-Essen Barbara König Übungsleitung: Sebastian Küpper Barbara König Vorlesung Modellierung nebenläufiger Systeme 1 Das
Vorlesung Modellierung nebenläufiger Systeme Sommersemester 2014 Universität Duisburg-Essen Barbara König Übungsleitung: Sebastian Küpper Barbara König Vorlesung Modellierung nebenläufiger Systeme 1 Das
Beauty is our Business
 Beauty is our Business Prof. Dr. W. Reisig Sommersemester 2003 1. Übersicht und Organisatorisches 1 Beauty is our Business... so heißt ein bekannter Klassiker des Informatikers Edsger W. Dijkstra. Wissenschaft
Beauty is our Business Prof. Dr. W. Reisig Sommersemester 2003 1. Übersicht und Organisatorisches 1 Beauty is our Business... so heißt ein bekannter Klassiker des Informatikers Edsger W. Dijkstra. Wissenschaft
Grundlagen der Programmiersprachen
 GPS-0-1 Grundlagen der Programmiersprachen Prof. Dr. Uwe Kastens Sommersemester 2016 Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2016 / Folie 001 Anfang Begrüßung Ziele GPS-0-2 Die Vorlesung soll Studierende
GPS-0-1 Grundlagen der Programmiersprachen Prof. Dr. Uwe Kastens Sommersemester 2016 Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2016 / Folie 001 Anfang Begrüßung Ziele GPS-0-2 Die Vorlesung soll Studierende
How to make a PIXAR movie? WS 2012/2013
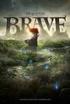 Proseminar/Seminar How to make a PIXAR movie? WS 2012/2013 Computer Graphics and Visualization Group Technische Universität München Überblick Sinn und Zweck eines Seminars Anforderungen und Zeitplan Überblick
Proseminar/Seminar How to make a PIXAR movie? WS 2012/2013 Computer Graphics and Visualization Group Technische Universität München Überblick Sinn und Zweck eines Seminars Anforderungen und Zeitplan Überblick
Einführung zum Seminar
 Einführung zum Seminar Philipp Slusallek Computergraphik Universität des Saarlandes Übersicht Motivation Literatur Vortrag Bericht 1 Motivation Seminare Einführung und Training des wissenschaftlichen Arbeitens
Einführung zum Seminar Philipp Slusallek Computergraphik Universität des Saarlandes Übersicht Motivation Literatur Vortrag Bericht 1 Motivation Seminare Einführung und Training des wissenschaftlichen Arbeitens
Seminar Visualisierung von Graphen
 Seminar Visualisierung von Graphen Vortrag, Ausarbeitung, Feedback Wintersemester 2015/2016 28. Oktober 2015 Fabian Lipp basierend auf einem Vortrag von Dorothea Wagner Vorbereitung des Vortrags Den bzw.
Seminar Visualisierung von Graphen Vortrag, Ausarbeitung, Feedback Wintersemester 2015/2016 28. Oktober 2015 Fabian Lipp basierend auf einem Vortrag von Dorothea Wagner Vorbereitung des Vortrags Den bzw.
Gute Seminarvorträge Tipps & Tricks. Katharina Hahn
 Gute Seminarvorträge Tipps & Tricks. Katharina Hahn Motivation» Vorträge sind in Studium und Wissenschaft unumgänglich» Seminarvorträge» Diplom/Master/Studien/Bachelorarbeiten» Evtl. weitergehend: Vorträge
Gute Seminarvorträge Tipps & Tricks. Katharina Hahn Motivation» Vorträge sind in Studium und Wissenschaft unumgänglich» Seminarvorträge» Diplom/Master/Studien/Bachelorarbeiten» Evtl. weitergehend: Vorträge
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR INFORMATIK. Seminar. Vortragstechnik und Organisation. Dr. V. Vojdani & Dr. M. Petter. Sommersemester 2012
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR INFORMATIK Seminar Vortragstechnik und Organisation Dr. V. Vojdani & Dr. M. Petter Sommersemester 2012 Dr. V. Vojdani & Dr. M. Petter (TUM) Seminar SS 2012 1
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR INFORMATIK Seminar Vortragstechnik und Organisation Dr. V. Vojdani & Dr. M. Petter Sommersemester 2012 Dr. V. Vojdani & Dr. M. Petter (TUM) Seminar SS 2012 1
Wissenschaftliches Arbeiten
 Wissenschaftliches Arbeiten Sommersemester 2017 Steffi Nagel Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomie, Prof. Dr. Klaus Wälde Ziel der Veranstaltung Ziel des Seminars ist der Erwerb der
Wissenschaftliches Arbeiten Sommersemester 2017 Steffi Nagel Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomie, Prof. Dr. Klaus Wälde Ziel der Veranstaltung Ziel des Seminars ist der Erwerb der
Techniken der Projektentwicklung
 Präsentationstechniken 2. Termin Inhaltliche Fragen Präsentationen in der Projektentwicklung Übersicht Inhaltliche Fragen Präsentationen in der Projektentwicklung Inhaltliche Planung Optische Gestaltung
Präsentationstechniken 2. Termin Inhaltliche Fragen Präsentationen in der Projektentwicklung Übersicht Inhaltliche Fragen Präsentationen in der Projektentwicklung Inhaltliche Planung Optische Gestaltung
Berühmte Informatiker
 Berühmte Informatiker Teil 10: J. Backus & D. E. Knuth 1924-1938- * 03.12.1924 in Philadelphia John Backus Vorzeitiger Abbruch des Studiums der Chemie (1942) und der Medizin (1945) Während der Arbeit als
Berühmte Informatiker Teil 10: J. Backus & D. E. Knuth 1924-1938- * 03.12.1924 in Philadelphia John Backus Vorzeitiger Abbruch des Studiums der Chemie (1942) und der Medizin (1945) Während der Arbeit als
Seminar Ubiquitous Computing Bachelor / Seminar Ubiquitous Computing Master
 Seminar Ubiquitous Computing Bachelor / Seminar Ubiquitous Computing Master Institute of Operating Systems and Computer Networks Abteilung DUS Monty Beuster TU Braunschweig Institute of Operating Systems
Seminar Ubiquitous Computing Bachelor / Seminar Ubiquitous Computing Master Institute of Operating Systems and Computer Networks Abteilung DUS Monty Beuster TU Braunschweig Institute of Operating Systems
Seminar. NoSQL Datenbank Technologien. Michaela Rindt - Christopher Pietsch. Richtlinien Ausarbeitung (15. November 2015)
 Seminar Datenbank Technologien Richtlinien Ausarbeitung (15. November 2015) Michaela Rindt - Christopher Pietsch Agenda 1 2 3 1 / 12 Richtlinien Ausarbeitung (15. November 2015) Teil 1 2 / 12 Richtlinien
Seminar Datenbank Technologien Richtlinien Ausarbeitung (15. November 2015) Michaela Rindt - Christopher Pietsch Agenda 1 2 3 1 / 12 Richtlinien Ausarbeitung (15. November 2015) Teil 1 2 / 12 Richtlinien
Computerspiele. Seminar WS 2007/08 Prof. Dr. R. Westermann & Andere. computer graphics & visualization. computer graphics & visualization
 Computerspiele Seminar WS 2007/08 Prof. Dr. R. Westermann & Andere Motivation - Sinn und Zweck eines Seminars Einführung (Training) in das wissenschaftliche Arbeiten - Strukturierte Informationssuche -
Computerspiele Seminar WS 2007/08 Prof. Dr. R. Westermann & Andere Motivation - Sinn und Zweck eines Seminars Einführung (Training) in das wissenschaftliche Arbeiten - Strukturierte Informationssuche -
Prozessmodellierung am Beispiel Seminar MIS im WS 2013/2014
 Prozessmodellierung am Beispiel Seminar MIS im WS 2013/2014 Auszug: Mokosch, M. 2013 Folie 1 Agenda Einleitung Vorbereitung Struktur der Präsentation Umgang mit Fragen Typische Fehler Arten der visuellen
Prozessmodellierung am Beispiel Seminar MIS im WS 2013/2014 Auszug: Mokosch, M. 2013 Folie 1 Agenda Einleitung Vorbereitung Struktur der Präsentation Umgang mit Fragen Typische Fehler Arten der visuellen
Richtlinien und Hinweise für. Seminararbeiten
 Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Wie halte ich einen Vortrag?
 Einführung in die Geheimnisse eines guten Vortrags Martin Gruber Bin Hu 25. Oktober 2005 Grundregeln Prinzipielle Fragen Welchen Zweck verfolge ich mit meinem Vortrag? Seminarvortrag, Vorlesung, Konferenz,...?
Einführung in die Geheimnisse eines guten Vortrags Martin Gruber Bin Hu 25. Oktober 2005 Grundregeln Prinzipielle Fragen Welchen Zweck verfolge ich mit meinem Vortrag? Seminarvortrag, Vorlesung, Konferenz,...?
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Wintersemester 1999/00 Informatik und Gesellschaft Dipl.-Soz. Andreas Breiter Forschungsgruppe Telekommunikation Universität Bremen 1 Überblick Phasen der Referatserstellung
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Wintersemester 1999/00 Informatik und Gesellschaft Dipl.-Soz. Andreas Breiter Forschungsgruppe Telekommunikation Universität Bremen 1 Überblick Phasen der Referatserstellung
Präsentationstechnik
 Lehrstuhl für Informatik III RWTH Aachen Seminar im Hauptstudium Wintersemester 03/04 Entwicklungsprozesse Management, Werkzeuge, Integration Präsentationstechnik Prof. Dr.-Ing. Manfred Nagl Priv.-Doz.
Lehrstuhl für Informatik III RWTH Aachen Seminar im Hauptstudium Wintersemester 03/04 Entwicklungsprozesse Management, Werkzeuge, Integration Präsentationstechnik Prof. Dr.-Ing. Manfred Nagl Priv.-Doz.
Vorlesung Automotive Software Engineering Prüfung Sommersemester 2015
 Vorlesung Automotive Software Engineering Prüfung Sommersemester 2015 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik Honorarprofessur
Vorlesung Automotive Software Engineering Prüfung Sommersemester 2015 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik Honorarprofessur
Sequenzanalyse-Praktikum
 Sequenzanalyse-Praktikum Veranstalter: Stefan Janssen, Jens Stoye, Linda Sundermann http://wiki.techfak.uni-bielefeld.de/gi/teaching/2013summer/sequaprak praktikum-seqan@cebitec.uni-bielefeld.de Inhalte
Sequenzanalyse-Praktikum Veranstalter: Stefan Janssen, Jens Stoye, Linda Sundermann http://wiki.techfak.uni-bielefeld.de/gi/teaching/2013summer/sequaprak praktikum-seqan@cebitec.uni-bielefeld.de Inhalte
Einige Tipps zur Präsentation von Referaten mit PowerPoint sowie zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten
 Einige Tipps zur Präsentation von Referaten mit PowerPoint sowie zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten Markus Knauff Institut für Kognitionsforschung Übersicht (1) Motivation und Einleitung Gestaltung
Einige Tipps zur Präsentation von Referaten mit PowerPoint sowie zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten Markus Knauff Institut für Kognitionsforschung Übersicht (1) Motivation und Einleitung Gestaltung
Korrektheit durch modulare Konstruktion. Wie kann man die Korrektheit reaktiver Systeme gewährleisten?
 Korrektheit durch modulare Konstruktion Wie kann man die Korrektheit reaktiver Systeme gewährleisten? Ansatz: Durch systematische Konstruktion (Schlagwort: strukturierte Programmierung für parallele Programmiersprachen)
Korrektheit durch modulare Konstruktion Wie kann man die Korrektheit reaktiver Systeme gewährleisten? Ansatz: Durch systematische Konstruktion (Schlagwort: strukturierte Programmierung für parallele Programmiersprachen)
Objektorientiertes Programmieren
 JL Ute Claussen Objektorientiertes Programmieren Mit Beispielen und Übungen in C++ Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 24 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Was ist
JL Ute Claussen Objektorientiertes Programmieren Mit Beispielen und Übungen in C++ Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 24 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Was ist
Wie kann man die Korrektheit reaktiver Systeme gewährleisten?
 Korrektheit durch modulare Konstruktion Wie kann man die Korrektheit reaktiver Systeme gewährleisten? Ansatz: Durch systematische Konstruktion (Schlagwort: strukturierte Programmierung für parallele Programmiersprachen)
Korrektheit durch modulare Konstruktion Wie kann man die Korrektheit reaktiver Systeme gewährleisten? Ansatz: Durch systematische Konstruktion (Schlagwort: strukturierte Programmierung für parallele Programmiersprachen)
Richtig Zitieren. Merkblatt für das Zitieren in Studienarbeiten und Masterarbeit. September, 2015
 Richtig Zitieren Merkblatt für das Zitieren in Studienarbeiten und Masterarbeit September, 2015 Wann ist ein Text ein Plagiat? In einer als Plagiat bezeichneten schriftlichen Arbeit weist der überwiegende
Richtig Zitieren Merkblatt für das Zitieren in Studienarbeiten und Masterarbeit September, 2015 Wann ist ein Text ein Plagiat? In einer als Plagiat bezeichneten schriftlichen Arbeit weist der überwiegende
Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität Wintersemester 2016/17. Wer sind wir? Willkommen zu
 Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität Wintersemester 2016/17 Prof. Barbara König Übungsleitung: Sebastian Küpper Willkommen zu Berechenbarkeit und Komplexität (Bachelor Angewandte Informatik, Duisburg
Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität Wintersemester 2016/17 Prof. Barbara König Übungsleitung: Sebastian Küpper Willkommen zu Berechenbarkeit und Komplexität (Bachelor Angewandte Informatik, Duisburg
Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey D. Ullman. Data Structures and Algorithmus. Addison-Wesley, Reading, NY,
 312 Literaturverzeichnis [AHU83] [Aig04] [ASU86] [AU92] [Bro04] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey D. Ullman. Data Structures and Algorithmus. Addison-Wesley, Reading, NY, 1983. 10.6 Martin Aigner.
312 Literaturverzeichnis [AHU83] [Aig04] [ASU86] [AU92] [Bro04] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey D. Ullman. Data Structures and Algorithmus. Addison-Wesley, Reading, NY, 1983. 10.6 Martin Aigner.
Vorlesung Automotive Software Engineering Prüfung Wintersemester 2014/15 TU Darmstadt, FB 18 und FB 20
 Vorlesung Automotive Software Engineering Prüfung Wintersemester 2014/15 TU Darmstadt, FB 18 und FB 20 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität
Vorlesung Automotive Software Engineering Prüfung Wintersemester 2014/15 TU Darmstadt, FB 18 und FB 20 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität
Einführung in die Informatik für Nebenfach. Einleitung
 Einführung in die Informatik für Nebenfach Einleitung Organisatorisches, Motivation, Herangehensweise Wolfram Burgard 1 Vorlesung Zeit und Ort: Di+Do 11.00 13.00 Uhr, Gebäude 086, Raum 00-006 Dozent: Prof.
Einführung in die Informatik für Nebenfach Einleitung Organisatorisches, Motivation, Herangehensweise Wolfram Burgard 1 Vorlesung Zeit und Ort: Di+Do 11.00 13.00 Uhr, Gebäude 086, Raum 00-006 Dozent: Prof.
Abschnitt 1: Einführung
 Abschnitt 1: Einführung 1. Einführung 1.1 Historischer Überblick: Objektorientierte Programmiersprachen 1.2 Java Erste Schritte 1.3 Kommentare in Java 1 Einführung Informatik 2 (SS 07) 10 Überblick 1.
Abschnitt 1: Einführung 1. Einführung 1.1 Historischer Überblick: Objektorientierte Programmiersprachen 1.2 Java Erste Schritte 1.3 Kommentare in Java 1 Einführung Informatik 2 (SS 07) 10 Überblick 1.
Seminar Green-IT. Wissenschaftliches Arbeiten. Web: http://www.nm.ifi.lmu.de/seminar Email: seminar12@nm.ifi.lmu.de
 Seminar Green-IT Wissenschaftliches Arbeiten Web: http://www.nm.ifi.lmu.de/seminar Email: seminar12@nm.ifi.lmu.de Ablauf des Seminars und Termine Einführungsveranstaltung Donnerstag, 26. April 16:00 Uhr
Seminar Green-IT Wissenschaftliches Arbeiten Web: http://www.nm.ifi.lmu.de/seminar Email: seminar12@nm.ifi.lmu.de Ablauf des Seminars und Termine Einführungsveranstaltung Donnerstag, 26. April 16:00 Uhr
Seminar aus Informationswirtschaft
 Seminar aus Informationswirtschaft ao.univ.prof. Dr. Alexander Kaiser Institut für Informationswirtschaft 1 Seminararbeit Deckblatt Titel der Arbeit Name der LV Name, Matrikelnummer der Seminargruppe Email,
Seminar aus Informationswirtschaft ao.univ.prof. Dr. Alexander Kaiser Institut für Informationswirtschaft 1 Seminararbeit Deckblatt Titel der Arbeit Name der LV Name, Matrikelnummer der Seminargruppe Email,
Seminarvorbesprechung
 Seminarvorbesprechung Christian Funk, Christiane Barz, Christoph Sorge, Heiko Schepperle, Patrick Jochem Ausgewählte technische, rechtliche und ökonomische Aspekte des Entwurfs von Fahrerassistenzsystemen
Seminarvorbesprechung Christian Funk, Christiane Barz, Christoph Sorge, Heiko Schepperle, Patrick Jochem Ausgewählte technische, rechtliche und ökonomische Aspekte des Entwurfs von Fahrerassistenzsystemen
Kick-Off Paralleles Programmieren
 Fakultät Informatik Institut für Software- und Multimediatechnik, Lehrstuhl für Softwaretechnologie Kick-Off Paralleles Programmieren Thomas Kühn Motivation Moore's Law The complexity for minimum component
Fakultät Informatik Institut für Software- und Multimediatechnik, Lehrstuhl für Softwaretechnologie Kick-Off Paralleles Programmieren Thomas Kühn Motivation Moore's Law The complexity for minimum component
Wissenschaftliches Schreiben
 Wissenschaftliches Schreiben Clemens H. Cap Lehrstuhl Informations- und Kommunikationsdienste Universität Rostock http://www.tec.informatik.uni-rostock.de/iuk Didaktisches Vorgehen Wir sehen uns die einzelnen
Wissenschaftliches Schreiben Clemens H. Cap Lehrstuhl Informations- und Kommunikationsdienste Universität Rostock http://www.tec.informatik.uni-rostock.de/iuk Didaktisches Vorgehen Wir sehen uns die einzelnen
Ausgewählte Kapitel der Systemsoftwaretechnik: Rekonfigurierbare Systemsoftware
 Ausgewählte Kapitel der Systemsoftwaretechnik: Rekonfigurierbare Systemsoftware Christoph Erhardt, Peter Ulbrich Lehrstuhl für Informatik 4 Verteilte Systeme und Betriebssysteme Friedrich-Alexander-Universität
Ausgewählte Kapitel der Systemsoftwaretechnik: Rekonfigurierbare Systemsoftware Christoph Erhardt, Peter Ulbrich Lehrstuhl für Informatik 4 Verteilte Systeme und Betriebssysteme Friedrich-Alexander-Universität
Seminar Kryptographische Protokolle Tipps zum Halten eines Vortrags. Barbara König.. p.1/15
 Seminar Kryptographische Protokolle Tipps zum Halten eines Vortrags Barbara König. p.1/15 Warum halte ich einen Vortrag? Antwort 1: Um die Zuhörer zu beeindrucken Taktik: Viele Fremdwörter Schnelles Tempo
Seminar Kryptographische Protokolle Tipps zum Halten eines Vortrags Barbara König. p.1/15 Warum halte ich einen Vortrag? Antwort 1: Um die Zuhörer zu beeindrucken Taktik: Viele Fremdwörter Schnelles Tempo
Wege zur Hausarbeit Aufbau und Inhalt
 Wege zur Hausarbeit Aufbau und Inhalt 1 Aufbau einer Hausarbeit 1. Deckblatt 2. Inhaltsverzeichnis 3. Einleitung 4. Hauptteil 5. Schluss 6. Literaturverzeichnis 7. Anhang (optional) 2 D E C K B L A T T
Wege zur Hausarbeit Aufbau und Inhalt 1 Aufbau einer Hausarbeit 1. Deckblatt 2. Inhaltsverzeichnis 3. Einleitung 4. Hauptteil 5. Schluss 6. Literaturverzeichnis 7. Anhang (optional) 2 D E C K B L A T T
Seminar Serious Games FT Auftaktveranstaltung
 Seminar Serious Games FT 2017 Auftaktveranstaltung Agenda 1. Zeitplanung und Aufgaben 2. Bewertungskriterien (als Anhalt) 3. Aufgabenstellungen/Fragen Zeitplanung 15./16.03. Vortreffen 05.04. Auftaktveranstaltung
Seminar Serious Games FT 2017 Auftaktveranstaltung Agenda 1. Zeitplanung und Aufgaben 2. Bewertungskriterien (als Anhalt) 3. Aufgabenstellungen/Fragen Zeitplanung 15./16.03. Vortreffen 05.04. Auftaktveranstaltung
Vortrags- und Foliengestaltung
 Vortrags- und Foliengestaltung Elke Braun Marc Hanheide Mai 2003 Inhalt: Ziel eines Vortrags Vorbereitung Foliengestaltung Vortragsstil Kritik Zusammenfassung Vortrags- und Foliengestaltung 1 Der Vortrag
Vortrags- und Foliengestaltung Elke Braun Marc Hanheide Mai 2003 Inhalt: Ziel eines Vortrags Vorbereitung Foliengestaltung Vortragsstil Kritik Zusammenfassung Vortrags- und Foliengestaltung 1 Der Vortrag
Beispiel: Hamming-Folge Erzeuge eine Folge X = x 0,x 2,... mit folgenden Eigenschaften: 1. x i+1 > x i für alle i
 Beispiel: Hamming-Folge Erzeuge eine Folge X = x 0,x 2,... mit folgenden Eigenschaften: 1. x i+1 > x i für alle i FP-8.7 2. x 0 = 1 3. Falls x in der Folge X auftritt, dann auch 2x, 3x und 5x. 4. Nur die
Beispiel: Hamming-Folge Erzeuge eine Folge X = x 0,x 2,... mit folgenden Eigenschaften: 1. x i+1 > x i für alle i FP-8.7 2. x 0 = 1 3. Falls x in der Folge X auftritt, dann auch 2x, 3x und 5x. 4. Nur die
Wegleitung Master-Arbeiten
 Wegleitung Master-Arbeiten Prof. Dr. Philipp Baumann Prof. Dr. Norbert Trautmann Professur für Quantitative Methoden der BWL 16. Februar 2017 Überblick 1 2 3 Wegleitung Master-Arbeiten Frühjahrssemester
Wegleitung Master-Arbeiten Prof. Dr. Philipp Baumann Prof. Dr. Norbert Trautmann Professur für Quantitative Methoden der BWL 16. Februar 2017 Überblick 1 2 3 Wegleitung Master-Arbeiten Frühjahrssemester
Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten. Sabrina Strang Florian Zimmermann
 Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten Sabrina Strang Florian Zimmermann Überblick Ziel: Selbständig eine wissenschaftliche Arbeit erstellen und präsentieren Aufbau: 1. Einführung in das wissenschaftliche
Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten Sabrina Strang Florian Zimmermann Überblick Ziel: Selbständig eine wissenschaftliche Arbeit erstellen und präsentieren Aufbau: 1. Einführung in das wissenschaftliche
Informatik III. 1. Motivation und Organisation. Christian Schindelhauer
 1. Motivation und Organisation Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Institut für Informatik Wintersemester 2007/08 1 Organisation Motivation 2 2 Inhalt Endliche Automaten und Formale Sprachen Berechenbarkeitstheorie
1. Motivation und Organisation Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Institut für Informatik Wintersemester 2007/08 1 Organisation Motivation 2 2 Inhalt Endliche Automaten und Formale Sprachen Berechenbarkeitstheorie
Richtig Zitieren. Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten -eine Einführung- September 2017
 Richtig Zitieren Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten -eine Einführung- September 2017 Wann ist ein Text ein Plagiat? In einer als Plagiat bezeichneten schriftlichen Arbeit weist der überwiegende Teil
Richtig Zitieren Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten -eine Einführung- September 2017 Wann ist ein Text ein Plagiat? In einer als Plagiat bezeichneten schriftlichen Arbeit weist der überwiegende Teil
Aufbau der Klausur Controlling 2
 Aufbau der Klausur Controlling 2 Erster Teil der Klausur Bearbeitungsdauer 60 Minuten (d. h. 60 Punkte) Genau ein Thema aus mehreren Themen ist zu beantworten Es sind Zusammenhänge problemorientiert zu
Aufbau der Klausur Controlling 2 Erster Teil der Klausur Bearbeitungsdauer 60 Minuten (d. h. 60 Punkte) Genau ein Thema aus mehreren Themen ist zu beantworten Es sind Zusammenhänge problemorientiert zu
Informatik I. Grundlagen der systematischen Programmierung. Peter Thiemann WS 2007/08. Universität Freiburg, Germany
 Informatik I Grundlagen der systematischen Programmierung Peter Thiemann Universität Freiburg, Germany WS 2007/08 Literatur Herbert Klaeren, Michael Sperber. Die Macht der Abstraktion. Teubner Verlag,
Informatik I Grundlagen der systematischen Programmierung Peter Thiemann Universität Freiburg, Germany WS 2007/08 Literatur Herbert Klaeren, Michael Sperber. Die Macht der Abstraktion. Teubner Verlag,
Sequenzanalyse-Praktikum
 Sequenzanalyse-Praktikum Veranstalter: Roland Wittler, Linda Sundermann http://wiki.techfak.uni-bielefeld.de/gi/teaching/2016summer/sequaprak praktikum-seqan@cebitec.uni-bielefeld.de Inhalte und Ziele
Sequenzanalyse-Praktikum Veranstalter: Roland Wittler, Linda Sundermann http://wiki.techfak.uni-bielefeld.de/gi/teaching/2016summer/sequaprak praktikum-seqan@cebitec.uni-bielefeld.de Inhalte und Ziele
Einführung in die Informatik
 Einführung in die Informatik Einleitung Organisatorisches, Motivation, Herangehensweise Wolfram Burgard 1.1 Vorlesung Zeit und Ort: Mittwochs 16.00 18.00 Uhr Gebäude 101 HS 00-036 Informationen zur Vorlesung,
Einführung in die Informatik Einleitung Organisatorisches, Motivation, Herangehensweise Wolfram Burgard 1.1 Vorlesung Zeit und Ort: Mittwochs 16.00 18.00 Uhr Gebäude 101 HS 00-036 Informationen zur Vorlesung,
Einführung in die Theoretische Informatik. Woche 1. Harald Zankl. Institut für UIBK Wintersemester 2014/2015.
 Einführung in die Woche 1 Harald Zankl Institut für Informatik @ UIBK Wintersemester 2014/2015 Einleitung Einleitung HZ (IFI) ETI - Woche 1 8/210 Die beschäftigt sich mit der Abstraktion, Modellbildung
Einführung in die Woche 1 Harald Zankl Institut für Informatik @ UIBK Wintersemester 2014/2015 Einleitung Einleitung HZ (IFI) ETI - Woche 1 8/210 Die beschäftigt sich mit der Abstraktion, Modellbildung
Nein, bei der Luft, die ich atme, nein, bei dem Wasser, das ich trinke, niemals werde ich mir Tadel gefallen lassen über diese Darlegung!
 Nein, bei der Luft, die ich atme, nein, bei dem Wasser, das ich trinke, niemals werde ich mir Tadel gefallen lassen über diese Darlegung! [Pythagoras] Seminarvorträge Hinweise für Präsentationen Bernd
Nein, bei der Luft, die ich atme, nein, bei dem Wasser, das ich trinke, niemals werde ich mir Tadel gefallen lassen über diese Darlegung! [Pythagoras] Seminarvorträge Hinweise für Präsentationen Bernd
Einführung in die Theoretische Informatik
 Einführung in die Theoretische Informatik Woche 1 Harald Zankl Institut für Informatik @ UIBK Wintersemester 2014/2015 Einleitung Einleitung HZ (IFI) ETI - Woche 1 8/210 Theoretische Informatik Theoretische
Einführung in die Theoretische Informatik Woche 1 Harald Zankl Institut für Informatik @ UIBK Wintersemester 2014/2015 Einleitung Einleitung HZ (IFI) ETI - Woche 1 8/210 Theoretische Informatik Theoretische
Softwaretechnik. Überblick I. Prof. Dr. Rainer Koschke. Sommersemester 2007
 Softwaretechnik Prof. Dr. Rainer Koschke Fachbereich Mathematik und Informatik Arbeitsgruppe Softwaretechnik Universität Bremen Sommersemester 2007 Überblick I 1 Vorbemerkungen Vorbemerkungen: Vorbemerkungen
Softwaretechnik Prof. Dr. Rainer Koschke Fachbereich Mathematik und Informatik Arbeitsgruppe Softwaretechnik Universität Bremen Sommersemester 2007 Überblick I 1 Vorbemerkungen Vorbemerkungen: Vorbemerkungen
Softwaretechnik. Prof. Dr. Rainer Koschke. Sommersemester Fachbereich Mathematik und Informatik Arbeitsgruppe Softwaretechnik Universität Bremen
 Softwaretechnik Prof. Dr. Rainer Koschke Fachbereich Mathematik und Informatik Arbeitsgruppe Softwaretechnik Universität Bremen Sommersemester 2007 Überblick I 1 Vorbemerkungen Vorbemerkungen: Vorbemerkungen
Softwaretechnik Prof. Dr. Rainer Koschke Fachbereich Mathematik und Informatik Arbeitsgruppe Softwaretechnik Universität Bremen Sommersemester 2007 Überblick I 1 Vorbemerkungen Vorbemerkungen: Vorbemerkungen
Konferenzseminar IT-Sicherheit
 Konferenzseminar IT-Sicherheit SS 2014 Veranstalter: Felix Freiling, Hans-Georg Eßer Weitere Betreuer: Zinaida Benenson, Michael Gruhn, Norman Hänsch, Nadina Hintz, Sven Kälber, Philipp Klein, Werner Massonne,
Konferenzseminar IT-Sicherheit SS 2014 Veranstalter: Felix Freiling, Hans-Georg Eßer Weitere Betreuer: Zinaida Benenson, Michael Gruhn, Norman Hänsch, Nadina Hintz, Sven Kälber, Philipp Klein, Werner Massonne,
Seminar MAMMAMIA WS 2012/13 Literaturrecherche
 Seminar MAMMAMIA WS 2012/13 Literaturrecherche Richard Schaller Martin Hacker Künstliche Intelligenz Department Informatik FAU Erlangen-Nürnberg 15.11.2012 Gliederung 1 Wie finde ich relevante Literatur?
Seminar MAMMAMIA WS 2012/13 Literaturrecherche Richard Schaller Martin Hacker Künstliche Intelligenz Department Informatik FAU Erlangen-Nürnberg 15.11.2012 Gliederung 1 Wie finde ich relevante Literatur?
Richtlinien und Hinweise für. Bachelorarbeiten
 Richtlinien und Hinweise für Bachelorarbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Richtlinien und Hinweise für Bachelorarbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Sequenzanalyse-Praktikum
 Sequenzanalyse-Praktikum Veranstalter: Jens Stoye, Daniel Dörr, Tizian Schulz http://wiki.techfak.uni-bielefeld.de/gi/teaching/2017winter/sequaprak praktikum-seqan@cebitec.uni-bielefeld.de Inhalte und
Sequenzanalyse-Praktikum Veranstalter: Jens Stoye, Daniel Dörr, Tizian Schulz http://wiki.techfak.uni-bielefeld.de/gi/teaching/2017winter/sequaprak praktikum-seqan@cebitec.uni-bielefeld.de Inhalte und
Grundlagen methodischen Arbeitens
 Grundlagen methodischen Arbeitens Präsentationstechnik Ingo Feinerer, Reinhard Pichler, Stefan Woltran Arbeitsbereich Datenbanken und Artificial Intelligence Institut für Informationssysteme Technische
Grundlagen methodischen Arbeitens Präsentationstechnik Ingo Feinerer, Reinhard Pichler, Stefan Woltran Arbeitsbereich Datenbanken und Artificial Intelligence Institut für Informationssysteme Technische
Gut vortragen! Aber wie? Die Matiker e.v. Winter 2008/2009 Harald Selke. Die Matiker: Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten
 Gut vortragen! Aber wie? Die Matiker e.v. Winter 2008/2009 Harald Selke Die frohe Botschaft Gutes Vortragen ist keine Frage der Begabung. Gutes Vortragen sollte man wollen: - Es macht (allen) mehr Spaß.
Gut vortragen! Aber wie? Die Matiker e.v. Winter 2008/2009 Harald Selke Die frohe Botschaft Gutes Vortragen ist keine Frage der Begabung. Gutes Vortragen sollte man wollen: - Es macht (allen) mehr Spaß.
Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik 1 (Wintersemester 2017/18)
 Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik 1 (Wintersemester 2017/18) Steffen Lange steffen.lange@h-da.de copyrighted material (for h_da student use only) Über mich Fachgebiet: Theoretische Informatik
Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik 1 (Wintersemester 2017/18) Steffen Lange steffen.lange@h-da.de copyrighted material (for h_da student use only) Über mich Fachgebiet: Theoretische Informatik
P 5. Motivation. Motivation. Themenübersicht. Professionelle PräsentatorInnen präsentieren praxisnahe Präsentationstipps
 Professionelle PräsentatorInnen präsentieren praxisnahe Präsentationstipps P 5 Motivation Was fandet Ihr schon immer besonders schrecklich? Annika Hinze Jochen Schiller 22.1.2002/25.6.2002 Schiller/Hinze:
Professionelle PräsentatorInnen präsentieren praxisnahe Präsentationstipps P 5 Motivation Was fandet Ihr schon immer besonders schrecklich? Annika Hinze Jochen Schiller 22.1.2002/25.6.2002 Schiller/Hinze:
Wie gestalte ich eine Mindmap?
 Wie gestalte ich eine Mindmap? Schreibe das Thema in die Seitenmitte. Zeichne die Linien für die Hauptthemen vom Zentrum weg in Form von Ästen. Schreibe jeweils das Hauptthema ans Ende der Verbindungslinie
Wie gestalte ich eine Mindmap? Schreibe das Thema in die Seitenmitte. Zeichne die Linien für die Hauptthemen vom Zentrum weg in Form von Ästen. Schreibe jeweils das Hauptthema ans Ende der Verbindungslinie
Teil 2: Schriftliche Ausarbeitung. Hinweise zur Gestaltung von Seminararbeiten und anderen wissenschaftlichen Aufsätzen
 Teil 2: Schriftliche Ausarbeitung Hinweise zur Gestaltung von Seminararbeiten und anderen wissenschaftlichen Aufsätzen Elemente einer schriftlichen Arbeit Titel Autoren und ihre organisatorische Zugehörigkeit
Teil 2: Schriftliche Ausarbeitung Hinweise zur Gestaltung von Seminararbeiten und anderen wissenschaftlichen Aufsätzen Elemente einer schriftlichen Arbeit Titel Autoren und ihre organisatorische Zugehörigkeit
Verfassen von Hausarbeiten. Allgemeine Hinweise Erscheinungsbild Formale Kriterien. [Soziologie Augsburg] Sasa Bosancic, M.A.
![Verfassen von Hausarbeiten. Allgemeine Hinweise Erscheinungsbild Formale Kriterien. [Soziologie Augsburg] Sasa Bosancic, M.A. Verfassen von Hausarbeiten. Allgemeine Hinweise Erscheinungsbild Formale Kriterien. [Soziologie Augsburg] Sasa Bosancic, M.A.](/thumbs/50/25924352.jpg) Verfassen von Hausarbeiten Allgemeine Hinweise Erscheinungsbild Formale Kriterien Verfassen von Hausarbeiten 1 Allgemeines Bei Proseminararbeiten geht es nicht um das Erlernen einer Kunst sondern eines
Verfassen von Hausarbeiten Allgemeine Hinweise Erscheinungsbild Formale Kriterien Verfassen von Hausarbeiten 1 Allgemeines Bei Proseminararbeiten geht es nicht um das Erlernen einer Kunst sondern eines
