Solare Energieversorgung im alpinen Raum Reka-Feriendorf Blatten-Belalp
|
|
|
- Benjamin Böhmer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Sektion Cleantech Schlussbericht vom Solare Energieversorgung im alpinen Raum Reka-Feriendorf Blatten-Belalp Reka, 2014
2 Datum: 29. Dezember 2016 Ort: Bern Subventionsgeberin: Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch das Bundesamt für Energie BFE Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprogramm CH-3003 Bern Subventionsempfänger: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft Neuengasse Bern ELIMES AG Winkelgasse 2 CH-3900 Brig Lauber IWISA AG Kehrstrasse 14 CH-3904 Naters Hochschule Luzern Zentrum für Integrale Gebäudetechnik Technikumstrasse 21 CH-6048 Horw Autoren: Prof. Matthias Sulzer, Hochschule Luzern, matthias.sulzer@hslu.ch Simon Summermatter, ELIMES AG, simon.summermatter@elimes.ch BFE-Programmleitung: BFE-Projektbegleitung: BFE-Vertragsnummer: Yasmine Calisesi, yasmine.calisesi@bfe.admin.ch Marc Köhli, koehli@enerconom.ch SI/ Für den Inhalt und die Schlussfolgerungen sind ausschliesslich die Autoren dieses Berichts verantwortlich. Bundesamt für Energie BFE Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen; Postadresse: CH-3003 Bern Tel Fax contact@bfe.admin.ch 2/25
3 Zusammenfassung Das BFE-Leuchtturmprojekt Reka-Feriendorf Blatten-Belalp umfasst 9 Gebäude mit 50 Wohnungen, Gemeinschaftsanlagen und einem Hallenbad. Kernelemente des Energiekonzeptes sind die hybriden Sonnenkollektoren, der saisonale Erdwärmespeicher und die Abwasserwärmerückgewinnung. Das umfassende Monitoring über die Jahre 2015/2016 erlaubt eine detaillierte Erfolgskontrolle mit Fokus auf die Energiebilanzierung sowie Analysen der Hauptkomponenten. Insgesamt kann das Energiesystem als erfolgreich umgesetzt betrachtet werden. Die Eigenenergieversorgung erreicht 2016 einen Grad von 83% und übertrifft den Planungswert von 75% deutlich. Der elektrische sowie der thermische Solarertrag entsprechen nicht den Erwartungen. Der elektrische Minderertrag betrug 2016 rund 8%, der thermische 12%. Der Erdspeicher wurde trotzdem zu 98% solar regeneriert, die restliche Energie floss aus der Erdumgebung zu. Das Monitoring zeigte entgegen den Erwartungen auf, dass Diskrepanzen zwischen den projektierten und den gemessenen Werten insbesondere bei den Senken und weniger bei den Quellen vorliegen. Der Warmwasserverbrauch beträgt lediglich 39% - also rund 1.8 kwh/logiernacht. Die Beheizung des Schwimmbades hingegen benötigt 167% des geplanten Energiebedarfs. Die Betriebsoptimierung wirkte sich entsprechend auf die Senken positiv aus: So konnte beispielsweise der Heizenergieverbrauch im Vergleich zu den projektierten Werten um 18% gesenkt werden. Der spezifische Heizenergieverbrauch beträgt zwischen 29.0 kwh/m 2 EBF und 36.4 kwh/m 2 EBF. Das ganzheitliche Projekt zeigt auf, wie energieeffiziente Gebäude - welche thermisch und elektrisch vernetzt sind - ohne Emissionen und ausschliesslich mit erneuerbarer Energie betrieben werden können. 3/25
4 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Ausgangslage Ziel Vorgehen Grundlagen Rahmenbedingungen Anlagenbeschrieb Methodik Ergebnisse und Erkenntnisse Quellen Energieaufbereitung Senken Energiebilanz Schlussfolgerung Würdigung Handlungsempfehlung Fazit Wissenstransfer Referenzen /25
5 1 Einleitung 1.1 Ausgangslage Das Reka-Feriendorf Blatten-Belalp ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinde Naters ( Energiestadt, European Energy Award) und der Genossenschaft Schweizer Reisekasse Reka. Die Ferienanlage befindet sich am Rande des UNESCO-Weltnaturerbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Als erste Ferienanlage im alpinen Raum versorgt sich das Reka-Feriendorf Blatten-Belalp CO2-neutral mit selbst produzierter Solarenergie, ergänzt durch Labelstrom Wasserkraft. Die insgesamt 50 Wohnungen generieren über 50'000 Logiernächte und garantieren energetisch nachhaltige Ferien ohne Komforteinbusse. Das Reka-Feriendorf Blatten-Belalp wurde im Dezember 2014 eröffnet. Bereits in der ersten Wintersaison 2014/15 erreichte die Ferienanlage einen Grossteil der gesteckten Ziele. Die verfügbaren Ferienwohnungen waren zu 78% belegt. Das Energetische in vier Sätzen: a) ganzheitliches, solares Energieversorgungskonzept: ohne CO2-Emissionen und mit hoher Effizienz durch niedrigen Primär-Energieeinsatz b) Effizienzsteigerung dank Energiespeicherung: Die saisonale Energiespeicherung mittels Erdreich ermöglicht einen effizienten Betrieb der Wärmepumpen c) auf dem neusten Stand der Technik: vom Geschirrspüler bis hin zur Solaranlage wurden die neusten Errungenschaften eingesetzt. Frischwasserstation, hybride Solaranlage und LED-Beleuchtung sind ein Auszug davon d) Energie kennenlernen: Das solarbetriebene Reka-Feriendorf sensibilisiert sein Publikum von Jung bis Alt mit Energie-Spieltürmen, einem Energierundgang und Informationstafeln bezüglich Umgang mit Energie Das Projekt zeigt auf, wie energieeffiziente Gebäude - welche thermisch und elektrisch vernetzt sind - ohne Emissionen (Zero Emission) und weitestgehend mit Solarenergie betrieben werden können. Die Erfahrungen im Projekt erlauben, die Planungs- und Betriebssicherheit ähnlicher Energiesysteme zu erhöhen. Im Fokus der Analyse stehen der systemische Ansatz mit Hybridkollektoren, einem Erdwärmespeicher, der Abwasserwärmerückgewinnung und Wärmepumpen sowie der wirtschaftliche Betrieb eines solchen Konzeptes. 1.2 Ziel Im Rahmen des BFE-Leuchtturmprojektes wurden zwecks Monitorings rund 400 Datenpunkte erfasst und ausgewertet. Die Erkenntnisse wurden einerseits zur ganzheitlichen Optimierung der Anlage genutzt, andererseits sollen diese dem Wissenstransfer für ähnliche Energiekonzepte dienen. Der Bericht dokumentiert des Weiteren Handlungen und Massnahmen im Rahmen der Projektkommunikation. 5/25
6 1.3 Vorgehen Das Monitoring erstreckte sich über rund zweieinhalb Jahre. Folgendes sind die Meilensteine: A) Datenerfassung B) Einleitung erster Optimierungsansätze C) Erfolgskontrolle und Auswertung der Energiebilanz D) Detailanalyse der Komponenten E) Sensitivitätsanalyse der Betriebsparameter F) Ganzheitliche Optimierung des Energiekonzeptes G) Benchmarking Gebäudehülle und Technik 1 Im vorliegenden Bericht werden die Auswertungen und Detailanalysen der Komponenten festgehalten. Die oben genannten Punkte C) und D) wurden dabei jährlich wiederholt. Die folgende Übersicht zeigt die Terminierung des gesamten Projektes. Aktivitäten Anfang Ende Meilenstein Zuständige/r Projektpartner/in Vorstudie Jan 12 März 12 Vorprojekt ELIMES Planung April 12 Dez 13 Projekt, Ausschreibung, Vergabe Lauber IWISA Bau / Durchführung März 14 Dez 14 Ausführung Gebäudetechnik Lauber IWISA 1. Jahresbericht Dez 14 ELIMES, HSLU Messperiode(n) 1 Dez 14 Nov 15 Monitoring Lauber IWISA Erfolgskontrolle 1 Nov 15 Dez 15 Auswertung Monitoring Daten ELIMES, HSLU 2. Jahresbericht Dez 15 ELIMES, HSLU Messperiode(n) 2 Dez 15 Nov 16 Monitoring Lauber IWISA Erfolgskontrolle 2 Nov 16 Dez 16 Auswertung Monitoring Daten ELIMES, HSLU Kommunikation Jan 15 Dez 16 Kommunikation ELIMES, HSLU Benchmarking* Nov 16 März 16 Gebäudehülle und Technik ELIMES, HSLU Schlussbericht Dez 16 ELIMES, HSLU Tabelle 1:Terminplan der Aktivitäten rund um das Pilot- und Demonstrationsprojekt. 1 Das vorgesehene Benchmarking zwischen Gebäudehülle und Gebäudetechnik erwies sich als umfangreicher als angenommen. Die Grundlagen für das Reka-Feriendorf Blatten-Belalp wurden zusammengetragen und erste Berechnungsmodelle erstellt. Um aussagekräftige Resultate machen zu können, werden weitere Gebäude in die Betrachtung miteinbezogen. Die Auswertung wird im Rahmen des BFE-Projektes Oscar im kommenden Jahr 2017 präsentiert. 6/25
7 2 Grundlagen 2.1 Rahmenbedingungen Das Monitoring umfasst sämtliche energietechnische Komponenten im System - sowohl Wärme wie auch Elektrizität. Die elektrische und thermische Energiegewinnung, wie auch der Wärmebedarf wurden vollumfänglich aufgezeichnet. Der detaillierte Strombedarf hingegen steht nur zur Verfügung über vereinzelte grosse Komponenten wie Wärmepumpen, der Erdsonden-Umwälzpumpe und über die allgemeinen Zähler. Die Auswertungen der nicht erfassten einzelnen elektrischen Verbraucher wurden anhand der allgemeinen Zähler nach den Standardwerten gemäss SIA 2024 aufgeteilt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Ungenauigkeit in der Messwerterfassung oder kurzzeitiger Ausfall der Datenerfassung zu Abweichungen der Energiebilanz führen kann. Die Verifizierung des Messfehlers beläuft sich insgesamt auf unter 10%, weshalb von einer hohen Genauigkeit ausgegangen werden kann. Kritische Messwerte liegen insbesondere in den Energieströmen mit tiefen Temperaturdifferenzen vor sie werden explizit erwähnt. 2.2 Anlagenbeschrieb Die hybride Photovoltaik-Solarthermiekollektoren (PVT) generieren zugleich elektrische und thermische Energie. Die thermische Energie kann direkt genutzt oder dem saisonalen Geothermiespeicher zur Regeneration zugeführt werden. Mit der elektrischen Energie werden die Wärmepumpen betrieben, welche die Quellenergie aus dem Erdwärmespeicher oder aus den PVT auf die gewünschten Temperaturniveaus für Gebäudeheizung und Warmwasser bereitstellen. Die Nutzenergie wird auf zwei Temperaturniveaus bereitgestellt: 35 C für Gebäudeheizung sowie C für die Warmwasseraufbereitung. Eine umfangreiche Anlagenbeschreibung mit Auslegungsdaten kann der Dokumentation [2] entnommen werden. Energetische Senken (Heizwärmebedarf und Warmwasserbedarf) wurden minimal gehalten, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen. Die Gebäudehülle erreicht die Primäranforderung nach Minergie- A und die Wärme aus dem Abwasser wird mittels einer Abwasserwärmerückgewinnungsanlage rekuperiert. Auf eine kontrollierte Lüftungsanlage in den Wohnungen wurde bewusst verzichtet. Die Betriebserfahrungen der Reka zeigen, dass die Wohnungen tagsüber wenig genutzt werden, jedoch während der Nutzungszeiten eine sehr hohe Belegung aufweisen. Um den Komfortansprüchen gerecht zu werden, müsste die Lüftungsanlage auf diese wenigen Spitzenzeiten ausgelegt werden. Aus wirtschaftlichen Überlegungen wurde entschieden, die Abwärme aus der Raumlüftung durch andere technischen Komponenten anstelle einer Wärmerückgewinnungsanlage zu kompensieren. Das Feriendorf erreicht eine planerische Energiekennzahl nach Minergie-A von 24 kwh/m 2 (nur Wohnungen, MFH) bzw. 19 kwh/m 2 (andere Nutzungen). 2.3 Methodik Die Erfolgskontrolle wird unterteilt in die Stufen Quellen/Speicherung, Energieaufbereitung (Umwandlung) und Senken. In den jeweiligen Kategorien werden bereits getroffene Massnahmen und deren Wirkung dargelegt. Anschliessend wird die generelle Energiebilanz über die ersten beiden Betriebsjahre beschrieben. Die Resultate werden mit den projektierten und prognostizierten Daten verglichen. Die Diskussion gibt abrundend Aufschluss über den Erfolg des Projektes. 7/25
8 Solare Energieversorgung im alpinen Raum Reka Feriendorf Blatten-Belalp 3 Ergebnisse und Erkenntnisse Die folgende Struktur gilt in Anlehnung an den Bericht Projektierung Energieversorgung Reka-Feriendorf Blatten, 2013 [2] und ist eine Ergänzung und Zusammenfassung der Jahresberichte [6] und [7]. Dabei beinhaltet das Kapitel Quellen die relevanten Energie-Inputs wie elektrische und thermische Solarenergie, deren Speicherung durch den Erdwärmespeicher, die Abwasserwärmerückgewinnung sowie externe elektrische Energie. Das Kapitel Energieaufbereitung behandelt die Wärmepumpen und die Themen Energiebezüger und Verluste. 3.1 Quellen Thermische Solarenergie Grundlagen: Im Reka-Feriendorf Blatten-Belalp wurden zwei verschiedene Solarmodul-Typen eingesetzt. Einerseits das Hybrid I (MeyerBurger, 3S HYBRID 240/900 SKY, sowie das Folgemodell Hybrid II (MeyerBurger, 3S HYBRID 260/900 SKY). Eine Übersicht der eingesetzten Module auf den jeweiligen Dächern ist in der untenstehenden Tabelle 2 dargestellt, die Vogelperspektive kann in Abbildung 1 betrachtet werden. Dach Typ A1 A3 C1 C2 Orientierung Anzahl Fläche Module m2 Hybrid II Ost Hybrid II West Hybrid I Ost Hybrid I West Hybrid I West Hybrid I Ost Hybrid II West Hybrid II Ost Total PVT Tabelle 2: Übersicht der eingesetzten PVT Solarmodule und deren Positionierung C2 Empfangshaus A3 C1 Gemeinschaftshaus A1 B1 A2 Abbildung 1: Übersicht Solardächer [Lauber IWISA AG, 2014]. 8/25 B2
9 Analyse: Zur Beurteilung des thermischen Ertrages der PVT-Module wird die thermische Leistung in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur, der Modultemperatur und der Aussentemperatur über die Messperiode betrachtet. Die folgende Abbildung 2 zeigt die Messergebnisse des ersten Betriebsjahres 2015 von April bis Dezember. Wie zu erwarten, nimmt bei höheren Aussentemperaturen die durchschnittliche Leistung zu. Je nach Abnahmetemperatur (das heisst Erdreichtemperatur) konnte bereits ab einer Aussentemperatur von rund 5 C solare Energie genutzt werden. Dabei wurde C Vorlauftemperatur erreicht. Die Leistung war jedoch äusserst gering: Sie lag unter 30 kw. Ab Aussentemperaturen von > 10 C konnte kurzzeitig bis zu 200 kw erzielt werden. In Spitzentagen wurde eine thermische Leistung von 450 kw erzielt, was einem spezifischen Ertrag von 670 W/m 2 entspricht. Im Schnitt liegen dabei die Vorlauftemperaturen zwischen 20 C und 35 C und die Temperaturdifferenz von Vorlauf zu Rücklauf zwischen K. thermische Leistung [kw] Leistung [kw] Aussentemp [ C] Summenhäufigkeit von April 2015 bis Dezember Aussentemperatur [ C] Abbildung 2: Thermische Leistung der Solaranlage in Abhängigkeit der Aussentemperatur Im Sommer läuft die Solaranlage bei Aussentemperaturen >20 C ebenfalls nachts und nutzt so die Umgebungswärme als Quelle. Dies ist vorwiegend abhängig von der Temperatur der Abnehmer (Erdwärmespeicher, Wärmepumpen). In der Abbildung 3 ist das Jahr 2016 dargestellt. Trotz Anpassung der Einschaltbedingungen sind keine wesentlichen Veränderungen ersichtlich thermische Leistung [kw] Leistung [kw] Aussentemp. [ C] Aussentemperatur [ C] 0 Summenhäufigkeit Dezember 2015 bis Dezember Abbildung 3: Thermische Leistung der Solaranlage in Abhängigkeit der Aussentemperatur /25
10 Die Leistungsspitzen konnten mit der tiefer liegenden Einschaltbedingung (statt 30 C bereits 20 C) vorteilhaft reduziert werden. Weiter kann bei hohen Aussentemperaturen vermehrt auch geringere Leistung verzeichnet werden, was darauf schliessen lässt, dass die Nutzung der Umgebungswärme in der Nacht ebenfalls gesteigert werden konnte. Die durchschnittliche Vorlauf- und Rücklauftemperatur wurde mit der Änderung um rund 5 bis 10 K gesenkt. Die Auswertung sämtlicher Kollektortemperaturen zeigt, dass sich alle Dächer in etwa gleich verhalten. Repräsentativ wird in Abbildung 4 die Kollektortemperatur Ost des Gebäudes C2 dargestellt. Zwischen den Ausrichtungen Ost und West werden, abgesehen vom zeitlichen Verlauf, keine relevanten Differenzen festgestellt. Zu beachten ist, dass die Kollektortemperatur durch Strahlung nachts tiefere Werte erreichen kann als die Umgebungstemperatur. Die Kollektortemperatur erreichte 2015 Spitzen von 65 C. Im Vergleich zum Folgejahr 2016 wird auch hier ersichtlich (siehe Abbildung 5), dass mehr Energie abgeführt werden konnte und entsprechend die Kollektortemperaturen tiefer liegen. Zwar wurden ebenfalls Spitzen von bis zu 65 C erreicht, jedoch nur während kurzen Zeitabschnitten eine Temperatur über 50 C überschritten. Temperatur [ C] Kollektortemperatur C2 Ost Aussentemperatur Summenhäufigkeit von April 2015 bis Dezember 2016 Abbildung 4: Kollektortemperatur der Solaranlage C2 Ost in Abhängigkeit der Aussentemperatur Temperatur [ C] Kollektortemperatur C2 Ost Aussentemp. [ C] Summenhäufigkeit von Dezember 2015 bis Dezember 2016 Abbildung 5: Kollektortemperatur der Solaranlage C2 Ost in Abhängigkeit der Aussentemperatur Interessant ist der lineare Anstieg der Kollektortemperatur ab Aussentemperaturen von 8 C bis rund 16 C, was den Übergangszeiten eintritt. In dieser Phase läuft die Solaranlage äusserst stabil. 10/25
11 Zur qualitativen Beurteilung der thermischen Solaranlage wurden 2015 Thermografie-Aufnahmen mittels einer Drohne erstellt. Im Generellen liegt eine intakte, gut durchflossene Solaranlage vor. Zwischen 100% Öffnen des Ventiles und der erkennbaren Temperatursenkung auf den Modulen vergehen je nach Wetterbedingungen rund 5 min. Die Abbildung 6 wurde in der Startphase aufgenommen, was erklärt, wieso die Module im linken Bereich bereits kühler sind als jene rechts. Abbildung 6: Thermografie in der Startphase Dach C1. Durchschnittliche Temperatur im Modulbereich: 21 C, (1): 13 C, (2): 35 C. Es wurde festgestellt, dass die Module unterschiedlich durchflossen werden. Die folgenden Module links (vgl. Abbildung 7) werden durch die aussenliegende Rohrleitung gespiesen, der Rücklauf erfolgt durch den innenliegenden Anschluss. Die Umgekehrte Situation ist in den rechten Modulen ersichtlich. Dies führt zu einer generellen Temperaturdifferenz des Modules von rund 2 K. Rücklauf Vorlauf Vorlauf Rücklauf Abbildung 7: Unterschiedliche Flussrichtungen im PVT-Modul. Durchschnittliche Temperatur im Bereich 1: 13 C, durchschnittliche Temperatur im Bereich 2:11 C, (1): 8 C, (2): 14 C, (3): 13 C, (4): 7 C. Es wird nicht davon ausgegangen, dass dieser Sachverhalt eine grosse Relevanz auf den Solarertrag mit sich bringt; der Hersteller gibt keine Empfehlung betreffend Flussrichtung an. Trotzdem wird empfohlen, den Vorlauf auf das innenliegende Rohr anzuschliessen. 11/25
12 Des Weiteren wurden drei wenig durchflossene Zonen festgehalten. Die Abbildung 8 zeigt drei Module in Reihe auf dem Dach A3 West, die trotz Tichelmann-System in Abhängigkeit stehen: Sie sind am gleichen Hauptstrang eingebunden. Vereinzelte Module auf dem Dach A3 West sowie ein Modul auf dem Dach C1 Ost werden lediglich minimal durchflossen siehe auch Abbildung 9. Abbildung 8: minimal durchflossene Zone in der zweiten Modulreihe des Daches A3 West. Abbildung 9: links: Haus C1 Ost, vereinzeltes Modul, das wenig durchflossen wird rechts: Haus A3 West, unterschiedlich stark durchflossene Module. Validierung und Zwischenfazit: Insgesamt lag der thermische Solarertrag im Jahr 2015 mit 325 kwh/m 2 bedeutend tiefer als der projektierte Wert von 450 kwh/m 2. Allerdings waren die Einschaltbedingungen der Solaranlage mit 30 C relativ hoch und träge gesetzt. So dauerte die Einfahrphase bis zum vollen Betrieb (Ventil 100% geöffnet) im Schnitt eine Stunde. Dieser Sachverhalt ist auch in den hohen Modul-Temperaturen von bis zu 65 C ersichtlich. Diesbezüglich wurden im August 2015 Optimierungen eingeleitet - die Einschaltbedingung wurde auf 20 C gestellt. Des Weiteren wurde das Solarsystem mit einem Spülvorgang pro Dach erneut entlüftet. Ziel war es, durch diese Massnahmen den spezifischen thermischen Solarertrag im Jahr 2016 bis zu 25% zu steigern. Trotz minim geringerer Globalstrahlung von rund 6% am Standort Blatten b. Naters wurde ein Ertrag von 400 kwh/ m 2 erreicht und somit wurden die Erwartungen praktisch erfüllt. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Einschaltbedingung weiter gesenkt werden kann, um so den projektierten Wert von 450 kwh/m 2 zu erreichen. Insbesondere in den Einfahrphasen könnten durch schnellere Reaktionszeiten die Modultemperaturen noch tiefer gehalten werden. Die ursprünglich vorgesehene Testphase, den Schnee durch kurzzeitiges Erwärmen der hybriden Module abrutschen zu lassen, konnte nicht durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen musste davon abgesehen werden. 12/25
13 Elektrische Solarenergie Grundlagen: Neben den Hybridmodulen gemäss vorherigen Angaben sind zusätzlich drei Dächer mit konventionellen Photovoltaikmodulen ausgestattet. Dabei wurde der Modultyp MeyerBurger, MEGAS- LATE II STANDARD 165 WP gewählt. Analyse: Die Solarmodule waren 2015 und auch 2016 während rund dreieinhalb Monaten (zwischen Dezember bis April) schneebedeckt und konnten während dieser Zeit entsprechend keine Energie generieren. Wie in der nachfolgenden Tabelle 3 rot und orange dargestellt, lag 2015 die Effizienz von 4 Teildächern mit kwh/kwp unter dem Ertrag der anderen Dächer. Sämtliche weiteren Erträge entsprechen den prognostizierten Werten von rund 800 kwh/kwp. A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 Typ Orientierung Anzahl Module Fläche El. Ertrag spez. El. Ertrag spez. El. Ertrag m 2 MWh/a kwh/m 2 kwh/kwp Hybrid II Ost Hybrid II West PV Ost PV West Hybrid I Ost Hybrid I West PV Ost PV West PV Ost PV West Hybrid I Ost Hybrid I West Hybrid II Ost Hybrid II West Total/Mittelwert PV Total/Mittelwert PVT Total/Mittelwert Tabelle 3: Elektrischer Solarertrag pro Dachfläche der Photovoltaik- und Hybridmodule Der Unterschied im Ertrag zwischen hybriden Solarmodulen und Photovoltaik ist marginal. Die durchschnittliche Differenz beträgt lediglich 16 kwh/kwp, wobei zu beachten ist, dass mit dem Solardach B1 West der Photovoltaik-Schnitt deutlich negativ beeinträchtigt wird. 2 Ohne Berücksichtigung dieses Daches liegt der Ertrag der Photovoltaik-Dächer bei rund 850 kwh/kwp. 2 Die Ursache für den schlechten Ertrag auf dem Dach B1 West konnte im Jahr 2016 trotz visueller Prüfung der Module und Messungen der Stränge nicht eruiert werden. Entsprechend musste im Folgejahr auf diesem Dach erneut ein schlechter Ertrag von lediglich 465 kwh/kwp verzeichnet werden. 13/25
14 Die Auswertung der Stromanlage im Jahr 2016 ist in der Tabelle 4 ersichtlich. Waren es im 2015 die Dächer A3 und C1 mit weniger Ertrag, zeigt die Bilanz im 2016 für diese Dächer einen durchschnittlichen Ertrag, jedoch Einbussen bei den Dächern A2 und C1. A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 Typ Orientierung Anzahl Module Fläche El. Ertrag spez. El. Ertrag spez. El. Ertrag m 2 MWh/a kwh/m 2 kwh/kwp Hybrid II Ost Hybrid II West PV Ost PV West Hybrid I Ost Hybrid I West PV Ost PV West PV Ost PV West Hybrid I Ost Hybrid I West Hybrid II Ost Hybrid II West Total/Mittelwert PV Total/Mittelwert PVT Total/Mittelwert Tabelle 4: Elektrischer Solarertrag pro Dachfläche der Photovoltaik- und Hybridmodule Die Funktion des einzelnen Moduls konnte mittels Thermografie beurteilt werden. Dabei werden defekte Zellen rasch erkennbar, da sie elektrische Energie verlieren und damit die Zelle erhitzen siehe Abbildung 10. Zellendefekte wurden auf den Dächern A1, A2 und A3 festgestellt. Abbildung 10: Defekte Solarzellen werden durch Thermografie erkennbar. Oben links: Dach A1, Ost; oben rechts: Dach A2 Ost; unten links: Dach A3 West, unten rechts: A3 Ost. 14/25
15 Validierung und Zwischenfazit: Trotz diversen Ertragsminderungen liegt die Stromproduktion mit rund 141 MWh/a (2015) und 144 MWh/a (2016) vor dem Wechselrichter nah an den geplanten 150 MWh/a. Die jährlich unterschiedlichen Erträge pro Dach lassen darauf schliessen, dass die Module unterschiedlicher Strahlung - beeinflusst durch die Meteorologie - ausgesetzt sind, jedoch intakt laufen. Die Effizienzsteigerung um 10% konnte 2016 allerdings nicht erreicht werden, was insbesondere am tiefen Solarertrag des Daches B1 West liegt. Um die Ursache definitiv ausfindig machen und beheben zu können, müssen die Solarmodule angehoben und deren elektrische Verbindungen geprüft werden. Im Verhältnis liegen die Erträge der Hybridmodule im Jahr 2015 wider Erwarten unter jenen der Photovoltaik. Hingegen wurde unter anderem mit den tieferen Kollektortemperaturen aufgrund der thermisch tieferen Einschaltbedingung mit bereits 20 C statt 30 C - der spezifische elektrische Ertrag um rund 45 kwh/kwp angehoben. Eine fundierte Aussage bezüglich der Auswirkung von gekühlten Solarzellen kann nicht gemacht werden, da unterschiedliche Solarmodule (Typen) im Einsatz sind und zudem leicht variierende Dachneigungen vorliegen. Trotzdem ist der Einsatz hybrider Solarmodule im Vergleich zu thermischen Solarkollektoren in Kombination mit Photovoltaik interessant, weil hybride Solaranlagen weniger Flächen benötigen. Erdwärmespeicher Grundlagen: Insgesamt dienen 31 Erdsonden in rund 150 m Tiefe (Total m) und einem Abstand von ca. 5 m als saisonaler Erdspeicher. Dem Erdreich wurde im Herbst 2014 erstmals Energie entzogen eine vorgängige Temperaturanhebung (Ladung) wurde nicht vorgenommen. Aufgrund fehlender Archivdaten der Energiezähler im Wasser-Glykol-Kreislauf wird der Zeitraum von 01. März bis 01. Dezember 2015 und anschliessend 01. Dezember 2015 bis 01. Dezember 2016 ausgewertet. Die Energiezähler in diesem Bereich sind durch Rundung auf ganze Zahlen mit einem grösseren Messfehler behaftet. Analyse: Mit dem Erdwärmespeicher wurde im Dezember 2014 eine Vorlauf-Temperatur von C erreicht. Die Vorlauftemperatur im Erdwärmespeicher lag im Dezember 2015 zwischen 7 C und 9 C. Daraus kann geschlossen werden, dass das Erdreich in den Sommermonaten 2015 nahezu vollständig regeneriert wurde. Wie die folgende Abbildung 11 zeigt, sind während der Regeneration hohe Leistungsspitzen durch die Solaranlage erkennbar. Die Dimensionierung des Erdspeichers ist dementsprechend auf die Regeneration abzustimmen. Bei der Entzugsleistung sind gut die Stufen der drei Wärmepumpen sichtbar. Energie [kwh/h] Entzugsenergie Regeneration EWS Vorlauftemperatur Jahresverlauf ( bis ) Erdsonden Vorlauftemperatur [ C] Abbildung 11: Energiebezug und Regeneration des Erdreichs, sowie der Verlauf der Erdsonden Vorlauftemperatur während bis /25
16 Die Entzugsleistung beträgt bei einer Wärmepumpe rund 15 W/m, bei zwei Wärmepumpen 30 W/m und bei drei zirka 45 W/m. Bezieht in Ausnahmesituationen ebenfalls die vierte Wärmepumpe (grundsätzlich mit der Abwasserwärmerückgewinnung gekoppelt), werden bis zu 55 W/m erreicht. Es wurden Spitzen von bis zu 80 W/m beobachtet, wobei hier von Messfehlern im Zusammenhang mit der Regeneration ausgegangen wird. In obiger Grafik sind diese Ausreisser ab Energieströmen von über 200 kwh/h ersichtlich. Die Regenerationsleistung hingegen liegt durchschnittlich bei 60 W/m und kann bei Erdreich-Rücklauftemperaturen von 23 C bis zu 140 W/m erreichen. Derselbe Sachverhalt konnte im Folgejahr 2016 beobachtet werden (Abbildung 12). Tendenziell liegt die Erdsonden-Vorlauftemperatur Ende 2016 etwas tiefer bei 6..7 C. Der Mittelwert über das Jahr 2015 sowie 2016 mit jeweils 9 C zeigt, sodass sich die Erdreichtemperatur nicht verändert hat. Energie [kwh/h] Entzugsenergie Regeneration EWS Vorlauftemperatur Jahresverlauf ( bis ) Erdsonden Vorlauftemperatur [ C] Abbildung 12: Energiebezug und Regeneration des Erdreichs, sowie der Verlauf der Erdsonden Vorlauftemperatur während bis Im September 2016 wurde die Regulierung der Erdsonden-Pumpe von konstanter Drehzahl auf eine Temperaturdifferenz von 4 K in Betrieb eingestellt. Der Strombedarf konnte damit um bis zu 65% - von rund kwh auf 825 kwh pro Monat - gesenkt werden. Die Regulierung über eine Temperaturdifferenz hat allerdings aufgezeigt, dass die Strömung in den laminaren Bereich fallen kann und folglich die Wärmeübertragung vom Erdreich an das Sondenfluid nicht mehr gewährleistet wird. Entsprechend musste übergeordnet ein minimaler Durchfluss definiert werden. Validierung und Zwischenfazit: Die Energiebilanz im Jahr 2015 zeigte, dass von den bezogenen 345 MWh nur in etwa 250 MWh (72%) mit Solarenergie regeneriert wurden. Trotzdem konnte die Ausgangstemperatur wiederum erreicht und das Erdreich entsprechend regeneriert werden. Die durchschnittliche Vorlauftemperatur lag bei 9 C. Somit floss aus dem Erdinneren Energie nach. Ziel war es, diese Diskrepanz durch die Betriebsoptimierung für 2016 zu reduzieren und eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen. Im Jahr 2016 wurden rund 268 MWh Solarenergie zur Regenerierung gewonnen, was im Vergleich zu 2015 lediglich 9% mehr ist. Allerdings wurde wesentlich weniger Energie aus dem Erdreich benötigt: 273 MWh. Somit konnte der Erdwärmespeicher im 2016 zu 98% regeneriert werden. Die durchschnittliche Erdreichtemperatur hat sich 2016 nicht verändert - sie blieb bei 9 C. 16/25
17 Abwasserwärmerückgewinnung Grundlagen: Durch die Einbindung der Abwasserwärmerückgewinnung, hauptsächlich zur Bereitstellung des höheren Temperaturniveaus, aber auch als Reserve für die drei Niedertemperatur-Wärmepumpen ist eine Zuordnung der Energieflüsse schwierig nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass die Energiezähler mit den vorherrschenden geringen Temperaturdifferenzen eine grosse Messungenauigkeit aufweisen. Die Abwasserwärmerückgewinnung wird daher aus den Resultaten im Kapitel 3.4 Energiebilanz beurteilt. Analyse: Die Menge der zurückgewonnen Energie ist abhängig vom Schwimmbad und Warmwasserbedarf, wobei Letzterer in Abhängigkeit der Wohnungsbelegung stark variieren kann. Das Verhältnis zwischen Warmwasser- und Schwimmbadenergie zur Wärmerückgewinnung soll Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Systems geben. Projekt [kwh/a] [kwh/a] [kwh/a] Warmwasser und Schwimmbad 350' Wärmerückgewinnung 200' '000 Leistungsindex Tabelle 5: Auswertung der Abwasserwärmerückgewinnung. Validierung und Zwischenfazit: Die Abwasserwärmerückgewinnung erfüllt die Anforderungen, weist allerdings im Jahr 2016 einen tieferen Leistungsindex auf. Die Effizienz lässt sich durch eine separate Betriebsoptimierungen erhöhen. Wertvoll ist die Abwasserwärmerückgewinnung insbesondere durch die direkte Koppelung zwischen Quellenergie und Bedarf. Die Variabilität der Gäste und entsprechend der unterschiedliche Warmwasserbedarf kann so elegant ausgeglichen werden. 3.2 Energieaufbereitung Grundlagen: In der Technikzentrale sind drei Wärmepumpen (KWT Vitocal 300-G Pro spez.) für das untere Temperaturniveau von C, sowie eine Wärmepumpe (CMH2 267 spez.) für C installiert. Die Leistungszahlen gemäss Hersteller belaufen sich für die ersten drei Wärmepumpen mit B0/W35 auf 4.75; jene mit B0/W65 C auf 2.5. Analyse: Die Auswertung der Energieaufbereitung 2015 zeigt, dass die vierte Wärmepumpe die prognostizierte Jahresarbeitszahl von 2.5 trotz hohen Vorlauftemperaturen von durchschnittlich über 60 C übersteigt. Dies ist vorwiegend auf die höheren Quelltemperaturen seitens Abwasserwärmerückgewinnung zurückzuführen. Hingegen liegt die Jahresarbeitszahl der drei Niedertemperatur-Wärmepumpen unter den Erwartungen. Der Grund hierfür liegt einerseits in der höheren Vorlauftemperatur von bis zu 45 C und andererseits wird beobachtet, dass die quellseitige Regulierung eine Verdampfungstemperatur von rund 4 C nicht überschreitet. 17/25
18 JAZ COPc Gütegrad Betriebsstunden Einschaltungen ø Betriebsdauer Verd.1 Verd.2 Verd.1 Verd.2 Verd.1 Verd.2 [h] [h] [-] [-] min min WP1 1'909 1'909 1'517 1' WP % 2'040 2'040 1'794 1' WP3 2'008 2'008 2'043 2' WP % 4'655 4'655 6'824 6' Tabelle 6: Auswertung der Wärmepumpen: JAZ, Betriebsstunden und Einschaltungen Die hohen Vorlauftemperaturen wurden durch Senken (Verbraucher) mit ungenügend tiefen Rücklauftemperaturen erforderlich. Um im Allgemeinen die Rücklauftemperaturen der Abnehmer zu senken, wurden im November 2015 im Rahmen des Monitorings die Energiezähler bei den Abnehmern verifiziert und neu statt nur Energieimpulse auch Durchfluss und Temperaturen erfasst. Ende 2015 und Anfang 2016 wurden unter anderem erneut ein hydraulischer Abgleich der Systeme vorgenommen, die Heizkurven reduziert sowie die Warmwasserladungen mit Vorlauftemperaturen von maximal 55 C (statt 65 C) begrenzt. Insgesamt konnte so für 2016 die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen 1 bis 3 von 5.29 sowie jene der Wärmepumpe 4 auf 3.19 angehoben werden. Die weiteren Resultate sind in der Tabelle 7 ersichtlich. JAZ COPc Gütegrad Betriebsstunden Einschaltungen ø Betriebsdauer Verd.1 Verd.1 Verd.1 Verd.1 Verd.1 Verd.1 [h] [h] [-] [-] min min WP WP % WP WP % Tabelle 7: Auswertung der Wärmepumpen: JAZ, Betriebsstunden und Einschaltungen Validierung und Zwischenfazit: Grundsätzlich liegt ein stabiler Wärmepumpenbetrieb vor. Die Effizienz der Wärmepumpen konnte durch Reduktion der Vorlauftemperaturen, aber auch durch regulierungstechnische Optimierungen der Quelltemperaturen wesentlich erhöht werden. Die teils hohen Rücklauftemperaturen einzelner Senken (Verbraucher) sind Ursache fehlender Informationen/Detailplanung während der Projektierung. Insbesondere im Dreileiter-System ist in der Abstimmung der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen ein Schwerpunkt zu setzten. Wo es möglich war, wurde die Rücklauftemperatur regeltechnisch begrenzt. Die Machbarkeit wird jedoch stark durch die damalige Auslegung eingeschränkt. So ist es beispielsweise ohne hydraulische Anpassungen nicht möglich die Rücklauftemperatur der Lüftungsanalgen oder der Schwimmbäder zu senken. 18/25
19 3.3 Senken Grundlagen: Die Auswertung der Senken erfolgt mittels Energiemessungen auf den jeweiligen Heizgruppen. Dabei werden die Wohnbauten, das Warmwasser sowie das Schwimmbad separat betrachtet. Im Schwimmbad werden die Bäder, die Fussbodenheizung sowie die Lüftungsanlagen integriert. Analyse: Im ersten Betriebsjahr wurde für die Gebäudeheizung 26% mehr Energie benötigt als nach SIA 380/1 berechnet. Hingegen wurde zirka 55% weniger Warmwasser bezogen, was stark nach Gästeanzahl variiert. Das Schwimmbad liegt mit kwh/a für 2015 bzw MW^h/a im 2016 am deutlichsten über dem projektierten Wert von kwh/a. Im Folgejahr 2016 drastisch gesenkt werden konnten der Bedarf an Heizenergie (-44%, bzw. -18% zum projektierten Wert) und Warmwasser (-9%). Hingegen wurden mehr Verluste auf den Transportleitungen ausgewiesen es wird davon ausgegangen, dass der Wert von 2015 fehlerbehaftet ist. Sämtliche Resultate sind in der Tabelle 8 zusammengefasst. Projekt Abweichung 2016 Abweichung 2016 [kwh/a] [kwh/a] [kwh/a] [%] [%] Heizen 250' ' ' % 82% Warmwasser 250' '392 96'797 48% 39% Schwimmbad 100' ' ' % 167% Verluste 70'000 75'982 93' % 134% Total 670' ' ' % 84% Tabelle 8: Thermische Bezugsenergie für sämtliche Senken im Vergleich zu den projektierten Werten und der prozentualen Abweichung. Weiter wurden die Energiekennzahlen der jeweiligen Senken evaluiert siehe Tabelle 9. Der Warmwasserbedarf lag 2015 mit rund 2.4 kwh/person bereits unter der Auslegung von 4 kwh/logiernacht, entsprach jedoch der Normierung nach SIA. Er konnte durch Reduktion der Ladetemperatur von 65 C auf 55 C sowie den Warmwassersollwert 50 C statt 55 C im 2016 auf rund 1.8 kwh/logiernacht reduziert werden. Bei der Heizenergie wurde die Heizkurve 2016 generell um bis zu 5 K reduziert. Es fällt auf, dass die Gebäude B und C grundsätzlich mehr Energie benötigen, als die Gebäude A. Hingegen liegt der Wert des Gemeinschaftshauses unbegründet hoch dies trotz deutlich tieferer Heizkurve als bei den Wohngebäuden. Warmwasser 2015 Warmwasser 2016 Heizenergie 2015 Heizenergie 2016 [kwh/logiernacht] [kwh/logiernacht] [kwh/m 2 ] [kwh/m 2 ] A A A B B C C GH Tabelle 9: Energiekennzahlen von Warmwasser und Heizenergie nach Gebäude. 19/25
20 Validierung und Zwischenfazit: Die Energiekennzahlen lagen 2015 mit kwh/m 2 über dem Normwert nach SIA2024 von 40 kwh/m 2. Die Ursache kann an der Bauaustrocknung, der Gebäudehülle, übermässigem Lüften oder hohen Raumtemperaturen liegen. Durch die drastische Senkung der Heizkurve sowie das Ausbleiben der Bauaustrocknung im Jahr 2016 wurden die Minergie-Grenzwerte von 38 kwh/m 2 in sämtlichen Gebäuden unterboten. Erfahrungsgemäss beträgt die Bauaustrocknung bis zu 20% des normalen Heizbedarfs. Entsprechend liegt der Anteil der Bedarfsoptimierung für die Raumtemperaturen in diesem Falle bei rund 24%. Die Grenze liegt hierbei allerdings bei der Behaglichkeit der Gäste der Komfort muss gewährleistet sein. Zu berücksichtigen ist eine leichte Zunahme der Heizgradtage von 2015 zu 2016 um zirka 5% sowie eine erhöhte Belegung des Reka Feriendorfs von auf rund Logiernächte. Der hohe Bedarf im Schwimmbad kann auf die Wassertemperatur, allenfalls die Lüftungsanlage und die später hinzugefügten Wasserspiele zurückgeführt werden. Für letztere wurden im Dezember 2015 manuelle Aktivierungsschalter nachgerüstet, so dass diese nicht im Dauerbetrieb laufen. Die ungewollte Anhebung der Temperatur im Kinderbecken von 32 C auf 36 C im 2016 während rund 4 Monaten hatte während dieser Zeit eine Erhöhung des Energiebedarfs von rund 25% zur Folge. 3.4 Energiebilanz Grundlagen: Abschliessend zeigt die Energiebilanz des Feriendorfes die ganzheitliche Betrachtung der Energieflüsse. Die Energiebilanz wird vorwiegend über die Energiezähler der Senken und den Elektrizitätsbedarf erstellt. Aufgrund der grossen Messungenaugigkeit (± 30%) der Energiezähler im Wasser-/Glykolkreis können diese lediglich zur Bestimmung der Grössenordnung beigezogen werden. Das Problem ist physikalischer Natur: Die Standardabweichung der Messfehler bei den Temperaturfühlern wirkt sich bei geringer Temperaturdifferenz sehr stark aus. Analyse: Wurde im Jahr 2015 gesamthaft mit 793 MWh rund 77 MWh weniger Energie benötigt als prognostiziert (870 MWh), konnte der Energiebedarf 2016 erneut auf 677 MWh gesenkt werden. Auf der Produktionsseite wurden ausgenommen von dem thermisch solaren Ertrag die berechneten Erträge erzielt. Das solare Defizit wurde 2015 durch Nachströmung aus dem Erdreich ausgeglichen. Insgesamt wird weniger externe elektrische Energie benötigt als im Projekt prognostiziert. Die grafische Darstellung der Energiebilanz ist in der Abbildung 13 ersichtlich. jährliche Energie in MWh Verluste Schwimmbad Allgemein-, Haushaltsstrom Warmwasser Heizung Label Wasserstrom (extern) elektrische Solarenergie PV Wärmerückgewinnung FEKA Umweltenergie 0 Abbildung 13: Projekt Projekt Gesamtenergiebilanz des Reka-Feriendorfs Blatten-Belalp. 20/25
21 Validierung und Zwischenfazit: Die gesamte Energiebilanz fällt positiv aus, was die Detailanalysen bereits vermuten liessen. Die Senken weisen deutliche Unterschiede zu den Projektwerten auf: insbesondere jene für Warmwasser und Schwimmbad. Hingegen zeigt sich, dass sich die Quellen nahezu wie berechnet verhalten. Der Warmwasserbedarf kann je nach Belegung verdoppelt werden. Letzteres ist jedoch stark mit der Quellenergie der Abwasserwärmerückgewinnung gekoppelt, so dass dies nahezu keinen Einfluss auf den saisonalen Erdspeicher hat. Die Eigenenergieversorgung (EEV) des Reka-Feriendorfs Blatten-Belalp liegt im 2015 bereits bei 81%, 2016 leicht höher mit 83% und ist somit über dem erwarteten Wert von 75%. 21/25
22 4 Schlussfolgerung 4.1 Würdigung Die damaligen Projektziele wurden nach der Methode SMART wie folgt definiert: Spezifisch: Messbar: Akzeptiert: Realistisch: Terminiert: Eine langfristig nachhaltige und CO2 neutrale Energieversorgung erreichen. Die Leistungskennzahlen werden eingehalten oder schneiden besser ab. Der Gast spürt keinerlei Einschränkung bezüglich Komfort. Die gesteckten Ziele sind realistisch gesetzt. Das Feriendorf geht im Dez in Betrieb und wird bis Dez optimiert. Im ersten Betriebsjahr wurden die geforderten Leistungskennzahlen (Tabelle 10) abgesehen vom thermischen Solarertrag (welcher sich dann auf den Erdwärmespeicher auswirkte), sowie dem elektrischen Solarertrag erreicht. Daher lag der Fokus der weiteren Betriebsoptimierung für 2016 insbesondere bei A) der Ertragssteigerung der thermischen Solaranlage, bzw. der 100%-igen Regeneration des Erdwärmespeichers und B) der Optimierung der elektrischen Solaranlage. Wichtig für einen nachhaltigen Betrieb ist die Regeneration des Erdwärmespeichers, was durch die solare Ertragssteigerung und den gesenkten Energiebedarf vollumfänglich erreicht werden konnte. Die Optimierung der Photovoltaik-Anlage ist allerdings weiterhin zu verfolgen. Leistungskennzahlen Projektierung 2015 Ziel [-] [-] [-] [-] 1 Thermische Solarenergie > Elektrische Solarenergie > Saisonaler Erdwärmespeicher > Abwasserwärmerückgewinnung > Jahresarbeitszahl WP Niedertemperatur > Jahresarbeitszahl WP Hochtemperatur > > Totaler Energiebedarf < Eigenenergieversorgungsgrad > > Tabelle 10: Performance Indices des Energiekonzeptes. Insgesamt konnten die Projektziele erfolgreich umgesetzt werden. Insbesondere kann ein Eigenenergieversorgungsgrad von über 83% ausgewiesen werden. Sofern keine massiven Änderungen im Energiebedarf auftreten, kann das Energiesystem langfristig nachhaltig betrieben werden. 22/25
23 4.2 Handlungsempfehlung Ausstehend ist die weitere Prüfung des elektrischen Solardaches B1 West. Kann die Ursache des Minderertrags behoben werden, liegt der elektrische Ertrag bei den prognostizierten Werten. Um einen weiterhin nachhaltigen Betrieb des Reka-Feriendorfs gewährleisten zu können, wird eine jährliche Kontrolle empfohlen. Dabei kann mit der Analyse und Bilanzierung folgender Daten eine Aussage über die Funktion gemacht werden: A) Bilanzierung des thermischen Energiebedarfs (siehe Tabelle 8) B) Erstellung einer Gesamtenergiebilanz (siehe Abbildung 13) C) Ermittlung der durchschnittlichen Erdsonden-Vorlauftemperatur (Sollwert > 9 C) Weniger im Fokus des Monitorings/der Betriebsoptimierung war das aktive Energiemanagement zwischen Quellen und Senken. Insbesondere in der Nutzung des eigens produzierten Solarstroms liegt noch Potenzial. Mit dem laufenden Projekt Service on Demand 3 wird einerseits ein Energiemanagement angestrebt, aber andererseits auch eine automatische Auswertung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Energiesystems erzielt. 4.3 Fazit Die Begleitung des Projektes hat gezeigt, dass zwischen den projektierten Werten und den effektiv gemessenen Resultaten beachtliche Diskrepanzen liegen können. Interessanterweise liegen diese mehrheitlich auf der Seite der Senken (Performance Gap), obwohl für deren Auslegung umfangreiche Grundlagen zur Verfügung stehen. Die Optimierungsmassnahmen sind vorteilhafterweise bei den Senken und weniger bei den Quellen anzusetzen. Während kleine Massnahmen im Bereich der Senken bereits grossen Einfluss hatten, benötigt es bei den Quellen einen hohen Aufwand. Es zeigt sich, dass die Effizienz der Quellen - mit der damaligen Dimensionierung - einen Grenzwert aufweisen, welcher asymptotisch erreicht werden kann. Grenzen weisen aber auch die Senken auf. Sind beispielsweise Wärmetauscher oder Luftregister zu gering dimensioniert um eine gewünschte Temperaturdifferenz zu erhalten, kann nur beschränkt mit Regelungstechnik Einfluss genommen werden. Das ganzheitliche System kann als erfolgreich umgesetzt betrachtet werden, da die einzige unkontrollierbare, massiv beeinflussende Variable im Energiebedarf der Warmwasserbezug ist: Da das Warmwasser in direkter Relation zur Abwasserwärmerückgewinnung steht, besteht wenig Risiko von übermässigem Quellbezug aus dem saisonalen Erdspeicher. 3 Produktentwicklung aus dem BFE-Forschungsprojekt WarmUp der Misurio AG. 23/25
24 5 Wissenstransfer Dank der grosszügigen Unterstützung des Bundesamtes für Energie und der guten Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten lässt sich ein wertvoller Erfahrungsschatz gewinnen. Dieses Wissen wird über verschiedene Kanäle öffentlich zugänglich gemacht. Der Fokus liegt dabei in Fachberichten, Führungen und Präsentationen vor Fach- und Laienpublikum und Präsenz in Preisverleihungen und Fachtagungen. Nachfolgend werden die wichtigsten Massnahmen aufgelistet: Führungen: - Wöchentliche Führung durch den Gastgeber - Präsentation und Führung vor Ort nach Anfrage durch Lauber IWISA AG Auszug der Fachartikel: - T. Compagno: Sparkurs eine CO2-freie Ferienanlage, Coop-Zeitung, Sept Redaktion, Heizender Fels unter dem Ferienhaus, Tagesaneziger, Dez Jasmin N. Zweifel, Reka-Feriendorf Blatten-Belalp, Bau info, Jan Hans-Jörg Wigger, Solare Energieversorgung im alpinen Raum, ET, Jan Michael Staub, Von der Piste in die Sonnenstube, Haustech, März Benedikt Vogel, Von der Sonne doppelt verwöhnt, Baublatt, Apr Benedikt Vogel, Von der Sonne gleich doppelt verwöhnt, Spektrum Gebäudetechnik, April 15 - Benedikt Vogel, La double générosité du soleil, Swiss Engineering RTS, Jun Benedikt Vogel, Von der Sonne gleich doppelt verwöhnt, Erneuerbare Energien, Aug Damian Bumann, Reka-Feriendorf, MountainManager, Sept Damian Bumann, Reka-Feriendorf, VTK UCT, Sept Matthias Sulzer, Ferien im Reka-Feriendorf Blatten-Belalp, energiaplus, Nov Benedikt Vogel, Neue Schweizer Hybrid-Solarpanels liefern Strom und Warmwasser, Schweizer Energiefachbuch, Nov.2015 Auszug Präsentationen Fachveranstaltungen: - Matthias Sulzer, Solarenergie und thermische Vernetzung sinnvoll oder unsinnig?, PV Tagung, März Matthias Sulzer, Solarenergie und Anergienetze - sinnvoll oder unsinnig?, Solartagung, Nov Simon Summermatter, dezentrale Energieversorgung sind Energiespeicher die Lösung?, 5.Smart Energy Sion, Sept Simon Summermatter, Solare Energieversorgung im alpinen Raum - Reka-Feriendorf Blatten- Belalp, Swissolar Solarupdate Bern, Juni Simon Summermatter, Solare Energieversorgung im alpinen Raum - Reka-Feriendorf Blatten- Belalp, 19. Brenet Statusseminar, Sept Simon Summermatter, Solare Energieversorgung im alpinen Raum - Reka-Feriendorf Blatten- Belalp, 12. Haustech Planertag, Februar 2017 Auszeichnungen: - Schweizer Solarpreis Zertifikat Milestone /25
25 6 Referenzen [1] M.Sulzer, O.Meyer: Energiekonzept Feriendorf Blatten-Belalp AG, Vorprojekt, 2012 [2] S.Summermatter, Projektierung Energieversorgung Reka-Feriendorf Blatten, 2013 [3] M.Sulzer, S.Summermatter, Regel- und Funktionsbeschrieb Reka-Feriendorf Blatten-Belalp, 2014 [4] M.Sulzer, S.Summermatter, Kommunikationskonzept Leuchtturmprojekt Energieversorgung REKA Feriendorf Blatten, 2014 [5] M.Sulzer, S.Summermatter: Solare Energieversorgung im alpinen Raum, Paper 18. Status-Seminar, 2014 [6] M.Sulzer, S.Summermatter: BFE Leuchtturmprojekt Jahresbericht, 2014 [7] M.Sulzer, S.Summermatter: BFE Leuchtturmprojekt Jahresbericht, /25
Von der Sonne doppelt verwöhnt
 Von der Sonne doppelt verwöhnt Wer im neu eröffneten Reka-Feriendorf in Blatten (VS) seinen Urlaub verbringt, profitiert von der Sonne gleich doppelt. Er kann am Walliser Südhang die wärmenden Strahlen
Von der Sonne doppelt verwöhnt Wer im neu eröffneten Reka-Feriendorf in Blatten (VS) seinen Urlaub verbringt, profitiert von der Sonne gleich doppelt. Er kann am Walliser Südhang die wärmenden Strahlen
Monitoring-Ergebnisse eines MINERGIE -A-Standards Gebäudes mit Büronutzung
 Workshop Swissbau Fokus 2016 Netto-Nullenergiegebäude Stand und Ausblick national und international Monitoring-Ergebnisse eines MINERGIE -A-Standards Gebäudes mit Büronutzung 14.1.2016 Referat W. Hässig,
Workshop Swissbau Fokus 2016 Netto-Nullenergiegebäude Stand und Ausblick national und international Monitoring-Ergebnisse eines MINERGIE -A-Standards Gebäudes mit Büronutzung 14.1.2016 Referat W. Hässig,
Merkblatt 3. Hotelpower Heizung erneuern. Energie- und Gebäudetechnik. Beratende Ingenieure SIA. Naters, Seite 1/7
 Merkblatt 3 Naters, 21.09.2010 Seite 1/7 Hotelpower Heizung erneuern Lauber IWISA AG Bahnhofstrasse 8 CH-3904 Naters info@lauber-iwisa.ch Impressum Auftraggeber Hochschule Luzern - Technik & Architektur
Merkblatt 3 Naters, 21.09.2010 Seite 1/7 Hotelpower Heizung erneuern Lauber IWISA AG Bahnhofstrasse 8 CH-3904 Naters info@lauber-iwisa.ch Impressum Auftraggeber Hochschule Luzern - Technik & Architektur
Nachhaltigkeit in einer neuen Dimension Sonnenhäuser im Bühl ǀ Singen
 Nachhaltigkeit in einer neuen Dimension Sonnenhäuser im Bühl ǀ Singen Einen Schritt weiter Die Sonnenhäuser Im Bühl Der nachhaltige Umgang mit vorhandenen Ressourcen ist eine der großen Herausforderungen
Nachhaltigkeit in einer neuen Dimension Sonnenhäuser im Bühl ǀ Singen Einen Schritt weiter Die Sonnenhäuser Im Bühl Der nachhaltige Umgang mit vorhandenen Ressourcen ist eine der großen Herausforderungen
Programm EWS. Solare Regeneration von Erdwärmesondenfeldern. Arthur Huber dipl. Ing. ETH
 Solare Regeneration von Erdwärmesondenfeldern Programm EWS Arthur Huber dipl. Ing. ETH dipl. Masch.-Ing. ETH / SIA Mitglied SWKI / FEZ 1995 Gründung der Firma Huber Energietechnik - Geothermische Planungen
Solare Regeneration von Erdwärmesondenfeldern Programm EWS Arthur Huber dipl. Ing. ETH dipl. Masch.-Ing. ETH / SIA Mitglied SWKI / FEZ 1995 Gründung der Firma Huber Energietechnik - Geothermische Planungen
KWT Kälte- Wärmetechnik AG. Der Eisspeicher mit erstaunlichen Einsatzmöglichkeiten
 KWT Kälte- Wärmetechnik AG Der Eisspeicher mit erstaunlichen Einsatzmöglichkeiten KWT heute 87 Mitarbeiter davon 12 Lehrlinge Grösster Arbeitgeber der Gemeinde Worb Einziger Anbieter von Wärmepumpen- Komplettlösungen
KWT Kälte- Wärmetechnik AG Der Eisspeicher mit erstaunlichen Einsatzmöglichkeiten KWT heute 87 Mitarbeiter davon 12 Lehrlinge Grösster Arbeitgeber der Gemeinde Worb Einziger Anbieter von Wärmepumpen- Komplettlösungen
Kombination von Solarthermie, Wärmepumpe und Photovoltaik. Das Nullenergiehaus
 Kombination von Solarthermie, Wärmepumpe und Photovoltaik Das Nullenergiehaus 1 Schüco Clean Energy² System Technology Umfassende Systemlösungen zur Nutzung von Sonnenenergie 2 Schüco Clean Energy² System
Kombination von Solarthermie, Wärmepumpe und Photovoltaik Das Nullenergiehaus 1 Schüco Clean Energy² System Technology Umfassende Systemlösungen zur Nutzung von Sonnenenergie 2 Schüco Clean Energy² System
Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld. Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
versorgt Gebäude emissionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte Das zuverlässige, wirtschaftliche Gesamtsystem für den CO 2 -freien Gebäudebetrieb.
 versorgt Gebäude emissionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte Das zuverlässige, wirtschaftliche Gesamtsystem für den CO 2 -freien Gebäudebetrieb. Das System 2SOL: Ein einfaches Prinzip mit grosser Wirkung
versorgt Gebäude emissionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte Das zuverlässige, wirtschaftliche Gesamtsystem für den CO 2 -freien Gebäudebetrieb. Das System 2SOL: Ein einfaches Prinzip mit grosser Wirkung
SPF- Industrietag 2013: Anbindung von Wärmepumpen an Kombispeicher: Details entscheiden!
 SPF- Industrietag 2013: Anbindung von Wärmepumpen an Kombispeicher: Details entscheiden! Dr. Michel Haller, Dipl. Ing. (FH) Robert Haberl Kombination Solarwärme und Wärmepumpe Mass für energetische Effizienz
SPF- Industrietag 2013: Anbindung von Wärmepumpen an Kombispeicher: Details entscheiden! Dr. Michel Haller, Dipl. Ing. (FH) Robert Haberl Kombination Solarwärme und Wärmepumpe Mass für energetische Effizienz
Wärmepumpen + Solaranlagen richtig kombiniert
 Wärmepumpen + Solaranlagen richtig kombiniert Gute Systeme mit Polysun-Simulationen EnergiePraxis-Seminare Zürich, St. Gallen, Winterthur Ziegelbrücke, Landquart Dr. Andreas Witzig Geschäftsführer Vela
Wärmepumpen + Solaranlagen richtig kombiniert Gute Systeme mit Polysun-Simulationen EnergiePraxis-Seminare Zürich, St. Gallen, Winterthur Ziegelbrücke, Landquart Dr. Andreas Witzig Geschäftsführer Vela
ZIG Planerseminar. Monitoring Suurstoffi: Erfahrung erstes Betriebsjahr. Dienstag 25.3.2014
 Übersicht WP, Pumpen Heizbänder / WM / Lüftung Messtechnik Fazit ZIG Planerseminar Dienstag 25.3.2014 Monitoring Suurstoffi: Erfahrung erstes Betriebsjahr 25.03.2014, Monitoring Suurstoffi Seite 1 Übersicht
Übersicht WP, Pumpen Heizbänder / WM / Lüftung Messtechnik Fazit ZIG Planerseminar Dienstag 25.3.2014 Monitoring Suurstoffi: Erfahrung erstes Betriebsjahr 25.03.2014, Monitoring Suurstoffi Seite 1 Übersicht
SCOP versus COP und JAZ
 SCOP versus COP und JAZ Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsrechnung Harry Grünenwald Geschäftsführer Grünenwald AG Grünenwald AG stellt sich vor Rechtsform Aktiengesellschaft Gründungsjahr 1989 Anzahl
SCOP versus COP und JAZ Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsrechnung Harry Grünenwald Geschäftsführer Grünenwald AG Grünenwald AG stellt sich vor Rechtsform Aktiengesellschaft Gründungsjahr 1989 Anzahl
Speicherung von Wärme in Erdwärmesonden
 Speicherung von Wärme in Erdwärmesonden Arthur Huber dipl. Ing. ETH dipl. Masch.-Ing. ETH / SIA Mitglied SWKI / FEZ Huber Energietechnik AG Jupiterstrasse 26 CH 8032 Zürich www.hetag.ch 1995 Gründung der
Speicherung von Wärme in Erdwärmesonden Arthur Huber dipl. Ing. ETH dipl. Masch.-Ing. ETH / SIA Mitglied SWKI / FEZ Huber Energietechnik AG Jupiterstrasse 26 CH 8032 Zürich www.hetag.ch 1995 Gründung der
Nachhaltigkeitsbericht. Primärenergieverbrauch erneut verringert. Fläche mit Wärme aus erneuerbarer Energie verdoppelt
 Nachhaltigkeitsbericht Mit dem schrittweisen Bezug der Suurstoffi kam Zug Estates ihrer Vision vom energieautarken und treibhausgasfreien Betrieb der Liegenschaften ein Stück näher. Mit der Vision Zero-Zero
Nachhaltigkeitsbericht Mit dem schrittweisen Bezug der Suurstoffi kam Zug Estates ihrer Vision vom energieautarken und treibhausgasfreien Betrieb der Liegenschaften ein Stück näher. Mit der Vision Zero-Zero
Auslegung und Bewertung aus der Sicht des Planers Christoph Rosinski
 Workshop Projekt BiSolar-WP Emmerthal, 30.03.2011 Auslegung und Bewertung aus der Sicht des Planers Christoph Rosinski Projektpartner Inhalt o GEFGA mbh o Aufgabenstellung o Grundlagen o Erdwärmespeicher
Workshop Projekt BiSolar-WP Emmerthal, 30.03.2011 Auslegung und Bewertung aus der Sicht des Planers Christoph Rosinski Projektpartner Inhalt o GEFGA mbh o Aufgabenstellung o Grundlagen o Erdwärmespeicher
Renovationsprojekt La Cigale
 ZIG Planertagung 25.3.2015, Luzern Renovationsprojekt La Cigale Dr. Lukas Küng Hochschule Luzern, 25.3.2015 1 Inhalt Über BG Wieso energetische Renovationen? Überblick "la cigale" Genf Vergleich der Heizsysteme
ZIG Planertagung 25.3.2015, Luzern Renovationsprojekt La Cigale Dr. Lukas Küng Hochschule Luzern, 25.3.2015 1 Inhalt Über BG Wieso energetische Renovationen? Überblick "la cigale" Genf Vergleich der Heizsysteme
energo - Kompetenzzentrum für Energieeffizienz Energetische Betriebsoptimierung Vorgehen und Beispiele
 Optimierung ohne Investitionen energo - Kompetenzzentrum für Energieeffizienz Energetische Betriebsoptimierung Vorgehen und Beispiele EnergiePraxis-Seminar 2016-1, Rotkreuz, 31.5.2016 Roland Stadelmann,
Optimierung ohne Investitionen energo - Kompetenzzentrum für Energieeffizienz Energetische Betriebsoptimierung Vorgehen und Beispiele EnergiePraxis-Seminar 2016-1, Rotkreuz, 31.5.2016 Roland Stadelmann,
Zusammenfassung. 1. Einleitung
 Zusammenfassung 1. Einleitung Es ist technisch möglich Photovoltaik- und Solarthermiemodule zu einem Hybridmodul zu vereinen. Diese Kombination wird kurz PVT genannt. Dabei können grundsätzlich zwei Systeme
Zusammenfassung 1. Einleitung Es ist technisch möglich Photovoltaik- und Solarthermiemodule zu einem Hybridmodul zu vereinen. Diese Kombination wird kurz PVT genannt. Dabei können grundsätzlich zwei Systeme
PILOTPROJEKT: DAS EnergieHausPLUS ALS MEHRFAMILIENWOHNHAUS
 Zukunftsorientierte Wohnformen, ein hoher Energiestandard und neue Ansätze der Mobilität das alles vereint das EnergieHausPLUS unter einem Dach. Das EnergieHausPLUS-Projekt der Unternehmensgruppe Nassauische
Zukunftsorientierte Wohnformen, ein hoher Energiestandard und neue Ansätze der Mobilität das alles vereint das EnergieHausPLUS unter einem Dach. Das EnergieHausPLUS-Projekt der Unternehmensgruppe Nassauische
Thermische Arealvernetzung am Beispiel des Areals Suurstoffi (Simulation und Monitoring) Philipp Kräuchi und Nadège Vetterli
 Thermische Arealvernetzung am Beispiel des Areals Suurstoffi (Simulation und Monitoring) Forschung & Entwicklung Zentrum für Integrale Gebäudetechnik Philipp Kräuchi Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Thermische Arealvernetzung am Beispiel des Areals Suurstoffi (Simulation und Monitoring) Forschung & Entwicklung Zentrum für Integrale Gebäudetechnik Philipp Kräuchi Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter
SPF-Industrietag 2013: Saisonale Wärmespeicherung im Eisspeicher Erste Erfahrungen mit einer Pilotanlage
 SPF-Industrietag 2013: Saisonale Wärmespeicherung im Eisspeicher Erste Erfahrungen mit einer Pilotanlage Daniel Philippen Hintergrund des vorgestellten Projekts Entwicklungsprojekt finanziert von der Elektrizitätswerke
SPF-Industrietag 2013: Saisonale Wärmespeicherung im Eisspeicher Erste Erfahrungen mit einer Pilotanlage Daniel Philippen Hintergrund des vorgestellten Projekts Entwicklungsprojekt finanziert von der Elektrizitätswerke
VOM PASSIVHAUS ZUM PLUSENERGIEHAUS
 Objekt: Ingenieurbüro für energieeffizientes Bauen, Schwyz VOM PASSIVHAUS ZUM PLUSENERGIEHAUS Passivhaus Spescha Erweiterung zum Plusenergiehaus Bauträger: Christina und Otmar Spescha-Lüönd Ingenieur:
Objekt: Ingenieurbüro für energieeffizientes Bauen, Schwyz VOM PASSIVHAUS ZUM PLUSENERGIEHAUS Passivhaus Spescha Erweiterung zum Plusenergiehaus Bauträger: Christina und Otmar Spescha-Lüönd Ingenieur:
Energie-Cluster. SIA 2031 Energieausweis Charles Weinmann. Vorstand Energie-Cluster Umwelt Arena AG 20. April 2016
 1 Energie-Cluster SIA 2031 Energieausweis Vorstand Energie-Cluster Umwelt Arena AG 20. April 2016 Inhalt Inhalt Ziel Gemessene und berechnete Bilanz Bilanzgrenzen Gewichtungsfaktoren Definition PEG Schlussfolgerungen
1 Energie-Cluster SIA 2031 Energieausweis Vorstand Energie-Cluster Umwelt Arena AG 20. April 2016 Inhalt Inhalt Ziel Gemessene und berechnete Bilanz Bilanzgrenzen Gewichtungsfaktoren Definition PEG Schlussfolgerungen
Möglichkeiten zur optimalen Nutzung und Kombination von Photovoltaik, Wärmepumpen und Solarthermie Energie Apéro Luzern, 11.
 Möglichkeiten zur optimalen Nutzung und Kombination von Photovoltaik, Wärmepumpen und Solarthermie Energie Apéro Luzern, 11. Mai 2015 Inhalt _ Energie von der Sonne: Aktuelle Preise und Wirkungsgrade von
Möglichkeiten zur optimalen Nutzung und Kombination von Photovoltaik, Wärmepumpen und Solarthermie Energie Apéro Luzern, 11. Mai 2015 Inhalt _ Energie von der Sonne: Aktuelle Preise und Wirkungsgrade von
Kombination von Solarthermie mit Wärmepumpen
 Kombination von Solarthermie mit Wärmepumpen ichel Haller Projektleiter Forschung SPF Institut für Solartechnik Hochschule für Technik HSR Rapperswil 1 80% nicht erneuerbar Gesamtenergiestatistik Schweiz
Kombination von Solarthermie mit Wärmepumpen ichel Haller Projektleiter Forschung SPF Institut für Solartechnik Hochschule für Technik HSR Rapperswil 1 80% nicht erneuerbar Gesamtenergiestatistik Schweiz
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Wärmepumpe und Solaranlage. Urs Jaeggi, SOLTOP Schuppisser AG, Elgg
 Wärmepumpe und Solaranlage schlau kombiniert Urs Jaeggi, SOLTOP Schuppisser AG, Elgg SOLTOP Schuppisser AG 35 Jahre Erfahrung Wir entwickeln, produzieren + verkaufen Haustechniksysteme - für Heizung, Warmwasser
Wärmepumpe und Solaranlage schlau kombiniert Urs Jaeggi, SOLTOP Schuppisser AG, Elgg SOLTOP Schuppisser AG 35 Jahre Erfahrung Wir entwickeln, produzieren + verkaufen Haustechniksysteme - für Heizung, Warmwasser
Praxistest MINERGIE. Erfolgskontrollen an 52 Wohnbauten Verbrauchsdatenauswertung von 506 Wohnbauten
 Praxistest MINERGIE Erfolgskontrollen an 52 Wohnbauten Verbrauchsdatenauswertung von 506 Wohnbauten Silvia Gemperle Projektleiterin Energie und Bauen Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen Hält
Praxistest MINERGIE Erfolgskontrollen an 52 Wohnbauten Verbrauchsdatenauswertung von 506 Wohnbauten Silvia Gemperle Projektleiterin Energie und Bauen Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen Hält
Daniel Tschopp. Stadt:Werk:Lehen - Wärmebereitstellung für Niedertemperaturnetz mit Solaranlage und speicherintegrierter Wärmepumpe
 Stadt:Werk:Lehen - Wärmebereitstellung für Niedertemperaturnetz mit Solaranlage und speicherintegrierter Wärmepumpe qm heizwerke Fachtagung Wärmenetze der Zukunft 03.06.2016 Daniel Tschopp AEE Institut
Stadt:Werk:Lehen - Wärmebereitstellung für Niedertemperaturnetz mit Solaranlage und speicherintegrierter Wärmepumpe qm heizwerke Fachtagung Wärmenetze der Zukunft 03.06.2016 Daniel Tschopp AEE Institut
Gewerbebau mit Wohlfühlfaktor
 Gewerbebau mit Wohlfühlfaktor Wirtschaftlich bauen I zufriedene Mitarbeiter heizen mit erneuerbaren Energien nach ENEV kühlen ohne Zugerscheinungen nachhaltig und wirtschaftlich Gewerbeimmobilien sollen
Gewerbebau mit Wohlfühlfaktor Wirtschaftlich bauen I zufriedene Mitarbeiter heizen mit erneuerbaren Energien nach ENEV kühlen ohne Zugerscheinungen nachhaltig und wirtschaftlich Gewerbeimmobilien sollen
Physikalische Grundlagen energieeffizienten Bauens. Energieeffizientes Bauen Voraussetzungen, Faktoren, Gedanken. Zur Person
 Energieeffizientes Bauen Voraussetzungen, Faktoren, Gedanken Physikalische Grundlagen energieeffizienten Bauens Urs-Peter Menti Dipl. Masch. Ing. ETH/SIA, MAS-BA Leiter Zentrum für Integrale Gebäudetechnik
Energieeffizientes Bauen Voraussetzungen, Faktoren, Gedanken Physikalische Grundlagen energieeffizienten Bauens Urs-Peter Menti Dipl. Masch. Ing. ETH/SIA, MAS-BA Leiter Zentrum für Integrale Gebäudetechnik
SOLAERA, die innovative Solarheizung für Ihr Haus
 SOLAERA SONNE. TAG UND NACHT. SOLAERA, die innovative Solarheizung für Ihr Haus Rosmarie Neukomm, Gebr. Müller AG, Bern; www.solarmueller.ch 1 Inhalt Solaera Komponenten + System Solaera am Beispiel Altbausanierung
SOLAERA SONNE. TAG UND NACHT. SOLAERA, die innovative Solarheizung für Ihr Haus Rosmarie Neukomm, Gebr. Müller AG, Bern; www.solarmueller.ch 1 Inhalt Solaera Komponenten + System Solaera am Beispiel Altbausanierung
Energieeffiziente Sanierung und architektonische Aufwertung: das Ex-Post Gebäude in Bozen / Italy
 Energieeffiziente Sanierung und architektonische Aufwertung: das Ex-Post Gebäude in Bozen / Italy Hannes Mahlknecht, Alexandra Troi, Michael Tribus, Andrea Costa et alia AGENDA 1. Beschreibung des Gebäudes
Energieeffiziente Sanierung und architektonische Aufwertung: das Ex-Post Gebäude in Bozen / Italy Hannes Mahlknecht, Alexandra Troi, Michael Tribus, Andrea Costa et alia AGENDA 1. Beschreibung des Gebäudes
Solar-Wärmepumpe Eine sinnvolle Kombination?
 Solar-Wärmepumpe Eine sinnvolle Kombination? Dipl. Phys. Manfred Reuß Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung Abteilung: Techniken für Energiesysteme und Erneuerbare Energien Walther-Meißner-Str.
Solar-Wärmepumpe Eine sinnvolle Kombination? Dipl. Phys. Manfred Reuß Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung Abteilung: Techniken für Energiesysteme und Erneuerbare Energien Walther-Meißner-Str.
Speicherung von Wärme in. Erdwärmesonden. Arthur Huber dipl. Ing. ETH. Huber Energietechnik AG Jupiterstrasse 26 CH 8032 Zürich
 Speicherung von Wärme in Erdwärmesonden Arthur Huber dipl. Ing. ETH dipl. Masch.-Ing. ETH / SIA Mitglied SWKI / FEZ / SVG Huber Energietechnik AG Jupiterstrasse 26 CH 8032 Zürich www.hetag.ch 1995 Gründung
Speicherung von Wärme in Erdwärmesonden Arthur Huber dipl. Ing. ETH dipl. Masch.-Ing. ETH / SIA Mitglied SWKI / FEZ / SVG Huber Energietechnik AG Jupiterstrasse 26 CH 8032 Zürich www.hetag.ch 1995 Gründung
Bosch Thermotechnik. Thermotechnology
 Bosch Thermotechnik Energie-Plus-Haus mit verfügbarer Technik Miriam Asbeck, Projektleitung Energie-Plus-Haus Pressekonferenz in Stuttgart Bosch Haus Heidehof am 05.05.2010 1 Energie-Plus-Haus mit verfügbarer
Bosch Thermotechnik Energie-Plus-Haus mit verfügbarer Technik Miriam Asbeck, Projektleitung Energie-Plus-Haus Pressekonferenz in Stuttgart Bosch Haus Heidehof am 05.05.2010 1 Energie-Plus-Haus mit verfügbarer
FAQ. Häufig gestellte Fragen... und die Antworten
 FAQ Häufig gestellte Fragen... und die Antworten Erdwärme bietet eine nachhaltige, von Klima, Tages- und Jahreszeit unabhängige Energiequelle zur Wärme- und Stromerzeugung. Bereits mit den heutigen technischen
FAQ Häufig gestellte Fragen... und die Antworten Erdwärme bietet eine nachhaltige, von Klima, Tages- und Jahreszeit unabhängige Energiequelle zur Wärme- und Stromerzeugung. Bereits mit den heutigen technischen
Großer Eisspeicher im Wohnungsbau
 6. Europäischer Kongress EBH 2013 Großer Eisspeicher im Wohnungsbau R. Mnich 1 Großer Eisspeicher im Wohnungsbau Ralf Mnich PBS & Partner DE-Haan 2 Großer Eisspeicher im Wohnungsbau R. Mnich 6. Europäischer
6. Europäischer Kongress EBH 2013 Großer Eisspeicher im Wohnungsbau R. Mnich 1 Großer Eisspeicher im Wohnungsbau Ralf Mnich PBS & Partner DE-Haan 2 Großer Eisspeicher im Wohnungsbau R. Mnich 6. Europäischer
Anergienetze und Wärmepumpen. Marco Nani
 Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
SolarPowerPack Solar-Dachpfannen-Kollektor System
 SolarPowerPack MS 5 PV & MS 5 2Power 2Power SolarPowerPack Solar-Dachpfannen-Kollektor System SolarPowerPack Wärmepumpe SolarPowerPack Funktionsprinzip www.revolution-ist-jetzt.de SOLARTECHNIK OHNE ARCHITEKTONISCHE
SolarPowerPack MS 5 PV & MS 5 2Power 2Power SolarPowerPack Solar-Dachpfannen-Kollektor System SolarPowerPack Wärmepumpe SolarPowerPack Funktionsprinzip www.revolution-ist-jetzt.de SOLARTECHNIK OHNE ARCHITEKTONISCHE
Effizienzuntersuchung von Brauchwarmwasser an Wärmepumpen mit integriertem Boiler
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Effizienzuntersuchung von Brauchwarmwasser an Wärmepumpen mit integriertem Boiler Schlussbericht
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Effizienzuntersuchung von Brauchwarmwasser an Wärmepumpen mit integriertem Boiler Schlussbericht
Planer-Seminar Die Raumautomation im Zuge der neuen SIA (Ausgabe 2012) Kurs 8. Nov. 2012
 Planer-Seminar 2012 Die Raumautomation im Zuge der neuen SIA 386.110 (Ausgabe 2012) Kurs 8. Nov. 2012 Basis: Energieeffiziente Gebäudeautomation SN EN 15232:2012 SIA 386.110:2012 Heizen Trinkwassererwärmung
Planer-Seminar 2012 Die Raumautomation im Zuge der neuen SIA 386.110 (Ausgabe 2012) Kurs 8. Nov. 2012 Basis: Energieeffiziente Gebäudeautomation SN EN 15232:2012 SIA 386.110:2012 Heizen Trinkwassererwärmung
Stromverbrauch der letzen 50 Monate
 45 Stromverbrauch der letzen 50 Monate 40 35 30 25 20 15 10 Strom HT NT HT+NT Heiz.-Steuerung Lüftung Strom Haushalt 5 April 2011 Mai 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 September 2011 Oktober 2011 November
45 Stromverbrauch der letzen 50 Monate 40 35 30 25 20 15 10 Strom HT NT HT+NT Heiz.-Steuerung Lüftung Strom Haushalt 5 April 2011 Mai 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 September 2011 Oktober 2011 November
Nullenergiestadt - Bad Aibling
 Nullenergiestadt - Bad Aibling Strom zur Wärmebereitstellung im Wärmenetz der Nullenergiestadt 7. Projektleiter-Meeting EnEff:Stadt am 01./02.07.2014 Florian Alscher Gefördert durch Gliederung Einführung
Nullenergiestadt - Bad Aibling Strom zur Wärmebereitstellung im Wärmenetz der Nullenergiestadt 7. Projektleiter-Meeting EnEff:Stadt am 01./02.07.2014 Florian Alscher Gefördert durch Gliederung Einführung
Realisierung eines thermoelektrischen Generators für die Stromerzeugung aus Niedertemperatur
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Jahresbericht 3. Dezember 2009 Realisierung eines thermoelektrischen Generators für die Stromerzeugung
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Jahresbericht 3. Dezember 2009 Realisierung eines thermoelektrischen Generators für die Stromerzeugung
Strom und Wärme aus solaren Hybridsystemen. Peter Schibli, Geschäftsführer, Heizplan AG
 Strom und Wärme aus solaren Hybridsystemen Peter Schibli, Geschäftsführer, Heizplan AG Dramaturgie 1. Big Picture 2. Überleitung auf Lösungen im Gebäude à Lösung PV von MB 3. Überleitung auf Wärmesektor
Strom und Wärme aus solaren Hybridsystemen Peter Schibli, Geschäftsführer, Heizplan AG Dramaturgie 1. Big Picture 2. Überleitung auf Lösungen im Gebäude à Lösung PV von MB 3. Überleitung auf Wärmesektor
Solarthermie und Wärmepumpe Erfahrungen aus 3 Heizperioden Entwicklung einer solaren Systemarbeitszahl
 Solarthermie und Wärmepumpe Erfahrungen aus 3 Heizperioden Entwicklung einer solaren Systemarbeitszahl Dipl.-Ing. (FH) Frank Thole, Dipl.-Ing. (FH) Nadine Hanke Schüco International KG Karolinenstrasse
Solarthermie und Wärmepumpe Erfahrungen aus 3 Heizperioden Entwicklung einer solaren Systemarbeitszahl Dipl.-Ing. (FH) Frank Thole, Dipl.-Ing. (FH) Nadine Hanke Schüco International KG Karolinenstrasse
Nutzung der Sonnenergie in Zofingen
 Nutzung der Sonnenergie in Zofingen Pius Hüsser, Energieberater, Aarau Inhalt Potential der Sonnenenergie Nutzungsarten Was ist in Zofingen möglich Wie gehe ich weiter? Wie lange haben wir noch Öl? Erdölförderung
Nutzung der Sonnenergie in Zofingen Pius Hüsser, Energieberater, Aarau Inhalt Potential der Sonnenenergie Nutzungsarten Was ist in Zofingen möglich Wie gehe ich weiter? Wie lange haben wir noch Öl? Erdölförderung
Photovoltaik-Anlage Ihr eigenes Kraftwerk.
 Photovoltaik-Anlage Ihr eigenes Kraftwerk. www.naturenergie.de/my-e-nergy Ihre eigene Energie aus der Kraft der Sonne. Strom, Wärme, Mobilität: Produzieren Sie Ihren Strom selbst mit einer auf Ihre Bedürfnisse
Photovoltaik-Anlage Ihr eigenes Kraftwerk. www.naturenergie.de/my-e-nergy Ihre eigene Energie aus der Kraft der Sonne. Strom, Wärme, Mobilität: Produzieren Sie Ihren Strom selbst mit einer auf Ihre Bedürfnisse
Das fast autarke Bürogebäude GHC Solarer Erdspeicher EnergiePraxis Seminar AWEL Kt. Zürich
 Das fast autarke Bürogebäude GHC Solarer Erdspeicher EnergiePraxis Seminar AWEL Kt. Zürich Agenda _ Standort Esslingen _ Kurzvorstellung Geschäftshaus C _ Energiekonzept (DVD) _ Fokus Erdspeicher _ Erfahrungen
Das fast autarke Bürogebäude GHC Solarer Erdspeicher EnergiePraxis Seminar AWEL Kt. Zürich Agenda _ Standort Esslingen _ Kurzvorstellung Geschäftshaus C _ Energiekonzept (DVD) _ Fokus Erdspeicher _ Erfahrungen
Professioneller Report
 "Projektname" 22j: Raumheizung (Wärmepumpe + Erdwärmesonde, ohne Pufferspeicher) Standort der Anlage Kartenausschnitt Winterthur Längengrad: 8.727 Breitengrad: 47.5 Höhe ü.m.: 450 m Dieser Report wurde
"Projektname" 22j: Raumheizung (Wärmepumpe + Erdwärmesonde, ohne Pufferspeicher) Standort der Anlage Kartenausschnitt Winterthur Längengrad: 8.727 Breitengrad: 47.5 Höhe ü.m.: 450 m Dieser Report wurde
SUN MEMORY WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT. Sonnenstrom. 4 kw. = 1 kw. Wärme.
 SUN MEMORY WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT Sonnenstrom 4 kw = 1 kw Wärme www.waermepumpensysteme.com Mehr Unabhängigkeit durch die effiziente Nutzung des eigenproduzierten,
SUN MEMORY WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT Sonnenstrom 4 kw = 1 kw Wärme www.waermepumpensysteme.com Mehr Unabhängigkeit durch die effiziente Nutzung des eigenproduzierten,
Wärmepumpen. Ressortleiter Qualität und Wärmepumpendoktor Mail: peter.hubacher@fws.ch. Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz, FWS
 Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung Peter Hubacher, dipl. Ing. HTL/ HLK Ressortleiter Qualität und Wärmepumpendoktor Mail: peter.hubacher@fws.ch Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz, FWS Hubacher
Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung Peter Hubacher, dipl. Ing. HTL/ HLK Ressortleiter Qualität und Wärmepumpendoktor Mail: peter.hubacher@fws.ch Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz, FWS Hubacher
Von der KEV zum Eigenverbrauch
 Electrosuisse Forum für Elektrofachleute 2015 Von der KEV zum Eigenverbrauch Dezentrale Energieerzeugung Dezentrale Energieerzeugung KEV / Einmalvergütung am Beispiel der Photovoltaik Konzept gütig ab
Electrosuisse Forum für Elektrofachleute 2015 Von der KEV zum Eigenverbrauch Dezentrale Energieerzeugung Dezentrale Energieerzeugung KEV / Einmalvergütung am Beispiel der Photovoltaik Konzept gütig ab
Forschungsvorhaben DEZENTRALE WÄRMERÜCKGEWINNUNG AUS HÄUSLICHEM ABWASSER Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher Seybold
 Forschungsvorhaben DEZENTRALE WÄRMERÜCKGEWINNUNG AUS HÄUSLICHEM ABWASSER Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher Seybold Projektvorstellung Dezentrale Wärmerückgewinnung aus häuslichem Abwasser gefördert durch: Projektpartner:
Forschungsvorhaben DEZENTRALE WÄRMERÜCKGEWINNUNG AUS HÄUSLICHEM ABWASSER Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher Seybold Projektvorstellung Dezentrale Wärmerückgewinnung aus häuslichem Abwasser gefördert durch: Projektpartner:
Niedrigenergiehaus Erlenbach
 Energieforschung Programm Rationelle Energienutzung in Gebäuden im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE Jahresbericht 2002 Niedrigenergiehaus Erlenbach Autor und Koautor Thomas Nordmann, Luzi Clavadetscher
Energieforschung Programm Rationelle Energienutzung in Gebäuden im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE Jahresbericht 2002 Niedrigenergiehaus Erlenbach Autor und Koautor Thomas Nordmann, Luzi Clavadetscher
Stand Umsetzung Energiekonzept
 Baudepartement Stand Umsetzung Energiekonzept - Zielerreichung: Stand Ende 2014 - neue Angebote / Produkte der Energiefachstelle - Energieförderung: Ausblick Marcel Sturzenegger Leiter Energie Grundlagen
Baudepartement Stand Umsetzung Energiekonzept - Zielerreichung: Stand Ende 2014 - neue Angebote / Produkte der Energiefachstelle - Energieförderung: Ausblick Marcel Sturzenegger Leiter Energie Grundlagen
Erfolgskontrolle ZeroEmission-LowEx-Mehrfamilienhaus B35 Zürich
 18. Status-Seminar «Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt» Erfolgskontrolle ZeroEmission-LowEx-Mehrfamilienhaus B35 Zürich Tjeerd de Neef, Rudolf Furter, Matthias Sulzer, Hochschule Luzern
18. Status-Seminar «Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt» Erfolgskontrolle ZeroEmission-LowEx-Mehrfamilienhaus B35 Zürich Tjeerd de Neef, Rudolf Furter, Matthias Sulzer, Hochschule Luzern
Schlauer-Wohnen Koni Osterwalder Urs Hugentobler Habsburgstr Zürich
 Koni Osterwalder Urs Hugentobler Habsburgstr. 1 8037 Zürich Gebäudetechnik technische Schnittstelle soziale Schnittstelle Bewohner Bewohner interagiert mit Gebäudetechnik interagiert mit Verwaltung zum
Koni Osterwalder Urs Hugentobler Habsburgstr. 1 8037 Zürich Gebäudetechnik technische Schnittstelle soziale Schnittstelle Bewohner Bewohner interagiert mit Gebäudetechnik interagiert mit Verwaltung zum
Informationsveranstaltung Fernwärmenetz Saas-Fee. Vortrag vom 02. Dezember 2015 Zeit: 20:00 Uhr Gemeindehaus, Saas-Fee
 Informationsveranstaltung Fernwärmenetz Saas-Fee Vortrag vom 02. Dezember 2015 Zeit: 20:00 Uhr Gemeindehaus, Saas-Fee Informationsveranstaltung Einleitung Aktuelles zum Projekt Erläuterung Gesamtsystem
Informationsveranstaltung Fernwärmenetz Saas-Fee Vortrag vom 02. Dezember 2015 Zeit: 20:00 Uhr Gemeindehaus, Saas-Fee Informationsveranstaltung Einleitung Aktuelles zum Projekt Erläuterung Gesamtsystem
Auswertung von Lastgängen eines Gärtnerei-Betriebes mit eigener Photovoltaik-Anlage
 Auswertung von Lastgängen eines Gärtnerei-Betriebes mit eigener Photovoltaik-Anlage Autor: swissgrid ag Erstelldatum: 24. Februar 2012 Version: 1.0 Seite: 1 von 12 Alle Rechte, insbesondere das Vervielfältigen
Auswertung von Lastgängen eines Gärtnerei-Betriebes mit eigener Photovoltaik-Anlage Autor: swissgrid ag Erstelldatum: 24. Februar 2012 Version: 1.0 Seite: 1 von 12 Alle Rechte, insbesondere das Vervielfältigen
Professioneller Report
 "Projektname" 52c: Invertergesteuerte Wärmepumpe Standort der Anlage Kartenausschnitt Winterthur Längengrad: 8.727 Breitengrad: 47.5 Höhe ü.m.: 450 m Dieser Report wurde erstellt durch: Vela Solaris AG
"Projektname" 52c: Invertergesteuerte Wärmepumpe Standort der Anlage Kartenausschnitt Winterthur Längengrad: 8.727 Breitengrad: 47.5 Höhe ü.m.: 450 m Dieser Report wurde erstellt durch: Vela Solaris AG
7.1.3 Einsatzbereiche solarer Systeme Solaranlagen zur Warmwasserbereitung
 Seite 1.1 Solaranlagen zur Warmwasserbereitung Solaranlagen zur Warmwasserbereitung werden in warmen südlichen Ländern oft als einfache Schwerkraftanlagen (Thermosiphonanlagen) gebaut. In unseren Breiten
Seite 1.1 Solaranlagen zur Warmwasserbereitung Solaranlagen zur Warmwasserbereitung werden in warmen südlichen Ländern oft als einfache Schwerkraftanlagen (Thermosiphonanlagen) gebaut. In unseren Breiten
Bericht Temperaturmessungen
 Hochbauamt Energiemanagement Bericht Temperaturmessungen Liegenschaft: Julius-Leber-Schule Auftrag: Temperaturmessungen Bearbeiter: Giuseppe Vitale Datum: 16.01-31.01.2013 Hochbauamt Energiemanagement
Hochbauamt Energiemanagement Bericht Temperaturmessungen Liegenschaft: Julius-Leber-Schule Auftrag: Temperaturmessungen Bearbeiter: Giuseppe Vitale Datum: 16.01-31.01.2013 Hochbauamt Energiemanagement
Kirchheimer. Auftaktveranstaltung 18. April 2013
 Kirchheimer Klimaschutzkonzept Auftaktveranstaltung 18. April 2013 Klimawandel: Doch nicht in Kirchheim - oder? LUBW: Die Temperatur steigt Starkregenereignisse und Stürme nehmen zu Jährliche Anzahl der
Kirchheimer Klimaschutzkonzept Auftaktveranstaltung 18. April 2013 Klimawandel: Doch nicht in Kirchheim - oder? LUBW: Die Temperatur steigt Starkregenereignisse und Stürme nehmen zu Jährliche Anzahl der
Strom und Wärme von der Glarner Sonne
 Strom und Wärme von der Glarner Sonne Sonnenenergie lässt sich mit Kollektoren in Warmwasser und mit PV-Modulen in Strom verwandeln. Die Kombination der beiden Methoden in Hybridmodulen (PVT-Modulen) verspricht
Strom und Wärme von der Glarner Sonne Sonnenenergie lässt sich mit Kollektoren in Warmwasser und mit PV-Modulen in Strom verwandeln. Die Kombination der beiden Methoden in Hybridmodulen (PVT-Modulen) verspricht
Exergiekenndaten und Bewertungsverfahren für den Gebäudebestand in Deutschland. Fraunhofer-Institut für Bauphysik Tekn. Dr.
 Exergiekenndaten und Bewertungsverfahren für den Gebäudebestand in Deutschland Fraunhofer-Institut für Bauphysik Tekn. Dr. Dietrich Schmidt Gliederung 1. Definition Exergie 2. LowEx -Ansatz 3. Wirkung
Exergiekenndaten und Bewertungsverfahren für den Gebäudebestand in Deutschland Fraunhofer-Institut für Bauphysik Tekn. Dr. Dietrich Schmidt Gliederung 1. Definition Exergie 2. LowEx -Ansatz 3. Wirkung
Ein neues Konzept zur energetischen Gebäudesanierung unter Verwendung von Infrarotheizungen und Photovoltaik
 Ein neues Konzept zur energetischen Gebäudesanierung unter Verwendung von Infrarotheizungen und Photovoltaik Vortrag auf der sportinfra 2014, Frankfurt am Main 13.11.2014 Dr.-Ing. Peter Kosack Technische
Ein neues Konzept zur energetischen Gebäudesanierung unter Verwendung von Infrarotheizungen und Photovoltaik Vortrag auf der sportinfra 2014, Frankfurt am Main 13.11.2014 Dr.-Ing. Peter Kosack Technische
SPF- Industrietag 2014: Wärmepumpe und Solarwärme: Vermeintliche und tatsächliche Synergien. Dr. Michel Haller Projektleiter F+E
 SPF- Industrietag 2014: Wärmepumpe und Solarwärme: Vermeintliche und tatsächliche Synergien Dr. Michel Haller Projektleiter F+E Solarwärme und Wärmepumpen Synergien? Wärmepumpe Erdsonden??? Bild: Hoval
SPF- Industrietag 2014: Wärmepumpe und Solarwärme: Vermeintliche und tatsächliche Synergien Dr. Michel Haller Projektleiter F+E Solarwärme und Wärmepumpen Synergien? Wärmepumpe Erdsonden??? Bild: Hoval
Umbau Romantik Hotel Muottas Muragl Wie entsteht ein Plus-Energie Haus auf m.ü.m
 Umbau Romantik Hotel Muottas Muragl Wie entsteht ein Plus-Energie Haus auf 2 456 m.ü.m Geschichte Muottas Muragl - Die Idee den Berg zu erschliessen entsteht 1890 - Eröffnung Standseilbahn 1907 - Frühe
Umbau Romantik Hotel Muottas Muragl Wie entsteht ein Plus-Energie Haus auf 2 456 m.ü.m Geschichte Muottas Muragl - Die Idee den Berg zu erschliessen entsteht 1890 - Eröffnung Standseilbahn 1907 - Frühe
In diesem Zusammenhang werden folgende Fragen an den Stadtrat gestellt:
 Schriftliche Anfrage vom 10. Juli 2008 08.08 der GP-Fraktion betreffend Energiebuchhaltung von öffentlichen Gebäuden Wortlaut der Anfrage Die Liegenschaftsabteilung führt eine Energiebuchhaltung der öffentlichen
Schriftliche Anfrage vom 10. Juli 2008 08.08 der GP-Fraktion betreffend Energiebuchhaltung von öffentlichen Gebäuden Wortlaut der Anfrage Die Liegenschaftsabteilung führt eine Energiebuchhaltung der öffentlichen
DPG - Frühjahrstagung Haustechniksystem AEREX für Passivhäuser - Technik und Erfahrungen
 DPG - Frühjahrstagung 2003 Haustechniksystem AEREX für Passivhäuser - Technik und Erfahrungen Dr. Gerhard Kirchner MAICO Ventilatoren Inhalt Motivation Anforderungen an ein Haustechniksystem Umsetzung
DPG - Frühjahrstagung 2003 Haustechniksystem AEREX für Passivhäuser - Technik und Erfahrungen Dr. Gerhard Kirchner MAICO Ventilatoren Inhalt Motivation Anforderungen an ein Haustechniksystem Umsetzung
SIMULATIONSGESTÜTZTE OPTIMIERUNG IM IT-ZENTRUM DER BMW GROUP IN MÜNCHEN. EINFLUSS AUF KOMFORT UND ENERGIEVERBRAUCH. Dr. Angerhöfer I
 SIMULATIONSGESTÜTZTE OPTIMIERUNG IM IT-ZENTRUM DER BMW GROUP IN MÜNCHEN. EINFLUSS AUF KOMFORT UND ENERGIEVERBRAUCH. Dr. Angerhöfer I 06.10.2016 DAS BMW-GROUP IT-ZENTRUM. Mäanderartiger 5-geschossiger Gebäudekomplex
SIMULATIONSGESTÜTZTE OPTIMIERUNG IM IT-ZENTRUM DER BMW GROUP IN MÜNCHEN. EINFLUSS AUF KOMFORT UND ENERGIEVERBRAUCH. Dr. Angerhöfer I 06.10.2016 DAS BMW-GROUP IT-ZENTRUM. Mäanderartiger 5-geschossiger Gebäudekomplex
EnFa Die Energiefabrik
 Herzlich Willkommen zum Vortrag zur EnFa Die Energiefabrik Gliederung des Kurzreferates: 1.Firmenvorstellung 2.Die Idee 3.Gesetzgebung 4.Technische Umsetzung 5.Praktischer Betrieb 6.Wirtschaftlichkeit
Herzlich Willkommen zum Vortrag zur EnFa Die Energiefabrik Gliederung des Kurzreferates: 1.Firmenvorstellung 2.Die Idee 3.Gesetzgebung 4.Technische Umsetzung 5.Praktischer Betrieb 6.Wirtschaftlichkeit
Planungswerkzeuge für solar-aktive Komponenten und Speicher
 Planungswerkzeuge für solar-aktive Komponenten und Speicher Dr.-Ing. G. Valentin Dipl.-Math. B. Gatzka Stralauer Platz 34, D-10243 Berlin Tel.: (0049-30) 58 84 39 10, Fax: (0049-30) 58 84 39 11 info@valentin.de
Planungswerkzeuge für solar-aktive Komponenten und Speicher Dr.-Ing. G. Valentin Dipl.-Math. B. Gatzka Stralauer Platz 34, D-10243 Berlin Tel.: (0049-30) 58 84 39 10, Fax: (0049-30) 58 84 39 11 info@valentin.de
Effizienzsteigerungen durch intelligente Regelungen in der Gebäudetechnik
 Effizienzsteigerungen durch intelligente Regelungen in der Gebäudetechnik Abend der Wirtschaft 215 Hochschule Luzern Technik & Architektur, Horw, 12.11.215 Relevanz effizienter Gebäudetechnik Energieverbrauchsstatistik
Effizienzsteigerungen durch intelligente Regelungen in der Gebäudetechnik Abend der Wirtschaft 215 Hochschule Luzern Technik & Architektur, Horw, 12.11.215 Relevanz effizienter Gebäudetechnik Energieverbrauchsstatistik
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien Lüftung Gebäudefoto (freiwillig) Anlass der
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien Lüftung Gebäudefoto (freiwillig) Anlass der
MuKEn14 I N S I G H T S Energiekennzahlen bei Neubauten
 MuKEn14 I N S I G H T S Energiekennzahlen bei Neubauten Theorie zu Energiebedarf, Grenzwert und Massnahmen Olivier Brenner dipl. Ing. HTL / HLK NDS EnBau FH Diploma of Advanced Studies in Renewable Energy
MuKEn14 I N S I G H T S Energiekennzahlen bei Neubauten Theorie zu Energiebedarf, Grenzwert und Massnahmen Olivier Brenner dipl. Ing. HTL / HLK NDS EnBau FH Diploma of Advanced Studies in Renewable Energy
Klassische Solarthermie oder Photovoltaik mit Wärmepumpe?
 Klassische Solarthermie oder Photovoltaik mit Wärmepumpe? Ing.-Büro solar energie information Axel Horn, D-82054 Sauerlach www.ahornsolar.de Sauerlach, 05. März 2016 Das ist hier die Frage: Löst Photovoltaik
Klassische Solarthermie oder Photovoltaik mit Wärmepumpe? Ing.-Büro solar energie information Axel Horn, D-82054 Sauerlach www.ahornsolar.de Sauerlach, 05. März 2016 Das ist hier die Frage: Löst Photovoltaik
«Effiziente Abluft-Erdsonden- Wärmepumpen für die Gebäudeerneuerung» - Zwischenbericht zum Messprojekt
 «Effiziente Abluft-Erdsonden- Wärmepumpen für die Gebäudeerneuerung» - Zwischenbericht zum Messprojekt Innovationsgruppe Komfortlüftung, 21. April 215 21.4.215 1 Trägerschaft Bundesamt für Energie, BFE
«Effiziente Abluft-Erdsonden- Wärmepumpen für die Gebäudeerneuerung» - Zwischenbericht zum Messprojekt Innovationsgruppe Komfortlüftung, 21. April 215 21.4.215 1 Trägerschaft Bundesamt für Energie, BFE
Warum durch kleinen Veränderungen in der EnEV 2016 bezahlbares Bauen möglichen wäre am Praxisbeispiel einer Quartierssanierung
 Warum durch kleinen Veränderungen in der EnEV 2016 bezahlbares Bauen möglichen wäre am Praxisbeispiel einer Quartierssanierung Taco Holthuizen, GF ezeit Ingenieure Gebäude N, Energiewende durch energieeffiziente
Warum durch kleinen Veränderungen in der EnEV 2016 bezahlbares Bauen möglichen wäre am Praxisbeispiel einer Quartierssanierung Taco Holthuizen, GF ezeit Ingenieure Gebäude N, Energiewende durch energieeffiziente
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
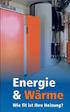 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Mehr Sonnenenergie in Graubünden. Fördermöglichkeiten. Energie-Apéro
 Mehr Sonnenenergie in Graubünden Fördermöglichkeiten Energie-Apéro 20.06.2007 Andrea Lötscher, Gliederung Energie heute Energie morgen Schwerpunkte der Energiepolitik in Graubünden Fördermöglichkeiten
Mehr Sonnenenergie in Graubünden Fördermöglichkeiten Energie-Apéro 20.06.2007 Andrea Lötscher, Gliederung Energie heute Energie morgen Schwerpunkte der Energiepolitik in Graubünden Fördermöglichkeiten
Elektrische Wärmepumpen Einflüsse auf die Effizienz, Ökobilanz, erreichbare Jahresarbeitszahlen
 Elektrische Wärmepumpen Einflüsse auf die Effizienz, Ökobilanz, erreichbare Jahresarbeitszahlen Inhalt Unterschied Jahresarbeitszahl (JAZ) zu COP... 1 Wie ökologisch ist eine Wärmepumpenanlage?... 4 "Nennenswert
Elektrische Wärmepumpen Einflüsse auf die Effizienz, Ökobilanz, erreichbare Jahresarbeitszahlen Inhalt Unterschied Jahresarbeitszahl (JAZ) zu COP... 1 Wie ökologisch ist eine Wärmepumpenanlage?... 4 "Nennenswert
Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet weitgehend ausgereizt
 Ausgangssituation (17) Bestandsaufnahme Erneuerbare Energien Wasserkraft (1) Wasserkraftnutzung an der Glonn 3 Wasserkraftwerke in Betrieb Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet weitgehend ausgereizt
Ausgangssituation (17) Bestandsaufnahme Erneuerbare Energien Wasserkraft (1) Wasserkraftnutzung an der Glonn 3 Wasserkraftwerke in Betrieb Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet weitgehend ausgereizt
Neubau Kindertagesstätte E+ Weingartenstraße Phoenix See Energiekonzept
 Neubau Kindertagesstätte E+ Weingartenstraße Phoenix See Energiekonzept 1 Übersicht Flächenkennwerte BGF 1.089 m² Nutzfläche 935 m² Geschosszahl 2 A/V-Verhältnis 0,45 m -1 Bruttovolumen (Innerhalb der
Neubau Kindertagesstätte E+ Weingartenstraße Phoenix See Energiekonzept 1 Übersicht Flächenkennwerte BGF 1.089 m² Nutzfläche 935 m² Geschosszahl 2 A/V-Verhältnis 0,45 m -1 Bruttovolumen (Innerhalb der
Klimaschutz-Teilkonzept für den Ilzer-Land e.v.
 Klimaschutz-Teilkonzept für den Ilzer-Land e.v. Gemeinde Fürsteneck Dieses Projekt wird gefördert durch: Klimaschutz in eigenen Liegenschaften für ausgewählte kommunale Nichtwohngebäude Erstellt durch:
Klimaschutz-Teilkonzept für den Ilzer-Land e.v. Gemeinde Fürsteneck Dieses Projekt wird gefördert durch: Klimaschutz in eigenen Liegenschaften für ausgewählte kommunale Nichtwohngebäude Erstellt durch:
THERMOS die Innovation. Kompakte Effizienz der modularen Vorwandsysteme für alle Badezimmer. Haustechnik der Zukunft.
 Haustechnik der Zukunft THERMOS die Innovation. Präsentation für: Architektur Rast & Johanson, New York Kompakte Effizienz der modularen Vorwandsysteme für alle Badezimmer. Modulare Vorwandsysteme für
Haustechnik der Zukunft THERMOS die Innovation. Präsentation für: Architektur Rast & Johanson, New York Kompakte Effizienz der modularen Vorwandsysteme für alle Badezimmer. Modulare Vorwandsysteme für
Konzepte und Technologien für den ZeroEmission-Gebäudebetrieb
 Chair of Building Systems Prof. Hansjürg Leibundgut Konzepte und Technologien für den ZeroEmission-Gebäudebetrieb Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut / ITA Institute of Technology in Architecture Faculty of
Chair of Building Systems Prof. Hansjürg Leibundgut Konzepte und Technologien für den ZeroEmission-Gebäudebetrieb Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut / ITA Institute of Technology in Architecture Faculty of
Wärmerückgewinnung aus Abwasser
 Wärmerückgewinnung aus Abwasser Alexander Schitkowsky Leiter Industriedienstleistungen, Prokurist 13.12.2010 Alexander Schitkowsky Wärmerückgewinnung aus Abwasser Einführung Beispiel IKEA Weitere Beispiele
Wärmerückgewinnung aus Abwasser Alexander Schitkowsky Leiter Industriedienstleistungen, Prokurist 13.12.2010 Alexander Schitkowsky Wärmerückgewinnung aus Abwasser Einführung Beispiel IKEA Weitere Beispiele
Solarthermie und/oder Photovoltaik Die Sonne effektiv nutzen für Strom und Warmwasser
 Solarthermie und/oder Photovoltaik Die Sonne effektiv nutzen für Strom und Warmwasser Fachvortrag GETEC 1. März 2015 Thomas Kaltenbach Dipl. Phys. Energie Ing. (FH) Honorarberater vz-bw Freiburg i.br.
Solarthermie und/oder Photovoltaik Die Sonne effektiv nutzen für Strom und Warmwasser Fachvortrag GETEC 1. März 2015 Thomas Kaltenbach Dipl. Phys. Energie Ing. (FH) Honorarberater vz-bw Freiburg i.br.
Bedarfsanalyse und Szenarienentwicklung für Europa: Die Heat Roadmap Europe 2050
 Bedarfsanalyse und Szenarienentwicklung für Europa: Die Heat Roadmap Europe 2050 10.12.2015 Fachveranstaltung Exportchancen für erneuerbare Wärme- und Kältetechnologien Niedrigstenergiegebäude (NZEB) gemäß
Bedarfsanalyse und Szenarienentwicklung für Europa: Die Heat Roadmap Europe 2050 10.12.2015 Fachveranstaltung Exportchancen für erneuerbare Wärme- und Kältetechnologien Niedrigstenergiegebäude (NZEB) gemäß
BHKW trifft PV trifft Stromspeicher. 100% autark? Referent Ulrich Schimpf Viessmann Akademie
 Seite 1 BHKW trifft PV trifft Stromspeicher 100% autark? Referent Ulrich Schimpf Viessmann Akademie Seite 2 100 % autark? Geht das schon? Ist das schon bezahlbar? Seite 3 Die Energiezentrale der Firma
Seite 1 BHKW trifft PV trifft Stromspeicher 100% autark? Referent Ulrich Schimpf Viessmann Akademie Seite 2 100 % autark? Geht das schon? Ist das schon bezahlbar? Seite 3 Die Energiezentrale der Firma
Das Förderprogramm von proklima: Bonus Verbrauchsauswertung. Zielsetzung und Erfahrungen
 Das Förderprogramm von proklima: Bonus Verbrauchsauswertung. Supermarkt als Passivhaus?! Zielsetzung und Erfahrungen Matthias Wohlfahrt Berlin, 15.06.2016 Fachtagung Wirksam sanieren für den Klimaschutz,
Das Förderprogramm von proklima: Bonus Verbrauchsauswertung. Supermarkt als Passivhaus?! Zielsetzung und Erfahrungen Matthias Wohlfahrt Berlin, 15.06.2016 Fachtagung Wirksam sanieren für den Klimaschutz,
Faktenblatt KEV für Photovoltaik-Anlagen
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Sektion Erneuerbare Energien Faktenblatt KEV für Photovoltaik-Anlagen Version 3.1 vom 11. November
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Sektion Erneuerbare Energien Faktenblatt KEV für Photovoltaik-Anlagen Version 3.1 vom 11. November
Wärmepumpe & Photovoltaik und eine gute Kombination
 Wärmepumpe & Photovoltaik und eine gute Kombination 1. Willicher Praxistage Geothermie, 25.09.2015, Willich Leonhard Thien, EnergieAgentur.NRW, Leiter Netzwerk Geothermie NRW Inhalt EnergieAgentur.NRW
Wärmepumpe & Photovoltaik und eine gute Kombination 1. Willicher Praxistage Geothermie, 25.09.2015, Willich Leonhard Thien, EnergieAgentur.NRW, Leiter Netzwerk Geothermie NRW Inhalt EnergieAgentur.NRW
Kombispeicher im Einsatz für Solarwärme & Wärmepumpen. Michel Haller, Robert Haberl, Daniel Philippen
 Kombispeicher im Einsatz für Solarwärme & Wärmepumpen Michel Haller, Robert Haberl, Daniel Philippen Übersicht Vorteile der Kombination Wärmepumpe und Solarwärme Kombispeicher: Vorteile Wärmeverluste vermeiden
Kombispeicher im Einsatz für Solarwärme & Wärmepumpen Michel Haller, Robert Haberl, Daniel Philippen Übersicht Vorteile der Kombination Wärmepumpe und Solarwärme Kombispeicher: Vorteile Wärmeverluste vermeiden
Umweltfreundlich wärmen und kühlen mit einer Wärmepumpe.
 Umweltfreundlich wärmen und kühlen mit einer Wärmepumpe. www.enalpin.com/my-e-nergy Gut für Sie. Gut für die Umwelt. Das ist eine Kombination, die sich rechnet: Luft-/Wasser- bzw. Sole-/Wasser-Wärmepumpen
Umweltfreundlich wärmen und kühlen mit einer Wärmepumpe. www.enalpin.com/my-e-nergy Gut für Sie. Gut für die Umwelt. Das ist eine Kombination, die sich rechnet: Luft-/Wasser- bzw. Sole-/Wasser-Wärmepumpen
Effektive Gebäudelüftungssysteme
 Effektive Gebäudelüftungssysteme Lüftungstechnik kritisch Dipl. Ing Bernd Schwarzfeld BZE ÖKOPLAN Büro für zeitgemäße Energieanwendung Energiedesign Gebäudeanalyse Solare Systeme Trnsys-; CFD-Simulationen
Effektive Gebäudelüftungssysteme Lüftungstechnik kritisch Dipl. Ing Bernd Schwarzfeld BZE ÖKOPLAN Büro für zeitgemäße Energieanwendung Energiedesign Gebäudeanalyse Solare Systeme Trnsys-; CFD-Simulationen
