Editorial. Grußwort des Präsidenten
|
|
|
- Kai Sommer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Goethe-Gesellschaft in Weimar e.v. Ausgabe 2 Oktober Jahrgang Editorial. Grußwort des Präsidenten Inhaltsverzeichnis A lle Blüten müssen vergehn, daß Früchte beglücken; / Blüten und Frucht zugleich gebt ihr, Musen, allein. Mit diesem Distichon aus Goethes Herbst - Zyklus legen die Herausgeber des Newsletter Ihnen eine neue Folge vor, lassen wichtige Ereignisse des Goethe-Jahres Revue passieren. Es ist stets ein Wagnis, die Tage der Hauptversammlung in wenigen Sätzen darstellen zu wollen, ein doppeltes Wagnis auch darum, weil Wichtiges noch aussteht, der Druck der gehaltenen Vorträge, die im nächsten und übernächsten Jahrbuch nachgelesen werden können. Meine Bemerkungen sollen Appetit machen auf die Lektüre des Goethe-Jahrbuchs 2017, das zur Mitte des nächsten Jahres erscheint. Dank zahlreicher Patenschaften, die unserem Periodikum zuteilgeworden sind, können wir ihm eine sorgenfreiere Zukunft geben. Wer die Tagung der Ortsvereinigungen in München miterlebt hat, wird bestätigen, dass die Münchner Goethe-Gesellschaft, auf hundertjähriges Bestehen zurückblickend, eine in jeder Hinsicht maßstabsetzende Tagung organisiert hat. Einen Abglanz davon kann der Bericht von Hans- Joachim Kertscher vermitteln. Selbst das Wetter, nicht immer ein Aktivposten im Voralpenland, hat sich des Ereignisses würdig gezeigt. Die Goethe-Gesellschaft in Bad Harzburg wird am 11. November 70 Jahre erfolgreicher Tätigkeit feiern; großen Anteil daran hatte der langjährige Vorsitzende Dr. Eberhard Völker. Marliese Raschicks zurück- wie vorausschauender Bericht, ungemein lebendig und sympathisch geschrieben, enthält zahlreiche Anregungen für die Arbeit der Ortsvereinigungen; mögen sie davon Gebrauch machen. Gern haben wir auch das kleine Vortragsmanuskript von Julius Fricke aus Bad Harzburg aufgenommen, seiner impulsiven Frische wegen eine schöne Ergänzung. Sehr dankbar bin ich wiederum Andreas Rumler, der einen weiteren Band unserer Schriftenreihe vorstellt und auch seine Erfahrungen als Leser des neuen Goethe-Jahrbuchs weitergibt. Die anderen Goethe-Novitäten ebenfalls Ihrer Aufmerksamkeit empfehlend, bin ich mit herzlichen Grüßen Ihr Jochen Golz Präsident der Goethe-Gesellschaft Titel 1 Editorial Aktuell 2 Stipendienprogramm 2017 Ein neues Projekt, ein neuer Name Seite Drei 3 Ortsvereinigung Bad Harzburg Ausland 5 3. Goethe-Übersetzungswettbewerb in Estland 5 Impressum Feature 6 Zwanzig und Goethe-Gesellschaft Neue Bücher 7 Goethe-Jahrbuch Band 133 (2016) 11 Zur Neuedition des Journals von Tiefurt 13 Stefan Greif: Ich bin nicht G[oethe]. J.G. Herders Italienreise 14 Melanie Feiler: Mein Freund Goethe Veranstaltungen 15 Netzwerk Rückblick 16 Die 85. Hauptversammlung im Überblick 18 Das Symposium junger Goethe- Forscher 19 Bericht von der Jahrestagung der Vorstände der OV Vermischtes 23 Goethe-Gedenktafel am Dessauer Schloss 24 Friedrich Wilhelm Riemers Grab 25 Mori Ôgai und Goethe 26 Goethe in Venedig
2 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 2 Aktuell Werner-Keller-Stipendiaten in Weimar I m Rahmen ihres Stipendienprogramms empfängt die Goethe- Gesellschaft in Weimar in der zweiten Jahreshälfte vier Wissenschaftler. Frau Dr. Aida Sobor (Baku) wird sich Auffassungen von Bilingualität und Bikulturalität am Beispiel von Goethes Werk widmen, die chinesische Germanistin Na Liu, zur Zeit in Göttingen tätig, untersucht Goethes Märchen Der neue Paris im Kontext von Dichtung und Wahrheit, Herr Prof. Gábor Zemplén (Budapest) plant eine Studie zum Thema Steigende Polarität. Die Methode von Goethe und die Strukturierung des Wissens und der chinesische Germanist Hu Dan (Zhejiang) geht der Frage nach, wie Goethes Drama Iphigenie auf Tauris in seinem Heimatland rezipiert worden ist. Ein neues Projekt, ein neuer Name von Jochen Golz D ie Goethe-Gesellschaft, unsere Leser wissen das, hat in jüngerer Zeit große Anstrengungen unternommen, um ihrer umfangreichen Tätigkeit ein solides finanzielles Fundament zu geben. Für das Goethe-Jahrbuch hat sie zu Patenschaften eingeladen; nicht wenige Goethe-Freunde sind dieser Einladung gefolgt, so dass ein Fonds von ca zusammengekommen ist, eine Summe, die uns leicht entspannt in die Zukunft blicken lässt, doch nicht alle Sorgen vertreiben kann, denn jedes Jahrbuch kostet uns ca Doch groß ist unsere Freude darüber, dass mit uns viele Goethe-Freunde an die Zukunft des gedruckten Buches glauben und das Jahrbuch, Spiegelbild der internationalen Goethe-Forschung und dauerhaftes Bindeglied zwischen unseren Mitgliedern, nicht entbehren wollen. Auf Erfolge kann unsere Gesellschaft ebenfalls zurückblicken, wenn es um die Einladung von Studenten und jungen Wissenschaftlern zu unseren Hauptversammlungen geht. Dank größerer Zuwendungen einiger Mitglieder ist uns das immer wieder möglich. Allen unseren Förderern sei auch an dieser Stelle herzlich Dank gesagt. Um aber der Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft eine solide finanzielle Zukunft zu geben, bedarf es neuer Überlegungen. Leben und Werk Goethes bilden nicht nur das Zentrum unserer Arbeit, sondern geben auch dem geistigen Leben der Gegenwart Impulse, ob es sich um Probleme des interreligiösen Diskurses, um Migrationskonflikte oder um die persönliche Orientierung in einer komplizierter werdenden Welt handelt. So liegt der Gedanke nahe, über den Kreis der persönlichen Förderer hinaus insbesondere Firmen anzusprechen, die auf Grund ihres Profils eine Affinität zu Goethe besitzen oder dafür aufgeschlossen werden können, stets nach dem Grundsatz gib, so wird dir gegeben. Dank der Spende eines Freundes unserer Gesellschaft haben wir für ein Jahr eine Mitarbeiterin, Frau Kathleen Hirschnitz aus Halle, stundenweise einstellen können, die sich dank eigener Marketing-Erfahrungen um die Erschließung neuer finanzieller Quellen für unsere Gesellschaft kümmern wird. Hilfe und Unterstützung erhält sie sowohl von der Weimarer Geschäftsstelle wie von Vorstand und Beirat unserer Gesellschaft. Anregungen und Hinweise von Ihrer Seite nimmt Frau Hirschnitz (kathleen_hirschnitz@gmx.de) gern entgegen.
3 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 3 Seite Drei. Was wir Dir noch sagen wollen und dem neuen Vorstand für den Weg... von Marliese Raschick Am 11. November 2017 liegen die Anfänge der Bad Harzburger Ortsvereinigung der Goethe- Gesellschaft in Weimar genau 70 Jahre zurück; denn gleich nach Kriegsende haben sich einige Harzburger Literaturliebhaber daran erinnert, welche Gedichte und Texte ihnen in der Kriegsgefangenschaft geholfen haben. Daraufhin beschlossen sie, sich regelmäßig zu treffen und die Texte von Goethe zu lesen und zu besprechen, der Arzt und Autor Dr. Unger, Zahnarzt Dr. Klußmann, darunter später Rolf Denecke und Ernst Raschick, Lehrer an der Rudolf-Huch-Schule. Langjähriger 1. Vorsitzender wurde der Postamtmann Friedrich Gohlke. Dr. Denecke wurde dann 1964 Vorsitzender und war der Goethe-Gesellschaft bis zu seinem Tode 1999 als Ehrenvorsitzender treu, nicht mehr als Vorsitzender. Diesen Posten hat sein langjähriger Geschäftsführer Dr. Eberhard Völker übernommen, der den Ortsverein mit großem Engagement bis 2009 geleitet hat. Erst eine ernsthafte Krankheit hat seine Tätigkeit beendet. Die Goethe-Gesellschaft Bad Harzburg war 2009 eine feste Gemeinschaft, und ein Mitglied aus dem Vorstand, Frau Ruth Weber, hat sich sofort bereit erklärt, die Geschäfte weiterzuführen mit der Unterstützung von Dieter Rasch, Peter Wasmus und Marliese Raschick, die seit 2008 wieder in Bad Harzburg wohnt. Im Jahre 2012 wurde Rolf Kolb zum 1. Vorsitzenden gewählt, Marliese Raschick, Gerda Arnold und Peter Wasmus standen ihm zur Seite. Im August 2017 löst nun Wilfried Eberts Rolf Kolb ab, der aus Altersgründen zurücktritt. Fünf Jahre hat der Ortsverein unter Rolf Kolb gearbeitet. Wir sind noch nahe daran, aber es lassen sich doch prägnante Änderungen in diesen fünf Jahren feststellen. Das Wichtigste zuerst: Wir sind gewachsen, und zwar auch um jüngere Mitglieder, was für den Fortbestand unserer Ortsvereinigung dringend notwendig ist; denn wir haben auch viele Mitglieder durch Tod verloren, darunter auch Erika Drößler, langjähriges Mitglied auch in der Weimarer Goethe-Gesellschaft. Anna Kuschnarowa stellt Der Kosakenmantel im Schloss vor (2016) Die Schritte, die wir unternommen haben, um neue Mitglieder zu bekommen, hatte schon Eberhard Völker vorbereitet: Wir haben die Abiturpreise (Goethe-Preis für den besten Schüler im Fach Deutsch) ausgedehnt auf alle Gymnasien in Bad Harzburg, und wir haben die Zusammenarbeit mit den Musiklehrern verstärkt. Regelmäßig musizieren begabte Musiker aus den beiden Gymnasien zu Festlichkeiten der Goethe-Gesellschaft. Wir haben auch andere Kollegen aus den Gymnasien in die Vortragsveranstaltungen eingebunden. Das hat uns auch zu einem weiteren Schritt veranlasst. Da wir uns in einem Gastzimmer des Braunschweiger Hofs treffen, war nicht genügend Raum für gemeinsame Veranstaltungen mit einem großen Gymnasium vorhanden. Wir haben uns also mit dem Kulturklub zusammengeschlossen und konnten so im Bündheimer Schloss die erste Großveranstaltung starten mit vielen Schülern, Lehrern und Eltern des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, mit dem Schauspieler Andreas Weißert, der Goethe-Texte vortrug und später Hölderlin-Gedichte, mit der Jugendbuchautorin und Eselsohr- Preisträgerin Anna Kuschnarowa und natürlich auch mit dem Schauspieler Axel Gottschick aus Bad Harzburg. Da diese erste Vernetzung so erfolgreich verlief, haben wir eine weitere Vernetzung mit der Deutsch- Französischen Gesellschaft unternommen und den blinden Pianisten Martin Engel und seinen Vater eingeladen in die Wandelhalle Bad Harzburg zu Chopin und Heine. Unser Mitglied Katja Nordmann- Mörike hat im Cercle der DFG einen vorbereitenden Vortrag zu Heinrich Heine gehalten. Unser letztes Vernetzungsvorhaben mit dem hiesigen Geschichtsverein ist in der Stadtbücherei Bad Harzburg 2016 geboren, als Barbara Kindermann vor zwei vierten Klassen ihren Wilhelm Tell aus der Reihe Weltliteratur für Kinder vorstellte. Die Vorsitzenden des Geschichtsvereins und ich waren so
4 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 4 begeistert, dass wir beschlossen, Barbara Kindermann gemeinsam einzuladen. In ihrer Eigenschaft als Verlagsgründerin sprach sie im Mai 2017 zum Thema Wie man mit Klassikern einen Verlag gründet. A propos Stadtbücherei. Mit dem Leiter Detlev Lisson hat schon Eberhard Völker das Anna Amalia- Kabinett eingerichtet. Jetzt setzen wir schon im fünften Jahr den Sommerleseclub von Bibliothek und Goethe-Gesellschaft fort. Durch Detlev Lisson wurden auch im Café Flora die Bücherschwärmer aus der Taufe gehoben, ein monatlicher Lesekreis, der sich ständig erweitert und in lockerer Form Lese- Erlebnisse von Bücherschwärmern laut werden lässt. Das ist allerdings nicht der einzige Lesekreis im Café Flora. Dort treffen sich auch zehn bis zwölf Mitglieder der Goethe-Gesellschaft jeden Monat. Es werden Bücher gelesen und besprochen, die Gegenstand der Vorträge in der Gesellschaft sind, aber auch literarische Neuerscheinungen. Mitglieder der Goethegesellschaft Bad Harzburg vor der Novalisrose in Oberwiederstedt (2016) Rolf Kolb und Peter Wasmus nach der Hauptversammlung 2014 Schon bei Eberhard Völker wurden auch Ausflüge zu literarischen Stätten unternommen. Seit einiger Zeit machen wir nur noch Tagesausflüge, weil es für unsere Mitglieder weniger anstrengend ist. Gerda Arnold und ich haben diese Tätigkeit von Ruth Weber fortgesetzt, allerdings werden nähere Ziele angesteuert und neuerdings bringen sich auch die Mitglieder des Lesekreises durch Lesungen ein. Was ich Dir noch sagen wollte, lieber Rolf, das ist der Dank für die fünf Jahre angenehmer Zusammenarbeit mit Dir. Du hast uns vier Vorständler zu einer harmonischen Gruppe gemacht und auch Wilfried Eberts gleich integriert. Du hast uns immer sehr viel freie Hand zu allen Aktivitäten gelassen, so auch zu der heutigen an Goethes Geburtstag, die jetzt gleich stattfindet. In diesem Jahr habe ich den Rückweg in die Anfänge der Goethe-Gesellschaft eingeschlagen und einen angehenden Arzt eingeladen, David Rau, einen ehemaligen Goethe-Preisträger, der in Göttingen gerade sein Physikum bestanden hat. Unser Mitglied und erfolgreicher Sänger Julius Fricke singt diesmal kein Goethelied, sondern spricht. Eberhard Völker kann leider nicht mehr sprechen, dafür aber seine Enkelin, Carla Posch. Sonja Weber und Detlef Linke muss ich nicht vorstellen, jeder kennt sie aus ihren Tätigkeiten und Publikationen. Am Schluss des Abends stehen wieder Bilder: Der Student der Medienkommunikation Luca Weber zeigt seine Harzfotografien unter dem Titel: Herr Weber 1777 und 2017 im Harz. Wir danken Dir, lieber Rolf, mit diesem Artikel, den Du demnächst auch im Newsletter der Goethe- Gesellschaft in Weimar lesen kannst. Wir danken Dir auch im Namen der Ortsvereinigung Bad Harzburg. Wir danken auch Eberhard Völker für seine Vorarbeit zu diesem Artikel und gratulieren ihm zu seinem Geburtstag. Dir, lieber Wilfried, wünschen wir einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dir.
5 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 5 Ausland. Ergebnisse des dritten Goethe-Übersetzungswettbewerbs in Estland von Kairit Kaur I n Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturinstitut Tartu veranstaltete die Estnische Goethe- Gesellschaft schon zum dritten Mal einen Übersetzungswettbewerb. Während am ersten Wettbewerb 2012 nur Schüler teilnehmen konnten, sind seit dem zweiten Mal (2014) auch Studenten dabei. Wurden zunächst ausschließlich Auszüge aus Goethes Werk übersetzt, so konzentrierte sich der zweite Wettbewerb auf Texte deutschbaltischer Autoren aus der Goethezeit (Carl Gustav Jochmann, August von Kotzebue, Elisa von der Recke). Auch diesmal wurden deutschbaltische Autoren übersetzt, allerdings aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Insgesamt sind acht Beiträge eingegangen (sechs von Studenten und zwei von Schülern). Die Ergebnisse wurden am 25. März 2017 im Goethe-Zimmer des Deutschen Kulturinstituts Tartu bekanntgegeben. Dieses Jahr konnte der erste Preis in der studentischen Sparte gleich zweimal vergeben werden. Als Gewinner wurden Silva Lilleorg (Universität Tartu, Doktorandin der Zell- und Molekularbiologie), die schon 2014 den Wettbewerb gewonnen hatte, und Liis Kägu (Universität Tartu, Masterstudentin der Übersetzung) ausgerufen. Beide hatten einen Auszug aus der Erzählung Jaschka und Janne (1965) von Siegfried von Vegesack übersetzt, die Liebesgeschichte eines deutschen Majoratsherrn in spe, in Wahrheit eines ewigen Studenten, und einer estnischen Schneiderin, die in der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts in der Universitätsstadt Tartu (Dorpat) spielt. Die Jury (Vahur Aabrams, Tiina-Erika Friedenthal, Liina Lukas, Ülo Matjus, Tiina Paesalu und Liina Sumberg) hob auch die Übersetzungen von Marin Jänes (Universität Tallinn, Lehramtstudentin Deutsch) und Laura Lahesoo (Technische Universität München, Informatik, B.Sc.) hervor. Sie hatten einen Auszug aus dem Essay Neues Menschentum (1949) von Manfred Kyber übersetzt, der von dem rechten und unangebrachten Gebrauch der Technik handelte. Die Schülerinnen, die eine kleine Auswahl humoristischer Texte aus der deutschbaltischen mündlichen Erzählungstradition (sogenannte Pratchen) übersetzten, erhielten als Trostpreis eine kommentierte Ausgabe des Faust in der Übersetzung von Ants Oras, einem renommierten estnischen Literaturwissenschafler. Als Prämie erhielten Liis Kägu und Marin Jänes eine Reise zur Hauptversammlung der Goethe- Gesellschaft in Weimar, die dieses Jahr vom 7. bis 10. Juni stattgefunden hat und dem Thema Globalisierung als Chance? Goethe und die Weltliteratur gewidmet war. Die besten Beiträge werden in der estnischen Kulturzeitschrift Akadeemia erscheinen. Impressum. Herausgeber: Presserechtlich verantwortlich: Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. Tel.: Dr. Jochen Golz und Geschäftsstelle Fax: Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher Burgplatz 4 newsletter@goethe-gesellschaft.de c/o Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V Weimar Internet: Gestaltung: Steffen Heinze Der Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. erscheint zwei- bis dreimal jährlich. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung oder Garantie übernommen. Gleiches gilt auch für die eigene Website und die Websites Dritter, deren Inhalte per Link erreichbar sind. Inhalt und Struktur des Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der Goethe- Gesellschaft in Weimar e.v. und muss eine entsprechende Quellenangabe enthalten.
6 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 6 Feature. Zwanzig und Goethe-Gesellschaft Ein kleines Resümee von Julius Fricke Liebe Mitglieder, liebe Gäste der Goethe- Gesellschaft, ich freue mich, die Vorträge anlässlich Goethes Geburtstags eröffnen zu dürfen. Kurz zu meiner Person: Mein Name ist Julius Fricke, ich bin 20 Jahre alt und seit Anfang 2016 Mitglied der Goethe- Gesellschaft Bad Harzburg. Wie kam es zur Mitgliedschaft? Im Dezember 2015 erreichte mich eine nette Weihnachtsgrußkarte von Marliese mit einem beigefügten Programm der Goethe-Gesellschaft für das nächste Halbjahr. Sie könne sich vorstellen, dass mir eine Mitgliedschaft gefallen würde. Zunächst habe ich mir die Berührungspunkte, die ich bis dato mit Goethe hatte, überlegt. Hermann und Dorothea gelesen, im Deutschkurs Faust I und Faust II analysiert und interpretiert und zahlreiche Vertonungen von Goethe-Gedichten gesungen. Beim Studieren des Programms merkte ich schnell, dass die reflexartige Überlegung zu kurz griff. Die Goethe-Gesellschaft hat wesentlich mehr zu bieten. Auch wenn Themen rund um Goethe einen großen Raum einnehmen, gleicht das Programm jedes Mal aufs Neue einem bunten Blumenstrauß, gepflückt aus den unterschiedlichsten literarischen Themen. Die Vorträge befinden sich auf einem hohen Niveau und bieten die unterschiedlichsten Blickwinkel, die man meist zuvor nicht zur Kenntnis zu nehmen imstande war. Einen besonderen Höhepunkt bot für mich Herr Dr. Stein mit seinem Vortrag zum Schimmelreiter. Schon während des Vortrages ergänzten seine Interpretationsansätze meine Gedanken und bei der erneuten Lektüre hoben sie das Gelesene auf eine neue Ebene. Das Verfügbarmachen von Expertenwissen für Literaturlaien wie mich ist eine wesentliche Kompetenz des Vereins, die ich sehr zu schätzen weiß. Auch wenn ich des Öfteren gefragt werde, ob die Goethe-Gesellschaft und die Vortragsthemen nicht überholt seien, kann ich nach eineinhalbjähriger Mitgliedschaft diese Frage mit voller Überzeugung verneinen, obgleich auch mich die Parallelen zu meinem Alltag, die manche Referenten herstellen, immer wieder erstaunen lassen. Die Flüchtlingsthematik aus Goethes Hermann und Dorothea ist aktuell. Die Familienkonstellation der Wirtsfamilie lässt sich, psychoanalytisch aufgearbeitet, auf so manche heutige Familie beziehen. Auch in meinem Bekanntenkreis. Darüber hinaus werden auch Vorträge angeboten, die sich nicht primär mit literarischen Fragestellungen beschäftigen. Das Gymnasium am Schloss in Wolfenbüttel ist mir wohlbekannt, nicht aber, dass es lange Zeit wichtiges Zentrum der modernen Pädagogik war. Hierzu hielt Gaby Drews Anfang des Jahres einen interessanten Vortrag. Und als die Garderobe bei meinem Wertungsspiel von Jugend musiziert in der Landesmusikakademie Wolfenbüttel im Anna-Vorwerk-Saal war, freute ich mich, etwas über die historischen Hintergründe zu wissen. Die Goethe-Gesellschaft ist nicht nur aus fachlicher, sondern auch aus zwischenmenschlicher Sicht zu empfehlen. Ich bin herzlich in den Verein aufgenommen worden. Bei jeder Veranstaltung finde ich nette Gesprächspartner, mit denen auch Unterhaltungen über die Referatsthemen hinaus möglich sind. Abschließend fasse ich zusammen, dass die Goethe-Gesellschaft Bad Harzburg viel zu bieten hat. Für einen geringen Jahresbeitrag gibt es erstklassige, abwechslungsreiche literarische Vorträge von sehr guten Referenten. Die Aufgabe für die Zukunft muss es sein, diese Qualitäten verstärkt nach außen hin zu kommunizieren. Dann werden wir sicherlich noch mehr Mitglieder gewinnen können. Nun freue ich mich auf die nächsten Beiträge und auf das kommende Halbjahr, dessen Höhepunkt die Jubiläumsveranstaltung anlässlich 70 Jahre Goethe-Gesellschaft im November sein wird. Vielen Dank.
7 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 7 Neue Bücher. Erste Lektüre-Eindrücke: Das neue Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft Band 133 von 2016 von Andreas Rumler G leich der erste Satz klingt wie ein Programm des neuen Jahrbuchs, wenn er auch als Frage formuliert ist: Vielleicht wächst Goethe in Zeiten wie diesen eine neue Orientierungsfunktion zu. (S. 11) Damit weisen die Herausgeber auf die Aktualität seines Denkens hin und vor allem aber auch darauf, dass die Beschäftigung mit Werk und Vita eines vor fast 200 Jahren gestorbenen Schriftstellers nicht nur für ein akademisches Fachpublikum von Interesse sein muss. Seine Gedanken und Anregungen vermögen noch immer Anstöße zu geben oder werden von heutigen Künstlern aufgegriffen. Das zeigt die produktive Rezeption des Faust -Stoffs als Comic oder als moderner Roman wie in Thea Dorns Die Unglückseligen ebenso wie Ferdinand Wülfings Studie Die Farben und der Goldene Schnitt : sie nimmt Ideen der Farbenlehre auf, setzt sich mit ihnen auseinander und entwickelt sie weiter. Und das gilt weltweit, wie die hier vorgelegten Texte und ihre Autoren belegen ganz im Sinn Goethes, der als Kosmopolit an einem internationalen Dialog der Künste und Wissenschaften interessiert war. Nachdem im letzten Band (132) die Hauptversammlung 2015 im Zentrum stand, werden hier im Jahrgang 2016 einige Beiträge des damaligen Symposiums junger Goetheforscher nachgereicht. Dabei zeigt sich eindrucksvoll, dass sie einerseits klassische Fragestellungen neu beleuchten und zugleich modernere Ansätze entwickeln. Martin Schneider untersucht am Beispiel der Lehrjahre Wilhelm Meisters, der Wahlverwandtschaften sowie der Novelle die Theatrale Kollektivbildung in Goethes Prosa (S. 15 ff.) und führt aus, dass es Goethe in diesen Texten mit erzählerischen Mitteln gelinge, theatrale Unmittelbarkeit zu inszenieren, wie Teilnehmer einer Trauergesellschaft diese Feier als ästhetische Gemeinschaft erleben, deren Ende sie als Verlust begreifen. Ähnlich vergleichend geht Adrian Robanus vor, wenn er verschiedene Texte Goethes analysiert: Vernunftähnliches oder unendliche Kluft? Die anthropologische Differenz in Dichtung und Wahrheit, Satyros, Metamorphose der Tiere und Die Wahlverwandtschaften (S. 23 ff.). Bei der Untersuchung der Frage, wie Goethe die charakteristischen Merkmale gestaltet, die einen Menschen vom Tier unterscheiden, erkennt er verschiedenste darstellungstechnische Strategien [ ]: Differenzstatuierung in Dichtung und Wahrheit, groteske Grenzauflösung in Satyros, Harmonisierung in Metamorphose der Tiere und Aporetik in Die Wahlverwandtschaften. (S. 30) Wie Goethe einer Bitte Cottas nachkommt, kommentierende Erläuterungen zu einer Reihe von Kupferstichen für dessen Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1801 anzufertigen und mit seiner Erzählung zugleich ein damals gängiges literarisches Genre die vor allem von Lichtenberg gern veröffentlichten Erklärungen von bildlichen Darstellungen kritisch hinterfragt, zeigt Anna Christina Schütz: Vom Kommentar zur Bildkritik. Goethes Erzählung Die guten Frauen als Gegenbilder der bösen Weiber (S. 31 ff.). Goethe liefert nichts weniger als eine medientheoretische Abhandlung in Gestalt eines literarischen Diskurses über den Sinn und Wert reflektierender Bildbetrachtungen. Und Philipp Restetzki zeigt in seinem Referat: der Schlüssel zu Fausts Rettung. Streben und Liebe als spinozistische Motive in den Faust -Szenen Prolog im Himmel und Bergschluchten (S. 40 ff.), dass Goethe das erkenntnistheoretisch-ethische System Spinozas motivisch funktionalisierte, um Fausts Erlösung zu rechtfertigen. Wie vielfältig und letztlich erkenntnisoffen Goethes wissenschaftliche Interessen waren, wird bei der Lektüre von Oliver Grills Aufsatz: Wenn so viele Wesen durcheinander arbeiten. Widriges Wetter und schwankende Gründe in Goethes Meteorologie (S. 49 ff.) deutlich, wenn Oliver Grill hervorhebt: Das eigentlich Bemerkenswerte am Versuch einer Witterungslehre ist jedoch, dass er die eigene Herstellung von Gewissheit permanent mit selbstkritischen Signalen und Reflexionen unterläuft. (S. 54) Die vier Abhandlungen (S. 57 ff.) dieses Bandes verbindet, dass sie sich jeweils auf Arbeiten und Werke beziehen, die Goethe sein Leben lang beschäftigt haben, die er des Öfteren neu aufgriff und in
8 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 8 veränderter Form weiterverfolgte, etwa unter dem Eindruck wichtiger politischer Ereignisse. Immerhin erlebte Goethe die Entwicklung vom Ancien Régime über die Revolutionszeit bis zur nachrevolutionären Moderne (S.91). Das habe inhaltliche und erzähltechnische Konsequenzen nach sich gezogen. Beim Wilhelm Meister-Komplex handele es sich, so Klaus-Detlef Müller, um vier in ihrer Zielsetzung und ihren Perspektiven deutlich verschiedene Romane oder Romanfragmente, die ein groß angelegtes Erziehungs- und Bildungskonzept unter je anderen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen und mit unterschiedlichen Zielen thematisieren. So hätten sich das Profil des Protagonisten und seine Lebensperspektiven, die Figurenkonstellation und die Erzählweise nachhaltig verändert, weil der realitätsnahe Romankomplex auf den gesellschaftlichen Wandel und seine immer neuen Herausforderungen reagieren musste (S. 57). Durch die Aufnahme der Sammlungen Aus Makariens Archiv und Betrachtungen im Sinne der Wanderer erreiche Goethe eine komplementäre Erweiterung der Narration (S. 89). Durch dieses Integrationsverfahren verändere sich die Struktur der Wanderjahre zu einem Archivroman, wie es bereits Volker Neuhaus gezeigt habe. Und Klaus-Detlef Müller fährt fort: Damit überschreitet der Roman die Grenzen seiner Erzählung, indem er zugleich den Leser zur Koautorschaft [ ] auffordert. (S. 90) Auch Johannes John hat sich des Wilhelm Meister- Komplexes angenommen ( Goethes Wanderjahre und das Theater ;S. 92 ff.) und führt detailliert aus, wie sich Goethes Vorstellungen über die Möglichkeiten und Aufgaben des Theaters im Lauf seiner langen Arbeit an dem Romanprojekt entwickelt haben. Wer aus dem Garten hinter Goethes Haus am Frauenplan auf die Fenster des Arbeitszimmers blickt, bemerkt eine kleine Öffnung in einem der Fensterläden. Dabei handelt es sich nicht um einen Schaden, etwa durch ein Astloch, sondern um eine im Auftrag Goethes angebrachte Blendenöffnung ein Zeugnis der von ihm dort durchgeführten Experimente im Rahmen seiner Forschungen zur Farbenlehre. Olaf L. Müller hat sich die räumlichen Verhältnisse genau angesehen und versucht, den genauen Ablauf am 25. Februar 1801 zu rekonstruieren: Optische Experimente in Goethes Arbeitszimmer. Mutmaßungen über die apparative Ausstattung und deren räumliche Anordnung. (S. 112 ff.) Anschaulich beschreibt er, wie Goethe dabei vorgegangen sein könnte, und zwar gemeinsam mit einem Gast, dem Physiker Johann Wilhelm Ritter bekannt auch als romantischer Physiker (S. 240), den Thea Dorn zu einem ihrer Protagonisten des Romans Die Unglückseligen gemacht hat, dessen Besprechung den Rezensions-Teil des Jahrbuchs abschließt. Nicht wenigen Goethe-Freunden mag es als Sakrileg erscheinen, dass Goethes Faust neuerdings auch als Graphic Novel zu haben ist, zwar nicht mit direktem Hinweis auf die klassische Vorlage, aber immerhin mit dem Untertitel Der Tragödie erster Teil. Michael Veeh hat sich der Sache wissenschaftlich angenommen ( Teufelspakt und Gretchenfrage als Mittel der Gegenwartsdiagnose. Goethes Faust I in Flix Comic-Neuinszenierung ; S. 126 ff.) und gelangt dabei zu einem durchaus positiven Urteil: Es handele sich weniger um eine Faust -Parodie, sondern eher um eine satirische Kontrafaktur, die den Dramentext ironisierend aufgreift, um davon ausgehend eigene Gegenwartsdiagnosen zu stellen, und komme womöglich Goethes eigener Produktionsästhetik wesentlich näher (S. 138), als auf den ersten Blick zu vermuten sei. Denn Goethe habe schließlich auch auf ältere Vorlagen zurückgegriffen und sie aktualisiert. Wie sich die (nicht nur Goethe-) Philologie im Lauf der Zeit wandeln und den aktuellen Anforderungen gerecht werden kann, wie sie sich generell weiterentwickelt, belegen die den Abhandlungen folgenden zwei Beiträge der neuen Rubrik Goethe philologisch (S. 141 ff). Katharina Mommsen berichtet über die Entstehung ihres gemeinsam mit ihrem Mann Momme Mommsen in den frühen 1950er Jahren begonnenen Großprojekts Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten. Man kann dem Mut, sich an eine derart ambitionierte Mammutaufgabe zu wagen, kaum genug Respekt zollen. Etwa zwölf Bände sind geplant, die die Genese von 1275 Werken in alphabetischer Folge darstellen sollen, von den Artikeln sind 511 bereits publiziert. Und nach der Veröffentlichung der übrigen 764 Artikel sind analoge Dokumentierungen für die lyrischen Dichtungen, Amtlichen Schriften, Prosasprüche und bis dato unbestimmten Paralipomena geplant (S. 141). Dass gerade bei einem Autor wie Goethe, der an manchen Texten über Jahre arbeitete, eine Erforschung der Chronologie und Entstehungsmodalitäten jedes Werks extrem schwer zu bewältigen ist, nicht zuletzt wegen des gewaltigen Umfangs der Archivalien, liegt nahe. Dieses monumentale Standardwerk dürfte noch einer ganzen Reihe von Generationen von Goethe-Forschern und -Liebhabern wichtige Basisinformationen liefern.
9 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 9 Auch wenn es Traditionalisten befremden mag, Liebhabern bibliophiler Kostbarkeiten leicht abwegig vorkommen dürfte: Mit der Digitalisierung des Faust ist den Herausgebern Anne Bohnenkamp, Silke Henke, Fotis Jannidis, Gerrit Brüning, Katrin Henzel, Dietmar Pravida, Thorsten Vitt und Moritz Wissenbach ein Quantensprung in der modernen, zeitgenössischen Klassik-Edition gelungen. Darüber berichten sie ausführlich und erläutern die Struktur und Zugriffsmöglichkeiten dank moderner technischer Möglichkeiten. Ohne die Leistungen von Herausgebern bekannter und bewährter analoger wie das so schön neudeutsch heißt Ausgaben literarischer Texte geringschätzig beurteilen zu wollen: Für einen raschen und gezielten Zugriff auf Texte, zum Vergleich mehrerer Lesarten und um einen gut handhabbaren Anmerkungsapparat zur Verfügung zu haben, bietet sich die digitale Form an. Diese digitale Faust -Edition dürfte der Forschung und auch interessierten Lesern völlig neue Perspektiven eröffnen, könnte ihnen neue Impulse geben, weil sich mit dieser Darstellung neue Kombinationen, Querverweise, Assoziationen anbieten werden, die bislang vielleicht nicht so in den Blick geraten sind. Die Herausgeber begreifen ihre Leistung aber nicht nur als eine moderne, wegweisende und für die Zukunft unverzichtbare Goethe-Edition, sondern auch als ein Modell für künftige Ausgaben: Hier soll erprobt werden, wie es gelingen kann, im neuen Medium die Komplexität der Informationsdichte moderner historisch-kritischer Werkausgaben mit einer deutlich vereinfachten, möglichst intuitiven Zugänglichkeit und flexibleren Handhabung zu kombinieren. (S. 162) Goethes Interesse an Mineralien führte dazu, dass er ausgedehnte Briefwechsel mit Fachgelehrten der damals bekannten Welt unterhielt, mit ihnen Informationen und auch Exponate austauschte. In seiner sorgfältig erläuterten Dokumentation Goethe und Karl Ludwig Giesecke eine mineralogische Korrespondenz (S. 163 ff.) zeigt Gerd Ibler, dass Goethe auch hier, wie immer bei seinen Projekten, in größeren Zusammenhängen dachte und Giesecke bat, ihm auch Barometerstände aus Dublin mitzuteilen. Gerd Ibler kommt deshalb auch in seinem Resümee zu dem Schluss, dass ihre Korrespondenz im Rahmen seiner [Goethes] vielfältigen naturwissenschaftlichen Tätigkeiten einen höchst interessanten Mosaikstein (S. 168) darstelle. Mitunter kann übrigens die Frage, wer etwas nicht gesagt hat, fast ebenso spannend sein wie die Recherche nach dem Urheber eines Zitats. Das legt jedenfalls die Lektüre von Anton Karl Mallys Aufsatz nahe: Irrt hier jemand, so irrt Goethe selbst. Die mögliche Urfassung der Redewendung Hier irrt Goethe, in dem Anton Karl Mally eine recht amüsante Kontroverse zweier Germanisten des 19. Jahrhunderts schildert. Zu den wichtigsten Service-Leistungen des Jahrbuchs zählen natürlich auch in dieser Ausgabe wieder die Rezensionen, geben sie doch einen guten Überblick der aktuellen Literatur, die sich im weitesten Sinn auf Goethe bezieht. Gleich zu Beginn fallen zwei britische Neuerscheinungen auf: Goethe. A Very Short Introduction von Ritchie Robertson und die Auswahl The Essential Goethe von Matthew Bell. Offenbar besteht auf der Insel, trotz aller Brexit-Stimmung, noch ein reges Interesse an dem Weimarer Klassiker. Das gilt auch für Frankreich, wo jetzt mit La vocation théâtrale de Wilhelm Meister, übersetzt von Florence Halévy, eine wie die Rezensentin Sylvie Le Moël urteilt musterhafte kritische Ausgabe [ ] einen wertvollen Beitrag zur Vermittlung des Goethe schen Œuvre (S. 192) leiste. L Italia di Goethe heißt die Sammlung italienischer Aufsätze, die Marino Freschi 2016 in Rom herausgegeben hat, 200 Jahre nach dem ersten Erscheinen der Italienischen Reise. Auch sie zeigt das ungebrochene Interesse der Italiener an Goethe. Das sei nicht verwunderlich, meint der Rezensent Albert Meier, prägt das deutsche Fremdbild vom Zitronenland die italienische Selbstwahrnehmung doch bis heute, wie sehr die mediterranen Erfahrungen Goethes in ihrer literarischen Konstruiertheit auch durchschaut sein mögen (S. 216). Sigrid Damms Sommerregen der Liebe. Goethe und Frau von Stein sei, so Sabine Doering, still und klug komponiert und werde ihrem Publikum trotz weniger punktuellen Einwände nicht den Lesegenuss schmälern (S. 214). Wie sehr auch der Naturforscher Goethe bis in unsere Tage Anstöße zu geben vermag beweist schließlich die umfangreiche Untersuchung Die Farben und der Goldene Schnitt des Malers und Farbwissenschaftlers Ferdinand Wülfing, der von Goethes Farbenkreis ausgeht und ihn um zusätzliche, stärker nuancierte Schattierungen erweiterte. Ferdinand Wülfings umfangreiche Arbeit, in die er Jahrzehnte seines Lebens und seiner Erfahrungen als Künstler investiert hat, dürfte sich zu einem Standardwerk für Maler und Kunsterzieher entwickeln es basiert auf Ideen Goethes, der seiner Farbenlehre bekanntlich einen besonderen Rang innerhalb seines vielfältigen Werks einräumte. Es ist die Darstellung, Begründung und Absicherung eines auf Goethes Anregung zurückgehenden und auf dem
10 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 10 Goldenen Schnitt beruhenden neuen Farbensystems, das alle an ein modernes Farbensystem zu stellenden Anforderungen erfüllt (S. 231), resümiert Thomas Nickol in seiner Besprechung. Nicht zuletzt die zahlreichen, sorgfältig argumentierenden und spannend zu lesenden Rezensionen dokumentieren, in welchen Regionen der Welt man Goethe bis heute in der Tat eine Orientierungsfunktion zubilligt. Bei der Lektüre dieses Bandes hat man das erfreuliche Gefühl, eingeladen zu sein, an einem Dialog teilnehmen zu dürfen oder besser: einem vielstimmigen Diskurs lauschen zu können, der über Kontinente und durch Jahrzehnte produktiv geführt wurde und stets aufs Neue Einsichten und Anregungen zu vermitteln vermag. Für den jetzt vorliegenden 133. Band des Goethe-Jahrbuchs von 2016 gilt wieder, dass Goethe darin in seinen vielfältigen Interessen, in allen Facetten seines umfangreichen Werks und Wirkens sichtbar wird: als Naturwissenschaftler in Sachen Geologie, Meteorologie und Farbenkunde und natürlich last, but not least als Dichter. Goethe-Jahrbuch 133, 2016 Herausgegeben von Frieder von Ammon, Jochen Golz und Edith Zehm Reihe: Goethe-Jahrbuch (i. A. des Vorstands der Goethe-Gesellschaft hrsg. von Jochen Golz und Edith Zehm); Bd. 133, 2016 Göttingen (Wallstein Verlag) S., 28, z.t. farb., Abb., geb., 17 x 24 ISBN: Preis: 29,95
11 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 11 Weimarer Klassik in nuce zur Neuedition des Journals von Tiefurt von Andreas Rumler Allein die Titel lassen aufhorchen: Scharade, Manifest der Langenweile oder eine Folge merkwürdiger Würdigungen: Grabschrifft auf Juncker Hans, Glasers Grabschrifft sowie Noch eine Grabschrifft auf ebendenselben. Es handelt sich um Überschriften einzelner Beiträge des kuriosesten Blättchens, das je in Deutschland publiziert wurde: Gemeint ist Das Journal von Tiefurt. Nach dem Vorbild der damals beliebten französischen Tageszeitung Journal de Paris hatten die Herzogin Anna Amalia und Mitglieder ihres Weimarer Hofstaats eine launige Parodie produziert, die sie in ihrem Kreis intern veröffentlichten. Mit Scharaden sind Rätsel gemeint. Das Manifest ironisierte höfische Etikette. Und fiktive Grabinschriften waren damals nicht nur in Adelskreisen ein beliebtes Genre, um menschliches Fehlverhalten zu karikieren, wie den adelsstolzen Juncker Hans. Bei Johann Elias Glaser allerdings verhielt sich die Sache anders. Der lebte bis zu seinem Tod 1781 als wohlhabender Kaufmann im thüringischen Stützerbach, in dessen Haus die Hofgesellschaft öfters einkehrte und ihr Mütchen kühlte. Mal beschrifteten sie im Lager seine Waren neu, dann trugen sie ihm Fässer vors Haus und ließen sie den Berg hinabkollern. In Goethes Tagebuch: Glasern sündlich geschunden. Und nun diente er ihnen posthum ein letztes Mal in zwei Gedichtchen zum Spott. Wohl nie hat ein kleines, bescheidenes Periodikum, handschriftlich in einer Auflage von nur wenigen wahrscheinlich maximal 11 Exemplaren kopiert, als geistvolle Unterhaltung spielerischer Art innerhalb eines sehr eng begrenzten Teilnehmerkreises und zunächst nur für seine Mitglieder bestimmt, so viel Nachhall und damit doch noch Aufmerksamkeit gefunden wie das legendäre Journal von Tiefurt. Es erschien vom August 1781 bis zur Mitte des Jahres 1784 in nur 49 Stücken, wie man die einzelnen Ausgaben nannte, von denen nur 47 überliefert sind. Trotzdem hat dies Wochenblatt zum Scherze angefangen (im Lauf der Zeit erschienen die Ausgaben seltener) Germanisten und Literatur-Liebhaber seit über 200 Jahren beschäftigt wie nur wenige andere ähnliche Veröffentlichungen für Insider. Das lag am illustren Kreis der Journalisten, wie sich die Autoren und Empfänger selbst nannten, und dem idyllischen Erscheinungsort. Denn als Scherz hatte Goethe das Blättchen bezeichnet, er gehörte diesem Kreis an und neben ihm Wieland, Herder, Knebel sowie die Herzogin Anna Amalia, ihre Gesellschafterin und Hofdame Louise von Göchhausen und ihre beiden Kammerherren: von Einsiedel und von Seckendorff. Dieses Team produzierte und redigierte das Journal. Als nicht standesgemäß galt, dass Vertreter des höheren Adels als Autoren in Erscheinung traten, im privaten Kreis und geschützt durch die Anonymität hatten sie sich hier ein Medium geschaffen. Und weil die Artikel anonym erschienen, galt es, die Verfasser zu enttarnen, das Rätsel ihrer jeweiligen Urheberschaft zu lösen. Die Hefte wurden nur weitergereicht an Vertraute: an Goethes Mutter oder Frau von Stein. Das kleine Schlösschen Tiefurt, eigentlich eher ein komfortables Landhaus als ein Fürstensitz, lag inmitten einer romantischen Ilm-Schleife unweit von Weimar. Nah genug, dass Wanderer es bequem erreichen konnten und doch außerhalb der Sichtweite der Residenz, damit man sich hier, unbelastet von Zwängen des Protokolls, einem freieren Landleben und den schönen Künsten hingeben konnte. Zum englischen Landschaftsgarten wurde das Areal umgestaltet. Ein Musentempel erinnerte an Kalliope und im Lohhölzchen standen die Büsten von»weimars drei Genien«: von Goethe, Herder und Wieland. Hoch auf dem Steilufer oberhalb der Ilm erbaute man eine Grotte zu Ehren des Römers Vergil, er hatte das Landleben verherrlicht. Anna Amalia konnte hier ganz ungestört ihre musischen Neigungen pflegen und Gäste empfangen: Musikdarbietungen und Aufführungen des Liebhabertheaters gehörten ebenso zum Repertoire wie gesellige Runden, in denen man las und sich vorlas, zeichnete und musizierte. Anna Amalias Verdienst war es, dass Weimar als der klassische Musenhof in die deutsche Kulturgeschichte einging. Sie musizierte selbst, befasste sich mit Musiktheorie, setzte Lieder in Noten und vertonte Goethes Singspiel Erwin und Elmire. An Sprachen interessiert, lernte sie Griechisch, Englisch und Italienisch, Französisch-Kenntnisse waren in Adelskreisen ohnehin üblich und außerdem nahm sie Zeichenunterricht. Was die Bedeutung des von ihr selbst mit eher charmantem Understatement als kleiner Spaß bezeichneten Tiefurter Journals ausmacht, ist, dass sich hier, wie in einem Brennglas oder dem Zeitraffer nur weniger Jahre, beobachten lässt, welche künstlerischen und kulturellen Aktivitäten Anna
12 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 12 Amalia und ihr Kreis entwickelten. In nuce, lässt sich hier zu Beginn von Goethes Tätigkeit in Weimar erkennen, formte sich im Programm des Journals von Tiefurt, was sich im Lauf der folgenden Jahrzehnte als Weimarer Klassik herausbilden sollte. Hier erschienen Erzählungen und Fabeln, heitere Possen und philosophische Abhandlungen, es wurden neue Bücher oder Theateraufführungen wie auf der Liebhaberbühne anlässlich von Goethes Geburtstag besprochen sowie fremdsprachige Texte und die Literatur griechischer oder römischer Klassiker übersetzt. Goethes lyrischer Nachruf Auf Miedings Tod wurde hier erstmals in sehr bescheidener Umgebung veröffentlicht und ebenso seine Ode (später Meine Göttin ) sowie Edel sey der Mensch/ Hülfreich und gut. Zwei wichtige, zentrale Themenkomplexe, derer sich das Journal annahm, waren die Auseinandersetzung mit der Antike und das Leben in und mit der Natur, ein empfindsamer Umgang mit der ländlichen Idylle letztlich ein Kontrastentwurf als Alternative zum streng reglementierten Hofzeremoniell. Und weil die Autoren anonym bleiben, liest sich die Abfolge ihrer Beiträge wie ein Gesamtkunstwerk, als programmatische Zielvorgabe: zurück zur (freilich idealisierten) Natur mit den Mitteln der Kunst. Anna Amalias berühmte und von Georg Melchior Kraus im Bild fixierte Tafelrunde konnte hier zwanglos die Naturbühne des Ilmbogens bespielen. Das Verdienst dieser Neu-Edition des kompletten Journals von Tiefurt (eine frühe Ausgabe von 1892 ist auch antiquarisch nur schwer zu bekommen) liegt darin, dass sie üppig kommentiert und mit erläuternden Anmerkungen versehen ist. Nach über 200 Jahren sind manche Ausdrücke und Wendungen nicht mehr geläufig oder haben eine andere Bedeutung gewonnen, viele der erwähnten Autoren und Begebenheiten sind längst vergessen und auch ist unsere Kenntnis der Antike und ihrer Schriften bei weitem nicht mehr so umfangreich wie offenbar zu Goethes Zeit. Und schließlich waren die Texte für einen miteinander vertrauten Zirkel zur Selbstverständigung bestimmt darauf konnten die Autoren vertrauen. Deshalb sind viele Anspielungen für uns Nachgeborene schlicht nicht mehr verständlich. Dank dieses umfassenden Erläuterungsapparates werden wir aber fast in die Lage versetzt, mit dem Blick des damaligen Zeitgenossen teilzunehmen an dem illustren und gebildeten Kreis, der hier geistvoll miteinander scherzte, als Leser darf man sich eingeladen fühlen, an Anna Amalias Tafelrunde dem gelehrten und humorvollen Diskurs zu folgen.»es ward als ein Wochenblatt zum Scherze angefangen«das Journal von Tiefurt Herausgegeben von Jutta Heinz und Jochen Golz unter Mitarbeit von Cornelia Ilbrig, Nicole Kabisius und Matthias Löwe Reihe: Schriften der Goethe-Gesellschaft (hrsg. von Jochen Golz); Bd. 74 Göttingen (Wallstein Verlag) S., 30 Abb., geb., Schutzumschlag, 15,5 x 23 cm ISBN: (2011) Preis: 39,00
13 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 13 Stefan Greif: Ich bin nicht G[oethe]. J.G. Herders Italienreise 1788/89 von Jochen Golz Z u den Ortsvereinigungen, die mit eigenen Publikationen hervortreten, gehört seit Längerem die Goethe-Gesellschaft in Kassel, und es ist nicht vermessen zu sagen, dass sie auf diesem Felde Pionierarbeit geleistet hat. Eine stattliche Veröffentlichungsliste legt davon Zeugnis ab. In ihrer Schriftenreihe ist 2016 als Jahresgabe für die Mitglieder eine Abhandlung erschienen, in der Stefan Greif, Mitherausgeber des 2016 erschienenen Herder-Handbuchs, sich Herders Reise nach Italien widmet, die dieser 1788/89 unternommen hat. Verdienstlich ist es allemal, den Blick auf diese Reise zu lenken, steht sie doch immer noch im Schatten jener exemplarischen Reise, die Goethe zuvor unternommen hatte und die zur Musterreise für deutsche Italien-Liebhaber geworden ist. Das hat seine Ursache freilich auch darin, dass Herder von seiner Reise nur in Briefen und persönlichen Aufzeichnungen berichtet, während Goethe sie Jahrzehnte später aus seinen Aufzeichnungen rekonstruiert und als großen, selbstständigen Text in die Folge seiner autobiographischen Schriften aufgenommen hat. Den persönlichen Spuren folgt Greif, die überlieferten Dokumente akribisch nutzend, mit Sympathie und Leidenschaft. Erkennbar werden Herders sehr individuelles Italien-Bild, seine spezifische Weise der Kunstbetrachtung, das Auf und Ab seiner Stimmungen und Reflexionen. Oft ist es der Freund Goethe, über den berichtet und geurteilt wird. An diesem Punkt mag ein kleiner Einspruch erlaubt sein. Wer wie Greif ganz und gar Partei für Herder ergreift, sieht sich einerseits von seiner Warte aus im Recht, wenn er bereits existierende Urteile oder Vorurteile über Herders Italienreise kritisch kommentiert, erliegt andererseits zuweilen aber der Versuchung, Vorurteile aus älterer, vor allem politisch motivierter Herder-Parteinahme wieder aufleben zu lassen. Goethe wird Genieattitüde und ein elitäre[s] Kunstprogramm attestiert, Karl Philipp Moritz, dessen Schrift Über die bildende Nachahmung des Schönen die klassische Autonomieästhetik mit begründet hat, wird vorgeworfen, er vertrete einen Klassizismus, der sich politischen Zielsetzungen verweigert, gleichzeitig aber den Anspruch erhebt, zur Erziehung des Menschengeschlechts beizutragen, und habe darum Herders Einspruch herausgefordert. Es ist ein wenig schade, dass Greif nicht Gelegenheit genommen hat, die aktuelle Forschung heranzuziehen, wie sie etwa in Publikationen aus einem Sonderforschungsbereich der Universität Jena oder in Sammelbänden der Klassik Stiftung Weimar dokumentiert ist, in der aus meiner Sicht die (vermeintliche) Dichotomie von volksaufklärerischer, politisch motivierter Literatur hier und elitärer, politikferner Dichtung und Theorie dort von einer differenzierteren Betrachtungsweise abgelöst worden ist. Dass aber der Blick ebenso anschaulich wie präzis auf Herder gelenkt worden ist, darf zu den Verdiensten der Studie gezählt werden. Man lese Herders Aufzeichnungen und bilde sich sein eigenes Urteil. Stefan Greif Ich bin nicht G[oethe]. J. G. Herders Italienreise 1788/89 Schriften der Goethe-Gesellschaft Kassel. Im Auftrag des Vorstands herausgegeben von Maja Fischer und Stefan Grosche Kassel (AQUINarte) S., Abb. ISBN:
14 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 14 Melanie Feiler: Mein Freund Goethe von Jochen Golz W as wir hier vor uns haben, ist keine neue Goethe-Biographie, wie der Titel möglicherweise vermuten lässt, sondern eine Erzählung um den jungen Goethe. Eine Weimar-Besucherin unverkennbar die Autorin sucht das Gartenhaus im Ilmpark auf, in der Absicht, dort von der Technischen Universität Ilmenau installierte Virtual-Reality-Brillen auszuprobieren. Vor ihren Augen verwandelt sich der virtuell wahrgenommene Goethe in einen realen, mit dem sie nun im Weimar von heute allerlei Abenteuer erlebt, deren Ende Goethes Retro-Transformation ins Geistige darstellt, von Blitz und Donner am Hang des Ettersbergs begleitet. Ein solcher Plot ist nicht ohne Witz, birgt freilich auch Tücken. Goethe wird für die Erzählerin zum Gesprächspartner, was bedeutet, den erfundenen Goethe in einem erfundenen, aber möglichst originären Goethe-Ton sprechen zu lassen, ihm einmal sogar Verse in den Mund zu legen, die dem historischen Goethe vermutlich so nicht in den Sinn gekommen wären. Das geht nicht ohne Klippen ab, verrät aber stets große, man ist versucht zu sagen naturwüchsige Sympathie der Autorin für ihren Goethe, eine Sympathie, die aus genauerer Kenntnis von Leben und Werk des fiktiv-realen Partners geschöpft ist. Gleichwohl bleibt das Profil dieses literarisierten Goethe ein wenig konturlos. Das liegt auch daran, dass die Erzählerin einerseits mit ihrem Weimarer Gefährten eine alltägliche Kommunikation bestreitet, ohne den Anschein einer erotischen Beziehung aufkommen zu lassen, ihn sogar in ihre persönlichsten Verhältnisse hineinzieht die gemeinsame Reise zur krebskranken Mutter der Erzählerin stellt die intensivste, sehr berührende gemeinsame Erfahrung dar, andererseits auf Abstand zur imaginierten historischen Persönlichkeit bedacht sein muss. Diese Balance von lebensweltlicher Sympathie und historischer Distanzierung ist nicht immer gelungen, sie ist aber auch sehr schwer herzustellen. Wenn aber heutzutage eine junge Autorin im Selbstverlag einen Goethe-Roman veröffentlicht, stellt das in jedem Falle ein Wagnis dar, das Ermutigung verdient. Ich habe zunächst geschwankt, ob ich das Buch in unserem Newsletter anzeigen soll, habe mich dann aber dafür entschieden auch als Ermutigung für andere, nicht zuletzt junge Leser, zu diesem Buch zu greifen. Melanie Feiler Mein Freund Goethe Selbstverlag (Melanie Cornelia Feiler, Zeppelinstraße 3, Königsbrunn) S. ISBN: Preis: 12,99
15 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 15 Veranstaltungen. Netzwerk Klassik Stiftung Weimar und Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums Ausstellung Charlotte von Stein. Schriftstellerin, Freundin und Mentorin >> noch bis zum 17. Dezember 2017, Goethe- und Schiller- Archiv Ausgewählte Veranstaltungen Goethes Wohnung in der Seifengasse Vortrag mit Prof. Dr. Volker Wahl (Weimar) >> 19. Oktober 2017, 18:00 Uhr, Goethe-Nationalmuseum Gedenke zu leben! Wage es, glücklich zu sein! oder Goethe und das Glück Manfred Osten im Gespräch mit Hellmut Seemann >> 12. November 2017, 11:00 Uhr, Goethe-Nationalmuseum Vorstehende Rechnung habe durchgesehen und richtig befunden Goethes Haushalts-Rechnungen Vortrag von Dr. Ulrike Müller-Harang (Weimar) >> 16. November 2017, 17:00 Uhr, Goethe- und Schiller-Archiv Briefe an Goethe Präsentation des 9. Bandes ( ) Buchpräsentation >> 7. Dezember 2017, 17:00 Uhr, Goethe- und Schiller-Archiv weitere Informationen unter: >> >> Goethe-Museum Düsseldorf Seminar Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften VHS Seminar mit Dr. Heike Spies >> 10. Oktober 2017, 17:00 Uhr (weitere 5 Termine folgen) Vorträge Karl Philipp Moritz Goethes jüngerer Bruder? Prof. Dr. Anneliese Klingenberg (Weimar) >> 11. Oktober 2017, 20:00 Uhr Goethe und Jakob Michael Reinhold Lenz in ihren alternativen Lebensentwürfen Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann (Düsseldorf) >> 15. November 2017, 20:00 Uhr weitere Informationen unter: >> Goethe-Gesellschaft in Weimar Vorträge und doch ist und bleibt er außerordentlich für seine und für künftige Zeiten. Martin Luther und die Reformation im Urteil Goethes Prof. Dr. Günter Niggl (Eichstätt) >> 17. Oktober 2017, 18:00 Uhr, Goethe- und Schiller-Archiv Boccaccio in der Goethezeit Prof. Dr. Achim Aurnhammer (Freiburg i. Br.) >> 21. November 2017, 18:00 Uhr, Goethe- und Schiller-Archiv Goethe-Haus Frankfurt Vorträge Abends dann mit Göthe um s Tor gewandelt zum 250. Geburtstag von Johann Isaak von Gerning Dr. Wolfgang Cilleßen >> 11. November 2017, 19:00 Uhr, Arkadensaal Kleist gegen Goethe eine literarische Staatsaffäre Dr. Jens Bisky >> 28. November 2017, 19:00 Uhr, Arkadensaal Hommage ab den West-östlichen Divan Michael Kleeberg >> 12. Dezember 2017, 19:00 Uhr, Arkadensaal weitere Informationen unter: >> Casa di Goethe Rom Ausstellung Punti di vista Kerstin Schomburg und Jakob Philipp Hackert: eine fotografische Recherche Die Casa di Goethe zeigt Arbeiten der deutschen Fotografin Kerstin Schomburg. Im Sommer 2015 unternahm sie als Stipendiatin der Casa di Goethe eine fotografische Recherche auf den Spuren des Landschaftsmalers und Goethe-Freundes Jakob Philipp Hackert ( ), der Jahrzehnte in Italien lebte und arbeitete. >> verlängert bis zum 14. Oktober 2017, 16:00 Uhr (Finissage) Vortrag Goethes Wanderjahre in Lateinamerika und der Südsee Dieter Strauss >> 21. November 2017, 19:00 Uhr weitere Informationen unter: >>
16 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 16 Die 85. Hauptversammlung im Überblick von Jochen Golz N ational-literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Welt Literatur ist an der Zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. Goethes Diktum, Eckermann gegenüber am 31. Januar 1827 geäußert, bildete das Leitzitat unserer Hauptversammlung, die sich vom 7. bis zum 10. Juni dem Thema Globalisierung als Chance? Goethe und die Weltliteratur gewidmet hat. Wer die Themen unserer letzten Hauptversammlungen überschaut, wird bemerken, dass zusehends Aspekte von Goethes Aktualität in den Blick gerückt worden sind. Das war in diesem Jahr nicht anders. Globalisierung ein Reizwort, das für die einen Fluch, für die anderen Segen darstellt: Fluch im Zeichen von Machtausübung durch weltmarktbeherrschende Großkonzerne und kultureller Trivialisierung, Segen im Geiste weltumspannender kultureller Kommunikation. Eben dieser Kommunikation hat Goethe das Wort geredet, ihre Chancen hat er in seiner Vorstellung von Weltliteratur auf den Begriff gebracht. Unser Vorstand war, so denke ich, gut beraten, dieses Thema in allen seinen Facetten auf die Tagesordnung zu setzen. Eine Hauptversammlung, die sich den aktuellen Dimensionen von Weltliteratur widmet, muss sich selbst weltliterarisch orientieren, wissenschaftliche Partner aus ganz unterschiedlichen Weltgegenden zum Gespräch einladen. So geschehen auf dem eröffnenden Podium Weltliteratur heute, das, moderiert von Werner Frick (Freiburg), von Wissenschaftlerinnen aus St. Petersburg (Larissa Polubojarinova) und Philadelphia (Liliane Weissberg) sowie von zwei deutschen Komparatisten (Peter Goßens, Bochum, und Dieter Lamping, Mainz) bestritten wurde und wie stets ein großes Auditorium vereinigte. Zuvor hatte der Londoner Germanist Jeremy Adler in seinem Festvortrag den Begriff Weltliteratur gewissermaßen zurückverfolgt und demonstrieren können, dass seine Wurzeln nicht zuletzt auch europaweit in den Grundlagen des Völkerrechts zu finden sind, was ihm in der Gegenwart eine starke rechtliche Legitimation verschafft. In den sechs Arbeitsgruppen der wissenschaftlichen Konferenz ist das Rahmenthema sowohl unter übergreifenden Aspekten als auch im Blick auf Goethes persönliches Verhältnis zu markanten Autoren der Weltliteratur erörtert worden. Hendrik Birus, dem wir eine profund kommentierte Edition des West-östlichen Divans verdanken, sprach über Goethes Zeitschrift Kunst und Altertum im Kontext seiner Idee der Weltliteratur, Nicholas Boyle aus Cambridge, der sehr bald auch den dritten Band seiner monumentalen Goethe-Monographie veröffentlichen wird, widmete sich Goethes Shakespeare-Bild, Edoardo Costadura (Jena) befragte das Verhältnis Goethes zu Diderot. Dass Goethe mit großer Aufmerksamkeit auf die Stimmen seiner Rezensenten aus Edinburgh, Paris und Moskau hörte, nachdem seine Helena separat erschienen war, rückte Sebastian Donat (Innsbruck) in den Mittelpunkt, während Stefan Matuschek (Jena) Goethes Engagement für Alessandro Manzoni als Engagement in eigener Sache verstand. Mit faszinierenden kulturellen Phänomenen machte Stefan Keppler-Tasaki (Tokio) bekannt, als er über Goethe-Rezeption in Japan sprach. In allen Vorträgen und den sich anschließenden lebhaften Aussprachen war Goethes Gegenwärtigkeit mittel- oder unmittelbar präsent.
17 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 17 Moderiert von unserem Vorstandsmitglied Nikolina Burneva (Veliko Tarnovo), bildete das Podium Goethe weltweit. Netzwerk deutscher Kultur traditionsgemäß den Abschluss der Hauptversammlung. Erfreulich immer wieder die Beobachtung, wie groß das Interesse unserer Mitglieder an dieser Veranstaltung ist. Was sie erfuhren, konnte sie in der Zuversicht bestärken, dass Goethes Stimme weltweit Gehör findet. Nanuli Kakauridse (Kutaissi) wusste sehr lebendig darzustellen, dass die Aufnahme deutscher Kultur in Georgien eine lange Tradition besitzt, an der die Arbeit der Goethe- Gesellschaft in Kutaissi anknüpfen kann mit wissenschaftlichen Konferenzen und literarischen Wettbewerben. Goethe und die Schweiz ein Thema, dem sich die Goethe-Gesellschaft in der Schweiz, wie ihre Präsidentin Margret Wyder zeigte, in vielfältiger Weise widmet, in Gestalt wissenschaftlicher Veranstaltungen wie auch, besonders attraktiv, bei Ausflügen auf Goethes Spuren. Pawan Surana (Jaipur), für den erkrankten Mo Guanghua (Chengdu) eingesprungen, gab Auskunft über die Arbeit der indischen Goethe-Gesellschaft, die jährlich eine internationale wissenschaftliche Konferenz veranstaltet und diese in einem eigenen Jahrbuch dokumentiert. Sehr gemischt waren die Eindrücke, die die Podiumsteilnehmer vom Deutschunterricht an Schulen und Universitäten in ihren Heimatländern vermittelten. Überall, so der allgemeine Eindruck, sei das Englische auf dem Vormarsch, walte eine sprachliche Globalisierung, die auch die Einebnung kultureller Traditionen und sprachlicher Ausdrucksmittel zur Folge habe. Ungeachtet dessen, diesen Eindruck nahmen die Zuhörer mit, lassen sich die Repräsentanten der internationalen Goethe-Gesellschaften nicht davon abbringen, Goethes weltliterarischer Stimme in vielfältiger Weise, auch durch klugen Gebrauch der modernen Medien, Gehör zu verschaffen. Eine eher kleine Beobachtung mag verdeutlichen, dass Goethe auch bei aktuellen politischen Entscheidungen klärend zu Hilfe gerufen werden kann. In der festlichen Eröffnung empfingen Nicholas Boyle und Dieter Borchmeyer die höchste Auszeichnung, die die Goethe-Gesellschaft zu vergeben hat, die Goldene Goethe-Medaille. Beider Dankesworte waren,buchenswert, die von Boyle, weil sie von englischem, humorvoll akzentuiertem Understatement geprägt waren, die von Borchmeyer, weil sie, schwungvoll vorgetragen, auf ein sehr aktuelles Problem Bezug nahmen. Borchmeyer musterte die Richtlinien, die in Deutschland ankommenden Migranten von der Bundesregierung ausgehändigt werden, und kritisierte daran, dass von deutscher Kultur darin kaum die Rede sei. Wie sollen sich, so beschloss der Ausgezeichnete seine Dankesrede, Migranten und Flüchtlinge integrieren, sich mit unserem Land identifizieren, wenn sie vielfach selbst traumatisiert fast nur die Schattenseiten und Traumata ihres Gastlandes kennenlernen und ihren vom eigenen Schicksal ohnehin beladenen Schultern auch noch die Last der Geschichte des Landes aufgebürdet wird, das ihnen zur neuen Heimat werden soll. Dabei gäbe es genug in dieser Geschichte, das ihnen Hoffnung auf eine neue Identität einflößen könnte. Und für dieses andere, Hoffnung einflößende Deutschland steht nicht zuletzt der Name Goethe, von dem sie in ihren Integrationskursen nichts erfahren. Hier muss ein Gesinnungswandel eintreten. Mahnende Worte, die hoffentlich ein Echo unter den politisch Verantwortlichen finden. Sie sollten, wenn sie denn ihre Richtlinien einmal neu gestalten, ein Gedichtbuch Goethes heranziehen, an dem sich ihre Richtlinienkompetenz orientieren kann: den West-östlichen Divan, dessen Erstausgabe 1819 erschienen ist. Nirgendwo sonst hat Goethe in seinen Gedichten und dem ebenso bedeutsamen Kommentar, den Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis, seine Vorstellung von wechselseitigem Austausch und wechselseitiger Bereicherung unterschiedlicher Kulturen so intensiv in berückenden Versen und in geschichtliche Zusammenhänge erhellenden Kommentaren Ausdruck gegeben. Die zweihundertste Wiederkehr des Erscheinens von Goethes epochemachendem Gedichtbuch war für unseren Vorstand Anlass, Goethes Divan in den Mittelpunkt der 86. Hauptversammlung 2019 zu stellen. Dabei wird es indes nicht bleiben. Denn Goethes Gedichtbuch entstand in einer Zeit, die gekennzeichnet war von den Widersprüchen der aufziehenden Moderne, von großen sozialen und kulturellen Gegensätzen, zu denen Goethe sich in Beziehung gesetzt hat auf eine Weise, die genauere Untersuchung verdient. Schon heute sind Sie eingeladen, aktiv teilzunehmen an den Debatten, die sich an den Themen der nächsten Hauptversammlung entzünden werden.
18 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 18 Wissen gestalten. Das Symposium junger Goethe-Forscher, Auftakt der 85. Hauptversammlung von Jochen Golz W issen gestalten, so hatte Valérie Kobi (Bielefeld) ihren Beitrag zu unserem bereits zum neunten Mal stattfindendem Symposium überschrieben, das, von Michael Bies (Hannover) und Gerrit Brüning (Berlin) mustergültig vorbereitet und ebenso vorbildlich geleitet, den Auftakt der Hauptversammlung bildete. Wenngleich sich Kobi ganz speziell auf ästhetische Dispositionen und Präsentationsformen von Goethes naturwissenschaftlichen Sammlungen bezog und damit auch einen Beitrag zur gegenwärtig trendbestimmenden Wissenspoetik leistete, so kann ihr Titel doch generell die Tendenz unseres Symposiums charakterisieren. Denn alle Teilnehmer wollten ihr Wissen gestalten, wollten ihre Erkenntnisse anspruchsvoll in Gehalt und Gestalt ihren zahlreich anwesenden Zuhörern vermitteln. Attraktiv in mehrfacher Hinsicht ist unser Symposium für seine Gäste, ob sie nun referieren oder zuhören und mitdiskutieren. Es liefert zum einen den Beweis, dass Goethe-Forschung auch unter jungen Wissenschaftlern Kredit hat, und vermittelt zum anderen den Eindruck, dass solche Forschung keine Domäne deutscher Germanisten ist. Sprecherinnen und Sprecher kamen aus Deutschland, Österreich und Japan. Yuho Hisayama (Kobe) widmete sich Goethes Gedicht Eins und alles, das er in einen großen geistesgeschichtlichen Zusammenhang einbettete; beeindruckend daran waren sowohl seine große philosophische Bildung als auch die subtile Interpretation des poetischen Textes, die um die Begriffe Weltseele und Weltgeist kreiste. Unterschiedliche Wege gingen Stephanie Langer und Hanna Hamel (beide Wien). Während Langer sich dem Spannungsfeld von Scheintod-Wissen und Hagiographie am Beispiel der Figur der Ottilie aus Goethes Wahlverwandtschaften zuwandte und damit ein zur Goethe- Zeit lebhaft diskutiertes Phänomen akzentuierte, rückte Hamel Witterungsphänomene in den Mittelpunkt; sie zogen nicht nur Goethes Interesse auf sich wovon Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen Zeugnis ablegen, sondern sind auch heutzutage angesichts der allgegenwärtigen Klimaveränderung Gegenstand großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Über die Registrierung solcher medialer Phänomene hinaus bewegte Hamel die Frage nach deren Darstellbarkeit. Das aber ist eine Frage, die künftig noch an Bedeutung zunehmen wird, weil die Sinne einer kritischen Öffentlichkeit im Angesicht aktueller Klimakatastrophen weiter geschärft werden müssen. Waren solche Fragen dazu angetan, Goethes Aktualität ins Bild zu bringen, so wurde auch das Feld der eher traditionellen Goethe-Forschung fruchtbar beackert. Christina Clausen (Hildesheim) wusste zu verdeutlichen, dass sich die künstlerische Produktivität des jungen Goethe in ihrer Einheit von Inspiration und deren kontrollierter Bändigung sowohl in Texten als auch in Zeichnungen Geltung verschafft. Vor allem die Jugendbriefe seien geprägt von einem formalen wie inhaltlichen Ineinanderfließen von Schrift und Zeichnung ; schönstes Beispiel ist Goethes Brief an Auguste Gräfin Stolberg vom März Philipp Kampa (Halle) widmete sich dem wechselvollen Verhältnis, das Goethe mit dem französischen Ästhetiker Charles Batteux verband und noch in seiner Übersetzung von Diderots Rameaus Neffe seinen Niederschlag findet, während Hauke Kuhlmann (Bremen) der Häufigkeit und Intensität der Bezüge auf die Geschichte von Saul und David in Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre nachging und nachdrücklich postulierte, dass diesen Bezügen eine ähnliche Bedeutung zukomme wie dem Leitmotiv des kranken Königssohns. Beeindruckend der Vortrag von Sylvia Brockstieger (Heidelberg) über Lukrez in Weimar ein weltliterarisches Thema also, die in sorgfältiger Argumentation nachwies, dass die Auseinandersetzung mit Lukrez De rerum natura im klassischen Weimar als breiter Modernisierungsimpuls unter antiken Vorzeichen verstanden werden kann. Mit einem geselligen Beisammensein, das die aktiven Teilnehmer des Symposiums sowie Studenten und junge Wissenschaftler aus vielen Ländern zusammenführte, klang der erste Tag der Hauptversammlung aus. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass Goethe in tausend Zungen zur Sprache gebracht werden kann, dann wurde er in den Tages- und Abendstunden des Symposiums erbracht.
19 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 19 Bericht von der Jahrestagung der Vorstände der Ortsvereinigungen der Goethe- Gesellschaft Weimar e.v. vom 25. bis zum 8. Mai 2017 in München von Hans-Joachim Kertscher I n München ist am 21. November 1917 eine Ortsgruppe gegründet worden, die 110 Mitglieder zählt. Diese Meldung konnte man dem Goethe-Jahrbuch von 1918 entnehmen. Es handelte sich dabei um die erste in Deutschland gegründete Ortsvereinigung, deren Bildung gemäß einer Satzungsänderung der,muttergesellschaft vom gleichen Jahr möglich geworden war. München hatte also die Vorreiterrolle übernommen, viele andere sollten später dem Beispiel folgen. Der hundertste Geburtstag der Vereinigung war Grund genug, die Vorstände der Ortsvereinigungen nach München einzuladen und mit ihnen gemeinsam zu feiern. 38 von insgesamt 57 hatten ihre Vertreter entsandt. Sie erlebten einen furiosen Auftakt im Literaturhaus am Salvatorplatz mit einem stimmungsvollen Mozart-Allegro, intoniert von Mayuko Obuchi (Klavier). Begrüßt wurden die Gäste vom Vorsitzenden der Münchener Vereinigung, Herrn Prof. Dr. Rolf Selbmann. Ihm schloss sich der Kulturreferent der Landeshauptstadt, Herr Dr. Hans-Georg Küppers (in Vertretung des Herrn Oberbürgermeisters Dieter Reiter), mit einem Grußwort an. (Bildnachweis: Gerhard Leib) (Bildnachweis: Gerhard Leib) Josefine Renelt (Sopran) widmete sich, am Klavier begleitet von Mayuko Obuchi, einfühlsam dem von Johannes Brahms vertonten Mädchenlied Paul Heyses. Damit war gleichsam der Übergang geschaffen worden zum Festvortrag von Dr. Walter Hettche (München), der dem Literaturnobelpreisträger Paul
20 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 20 Heyse galt. Unter dem Titel Zwischen Goethetuerei und Goethekritik stellte der Referent den Münchener Schriftsteller, der zeitweise zu den Vizepräsidenten der,muttergesellschaft gehörte, als eine literarische,zelebrität am Münchener Musenhof des bayerischen Königs Maximilian vor. Interessante und nicht ohne Witz gefärbte Einblicke boten seine Bemerkungen samt der von Julia Cortis rezitierten Textpassagen aus Heyses Gedicht Das Goethehaus in Weimar, von dem Eduard Engel in seinem Goethe. Der Mann und das Werk meinte, dass es jeder gebildete Deutsche [ ] vor oder nach einer Pilgerfahrt zu diesem Heiligtum deutscher Nation gelesen haben müsse. Der Berichtende muss gestehen, dass er dies bislang noch nicht getan hat, es aber bei passender Gelegenheit nachzuholen gedenkt. Der 26. Mai war der traditionell zu absolvierenden Arbeitstagung vorbehalten. Zwei neue Vorsitzende von Ortsvereinigungen stellten sich vor. Zum einen war es Frau Dr. Barbara Pendorf, die an die Stelle der langjährigen und verdienstvollen Vorsitzenden der OV Plauen, Frau Gertraud Markert, getreten ist. Zum anderen präsentierte sich Frau Dr. Barbara Heuchel als neue Vorsitzende der OV Sondershausen, die 2016 die Amtsgeschäfte des ebenso langjährigen wie rührigen Goethefreundes Helmut Köhler übernommen hat. Der Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar, Herr Dr. habil. Jochen Golz, stellte in seinem Bericht das Programm der vom 7. bis 10. Juni angesetzten 85. Hauptversammlung vor. Unter dem Titel Globalisierung als Chance? Goethe und die Weltliteratur und mit Goethes Diktum aus dem Jahr 1827: National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Welt-Literatur ist an der Zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen soll die Frage erörtert werden, ob der gegenwärtig ablaufende und von manchen Seiten geschmähte Globalisierungsprozess Chancen für internationale kulturelle Beziehungen eröffne. Hinsichtlich der Mitgliedschaftsstatistik in der,muttergesellschaft wusste der Präsident Zufriedenstellendes zu berichten: Im vergangenen Jahr seien 153 neue Mitglieder gewonnen worden, gegenwärtig gehörten der Gesellschaft etwa 2600 Mitglieder an. In diesem Zusammenhang verwies der Berichtende auf die Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft in der,muttergesellschaft und in einer Ortsvereinigung. Mit großem Interesse sehe er dem Jahr 2019 entgegen, in dem das Pilotprojekt Kopplung der Jahreshauptversammlung mit der Tagung der Ortsvereinigungen gestartet werde. Erfreulich verlaufe weiterhin die internationale Arbeit der Gesellschaft, wobei beispielhaft der Aufenthalt junger ausländischer Wissenschaftler herauszuheben sei. Jährlich weilten maximal 12 Stipendiaten in Weimar. Die noch vorhandenen Mittel sorgen ebenso wie der regelmäßige Zuschuss der Bundesregierung mit dafür, dass das Projekt weitergeführt werden kann, auf längere Sicht jedoch müssten neue Möglichkeiten für dessen Absicherung gefunden werden. Gut angelaufen sei die gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg veranstaltete Goethe Akademie. Sie werde deshalb mit vier Veranstaltungen pro Jahr fortgeführt. Der Präsident bat die anwesenden Vorstände darum, bei der Verteilung der für jede Veranstaltung gefertigten Flyer mitzuwirken. Mit Sorge schaue der Präsident auf die Weiterführung des Projektes Geschichte der Goethe- Gesellschaft. Dies sei seit einiger Zeit aus verschiedenen Gründen ins Stocken geraten, ein wohlfundierter Antrag auf Fördermittel durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft sollte so bald wie möglich auf den Weg gebracht werden. Das in die Jahre gekommene Haus am Frauenplan werde, so war zu erfahren, ab 2019 aus Gründen einer umfangreichen Restaurierung geschlossen. In der Hypo-Kunsthalle München wird die Klassik Stiftung im Frühjahr 2018 eine Faust-Ausstellung, in Weimar 2019 eine Ausstellung zum Thema Goethe und die Naturwissenschaften präsentieren. Herzlich lud der Präsident die Ortsvereinigungen ein, sich bei Weimar-Exkursionen auch einen Besuch in der Geschäftsstelle vorzumerken. Sie würden dort gern zu anregenden Gesprächen empfangen; bei der Vorbereitung solcher Weimar-Exkursionen helfen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle ebenso gern. Frau Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, die Direktorin des Frankfurter Goethehauses, verwies in ihrem Bericht auf die museumspädagogischen Ambitionen des Hauses, die einen gewichtigen Anteil an dessen Präsentation in der Öffentlichkeit haben. Dabei spielten Fragen der Inklusion von Migranten bis hin zu Problemen des Verständnisses literarischer Texte eine bedeutende Rolle. Daneben laufe der,normale Ausstellungsalltag weiter, gegenwärtig hätten die Besucher die Möglichkeit, mit Füsslis Nachtmahr
21 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 21 Traum und Wahnsinn eine Ausstellung zu sehen, die Werke des Malers Johann Heinrich Füssli präsentiert. Neben dem vom Goethehaus 1953 erworbenen Gemälde Der Nachtmahr, das als Prototyp der Schauerromantik in die Kunstgeschichte eingegangen ist, seien auch spätere Erwerbungen aus der Hand des Künstlers zu besichtigen. Für das Jahr 2018 werde eine Ausstellung vorbereitet, die sich dem Thema Goethe und die Musik zuwenden wolle. Für Interessenten an dem geplanten Anbau des Romantik-Museums gab es am Anfang des Jahres 2017 die Möglichkeit, sich im Arkadensaal des Goethehauses über das Bauvorhaben zu informieren. Die von den Architekten gefundene Lösung des Anbaus sei, so die Referentin, nicht unproblematisch, sondern eher gewöhnungsbedürftig. Dennoch konnten sich die Anwesenden anhand der Powerpoint- Präsentation überzeugen, dass hier ein durchaus sehenswertes Bauvorhaben seinen Anfang genommen hat. Das Richtfest werde, so war weiter zu erfahren, im September 2017 gefeiert, die Eröffnung sollte im Frühjahr 2020 möglich sein. Auf eine gelungene Festveranstaltung anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Düsseldorfer Goethe- Museums im Jahr 2016 konnte dessen Direktor, Herr Prof. Dr. Christof Wingertszahn, verweisen. Trotz umfangreicher Renovierungsarbeiten hatten interessierte Besucher die Möglichkeit, die Ausstellungen Goethe und der Karneval (2016) und Goethe und Luther (2017) zu besuchen. Im nächsten Jahr werde an einer Umgestaltung der Dauerausstellung gearbeitet. Zu fragen sei in diesem Zusammenhang, wie eine Stadt, die nicht auf die Aura Goethes bauen kann, mit dessen Persönlichkeit und Werk umgehen könne. Generell sei Sorge am Platz angesichts der Absicht des Landes Nordrhein-Westfalen, in seinen Kulturentwicklungsplan eine Zentralisierung der Museen einzubetten. Wirksamkeitsnachweise müssten erbracht werden, Stelleneinsparungen seien zu befürchten. Gegenwärtig laufe eine Unterschriftenaktion zum Erhalt des Düsseldorfer Goethe-Museums. Die Teilnehmer der Tagung waren sofort bereit, dieses Unternehmen mit ihren Unterschriften zu unterstützen. Die anschließende Diskussion galt nicht nur den vorgestellten Berichten, sondern auch Problemen, die allgemein von den Ortsvertretungen bewältigt werden müssen. Das war vornehmlich die Frage, welche Rolle unser Namenspatron im allgemeinen Denken und Fühlen unserer Gegenwart spielt. Herr Dr. Bortloff (Mannheim) regte dazu an, über die Frage Warum Goethe heute? zu diskutieren. Stoff dazu gebe es genug angesichts von deutlichen Defiziten in den Schulen. In Mannheim werde versucht, Schauspieler dafür zu gewinnen, in Schulen Goethe-Texte vorzustellen, um damit Distanzhaltungen zum Werk des Dichters abzubauen. Frau Dr. Oberhauser (Weimar) verwies auf eine Initiative der,muttergesellschaft, die ein Buch mit dem Titel Warum Goethe heute? herausgebracht hat, in dem allgemein interessierende Artikel aus den Goethe-Jahrbüchern vergangener Jahre versammelt sind, und damit sowohl für das Interesse an Goethe allgemein als auch für die Mitgliedschaft in der Goethegesellschaft speziell werben will. Diskutiert wurden darüber hinaus Möglichkeiten der Finanzierung von Vorhaben der OV. So benannte Herr Dr. Müller (Ilmenau) Probleme bei der weiteren Finanzierung des Goethe-Museums in Stützerbach. Auf der einen Seite sei das Museum dankenswerterweise durch eine Anschubfinanzierung von Euro (der Newsletter berichtete in seiner Ausgabe 2/15 darüber),gerettet worden. Nunmehr fehlten aber jährlich Euro, um den Betrieb des Hauses weiterhin gewährleisten zu können. Auf eine Option, die Arbeit einer Ortsvereinigung finanziell zu unterstützen, verwies Herr Dr. Heizmann (Essen). Unter dem Motto Golfen mit Goethe veranstalteten Mitglieder der Essener OV in der Golfriege des ETuF am Baldeneysee ein gut angenommenes Goethe-Golf-Turnier, an dessen Erlösen die Gesellschaft beteiligt wurde. Einen Vorschlag zur Popularisierung des Veranstaltungsangebotes unterbreitete Frau Dr. Heuchler (Sondershausen). Ihre Ortsvereinigung nutze das Amtsblatt der Stadt Sondershausen für die kostenfreie Publikation von Veranstaltungshinweisen. Frau Arnold (Anhaltische Goethe-Gesellschaft) lud die Vorstände für das nächste Jahr (10. bis 13. Mai) zur Tagung nach Dessau-Roßlau ein. Neben einem Festvortrag und den Arbeitsgesprächen erwarte die Teilnehmer ein interessantes Exkursionsprogramm, auf dessen Agenda der Besuch des Wörlitzer Gartenreiches, des Dessauer Bauhauses und des Bundesumweltamtes Dessau-Roßlau stehen werden. Hinsichtlich des Beiprogramms haben sich die Münchener Beachtenswertes einfallen lassen. Neben der Besichtigung des Deutschen Theatermuseums gab es eine Residenz- und eine Stadtführung. Der Freitagabend bot die Wahl zwischen einer wilden, schönen Frauenfantasie, nämlich dem Ballett Ein
22 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 22 Sommernachtstraum in der Bayerischen Staatsoper, oder einem Abend im Lyrikkabinett, wo der Übersetzer Stefan Weidner eindrucksvoll Verse des islamischen Dichters Ibn Arabi mit solchen aus Goethes Divan in Verbindung brachte und damit einen weltliterarischen Dialog zweier großer Lyriker in Gang setzte. Ausflug nach Murnau (Bildnachweis: Gerhard Leib) Abschlussabend im Hofbräuhaus (Bildnachweis: Gerhard Leib) Ein weiterer Höhepunkt der Tage in München war die samstägliche Exkursion in das Voralpengebiet nach Murnau, wo die Teilnehmer das Haus der Malerin Gabriele Münter sowie das dortige Museum besichtigen und bei einer Führung die Aura des Blauen Reiters erspüren konnten. Den Abschluss des Tages markierte ein zünftiges Spanferkelessen im Ambiente des Hofbräuhauses. Verabschiedet wurden die Gäste am nächsten Morgen mit einem sonntäglichen Weißwurstfrühstück im Reichthaler Hof. Der Dank für die wunderschöne Tagung wurde den rührigen Münchener Vorstandsmitgliedern Prof. Rolf Selbmann und Hans Brendel samt ihren unermüdlichen Helfern von vielen Seiten vor Ort geäußert. Er sei hier noch einmal ganz offiziell wiederholt. Bei so viel Engagement dürfte uns um die Zukunft unserer Gesellschaft nicht bange sein.
23 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 23 Vermischtes. Goethe-Gedenktafel am Dessauer Schloss von Ingeborg Arnold Goethe-Gedenktafel am Dessauer Schloss Die Enthüllung der Gedenktafel (v.l.: Hans-Joachim Kertscher, Joachim Liebig, Frank Schönemann, Peter Kuras) Ein lang gehegter Wunsch der Anhaltischen Goethe-Gesellschaft e.v. ging am 6. Dezember 2016 in Erfüllung. Mit der Anbringung der Goethetafel am einzig verbliebenen Flügel des ehemaligen Residenzschlosses, dem Johannbau, dokumentiert unsere Goethe-Gesellschaft die mehrmaligen Besuche Goethes (acht insgesamt) in Dessau und Wörlitz. Die Tafel (hier im Bild) wurde von Detlef Bittner entworfen und von dem Kunstschmied Frank Schönemann gestaltet. Im Beisein des Oberbürgermeisters Peter Kuras, der seine Dankbarkeit für den durch die Anhaltische Goethe- Gesellschaft geschaffenen neuen Erinnerungsort zum Ausdruck brachte, von Herrn Prof. Hans-Joachim Kertscher (in Vertretung des Präsidenten der Weimarer Goethe-Gesellschaft) und des Vorsitzenden der Anhaltischen Goethe-Gesellschaft, Herrn Kirchenpräsident Joachim Liebig, wurde unter dem Beifall der Mitglieder und Gäste die Tafel enthüllt. Goethe begleitete seinen Dienstherrn, Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, auf seiner ersten Reise in das Fürstentum von Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau; er entdeckte den Reiz der herrlichen Parklandschaft und schrieb am 14. Mai 1778 begeistert an Charlotte von Stein: Hier ists iezt unendlich schön. Mich hats gestern Abend wie wir durch die Seen Canäle und Wäldgen schlichen sehr gerührt wie die Götter dem Fürsten erlaubt haben einen Traum um sich herum zu schaffen. Bei späteren Besuchen interessiert ihn zwar noch immer die Parklandschaft, doch nach seiner Italienreise sind es die bemerkenswerten Antiken im Wörlitzer Schloss, die seine Aufmerksamkeit finden. Außerdem traf er hier auf einen älteren Freund aus Leipziger Tagen, den Prinzenerzieher Ernst Wolfgang Behrisch.
24 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 24 Vermischtes. Friedrich Wilhelm Riemers Grab in neuem Glanz von Jochen Golz I n der letzten Nummer unseres Newsletters hatten wir von dem katastrophalen Zustand des Riemer- Grabes auf Weimars historischem Friedhof berichtet und unsere Leser um Spenden gebeten sind auf unserem Konto eingegangen. Allen Spendern sei von Herzen gedankt! Parallel dazu haben sich Weimarer Freundeskreise für benachbarte Gräber eingesetzt. Am 12. Juli war es dann so weit. An den restaurierten historischen Grabstätten hatten sich die Vorsitzenden Weimarer Freundeskreise, Handwerker und Nachfahren der bestatteten Persönlichkeiten eingefunden. Großen Anteil am Zustandekommen des Projekts hatten der Freundeskreis des Goethe- Nationalmuseums mit seinem Vorsitzenden Dieter Höhnl, dem besonders die Restaurierung des Grabes von Goethes Hauszeichner Johann Joseph Schmeller am Herzen lag, sowie Prof. Dr. Wolfram Huschke, der das eigene Familiengrab restaurieren ließ und die Freundesgesellschaft des Goethe- und Schiller-Archivs, deren Vorsitz er innehat, für die denkmalgerechte Wiederherstellung des Riemer-Grabs gewinnen konnte. Die Goethe-Gesellschaft stand nicht abseits (siehe oben). Anwesend war auch Weimars Oberbürgermeister Stefan Wolf, der die Sanierung weiterer Grabstätten an der Ostseite des historischen Friedhofs in Aussicht stellte. Allen Weimar-Besuchern sei ein Gang zu den restaurierten Gräbern empfohlen in der Hoffnung auf gänzliche Wiederherstellung von Umfriedungsmauer und Grabstätten. Das Riemer-Grab vor (oben) und nach seiner Sanierung (links) (Bildnachweis: Dr. Ulrike Bischof)
25 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 25 Vermischtes. Mori Ôgai und Goethe von Hartmut Heinze Mori Ôgai, um 1916 Weiterführende Informationen über die Mori-Ôgai-Gedenkstätte: >>> u.hu-berlin.de/ogai Mori Ôgai wird 1862 als Sohn einer Arztfamilie in einer kleinen westjapanischen Stadt geboren. Noch ganz im konfuzianischen Loyalitätsprinzip erzogen, befindet sich Ôgai stets in der Nähe des Machtzentrums, und das ist auch Voraussetzung und Bedingung seiner beruflichen Laufbahn. Gleichzeitig fördert das gründliche Studium der westlichen Zivilisation sein Selbstverständnis. Er studiert Medizin in Tokio, u. a. bei dem deutschen Arzt Erwin Bälz; seit 1884 hält er sich zu einem vierjährigen Studienaufenthalt in Deutschland auf. Ôgai studiert in Leipzig, bei Pettenkofer in München und seit 1887 bei Robert Koch in Berlin. Als sensibler Beobachter führt er ein Deutschlandtagebuch kehrt er nach Tokio zurück und entfaltet eine vielfältige Tätigkeit als Schriftsteller und Übersetzer. Ôgai verfasst Romane und Erzählungen, wird Generalstabsarzt des japanischen Heeres, später Direktor des kaiserlichen Hofmuseums und Präsident der Reichsakademie der Künste. 60jährig stirbt Ôgai 1922 in Tokio. Goethe, mit dem er sich immer wieder beschäftigt, wird für Ôgai ein Lebensthema, ihm verdankt er eine geistige Befreiung, die ihn die Grenzen seiner Zeit überwinden lässt. Goethes Doppelexistenz als Dichter und Staatsmann war für Ôgai faszinierend. Bereits während seines Aufenthalts in Leipzig erwarb er eine 45bändige Goethe- Ausgabe. Am selben Ort, und zwar in Auerbachs Keller, machte ihm der japanische Philosoph Inoue den Vorschlag, Goethes Faust im Stil der chinesischen Dichtung zu übersetzen. In Dresden sah Ôgai dann Goethes Faust auf der Bühne. In mehreren Aufsätzen so z. B. Debatte über Goethes Gedichte und Goethe als Naturforscher hat er sich mit dem deutschen Dichter auseinandergesetzt; auch in seinen eigenen Werken finden sich zahlreiche Goethe-Zitate. Umfangreich ist Ôgais Übersetzungstätigkeit. Er übersetzte Gedichte wie Heidenröslein und Mignon, Goethes Drama Götz von Berlichingen, zu dem er 1914 auch einen Kommentar veröffentlichte, sowie beide Teile des Faust ; dieser Übersetzung stellte er 1913 Faust-Studien an die Seite. Zwar bilden Gedichte und Dramen Goethes einen Schwerpunkt von Ôgais übersetzerischer Arbeit, doch übertrug er auch andere Texte aus der europäischen Kultur ins Japanische, so Clausewitz Vom Kriege oder Über den Umgang mit Menschen des Freiherrn Adolph Knigge. Besondere Resonanz in seinem Heimatland fand eine autobiographisch fundierte Erzählung mit dem Titel Das Ballettmädchen (1890), in der Ôgai die tragische Liebesbeziehung eines japanischen Studenten zu einer Berlinerin beschreibt. Seit 1984 gibt es in Berlin eine Mori-Ôgai-Gedenkstätte, die in jüngster Zeit völlig neu gestaltet werden konnte Sie befindet sich in Berlin-Mitte, Luisenstraße 39 (Ecke Marienstraße), und ist von Montag bis Freitag zwischen und Uhr geöffnet.
26 Newsletter der Goethe-Gesellschaft in Weimar Ausgabe 2/2017 Seite 26 Vermischtes. Goethe in Venedig von Stephan Oswald Am 28. August 2017, mit dem Glockenschlag zwölf, ist zu Goethes 268. Geburtstag in Venedig eine Gedenktafel enthüllt worden, die an den zweiten Aufenthalt des Dichters in der Lagunenstadt im Jahre 1790 erinnert. Die Initiative geht auf den in Bologna lebenden Germanisten Stephan Oswald zurück, der bei seinen Recherchen zu Goethes Venezianischen Epigrammen (Früchte einer großen Stadt, Heidelberg 2015) nicht nur Goethe selbst in den Fremdenlisten der Staatsinquisition, die damals die in der Stadt weilenden Ausländer registrierte, ausfindig gemacht hat, sondern auch das Quartier identifizieren konnte, in dem Goethe vom 31. März bis zum 22. Mai 1790 wohnte. Es handelte sich nicht um eines der großen Hotels wie etwa den Scudo di Francia, in dem später Anna Amalia mit ihrem Gefolge abstieg, sondern um eine kleine Pension, die Locanda della Tromba, also Zur Trompete. Sie lag am Canal Grande dicht bei der Rialto-Brücke, an der Riva del Carbon, einem Uferstück, das noch heute seinen Namen nach den Holzkohlehandlungen trägt, die sich früher dort befanden. Hier lebte Goethe zunächst völlig zurückgezogen mit seinem Diener Paul Goetze, studierte die Anfänge der venezianischen Malerei, machte eine für seine Schädellehre bedeutsame Entdeckung, ließ sich von Francesco Zucchi, dem Schwager Angelika Kaufmanns, die komplizierte Verfassung der Republik Venedig erklären (ein durch die Ereignisse in Frankreich hochaktuelles Thema) und verfasste eine große Zahl von Epigrammen, die später den Namen ihres Entstehungsortes trugen. Nach der Ankunft Anna Amalias begleitete er die Herzogin bei der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Venedigs, wurde in ihrem Gefolge in das gesellschaftliche Leben der Stadt hineingezogen und erlebte eine der letzten traditionellen Ausfahrten des Bucintoro, der vergoldeten Prunkgaleere der Serenissima, auf der am Himmelfahrtstag der Doge, von hunderten Booten begleitet, aufs offene Meer hinausgerudert wurde, um dort die symbolische Vermählung der Stadt mit der Adria zu vollziehen. Die Anbringung der Gedenktafel wurde ermöglicht durch die Zusammenarbeit der Gemeinde Venedig, des Deutschen Studienzentrums, der Deutsch-Italienischen Gesellschaft, der Casa di Goethe in Rom und vor allem der Mitglieder des Freundeskreises des Goethe-Nationalmuseums in Weimar, die durch ihre großzügige Spende die erforderlichen Mittel aufgebracht haben. Gedenktafel in Venedig
INHALT. Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11
 INHALT Geleitwort... 7 Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11 Irene Roch-Lemmer Zur Übergabe des Silberbechers an die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle am 27. November 2009... 31 Irene
INHALT Geleitwort... 7 Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11 Irene Roch-Lemmer Zur Übergabe des Silberbechers an die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle am 27. November 2009... 31 Irene
Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz
 Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 2003 Herausgegeben von Günther Wagner Verlag J.B. Metzler Stuttgart Weimar 3 INHALT Vorwort......................................................
Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 2003 Herausgegeben von Günther Wagner Verlag J.B. Metzler Stuttgart Weimar 3 INHALT Vorwort......................................................
Vergleich künstlerischer, religiöser und gesellschaftlicher Motive in Goethes Prometheus und Ganymed
 Germanistik Susanne Fass Vergleich künstlerischer, religiöser und gesellschaftlicher Motive in Goethes Prometheus und Ganymed Examensarbeit Universität Mannheim Wissenschaftliche Arbeit im Fach Deutsch:
Germanistik Susanne Fass Vergleich künstlerischer, religiöser und gesellschaftlicher Motive in Goethes Prometheus und Ganymed Examensarbeit Universität Mannheim Wissenschaftliche Arbeit im Fach Deutsch:
INVENTARE SCHILLERBESTAND
 INVENTARE DES GOETHE- UND SCHILLER-ARCHIVS Band 1 SCHILLERBESTAND Redaktor GERHARD SCHMID 1989 HERMANN BÖHLAUS NACHFOLGER WEIMAR INHALT Vorwort 9 Einleitung 13 Geschichte des Schillerbestandes im Goethe-
INVENTARE DES GOETHE- UND SCHILLER-ARCHIVS Band 1 SCHILLERBESTAND Redaktor GERHARD SCHMID 1989 HERMANN BÖHLAUS NACHFOLGER WEIMAR INHALT Vorwort 9 Einleitung 13 Geschichte des Schillerbestandes im Goethe-
Russische Philosophen in Berlin
 Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Literaturepoche der Klassik
 Literaturepoche der Klassik 1786-1832 Gliederung Hauptmerkmale Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellun gen Blütezeiten Weimarer Klassik Literaturformen Beispiele Balladenjahr Quellen Hauptmerkmale
Literaturepoche der Klassik 1786-1832 Gliederung Hauptmerkmale Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellun gen Blütezeiten Weimarer Klassik Literaturformen Beispiele Balladenjahr Quellen Hauptmerkmale
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Textanalyse und Interpretation zu: Lyrik der Klassik
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Textanalyse und Interpretation zu: Lyrik der Klassik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de königs erläuterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Textanalyse und Interpretation zu: Lyrik der Klassik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de königs erläuterungen
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. anlässlich des Empfanges der. Theodor-Körner-Preisträger. am Montag, dem 24.
 - 1 - Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Empfanges der Theodor-Körner-Preisträger am Montag, dem 24. April 2006 Meine Damen und Herren! Tradition ist Schlamperei, meinte einst Gustav
- 1 - Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Empfanges der Theodor-Körner-Preisträger am Montag, dem 24. April 2006 Meine Damen und Herren! Tradition ist Schlamperei, meinte einst Gustav
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Protokoll, Zusammenfassung, Exzerpt: Lernwerkstatt Aufsatz
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Protokoll, Zusammenfassung, Exzerpt: Lernwerkstatt Aufsatz Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Nimm zum dir Zeit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Protokoll, Zusammenfassung, Exzerpt: Lernwerkstatt Aufsatz Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Nimm zum dir Zeit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Erläuterungen zu Joseph von Eichendorff: Das lyrische Schaffen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erläuterungen zu Joseph von Eichendorff: Das lyrische Schaffen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erläuterungen zu Joseph von Eichendorff: Das lyrische Schaffen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Königs Erläuterungen und Materialien Band 428. Erläuterungen zu. Arthur Schnitzler. Fräulein Else. von Lisa Holzberg
 Königs Erläuterungen und Materialien Band 428 Erläuterungen zu Arthur Schnitzler Fräulein Else von Lisa Holzberg Über die Autorin dieser Erläuterung: Lisa Katharina Holzberg, geboren 1983 in Wolfenbüttel,
Königs Erläuterungen und Materialien Band 428 Erläuterungen zu Arthur Schnitzler Fräulein Else von Lisa Holzberg Über die Autorin dieser Erläuterung: Lisa Katharina Holzberg, geboren 1983 in Wolfenbüttel,
GOETHE STAFFEL 2 Episode II Venedig. Ich kenne mich nicht wieder.
 Arbeitsblatt 1 Erste Stunde Aktivität 1.1 Hörspiel GOETHE STAFFEL 2 Episode II Venedig. Ich kenne mich nicht wieder. Hör den Text und versuche beim Hören die richtige Antwort zu folgenden Fragen zu finden.
Arbeitsblatt 1 Erste Stunde Aktivität 1.1 Hörspiel GOETHE STAFFEL 2 Episode II Venedig. Ich kenne mich nicht wieder. Hör den Text und versuche beim Hören die richtige Antwort zu folgenden Fragen zu finden.
Johann Wolfgang Goethe
 Johann Wolfgang Goethe Vita: 1749 Am 28. August wird Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt am Main geboren als Sohn des Kaiserlichen Rats Johann Caspar Goethe und seiner Frau Catharina Elisabeth, geb. Textor.
Johann Wolfgang Goethe Vita: 1749 Am 28. August wird Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt am Main geboren als Sohn des Kaiserlichen Rats Johann Caspar Goethe und seiner Frau Catharina Elisabeth, geb. Textor.
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Andreas Venzke: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Andreas Venzke: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de ZUM
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Andreas Venzke: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de ZUM
Vorwort. Brief I An Claudine. Brief II Die Idylle und die Zäsur. Brief III Ein Hurenhaus in Wien. Brief IV Wiener Kreise
 Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Begriff der Klassik. classicus = röm. Bürger höherer Steuerklasse. scriptor classicus = Schriftsteller 1. Ranges
 Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Benn, Gottfried - Das lyrische Schaffen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Benn, Gottfried - Das lyrische Schaffen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Königs Erläuterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Benn, Gottfried - Das lyrische Schaffen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Königs Erläuterungen
Friedrich Schiller Wilhelm Tell. Reclam Lektüreschlüssel
 Friedrich Schiller Wilhelm Tell Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER Friedrich Schiller Wilhelm Tell Von Martin Neubauer Philipp Reclam jun. Stuttgart Dieser Lektüreschlüssel
Friedrich Schiller Wilhelm Tell Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER Friedrich Schiller Wilhelm Tell Von Martin Neubauer Philipp Reclam jun. Stuttgart Dieser Lektüreschlüssel
Begrüßungsrede. von. Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion. Selbstverbrennung oder Transformation.
 Begrüßungsrede von Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion Selbstverbrennung oder Transformation. Mit Kunst und Kultur aus der Klimakrise? am 15. Juli, in
Begrüßungsrede von Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion Selbstverbrennung oder Transformation. Mit Kunst und Kultur aus der Klimakrise? am 15. Juli, in
Hitler - Der Architekt
 Geschichte Matthias Heise Hitler - Der Architekt Studienarbeit Hitler - Der Architekt Hauptseminar Hitler - Eine Biographie im 20. Jh. " Dr. M. Gailus, Technische Universität Berlin, WS 2003/2004 Matthias
Geschichte Matthias Heise Hitler - Der Architekt Studienarbeit Hitler - Der Architekt Hauptseminar Hitler - Eine Biographie im 20. Jh. " Dr. M. Gailus, Technische Universität Berlin, WS 2003/2004 Matthias
Königs Erläuterungen und Materialien Band 176. Auszug aus: Friedrich Hebbel. Maria Magdalena. von Magret Möckel
 Königs Erläuterungen und Materialien Band 176 Auszug aus: Friedrich Hebbel Maria Magdalena von Magret Möckel Friedrich Hebbel: Maria Magdalena. Ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten. Mit Hebbels Vorwort
Königs Erläuterungen und Materialien Band 176 Auszug aus: Friedrich Hebbel Maria Magdalena von Magret Möckel Friedrich Hebbel: Maria Magdalena. Ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten. Mit Hebbels Vorwort
Aus dem Vorstand. Liebe Mitglieder des MPW! 25 Jahre MPW - ein heißer Abend in der Amber Suite im Berliner Ullsteinhaus. Nr. 4/2015.
 Aus dem Vorstand Nr. 4/2015 Juli 2015 Liebe Mitglieder des MPW! Wir wünschen Ihnen allen für die jetzt begonnene Sommer- und damit auch Hauptferienzeit erholsame Tage und Stunden, gutes Wetter und viele
Aus dem Vorstand Nr. 4/2015 Juli 2015 Liebe Mitglieder des MPW! Wir wünschen Ihnen allen für die jetzt begonnene Sommer- und damit auch Hauptferienzeit erholsame Tage und Stunden, gutes Wetter und viele
Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller
 Germanistik Klaudia Spellerberg Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Magisterarbeit Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Schriftliche Hausarbeit für die Magisterprüfung
Germanistik Klaudia Spellerberg Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Magisterarbeit Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Schriftliche Hausarbeit für die Magisterprüfung
Frankfurter Goethe-Haus - Freies Deutsches Hochstift : Goethe und das Geld. Der Dichter und die moderne Wirtschaft - Sonderausstellung
 Sie sind hier: www.aski.org/portal2/ / 9: KULTUR lebendig / 9.9: KULTUR lebendig 2/12. Frankfurter Goethe-Haus - Freies Deutsches Hochstift : Goethe und das Geld. Der Dichter und die moderne Wirtschaft
Sie sind hier: www.aski.org/portal2/ / 9: KULTUR lebendig / 9.9: KULTUR lebendig 2/12. Frankfurter Goethe-Haus - Freies Deutsches Hochstift : Goethe und das Geld. Der Dichter und die moderne Wirtschaft
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur... 87
 Inhalt Vorwort... 5 1. Thomas Mann: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 11 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 16 2. Textanalyse und -interpretation...
Inhalt Vorwort... 5 1. Thomas Mann: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 11 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 16 2. Textanalyse und -interpretation...
Wenn wir das Váray-Quartett so wunderbar musizieren hören, spüren wir, wie uns Kunst und Kultur berühren.
 Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Verlauf Material LEK Glossar Literatur
 Reihe 7 S 8 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Georg Büchner: Dantons Tod Regieentscheidungen als Zugang zu einem komplexen Drama Interpretation durch Vorbereitung einer Inszenierung Stunden
Reihe 7 S 8 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Georg Büchner: Dantons Tod Regieentscheidungen als Zugang zu einem komplexen Drama Interpretation durch Vorbereitung einer Inszenierung Stunden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Interpretation zu Kafka, Franz - Ein Bericht für eine Akademie
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Kafka, Franz - Ein Bericht für eine Akademie Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Kafka, Franz - Ein Bericht für eine Akademie Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Thomas Mann Mario und der Zauberer. Reclam Lektüreschlüssel
 Thomas Mann Mario und der Zauberer Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLER Thomas Mann Mario und der Zauberer Von Michael Mommert Philipp Reclam jun. Stuttgart Alle Rechte vorbehalten 2004,
Thomas Mann Mario und der Zauberer Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLER Thomas Mann Mario und der Zauberer Von Michael Mommert Philipp Reclam jun. Stuttgart Alle Rechte vorbehalten 2004,
Stadtbibliothek. Weltoffen und traditionell: die Schweizer Literatur der letzten zwei Jahrzehnte. Literaturkreis Stadtbibliothek
 Stadtbibliothek Weltoffen und traditionell: die Schweizer Literatur der letzten zwei Jahrzehnte Literaturkreis Stadtbibliothek September 2014 bis Mai 2015 Weltoffen und traditionell: die Schweizer Literatur
Stadtbibliothek Weltoffen und traditionell: die Schweizer Literatur der letzten zwei Jahrzehnte Literaturkreis Stadtbibliothek September 2014 bis Mai 2015 Weltoffen und traditionell: die Schweizer Literatur
Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes 'Faust' im Vergleich mit der Hiobswette aus der Bibel
 Germanistik Anonym Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes 'Faust' im Vergleich mit der Hiobswette aus der Bibel Studienarbeit Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes Faust im
Germanistik Anonym Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes 'Faust' im Vergleich mit der Hiobswette aus der Bibel Studienarbeit Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes Faust im
Sperrfrist: 5. November 2010, Uhr Es gilt das gesprochene Wort.
 Sperrfrist: 5. November 2010, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, bei der Verleihung des Preises
Sperrfrist: 5. November 2010, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, bei der Verleihung des Preises
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Interpretation zu Schiller, Friedrich von - Wallenstein
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Schiller, Friedrich von - Wallenstein Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Königs Erläuterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Schiller, Friedrich von - Wallenstein Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Königs Erläuterungen
Das Modell der Gewaltenteilung nach Montesquieu
 Politik Michael Brandl Das Modell der Gewaltenteilung nach Montesquieu Studienarbeit 1.) Einleitung... 2 2.) Biographie... 2 3.) Das Englandkapitel in Vom Geist der Gesetze... 3 3.1.) Allgemeines... 3
Politik Michael Brandl Das Modell der Gewaltenteilung nach Montesquieu Studienarbeit 1.) Einleitung... 2 2.) Biographie... 2 3.) Das Englandkapitel in Vom Geist der Gesetze... 3 3.1.) Allgemeines... 3
Zeitgenössische Kunst verstehen. Wir machen Programm Museumsdienst Köln
 Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages
 Hans-Gert Pöttering Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am
Hans-Gert Pöttering Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Portfolio: "Prinz Friedrich von Homburg" von Heinrich von Kleist
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Portfolio: "Prinz Friedrich von Homburg" von Heinrich von Kleist Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Portfolio: "Prinz Friedrich von Homburg" von Heinrich von Kleist Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Heines Reise von München nach Genua
 Germanistik Silvia Schmitz-Görtler Heines Reise von München nach Genua Eine Reise von der Tradition zur Utopie Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung 1 II. Heines Darstellung Italiens 2 1. Das
Germanistik Silvia Schmitz-Görtler Heines Reise von München nach Genua Eine Reise von der Tradition zur Utopie Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung 1 II. Heines Darstellung Italiens 2 1. Das
Mut zur Inklusion machen!
 Heft 4 - Dezember 2015 Mut zur Inklusion machen! Die Geschichte... von dem Verein Mensch zuerst Was bedeutet People First? People First ist ein englischer Name für eine Gruppe. Man spricht es so: Piepel
Heft 4 - Dezember 2015 Mut zur Inklusion machen! Die Geschichte... von dem Verein Mensch zuerst Was bedeutet People First? People First ist ein englischer Name für eine Gruppe. Man spricht es so: Piepel
Publikationen Studium Universale
 Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0
Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0
Selbstorganisation in der Wissenschaft wird meist durch eine Instabilität bisheriger Forschungssituationen gegenüber mehr oder weniger kleinen
 Vorwort Selbstorganisation in der Wissenschaft wird meist durch eine Instabilität bisheriger Forschungssituationen gegenüber mehr oder weniger kleinen Veränderungen des Zusammenhangs von Problemfeldern
Vorwort Selbstorganisation in der Wissenschaft wird meist durch eine Instabilität bisheriger Forschungssituationen gegenüber mehr oder weniger kleinen Veränderungen des Zusammenhangs von Problemfeldern
Königs Erläuterungen und Materialien Band 21. Auszug aus: Johann Wolfgang von Goethe. Faust Teil I. von Rüdiger Bernhardt
 Königs Erläuterungen und Materialien Band 21 Auszug aus: Johann Wolfgang von Goethe Faust Teil I von Rüdiger Bernhardt Die Lösungstipps beziehen sich auf die Seiten der vorliegenden Erläuterung. 1) Thema:
Königs Erläuterungen und Materialien Band 21 Auszug aus: Johann Wolfgang von Goethe Faust Teil I von Rüdiger Bernhardt Die Lösungstipps beziehen sich auf die Seiten der vorliegenden Erläuterung. 1) Thema:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Interpretation zu Büchner, Georg - Der Hessische Landbote
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Büchner, Georg - Der Hessische Landbote Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Königs Erläuterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Büchner, Georg - Der Hessische Landbote Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Königs Erläuterungen
Die Leibniz-Dauerausstellung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität im Sockelgeschoss des Hauptgebäudes, Welfengarten 1
 Die Leibniz-Dauerausstellung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität im Sockelgeschoss des Hauptgebäudes, Welfengarten 1 G.W. Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, Kopie aus dem Jahre
Die Leibniz-Dauerausstellung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität im Sockelgeschoss des Hauptgebäudes, Welfengarten 1 G.W. Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, Kopie aus dem Jahre
Klassiker-Lektüren. Band 13
 Klassiker-Lektüren Band 13 Heinrich Heine Gedichte und Prosa von Renate Stauf E R I C H SC H M I D T V E R LAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Klassiker-Lektüren Band 13 Heinrich Heine Gedichte und Prosa von Renate Stauf E R I C H SC H M I D T V E R LAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig
 90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
detaillierte Darstellung von Forschungshypothesen, Nachweismethoden und den daraus resultierenden Ergebnissen taugt nicht zum Bestseller, der über
 Vorwort Sie war schon nach wenigen Wochen vergriffen, die erste Auflage der Langzeitstudie mit dem Titel Musik(erziehung) und ihre Wirkung* zur Freude der Autoren, die viele Jahre an Berliner Grundschulen
Vorwort Sie war schon nach wenigen Wochen vergriffen, die erste Auflage der Langzeitstudie mit dem Titel Musik(erziehung) und ihre Wirkung* zur Freude der Autoren, die viele Jahre an Berliner Grundschulen
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur
 Inhalt Vorwort... 5 1. Heinrich von Kleist: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 16 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und
Inhalt Vorwort... 5 1. Heinrich von Kleist: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 16 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und
Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso
 Germanistik Katrin Saalbach Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso Studienarbeit Universität Erfurt BA-Literaturwissenschaft: Seminar: Die Kunst des Reisens. Deutschsprachige
Germanistik Katrin Saalbach Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso Studienarbeit Universität Erfurt BA-Literaturwissenschaft: Seminar: Die Kunst des Reisens. Deutschsprachige
Der Hofmeister im Wandel der Zeit
 Germanistik Fabian Schäfer Der Hofmeister im Wandel der Zeit "Der Hofmeister": Zu Lenz' Zeiten, in Brechts Bearbeitung und heute Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1. Parallelen zwischen dem Hofmeister
Germanistik Fabian Schäfer Der Hofmeister im Wandel der Zeit "Der Hofmeister": Zu Lenz' Zeiten, in Brechts Bearbeitung und heute Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1. Parallelen zwischen dem Hofmeister
Zum 250. Band der Zeitschrift Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
 Zum 250. Band der Zeitschrift Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Die 1846 von Ludwig Herrig und Heinrich Viehoff ins Leben gerufene Zeit - schrift Archiv für das Studium der neueren
Zum 250. Band der Zeitschrift Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Die 1846 von Ludwig Herrig und Heinrich Viehoff ins Leben gerufene Zeit - schrift Archiv für das Studium der neueren
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
I. Begrüßung Bedeutung von Freundschaft. Wenn man einen Freund hat braucht man sich vor nichts zu fürchten.
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 17.01.2014, 09:30 Uhr - Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Deutsch-Französischen
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 17.01.2014, 09:30 Uhr - Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Deutsch-Französischen
Zitate-Steckbrief. Vieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig. Johann Wolfgang von Goethe ( ), Dichter und Forscher
 Zitate-Steckbrief Vieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig. Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832), Dichter und Forscher www.hypnoseausbildung-seminar.de Einleitung Die Worte einer
Zitate-Steckbrief Vieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig. Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832), Dichter und Forscher www.hypnoseausbildung-seminar.de Einleitung Die Worte einer
Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven
 Geisteswissenschaft Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven Studienarbeit Hausarbeit im an der TU-Berlin Alfred Schütz und Karl Mannheim Ein Vergleich zweier
Geisteswissenschaft Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven Studienarbeit Hausarbeit im an der TU-Berlin Alfred Schütz und Karl Mannheim Ein Vergleich zweier
TCP/IP Grundlagen und Praxis
 D3kjd3Di38lk323nnm Gerhard Lienemann Dirk Larisch TCP/IP Grundlagen und Praxis Protokolle, Routing, Dienste, Sicherheit 2., aktualisierte Auflage Heise Gerhard Lienemann / Dirk Larisch, TCP/IP Grundlagen
D3kjd3Di38lk323nnm Gerhard Lienemann Dirk Larisch TCP/IP Grundlagen und Praxis Protokolle, Routing, Dienste, Sicherheit 2., aktualisierte Auflage Heise Gerhard Lienemann / Dirk Larisch, TCP/IP Grundlagen
WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli )
 ( grüne Farbe: ALLE ) WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli ) KREUZZEICHEN - LITURGISCHER GRUSS Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und das
( grüne Farbe: ALLE ) WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli ) KREUZZEICHEN - LITURGISCHER GRUSS Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und das
Anke Kallauch. Das große Buch der Glaubensfragen. Mit Illustrationen von Amelia Rosato
 Anke Kallauch Weiß Gott, Das große Buch der Glaubensfragen wer ich bin? Mit Illustrationen von Amelia Rosato Für meine Mutter Shirley Rosato und meine Töchter Louisa und Emma Inwood Amelia Rosato Dieses
Anke Kallauch Weiß Gott, Das große Buch der Glaubensfragen wer ich bin? Mit Illustrationen von Amelia Rosato Für meine Mutter Shirley Rosato und meine Töchter Louisa und Emma Inwood Amelia Rosato Dieses
Böll, Heinrich - Die verlorene Ehre der Katharina Blum
 Germanistik Stefanie Wimmer Böll, Heinrich - Die verlorene Ehre der Katharina Blum Studienarbeit GLIEDERUNG 1. TEXTTEIL 1 1.1. Einleitung 1.2. Kurzbiographie des Autors 1.2.1. Leben 1.2.2. Werke und erhaltene
Germanistik Stefanie Wimmer Böll, Heinrich - Die verlorene Ehre der Katharina Blum Studienarbeit GLIEDERUNG 1. TEXTTEIL 1 1.1. Einleitung 1.2. Kurzbiographie des Autors 1.2.1. Leben 1.2.2. Werke und erhaltene
Laudatio. des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Winfried Bausback. zur Aushändigung des Verdienstkreuzes am Bande. an Frau Marion Gopp. am 29.
 Der Bayerische Staatsminister der Justiz Prof. Dr. Winfried Bausback Laudatio des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Winfried Bausback zur Aushändigung des Verdienstkreuzes am Bande an Frau Marion Gopp am
Der Bayerische Staatsminister der Justiz Prof. Dr. Winfried Bausback Laudatio des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Winfried Bausback zur Aushändigung des Verdienstkreuzes am Bande an Frau Marion Gopp am
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Goethe, Johann Wolfgang von - Faust. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Goethe, Johann Wolfgang von - Faust Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Thomas Möbius Johann Wolfgang von Goethe
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Goethe, Johann Wolfgang von - Faust Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Thomas Möbius Johann Wolfgang von Goethe
Schriften der Goethe-Gesellschaft Übersicht
 Schriften der Goethe-Gesellschaft Übersicht Schriften der Goethe-Gesellschaft In der Reihe Schriften der Goethe-Gesellschaft sind folgende Bände erschienen: 1885 Bd. 1 Briefe von Goethes Mutter an Anna
Schriften der Goethe-Gesellschaft Übersicht Schriften der Goethe-Gesellschaft In der Reihe Schriften der Goethe-Gesellschaft sind folgende Bände erschienen: 1885 Bd. 1 Briefe von Goethes Mutter an Anna
Wissensaustausch im Agrar- und Ernährungssektor fördern
 Wissensaustausch im Agrar- und Ernährungssektor Leitbild der Schweizerischen Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA) 1 Stand: 17.03.15 Unser Profil Die Schweizerische Gesellschaft für
Wissensaustausch im Agrar- und Ernährungssektor Leitbild der Schweizerischen Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA) 1 Stand: 17.03.15 Unser Profil Die Schweizerische Gesellschaft für
Gestalten und Geschichten der Hebräischen Bibel
 Gestalten und Geschichten der Hebräischen Bibel Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 6 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann
Gestalten und Geschichten der Hebräischen Bibel Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 6 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann
Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin
 Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin Es gilt das Gesprochene Wort! Vom Sterben vor der Zeit hat Bruno Kreisky manchmal
Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin Es gilt das Gesprochene Wort! Vom Sterben vor der Zeit hat Bruno Kreisky manchmal
FÜREINANDER ein Kunstprojekt
 FÜREINANDER ein Kunstprojekt Konzept für das Kunstprojekt der Initiative Dialog der Generationen von in Zusammenarbeit mit den Deichtorhallen Hamburg unterstützt von der Stiftung Füreinander und der stilwerk
FÜREINANDER ein Kunstprojekt Konzept für das Kunstprojekt der Initiative Dialog der Generationen von in Zusammenarbeit mit den Deichtorhallen Hamburg unterstützt von der Stiftung Füreinander und der stilwerk
Schülerzeitungspreis: DIE RAUTE 2016
 Ursula Männle Schülerzeitungspreis: DIE RAUTE 2016 Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am 07.11.2016 unter www.hss.de/download/161107_raute_rede_gesamt.pdf Autor Prof. Ursula Männle Vorsitzende
Ursula Männle Schülerzeitungspreis: DIE RAUTE 2016 Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am 07.11.2016 unter www.hss.de/download/161107_raute_rede_gesamt.pdf Autor Prof. Ursula Männle Vorsitzende
0. Inhalt :12 Uhr Seite 1. Moritz Schlick Die frühen Jahre ( )
 0. Inhalt 1-12 01.04.2009 10:12 Uhr Seite 1 Moritz Schlick Die frühen Jahre (1881 1907) 0. Inhalt 1-12 01.04.2009 10:12 Uhr Seite 2 SCHLICKIANA Herausgegeben von Fynn Ole Engler, Mathias Iven und Hans
0. Inhalt 1-12 01.04.2009 10:12 Uhr Seite 1 Moritz Schlick Die frühen Jahre (1881 1907) 0. Inhalt 1-12 01.04.2009 10:12 Uhr Seite 2 SCHLICKIANA Herausgegeben von Fynn Ole Engler, Mathias Iven und Hans
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik
 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Abschlussbericht: Praktikum bei der Abendzeitung-München (November 2011 Januar 2012)
 Abschlussbericht: Praktikum bei der Abendzeitung-München (November 2011 Januar 2012) 1 Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin 24 Jahre alt und komme aus Italien. Ich habe Fremdsprachen und Literaturen
Abschlussbericht: Praktikum bei der Abendzeitung-München (November 2011 Januar 2012) 1 Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin 24 Jahre alt und komme aus Italien. Ich habe Fremdsprachen und Literaturen
Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie
 Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Der große und starke Elefant Ein junger Elefant wird gleich nach der Geburt
Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Der große und starke Elefant Ein junger Elefant wird gleich nach der Geburt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutsch-Quiz: Dramen. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch-Quiz: Dramen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Quiz zum Thema: Drama Merkmale,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch-Quiz: Dramen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Quiz zum Thema: Drama Merkmale,
Ideengeschichte der Physik
 Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen Kontext 2. Auflage Ideengeschichte der Physik Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen
Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen Kontext 2. Auflage Ideengeschichte der Physik Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen
Inhaltsverzeichnis von Band 1 30
 Inhaltsverzeichnis von Band 1 30 Abteilung I: Biographische Werke Band 1. Dichtung und Wahrheit (Aus meinem Leben). Buch 1 5. 2. Dasselbe. Buch 6 10. 3. Dasselbe. Buch 11 15. 4. Dasselbe. Buch 16 20. Briefe
Inhaltsverzeichnis von Band 1 30 Abteilung I: Biographische Werke Band 1. Dichtung und Wahrheit (Aus meinem Leben). Buch 1 5. 2. Dasselbe. Buch 6 10. 3. Dasselbe. Buch 11 15. 4. Dasselbe. Buch 16 20. Briefe
ich begrüße Sie sehr herzlich auf der Leipziger Buchmesse. Der Anlass, der uns heute zusammenführt, ist denkbar schön: Bücher.
 Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Professor Lässig, sehr geehrter Herr Bürgermeister Prof. Fabian, sehr geehrter Herr Buhl-Wagner, sehr geehrter Herr Zille, sehr geehrte Frau
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Professor Lässig, sehr geehrter Herr Bürgermeister Prof. Fabian, sehr geehrter Herr Buhl-Wagner, sehr geehrter Herr Zille, sehr geehrte Frau
angesichts all der Vertrauenskrisen in ihrem persönlichen und im öffentlichen Leben. ANNE & NIKOLAUS SCHNEIDER
 Vertrauen lehrt Menschen, das Leben zu lieben und das Sterben getrost in Gottes Hände zu legen. Und zugleich ist das Dennoch-Vertrauen eine unersetzbare Lebensader für eine menschenfreundliche Politik
Vertrauen lehrt Menschen, das Leben zu lieben und das Sterben getrost in Gottes Hände zu legen. Und zugleich ist das Dennoch-Vertrauen eine unersetzbare Lebensader für eine menschenfreundliche Politik
Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln
 Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Bildimpressionen von Weimar und Umgebung Karte von Weimar und Umgebung
 Bildimpressionen von Weimar und Umgebung 1. 1. Karte von Weimar und Umgebung (Karte nach www.openstreetmap.org) 1. 2. Karte von Weimar-Innenstadt (Karte nach www.openstreetmap.org) 1.3. Karte von Weimar-Altstadt
Bildimpressionen von Weimar und Umgebung 1. 1. Karte von Weimar und Umgebung (Karte nach www.openstreetmap.org) 1. 2. Karte von Weimar-Innenstadt (Karte nach www.openstreetmap.org) 1.3. Karte von Weimar-Altstadt
Die Zwanziger Jahre Tanz auf dem Vulkan Aufgabenteil A und B
 A Beobachtungsaufgaben Eine oder mehrere der jeweils vier (a d) genannten Lösungen sind richtig. Markiere den entsprechenden Buchstaben durch Umkreisen! A1 Im Zuge der Inflation fehlte es zahlreichen Menschen
A Beobachtungsaufgaben Eine oder mehrere der jeweils vier (a d) genannten Lösungen sind richtig. Markiere den entsprechenden Buchstaben durch Umkreisen! A1 Im Zuge der Inflation fehlte es zahlreichen Menschen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Liebeslyrik in Romantik und Gegenwart. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Kompetenzorientierte Unterrichtsreihen für die Vorbereitung auf das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Kompetenzorientierte Unterrichtsreihen für die Vorbereitung auf das
Evaluation. Europäische Märchen für DuisburgerInnen. In Kooperation mit der Stadtbibliothek Duisburg und unter der Schirmherrschaft von Studio 47
 Evaluation Europäische Märchen für DuisburgerInnen Eine Veranstaltung von Europe Direct Duisburg In Kooperation mit der Stadtbibliothek Duisburg und unter der Schirmherrschaft von Studio 47 Am Donnerstag,
Evaluation Europäische Märchen für DuisburgerInnen Eine Veranstaltung von Europe Direct Duisburg In Kooperation mit der Stadtbibliothek Duisburg und unter der Schirmherrschaft von Studio 47 Am Donnerstag,
Begrüssung. Liebe Leserin, lieber Leser
 Inhalt Begrüssung 7 Einleitung 9 Meine Geschichte 11 The Work eine Methode, Gedanken zu hinterfragen 29 Einstieg 29 Meine erste Work 38 Die Wirkungsweise von The Work 44 Nahtodforschung 51 Medialität 61
Inhalt Begrüssung 7 Einleitung 9 Meine Geschichte 11 The Work eine Methode, Gedanken zu hinterfragen 29 Einstieg 29 Meine erste Work 38 Die Wirkungsweise von The Work 44 Nahtodforschung 51 Medialität 61
was Paulus aus der Gemeinde in Korinth zu Ohren gekommen ist, fährt ihm durch Mark und Bein und bereitet ihm eine schlaflose Nacht.
 Liebe Gemeinde, was Paulus aus der Gemeinde in Korinth zu Ohren gekommen ist, fährt ihm durch Mark und Bein und bereitet ihm eine schlaflose Nacht. Aber was ist ihm zu Ohren gekommen? Dass die Gemeinde
Liebe Gemeinde, was Paulus aus der Gemeinde in Korinth zu Ohren gekommen ist, fährt ihm durch Mark und Bein und bereitet ihm eine schlaflose Nacht. Aber was ist ihm zu Ohren gekommen? Dass die Gemeinde
Eduard Schäfers (Autor) Gedichte zur Poesie der Liebe
 Eduard Schäfers (Autor) Gedichte zur Poesie der Liebe https://cuvillier.de/de/shop/publications/7387 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen, Germany
Eduard Schäfers (Autor) Gedichte zur Poesie der Liebe https://cuvillier.de/de/shop/publications/7387 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen, Germany
Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt um mit einem lauten Ooohh euer Bedauern auszudrücken ;-)
 Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Verwandten und Freunde, liebe Lehrer, meine Damen und Herren, die zu keiner dieser Gruppen gehören ICH HABE FERTIG! Das hat Giovanni Trappatoni, der
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Verwandten und Freunde, liebe Lehrer, meine Damen und Herren, die zu keiner dieser Gruppen gehören ICH HABE FERTIG! Das hat Giovanni Trappatoni, der
Werner Walsch ein Lebenswerk zur Mathematik-Methodik
 Werner Walsch ein Lebenswerk zur Mathematik-Methodik 7 Werner Walsch ein Lebenswerk zur Mathematik-Methodik Ein Blick zurück Lehrerstudium Mathematik an der Universität Halle- Wittenberg in den 1960ern
Werner Walsch ein Lebenswerk zur Mathematik-Methodik 7 Werner Walsch ein Lebenswerk zur Mathematik-Methodik Ein Blick zurück Lehrerstudium Mathematik an der Universität Halle- Wittenberg in den 1960ern
Predigt Joh 2,1-11 St. Lukas, Liebe Gemeinde! Wenn Ihr, Konfirmandinnen und Konfirmanden, einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin
 1 Predigt Joh 2,1-11 St. Lukas, 17.1.2016 Liebe Gemeinde! Wenn Ihr, Konfirmandinnen und Konfirmanden, einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin bekommt, die oder der neu an der Schule ist, dann seid Ihr
1 Predigt Joh 2,1-11 St. Lukas, 17.1.2016 Liebe Gemeinde! Wenn Ihr, Konfirmandinnen und Konfirmanden, einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin bekommt, die oder der neu an der Schule ist, dann seid Ihr
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Care-Paket Vor- und Frühgeschichte. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Care-Paket Vor- und Frühgeschichte Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Vor- und Frühgeschichte Arbeitsblätter
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Care-Paket Vor- und Frühgeschichte Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Vor- und Frühgeschichte Arbeitsblätter
VIII. Tierisch kultiviert Menschliches Verhalten zwischen
 Vorwort Den Abend des 9. November 1989 verbrachte ich in meinem WG-Zimmer in West-Berlin und lernte Statistik (für Kenner: Ich bemühte mich, den T-Test zu verstehen). Kann man sich etwas Blöderes vorstellen?
Vorwort Den Abend des 9. November 1989 verbrachte ich in meinem WG-Zimmer in West-Berlin und lernte Statistik (für Kenner: Ich bemühte mich, den T-Test zu verstehen). Kann man sich etwas Blöderes vorstellen?
Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts Online
 Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts Online Erstausgaben und Werkausgaben von der Frühaufklärung bis zur Spätaufklärung Herausgegeben von Paul Raabe / Bearbeitet von Axel Frey Deutsche Literatur des
Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts Online Erstausgaben und Werkausgaben von der Frühaufklärung bis zur Spätaufklärung Herausgegeben von Paul Raabe / Bearbeitet von Axel Frey Deutsche Literatur des
Zitate-Steckbrief. Sobald Du dir vertraust, sobald weißt Du zu leben. Johann Wolfgang von Goethe ( ), Dichter und Forscher
 Zitate-Steckbrief Sobald Du dir vertraust, sobald weißt Du zu leben. Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832), Dichter und Forscher www.hypnoseausbildung-seminar.de Einleitung Die Worte einer großen Persönlichkeit
Zitate-Steckbrief Sobald Du dir vertraust, sobald weißt Du zu leben. Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832), Dichter und Forscher www.hypnoseausbildung-seminar.de Einleitung Die Worte einer großen Persönlichkeit
Reformation heißt, die Welt zu hinterfragen.
 Reformation heißt, die Welt zu hinterfragen. Kampagne zum #Reformationssommer Reformationsjubiläum 2017 e.v. Feiern Sie mit uns 500 Jahre Reformation! 1517 begann eine weltweite Bewegung, die Kirche,
Reformation heißt, die Welt zu hinterfragen. Kampagne zum #Reformationssommer Reformationsjubiläum 2017 e.v. Feiern Sie mit uns 500 Jahre Reformation! 1517 begann eine weltweite Bewegung, die Kirche,
Dr. Michael Diechtierow
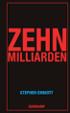 Dr. Michael Diechtierow michi@dpunkt.de Lektorat: Gerhard Rossbach, Rudolf Krahm Technische Redaktion: Rudolf Krahm Korrektorat: Sandra Gottmann Satz: Anna Diechtierow Herstellung: Birgit Bäuerlein Umschlaggestaltung:
Dr. Michael Diechtierow michi@dpunkt.de Lektorat: Gerhard Rossbach, Rudolf Krahm Technische Redaktion: Rudolf Krahm Korrektorat: Sandra Gottmann Satz: Anna Diechtierow Herstellung: Birgit Bäuerlein Umschlaggestaltung:
thomas mann Jahrbuch Band KLOSTERMANN Begründet von Eckhard Heftrich und Hans Wysling Herausgegeben von Katrin Bedenig und Hans Wißkirchen
 thomas mann Jahrbuch Band 29 2016 Begründet von Eckhard Heftrich und Hans Wysling Herausgegeben von Katrin Bedenig und Hans Wißkirchen KLOSTERMANN Herausgegeben in Verbindung mit der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft,
thomas mann Jahrbuch Band 29 2016 Begründet von Eckhard Heftrich und Hans Wysling Herausgegeben von Katrin Bedenig und Hans Wißkirchen KLOSTERMANN Herausgegeben in Verbindung mit der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft,
BEREICH 3: FESTE UND FEIERN
 BEREICH 3: FESTE UND FEIERN FEIERN IM 18. JAHRHUNDERT: GEBURTSTAGE UND HOCHZEITEN Geburtstage Fast jeder Mensch feiert heutzutage seinen Geburtstag. Das war aber nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
BEREICH 3: FESTE UND FEIERN FEIERN IM 18. JAHRHUNDERT: GEBURTSTAGE UND HOCHZEITEN Geburtstage Fast jeder Mensch feiert heutzutage seinen Geburtstag. Das war aber nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
