2., vollständig überarbeitete Auflage
|
|
|
- Rüdiger Kramer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hans Palmtag Mark Goepel Helmut Heidler Urodynamik 2., vollständig überarbeitete Auflage
2 Hans Palmtag Mark Goepel Helmut Heidler Urodynamik 2., vollständig überarbeitete Auflage Mit 209 Abbildungen 123
3 Prof. Dr. med. H. Palmtag Urologische Abteilung Städtisches Krankenhaus Arthur-Gruber-Str Sindelfingen Prof. Dr. med. M. Goepel Klinik für Urologie, Kinderurologie u. Urolog. Onkologie Klinikum Niederberg Robert-Koch-Str Velbert Prim. Univ.-Doz. Dr. med. H. Heidler Urologische Klinik Allgemeines Krankenhaus Krankenhausstr. 9 A-4020 Linz ISBN Springer Medizin Verlag Heidelberg Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikro verfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungs anlagen, bleiben, auch bei nur auszugs weiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts gesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts gesetzes. Springer Medizin Verlag springer.de Springer Medizin Verlag Heidelberg 2004, 2007 Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Marken schutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Planung: Dr. med. Lars Rüttinger, Heidelberg Projektmanagement: Ina Conrad, Heidelberg Einbandgestaltung: deblik Berlin SPIN: Satz: TypoStudio Tobias Schaedla, Heidelberg Gedruckt auf säurefreiem Papier
4 Vorwort Mit der 2. Auflage kommt der Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau einer erfreulich großen Nachfrage des gemeinschaftlich erstellten Buches»Urodynamik«nach. In dieser 2. Auflage haben dankenswerter Weise wieder alle Mitglieder dieses Arbeitskreises mitgearbeitet und alle Kapitel überarbeitet. In einer gemeinsamen internen Abstimmung wurden sowohl die Nomenklatur, als auch neue Daten mit aufgenommen. Zusätzlich wurden international standardisierte und validierte Fragebögen im Anhang abgedruckt. Es ist dem Verlag zu danken, dass in dieser 2. Auflage neue Abbildungen in Farbe mit aufgenommen werden konnten, außerdem eine nochmalige Qualitätsverbesserung dieser Abbildungen erreicht werden konnte. Unverändert bleibt zu wünschen, dass dieses Buch»Urodynamik«weiter Standardwerk in der urologischen Diagnostik bleibt und einen Beitrag dazu leistet, das Verständnis pathophysiologischer Zusammenhänge für Funktionsstörungen am unteren Harntrakt zu verbessern. Urodynamik stellt heute keine Subspezialität in der Urologie mehr dar, sondern ist fester elementarer Bestandteil der urologischen Routinediagnostik in Klinik und Praxis. Für die erneute Mitarbeit aller Arbeitskreismitglieder dürfen sich die Herausgeber bedanken. Ganz besonders gilt dieser Dank aber auch dem Springer Verlag für die unverändert stets gute Kooperation und für die Bereitschaft, in dieser 2. Auflage weitere Qualitätsverbesserungen mit aufzunehmen. Für den Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau Die Herausgeber H. Palmtag, Sindelfingen, M. Goepel, Velbert, H. Heidler, Linz
5 VII Inhaltsverzeichnis I Grundlagen 1 Geschichte der Urodynamik M. Goepel, B. Schönberger 1.1 Blasendruckmessung Uroflowmetrie Urodynamische Kombinationsuntersuchung Harnröhrendruckprofil Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun, K.-P. Jünemann 2.1 Anatomie des unteren Harntraktes Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) Zentrale Steuerung Periphere Innervation Neurophysiologie Harnspeicherung Harnentleerung Pharmakologie des Harntraktes C. Hampel, J.W. Thüroff 3.1 Einleitung Cholinerge Rezeptoren Adrenerge Rezeptoren Dopaminerge Rezeptoren Serotoninerge (5HT) Rezeptoren Purinerge Rezeptoren (P2X, P2Y) GABAerge Rezeptoren Pharmakologie der Glutaminsäure Pharmakologie von Glycin Peptiderge Rezeptoren (Opioide, VIP, Substanz P) Pharmakologie von Stickstoffmonoxid (NO) Pharmakologie der Prostaglandine Ionenkanäle (Ca, K) Toxine als Therapieoptionen (Capsaicin, RTX, Clostridium botulinum Toxin Typ A) Muskelrelaxanzien (Vinpocetin, Dicyclomin) Östrogene Pharmakologie des antidiuretischen Hormons (ADH) Zusammenfassung Funktionsstörungen des unteren Harntraktes H. Heidler, S. Schumacher 4.1 Terminologie Einführung Symptome des unteren Harntraktes (lower urinary tract symptoms, LUTS) Klinische Hinweise auf eine Dysfunktion des unteren Harntraktes Urodynamischer Befund und Beobachtungen während der urodynamischen Untersuchung Diagnosen Klassifikation der Funktionsstörungen Blasen- und Sphinkterfunktionsstörungen Neue Klassifikation der Harninkontinenz Pathophysiologie der Funktionsstörungen Speicherstörungen der Harnblase Entleerungsstörungen der Harnblase Urodynamik der oberen Harnwege S. Alloussi, C. Hampel 5.1 Anatomie und Physiologie des oberen Harntraktes Urodynamik des oberen Harntraktes Pharmakologische Beeinflussung des oberen Harntraktes II Urodynamische Untersuchung 6 Grundlagen urodynamischer Messmethoden W. Schäfer 6.1 Zielsetzung Physikalische Grundlagen Physikalische Eigenschaften des Drucks Praktische Probleme bei der Druckmessung Nullwert Referenzhöhe Externe und Mikrotiptransducer Detrusordruck Grundlagen der Signalkontrolle beim Druck Technische Voraussetzungen Grundausstattung Erweiterte Ausstattung Darstellung der Signale Dokumentation und Ausdruck Urodynamische Messverfahren Grundlagen der Uroflowmeterie Füllungszystometrie Kombinierte Druckflussstudien Urodynamische Messung des Harnröhrenverschlusses EMG
6 VIII Inhaltsverzeichnis 7 Anamnese und Basisuntersuchungen K.U. Laval, H. Palmtag 7.1 Anamnese Gynäkologische Anamnese Operationsanamnese Neurologische Anamnese Medikamentenanamnese Fragebögen Miktionskalender, Miktionsprotokoll, Miktionstagebuch Körperliche Untersuchung Vaginale Untersuchung Hustentest Urinuntersuchung Uringewinnung Urinbefundung Neurourologische Untersuchung Mentaler Status Motorische Funktionsprüfung Sensible Funktionsprüfung Untersuchung der Reflexaktivität der sakralen Segmente Uroflowmetrie B. Schönberger, S. Bross 8.1 Definition, Parameter, Symbole Technische Voraussetzungen Überlaufprinzip Luftverdrängungsprinzip Gravimetrisches Prinzip Rotationsdynamisches Prinzip Tauchstabprinzip Durchführung der Uroflowmetrie Aufklärung Räumliche Voraussetzungen Untersuchungsposition Interpretation der Ergebnisse Normale Harnflussraten und Harnflusskurven Pathologische Harnflussraten und Harnflusskurven Reproduzierbarkeit der Ergebnisse Homeuroflowmetrie Uroflowmetrie als Kombinationsuntersuchung Zystometrie P.M. Braun, K.-P. Jünemann 9.1 Messgrößen Füllungsphase Normalbefund Entleerungsphase Urethradruckprofil H. Heidler 10.1 Einleitung Technik Untersuchungsbedingungen Messprinzipien Ruheprofil Stressprofil (Belastungsprofil) Normalbefunde Ruheprofil Stressprofil (Belastungsprofil) Drucktransmission Passive Drucktransmission Aktive Drucktransmission Interpretation Urethradruckprofil Messung des Leak Point Pressure K. Höfner 11.1 Einleitung Detrusor leak point pressure Valsalva leak point pressure Cough leak point Methode Druckflussmessung K. Höfner 12.1 Grundlagen und Definitionen Druckflussanalyse Mechanische Obstruktion Funktionelle Obstruktion Kontraktilität Interpretation Ein-Punkt-Verfahren Zwei-Punkt-Verfahren (lineare PURR) Multiple-Punkte-Verfahren (PURR) Nomogramme ICS-Nomogramm Abrams-Griffiths-Number Schäfer-Nomogramm CHESS-Klassifikation Videourodynamik S. Alloussi, C. Hampel 13.1 Historische Entwicklung Das Prinzip der videourodynamischen Untersuchung Verfahren der Videourodynamik Indikation Nachteile
7 Inhaltsverzeichnis IX 14 Langzeiturodynamik P. M. Braun, K.-P. Jünemann 14.1 Einleitung Indikationen Methode Druckmessung Aufzeichnung Instruktionen für den Patienten Literaturauswertung Neurophysiologische Untersuchungen G. Kiss, H. Madersbacher 15.1 Einleitung Beckenbodenelektromyographie Evozierte Potentiale Bulbokavernosusreflex (BCR), Analreflex (AR) Methodik der BCR-Latenzzeitmessung Methodik der AR-Latenzzeitmessung Pudenduslatenzzeit (Pudendusneurographie) Motorisch evozierte Potentiale des N. pudendus (P-MEP) Algorithmen zur klinischen Anwendung Zusammenfassung Indikation zur urodynamischen Untersuchung B. Schönberger, K. Höfner 16.1 Indikation zur Uroflowmetrie Home-Uroflowmetrie Uroflow-EMG-Studie Indikation zur Zystometrie Füllungszystometrie Druckflussstudie Indikation zur Videourodynamik Indikation zur EMG im Rahmen einer Zystometrie Indikation zur Urethradruckprofilmessung Indikation zur Messung des leak point pressure Detrusor leak point pressure (LPP) Valsalva leak point pressure, Cough leak point pressure (VLPP, CLPP) Indikation zur Langzeiturodynamik Bildgebende Untersuchungen M. Goepel, H. Heidler 17.1 Röntgenuntersuchungen Ausscheidungsurogramm (AUG) Zystogramm Miktionszysturethrographie (MCU) Urethrogramm Videogestützte Untersuchung des unteren Harntraktes (Videourodynamik) Sonographie Niere, Harnleiter, Retroperitoneum Blase und Blasenhals Prostata und Samenblasen Introitus und Perineum Schnittbildverfahren CT des Abdomens und Beckens MRT des Abdomens und Beckens MRT des Beckenbodens MRT des Nervensystems III Spezielle Urodynamik 18 Spezielle Urodynamik der Frau H. Palmtag, H. Heidler 18.1 Einleitung Prolapsklassifikation Beckenbodenmuskelstärke Speicherstörungen Sensitivitätsstörung (Hypersensitivität) Detrusorbedingte Speicherstörung Auslassbedingte Speicherstörungen Mischinkontinenz Entleerungsstörungen Ungestörte Funktion Sensitivitätsstörung Hyposensitivität (sekundäre Megazystis) Detrusorbedingte Entleerungsstörungen Auslassbedingte Entleerungsstörungen Mischformen Spezielle Urodynamik des Mannes V. Grünewald, K. Höfner 19.1 Spezielle Aspekte der Blasenfunktionsstörung beim Mann Speicherstörungen Blasenhypersensitivität Detrusorbedingte Speicherstörungen Auslassbedingte Speicherstörungen Entleerungsstörungen Blasenhyposensitivität Detrusorhypokontraktilität akontraktiler Detrusor Blasenauslassobstruktion Klinischer Wert der urodynamischen Diagnostik beim Mann Urodynamik bei Blasenfunktionsstörungen des Kindes D. Schultz-Lampel, M. Goepel, B. Schönberger 20.1 Definitionen Enuresis
8 X Inhaltsverzeichnis Kindliche Harninkontinenz Ätiologie und Pathophysiologie Enuresis Kindliche Harninkontinenz Diagnostik Basisdiagnostik Weiterführende Diagnostik Häufigste urodynamische Befunde Wertigkeit der Urodynamik Schlussfolgerungen Spezielle Urodynamik beim alten Menschen D. Schultz-Lampel, H. Madersbacher 21.1 Altersbedingte Veränderungen der Blasenfunktion Abklärung der Harninkontinenz beim älteren Menschen Basisdiagnostik Indikationen zur Urodynamik beim alten Menschen Durchführung der Urodynamik beim alten Menschen Typische urodynamische Befunde beim alten Menschen Detrusorhyperaktivität Fazit Anamnese Studium der Akten Körperliche Untersuchung Miktionstagebuch Bildgebende Verfahren Urodynamische Untersuchung Pathologische Befunde Problematische Indikationsstellungen Harninkontinenz Entleerungsstörungen Begutachtung von Blasenfunktionsstörungen M. Stöhrer, H. Palmtag, J. Pannek 24.1 Unterschiede bei der Auftragserteilung Gesetzliche Unfallversicherung Sonstige Versicherungen Einteilung und Folgen von Blasenfunktionsstörungen Diagnostik Anhang A1 Urodynamische Normbereiche A2 Fragebögen A3 Verzeichnis der Synonyme Stichwortverzeichnis Urodynamik bei neurogener Blasenfunktionsstörung H. Madersbacher, M. Stöhrer, B. Schönberger, J. Pannek 22.1 Allgemeiner Teil Diagnostik vor einer urodynamischen Untersuchung Urodynamische Untersuchung Klinische Wertigkeit Ergänzende Untersuchungen Definitionen Spezieller Teil Urodynamik bei suprapontinen Läsionen Urodynamik bei spinalen suprasakralen Läsionen Urodynamik bei subsakralen und peripheren Läsionen unter besonderer Berücksichtigung der Myelomeningozele Urodynamik bei Blasenersatz M. Hohenfellner 23.1 Urodynamische Anforderungen an Harnableitungen Indikationen zur urodynamischen Untersuchung Ergänzende diagnostische Maßnahmen
9 XI Mitarbeiterverzeichnis Prof. Dr. med. S. Alloussi Urologische Abteilung Krankenhaus Neunkirchen Brunnenstr Neunkirchen PD Dr. med. P.M. Braun Klinik für Urologie Universitätsklinikum Kiel Arnold-Heller-Str Kiel PD Dr. med. S. Bross Urologische Klinik Klinikum Darmstadt Grafenstr Darmstadt Prof. Dr. med. M. Goepel Klinik für Urologie, Kinderurologie u. Urolog. Onkologie Klinikum Niederberg Robert-Koch-Str Velbert PD Dr. med. V. Grünewald Urologische Praxis in Bothfeld Sutelstr. 54A Hannover PD Dr. med. C. Hampel Urologische Klinik u. Poliklinik Johannes-Gutenberg- Universität Langenbeckstr Mainz Prim. Univ.-Doz. Dr. med. H. Heidler Urologische Klinik Allgemeines Krankenhaus Krankenhausstr. 9 A-4020 Linz Prof. Dr. med. K. Höfner Urologische Klinik Evangelisches Krankenhaus Oberhausen Virchowstr Oberhausen Prof. Dr. med. M. Hohenfellner Urologische Universitätsklinik Universitätsklinikum Heidelberg Im Neuenheimer Feld Heidelberg Prof. Dr. med. K.-P Jünemann Klinik für Urologie Universitätsklinikum Kiel Arnold-Heller-Str Kiel Dr. med. G. Kiss Neurourologische Ambulanz Universitätsklinik lnnsbruck Anichstr.35 A-6020 lnnsbruck Dr. med. K.-U. Laval Münsterstr Düsseldorf Prof. Dr. med. H. Madersbacher Neurourologische Ambulanz Universitätsklinik lnnsbruck Anichstr.35 A-6020 lnnsbruck Prof. Dr. med. H. Palmtag Urologische Abteilung Städtisches Krankenhaus Arthur-Gruber-Str Sindelfingen Prof. Dr. med. J. Pannek Chefarzt Neuro-Urologie Schweizer Paraplegiker-Zentrum CH-6207 Nottwil Prof. W. Schäfer DI Continence Research Unit University of Pittsburgh Medical School th Avenue Pittsburg, PA USA Prof. Dr. med. B. Schönberger Klinik für Urologie Universitätsklinikum Charité, Berlin Prof. Dr. med. D. Schultz-Lampel Kontinenz-Zentrum Klinik für Urologie Klinikum der Stadt Villingen- Schwenningen Röntgenstr Villingen-Schwenningen Prof. Dr. med. S. Schumacher Dept. of Urology Zayed Military Hospital PO-Box Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Prof. Dr. med. M. Stöhrer Urologische Klinik BG-Unfallklinik Prof. Küntscher-Str Murnau Prof. Dr. med. J.W. Thüroff Urologische Klinik und Poliklinik Johannes-Gutenberg-Universität Langenbeckstr Mainz
10 I I Grundlagen 1 Geschichte der Urodynamik 3 2 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes 11 3 Pharmakologie des Harntraktes 17 4 Funktionsstörungen des unteren Harntraktes 35 5 Urodynamik der oberen Harnwege 51
11 1 Geschichte der Urodynamik M. Goepel, B. Schönberger 1.1 Blasendruckmessung Uroflowmetrie Urodynamische Kombinationsuntersuchung Harnröhrendruckprofil 8 Literatur 9
12 4 Teil I Grundlagen 1 Schon im Altertum war bekannt, dass die Funktion der Harnblase vom Nervensystem beeinflusst wird. Das älteste bekannte Dokument ist wahrscheinlich der Edwin Smith-Papyrus [16], der aus der Zeit zwischen 1500 und 1300 v. Chr. stammt und darüber berichtet, dass die Paralyse der Blase nach einem spinalen Trauma auftritt. Galen ( v. Chr.) zeigte durch Tierexperimente, dass der Schweregrad einer Rückenmarksverletzung nicht nur eine Lähmung der unteren Extremitäten, sondern auch den Verlust der Blasenfunktion nach sich zieht [9]. Er beschrieb außerdem die Existenz eines Blasenmuskels oder des Schließmuskels, war aber der Meinung, dass die Kontraktionen der Bauchmuskeln die wichtigste Rolle bei der Miktion spielen. Die Theorie von Galen beeinflusste das medizinische Denken in dieser Hinsicht über Jahrhunderte. Auch der Physiologe Albrecht von Haller ( ; [14]); teilte Galens Beurteilung der Miktion, obwohl er die Beobachtung hinzufügte, dass die Kontraktion der Abdominalmuskulatur durch eine Kontraktion des Zwerchfells eingeleitet wurde. G. Valentin ( ), der als Professor für Physiologie in Bern arbeitete, hing ebenfalls der Theorie von Galen an, kam aber zu dem Schluss, dass neben der Bauchmuskulatur auch der Detrusormuskel einen wichtigen Anteil am Miktionsvorgang hat [23]. Er vermutete, dass der quergestreifte Schließmuskel willkürlich entspannt werden könne und dass eine Kontraktion der Abdominalmuskulatur bei der Miktion nur dann notwendig sei, wenn eine Obstruktion oder ein Prostataadenom vorhanden sei. Daneben beschrieb Valentin verschiedene Gründe für eine Harninkontinenz wie z. B. die Sphinkterschwäche und ebenso die Schwangerschaft: Der vergrößerte Uterus nimmt den gesamten Raum in der Beckenhöhle ein und dieser Druck, der durch Husten noch erhöht wird, ist die Ursache für Urinverlust. 1.1 Blasendruckmessung Heidenhein aus Breslau ( ) war der Erste, der an Versuchstieren den intravesikalen Druck beurteilbar machte. Er schloss daraus, dass Harnkontinenz abhängig ist vom Tonus des Schließmuskels, und dass dieser wiederum durch spinale Nervenzentren kontrolliert wird [16]. Etwa zur selben Zeit entdeckte Julius Budje ( ) in Greifswald die Existenz autonomer Kontraktionen der Blase und vermutete, dass Sakralnerven die einzigen motorischen Nerven mit Verbindung zur Harnblase seien [4]. Goltz entdeckte 1874 in Halle den lumbosakralen Reflex der Miktion [13]. Er beschrieb, dass die Miktion durch die Stimulation sakraler Dermatome oder durch erhöhten Druck auf die suprapubische Region ausgelöst werden kann. Kopressow führte im Rahmen einer Doktorarbeit 1870 in St. Petersburg die Theorie ein, dass das Miktionszentrum zwischen L5 und L6 lokalisiert sei [16]. Bis zu diesem Zeitpunkt stammte das gesamte Wissen über die Blasenfunktion aus Tierexperimenten. Schatz ( ) publizierte 1872 die Ergebnisse der ersten zystomanometrischen Blasendruckmessung beim Menschen. Nach seinen Erkenntnissen lag der Blasendruck während der Miktion im Bereich von 8 cm Wassersäule. Auf der Grundlage der Vorarbeiten von Schatz führte P. Dubois in Bern systematische Untersuchungen an Lebenden unter bestimmten Stressbedingungen und in unterschiedlicher Körperhaltung durch. Gleichzeitig nahm er auch Rektaldruckmessungen vor. Er beschrieb bei bestimmten Kranken unwillkürliche Detrusorkontraktionen mit Harnverlust, die er bei sich selbst nicht nachweisen konnte [8]. Der Durchbruch in der Untersuchung der Blasenfunktion ergab sich nach der Publikation von Mosso und Pellacani von 1881 [19]. Die Autoren beschrieben erstmals ein Zystometer, mit dem es gelang, intravesikale Druckschwankungen auf einem Rauchglaszylinderplethysmographen aufzuzeichnen. Sie entdeckten, dass der Blasenmuskeltonus sich an steigende Urinvolumina anpassen konnte, ohne dass der intravesikale Druck anstieg. Daneben gelang die Unterscheidung zwischen dem Anstieg des Bauchmuskeldruckes und des intravesikalen Druckes. Sie stellten außerdem fest, dass eine Blasenkontraktion nicht automatisch eine Relaxation des Sphinkterapparates nach sich zog. Fritz Born [16] führte die genannte Untersuchungstechnik in der Schweiz für Patienten mit Prostataadenom und Harnröhrenstriktur als klinische Untersuchungsmethode ein. Der große Förderer der klinischen Anwendung der Zystomanometrie war allerdings Felix Guyon in Paris. Dank seines Einflusses wurden zwischen 1882 und 1892 mehr als zehn Doktorarbeiten über die Physiologie der Harnblase in Paris publiziert war Desnos [16] der Erste, der Quecksilber statt Wasser in seinem Manometer benutzte. Gustav Trouve [16] beschrieb 1893 die Benutzung eines Instrumentes, welches er»contractometre vesical«nannte. Hier wurde ein Katheter mit einer Elektrode mit der Blasenwand in Kontakt gebracht. Daran wurde eine kalibrierte Säule angeschlossen, die den Untersucher in die Lage versetzte, die Stärke einer Blasenkontraktion abzulesen. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Zystometrie nur noch selten genutzt. Eine größere Arbeit stammt von Frankl-Hochwart und Zuckerkandl (1899) über die nervösen Erkrankungen der Blase. Sie stützten sich auch auf zystometrische Untersuchungen ( Abb. 1.1). Erst nach dem 1. Weltkrieg kam es erneut zu einer Reihe von Untersuchungen, nachdem tausende junger Soldaten an Querschnittlähmung mit nachfolgenden Miktionsproblemen litten.
13 5 1 Kapitel 1 Geschichte der Urodynamik Abb Versuchsanordnung zur Messung des Intravesikaldruckes mittels eines Wassermanometers. (Nach Frankl-Hochwart u. Zuckerkandl 1899) 1927 entwickelte Rose in St. Louis ein Quecksilbermanometer, mit dem eine kontinuierliche Messung des Blasendruckes während einer kontinuierlichen Blasenfüllung mit Wasser möglich war. Mit diesem Instrument war Rose in der Lage, Messkurven aufzuzeichnen, die denen der heutigen elektronischen Zystomanometrie sehr ähnlich waren. Um 1940 entwickelte Lewis [18] ein Zystometer, das wahrscheinlich das populärste und am meisten benutzte Zystometer der ganzen Welt war. Dieses Modell hatte den Vorteil ersetzbarer und sterilisierbarer peripherer Teile und war daneben preiswert und sehr kompakt. Später entwickelte sich dann das Luftzystometer, das die Möglichkeit eröffnete, die Blase in wenigen Minuten mit Luft zu füllen. Es war auch bei Kindern einsetzbar. Diese Gaszystometrie wurde primär von Gleason und Kollegen gefördert und bis 1977 regelmäßig eingesetzt [11]. Nach einer Reihe von Luftembolisationen wurde anstatt Luft CO 2 -Gas eingesetzt. Im Rahmen dieser CO 2 -Gaszystometrie wurden empfindlichere und kompaktere elektronische Geräte entwickelt. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zystometrische Untersuchungen vorgenommen, die den Einfluss von Pharmaka auf die Blasenfunktion untersuchten [21]. Das klinische Interesse an derartigen Studien erwachte aber erst in den 50er-Jahren ( Abb. 1.2, Abb. 1.3, Abb. 1.4 [2]). In den 60er-Jahren erfolgte die Entwicklung verschiedener englumiger und mehrlumiger Messkatheter, so dass verschiedene Parameter gleichzeitig Abb Einfaches Zystometer. (Nach Bauer 1951)
14 6 Teil I Grundlagen 1 Abb Schema der Apparatur zur Zystometrie von Povlsen (1951) unter Verwendung eines Quecksilbermanometers und eines einfachen Aufzeichnungsgerätes Abb Uroflowmeter nach dem Waageprinzip mit angeschlossenem Kympgraphen. (Drake [7]) Abb Zystometrogramm einer Normalblase vor (gestrichelte Linie) und nach (durchgezogene Linie) Strychnin (Invocan 2 ml täglich, 1 Amp. s.c.) registriert werden konnten. Kurze Zeit später wurden dann die aus der kardiovaskulären Chirurgie bekannten Mikrotransducer für die Zystomanometrie adaptiert. 1.2 Uroflowmetrie Die ersten Anstrengungen zur Messung der Harnstrahlgeschwindigkeit und -kraft stammen vermutlich aus dem Altertum: Hier existieren Darstellungen zweier kleiner Jungen, die Kraft und Weite ihres Harnstrahles vergleichen. Im Mittelalter beschrieb der Theologe Albertus Magnus eine Untersuchung zur Prüfung der Jungfernschaft. Hierbei wurde postuliert, dass Jungfrauen einen höheren Harnstrahl als verheiratete Frauen produzieren könnten wurde festgestellt, dass der von Albertus Magnus beschriebene Test bei den Ureinwohnern der Humahuaca-Region im Norden Argentiniens immer noch angewendet wird. Im Jahr 1902 wurde das erste primitive Uroflowmeter von Havelock Ellis beschrieben [16], einem Pionier der Urophysiologie. Die erste wissenschaftliche Urinflowmessung ist aber wahrscheinlich von Rehfisch 1897 durchgeführt worden [20]. Dabei interessierte ihn nur der Miktionsbeginn, nicht aber der mittlere oder maximale Uroflowwert. Andere, exakte Messungen des Harnflusses wurden durchgeführt von Schwartz und Brenner [22]. Die erste direkte Flowuntersuchung wurde von Drake 1948 durchgeführt ( Abb. 1.5). Er sammelte und wog den entleerten Urin in einem Messgefäß [7]. Drake ist um diese Zeit auch die Kreation des Begriffes Uroflowmeter zuzuschreiben. J.J. Kaufmann verbesserte dieses Instrument im Jahre 1957 und zeigte, dass die mittlere Miktionsgeschwindigkeit etwa bei 20 ml/s lag. Eine weitere Modifikation wurde von B. von Garrelts 1956 beschrieben [10]. Er führte einen Gewichtsumformer zur Aufzeichnung der entleerten Miktionsmenge in die Untersuchung ein. Auch das Luftverdrängungsprinzip wurde wieder eingesetzt ( Abb. 1.6 [1]). Weitere Modifikationen dieses Prinzips wurden bei Whitacker und Johnson 1966 [25] und bei Glaeson, Bottacini und Bryne beim ersten internationalen Symposium für Urodynamik in Aachen 1971 beschrieben [12].
15 7 1 Kapitel 1 Geschichte der Urodynamik Abb Uroflowmeter nach dem Luftverdrängungsprinzip. (Nach Bressel et al. 1968) 1.3 Urodynamische Kombinationsuntersuchung Die erste vollständig dokumentierte urodynamische Untersuchung der Beziehung von Blasendruck und Urinfluss war von Rehfisch 1897 publiziert worden ( Abb. 1.1, [20]). Er entwickelte eine Methode, den Blasendruck und den Harnfluss simultan zu registrieren. Wie schon oben bemerkt, nutzte er seine Versuchsanordnung aber noch nicht im heutigen Sinne aus. Die Arbeit wurde in Virchows Archiv für Pathologie, Anatomie und Physiologie unter dem Titel»Über den Mechanismus des Harnblasenverschlusses und der Harnentleerung«publiziert ( Abb. 1.7). Die modernen Konzepte der Urodynamik entwickelten sich in den frühen 50er-Jahren. In dieser Zeit begann Frank Hinmann, die Form, Größe und Position der Harnblase während der Füllung und Enteerung als eine Funktion der Zeit aufzuzeichnen. Dabei benutzte er einen schnellen automatischen Röntgenkassettenwechsler. Später wurde diese Untersuchung mittels Röntgenfilm durchgeführt. Weitere Verbesserungen dieser Technik erfolgten durch die Bildverstärkertechnik sowie die Videotransmission der Bilder und die Einführung des Videobandes ( Abb. 1.8). In den frühen 60er-Jahren konnte G. Enhorning [8a] in Schweden als Erster simultane Druckkurven für die Füllungs- und Entleerungsphase gleichzeitig in der Blase, in der Harnröhre und im Rektum durchführen. Der sich aus dieser Arbeit entwickelnde Kontakt und die spätere Zusammenarbeit zwischen Enhorning und Hinman an der Universität von Kalifornien führte zur Entwicklung der heutigen urodynamischen Untersuchung, wobei zunächst von Hydrodynamik des Harntraktes, später dann von Urodynamik gesprochen wurde. Die Elektromyographie wurde ebenfalls als Untersuchungstechnik in die urodynamische Untersuchung eingeführt. Bradley und andere versuchten auf diese Weise, die Sphinkterfunktion Abb Versuchsanordnung von Rehfisch (1897). Zweikanalmessung unter Verwendung eines Blutdruckmanometers, eines Harnflussregistriergerätes (Luftverdrängungsprinzip) und eines GAD-Volumenschreibers (Aeroplethysmograph) und mögliche Dysfunktionen bei der Blasenfüllung und -entleerung genauer zu beurteilen [3]. Das Jahr 1968 ist ein wichtiges Datum in der Geschichte der Urodynamik, denn in diesem Jahr fand der 1. Internationale Workshop über die Hydrodynamik der Miktion statt. Im gleichen
16 8 Teil I Grundlagen 1 Abb Schema einer Mehrkanalmessung Jahr tagte die Nephrourologische Arbeitsgemeinschaft in Homburg an der Saar und diskutierte aktuelle Probleme der neurogenen Blasenstörungen mit internationalen Experten [1]. Im Juli 1971 wurde dann das 1. Internationale Symposium für Urodynamik unter der Leitung von W. Lutzeyer und W. Gregoir in Aachen durchgeführt. Eine weitere Entwicklung in der Urodynamik umfasst die Langzeiturodynamik und die Telemetrie. Die ersten Experimente in dieser Richtung wurden 1962 von Gleason durchgeführt. Er platzierte einen Messkatheter für die Aussendung von Radiosignalen mit einem Mikrotransducer in der Blase, aber die Ergebnisse konnten nicht recht interpretiert werden, da die intravesikal platzierte Aufzeichnungskapsel mit einem Durchmesser von 3 1 cm wie ein Blasenstein wirkte und starke Blasenkontraktionen auslöste. Ein Jahr später konnten Warrell, Watson und Shelley [24] die ersten interpretierbaren Ergebnisse telemetrischer urodynamischer Untersuchungen erzielen. Die aktuellste Entwicklung der urodynamischen Untersuchungstechnik ist die Aufzeichnung evozierter Potenziale. Somatosensorisch evozierte Potenziale wurden etwa um 1947 von Dawson in die Untersuchungstechnik eingeführt [5] beschrieben Gersterberg und Mitarbeiter als Erste zerebral evozierte Potenziale, die durch sensible Harnröhrennerven vermittelt wurden, und 1982 somatosensorisch evozierte Potenziale für den N. pudendus, die Harnröhre und die Blasenwand. 1.4 Harnröhrendruckprofil Dennis-Brown und Robertson führten 1933 einen koaxialen Katheter in die Blase ein, wobei der innere Katheter in der Blase verblieb, während der äußere Katheter während der Messung zurückgezogen wurde und an verschiedenen Stellen den Druck in der Harnröhre maß [6]. Simons benutzte bereits 1936 ein Mikrozystometer, um diese Untersuchung durchzuführen [16]. Diese Methode blieb bis in die 50er-Jahre unverändert. Zu dieser Zeit konnte Karlson [15] Mikrotransducer und elektronisch empfindliche Sonden zur simultanen Messung von Blasen- und Harnröhrendruck in die Untersuchungstechnik einführen. Bei all diesen Untersuchungen, die der Messung des Sphinkterdruckes dienen sollten, wurden flüssigkeitsgefüllte Ballonsysteme in die Harnröhre eingeführt. Auf diesem Wege konnte Langworthy bereits 1940 nachweisen, dass die Harnröhre mehr als nur eine passive Rolle bei der Miktion spielen müsste [17]. Er führte das
17 9 1 Kapitel 1 Geschichte der Urodynamik Literatur Abb Schema einer Harnröhrendruckprofilometrie. (Nach Brown und Wickham) Konzept des urethralen Widerstandes in die theoretischen Überlegungen ein und versuchte diesen auch messbar zu machen. Er schloss aus seinen Untersuchungen, dass ein wesentlicher Teil des urethralen Widerstandes im mechanischen Druck der perinealen Muskulatur zu suchen sei. Enhorning [8a] war einer der Pioniere in der Erforschung der Belastungsinkontinenz von Frauen. Dieses Phänomen untersuchte er mit Hilfe eines Doppelballonkatheters. Die Ergebnisse dieser Studien wurden Anfang der 60er-Jahre publiziert. Brown und Wickham maßen 1969 den urethralen Druck, der notwendig ist, um einen konstanten Fluss durch die Urethra aufrecht zu erhalten, und nannten diese Untersuchung Perfusionsharnröhrendruckmessung ( Abb. 1.9). Harrison und Constabel waren die Ersten, die 1970 einen mechanischen Rückzugsapparat für den Harnröhrendruckprofilkatheter benutzten. Gleason verband diese Untersuchungseinheit mit einer Pumpe, die einen konstanten Fluss über die gesamte Länge der Harnröhre bei der Perfusionsprofilometrie sicherstellte. Im Jahr 1977 wurde der Begriff urethraler Verschlussdruck von der Internationalen Gesellschaft für Kontinenz offiziell als urodynamischer Fachbegriff anerkannt. Die weitere Entwicklung der urodynamischen Untersuchungstechnik in den letzten 20 Jahren ist vor allem gekennzeichnet von einer Weiterentwicklung der technischen Ausrüstung und der Aufzeichnungsgeräte, die mit Beginn des Computerzeitalters sämtlich digitalisiert wurden. Ob sich dadurch die Untersuchungsqualität wesentlich verbessert hat, ist bis heute nicht entschieden. Die primäre Datenerfassung durch externe Transducer oder Mikrotipkatheter ist jedenfalls seit Ende der 60er-Jahre bis heute unverändert geblieben. 1. Allert ML, Bressel M, Sökeland J (1969) Neurogene Blasenstörungen Aktuelle Probleme. Thieme, Stuttgart 2. Bauer K (1952) Zur pharmakologischen Beeinflußung des Blasentonus. Urol (Sonderheft) 2: Bradley WE, Scott FB, Timm GW (1974) Sphincter electromyography, Urol Clin North Am 1: Budje J (1864) Über den Einfluß des Nervensystems auf die Bewegung der Blase. Z Rat Med 21: Dawson GD (1947) Cerebral responses to electrical stimulation of the peripheral nerve in man. J Neurol Neurosurg Psychiatry 10: Dennis-Brown D, Robertson EG (1933) On the physiology of micturiti-on. Brain 56: Drake WM (1948) Uroflowmeter: Aid to the study of the lower urinary tract. J Urol 59: Dubois P (1876) Über den Druck in der Harnblase. Dtsch Arch Klin Med a. Enhorning G (1961) Simultaneous recording of intravesical and intraurethral pressure. Acta Chir Scan [Suppl] 276: 9 9. Galen C (1968) On the usefulness of the parts of the body. (translated by MT May.) Cornell Univ Press, Ithaka 10. Garrelts B von (1956) Analysis of micturition. Acta Chir Scan 112: Gleason DM, Bottacini M, Byrne J (1971) Measurement of urethral resis- tance. 1. International Symposium on Urodynamics, Aachen, abstracts, pp Gleason DM, Bottacini MR, Reilly RJ (1977) Comparison of cystometro-grams and urethral profiles with gas and water media. Urology 9: Goltz F (1874) Über die Funktion des Lendenmarkes des Hundes. Pflügers Arch Gesamte Physiol Menschen Tiere 8: Haller A von (1778) Elementa physiologiae, vol VII, Lausanne 15. Karlson S (1953) Experimental studies on functioning of the female urinary bladder and urethra. Acta Obstet Gynecol Scand 32: Küss R, Gregoir W (1988) Histoire illustrée de l Urologie. Roger Dacosta, Paris 17. Langworthy OR, Drew JE, Vesa SA (1940) Urethral resistance in relation to vesical activity. J Urol 43: Lewis LG (1943) Treatment of the neurogenic bladder after acute spi-nal injury. Surg Clin North Am 23: Mosso A, Pellacini P (1881) Sulle funzioni della vesica. Arch Ital Biol 12: Rehfisch E (1897) Über den Mechanismus des Harnblasenverschlusses und der Harnentleerung. Virchows Arch 150: Schwarz O (1918) Zur Pharmakotherapie der Miktionsstörungen. Arch Klin Chir 110: Schwarz O, Brenner A (1921) Untersuchungen über die Physiologie und Pathologie der Blasenfunktion. Z Urol Chir 8: Valentin G (1847) Lehrbuch der Physiologie, vol 10. Braunschweig, S Warrell DW, Watson BW, Shelley T (1963) Intravesical pressure measure-ment in women during movement during a radio pill and air probe. J Obstet Gynecol Br Commw 70: Whitaker J, Johnson GS (1966) Estimation of urinary outflow resistance in children: Simultaneous measurement of bladder pressure, flow rate and exit pressure. Investig Urol 3: 379
18 2 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun, K.-P. Jünemann 2.1 Anatomie des unteren Harntraktes Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) Zentrale Steuerung Periphere Innervation Neurophysiologie Harnspeicherung Harnentleerung 15 Literatur 16
19 12 Teil I Grundlagen Anatomie des unteren Harntraktes Morphologisch aus unterschiedlichen Geweben aufgebaut, wirken Blase und Urethra als funktionelle Einheit zusammen und erfüllen die Aufgaben der Harnspeicherung und Harnentleerung. Die Harnblasenmuskulatur (Detrusor vesicae) setzt sich aus drei muskulären Schichten zusammen (einer inneren und äußeren Längsschicht sowie einer mittleren Zirkulärschicht), die bei Kontraktion eine konzentrische Verkleinerung des Blasenlumens bewirken. Im Bereich des Blasenhalses geht die Blasenmuskulatur in das dreieckförmig angelegte Trigonum vesicae über, das die laterokranial mündenden Harnleiter aufnimmt. Das ebenfalls aus glatten Muskelzellen aufgebaute Trigonum verjüngt sich zum Blasenhals hin und mündet in die proximale Harnröhre. An dieser Stelle geht der dreischichtige muskuläre Aufbau verloren und wird von einer beim Mann zirkulär angeordneten, bei der Frau längs gerichteten glattmuskulären Schicht der proximalen Harnröhre ersetzt, die als Blasenhals bezeichnet wird ( Abb. 2.1). Im weiteren Verlauf der Urethra, weiter distal auf dem Niveau des Beckenbodens gelegen, findet sich der für die Kontinenz relevante Harnröhrensphinkter, der sich aus der intramuralen Harnröhrenmuskulatur, der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur (Mm. transversi perinei profundus und superficialis und M. levator ani und dem aus glatten und quergestreiften Muskelfasern aufgebauten, W-förmigen Sphincter urethrae zusammensetzt. Die Muskelfasertypen des Harnröhrenschließmuskels erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Durch einen Dauertonus sog. Slow-twitch-Fasern wird die Kontinenz in Ruhe aufrechterhalten. Durch die additive schnelle Kontraktion sog. Fast-twitch-Fasern wird die Kontinenz unter Belastung (Stress durch Hustenstoß, Niesen usw.) gewährleistet. Neben der rein funktionellen Integrität der genannten Muskelgruppen ist die korrekte topographische Lage der Urethra im kleinen Becken wesentlich. 2.2 Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) Zentrale Steuerung Die Steuerung von Harnspeicherung und Harnentleerung wird durch zwei übergeordnete Zentren kontrolliert: durch das in der Großhirnrinde (Lobus frontalis und Corpus callosum) gelegene motorische zerebrokortikale Zentrum, das für die willkürliche Detrusorsteuerung verantwortlich ist und in direkter Verbindung mit dem Thalamus steht ( Abb. 2.2); Vom pontinen Miktionszentrum zieht das motorische Neuron entlang der Seitenstränge des Rückenmarks, und zwar im Tractus reticulospinalis, zu dem sakralen Miktionszentrum (S2 S4). Dort wird der zerebral kontrollierte Befehl einer koordinierten Blasenkontraktion und Sphinkterrelaxation umgesetzt und über viszero- und somatomotorische Nervenfasern weitergeleitet. Über die afferenten Leitungsbahnen der Hinterstränge des Rückenmarks sowie über die nicht umgeschalteten Bahnen des Tractus spinothalamicus gelangen sowohl die exterozeptiven (Schmerz, Temperatur, Berührung) als auch die propriozeptiven (Dehnungs-, Kontraktionszu- Abb Anatomie des männlichen und weiblichen unteren Harntrakts. Beim Mann wird der Blasenhals von zirkulär angeordneten Muskelfasern gebildet; bei der Frau ist diese Muskelschicht längs der Urethra angeordnet. 1 Detrusor 2 Trigonum 3 Blasenhals 4 Prostatakapsel 5 M. levator ani 6 M. transversus perinei 7 M. bulbocavernosus 8 glattmuskulärer Harnröhrenanteil [1]
20 13 2 Kapitel 2 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes stand) Reize der intramuskulären und mukösen Rezeptoren der Blasenwand zum Thalamus und informieren über Blasenfüllungsgefühl und Harndrang ( Abb. 2.3). Darüber hinaus stehen einzelne sensorische Bahnen in direktem Kontakt mit dem Kleinhirn und den Basalganglien. Der mit der motorischen Großhirnrinde in direktem axonalen Kontakt stehende Thalamus initiiert den Detrusorreflex, der im pontinen Miktionszentrum weiter moduliert wird, bevor die Impulse an das sakrale Miktionszentrum weitergeleitet werden. Der Kortex ist für die hemmenden Einflüsse verantwortlich. Informationen über die quergestreifte Beckenbodenmuskulatur und den Harnröhrensphinkter steigen in den Hintersträngen des Rückenmarks zum Hirnstamm und Kleinhirn auf bzw. werden bereits auf sakraler Ebene umgeschaltet. Der Hirnstamm leitet diese Informationen a c b Abb a Sympathische und parasympathische Innervation von Detrusor und Blasenhals. b Sympathische und somatische Innervation von Blasenhals und Sphinkter. c Dem übergeordnet ist das pontine Miktionszentrum. 1 glattmuskuläre Blasenwand 2 glattmuskulärer Blasenhals 3 glattmuskulärer Harnröhrensphinkteranteil 4 M. Levator ani (quergestreift) 5 M. transversus perineus (quergestreift) 6 M. bulbocavernosus (quergestreift) Urothelium PGs+ ATP+ ACh+ NO - IC Lamina propria Basal membrane VIP- PACAP - Muscularis mucosae IC Detrusor IC = interstitial cells A delta fiber C-fiber C-fiber K-E Andersson, 2005 Abb Rezeptortypen und Transmitter am unteren Harntrakt
21 14 Teil I Grundlagen 2 über Axone an den Thalamus weiter, der mit der Area pudendalis kommuniziert, von wo aus efferente, motorische Nervenfasern durch die innere Kapsel, die Hirnstammregion und über die Seitenstränge des Rückenmarks zu den Vorderhörnern des Sakralmarkes (S2 S4) gelangen. Eine suprasakrale Unterbrechung der übergeordneten pontinen Signale führt zum Fehlverhalten im sakralen Miktionszentrum; Harnspeicherung und Harnentleerung sind nicht mehr koordiniert regulierbar. Dieses streng hierarchische Kontroll- und Steuerungssystem von Speicherung und Entleerung erklärt auch, dass ein Kleinkind, bei dem die zentralen Nervenbahnen erst ausreifen müssen und das durch die Erziehung erst konditioniert wird, unkontrolliert einnässt. Es erklärt ebenfalls, weshalb ein querschnittgelähmter Patient durch Rückenmarksverletzung oberhalb des sakralen Miktionszentrums (suprasakrale Läsion) aufgrund der fehlenden willkürlichen Steuerung inkontinent wird Periphere Innervation Sympathisch Die vom thorakalen Grenzstrang entspringenden sympathischen Nervenfasern gelangen über den N. hypogastricus an ihre beiden Angriffspunkte des unteren Harntrakts: die Blasenwand, die Blasenhalsregion und die proximale Harnröhre. Über betaadrenerge Rezeptoren in der Blasenwand wird eine Hemmung der Detrusoraktivität erreicht, selektive alphaadrenerge Rezeptoren stimulieren den Blasenhals, wodurch bei zunehmender Blasenfüllung einerseits eine Ruhigstellung des Detrusors, andererseits eine zunehmende Tonisierung des Blasenhalses und der proximalen Urethra als Teil des Kontinenzmechanismus erreicht wird. Die sog. non-adrenergen non-cholinergen Neurotransmitter (NANC) wie beispielsweise VIP (vasoaktives intestinales Polypeptid), NPY (Neuropeptid Y) oder Substanz P als Überträgerstoffe sind für die Beeinflussung von Blasenkontraktion und -relaxation von Bedeutung. Analog zu anderen glattmuskulären Organen (z. B. Corpora cavernosa des Penis) wird Stickoxid (NO; bzw. NOS- NO-Synthese), als relaxierendes Agens an der Muskelzelle des Detrusors, eine Schlüsselfunktion an der Harnblase zugesprochen. Somatisch Beckenbodenmuskulatur und Harnröhrensphinkter werden ebenfalls aus den Sakralsegmenten S2 S4 innerviert. Neben separaten somatomotorischen Fasern aus S2 und S3, die zum M. levator ani ziehen, wird die übrige Beckenbodenmuskulatur einschließlich des M. transversus perineus über den N. pudendus innerviert (Abb. 2.2). Die periphere Innervation des unteren Harntrakts läuft sowohl über viszerale als auch über somatische Nervenfasern. Dabei führt das dem sakralen Miktionszentrum entspringende pelvine Nervengeflecht (Plexus pelvicus) parasympathische Fasern, während die sympathische Innervation über die Nn. hypogastrici erfolgt, die dem thorakalen Grenzstrang aus Th10 L2 entstammen. Die somatischen Leitungsbahnen verlaufen sowohl über den N. pudendus aus den Segmenten S2-S4 als auch separaten somatomotorischen Fasern aus S2 und S3 über den pelvinen Nervenplexus zum Zielorgan ( Abb. 2.2). 2.3 Neurophysiologie Komplexität und neurale Eigenständigkeit des unteren Harntrakts bieten ein weites Spektrum vielfältiger Fehlfunktionen und Schädigungsmöglichkeiten dieses neuromuskulären Systems, die zu unterschiedlichsten Formen von Blasenspeicher- und Entleerungsstörungen führen können Harnspeicherung Parasympathisch Die präganglionären parasympathischen Nervenfasern entspringen dem sakralen Miktionszentrum und werden im Plexus pelvicus bzw. erst in der Blasenwand auf postganglionäre cholinerge Neurone umgeschaltet ( Abb. 2.2a). Detrusorkontraktion und Detrusortonus sind parasympathisch kontrollierte Funktionszustände. Mit zunehmender Blasenfüllung tritt eine Dehnung der Blasenwandmuskulatur (Detrusor vesicae) ein, die den volumenbedingten Druckanstieg kompensiert und den intravesikalen Druck bis zum Erreichen der maximalen Blasenfüllungskapazität geringfügig bis maximal 15 cm H 2 O ansteigen lässt. Die Dehnbarkeit der Harnblase ist direkt abhängig von der Wandspannung des Detrusors (intravesikaler Druck) in Abhängigkeit vom Füllungsvolumen und wird als errechneter Detrusorkoeffizient (Compliance; C=n V/n p) angegeben. Dieser Vorgang vollzieht sich nahezu wahrnehmungsfrei, da die durch die vermehrte Dehnung aktivierten afferenten Signale bereits intraspinal oder zerebral unterdrückt werden. Ab einem Füllungsvolumen von etwa ml wird ein erstes Harndranggefühl registriert, das mit Erreichen der Blasenkapazität zwischen 350 und 450 ml als starker Harndrang wahrgenommen wird. Über das zentral gelegene pontine Miktionszentrum kann durch willkürliche Hemmung des Miktionsreflexes die Detrusor-
22 15 2 Kapitel 2 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes Abb Normale Speicher- und Entleerungsphase. P ves = intravesikaler Durck, P ura = intraurethraler Druck, EMG = Beckenboden, S = Sensibilität, 1. HD = 1. Harndrang, 1. MV = 1. Miktionsversuch, 2. MV = 2. Miktionsversuch, Stopp = willkürliche Miktionsunterbrechung Halteversuch (Aus Jünemann [1]) Tab Normalbefunde der Speicherphase (Anhaltswerte Erwachsener) Compliance (C) (>25 ml/cm H 2 O) Erster Harndrang (1. HD) Zystometrische Blasenkapazität Funktionelle Blasenkapazität Detrusoraktivität Beckenboden-EMG = ml = ml Zystometrische Blasenkapazität minus Restharn Keine oder geringgradiger Druckanstieg Aktivität mit zunehmender Blasenfüllung ansteigend Harnröhrenverschlussdruck (p ura ) Intravesikaler Druck (p ves ) kontraktion so lang unterdrückt werden, bis die äußeren Umstände eine Blasenentleerung zulassen ( Tab. 2.1). Während der gesamten Speicherphase bleibt der Blasenhals verschlossen, die Muskelaktivität des Sphinkters nimmt kontinuierlich zu ( Abb. 2.4). Sowohl willkürliche als auch unwillkürliche intraabdominelle oder intravesikale Druckerhöhungen werden reflektorisch mit einer Aktivitätszunahme der Sphinktermuskulatur beantwortet und über den konsekutiven intraurethralen Druckanstieg kompensiert. Der Harnröhrenverschlussdruck liegt bei intaktem System stets über dem intravesikalen Druck und gewährleistet die Kontinenz unter Ruhe- sowie unter Belastungsbedingungen (beispielsweise beim Husten, Niesen) Harnentleerung Im Gegensatz zur Blasenfüllung (Harnspeicherung) ist die Harnentleerung (Miktion) ein aktiver, willkürlich eingeleiteter Vorgang. Die zerebralen, inhibitorischen Impulse auf das pontine Miktionszentrum werden reduziert, wodurch der Miktionsreflex ausgelöst wird. Eingeleitet wird die Miktion durch die Relaxation der quergestreiften Harnröhren- und Beckenbodenmuskulatur, die zu einer mit trichterförmiger Öffnung des Blasenhalses und einem konsekutiven Abfall des Harnröhrenverschlussdrucks führt. Die simultane Detrusorkontraktion bewirkt einen intravesikalen Druckanstieg, der den Strömungswiderstand in der Harnröhre (Blasenauslasswiderstand) übersteigt und eine ungestörte Entleerung der Harnblase ermöglicht. Der reine Detrusorkontraktionsdruck (Miktionsdruck Rektaldruck) liegt bei ungestörten Abflussverhältnissen bei ca. 40 cm H 2 O (weiblich) und bei ca. 50 cm H 2 O (männlich; Tab. 2.2). Am Ende der Miktion kontrahieren Harnröhrensphinkter- und Beckenbodenmuskulatur, die Detrusorkontraktion endet und der Blasenauslass wird in seinen Ausgangszustand angehoben und verschlossen. Das ungestörte synerge Zusammenspiel aus urethraler Relaxation und Detrusorkontraktion resultiert in einer restharnfreien Blasenentleerung. Die willkürliche Unterbrechung der Miktion durch Kontraktion der quergestreiften Sphinktermuskulatur bedingt messtechnisch eine initiale intravesikale Druckerhöhung mit nachfolgendem Druck-
23 16 Teil I Grundlagen Tab Normalbefunde der Entleerungsphase (Anhaltswerte Erwachsener) 2 Detrusorkontraktionsdruck (p det ) maximaler Harnfluss (Qmax) (Miktionsvolumen: 150 ml) Beckenboden-EMG Mann: 50 cm H 2 O Frau: 40 cm H 2 O Mann: ml/s Frau: ml/s Aktivität abfallend abfall aufgrund der reflektorischen Aufhebung der Detrusorkontraktion. Im Säuglingsalter ist die zentrale Kontrolle des Miktionsreflexes noch nicht ausgereift, die Miktion erfolgt ausschließlich über eine unwillkürliche Reflexentleerung. Das Kind erlernt in der Regel bis zum Schulkindalter (6 Jahre) eine willkürlich kontrollierte und koordinierte Miktion. Literatur 1. Jünemann KP (1992) In: Alken P, Walz PH (Hrsg) Urologie. VCH, Weinheim
24 3 Pharmakologie des Harntraktes C. Hampel, J.W. Thüroff 3.1 Einleitung Cholinerge Rezeptoren Adrenerge Rezeptoren Dopaminerge Rezeptoren Serotoninerge (5HT) Rezeptoren Purinerge Rezeptoren (P2X, P2Y) GABAerge Rezeptoren Pharmakologie der Glutaminsäure Pharmakologie von Glycin Peptiderge Rezeptoren (Opioide, VIP, Substanz P) Pharmakologie von Stickstoffmonoxid (NO) Pharmakologie der Prostaglandine Ionenkanäle (Ca, K) Toxine als Therapieoptionen (Capsaicin, RTX, Clostridium botulinum Toxin Typ A) Muskelrelaxanzien (Vinpocetin, Dicyclomin) Östrogene Pharmakologie des antidiuretischen Hormons (ADH) Zusammenfassung 30 Literatur 32
Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion
 Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Mit 106
Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Mit 106
Urodynamik Update. Urodynamik. Nativ-Harnflussmessung. Nachteil: keine Information über Druckwerte keine Unterscheidung Obstruktion - "schwache" Blase
 Urodynamik Update D. Kölle Universitätsklinik für Frauenheilkunde Innsbruck Geinberg, 12. Dezember 2001 Urodynamik = Bestimmung des anatomischen und funktionellen Status von Harnblase und Harnröhre Uroflowmetrie
Urodynamik Update D. Kölle Universitätsklinik für Frauenheilkunde Innsbruck Geinberg, 12. Dezember 2001 Urodynamik = Bestimmung des anatomischen und funktionellen Status von Harnblase und Harnröhre Uroflowmetrie
Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen
 Sport Carla Vieira Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Sport Carla Vieira Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC
 Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland
 Geisteswissenschaft Axel Jäckel Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland Ein Fall für die soziale Arbeit?! Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Geisteswissenschaft Axel Jäckel Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland Ein Fall für die soziale Arbeit?! Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Guerilla Marketing in der Automobilindustrie
 Sven Pischke Guerilla Marketing in der Automobilindustrie Möglichkeiten und Grenzen Diplomica Verlag Sven Pischke Guerilla Marketing in der Automobilindustrie - Möglichkeiten und Grenzen ISBN: 978-3-8428-0561-3
Sven Pischke Guerilla Marketing in der Automobilindustrie Möglichkeiten und Grenzen Diplomica Verlag Sven Pischke Guerilla Marketing in der Automobilindustrie - Möglichkeiten und Grenzen ISBN: 978-3-8428-0561-3
Anforderungen von Crossmedia-Kampagnen
 Medien Christian Regner Anforderungen von Crossmedia-Kampagnen Eine Untersuchung am Beispiel einer Casting-Show Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Medien Christian Regner Anforderungen von Crossmedia-Kampagnen Eine Untersuchung am Beispiel einer Casting-Show Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Die Bedeutung der Geburtenregistrierung. für die Verwirklichung der UN-Kinderrechte
 Mareen Schöndube Die Bedeutung der Geburtenregistrierung für die Verwirklichung der UN-Kinderrechte Der Artikel Sieben: Recht auf Geburtsregister, Name und Staatszugehörigkeit Diplomica Verlag Mareen Schöndube
Mareen Schöndube Die Bedeutung der Geburtenregistrierung für die Verwirklichung der UN-Kinderrechte Der Artikel Sieben: Recht auf Geburtsregister, Name und Staatszugehörigkeit Diplomica Verlag Mareen Schöndube
Inhaltsverzeichnis. Einladung 2. Programmübersicht 3. Wissenschaftliches Programm 4. Rahmenprogramm 8. Der Arbeitskreis 9
 Inhaltsverzeihnis Einladung 2 Programmübersiht 3 Wissenshaftlihes Programm 4 Rahmenprogramm 8 Der Arbeitskreis 9 Referenten und Moderatoren 10 Geshihte der Seminarreihe 14 Allgemeine Hinweise 18 Anfahrt
Inhaltsverzeihnis Einladung 2 Programmübersiht 3 Wissenshaftlihes Programm 4 Rahmenprogramm 8 Der Arbeitskreis 9 Referenten und Moderatoren 10 Geshihte der Seminarreihe 14 Allgemeine Hinweise 18 Anfahrt
Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr
 Wirtschaft Gordon Matthes Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr Diplomarbeit Bibliografische
Wirtschaft Gordon Matthes Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr Diplomarbeit Bibliografische
Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie Band 7. Behandlungsleitlinie Psychosoziale Therapien
 Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie Band 7 Behandlungsleitlinie Psychosoziale Therapien Herausgeber Deutsche Gesellschaft fçr Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) Redaktionelle
Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie Band 7 Behandlungsleitlinie Psychosoziale Therapien Herausgeber Deutsche Gesellschaft fçr Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) Redaktionelle
Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz
 12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
Harn- und Stuhlinkontinenz
 Harn- und Stuhlinkontinenz Harninkontinenz, dass heißt unwillkürlicher Urinverlust, ist eine häufige Erkrankung, unter der in Deutschland etwa sechs bis acht Millionen Frauen und Männer leiden. Blasenfunktionsstörungen,
Harn- und Stuhlinkontinenz Harninkontinenz, dass heißt unwillkürlicher Urinverlust, ist eine häufige Erkrankung, unter der in Deutschland etwa sechs bis acht Millionen Frauen und Männer leiden. Blasenfunktionsstörungen,
Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten
 Medien Claudio Cosentino Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten Sport und Lifestylemagazin für Frauen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Medien Claudio Cosentino Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten Sport und Lifestylemagazin für Frauen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
K.-H. Bichler Das urologische Gutachten
 K.-H. Bichler Das urologische Gutachten Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH K.-H. Bichler Das urologische Gutachten 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von B.-R. Kern, W. L Strohmaier,
K.-H. Bichler Das urologische Gutachten Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH K.-H. Bichler Das urologische Gutachten 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von B.-R. Kern, W. L Strohmaier,
1 3Walter Fischer Digitale Fernsehtechnik in Theorie und Praxis
 1 3Walter Fischer Digitale Fernsehtechnik in Theorie und Praxis 1 3Walter Fischer Digitale Fernsehtechnik in Theorie und Praxis MPEG-Basiscodierung DVB-, DAB-, ATSC- 0 5bertragungstechnik Messtechnik Mit
1 3Walter Fischer Digitale Fernsehtechnik in Theorie und Praxis 1 3Walter Fischer Digitale Fernsehtechnik in Theorie und Praxis MPEG-Basiscodierung DVB-, DAB-, ATSC- 0 5bertragungstechnik Messtechnik Mit
Blasenfunktionsdiagnostik
 SIGUP 211 Basel Blasenfunktionsdiagnostik Dr. med. Daniel Engeler Leitender Arzt Klinik für Urologie Kantonsspital St. Gallen daniel.engeler@kssg.ch SIGUP 211 Basel Übersicht Einleitung Basisabklärungen
SIGUP 211 Basel Blasenfunktionsdiagnostik Dr. med. Daniel Engeler Leitender Arzt Klinik für Urologie Kantonsspital St. Gallen daniel.engeler@kssg.ch SIGUP 211 Basel Übersicht Einleitung Basisabklärungen
Together is better? Die Magie der Teamarbeit entschlüsseln
 Together is better? Daniela Eberhardt (Hrsg.) Together is better? Die Magie der Teamarbeit entschlüsseln Mit 17 Abbildungen 1 23 Herausgeber Prof. Dr. Daniela Eberhardt Leiterin IAP Institut für Angewandte
Together is better? Daniela Eberhardt (Hrsg.) Together is better? Die Magie der Teamarbeit entschlüsseln Mit 17 Abbildungen 1 23 Herausgeber Prof. Dr. Daniela Eberhardt Leiterin IAP Institut für Angewandte
Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel
 Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
MedR. Schriftenreihe Medizinrecht
 MedR Schriftenreihe Medizinrecht Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht e.y. (Hrsg.) Medizinische Notwendigkeit und Ethik Gesundheitschancen in Zeiten
MedR Schriftenreihe Medizinrecht Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht e.y. (Hrsg.) Medizinische Notwendigkeit und Ethik Gesundheitschancen in Zeiten
Management im Gesundheitswesen
 Management im Gesundheitswesen Reinhard Busse Jonas Schreyögg Tom Stargardt (Hrsg.) Management im Gesundheitswesen Das Lehrbuch für Studium und Praxis 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Management im Gesundheitswesen Reinhard Busse Jonas Schreyögg Tom Stargardt (Hrsg.) Management im Gesundheitswesen Das Lehrbuch für Studium und Praxis 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
René Müller. Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen. Europa, USA und Japan vor dem Abgrund? Diplomica Verlag
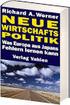 René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen Europa, USA und Japan vor dem Abgrund? Diplomica Verlag René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen: Europa, USA und Japan vor
René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen Europa, USA und Japan vor dem Abgrund? Diplomica Verlag René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen: Europa, USA und Japan vor
Gemeinsam einsam fernsehen
 Alexander Blicker-Dielmann Gemeinsam einsam fernsehen Eine Untersuchung zum Einfluss sozialer Hinweisreize auf die Filmrezeption Diplomica Verlag Alexander Blicker-Dielmann Gemeinsam einsam fernsehen:
Alexander Blicker-Dielmann Gemeinsam einsam fernsehen Eine Untersuchung zum Einfluss sozialer Hinweisreize auf die Filmrezeption Diplomica Verlag Alexander Blicker-Dielmann Gemeinsam einsam fernsehen:
Konzepte der wertorientierten Unternehmensführung: die DAX 30 Unternehmen
 Steve Pilzecker Konzepte der wertorientierten Unternehmensführung: die DAX 30 Unternehmen Eine vergleichende Auswertung Diplomica Verlag Steve Pilzecker Konzepte der wertorientierten Unternehmensführung:
Steve Pilzecker Konzepte der wertorientierten Unternehmensführung: die DAX 30 Unternehmen Eine vergleichende Auswertung Diplomica Verlag Steve Pilzecker Konzepte der wertorientierten Unternehmensführung:
Diplomarbeit. Demografie und Öffentlicher Dienst. Personalbedarfsdeckung. Thomas Dockenfuß. Bachelor + Master Publishing
 Diplomarbeit Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst Personalbedarfsdeckung Bachelor + Master Publishing Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst: Personalbedarfsdeckung Originaltitel
Diplomarbeit Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst Personalbedarfsdeckung Bachelor + Master Publishing Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst: Personalbedarfsdeckung Originaltitel
Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Praxis der Brustoperationen
 Praxis der Brustoperationen Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Budapest Hongkong London Mailand Paris Santa Clara Singapur Tokio U. Herrmann W. Audretsch Praxis der Brustoperationen Tumorchirurgie
Praxis der Brustoperationen Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Budapest Hongkong London Mailand Paris Santa Clara Singapur Tokio U. Herrmann W. Audretsch Praxis der Brustoperationen Tumorchirurgie
Handbuch Kundenmanagement
 Handbuch Kundenmanagement Armin Töpfer (Herausgeber) Handbuch Kundenmanagement Anforderungen, Prozesse, Zufriedenheit, Bindung und Wert von Kunden Dritte, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Handbuch Kundenmanagement Armin Töpfer (Herausgeber) Handbuch Kundenmanagement Anforderungen, Prozesse, Zufriedenheit, Bindung und Wert von Kunden Dritte, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Inkontinenz. Was versteht man unter Harninkontinenz? Welche Untersuchungen sind notwendig?
 Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Führung und Mikropolitik in Projekten
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Entwicklung eines Marknagels für den Humerus
 Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Störung der Blasenfunktion und ihre Auswirkungen
 Unfreiwilliger Harnverlust oder Harninkontinenz In den ersten Lebensjahren können Babys und später Kleinkinder die Harnblase nicht kontrollieren. Der von den Nieren ausgeschiedene Harn wird in der Blase
Unfreiwilliger Harnverlust oder Harninkontinenz In den ersten Lebensjahren können Babys und später Kleinkinder die Harnblase nicht kontrollieren. Der von den Nieren ausgeschiedene Harn wird in der Blase
Christian Westendorf. Marketing für Physiotherapeuten. Erfolgreich mit kleinem Budget
 Marketing für Physiotherapeuten Erfolgreich mit kleinem Budget Marketing für Physiotherapeuten Erfolgreich mit kleinem Budget In Zusammenarbeit mit Sabine Westendorf Mit 21 Abbildungen in Farbe 123 FiHH
Marketing für Physiotherapeuten Erfolgreich mit kleinem Budget Marketing für Physiotherapeuten Erfolgreich mit kleinem Budget In Zusammenarbeit mit Sabine Westendorf Mit 21 Abbildungen in Farbe 123 FiHH
Kulturelle Norm und semantischer Wandel
 Englisch Franziska Strobl Kulturelle Norm und semantischer Wandel Die Bedeutung von Anredepronomina in literarischen Übersetzungen am Beispiel Englisch - Deutsch Magisterarbeit Bibliografische Information
Englisch Franziska Strobl Kulturelle Norm und semantischer Wandel Die Bedeutung von Anredepronomina in literarischen Übersetzungen am Beispiel Englisch - Deutsch Magisterarbeit Bibliografische Information
> RUNDER TISCH MEDIZINTECHNIK
 acatech DISKUTIERT RUNDER TISCH MEDIZINTECHNIK WEGE ZUR BESCHLEUNIGTEN ZULASSUNG UND ERSTATTUNG INNOVATIVER MEDIZINPRODUKTE THOMAS SCHMITZ-RODE (Hrsg.) Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rode RWTH Aachen Lehrstuhl
acatech DISKUTIERT RUNDER TISCH MEDIZINTECHNIK WEGE ZUR BESCHLEUNIGTEN ZULASSUNG UND ERSTATTUNG INNOVATIVER MEDIZINPRODUKTE THOMAS SCHMITZ-RODE (Hrsg.) Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rode RWTH Aachen Lehrstuhl
Harninkontinenz - Kontinenzförderung. Rita Willener Pflegeexpertin MScN
 Harninkontinenz - Kontinenzförderung Rita Willener Pflegeexpertin MScN Klinik für Urologie, Inselspital Bern, 2011 Übersicht zum Referat Harninkontinenz Epidemiologie Definition Risikofaktoren Auswirkungen
Harninkontinenz - Kontinenzförderung Rita Willener Pflegeexpertin MScN Klinik für Urologie, Inselspital Bern, 2011 Übersicht zum Referat Harninkontinenz Epidemiologie Definition Risikofaktoren Auswirkungen
Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens für eine verbesserte Unternehmenssteuerung
 Wirtschaft Andreas Taube Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens für eine verbesserte Unternehmenssteuerung Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Wirtschaft Andreas Taube Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens für eine verbesserte Unternehmenssteuerung Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
DR. ANDREA FLEMMER. Blasenprobleme. natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung
 DR. ANDREA FLEMMER Blasenprobleme natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung it se m ln a l B Die Mitte n e h c n einfa trainiere aktiv 18 Ihre Harnblase das sollten
DR. ANDREA FLEMMER Blasenprobleme natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung it se m ln a l B Die Mitte n e h c n einfa trainiere aktiv 18 Ihre Harnblase das sollten
Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion
 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion Fortschritte der Psychotherapie Band 39 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion von Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel und Dipl.-Psych. Sybille Hubert Herausgeber
Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion Fortschritte der Psychotherapie Band 39 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion von Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel und Dipl.-Psych. Sybille Hubert Herausgeber
Anatomie der Harnwege
 Anatomie der Harnwege Quellen: Innere Medizin, Weiße Reihe, Urban & Fischer, Band 4, 7. Auflage, 2oo2 Der Mensch Anatomie und Physiologie Thieme Verlag, 3. Auflage, 2oo2 HNO-Augenheilkunde, Dermatologie
Anatomie der Harnwege Quellen: Innere Medizin, Weiße Reihe, Urban & Fischer, Band 4, 7. Auflage, 2oo2 Der Mensch Anatomie und Physiologie Thieme Verlag, 3. Auflage, 2oo2 HNO-Augenheilkunde, Dermatologie
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung
 Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Die Harninkontinenz bei der Frau. Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien
 Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Einführung in die Neuroanatomie Bauplan, vegetatives Nervensystem
 Einführung in die Neuroanatomie Bauplan, vegetatives Nervensystem David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität
Einführung in die Neuroanatomie Bauplan, vegetatives Nervensystem David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität
Wirtschaft. Tom Keller
 Wirtschaft Tom Keller Die realitätsnähere Bewertung der Schadenrückstellungen des Versicherers im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes (StEntlG) 1999/2000/2002 und ausgewählte Konsequenzen für die Handels-
Wirtschaft Tom Keller Die realitätsnähere Bewertung der Schadenrückstellungen des Versicherers im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes (StEntlG) 1999/2000/2002 und ausgewählte Konsequenzen für die Handels-
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz
 Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz Katja Sonntag Dr. Christine von Reibnitz Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz Praxishandbuch und Entscheidungshilfe Mit 15 Abbildungen 1 C Katja Sonntag
Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz Katja Sonntag Dr. Christine von Reibnitz Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz Praxishandbuch und Entscheidungshilfe Mit 15 Abbildungen 1 C Katja Sonntag
Schwerhörigkeit und Hörgeräte
 Karl-Friedrich Hamann Katrin Hamann Schwerhörigkeit und Hörgeräte 125 Fragen und Antworten 2., aktualisierte und ergänzte Auflage W. Zuckschwerdt Verlag IV Bildnachweis Titelbild: Bilder im Innenteil:
Karl-Friedrich Hamann Katrin Hamann Schwerhörigkeit und Hörgeräte 125 Fragen und Antworten 2., aktualisierte und ergänzte Auflage W. Zuckschwerdt Verlag IV Bildnachweis Titelbild: Bilder im Innenteil:
Ulrich Gebhard. Kind und Natur
 Ulrich Gebhard Kind und Natur Ulrich Gebhard Kind und Natur Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 11 SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH Bibliografische
Ulrich Gebhard Kind und Natur Ulrich Gebhard Kind und Natur Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 11 SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH Bibliografische
Erfolgreicher Turnaround mit Private Equity
 Lukas Schneider Erfolgreicher Turnaround mit Private Equity Warum eine Restrukturierung mit Private Equity Investoren erfolgreicher ist Diplomica Verlag Lukas Schneider Erfolgreicher Turnaround mit Private
Lukas Schneider Erfolgreicher Turnaround mit Private Equity Warum eine Restrukturierung mit Private Equity Investoren erfolgreicher ist Diplomica Verlag Lukas Schneider Erfolgreicher Turnaround mit Private
PATIENTENINFORMATION. über. Harninkontinenz
 PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
Empirische Methoden in der Psychologie
 Markus Pospeschill Empirische Methoden in der Psychologie Mit 41 Abbildungen und 95 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel PD Dr. Markus Pospeschill lehrt und forscht als Akademischer Direktor
Markus Pospeschill Empirische Methoden in der Psychologie Mit 41 Abbildungen und 95 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel PD Dr. Markus Pospeschill lehrt und forscht als Akademischer Direktor
Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz
 Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund
 Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Peter Keel Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen 1 C Peter
Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Peter Keel Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen 1 C Peter
Gunter Groen Franz Petermann. Wie wird mein. Kind. wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen
 Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher
Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher
Aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin (Direktor Univ.-Prof. Dr. Nicolai Maass)
 Aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin (Direktor Univ.-Prof. Dr. Nicolai Maass) Zusammenhang der weiblichen Harninkontinenz mit der urodynamisch erhobenen funktionellen und perinealsonographisch
Aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin (Direktor Univ.-Prof. Dr. Nicolai Maass) Zusammenhang der weiblichen Harninkontinenz mit der urodynamisch erhobenen funktionellen und perinealsonographisch
Pharmakokinetische Studie einer intravesikalen Applikation von Oxybutinin-Hydrochlorid zur Therapie der Detrusorüberaktivität
 1 Aus der Klinik für Urologie des St. Hedwig Krankenhauses Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Pharmakokinetische Studie einer intravesikalen
1 Aus der Klinik für Urologie des St. Hedwig Krankenhauses Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Pharmakokinetische Studie einer intravesikalen
Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen http://d-nb.info/992492254. digitalisiert durch
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1.1 Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) - allgemeine Einführung 1.1.1 Die TMS - technisches Prinzip 17-18 1.1.2 Einsatz der TMS in der neuro-psychiatrischen Forschung
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1.1 Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) - allgemeine Einführung 1.1.1 Die TMS - technisches Prinzip 17-18 1.1.2 Einsatz der TMS in der neuro-psychiatrischen Forschung
Einfache und effiziente Zusammenarbeit in der Cloud. EASY-PM Document Client Handbuch
 Einfache und effiziente Zusammenarbeit in der Cloud EASY-PM Document Client Handbuch Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 3 2. Hochladen 4 2.1 Schritt 1 Benutzerdaten eingeben 4 2.2 Schritt 2 Quellordner wählen
Einfache und effiziente Zusammenarbeit in der Cloud EASY-PM Document Client Handbuch Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 3 2. Hochladen 4 2.1 Schritt 1 Benutzerdaten eingeben 4 2.2 Schritt 2 Quellordner wählen
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhalt. Vorwort Diagnostik peripherer Nervenerkrankungen. 1 Der Patient mit neuropathischen Beschwerden... 15
 Inhalt Vorwort................................................ 11 A Diagnostik peripherer Nervenerkrankungen 1 Der Patient mit neuropathischen Beschwerden............. 15 2 Schlüsselinformationen aus Anamnese
Inhalt Vorwort................................................ 11 A Diagnostik peripherer Nervenerkrankungen 1 Der Patient mit neuropathischen Beschwerden............. 15 2 Schlüsselinformationen aus Anamnese
Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge attraktiver
 Wibke Derboven Gabriele Winker Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge attraktiver chläge für Hochschulen 4lJ Springer ieurwissenschaftliche Studiengänge ttver gestalten fegmnisü^e üilivchültät DAiiiviSTAÖT
Wibke Derboven Gabriele Winker Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge attraktiver chläge für Hochschulen 4lJ Springer ieurwissenschaftliche Studiengänge ttver gestalten fegmnisü^e üilivchültät DAiiiviSTAÖT
32 Miktions- und Defäkationsstörungen sowie Inkontinenz
 361 32 Miktions- und Defäkationsstörungen sowie Inkontinenz 32.1 Vorbemerkungen Nachfolgend wird vorwiegend von der Miktion die Rede sein, deren Störungen viel häufiger ein Leitsymptom sind als Defäkationsstörungen.
361 32 Miktions- und Defäkationsstörungen sowie Inkontinenz 32.1 Vorbemerkungen Nachfolgend wird vorwiegend von der Miktion die Rede sein, deren Störungen viel häufiger ein Leitsymptom sind als Defäkationsstörungen.
Tiberius Hehn Roland Riempp. PDF@Flash. Multimediale interaktive PDF-Dokumente durch Integration von Flash
 Tiberius Hehn Roland Riempp PDF@Flash Multimediale interaktive PDF-Dokumente durch Integration von Flash 123 Tiberius Hehn Medien- und Informationswesen (B. Sc.) 79114 Freiburg hehn@multi-media-design.de
Tiberius Hehn Roland Riempp PDF@Flash Multimediale interaktive PDF-Dokumente durch Integration von Flash 123 Tiberius Hehn Medien- und Informationswesen (B. Sc.) 79114 Freiburg hehn@multi-media-design.de
Sylke Werner. Kontinenzförderung. Ein Leitfaden. Verlag W. Kohlhammer
 Pflegekompakt Sylke Werner Kontinenzförderung Ein Leitfaden Verlag W. Kohlhammer Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen
Pflegekompakt Sylke Werner Kontinenzförderung Ein Leitfaden Verlag W. Kohlhammer Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen
Anatomie des Nervensystems
 Anatomie des Nervensystems Gliederung Zentrales Nervensystem Gehirn Rückenmark Nervensystem Peripheres Nervensystem Somatisches Nervensystem Vegetatives Nervensystem Afferente Nerven Efferente Nerven Afferente
Anatomie des Nervensystems Gliederung Zentrales Nervensystem Gehirn Rückenmark Nervensystem Peripheres Nervensystem Somatisches Nervensystem Vegetatives Nervensystem Afferente Nerven Efferente Nerven Afferente
M edr Schriftenreihe Medizinrecht
 M edr Schriftenreihe Medizinrecht Rechtliche und ethische Probleme bei klinischen Untersuchungen am Menschen Herausgegeben von H. K. Breddin E. Deutsch R. Ellermann H.l.lesdinsky Springer-Verlag Berlin
M edr Schriftenreihe Medizinrecht Rechtliche und ethische Probleme bei klinischen Untersuchungen am Menschen Herausgegeben von H. K. Breddin E. Deutsch R. Ellermann H.l.lesdinsky Springer-Verlag Berlin
Ausweg am Lebensende
 , Christian Walther Ausweg am Lebensende Selbstbestimmtes Sterben durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. med.,
, Christian Walther Ausweg am Lebensende Selbstbestimmtes Sterben durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. med.,
Ich kann nicht Wasser lösen!
 Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Hunde in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
 Martina Kirchpfening Hunde in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mit 17 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Martina Kirchpfening ist Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin des
Martina Kirchpfening Hunde in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mit 17 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Martina Kirchpfening ist Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin des
Vorwort 11. Der Harntrakt und seine Funktion 15
 Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Urologie. Sonderfach Grundausbildung (36 Monate)
 Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Urologie Anlage 32 Sonderfach Grundausbildung (36 Monate) 1. Ätiologie, Pathogenese, Symptomatologie, Diagnostik, Differenzialdiagnostik urologischer Erkrankungen 2. Topographische
Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Urologie Anlage 32 Sonderfach Grundausbildung (36 Monate) 1. Ätiologie, Pathogenese, Symptomatologie, Diagnostik, Differenzialdiagnostik urologischer Erkrankungen 2. Topographische
Der rote Faden. Beckenboden. Beckenboden in "3E" Begriffsdefinition - Der Beckenboden. 1. Begriffsdefinition. 2. Der Beckenboden - ein "Trichter"
 Dr. Senckenbergische Anatomie J.-W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main 1. Begriffsdefinition Der rote Faden 2. Der Beckenboden - ein "Trichter" Beckenboden Prof. Dr. Thomas Deller 3. Anatomische Strukturen
Dr. Senckenbergische Anatomie J.-W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main 1. Begriffsdefinition Der rote Faden 2. Der Beckenboden - ein "Trichter" Beckenboden Prof. Dr. Thomas Deller 3. Anatomische Strukturen
Parallelimporte von Arzneimitteln
 Parallelimporte von Arzneimitteln Erfahrungen aus Skandinavien und Lehren für die Schweiz Zusammenfassung und Übersetzung der Dissertation: Parallel Trade of Pharmaceuticals Evidence from Scandinavia and
Parallelimporte von Arzneimitteln Erfahrungen aus Skandinavien und Lehren für die Schweiz Zusammenfassung und Übersetzung der Dissertation: Parallel Trade of Pharmaceuticals Evidence from Scandinavia and
BWL im Bachelor-Studiengang
 BWL im Bachelor-Studiengang Reihenherausgeber: Hermann Jahnke, Universität Bielefeld Fred G. Becker, Universität Bielefeld Fred G. Becker Herausgeber Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Mit 48 Abbildungen
BWL im Bachelor-Studiengang Reihenherausgeber: Hermann Jahnke, Universität Bielefeld Fred G. Becker, Universität Bielefeld Fred G. Becker Herausgeber Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Mit 48 Abbildungen
Möglichkeiten und Hindernisse des Cross-Selling in einem Unternehmen der Wohnungswirtschaft
 Wirtschaft Dirk Kuscher Möglichkeiten und Hindernisse des Cross-Selling in einem Unternehmen der Wohnungswirtschaft Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Wirtschaft Dirk Kuscher Möglichkeiten und Hindernisse des Cross-Selling in einem Unternehmen der Wohnungswirtschaft Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
BRUSTKREBS. Patientenratgeber zu den AGO-Empfehlungen 2016
 BRUSTKREBS Patientenratgeber zu den AGO-Empfehlungen 2016 herausgegeben von Anton Scharl, Volkmar Müller und Wolfgang Janni im Namen der Kommission Mamma der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie
BRUSTKREBS Patientenratgeber zu den AGO-Empfehlungen 2016 herausgegeben von Anton Scharl, Volkmar Müller und Wolfgang Janni im Namen der Kommission Mamma der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie
Jan Lies. Kompakt-Lexikon PR Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden
 Kompakt-Lexikon PR Jan Lies Kompakt-Lexikon PR 2.000 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden Jan Lies Hamm Deutschland ISBN 978-3-658-08741-8 DOI 10.1007/978-3-658-08742-5 ISBN 978-3-658-08742-5 (ebook)
Kompakt-Lexikon PR Jan Lies Kompakt-Lexikon PR 2.000 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden Jan Lies Hamm Deutschland ISBN 978-3-658-08741-8 DOI 10.1007/978-3-658-08742-5 ISBN 978-3-658-08742-5 (ebook)
Die Krebsbehandlung in der Thoraxklinik Heidelberg
 Die Krebsbehandlung in der Thoraxklinik Heidelberg P. Drings, I. Vogt-Moykopf (Hrsg.) Die Krebsbehandlung in der Thoraxklinik Heidelberg Festschrift zum lojährigen Bestehen der Onkologie Springer-Verlag
Die Krebsbehandlung in der Thoraxklinik Heidelberg P. Drings, I. Vogt-Moykopf (Hrsg.) Die Krebsbehandlung in der Thoraxklinik Heidelberg Festschrift zum lojährigen Bestehen der Onkologie Springer-Verlag
Karin Willeck Alternative Medizin im Test
 Karin Willeck Alternative Medizin im Test Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Hongkong London Mailand Paris Singapur Tokio Karin Willeck Alternative Medizin im Test Das Buch zum SWR»-Wissenschaftsmagazin
Karin Willeck Alternative Medizin im Test Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Hongkong London Mailand Paris Singapur Tokio Karin Willeck Alternative Medizin im Test Das Buch zum SWR»-Wissenschaftsmagazin
Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz
 Marie Schröter Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz Ein Vergleich zwischen Deutschland und Russland Bachelorarbeit Schröter, Marie: Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne
Marie Schröter Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz Ein Vergleich zwischen Deutschland und Russland Bachelorarbeit Schröter, Marie: Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne
Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager
 Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Günter Umbach Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren
Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Günter Umbach Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren
Von einem der ersten Elektrokardiographen. und dessen Einsatz bei einer Marsmission. zum mobilen kardialen Komplexanalyzer clue medical
 clue medical - der mobile kardiale Komplexanalyzer Von einem der ersten Elektrokardiographen zum mobilen kardialen Komplexanalyzer clue medical und dessen Einsatz bei einer Marsmission clue medical - der
clue medical - der mobile kardiale Komplexanalyzer Von einem der ersten Elektrokardiographen zum mobilen kardialen Komplexanalyzer clue medical und dessen Einsatz bei einer Marsmission clue medical - der
Leseförderung mit Hund
 Andrea Beetz Meike Heyer Leseförderung mit Hund Grundlagen und Praxis Mit 18 Abbildungen und 2 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. Andrea Beetz ist Dipl.-Psychologin. Sie lehrt und forscht
Andrea Beetz Meike Heyer Leseförderung mit Hund Grundlagen und Praxis Mit 18 Abbildungen und 2 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. Andrea Beetz ist Dipl.-Psychologin. Sie lehrt und forscht
Fuat H. Saner. Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen (Untersuchungskurs) Einführung um 14:15 Uhr, Verwaltungshörsaal
 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen (Untersuchungskurs) Fuat H. Saner Einführung 16.10.2012 um 14:15 Uhr, Verwaltungshörsaal Universitätsklinikum Essen Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie
Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen (Untersuchungskurs) Fuat H. Saner Einführung 16.10.2012 um 14:15 Uhr, Verwaltungshörsaal Universitätsklinikum Essen Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie
Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe
 Inkontinenz im Alter Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe Gedächtnisschwund und Blasenschwäche kommen sehr oft zusammen, weil Demenz die Hirnregion zerstört, die für die Blasenkontrolle zuständig
Inkontinenz im Alter Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe Gedächtnisschwund und Blasenschwäche kommen sehr oft zusammen, weil Demenz die Hirnregion zerstört, die für die Blasenkontrolle zuständig
Expertenstandard Konkret Bd. 4. Team boq. Sturzprophylaxe. Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung
 Expertenstandard Konkret Bd. 4 Team boq Sturzprophylaxe Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 4 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und Qualität
Expertenstandard Konkret Bd. 4 Team boq Sturzprophylaxe Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 4 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und Qualität
Die Behandlung Rückenmarkverletzter
 D.C.Burke D.D. Murray Die Behandlung Rückenmarkverletzter Ein kurzer Leitfaden Übersetzt von F.-W. Meinecke Mit 8 Abbildungen Institut für Arbeitswissons-hoft der TH Springer-Verlag Berlin Heidelberg New
D.C.Burke D.D. Murray Die Behandlung Rückenmarkverletzter Ein kurzer Leitfaden Übersetzt von F.-W. Meinecke Mit 8 Abbildungen Institut für Arbeitswissons-hoft der TH Springer-Verlag Berlin Heidelberg New
Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen
 Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Carsten Wesselmann Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Detaillierte T-Konten und Rechenwege Carsten Wesselmann Köln Deutschland ISBN 978-3-658-07066-3
Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Carsten Wesselmann Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Detaillierte T-Konten und Rechenwege Carsten Wesselmann Köln Deutschland ISBN 978-3-658-07066-3
Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule
 Maria-Raphaela Lenz Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Lenz, Maria-Raphaela: Förderung der Autonomieentwicklung
Maria-Raphaela Lenz Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Lenz, Maria-Raphaela: Förderung der Autonomieentwicklung
Diplomarbeit. Demografie und Öffentlicher Dienst. Personalbedarfsdeckung. Thomas Dockenfuß. Bachelor + Master Publishing
 Diplomarbeit Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst Personalbedarfsdeckung Bachelor + Master Publishing Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst: Personalbedarfsdeckung Originaltitel
Diplomarbeit Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst Personalbedarfsdeckung Bachelor + Master Publishing Thomas Dockenfuß Demografie und Öffentlicher Dienst: Personalbedarfsdeckung Originaltitel
Ernährungsmanagement
 Expertenstandard Konkret Bd. 6 Team boq Ernährungsmanagement Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Altenpflege Vorsprung durch Wissen Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 6 boq
Expertenstandard Konkret Bd. 6 Team boq Ernährungsmanagement Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Altenpflege Vorsprung durch Wissen Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 6 boq
Gesundheitsmarketing. Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen
 Wirtschaft Jasmin Rüegsegger Gesundheitsmarketing. Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen Eine explorative Untersuchung in der Schweiz Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Wirtschaft Jasmin Rüegsegger Gesundheitsmarketing. Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen Eine explorative Untersuchung in der Schweiz Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Diagnostik sozialer Kompetenzen
 Diagnostik sozialer Kompetenzen Kompendien Psychologische Diagnostik Band 4 Diagnostik sozialer Kompetenzen von Prof. Dr. Uwe Peter Kanning Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Franz Petermann und Prof. Dr.
Diagnostik sozialer Kompetenzen Kompendien Psychologische Diagnostik Band 4 Diagnostik sozialer Kompetenzen von Prof. Dr. Uwe Peter Kanning Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Franz Petermann und Prof. Dr.
RATGEBER BLASEN- UND DARMFUNKTION BEI MULTIPLER SKLEROSE
 RATGEBER BLASEN- UND DARMFUNKTION BEI MULTIPLER SKLEROSE MULTIPLE SKLEROSE KANN STÖRUNGEN VON HARNBLASE, DARM UND BECKENBODEN VERURSACHEN. EINE SPEZIALISIERTE ABKLÄRUNG UND BEHANDLUNG BRINGT LEBENSQUALITÄT
RATGEBER BLASEN- UND DARMFUNKTION BEI MULTIPLER SKLEROSE MULTIPLE SKLEROSE KANN STÖRUNGEN VON HARNBLASE, DARM UND BECKENBODEN VERURSACHEN. EINE SPEZIALISIERTE ABKLÄRUNG UND BEHANDLUNG BRINGT LEBENSQUALITÄT
Fetale Anatomie im VI traschall
 Alf Staudach Fetale Anatomie im VI traschall Geleitworte von w. Thiel und M. Hansmann Mit 247 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Univ.-Doz. Dr. med. AlfStaudach Landesfrauenklinik,
Alf Staudach Fetale Anatomie im VI traschall Geleitworte von w. Thiel und M. Hansmann Mit 247 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Univ.-Doz. Dr. med. AlfStaudach Landesfrauenklinik,
Bachelorarbeit. Diagnose und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in dem Beruf Koch/Köchin. Regina Schlosser. Diplom.de
 Bachelorarbeit Regina Schlosser Diagnose und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in dem Beruf Koch/Köchin Diplom.de Regina Schlosser Diagnose und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in dem Beruf Koch/Köchin
Bachelorarbeit Regina Schlosser Diagnose und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in dem Beruf Koch/Köchin Diplom.de Regina Schlosser Diagnose und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in dem Beruf Koch/Köchin
Mit einem Vorwort von Bernhard Ringbeck
 Marianne Gäng (Hrsg.) Reittherapie 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit einem Vorwort von Bernhard Ringbeck Beiträge von Christina Bär, Claudia Baumann, Susanne Blume, Georgina Brandenberger, Annette
Marianne Gäng (Hrsg.) Reittherapie 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit einem Vorwort von Bernhard Ringbeck Beiträge von Christina Bär, Claudia Baumann, Susanne Blume, Georgina Brandenberger, Annette
Expertenstandard Konkret Bd. 5. Team boq. Chronische Wunden. Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung
 Expertenstandard Konkret Bd. 5 Team boq Chronische Wunden Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 5 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und
Expertenstandard Konkret Bd. 5 Team boq Chronische Wunden Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 5 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und
