Großpilze in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens der Universität Graz
|
|
|
- Jacob Rothbauer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Österr. Z. Püzk. 10(2001) 43 Großpilze in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens der Universität Graz HELMUT PIDLICH-AIGNER Hoschweg 8 : A-8046 Graz, Österreich j ANTON HAUSKNECHT Sonndorferstraße 22 A-3712 Maissau, Österreich Eingelangt am Key words: Agaricales, Aphyllophorales, Greenhouse fungi. - Botanical Garden Graz. - Mykoflora of Austria. Abstract: Fungal growth in greenhouses of the Botanical Garden in Graz has been intensively studied by the senior author during a period of three years. 37 taxa were observed, some of them known from the tropics. One species is new to Europe, three taxa remain unidentified up to now. Besides macroand microscopical descriptions of interesting species, colour plates of seven species are given. Further, a comparison of fungal growth in the different types of greenhouses is made. Zusammenfassung: Das Pilzwachstum in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens der Universität Graz wurde vom Erstautor während eines Zeitraumes von drei Jahren intensiv beobachtet. Es wurden insgesamt 37 Taxa nachgewiesen, darunter einige aus den Tropen bekannte. Eine Art ist neu für Europa, drei Taxa konnten bisher nicht bestimmt werden. Neben makro- und mikroskopischen Beschreibungen interessanter Arten werden sieben Arten farbig dargestellt. Weiters wird eine Gegenüberstellung des Pilzwachstums in den einzelnen Typen von Glashäusern gemacht. Anfang Februar 1998 hatte der Erstautor im Rahmen einer Führung durch die neu erbauten Gewächshäuser des Botanischen Gartens in Graz die Gelegenheit, die artenreiche und exotische Pflanzenwelt der unterschiedlichen Klimabereiche zu bewundern. Am Boden zwischen den Pflanzen entdeckte er aber auch einige büschelig wachsende Pilze, die sofort besonderes Interesse erweckten. Umgehend reifte der Plan, das Vorkommen der Pilze in den Glashäusern zu erkunden. Nachdem die Bewilligung vom Leiter, Herrn Univ.-Prof. Dr. HERWIG TEPPNER, eingeholt worden war und bei der Bestimmung der doch recht zahlreichen Arten bald die Grenze des eigenen mykologischen Wissens erreicht war, ergab sich nach einiger Zeit eine intensive Zusammenarbeit mit dem Zweitautor, zumal es sich oft um seltene, meist in der freien Natur in unseren Breiten kaum vorkommende Arten handelte. Nachfolgend werden die innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von drei Jahren, also von Anfang Februar 1998 bis Ende Jänner 2001, gefundenen Großpilze alphabetisch aufgelistet und kommentiert. Makroskopische Beschreibungen werden auch von solchen Arten gegeben, die im Freiland bei uns häufig sind, wenn sich durch das Wachstum im geschlossenen Raum Abweichungen ergeben. Bei interessanteren Arten werden die Mikromerkmale in Form von Strichzeichnungen dargestellt. Sieben Arten werden farbig abgebildet.
2 44 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Es konnten insgesamt 37 Taxa nachgewiesen werden, davon 33 Agaricales und vier Aphyllophorales s. 1. Ascomyceten werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Bei den nachgewiesenen Agaricales handelt es sich durchwegs um saprophytisch lebende Arten, die sich von den im Boden befindlichen organischen Substanzen, vor allem von Rinden- und Holzanteilen, oder von Torfbeigaben ernähren. Belege aller gefundenen Arten wurden im Herbarium der Universität Wien (WU) bzw. in den Privatherbarien PIDLICH-AIGNER (PA) und HAUSKNECHT (H) hinterlegt. Technische Daten der Gewächshäuser (nach KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ, BOTA- NISCHER GARTEN 1994 bzw. KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ & STEIRISCHE LANDES- REGIERUNG, LANDESBAUDIREKTION 1995). Die 1995 fertiggestellte und als Ikone der modernen Architektur gelobte Anlage besteht aus drei miteinander verbundenen Gewächshäusern mit vier Klimazonen und einem Anzuchthaus mit drei Klimazonen sowie verschiedenen Betriebsbereichen, wie Seminarraum, Büros, Labor, Werkstatt, Aufenthaltsraum, Technikerräumen und Trafostation. Die Fläche unter Glas beträgt m 2, das Raumvolumen m 3. Aus der folgenden Tabelle sind die Größen und Nutzflächen der einzelnen Bereiche sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Sommer und im Winter ersichtlich (Tabelle 1). Eine Grundrißzeichnung verdeutlicht die voneinander abgegrenzten Einzelbereiche (Abb. 1). Tabelle 1. Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Teilbereichen. Größenangaben in m 2, Temperatur in Grad Celsius, Humidität in Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Kalthaus Temperierthaus Sukkulentenhaus Tropenhaus Anzucht kalt Anzucht temperiert Anzucht warm Nutz- Temperatur Temperatur Humidität Humidität Größe fläche im Sommer im Winter im Sommer im Winter * * * * * * * * abhängig von der Außentemperatur I Was den Bodenaufbau in den Gewächshäusern betrifft, kann davon ausgegangen werden, daß in allen Bereichen auf dem gewachsenen Boden, bestehend aus Lehmerde, eine grobe Rollierung (16/32) von ca. 30 cm, dazwischen ein Trennvlies, darauf eine feine Rollierung (5/10) von ca. 15 cm und darauf Grunderde von cm aufgebracht wurde. Erst darauf wurde das Substrat in unterschiedlicher Zusammensetzung und in einer Höhe von cm aufgeschüttet: Kalthaus: Tropenhaus: Temperierthaus: 40 % Humuserde 40 % Rindenkompost 10 % Quarzsand 10 % Weißtorf 20 % Humuserde 30 % Rindenkompost 20 % Lavasplitt 15% Weißtorf 15% Flußsand 40 % Humuserde 30 % Rindenkompost 10 % Lavasplit 10 % Weißtorf 10 % Quarzsand
3 Österr. Z. Pilzk. 10 (2001) 45 Sukkulentenhaus- Bereich I: Sukkulentenhaus- Bereich II: 40 % Lehmerde 30 % Schamotte 20 % Quarzsand 10% Weißtorf 50 % Humuserde 30 % Lavasplitt 10 % Weißtorf 10 % Quarzsand Grunderde: Sand-, Kies-, Schluff-, Tongemisch mit > 15 Gew. % 0,06 mm. Bindiger Boden von leichter bis mittlerer Plastizität und < 30 Gew. % Steinen < als 6 cm Einzelkorngröße. Humuserde: Oberste Bodenschichten, die neben anorganischen Stoffen (Kies-, Schluff-, Tongemische) Humus (mindestens 10 %) und Bodenbakterien enthalten. Rindenkompost: Hauptsächlich aus Rinde von Nadelbäumen, v. a. von Zirbe, Lärche und Fichte, Korngröße bis 50 mm. Der Rindenkompost war zum Zeitpunkt der Lieferung bereits 3 bis 4 Jahre verrottet. Körnung/mm: Quarzsand 1-5; Lavasplitt 5-7; Schamotte 2-6. ph-wert: Tropenhaus 6,0; sonst 6,5. SUKKULENTENHAUS Bereich I KALTHAUS Abb. 1. Grundriß der Gesamtanlage mit den unterschiedlichen Teilbereichen
4 46 Österreichische H. PIDLICH-AIGNER Mykologische Gesellschaft, & A. Austria, HAUSKNECHT: download unter Großpilze im Botanischen Garten Graz Bemerkungen zu den einzelnen Taxa Agaricales Armillaria mellea (VAHL.: FR.) KUMMER Im Tropenhaus, im unteren Bereich eines Laubholzstammes, der Epiphyten als Unterlage dient, wuchsen am riesige Fruchtkörper mit Hüten bis zu einem Durchmesser von 150 mm. Untersuchte Kollektionen: (PA 974); (WU 20217). Conocybe crispella (MURRELL) SINGER (Abb 2 ad) Merkmale: Hut: ca. 8 mm breit und 4 mm hoch, flach konvex, hygrophan und leicht gerieft; graulichbeige, Oberfläche fast bis zur Mitte fein gekerbt. Lamellen: schmal angewachsen, im Exsikkat relativ hell. Stiel: ca. 25 x 1 mm, weißlich, fadenförmig mit leicht knolliger Basis, in ganzer Länge behaart-bereift. Fleisch: sehr dünn, rasch zerfallend. Sporen: 11,9-13,1 x 7,8-8,5 x 7,0-7,8 um, im Mittel 12,5 x 7,9 x 7,3 um, ellipsoidisch, leicht lentiform abgeplattet, rötlich gelbbraun in KOH mit dicker, rötlicher Wand; Keimporus groß. Mikrosporen nicht selten. Basidien: 4-sporig, x 10-13,5 um. Cheilozystiden: lecythiform, x 8-14,5 um, mit 4-5 um großem Köpfchen und kurzem Hals. Huthaut: hymeniform, vom Conocybe-Typ. Stielbekleidung: nur aus Haaren und nicht-lecythiformen Elementen bestehend. Vorkommen: im Anzuchtraum des Temperierthauses in einem Blumentopf bei Ptychosperma microcarpum (BURRET) BURRET {Ericaceae), auf humoser Erde. Untersuchte Kollektion: (PA 1072, WU 19467). Conocybe crispella ist eine aus Nordamerika beschriebene Art, die erst seit wenigen Jahren auch aus Europa bekannt ist (HAUSKNECHT 1997). Sie wächst hier vorwiegend in Glashäusern und in Blumentöpfen und -kistchen, also in geschlossenen Räumen, während sie in den Tropen an grasigen Stellen weit verbreitet ist. Nahestehend ist die sehr häufige Conocybe albipes (OTTH) HAUSKN. [= C. lactea (LANGE) METROD], welche sich durch meist kräftigere Fruchtkörper mit länglich-zylindrischem Hut, hellere, weißlichere Hutfarben und mikroskopisch durch dickwandigere, etwas größere Sporen unterscheidet. Conocybe spec. (Abb. 2 e-h) Hut: 10 mm breit, breitkegelig bis konvex mit spitzer Mitte, hygrophan, fast bis zur Mitte durchscheinend gerieft. In der Mitte dunkelbraun, zum Rand hin blasser, hellbraun.
5 Österr. Z. Pilzk. 10 (2001) 47 Abb. 2 a-d. Conocybe crispella. a Sporen, x 2000; b Basidien, x 800; c Cheilozystiden, x 800; d Stielbekleidung, x 800. e-h. Conocybe spec, e Sporen, x 2000;/Basidien, x 800; g Cheilozystiden, x 800; h Stielbekleidung, x 800.
6 48 Österreichische H. PIDLICH-AIGNER Mykologische Gesellschaft, & Austria, A. HAUSKNECHT: download unter Großpilze im Botanischen Garten Graz Lamellen: schmal angewachsen, mäßig entfernt, bogig, hellbraun mit gleichfarbiger, unauffälliger Schneide. Stiel: 25 mm lang, 0,8 mm dick (zur Basis hin etwas verdickt bis 1 mm), weiß, in ganzer Länge bereift. Fleisch: dünn, ohne auffalligen Geruch. Sporen: 8,7-10,3 x 6,2-7,0 x 5,2-6,0 um, im Mittel 9,5 x 6,6 x 5,7 um, linsenförmig plattgedrückt und in Aufsicht deutlich hexagonal, in Seitenansicht zitronenförmig, mit großem, papilliertem Porus; in KOH orangebraun mit dicker, roter Wand. Basidien: 4-sporig, x um. Cheilozystiden: lecythiform, x 7-10 um, mit 2,5-4 um großem Köpfchen. Stielbekleidung: aus haarförmigen, zylindrischen bis länglich-rundlichen Elementen bestehend, dazwischen vor allem an der Stielspitze spärlich lecythiforme Zystiden ähnlich den Cheilozystiden. Huthaut: hymeniform aus rundlich-gestielten Elementen. Vorkommen: im Anzuchtraum des Tropenhauses in einem Blumentopf. Untersuchte Kollektion: (PA 1347, H S3189). Die hexagonalen, lentiformen Sporen in Verbindung mit einer Stielbekleidung der Sektion Pilosellae (mit einzelnen kopfigen Elementen) fuhren in die Nähe von Conocybe hexagonospora HAUSKN. & ENDERLE sowie Conocybe lenticulospora WAT- LING. Erstere hat kleinere, hellere und dünnwandigere Sporen und wächst in montanen bis subalpinen Lagen im Nadelwald, letztere ist ein Bewohner von Dung und nährstoffreichen Wiesen, hat größere, ebenfalls hellere, dünnwandigere Sporen, die zwar lentiform und etwas eckig, aber nie so deutlich hexagonal sind. Beide unterscheiden sich außerdem makroskopisch durch weniger spitze Hüte und hellere Farben. Conocybe mitrispora WATLING aus Malaysia hat zwar ähnliche Sporen, aber eine gänzlich andere Stielbekleidung (WATLING 1994). Zwei Fruchtkörper derselben Sippe wurden schon 1989 von E. LUDWIG in einem Warmhaus des Botanischen Gartens in Berlin gefunden (Herb. LUDWIG und HAUS- KNECHT S2602). WATLING (1994) erwähnt eine Kollektion aus Queensland, Australien, die den europäischen Funden sehr nahe stehen könnte, aber stärker mitriforme Sporen hat. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die oben erwähnten Funde in Glashäusern in Europa ziemlich sicher ein unbeschriebenes Taxon sind; leider ist das vorhandene Herbarmaterial zu dürftig für eine Neubeschreibung, und es muß wohl abgewartet werden, bis eine größere, gut dokumentierte Kollektion zur Verfügung steht. Coprinus disseminates (PERS.: FR.) S. F. GRAY \ Während diese Art im Freien meist nur Laubholzstrünke in einer fortgeschrittenen Zersetzungsphase besiedelt und sich von diesen aus eventuell auf den angrenzenden Boden ausbreiten kann, fruktifizierte sie am recht zahlreich an einer Stelle des Tropenhauses, scheinbar auf Erde, wohl aber auf unterirdischen organischen Substanzen. Wenige Fruchtkörper fanden sich auch am im Anzuchtraum des Tropenhauses auf einer Palmenfrucht. Untersuchte Kollektionen: (PA 1265); (PA 1640). J
7 österr.z.pilzk. 10(2001) 49 to o c Abb. 3 a-d. Coprinus plagioporus. a Huthaut (zellig mit Pileozystiden), b Cheilozystiden, c Basidien, d Sporen.
8 50 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter Coprinus domesticus (BOLT.: FR.) S. F. GRAY Wie die vorige Art im Freien meist ein Holzbewohner (wohl auch auf vergrabenem Holz), erschienen im Temperierthaus am zwei Fruchtkörper scheinbar auf sandiger Erde. Untersuchte Kollektion: (PA 632). Coprinus plagioporus ROMAGN. (Abb. 3) Merkmale: Hut: 7-22 mm im Durchmesser, 14 mm hochjung walzenförmig, später kegelig-glokkig, beinahe bis zur Mitte furchig gerieft; jung ockerbraun (KORNERUP & WAN- SCHER 1981: 6B6), später graubraun (6D3), mit grauer Randzone, Mitte braun (6D5). Lamellen: jung weiß, dann graubraun, schließlich schwarz, leicht zerfließend. Stiel: 43 x 1,5-3 mm, zylindrisch, weiß. Sporen: x 6-7,3 um, ellipsoidisch, oval, glatt, mit gut sichtbarem, oft exzentrischem Keimporus. Basidien: x 7-9 um, mit vier kurzen Sterigmen. Cheilozystiden: um, rundlich-blasenförmig, zahlreich. Pleurozystiden: keine gefunden. Huthaut: aus rundlichen, bis 32 x 28 um großen Zellen bestehend, dazwischen vereinzelt Pileozystiden ( x 4-8 um), diese flaschenförmig, mit langem, meist geradem, seltener etwas wellig verbogenem, zylindrischem Hals, der oft gegen die Spitze geringfügig kopfig bis keulig verbreitert ist. Kaulozystiden: den Pileozystiden ähnlich. Schnallen: vorhanden. Vorkommen: Nur zwei Fruchtkörper am im Temperierthaus, auf Holzstückchen fruktifizierend. I Untersuchte Kollektion: (PA 1346, WU 20206)., 1 Coprinus plagioporus ist charakterisiert durch die Kombination leicht kopfiger Pileo- und Kaulozystiden und rundlicher Cheilozystiden in Verbindung mit Sporen mit exzentrischem Keimporus. Manchmal sind die Zystidenköpfe (wie auch in unserem Fall) aber leider nur leicht erweitert und dann ist eine Verwechslung mit Coprinus fallax M. LANGE & A. H. SMITH bzw. Coprinus subpurpureus A. H. SMITH möglich (ULJE&BAS 1991: 310). Die Art scheint im Freien im östlichen Österreich extrem selten zu sein, uns ist nur ein einziger Fund aus Niederösterreich, auf Pflanzenabfällen am Rande eines Weingartens, bekannt (WU 9898). Gymnopus dryophilus (BULL.: FR.) MURRILL Diese häufig vorkommende Art ist von den Niederungen bis in die alpine Zone verbreitet. Auch im Kalthaus wurden am und zahlreiche Fruchtkörper an einer kleinen, begrenzten Stelle gefunden. Untersuchte Kollektion: (PA 1495, WU 20944). j ' J
9 Österr. Z. Pilzk. 10(2001) Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter 51 Abb. 4 a-e. Gymnopus luxurians. a Huthaut, b Kaulozystiden (Hyphenenden der Stielspitze), c Cheilozystiden, d Basidien und Basidiolen, e Sporen.
10 52 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Gymnopus luxurians (PECK) MURRILL (Abb 4) Merkmale: Hut: mm breit, jung halbkugelig, konvex, bald ausgebreitet bis abgeflacht, Rand oft wellig verbogen, meist gerieft. Oberfläche oft radialfaserig, jung einheitlich dunkelbraun (10F3), später eher rotbraun (6D8, 7C6), trocken auch ausblassend (5B2) 5 Mitte meist dunkler. Lamellen: schmal, dicht, mit Lamelletten, am Stiel ausgebuchtet angewachsen, mit Zähnchen herablaufend; jung beige, später dem Hut gleichfarbig, im Alter oft kelbraun fleckig, Schneiden jung hell flockig, im Alter dunkler. Stiel: x 4-25 mm, meist zylindrisch, aber auch gegen die Basis keulig ver-l dickt, manchmal ganzer Stiel verdreht, Basis auch spindelig; beige bis hellbraun,j dunkler längs gefasert vor allem an der Basis und der Stielspitze. Fleisch: cremefarben, fest; Geschmack mild, pilzartig; Geruch intensiv (beinah«unangenehm) pilzartig. Makroreaktionen: FeSO 4, H 2 SO 4, KOH und NH 4 0H negativ. Sporen: 7,7-11,5(13) x 3,5-5,2(6) um, lang elliptisch bis tropfenförmig, glat hyalin, teilweise mit einem Öltropfen von bis zu 2(-3) um Durchmesser, inamyloidj kongophil. Sporenpulver weißlich bis creme, ROMAGNESI (1967): Ib. Basidien: x 5-8 um, lang keulig mit vier Sterigmen und Basalschnalle. Cheilozystiden: verschiedengestaltig, unregelmäßig, meist wellig verbogen, bis 50 um lang und 4-15 um dick, oft mit knorrigen Auswüchsen und Verzweigungen. Pleurozystiden: keine vorhanden. Kaulozystiden: meist zylindrisch, mit 4-7 um Dicke, teils gegen das Ende etwa verjüngt, teils verbogen, auch etwas kopfig oder leicht keulig. Huthaut: eine Kutis, bestehend aus ± parallel liegenden, teils dickwandigen, zylindrischen, lang septierten, zwischen 3-7 um dicken Hyphen, teils mit knorrigen Auswüchsen, die manchmal etwas keulig, spindelig, auch etwas kopfig, oft auch zylindrisch oder verjüngend enden. Schnallen: an fast allen Septen. Vorkommen: die Fruchtkörper meist büschelig wachsend und mittels Rhizomorphen mit kleinen Holz- bzw. Rindenstücken verbunden. Auf das Tropenhaus beschränkt, dort allerdings im ersten Jahr (ab ) nahezu überall ganzjährig in unglaublichen Mengen. Die ersten Funde sind schon vom (Herbarium GZU, leg. C. SCHEUER), also bereits 1 l A Jahre nach der Substrataufbringung und der Bepflanzung im Frühjahr 1995, dokumentiert. Im Jahr 1999 fand man bedeutend weniger Fruchtkörper und seither nur mehr an einer Stelle, abseits vom vorherigen Massenauftreten. Untersuchte Belege: (PA 575); (WU 18846); (WU 18024). Bei diesem seltenen Rübling handelt es sich ursprünglich um eine aus Nordamerika beschriebene Art. Erst in letzter Zeit tauchten auch Funde in Europa auf, meist auch in Glashäusern, seltener an Ruderalstellen in Parks. Bei den Glashausfunden (wie in unserem Fall) war öfter festzustellen, daß die Fruchtkörper hauptsächlich in den Wintermonaten steril waren. Dann sind die Lamellen vor allem bei jungen Fruchtkörpern gegen den Hutrand an der Basis zusammengewachsen, wodurch auch der Eindruck entsteht, die Lamellenschneiden seien gespalten. Es finden sich dann natürlich auch keine Basidien, Sporen oder Cheilozystiden, sondern nur Basidiolen. Diese of-
11 Osten-. Z.PÜzk. 10 (2001) 53 fensichtlich glashausbedingte Anomalie und auch die Tatsache, daß die Lamellen bei den Glashausfunden bedeutend weiter auseinanderstehen und auch die Stiele etwas anders aussehen als bei Freilandfruktifikationen, gab zu Überlegungen Anlaß, diese von der Freilandart abzutrennen. ANTONIN & HERINK (1999) haben aber erkannt, daß alle europäischen Funde von Gymnopus luxurians TAX einer einzigen Art gehören. Die Funde in den Glashäusern in Graz sind Erstfunde für Österreich (siehe dazu auch HAUSKNECHT & KRISAI-GREILHUBER 2000). ANTONIN & HERINK (1999) listen weiters europäische Belege aus Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik auf, BON & MASSART (1996) berichten von drei französischen Kollektionen. Abb. 5 a-c. Gymnopus spec, a Huthaut, b Basidien und Basidiolen, c Sporen.
12 54 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Gymnopus spec. (Farbige Abb. IV, Abb. 5) Merkmale: Hut: 4-26 mm breit, konvex, bald ausgebreitet und mit leicht vertiefter bis fast genabelter Mitte; Rand eingebogen; hygrophan, aber nur am Rand ein wenig gerieft; braun (6E4) bis rotbraun (6E8), älter oft ausblassend nach braunorange, Sahara (6C5), hellbraun (6D4) bis grauorange (5B3), Mitte auch dunkler rotbraun bleibend. Oberfläche samtig, trocken fast glänzend, Mitte älter auch feinschuppig. Lamellen: am Stiel ausgebuchtet bis mit Zähnchen herablaufend, ziemlich dick, bei ausgewachsenen Fruchtkörpern 3-4 mm breit; braunorange (6C5) bis hellbraun (6D4). Stiel: x 2-5 mm, gerade bis etwas verbogen, zylindrisch, flachgedrückt, deutlich längsrillig, an der Spitze dicker als zur Basis hin; oben braunorange (6C5), gegen die Basis dunkler rotbraun (6E8), Basis weißsamtig überzogen. Fleisch: weißlich bis beige; Geruch stark nach verfaulendem Kohl mit zusätzlicher, intensiver, knoblauchartiger Komponente; dieser Geruch ist im Schnitt besonders intensiv. Geschmack zuerst mild, pilzartig, später anhaltend adstringierend und ekelerregend ähnlich dem Geruch. Sporen: 4,7-6,2 x 2,7-3,5 um, ellipsoidisch bis tropfenförmig, glatt, hyalin, inamyloid. Basidien: x 5-6 um, langgestreckt keulig, mit vier Sterigmen und Basalschnallen. Cheilo-, Pleuro- und Kaulozystiden: fehlen. Huthaut: eine Kutis aus ± parallel liegenden, verzweigten, 3-10 um dicken, dünnwandigen Hyphen. Endhyphen nicht oder sehr spärlich divertikulat. Schnallen: an fast allen Septen. Vorkommen: insgesamt 15 Fruchtkörper in allen Reifestadien vom bis im Anzuchtraum des Tropenhauses in einem Blumentopf mit Oncidium apliatum LINDL. (Orchidaceae), Rinden- bzw. Holzstückchen (von Nadelholz) aufsitzend oder mit Rhizomorphen mit diesen verbunden. 1 Untersuchte Kollektionen: (PA 1642, WU 21007); (WU 21143). In der Klassifikation der europäischen Arten der Gattung Gymnopus von ANTO- NIN & NOORDELOOS (1997) gehört unsere Aufsammlung auf Grund des intensiven Geruches in die Sektion Vestipedes Subsektion Impudicae, wobei allerdings koralloide oder divertikulate Terminalzellen in der Huthaut nur spärlich entwickelt sind, was eher für die Sektion Vestipedes spräche. In der Subsektion Impudicae kommt auf Grund der wenig ausgeprägten divertikulaten Elemente in der Huthaut und des Fehlens von echten Cheilozystiden Gymnopus herinkii ANTONIN & NOORDEL. sehr nahe, aber unser Fund hat wesentlich kleinere Sporen, keinen bereiften, sondern einen deutlich längsgestreiften Stiel (erinnert ein wenig an die Gattung Rhodocollybia), etwas andere Farben und wächst auf Rindenabfällen im Glashaus und nicht in der Laubstreu. So sind wir ziemlich sicher, es mit einem in Europa unbekannten Taxon zu tun zu haben; in der außereuropäischen Literatur konnten wir aber nichts finden, was unserem Fund ent- ] spricht. i
13 österr.z.pilzk. 10(2001) 55 Hemimycena cucullata (PERS.: FR.) SINGER Nur zwei Fruchtkörper bildete dieser weiße Scheinhelmling am im Kalthaus in einem erst kurz zuvor ausgesetzten Topfballen mit Arisarum proboscideum (L) SAVI (Araceae) aus. Diese Art soll auch im Juli 2000 nochmals fruktifiziert haben. Untersuchte Kollektion: (PA 1019, WU 19473). Hohenbuehelia mastrucata (FR.: FR.) SINGER Vertreter der Gattung Hohenbuehelia sind in unseren Breiten nicht häufig und an den ± seitlich gestielten oder ungestielten, muschel- bis spateiförmigen Fruchtkörpern sowie mikroskopisch an der gelifizierten Schicht in der Huthaut und den (bei den meisten Arten vorhandenen) metuloiden Hymenialzystiden zu erkennen. In der zum Tropenbereich gehörenden Vitrine bildete diese Holzstückchen aufsitzende und eher einzeln wachsende Art am nur wenige Fruchtkörper aus. Untersuchte Kollektion: (PA 1600, WU 20943). Hohenbueheliapetalodes (BULL.: FR.) SCHULZ. Hohenbuehelia petalodes fruktifizierte am , und im Juli 2000 recht zahlreich und büschelig wachsend im Tropenhaus. Diese Art wird in MOSER (1983) noch als Hohenbuehelia geogenia (DC: FR.) SINGER geführt, in der aktuellsten Bearbeitung der Gattung Hohenbuehelia durch S. ELBORNE (BAS & al. 1995) wird aber der ältere Name H. petalodes verwendet. Untersuchte Kollektion: (PA 693, WU 19151). Hypholomafasciculare (HUDS.: FR.) KUMMER j i Drei kleine, büschelig wachsende Fruchtkörper wuchsen am im Tropenhaus aus einem am Boden stehenden hölzernen Pflanzentrog. Untersuchte Kollektion: (PA 1344, WU 20220). Lepiota aspera (PERS.: FR.) QUEL. Beim Fund vom , wie auch bei anderen Funden an einer anderen, nicht weit entfernten, doch eng begrenzten Stelle des Tropenhauses ( , , , Juli 2000, ) mit jeweils meist nur einem Fruchtkörper war eine standortbedingte größere Variationsbreite, vor allem bei den Sporenmaßen, besonders auffällig, sodaß die Abgrenzung zu Lepiota perplexa KNUDSEN oft schwer fiel. Untersuchte Kollektionen: (PA 633); , 1999 (PA 1059, WU 19803). Lepiota cristata (BOLT.: FR.) KUMMER Eine der in unseren Breiten wohl häufigsten und bekanntesten kleinen Schirmlingsarten, der Stinkschirmling, fruktifizierte mit wenigen Fruchtkörpern immer wieder an der selben Stelle des Tropenhauses ( , , , und ), aber auch recht zahlreich im sandigen Boden des Sukkulentenbereiches,
14 \ 56 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter und zwar in der Nähe der Abgrenzung zum Temperierthaus ( und ). Untersuchte Kollektionen: (PA 881); (PA 970). Lepiota elaiophylla VELLINGA & HUIJSER (Farbige Abb V, Abb 6) Merkmale: Hut: mm, jung halbkugelig, später konvex bis flach kegelig, auch ausgebreitet, oft wellig verbogen; jung Oberfläche samtig-filzig, schließlich beim Aufschirmen von der dunkelbraunen (7F7) bis hellbraunen (7D6) Mitte aus konzentrisch gegen den Rand aufreißend, braun (6D7) bis braunorange (6C8) geschuppt auf gelbem (2A5) bis gelbweißem (2A2) Grund. Lamellen: am Stiel ausgebuchtet, bogig herablaufend, mit Zwischenlamellen, pastellgelb (3A5) bis graugelb (4B5). Im Exsikkat weisen die Lamellen eine olivbraune (4D6) bis gelbbraune (5E5) Verfärbung auf. Stiel: x 3-5 mm, zylindrisch, hohl, Basis oft etwas knollig verdickt; Oberfläche an der Spitze gelblich wie die Lamellen gefärbt, Ringzone bestehend aus größeren braunen Schuppen, gegen die Basis feinschuppiger. Fleisch: blaßgelblich, gegen die Stielbasis dunkler, braun; Geschmack etwas bitter; Geruch nach Lepiota cristata mit etwas süßlicher Komponente. Makroreaktionen: H 2 SO 4 und NH 4 OH negativ, KOH langsam orangebräunlich, außerdem löst KOH das gelbe Pigment. j Sporen: 6,5-9,5 x 3,2-3,3 um, schmal ellipsoidisch bis zylindrisch, glatt, dextrinoid, kongophil. Sporenpulver weißlich, etwa ROMAGNESI (1967) Ib. Basidien: x 6-7 um, langgestreckt keulig bis zylindrisch, Basis teils wellig verbogen, 4-(2-)sporig. Basalschnallen vorhanden. Cheilozystiden: x 9-18 um, meist lang keulig, auch rundlich, selten etwas spindelig. Im Exsikkat waren gegenüber dem untersuchten Frischmaterial nur wenige Cheilozystiden zu finden, weil sie im Alter kollabieren. Pleurozystiden: keine beobachtet. ' Huthaut: (in der Mitte) ein Trichoderm aus meist aufgerichteten, dann keulig endenden, aber auch aus zylindrischen, ± wellig verbogenen Hyphen mit einer Dicke bis 17 um; Septen mit Schnallen. Vorkommen: am sowie im Folgejahr zwischen und (allerdings an einer anderen Stelle) des Tropenhauses. Die Basis der oft etwas knolligen Stiele war mittels Rhizomorphen mit kleinen Holz- bzw. Rindenstückchen verbunden. Untersuchte Kollektion: (PA 713, WU 18988). Die in Glashäusern oder Blumentöpfen wachsenden Schirmlinge mit gelben Lamellen wurden früher zu Lepiota xanthophylla ORTON gestellt. Erst 1997 wurden sie als selbständige Art abgetrennt (VELLINGA & HUIJSER 1997). Lepiota elaiophylla unterscheidet sich von L. xanthophylla durch fehlendes zelliges Subhymenium, etwas kleinere und schmälere Sporen mit einem Quotienten von über 2, durch anders gestaltete Cheilozystiden und auch dadurch, daß die Lamellen im Exsikkat nicht schön gelb, sondern mehr bräunlichgelb bis braun sind. All dies trifft bei den angeführten Funden zu. Zur Verbreitung der Art kann nur wenig gesagt werden, schon auch wegen der früheren Verwechslungen mit L. xanthophylla. Aus Österreich ist uns bisher nur ein
15 österr. Z. Püzk. 10(2001) 57 Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter einziger weiterer Fund bekannt, und zwar von einem Glashaus im Botanischen Garten in Wien (WU 20257). Abb. 6 a-d. Lepiota elaiophylla. a Huthaut, b Basidien und Basidiolen, c Sporen, d Cheilozystiden.
16 58 Österreichische H. PIDLICH-AIGNER Mykologische Gesellschaft, & A. Austria, HAUSKNECHT: download unter Großpilze im Botanischen Garten Graz Leucoagaricus americanus (PECK) VELLINGA i Diese mit Arten der Gattung Macrolepiota leicht zu verwechselnde Leucoagaricus-Art wächst büschelig und hat zuerst gilbendes, dann rötendes Fleisch; sie ist weiters gekennzeichnet durch sofortige Grünverfärbung des Fleisches mit NH4OH. Nur im ersten Jahr fruktifizierte sie im Tropenhaus (am und ) sowie am im Kalthaus mit wenigen Exemplaren. In der europäischen Literatur ist die Art unter dem Namen Leucoagaricus bresadolae (SCHULZER) BON gut bekannt. Erst im Vorjahr hat VELLINGA nachgewiesen, daß es einen älteren nordamerikanischen Namen für dieses Taxon gibt und dieses korrekterweise L. americanus heißen muß (VELLINGA 2000). Untersuchte Kollektionen: (PA 578, WU 18059); (PA 624, WU 18061); (PA 699, WU 19154). Leucoagaricus leucothites (VITT.) WASSER Vor allem im Sommer 2000 war der Rosablättrige Egerlingsschirmpilz auch in Gärten in der Wiese, aber auch in mit Rindenmulch gedüngten Beeten recht häufig anzutreffen. Im Kalthaus erschienen am und jeweils ein einziger Fruchtkörper. Untersuchte Kollektion: (PA 579, WU 18062). Leucocoprinus birnbaumii (CORDA) SINGER Der wohl bekannteste, auch in Wohnungen in Blumentöpfen fruktifizierende leuchtend zitronengelbe Faltenschirmling ist wohl in den ersten beiden Jahren neben Gymnopus luxurians im Tropenhaus die häufigste Art gewesen. Sogar in einem im letzten Eck eines unbeleuchteten Abstellraumes gelagerten Kompostsack fand man zahlreiche büschelig wachsende Fruchtkörper in allen Größen. Im letzten Jahr des Beobachtungszeitraumes allerdings war auch er eher eine Seltenheit und fand sich nur mehr an einer einzigen Stelle des Kalthauses. \ Untersuchte Kollektion: (PA 576, WU 19161)., Leucocoprinus cepistipes (SOW.: FR) PAT. var. rorulentus (PANIZZI) BABOS (Farbige Abb. VI, Abb. 7) Merkmale: Hut: mm, jung kegelig abgestutzt, trapezförmig bis nahezu zylindrisch, aufschirmend glockig bis konvex mit ausgeprägtem, flachem Buckel; Scheitel grau (1D1) bis graubraun (8D3), mehlig-samtig, Hut sonst weiß bis creme, zuerst gegen den Rand feinschuppig, schließlich grobschuppig aufreißend; die zuerst weißlichen Schuppen werden im Alter oder bei Berührung braun, dann dunkelbraun und schließlich beinahe schwarz; Randzone manchmal kurz gerieft. Lamellen: weiß, sehr eng stehend, schmal (bis 4 mm breit), am Stiel stark ausgebuchtet, Schneiden fein bewimpert (Lupe), im Exsikkat graubräunlich. Stiel: x 4-8 mm, zylindrisch, hohl, an der Spitze am dünnsten, gegen die Basis kontinuierlich dicker (bis 15 mm), schließlich zwiebelartig verdickt; jung weiß,
17 Österr. Z. PiLzk. 10(2001) 59 Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter Abb. 7 a-d. Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus. a Huthaut, b Cheilozystiden, c Basidien und Basidiolen, d Sporen.
18 60 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz samtig, im Alter oder bei Berührung bald braun, dann dunkelbraun und schließlich beinahe schwarz verfärbend. Ring im oberen Drittel, dünn, weiß, aufsteigend, vergänglich; Rand fransig und im Alter etwas dunkler. Fleisch: weiß, in der Hutmitte und im Stiel fest, gegen den Hutrand watteartig weich. Bei kleinen bis mittleren Fruchtkörpern zahlreiche Guttationstropfen am gesamten Pilz oder nur am Stiel. Geschmack mild, pilzartig; Geruch (parfümiert-) pilzartig. Makroreaktionen: KOH und NH 4 OH negativ. Sporen: 8,3-13,5 x 5,5-8,3 um, ellipsoidisch bis oval, glatt, dickwandig, mit gut sichtbarem, metachromatischem Keimporus, dextrinoid, kongophil, cyanophil. Sporen-' pulver creme, etwa ROMAGNESI (1967) 1 b, c. Basidien: x 5-14 um, dickkeulig, nahezu kopfig, mit vier Sterigmen; ohne Basalschnallen. Cheilozystiden: x 7-22 um, zahlreich, vielgestaltig, teils dick keulig, beinahe rund, teils spindelig bis keulig und mit flaschenartigen, meist wellig-knorrig verbogenen, oft verzweigten Fortsätzen; vereinzelt sind die flaschenförmigen Fortsätze auch eingeschnürt. Pleurozystiden: keine vorhanden. Huthaut: in der Mitte aus meist aufgerichteten oder schräg stehenden, auch liegenden, meist zylindrischen, geraden, aber auch unregelmäßig welligen, lang septierten Hyphen von 2-8 um Durchmesser bestehend; Septen ohne Schnallen. Vorkommen: büschelig im Kalthaus vom bis , vom bis sowie Anfang Juli 2000; im Temperierthaus am ; im Tropenhaus am und und im Sukkulentenhaus am Meist war die Stielbasis mittels Rhizomorphen mit kleinen Holz- bzw. Rindenstückchen verbunden. Das Hauptvorkommen war eindeutig im Kalthaus gegeben, doch erschien auch eine Gruppe von Fruchtkörpern im Temperierthaus und eine kleine Gruppe im Sukkulentenbereich an der Abgrenzung zum Tropenhaus und auch im Tropenhaus selbst (allerdings nur zwei Einzelfruchtkörper). Während die Funde im Kalthaus sich noch in den folgenden Jahren geringfügig fortsetzten, sind die Fundorte in den anderen Bereichen erloschen. Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus ist die einzige Art, die in allen vier Bereichen fruktifizierte, also auch im trockenen Sukkulentenbereich, dort allerdings genau an der Glastrennwand zum Tropenhaus, die an dieser Stelle nur am Boden aufgesetzt ist. Die bauliche Abgrenzung in Form eines betonierten Grabens befindet sich erst einige Zentimeter dahinter im Tropenhaus. Somit ist an dieser Stelle durch das regelmäßige Kondenswasser an der Glasfläche im Tropenhaus für die nötige Feuchtigkeit gesorgt. Untersuchte Kollektionen: (PA 622, WU 19163); (PA 625, WU 18064, WU 18925); (PA 634); (WU 19150); (PA 703, WU 19165); (PA 882). MIGLIOZZI & PERRONE (1992) unterscheidet die var. rorulentus an Hand der Anwesenheit zahlreicher Guttationströpfchen an allen Teilen der Fruchtkörper und durch die Verfärbung der Lamellen nach bräunlichrosa bis grünlich mit rosa Ton, schließlich gänzlich graugrün oder graubraun im Herbarmaterial. Die beiden Fruchtkörper im Tropenhaus wurden zunächst aufgrund des Einzelwachstums, der eher braunen und nicht grauenden Fruchtkörper und der Cheilozystidenform für Leucocoprinus cepistipes var. cepistipes gehalten, nach nochmaliger Un-
19 österr. Z. Pilzk. 10 (2001) Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter 61 tersuchung dann aber doch der obigen Art zugeordnet. Der Grund hierfür war, daß sich unter den flaschenförmigen Zystiden vereinzelt sehr wohl solche mit apikal unree m äßig-fingerförmigen Verzweigungen fanden, vor allem aber wiesen die Exsikkate dieselbe graue Lamellenverfarbung auf wie die Exsikkate von var. rorulentus. Erwähnenswert ist, daß es sich bei den vier Fundpunkten sicherlich um separate Myzelien handelt, die keineswegs miteinander verbunden sein können. Die Funde aus Graz dürften wohl ein Erstnachweis dieses Taxons für Österreich sein. ". Leucocoprinus denudatus (RABENH.^ SACC.) SINGER (Farbige Abb. VII, Abb. 8) Merkmale: Hut: mm, jung eiförmig, dann glockig, konvex, schließlich ausgebreitet, blaßgelb (1A3), Scheibe vor allem bei jungen Fruchtkörpern braungelb (5C8), sonst heller, samtig, bis zu einem Drittel vom Hutrand gekerbt-gerieft, Oberfläche kleiig bereift, gelblich, Randzone kahl. Lamellen: blaßgelb, engstehend, am Stiel ausgebuchtet. Stiel: x 2,5-3 mm, zylindrisch, hohl, Basis keulig bis 6 mm verdickt, ebenfalls blaßgelb, Oberfläche fein gelblich bereift; Ring in der Mitte des Stieles, ± aufsteigend, ebenfalls gelblich. Abb. 8 a-e. Leucocoprinus denudatus. a Huthaut, b Pleurozystiden, c Cheilozystiden, d Basidien und Basidiolen, e Sporen.
20 62 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten GTÜZ Fleisch: weißlich, im Stiel fest, im Hut weich, watteartig; Geruch angenehm süßlich-pilzartig; Geschmack pilzartig, schwach bitterlich. Sporen: 5-7 x 3,5-4,7 um, rundlich bis breit ellipsoidisch, glatt, dickwandig, ohne Keimporus, dextrinoid, kongophil, relativ schwach metachromatisch. Sporenpulver weiß bis creme, etwa ROMAGNESI (1967) Ib. Basidien: x 6-9 um, dick keulenförmig mit vier relativ kurzen Sterigmen, ohne Basalschnallen. Cheilozystiden: x 5-10 um, verschiedengestaltig, meist schmal bis breit flaschenförmig, spindelig, seltener langgestreckt keulig oder unregelmäßig zylindrisch, vereinzelt apikal kopfig verdickt. Pleurozystiden: x 3-7 um, schlank flaschenförmig, auch mit welligem Hals. Huthaut: aus unterschiedlich großen runden Zellen mit einem Durchmesser von bis zu 32 um zusammengesetzt, dazwischen wurstförmig aneinandergereihte, verzweigte, zylindrische Hyphen mit einer Dicke bis zu 12 um; Septen ohne Schnallen. Vorkommen: nur ein Fund, nämlich am mit drei reifen und mehreren kleinen Fruchtkörpern im Kalthaus. Obwohl der Boden an dieser Stelle oberflächlich sehr sandig war, war die Stielbasis mittels Rhizomorphen mit tieferliegenden kleinen Rinden- bzw. Holzstückchen verbunden. Büscheliges Wachstum. Untersuchte Kollektion: (PA 728, WU 18965). Als typische mikroskopische Merkmale für die Gattungen Leucoagaricus und Leucocoprinus werden das metachromatische Endospor (Medulla) durch Einwirkung von Kresylblau bzw. Toluidinblau angesehen. Bei unserer Kollektion von Leucocoprinus denudatus war diese Eigenschaft nur schwach ausgebildet. Die Art ist weit verbreitet, kommt aber in Europa nur in Gärten, Parks, Glashäusern und Blumentöpfen vor (WASSER 1979, CANDUSSO & LANZONI 1990, BON 1996). Limacella glioderma (FR.) MAIRE 1 An den schmierig-glänzenden, rotbraunen Hüten der jungen Fruchtkörper ist diese Art, die zwar nicht sehr zahlreich, aber doch in allen drei Häusern vorgekommen ist, leicht zu erkennen. Erstmals fruktifizierte sie am an einer Stelle im Temperierthaus, an der sich immer wieder bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes wenige Fruchtkörper bildeten; im Tropenhaus ebenfalls auf einem ziemlich kleinen Areal erstmals am , über die Wintermonate bis Juli 1999 und dann noch vereinzelt im Jahr 2000; im Kalthaus auch an einer kleinen Stelle am , und im Mai Untersuchte Kollektionen: (PA 577, WU 18063); (PA 623, WU 19155); (PA 969). Lyophyllumfumosum (PERS.: FR) ORTON Während diese Art erstmals am und dann bis Mitte November im Kalthaus immer wieder einzeln bis büschelig wachsend zahlreiche Fruchtkörper ausbildete, wuchsen im Temperierthaus am nur 2 Exemplare. Untersuchte Kollektionen: (PA 1354, WU 20225); (PA 1645).
21 österr. Z. Pilzk. 10 (2001) jm Abb. 9 a-d. Melanoleuca rasüis var. leucophylloides. a Huthaut, b Cheilozystiden, c Basidien und Basidiolen, d Sporen. i : Melanoleuca rasilis (FR.) SINGER var. leucophylloides BON (Abb. 9) Merkmale: Hut: 50 mm, ausgebreitet, an einer Stelle bis zur Mitte eingeschnitten und die beiden Teile etwas überlappend, Mitte vertieft, hellgrau (1C1), Randzone blaßgrau (1B1), gegen die Mitte mehr braungrau (5C3), schließlich in der Mitte dunkel braungrau (6E2); Oberfläche schwach radialfaserig, Rand dünn, scharf. Lamellen: weiß, mit Zwischenlamellen, am Stiel meist mit Zahn herablaufend. Stiel: zylindrisch, gegen die Basis verdickt, längs gerillt, dunkel braungrau, etwa wie die Hutmitte gefärbt, an der Stielspitze heller; Oberfläche längsfaserig, auch etwas gedreht. Sporen: 6,5-8 x 5-6 (im, breit ellipsoidisch, Oberfläche mit isolierten, amyloiden Warzen und glattem Apikularfleck. Sporenpulver weiß, ROMAGNESI (1967) la. Basidien: x 8-10 um, langgestreckt keulig bis beinahe zylindrisch, meist mit vier, aber auch mit zwei Sterigmen, ohne Basalschnallen. Cheilozystiden: zahlreich, brennhaarförmig, an der Spitze oft mit Kristallen besetzt (im Exsikkat meist nicht sichtbar), einmal septiert, oberer Teil bis 30 um lang und bis 3 um dick, unterer Teil oft spindelig, aber auch unregelmäßig keulig oder zylindrisch oder rundlich verformt, bis 25 (im lang und zwischen 4-8 um dick. Pleurozystiden: keine vorhanden.
22 64 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Kaulozystiden: an der Stielspitze wie die Cheilozystiden geformt, Apikaiteil aber länger, bis 40 um lang. Huthaut: eine Kutis aus meist parallel liegenden, aber auch schräg stehenden, zylindrischen Hyphen von 3-8 um Dicke, oft mit ± kurzen Auswüchsen, mit meist abgerundeten, oft auch schwach keuligen oder spitzen Enden. Septen ohne Schnallen. Vorkommen: Am im Kalthaus nur an einer einzigen, sandigen Stelle ohne Bezug zu einem Nadel- oder Laubbaum. Der Fund bestand aus einem einzigen gut ausgebildeten Fruchtkörper. Untersuchte Kollektion: (PA 1309, WU 20113). Untypisch für diese Art an unserem Fund ist die ± graue Hutfarbe, die aber wohl auf den Standort im Glashaus, versteckt hinter einem großen Blumentopf, zurückzuführen sein muß. Laut BON (1995) sollte der Hut düster gefärbt sein (bis schwärzlich), und dazu bilden die fast weißen Lamellen einen scharfen Kontrast. Auch die fur die Gattung eher ungewöhnlichen Auswüchse an den Huthauthyphen weisen auf eine gewisse Anomalie hin. Melanophyllum haematospermum (BULL.: FR) KREISEL An den auffallend karmin- bis braunrot gefärbten Lamellen ist dieser Pilz leicht zu erkennen. Vor allem im Tropenhaus an zwei Stellen (am und sowie im März 1999), aber auch im Temperierthaus (am ) fand man diese Art meist einzeln wachsend oder in kleinen Gruppen. Auf einen weiteren Fund im Tropenhaus am sei besonders verwiesen, da hier, auf etwa 1 m 2 beschränkt, nur ganz winzige Fruchtkörper mit einem Hutdurchmesser bis 10 mm ausgebildet waren, während bei allen anderen Funden der Hutdurchmesser doch bis 35 mm maß. Hier handelt es sich aber offensichtlich nur um eine ökologisch bedingte Absonderlichkeit und nicht um die bei BON (1996) angeführte forma gracilis, da diese viel blassere Lamellen haben soll, was bei unserem Fund nicht der Fall war. Untersuchte Kollektionen: (PA 581, WU 19152); (PA 614, PA 615, WU 18060, WU 19153); (PA 972). Melanotusflavolivem (BERK. & CURT.) SINGER (Farbige Abb. VIII, IX; Abb. 10) Merkmale: Hut: länglich-muschelförmig bzw. Spatel- bis löffeiförmig, lateral gestielt, Höhe bis 11 mm, Breite bis 9 mm, an der Basis 4 mm, Oberfläche feinfaserig, Randzone schwach gerieft; obere Randzone grau (5B1) bis orangegrau (5B2), gegen den Stiel zu blaßorange (5A3). Lamellen: am Stiel mit Zähnchen angeheftet, gegen den Hutrand dichter mit Zwischenlamellen, gegen den Stiel zahlenmäßig abnehmend, Schneide glatt; Lamellenfarbe orangegrau, dann dunkler grau-fleckig, schließlich grau. Stiel: nur 4 mm lang und 3 mm dick, gegen die Basis sich auf 2 mm verjüngend, weiß mit dunkelgrauer Basis. Sporen: 5,5-7 x 4-4,5 (im, dunkelbraun, breit ellipsoidisch, glatt, dickwandig, mit ausgeprägtem Keimporus. Basidien: x 4-6 um, schwach langgestreckt keulig, beinahe zylindrisch mit schwach verdicktem Oberteil, mit vier kurzen Sterigmen und Basalschnallen.
23 Österr. Z. Pilzk. 10(2001) um Abb. 10 a-d. Melanotus flavolivens. a Huthaut, b Cheilozystiden, c Basidien, d Sporen. Cheilozystiden: x 4-7 um, relativ klein, flaschenförmig, Basis spindelig, Hals kontinuierlich gegen die Spitze dünner werdend, oft wellig verbogen. Pleurozystiden: keine gefunden. Huthaut: aus wirr verflochtenen, teilweise aufgerichteten Hyphen von 3-9 [im Durchmesser, teilweise mit knorrigen Auswüchsen; Septen mit Schnallen. Vorkommen: In einem Blumentopf auf einer bereits keimenden, beinahe gänzlich mit Sand bedeckten Palmenfrucht (Samen von Veitchia sp., Arecaceae, die aus Neukaledonien stammt), am im zum Tropenhaus gehörigen Anzuchtraum. Untersuchte Kollektion: (PA 1639, WU 21006). Der Schlüssel in der monografischen Bearbeitung der Gattung Melanotus durch HORAK (1977) führt für unseren Fund ohne Probleme zu M. flavolivens, einer bisher aus Neukaledonien, den Salomonen und den Bonin-Inseln bekannten Art. Sie wächst dort auf pflanzlichen Abfällen {Heliconia, COCQS), was auch auf unseren Fund zutrifft. Übereinstimmend sind nicht nur die mikroskopischen Merkmale, sondern auch der für die Gattung etwas abweichende Habitus und die Farben. Die Gattung Melanotus wird in jüngerer Zeit nicht mehr als selbständig anerkannt. Nachdem schon HORAK (1977) einige Zweifel äußerte, hat sie M. E. NOORDELOOS zu einer Untergattung von Psilocybe zurückgestuft (BAS & al. 1999). M. flavolivens ist bisher in Europa noch nicht gefunden worden. Auch ein Farbfoto von dieser Art gibt es noch nicht.,
24 66 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Mycena leptocephala (PERS.: FR.) GILLET Nur jeweils ein Einzelfruchtkörper dieser Art erschien am in einem Blumentopf im Anzuchtraum des Kalthauses bzw. am im Kalthaus am Boden, scheinbar auf Erde. Ob Funde aus der Vitrine vom und (jeweils ein Fruchtkörper) sowie vom (10 Fruchtkörper) ebenfalls dieser Art zuzuordnen sind, ist noch unklar. Im Gegensatz zu den obigen Funden weisen diese keine Schnallen an den Septen auf, außerdem fanden sich neben 4-sporigen Basidien auch 2-sporige. Allerdings hat MAAS GEESTERANUS (1992: 259) auf eine nordamerikanische Kollektion SMITHs von M. leptocephala mit einer derartigen Merkmalskombination hingewiesen. Untersuchte Kollektionen: (PA 1071); (PA 1343, WU 20221); , und (PA 1352). Mycena sanguinolenta (ALB. & SCHWEIN.: FR.) KUMMER Diese in den heimischen Nadelwäldern in der Nadelstreu häufige Art wuchs im Kalthaus mit zahlreichen Fruchtkörpern am in beinahe 2 m Höhe aus einem Metallkorb, gefüllt mit Rindenstückchen, Sphagnum und Torf, die als Substrat für Orchideen dienen. Diese Ampelpflanze wurde ab Mitte Mai ins Freie gehängt, wo die Helmlinge, Rindenstückchen aufsitzend, mit kurzen Unterbrechungen noch bis Ende Juli Fruchtkörper ausbildeten. Ein weiterer Fund stammt vom von einem am Boden stehenden Blumentopf des Temperierthauses. Untersuchte Kollektionen: (PA 582, WU 19160); (PA 1312). Mycena spec. (Farbige Abb. X) Merkmale: Hut: 3-13 mm, jung glockig, dann konvex, schließlich ausgebreitet, auch mit aufgebogenem Rand, dieser bei älteren Fruchtkörpern bis zur Mitte gerieft; jung blaßgrau (1C1), über platingrau (1D1) bis mittelgrau (1 El), alt graubraun (9E3) bis braungrau (7C2); Oberfläche vor allem jung fein weiß bereift. Lamellen: entfernt stehend, mit Zwischenlamellen, bogig, am Stiel ausgebuchtet, mit Zahn geringfügig am Stiel herablaufend, im Alter aderig verbunden, Schneiden ganz fein weißflockig; jung weiß, im Alter etwas graulich, auch rotgrau (7B2). Stiel: x 0,5-1 mm, zylindrisch, jung vor allem an der Spitze weiß, gegen die Basis etwas grau, etwa dem Hut gleichfarben, im Alter ganzer Stiel dunkler. Oberfläche glatt. Fleisch: dünn; Geschmack mild; Geruch intensiv pilzartig etwa nach getrockneten Steinpilzen. Sporen: 6-10,4 x 4,2-5,5 um, ellipsoidisch-subamygdaliform, glatt, hyalin, inamyloid. Basidien: nicht gefunden. Cheilozystiden: x 4-6(-8) um, zylindrisch-verbogen, glatt mit abgerundetem Apex. Lamellenschneide steril.
25 Österr. Z. 10(2001) 67 Huthaut: aus großen, rundlichen, um breiten Zellen, eingebettet in einer dicken gelatinösen Schicht [ähnlich der Huthaut von Mycena rorida (FR.: FR.) QUEL.]. Hyphen der Stielrinde: 2-3 um breit, mit dicker Wand ähnlich einem Marastnius, mit gelbbraunem Pigment und einem dünnen gelatinösen Überzug. Schnallen: vorhanden. Vorkommen: Ungefähr 20 Fruchtkörper fruktifizierten am im Tropenhaus auf Holz von Vitis vinifera L. Die Holzstücke sind etwa 20 cm lang, und stammen aus dem Übergangsbereich von Stamm und Wurzel, sind daher verkrüppelt und weisen Hohlräume auf. i Untersuchte Kollektion: (PA 685, WU 20867). Unser Material wurde von G. ROBICH, Venedig, untersucht, von ihm stammt auch ein Großteil der mikroskopischen Daten. An Hand des Exsikkats war es ihm nicht möglich, Basidien sowie Schleimhyphen der Huthaut zu finden. Laut ROBICH (schriftl. Mitteilung) handelt es sich um eine tropische Mycena, deren Identifizierung wahrscheinlich nur an Hand von Frischmaterial möglich ist. Wir geben eine ausfuhrliche Dokumentation in der Hoffnung, daß eine spätere Zuordnung unseres Fundes an Hand von Neufunden möglich wird. Psathyrella candolleana (FR: FR ) MAIRE Diese auch im Freien häufige Art bildete im Tropenhaus am und sowie am jeweils nur drei büschelig wachsende Fruchtkörper aus; weitere fünf Fruchtkörper wuchsen ebenfalls büschelig am im Temperierthaus. Untersuchte Kollektionen: (PA 580, WU 19162); (PA 1345, WU 20224). Abb. 11 a-c. Psathyrella pseudocorrugis. a Cheilozystiden, b Pleurozystiden, c Sporen.
26 Mitte Mai werden alljährlich eine Anzahl größerer Pflanzentröge aus dem Temperiertund Kalthaus ins Freigelände gestellt. In einem der Pflanzentröge aus dem Temperierthaus fruktifizierte auf abgestorbenen und verfilzten Wurzeln am und am eine größere Anzahl von Fruchtkörpern. Ob bereits im Temperierthaus Fruchtkörper ausgebildet worden waren, ist nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich, da neben frischen Exemplaren schon sehr alte und überreife bzw. vertrocknete Fruchtkörper vorhanden waren. Im selben Jahr wurde die Pflanze umgetopft, wodurch diese Fundstelle erlosch. Untersuchte Kollektion: (PA 640, WU 19159). I Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter 68 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Psathyrellapseudocorrugis (ROMAGN.) BON (Abb. 11) Merkmale: Hut: mm breit, flach ausgebreitet, graubraun (6D3) bis braun (6D5), mit dunkelbrauner (6E4-6F4) Mitte; Oberfläche trocken, weiß radialfaserig (Velumreste); Rand scharf. Lamellen: braungrau, dunkler als der Hut, am Stiel ausgebuchtet, auch mit Zähnchen angewachsen und etwas herablaufend. Lamellenschneide makroskopisch nicht auffallend rot gerandet. Stiel: x 2-3 mm, zylindrisch, an der Basis etwas verdickt, aber nicht knollig; weiß, weißfaserig, vor allem an der Spitze auch weißflockig. Sporen: 7-8,5(-9,5) x 4-5 um, ellipsoidisch, glatt, mit ausgeprägtem Keimporus. Sporenpulver schwarzbraun. Basidien: x 8-10 um, keulig, mit vier Sterigmen. Cheilozystiden: bis 50 um lang und 15 um breit, dick bis langgestreckt keulig, auch schwach utriform, selten auch etwas kopfig, basal mit bräunlichem Pigment. Pleurozystiden: bis 45 x 12 um, meist spindelig, selten auch mit leicht kopfigem oder etwas deformiertem Apikaiteil. Huthaut: zellig, aus birnenförmigen, keuligen, auch ovalen Elementen mit einer Breite bis 25 um. Vereinzelt fanden sich auch Velumreste aus Hyphen mit bis zu 5 um Durchmesser. Vorkommen: drei Fruchtkörper in einem Blumentopf mit Clerodendron sp. (Verbenaceae) am im Temperierthaus. Untersuchte Kollektion: (PA 1009, WU 19472). Leider waren nur diese drei Fruchtkörper im selben Entwicklungsstadium anzutreffen, es fehlten vor allem junge, frische Exemplare, sodaß nicht alle arttypischen makroskopischen Merkmale festzustellen waren. i Psathyrella spadiceogrisea (SCHAEFF.) MAIRE I Diese Art zählt neben Psathyrella candolleana wohl zu den in Mitteleuropa häufigsten Faserlingen. Zwei Fruchtkörper erschienen am im Temperierthaus in einem Blumentopf. Untersuchte Kollektion: (PA 1544, WU 20924). Tubaria conspersa (PERS.: FR.) FAYOD
27 Österr. Z. Püzk. 10(2001) um Abb. 12 a-c. Rigidiporus lineatus. a Hyphen, b Zystiden, c Sporen.
28 70 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz I Aphyllophorales s. 1. Coniophora puteana (SCHUM.: FR.) KARSTEN Die Fruchtkörper dieser Art besiedelten am nicht nur am Boden liegendes Holz, sondern gingen auch auf die angrenzende Erde über. Die offensichtlich schon seit längerer Zeit durch den sogenannten "Kellerpilz" befallenen Fichtenhölzer zur Begrenzung der Kulturflächen im Temperierthaus wurden im zweiten Jahr des Beobachtungszeitraumes durch Steinbegrenzungen ersetzt. Untersuchte Kollektion: (PA 973). Rigidiporus lineatus (PERS.) RYV. (Farbige Abb. XI, Abb. 12) Merkmale: Fruchtkörper: pileat, insgesamt nicht dicker als 4 mm, Hüte bis 15 mm vom Substrat abstehend und bis 40 mm breit, Oberfläche feinfilzig, Rand schwach konzentrisch gezont, Kante scharf, cremefarben (4A3). j Poren: rundlich, am senkrechten Substrat, vor allem an der untersten dünnen Zuwachszone aufgeschlitzt, Porenschicht ca. 3 mm dick, sehr feinporig, ca. 8 Porenöffnungen pro mm, ebenfalls cremefarben. Trama: zäh, trocken hart, wie der ganze Fruchtkörper gefärbt; Geruch intensiv säuerlich-pilzartig; Geschmack mild, intensiv pilzartig. Makroreaktionen: KOH =fc negativ (nach längerer Zeit Porenschicht etwas bräunlich), NH 4 OH negativ. Sporen: 4-5 um im Durchmesser, ± rund, glatt, inamyloid. Basidien: x 8-10 [im, breit keulig bis etwas tonnenförmig, mit vier Sterigmen, an der Basis einfach septiert. Zystiden und Zystidiolen: Apikaiteil x 5-13 um, zahlreich aus dem Hymenium ragend, zylindrisch, spindelig bis langgestreckt keulig, apikal bis zu 18 um Länge und 13 um Dicke inkrustiert. Im Exsikkat dürften die Kristalle teilweise abgefallen sein, da beim Frischmaterial bedeutend mehr Kristalle an den Zystiden- bzw. Zystidiolenenden festzustellen waren. Hyphensystem: monomitisch, generative Hyphen im Hymenialbereich 4-6 um im Durchmesser, meist dickwandig, dünnere Hyphen auch dünnwandig, sonst, vor allem in der Trama, 6-9 um im Durchmesser, dickwandig; alle Septen ohne Schnallen. 1 Vorkommen: am im Anzuchtraum des Tropenhauses auf der Außenseite eines Blumentopfes. Der Fruchtkörper war vom Topf leicht abzulösen, der gebrannte Ton darunter war weder farblich anders, noch schien die Oberfläche der Anwuchsstelle poröser als die Umgebung. Im sehr feucht gehaltenen Topf befand sich sandig-lehmige Erde mit Humusanteilen sowie Seramis und darin der Keimling einer Dattelpalmen-Art. Untersuchte Kollektion: (PA 1033, WU 19474). < Nach RYVARDEN & GILBERTSON (1994) ist Rigidoporus lineatus in den Tropen ein häufiger Porling. In Europa wurde die Art insgesamt erst zweimal gefunden, und zwar in Budapest, ebenfalls in einem Glashaus, und in der ehemaligen Tschechoslowakei, in einer Mine in 450 m Tiefe.
29 österr. Z. Pilzk. 10(2001) 71 Schizophyllum commune FR.: FR. Der in der ganzen Welt verbreitete Spaltblättling, ein Holzzersetzer schon in der Initialphase, besiedelte während des gesamten Beobachtungszeitraumes am Boden liegende, als Trittplatten benützte Weichholzscheiben im Tropenhaus. Untersuchte Kollektion: (PA 1353, WU 20223). Steccherinum ochraceum (PERS.: FR.) S. F. GRAY Schon bald nach dem Aufstellen und der Bepflanzung der Vitrine fruktifizierte diese auch im Feld häufige Art am mit zahlreichen Fruchtkörpern pileat an einem Laubholzstamm. Untersuchte Kollektion: (PA 1358, WU 20946). Vorkommen der einzelnen Arten 1) Tropenhaus mit Anzuchtraum (AZ) und der in Abb. 2 gekennzeichneten und erst Anfang des Jahres 2000 aufgestellten Vitrine (V) mit tropischem Kleinklima (hier werden blühende Vertreter dieser Klimazone, meist aus dem Tropen-Anzuchtraum, zur Schau gestellt.) Armillaria meilea Conocybe spec. (AZ) Coprinus disseminatus Gymnopus luxurians Gymnopus spec. (AZ) Hohenbuehelia mastrucata (V) Hohenbuehelia petalodes Hypholoma fasciculare Lepiota aspera Lepiota cristata Lepiota elaiophylla Leucoagahcus americanus i Leucocoprinus birnbaumn i Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus ' Limacella glioderma \ Melanophyllum haematospermum Melanotus flavolivens (AZ) Mycena spec. Psathyrella candolleana Rigidiporus lineatus (AZ) Schizophyllum commune Steccherinum ochraceum (V) 2) Temperierthaus mit Anzuchtraum (AZ) Coniophora puteana Conocybe crispella (AZ) Coprinus domesticus i ' Coprinus plagioporus Leucocoprinus birnbaumii Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus Limacella glioderma Lyophyllum fumosum j Melanoleuca rasilis var. leucophylloides * Melanophyllum haematospermum
30 72 H. PIDLICH-AIGNER & A. HAUSKNECHT: Großpilze im Botanischen Garten Graz Mycena sanguinolenta Psathyrella candolleana Psathyreüa pseudocorrugis Psathyrella spadiceogrisea Tubaria conspersa 3) Kalthaus mit Anzuchtraum (AZ) Gymnopus dryophilus Hemimycena cucullata Leucoagaricus americanus Leucoagaricus leucothites Leucocoprinus birnbaumii Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus Leucocoprinus denudatus Limacella glioderma Lyophyllum fumosum Mycena leptocephala (und AZ) Mycena sanguinolenta ' 4) Sukkulentenhaus-Bereich I Lepiota cristala Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus 5) Sukkulentenhaus-Bereich II Keine Funde. Wir danken V. ANTONIN, Brno und G. ROBICH, Venezia, für Bestimmungshilfe und wertvolle Hinweise. Unser besonderer Dank gilt Frau R. HÖLLRIEGL und Frau MONIKA KÖBERL für die Reinzeichnung der Mikrozeichnungen, wie auch den Mitarbeitern des Botanischen Gartens für die Unterstützung bei diesem Projekt. j Literatur I I ANTONIN, V., HERINK, J., 1999: Notes on the variability of Gymnopus luxuriam {Tricholomataceae). - Czech Mycol. 53: NOORDELOOS, M. E.,1997: A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe, Part 2. Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus and additions to Marasmiellus. - Libri Botanici Eching: IHW. BAS, C, KUYPER, T. W., NOORDELOOS, M. E., VELLINGA, E. C, 1995: Flora Agaricina Neerlandica 3. - Tricholomataceae (2). - Rotterdam, Brookfield: Balkema. 1999: Flora Agaricina Neerlandica 4. - Strophariaceae, Tricholomataceae (3). - Rotterdam, Brookfield: Balkema. BON, M., 1995: Die Großpilzflora von Europa 2 - Tricholomataceae 1. - Eching: IHW. \ 1996: Die Großpilzflora von Europa 3 - Lepiotaceae. - Eching: IHW. MASSART, F., 1996: Deux especes americaines decouvertes dans le sud-ouest de la France. - Doc. Mycol. 26/103: CANDUSSO, M., LANZONI, G., 1990: Lepiota s. 1. Fungi Europaei 4. - Saronno: Giovanni Biella. ' HAUSKNECHT, A., 1997: Erste Funde von Conocybe crispella in Europa. - Boll. Gr. Micol. Bresadola 40: KRISAI-GREILHUBER, I., 2000: Rüblinge, Schwindlinge und verwandte Taxa in Ostösterreich. - Österr. Z. Pilzk. 9: HORAK, E., 1977: The genus Melanotus PAT. -Persoonia 9: " ' -' KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ, BOTANISCHER GARTEN, 1994 (Herausg.): Bodenaufbau und Substratmischungen in den Gewächshäusern. - Wien: Ungar.
31 österr. Z. Pilzk. 10(2001) 73 STEIRISCHE LANDESREGIERUNG, LANDESBAUDIREKTION, 1995 (Herausg.): Die Gewächshäuser der Uni Graz. - Wien: Ungar. KORNERUP, A., W ANSCHER, J. H., 1981: Taschenlexikon der Farben, 3. Aufl. - Zürich, Göttingen: Musterschmidt. MAAS GEESTERANUS, R. A., 1992: Conspectus of the Mycenas of the Northern Hemisphere n. - Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo: Kon. Nederl. Akad. Wetensch. Verh. MIGLIOZZI, V., PERRONE, L., 1992: Sulle Lepiotee - 7 contribute Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus (PANIZZI) BABOS. - Boll. AMER 25: 3-8. MOSER, ML, 1983: Die Röhrlinge und Blätterpilze, 5. Aufl. - In GAMS, H., (Begr.): Kleine Kryptogamenflora üb/2.- Stuttgart: G. Fischer. ROMAGNESI, H., 1967: Les Russules d'europe et d'afrique du Nord. - Paris: Bordas. RYVARDEN, L., GILBERTSON, R. L., 1994: European Polypores 2. - Oslo: Fungiflora ULJE, C. B., BAS, C, 1991: Studies in Coprinus - II. - Persoonia 14: VELLINGA, E. C, 2000: Notes on Lepiota and Leucoagaricus. Type studies on Lepiota magnispora, Lepiota barssii, andagaricus americanus. - Mycotaxon 76: HUUSER, H. A., 1997: Lepiota xanthophylla and its greenhouse counterpart. - Boll. Gr. Mycol. Bresadola 40: WASSER, S. P., 1979: Fungorum rariorum Icones coloratae Vaduz: Cramer. WATLING, R., 1994: Observations on Malaysian Bolbitiaceae with records from Salomon Islands. - Garden's Bull. Singapore 45:
32
33 Farbige Abb. IV. Gymnopus spec. (WU 21007). Farbige Abb. V. Lepiota elaiophylla (WU 18988). Farbige Abb. VI. Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus (WU 18925). Farbige Abb. VII. Leucocoprinus denudatus (WU 18965). - Phot. H. PIDLICH-AIGNER.
34
35 Farbige Abb. VIII, IX. Melanotus flavolivens (WU 21006). Farbige Abb. X. Mycena spec. (WU 20867). Farbige Abb. XI. Rigidopoms lineatus (WU 19474). Phot. H. PIDLICH-AIGNER.
Renate Volk Fridhelm Volk. Pilze. sicher bestimmen lecker zubereiten. 3. Auflage 231 Farbfotos von Fridhelm Volk
 Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten 3. Auflage 231 Farbfotos von Fridhelm Volk 20 Pfefferröhrling Chalciporus piperatus Hut: 2 7 cm. Halbkugelig, orange bis zimtbraun oder
Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten 3. Auflage 231 Farbfotos von Fridhelm Volk 20 Pfefferröhrling Chalciporus piperatus Hut: 2 7 cm. Halbkugelig, orange bis zimtbraun oder
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
6. DIE NEUE GATTUNG CHLOROPHYLLUM NACH VELLINGA - SELTSAME IN-
 DGfM-Mitteilungen, 18. Jahrgang 51 6. DIE NEUE GATTUNG CHLOROPHYLLUM NACH VELLINGA - SELTSAME IN- TOXIKATIONSSYMPTOME Daniel Frank Key Words: Basidiomycetes, Agaricales, Chlorophyllum brunneum, Chlorophyllum
DGfM-Mitteilungen, 18. Jahrgang 51 6. DIE NEUE GATTUNG CHLOROPHYLLUM NACH VELLINGA - SELTSAME IN- TOXIKATIONSSYMPTOME Daniel Frank Key Words: Basidiomycetes, Agaricales, Chlorophyllum brunneum, Chlorophyllum
Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 5. Die Conocyberickeniana-und G magnicapitata-gruppe in Europa
 östcrr. Z. Pilzk. 8(1999) 35 Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 5. Die Conocyberickeniana-und G magnicapitata-gruppe in Europa ANTON HAUSKNECHT Sonndorferstraße 22 A-3712 Maissau, Österreich Eingelangt
östcrr. Z. Pilzk. 8(1999) 35 Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 5. Die Conocyberickeniana-und G magnicapitata-gruppe in Europa ANTON HAUSKNECHT Sonndorferstraße 22 A-3712 Maissau, Österreich Eingelangt
Pilze. Schopftintling. zusammengestellt von Ingrid Chyna/2002
 Schopftintling Die Tintlinge haben ihren Namen von einer besonderen Eigenschaft erhalten, die sie deutlich von anderen Pilzen unterscheidet. Mit zunehmender Reife verfärben sich die Lamellen dieser Pilze
Schopftintling Die Tintlinge haben ihren Namen von einer besonderen Eigenschaft erhalten, die sie deutlich von anderen Pilzen unterscheidet. Mit zunehmender Reife verfärben sich die Lamellen dieser Pilze
Bestimmungshilfe Krautpflanzen
 Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Laubbäume
 Laubbäume http://www.faz-mattenhof.de/ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung/unterlagen Stand: 06-11-12 Knospen gelbgrün, kreuzgegenständig Seitenknospen abstehend glatte Rinde Knospen klein, spitz, graubraun
Laubbäume http://www.faz-mattenhof.de/ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung/unterlagen Stand: 06-11-12 Knospen gelbgrün, kreuzgegenständig Seitenknospen abstehend glatte Rinde Knospen klein, spitz, graubraun
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4)
 Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten. Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach
 Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
Entoloma noordeloosi, eine neue Art der Sektion Rhodopolia aus Österreich
 Österr. Z. Pilzk. 8(1999) 149 Entoloma noordeloosi, eine neue Art der Sektion Rhodopolia aus Österreich ANTON HAUSKNECHT SonndorfCTstraße 22 A-3712 Maissau, Österreich Eingelangt am 22. 7. 1999 Key words:
Österr. Z. Pilzk. 8(1999) 149 Entoloma noordeloosi, eine neue Art der Sektion Rhodopolia aus Österreich ANTON HAUSKNECHT SonndorfCTstraße 22 A-3712 Maissau, Österreich Eingelangt am 22. 7. 1999 Key words:
Vier neue Arten der Gattung Cartodere (Aridius) C. G. THOMSON, 1859 aus Papua-Neuguinea und Neuseeland (Coleoptera: Latridiidae)
 Vier neue Arten der Gattung Cartodere (Aridius) C. G. THOMSON, 1859 aus Papua-Neuguinea und Neuseeland (Coleoptera: Latridiidae) WOLFGANG H. RÜCKER Abstract Three new species of the genus Cartodere C.G.
Vier neue Arten der Gattung Cartodere (Aridius) C. G. THOMSON, 1859 aus Papua-Neuguinea und Neuseeland (Coleoptera: Latridiidae) WOLFGANG H. RÜCKER Abstract Three new species of the genus Cartodere C.G.
Zoologische Staatssammlung München;download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at SPIXIANA
 SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
nadelbäume In weiterer Folge wird auf vier bedeutende heimische Nadelbäume (Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche) eingegangen.
 bäume besitzen an Stelle der Blätter n, die den Sommer über dieselbe Funktion erfüllen wie die Blätter. Auf einem Baum befinden sich gleichzeitig immer unterschiedlich alte n (jahrgänge = n, die an einem
bäume besitzen an Stelle der Blätter n, die den Sommer über dieselbe Funktion erfüllen wie die Blätter. Auf einem Baum befinden sich gleichzeitig immer unterschiedlich alte n (jahrgänge = n, die an einem
Herausgeber: Jochen Gartz»Psychoaktive Pilze Bestimmungskarten«1998, Nachtschatten Verlag, CH-4502 Solothurn
 Titelmotiv: Aquarell des Panaeolus subbalteatus aus E. Michael und R. Schulz: Führer für Pilzkunde, Bd.2, Leipzig (1927). Farblich aktualisiert durch Janine Warmbier. Gelegentlich wurden psychoaktive Pilzarten
Titelmotiv: Aquarell des Panaeolus subbalteatus aus E. Michael und R. Schulz: Führer für Pilzkunde, Bd.2, Leipzig (1927). Farblich aktualisiert durch Janine Warmbier. Gelegentlich wurden psychoaktive Pilzarten
Kunterbunter Ostertisch Über den Wolken Altes Holz, neues Leben
 Die schönen Seiten des Landlebens März/ April 2015 I 4,00 Kunterbunter Ostertisch Über den Wolken Altes Holz, neues Leben Frühling Frühe Glöckchen und Sterne Propertius hat zart duftende Blüten. An sonnigen
Die schönen Seiten des Landlebens März/ April 2015 I 4,00 Kunterbunter Ostertisch Über den Wolken Altes Holz, neues Leben Frühling Frühe Glöckchen und Sterne Propertius hat zart duftende Blüten. An sonnigen
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume. Acer platanoides. Diplomarbeit von Jennifer Burghoff. Fachbereich Gestaltung. Kommunikationsdesign
 Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Champagne- Silber (Schweizer Zuchtrichtung)
 Champagne- Silber (Schweizer Zuchtrichtung) Erstellt von: UrbanHamann Rassegeschichte Ursprungsland Frankreich Silberungsmutationen im 17. Jahrhundert erste schriftliche Erwähnung ca. 1730 1895 erste Tiere
Champagne- Silber (Schweizer Zuchtrichtung) Erstellt von: UrbanHamann Rassegeschichte Ursprungsland Frankreich Silberungsmutationen im 17. Jahrhundert erste schriftliche Erwähnung ca. 1730 1895 erste Tiere
Die Natur in den 4 Jahreszeiten. Julian 2012/13
 Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Die grauen Farbenschläge. Lorenz Paulus Schulungsleiter LV Hannover
 hasenfarbig wildgrau hasengrau dunkelgrau eisengrau Grundsätzlich gilt: Die Farbbezeichnung grau als solche gibt es nur noch für Graue Wiener! Aber auch dort muss eine explizite Farbangabe erfolgen, wenn
hasenfarbig wildgrau hasengrau dunkelgrau eisengrau Grundsätzlich gilt: Die Farbbezeichnung grau als solche gibt es nur noch für Graue Wiener! Aber auch dort muss eine explizite Farbangabe erfolgen, wenn
Spuren/Trittsiegel erkennen
 Spuren/Trittsiegel erkennen Einleitung Die Zehen Ihre Länge ist verschieden. Wie bei des Menschen Hand, der 3 Zeh ist der längste, dann der 4, 2, 5 Zehballen und zum Schluss der Innenzehe (Daumen) Die
Spuren/Trittsiegel erkennen Einleitung Die Zehen Ihre Länge ist verschieden. Wie bei des Menschen Hand, der 3 Zeh ist der längste, dann der 4, 2, 5 Zehballen und zum Schluss der Innenzehe (Daumen) Die
BEOBACHTUNGSBOGEN T O M AT E N 2014
 BEOBACHTUNGSBOGEN T O M AT E N 2014...... Sortenname Patin/Pate Herkunft (lt. Patenschaftserklärung)... Bei mir im Anbau seit... und in den Jahren... Wie war die Witterung im diesjährigen Anbaujahr? Temperaturen
BEOBACHTUNGSBOGEN T O M AT E N 2014...... Sortenname Patin/Pate Herkunft (lt. Patenschaftserklärung)... Bei mir im Anbau seit... und in den Jahren... Wie war die Witterung im diesjährigen Anbaujahr? Temperaturen
KostProbe Seiten. So bestimmst du Blütenpflanzen
 Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
FCI - Standard Nr. 108 / / D. PICARDIE-SPANIEL (Epagneul picard)
 FCI - Standard Nr. 108 / 25. 09. 1998 / D PICARDIE-SPANIEL (Epagneul picard) ÜBERSETZUNG : Frau Michèle Schneider. URSPRUNG : Frankreich. 2 DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDES : 30.
FCI - Standard Nr. 108 / 25. 09. 1998 / D PICARDIE-SPANIEL (Epagneul picard) ÜBERSETZUNG : Frau Michèle Schneider. URSPRUNG : Frankreich. 2 DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDES : 30.
1 Einleitung Das Holz der Eberesche Eigenschaften und Aussehen des Holzes Verwendung des Holzes...
 Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Lösung Station 1. Teile des Baumes (a)
 Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
 Konsistenzen und Bodenarten klüftig Ton (T) A Auffüllung (A) fest Schluff (U) Mudde (F) halbfest - fest halbfest Sand (S) Z Z Z Sandstein (^s) steif - halbfest Feinsand (fs) steif Mittelsand (ms) weich
Konsistenzen und Bodenarten klüftig Ton (T) A Auffüllung (A) fest Schluff (U) Mudde (F) halbfest - fest halbfest Sand (S) Z Z Z Sandstein (^s) steif - halbfest Feinsand (fs) steif Mittelsand (ms) weich
Sommerzwiebeln, gesät: Anfälligkeit der Sorten auf Falschen Mehltau und Qualität bei Ein- und Auslagerung
 Sommerzwiebeln, gesät: Anfälligkeit der Sorten auf Falschen Mehltau und Qualität bei Ein- und Auslagerung R. Six, F. Haslinger, 2010 1. Versuchsziel Vergleich von resistenten und nicht resistenten gelben
Sommerzwiebeln, gesät: Anfälligkeit der Sorten auf Falschen Mehltau und Qualität bei Ein- und Auslagerung R. Six, F. Haslinger, 2010 1. Versuchsziel Vergleich von resistenten und nicht resistenten gelben
Wie vermehren sich Pilze?
 Wie vermehren sich Pilze? 31. Woche Pilze sind geheimnisvoll. Manche schaffen es, über Nacht zu wachsen Sie vermehren sich durch Sporen. Sporen sieht man nur ganz selten, aber du kannst sie sichtbar machen.
Wie vermehren sich Pilze? 31. Woche Pilze sind geheimnisvoll. Manche schaffen es, über Nacht zu wachsen Sie vermehren sich durch Sporen. Sporen sieht man nur ganz selten, aber du kannst sie sichtbar machen.
Parc Ela Region Albula-Bergün, Savognin-Bivio. Infoblatt Kleinlebewesen. Echte Spinnen
 Infoblatt Kleinlebewesen Quelle: Lohri F., Schwyter Hofmann A. (2004): Treffpunkt Wald. Waldpädagogik für Forstleute. Ein Handbuch mit praktischen Arbeitsunterlagen, Ideen und Beispielen von Waldführungen.
Infoblatt Kleinlebewesen Quelle: Lohri F., Schwyter Hofmann A. (2004): Treffpunkt Wald. Waldpädagogik für Forstleute. Ein Handbuch mit praktischen Arbeitsunterlagen, Ideen und Beispielen von Waldführungen.
Zwei. Pilzspiele für Gruppen. Pilzbestimmungsspiel Material: Pilze, weißes Laken
 Zwei Pilzspiele für Gruppen Pilzbestimmungsspiel Material: Pilze, weißes Laken Um erworbene Pilzkenntnisse spielerisch zu festigen, werden zwei gleich große Gruppen gebildet, die sich etwa in einem Abstand
Zwei Pilzspiele für Gruppen Pilzbestimmungsspiel Material: Pilze, weißes Laken Um erworbene Pilzkenntnisse spielerisch zu festigen, werden zwei gleich große Gruppen gebildet, die sich etwa in einem Abstand
SÜDRISSISCHER OVTSCHARKA
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard Nr. 326 / 30. 09. 1983 / D SÜDRISSISCHER OVTSCHARKA (Ioujnorousskaia Ovtcharka)
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard Nr. 326 / 30. 09. 1983 / D SÜDRISSISCHER OVTSCHARKA (Ioujnorousskaia Ovtcharka)
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010
 Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Der Regenwurm. Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar.
 Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
laubbäume Quelle: Bundesforschungs- u Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)
 Laubbäume zeichnet aus, dass sie jedes Jahr im Herbst ihre Blätter abwerfen. Zunächst verfärben sich die Blätter. Diese herbstliche Farbenpracht ist das Ergebnis eines längeren Vorganges, bei dem den Blättern
Laubbäume zeichnet aus, dass sie jedes Jahr im Herbst ihre Blätter abwerfen. Zunächst verfärben sich die Blätter. Diese herbstliche Farbenpracht ist das Ergebnis eines längeren Vorganges, bei dem den Blättern
Zwei neue Phanerotoma-Arten aus dem mediterranen Raum (Hymenoptera, Braconidae: Cheloninae)
 ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Tomus81. Budapest, 1990 p. 153-157. Zwei neue Phanerotoma-Arten aus dem mediterranen Raum (Hymenoptera, Braconidae: Cheloninae) von H. ZETTEL, Wien
ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Tomus81. Budapest, 1990 p. 153-157. Zwei neue Phanerotoma-Arten aus dem mediterranen Raum (Hymenoptera, Braconidae: Cheloninae) von H. ZETTEL, Wien
Welcher Hauttyp sind Sie?
 Welcher Hauttyp sind Sie? Sommer, Sonne, Spaß und Freizeit. Jetzt ist sie da, die heiße Jahreszeit. Damit Sie den Sommer unbeschwert genießen können haben wir ein paar Empfehlungen für Sie zusammengestellt.
Welcher Hauttyp sind Sie? Sommer, Sonne, Spaß und Freizeit. Jetzt ist sie da, die heiße Jahreszeit. Damit Sie den Sommer unbeschwert genießen können haben wir ein paar Empfehlungen für Sie zusammengestellt.
Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet
 Newsletter Nr. 8-2008 Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet Die Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen - bedingt durch die Blüte der windblütigen Bäume - im Zeitraum von März bis Mai ihre höchsten
Newsletter Nr. 8-2008 Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet Die Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen - bedingt durch die Blüte der windblütigen Bäume - im Zeitraum von März bis Mai ihre höchsten
Fischaufstiegskontrollen bei den Aarekraftwerken, FIPA.2005
 Bestimmung der in der Aare vorkommenden Fischarten Die hier zusammengestellten Bestimmungsunterlagen sollen es den Verantwortlichen für die Aufstiegskontrollen ermöglichen, die Arten der vorgefundenen
Bestimmung der in der Aare vorkommenden Fischarten Die hier zusammengestellten Bestimmungsunterlagen sollen es den Verantwortlichen für die Aufstiegskontrollen ermöglichen, die Arten der vorgefundenen
Bestimmungsschlüssel der Flusskrebse in Sachsen
 Rostrum Abdomen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft - Fischereibehörde Bestimmungsschlüssel der Flusskrebse in Sachsen Rückenfurchen Nackenfurche Fühlerschuppe Scherengelenk Augenleisten ja - rote
Rostrum Abdomen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft - Fischereibehörde Bestimmungsschlüssel der Flusskrebse in Sachsen Rückenfurchen Nackenfurche Fühlerschuppe Scherengelenk Augenleisten ja - rote
Winter-Linde 51 Tilia cordata. Robinie 29 Robinia pseudacacia. Baum: bis 40 m hoch, oft als Parkbaum
 Winter-Linde 51 Tilia cordata Baum: bis 40 m hoch, oft als Parkbaum Blatt: herzförmig, zugespitzt, steif Früchte: mehrere Nüsschen mit Flughaut Blüten: wohlriechend (Tee) Blattunterseite mit rostfarbenen
Winter-Linde 51 Tilia cordata Baum: bis 40 m hoch, oft als Parkbaum Blatt: herzförmig, zugespitzt, steif Früchte: mehrere Nüsschen mit Flughaut Blüten: wohlriechend (Tee) Blattunterseite mit rostfarbenen
Selber Kompost machen
 Selber Kompost machen Die Natur kennt keine Abfälle. Material, das sich zersetzen kann, können Sie weiter verwenden. Das wird Kompost genannt. Kompost ist ein guter Dünger für Blumen und Pflanzen. Selber
Selber Kompost machen Die Natur kennt keine Abfälle. Material, das sich zersetzen kann, können Sie weiter verwenden. Das wird Kompost genannt. Kompost ist ein guter Dünger für Blumen und Pflanzen. Selber
Fellfarben beim Border Collie Leitfaden fär die Wurfabnahme bis zur 3. Woche
 Fellfarben beim Border Collie Leitfaden fär die Wurfabnahme bis zur 3. Woche FÄr alle verwendeten Bilder liegt das Nutzungsrecht fär die Verwendung durch den Club fär Britische HÄtehunde ohne weitere Quellenangabe
Fellfarben beim Border Collie Leitfaden fär die Wurfabnahme bis zur 3. Woche FÄr alle verwendeten Bilder liegt das Nutzungsrecht fär die Verwendung durch den Club fär Britische HÄtehunde ohne weitere Quellenangabe
SALAT- UND SAUCENTOMATEN
 SALAT- UND SAUCENTOMATEN TICA Glänzend rote, sehr feste Salattomate, sehr ertragreich und gesund. HELLFRUCHT Ertragreiche rote Salattomate mit sehr gutem Geschmack. MATINA Sehr frühe rote Salattomate,
SALAT- UND SAUCENTOMATEN TICA Glänzend rote, sehr feste Salattomate, sehr ertragreich und gesund. HELLFRUCHT Ertragreiche rote Salattomate mit sehr gutem Geschmack. MATINA Sehr frühe rote Salattomate,
Sibirische Lärche. lagernd. Beschreibung: Preis/m²: 33,14 excl.mwst. Als Schnittholz lagernd erhältlich!
 Sibirische Lärche lagernd Verbreitung: Vier isolierte Teilareale in den Alpen, Sudeten, in der Tatra und in Polen; Nach diesen Gebieten werden die in ihren Wuchsformen und -leistungen unterschiedlichen
Sibirische Lärche lagernd Verbreitung: Vier isolierte Teilareale in den Alpen, Sudeten, in der Tatra und in Polen; Nach diesen Gebieten werden die in ihren Wuchsformen und -leistungen unterschiedlichen
Experiment Nr. 1: Wasser hat eine Haut. 1. Lege das Seidenpapier vorsichtig auf die Wasseroberfläche.
 Experiment Nr. 1: Wasser hat eine Haut Siehe Pädagogische Unterlagen, Seite 6, 1: Was ist Wasser? Wasser hat eine erhöhte Oberflächenspannung ein Glas, mit Wasser gefüllt Nadel Büroklammer ein kleines
Experiment Nr. 1: Wasser hat eine Haut Siehe Pädagogische Unterlagen, Seite 6, 1: Was ist Wasser? Wasser hat eine erhöhte Oberflächenspannung ein Glas, mit Wasser gefüllt Nadel Büroklammer ein kleines
Sorte Farbe Früchte Reife Geschmack Sonstiges Normalfrüchtige Tomaten
 Normalfrüchtige Tomaten Money Maker rot rund mit sehr gutem Geschmack empfehlenswerte Freilandsorte Schrammstraße 46 02763 Zittau Telefon: 0160-5254400 E-Mail: biogaertnerei-zittau@gmx.de www.biogaertnerei-zittau.de
Normalfrüchtige Tomaten Money Maker rot rund mit sehr gutem Geschmack empfehlenswerte Freilandsorte Schrammstraße 46 02763 Zittau Telefon: 0160-5254400 E-Mail: biogaertnerei-zittau@gmx.de www.biogaertnerei-zittau.de
der Bach viele Bäche der Berg viele Berge die Bewölkung der Blitz viele Blitze der Donner Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. Der Berg ist hoch.
 der Bach viele Bäche Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. der Berg viele Berge Der Berg ist hoch. die Bewölkung Die Bewölkung am Himmel wurde immer dichter. der Blitz viele Blitze In dem Baum hat ein
der Bach viele Bäche Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. der Berg viele Berge Der Berg ist hoch. die Bewölkung Die Bewölkung am Himmel wurde immer dichter. der Blitz viele Blitze In dem Baum hat ein
Seite 2. Allgemeine Informationzu Basilikum. Kontakt. Vorwort. ingana Shop
 2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
FCI - Standard Nr. 105 /05. 07.2006 / D. FRANZÖSISCHER WASSERHUND (Barbet)
 FCI - Standard Nr. 105 /05. 07.2006 / D FRANZÖSISCHER WASSERHUND (Barbet) 2 ÜBERSETZUNG: Doris Czech URSPRUNG: Frankreich DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDS 21.02.2006. VERWENDUNG:
FCI - Standard Nr. 105 /05. 07.2006 / D FRANZÖSISCHER WASSERHUND (Barbet) 2 ÜBERSETZUNG: Doris Czech URSPRUNG: Frankreich DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDS 21.02.2006. VERWENDUNG:
Bestimmung von Waldfledermäusen in Rund- und Flachkästen
 Bestimmung von Waldfledermäusen in Rund- und Flachkästen Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern Dr. Andreas Zahn Andreas.Zahn@iiv.de Mit Bildern von Matthias Hammer und Andreas Zahn 1 A: Ohren
Bestimmung von Waldfledermäusen in Rund- und Flachkästen Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern Dr. Andreas Zahn Andreas.Zahn@iiv.de Mit Bildern von Matthias Hammer und Andreas Zahn 1 A: Ohren
Hebeloma edurum Metrod, der Kakaofälblin g ein häufiger, leicht kenntlicher Fälblin g
 Hebeloma edurum Metrod, der Kakaofälblin g ein häufiger, leicht kenntlicher Fälblin g Von Frieder G r ö g e r, Brühei m (Mit 1 Abbildung ) Die Gattung der Fälblinge Hebeloma muß als eine der zur Zeit am
Hebeloma edurum Metrod, der Kakaofälblin g ein häufiger, leicht kenntlicher Fälblin g Von Frieder G r ö g e r, Brühei m (Mit 1 Abbildung ) Die Gattung der Fälblinge Hebeloma muß als eine der zur Zeit am
Farbberatung bei ioro.de
 Farbberatung bei ioro.de Be your own kind of beautiful Life ist too short to wear boring jewellery Finden Sie heraus, welche Schmuckfarben perfekt zu Ihnen passen! Mit unseren Vorschlägen entdecken Sie
Farbberatung bei ioro.de Be your own kind of beautiful Life ist too short to wear boring jewellery Finden Sie heraus, welche Schmuckfarben perfekt zu Ihnen passen! Mit unseren Vorschlägen entdecken Sie
Das ist eure Aufgabe: Geht zur Reiseleitung und schnuppert an den drei Holzkugeln. Welche Duftkugel riecht nach Orange?
 Italien. Das ist ein Land im Süden von Europa und liegt überwiegend in einer Biodiversitätszone mit einer mittelgroßen Pflanzenvielfalt. Nur im Norden des Landes, am Rande der Alpen ist die Vielfalt geringer.
Italien. Das ist ein Land im Süden von Europa und liegt überwiegend in einer Biodiversitätszone mit einer mittelgroßen Pflanzenvielfalt. Nur im Norden des Landes, am Rande der Alpen ist die Vielfalt geringer.
konvex flach mit stumpfem Buckel matt / feinfilzig bereift wirkend (feucht etwas glänzend) Huthaut überragt am Rand die Lamellen
 Gattung M e l a n o l e u c a Art e x s c i s s a (Fries 1821) inger 1935 ss. Kuehner Deutsche Bezeichnung: Blassgrauer Weichritterling ynonyme: Agaricus exscissus Fries 1821 Tricholoma exscissa (Fr.)
Gattung M e l a n o l e u c a Art e x s c i s s a (Fries 1821) inger 1935 ss. Kuehner Deutsche Bezeichnung: Blassgrauer Weichritterling ynonyme: Agaricus exscissus Fries 1821 Tricholoma exscissa (Fr.)
Bestimmung des ph-wertes des Bodens
 Bestimmung des ph-wertes des Bodens Durch den ph-wert erhältst du eine Angabe zum Säuregehalt. Er wird im Bereich zwischen 1 (sehr sauer!!!) und 14 (sehr basisch!) angegeben. Bei einem ph-wert von 7 spricht
Bestimmung des ph-wertes des Bodens Durch den ph-wert erhältst du eine Angabe zum Säuregehalt. Er wird im Bereich zwischen 1 (sehr sauer!!!) und 14 (sehr basisch!) angegeben. Bei einem ph-wert von 7 spricht
Was ist eigentlich der Falsche Satans-Röhrling
 Was ist eigentlich der Falsche Satans-Röhrling Boletus rubrosanguineus (Walty) ex Cheype? Von Frank Röger, Am Wasserwerk 16 c, 53840 Troisdorf. Alle Fotos vom Autor Eines der aufregendsten Erlebnisse im
Was ist eigentlich der Falsche Satans-Röhrling Boletus rubrosanguineus (Walty) ex Cheype? Von Frank Röger, Am Wasserwerk 16 c, 53840 Troisdorf. Alle Fotos vom Autor Eines der aufregendsten Erlebnisse im
Fellfarben beim Welsh Corgi Pembroke Leitfaden fär die Wurfabnahme bis zur 3. Woche
 Fellfarben beim Welsh Corgi Pembroke Leitfaden fär die Wurfabnahme bis zur 3. Woche FÄr alle verwendeten Bilder liegt das Nutzungsrecht fär die Verwendung durch den Club fär Britische HÄtehunde ohne weitere
Fellfarben beim Welsh Corgi Pembroke Leitfaden fär die Wurfabnahme bis zur 3. Woche FÄr alle verwendeten Bilder liegt das Nutzungsrecht fär die Verwendung durch den Club fär Britische HÄtehunde ohne weitere
Ist der Elefant ein kleines Tier?...
 Fragen stellen 1 Meist kann man aus einem einfachen Satz durch das Umstellen der Wörter eine Frage bilden Der Elefant ist ein kleines Tier. Ist der Elefant ein kleines Tier? Der Satz beginnt immer mit
Fragen stellen 1 Meist kann man aus einem einfachen Satz durch das Umstellen der Wörter eine Frage bilden Der Elefant ist ein kleines Tier. Ist der Elefant ein kleines Tier? Der Satz beginnt immer mit
Wärmsteine-Brique chauffeuse. Histor. Wärmespender - Sammlung Brigitte & Achim Werner
 Wärmsteine-Brique chauffeuse Histor. Wärmespender - Sammlung Brigitte & Achim Werner Historische Bettwärmer Wärmesteine aus Keramik und aus Serpentin Zum Aufwärmen des Bettes wurde schon immer vorallem
Wärmsteine-Brique chauffeuse Histor. Wärmespender - Sammlung Brigitte & Achim Werner Historische Bettwärmer Wärmesteine aus Keramik und aus Serpentin Zum Aufwärmen des Bettes wurde schon immer vorallem
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. Art Ab 15. Februar. März April Mai Juni Juli.
 Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
DIE SCHNEEROSE. Helleborus niger
 DIE SCHNEEROSE Die Gattung Helleborus, zu deutsch Schnee- oder Christrose, mancherorts auch Lenzrose genannt, gehört mit 15 bis 25 Arten zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae), hat also nichts mit Rosen
DIE SCHNEEROSE Die Gattung Helleborus, zu deutsch Schnee- oder Christrose, mancherorts auch Lenzrose genannt, gehört mit 15 bis 25 Arten zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae), hat also nichts mit Rosen
Meisterwurz. Imperatoriae Radix. Radix Imperatoriae
 ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
Massivholzplatten 1-schicht A
 Massivholzplatten 1-schicht A EN 13017-1 Erscheinungsklassen von einlagigen Massivholzplatten (Nadelholz) Bei der Beschreibung der Platte ist nur die Klasse der besseren Seite anzugeben Merkmale 0 A B
Massivholzplatten 1-schicht A EN 13017-1 Erscheinungsklassen von einlagigen Massivholzplatten (Nadelholz) Bei der Beschreibung der Platte ist nur die Klasse der besseren Seite anzugeben Merkmale 0 A B
Prüfungsordnung. für die Prüfung zum. Pilzsachverständigen BUND (PSV BUND )
 Prüfungsordnung für die Prüfung zum Pilzsachverständigen BUND (PSV BUND ) Stand: 06.04.2016 Inhalt Präambel...... 4 Prüfung zum PSV BUND... 5 1. Prüfungskommission... 5 2. Zulassung zur Prüfung... 5 3.
Prüfungsordnung für die Prüfung zum Pilzsachverständigen BUND (PSV BUND ) Stand: 06.04.2016 Inhalt Präambel...... 4 Prüfung zum PSV BUND... 5 1. Prüfungskommission... 5 2. Zulassung zur Prüfung... 5 3.
Ein Such- und Merkspiel, für 2-4 Spieler Von 5-8 Jähren Ravensburger Spiele Nr Autor! Bertram Kaes Illustratorin: Waltraut Schmidt Inhalt: 7
 Ein Such- und Merkspiel, für 2-4 Spieler Von 5-8 Jähren Ravensburger Spiele Nr. 240760 Autor! Bertram Kaes Illustratorin: Waltraut Schmidt Inhalt: 7 farbige Holzsteine 35 Bildkärtchen zu 7 bekannten Baumarten
Ein Such- und Merkspiel, für 2-4 Spieler Von 5-8 Jähren Ravensburger Spiele Nr. 240760 Autor! Bertram Kaes Illustratorin: Waltraut Schmidt Inhalt: 7 farbige Holzsteine 35 Bildkärtchen zu 7 bekannten Baumarten
Written by André Annen. Feuer-Experiment
 Feuer-Experiment 1 Vorbereitung In diesem Experiment geht es darum auf zwei verschiedenen Flächen, einer mit Vieh behandelten Fläche A und einer unbehandelten Fläche B, Unterschiede in Bezug auf die Reaktion
Feuer-Experiment 1 Vorbereitung In diesem Experiment geht es darum auf zwei verschiedenen Flächen, einer mit Vieh behandelten Fläche A und einer unbehandelten Fläche B, Unterschiede in Bezug auf die Reaktion
Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1):
![Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1):](/thumbs/55/37824085.jpg) Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): (a) dem Halo [1], der die Galaxis [1] wie eine Hülle umgibt; er besteht vorwiegend aus alten Sternen,
Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): (a) dem Halo [1], der die Galaxis [1] wie eine Hülle umgibt; er besteht vorwiegend aus alten Sternen,
Bronzezeitliche Beilformen und deren Datierung in Mitteleuropa!
 Bronzezeitliche Beilformen und deren Datierung in Mitteleuropa! Spricht man von der Bronzezeit, so ist eine gewisse Epoche bzw. gewisser Zeitraum gemeint, welcher sich in Mitteleuropa zwischen der Kupferzeit
Bronzezeitliche Beilformen und deren Datierung in Mitteleuropa! Spricht man von der Bronzezeit, so ist eine gewisse Epoche bzw. gewisser Zeitraum gemeint, welcher sich in Mitteleuropa zwischen der Kupferzeit
Der Versuch im Bild. März 2008
 Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Kräutergarten Lehrerinformation
 02/ Garten Lehrerinformation 1/9 Arbeitsauftrag Die SuS pflanzen ihren eigenen an. Sie beobachten das Wachstum der Pflanzen und sind für die Pflege zuständig. Ziel Material Sozialform Es gibt verschiedene
02/ Garten Lehrerinformation 1/9 Arbeitsauftrag Die SuS pflanzen ihren eigenen an. Sie beobachten das Wachstum der Pflanzen und sind für die Pflege zuständig. Ziel Material Sozialform Es gibt verschiedene
Rasenkranheiten und Plagen
 Rasenkranheiten und Plagen Der Rasen kann, je nach Wetter, von verschiedenen Krankheiten und Plagen befallen werden. Wenn die Rasenkrankheiten oder -plagen rechtzeitig erkannt und die richtige Diagnose
Rasenkranheiten und Plagen Der Rasen kann, je nach Wetter, von verschiedenen Krankheiten und Plagen befallen werden. Wenn die Rasenkrankheiten oder -plagen rechtzeitig erkannt und die richtige Diagnose
Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20
 Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20 (1) Jedes der 24 Teilquadrate grenzt an genau eine der acht Ecken. Da nach unserer Vorschrift die drei Teilquadrate an jeder Ecke unterschiedlich gefärbt sein
Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20 (1) Jedes der 24 Teilquadrate grenzt an genau eine der acht Ecken. Da nach unserer Vorschrift die drei Teilquadrate an jeder Ecke unterschiedlich gefärbt sein
GOLDENE KAFFEEBOHNE 2014
 GOLDENE KAFFEEBOHNE 2014 Bewertungsleitfaden FALSTAFF UND JACOBS PRÄMIEREN DEN BESTEN KAFFEE ÖSTERREICHS BEWERTUNGSKRITERIEN Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, auf die wesentlichen Details zu achten.
GOLDENE KAFFEEBOHNE 2014 Bewertungsleitfaden FALSTAFF UND JACOBS PRÄMIEREN DEN BESTEN KAFFEE ÖSTERREICHS BEWERTUNGSKRITERIEN Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, auf die wesentlichen Details zu achten.
Gemeindehaus Meiersmaadstrasse Sigriswil 3657 Schwanden. Praxishilfe Neophytenbekämpfung
 Gemeinde Sigriswil Forstbetrieb Sigriswil Gemeindehaus Meiersmaadstrasse 24 3655 Sigriswil 3657 Schwanden Praxishilfe Neophytenbekämpfung Andreas Schweizer Försterpraktikant BZW-Lyss verfasst am 8.8.2013
Gemeinde Sigriswil Forstbetrieb Sigriswil Gemeindehaus Meiersmaadstrasse 24 3655 Sigriswil 3657 Schwanden Praxishilfe Neophytenbekämpfung Andreas Schweizer Försterpraktikant BZW-Lyss verfasst am 8.8.2013
Unterscheidung von Bodentypen Bodenprofil. Grundversuch 45 min S
 Bodentypen bestimmen Kurzinformation Um was geht es? Durch das Zusammenwirken von Niederschlag, Grundwasser und Temperatur und Ausgangsgestein sind Böden mit übereinstimmenden oder ähnlichen Merkmalen
Bodentypen bestimmen Kurzinformation Um was geht es? Durch das Zusammenwirken von Niederschlag, Grundwasser und Temperatur und Ausgangsgestein sind Böden mit übereinstimmenden oder ähnlichen Merkmalen
FCI - Standard Nr. 301 / 22. 01. 1999 / D. AMERIKANISCHER WASSERSPANIEL (American Water Spaniel)
 FCI - Standard Nr. 301 / 22. 01. 1999 / D AMERIKANISCHER WASSERSPANIEL (American Water Spaniel) ÜBERSETZUNG : Frau Roswitha Steiner-Häfner und Harry G.A.Hinckeldeyn. URSPRUNG : U.S.A. 2 DATUM DER PUBLIKATION
FCI - Standard Nr. 301 / 22. 01. 1999 / D AMERIKANISCHER WASSERSPANIEL (American Water Spaniel) ÜBERSETZUNG : Frau Roswitha Steiner-Häfner und Harry G.A.Hinckeldeyn. URSPRUNG : U.S.A. 2 DATUM DER PUBLIKATION
Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand
 Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand Aus der Vielzahl an neuen Sorten für den Anbau von Sommerhimbeeren stachen in den letzten Jahren Tulameen und Glen Ample als besonders anbauwürdig hervor und
Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand Aus der Vielzahl an neuen Sorten für den Anbau von Sommerhimbeeren stachen in den letzten Jahren Tulameen und Glen Ample als besonders anbauwürdig hervor und
PRAGER RATTLER (Ratier de Prague) Standard des Ursprungslandes (ČMKU)
 PRAGER RATTLER (Ratier de Prague) Standard des Ursprungslandes (ČMKU) URSPRUNG: Tschechische Republik DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDS: 12. 10. 1980, angepasst am 15. 11. 2008 VERWENDUNG:
PRAGER RATTLER (Ratier de Prague) Standard des Ursprungslandes (ČMKU) URSPRUNG: Tschechische Republik DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDS: 12. 10. 1980, angepasst am 15. 11. 2008 VERWENDUNG:
Station 1 Der Baum. Frucht Blüte Stamm. Wurzeln Blatt Ast
 Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Fragebogen für die Erfassung von Farb- und Fellmerkmalen bei Karabaghen
 Fragebogen für die Erfassung von Farb- und Fellmerkmalen bei Karabaghen Name des Pferdebesitzers: Datum der Erfassung: (Fellzustand: Sommerfell/ Winterfell/ Fohlenfell?) Name des Karabagh/ Arabo-Karabagh:
Fragebogen für die Erfassung von Farb- und Fellmerkmalen bei Karabaghen Name des Pferdebesitzers: Datum der Erfassung: (Fellzustand: Sommerfell/ Winterfell/ Fohlenfell?) Name des Karabagh/ Arabo-Karabagh:
DOWNLOAD. Sachtexte verstehen: Texte, Grafiken und Tabellen. Der Wetterbericht. Ulrike Neumann-Riedel. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Sachtexte verstehen: Texte, Grafiken und Tabellen Der Wetterbericht Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich
DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Sachtexte verstehen: Texte, Grafiken und Tabellen Der Wetterbericht Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich
Haften ohne Klebstoff der Geckofuß
 Bodensee-Naturmuseum Konstanz Botanischer Garten Universität Konstanz Haften ohne Klebstoff der Geckofuß Der Gecko (z.b. der Taggecko, Phelsuma) zählt zu den interessantesten und gleichzeitig spektakulärsten
Bodensee-Naturmuseum Konstanz Botanischer Garten Universität Konstanz Haften ohne Klebstoff der Geckofuß Der Gecko (z.b. der Taggecko, Phelsuma) zählt zu den interessantesten und gleichzeitig spektakulärsten
Gelb- und Rotschnäbelige. Spitzschwanzamadine
 Gelb- und Rotschnäbelige Poephila acuticauda acuticauda (Gould, 1840) Poephila acuticauda hecki (Heinroth, 1900) Verbreitung: Habitat: Unterarten: Mutationen: Die kommt in Nord-Australien in einem sehr
Gelb- und Rotschnäbelige Poephila acuticauda acuticauda (Gould, 1840) Poephila acuticauda hecki (Heinroth, 1900) Verbreitung: Habitat: Unterarten: Mutationen: Die kommt in Nord-Australien in einem sehr
Garten-Melde. Anbau. Vermehrung AS_Z_026. (Atriplex hortensis)
 Die Gartenmelde ist eine historische der Name Melde ableitet. Diese rote Melde stammt aus dem Wittgensteiner Land. Die jungen, feinen Blätter der Melde kann man frisch als Salat verwenden, die älteren
Die Gartenmelde ist eine historische der Name Melde ableitet. Diese rote Melde stammt aus dem Wittgensteiner Land. Die jungen, feinen Blätter der Melde kann man frisch als Salat verwenden, die älteren
Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius
 Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius Definition Das durch Abkratzen von Stämmen von Picea abies gewonnene vom Baum selbst abgesonderte Produkt. Sammelvorschrift Picea abies kann sehr unterschiedliche
Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius Definition Das durch Abkratzen von Stämmen von Picea abies gewonnene vom Baum selbst abgesonderte Produkt. Sammelvorschrift Picea abies kann sehr unterschiedliche
DOWNLOAD. Geografisches Grundwissen 7. Unterwegs in der Welt. Vegetation und Vegetationszonen. Friedhelm Heitmann
 DOWNLOAD Friedhelm Heitmann Geografisches Grundwissen 7 Vegetation und Vegetationszonen Friedhelm Heitmann Downloadauszug aus dem Originaltitel: Bergedorfer Unterrichtsideen Unterwegs in der Welt Materialien
DOWNLOAD Friedhelm Heitmann Geografisches Grundwissen 7 Vegetation und Vegetationszonen Friedhelm Heitmann Downloadauszug aus dem Originaltitel: Bergedorfer Unterrichtsideen Unterwegs in der Welt Materialien
in die Buchhorst Waldsaum dient als Weidefläche Eichen ließ man groß wachsen Schweinefutter; Bauholz Hainbuchen: Brennholz
 Von Kristina, Lisa, Roberta und Gesa!!! die Mönchsteiche M stammen aus der zeit der Zisterzienser MöncheM sie werden und wurden zur Fischzucht genutzt das Wasser erhalte sie vom Springberg (früher:
Von Kristina, Lisa, Roberta und Gesa!!! die Mönchsteiche M stammen aus der zeit der Zisterzienser MöncheM sie werden und wurden zur Fischzucht genutzt das Wasser erhalte sie vom Springberg (früher:
Sich selbst und andere besser verstehen
 R I T A D A N Y L I U K Sich selbst und andere besser verstehen Die fünf Elemente genannt die fünf Himmelszeichen 19 Wachsen und Gedeihen gebrauchen; wenig Metall-, wenig Feuer-, wenig Erd-Zeichen sind
R I T A D A N Y L I U K Sich selbst und andere besser verstehen Die fünf Elemente genannt die fünf Himmelszeichen 19 Wachsen und Gedeihen gebrauchen; wenig Metall-, wenig Feuer-, wenig Erd-Zeichen sind
Färbungsbeweise. 1 Aufgaben
 Schweizer Mathematik-Olympiade smo osm Färbungsbeweise Aktualisiert: 1. Dezember 2015 vers. 1.0.0 1 Aufgaben Einstieg 1.1 Kann man überlappungsfrei und ohne Löcher die Figuren auf den Bildern unten mit
Schweizer Mathematik-Olympiade smo osm Färbungsbeweise Aktualisiert: 1. Dezember 2015 vers. 1.0.0 1 Aufgaben Einstieg 1.1 Kann man überlappungsfrei und ohne Löcher die Figuren auf den Bildern unten mit
Bestimmungsschlüssel Picea
 1 Nadeln auf der nach oben gerichteten Seite glänzend, rein grün, stets ohne weiße Spaltöffnungsreihen, unterst. mit auffallend silberweißen Spaltöffnungsreihen, deutlich abgeflacht - Nadeln auf allen
1 Nadeln auf der nach oben gerichteten Seite glänzend, rein grün, stets ohne weiße Spaltöffnungsreihen, unterst. mit auffallend silberweißen Spaltöffnungsreihen, deutlich abgeflacht - Nadeln auf allen
Tomatenanbau JUNGES GEMÜSE. von klingelhöfer
 Tomatenanbau JUNGES GEMÜSE von klingelhöfer Veredelte Tomaten Veredeltes Gemüse Auf resistente, starkwüchsige und kälteverträglichere Unterlagen veredelte Tomatenjungpflanzen ist eine lohnende Investition:.
Tomatenanbau JUNGES GEMÜSE von klingelhöfer Veredelte Tomaten Veredeltes Gemüse Auf resistente, starkwüchsige und kälteverträglichere Unterlagen veredelte Tomatenjungpflanzen ist eine lohnende Investition:.
Einige Beobachtungen über die Aufarbeitung und Verwahrung des Brennholzes.
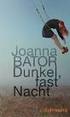 Einige Beobachtungen über die Aufarbeitung und Verwahrung des Brennholzes. Von O. Heikinheimo. Der Wassergehalt des Holzes übt öfters eine nachteilige Wirkung auf den Transport, die Aufbewahrung und die
Einige Beobachtungen über die Aufarbeitung und Verwahrung des Brennholzes. Von O. Heikinheimo. Der Wassergehalt des Holzes übt öfters eine nachteilige Wirkung auf den Transport, die Aufbewahrung und die
Raum- und Flächenmessung bei Körpern
 Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-
Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-
Borke. Bast (die Rinde) Kambium. Splintholz (Weichholz) Kernholz
 Um über die verschiedenen Holzarten nähere Informationen zu erhalten ist es von Nöten, erst einmal das Grundwissen über den Aufbau des Holzes zu haben. Ein Baumstamm setzt sich aus folgenden Schichten
Um über die verschiedenen Holzarten nähere Informationen zu erhalten ist es von Nöten, erst einmal das Grundwissen über den Aufbau des Holzes zu haben. Ein Baumstamm setzt sich aus folgenden Schichten
