Endbericht April 2002
|
|
|
- Stanislaus Becker
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Institut für Land-, Umweltund Energietechnik Universität für Bodenkultur Wien A-1190 Wien, Nussdorfer Lände Tel: thomas.amon@boku.ac.at Endbericht April 2002 KOFERMENTATION VON WIRTSCHAFTSDÜNGERN MIT ENERGIEGRÄSERN IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BIOGASANLAGEN OPTIMIERUNGEN DER GÄRGUTMISCHUNGEN UND DES BIOGASERTRAGES ao.univ.prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Amon (Projektleiter) Dr. Evelyn Hackl Dipl.-Ing. Dragomir Jeremic Dr. Barbara Amon
2 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung Potenziale der landwirtschaftlichen Biogaserzeugung Biogaserzeugung aus Sudangras (Zuckerhirse, Sorghum sudanense) Ziele Material und Methoden Wuchsgebiet der Sudangraspflanzen Klimatische Bedingungen Bodeneigenschaften Anbautechnik und Kulturführung Ernte und Probenaufbereitung Gewinnung des Impfmaterials und des Kosubstrates Bestimmung der Biogasproduktion unter Verwendung der Eudiometerapparatur Versuchsansatz Berechnung des spezifischen und des kumulativen Biogasertrags Versuchsprotokoll Gasnormvolumen Gasproduktion des Impfmaterials und korrigiertes Gasnormvolumen Spezifische Biogasproduktion Kumulative Biogasproduktion Laboranalysen Statistische Auswertung Ergebnisse und Diskussion Ertragsstruktur der Sudangraspflanzen Biogas- und Methanbildung aus frischen Sudangraspflanzen Biogas- und Methanbildung aus Sudangras-Silage und Kofermentationswirkungen mit Rinderfestmist Modellhafte Beschreibung der Methanbildung aus Sudangras Inhaltsstoffe der Gärgüter und deren Abbaubarkeit Vergleich der Methanerträge aus Sudangraspflanzen und Rinderfestmist in den untersuchten Varianten Energiebilanz der Methangärung Zusammenfassung Literatur... 38
3 1. Einleitung 1.1. Potenziale der landwirtschaftlichen Biogaserzeugung Die landwirtschaftliche Biogaserzeugung bietet zahlreiche Vorteile: regenerative Energie wird dezentral auf den landwirtschaftlichen Betrieben erzeugt, unkontrollierte Methanemissionen während der Lagerung der Wirtschaftsdünger werden vermieden, der Düngewert der Wirtschaftsdünger wird verbessert und außerlandwirtschaftliche organische Reststoffe können umweltfreundlich recycelt werden. Der regenerative Energieträger Biogas" entsteht, wenn organische Stoffe anaerob vergoren werden. In Österreich können jährlich 40 Mio. t Frischmasse für die Biogaserzeugung genutzt werden. Wirtschaftsdünger haben einen Anteil von etwa 60 % am Gesamtpotenzial, der Anteil der Energiepflanzen beträgt rund 38 %. Außerlandwirtschaftliche Reststoffe geben mengenmäßig einen Anteil von etwa 2 %. Durch die zunehmende Produktivitätssteigerung der Lebensmittelerzeugung werden zukünftig vermehrt landwirtschaftliche Nutzflächen aus der Nahrungsmittelerzeugung freigesetzt und können für den Anbau von Energiepflanzen genutzt werden. Bei der gemeinsamen Vergärung von Wirtschaftsdüngern und Energiepflanzen in Biogasanlagen könnten in Österreich jährlich etwa GWh elektrischer Strom und GWh Wärme erzeugt werden. Das entspricht ca. 10 % der inländischen Stromerzeugung bzw. dem optimierten Wärmeenergiebedarf von Einfamilienhäusern (Amon et al. 2001). Neue Berechnungen des Institutes für Land-, Umwelt- und Energietechnik (ILUET) zeigen, dass der landwirtschaftlichen Biogaserzeugung auch aus der Sicht des Klimaschutzes ein hoher Stellenwert zukommt. Durch die Biogaserzeugung aus Wirtschaftsdüngern und Energiepflanzen können klimarelevante Emissionen jährlich um 5,2 Mio. t CO 2 -Äquivalente vermindert werden. Ein Biogasanlagenbetreiber würde im Mittel 400 t CO 2 -Emissionen pro Jahr vermeiden, was der durchschnittlichen CO 2 -Emission von 40 EU-Bürgern entspricht. 41,9 % des Emissionsminderungspotenzials der Vermeidung von Methanemissionen während der Wirtschaftsdüngerlagerung 1. 41,4 % werden durch die Energieerzeugung aus Energiepflanzen eingespart und 15,7 % durch die Energieerzeugung aus Wirtschaftsdüngern (Amon et al. 2000, 2001). Durch die Erstellung und den Betrieb der Biogasanlagen können langfristig Arbeitsplätze neu entstehen. Neben den wichtigen ökologischen Wirkungen in den Bereichen des Umwelt- und Klimaschutzes ergeben sich durch die Förderung der Entwicklung ländlicher Räume wesentliche sozioökonomische Vorteile. Für die Betreiber landwirtschaftlicher Biogasanlagen ist außerdem die verbesserte Düngewirkung des vergorenen Düngers und die damit einhergehende Einsparung beim Düngerzukauf von Bedeutung. Während und nach der Ausbringung des Düngers ist eine wesentliche Minderung der Geruchsbelastung zu erwarten. 1 Während der Lagerung von unbehandeltem Wirtschaftsdünger werden beträchtliche Methanemissionen frei. Diese Emissionen können vermieden werden, wenn Wirtschaftsdünger anaerob vergoren und das entstehende Methan energetisch verwertet wird
4 1.2. Biogaserzeugung aus Sudangras (Zuckerhirse, Sorghum sudanense) Die Potenziale der Biogaserzeugung können am besten genutzt werden, wenn Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen im Verfahren der Cofermentation gemeinsam vergoren werden. Untersuchungen zum Methanbildungsvermögen verschiedener Energiepflanzen bei der Cofermentation mit Wirtschaftsdüngern wurden bislang punktuell durchgeführt. Das Spektrum geeigneter Energiepflanzenarten reicht von Wiesengras, Luzerne, Klee und Kleegras, Getreide wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Triticale bis hin zu Futterrüben, Mais und Zuckerhirse. Feuchte Ernterückstände wie Zucker- oder Futterrübenblätter eignen sich ebenfalls gut zur Vergärung mit Wirtschaftsdüngern. Zuckerhirse oder Sudangras" ist eine in Europa bisher nicht für die Biogaserzeugung genutzte Grasart der Gattung Sorghumhirse, die hohe bis sehr hohe Biomasseerträge von bis zu 25 t TS/ha ermöglicht. Praktische Erfahrungen zeigen, dass bis zu m 3 Biogas pro Hektar erzeugt werden können (Mairitsch und Graf 2000). Jedoch gibt es Anzeichen von Unsicherheiten in der Ertragslage (Köhling 2000). Es gibt bereits eine Untersuchung zum spezifischen Biogasertrag dieser Grasart (Pouech et al. 1998). Untersuchungen zum Biogasertrag bei Cofermentation von Sudangras und Wirtschaftsdüngern liegen nicht vor. Sudangras hat als typischer Vertreter von Energiegräsern anaerob leicht abbaubare Inhaltsstoffe wie Stärke, Zucker und Fette und eignet sich deshalb sehr gut zur anaeroben Vergärung in Biogasanlagen. Jedoch kann der Gärprozess auch vom Gehalt der Pflanzen an schwer abbaubaren Gerüstsubstanzen (hauptsächlich Lignin), die Bestandteile der Rohfaser sind, beeinflusst werden. Der Rohfasergehalt variiert in den verschiedenen Reifestadien der Pflanzen. Deshalb ist es wichtig, das Methanbildungsvermögen von Sudangras in unterschiedlichen Reifestadien zu bestimmen. Außerdem liegen bisher kaum Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Konservierungsverfahren und zu Sorteneinflüssen auf den Methanertrag von Sudangras vor. Die Biogasausbeute verschiedener Sorten von Sudangras bei der Cofermentation mit Wirtschaftsdüngern ist noch nicht optimiert worden. Angaben zu den wichtigen Inhaltsstoffen (Rohfaser, Zellulose, Hemizellulose, Rohfett, Rohprotein, NH 4 -Stickstoff), die den Verlauf der Methangärung prägen, sind nur vereinzelt zu finden (Pouech et al. 1998). Die Untersuchungen wurden unter verschiedenen methodischen Rahmenbedingungen durchgeführt, meist als Batchversuche im Labormaßstab, aber auch unter praktischen Bedingungen mit unterschiedlichen technischen Systemen. Sie sind deswegen nur eingeschränkt vergleichbar und nicht ohne weiteres auf praktische Verhältnisse übertragbar. Versuchsergebnisse sind nur vergleichbar, wenn der Methanertrag unter standardisierten Gärbedingungen ermittelt wird und im Normzustand (0 C, 1013 mbar) angegeben wird. Dazu werden zumeist keine Angaben gemacht. Oftmals ist auch nur der Biogasertrag angegeben. Für die Energiegewinnung entscheidend ist aber der Methangehalt im Biogas und somit der Methanertrag. Dieser kann je nach Gärbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.
5 2. Ziele Inhalt des Forschungsprojektes war es, das Methanbildungsvermögen der Energiepflanze Zuckerhirse (Sudangras) bei konstanten, vergleichbaren und exakt definierten Gärbedingungen zu untersuchen. Die gärtechnischen Eigenschaften von Sudangras wurden ermittelt, damit diese Pflanze in der Zukunft optimal als Energiepflanze eingesetzt werden kann. Dazu wurde auch untersucht, welchen Einfluss der Erntezeitpunkt sowie das Konservierungsverfahren und das Mischungsverhältnis mit Wirtschaftsdüngern auf die Stabilität der Methangärung und auf den Methanertrag haben. In der Biogasanlage kann sich die Zugabe leicht abbaubarer organischer Substanz unter Umständen auch negativ auf den Biogasertrag auswirken, nämlich dann, wenn der Stoffabbau zu intensiv ist und dadurch der ph-wert im Gärgut zu stark absinkt. Es wurde daher angestrebt, Gärgutmischungen zu finden, die einen optimalem Ablauf der Methangärung ermöglichen und einen maximalen spezifischen Methanertrag bei möglichst konstanter Biogasqualität gewährleisten. Für die Optimierung der Cofermentationen von Sudangras mit Wirtschaftsdüngern wurden folgende Aspekte betrachtet: 1. Spezifischer Methanertrag Der Methangehalt im Biogas kann zwischen 45 und 75 % schwanken. Neben dem Biogasertrag wurde der spezifische Methanertrag der Sudangraspflanzen unter Normalbedingungen ermittelt, weil dieser für den Energiegewinn und somit für die Wirtschaftlichkeit der Biogaserzeugung entscheidend ist. 2. Energetische Effizienz der Methanbildung Zur Ermittlung der energetischen Effizienz der Methanbildung wurden die Energiegehalte der verwendeten Gärgüter sowie des ausgegorenen Materials kalorimetrisch gemessen. Außerdem wurde bestimmt, welchen Energiegehalt das gebildete Methan aufweist. Auf diese Weise war es möglich, eine Energiebilanz des Methanbildungsprozesses zu erstellen. 3. Hydraulische Verweilzeit Zur erforderlichen hydraulischen Verweilzeit von Sudangras in Biogasanlagen liegt bislang wenig Information vor. Sie ist jedoch eine wichtige Größe für die Dimensionierung der Biogasanlage und beeinflusst maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der Biogaserzeugung. Die Beobachtung der Abbauprozesse im Laborversuch ermöglicht Rückschlüsse auf den zeitlichen Ablauf der Gärung im Biogasfermenter. 4. Reifestadium Die Zusammensetzung der Sudangraspflanzen ist vom Reifestadium der Pflanzen abhängig. In den verschiedenen Reifestadien variiert vor allem der Gehalt an schwer abbaubaren Gerüstsubstanzen (v.a. Lignin) in der Graspflanze. Indem Sudangraspflanzen aus drei verschiedenen Erntezeitpunkten eingesetzt wurden, konnte der Einfluss des
6 Reifestadiums auf das Methanertragspotential von Sudangras untersucht werden. Auf diese Weise können Empfehlungen zum optimalen Erntezeitpunkt für einen hohen Methanhektarertrag abgeleitet werden. 5. Mischungsverhältnis Empfehlungen zum Mischungsverhältnis von Wirtschaftsdüngern und Energiepflanzen sollten abgeleitet werden, um einen sicheren Betrieb der Biogasanlage zu ermöglichen.
7 3. Material und Methoden 3.1. Wuchsgebiet der Sudangraspflanzen Die für das vorliegende Projekt verwendeten Sudangraspflanzen wurden auf Feldern der Versuchswirtschaft der Universität für Bodenkultur in Großenzersdorf (NÖ) angebaut. Diese befinden sich im Marchfeld, ca. 5 km östlich von Wien. Die dort herrschenden Klimaund Bodenverhältnisse sind für das pannonische Produktionsgebiet repräsentativ (Storchschnabel 1974). Die Versuchparzellen für den Anbau der Zuckerhirsepflanzen befinden sich in der Nähe von Raasdorf. Die Langparzellen sind 3 m breit und 50 m lang und gewährleisten eine praxisübliche Feldbestellung mit der Drillsämaschine (Abb. 1 und 2) Die Versuchswirtschaft liegt im pannonischen Klimagebiet bzw. im Kleinproduktionsgebiet Marchfeld. Die Felder befinden sich in offener, windiger Lage in 156 m Seehöhe. Der Klimaraum ist durch heiße, trockene Sommer und kalte, schneearme Winter geprägt. Die mittlere Jahrestemperatur ( ) beträgt 9,8 C, die mittlere Niederschlagssumme 547 mm und die durchschnittliche relative Luftfeuchte 75 %. Im Sommer ist das Klima durch geringe Luftfeuchtigkeit und wenig Taubildung gekennzeichnet. Abb. 3 und 4 zeigen Klimadiagramme für den Versuchsstandort Großenzersdorf im langjährigen Mittel und für den Zeitraum der Anbauversuche.
8 Die Vegetationsperiode von Mai bis September 2001 lässt sich durch einen sehr niederschlagsreichen Juli (93 mm) und September (115 mm) charakterisieren, während der Mai mit nur 19 mm Niederschlag relativ trocken war. Die durchschnittliche Monatstemperatur im Mai betrug 17,8 C (vergleichbar mit dem Jahr 2000). Die Temperaturen in den Monaten Juni bis September waren niedriger als im Jahr zuvor. Die relativ gute Wasserversorgung in den Monaten Juli bis August hat die Biomasseproduktion positiv beeinflusst. Abb. 3: Klimadiagramm (langjähriger Durchschnitt ) für den Versuchsstandort Großenzersdorf (Skalierung nach Walter 1955). Abb. 4: 1955). Klimadiagramm (Jänner-September 2001) für den Versuchsstandort Großenzersdorf (Skalierung nach Walter Bodeneigenschaften Der Boden ist tiefgründig und mittelschwer und besteht aus schluffigem Lehm, wobei der Schluffgehalt im Unterboden stark zunimmt. Aufgrund des hohen Schluffanteils neigt der Boden sehr zur Verschlämmung. Es handelt sich um einen Tschernosem der Praterterrasse. Der A p Horizont reicht von 0 bis 25 cm und hat eine graubraune Farbe. Der Oberboden ist humos und stark lehmig. Der Humusgehalt in der 0 bis 25 cm starken Krume beträgt nach der Methode Walkey-Armstrong 1,2 % bis 3,8 % und schwankt im Unterboden zwischen 1,8 % und 2,2 %.
9 3.2. Anbautechnik und Kulturführung Auf den Versuchsparzellen wurde als Vorfrucht Triticale angebaut. Nach der Grundbodenbearbeitung im Herbst und der Sekundärbodenbearbeitung im Frühjahr wurden am 27. April 2001 die beiden Hirsesorten Susu und Piper in Drillsaat ausgesät (Saatstärke: 200 Körner/m 2, Reihenabstand: 24 cm). Am 3. Mai 2001 wurden 179 kg N/ha Harnstoff appliziert. Gegen zweikeimblättrige Unkräuter wurden am 30. Mai 2001 Herbizide (Banvel, Titus und Neowett) gespritzt Ernte und Probenaufbereitung An den drei Ernteterminen (Tab. 1) wurden repräsentative Pflanzen händisch mit der Sichel geerntet. Die Hektarerträge wurden ermittelt, indem Sudangraspflanzen auf einer Fläche von einem m 2 abgeerntet und quantifiziert wurden und diese Werte dann auf die Fläche von einem ha bezogen wurden. Die ermittelte Wuchshöhe der Pflanzen bezieht sich auf die durchschnittliche Höhe der Pflanzen im Bestand. Tab. 1: Erntezeitpunkte und Wuchstage der Sudangraspflanzen Erntezeitpunkt Wuchstage 2. August September September Die frisch geernteten Pflanzen wurden in einem Axialhäcksler zerkleinert. Um einen hohen Zerkleinerungsgrad zu erhalten, wurde das gehäckselte Material durch einen Radialhäcksler geführt. Für die Silierung wurde das gehäckselte Material gut durchgemischt und in einen Plastikkübel (5 Liter) gefüllt. Dabei wurde großer Wert auf eine gute Verdichtung gelegt. Die freie Oberfläche wurde mit Propionsäure behandelt und mit einer Plastikfolie luftdicht abgeschlossen. Die Kübelsilierung" wurde von beiden Sudangrassorten zu jedem Erntezeitpunkt (3 x) durchgeführt. Die frischen Sudangraspflanzen wie auch das silierte Pflanzenmaterial wurden bis zum Beginn der Versuche bei -18 C gelagert. Vor dem Einsetzen in die Eudiometerapparaturen wurden die Proben bei Zimmertemperatur aufgetaut und händisch mit einem Messer auf eine Partikelgröße von 2 bis 5 mm zerkleinert. Abb. 5 zeigt das frische und das silierte Probenmaterial vor dem Einsetzen in die Eudiometerapparaturen.
10
11 3.4. Gewinnung des Impfmaterials und des Kosubstrates Das Impfmaterial für die Fermentationsversuche wurde aus der Biogasanlage des Betriebes Annahof in Laab im Walde gewonnen. Dabei wurde bereits weitgehend ausgegorenes Material aus dem Überlauf des Rohrfermenters verwendet. Dieses wurde bei konstanter Temperatur ins Labor transportiert und innerhalb von 48 Stunden für die Versuche eingesetzt. Tab. 2 zeigt die Betriebsparameter der Biogasanlage Annahof zum Zeitpunkt der Probennahme. Als Kosubstrat wurde frischer Rinderfestmist eingesetzt, der ebenfalls vom Betrieb Annahof in Laab im Walde stammte. Tab. 2: Betriebsparameter der Biogasanlage Annahof, von der das Impfmaterial für die Versuche gewonnen wurde. Parameter Fermentertyp Rohrfermenter Größe des Gärbehälters 100 m 3 Verwendete Gärgüter Festmist von 53 GV Rindern, 23 GVE Schweinen Hydraulische Verweilzeit der Gärgüter Tage Temperatur im Gärbehälter 34 C Temperatur im Nachgärbehälter 25 C Raumbelastung 2,40kgoTSm -3 d -1
12 3.5. Bestimmung der Biogasproduktion unter Verwendung der Eudiometerapparatur Die spezifische Methanproduktion von Sudangras wurde in Eudiometer-Messzellen unter kontrollierten Gärbedingungen gemessen. Die Untersuchung erfolgte nach DIN-Norm Die Eudiometer Messapparatur umfasst sechs Messzellen (Abb. 7). Jede Messzelle besteht aus einer Glassäule, die mit Sperrflüssigkeit (NaCl-Lösung, angesäuert mit Zitronensäure) gefüllt ist. Die Säule ist am unteren Ende mit einem Ausgleichsgefäß verbunden und steht am oberen Ende mit dem Reaktionsgefäß in Verbindung, in dem sich das Probenmaterial und das Impfmaterial befinden. Die Reaktionsgefäße werden in einem Wasserbad temperiert (Gärtemperatur 34 C). Mittels eines Magnetrührers wird das Gärgut in Intervallen von 10 Minuten jeweils 10 Sekunden lang durchmischt. Das in den Reaktionsgefäßen gebildete Biogas verdrängt die Sperrflüssigkeit aus der Säule in die Ausweichgefäße. Die spezifische Biogasproduktion wird an der Säulenskalierung abgelesen und als Gasnormvolumen angegeben. Als Impfmaterial wurde aktives Gärgut aus der landwirtschaftlichen Biogasanlage am Annahof in Laab im Walde eingesetzt. Um zu verhindern, dass dieses mit Luftsauerstoff in Berührung kommt, wurden die leeren Gärgefäße mit Argon gefüllt und dann Impfmaterial und Probenmaterial in die anaeroben Gärgefäße eingewogen. Das Impfmaterial wurde zuvor homogenisiert, indem es durch eine gelochte (3 mm Lochweite) Siebplatte geleitet wurde. Die Proben wurden im Parallelansatz untersucht. Zeitgleich wurde (ebenfalls im Parallelansatz) die Biogasproduktion aus reinem Impfmaterial gemessen. Zu Beginn und am Ende jedes Versuches wurden Trockengewicht und Glühverlust von Probe und Impfmaterial erfasst, außerdem wurden Inhaltsstoffanalysen der Gärstoffe durchgeführt (siehe 3.8. Laboranalysen). Im Verlauf der Gärung wurde der ph-wert im Gärmedium kontrolliert und gegebenenfalls durch Zugabe von 2 N NaOH reguliert. Im dreitägigen Abstand wurden Proben des gebildeten Biogases zur gaschromatographischen Analyse entnommen. Ausgleichsgefäß Gassammelrohr Septum für Gasentnahme Wasserstand-Kontrolle Temperaturkontrolle Gärbehälter Magnetrührer Wasserbad Abb. 6: Eudiometer-Anlage zur Ermittlung des Biogasbildungspotenzials von Sudangras.
13 3.6. Versuchsansatz Der Biogasertrag von Sudangras wurde in den Reifestadien vor dem Rispenschieben" (1. Ernte), nach dem Rispenschieben" (2. Ernte) und zur Vollreife" der Pflanzen (3. Ernte) bestimmt. Die Untersuchungen wurden mit frischen Pflanzen der Sorten Susu und Piper sowie mit zuvor silierten Pflanzen der Sorte Piper durchgeführt. Die Kofermentationswirkung von Sudangras mit Wirtschaftsdüngern wurde in Gemischen aus Sudangraspflanzensilage und Rinderfestmist geprüft. Als Referenz wurde das Methanbildungsvermögen des Impfmaterials ermittelt. Aus der Fragestellung ergaben sich 12 Testvarianten, die im Parallelansatz untersucht wurden. Mit Hilfe von 3 Eudiometeranlagen konnten jeweils 6 Varianten gleichzeitig eingesetzt werden. In einem ersten Versuchsdurchgang wurden frische Pflanzen der Sorten Susu und Piper in jeweils drei Reifestadien (1. Ernte, 2. Ernte, 3. Ernte) untersucht (Tab. 3). Der zweite Versuchsdurchgang behandelte die Frage der Kofermentation von Sudangras mit Rinderfestmist. Hier wurden silierte Sudangraspflanzen der Sorte Piper in den Reifestadien vor dem Rispenschieben" und zur Vollreife" verwendet, wobei Pflanzenmaterial und Rinderfestmist in den Mischungsverhältnissen 30, 60 und 100 % ots-anteil eingesetzt wurden (Tab. 4). Tab. 3: Variante Versuchsansatz des ersten Versuchsdurchganges: Einwaagen und ots-gehalte der frischen Pflanzen und des Impfmaterial*. FM = Frischmasse, ots - organische Trockensubstanz (% TS). Sudangras Impfmaterial % ots in Mischung (g) % ots (g) % ots (mfm) Susu 1.Ernte frisch Susu 2.Ernte frisch Susu 3.Ernte frisch ,14 95,02 94, ,80 70,80 70,80 8,97 11,61 9,83 Piper 1. Ernte frisch Piper 2.Ernte frisch Piper 3.Ernte frisch ,70 95,13 94, ,80 70,80 70,80 9,69 10,38 10,58 Tab. 4: Variante Piper 1. Ernte Piper l. Ernte Piper 1. Ernte Versuchsansatz des zweiten Versuchsdurchganges Einwaagen und ots-gehalte der silierten Pflanzen, von Festmist und Impfmaterial. FM = Frischmasse. ots - organische Trockensubstanz (% TS). Silage Silage Silage ots-anteil Pflanze: Fest-. mist (%) 30:70 60:40 100:0 Sudangras Festmist Impfmaterial % ots in Mischung (g) % ots (g) %ots (g) %ots (in FM) ,33 94,33 94, ,23 86,23 86, ,18 78,18 78,18 14,97 12,01 8,07 Piper 3. Ernte Piper 3.Ernte Piper 3. Ernte Silage Silage Silage 30:70 60:40 100: ,39 95,39 95, ,23 86,23 86, ,18 78,18 78,18 14,72 12,11 8,49
14 3.7. Berechnung des spezifischen und des kumulativen Biogasertrags Versuchsprotokoll Um die Gasbildung in den 6 Eudiometerzellen (Reaktionsgefäße mit Probe + Impfmaterial und Impfmaterial allein) aufzuzeichnen, wurde für jedes Eudiometergerät ein Protokoll angelegt. Darin wurden auch die Messgrößen Temperatur und Luftdruck vermerkt. Ein Beispiel für ein Versuchsprotokoll ist in Abb. 7. dargestellt. Bei der Berechnung der Gaserträge wurden die Temperaturverhältnisse in der Umgebungsluft sowie im wärmegedämmten Bereich über dem Wasserbad berücksichtigt. PROTOKOLL EUDIOMETER Versuch Nr. Datum Uhrzeit Luftdruck Temperatur C Säule 1 Säule 2 Säule 3 Säule 4 Säule 5 Säule 6 mbar Luft Wasser Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende Abb. 7: Protokoll zur Durchführung der Eudiometerversuche Gasnormvolumen Zuerst wurde für jede Eudiometerzelle das Normvolumen des in den einzelnen Zeitabschnitten entwickelten Biogases berechnet: V 0 = V neu ( P P ) 273 V ( P P ) neu 1013 T W neu alt alt 1013 W T alt 273 V 0 Gasnormvolumen in ml V neu Volumen des Biogases bei der aktuellen Ablesung in ml V alt Volumen des Biogases bei der letzten Ablesung in ml P neu Luftdruck zur Zeit der aktuellen Ablesung in mbar P alt Luftdruck zur Zeit der letzten Ablesung in mbar P w Dampfdruck des Wassers in Abhängigkeit von der Temperatur des umgebenden Raumes, in mbar 273 Normtemperatur = 273 K Normdruck = 1013 mbar
15 T neu Temperatur des Biogases bzw. des umgebenden Raumes zur Zeit der aktuellen Ablesung in K T alt Temperatur des Biogases bzw. des umgebenden Raumes zur Zeit der letzten Ablesung in K.
16 Gasproduktion des Impfmaterials und korrigiertes Gasnormvolumen Um die Gasproduktion der Probe zu erhalten, muss die Gasproduktion des Impfmaterials vom Gasnormvolumen abgezogen werden. V = V m / m X 1 M I V x Anteil des Gasnormvolumens, das aus dem Impfmaterial gebildet wurde, in ml V I Gasnormvolumen, das in der Impfmaterial-Zelle gebildet wurde, in ml m M Masse des in der Mischung benutzten Impfmaterials in g m I Masse des in der Impfmaterial-Zelle benutzten Impfmaterials in g Durch Abzug der Gasproduktion aus dem Impfmaterial erhält man das korrigierte Gasnormvolumen: V korr = V 0 V X V korr korregiertes Gasnormvolumen in ml V 0 Gasnormvolumen in ml V X Anteil des Gasnormvolumens, das aus dem Impfmaterial gebildet wurde, in ml Spezifische Biogasproduktion Die in einem bestimmten Zeitabschnitt erfolgte Biogasproduktion wird auf die organische Trockensubstanz (ots) der Probe bezogen und in l/kg ots angegeben. V S = 4 V korr 10 m TS ots V S spezifische Biogasproduktion in 1/ kg GV V korr korrigiertes Gasnormvolumen in ml m Masse der eingewogenen Probe in g TS Trockensubstanzfaktor der Probe in % ots organische Trockensubstanz der Probe in % TS
17 Kumulative Biogasproduktion Die für die einzelnen Zeitabschnitte berechnete spezifische Biogasproduktion der Proben wird kumulativ addiert. Zur graphischen Darstellung werden diese Werte gegen die Versuchsdauer aufgetragen Laboranalysen Vor und nach der Vergärung der Substrate in der Eudiometereinheit wurden Inhaltsstoffanalysen durchgeführt. Außerdem wurden das Trockengewicht und der Gehalt der Gärgüter an organischer Trockensubstanz (ots) ermittelt. Die Bestimmung des Trockengewichts erfolgte durch Differenzwägung nach Trocknung der Gärgüter bei 105 C bis zur Gewichtskonstanz. Der Gehalt der Proben an organischer Trockensubstanz (ots) wurde durch Veraschung im Muffelofen bei 550 C ermittelt. Die Gehalte von organischem Stickstoff (N org ) und Kohlenstoff (C org ) in den Gärgütern wurden mit Hilfe eines Elementaranalysators bestimmt. Ammonium-Stickstoff wurde zu Versuchsende mittels Ammonium-Elektrode (WTW NH 500/2) gemessen. Mit Hilfe der Weender-Rohnährstoffanalyse wurden die Gehalte der Proben an den Inhaltsstoffgruppen Rohprotein, Rohfett und Rohfaser quantifiziert. Die Gehalte an Rohfaser wurden weiters in die Menge der gesamten Zellwandbestandteile (neutral detergent fibre, NDF) und in den Zellulose-Lignin-SiO 2 -Komplex (acid detergent fibre, ADF) aufgetrennt. Aus der ADF wurde der Gehalt an Rohlignin (acid detergent lignin, ADL) bestimmt (Van Soest et al. 1991). Zellulose wurde aus der Differenz von ADF und ADL berechnet, Hemizellulose aus der Differenz von NDF und ADF. Zur Kontrolle des Gärprozesses wurde der ph-wert mittels Glaselektrode gemessen. Diese Messungen erfolgten in der ersten Phase des Versuches in periodischen Abständen sowie zu Versuchsbeginn und Versuchsende. Wurde ein Abfallen des ph-wertes unter einen kritischen Wert beobachtet, so wurden zwischen 2 und 10 ml 2N NaOH zugegeben, um auf diese Weise den ph-wert der Gärguter zu regulieren. In Intervallen von 3 bis 5 Tagen wurden aus dem Gassammelrohr der Eudiometer jeweils 15 ml Gasprobe für die Analyse entnommen, in gasdichte, evakuierte Serumfläschchen gefüllt und bis zur Analyse in Wasser bei 4 C gelagert. Der Methangehalt in den Gasproben wurde an einem Gaschromatographen (Shimadzu 14B, Säule: HP-Plot molecular sieve 5A, 0,32 mm i.d., 12 µm Filmdicke) mittels Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) im isothermen Modus gemessen, Es wurde ein Probenvolumen von 50 µl injiziert. Die Ofen-, Detektor- und Injektortemperaturen betrugen 40, 150 und 105 C, als Trägergas diente Stickstoff. Die Kalibrierung erfolgte mit reinem Methangas. Der Energiegehalt der Gärgüter sowie des ausgegorenen Materials wurde mit Hilfe eines Bombenkalorimeters bestimmt und in J g -1 TG angegeben. Die im Methanertrag enthaltene Energiemenge wurde berechnet, indem der Energiegehalt von Methan bei Normalbedingungen mit kj/ kg Methan angenommen wurde.
18 3.9. Statistische Auswertung Die statistische Auswertung der Ergebnisse erfolgte mit Hilfe des Statistik-Programms SPSS Version 9. Unterschiede in den Biogas- und Methanerträgen sowie in Inhaltsstoffen zwischen den untersuchten Varianten (frisch/siliert, Erntezeitpunkte, Sorten) wurden mittels des nichtparametrischen Kruskall-Wallis-Tests und des Mann-Whitney-U-Tests auf Signifikanz geprüft (p<0,05). Der zeitliche Verlauf der Biogasproduktion wurde mittels einer Kurvenanpassung (quadratisches Modell) beschrieben. Diese Verläufe wurden ebenfalls mit Hilfe des Kruskall-Wallis-Tests verglichen. Zusammenhänge zwischen den Inhaltsstoffen der Gärgüter und dem Methanbildungspotenzial wurden mit Hilfe des Spearman-Korrelationskoeffizienten beschrieben.
19 4. Ergebnisse und Diskussion Als Ergebnisse dieser Untersuchung werden zunächst die Erntedaten der verwendeten Sudangraspflanzen dargestellt und dann die Gasbildungs- und Methanbildungsraten aus den Versuchsvarianten präsentiert. Die Ergebnisse der Inhaltsstoffanalysen und die Ermittlung deren Abbaubarkeit bilden einen weiteren Teil dieses Kapitels. Außerdem wird ein statistisches Modell der Kurvenverläufe der kumulativen Methanbildung vorgestellt. Anschließend werden die Biogas- und Methandaten aller untersuchter Varianten verglichen und mit den Ergebnissen aus den Inhaltsstoffanalysen in Verbindung gesetzt. Zuletzt wird eine Energiebilanz der Methangärung erstellt Ertragsstruktur der Sudangraspflanzen Abb. 8: Durchschnittliche Pflanzenhöhe der zwei Sudangrassorten Piper und Susu an den drei Ernteterminen Abb. 9: Frischmasseerträge der zwei Sudangrassorten Piper und Susu an den drei Ernteterminen
20 In den Abbildungen 8 und 9 sind die Pflanzenhöhe und Frischmasseerträge pro Hektar der Sudangrassorten Susu und Piper dargestellt. Die Sorte Susu zeigte mit 2,1 bis 2,2 m eine größere Wuchshöhe und mit bis kg/ha zu allen Erntezeitpunkten signifikant höhere Hektarerträge (Man-Whitney-U-Test, p<0,05) als die Sorte Piper mit 1,8 bis 1,9 m Höhe und bis kg Ertrag/ ha. Diese Erträge entsprechen Trockensubstanz-Erträgen von bis kg TS/ ha und Erträgen von bis kg organischer Trockensubstanz (ots)/ ha. Während sich die Pflanzenhöhe der einzelnen Sudangrassorten zu den verschiedenen Erntezeitpunkten kaum unterschied, gab es deutliche Unterschiede in der Ertragslage. Die Erträge der Sorte Piper waren zum ersten Erntetermin am 21. August deutlich höher als zu den beiden späteren Terminen. Die Erträge der Sorte Susu waren zu den früheren Ernteterminen am 21. August und 3. September höher als zum dritten Erntezeitpunkt am 19. September.
21 4.2. Biogas- und Methanbildung aus frischen Sudangraspflanzen Der Verlauf der Biogasbildung aus frischen Sudangraspflanzen der Sorten Susu und Piper ist in Abb. dargestellt. Der Gärprozess wurde über einen Zeitraum von 68 bzw. 67 (Susu 3. Ernte und Piper 3. Ernte) Tagen beobachtet. Die Biogaserträge für diesen Zeitraum betrugen 331, 385 und 342 l Biogas kg -1 ots für die Sudangrassorte Susu im ersten, zweiten und dritten Reifestadium sowie 383, 379 und Biogas kg -1 ots für die Sudangrassorte Piper in den jeweiligen Reifestadien. Aus der Abflachung der Kurve (Abb. 10) kann man schließen, dass zum betrachteten Zeitpunkt der Großteil der abbaubaren organischen Substanz bereits umgesetzt und der Gärprozess nahezu abgeschlossen war. Als bestimmender Einflussfaktor für den Gärprozess erwies sich der ph-wert des Gärsubstrates. Innerhalb der ersten zwei Tage nach dem Einsetzen des Gärsubstrates wurde ein Absinken des ph-wertes um bis zu 1,1 Einheiten festgestellt. Der ph-wert wurde nach dem Einsetzen des Gärsubstrates noch 19 Tage lang kontrolliert. Hierbei wurde im Abstand von einigen Tagen der ph-wert der Substrate gemessen und, falls der ph-wert unter einen kritischen Wert von 7,0 oder 6,5 abgefallen war, durch Zugabe von 1 bzw. 2 ml 2 N NaOH reguliert. Im weiteren Verlauf der Gärung war eine Stabilisierung des ph-wertes erreieht. Da die methanogenen Bakterien an einen engen ph-wert-bereich adaptiert sind, könnte das Absinken des ph-wertes innerhalb der ersten zwei Tage des Versuches bereits eine Hemmung der Methanogenese bewirkt haben. Diese dürfte im weiteren Versuchsverlauf wieder ausgeglichen worden sein, könnte jedoch eine zeitliche Verzögerung des Gärprozesses bedeuten. Bei allen untersuchten Varianten konnten nach der Höhe der spezifischen Biogasproduktion vier zeitliche Abschnitte unterschieden werden (Tab. 5). Innerhalb der ersten 14 Tage wurden die höchsten Raten der Biogasproduktion von 0,46 bis 0,74 l Biogas kg -1 ots h -1 gemessen. Die Biogasproduktion war ab dem 15. bis zum 28. Tag mit 0,27 bis 0,43 1 Biogas kg -1 ots h -1 geringer und betrug von Tag 29 bis 40 nur mehr zwischen 0,09 und Biogas kg -1 ots h -1. Ab dem 41. Tag wurden zwischen 0,04 und 0,08 I Biogas kg -1 ots h -1 gebildet. Die durchschnittlichen Methangehalte im Biogas betrugen zwischen 62,2 und 64,3 % (siehe auch Tab. 10). Der Verlauf der Methanbildung folgt dem Verlauf der Biogasbildung aus frischen Sudangraspflanzen und ist in Abb. 11 dargestellt. Die beiden Sudangrassorten Susu und Piper unterschieden sich weder bezüglich des Biogas- noch bezüglich des Methanbildungspotenzials signifikant. Auch zwischen den Pflanzen aus drei verschiedenen Erntezeitpunkten gab es keine signifikanten Unterschiede im Biogas- und Methanbildungspotenzial.
22 Tab. 5: Mittlere spezifische Biogasproduktton (1 Biogas kg -1 ots h -1 ) ±Stabw. der frischen Sudangraspflanzen in den verschiedenen Zeitabschnitten des Versuches. Tage Susu 1.E. Susu 2.E. Susu 3.E. Piper 1.E. Piper 2.E. Piper 3.E ±0.25 0,48±0.39 0,50±0,30 0,74±0.32 0,48 ± 0,23 0,54 ±0, ,30±0,09 0,41 ±0,11 0,35±0,10 0,27±0,15 0,43±0,13 0,35±0, ,15±0,05 0,20±0,10 0,11±0,03 0,09±0,02 0,14±0,04 0,10±0, ,07±0,02 0,08±0, ±0,02 0,06±0, ±0,03 0,04±0,01 Abb. 10: Kumulative Biogasbildung aus frischen Sudangraspflanzen der Sorten Susu (A) und Piper (B) in drei verschiedenen Reifestadien (1., 2., 3.Ernte) und Verlauf des ph-wertes während der Versuchsdauer.
23 Abb. 11: Kumulative Methanbildung aus frischen Sudangraspflanzen der Sorten Susu (A) und Piper (B) in drei verschiedenen Reifestadien (1., 2., 3.Ernte).
24 4.3. Biogas- und Methanbildung aus Sudangras-Silage und Kofermentationswirkungen mit Rinderfestmist Das Gärverhalten von Sudangras-Silage bei der Kofermentation wurde untersucht, indem Sudangras-Silage mit Rinderfestmist in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen eingesetzt wurde. Für diese Versuche wurde Silage von Sudangras der Sorte Piper aus dem ersten und dem dritten Erntezeitpunkt verwendet. Die Mischungsverhältnisse betrugen 30, 60 und 100 % ots-anteil Sudangras zu 70, 40 und 0 % Rinderfestmist. Die erhaltenen Verläufe der Biogasbildung sind in Abb. 12 dargestellt. Die Biogasbildungspotenziale betrugen für die Sorte Piper aus dem ersten Erntezeitpunkt und für die Mischungen 30, 60 und 100 % jeweils 291, 340 und Biogas kg -1 ots. Für die Sorte Piper aus dem dritten Erntezeitpunkt wurden in den Mischungen 30, 60 und 100 % Biogaspotenziale von 201, 346 und Biogas kg -1 ots gemessen. Somit waren die Biogasbildungspotenziale bei Verwendung von 100 % Silage am höchsten und in den Mischungen von 30 % ots geringer als in den jeweils anderen Varianten. Diese Unterschiede waren signifikant bei p<0,05. Die Biogasproduktion wurde über einen Zeitraum von 55 bzw. 56 Tagen beobachtet. Wie schon bei der Verwendung von frischen Sudangraspflanzen zeigte sich auch bei diesen Versuchen, dass der ph-wert des Gärgutes einen entscheidenden Faktor für den Verlauf der Biogasgärung darstellte. Wieder wurde ein kritisches Absinken des ph-wertes schon innerhalb der ersten zwei bis drei Tage festgestellt, das durch Zugabe von 2 N NaOH ausgeglichen werden konnte. Auf diese Weise konnte ein starkes Abfallen des ph-wertes verhindert werden, und die ph-werte lagen stets in Bereichen über ph 6,5 (siehe Abb. 12 ). Die Werte der spezifischen Biogasproduktion lagen bei der Vergärung von Sudangras- Silage in der gleichen Größenordnung wie bei der Verwendung von frischen Pflanzen. Auch hier konnten nach der Höhe der Bildungsraten vier zeitliche Abschnitte der Biogasbildung unterschieden werden (Tab. 6). Vermutlich weil hier die ph-absenkung, verbunden mit einer hemmenden Wirkung auf den Gärprozess, weniger stark ausgeprägt war als bei der Vergärung von frischem Sudangras, waren die Biogasbildungsraten im zweiten Abschnitt etwas höher. Innerhalb der ersten 14 Tage des Gärprozesses wurden durchschnittlich 0,29 bis 0,61 l Biogas kg -1 ots h -1 gebildet. Im Anschluss daran betrug die spezifische Biogasproduktion bis zum 21. Tag durchschnittlich zwischen 0,23 und 0,56 1 Biogas kg -1 ots h -1. Zwischen Tag 29 und 40 wurden durchschnittlich 0,11 bis 0,18 1 Biogas kg -1 ots h -1 gebildet, ab dem 41. Tag durchschnittlich 0,06 bis 0,08 l Biogas kg -1 ots h. Der Methangehalt im Biogas betrug bei Vergärung von reiner Silage (ohne Kosubstrat) durchschnittlich 62,8 % und war somit vergleichbar mit den Methangehalten bei Vergärung von frischen Pflanzen. Wenn Rinderfestmist als Kosubstrat eingesetzt wurde, wurden signifikant geringere Methangehalte von 59,1 bis 61,4 % erreicht (siehe auch Tab. 10). Der Verlauf der Methanbildung aus Sudangras-Silage folgt im Wesentlichen dem Verlauf der Biogasbildung und ist in Abb. 13 dargestellt. Die Methanbildung, ausgedrückt in l Methan pro kg organische Trockensubstanz, war bei Vergärung von reiner Silage signifikant höher als bei Kofermentation mit Rinderfestmist. Mit zunehmendem ots-anteil von Rinderfestmist nahmen die erzielten Methanerträge ab. Sudangraspflanzen aus dem ersten und dem dritten Erntezeitpunkt ergaben sowohl bei alleiniger Vergärung als auch bei Kofermentation mit Rinderfestmist vergleichbar hohe Methanerträge.
25 Abb. 12: Kumulative Biogasbildung aus Sudangras-Silage der Sorte Piper aus dem ersten Erntezeitpunkt (A) und aus dem 3. Erntezeitpunkt (B) in drei verschiedenen Mischungsverhältnissen zu Rinderfestmist (30:70 %ots-anteil, 60:40 %ots-anteil. 100 % ots-anteil Silage: Rinderfestmist) und Verlauf des ph-wertes während der Versuchsdauer.
26 Tab. 6: Mittlere spezifische Biogasproduktion (1 Biogas kg -1 Festmist (in den Mischungsverhältnissen 30 % 60 Zeitabschnitten des Versuches, ots h 1 ) ± Stabw. von Sudangras-Silage und % und 100 % Silage) in den verschiedenen Tage Piper 1.E. Piper 1.E. Piper 1.E. Piper 3.E. Piper 3.E. Piper 3.E. 30% 60 % 100% 30 % 60% 100% ,48±0,15 0,58±0,14 0,45±0,15 0,29±0, ±0,173 0,61 ±0, ,32±0,07 0,38±0,139 0,45±0,03 0,23±0,06 0,56±0,l83 0,39±0, ,19±0.03 0,20±0,03 0,39±0.07 0,17±0,02 0,20±0,03 0,23±0, ,12±0,03 0,12±0,03 0,18±0,07 0,11 ±0,03 0,13±0,03 0,16±0, ±0.02 0,06=0, ±0,01 0,06±0,01 0,06±0,02 0,08±0,01 Abb. 13: Kumulative Methanbildung aus Sudangras-Silage der Sorte Piper aus dem ersten Erntezeitpunkt (A) und aus dem 3. Erntezeitpunkt (B) in drei verschiedenen Mischungsverhältnissen zu Rinderfestmist (30:70 %ots. 60:40 % ots, 100 % ots Silage).
27 4.4. Modellhafte Beschreibung der Methanbildung aus Sudangras Der Verlauf der Methanbildung aus Sudangras lässt sich mit Hilfe einer Kurvenanpassung modellhaft beschreiben. Es wurde ein quadratisches Modell (y = b 0 + b 1 *t + b 2 *t²) angewendet. Die Kurvenverläufe der untersuchten Varianten unterschieden sich nicht signifikant bei p<0,05 (Kruskall-Wallis). Abb. 14 zeigt beispielhaft die Kurvenanpassung für die Methanbildung aus Sudangras der Sorte Susu, 2. Ernte. Die Parameter für die Gleichungen für die einzelnen Varianten sind in Tab. 7 angeführt. Tab. 7: Quadratisches Modell zur Beschreibung der Methanbildung aus frischen und silierten Sudangraspflanzen. Varianten Modell der Methanbildung b 0 b 1 b 2 Frisch Susu 1. Ernte 2,2690 7,0668-0,0600 Susu 2. Ernte 9,6155 7,1764-0,0555 Susu 3. Ernte 4,1133 7,6869-0,0691 Piper 1. Ernte 16,9510 9,3921-0,0982 Piper 2. Ernte ,9516-0,0823 Piper 3. Ernte -5,7850 9,2999-0,0907 Siliert Piper 1. Ernte 30 % ots 1,3373 5,4939-0,0547 Piper 1. Ernte 60 % ots -2,5223 9,1625-0,1044 Piper 1. Ernte 100 % ots ,4284-0,0755 Piper 3. Ernte 30 % ots 0, ,0501 Piper 3. Ernte 60 % ots -9,6258 9,5208-0,1031 Piper 3. Ernte 100 % ots 4,5288 9,2177-0,0985 Abb. 14: Quadratisches Modell (grün) und gemessene Werte (blau) der Methanbildung der Variante Susu 2 Ente.
28 4.5. Inhaltsstoffe der Gärgüter und deren Abbaubarkeit Die Ergebnisse der Inhaltsstoffanalysen der verwendeten Gärgüter sind in Tab. angeführt. Entgegen unserer Erwartungen unterschieden sich Sudangraspflanzen aus unterschiedlichen Erntezeitpunkten bezüglich der Gehalte an organischer Trockensubstanz, Gesamtstickstoff, Gesamtkohlenstoff, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser und den untersuchten Zellwandbestandteilen (NDF, ADF, ADL, Zellulose und Hemizellulose) nicht signifikant (Mann-Whitney-U-Test). Auch die Energiegehalte der Pflanzen unterschiedlicher Reifestadien unterschieden sich nicht signifikant. Die Trockensubstanzgehalte der untersuchten Sudangraspflanzen betrugen zwischen 26 und 58 %, die Gehalte an organischer Trockensubstanz lagen zwischen 94,4 und 95,9 % der Trockenmasse. Die Gehalte an Lignin, Zellulose und Hemizellulose betrugen jeweils zwischen 6,0 und 8,7, zwischen 26,4 und 33,5 und zwischen 19,3 und 25,2 % der Trockenmasse. Diese Werte sind vergleichbar mit Analysenwerten von Pouech et al. (1998), die für Sudangras (sweet sorghum) Gehalte von 90,7 % organischer Trockensubstanz und Gehalte an Lignin, Zellulose und Hemizellulose von jeweils 6,8, 30,0 und 25,8 % der Trockenmasse angeben. Zauner und Küntzel (1986) führten Untersuchungen zum Methanbildungspotenzial von silierten Grasmischungen durch, die ähnliche Gehalte an organischer Trockensubstanz aufwiesen wie die innerhalb des vorliegenden Projekts verwendete Sudangrassilage. Die Ligningehalte der Grasmischungen waren mit 3,6 % TS jedoch deutlich geringer als bei Sudangras. Bei niedrigeren Kohlenstoffgehalten und höheren Stickstoffgehalten war auch das C/N-Verhältnis von 16 bzw. 13 bei den Grasmischungen entschieden niedriger als bei dem hier untersuchten Sudangras. Die beiden Sudangrassorten Susu und Piper wiesen eine sehr ähnliche Zusammensetzung bezüglich der analysierten Inhaltsstoffe auf. Nur der Gehalt an Rohprotein war mit durchschnittlich 8,1 % TS bei den Pflanzen der Sorte Piper signifikant höher als bei der Sorte Susu mit durchschnittlich 7,1 % TS (Mann-Whitney-U-Test). Die frischen Sudangraspflanzen waren allgemein durch höhere ots-gehalte gekennzeichnet als die silierten Pflanzen. Die silierten Pflanzen wiesen gegenüber den frischen Pflanzen ein weiteres C/N-Verhältnis und höhere Gehalte an ADF auf. Die in den beiden Versuchsansätzen verwendeten Impfmaterialien zeigten Trockensubstanzgehalte von 4,3 und 6,4 % sowie Gehalte an organischer Trockensubstanz von 78,6 und 78,2 % TS. Das verwendete Impfmaterial war weitgehend ausgegoren, dementsprechend war das C/N-Verhältnis mit 15,0 und 13,2 niedriger als beim Pflanzenmaterial. Die Kohlenstoffgehalte betrugen 35,5 und 36,0 % TS. Die Gehalte an Rohfaser, Zellulose und Hemizellulose im Impfmaterial waren gegenüber den Gehalten in den Sudangraspflanzen geringer, während der Ligningehalt mit 17,6 und 16,4 % TS doppelt so hoch war wie die mittleren Ligningehalte der Pflanzen. Die Energiegehalte der Impfmaterialien lagen mit und J g -1 TS deutlich unter den Energiegehalten der Sudangraspflanzen mit durchschnittlich J g -1 TS. Der als Kosubstrat bei den Kofermentationsversuchen eingesetzte Rinderfestmist hatte einen Trockensubstanzanteil von 30,4 %, enthielt 74,3 % organische Trockensubstanz (in der TS) und hatte ein C/N-Verhältnis von 23,8. Der Energiewert des Rinderfestmists betrug J g -1 TS.
29 Tab. 8:Inhaltsstoffe der Gärgüter: frisches und siliertes Sudangras der Sorten Susu und Piper, Rinderrestmist als Kofermentationssubstrat und Impfmaterialien I und 2 der durchgeführten Gärversuche. NDF = non detergent fibre (gesamte Zellwandbestandteile), ADF = acid detergent fibre (Zellulose-Lignin-SiO 2 Komplex), ADL = acid detergent lignin (Rohlignin). Gärgüter TS ots N org C org C/N org Rohprotein NDF ADF ADL Zellulose Roh-fett Rohfaser Hemizellulose Energie % %TS % TS J g -1 TS Susu 1. Ernte frisch 26,04 95,39 0,98 42,05 42,9 7, ,80 59,39 36,54 6,41 30,14 22, ,7 Susu 2. Ernte frisch 37,77 95,43 1,06 41,08 38,8 7,20 2,88 24,72 53,00 32,40 6,01 26,38 20, ,1 Susu 3. Ernte frisch 37,26 95,52 0,88 39,54 44,9 6,84 1,99 25,40 58,61 35,83 6,82 29,00 22, ,1 Piper 1. Ernte frisch 36,44 95,25 1,16 43,95 37,9 8,20 2,70 27,48 69,28 37,37 7,13 30,23 31, ,8 Piper 2. Ernte frisch 57,99 95,91 0,87 42,53 48,9 8,12 1,95 22,77 53,66 34,33 6,49 27,83 19, ,6 Piper 3. Ernte frisch 48,30 95,74 0, ,2 7,80 2,15 26,32 58,31 34,50 7,63 26,87 23, ,7 Piper 1. Ernte siliert 33,56 94,43 1,48 42,32 28,6 8,52 3,06 28,06 61,71 39,16 7,15 32,01 22, ,1 Piper 3. Ernte siliert 36,23 94,54 1,09 39,45 36,2 7,69 2,41 29,43 67,44 42,27 8,73 33,54 25, ,0 Rinderfestmist 30,44 74,30 1,74 41,44 23,8 16,30 2,60 25,40 43,25 32,26 15,58 16,67 10, ,1 Impfmaterial 1 6,37 78,62 2,41 36,11 15,0 15,90 2,92 19,36 45,18 35,58 17,60 17,98 9, ,5 Impfmaterial 2 4,27 78,18 2,70 35,53 13,2 16,88 2,70 20,08 46,15 35,24 16,36 18,88 10, ,2
30 Tab. 9: Abbaugrade der Inhaltsstoffe in den Gärgutmischungen bei Methangärung von Sudangras. Angeführt sind das C/N-Verhältnis der Gärgutmischungen im Input und Output sowie der abgebaute Anteil der Trockensubstanz, der organischen Trockensubstanz, von organischem Stickstoff und Kohlenstoff sowie der Stoffgruppen Rohprotein, Rohfett und Rohfaser* Varianten C/N org C/N org TS ots N org C org protein Roh- Rohfett Rohfaser Input Output Abbau(%) Frisch Susu 1. Ernte 23,2 18,8 68,2 75,4 64,0 70,8 41,5 58,3 83,0 Susu 2. Ernte 22,6 22,8 62, ,1 65, ,7 75,3 Susu 3. Ernte 23, , ,5 66,9 33,1 47,1 76,9 Piper 1. Ernte 22, , ,9 65, , Piper 2. Ernte 24, , ,9 72,9 38,9 46, Piper 3. Ernte 24,5 19,6 62,7 68,3 56, ,2 38,5 71,4 Silage Piper 1.E. 30% 22,6 16,3 68,2 71,0 59,4 70, ,9 77,5 Piper 1.E. 60% 22,1 16, , , ,5 73,3 Piper 1.E. 100% 20,3 20,1 37,0 46,5 37,6 38,3 46,5 60,7 62,1 Piper 3. E. 30% 23, , ,2 68, , Piper 3. E. 60% 23, ,9 61, , , Piper 3. E. 100% ,9 50,4 59,7 37,4 53, ,1 74,3 Referenz Impfmaterial 1 15, ,1 73,9 74,7 71,3 45,5 46,7 79,8 Impfmaterial 2 13, ,1 59,9 55,5 54,9 45,2 42,8 4S.0 *Alle Werte wurden auf die Gehalte an Rohasche bezogen, die als Bezugsgröße während der Gärung konstant bleibt. Die Inhaltsstoffe der Gärgüter wurden sowohl zu Versuchsbeginn in den Input- Materialien als auch nach Versuchsende in den Output-Materialien analysiert. Auf diese Weise konnte der Abbaugrad der untersuchten Stoffgruppen berechnet werden. In Tab. 9 sind die Mengen der abgebauten Inhaltsstoffe in % der Gehalte in den Input-Materialien angeführt. Als Bezugsgröße wurde hierbei der Gehalt der Proben an Rohasche eingesetzt. Im Vergleich der C- und N-Gehalte der Gärgüter im Input und Output zeigt sich, dass das C/N-Verhältnis in fast allen Fällen während der Methangärung enger wurde (Tab. 9 ). Bei den Varianten mit frischem Sudangras betrug das C/N-Verhältnis im Input durchschnittlich 23.5 und im Output durchschnittlich 20,4. Die Varianten mit Sudangras-Silage wiesen ein mittleres C/N-Verhältnis von 22.3 im Input und von 17.5 im Output auf. Die Gehalte an organischem Kohlenstoff in den Gärgütern erreichten dementsprechend einen höheren Abbaugrad als die des organischen Stickstoffs. Während der Kohlenstoff in den frischen und den Silage-Varianten zu durchschnittlich 67 und 59 % abgebaut wurde, betrugen die mittleren Abbaugrade des Stickstoffs jeweils 63 und 40 %. Das C/N-Verhältnis des Substrats spielt eine wichtige Rolle im Gärprozess. Als günstig gelten C/N-Verhältnisse im Bereich von 20 bis 30. In diesem Bereich ist einerseits genügend Stickstoff für die Zellvermehrung vorhanden, um Kohlenstoff vollständig zu verwerten, andererseits gibt es keinen Stickstoff-Überschuss, der zu toxischen Ammoniak-Konzentrationen fuhren kann (Weiland 2001). Die C/N-Verhältnisse der in den Versuchen eingesetzten Gärgut-Mischungen lagen mit Werten zwischen 20,3 und 24,5 in einem für die Methanogenese günstigen Bereich. Im Impfmaterial 2 (des Versuches mit Sudangras-Silage),
31 das als Referenz vergoren wurde, könnten die am Gärprozess beteiligten Mikroorganismen eine Stickstofflimitierung erfahren haben. Der Abbaugrad der organischen Trockensubstanz betrug bei der Vergärung von frischen Sudangraspflanzen durchschnittlich 72 %. Bei der Vergärung von Sudangras-Silage wurden signifikant geringere Abbaugrade von durchschnittlich 62 % erreicht. Wenn Rinderfestmist als Kosubstrat eingesetzt wurde, wurden gegenüber der Verwendung von reiner Silage signifikant höhere Abbaugrade der organischen Trockensubstanz gefunden (Kruskall-Wallis-Test). Rohprotein und Rohfett wurden bei alleiniger Vergärung von Sudangras-Silage (ohne Kosubstrat) zu einem höheren Maße abgebaut als wenn frische Pflanzen verwendet wurden. Bei Rohprotein war dieser Unterschied signifikant (Kruskall-Wallis-Test). Der Abbau von Rohfaser verhielt sich bei frischen und silierten Sudangraspflanzen ähnlich. In den Kofermentationsversuchen wurde wie bei der organischen Trockensubstanz ein umso höherer Abbau von Rohprotein festgestellt, je größer der Anteil von Rinderfestmist gewählt wurde. Im Vergleich der beiden Sudangrassorten war festzustellen, dass bei der Vergärung von Sudangras der Sorte Susu ein höheren Abbaugrad von Rohfett und Rohfaser erreicht wurde als bei Sudangras der Sorte Piper. Diese Unterschiede waren jedoch nicht signifikant. Bei der Vergärung von Sudangras-Pflanzen unterschiedlicher Reifestadien wurden keine Unterschiede bezüglich des Abbaugrades der Inhaltsstoffe festgestellt. Innerhalb der Stoffgruppen Rohprotein, Rohfett und Rohfaser wurden durchgehend die höchsten Abbaugrade bei der Rohfaser gemessen. Die Rohfaser wurde bei den Varianten mit frischem Sudangras zu durchschnittlich 76 % abgebaut, bei den Varianten mit reiner Sudangras-Silage zu durchschnittlich 68 %. Rohfett wies mittlere Abbaugrade von 47 (frische Pflanzen) und 60 % (reine Silage) auf, Rohprotein zeigte mittlere Abbaugrade von 36 (frische Pflanzen) und 46 % (reine Silage). Auch bei Kofermentation mit Rinderfestmist wies die Rohfaser den höchsten Abbaugrad auf (67 bis 77 %). Die mittels der Weender Futtermittelanalyse bestimmte Rohfaser bezeichnet den in Säuren und Laugen unlöslichen Rückstand einer Substanz und umfasst unter anderem Zellulose, Lignin, Pentosane, Suberin und Cutin (Kirchgessner 1992). Die in den Gärgütern bestimmte Rohfaserfraktion enthält also unterschiedliche Anteile an verdaulichen sowie unverdaulichen Gerüstsubstanzen. Dass hohe Abbaugrade der Rohfaser erhalten wurden, könnte auf eine geringe Lignifizierung dieser Fraktion zurückzuführen sein. Ein Vergleich mit dem Abbauverhalten von Gräsern im Wiederkäuermagen zeigt, dass Rohprotein und Rohfett in frühem Weidegras zu 77 und 56 % verdaulich sind und dass die Rohfaser mit 81 % von diesen drei Stoffgruppen die höchste Verdaulichkeit aufweist (Kirchgessner 1992). Die in unseren Versuchen an der Methangärung beteiligten Mikroorganismen könnten aufgrund ähnlicher physiologischer Fähigkeiten der Substratnutzung in vergleichbarer Weise eine gute Abbaubarkeit der Rohfaserfraktion gewährleisten.
Ergebnisbericht, Mai Im Auftrag von Südsteirische Energie- und Eiweißerzeugung Reg.Gen.m.b.H. (SEEG) Pestkreuzweg 3 A-8480 Mureck
 ao.univ.prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Amon DI. Vitaliy Kryvoruchko Dr. Barbara Amon Dr. Mathias Schreiner Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik A-1190 Wien, Peter-Jordanstr. 82
ao.univ.prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Amon DI. Vitaliy Kryvoruchko Dr. Barbara Amon Dr. Mathias Schreiner Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik A-1190 Wien, Peter-Jordanstr. 82
Biogas- und Methanerträge neuer Energiepflanzen
 Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen Thema Biogas- und Methanerträge neuer Energiepflanzen V [l N /kg ots ] 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Biogas Methan Ablauf Einleitung Methoden und
Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen Thema Biogas- und Methanerträge neuer Energiepflanzen V [l N /kg ots ] 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Biogas Methan Ablauf Einleitung Methoden und
Energetische Verwertung
 Energetische Verwertung Biogaserzeugung Das Methanpotential von S. perfoliatum lag zwischen 204 und 330 Normliter (Nl) CH 4 kg -1 ots, im Durchschnitt bei 274 Nl CH 4 kg -1 ots. Das Methanpotential von
Energetische Verwertung Biogaserzeugung Das Methanpotential von S. perfoliatum lag zwischen 204 und 330 Normliter (Nl) CH 4 kg -1 ots, im Durchschnitt bei 274 Nl CH 4 kg -1 ots. Das Methanpotential von
Biogas und Methanpotential von Zwischenfrüchten
 Biogas und Methanpotential von Zwischenfrüchten Endbericht April 2010 Ao.Univ.Prof. Dipl. Ing. Dr. Thomas Amon Dr. Alexander Bauer DI Desanka Ilic Mag. Christian Leonhartsberger Ing. Günter Mair Institut
Biogas und Methanpotential von Zwischenfrüchten Endbericht April 2010 Ao.Univ.Prof. Dipl. Ing. Dr. Thomas Amon Dr. Alexander Bauer DI Desanka Ilic Mag. Christian Leonhartsberger Ing. Günter Mair Institut
EINSATZMÖGLICHKEITEN VON ENERGIEPFLANZEN AUF KIPPENFLÄCHEN ZUR BIOGASPRODUKTION. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Wissenschaftler, VÚRV-Chomutov
 EINSATZMÖGLICHKEITEN VON ENERGIEPFLANZEN AUF KIPPENFLÄCHEN ZUR BIOGASPRODUKTION Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Wissenschaftler, VÚRV-Chomutov ANALYSE DEFINITION DES TYPS UND DER QUALITÄT DES ROHSTOFFES
EINSATZMÖGLICHKEITEN VON ENERGIEPFLANZEN AUF KIPPENFLÄCHEN ZUR BIOGASPRODUKTION Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Wissenschaftler, VÚRV-Chomutov ANALYSE DEFINITION DES TYPS UND DER QUALITÄT DES ROHSTOFFES
Einfluss ausgewählter Kohlenstofffraktionen unterschiedlicher Einsatzsubstrate auf deren Biogas- und Methanertrag. B. Eng.
 Einfluss ausgewählter Kohlenstofffraktionen unterschiedlicher Einsatzsubstrate auf deren Biogas- und Methanertrag B. Eng. Abteilungskolloquium in der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena 16.11.2011
Einfluss ausgewählter Kohlenstofffraktionen unterschiedlicher Einsatzsubstrate auf deren Biogas- und Methanertrag B. Eng. Abteilungskolloquium in der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena 16.11.2011
Einfluss von Erntezeitpunkt und Bestandesdichte. Ergebnisse
 Energiemais Einfluss von Erntezeitpunkt und Bestandesdichte Ergebnisse 2004-06 Gliederung 1. Problemstellung 2. Ergebnisse - Erntetermin - Bestandesdichte 3. Schlussfolgerungen Problemstellung Endlichkeit
Energiemais Einfluss von Erntezeitpunkt und Bestandesdichte Ergebnisse 2004-06 Gliederung 1. Problemstellung 2. Ergebnisse - Erntetermin - Bestandesdichte 3. Schlussfolgerungen Problemstellung Endlichkeit
Integriertes Klimaschutzkonzept für den Kreis Soest unter Einbeziehung der Kommunen
 Integriertes Klimaschutzkonzept für den Kreis Soest unter Einbeziehung der Kommunen Wärme aus Biogas im industriellen Umfeld Grundlagen Biogas Die Anlage in Ense Daten und Fakten Wie funktioniert eine
Integriertes Klimaschutzkonzept für den Kreis Soest unter Einbeziehung der Kommunen Wärme aus Biogas im industriellen Umfeld Grundlagen Biogas Die Anlage in Ense Daten und Fakten Wie funktioniert eine
Methanbildungsvermögen von Mais Einfluss der Sorte, der Konservierung und des Erntezeitpunktes. Endbericht Oktober 2002
 Institut für Land-, Umweltund Energietechnik Universität für Bodenkultur Wien A-1190 Wien, Nussdorfer Lände 29-31 Tel: +43 1 3189877-92 e-mail: thomas.amon@boku.ac.at Methanbildungsvermögen von Mais Einfluss
Institut für Land-, Umweltund Energietechnik Universität für Bodenkultur Wien A-1190 Wien, Nussdorfer Lände 29-31 Tel: +43 1 3189877-92 e-mail: thomas.amon@boku.ac.at Methanbildungsvermögen von Mais Einfluss
Probleme und Optimierungsmöglichkeiten. bei der Biogaserzeugung und Nutzung
 Plant - Energy Workshop Potsdam, 12.02.2007 Probleme und Optimierungsmöglichkeiten bei der Biogaserzeugung und Nutzung P. Weiland (FAL) Inhalt Probleme Potenzielle Schwachstellen Optimierungsmöglichkeiten
Plant - Energy Workshop Potsdam, 12.02.2007 Probleme und Optimierungsmöglichkeiten bei der Biogaserzeugung und Nutzung P. Weiland (FAL) Inhalt Probleme Potenzielle Schwachstellen Optimierungsmöglichkeiten
2. Einflüsse auf das Methanbildungsvermögen von Energiepflanzen
 Biogaserträge aus landwirtschaftlichen Gärgütern Th. Amon 1), V. Kryvoruchko 1), B. Amon 1), S. Buga 1), A. Amid 1), W. Zollitsch, 2), K. Mayer 3) E. Pötsch, 4) 1) Institut für Landtechnik im Department
Biogaserträge aus landwirtschaftlichen Gärgütern Th. Amon 1), V. Kryvoruchko 1), B. Amon 1), S. Buga 1), A. Amid 1), W. Zollitsch, 2), K. Mayer 3) E. Pötsch, 4) 1) Institut für Landtechnik im Department
Energie aus Grünland -Biogasproduktion von Grünland und Feldfutter
 Energie aus Grünland -Biogasproduktion von Grünland und Feldfutter Univ. Doz. Dr. Erich M. PÖTSCHP Abteilung Grünlandmanagement und Kulturlandschaft der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Universität t für f
Energie aus Grünland -Biogasproduktion von Grünland und Feldfutter Univ. Doz. Dr. Erich M. PÖTSCHP Abteilung Grünlandmanagement und Kulturlandschaft der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Universität t für f
Forschungsprojekt Nr BMLFUW, GZ LE.1.3.2/0050-II/1/2005 FA13B /04-G2. Zwischenbericht 27. Juni 2006
 Universität für Bodenkultur Wien Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik Optimierung der Methanausbeute aus Zuckerrüben, Silomais, Körnermais, Sonnenblumen, Ackerfutter, Getreide,
Universität für Bodenkultur Wien Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik Optimierung der Methanausbeute aus Zuckerrüben, Silomais, Körnermais, Sonnenblumen, Ackerfutter, Getreide,
2. Workshop des Arbeitskreises Biogas im Ökolandbau: Biogas aus Kleegras. "Biogas aus Kleegras Fermenterbiologie in der Balance"
 2. Workshop des Arbeitskreises Biogas im Ökolandbau: Biogas aus Kleegras "Biogas aus Kleegras Fermenterbiologie in der Balance" Dipl. Ing. (FH) Matthias Schriewer www.biogas-advisor.com Zur Person Matthias
2. Workshop des Arbeitskreises Biogas im Ökolandbau: Biogas aus Kleegras "Biogas aus Kleegras Fermenterbiologie in der Balance" Dipl. Ing. (FH) Matthias Schriewer www.biogas-advisor.com Zur Person Matthias
Nutzung von Zuckerrüben als Gärsubstrat Lagerung - Vergärung - Wirtschaftlichkeit
 Nutzung von Zuckerrüben als Gärsubstrat Lagerung - Vergärung - Wirtschaftlichkeit Dr. Andreas LEMMER Dr. S. Zielonka, E. Kumanowska Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie Biogasinfotage Ulm, 11.01.2018
Nutzung von Zuckerrüben als Gärsubstrat Lagerung - Vergärung - Wirtschaftlichkeit Dr. Andreas LEMMER Dr. S. Zielonka, E. Kumanowska Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie Biogasinfotage Ulm, 11.01.2018
Energiegehalt und Einflussgrößen der Energieschätzgleichung für Grassilagen
 Energiegehalt und Einflussgrößen der Energieschätzgleichung für Grassilagen Neuerung: Ab 2008 wurde bei der LUFA NRW eine neue Energieschätzgleichung für Grassilagen eingesetzt. Neben Rohasche und Rohprotein
Energiegehalt und Einflussgrößen der Energieschätzgleichung für Grassilagen Neuerung: Ab 2008 wurde bei der LUFA NRW eine neue Energieschätzgleichung für Grassilagen eingesetzt. Neben Rohasche und Rohprotein
Vergärung von Durchwachsener Silphie - Beurteilung mittels eines Gärtestes
 Vergärung von Durchwachsener Silphie - Beurteilung mittels eines Gärtestes In Kooperation zwischen Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG Hahnennest 100 88356 Ostrach Und SensoPower Phytobiotics Futterzusatzstoffe
Vergärung von Durchwachsener Silphie - Beurteilung mittels eines Gärtestes In Kooperation zwischen Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG Hahnennest 100 88356 Ostrach Und SensoPower Phytobiotics Futterzusatzstoffe
Silohirseversuche 2015 und 2016
 Silohirseversuche 2 und 216 Versuchsziel: In den letzten Jahren verursachte der westliche Maiswurzelbohrer nicht nur bei Körnermais sondern in den kühleren Regionen der Steiermark auch beim Silomais zum
Silohirseversuche 2 und 216 Versuchsziel: In den letzten Jahren verursachte der westliche Maiswurzelbohrer nicht nur bei Körnermais sondern in den kühleren Regionen der Steiermark auch beim Silomais zum
Biogas und Methanpotential von Zwischenfrüchten
 Biogas und Methanpotential von Zwischenfrüchten Endbericht Oktober 2012 Dr. Alexander Bauer DI Franz Theuretzbacher Prof. Dr. Andreas Gronauer Institut f. Landtechnik, Department Nachhaltige Agrarsysteme,
Biogas und Methanpotential von Zwischenfrüchten Endbericht Oktober 2012 Dr. Alexander Bauer DI Franz Theuretzbacher Prof. Dr. Andreas Gronauer Institut f. Landtechnik, Department Nachhaltige Agrarsysteme,
Analyse eines Gemenges aus Triticale und Wintererbsen. zur Verwendung als Substrat für Biogasanlagen
 Analyse eines Gemenges aus Triticale und Wintererbsen zur Verwendung als Substrat für Biogasanlagen - Kurzbericht - Auftraggeber: Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg z. Hd. Frau D. Angel Auftragnehmer:
Analyse eines Gemenges aus Triticale und Wintererbsen zur Verwendung als Substrat für Biogasanlagen - Kurzbericht - Auftraggeber: Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg z. Hd. Frau D. Angel Auftragnehmer:
Energieforschung Forschungs- und P+D-Programm Biomasse
 Energieforschung Forschungs- und P+D-Programm Biomasse im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE Jahresbericht 2002, 2. Dezember 2002 Vergärung von Pulpa aus der Kaffee-Produktion (Projekttitel, 2. Zeile)
Energieforschung Forschungs- und P+D-Programm Biomasse im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE Jahresbericht 2002, 2. Dezember 2002 Vergärung von Pulpa aus der Kaffee-Produktion (Projekttitel, 2. Zeile)
Anbau und Nutzung von Energiepflanzen
 Hochschule Anhalt, FB Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung Dr. agr. Lothar Boese ehem. Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) Sachsen- Anhalt, Zentrum für Acker- und
Hochschule Anhalt, FB Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung Dr. agr. Lothar Boese ehem. Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) Sachsen- Anhalt, Zentrum für Acker- und
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag und Unkrautunterdrückung von Winterackerbohne 2015
 Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag und Unkrautunterdrückung von Winterackerbohne 2015 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag und Unkrautunterdrückung von Winterackerbohne 2015 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Methangewinnung aus flüssig silierten Gehaltsrüben
 Methangewinnung aus flüssig silierten Gehaltsrüben Abdel-Hadi, Mohamed; Jürgen Beck und Thomas Jungbluth, Institut für Agrartechnik, Universität Hohenheim (44), 759 Stuttgart, Germany 1 Einleitung Lange
Methangewinnung aus flüssig silierten Gehaltsrüben Abdel-Hadi, Mohamed; Jürgen Beck und Thomas Jungbluth, Institut für Agrartechnik, Universität Hohenheim (44), 759 Stuttgart, Germany 1 Einleitung Lange
Silohirse - Sortenversuche Hafendorf
 Silohirse - Sortenversuche Hafendorf 216-217 Versuchsziel: In den letzten Jahren verursachte der westliche Maiswurzelbohrer nicht nur bei Körnermais sondern in den kühleren Regionen der Steiermark auch
Silohirse - Sortenversuche Hafendorf 216-217 Versuchsziel: In den letzten Jahren verursachte der westliche Maiswurzelbohrer nicht nur bei Körnermais sondern in den kühleren Regionen der Steiermark auch
BGA (Biogasanlage) Aufbau & Funktionsweise der Biogasanlage:
 BGA (Biogasanlage) So entsteht Biogas: Als Grundstoffe für die Biogaserzeugung kommen alle Arten von Biomasse in Frage, also alle organischen Materialien, die aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten bestehen.
BGA (Biogasanlage) So entsteht Biogas: Als Grundstoffe für die Biogaserzeugung kommen alle Arten von Biomasse in Frage, also alle organischen Materialien, die aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten bestehen.
Höchste Grundfutterqualität ist kein Kinderspiel jedoch lohnenswert! Inhalt
 Höchste Grundfutterqualität ist kein Kinderspiel jedoch lohnenswert! BLGG AgroXpertus Karen Oerlemans Inhalt BLGG AgroXpertus Proteinbeurteilung Zellwände Energiebeurteilung Silagemanager 1 BLGG AgroXpertus
Höchste Grundfutterqualität ist kein Kinderspiel jedoch lohnenswert! BLGG AgroXpertus Karen Oerlemans Inhalt BLGG AgroXpertus Proteinbeurteilung Zellwände Energiebeurteilung Silagemanager 1 BLGG AgroXpertus
Die Turbo Maische. Die biologische Substrataufbereitung als Beitrag zur saisonal flexibilisierten Biogaserzeugung
 Die Turbo Maische Die biologische Substrataufbereitung als Beitrag zur saisonal flexibilisierten Biogaserzeugung 1 Triesdorf BIOGAS FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET Dr. Petra Rabe 24.05.2017 Infotag zu Flexibilisierung
Die Turbo Maische Die biologische Substrataufbereitung als Beitrag zur saisonal flexibilisierten Biogaserzeugung 1 Triesdorf BIOGAS FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET Dr. Petra Rabe 24.05.2017 Infotag zu Flexibilisierung
Hochschule Anhalt (FH)
 Hochschule Anhalt (FH) EINSATZ VON VETIVERIA-GRAS ZUR BIOGASERZEUGUNG Nutzung von Problemstandorten Professur für Bioprozesstechnik - Köthen Prof. Dr. Reinhard Pätz Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Henryk Listewnik
Hochschule Anhalt (FH) EINSATZ VON VETIVERIA-GRAS ZUR BIOGASERZEUGUNG Nutzung von Problemstandorten Professur für Bioprozesstechnik - Köthen Prof. Dr. Reinhard Pätz Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Henryk Listewnik
Was versteht man unter Vergärung?
 Was versteht man unter Vergärung? Unter dem Begriff Vergärung versteht man den Abbau von biogenem Material durch Mikroorganismen in Abwesenheit von Sauerstoff, d.h. unter anaeroben Bedingungen. Mehrere
Was versteht man unter Vergärung? Unter dem Begriff Vergärung versteht man den Abbau von biogenem Material durch Mikroorganismen in Abwesenheit von Sauerstoff, d.h. unter anaeroben Bedingungen. Mehrere
Effizienzkontrolle der Biogasproduktion durch Massenbilanzierung anhand der FoTS. Prof. Dr. agr. habil. Friedrich Weißbach Elmenhorst.
 Effizienzkontrolle der Biogasproduktion durch Massenbilanzierung anhand der FoTS Prof. Dr. agr. habil. Friedrich Weißbach Elmenhorst Aufgabe Entwicklung und Erprobung einer praxistauglichen Methode zur
Effizienzkontrolle der Biogasproduktion durch Massenbilanzierung anhand der FoTS Prof. Dr. agr. habil. Friedrich Weißbach Elmenhorst Aufgabe Entwicklung und Erprobung einer praxistauglichen Methode zur
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag und Unkrautunterdrückung von Winterackerbohne 2014
 Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag und Unkrautunterdrückung von Winterackerbohne 2014 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag und Unkrautunterdrückung von Winterackerbohne 2014 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
TSk XF XA in % in % TSk in % TSk A Zuckerrüben ,2 4,2 4,4 A Energierüben ,9 3,9 5,3
 Zucker- und Energierüben ganzjährig als Gärsubstrat in Biogasanlagen einsetzen wie hoch sind die Verluste an Biogasertragspotenzial durch die Lagerung und Konservierung in Mieten und Silos? Professorin
Zucker- und Energierüben ganzjährig als Gärsubstrat in Biogasanlagen einsetzen wie hoch sind die Verluste an Biogasertragspotenzial durch die Lagerung und Konservierung in Mieten und Silos? Professorin
Forschungsprojekt Nr BMLFUW, GZ LE.1.3.2/0050-II/1/2005 FA13B /04-G2. Endbericht 31. März 2007
 Universität für Bodenkultur Wien Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik Optimierung der Methanausbeute aus Zuckerrüben, Silomais, Körnermais, Sonnenblumen, Ackerfutter, Getreide,
Universität für Bodenkultur Wien Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik Optimierung der Methanausbeute aus Zuckerrüben, Silomais, Körnermais, Sonnenblumen, Ackerfutter, Getreide,
Die Bewertung von nachwachsenden Rohstoffen als Substrate für die Biogasproduktion. Prof. Dr. F. Weißbach Elmenhorst
 Die Bewertung von nachwachsenden Rohstoffen als Substrate für die Biogasproduktion Prof. Dr. F. Weißbach Elmenhorst Die Bewertung des Gasbildungspotenzials ist notwendig, um entscheiden zu können über:
Die Bewertung von nachwachsenden Rohstoffen als Substrate für die Biogasproduktion Prof. Dr. F. Weißbach Elmenhorst Die Bewertung des Gasbildungspotenzials ist notwendig, um entscheiden zu können über:
Methanbildungspotenziale als Grundlage für die ökologische und ökonomische Bewertung von Energiefruchtfolgen
 Methanbildungspotenziale als Grundlage für die ökologische und ökonomische Bewertung von Energiefruchtfolgen Christiane Herrmann, Vincent Plogsties, Christine Idler, Monika Heiermann 4. Energiepflanzenforum
Methanbildungspotenziale als Grundlage für die ökologische und ökonomische Bewertung von Energiefruchtfolgen Christiane Herrmann, Vincent Plogsties, Christine Idler, Monika Heiermann 4. Energiepflanzenforum
Sekundärwand Zellumen
 Kohlenhydrate Kohlenhydrate in Pressschnitzeln Pressschnitzel bestehen überwiegend aus den Zellwand- oder Gerüstkohlenhydraten Pektin, Hemicellulose und Cellulose, wobei die anteilig jeweils etwas ein
Kohlenhydrate Kohlenhydrate in Pressschnitzeln Pressschnitzel bestehen überwiegend aus den Zellwand- oder Gerüstkohlenhydraten Pektin, Hemicellulose und Cellulose, wobei die anteilig jeweils etwas ein
Sudangras und Zuckerhirse eine Alternative zu Mais in der Biogasproduktion
 Sudangras und Zuckerhirse eine Alternative zu Mais in der Biogasproduktion Projektleiter Sachsen: Dr. Ch. Röhricht, Bearbeiter: D. Zander, S. Schröder und S. Freydank Sorghumhirseprojekte (Biogas) der
Sudangras und Zuckerhirse eine Alternative zu Mais in der Biogasproduktion Projektleiter Sachsen: Dr. Ch. Röhricht, Bearbeiter: D. Zander, S. Schröder und S. Freydank Sorghumhirseprojekte (Biogas) der
Untersuchungsbericht zur energetischen Grundfutterbewertung in Thüringen mit neuen Schätzgleichungen
 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Untersuchungsbericht zur energetischen Grundfutterbewertung in Thüringen mit neuen Schätzgleichungen Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Untersuchungsbericht zur energetischen Grundfutterbewertung in Thüringen mit neuen Schätzgleichungen Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und
Kleegrassilagen in Ökobetrieben Futterwert, Mineralstoffgehalt und Gärqualität
 Kleegrassilagen in Ökobetrieben Futterwert, Mineralstoffgehalt und Gärqualität Fragestellungen: Wie hoch sind die Mineralstoff- und Spurenelementgehalte? Welcher Futterwert und welche Gärqualität wurden
Kleegrassilagen in Ökobetrieben Futterwert, Mineralstoffgehalt und Gärqualität Fragestellungen: Wie hoch sind die Mineralstoff- und Spurenelementgehalte? Welcher Futterwert und welche Gärqualität wurden
Biogaserzeugung aus Mais - Einfluss der Inhaltsstoffe auf das spezifische Methanbildungsvermögen von früh- bis spätreifen Maissorten
 Hybridmais, Züchtung und Verwertung Biogaserzeugung aus Mais - Einfluss der Inhaltsstoffe auf das spezifische Methanbildungsvermögen von früh- bis spätreifen Maissorten TH. AMON, V. KRYVORUCHKO, B. AMON,
Hybridmais, Züchtung und Verwertung Biogaserzeugung aus Mais - Einfluss der Inhaltsstoffe auf das spezifische Methanbildungsvermögen von früh- bis spätreifen Maissorten TH. AMON, V. KRYVORUCHKO, B. AMON,
Hohenheimer Biogasertragstest
 Hohenheimer Biogasertragstest Frank Hengelhaupt Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft V [l N /kg ots ] 800 700 Biogas Methan 600 500 400 300 200 100 0 Gliederung Biogasentstehung und Gärtests im Labormaßstab
Hohenheimer Biogasertragstest Frank Hengelhaupt Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft V [l N /kg ots ] 800 700 Biogas Methan 600 500 400 300 200 100 0 Gliederung Biogasentstehung und Gärtests im Labormaßstab
STOFFLICHE BESCHAFFENHEIT
 Fachtagung Pflanzenbauliche Verwertung von Gärrückständen aus Biogasanlagen STOFFLICHE BESCHAFFENHEIT VON GÄRPRODUKTEN AUS BIOGASANLAGEN Verena Wragge Karen Sensel-Gunke, Kerstin Nielsen Institut für Agrar-
Fachtagung Pflanzenbauliche Verwertung von Gärrückständen aus Biogasanlagen STOFFLICHE BESCHAFFENHEIT VON GÄRPRODUKTEN AUS BIOGASANLAGEN Verena Wragge Karen Sensel-Gunke, Kerstin Nielsen Institut für Agrar-
Prüfung von Rapsextraktionsschrot
 Prüfung von Rapsextraktionsschrot In den DLG-Futterwerttabellen für Wiederkäuer werden beim Rapsextraktionsschrot unterschiedliche Qualitäten aufgeführt. Unterschieden wird in 00-Qualitäten und in alte
Prüfung von Rapsextraktionsschrot In den DLG-Futterwerttabellen für Wiederkäuer werden beim Rapsextraktionsschrot unterschiedliche Qualitäten aufgeführt. Unterschieden wird in 00-Qualitäten und in alte
Maissilage 2009 geht s noch besser? Die Maissilageernte 2009 zeigte eine gute Qualität. Bei sehr hoch gewachsenen Beständen führte dies aber
 Maissilage 2009 geht s noch besser? Die Maissilageernte 2009 zeigte eine gute Qualität. Bei sehr hoch gewachsenen Beständen führte dies aber teilweise zu mehr Masse auf Kosten von Energie. Der Silomais
Maissilage 2009 geht s noch besser? Die Maissilageernte 2009 zeigte eine gute Qualität. Bei sehr hoch gewachsenen Beständen führte dies aber teilweise zu mehr Masse auf Kosten von Energie. Der Silomais
Landwirtschaftliche Biogasanlagen. Dipl. Ing. Mag (FH) Wolfgang Gabauer Anacon GmbH, Technopark 1 A-3430 Tulln an der Donau mobile:
 Landwirtschaftliche Biogasanlagen Dipl. Ing. Mag (FH) Wolfgang Gabauer Anacon GmbH, Technopark 1 A-3430 Tulln an der Donau mobile: +43 680 1180 963 Biogasanlagen in Österreich Quelle: Arge Kompost & Biogas
Landwirtschaftliche Biogasanlagen Dipl. Ing. Mag (FH) Wolfgang Gabauer Anacon GmbH, Technopark 1 A-3430 Tulln an der Donau mobile: +43 680 1180 963 Biogasanlagen in Österreich Quelle: Arge Kompost & Biogas
Steigerung des Methanertrages durch mechanische Substrat- und Gärrestaufbereitung
 Steigerung des Methanertrages durch mechanische Substrat- und Gärrestaufbereitung Dr. Matthias Mönch-Tegeder Dr. Andreas Lemmer Dr. Hans Oechsner 14.01.2016 Gefördert durch Koordiniert vom 1 Rohstoffeinsatz
Steigerung des Methanertrages durch mechanische Substrat- und Gärrestaufbereitung Dr. Matthias Mönch-Tegeder Dr. Andreas Lemmer Dr. Hans Oechsner 14.01.2016 Gefördert durch Koordiniert vom 1 Rohstoffeinsatz
Langfristige Bereitstellung von Energie aus der Landwirtschaft
 Langfristige Bereitstellung von Energie aus der Landwirtschaft Alexander Bauer Institut für Landtechnik Universität für Bodenkultur, Wien 21.10.2016 Status quo: Bioenergieherstellung Energie aus der Landwirtschaft
Langfristige Bereitstellung von Energie aus der Landwirtschaft Alexander Bauer Institut für Landtechnik Universität für Bodenkultur, Wien 21.10.2016 Status quo: Bioenergieherstellung Energie aus der Landwirtschaft
Effekte von Fruchtfolge und Beregnung auf die Leistung von Energiepflanzen
 Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg Effekte von Fruchtfolge und Beregnung auf die Leistung von Dr. Sandra Kruse Workshop Pflanzliche Rohstoffe zur Biogasgewinnung - Bereitstellung und
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg Effekte von Fruchtfolge und Beregnung auf die Leistung von Dr. Sandra Kruse Workshop Pflanzliche Rohstoffe zur Biogasgewinnung - Bereitstellung und
Mais und Alternativen zur Biogaserzeugung. Dr. Karl Mayer, Abteilung Pflanzenbau
 Mais und Alternativen zur Biogaserzeugung Dr. Karl Mayer, Abteilung Pflanzenbau Kulturführungsdaten Anbau: Anbau Obgrün 27. 28. April Anbau Hafendorf 10. Mai Düngung: Mais und Sorghum 210 kg N/ha Teilung
Mais und Alternativen zur Biogaserzeugung Dr. Karl Mayer, Abteilung Pflanzenbau Kulturführungsdaten Anbau: Anbau Obgrün 27. 28. April Anbau Hafendorf 10. Mai Düngung: Mais und Sorghum 210 kg N/ha Teilung
Energiepflanzentag Haus Düsse, Entwicklung des Maisanbaus in Niedersachsen
 Prof. Dr. Christa Hoffmann Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen Energiepflanzentag Haus Düsse, Entwicklung des Maisanbaus in Niedersachsen Flächenanteil Mais steigt in einigen Regionen extrem an
Prof. Dr. Christa Hoffmann Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen Energiepflanzentag Haus Düsse, Entwicklung des Maisanbaus in Niedersachsen Flächenanteil Mais steigt in einigen Regionen extrem an
Wir bringen neue Energien voran. Können Enzyme die Biogasausbeute erhöhen?
 Wir bringen neue Energien voran. Können Enzyme die Biogasausbeute erhöhen? Fachtagung: Effizienzsteigerung von Biogasanlagen im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 10.11.2011 Können Enzyme die Biogasausbeute
Wir bringen neue Energien voran. Können Enzyme die Biogasausbeute erhöhen? Fachtagung: Effizienzsteigerung von Biogasanlagen im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 10.11.2011 Können Enzyme die Biogasausbeute
BIOKATGAS. Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage
 BIOKATGAS Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage Was ist Bio-Kat-Gas? Bio-Kat-Gas ist ein rein pflanzliches, vollkommen biologisch abbaubares Produkt aus einer speziellen Mischung von Katalysatoren
BIOKATGAS Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage Was ist Bio-Kat-Gas? Bio-Kat-Gas ist ein rein pflanzliches, vollkommen biologisch abbaubares Produkt aus einer speziellen Mischung von Katalysatoren
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag, Unkrautunterdrückung und Standfestigkeit von Wintererbsen 2013
 Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag, Unkrautunterdrückung und Standfestigkeit von Wintererbsen 2013 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag, Unkrautunterdrückung und Standfestigkeit von Wintererbsen 2013 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Gas aus Gras. Biologie der Grasvergärung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. agrikomp GmbH Petra Zigldrum Dipl. Biologin Laborservice
 Gas aus Gras Biologie der Grasvergärung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen agrikomp GmbH Petra Zigldrum Dipl. Biologin Laborservice Inhalt Vorstellung agrikomp GmbH, agrikomp Labor Unterschiede, Eigenschaften
Gas aus Gras Biologie der Grasvergärung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen agrikomp GmbH Petra Zigldrum Dipl. Biologin Laborservice Inhalt Vorstellung agrikomp GmbH, agrikomp Labor Unterschiede, Eigenschaften
Gülledüngung bei Winterweizen und Triticale 2013:
 Gülledüngung bei Winterweizen und Triticale 213: Versuchsstandort: Unterhatzendorf, Fachschule Hatzendorf Versuchsbeschreibung: Kulturführung allgemein: Anbau: Sorten: Winterweizen: Chevalier, 25 K/m²
Gülledüngung bei Winterweizen und Triticale 213: Versuchsstandort: Unterhatzendorf, Fachschule Hatzendorf Versuchsbeschreibung: Kulturführung allgemein: Anbau: Sorten: Winterweizen: Chevalier, 25 K/m²
Mechanische Zerkleinerung als Substratvorbehandlung zur Biogaserzeugung
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Mechanische Zerkleinerung als Substratvorbehandlung zur Biogaserzeugung Diana Andrade Johanna Barth Fabian Lichti Optimierung und Alternatives beim Substratinput
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Mechanische Zerkleinerung als Substratvorbehandlung zur Biogaserzeugung Diana Andrade Johanna Barth Fabian Lichti Optimierung und Alternatives beim Substratinput
Experiment Biomasse Arbeitsblatt
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Zum Thema Biomasse wird ein Vergärungs-Experiment durchgeführt. Dadurch kann die zukunftsweisende Technik optimal dargestellt und von den SuS nachvollzogen werden.
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Zum Thema Biomasse wird ein Vergärungs-Experiment durchgeführt. Dadurch kann die zukunftsweisende Technik optimal dargestellt und von den SuS nachvollzogen werden.
Welche Abfälle eignen sich zur Kofermentation in Faultürmen?
 Welche Abfälle eignen sich zur Kofermentation in Faultürmen? Dr.-Ing. Klemens Finsterwalder Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co.KG Bernau - 53 - - 54 - Zusammenfassung Zur Verbesserung der Ausnutzung
Welche Abfälle eignen sich zur Kofermentation in Faultürmen? Dr.-Ing. Klemens Finsterwalder Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co.KG Bernau - 53 - - 54 - Zusammenfassung Zur Verbesserung der Ausnutzung
Nährwerte und Konservierung von Powermaissilage
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Agroscope Nährwerte und Konservierung von silage Yves Arrigo Ueli Wyss 28. September 2016 www.agroscope.ch I gutes Essen, gesunde Umwelt
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Agroscope Nährwerte und Konservierung von silage Yves Arrigo Ueli Wyss 28. September 2016 www.agroscope.ch I gutes Essen, gesunde Umwelt
Organische Stickstoff-Düngung zu Feldsalat
 Organische Stickstoff-Düngung zu Feldsalat Einleitung Für optimale Erträge und Qualitäten muss Feldsalat in kurzer Zeit ausreichend mineralisierter Stickstoff zu Verfügung stehen. Im Jahr 2004 wurde im
Organische Stickstoff-Düngung zu Feldsalat Einleitung Für optimale Erträge und Qualitäten muss Feldsalat in kurzer Zeit ausreichend mineralisierter Stickstoff zu Verfügung stehen. Im Jahr 2004 wurde im
Noch viel Potenzial für die neue Anlagentechnik
 Biogas Noch viel Potenzial für die neue Anlagentechnik Biogasanlagen könnten in den nächsten Jahren einen deutlichen Aufschwung erleben. Warum, das hat ein Autorenteam* ) vom Landtechnik- Institut der
Biogas Noch viel Potenzial für die neue Anlagentechnik Biogasanlagen könnten in den nächsten Jahren einen deutlichen Aufschwung erleben. Warum, das hat ein Autorenteam* ) vom Landtechnik- Institut der
3. Norddeutsche Biogastagung Hildesheim
 3. Norddeutsche Biogastagung Hildesheim Vortrag: Prozesstechnische Kriterien bei der Nass- und Trockenfermentation Dipl.Agr.Biol. Michael Köttner, IBBK Internationales Auch eine Biogasanlage braucht
3. Norddeutsche Biogastagung Hildesheim Vortrag: Prozesstechnische Kriterien bei der Nass- und Trockenfermentation Dipl.Agr.Biol. Michael Köttner, IBBK Internationales Auch eine Biogasanlage braucht
Artenvielfalt mit Biogas
 BIOGAS Artenvielfalt mit Biogas Handliche Fakten zur Biogasnutzung Wissen_to go Biogas ist bunt... Biogas entsteht durch die Vergärung biogener Stoffe in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter, dem sogenannten
BIOGAS Artenvielfalt mit Biogas Handliche Fakten zur Biogasnutzung Wissen_to go Biogas ist bunt... Biogas entsteht durch die Vergärung biogener Stoffe in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter, dem sogenannten
Messungen zur Abbaukinetik von Einzelsubstraten und Substratmischungen
 Nils Engler, Michael Nelles Messungen zur Abbaukinetik von Einzelsubstraten und Substratmischungen Fachtagung Prozessmesstechnik an Biogasanlagen 25. und 26. März 2014 / Leipzig 27.03.2014 UNIVERSITÄT
Nils Engler, Michael Nelles Messungen zur Abbaukinetik von Einzelsubstraten und Substratmischungen Fachtagung Prozessmesstechnik an Biogasanlagen 25. und 26. März 2014 / Leipzig 27.03.2014 UNIVERSITÄT
DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE
 DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE Mehr Milch aus dem Grünland von Dipl.-HLFL-Ing. Josef Galler Das Dauergrünland verfügt über ein enormes Eiweißpotenzial. Auf heimischen Wiesen können 1.000 2.500 kg Rohprotein
DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE Mehr Milch aus dem Grünland von Dipl.-HLFL-Ing. Josef Galler Das Dauergrünland verfügt über ein enormes Eiweißpotenzial. Auf heimischen Wiesen können 1.000 2.500 kg Rohprotein
mittlere WS bis Silageernte ab Blüte
 Mais - Modellbeschreibung und Interpretationshilfe Anhand vorliegender Temperaturzeitreihen und beobachteter phänologischer Phasen werden Silage- und des Maises vorhergesagt. Diese Vorhersagen werden tabellarisch
Mais - Modellbeschreibung und Interpretationshilfe Anhand vorliegender Temperaturzeitreihen und beobachteter phänologischer Phasen werden Silage- und des Maises vorhergesagt. Diese Vorhersagen werden tabellarisch
Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.) Was kann der Praktiker erwarten?
 Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.) Was kann der Praktiker erwarten? M. Conrad, A. Biertümpfel Pflanzenporträt Botanik perennierender Korbblütler Rosette im Anpflanzjahr Wuchshöhe 2 bis 3 m,
Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.) Was kann der Praktiker erwarten? M. Conrad, A. Biertümpfel Pflanzenporträt Botanik perennierender Korbblütler Rosette im Anpflanzjahr Wuchshöhe 2 bis 3 m,
produktion hinsichtlich der Konstanz von Biogasqualität und -menge
 Schriftenreihe Umweltingenieurwesen Band 34 Dissertation Ralph Sutter Analyse und Bewertung der Einflussgrößen auf die Optimierung der Rohbiogas produktion hinsichtlich der Konstanz von Biogasqualität
Schriftenreihe Umweltingenieurwesen Band 34 Dissertation Ralph Sutter Analyse und Bewertung der Einflussgrößen auf die Optimierung der Rohbiogas produktion hinsichtlich der Konstanz von Biogasqualität
Ermittlung der Bewässerungswürdigkeit von für die energetische Nutzung in Betracht kommenden konventionellen und seltenen Arten (kurz: Artenvergleich)
 Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg - Außenstelle - Rheinstetten-Forchheim - Kutschenweg 20 76287 Rheinstetten Ermittlung der Bewässerungswürdigkeit von für die energetische Nutzung in
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg - Außenstelle - Rheinstetten-Forchheim - Kutschenweg 20 76287 Rheinstetten Ermittlung der Bewässerungswürdigkeit von für die energetische Nutzung in
Nitratmessdienst der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Teil 2 Nitratgehalte in der zweiten Messung gestiegen
 Nitratmessdienst der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Teil 2 Nitratgehalte in der zweiten Messung gestiegen Die Ergebnisse der zweiten Messung des Nitratmessdienstes in diesem Frühjahr liegen vor.
Nitratmessdienst der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Teil 2 Nitratgehalte in der zweiten Messung gestiegen Die Ergebnisse der zweiten Messung des Nitratmessdienstes in diesem Frühjahr liegen vor.
Möglichkeiten der Vergärung von Pferdemist in Biogasanalagen
 Möglichkeiten der Vergärung von Pferdemist in Biogasanalagen Weiterentwicklung von Technologien zur effizienten Nutzung von Pferdemist als biogener Reststoff und Dr. Hans Oechsner Landesanstalt für Agrartechnik
Möglichkeiten der Vergärung von Pferdemist in Biogasanalagen Weiterentwicklung von Technologien zur effizienten Nutzung von Pferdemist als biogener Reststoff und Dr. Hans Oechsner Landesanstalt für Agrartechnik
Amarant als Biogassubstrat
 Amarant als Biogassubstrat Nr. I 5/2009 Zusammengestellt von der Arbeitsgruppe I (Substratproduktion) im Biogas Forum Bayern von: Dr. Maendy Fritz Dr. Kathrin Deiglmayr Amarant als Biogassubstrat 1 Amarant
Amarant als Biogassubstrat Nr. I 5/2009 Zusammengestellt von der Arbeitsgruppe I (Substratproduktion) im Biogas Forum Bayern von: Dr. Maendy Fritz Dr. Kathrin Deiglmayr Amarant als Biogassubstrat 1 Amarant
Biogas aus Gras wir stehen noch am Anfang
 Biogas aus Gras wir stehen noch am Anfang Dr. Antje Priepke und Dr. Heidi Jänicke, LFA MV, IfT Dummerstorf, 7. Seminar Futterproduktion 1. März 2012 Hintergrund Mais = bedeutsamste Biogaskultur zunehmend
Biogas aus Gras wir stehen noch am Anfang Dr. Antje Priepke und Dr. Heidi Jänicke, LFA MV, IfT Dummerstorf, 7. Seminar Futterproduktion 1. März 2012 Hintergrund Mais = bedeutsamste Biogaskultur zunehmend
Pflanzen als Biogassubstrat Wann ernten?
 Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung e.v. (LVAT) Pflanzen als Biogassubstrat Wann ernten? Gunter Ebel, LVAT Groß Kreutz und LELF Christiane Herrmann, ATB Fachveranstaltung Energiepflanzen,
Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung e.v. (LVAT) Pflanzen als Biogassubstrat Wann ernten? Gunter Ebel, LVAT Groß Kreutz und LELF Christiane Herrmann, ATB Fachveranstaltung Energiepflanzen,
Biogasproduktion Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung aus landwirtschaftlicher Perspektive
 Biogasproduktion Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung aus landwirtschaftlicher Perspektive Mathias Jung M.Sc. Agrarökonomik Agro-Farm GmbH Nauen Betriebsleitung Pflanzenbau und Biogas 1 Gliederung 1.
Biogasproduktion Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung aus landwirtschaftlicher Perspektive Mathias Jung M.Sc. Agrarökonomik Agro-Farm GmbH Nauen Betriebsleitung Pflanzenbau und Biogas 1 Gliederung 1.
Parameter für die Steuerung und Optimierung landwirtschaftlicher Biogasanlagen
 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Parameter für die Steuerung und Optimierung landwirtschaftlicher Biogasanlagen DR. G. REINHOLD Leipziger Biogas-Fachgespräch 2003/2004 "Steuerung von Biogasprozessen
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Parameter für die Steuerung und Optimierung landwirtschaftlicher Biogasanlagen DR. G. REINHOLD Leipziger Biogas-Fachgespräch 2003/2004 "Steuerung von Biogasprozessen
2012 mit guter Grassilage Kraftfutter sparen
 1 2012 mit guter Grassilage Kraftfutter sparen Auch 2012 wurden wieder gute Grassilage-Qualitäten erreicht; allerdings nicht in allen Teilen Bayerns. Rund 2300 Proben aus dem ersten und 2100 Proben aus
1 2012 mit guter Grassilage Kraftfutter sparen Auch 2012 wurden wieder gute Grassilage-Qualitäten erreicht; allerdings nicht in allen Teilen Bayerns. Rund 2300 Proben aus dem ersten und 2100 Proben aus
Saatdichte-Versuch: Wintergerste Grangeneuve
 Kantonale Station für Tierproduktion und Pflanzenbau Versuchsbericht 2007 -Versuch: Wintergerste Grangeneuve 2006-2007 Grangeneuve, Juli 2007 Sandra Dougoud Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve Kantonale
Kantonale Station für Tierproduktion und Pflanzenbau Versuchsbericht 2007 -Versuch: Wintergerste Grangeneuve 2006-2007 Grangeneuve, Juli 2007 Sandra Dougoud Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve Kantonale
Assimilationsbelichtung mit LED hat Auswirkungen auf das Wachstum von Hedera helix
 Die Ergebnisse kurzgefasst Durch die Belichtung der Hedera mit LED einzelner Spektralfarben oder einer Mischung aus diesen, konnte ein kompakterer Wuchs erzielt werden im Vergleich zur Belichtung mit Natriumdampf-
Die Ergebnisse kurzgefasst Durch die Belichtung der Hedera mit LED einzelner Spektralfarben oder einer Mischung aus diesen, konnte ein kompakterer Wuchs erzielt werden im Vergleich zur Belichtung mit Natriumdampf-
Fruchtfolgeversuch unter den Bedingungen des Ökologischen Landbaus 2011
 Fruchtfolgeversuch unter den Bedingungen des Ökologischen Landbaus 211 Einleitung / Fragestellung Es wird der Einfluss von differenzierter Fruchtfolgegestaltung und Nährstoffversorgung auf die Erträge
Fruchtfolgeversuch unter den Bedingungen des Ökologischen Landbaus 211 Einleitung / Fragestellung Es wird der Einfluss von differenzierter Fruchtfolgegestaltung und Nährstoffversorgung auf die Erträge
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag, Unkrautunterdrückung und Standfestigkeit von Wintererbsen 2014
 Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag, Unkrautunterdrückung und Standfestigkeit von Wintererbsen 2014 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Einfluss von Saatstärke und Gemengepartner auf Ertrag, Unkrautunterdrückung und Standfestigkeit von Wintererbsen 2014 Einleitung Im ökologischen Landbau wird seit einiger Zeit über den Anbau von Winterkörnerleguminosen
Wie viel Stickstoff braucht der Mais?
 Wie viel Stickstoff braucht der Mais? Unterschiedliche N min -Gehalte in den Regierungsbezirken bei der Planung berücksichtigen Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 14/2018
Wie viel Stickstoff braucht der Mais? Unterschiedliche N min -Gehalte in den Regierungsbezirken bei der Planung berücksichtigen Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 14/2018
Faktoren zum Erfolg im Zuckerrübenbau Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz
 Faktoren zum Erfolg im Zuckerrübenbau Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz Aussaat Neben einer guten Saatbeetvorbereitung ist die Aussaat der nächste wichtige Schritt zum Erfolg im Zuckerrübenbau. Daß die
Faktoren zum Erfolg im Zuckerrübenbau Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz Aussaat Neben einer guten Saatbeetvorbereitung ist die Aussaat der nächste wichtige Schritt zum Erfolg im Zuckerrübenbau. Daß die
Biomasseanbau in Deutschland - Standpunkte und Positionen
 M. Renger DRL Koppelweg 3 37574 Einbeck Biomasseanbau in Deutschland - Standpunkte und Positionen Der Anbau von Energiepflanzen bietet die Chance boden- und umweltschonende Anbauverfahren zu entwickeln
M. Renger DRL Koppelweg 3 37574 Einbeck Biomasseanbau in Deutschland - Standpunkte und Positionen Der Anbau von Energiepflanzen bietet die Chance boden- und umweltschonende Anbauverfahren zu entwickeln
Analyse und Optimierung neuer Biogasanlagen
 Analyse und Optimierung neuer Biogasanlagen Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik K. Hopfner-Sixt Inhalt Ökostromgesetz bietet den rechtlichen Rahmen für eine zukunftsweisende
Analyse und Optimierung neuer Biogasanlagen Department für Nachhaltige Agrarsysteme Institut für Landtechnik K. Hopfner-Sixt Inhalt Ökostromgesetz bietet den rechtlichen Rahmen für eine zukunftsweisende
Versuchsergebnisse aus Bayern
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2005 Düngewirkung von entwässertem Klärschlamm Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern Herausgeber: Bayerische
Versuchsergebnisse aus Bayern 2005 Düngewirkung von entwässertem Klärschlamm Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern Herausgeber: Bayerische
Gärtests für nachwachsende Rohstoffe Probleme der VDI-Richtlinie und mögliche Lösungen
 Hochschule Anhalt (FH) Gärtests für nachwachsende Rohstoffe Probleme der VDI-Richtlinie und mögliche Lösungen Jan-Henryk Listewnik Hochschule Anhalt (FH) Köthen Prof. Dr. Reinhard Pätz Hochschule Anhalt
Hochschule Anhalt (FH) Gärtests für nachwachsende Rohstoffe Probleme der VDI-Richtlinie und mögliche Lösungen Jan-Henryk Listewnik Hochschule Anhalt (FH) Köthen Prof. Dr. Reinhard Pätz Hochschule Anhalt
Optimierung der Biogaserzeugung aus den Energiepflanzen Mais und Kleegras Biogas production from the energy crops maize and clover grass
 Institut für Land-, Umweltund Energietechnik Universität für Bodenkultur Wien A-1190 Wien, Nussdorfer Lände 29-31 Tel: +43 1 3189877-92 e-mail: amon@boku.ac.at Optimierung der Biogaserzeugung aus den Energiepflanzen
Institut für Land-, Umweltund Energietechnik Universität für Bodenkultur Wien A-1190 Wien, Nussdorfer Lände 29-31 Tel: +43 1 3189877-92 e-mail: amon@boku.ac.at Optimierung der Biogaserzeugung aus den Energiepflanzen
Biogasertrag und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Substratvorbehandlung mittels Querstromzerschneider
 Biogasertrag und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Substratvorbehandlung mittels Querstromzerschneider Referent: Oliver Wulff 16.12.2015 Anlagenbeschreibung BGA Anlagendaten/-informationen Speicher-Durchfluss-Verfahren
Biogasertrag und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Substratvorbehandlung mittels Querstromzerschneider Referent: Oliver Wulff 16.12.2015 Anlagenbeschreibung BGA Anlagendaten/-informationen Speicher-Durchfluss-Verfahren
Grassilagen 2013 deutliche Unterschiede zu den Vorjahren
 1 Grassilagen 2013 deutliche Unterschiede zu den Vorjahren Rund 2800 Futterproben vom ersten und 1800 Proben von Folgeschnitten zeigen große Unterschiede nicht nur zwischen oberen und unteren n, sondern
1 Grassilagen 2013 deutliche Unterschiede zu den Vorjahren Rund 2800 Futterproben vom ersten und 1800 Proben von Folgeschnitten zeigen große Unterschiede nicht nur zwischen oberen und unteren n, sondern
Ganzpflanze als Biogassubstrat Getreide, Mais und Hirsen im Vergleich
 LLFG Sachsen-Anhalt, Vortragstagung Pflanzenbau aktuell am 27.01.2010 in Bernburg-Strenzfeld Dr. agr. Lothar Boese Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Sachsen-Anhalt, Zentrum
LLFG Sachsen-Anhalt, Vortragstagung Pflanzenbau aktuell am 27.01.2010 in Bernburg-Strenzfeld Dr. agr. Lothar Boese Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Sachsen-Anhalt, Zentrum
Gräser in Biogasanlagen - erste Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen
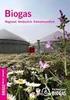 Workshop Futterpflanzen Perspektiven für die energetische Nutzung 9. 3. 2006 Gräser in Biogasanlagen - erste Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen Dr. F.-F. Gröblinghoff Prof. Dr. N. Lütke Entrup Einleitung
Workshop Futterpflanzen Perspektiven für die energetische Nutzung 9. 3. 2006 Gräser in Biogasanlagen - erste Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen Dr. F.-F. Gröblinghoff Prof. Dr. N. Lütke Entrup Einleitung
Alternative Pflanzen zu Mais für die Biogaserzeugung
 Alternative Pflanzen zu für die Biogaserzeugung in Obgrün bei Fürstenfeld und in Hafendorf bei Kapfenberg (FS-Hafendorf) - 1-jährig (geschrieben von Dr. Karl Mayer, LK Steiermark) Bis dato sind die Trockenmasseerträge
Alternative Pflanzen zu für die Biogaserzeugung in Obgrün bei Fürstenfeld und in Hafendorf bei Kapfenberg (FS-Hafendorf) - 1-jährig (geschrieben von Dr. Karl Mayer, LK Steiermark) Bis dato sind die Trockenmasseerträge
Stickstoffdüngung mit Ackerbohnenschrot zu Kartoffeln
 A. Paffrath, Landwirtschaftskammer Rheinland, Endenicher Allee, 53115 Bonn, 228/73-1537, Fax: (228) 73-8289 Stickstoffdüngung mit Ackerbohnenschrot zu Kartoffeln - Versuchsbeschreibung - Versuchsfrage:
A. Paffrath, Landwirtschaftskammer Rheinland, Endenicher Allee, 53115 Bonn, 228/73-1537, Fax: (228) 73-8289 Stickstoffdüngung mit Ackerbohnenschrot zu Kartoffeln - Versuchsbeschreibung - Versuchsfrage:
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle für Bildung und Forschung Versuchsberichte
 LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle für Bildung und Forschung Versuchsberichte Seite 1 Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsregler- und Fungizidvarianten
LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle für Bildung und Forschung Versuchsberichte Seite 1 Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsregler- und Fungizidvarianten
Nachhaltige Landwirtschaft mit. Ihre landwirtschaftliche Genossenschaft für Tierzucht und Beratung in Lux
 Nachhaltige Landwirtschaft mit Ihre landwirtschaftliche Genossenschaft für Tierzucht und Beratung in Luxemburg ibtes Ertrags-undQualitätsunterschiedeaufGrundder Düngung? GrundfutteranalysenimLAKU-Gebiet
Nachhaltige Landwirtschaft mit Ihre landwirtschaftliche Genossenschaft für Tierzucht und Beratung in Luxemburg ibtes Ertrags-undQualitätsunterschiedeaufGrundder Düngung? GrundfutteranalysenimLAKU-Gebiet
Kleine Biogasanlagen auf was muss man achten?
 Kleine Biogasanlagen auf was muss man achten? Dr. Andreas Lemmer der Universität Hohenheim 13. 14. Januar 2016 Messegelände Ulm Besonderheiten der Güllevergärung Zusammensetzung der Gülle Biomasse (Nachwachsende
Kleine Biogasanlagen auf was muss man achten? Dr. Andreas Lemmer der Universität Hohenheim 13. 14. Januar 2016 Messegelände Ulm Besonderheiten der Güllevergärung Zusammensetzung der Gülle Biomasse (Nachwachsende
