Heute in Gang setzen, was uns morgen bewegt
|
|
|
- Hartmut Becke
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gymnasium Puchheim Kurs erneuerbare Energien Heute in Gang setzen, was uns morgen bewegt Die elektrische Versorgung eines Automobils mit einer Brennstoffzelle 1
2 Die Autoren: Andreas Eger Florian Heiß Manuel Fluck Marius Becker Max Grass Max Konrad Maximilian Schlehlein Michael Hörlein Peer Borries Philip Küfmann Philipp Stephan Sabine Konzack Thomas Bodendorfer Betreuende Lehrkräfte: Dr. Walter Bube Nils Fischer In Zusammenarbeit mit: Andreas Klugescheid BMW Group Konzernkommunikation und Politik Technologiekommunikation Dipl.-Ing. Wolfgang Burmeister Ingenieur VDI Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit H 2 -Projekt-Flughafen München Im Besonderen: Herr Bruno Trost Geschäftsleiter bei AirCool - Kälte und Klimatechnik 2
3 Vorwort Die gegenwärtige Energieversorgung basiert überwiegend auf erschöpfbaren, fossilen Primärenergieträgern. Die zukünftige Energieversorgung hat als Primärenergieträger nur noch Kohle, Kernenergie, Sonnen- und Windenergie zur Verfügung. Mineralölprodukte und Erdgas müssen durch andere, speziell synthetische Sekundärenergieträger, wie zum Beispiel Wasserstoff, ersetzt werden. Tatsachen wie beschleunigtes Menschheitswachstum, damit steigendem Energieverbrauch, absehbare Ressourcenknappheit bei Öl, Kohle und Gas, der Klimabeeinflussung usw., weisen darauf hin, dass es zu einem Wandel kommen muss. Die gegenwärtige Kohlen-Wasserstoff- Energiewirtschaft muss in eine Wasserstoff-Energie-wirtschaft umgewandelt werden. Weltweit hat die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Politik dieses Signal erkannt. Aus dem Modewort Wasserstoff ist ein Realer Begriff geworden. Projekte in aller Welt, ob im mobilen Bereich, in der Energiewirtschaft oder in der chemischen Industrie sind gestartet und sind seit Jahren erfolgreich im Testbetrieb. Die vorliegende Arbeit einer Schülergruppe zeigt auf, dass diese Thematik für die Erhaltung einer Lebensqualität in den nächsten Generationen wichtig genug erscheint um sich heute damit zu befassen. Es ist auch nicht wichtig, sich heute mit der Problematik, ob man im mobilen Bereich einen Verbrennungsmotor oder eine Brennstoffzelle bevorzugt, auseinander zu setzen, wichtig ist, dass man an der Einführung der Wasserstofftechnologie arbeitet. Man sollte nie vergessen das Jules Verne in seinem Roman Die geheimnisvolle Insel bereits 1874 warnend sagte: Was ist, wenn eines Tages das köstliche Mineral die Kohle am Ende ist?, worauf sein Ingenieur antwortete: Dann heizen wir mit Wasser, Wasser, jedoch zerlegt in seine chemischen Elemente, Wasserstoff und Sauerstoff! Abschließend möchte ich Ihnen mit Ihrer hervorragenden Arbeit viel Glück wünschen. Bleiben sie an der Thematik, denn die Weiterentwicklung der Wasserstoffspeicherund Transporttech-nik wartet auf Ihre Generation, Begriffe wie: Carbon Nanotubes, 800 bar Speichertechnik, die Einführung der Wasserstoff Energiewirtschaft, Begriffe wie Hydrogen Now, usw. werden Ihren beruflichen Weg begleiten. Wolfgang Burmeister Leiter für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der ARGEMUC München, 10. Juni
4 Kapitel I: Unsere praktische Arbeit 5 Kapitel II: Der theoretische Hintergrund 12 Seite Kapitel III: Zusammenfassung der Abschlusspräsentation 47 4
5 Kapitel I Unsere praktische Arbeit 5
6 Der am Gymnasium Puchheim angebotene Kurs "Regenerative Energiequellen" wurde an unserer Schule entwickelt und seit 1990 im Rahmen des Ergänzungsprogramms der Kollegstufe auch als Wahlunterricht angeboten. In handlungsorientierten Unterrichtsprojekten werden dabei verstärkt Eigeninitiative, Kreativität, selbständiges Lernen und Teamfähigkeit gefördert, aber auch einfache handwerkliche Arbeitstechniken erlernt. Ein Ziel ist es auch, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, von denen man ansonsten nur am Rande etwas erfährt. Im Rahmen dieses Kurses besuchten wir im Januar dieses Jahres die Wasserstofftankstelle am Münchner Flughafen, wo uns erstmals hautnah diese doch schon relativ weit entwickelte Technologie vorgestellt wurde. Dieses Ereignis weckte im gesamten Kurs den Wunsch, sich näher mit der Wasserstofftechnologie zu beschäftigen und es zum Thema für den FOCUS Schülerwettbewerb zu machen. Wir haben uns durch das Internet, Literatur, Exkursionen und unseren Coach Herrn Burmeister gründlich über die Möglichkeiten der Wasserstofftechnologie informiert und die technischen, wirtschaftlichen, physikalischen und chemischen Grundlagen der Wasserstofftechnik in einem theoretischen Teil zusammenfassend dargestellt (Kapitel II). Hier haben wir auch schon gezeigt, das sich die Wasserstofftechnologie über kurz oder lang gegen die fossilen Konkurrenten durchsetzten wird. Doch das allein hat uns nicht genügt: Wir wollen an einem selbst konzipierten Modellauto in der Praxis die Möglichkeiten der Wasserstofftechnik ausprobieren und analysieren. Wir haben dafür die elektrische Versorgung des Bordnetzes mit einer Brennstoffzelle ausgewählt. Als elektrischer Verbraucher ist neben der Beleuchtung auch eine Modellklimaanlage vorgesehen. Gegenüber der üblichen elektrischen Versorgung des Bordnetzes über einen Generator und eine Batterie benötigt das System mit der Brennstoffzelle weniger Energie, emittiert weniger Schadstoffe und spart Gewicht. Schwerpunkt unserer Teamarbeit ist es, das Modellauto mit den nötigen Komponenten aufzubauen und daran exemplarisch die Wasserstofftechnik zu demonstrieren. Die Entwicklung, Dimensionierung und die Analyse unseres Modellsystems ist im folgenden Text dargestellt. Wir haben neben unserem Partner, der BMW Group, noch mehr Verstärkung geholt: unter anderem die Firmen aircool, National Instruments, Shell und Conrad Electronik. Abb.1: erste Skizze des Modells Über unseren Besuch an der Münchner H 2 Tankstelle entwickelte sich ein Kontakt zur BMW Group, die sich neben anderen Unternehmen mit der Wasserstofftechnologie befasst. Im Vorfeld hat sich die gesamte Gruppe zweimal mit Herrn Klugescheid von der BMW Group (Unternehmensbereich Technologiekommunikation Clean Energy) getroffen, um gemeinsam ein Konzept für die Projektarbeit zum Schülerwettbewerb zu erarbeiten. Nach dem ersten Treffen am einigten wir uns auf das obige Konzept. Wir werden in der Endphase ab Mitte Juni mit einem 50W Brennstoffzellenstack experimentieren, das uns von der BMW Group leihweise zur Verfügung ge- 6
7 stellt wird. Unsere Vorversuche haben wir mit kleineren Systemen durchgeführt. Dazu haben wir uns auf drei Teams verteilt, um effizienter arbeiten zu können. Gruppe 1: Elektrolyse und Brennstoffzelle Die erste Gruppe beschäftigte sich während der nächsten Wochen mit einem Elektrolyse-Gerät und einer Brennstoffzelle. Diese beiden doch recht kostspieligen Komponenten wurden von der Shell AG gestellt. Der PEM-Elektrolyseur arbeitet bei einer Spannung von 2V. Bei einer eingespeisten elektrischen Leistung von 3,6W entstehen 100ml Wasserstoff und die halbe Menge an Sauerstoff in einem Zeitraum von 10 Minuten. Der so entstandene Wasserstoff enthält eine Energie von 1kJ. Wenn man von der Umrechnung auf Normalbedingungen absieht, beträgt der Wirkungsgrad der E- lektrolyse ca. 58%. Um diesen Vorgang noch regenerativ ablaufen zu lassen haben wir uns entschlossen, den Elektrolyseur nicht mit Strom aus der Steckdose, sondern aus der von Shell mitgelieferten und später vielleicht noch mit der schuleigenen Solaranlage zu betreiben. Die erstere liefert mit ihrer Fläche von 225cm 2 und dem Wirkungsgrad von 58% bei einer mittleren Sonneneinstrahlung von ca. 500 W/m 2 eine elektrische Leistung von 2W. Bei einem Wirkungsgrad der Elektrolyse von ca. 50% braucht man für die Erzeugung von 100cm 3 Wasserstoff knapp 20min, wenn man die (im theoretischen Teil angegebene) Reaktionsenthalpie von 12,8 kj/dm 3 ansetzt. Nachdem wir den Wasserstoff nun hergestellt hatten, stellte es sich als problematisch heraus, diesen mit einem Druck von ca. 12bar, den die Brennstoffzelle benötigt, in spezielle Tanks abzufüllen. Die erste Idee war, den Wasserstoff durch einen Kompressor unter Druck zu setzten und dann abzufüllen. Mit dem schuleigenen Kompressor war dies leider nicht durchführbar, und da wir keinen erschwinglichen und dafür geeigneten Kompressor im Einzelhandel gefunden haben, haben wir eine andere Lösung für dieses Problem gesucht und nach einigen Nachforschungen auch gefunden. Dabei handelt es sich um das Prinzip der elektrochemischen Verdichtung von Wasserstoff, was bedeutet, dass der Wasserstoff mit einem speziellen druckfeste Elektrolyseur hergestellt wird, und so H 2 direkt mit bis zu 30bar liefert. Für dieses Gerät haben wir schon einen Kontakt geknüpft der uns dieses vielleicht auch zur Verfügung stellt. Doch dazu dann bei unser Präsentation mehr. Als Brennstoffzelle standen uns zunächst nur kleine PEM Zellen mit einer elektrischen Leistung von 1W zur Verfügung. Um den Verlauf der Leistung bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen zu analysieren, nahmen wir eine Kennlinie auf (Abb.2). Kennlinie B renstoffzelle 4 Da wir diese Brennstoffzelle jedoch 3 nur mit Luftsauerstoff statt, einem separatem O 2 Tank betrieben haben, 2 um Geld und Platz für einen eigenen 1 Sauerstofftank einzusparen, ergab sich 0 erwartungsgemäß eine niedrigere Leistung im Bereich von etwa 100mW, Strom I in ma Die folgende Kennlinie (Abb. 3) zeigt, Abb. 2 wie sich die elektrische Leistung der Brennstoffzelle mit der Belastung (höhere Stromstärke I) verändert: Spannung U in V 7
8 Leistung P in mw 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Zum einen sinkt die Spannung und somit auch die Leistung bei zunehmender Stromstärke. 40,0 Jedoch ist die Leistung auch bei der 20,0 Parallelschaltung der 4 vorhandenen Brennstoffzellen zu gering, um 0, Strom I in ma Beleuchtung und das Kühlsystem des Modellautos zu betreiben. Die Abb. 3 Gruppe setzte sich deshalb erneut mit BMW in Verbindung und schaffte es, dass die Ingenieure von BMW uns nun ab Mitte Juni ein Brennstoffzellenstack mit einer maximalen Leistung von 50W für einen Zeitraum von einem Monat leihweise zur Verfügung stellen. Damit konnten wir ein leistungsfähiges Kühlsystem als Modellklimaanlage entwerfen. Abb.4: Firma aircool Gruppe 2: Modellklimaanlage Die zweite Gruppe beschäftigte sich mit dem geplanten Kühlsystem. Dabei war zunächst ein Peltierelement vorgesehen, da diese sehr klein und billig sind, eine für unsere Zwecke vernünftige Kühlleistung haben und auch in jedem Fachhandel zu erwerben sind. Für die Vorversuche beschafften wir uns ein Element und betrieben dies mit einer elektrischen Leistung von 10W und bauten eine Probekammer aus Styropor, die damit gekühlt wurde. Das Peltierelement wurde mit einer Spannung von 6V und einer Stromstärke von 1,6A betrieben. Über einen Flächenkühler wurde mittels eines Ventilators (PC Lüfter) die Abwärme abgeführt. Es gelang damit, den Proberaum von ca. 1000cm3 auf einer Temperatur von 15 C zu halten. Ungünstig für unsere Zwecke ist die geringe thermische Trennung beim Peltierelement: Die kalte und die warme Seite des Elements liegen zu nahe beieinander, d.h. es war uns nicht möglich, die Wärme von der einen Seite des Elements so effizient abzuleiten, dass sie nicht den zu kühlenden Raum aufheizte. Zudem ist der Wirkungsgrad mit sehr niedrig. Ein solches System wäre außerdem nicht zum Vergleich mit den realen Klimaanlagen im Kfz-Bereich geeignet, da dort eine Kältemaschine mit einem Verdichter und Wärmetauschern arbeitet. Verdampfer und Kondensator können bei einer Kältemaschine weit voneinander getrennt eingebaut werden. Das Team führte Recherchen (Internet, Branchenbücher...) durch und fand schließlich bei der Münchner Firma aircool einen geeigneten Partner für die Konzeption einer solchen Kältemaschine. Der Geschäftsführer, Herr Trost, zeigte sich bei einer ersten Besprechung in Puchheim sehr aufgeschlossen gegenüber unserem Projekt und erklärte sich zur Kooperation mit den Schülern bereit. Komponenten von geringer Größe und mit einem kleinen Kälteleistungsbereich, wie wir sie für das Modellauto benötigten, mussten allerdings zunächst gesucht werden. 8
9 Herr Trost lud die Gruppe am zu einer Besprechung in die Firma im Münchner Gewerbegebiet Riem ein. Er hatte bereits einen kleinen Verdichter sowie einen Wärmetauscher (Abb. 5) besorgt und hatte für alle Schüler Datenblätter und Kennlinienblätter bereit gestellt anhand derer er die Funktionsweise und die BesonderheiAbb.5 ten einer Kältemaschine mit Verdichter deutlich machte. Nach dieser interessanten Einführung wurden der Verdichter und der Kondensators anhand der vorgegebenen Betriebsdaten zusammen mit Herrn Trost in der Theorie dimensioniert. Dabei arbeiteten wir mit einem zunächst noch ungewohnten Kennliniendiagramm (Enthalpie/ Druck), das uns bereits zu Beginn ausgeteilt worden war. Bei einem kleinen Verdichter, wie wir ihn benötigen, galt es zunächst Betriebsbedingungen zu finden, die eine kleine Leistung mit einem vernünftigen Wirkungsgrad verbinden. Aus dem uns ebenfalls zur Verfügung gestellten Datenblatt des Danfoss Verdichters wurde eine Verdampfungstemperatur von -15 C gewählt, da die zugehörige Kühlleistung von ca. 44W bei einer elektrischen Leistung von ca. 34W gut zu unserem 50W Brennstoffzellenstack passt. Dabei läuft der Verdichter bereits auf der niedrigsten Drehzahl von 2000 rpm. Kleinere Verdampfungstemperaturen würden den Wirkungs- Abb.6: Dimensionierung der Klimaanlage anhand der Kennlinie grad deutlich verschlechtern. Für den Verdampfungsprozess wurde im Diagramm für das Kältemittel 134a die Linie bei -15 C vom flüssigen Aggregatzustand durch das Gebiet des gesättigten Dampfes bis in das Gebiet des Gaszustandes eingezeichnet. 9
10 Eine Überhitzung bis auf -10 C muss einberechnet werden, damit dem Verdichter nur Gas und keine Flüssigkeitsanteile zugeführt werden, da ansonsten Schäden durch die inkompressible Flüssigkeit auftreten können. Als Temperatur für den Kondensator wurde 50 C gewählt und die horizontale Linie für den Prozess bis 48 C gezeichnet (2 C unterkühlt). Aus dem Diagramm ergab sich dann für den Verdampfungsprozess eine Enthalpie von ca. 125kJ auf der x-achse. Bei dieser Energie erhalten wir eine Kühlleistung von ca. 44W. Der aufgewendeten elektrischen Leistung von 34 W entspricht eine Energie von ca. 96 kj. Addiert man diese in horizontaler Richtung, ergibt sich die schräg nach oben laufende Linie für den Verdichtungsprozess, die den erwartungsgemäß nicht-idealen Wirkungsgrad ausdrückt. Das Team überlegte anhand des mitgebrachten Modellautos, wie die Einzelkomponenten untergebracht werden können. Herr Trost prüft derzeit in seiner Firma, wie weit Abmessungen von Kondensator und Verdampfer minimiert werden können. Am Freitag, den trifft sich die Gruppe wieder bei aircool, um die Verbindungen zu löten, die Anlage mit dem Kältemittel zu füllen und schließlich ausgiebig zu testen. Abb.7 Gruppe 3: LavView Vom bis zum nahmen 4 Schüler aus dem Team an einem Informatikkurs unter Leitung von Herrn Fischer in der Schule teil. Wir beschäftigten uns innerhalb des Kurses mit LabVIEW, einer Entwicklungsumgebung wie professionelle C oder Pascal Systeme. Die mit LabVIEW erstellten so genannten virtuellen Instrumente werden in der Industrie in unterschiedlichsten Bereichen verwendet. LabVIEW unterscheidet sich von den gängigen Programmen, die in Schulen zur Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Messungen eingesetzt werden, da es im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen mit seiner grafischen Programmieroberfläche (s. Abb.1) leicht an unterschiedlichste Aufgaben angepasst werden kann. Die strukturierte, bedienerfreundliche und vielseitig nutzbare Entwicklungsumgebung bietet für den Einsatz an Schulen vielfältige Möglichkeiten. Mit Hilfe dieses Programms wollen wir Messwerte wie Spannung und Druck erfassen und die gemessenen Größen in Form von Diagrammen auswerten. Für die Aufnahme der Messwerte gibt es gängige Interfacekarten von National Instruments, aber auch Entwicklungen für schultypische Hardwareausstattungen, die wir ebenfalls demnächst bei Nachfrage erhalten werden. 10
11 Abb.8 Beispiel eines selbst erstellten Programms (Frontpanel und Blockdiagramm) Gruppe 3: Wasserstofftank Die letzte Gruppe beschäftigte sich mit verschiedenen Möglichkeiten den Wasserstoff für die Brennstoffzelle zu speichern. Obwohl bei der von BMW gestelltem Brennstoffzellenstack zwei Hydridspeicher dabei sind, entschied das Team, diese zwei Speicher auszubauen und durch Drucktanks zu ersetzen. Der Grund für diesen Beschluss war die Nichtübertragbarkeit der Metallhydritspeicher auf die Praxis, da diese für den Betrieb im Auto viel zu schwer sind. Also machte sich das Team ans organisieren brauchbarer Tanks, was sich als relativ schwierig erwies, da kleine Wasserstofftanks in der Praxis noch fast keine Anwendung haben. Nach eineigen Nachforschungen kam das Team an die Firma Messer Griesheim, von der wir schließlich zwei Druckdosen gekauft haben, die 12l H 2 bei einem Druck von 12bar speichern konnten und diesen auch gleich enthielten. Dazu kamen dann noch ein Barometer und ein Durchflussmesser, um zu messen, wie viel Wasserstoff verbraucht wird, damit wir ihn später zur elektrischen Leistung ins Verhältnis setzten können. Der Nachteil dieser Tanks war jedoch, dass sie nicht nachfüllbar waren, was uns aber zu dem Zeitpunkt egal war, da es sonst keine geeigneten Wasserstoffflaschen zu erwerben gab. Erst später erfuhren wir von der Firma B.E.S.T. Ventil + Fitting GmbH, die auch nachfüllbare Modelle vertreibt. Also setzten wir uns auch hier wieder mit der Firma in Kontakt und sind auch gegenwärtig noch dabei die Tanks zu erwerben. In den nächsten Wochen bis zur Präsentation am werden wir alle Komponenten, die wir schon haben bzw. noch organisieren müssen, zusammenbauen. In der Endphase des Projekts werden wir schließlich noch das Modell optimieren, Messwerte erfassen und diese auswerten, um ihnen bei der Präsentation unsere Eindrücke und Ergebnisse über die Wasserstofftechnologie darstellen zu können. 11
12 Kapitel II Der theoretische Hintergrund 12
13 Inhalt: 1. Einleitung Welche Chance hat Wasserstoff als Energieträger? 16 Ein Vergleich 3. Wie gewinnt man Wasserstoff? Organische Ausgangsstoffe Großtechnische Möglichkeiten Wasserstofferzeugung direkt im Kfz Elektrolyse von Wasser Wo kann Wasserstoff eingesetzt werden? Allgemeiner Überblick H 2 in der Raumfahrt H 2 -betriebene Triebwerke für Flugzeuge Kraftwerksbetrieb mit H Hausinterne Stromversorgung mit H H 2 -Autos und Busse Wasserstoff als zukunftsfähiger Energieträger in Kraftfahrzeugen H 2 im Verbrennungsmotor Brennstoffzelle und Elektroantrieb Die APU-Technologie Die Brennstoffzelle als Stromversorger für Kleingeräte Die Brennstoffzelle - die direkte Wandlung von Seite 13
14 Wasserstoff in Strom Wie sie entstand Wie sie funktioniert Die Handhabung von Wasserstoff Speicherung von Wasserstoff Sicherheit von Flüssigwasserstoff-Tanks Die Wasserstofftankstelle Zukunftsvisionen - die Pläne von BMW Anhang Tabellen und Bilder Quellenangaben 45 14
15 1. Einleitung In nahezu allen Verkehrsprognosen wird angenommen, dass die Fahrleistungen bis zum Jahr 2010 weiter ansteigen. 1 (siehe auch Abbildung 2)Im Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz, das am 22. März 2002 vom Bundestag ratifiziert wurde, hat sich Deutschland allerdings verpflichtet, die landesweite CO 2 Emission bis 2012 um 21% im Vergleich zu 1990 zu verringern. 2 In Folge Dessen setzen viele Politiker auf eine verstärkte Förderung der Entwicklung schadstoffarmer Verkehrsmittel. Die Automobilindustrie muss auf die verstärkte Nachfrage nach emissionsarmen, aber vor Allem sparsamen Fahrzeugen reagieren. Sie arbeitet insofern hart an sogenannten Low Emission Modellen. Dabei wird versucht, den Verbrennungsmotor immer weiter zu optimieren und somit den Schadstoffausstoß zu minimieren. Diese Entwicklung wird jedoch über kurz oder lang an ihre Grenzen stoßen, da die verwendeten Materialien und Produktionsmechanismen immer teuerer werden, und der bestmögliche Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren durch eine einfache physikalische Formel begrenzt ist. 3 Darüber hinaus muss man noch mechanische Verluste, die durch die Kolbenbewegung und -beschleunigung, durch Ladungswechsel, Undichtheit, so wie Thermische Verluste und solche, die durch unvollständige Verbrennung entstehen 4, mit einberechnen. Somit liegt momentan der höchste Wirkungsgrad von Ottomotoren bei knapp 34% (zum Beispiel: BMW 6 Zyl. 4 Vent. 2,8l 33,5%, Mercedes V8 Zyl. 3 Vent. 5,0l 33,5%, Mitsubishi 4 Zyl 4 Vent. 1,8 l 32,1%) 5. Der durchschnittliche Wirkungsgrad im europäischen Fahrzyklus, bei dem dann reelle Bedingungen herrschen, liegt dann aber nur noch bei etwa 20% 6. An diesen Daten wird sich wegen der oben genannten Grenzen so auch nicht mehr viel ändern. Ausserdem ist es nur eine Frage der Zeit, bis fossile Brennstoffe wie Benzin aufgrund von Verknappung zu teuer für den Verbraucher werden und damit den herkömmlichen Verbrennungsmotor unrentabel machen. Für eine nachhaltige Reduzierung der Emission von Treibhausgasen, bei steigendem Energieverbrauch (siehe auch Abbildung 1) und auch steigenden Fahrleistungen, muss daher entweder ein Kraftstoff verwendet werden, der sauberer verbrennt (dies wäre zum Beispiel Wasserstoff (H 2 ), bei dessen Verbrennung reines Wasser entsteht), oder aber es muss ein anderes Gerät gefunden werden, das die Energie des Kraftstoffes effizienter nutzbar macht. Die Brennstoffzelle vereinigt beide Lösungsmöglichkeiten in sich: Sie kann Wasserstoff mit Luftsauerstoff in elektrischen Strom umsetzen, der sehr vielseitig verwendbar ist, und ihr möglicher Wirkungsgrad liegt über 90% 7! Vor allem aber wird bei der Reaktion nur reines Wasser freigesetzt! 1 TAB- Arbeitsbericht Nr vgl.: Reuters; 3 Wirkungsgrad des Carnot Prozesses (für ideale Wärmekraftprozesse) 4 vgl.: Pischinger, F.: Vorlesungsumdruck Verbrennungsmotoren 5 laut Dr. Andreas Schüers, Fahrzeugforschung, Leiter Forschung Verbrennungsmotoren, EV-24 6 laut Dr. Andreas Schüers, Fahrzeugforschung, Leiter Forschung Verbrennungsmotoren, EV-24 7 vgl.: BMW-Group: H2 Mobilität der Zukunft 15
16 Im Folgenden wollen wir uns mit der Wasserstofftechnologie und der Brennstoffzelle auseinandersetzen, ohne das andere Prinzip, die Verbrennung von sauberem H 2 in konventionellen Verbrennungsmotoren, völlig außer Acht zu lassen. Auch die umweltschonende, aber nicht einfache Erzeugung und Speicherung von Wasserstoff wird erläutert werden. 2. Welche Chance hat Wasserstoff als Energieträger? - Ein Vergleich Gegenwärtig wird sehr angestrengt im Bereich der Wasserstofftechnologie geforscht, um sie wirtschaftlicher, benutzerfreundlicher und sicherer zu gestalten. Doch warum wird all dieser Aufwand in eine Technologie gesteckt, die im Vergleich zu den üblichen Systemen, die auf fossilen Brennstoffen beruhen, noch in den Kinderschuhen steckt, wenn doch die altbewährten Systeme ausgereift sind und sich all die Jahre bewährt haben? Um diese Frage zu beantworten, werden die Energieträger miteinander verglichen. Drei Kriterien sind im Rahmen dieses Vergleiches von Bedeutung. Zum einen spielt das Vorkommen der jeweiligen Ressource eine wichtige Rolle. Sowohl Erdöl, aus dem Benzin gewonnen wird, als auch Steinkohle sind fossile Brennstoffe, d.h. Stoffe, die im Lauf der Erdgeschichte unter extremen Bedingungen entstanden sind. Der Ausgangsstoff ist hierbei organisches Material, das unter Luftabschluss, sehr hohen Temperaturen und Drücken zu den jeweiligen Endprodukten gepresst worden ist. Aus der Entstehungsgeschichte der fossilen Brennstoffe ist ersichtlich, dass sie nicht in unendlicher Menge vorkommen und es auch keinen Nachschub geben wird. Es wird geschätzt, dass die sicheren Erdölvorräte der Erde noch maximal 42 Jahre ausreichen. Auch Erdgas wird in einem Zeitraum von circa 65 Jahren zur Neige gehen. Nur unsere Kohlevorräte werden noch knapp zwei Jahrhunderte reichen 8. Diese Angaben gelten für den Fall, dass die Förderung der Brennstoffe auf dem jetzigen Stand bleibt. Dieser kann jedoch nicht beibehalten werden, wie man am Beispiel des wachsenden Verkehrs erkennen kann. Aus der Grafik ist ersichtlich (siehe auch Abbildung 2), dass der Verbrauch an fossilem Kraftstoff in den nächsten Jahren progressiv wächst, wobei sich dieser Trend auch in den folgenden Jahrzehnten fortsetzen und somit zu einer Energieknappheit führen wird, wenn wir keinen alternativen Kraftstoff finden. Im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen ist Wasserstoff in nahezu unendlichem Maße auf der Erde vorhanden, da er in allen möglichen chemischen Verbindungen vorkommt. Diejenige, die für den Menschen aber von ganz besonderem Nutzen sein kann, ist Wasser, welches 71% der gesamten Erdoberfläche bedeckt. Ein weiterer Vorteil des Wassers ist sein globales Vorkommen im Gegensatz zu den nur punktuell vorhandenen Erdöl-, Erdgas- und Kohlefeldern. Das bedeutet, dass die Produktion von Wasserstoff nicht ortsgebunden ist, sondern sich nach der Nachfrage richten kann. Ein weiterer Gesichtspunkt, unter dem Energieträger verglichen werden müssen, ist der Energiegehalt. Aus der nebenstehenden Grafik lässt sich der energetische Unterschied der Stoffe in Bezug auf Masse und Volumen erkennen. Betrachtet man nun 8 laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover 16
17 den Energiegehalt in Abhängigkeit der Volumina, so muss unterschieden werden, ob es sich um flüssigen oder gasförmigen Wasserstoff handelt, da die beiden Aggregatszustände unterschiedliche Dichten haben. In dieser Grafik zeigt sich der Wasserstoff als relativ schwacher Vertreter der Energieträger im Vergleich zu Steinkohle und Benzin. Lediglich 2380 kwh sind in einem Kubikmeter enthalten. Positiv fällt hier jedoch auf, dass sowohl flüssiger als auch gasförmiger Wasserstoff mehr Energie gespeichert hat als eine Batterie derselben Größe. Diese Eigenschaft wird in der ersten Serie von Wasserstoffautos, die bald auf den Markt kommen werden, genutzt werden. Hier wird es weder Batterie noch Lichtmaschine, sondern lediglich eine Brennstoffzelle mit Zubehör geben, die unabhängig vom Motorbetrieb Energie in Form von Strom in das Bordnetz einspeisen soll. Das zweite Diagramm zeigt dagegen, dass Wasserstoff überraschenderweise der Stoff ist, der mit kwh pro 1000kg mehr als viermal so viel Energie enthält wie die altbewährte Steinkohle. Doch muss man dazusagen, dass es nie möglich sein wird, zum Beispiel eine Tonne Wasserstoff auf das selbe Volumen zu komprimieren wie eine Tonne Kohle, da mit dem flüssigen Wasserstoff schon der dichteste Aggregatszustand erreicht ist. Um ihn noch dichter zu machen, also in den festen Zustand zu überführen, müsste man ihn auf eine Temperatur kühlen, die weit unter dem absoluten Nullpunkt, nämlich -273 C, liegt. Dies ist aus physikalischen Gründen nicht möglich. Das letzte Kriterium ist die Umweltverträglichkeit der unterschiedlichen Energiespeicher. Hierbei spielt nicht nur der Vorgang der Energiefreisetzung, sondern auch der Prozess der Förderung beziehungsweise der Herstellung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Sowohl bei der Förderung von Kohle als auch von Erdöl wird die Natur nachhaltig beschädigt. Und auch der Tramsport insbesondere von Erdöl birgt große Gefahren für Flora und Fauna. So kann man immer wieder in den Zeitungen lesen, dass wieder ein Öltransporter einen Unfall hatte und die gesamte Fracht in unsere Meere ausgelaufen ist, was oft ganze Tierarten bedroht. Was den Vorgang der Energiefreisetzung anbelangt, ist zu betonen, dass dabei im Motor eines handelsüblichen Autos das Benzin zur Gewinnung von zunächst thermischer Energie einfach explosionsartig verbrannt wird. Dabei treten trotz Katalysator 17
18 Gase, wie Kohlenstoff- und Stickoxide, aus, die die Umwelt schädigen und den Treibhauseffekt verstärken. Auch hier bietet Wasserstoff die Lösung: Zum einen ist die Herstellung sehr umweltfreundlich. Bei der Elektrolyse wird unter Stromzufuhr Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Dabei ist lediglich darauf zu achten, dass der Strom ebenfalls umweltfreundlich produziert wird. Eine Möglichkeit ist die Solartechnologie. Zum anderen ist die Freisetzung der Energie für unsere Umwelt sehr verträglich. Hier gibt es zwei Arten: Verbrennt man ihn mit Sauerstoff, so ist Wasser das einzige Abfallprodukt. Der zweite Weg um aus Wasserstoff Energie zu gewinnen ist die Brennstoffzelle. Dabei kommt es zu einer direkten Umwandlung von chemischer in elektrische Energie, was für den guten Wirkungsgrad von maximal 70% 9 verantwortlich ist. Wasser ist auch hierbei das einzige Abfallprodukt. Die genannten Aspekte machen deutlich, dass Wasserstoff eine Alternative zu unseren bisherigen fossilen Brennstoffen darstellt, die besser ist als die altmodische Technologie. 3. Wie gewinnt man Wasserstoff? Um den in der Natur nur in gebundener Form vorkommenden Wasserstoff in Brennstoffzellen nutzen zu können, muss man ihn unter Einsatz von Energie erzeugen. Es wird hierbei zwischen der primärenergetischen und der sekundärenergetischen Gewinnung unterschieden Organische Ausgangsstoffe Bei den primärenergetischen Verfahren wird der Wasserstoff aus primären Energiequellen gewonnen. Hierzu zählen die Dampfreformierung von Erdgas, die teilweise Oxidation von schweren Kohlenwasserstoffen, die Erzeugung aus Erdgas/Schweröl nach dem Kvaerner-Verfahren und die photobiologische Erzeugung. Diese kann entweder im großen Maßstab (industriell) oder direkt beim Verbraucher vorgenommen werden Großtechnische Möglichkeiten Im Zuge der Dampfreformierung von Erdgas werden leichte Kohlenwasserstoffe wie z.b. Methan unter Zufuhr von Energie und Wasserdampf mit Hilfe eines Katalysators bei Temperaturen von 850 C und Drücken von 25bar zu Kohlenmonoxid und Wasserstoff übergeführt: Allgemein: C n H m + n H 2 O n CO + (n+m/2) H 2 Bsp. Methan: CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 Das gebildete Kohlenmonoxid wird in einer Anschlussreaktion unter Zuhilfenahme des Katalysators und weiterer Energiezufuhr in Kohlendioxid und Wasserstoff umgesetzt (Shift-Reaktion): CO + H 2 O CO 2 + H 2 Bei der partiellen Oxidation von schweren Kohlenwasserstoffen werden z.b. Rückstandsöle aus der Erdölverarbeitung oder auch schweres Heizöl verwendet, die in 9 vgl.: hyweb.de 18
19 einer exothermen bzw. authothermen (je nach Sauerstoff/Wasserstoffgehalt) Reaktion zu einem Gasgemisch aus Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Wasserstoff reagieren: Bsp. : CH 1,4 + 0,3 H 2 O + 0,4 O 2 0,9 CO + 0,1 CO 2 + H 2 Das entstehende Kohlenmonoxid wird wie oben angegeben in einer Shift- Reaktion zu Kohlendioxid weiter überführt. Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten Verfahren entstehen beim Kvaerner- Verfahren, das auf einem Plasmabogenprozess basiert, keine nennenswerten Emissionen. Erdgas wird bei ca o C in seine Grundbestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff zerlegt; die entstehenden Stoffe werden anschließend mit Wasser gekühlt. Beachtlich bei diesem Verfahren ist der hohe Wirkungsgrad, der fast 100% beträgt; fast die gesamte Energie wird zur Erzeugung von Wasserstoff, Kohle und Wasserdampf verwendet. Ein noch relativ unbekanntes und neues Verfahren ist die photobiologische Wasserstofferzeugung. Im Grunde wandeln Blaualgen (Nostoc muscorum) durch ihre vegetativen Zellen und Heterozysten Abfälle der Milch- und Zuckerverarbeitung in Wasserstoffgase um, die sie anschließend freisetzen. Dieses Verfahren wird zurzeit an der Universität Bonn eingehender untersucht. Links: Aus dem von den Algen erzeugten Wasserstoff lässt sich in der Brennstoffzelle Strom gewinnen - und damit sogar ein kleiner Motor antreiben. Fotograf: Frank Luerweg/Universität Bonn Direkt im Kfz Da BMW schrittweise von dem benzinbetriebenen Auto auf das reine Wasserstoff- Auto umstellen will, wurde viel Entwicklungsarbeit in eine Lösung zum Problem der fehlenden Infrastruktur, was Wasserstoff anbelangt, gesteckt. Heraus kam dabei ein sogenannter Reformer, ein Gerät, welches aus Benzin und auch anderen Stoffen, wie Alkoholen oder Erdgas, reinen Wasserstoff gewinnt. Im Falle des Autos wird Benzin aus dem Tank entnommen und der Wasserstoff in die Brennstoffzelle geleitet. Für den Gebrauch als APU entwickelt BMW zusammen mit DELPHI Automotive Systems, dem größten Automobilzulieferer der Welt, die Solid Oxide Fuel Cell, kurz SOFC (siehe Tabellen 1 und 2). Zunächst wird das Benzin bei 800 C verdampft. Dann wird es in den Reformer eingeleitet, der bei dieser Temperatur in der Lage ist, von Benzin Wasserstoff abzuspalten. Dieser wird dann in die Brennstoffzelle eingeleitet. Bei immer noch ca. 800 C wird dann mit Hilfe einer Zirkonium-Oxid-Keramik Strom katalytisch erzeugt. Diese SOFC wird erst im Jahr 2005 fertig entwickelt sein; dann kann auch erst der Reformer zum Einsatz kommen. Bis dahin muss auf eine PEM zurückgegriffen werden, die jedoch nicht durch einen Reformer versorgt werden kann, da sie auf Verunreinigungen, wie zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid (CO), im Wasserstoff zu anfällig reagiert. 19
20 Um Wasserstoff für die Brennstoffzelle zu gewinnen, muss allerdings erst einmal E- nergie aufgebracht werden, um das Benzin zu verdampfen. Dieser Dampf, der dann in den Reformer geleitet wird, wird dort in Wasserstoff und CO umgewandelt. Die Energie, die dafür nötig ist, wird größtenteils dadurch erzeugt, dass das CO im nächsten Schritt unter Verbrauch von Wasser und Gewinn von Wasserstoff zu CO 2 aufoxidiert wird. Hierzu wird Wasser aus einem Tank zugeführt, später einfach das Abgas Wasserdampf der Brennstoffzelle verwendet. Die Reaktion findet zum Teil Schema: Umwandlung schon direkt bei Entstehung des Kohlenstoffoxids statt und wird dann im Shift- Konverter nahezu rückstandslos vollendet. Die Verwendung des Reformers bedeutet allerdings einen Energieverlust von 20-30% im Vergleich zu dem, was zu Beginn in den Atom-Bindungen des Benzins steckte. Dieser Energieverlust resultiert größtenteils aus der hohen Betriebstemperatur von Reformer und Stack. Der Benzindampf kann zwar mit den heißen Abgasen aufgeheizt werden, aber es geht Energie bei der Reformierung verloren. Auch wenn die Aufoxidation von CO einiges wieder dem System zuführt, ist die Brennstoffzelle mit ihren metallischen und damit gut wärmeleitenden Kontakten schwer zu isolieren. Ein weiteres Problem, das der Reformer mit sich bringt, ist, dass er zumindest bei dem aktuellen Entwicklungsstand mindestens genauso groß sein muss wie das Brennstoffzellenstack, das er versorgt Elektrolyse von Wasser Die wohl bekannteste Methode der sekundärenergetischen Verfahren stellt die Elektrolyse dar. Allgemein ist die Elektrolyse die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff unter Verwendung von elektrischem Strom. Die verschiedenen Arten der Elektrolyse werden lediglich durch den verwendeten Elektrolyten unterschieden. Da bei sämtlichen Elektrolysevorgängen im Endeffekt dieselbe Reaktion abläuft, wird hier als Musterbeispiel die konventionelle Alkalielektrolyse verwendet. Bei dieser Elektrolyse dient eine Alkalilösung als Elektrolyt; Kathoden- und Anodenraum sind durch ein ionendurchlässiges Diaphragma getrennt. Durch Anlegen Schema: Elektrolyse 20
21 von Gleichstrom entsteht an der Kathode Wasserstoff, an der Anode Sauerstoff, deren Vermischung durch das Diaphragma unterbunden wird. Der notwendige Ladungsausgleich findet durch Ionenleitung statt. Den zur Zersetzung benötigten Strom kann man auf umweltfreundliche Art und Weise, z.b. durch Solar-/Windanlagen oder Wasserkraft, herstellen, wodurch die Elektrolyse zu einem der umweltfreundlichsten Verfahren wird. Anodenreaktion: 2H 2 O + 2e - 2OH - + H 2 x 2 Kathodenreaktion: 4OH - O 2 + 2H 2 O + 4e - Gesamtreaktion: 2H 2 O 2H 2 + O 2 4. Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff Bisher wurden die Herstellungsmöglichkeiten von H 2 beschrieben. Im Folgenden werden wir näher auf die Anwendungsmöglichkeiten eingehen Allgemeiner Überblick Derzeit laufen viele Projekte, in denen möglich Anwendungen von Wasserstoff untersucht werden. Eines davon ist das Euro-Québec Hydro-Hydrogen Pilot Project (EQHHPP). In diesem Projekt wird die Durchführbarkeit der Wasserstoffanwendung in folgenden Bereichen untersucht: H 2 in der Raumfahrt In der Raumfahrt sind einige wichtige Punkte zu beachten: Raketen müssen so leicht wie möglich sein, ihre Triebwerke müssen den Schub leisten, um eine Last in den Orbit oder sogar außerhalb der Erdatmosphäre zu befördern, und die Masse einer Rakete wird zu 90% von Treibstoff eingenommen (während nur 1-2% des Gewichts auf die Nutzlast fallen). Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an den Treibstoff einer Rakete: Er muss leicht sein, bezogen auf seine Masse eine große Energiekapazität aufweisen und er muss einen möglichst großen Triebwerksschub bei möglichst geringem Treibstoffverbrauch ermöglichen. Diese Anforderungen werden von Flüssigwasserstoff besser erfüllt als von allen anderen Brennstoffen, da er gegenüber diesen, wie bereits erwähnt, einen vielfachen E- nergiegehalt aufweisen kann (siehe auch: 2.Vergleich der Rohstoffe). Zusätzlich erzeugt Wasserstoff bei seiner Verbrennung die höchste Ausströmgeschwindigkeit, d.h. er ermöglicht einen maximalen Triebwerksschub. Wegen dieser Eigenschaften wird Wasserstoff bereits seit den fünfziger Jahren in der Raumfahrt eingesetzt. Während zunächst nur die dritte Stufe der Trägerraketen mit Wasserstoff betrieben wurde, wird heute die Ariane 5 (ESA) vom Start bis zum Ziel von Wasserstoff angetrieben. Die Vorteile des Wasserstoffs gegenüber dem vorher verwendeten Kerosin liegen offen da: er ermöglicht eine größere Leistung der Rakete und erzeugt bei seiner Verbrennung einen Bruchteil der schädlichen Verbrennungsgase, wie es zum Beispiel bei Kerosin der Fall ist H 2 -betriebene Triebwerke für Flugzeuge Seit der Ölkrise in den siebziger Jahren machen sich weltweit auch die Flugzeughersteller Gedanken über Alternativen zu Kerosin. Schon damals dachte man an den Einsatz von Wasserstoff, und in Russland wurden sogar Testflüge mit entsprechend umgebauten Flugzeugen gemacht. Daraufhin kam es 1989 zum Start des deutsch- 21
22 russischen Projekts, das sich damit beschäftigte, einen Airbus A310 auf Wasserstoffantrieb umzurüsten. Die Durchführbarkeitsstudie hierfür, die von ausgeführt wurde, ergab ein positives Ergebnis. Zudem waren alle Technologien ausreichend entwickelt und die sicherheits-relevanten Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Dennoch einigte man sich auf die kleinere und kostengünstigere Variante eine Do 328 auf Wasserstoff umzurüsten. Dieses Flugzeug soll in Ländern eingeführt werden, in denen Wasserstoff aus einem Energieüberschuss aus Wasserkraft hergestellt werden kann. Solche Länder sind zum Beispiel Kanada und Norwegen. Allerdings befürchten Wissenschaftler, dass sich durch den erhöhten Wasserausstoß dieser Triebwerke die Bildung von Kondensstreifen erhöhen könnte 10. Daher sollte die Flughöhe solcher Flugzeuge auf maximal acht bis neun Kilometer beschränkt werden. Außerdem könnte durch die höhere Betriebstemperatur von Wasserstofftriebwerken der Ausstoß von Stickoxiden steigen. Allerdings widerlegen Flugzeughersteller diese These mit den verbesserten Zünd- und Verbrennungseigenschaften von Wasserstoff, wodurch der Stickoxidausstoß bedeutend verringert würde, was auch bereits in Studien belegt wurde. 11 Da die Entwicklung in der Luftfahrt lange Zeit in Anspruch nimmt, muss mit der Forschung an Flugzeugen, die ohne Kerosin auskommen und so die Umwelt nicht mehr belasten, bereits heute begonnen werden. Es muss also schon heute entwickelt werden, was in 50 Jahren Standard sein soll! Kraftwerksbetrieb mit H 2 Wegen ihres hohen Wirkungsgrades könnte die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle auch in Kraftwerken eingesetzt werden. Besonders werden hier Schmelzkarbonatbrennstoffzellen in Betracht gezogen (siehe auch Tabellen 1 und 2). Sie sind bereits heute weit entwickelt und können sehr hohe Leistungen erbringen, wobei sie allerdings ständig bei hoher Temperatur arbeiten, was sie für die meisten anderen Anwendungsgebiete neben der stationären Anwendung ungeeignet macht. Zusätzlich ist der Brennstoffzelle ein sehr hoher Wirkungsgrad (70%) möglich 12, da ihre Leistung durch die Fläche bestimmt wird. Anders ist das bei Maschinen, die mit Kolben und Verbrennung arbeiten, da diesen eingesetzmäßig recht geringer Wirkungsgrad gesetzt ist. 13 Zusätzlich wird bei der Brennstoffzelle die sog. Kraft-Wärmekupplung ausgenutzt. Dabei wird zusätzlich zum entstehenden Strom die Wärme, die in einer Brennstoffzelle entsteht, genutzt. Somit kann der Wirkungsgrad bis auf 100% gesteigert werden Hausinterne Stromversorgung mit H 2 Die Brennstoffzelle könnte auch in der Hausenergieversorgung (HEV) eine wesentliche Rolle spielen. Sie übernähme hier die Schlüsselrolle bei der dezentralen Stromerzeugung, die zusätzlich zur Wärmeerzeugung durch Erdgas oder -öl stattfindet. Allerdings müsste hierzu jedes Haus, das von einer Brennstoffzelle versorgt werden soll, mit einem Reformer ausgestattet sein, der aus Erdgas Wasserstoff gewinnt. Ein Erdgasanschluss ist bereits in vielen Haushalten vorhanden H 2 -Autos und Busse 10 vgl.: SZ vom , Wolken aus Jets 11 vgl.: TÜV Bayern Group 12 laut hyweb.de 13 vgl.: Einleitung 22
23 Der Betrieb von Autos und Bussen mit Wasserstoff ist sicher einer der wichtigsten Anwendungsbereiche. Dementsprechend forschen fast alle Hersteller von Autos auf diesem Gebiet. Allerdings stellt der Betrieb von Autos allein mit Wasserstoff noch einige Probleme dar, da derzeit die nötige Infrastruktur fehlt, vor allem die Wasserstofftankstellen. Daher befasst sich BMW mit dem Betrieb von Autos mit Verbrennungsmotoren, die mit zwei Tanksystemen ausgerüstet sind, so dass das Auto entweder mit Benzin oder Wasserstoff betrieben werden kann (siehe auch Abbildung 3). Auch MAN arbeitet an der Ausrüstung von Bussen mit Wasserstoffantrieb. Wie bei BMW werden die Busse zunächst noch mit zwei Tanksystemen betrieben. Dieses Konzept hat bereits in einer zweijährigen Testphase, in der die Busse am Münchner Flughafen eingesetzt wurden, seine Tauglichkeit bewiesen. So konnte mit bisherigen Testautos eine Reichweite von 400 km, bezogen auf den alleinigen Einsatz von Wasserstoff, erreicht werden. Bei einer weiteren Optimierung des Systems könnten in naher Zukunft bereits 500 km erreicht werden. Auch die hoch angesiedelten Ziele, betreffend der Emissionsarmut der wasserstoffbetriebenen Autos, konnte sehr zufriedenstellend gelöst werden Wasserstoff als zukunftsfähiger Energieträger in Kraftfahrzeugen Der Einsatz von Wasserstoff in Fahrzeugen erfolgt entweder in Verbrennungsmotoren (thermodynamisch) oder in Brennstoffzellen (elektrochemisch). Im Verbrennungsmotor funktioniert das im Großen und Ganzen so, dass das Benzin durch ebenfalls explosiven Wasserstoff ersetzt wird (siehe auch Abbildung 7). In dieser Richtung forschen nur sehr wenige Automobilunternehmen, unter ihnen die BMW-Group, die der Meinung ist, dass die Zeit für Brennstoffzellen in Fahrzeugen noch nicht reif ist. Beim elektrochemischen Antrieb wird in Brennstoffzellen Strom aus Wasserstoff gewonnen und mit diesem Strom ein Elektromotor angetrieben H 2 im Verbrennungsmotor Beim thermodynamischen Antrieb zeigen sich die Vorteile des geringen Schadstoffausstoßes und die des regenerativen Energieträgers, doch der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle wird so nie erreicht werden. Sein Vorteil gegenüber dem elektrochemischen Antrieb ist, dass man ihn auch mit Benzin betreiben kann und so nicht auf die wenigen vorhandenen Wasserstofftankstellen angewiesen ist. Der Wasserstoff-Verbrennungsmotor von BMW basiert grundsätzlich auf der Technik eines konventionellen 4-Takt-Ottomotors, nur mit dem generellen Unterschied, dass an Stelle von Benzin Wasserstoff verbrannt wird. Die Arbeitsweise eines Wasserstoffmotors ist gleich der eines benzinbetriebenen Motors. Es wird Wasserstoff mit Sauerstoff zu einem hochexplosiven Gasgemisch vermengt und in den Zylinderraum eingespritzt und nach einem Verdichtungsvorgang durch Zugabe von Aktivierungsenergie in Form einer Zündung zur Reaktion gebracht. Als Produkt entsteht hier aber lediglich reines Wasser. Durch die Explosion wird der Kolben nach unten gedrückt. Durch ein Schwungrad wird der Kolben wieder nach oben gehoben und verdichtet erneut das in der Zwischenzeit über die Ventile ausgetauschte Gasgemisch. 23
24 Der gesamte Vorgang wird ab diesem Punkt wiederholt. Der Kolben und das Schwungrad sind mit einer Kurbelwelle verbunden, die durch die Bewegung des Kolbens in Rotation gebracht wird. Diese Kurbelwelle treibt dann über ein Getriebe die Antriebsräder des entsprechenden Fahrzeuges an. Somit wird die chemisch gespeicherte Energie des Wasserstoffs genau wie bei einem konventionell mit Benzin betriebenen Ottomotor durch Verbrennung und mechanische Übersetzungen in kinetische Energie des Fahrzeuges umgewandelt. An den Teilen, die mit dem ultrakalten Treibstoff (ca. 250 C) in Berührung kommen, müssen gewisse Modifikationen vorgenommen werden, um das Fahrzeug für den Wasserstoff-Betrieb zu optimieren, wie zum Beispiel druck- und kälteunempfindliche Ventile, Leitungen und Dichtungen. Auch die Motor-Steuerelektronik muss auf die Zündeigenschaften des Treibstoffs Wasserstoff umgestellt werden. Die Verbrennung des Gasgemisches erfolgt generell mit hohem Luftüberschuss (λ=3.0). Die zusätzliche Luft im Brennraum nimmt Wärme auf und senkt damit die Flammentemperatur unter die kritische Grenze, oberhalb derer sich das Wasserstoff- Luft-Gemisch selbst entzünden kann. Somit werden Fehlzündungen und ein unrundes Laufen des Motors ( klopfen ) unterbunden und gleichzeitig die Entstehung von giftigen Stickstoffoxiden bei der Verbrennung vermieden. Diese entstehen nämlich hauptsächlich bei hohen Verbrennungstemperaturen durch Oxidierung des in der Luft enthaltenen Stickstoffes. Beim BMW Wasserstoff-Verbrennungsmotor besteht die Möglichkeit einer sogenannten bivalenten Auslegung. Das heißt, der Motor kann sowohl mit Wasserstoff als auch mit Benzin betrieben werden. Man kann sogar während der Fahrt umschalten. Gerade für die Übergangszeit bis zum Aufbau einer flächendeckenden Wasserstoff- Infrastruktur hat der Wasserstoff-Verbrennungsmotor daher als saubere Antriebsalternative sehr gute Aussichten. Auf lange Sicht gesehen wird der Verbrennungsmotor aufgrund seines geringeren Gesamtwirkungsgrad allerdings dem Brennstoffzellenantrieb unterliegen. Gebaut werden zur Zeit Autos mit Wasserstoffverbrennungsmotor außer von BMW auch von Ford und MAN. BMW setzt bei der Entwicklung auf bivalente 8- und 12- Zylindermotoren und einem Flüssigwasserstofftank. Die Reichweite des BMW 750hL beträgt 350km mit Wasserstoff und 650km mit Benzin. Ford baut einen 4- Zylinderreihenmotor mit komprimiertem Wasserstoff (250 bar) und einer Reichweite von 100km, die demnächst auf 250km verbessert werden soll. MAN baut in seine Passagierbusse für den Einsatz am Münchner Flughafen 6-Zylindermotoren mit 12l Hubraum und einen 250bar-Drucktank mit einem Fassungsvermögen von 2580l. In Deutschland gibt es bislang nur 2 öffentliche Wasserstofftankstellen, nämlich in Hamburg und München. Eine Dritte ist in Berlin geplant. Die Wasserstofftankstelle am Münchner Flughafen ist die erste automatische Robotertankstelle der Welt Brennstoffzelle und Elektroantrieb Doch wie schon gesagt bietet die elektrochemische Variante der Energiegewinnung aus Wasserstoff einige Vorteile im Vergleich zu bloßen Verbrennung. 24
25 Dadurch, dass die Antriebssysteme in den Unterboden eingebaut werden können, bietet sich die Möglichkeit völlig neuer Karosserieübergänge und auch die Unfallsicherheit wird verbessert. Wie Crashtests ergeben haben, ist der Motor bei Verkehrsunfällen keineswegs eine Knautschzone, sondern er schiebt sich des Öfteren in die Fahrgastzelle, was für die Insassen schwere Verletzungen zur Folge haben kann. Dank der Verlagerung des Antriebssystems und somit des Schwerpunktes nach unten verbessert sich auch das Fahrverhalten. Der eigentliche Vorteil des Brennstoffzellenantriebs liegt darin, dass die Brennstoffzelle, wie bereits erwähnt, einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, der sich mit Sicherheit noch verbessern lässt. Es gibt auch so gut wie keinen Schadstoffausstoß mehr, sondern nur noch Wasserdampf als Reaktionsprodukt. Das bedeutet, dass es auch an Tagen mit hohen Ozonwerten keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr geben muss, ja überhaupt das Ozonloch durch Autos nicht mehr vergrößert wird. Auch Smog, Atemautomaten (wie in Japan) und Fahrverbote in Städten wie Mailand würden der Vergangenheit angehören, der Treibhauseffekt wäre eingedämmt und auch die Amerikaner könnten es doch noch schaffen sich an das Kyoto-Protokoll zu halten, wenn der Verbrennungsmotor von der Brennstoffzellentechnik abgelöst würde. Der größte Vorteil ist, dass es sich bei Wasserstoff nicht um einen fossilen Brennstoff, wie Kohle, Erdöl oder Erdgas, sondern um einen regenerativen Brennstoff handelt, den man, wie der Name schon sagt, immer wieder herstellen kann (vorzugsweise durch regenerative Energiequellen, wie Sonne, Wind etc.) und der bei seiner Umsetzung die Umwelt nicht verschmutzt Die APU-Technologie APU steht für Auxillary Power Unit. Die bedeutet, dass der Wasserstoff nicht für den Antrieb verwendet wird, sondern als Hilfsenergie für das Bordstromnetz dient. Dazu wandelt ein Brenstoffzellen-Stack die gebundene H 2 Energie in Strom um, der dann zur Versorgung von Stromverbrauchern im Auto dient. Dies sind zum Beispiel: Klimaanlage, elektrische Fensterheber, automatische Sitz- und Spiegeleinstellung, Autoradio (mit Navigationssystem) und natürlich die Scheinwerfer und Lichter. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass somit die Lichtmaschine und die schwere Autobatterie überflüssig werden. Somit wird Gewicht und vor allem Platz gespart. Außerdem kann so eine Menge Kraftstoff eingespart werden, da durch den Generatorwiederstand der Verbrauch ansteigt. Dies kann bis zu 1,5 Liter pro 100 km betragen Die Brennstoffzelle als Stromversorger für Kleingeräte Bisher kennen wir Brennstoffzellen hauptsächlich als Einbauten in Autos, als Energieversorgung für Antriebe und als dezentrale Stromversorger und Kleinheizkraftwerke für Wohnhäuser. Doch auch den altbekannten Stromversorgern Batterie und Akku könnte die Brennstoffzellen-Technologie bald ernsthafte Konkurrenz machen. Dies wäre sowohl für die Umwelt als auch für den Verbraucher ein Fortschritt, denn Brennstoffzellen sind im Gegensatz zu Batterien und Akkus frei von Schwermetallen oder anderen hochgiftigen Stoffen und lassen sich so leichter entsorgen. 14 vgl. BMW-Group: H 2 Mobilität der Zukunft 25
26 Des Weiteren zeichnen sie sich durch eine wesentlich höhere Energiedichte und Lebensdauer aus. Ein anderer wichtiger Punkt: Die bei Akkus auftretende lästige Selbstendladung ist für Brennstoffzellen ebenso wie der so genannte Memory Effekt quasi ein Fremdwort, da bei diesem System Energiespeicher und Energieerzeugung klar getrennt sind. So ist auch nach einem Jahr Lagerung der Speicher noch voller Energie! 15 Da sie diese Vorteile nutzbar machen wollen Hier eine Abbildung des Systems und da der Markt für tragbare elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Camcorder, Digitalkameras und Laptops stetig wächst, haben sich unter der Leitung des Fraunhofer Instituts für Energiesysteme ISE sechs deutsche und ein amerikanisches Institut in der Fraunhofer-Initiative Mikro-Brennstoffzelle zusammengeschlossen. Ziel der gemeinsamen Forschung ist es, die Brennstoffzelle bei ausreichender Leistung so zu verkleinern, dass sie für Kleingeräte nutzbar wird, um so immer mehr Batterien und Akkus ersetzen zu können. Nach ca. zweijähriger Forschungsarbeit wurde auf der Hannover Messe zwischen dem 15. und 20. April 2001 am Gemeinschaftsstand Hydrogen + Fuel Cells in Zusammenarbeit mit dem Elektronikhersteller LG erstmals ein Laptop mit komplett integrierter Brennstoffzelleneinheit präsentiert. Ein ähnliches System wurde bereits vor vier Jahren vorgestellt, allerdings befand sich damals die Stromversorgungseinheit noch außerhalb des Laptops. 16 Die Brennstoffzelle besteht aus nur 27 in Stack-Bauweise aufeinander gestapelten Einzelzellen. Der benötigte Wasserstoff ist in drei Metallhydridspeichern an Metallpulver adsorbiert. Drei Lüfter führen der Zelle Luft-Sauerstoff zu. Ein hocheffizienter Spannungswandler mit einem Wirkungsgrad von 97% sorgt dafür, dass die nötige Ausgangsspannung für den tragbaren Computer erzeugt werden kann. Er wandelt die Volt Arbeitsspannung der Zelle im Betrieb in konstante 24 Volt für den Rechner um. Das Brennstoffzellensystem hat eine Spitzenleistung von 50 Watt. 17 Mit diesem System lässt sich der Laptop etwa 10 Stunden betreiben. 18 Die hier verwendete neuartige Streifenmembranzelle kommt ohne Schraubverbindungen aus. Sie wird lediglich zusammengeklebt und es werden erstmals leitfähige Polymere als Bipolarplatten-Material verwendet. 19 Die patentierte interne Reihenschaltung ermöglicht sowohl eine hohe Spannung als auch eine flache Bauform. Diese Optimierung des Verhältnisses Oberfläche zu Dichtungsfläche nutzt den Platz besser aus als die konventionelle Anordnung in Zellstapeln, die Zelle lässt sich leichter an die betreffenden Kleingeräte anpassen. Weitere Gesichtspunkte bei der Konzeption der Brennstoffzelle waren einfache Luftversorgung und geringes Gewicht vgl.: Fraunhofer Institut ISE Pressemitteilung 16 vgl.: Golem.de 17 vgl.: Golem.de 18 vgl.: Fraunhofer Institut ISE Pressemitteilung 19 vgl.: Innovation-Aktuell.de 20 vgl.: Fraunhofer Institut ISE 26
27 Hier eine computergenerierte Abbildung und ein Schnittbild einer solchen Streifenmembran-Brennstoffzelle Der Wasserstoffvorrat befindet sich in einem Metallhydridspeicher der Firma GfE Metalle und Materialien GmbH unter geringem Überdruck. Der Wasserstoffspeicher kann zu Hause mit einem Miniatur- Elektrolyseur aufgeladen oder wie eine Batterie einfach ausgewechselt werden, so Projektleiter Dr. Roland Nolte. Weitere auf der Messe vorgestellte spezielle Features der Neuentwicklung sind: -Mikroventile für die Wasserstoff-Zufuhr - eine voll integrierte Ablaufsteuerung - thermische Kopplung von Metallhydridspeicher und Brennstoffzelle. 21 Die hier abgebildete I-U-Kennlinie macht es letztendlich möglich, die Leistungsfähigkeit dieser neuartigen Zellentechnologie zu bewerten. Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Zelle dazu in der Lage ist, über einen weiten Stromstärkebereich eine relativ konstante Leistung zu liefern, was in Anbetracht des angestrebten Anwendungsbereiches eine durchaus willkommene Eigenschaft ist. Den Forschern des Fraunhofer Instituts ist es sogar gelungen, die Brennstoffzelle noch weiter zu verkleinern. Das Ergebnis haben sie ebenfalls in Hannover vorgestellt. Das ISE entwickelte eine so genannte "Mikro-Brennstoffzelle", die eine Leistung von 10 Watt bei einer Spannung von 8 Volt liefert und damit ausreichend Strom bereitstellt, um einen Camcorder anzutreiben. Diese Minibrennstoffzelle ist dabei kaum größer als eine Streichholzschachtel und besteht aus 16 Bipolarplatten, die aufeinander gestapelt und verklebt wurden. Als Tank für den Wasserstoff dient auch hier ein Metallhydridspeicher, den man schnell und einfach austauschen kann. 22 Die Forscher arbeiten nun daran, diese neue Technologie zur Serienreife und auf den Markt zu bringen. Weitere Ziele der zukünftigen Forschung sind: - eine Verbesserung der Leistungsdichte 21 vgl.: Innovation-Aktuell.de 22 vgl.: Golem.de 27
28 - erhöhte Miniaturisierung der Komponenten - Design für den Einbau in portable Geräte - smart technology für eine Ladezustandsanzeige des Hydridspeichers - Optimierung der Betriebsführung Auch soll auf eine kostengünstige Serienfertigung geachtet werden. Dazu Dr. Roland Nolte: Bei einer Großserienfertigung kann diese Technologie weniger als heute ein Lithium-Akku kosten. Bei entsprechender Forschung könnten Geräte mit Brennstoffzellenversorgung bald auf dem Markt zu kaufen sein. Voraussetzung dafür ist eine weitere Verbilligung der Komponenten für Brennstoffzellen, wie sie seit Jahren bereits stattfindet." 23 Bleibt zu hoffen, dass er damit Recht behält, denn mit den Worten von Dr. Angelika Heinzel, Abteilungsleiterin im Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, ist die Zukunftserwartung seitens der Industrie an die neue Technologie sehr gut beschrieben: Die Streifenmembran-Brennstoffzelle eröffnet völlig neue Möglichkeiten in einem milliardenschweren Markt Die Brennstoffzelle Die effizienteste Freisetzung der im Wasserstoff gebundenen Energie wird in der Brennstoffzelle erreicht. Über ihre Vergangenheit, derzeitige Nutzung und ihre Zukunft wird im Folgenden berichtet Wie sie entstand Der Grundstein für die heutige Brennstoffzellentechnik wurde bereits im Jahre 1839 gelegt. Schon damals konstruierte der walisische Jurist und Physiker Sir William Robert Grove ( ) eine galvanische Gasbatterie, den ersten funktionsfähigen Prototypen der Brennstoffzelle. Durch kalte Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff sollte sie elektrischen Strom liefern. Der Aufbau (und vor allem der Wirkungsgrad) hat sich seit dem vom Prinzip her nur wenig verändert. Groves Zeitgenossen verkannten jedoch seine Entdeckung, und die Brennstoffzelle verschwand in der Versenkung. Doch 1894 erkannt Wilhelm Ostwald ( ) bereits das Potential der Brennstoffzelle, als er sagte, die Brennstoffzelle sei eine technische Umwälzung, gegen welche die [...] Erfindung der Dampfmaschine verschwinden muss. Er räumte aber bereits ein, dass es noch ein weiter Weg bis zur anwendungsreifen Maschine sei...denn bis diese Aufgabe einmal ernst in Angriff genommen wird, wird noch einige Zeit vergehen. Aber dass es sich hier nicht um eine unpraktische Gelehrtenidee handelt, glaube ich allerdings annehmen zu dürfen. 23 Fraunhofer Institut ISE Pressemitteilung 24 Fraunhofer Institut ISE Pressemitteilung 28
29 Recht hatte er, denn erst in den 1950er Jahren, unter dem Einfluss des kalten Krieges, wurde seine Idee wieder aufgegriffen. Sowohl für die Raumfahrt als auch für U- Boote wurden Energiequellen benötigt, ohne dass Verbrennungsmotoren eingesetzt werden konnten. Da Batterien für Raumfahrzeuge zu schwer sind, entschied sich die NASA (z.b. im Apollo Programm) für die direkte chemische Energieerzeugung durch Brennstoffzellen. Zivil wird die Brennstoffzelle erst seit wenigen Jahren genutzt. Seitdem wird die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzellen kontinuierlich gesteigert bei gleichzeitiger Senkung der Kosten Wie sie funktioniert Die PEM-Brennstoffzelle erzeugt durch die Synthese von Wasserstoff und Sauerstoff an einer sogenannten PEM-Folie (Proton-Echange-Membran) Elektrische Energie. Diese PEM-Folie ist für Ionen durchlässig und an beiden Seiten sind platinhaltige Kohlenstoffmatten aufgebracht. An der Anode (+Pol) werden Wasserstoffmoleküle unter Abgabe von Elektronen zu positiv geladenen Wasserstoffionen oxidiert. Die Wasserstoffionen diffundieren durch die ionenleitende Kunststoffmembran (=Elektrolyt) zur Kathode. An der Kathode (-Pol) reagieren die Wasserstoffionen mit Sauerstoff und den zugeführten Elektronen zu Wasser. Werden Anode und Kathode elektrisch leitend verbunden, fließen die Elektronen (als nutzbarer elektrischer Strom) von der Anode zur Kathode. Somit ergibt sich folgende Reaktionsgleichung: Schema: Die Brennstoffzelle Anode: 2 H 2 4 H e - Kathode: O H e - 2 H 2 O Gesamtreaktion: 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Dieser Vorgang wir auch kalte Verbrennung genannt. Die theoretisch mögliche Spannung einer Einzelzelle beläuft sich auf 1,23 Volt. Im Betrieb kommt es jedoch bei Stromfluss durch Reaktionshemmungen, Innenwiderständen oder einer ungenügenden Gasdiffusion zu Verlusten (Überspannungen). Dies führt in der Praxis zu einer niedrigeren Zellspannung, die sich bei einer Einzelzelle im Rahmen von 0,6 0,9 Volt bewegt. Als Endprodukte entstehen lediglich Wasser, Abwärme und elektrische Energie. 29
30 So ist eine Energiegewinnung ganz ohne Schadstoffe möglich und zudem sind die chemischen Elemente auf der Welt im Überschuss vorhanden, wenn man sich einmal die Menge an Wasser in den Meeren und Ozeanen vor Augen führt. So wird der Wasser- und Sauerstoff als Energiespeicher genutzt, den man vorher durch die Elektrolyse von Wasser gewonnen hat. Weitere Arten von Brennstoffzellen sind: Die Alkalische Brennstoffzelle (AFC) - Elektrolyt: Kalilauge - Besonderheiten: benötigt reinen Sauerstoff und Wasserstoff - Anwendungsgebiet: in der Raumfahrt und bei U-Boot-Antrieben - Nachteile: ~ sehr teuer, aufgrund der hohen Anforderungen an die Gasreinheit ~ Kurzlebig, aufgrund eines Spannungsverlustes von mv pro 1000 Betriebsstunden Die Phosphorsäure Brennstoffzelle (PAFC) - Elektrolyt: hoch konzentrierte Phosphorsäure - Besonderheiten: ~hohe Betriebstemperatur ~bereits kommerziell erhältlich - Anwendungsgebiet: Blockheizkraftwerke - Nachteile: Fällt die Temperatur einmal unter 42 C, kristallisiert die Phosphorsäure irreversibel aus => Brennstoffzelle wird unbrauchbar Die Schmelzcarbonat Brennstoffzelle (MCFC) - Elektrolyt: Salzschmelze aus Alkalikarbonaten (Li2CO3 K2CO3) - Besonderheiten: ~Hohe Betriebstemperatur (580 C-660 C) ~Versorgung auch durch Erdgas, Kohlegas, Biogas und Synthesegas möglich - Anwendungsgebiet: im Industriellen Bereich, in dem hohe Temperaturen benötigt werden Die Oxidkeramische Brennstoffzelle (SOFC) - Elektrolyt: Yttriumdotiertes Zirkondioxid - Besonderheiten: ~ Röhrenförmig ~ Betriebstemperatur von 800 C-1000 C => zellinterne Teilreformierung von Erdgas zu Wasserstoff - Anwendungsgebiete: ~Blockheizkraftwerke ~Entwicklung von SOFC Großkraftwerken (geschätzter Wirkungsgrad von 70%) - Nachteile: sinnvoll erst ab 100kW Die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) - Elektrolyt: Protonenleitende Polymer-Elektrolyt-Membran 30
31 - Besonderheiten: Methanol als Edukt möglich - Anwendungsgebiete: Durch den fehlenden Reformer ist sie für den Einsatz in Kraftfahrzeugen am besten geeignet - Nachteile: CO 2 Ausstoß auf Grund des Methanol als Brennstoff. 6. Handhabung von Wasserstoff Da Wasserstoff ein sehr flüchtiges Gas ist, ist es relativ kompliziert mit ihm umzugehen. Deswegen hat man verschiedene Methoden entwickelt, um mit diesem Gas zurechtzukommen Speicherung von Wasserstoff Wasserstoff ist wohl der Energieträger der Zukunft, aber wie kann man ihn speichern? Da Wasserstoff ein hochflüchtiges Gas mit sehr kleinen Molekülen ist, ist das gar nicht so einfach. Hier bieten spezielle, äußerst dichte Druckflaschen die Lösung. Am billigsten ist es, Wasserstoff unter Druck in passende Behälter abzufüllen. Wenn es sich dabei um größere Mengen handelt, wird er meist bei nur 30 bar ( nur damit er nicht so leicht durch die Wand diffundiert) in fest installierten Tanks gelagert. Abgefüllt und zum Beispiel als Schweißgas verkauft wird er dann ebenso unter Druck. Wenn es dabei auch auf den Platzverbrauch ankommt, wird er in stahl- oder kohlefaserverstärkten Verbundmaterialflaschen bei bis zu 350 bar abgefüllt. Wenn Wasserstoff dann als Energieträger zum Beispiel in U-Booten zum Einsatz kommen soll, wird er nicht in Druck-, sondern in sogenannte Metall-Hydridspeicher abgefüllt. Diese nutzen die Eigenschaft der kleinen Wasserstoff Moleküle, sich in Metallgitter einzulagern. Diese Art der Speicherung verbraucht jedoch auch einiges an Platz und die Tanks sind, da sie aus Metall bestehen, sehr schwer. Deswegen muss daran noch länger weitergearbeitet werden. Der wohl interessanteste Weg ist einer, der noch in der Entwicklung steckt: Man versucht momentan Wasserstoff in Kohlenstoff-Nanoröhren zu speichern. Man kann sich diese als aufgerollte Kohlenstoff-Schichten vorstellen. Sie haben einen Durchmesser von etwa einem Nanometer (=1/ mm), ungefähr viermal so viel wie der eines Eisenatoms; da sie jedoch eine Länge von bis zu einem Millimeter besitzen, können sie in verschiedenen Bereichen (wie ein mikroskopisches Reagenzglas) verwendet werden. Bekannt sind sie auch aus der Mikroelektronik, wo es erst vor kurzem Ingenieuren von IBM gelang, leistungsfähige und präzise Transistoren aus Kohlenstoff-Nanoröhren zu bauen. 25 Es wird versucht, in diesen Nanoröhren Wasserstoff zu speichern. Wäre man dabei erfolgreich, würde das bedeuten, dass er so dicht untergebracht 25 vgl.: Hürter, T., Kohle schlägt Silizium 31
32 wäre wie bei ca. 700 bar in einer Druckflasche. Aber der verwendete Behälter wäre viel leichter als eine Metall-Hydrid- oder entsprechend starke Druckflasche. Was zurzeit jedoch die höchste Speicherdichte bietet, ist der Flüssiggastank (30 Liter Gas unter Normaldruck haben denselben Energiegehalt wie 1 Liter flüssiger Wasserstoff). Dort ist der Wasserstoff bei etwa 250 C Kälte flüssig. Deswegen muss er von der Umgebung mit einer hochisolierenden Schicht abgeschirmt werden. (siehe auch Abbildung 6). Wegen des extremen Temperaturunterschiedes ist es nicht möglich, den Wasserstoff ohne Entnahme von Gas länger als ein paar Tage zu speichern, da sich durch Erwärmung und somit Verdampfung so viel Gas bilden würde, dass der Tank platzen könnte. Aber in einem Auto, in dem diese Speicherart hauptsächlich verwendet wird, ist das nur ein geringes Problem. Zur Wiederentnahme muss der Wasserstoff nur um einige Grad aufgeheizt Abbildung siehe auch Anhang werden, um als Gas verwendet werden zu können. Viel schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass der Platzverbrauch auch bei den Möglichkeiten, die sich in einem 7er BMW bieten, immer noch zu groß ist. Ein weiteres größeres Problem ist die unausweichlich runde Form des Tanks, mit der die größte Stabilität und gleichzeitig die kleinste Oberfläche (nötig für möglichst geringen Wärmeaustausch) erreicht wird. Eine sinnvolle Raumnutzung bzw. Anpassung an freie Hohlräume in einem eher eckigen Wagen ist auf Grund der Tankform schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. In Sachen Stabilität und Isolierung würde nur ein kugelförmiger Tank noch besser abschneiden. Dieser wäre allerdings noch viel ungünstiger für die effektive Raumnutzung (siehe auch Abbildung 5). Wir hätten diesen Weg zur Speicherung trotzdem gerne zur Versorgung unseres APU-Modells verwendet, doch das war uns nicht möglich, weil die Kosten für so einen Tank noch zu hoch sind und Tanks in der von uns benötigten Größe so gut wie nicht existieren, da sich so ein Speicher wegen der aufwändigen, dicken Isolierung erst rentiert, wenn er größere Mengen fassen kann Sicherheit von Flüssigwasserstoff-Tanks Bevor eine neue Technik in unseren Alltag eintritt, müssen alle damit verbundenen Risiken umfassend bewertet werden. Das subjektive Risiko, das die mehr oder minder große Akzeptanz in der Bevölkerung bewirkt, ist nicht nur Ausdruck der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem entstehendem Schaden, sondern auch abhängig von der persönlichen Einschätzung und der allgemeinen Erfahrung. Es ist jedoch keine gute Idee zu warten, bis Unfälle passieren und dann erst Verbesserungen vorzunehmen, da so Opfer gefordert werden und Bedenken in der Bevölkerung aufkommen. Deswegen werden sogenannte Worst-Case - Untersuchungen 32
33 durchgeführt. So lassen sich die technischen Risiken kontrolliert abschätzen und die Sicherheitsstandards verbessern. Diese Untersuchungen wurden von BMW in Zusammenarbeit mit den Tankherstellern Linde und Messer Griesheim in den Jahren im Rahmen des EQHHPP durchgeführt. (siehe auch Abbildung 8) Dabei wurden die Flüssigwasserstoff-Tanks (LH 2 -Tanks) a) stark erhöhtem Innendruck b) mechanischen Kräften c) einem Propan Feuer ausgesetzt. Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt: Erhöhter Innendruck kann zum Beispiel durch einen Defekt in der Isolierung entstehen. Dabei erwärmt sich die Flüssigkeit, verdampft und baut so Überdruck auf. Dies geschieht allerdings auch, wenn der Tank nur lange Zeit unbenutzt steht. Deswegen wurden für diesen Fall in den BMW-Tank zwei Überdruckventile eingebaut, die den überschüssigen Wasserstoff entweichen lassen. Wenn nun aber diese beiden Ventile blockiert wären (z.b. durch einen sehr heftigen Unfall), würde der Druck im Tank inneren nicht mehr abgebaut werden können und somit immer weiter steigen. Dies wurde in den ersten Experimenten untersucht. (a) Es stellt sich heraus, dass die Tanks über 15-mal mehr als den Betriebsdruck aushalten. Zusätzlich wurde das Material der Tanks (austentischer Stahl bzw. kältefestes Aluminium) so gewählt, dass ein weiter ansteigender Druck nur einen kurzen Riß hervorruft, durch den dann der Überdruck entweichen kann und der so zu einer Entschärfung der Lage beiträgt (sog. leak before rupture Verhalten). Anzeichen für einen gefährlichen Rissfortschritt, der eine Explosion verursachen könnte, wurden bei keinem Experiment gefunden. Der Einbau einer Sollbruchstelle soll dieses Risiko noch verringern. Bei BMW ist der Wasserstoff-Tank hinter der Rücksitzbank zwischen den Rädern eingebaut. Dieser Bereich des Fahrzeugs ist sehr steif, somit ist der Tank zwar bei Autounfällen sehr gut geschützt, doch kann es trotzdem vorkommen (z.b. bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw oder einem festem Gegenstand, wie einem Baum oder einer Mauer), dass hohe Kräfte auf den Tank wirken. Welche Auswirkungen diese Druckkräfte auf den LH 2 -Tank haben, wurde in einer weiteren Reihe untersucht. (b) Dazu wurden Fallgewichte diverser Aufprallgeometrien und Massen auf den vollen Tank abgeworfen. Sie trafen diesen immer im Mittelpunkt des zylindrischen Mantels, da hier die schwächste Stelle liegt. Es stellte sich heraus, dass der Innendruck immer nur kurzzeitig ein wenig anstieg, dann aber durch die Sicherheitsventile abgebaut wurde. Der entstandene Kontakt zwischen Außen- und Innentank führte zu einem Defekt der Isolierung und somit zu einer relativ schnellen Entleerung des Inhalts durch Verdampfung der Fluids und Verflüchtigung über die Ventile. Bei kantigen Fallgewichten entstanden manchmal auch kleine Risse im Tank, die allerdings nur weiter zum schnellen Druckabbau beitrugen. Auch hier wurden niemals Anzeichen für einen gefürchteten Rissfortschritt, festgestellt. 33
34 Bei Versuchen, bei denen Wasserstoff durch Risse im Tank austrat, entzündete sich dieser an außen herum aufgestellten Scheinwerfern und verbrannte zuerst sehr schnell. Als jedoch das freie Gas (bereits nach wenigen Sekunden) verbraucht war, blieb nur noch eine kleine Flamme, die den nun verdampfenden Wasserstoff aufzehrte. Als der Tank leer war, verlöschte das Feuer von selbst. Des Weiteren wurden die LH 2 -Tanks einem Propan Feuer (ca. 900 C) ausgesetzt (c). Auch hier explodierte der Tank in keinem der Versuche, denn der Wasserstoff entwich langsam durch die Sicherheitsventile. All diese Tests zeigten zwar das gutmütige Verhalten der Flüssigwasserstoff-Tanks, da nie die gesamte Energie (mechanischer, thermischer und chemischer Art), die im Tank gespeichert ist, schlagartig frei wurde. Jedoch garantiert ein niedriges objektives Risiko noch nicht die Akzeptanz der Bevölkerung. Diese muss erst noch durch umfassende Aufklärung, eine klare und vor allem öffentliche Diskussion und einen möglichst großen Schutz vor Schäden von der neuen Technologie überzeugt werden. Dazu beitragen kann vielleicht die Feuerwehr, die durch gute Vorbereitungen den Bürgern bestmöglich helfen kann, falls doch einmal etwas passiert. Um einem Feuerwehreinsatz vorzubeugen, sind zwar in den Fahrzeugen jeweils mehrere Wasserstoff Sensoren eingebaut. Diese können die H 2 Zufuhr bei Lecks sofort unterbrechen und benachrichtigen dann sowohl den Fahrer als auch die BMW Zentrale via Satellit. Dennoch hat die Feuerwehr trotz des gutmütigen Verhaltens des LH 2- Tanks bereits einen Vorgehensplan für eventuelle Unfälle mit Wasserstofffahrzeugen entwickelt. Da sich H 2 bei der Verbrennung nicht wesentlich ausdehnt, sind zwar Explosionen von H 2 im Freien so gut wie ausgeschlossen, doch steigt der leichte Wasserstoff (0,09g/Liter), wenn er austritt, gemischt mit Luft auf. Er kann sich dann an Decken oder ähnlichem als explosives Gas ansammeln und dort leicht entzündet werden (z.b. durch einen Funken beim Licht anschalten), da Wasserstoff bei einem sehr breiten Mischungsverhältnis zwischen 4 Vol.-% bis 76 Vol.-% entzündlich ist. (siehe auch Abbildung 7). Dort würde Wasserstoff dann mit einer kaum sichtbaren Flamme brennen, da die charakteristische Emissionwellenlänge von H 2 Flammen bei nm (OH - - Radikale) und somit im ultravioletten Bereich liegt. Bei einem Fahrzeugbrand würde diese jedoch durch weitere brennende Gegenstände eingefärbt werden. Dies erleichtert dann die Arbeit der Feuerwehr. Ein weiteres Problem ist der Aggregatszustand des Wasserstoffs. Dieser liegt tiefkalt vor (eine sog. kryogene Flüssigkeit). Dadurch wird zwar die nötige Energiedichte erreicht, doch ist besondere Vorsicht geboten, da kryogene Flüssigkeiten und andere, durch diese Stoffe stark abgekühlte Gegenstände, bei Hautkontakt Kaltverbrennungen hervorrufen. 34
35 Es zeigte sich schließlich, dass der Umgang mit Wasserstoff nicht gefährlicher, aber anders als der mit Benzin [ist. Aber...] die Feuerwehren können [...] sich durch Information und Schulung rechtzeitig darauf einstellen. 26 Um einen Feuerwehreinsatz zu vermeiden, sind jedoch in dem Fahrzeug mehrere Wasserstoffsensoren eingebaut, die die H 2 Zufuhr bei Lecks sofort unterbrechen können und den Fahrer benachrichtigen Die Wasserstofftankstelle Um ein Wasserstoffauto effizient nutzen zu können, ist die wohl wichtigste Voraussetzung die Schaffung eines genauso dichten Netzes an Wasserstofftankstellen, wie wir es bereits heute bei Benzin- und Diesel-Tankstellen haben. Derzeit gibt es in Deutschland etwa konventioneller Tankstellen. Eine annähernd große Anzahl von Wasserstofftankstellen wäre also nötig. Doch soweit ist die Entwicklung trotz ihres rasanten Tempos noch nicht. Aber schon heute können wir erleben, wie man in Zukunft tankt oder besser tanken lässt. Als erstmals große Mengen benzinbetriebener Autos betankt werden mussten, übernahm ein Tankwart diese Der Tankroboter betankt einen BMW Aufgabe, denn der Tankvorgang erforderte einige Sachkenntnis. Obwohl dies bei der Einführung der Wasserstofftankstellen wieder ähnlich ist, wird kein Tankwart benötigt, sondern alles läuft vollautomatisch ab. Den ersten voll funktionsfähigen Tankroboter für Otto- und Dieselkraftstoffe stellte Aral 1995 vor. Der heute eingesetzte Roboter ist eine Weiterentwicklung dieses Prototyps, mit dem nun flüssiger Wasserstoff problemlos, komfortabel und sicher getankt werden kann. Anfang Mai wurde die Wasserstofftankstelle am Münchner Flughafen eröffnet und ist seither für den öffentlichen Betrieb zugänglich. Sie war die erste öffentliche Tankstelle für flüssigen Wasserstoff. Bei dem Tankroboter für Flüssigwasserstoff dauert der Tankvorgang nur fünf bis sechs Minuten. Der Roboter befüllt den rund 100 Liter fassenden Tank des NECAR 4 vom DaimlerChrysler mit flüssigem Wasserstoff. Der Fahrer muss nicht einmal aussteigen. Der Preis je Liter Wasserstoff beträgt ca. 0,56 Euro. Dabei handelt es sich um die reinen Produktkosten. Ein Liter flüssiger Wasserstoff entspricht vom Energiegehalt her dem Äquivalent von rund 0,3 Liter konventionellem Ottokraftstoff (s. auch Vergleich der Rohstoffe). 26 Pehr, K.; Fischer, P.; Zimmermann, G.; in: BRANDSchutz 11/2000 Seite
36 Die gesamte Tankstelle am Münchner Flughafen umfasst ein Areal von 4000 m 2. Doch es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass dies an der Größe der Tanks liege. Die Anlage umfasst zusätzlich zu den Tanks für Flüssigwasserstoff noch eine Produktionsanlage für gasförmigen Wasserstoff, da dieser nicht wie der flüssige aus Ingolstadt, aus der Wasserstoffverflüssigungsanlage der Linde AG, geliefert wird. Der gasförmige Wasserstoff entsteht in einem modernen Elektrolyseur der GHW (Gesellschaft für Hochleistungselektrolyseure zur Wasserstofferzeugung mbh) und wird auf 350 bar verdichtet. Mit einer Produktion von 100m 3 /h ist nach 17 Betriebsstunden genug Wasserstoff hergestellt, um die Busse am Flughafen München, die bisher die einzigen Nutzer des gasförmigen Wasserstoffes sind, zu versorgen. Bevor der durch Elektrolyse entstandene Wasserstoff in den Hydridspeicher kommt, wird er gereinigt und getrocknet. So wird z.b. der im Rohr enthaltene Sauerstoff zu Wasser umgesetzt und abgeführt. In der Betankungsphase des Speichers der Tankstelle wird die Temperatur des eingeleiteten Wasserstoffs gering gehalten (max. 5 C). Wird jedoch Wasserstoff an den Kompressor zur Fahrzeugbetankung abgegeben, wird er stetig erwärmt, um dem Kompressor einen Vordruck von max. 30 bar zu liefern, der zur Betankung der Busse nötig ist. Alle Speichertanks werden zu zwei Gruppen zusammengefasst, von denen in der Regel die eine Gruppe be-, die andere entladen wird. Erfolgt keine Entladung durch Betankung von Bussen, können auch beide zeitgleich geladen werden. Den gasförmigen Wasserstoff müssen die Busfahrer jedoch noch manuell tanken. Gesamtansicht der Tankstelle am Münchner Flughafen Der Betrieb der Tankstelle lief bisher ohne einen gefährlichen Zwischenfall ab und so können wir uns in Zukunft auf noch mehr dieser komfortablen und umweltfreundlichen Tankstellen freuen. 7. Zukunftsvisionen - die Pläne von BMW 36
37 Wasserstoff ist der automobile Antrieb der Zukunft, denn nur Wasserstoff löst das globale Umweltproblem, den Treibhauseffekt. Dazu muss Wasserstoff regenerativ erzeugt, weltweit verteilt und in entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen genutzt werden. Schon jetzt produziert BMW seinen Wasserstoff regenerativ in Kooperation mit den Firmen Bayernwerk, Linde und Siemens in einer Solar-Wasserstoff-Produktionsanlage im Bayerischen Wald. Wasserstoff lässt sich zwar auf ganz unterschiedliche Weise aus der Natur gewinnen, die Elektrolyse ist aber im Moment wegen des unermesslichen Potenzials wohl der einzige Weg, der im großen Maßstab Erfolge verspricht. Doch Elektrolyse braucht Strom. Der sollte aus regenerativen Quellen gewonnen werden. Hier stehen Wasserund Windkraft sowie Sonnenenergie zur Verfügung. Die derzeitige Wasserstoffproduktion für BMW erfolgt durch eine Photovoltaikanlage. Die Produktion alleine wäre nutzlos ohne den Aufbau eines dichten Versorgungsnetzes. Damit in einigen Jahrzehnten eine solche Infrastruktur für Wasserstoff zur Verfügung steht, wird bereits heute der Grundstein gelegt. Die heutige Infrastruktur beschränkt sich auf die Verwendung des Wasserstoffes in der Chemieindustrie und ist somit nicht öffentlich und in akzeptabler Menge verfügbar. Doch das muss der Fall sein, wenn wir Wasserstoffautos sinnvoll betreiben wollen. Allerdings wäre dieses Netzwerk schon mal eine Grundlage, wenn man es öffentlich zugänglich machen könnte. Dann müsste es nur noch weiter ausgebaut werden. BMW verwirklicht die Wasserstoffversorgung, in Zusammenarbeit mit Aral, durch den Betrieb einer der wenigen öffentlichen Wasserstoff Tankstellen. Sie befindet sich am Flughafen München. In Berlin ist eine weitere in Bau und eine dritte in Planung (vgl. andere Angaben). Ziel ist eine möglichst flächendeckende Wasserstoffversorgung. Doch da diese noch nicht vollständig gewährleistet ist, setzt BMW auf den Hybridantrieb des 750hL. Der Verbrennungsmotor des 750hL kann während des Betriebs von Wasserstoff- auf Benzinverbrennung umstellen. Das ermöglicht ein mit regenerativem Kraftstoff betriebenes Auto zu fahren, obwohl die Infrastruktur noch lückenhaft ist. Der Tank im Heck, mit minus 253 Celsius kaltem Wasserstoff, reicht je nach Fahrweise für bis zu 400 Kilometer. Während der gesamten Fahrt muss man keinesfalls auf gewohnten Komfort verzichten. Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit Brennstoffzellen-Technologie, die ihren Strom für den Elektromotor, mit ungewohntem Geräusch, erzeugen, ist der Wasserstoffverbrennungsmotor leise wie die jetzigen BMW Triebwerke. Die Brennstoffzelle findet auch im 750hL Anwendung. Sie sorgt für die Bordstromversorgung für HiFi-Anlage, Sicherheitselektronik Elektromotoren und die Klimaanlage. Besonders die wurde optimiert hinsichtlich des Betriebs unabhängig vom Motor, so dass auch der Standbetrieb möglich ist. 37
38 Die seit Mai 2000 im Einsatz befindliche Flotte von 15 BMW 750hL-Fahrzeugen weist den Weg zu einer umweltfreundlichen, individuellen Mobilität. BMW will dies durch eine Serienproduktion des 750 hl s in den nächsten Jahren erweitern. All das führt zu einer umweltbewussten Mobilität, ohne die Freude am Fahren zu verlieren. 38
39 8. Anhang 8.1. Tabellen und Bilder Tabelle 1 Brennstoffzellentypen: 27 Brennstoffzellentyp Betriebs- Temperatur [ C] Elektrolyt Brennstoff Oxidations- Medium Typische Einheitsgröße [kw e ] Alkalische Brennstoffzelle (AFC) Alkalilauge H 2 Sauerstoff << 100 Membranbrennstoffzelle (PEM) Perflurierter sulfonierter Polymerelektrolyt H 2 und reformierter H 2 Luftsauerstoff 0,1-500 Schmelzkarbonatbrennstoffzelle (MCFC) Festoxidbrennstoffzelle (SOFC) Schmelzkarbonatlösung Festkeramischer Elektrolyt H 2 und CO aus interner Reformierung von Erd- oder Kohlegas H 2 und CO aus interner Reformierung von Erd- oder Kohlegas Luftsauerstoff 800-2,000 (Anlagen bis zu 100,000) Luftsauerstoff , Quelle: Hyweb.de 39
40 Tabelle 2: Mögliche Anwendungsfelder der Brennstoffzellentypen 28 Brennstoffzellentyp Phosphorsaure Brennstoffzelle (PAFC) Schmelzkarbonatbrennstoffzelle (MCFC) Festoxidbrennstoffzelle (SOFC) Wahrscheinlichste Anwendungsfelder Stationäre Anwendungen für dedizierte Strom- (und Wärme-) Produktion Mobile Anwendungen im Schienenverkehr Stationäre Anwendungen für kombinierte Stromund Dampfproduktion Stationäre Anwendungen im EVU-Einsatz Stationäre Anwendungen in der häuslichen Wärme- (und Strom-) Produktion Stationäre Anwendungen für kommerzielle Wärme- und Stromproduktion Sationäre Anwendungen EVU-Sektor; Mobile Anwendungen Schienenverkehr Verfügbarkeit > > vgl. Hyweb.de 40
41 Abbildung 1: Energiebedarf Abbildung 2: Verkehrsleistung 41
42 Abbildung 3: Wasserstoff-BMW Abbildung 4: Die SOFC mit Reformer 42
43 Abbildung 5 im Kofferraum Abbildung 6: Der LH2-Tank 43
44 Abbildung 7: LH2-Speicher an der Tankstelle Flughafen München Abbildung : Sicherheit Worst-Case am LH2-Tank 44
Verbrennungsmotoren. Meinungsumfrage. CleanEnergy Project Survey
 Wasserstoff als Kraftstoff für Verbrennungsmotoren Meinungsumfrage Umfrageteilnehmer Mitglieder des CleanEnergy Project Branchennetzwerks: Personen über 18 hre Über 50 % der Personen haben Abitur und/oder
Wasserstoff als Kraftstoff für Verbrennungsmotoren Meinungsumfrage Umfrageteilnehmer Mitglieder des CleanEnergy Project Branchennetzwerks: Personen über 18 hre Über 50 % der Personen haben Abitur und/oder
Thema: Alternative Antriebsformen für Kraftfahrzeuge
 Thema: Alternative Antriebsformen für Kraftfahrzeuge vorgelegt von Name: Cem Koc Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 1. Begründung des Themas 3 2. Hauptteil 3 1. Benzin, bald Vergangenheit? 3 2. Neue Energieformen
Thema: Alternative Antriebsformen für Kraftfahrzeuge vorgelegt von Name: Cem Koc Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 1. Begründung des Themas 3 2. Hauptteil 3 1. Benzin, bald Vergangenheit? 3 2. Neue Energieformen
Wasserstoff. - Den Antrieb eines Fahrzeuges durch die direkte Verbrennung von Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor
 Wasserstoff Einführung Der so genannte Treibhauseffekt dürfte wohl jedem spätestens durch die aktuelle Diskussion um den UNO-Klimabericht 2007 ein Begriff sein. Auch dürfte allgemein bekannt sein, dass
Wasserstoff Einführung Der so genannte Treibhauseffekt dürfte wohl jedem spätestens durch die aktuelle Diskussion um den UNO-Klimabericht 2007 ein Begriff sein. Auch dürfte allgemein bekannt sein, dass
Station 1.1: Dampfreformierung
 Station 1.1: Dampfreformierung Kosten: 8 Energie pro Methan, 1 Wasser pro Methan Ausgangsstoff: Kohlenwasserstoffverbindung(meist Erdgase), Wasser(dampf), Wärme Funktion: prinzipiell eine Verbrennung des
Station 1.1: Dampfreformierung Kosten: 8 Energie pro Methan, 1 Wasser pro Methan Ausgangsstoff: Kohlenwasserstoffverbindung(meist Erdgase), Wasser(dampf), Wärme Funktion: prinzipiell eine Verbrennung des
Willkommen in der Zukunft! Wasserstoff tanken. Mit Strom fahren.
 Willkommen in der Zukunft! Wasserstoff tanken. Mit Strom fahren. Fortschritt tanken Sie bei Westfalen: für Mobilität heute und morgen. Mit Wasserstoff in die Zukunft Seit je fördert die Westfalen Gruppe
Willkommen in der Zukunft! Wasserstoff tanken. Mit Strom fahren. Fortschritt tanken Sie bei Westfalen: für Mobilität heute und morgen. Mit Wasserstoff in die Zukunft Seit je fördert die Westfalen Gruppe
Münchener Wissenschaftstage 23. Oktober 2004
 Münchener Wissenschaftstage 23. Energieträger Wasserstoff, Wasserstoffmotor und Brennstoffzellen Beauftragter des Vorstands für Verkehr und Umwelt Mobilität ist die Basis unseres Wohlstands Sicherung der
Münchener Wissenschaftstage 23. Energieträger Wasserstoff, Wasserstoffmotor und Brennstoffzellen Beauftragter des Vorstands für Verkehr und Umwelt Mobilität ist die Basis unseres Wohlstands Sicherung der
Willkommen in der Zukunft! Wasserstoff tanken. Mit Strom fahren.
 Willkommen in der Zukunft! Wasserstoff tanken. Mit Strom fahren. Fortschritt tanken Sie bei Westfalen: für Mobilität heute und morgen. Mit Wasserstoff in die Zukunft Seit je fördert die Westfalen Gruppe
Willkommen in der Zukunft! Wasserstoff tanken. Mit Strom fahren. Fortschritt tanken Sie bei Westfalen: für Mobilität heute und morgen. Mit Wasserstoff in die Zukunft Seit je fördert die Westfalen Gruppe
Wasserstoffautos. Leon Bentrup. 20. Januar Funktionsweise, Kritik und Gründe
 GFS NwT 2014 Fr. Maschner Wasserstoffautos Funktionsweise, Kritik und Gründe Leon Bentrup 20. Januar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort 3 2 Wasserstoff 4 2.1 Eigenschaften.................................
GFS NwT 2014 Fr. Maschner Wasserstoffautos Funktionsweise, Kritik und Gründe Leon Bentrup 20. Januar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort 3 2 Wasserstoff 4 2.1 Eigenschaften.................................
GRÜNDE FÜR DIE NUTZUNG VON ATOMENERGIE
 GRÜNDE FÜR DIE NUTZUNG VON ATOMENERGIE FOLGEND GRÜNDE SPRECHEN FÜR DIE WEITERE NUTZUNG VON ATOM-KRAFTWERKEN IN DEUTSCHLAND UND GEGEN IHRE ABSCHALTUNG: - positive Energiebilanz - gute CO2-Bilanz - keine
GRÜNDE FÜR DIE NUTZUNG VON ATOMENERGIE FOLGEND GRÜNDE SPRECHEN FÜR DIE WEITERE NUTZUNG VON ATOM-KRAFTWERKEN IN DEUTSCHLAND UND GEGEN IHRE ABSCHALTUNG: - positive Energiebilanz - gute CO2-Bilanz - keine
Einführung in Technik und Funktionsweise von Brennstoffzellen und Batterieantrieben Prof. Dr. K. Andreas Friedrich
 Einführung in Technik und Funktionsweise von Brennstoffzellen und Batterieantrieben Prof. Dr. K. Andreas Friedrich Folie 1 > Friedrich, Ungethüm > Institut für Technische Thermodynamik, Institut für Fahrzeugkonzepte
Einführung in Technik und Funktionsweise von Brennstoffzellen und Batterieantrieben Prof. Dr. K. Andreas Friedrich Folie 1 > Friedrich, Ungethüm > Institut für Technische Thermodynamik, Institut für Fahrzeugkonzepte
Wasserstoff/Hydrogen-Forum für Einsteiger
 Wasserstoff/Hydrogen-Forum für Einsteiger Energie? Wofür brauchen wir die eigentlich? Auch wenn es uns kaum bewußt ist, unser aller Leben ist stark mit dem Begriff "Energie" verknüpft. Ohne Energie funktioniert
Wasserstoff/Hydrogen-Forum für Einsteiger Energie? Wofür brauchen wir die eigentlich? Auch wenn es uns kaum bewußt ist, unser aller Leben ist stark mit dem Begriff "Energie" verknüpft. Ohne Energie funktioniert
Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels katalytischer Methangasreaktoren
 Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels katalytischer Methangasreaktoren Dr. rer. nat. Manfred Grigo, Berlin, Rostock Prof. a. D. Dr.-Ing. Karl-Hermann Busse, Berlin, Rostock 1. Biogasanlagen 1.1
Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels katalytischer Methangasreaktoren Dr. rer. nat. Manfred Grigo, Berlin, Rostock Prof. a. D. Dr.-Ing. Karl-Hermann Busse, Berlin, Rostock 1. Biogasanlagen 1.1
Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels katalytischer Methangasreaktoren
 Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels katalytischer Methangasreaktoren Dr. rer. nat. Manfred Grigo, Berlin, Rostock Prof. a. D. Dr.-Ing. Karl-Hermann Busse, Berlin, Rostock 1. Biogasanlagen 1.1
Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels katalytischer Methangasreaktoren Dr. rer. nat. Manfred Grigo, Berlin, Rostock Prof. a. D. Dr.-Ing. Karl-Hermann Busse, Berlin, Rostock 1. Biogasanlagen 1.1
Die Wirkungsweise einer Brennstoffzelle. Ein Vortrag von Bernard Brickwedde
 Die Wirkungsweise einer Brennstoffzelle Ein Vortrag von Bernard Brickwedde Inhalt Allgemein Definition Geschichte Anwendungsgebiete Aufbau Theoretische Grundlagen Redoxreaktion Wirkungsgrad Elektrochemische
Die Wirkungsweise einer Brennstoffzelle Ein Vortrag von Bernard Brickwedde Inhalt Allgemein Definition Geschichte Anwendungsgebiete Aufbau Theoretische Grundlagen Redoxreaktion Wirkungsgrad Elektrochemische
Energieeffizienz bei Kraftwerken mit fossilen Energieträgern
 Energieeffizienz bei Kraftwerken mit fossilen Energieträgern Gliederung 1. Grundprobleme bei Kraftwerken 2. Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung Funktion eines Kraftwerkes Wirkungsgrad Erhöhung des Wirkungsgrades:
Energieeffizienz bei Kraftwerken mit fossilen Energieträgern Gliederung 1. Grundprobleme bei Kraftwerken 2. Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung Funktion eines Kraftwerkes Wirkungsgrad Erhöhung des Wirkungsgrades:
Wasserstoff für die Energiewende Prof. Dr. Peter Tromm
 Wasserstoff für die Energiewende Prof. Dr. Peter Tromm 25. Januar 2018 FHO Fachhochschule Ostschweiz Agenda Überblick Energiequellen Wasserstoff als Energiespeicher Verbrennung von Wasserstoff Anwendungen
Wasserstoff für die Energiewende Prof. Dr. Peter Tromm 25. Januar 2018 FHO Fachhochschule Ostschweiz Agenda Überblick Energiequellen Wasserstoff als Energiespeicher Verbrennung von Wasserstoff Anwendungen
Historie und Histörchen (48): Wasserstoff auf Irrwegen
 Historie und Histörchen (48): Wasserstoff auf Irrwegen Von Hanns-Peter von Thyssen Bornemissza An einem trüben Novembertag 1988 übergaben BMW-Manager einem besonderen Mann ein ganz besonderes Auto - vor
Historie und Histörchen (48): Wasserstoff auf Irrwegen Von Hanns-Peter von Thyssen Bornemissza An einem trüben Novembertag 1988 übergaben BMW-Manager einem besonderen Mann ein ganz besonderes Auto - vor
Reformierung von Kohlenwasserstoffen PEM-Elektrolyse
 Bereitstellung von Wasserstoff Reformierung von Kohlenwasserstoffen PEM-Elektrolyse Ursula Wittstadt Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Wasserstoff Expo 2002 Hamburg, 10.10.2002 Fraunhofer
Bereitstellung von Wasserstoff Reformierung von Kohlenwasserstoffen PEM-Elektrolyse Ursula Wittstadt Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Wasserstoff Expo 2002 Hamburg, 10.10.2002 Fraunhofer
Power, der die Puste nie ausgeht!
 Fuel Cells Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Power, der die Puste nie ausgeht! Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Die Projektpartner Das Brennstoffzellen-Projekt im Hotelpark Westerwald-Treff
Fuel Cells Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Power, der die Puste nie ausgeht! Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Die Projektpartner Das Brennstoffzellen-Projekt im Hotelpark Westerwald-Treff
Speichertechniken für die zukünftige Energieversorgung Energiespeicher-Symposium Stuttgart 06./07. März Ulrich Wagner
 Speichertechniken für die zukünftige Energieversorgung Energiespeicher-Symposium Stuttgart 06./07. März 2012 Ulrich Wagner Energiespeicher strategische Elemente des zukünftigen Energiesystems - Energiekonzept
Speichertechniken für die zukünftige Energieversorgung Energiespeicher-Symposium Stuttgart 06./07. März 2012 Ulrich Wagner Energiespeicher strategische Elemente des zukünftigen Energiesystems - Energiekonzept
Energiespeichersysteme
 Speichersysteme - A-1 Energiespeichersysteme 1. Wasserstofftechnologie a) Gewinnung von Wasserstoff b) Sicherheitsproblematik c) Speicherung, Systemlösungen 2. Konventionelle Blockheizkraftwerke - Kraft-Wärme-(Kälte-)Kopplung
Speichersysteme - A-1 Energiespeichersysteme 1. Wasserstofftechnologie a) Gewinnung von Wasserstoff b) Sicherheitsproblematik c) Speicherung, Systemlösungen 2. Konventionelle Blockheizkraftwerke - Kraft-Wärme-(Kälte-)Kopplung
Wasserstoff als Energieträger Gliederung:
 Wasserstoff als Energieträger Gliederung: Wasserstoff: Energie speichern und verteilen Die Brennstoffzelle Wasserstoff aus der Ptm6 Alge Wasserstoff als Energiespeicher Der umweltfreundliche Akku: Um Wasserstoff
Wasserstoff als Energieträger Gliederung: Wasserstoff: Energie speichern und verteilen Die Brennstoffzelle Wasserstoff aus der Ptm6 Alge Wasserstoff als Energiespeicher Der umweltfreundliche Akku: Um Wasserstoff
Übungsaufgaben zu den LPE 16: Wärmekraftwerke und 17: Abgasreinigung
 Übungsaufgaben zu den LPE 16: Wärmekraftwerke und 17: Abgasreinigung Themenbereiche Clausius-Rankine-Prozess T,s-Diagramm Abgasreinigung Inhaltsverzeichnis 2 Übungsaufgaben zur LPE 17 (Abgasreinigung)...1
Übungsaufgaben zu den LPE 16: Wärmekraftwerke und 17: Abgasreinigung Themenbereiche Clausius-Rankine-Prozess T,s-Diagramm Abgasreinigung Inhaltsverzeichnis 2 Übungsaufgaben zur LPE 17 (Abgasreinigung)...1
Sich selbststromversorgende Elektroautos
 Projekt-Team: Damian Gemperle / Pascal Hostettler Beruf: Logistiker Lehrjahr: 2. Lehrjahr Name des Betriebs: Emmi AG Ostermundigen / Name der Lehrperson: Manuel Scheidegger Zusammenfassung: Elektrische
Projekt-Team: Damian Gemperle / Pascal Hostettler Beruf: Logistiker Lehrjahr: 2. Lehrjahr Name des Betriebs: Emmi AG Ostermundigen / Name der Lehrperson: Manuel Scheidegger Zusammenfassung: Elektrische
Verkehrsmittel im Vergleich 1
 Gliederung 1. Verkehrsmittel im Vergleich 2. Verkehrsverhalten 3. Alternative Antriebsmöglichkeiten bzw. Kraftstoffe a) Brennstoffzellenfahrzeug b) Hybridfahrzeug c) Biodiesel Verkehrsmittel im Vergleich
Gliederung 1. Verkehrsmittel im Vergleich 2. Verkehrsverhalten 3. Alternative Antriebsmöglichkeiten bzw. Kraftstoffe a) Brennstoffzellenfahrzeug b) Hybridfahrzeug c) Biodiesel Verkehrsmittel im Vergleich
Inhalt. History Prinzip der Brennstoffzelle Wasserstoff-Sauerstoff-BZ. Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell Direct Methanol Fuel Cell.
 Brennstoffzellen Inhalt History Prinzip der Brennstoffzelle Wasserstoff-Sauerstoff-BZ Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell Direct Methanol Fuel Cell o Stacks o Anwendung o Fazit History Erste BZ vor
Brennstoffzellen Inhalt History Prinzip der Brennstoffzelle Wasserstoff-Sauerstoff-BZ Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell Direct Methanol Fuel Cell o Stacks o Anwendung o Fazit History Erste BZ vor
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
Auftragskarte 1b Mein kleines Wetter-Retter-Buch der erneuerbaren Energien
 Auftragskarte 1b Mein kleines Wetter-Retter-Buch der erneuerbaren Energien 1) Lies dir in Ruhe die Texte durch und löse die Aufgaben. 2) Tipp: Du musst nicht das ganze Buch auf einmal bearbeiten. Lass
Auftragskarte 1b Mein kleines Wetter-Retter-Buch der erneuerbaren Energien 1) Lies dir in Ruhe die Texte durch und löse die Aufgaben. 2) Tipp: Du musst nicht das ganze Buch auf einmal bearbeiten. Lass
1. Wer sich über Erdgas informieren will, findet im Internet viele Informationen dazu, zum Beispiel diese:
 Autos, die mit Erdgas fahren Seit mehr als 15 Jahren werden Erdgasautos in Serie gefertigt. Das Erdgas wird in Tanks mitgeführt und steht unter einem Druck von 200 bar. Mittlerweile gibt es in Österreich
Autos, die mit Erdgas fahren Seit mehr als 15 Jahren werden Erdgasautos in Serie gefertigt. Das Erdgas wird in Tanks mitgeführt und steht unter einem Druck von 200 bar. Mittlerweile gibt es in Österreich
Erdgas/Biogas Die Energie.
 Erdgas/Biogas Die Energie. 1 Erdgas: effizient. Erdgas ist ein natürlich vorkommender brennbarer, farb- und geruchloser Energieträger und kann ohne Umwandlung direkt als Brennstoff und Treibstoff genutzt
Erdgas/Biogas Die Energie. 1 Erdgas: effizient. Erdgas ist ein natürlich vorkommender brennbarer, farb- und geruchloser Energieträger und kann ohne Umwandlung direkt als Brennstoff und Treibstoff genutzt
Wasserstoff Energieträger der Zukunft?
 Wasserstoff Energieträger der Zukunft? Udo Rindelhardt Einleitung Derzeitige Nutzung von Wasserstoff Wasserstoff in der Energiewirtschaft Mögliche Szenarien Wasserstoff aus Kernenergie Energieträger Wasserstoff
Wasserstoff Energieträger der Zukunft? Udo Rindelhardt Einleitung Derzeitige Nutzung von Wasserstoff Wasserstoff in der Energiewirtschaft Mögliche Szenarien Wasserstoff aus Kernenergie Energieträger Wasserstoff
WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999
 WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999 Autor: Michael Houben Kamera: Dieter Stürmer Ton : Jule Buerjes Schnitt: Birgit Köster Abschrift des Filmtextes 1: Automobile 0.08 Es sieht eigentlich ganz normal
WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999 Autor: Michael Houben Kamera: Dieter Stürmer Ton : Jule Buerjes Schnitt: Birgit Köster Abschrift des Filmtextes 1: Automobile 0.08 Es sieht eigentlich ganz normal
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
Warum ist Feuer nützlich und warum sind Flammen heiß?
 Warum ist Feuer nützlich und warum sind Flammen heiß? Professor Dr.-Ing. Dieter Brüggemann KinderUniversität Bayreuth 1. Juli 2009 Wozu nutzen wir Feuer? Wir nutzen Feuer, um zu beleuchten Quelle: Wikipedia
Warum ist Feuer nützlich und warum sind Flammen heiß? Professor Dr.-Ing. Dieter Brüggemann KinderUniversität Bayreuth 1. Juli 2009 Wozu nutzen wir Feuer? Wir nutzen Feuer, um zu beleuchten Quelle: Wikipedia
Neues Verfahren für Kohlekraftwerke
 Diskussionsbeitrag: Neues Verfahren für Kohlekraftwerke JOCHEN OTTO PRASSER Kohlekraftwerke Dreckschleudern sind moderne Kohlekraftwerke nicht mehr. Selbst der Feinstaub wird durch effektive Filter aus
Diskussionsbeitrag: Neues Verfahren für Kohlekraftwerke JOCHEN OTTO PRASSER Kohlekraftwerke Dreckschleudern sind moderne Kohlekraftwerke nicht mehr. Selbst der Feinstaub wird durch effektive Filter aus
Energie. Begriffsbildung (+einleitende Gedanken) Regenerative Energiequellen, Technik der Energieumwandlung. Energieträger und Speicherung
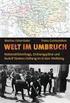 Alternative oder Erneuerbare oder Regenerative oder Nachhaltige Energie Begriffsbildung (+einleitende Gedanken) Regenerative Energiequellen, Technik der Energieumwandlung Energieträger und Speicherung
Alternative oder Erneuerbare oder Regenerative oder Nachhaltige Energie Begriffsbildung (+einleitende Gedanken) Regenerative Energiequellen, Technik der Energieumwandlung Energieträger und Speicherung
adele ein speicher für grünen strom
 adele ein speicher für grünen strom Sechs fragen zum projekt in Staßfurt 2 ADELE - Ein SpEichEr für grünen Strom ADELE - Ein SpEichEr für grünen Strom 3 Was plant rwe power in stassfurt? RWE Power möchte
adele ein speicher für grünen strom Sechs fragen zum projekt in Staßfurt 2 ADELE - Ein SpEichEr für grünen Strom ADELE - Ein SpEichEr für grünen Strom 3 Was plant rwe power in stassfurt? RWE Power möchte
2008: Verantwortung erfahren
 2008: Verantwortung erfahren Dipl. Ing. Jürgen J Keller Geschäftsf ftsführer General Motors Austria GmbH Graz, 18. Dezember 2007 Einleitung Allgemeines Bewusstsein für Umwelt(schutz) wächst EU-Richtlinien
2008: Verantwortung erfahren Dipl. Ing. Jürgen J Keller Geschäftsf ftsführer General Motors Austria GmbH Graz, 18. Dezember 2007 Einleitung Allgemeines Bewusstsein für Umwelt(schutz) wächst EU-Richtlinien
100 Fragen zur Wasserstofftechnologie
 T. Jordan, IKET 17. Juli 2007 100 Fragen zur Wasserstofftechnologie 1. Wer hat wann den ersten Nachweis der Existenz von Wasserstoff geführt und wer hat wann die Bezeichnung Wasserbildner ( hydrogen )
T. Jordan, IKET 17. Juli 2007 100 Fragen zur Wasserstofftechnologie 1. Wer hat wann den ersten Nachweis der Existenz von Wasserstoff geführt und wer hat wann die Bezeichnung Wasserbildner ( hydrogen )
4 Energie sparen. 4a Lampen im Vergleich. 4c Das Thermostatventil. 5 Alternative Energiequellen. 5b Photovoltaik (Strom) 5c Sonnenkollektor
 EnergieWerkstatt 1 Was ist Energie? 1a Knatterboot 4 Energie sparen 4a Lampen im Vergleich 1b Energiefahrrad 4b Heizen OHNE / MIT Wärmedämmung 1c Energie in Lebensmitteln 4c Das Thermostatventil 1d Solarzeppelin
EnergieWerkstatt 1 Was ist Energie? 1a Knatterboot 4 Energie sparen 4a Lampen im Vergleich 1b Energiefahrrad 4b Heizen OHNE / MIT Wärmedämmung 1c Energie in Lebensmitteln 4c Das Thermostatventil 1d Solarzeppelin
Brennstoffzelle Option zur Elektrifizierung der Langstreckenmobilität
 Brennstoffzelle Option zur Elektrifizierung der Langstreckenmobilität Dr.-Ing. Christian Martin Zillich (Volkswagen AG) Antriebsforschung Agenda Motivation für die automobile Elektrifizierung Brennstoffzellensystem
Brennstoffzelle Option zur Elektrifizierung der Langstreckenmobilität Dr.-Ing. Christian Martin Zillich (Volkswagen AG) Antriebsforschung Agenda Motivation für die automobile Elektrifizierung Brennstoffzellensystem
BOX 06. Welches Fahrzeug ist das beste?.
 Welches Fahrzeug ist das beste?. Welches Verkehrsmittel ist das umweltfreundlichste? Flugzeug, Auto, Zug oder auch das Rad verbrauchen Energie und erzeugen Abgase. Beim Flugzeug und beim Auto können wir
Welches Fahrzeug ist das beste?. Welches Verkehrsmittel ist das umweltfreundlichste? Flugzeug, Auto, Zug oder auch das Rad verbrauchen Energie und erzeugen Abgase. Beim Flugzeug und beim Auto können wir
Wald, Holz und Kohlenstoff
 Wald, Holz und Kohlenstoff Dr. Uwe Paar Landesbetrieb HESSEN-FORST Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Gliederung Bedeutung des Waldes Leistungen nachhaltiger Forstwirtschaft Wie entsteht Holz?
Wald, Holz und Kohlenstoff Dr. Uwe Paar Landesbetrieb HESSEN-FORST Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Gliederung Bedeutung des Waldes Leistungen nachhaltiger Forstwirtschaft Wie entsteht Holz?
TH-E Box der Weg zur solargestützten Energieautonomie
 TH-E Box der Weg zur solargestützten Energieautonomie 9. Innovationstagung der Randenkommission Franz Reichenbach ISC Konstanz e.v. 28. November 18 Ertragsschwankungen einer PV-Anlage 12 24 36 48 72 84
TH-E Box der Weg zur solargestützten Energieautonomie 9. Innovationstagung der Randenkommission Franz Reichenbach ISC Konstanz e.v. 28. November 18 Ertragsschwankungen einer PV-Anlage 12 24 36 48 72 84
Biodiesel? Wasserstoff?? Solarstrom???
 Biodiesel? Wasserstoff?? Solarstrom??? Welcher alternative Energieträger macht uns nachhaltig mobil? Roland Wengenmayr 1 Kernreaktor und Gasturbine 2 Atmosphäre: 1000 km hoch 3 Atmosphäre: 1000 km hoch
Biodiesel? Wasserstoff?? Solarstrom??? Welcher alternative Energieträger macht uns nachhaltig mobil? Roland Wengenmayr 1 Kernreaktor und Gasturbine 2 Atmosphäre: 1000 km hoch 3 Atmosphäre: 1000 km hoch
Wasserstoff - der Energieträger der Zukunft. für eine mobile Welt
 Wasserstoff - der Energieträger der Zukunft für eine mobile Welt Dipl.-Ing. Wolfgang Burmeister Telefon und Fax 089 / 351 99 60 email: BurmeisterH2@aol.com 18.04.2005 Wolfgang Burmeister Wasserstoff-Projekt
Wasserstoff - der Energieträger der Zukunft für eine mobile Welt Dipl.-Ing. Wolfgang Burmeister Telefon und Fax 089 / 351 99 60 email: BurmeisterH2@aol.com 18.04.2005 Wolfgang Burmeister Wasserstoff-Projekt
Grundlagen der Wärmelehre
 Ausgabe 2007-09 Grundlagen der Wärmelehre (Erläuterungen) Die Wärmelehre ist das Teilgebiet der Physik, in dem Zustandsänderungen von Körpern infolge Zufuhr oder Abgabe von Wärmeenergie und in dem Energieumwandlungen,
Ausgabe 2007-09 Grundlagen der Wärmelehre (Erläuterungen) Die Wärmelehre ist das Teilgebiet der Physik, in dem Zustandsänderungen von Körpern infolge Zufuhr oder Abgabe von Wärmeenergie und in dem Energieumwandlungen,
STENDAL. Das Windkraftwerk im Elektroauto. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht. Simon Hänel Julian Willingmann
 ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht STENDAL Das Windkraftwerk im Elektroauto Simon Hänel Julian Willingmann Schule: Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Westernstr. 29 38855 Wernigerode
ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht STENDAL Das Windkraftwerk im Elektroauto Simon Hänel Julian Willingmann Schule: Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Westernstr. 29 38855 Wernigerode
Wärmepumpe. Verflüssiger. Verdichter. Strom. Drosselventil. Umwelt
 Wärmepumpe Wärmepumpe Eine Wärmepumpe nutzt die in der Umwelt gespeicherte Wärme, etwa aus der Außenluft oder dem Erdboden. Das Temperaturniveau dieser in der Umwelt gespeicherten Energie wird mittels
Wärmepumpe Wärmepumpe Eine Wärmepumpe nutzt die in der Umwelt gespeicherte Wärme, etwa aus der Außenluft oder dem Erdboden. Das Temperaturniveau dieser in der Umwelt gespeicherten Energie wird mittels
Verbrennungskraftmaschine
 Wirtz Luc 10TG2 Verbrennungskraftmaschine Eine Verbrennungskraftmaschine ist im Prinzip jede Art von Maschine, die mechanische Energie in einer Verbrennungskammer gewinnt. Die Kammer ist ein fester Bestandteil
Wirtz Luc 10TG2 Verbrennungskraftmaschine Eine Verbrennungskraftmaschine ist im Prinzip jede Art von Maschine, die mechanische Energie in einer Verbrennungskammer gewinnt. Die Kammer ist ein fester Bestandteil
Perspektiven einer Wasserstoff-Energiewirtschaft
 Perspektiven einer Wasserstoff-Energiewirtschaft Vortragsreihe Naturwissenschaften Seniorenstudium der LMU München, 8. Januar 2007 Prof. Dr.-Ing. U. Wagner Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik
Perspektiven einer Wasserstoff-Energiewirtschaft Vortragsreihe Naturwissenschaften Seniorenstudium der LMU München, 8. Januar 2007 Prof. Dr.-Ing. U. Wagner Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik
JUFOTech. wko.at/tirol/jufotech DATENBLATT. Jugend forscht in der Technik. Titel der Projektarbeit: Fachgebiet:
 Datenblatt (dient als Titelblatt für die Projektarbeit) Seite 1/2 JUFOTech Jugend forscht in der Technik wko.at/tirol/jufotech DATENBLATT Wir nehmen am Wettbewerb Jugend forscht in der Technik Auf den
Datenblatt (dient als Titelblatt für die Projektarbeit) Seite 1/2 JUFOTech Jugend forscht in der Technik wko.at/tirol/jufotech DATENBLATT Wir nehmen am Wettbewerb Jugend forscht in der Technik Auf den
Strom, Wärme, Verkehr Das technologische Potential von Wasserstoff
 Strom, Wärme, Verkehr Das technologische Potential von Wasserstoff NIP-Vollversammlung Berlin Dr. Uwe Albrecht Geschäftsführer, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH LBST - Unabhängige Expertise seit über 30
Strom, Wärme, Verkehr Das technologische Potential von Wasserstoff NIP-Vollversammlung Berlin Dr. Uwe Albrecht Geschäftsführer, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH LBST - Unabhängige Expertise seit über 30
Photovoltaik-Module mm Länge eines Moduls 4.1A Strom bei max. Leistung
 Photovoltaik-Module Photovoltaik-Module wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dazu nutzen Solarzellen den photoelektrischen Effekt, der mittels Absorption von Sonnenlicht Elektronen in Bewegung
Photovoltaik-Module Photovoltaik-Module wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dazu nutzen Solarzellen den photoelektrischen Effekt, der mittels Absorption von Sonnenlicht Elektronen in Bewegung
Energie am Flughafen. Grafik 3B Lösungsblatt. Sozialform. Weitere Informationen
 Lehrerkommentar OST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Energie-Verbraucher es am Flughafen Zürich gibt und welche Energieformen die für ihren Betrieb
Lehrerkommentar OST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Energie-Verbraucher es am Flughafen Zürich gibt und welche Energieformen die für ihren Betrieb
Clean Energy Partnership (CEP) Arbeitsgruppe Produktion
 Clean Energy Partnership (CEP) Arbeitsgruppe Produktion NIP-Konferenz Berlin 14.12.2016 Alexander Zörner Projektleiter Wasserstoffanwendungen, Linde AG Die CEP fährt mit mindestens 50% grünem Wasserstoff
Clean Energy Partnership (CEP) Arbeitsgruppe Produktion NIP-Konferenz Berlin 14.12.2016 Alexander Zörner Projektleiter Wasserstoffanwendungen, Linde AG Die CEP fährt mit mindestens 50% grünem Wasserstoff
Trennung und Wiederverwendung von Kunststoffen
 Trennung und Wiederverwendung von Kunststoffen Die Wiederverwendung von Kunststoffen ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll! Es können jedoch nur sortenreine Kunststoffabfälle wieder verwendet werden!
Trennung und Wiederverwendung von Kunststoffen Die Wiederverwendung von Kunststoffen ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll! Es können jedoch nur sortenreine Kunststoffabfälle wieder verwendet werden!
P2H im Wärmesektor Kopplung von Effizienz und erneuerbaren Energien. Dr. Kai Schiefelbein 8. November 2017 NET 2017
 P2H im Wärmesektor Kopplung von Effizienz und erneuerbaren Energien Dr. Kai Schiefelbein 8. November 2017 NET 2017 Schlüsseltechnologien der Sektorkopplung: Was können sie heute und was können sie in der
P2H im Wärmesektor Kopplung von Effizienz und erneuerbaren Energien Dr. Kai Schiefelbein 8. November 2017 NET 2017 Schlüsseltechnologien der Sektorkopplung: Was können sie heute und was können sie in der
Hyundai ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)
 Pressekonferenz 04. Juli 2013; Schloss Laudon, Wien Hyundai ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) Univ. Prof. Dr. Bernhard Geringer Agenda Gesellschaftliche Vorgaben für die zukünftige Mobilität Lösungsportfolio
Pressekonferenz 04. Juli 2013; Schloss Laudon, Wien Hyundai ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) Univ. Prof. Dr. Bernhard Geringer Agenda Gesellschaftliche Vorgaben für die zukünftige Mobilität Lösungsportfolio
Was Sie schon immer über e mobilität mit everynear wissen wollten Q&A. energy very near. Teil 1. Warum Elektromobilität
 Was Sie schon immer über e mobilität mit everynear wissen wollten Q&A Teil 1 Warum Elektromobilität 1 Elektromobilität fördert die Gesundheit Elektromobilität ist im Vergleich zu fossiler Mobilität gut
Was Sie schon immer über e mobilität mit everynear wissen wollten Q&A Teil 1 Warum Elektromobilität 1 Elektromobilität fördert die Gesundheit Elektromobilität ist im Vergleich zu fossiler Mobilität gut
emissionsfrei Erfahrungsbericht Brennstoffzellenbusse Ein Résumé
 emissionsfrei Erfahrungsbericht Brennstoffzellenbusse Ein Résumé Inhaltsverzeichnis Antriebsvarianten Wasserstoffmobilität ÖV in Europa Brennstoffzellenpostauto Wasserstofftankstelle Wasserstoffmobilität
emissionsfrei Erfahrungsbericht Brennstoffzellenbusse Ein Résumé Inhaltsverzeichnis Antriebsvarianten Wasserstoffmobilität ÖV in Europa Brennstoffzellenpostauto Wasserstofftankstelle Wasserstoffmobilität
Erdgas/Biogas. die Energie
 Erdgas/Biogas die Energie 1 Erdgas ist einfach, praktisch, sauber Erdgas ist ein natürlich vorkommender brennbarer, farb- und geruchloser Energieträger und kann ohne Umwandlung direkt als Brennstoff und
Erdgas/Biogas die Energie 1 Erdgas ist einfach, praktisch, sauber Erdgas ist ein natürlich vorkommender brennbarer, farb- und geruchloser Energieträger und kann ohne Umwandlung direkt als Brennstoff und
HappyEvening am Brennstoffzellen zur mobilen Energiebereitstellung
 HappyEvening am 15.10.2008 Brennstoffzellen zur mobilen Energiebereitstellung T. Pröll 15.10.2008 Inhalt Grundlagen Zelltypen und Anwendungen PEM-Brennstoffzelle (Prinzip) Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
HappyEvening am 15.10.2008 Brennstoffzellen zur mobilen Energiebereitstellung T. Pröll 15.10.2008 Inhalt Grundlagen Zelltypen und Anwendungen PEM-Brennstoffzelle (Prinzip) Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
Reduktion der Kohlendioxid- Emissionen von Kraftwerken
 Reduktion der Kohlendioxid- Emissionen von Kraftwerken FH Südwestfalen, Meschede Kolloquium der Uni Siegen und des VDI Siegen Energietechnik sowie Fluid- und Thermodynamik Universität Siegen, 23.10.03
Reduktion der Kohlendioxid- Emissionen von Kraftwerken FH Südwestfalen, Meschede Kolloquium der Uni Siegen und des VDI Siegen Energietechnik sowie Fluid- und Thermodynamik Universität Siegen, 23.10.03
Möglichkeiten der Energiespeicherung
 Möglichkeiten der Energiespeicherung Großkategorien Thermische Speicher (Aquiferspeicher) Brennstoffe (Öl, Biomasse ) Chemische Speicherung (H 2,Batterien ) Mechanische Speicher (Pumpspeicherkraftwerk,
Möglichkeiten der Energiespeicherung Großkategorien Thermische Speicher (Aquiferspeicher) Brennstoffe (Öl, Biomasse ) Chemische Speicherung (H 2,Batterien ) Mechanische Speicher (Pumpspeicherkraftwerk,
Hausenergie nur aus Wasser und Sonne
 Hausenergie nur aus Wasser und Sonne 100% AUTARK 100% UMWELTFREUNDLICH 100% VERFÜGBAR Ein Mikro-BHKW mit 5 kw kw el Stromleistung für Ihre Unabhängigkeit bedeutet pro Jahr: über 8.000 Betriebsstunden (B/h)
Hausenergie nur aus Wasser und Sonne 100% AUTARK 100% UMWELTFREUNDLICH 100% VERFÜGBAR Ein Mikro-BHKW mit 5 kw kw el Stromleistung für Ihre Unabhängigkeit bedeutet pro Jahr: über 8.000 Betriebsstunden (B/h)
Die erste Schweizer Wasserkraft- Elektrolyseanlage für Wasserstoff. Nachhaltig erzeugt am Wasserkraftwerk in Aarau
 Die erste Schweizer Wasserkraft- Elektrolyseanlage für Wasserstoff Nachhaltig erzeugt am Wasserkraftwerk in Aarau Frontansicht des IBAarau Wasserkraftwerks in Aarau H2 Energy AG und IBAarau AG realisieren
Die erste Schweizer Wasserkraft- Elektrolyseanlage für Wasserstoff Nachhaltig erzeugt am Wasserkraftwerk in Aarau Frontansicht des IBAarau Wasserkraftwerks in Aarau H2 Energy AG und IBAarau AG realisieren
Gebäudeheizung mit Pflanzenöl-BHKW
 Moosburger Solartage, 7. Mai 2006 Gebäudeheizung mit Pflanzenöl-BHKW Hans Stanglmair Solarfreunde Moosburg Gebäudeheizung mit Pflanzenöl-BHKW Eine Heizung ist eine Einrichtung zur Erwärmung von Objekten
Moosburger Solartage, 7. Mai 2006 Gebäudeheizung mit Pflanzenöl-BHKW Hans Stanglmair Solarfreunde Moosburg Gebäudeheizung mit Pflanzenöl-BHKW Eine Heizung ist eine Einrichtung zur Erwärmung von Objekten
Die Erde wird momentan von über 7 Milliarden Menschen bewohnt. Der sekündliche Zuwachs der Weltbevölkerung beträgt circa 3 Menschen jede Sekunde:
 Die Erde wird momentan von über 7 Milliarden Menschen bewohnt. Der sekündliche Zuwachs der Weltbevölkerung beträgt circa 3 Menschen jede Sekunde: // In den letzten Jahrzehnten stieg die Erdbevölkerung
Die Erde wird momentan von über 7 Milliarden Menschen bewohnt. Der sekündliche Zuwachs der Weltbevölkerung beträgt circa 3 Menschen jede Sekunde: // In den letzten Jahrzehnten stieg die Erdbevölkerung
Für Wärme, Warmwasser und Strom
 Remeha HRe - Kessel Für Wärme, Warmwasser und Strom Remeha HRe - Kessel Mit unseren effektiv verknüpften Techniken sind Sie einen Schritt voraus! Elektrischer Strom eine der wichtigsten Energieformen.
Remeha HRe - Kessel Für Wärme, Warmwasser und Strom Remeha HRe - Kessel Mit unseren effektiv verknüpften Techniken sind Sie einen Schritt voraus! Elektrischer Strom eine der wichtigsten Energieformen.
Ihr Partner für Blockheizkraftwerke. Erdgas Flüssiggas Pflanzenöl Heizöl
 Ihr Partner für Blockheizkraftwerke Erdgas Flüssiggas Pflanzenöl Heizöl Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie bauen! KIMMEL Energietechnik Ihr kompetenter Partner für BHKW KIMMEL Energietechnik das
Ihr Partner für Blockheizkraftwerke Erdgas Flüssiggas Pflanzenöl Heizöl Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie bauen! KIMMEL Energietechnik Ihr kompetenter Partner für BHKW KIMMEL Energietechnik das
Kapitel 02: Erdgas und Erdöl
 Kapitel 02: Erdgas und Erdöl 1 Kapitel 02: Erdgas und Erdöl Kapitel 02: Erdgas und Erdöl 2 Inhalt Kapitel 02: Erdgas und Erdöl...1 Inhalt... 2 Einige Produkte aus Erdöl...3 Erdöl ist nicht gleich Erdöl...3
Kapitel 02: Erdgas und Erdöl 1 Kapitel 02: Erdgas und Erdöl Kapitel 02: Erdgas und Erdöl 2 Inhalt Kapitel 02: Erdgas und Erdöl...1 Inhalt... 2 Einige Produkte aus Erdöl...3 Erdöl ist nicht gleich Erdöl...3
Die Treibhausgase im Flugverkehr
 Lehrerkommentar OST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine Ahnung, welche Massnahmen am Flughafen Zürich getroffen werden, um die Treibhausgas-Emissionen
Lehrerkommentar OST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine Ahnung, welche Massnahmen am Flughafen Zürich getroffen werden, um die Treibhausgas-Emissionen
Photovoltaik-Module mm Länge eines Moduls 4.1A Strom bei max. Leistung
 Photovoltaik-Module Photovoltaik-Module wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dazu nutzen Solarzellen den photoelektrischen Effekt, der mittels Absorption von Sonnenlicht Elektronen in Bewegung
Photovoltaik-Module Photovoltaik-Module wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dazu nutzen Solarzellen den photoelektrischen Effekt, der mittels Absorption von Sonnenlicht Elektronen in Bewegung
Arbeitssicherheit in der Energieversorgung, Rheinsberg, 17. September 2013 Neue Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasserstoffanlagen
 Arbeitssicherheit in der Energieversorgung, Rheinsberg, 17. September 2013 Neue Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasserstoffanlagen Ulrich Schmidtchen BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung,
Arbeitssicherheit in der Energieversorgung, Rheinsberg, 17. September 2013 Neue Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasserstoffanlagen Ulrich Schmidtchen BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung,
Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik
 Helmut Eichlseder Manfred Klell Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik Erzeugung, Speicherung, Anwendung 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 228 Abbildungen und 29 Tabellen PRAXIS ATZ/MTZ-Fachbuch
Helmut Eichlseder Manfred Klell Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik Erzeugung, Speicherung, Anwendung 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 228 Abbildungen und 29 Tabellen PRAXIS ATZ/MTZ-Fachbuch
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
 Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
Forschungsförderung des Bundesamtes für Energie BFE
 Das Brennstoffzellen-Postauto in Brugg aus verschiedenen Blickwinkeln Forschungsförderung des Bundesamtes für Energie BFE Dr. VÖV Fachtagung KTBB, Fribourg, 26.April 2012 Globales CO 2 -Problem VerschiedensteTechnologien
Das Brennstoffzellen-Postauto in Brugg aus verschiedenen Blickwinkeln Forschungsförderung des Bundesamtes für Energie BFE Dr. VÖV Fachtagung KTBB, Fribourg, 26.April 2012 Globales CO 2 -Problem VerschiedensteTechnologien
Wasserstoffspeicherung
 Wasserstoffspeicherung Hauptseminar zum Thema Energie Martin Mainitz 19. Juli 2011 Überblick Grundlagen Motivation Wasserstofferzeugung Wasserstoffspeicherung Martin Mainitz Wasserstoffspeicherung 19.
Wasserstoffspeicherung Hauptseminar zum Thema Energie Martin Mainitz 19. Juli 2011 Überblick Grundlagen Motivation Wasserstofferzeugung Wasserstoffspeicherung Martin Mainitz Wasserstoffspeicherung 19.
Hybridantrieb. Geo-SOL Gymnasium Immensee. Denis Kohli & Fabrizio Gügler. [Geben Sie Text ein] 1
![Hybridantrieb. Geo-SOL Gymnasium Immensee. Denis Kohli & Fabrizio Gügler. [Geben Sie Text ein] 1 Hybridantrieb. Geo-SOL Gymnasium Immensee. Denis Kohli & Fabrizio Gügler. [Geben Sie Text ein] 1](/thumbs/56/39234212.jpg) Hybridantrieb Geo-SOL 2011 Gymnasium Immensee Denis Kohli & Fabrizio Gügler [Geben Sie Text ein] 1 Hybridantrieb Inhalt - Einleitung - Der bivalente Antrieb - Die Antriebs-Hybridtechnik - Argumente für
Hybridantrieb Geo-SOL 2011 Gymnasium Immensee Denis Kohli & Fabrizio Gügler [Geben Sie Text ein] 1 Hybridantrieb Inhalt - Einleitung - Der bivalente Antrieb - Die Antriebs-Hybridtechnik - Argumente für
Meine Energiequelle. das effizienteste Mikrokraftwerk der Welt
 Meine Energiequelle das effizienteste Mikrokraftwerk der Welt Aus Gas wird Strom Innovative Brennstoffzellen-Technologie Der BlueGEN wird mit Ihrem Gasanschluss verbunden und erzeugt aus Erdgas oder Bioerdgas
Meine Energiequelle das effizienteste Mikrokraftwerk der Welt Aus Gas wird Strom Innovative Brennstoffzellen-Technologie Der BlueGEN wird mit Ihrem Gasanschluss verbunden und erzeugt aus Erdgas oder Bioerdgas
Erläuterungen geben zum Thema: Erneuerbare Energie vs. fossile Energie :
 Lehrerkommentar MST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Die Kinder gewinnen einen Überblick über die Energie-Verbraucher am Flughafen, welche Energieformen für sie benötigt werden und sie lernen,
Lehrerkommentar MST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Die Kinder gewinnen einen Überblick über die Energie-Verbraucher am Flughafen, welche Energieformen für sie benötigt werden und sie lernen,
Biomasse/Biomüll. Biogas/Biogasanlage. Blockheizkraftwerk. Müllheizkraftwerk. Pelletheizung
 Biomasse/Biomüll Biogas/Biogasanlage Blockheizkraftwerk Müllheizkraftwerk Pelletheizung Christoph Hennemann 10 a 09.03.2010 Biomasse: Als Biomasse wird die gesamte organische Substanz bezeichnet. Basis
Biomasse/Biomüll Biogas/Biogasanlage Blockheizkraftwerk Müllheizkraftwerk Pelletheizung Christoph Hennemann 10 a 09.03.2010 Biomasse: Als Biomasse wird die gesamte organische Substanz bezeichnet. Basis
HOTEL BÜRKLE erfüllt Kyoto-Protokoll
 HOTEL BÜRKLE HOTEL BÜRKLE erfüllt Kyoto-Protokoll Klimaschutz bei höchstem Komfort Kraft-Wärme-Kopplung spart 14 Tonnen CO 2 pro Jahr Pressemitteilung Im Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen haben sich
HOTEL BÜRKLE HOTEL BÜRKLE erfüllt Kyoto-Protokoll Klimaschutz bei höchstem Komfort Kraft-Wärme-Kopplung spart 14 Tonnen CO 2 pro Jahr Pressemitteilung Im Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen haben sich
Engineering for the future inspire people Herbst Trinkwasser ein Energieproblem
 Trinkwasser ein Energieproblem Wasser ist Leben. Ohne Wasser wäre unser Planet wüst und tot. Unser Planet besteht auf seiner Oberfläche aus riesigen Mengen von Salzwasser. Dieses Salzwasser kann zum Beispiel
Trinkwasser ein Energieproblem Wasser ist Leben. Ohne Wasser wäre unser Planet wüst und tot. Unser Planet besteht auf seiner Oberfläche aus riesigen Mengen von Salzwasser. Dieses Salzwasser kann zum Beispiel
PC I Thermodynamik J. Stohner/M. Quack Sommer Übung 12
 PC I Thermodynamik J. Stohner/M. Quack Sommer 2006 Übung 12 Ausgabe: Dienstag, 20. 6. 2006 Rückgabe: Dienstag, 27. 6. 2006 (vor Vorlesungsbeginn) Besprechung: Freitag, 30.6./Montag, 3.7.2006 (in der Übungsstunde)
PC I Thermodynamik J. Stohner/M. Quack Sommer 2006 Übung 12 Ausgabe: Dienstag, 20. 6. 2006 Rückgabe: Dienstag, 27. 6. 2006 (vor Vorlesungsbeginn) Besprechung: Freitag, 30.6./Montag, 3.7.2006 (in der Übungsstunde)
sunfire GmbH Kraftstoffe der 3. Generation
 Kraftstoffe der 3. Generation Leipziger Biokraftstoff- und ForNeBik- Fachgespräche 2012 sunfire GmbH Kraftstoffe der 3. Generation David Wichmann sunfire GmbH david.wichmann@sunfire.de 1 Firmenvorstellung
Kraftstoffe der 3. Generation Leipziger Biokraftstoff- und ForNeBik- Fachgespräche 2012 sunfire GmbH Kraftstoffe der 3. Generation David Wichmann sunfire GmbH david.wichmann@sunfire.de 1 Firmenvorstellung
Fachkonferenz Energietechnologien 2050 Wasserstoff
 Fachkonferenz Energietechnologien 2050 Wasserstoff Prof. Dr. Martin Wietschel Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Berlin, 26. Mai 2009 Wasserstoff: Einsatz bei mobilen Anwendungen?
Fachkonferenz Energietechnologien 2050 Wasserstoff Prof. Dr. Martin Wietschel Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Berlin, 26. Mai 2009 Wasserstoff: Einsatz bei mobilen Anwendungen?
WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999
 WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999 Autor: Michael Houben Kamera: Dieter Stürmer Ton : Jule Buerjes Schnitt: Birgit Köster Abschrift des Filmtextes Teil 3: Vision 0.04 Stellen Sie sich vor, sie fahren
WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999 Autor: Michael Houben Kamera: Dieter Stürmer Ton : Jule Buerjes Schnitt: Birgit Köster Abschrift des Filmtextes Teil 3: Vision 0.04 Stellen Sie sich vor, sie fahren
Planungsblatt Physik für die 2C
 Planungsblatt Physik für die 2C Woche 28 (von 04.04 bis 08.04) Bis Freitag 08.04: Lerne die Mitschrift von Dienstag! Aufgaben bzw. Vorbereitungen 1 Bis Dienstag 12.04: Lerne die Notizen von der vorigen
Planungsblatt Physik für die 2C Woche 28 (von 04.04 bis 08.04) Bis Freitag 08.04: Lerne die Mitschrift von Dienstag! Aufgaben bzw. Vorbereitungen 1 Bis Dienstag 12.04: Lerne die Notizen von der vorigen
1 Warum brauchen wir Biotreibstoffe?
 1 Warum brauchen wir Biotreibstoffe? Weil unsere Vorräte an Erdöl begrenzt sind Weil wir CO 2 -Emissionen reduzieren müssen Um ein Einkommen für die regionale Landund Forstwirtschaft zu schaffen Weil unsere
1 Warum brauchen wir Biotreibstoffe? Weil unsere Vorräte an Erdöl begrenzt sind Weil wir CO 2 -Emissionen reduzieren müssen Um ein Einkommen für die regionale Landund Forstwirtschaft zu schaffen Weil unsere
Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums
 Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums Zentrale Inhalte in Klasse 9 1. Inhaltsfeld: Elektrizität Schwerpunkte: Elektrische Quelle und elektrischer Verbraucher Einführung von
Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums Zentrale Inhalte in Klasse 9 1. Inhaltsfeld: Elektrizität Schwerpunkte: Elektrische Quelle und elektrischer Verbraucher Einführung von
tgt HP 1999/00-3: Wärmekraftwerk
 tgt HP 1999/00-3: Wärmekraftwerk In einem Wärmekraftwerk wird mittels eines Kreisprozesses durch den Einsatz von Primärenergie elektrische Energie erzeugt. Teilaufgaben: 1 Das obige Bild zeigt die Darstellung
tgt HP 1999/00-3: Wärmekraftwerk In einem Wärmekraftwerk wird mittels eines Kreisprozesses durch den Einsatz von Primärenergie elektrische Energie erzeugt. Teilaufgaben: 1 Das obige Bild zeigt die Darstellung
Energieunabhängigkeit Wieso? Weshalb? Warum?
 Energieunabhängigkeit Wieso? Weshalb? Warum? Vision einer energieautarken Region Was ist eine energieautarke Region? Eine Region, die den eigenen Energiebedarf durch selbstständige Energieproduktion deckt
Energieunabhängigkeit Wieso? Weshalb? Warum? Vision einer energieautarken Region Was ist eine energieautarke Region? Eine Region, die den eigenen Energiebedarf durch selbstständige Energieproduktion deckt
Herzlich willkommen in
 Herzlich willkommen in Knapsack In Hürth-Knapsack betreibt Statkraft die beiden Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GuD-Kraftwerke) Knapsack I und II mit einer installierten Gesamtleistung von 1.230 Megawatt.
Herzlich willkommen in Knapsack In Hürth-Knapsack betreibt Statkraft die beiden Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GuD-Kraftwerke) Knapsack I und II mit einer installierten Gesamtleistung von 1.230 Megawatt.
Brennstoffzelle - Kosten
 Brennstoffzelle - Kosten Die Kosten für eine Brennstoffzelle sind schwer festzulegen zumal man vorab unterscheiden müsste für welchen Zweck die Brennstoffzelle eingesetzt werden soll und vor allem, welche
Brennstoffzelle - Kosten Die Kosten für eine Brennstoffzelle sind schwer festzulegen zumal man vorab unterscheiden müsste für welchen Zweck die Brennstoffzelle eingesetzt werden soll und vor allem, welche
Erzeugung elektrischer Energie mit einer PEM Brennstoffzelle
 Lehrer-/Dozentenblatt Erzeugung elektrischer Energie mit einer PEM Brennstoffzelle Aufgabe und Material Lehrerinformationen Zusätzliche Informationen Alle Brennstoffzellen bestehen prinzipiell aus zwei
Lehrer-/Dozentenblatt Erzeugung elektrischer Energie mit einer PEM Brennstoffzelle Aufgabe und Material Lehrerinformationen Zusätzliche Informationen Alle Brennstoffzellen bestehen prinzipiell aus zwei
