Machbarkeitsstudie für die Anwendung einer mikrobiellen Brennstoffzelle im Abwasser- und Abfallbereich AZ
|
|
|
- Frauke Maurer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Abschlussbericht Machbarkeitsstudie für die Anwendung einer mikrobiellen Brennstoffzelle im Abwasser- und Abfallbereich AZ Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt - Osnabrück Berichtszeitraum: bis Verfasser Prof. Dr.-Ing. Michael Sievers* Dr. Ottmar Schläfer* Dipl.-Ing. Hinnerk Bormann* Dipl.-Ing. Michael Niedermeiser* Prof. Dr. Detlef Bahnemann** Dr. Ralf Dillert** *Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH CUTEC-Institut GmbH Leibnizstr D Clausthal-Zellerfeld Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Internet **Leibniz Universität Hannover Institut für Technische Chemie Callinstr. 5 D Hannover Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Internet
2 Seite 2 von 18
3 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Stand des Wissens Kleiner Rückblick Funktionsbeschreibung Bisherige Entwicklung der maximal erzielten Stromdichten von MBZ Einflussgrößen (=Ansätze) bezüglich Leistungssteigerung Ergebnisse Ausgangssituation Verfahrenstechnische Merkmale der MBZ Abschätzung des Anwendungspotenzials Vorversuch Auswirkungen eines MBZ-Einsatzes auf der Kläranlage Kostenbetrachtungen Experimentelle Untersuchungen Aufbau der MBZ-Versuchsanlage Erste Ergebnisse...16 Literaturverzeichnis...18 Seite 3 von 18
4 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Abbildung 2: Beispielhafter Aufbau einer MBZ mit chemischer Kathode...6 Funktionsprinzip Biokatalyse auf der Anodenseite der mikrobiologischen Brennstoffzelle unter Beachtung verschiedener Redoxpotenziale...7 Abbildung 3: Die Entwicklung der Leistungsdichte der MBZ von 1999 bis Abbildung 4: Abbildung 5: Zeitlicher CSB-Verlauf und zugehörige Leistungsdichte während des Behandlung von vorgeklärtem kommunalen Abwasser und einer Acetatlösung...12 MBZ-Prüfstand (links) und Ansicht eines Zellenmoduls mit vier Einzelzellen in Reihenschaltung (rechts)...15 Abbildung 6: Zeitlicher Verlauf der Leistungsdichte...16 Abbildung 7: Leistungsdichte der MBZ als Funktion des Lastwiderstandes...17 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Tabelle 2: Stromproduktionspotenzial für verschiedene Kläranlagengrößen...12 Stromeinsparungspotenzial für verschiedene Kläranlagengrößen...13 Seite 4 von 18
5 1. Einleitung Mikrobielle oder bioelektrochemische Brennstoffzellen (MBZ) enthalten lebende Mikroorganismen, die aus komplexen organischen Substraten direkt elektrischen Strom produzieren. Gegenüber chemischen Brennstoffzellen haben MBZ den Vorteil, dass die Generierung von elektrischem Strom unter sehr milden Bedingungen (Raumtemperatur, Umgebungsdruck) erfolgt. Ein weiterer Vorteil ist die Katalysatorlebensdauer. Die Mikroorganismen vermehren sich unter geeigneten Bedingungen selbst, so dass der (Bio-)- Katalysator laufend reproduziert wird und deshalb kein Katalysatorverbrauch existiert. Die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der MBZ befinden sich noch am Anfang. Es gibt weltweit erst ca. 15 Forschergruppen, die sich in den letzten Jahren intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Die internationalen Schwerpunkte liegen derzeit im amerikanischen, australischen und asiatischen Raum. Untersuchungen zur MBZ liegen bisher nahezu ausschließlich für den Labormaßstab vor, Untersuchungen im Technikums- /Pilotmaßstab liegen nur vereinzelt vor, werden jedoch zurzeit verstärkt in Angriff genommen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse aus der Grundlagenforschung zeigen, dass die MBZ ein großes Anwendungspotenzial besitzt. Insbesondere die direkte Stromproduktion aus Abwässern (industrielle und kommunale Abwasserbehandlung) könnte sich als interessantes Anwendungsgebiet herauskristallisieren. Allerdings liegen bisher kaum Erkenntnisse im Hinblick auf technische Umsetzbarkeit vor. Fragen hinsichtlich der limitierenden Faktoren für größere elektrischen Leistungen sind noch nicht bzw. nicht ausreichend genug untersucht worden. Auch fehlen technische Reaktorkonzepte, so dass eine wirtschaftliche Anwendung noch nicht bewertbar ist. Im Rahmen eines von der DBU geförderten Projektes wurde deshalb eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ziel der Studie ist es, die genannten Fragestellungen aufzugreifen und die Machbarkeit einer technischen und wirtschaftlichen Umsetzung zu bewerten. Sie soll auch eine Hilfestellung für das weitere Vorgehen leisten und gegebenenfalls neue Entwicklungsarbeiten anstoßen, insbesondere innerhalb der Forschungsgemeinschaft in Deutschland. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden nachfolgend beschrieben. 2. Stand des Wissens Das Forschungsgebiet ist derzeit sehr dynamisch. Fortlaufend neue Erkenntnisse führen dazu, dass Zusammenfassungen zum Stand des Wissens vor allem bezüglich Leistungsfähigkeit und Reaktorkonzept schnell veralten. Dies möge bei der Lektüre nachfolgender Zusammenfassung beachtet werden. Wesentlich detaillierte Beschreibungen zu verschiedensten Erkenntnissen sind in Büchern von Logan (2008) und Rabaey et al. (2010). Seite 5 von 18
6 2.1. Kleiner Rückblick Die Idee der mikrobiologischen Brennstoffzelle ist nicht neu. Nachdem bereits 1911 die Biopotenzialdifferenz entdeckt wurde, führten frühe Ideen der bakteriellen Batterie (1931) zum NASA-Konzept für abfallfreie Energiesysteme in 1966 und später zu kommerziellen Entwicklungen für die Seefahrt in Diese Systeme benutzten flüssige Mediatoren für den Elektronentransfer zwischen Organismus und Anode und fanden keine weitergehende Verbreitung insbesondere wohl auch wegen der großen Umweltund Gesundheitsgefährdung, die von den Mediatoren ausging wurde erstmals über eine mediatorenfreie MBZ berichtet (Rohrback 1962, zitiert in Sell 2004, Sell 1991 zitiert in Lämmel 1999). Diese Erkenntnis sowie das seit der Energiediskussion Anfang 2000 stetig steigende Interesse an erneuerbaren Energien haben zu vielen Pionierarbeiten mit Leistungssteigerungen von 0,1 mw/m 2 in 2000 auf größer mw/m 2 in 2008 geführt. Es ist dabei zu beachten ist, dass diese Leistungen im Labormaßstab erzielt wurden Funktionsbeschreibung Die MBZ besteht im Wesentlichen aus einer Anode, einer Kathode und einer ionenselektiven Membran. Das Funktionsprinzip ist vergleichbar mit dem einer chemischen Brennstoffzelle mit dem Unterschied, dass die Elektronenabgabe an die Anode über Mikroorganismen erfolgt. Die Mikroorganismen, die im Biofilm auf der Anodenoberfläche wachsen, nehmen organische Stoffe aus der Flüssigkeit in der Anodenkammer auf und geben einen Teil der chemisch gebundenen Energie in Form von Elektronen an die Anode ab. Abbildung 1 fasst das Funktionsprinzip einer bioelektrochemischen Brennstoffzelle zusammen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den beiden Möglichkeiten einer biologischen Anode mit chemischer Kathode und einer biologischen Anode mit biologischer Ka- Last e - oxidiertes Medium Biologische Zelle organisches Nhrmedium z.b. Abwasser Ablufe im Biofilm Biokat. CO 2 e - H + Biofilm Kathode Anode 2 H + 2e - Membran 1/2 O 2 H 2 O Sauerstoff Chemische Zelle Wasser thode. Abbildung 1: Beispielhafter Aufbau einer MBZ mit chemischer Kathode. Die für die Anodenreaktion interessante Fähigkeit von Mikroorganismen, freie Elektronen ins Medium abzugeben, wird als Exoelektrogenese bezeichnet. Diese Gruppe von Bakte- Seite 6 von 18
7 rien gehört zu den anaeroben Atmern. Sie ist in der Lage verschiedene anorganische Stoffwechselprodukte der gärenden Organismen durch die Abgabe von freien Elektronen weiter zu reduzieren und dadurch eine Elektronentransportphosphorilierung (ähnlich den Atmern) zu betreiben und dadurch erheblich mehr Energie zu gewinnen, als die gärenden Organismen. Die Atmungsarten werden nach den anorganischen Elektronenakzeptoren bezeichnet (z.b. Schwefelatmung, Fumarat-Atmung, Eisenatmung etc.) und spielen in biotechnischen Prozessen eine wichtige Rolle. Für die MBZ ist vor allem die Carbonat- Atmung von Bedeutung in der z.b. durch Vertreter der Gattung Geobacter CO 2 und Carbonat-Ionen durch die Abgabe freier Elektronen zu Methan und Essigsäure umgesetzt werden. Von Bedeutung ist hierbei das Zusammenspiel verschiedener enzymatischer Reaktionen (Biokatalyse) im Biofilm bei unterschiedlich hohen Redoxpotenzialen, wie Abbildung 2 veranschaulicht. Abbildung 2: Funktionsprinzip Biokatalyse auf der Anodenseite der mikrobiologischen Brennstoffzelle unter Beachtung verschiedener Redoxpotenziale. Die Elektronen des organischen Substrats werden nach ihrer Abspaltung auf dem Niveau von - 0,4 V auf den ersten Elektronenakzeptor der Elektronentransportkette übertragen (NAD+). Von hier aus hätten die Elektronen beim Durchlaufen der aeroben Atmungskette mit Sauerstoff als Endakzeptor (E0I +0,8V) eine Potenzialdifferenz von 1,2 V. In Abwesenheit von Sauerstoff (anaerobe Atmung) müssen die Elektronen jedoch auf dem Energieniveau des verfügbaren anorganischen Elektronenakzeptors abgegeben werden. Dem Organismen steht daher für die eigene Energiegewinnung nur der erste Teil der Elektronentransportphosphorilierung zur Verfügung (NAD+ bis Cytrochrom c). Die Elektronen besitzen auf diesem Abgabe-Niveau jedoch noch eine Restenergie gegenüber dem Seite 7 von 18
8 Sauerstoff und anderen Elektronenakzeptoren. Dies macht man sich bei der MBZ zu Nutze indem man, anstatt eines anorganischen Elektronenakzeptors, eine Elektrode (Anode) auf ähnlich hohem Redoxpotenzial anbietet und die Elektronen auf diesem Niveau abfängt. Durch die räumlich getrennte Übertragung dieser Elektronen auf z.b. Sauerstoff in der MBZ wird letztlich die anaerobe Atmungskette der Organismen (Biofilm auf der Anode) technisch zu einer aeroben Atmung erweitert (Kathodenreaktion) und die vorhandene Potenzialdifferenz zwischen Anode und terminalem Elektronenakzeptor an der Kathode (z.b. Sauerstoff) durch den besonderen Aufbau der MBZ technisch nutzbar gemacht. Der Stromkreis für eine externe Energienutzung wird über die Potenzialdifferenz zwischen Anode und Kathode aufgebaut, indem z.b. eine ionenselektive Membran zwischen Anodenkammer und Kathodenkammer angeordnet und ein Elektronenakzeptor (z.b. Sauerstoff, Nitrat, Sulfid) in der Kathodenkammer bereitgestellt wird. Es gibt jedoch bereits einige Hinweise darauf, dass eine ionenselektive Membran nicht unbedingt erforderlich ist (Logan 2008). Ein Ziel bei der Entwicklung der MBZ ist u.a. die Senkung des Redoxpotenzials bei der Elektronenabgabe. Dies ist gleichbedeutend mit einer Reduzierung der vom biologischen System selbst genutzten Energie und führt zu einer Erhöhung der Potenzialdifferenz zwischen den Elektroden Bisherige Entwicklung der maximal erzielten Stromdichten von MBZ Seit Untersuchung der ersten mediatorenfreien MBZ im Jahre 1999 sind die maximal erzielten Leistungsdichten sprunghaft angestiegen. Abbildung 2 (nach Logan et al. 2008) zeigt die Entwicklung der Leistungsdichte von 0,05 mw/m 2 in 1999 auf 2700 mw/m 2 in Abbildung 3: Die Entwicklung der Leistungsdichte der MBZ von 1999 bis Zu beachten ist dabei insbesondere die Unterscheidung zwischen Luftkathode und Wasserkathode als auch die Unterscheidung zwischen den Arten von organischen Stoffen, die in der Anodenkammer abgebaut werden. Reine Chemikalien (= Glukose oder Acetat) sind wesentlich leichter biologisch abbaubar als die meisten organischen Abwasserinhaltsstoffe. Auch die Leitfähigkeit der organischen Flüssigkeit ist in der Regel deutlich höher, so Seite 8 von 18
9 Leistungsdichten bei Abwasseruntersuchungen niedriger sein müssen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass mit der Luftkathode bei der Abwasserbehandlung höhere Stromdichten erzielt wurden als mit der Wasserkathode beim Abbau von reinen Chemikalien. Die in den letzten Jahren erreichte Steigerung der Leistungsdichten wurde durch Beeinflussung vieler Faktoren erzielt. Diese werden im nachfolgenden Kapitel ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgelistet. Ein wesentlicher Punkt, der bei der Bewertung von Abbildung 3 zu beachten ist, sind die verwendeten Reaktordimensionen im Milliliterbereich. Größere Reaktordimensionen waren bisher zwangsläufig mit einer Leistungseinbuße verbunden. Insbesondere die Erfahrungen mit der weltweit ersten Pilotanlage (Rozendal et al. 2008) zeigten, dass viele Erfahrungen und Randbedingungen aus der Verfahrenstechnik, Elektrochemie, Biofilmchemie, Katalyse, Beschichtungstechnik, Elektrotechnik und Maschinen-/Apparatetechnik bisher nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wurden Einflussgrößen (=Ansätze) bezüglich Leistungssteigerung Nachfolgend sind einige Einflussfaktoren aufgelistet. Elektrodenabstand Leitfähigkeit Elektrolyt Innerer Widerstand Membran Ohmscher Widerstand Elektrodenmaterial Kollektor Sauerstoffdiffusion Elektrodenpotenzial (poised potentials) Protonentransport (Selektivität, Geschwindigkeit, Polarisation) Redox-Potenzial ph-wert Elektrodenoberfläche (Material, Dicke, Struktur, Fläche) Oberflächenladung Wasseraustritt (Diffusionshemmung Sauerstoff) Biofilmstruktur (Einfluss Scherrate etc.) Externer Widerstand Viele der Faktoren beeinflussen andere bzw. sich gegenseitig, so dass aussagekräftige Angaben bezüglich Gesamtleistung einer MBZ nur anhand von Untersuchungen in einem Gesamtsystem möglich sind. Halbzellenversuche sind zeitsparender und für grundlegende Untersuchungen besser geeignet. Sie sind als Vorstufe bzw. Ergänzung zu sehen, können jedoch keine abgesicherten Aussagen zur erzielbaren Gesamtleistung geben und sind grundsätzlich anhand von Untersuchungen am Gesamtsystem zu überprüfen. Gute Beispiele, die dies bestätigen, sind die - Konzentrationspolarisation, die sich bei höherer Leistungsdichte zunehmend einstellt und einen Leistungsabfall hervorruft, der die reaktionstechnische Optimierung von Anoden und Kathoden reduziert sowie - und der erfolgreiche Einsatz einer membranlosen MBZ, wobei als Diaphragma amerikanische Küchenputztücher mit der Bezeichnung J-Cloth eingesetzt wurde. Seite 9 von 18
10 Bis vor kurzem wurde noch davon berichtet, dass bisher nur Vermutungen angestellt werden können, warum dies so sei, - neue Erkenntnisse zur Re-Organisation und Anpassung von Biofilmstrukturen, die mit bisherigen Biofilmmodellen nicht ausreichend abgebildet werden. Kurzzeitige Ergebnisse, die diese Re-Organisation nicht berücksichtigen können, sind daher weniger aussagekräftig. 3. Ergebnisse 3.1. Ausgangssituation Der derzeitige Stand der Entwicklung lässt sich zusammenfassen mit folgenden Stichpunkten: - Bisher erfolgte weitestgehend eine Grundlagenforschung weltweit; Scale-up Untersuchungen stehen am Anfang (Australien, USA). - Nur wenige Untersuchungen liegen vor zur Realisierung größerer Spannungen (Parallel-Reihenschaltung von Zellen); auch Rückkopplungseffekte, die zur Leistungseinbuße führen, wurden festgestellt. - Reaktorkonzepte sind derzeit in der Entwicklung (Aufwuchsfläche, Strömungstechnik etc.), Untersuchungsergebnisse liegen nur vereinzelt vor. - Es können erhebliche Stickstoffverluste auftreten. - Das Einkammersystem mit Luftkathode scheint derzeit am leistungsfähigsten. - Zunehmende Untersuchungen erfolgen mit der Biokathode (z.b. Denitrifikation, Sulfatreduktion), da diese wegen des Verzichts auf Metall-Katalysator in der Herstellung am kostengünstigsten erscheint. - Ein Einsatz von Diaphragma ohne ionenselektive Membran ist auch möglich. - Am Markt verfügbare Elektroden sind zu kostenintensiv; ein Verzicht auf teure Edelmetallkatalysatoren scheint erforderlich. Ausgehend von dieser Situation, stellte sich die Frage, welches Potenzial bietet die MBZ im Bereich der Abwasser- und Abfallbehandlung. Hierzu wurden zunächst die verfahrenstechnischen Merkmale zusammengefasst Verfahrenstechnische Merkmale der MBZ Die mediatorenfreie MBZ wird derzeit als Biofilmverfahren realisiert. Interessant ist, dass auch bei geringen CSB-Konzentrationen von kleiner 100 mg/l Strom produziert wird, wobei die Stromproduktion weniger von der Konzentration als vielmehr von der Abbaubarkeit des CSB abhängt. Leicht abbaubare Stoffe ermöglichen eine höhere Stromdichte (Kinetik) und erfordern weniger enzymatische Abbauschritte (höhere spezifische Ausbeute). Zu beachten ist dabei, dass die Effizienz der Umwandlung organischer Stoffe in Strom maßgeblich von der Biofilmstruktur beeinflusst wird. Weiterhin ist bei den bisher erzielten Leistungsdichten die Umgebungstemperatur ausreichend. D.h. es ist kein Zusatzwärmebedarf wie bei mesophilen oder thermophilen Prozessen vorhanden. Es sind zwar Temperaturabhängigkeiten bekannt, doch diese sind im Vergleich zu Anaerobverfahren deutlich kleiner. Seite 10 von 18
11 Weiterhin wurde berichtet, dass eine geringe Feststoffbelastung des Abwassers den Wirkungsgrad der MBZ positiv beeinflusst und die Wachstumsrate der beteiligten Mikroorganismen gegenüber Methanbakterien vergleichsweise hoch ist. Diese verfahrenstechnischen Merkmale zeigen, dass die MBZ derzeit weniger als Konkurrenz zu den etablierten Anaerobverfahren zu sehen ist, sondern vielmehr als Ergänzung. Weiterhin wird durch den möglichen Abbau von CSB auf kleinem Konzentrationsniveau unterhalb 500 mg/l sowie bei Umgebungstemperaturen deutlich, dass die MBZ eher eine Konkurrenz für Aerobverfahren darstellt. Dies gilt, soweit die Stickstoffelimination anderweitig gelöst wird Abschätzung des Anwendungspotenzials Vorversuch Zur Abschätzung des Anwendungspotenzials wurde zunächst ein Vorversuch mit kommunalem Abwasser durchgeführt. Als MBZ wurde ein konventionelles Zweikammersystem mit einer Graphitelektrode auf der Anodenseite und einer platinhaltigen Graphitelektrode auf der Kathodenseite verwendet. Beide Kammern waren durch eine NAFION Membran getrennt, wobei die Anodenseite anaerob gehalten und die Kathodenseite mit Luft begast wurde. Diese Anordnung wird seit Anfang 2000 untersucht und weist keine große Effizienz auf (vgl. Abbildung 3). Trotzdem kann man über den zeitlichen Verlauf der relativen Stromabgabe Erkenntnisse zur Abbaubarkeit des Abwassers mittels MBZ gewinnen. Abbildung 4 zeigt das Ergebnis des Versuches. Gezeigt werden der zeitliche CSB-Verlauf von Abwasser und Acetat und die jeweils dazugehörige Leistungsabgabe bei 1 kohm Last. Der CSB des vorgeklärten kommunalen Abwassers betrug 190 mg/l, der Anfangswert der Acetatlösung lag bei mgcsb/l. Interessant ist, dass das kommunale Abwasser bis zu einem CSB-Wert von 61 mg/l keinen Leistungsabfall zeigte und der Endwert, bei dem keine Stromproduktion mehr stattfand, 56 mgcsb/l betrug. Prinzipiell ist damit ein sehr weitgehender CSB-Abbau in die Nähe des Direkteinleitgrenzwertes möglich. Weiterhin zeigt der Abbauversuch mit Acetat einen interessanten Effekt auf, der vermutlich auf Speichereffekte, die aus der Bio-P-Elimination bekannt sind, zurückzuführen ist: Obwohl der Rest-CSB-Wert von ca. 100 mg/l bereits nach 70 h erreicht wurde, ist trotzdem noch weitere 50 Stunden unverändert Strom abgegeben worden. Seite 11 von 18
12 Abbildung 4: Zeitlicher CSB-Verlauf und zugehörige Leistungsdichte während des Behandlung von vorgeklärtem kommunalen Abwasser und einer Acetatlösung Auswirkungen eines MBZ-Einsatzes auf der Kläranlage Der Vorversuch zeigte, dass vorgeklärtes Abwasser gut behandelt werden kann. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Behandlung des Trübwassers aus der Schlammentwässerung und gegebenenfalls auch aus der Schlammeindickung zu sehen. Durch den CSB- Abbau wird nicht nur Strom produziert, sondern gleichzeitig auch eine Einsparung an Belüftungsenergie ermöglicht. Die Höhe des Stromproduktionspotenzials wurde anhand des Energieinhaltes des Abwassers und der experimentellen Versuchsergebnisse aus der Literatur unter folgenden Annahmen grob geschätzt % des BSB (= 25% des CSB) im Rohabwasser können verwertet werden (kein Engpass in der Verwertung für die Denitrifikation) - die experimentellen Werte bezüglich der Couloumb-Effizienz (= Verhältnis von maximal abzugebenden Elektronen zu tatsächlich abgegebenen Elektronen) von 40 % sind bei systemtechnischer Optimierung auch im größeren Maßstab erreichbar Der Energieinhalt des Abwassers beträgt ca. 20 W pro Einwohnerwert (EW). Damit würde sich für eine EW Anlage ein Kraftwerk mit einer Leistung von 20 kw realisieren lassen, für die EW Modellanlage analog 200 kw. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick auf das Stromgewinnungspotenzial für verschiedene Kläranlagengrößen zusammen mit der Hochrechnung auf 80 Mio. EW für Deutschland. Tabelle 1: Stromproduktionspotenzial für verschiedene Kläranlagengrößen Seite 12 von 18
13 Kläranlagengröße Energieinhalt Verwertbar 50 % CVerwertbar 50 % Verwertbar 50 % Abwasser sehr optimistisch): optimistisch: 25 % mit Ceff = 40 % ak optimale Werte: 1 EW kw kw kw kw Hochrechnung Deutschland 400 MW 160 MW Die gleichzeitige Einsparung an Belüftungsenergie ergibt sich aus dem zugrunde gelegten BSB- bzw. CSB-Abbau von 50 bzw. 25 %. Für die Abschätzung wurden die Kennzahlen aus dem Energiehandbuch NRW (Müller et al. 1999) herangezogen. Demnach liegt der Energieverbrauch nur für die Belüftung zwischen 16 (größere Anlagen) und 28 kwh (kleinere Anlagen mit aerober Stabilisierung) pro Einwohnerwert und Jahr. Für eine EW-Kläranlage, die mit aerober Schlammstabilisierung betrieben wird, beträgt das Energieeinsparpotenzial 8 kw, für eine EW Modellanlage beträgt es ca. 45 kw. Die Tabelle 2 gibt einen Überblick auf das Stromeinsparungspotenzial für verschiedene Kläranlagengrößen zusammen mit der Hochrechnung auf 80 Mio. EW für Deutschland. Tabelle 2: Stromeinsparungspotenzial für verschiedene Kläranlagengrößen Kläranlagengröße CSB-Fracht 25 % CSB Abnahme (10 % in Strom) Energieeinsparung belüftung bei 16 kwh/ew.a Energieeinsparung belüftung bei 28 kwh/ew.a EW kgcsb/h kgcsb/h kw kw , Hochrechnung Deutschland 45 MW Zum Vergleich: Eine vollständig optimierte Modellanlage für EW nach dem Handbuch NRW hat einen mittleren Leistungsbedarf von 285 kw. Durch den Einsatz der MBZ wäre die Summe aus dem Stromproduktionspotenzial und dem Einsparungspotenzial 246 kw. Berücksichtigt man die Stromproduktion durch Schlammfaulung und Verstromung des Faulgases über ein BHKW, so werden auch nach Abzug von 25 % (durch MBZ verbraucht) immer noch 133 kw erzeugt. Damit können mit einer EW Anlage ca. 100 kwh/h Strom erzeugt werden. Die MBZ bietet somit das Potenzial, kommunale Kläranlagen nicht nur in die Nähe des energieautarken Betriebes zu bringen, sondern in Verbindung mit der Faulung in beachtenswerte Energieproduktionsanlagen umzuwandeln Kostenbetrachtungen Seite 13 von 18
14 Die Kosten sind für mögliche Anwendungen das wichtigste Entscheidungskriterium. Sie lassen sich erst mit belastbaren Pilotversuchen ermitteln, was voraussetzt, dass die Reaktortechnik vorhanden ist und die Systemtechnik funktioniert. Alles dies ist noch nicht nachgewiesen, so dass eine realistische Kostenbetrachtung nicht möglich ist. Trotzdem soll an dieser Stelle versucht werden, Hinweise zu den Kostenstrukturen zu geben, weil diese für die weitere Entwicklungsstrategie wertvoll sein können. Angenommen, es existiert eine MBZ-Anlage mit dem o.g. Stromproduktionspotenzial und eine Kläranlage mit dem entsprechenden Energieeinsparpotenzial. Eine EW- Anlage würde bei den o.g. Werten und einem Strompreis von 0,2 Euro pro kwh ca Euro im Jahr einsparen. Die Summe aus Abschreibungen für Anlagentechnik und Elektrodenstack muss deutlich unter diesen Erlösen bleiben, um eine annehmbare Kapitalrückzahlung zu erwirtschaften. Da schon von mehr als zweijährigem zwischenfallfreiem Betrieb im Labormaßstab berichtet wurde, ist davon auszugehen, dass eine 5- oder 10-jährige Abschreibung für Stackund Anlagentechnik nicht unrealistisch ist. Die in der Praxis annehmbare Investitionssumme kann damit größenordnungsmäßig abgeschätzt werden. Die weitergehende Kostenbetrachtung setzt die Kenntnis eines bestimmten Anlagendesigns mit entsprechender Reaktortechnik voraus. Bei der Anlagentechnik sind viele Kostenpositionen zu beachten. Hierzu gehören unter anderem: Reaktorgehäuse, Verkabelung, Resistoren, Spannungswandlung, evtl. Zwischenspeicherung, Automatisierung inkl. Lastregelung, Stackmontage, Anlageninstallation, Inbetriebnahme. Zusätzlich sind die Kosten für die Elektrodenherstellung zu berücksichtigen. Ohne hier auf Details zu den Annahmen der einzelnen Kostenpositionen einzugehen, kann festgehalten werden, dass bei einer angenommenen Leistungsdichte von 2 Watt pro m 2 Anodenfläche und einer gleichgroßen Kathodenfläche (plus einer eventuellen Membranfläche) die Elektrodenkosten unter 7,5 Euro bezogen auf die Anodenfläche liegen sollte. Diese Zahl ergibt sich aus der Tatsache, dass bei der kleinen Leistungsdichte von 2 W/m 2 eine extrem große Eklektrodenfläche erforderlich ist, so dass die Kosten für Elektrodenfläche im Vergleich zu den anderen Kosten dominieren. Die Kostenangabe ist im Zusammenhang mit den publizierten Kostenzielen von 30 US-Dollar pro m 2 zu verstehen, als das sie deutlich macht, dass man viel kostengünstiger werden muss als bisher angenommen. Anhand dieses ersten Anhaltswertes kann man aber auch erkennen, dass bei höheren Leistungsdichten und entsprechend geringerer Elektrodenfläche auch ein Potenzial nach oben besitzt. Sicherlich liegen hier noch viel zu viele Unsicherheiten vor, um diese Zahl als Maßstab zu nehmen. U.a. ist es durchaus möglich, dass einzelne Kostenpositionen bei der Anlagentechnik zu positiv abgeschätzt wurden. In diesem Fall sind für die Elektrodenkosten kleinere Werte anzusetzen. Trotzdem kann festgehalten werden, dass in der weiteren Entwicklung viel stärker als bisher auf die Materialentwicklung geachtet werden muss. Dies kann nur erreicht werden, wenn in der Materialauswahl auf kostengünstige Massenprodukte zurückgegriffen und zudem Material sparende Beschichtungstechniken angewendet werden. Dies wird auch deutlich, wenn man sich die erforderliche Elektrodenfläche bei einer Leistungsdichte 2 W/m 2 für eine 20 kw Anlage vor Augen führt: Es sind m 2 Anodenfläche (plus Kathodenfläche plus evtl. Membranfläche) erforderlich. Seite 14 von 18
15 Auf der anderen Seite ist bekannt, dass sich Biofilmsysteme mit 100 bis 200 m 2 Aufwuchsfläche pro m 3 Reaktorvolumen in der Praxis vielfach bewährt haben. Diese Flächendichte würde bei der MBZ zu einer Leistungsdichte von 200 bis 400 W/m 3 führen, was rechnerisch bereits vergleichbar ist mit der Leistungsdichte von Anaerobanlagen. Die oben genannte Schlussfolgerung der Kostenlimitierung für die Elektrodenoberfläche hat schließlich zu eigenen Aktivitäten in der Entwicklung und Untersuchung von Elektroden auf Basis von Massenwaren geführt. Nachfolgend werden die ersten Ergebnisse beschrieben Experimentelle Untersuchungen Aufbau der MBZ-Versuchsanlage Zur Durchführung von ersten orientierenden Versuchen zum Einfluss verschiedener material- und prozesstechnischer Parameter auf die Leistungsfähigkeit der mikrobiologischen Brennstoffzelle wurde ein MBZ-Prüfstand im Labormaßstab aufgebaut (s. Abbildung 5). Abbildung 5: MBZ-Prüfstand (links) und Ansicht eines Zellenmoduls mit vier Einzelzellen in Reihenschaltung (rechts) Dieser Prüfstand besitzt kontinuierlich durchströmte Einzelzellen (4 Module á 4 Zellpaare) die mit verschiedenen Elektroden-/Membranpaarungen bzw. -materialien bestückt und zeitgleich in Parallel- oder Reihenschaltung betrieben werden können. Durch eine spezielle Zellengeometrie werden die Elektrodenflächen gleichmäßig überströmt und ermöglichen die Einstellung definierter Scherraten auf den anhaftenden Biofilm. Die Versorgung der einzelnen Anoden- und Kathodenkammern mit Substrat bzw. sauerstoffgesättigtem Wasser erfolgt über getrennte Pumpenkreisläufe mit entsprechender online-messtechnik u.a. zur Aufzeichnung von Temperatur, ph-wert und Redoxpotenzial. Über die Verschaltung der Elektroden jeder Einzelzelle mit einem Multiplexer erfolgt eine kontinuierliche Aufzeichnung der Strom- und Spannungsverläufe aller 16 Zellpaare. Zur Leistungsregelung kann eine stufenlose Verstellung der einzelnen Zellen-Lastwiderstände vorgenommen werden. Seite 15 von 18
16 Erste Ergebnisse Die Interessantesten der ersten Ergebnisse werden nachfolgend vorgestellt. Neben der Prüfung vorhandener Elektrodenmaterialien und Kationenaustauscher-Membranen (Nafion und Selmion CMV) wurden zum Vergleich selbst hergestellte Elektroden durch Graphitbeschichtung von Edelstahlkollektoren untersucht. Dabei wurde auf Beimischung von Katalysatormaterialien bewusst verzichtet. Entgegen den Erwartungen stellte sich auch an diesem Zellenpaar eine Stromproduktion ein. Diese ist auf eine biokatalytische Aktivität auf der Kathodenseite zurückzuführen, wie Hemmungstests auf der Kathodenseite belegten. Abbildung 6 zeigt den zeitlichen Verlauf der flächenspezifischen Leistungsdichte über die Versuchsdauer von 18 Tagen. Die Untersuchungen wurde mit einer Glukoselösung durchführt. Verschiedene Zwischenfälle wie vollständiger Substratabbau, Substratzugabe, ph- Abnahme sowie ph-anhebung zeigen deutlich, dass die Stromproduktion biokatalytisch erfolgt. Auf der Kathodenseite ist ebenfalls ein vollständig ausgebildeter Biofilm festgestellt worden, so dass in weitergehenden Untersuchungen geklärt wird, welche Verbindungen die Elektronenakzeptoren sind. Abbildung 6: Zeitlicher Verlauf der Leistungsdichte Der Versuch wurde nach einer mehrwöchigen Unterbrechung weitergeführt. Dabei zeigte sich, dass die ursprüngliche Leistung bereits nach 3-4 Tagen wieder erreicht wurde und im weiteren Verlauf durch Anpassung des Lastwiderstandes weiter anstieg. Abbildung 7 zeigt den Einfluss des Lastwiderstandes auf die Leistungsdichte des Zellpaares und die Existenz eines Optimums, das zu dem Mess-Zeitpunkt bei 120 Ohm lag. Die maximale Stromdichte lag zu diesem Zeitpunkt (ca. 4 Wochen später) bereits bei 0,63 W/m 2 Anodenfläche. Seite 16 von 18
17 R Last = R innen = 120 Ohm R Last Abbildung 7: Leistungsdichte der MBZ als Funktion des Lastwiderstandes Die für die Machbarkeitsstudie wesentliche Erkenntnis dieser Untersuchung ist die Tatsache, dass mit der Leistungsdichte von über 0,6 W/m 2 bereits ein um Faktor 2 bis 3 besserer Wert gegenüber Literaturdaten für die wässrige Kathode erzielt wurde. Dieses darüber hinaus mit einer Bio-Kathode. Es fehlt allerdings noch ein Faktor 3 bis 4 zur oben angenommenen Leistungsdichte. Außerdem steht noch der Versuch mit realem Abwasser aus. Gleichzeitig muss auch beachtet werden, dass die Materialkosten für die Elektroden bisher nur einen unwesentlichen Teil der oben genanten 7,5 Euro pro m 2 betragen, so dass durchaus eine kleinere Leistungsdichte ausreichend ist. Weiterhin muss beachtet werden, dass das Potenzial der Materialoberfläche und beschichtung bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die bioelektrochemische Brennstoffzelle ein wirtschaftliches Anwendungspotenzial enthält und mittel- bis langfristig in die Praxis umgesetzt wird. Der Abwasserbereich - und hierzu gehören auch die Industrieabwässer - bietet wegen des anwendbaren Temperatur- und Konzentrationsbereiches und nicht zuletzt aufgrund der gleichzeitigen Energieeinsparung vergleichsweise gute Voraussetzungen. Seite 17 von 18
18 Literaturverzeichnis Lämmel, A. (1999): Entwicklung eines Sensorsystems zur Messung der biologischen Aktivität von Mikroorganismen und tierischen Zellen, Dissertation, Universität Hannover. Logan Bruce E. (2008): Microbial Fuel Cells, John Wiley & Sons Inc., New Jersey. Müller E A, Kobel B, Künti T, Pinnekamp J, Seibert-Erling G, Böcker K (1999). Handbuch Energie in Kläranlagen MURL NRW, Düsseldorf, Germany. Rabaey K., Angenent L., Schröder U, Keller J (2010): Bioelectrochemical systems: From extracellular electron transfer to biotechnological application. IWA Publishing, London. Rohrback GH, Scott WR Canfield JH (1962) Biochemical fuel cells. Proceedings 16th Annual Power Sources Conference, Sell, D. (1991): Untersuchungen zur Elektrochemie und Biochemie einer bioelektrochemischen Brennstoffzelle, Dissertation, Universität Dortmund. Sell D (2004): Wege zur online Bestimmung der mikrobiellen Stoffwechselaktivität mittels einer neuartigen Bioaktivitätssensorik. Habilitationsschrift, Universität Hannover. Seite 18 von 18
Direkte Stromerzeugung aus Abwasser mit mikrobiologischer Brennstoffzelle (MBZ) - Möglichkeiten und Grenzen
 Direkte Stromerzeugung aus Abwasser mit mikrobiologischer Brennstoffzelle (MBZ) - Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr.-Ing Ing.. M. Sievers Osnabrück, 24.06.2010 Ausgangssituation / Motivation Konzept Abfallfreie
Direkte Stromerzeugung aus Abwasser mit mikrobiologischer Brennstoffzelle (MBZ) - Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr.-Ing Ing.. M. Sievers Osnabrück, 24.06.2010 Ausgangssituation / Motivation Konzept Abfallfreie
BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage
 ERWAS Projektstart 03./04. Juli 2014 - Frankfurt am Main BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage Hinnerk Bormann Michael Niedermeiser
ERWAS Projektstart 03./04. Juli 2014 - Frankfurt am Main BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage Hinnerk Bormann Michael Niedermeiser
BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage
 ERWAS Statusseminar 02./03. Februar 2016 - Essen BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage Prof. Dr. Michael Sievers, CUTEC Überblick
ERWAS Statusseminar 02./03. Februar 2016 - Essen BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage Prof. Dr. Michael Sievers, CUTEC Überblick
Bio. Metha nol. Verbund-Koordinator: Dr. Sven Kerzenmacher Universität Freiburg Institut für Mikrosystemtechnik - IMTEK
 Verbund-Koordinator: Dr. Sven Kerzenmacher Universität Freiburg Institut für Mikrosystemtechnik - IMTEK Hintergrund: Energieeffizienz Elektrizitätsbedarf für die aerobe Abwasserreinigung ~16 kwh pro Einwohnergleichwert
Verbund-Koordinator: Dr. Sven Kerzenmacher Universität Freiburg Institut für Mikrosystemtechnik - IMTEK Hintergrund: Energieeffizienz Elektrizitätsbedarf für die aerobe Abwasserreinigung ~16 kwh pro Einwohnergleichwert
Leistungsvergleich des DWA-Landesverbandes Nord 2014
 Leistungsvergleich des DWA-Landesverbandes Nord 2014 Dipl.-Ing. Georg Thielebein, Ahrensburg 1. Einleitung Jährlich werden über die DWA die wichtigsten Betriebsdaten der Kläranlagen erfasst und mittlerweile
Leistungsvergleich des DWA-Landesverbandes Nord 2014 Dipl.-Ing. Georg Thielebein, Ahrensburg 1. Einleitung Jährlich werden über die DWA die wichtigsten Betriebsdaten der Kläranlagen erfasst und mittlerweile
BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage
 ERWAS Abschlusskonferenz 15./16. Mai 2017 Berlin BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage Michael Sievers, Dennis Haupt, Michael
ERWAS Abschlusskonferenz 15./16. Mai 2017 Berlin BioBZ - Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle als Baustein einer energieerzeugenden Abwasserbehandlungsanlage Michael Sievers, Dennis Haupt, Michael
Bayerisches Landesamt für Umwelt. Energieeffizienz
 Energieeffizienz bayerischer Kläranlagen Inhalt Anlass Energieverbrauch Faulgasproduktion Faulgasnutzung Fazit 2 Anlass Klimadiskussion Kommunale Kläranlagen benötigen rund 1 % des Gesamtenergiebedarfs
Energieeffizienz bayerischer Kläranlagen Inhalt Anlass Energieverbrauch Faulgasproduktion Faulgasnutzung Fazit 2 Anlass Klimadiskussion Kommunale Kläranlagen benötigen rund 1 % des Gesamtenergiebedarfs
HappyEvening am Brennstoffzellen zur mobilen Energiebereitstellung
 HappyEvening am 15.10.2008 Brennstoffzellen zur mobilen Energiebereitstellung T. Pröll 15.10.2008 Inhalt Grundlagen Zelltypen und Anwendungen PEM-Brennstoffzelle (Prinzip) Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
HappyEvening am 15.10.2008 Brennstoffzellen zur mobilen Energiebereitstellung T. Pröll 15.10.2008 Inhalt Grundlagen Zelltypen und Anwendungen PEM-Brennstoffzelle (Prinzip) Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
KLÄRSCHLAMMBEHANDLUNG DURCH ANAEROBE VORVERSÄUERUNG UND MIKROBIELLE BRENNSTOFFZELLE
 KLÄRSCHLAMMBEHANDLUNG DURCH ANAEROBE VORVERSÄUERUNG UND MIKROBIELLE BRENNSTOFFZELLE MFC4SLUDGE Klaus Brüderle, M.Sc. 1. Hammer Bioenergietage 21.07.2015 Inhalt Einleitung: Projekt MFC4Sludge Projektbeschreibung
KLÄRSCHLAMMBEHANDLUNG DURCH ANAEROBE VORVERSÄUERUNG UND MIKROBIELLE BRENNSTOFFZELLE MFC4SLUDGE Klaus Brüderle, M.Sc. 1. Hammer Bioenergietage 21.07.2015 Inhalt Einleitung: Projekt MFC4Sludge Projektbeschreibung
Ressource Klärschlamm: Hochlastfaulung für Kläranlagen mit saisonalem Einfluss
 Ressource Klärschlamm: Hochlastfaulung für Kläranlagen mit saisonalem Einfluss Dr.-Ing. Werner Sternad 2. Mainauer Nachhaltigkeitsdialog Insel Mainau, 11. Juli 2016 Kläranlagen in Baden-Württemberg nach
Ressource Klärschlamm: Hochlastfaulung für Kläranlagen mit saisonalem Einfluss Dr.-Ing. Werner Sternad 2. Mainauer Nachhaltigkeitsdialog Insel Mainau, 11. Juli 2016 Kläranlagen in Baden-Württemberg nach
Initiative Bayerischer Untermain 12. Arbeitstagung Wirtschaftsförderung. Energieautarke Kläranlagen. Aschaffenburg
 Initiative Bayerischer Untermain 12. Arbeitstagung Wirtschaftsförderung Energieautarke Kläranlagen 21.11.2013 Dipl.-Ing. Stefan Krieger Gliederung Einleitung Energieverbrauch Kläranlagen Energetische Optimierungspotentiale
Initiative Bayerischer Untermain 12. Arbeitstagung Wirtschaftsförderung Energieautarke Kläranlagen 21.11.2013 Dipl.-Ing. Stefan Krieger Gliederung Einleitung Energieverbrauch Kläranlagen Energetische Optimierungspotentiale
Möglichkeiten und Potenziale der. Energieerzeugung mittels Abwasser
 Möglichkeiten und Potenziale der Energieerzeugung mittels Abwasser PD Dr.-Ing. habil. Thomas Dockhorn Potenziale für die Energieerzeugung 1. Klärschlamm 2. Co-Substrate (z.b. Fett, Bioabfall) 3. Abwasser
Möglichkeiten und Potenziale der Energieerzeugung mittels Abwasser PD Dr.-Ing. habil. Thomas Dockhorn Potenziale für die Energieerzeugung 1. Klärschlamm 2. Co-Substrate (z.b. Fett, Bioabfall) 3. Abwasser
GALVANISCHE ELEMENTE, BATTERIEN UND BRENNSTOFFZELLEN
 10. Einheit: GALVANISCHE ELEMENTE, BATTERIEN UND BRENNSTOFFZELLEN Sebastian Spinnen, Ingrid Reisewitz-Swertz 1 von 17 ZIELE DER HEUTIGEN EINHEIT Am Ende der Einheit Galvanische Elemente, Batterien und
10. Einheit: GALVANISCHE ELEMENTE, BATTERIEN UND BRENNSTOFFZELLEN Sebastian Spinnen, Ingrid Reisewitz-Swertz 1 von 17 ZIELE DER HEUTIGEN EINHEIT Am Ende der Einheit Galvanische Elemente, Batterien und
Membrantechnologie. Materialwissenschaften. Abwasserbehandlung. Angewandte Papiertechnologie. Bioelektrochemische Reaktionstechnik
 Angewandte Papiertechnologie Membrantechnologie Bioelektrochemische Reaktionstechnik Materialwissenschaften Abwasserbehandlung Mikrobiologische Analyse 05.05.2017 1 Mikrobielle Brennstoffzelle 05.05.2017
Angewandte Papiertechnologie Membrantechnologie Bioelektrochemische Reaktionstechnik Materialwissenschaften Abwasserbehandlung Mikrobiologische Analyse 05.05.2017 1 Mikrobielle Brennstoffzelle 05.05.2017
Hochlastfaulung zur Vergärung von kommunalen Klärschlämmen
 Hochlastfaulung zur Vergärung von kommunalen Klärschlämmen Dr.-Ing. Werner Sternad 1. Hammer Bioenergietage, 21. Juli 2015 Herkömmliche Schlammfaulungen Üblicherweise werden Schlammfaulungen nach der Faulzeit
Hochlastfaulung zur Vergärung von kommunalen Klärschlämmen Dr.-Ing. Werner Sternad 1. Hammer Bioenergietage, 21. Juli 2015 Herkömmliche Schlammfaulungen Üblicherweise werden Schlammfaulungen nach der Faulzeit
Biologische Reinigungsmethoden in der Abwasserund Abfallbehandlung
 Biologische Reinigungsmethoden in der Abwasserund Abfallbehandlung Möglichkeiten der Biofilm- und Klärschlammdesintegrationsverfahren zur signifikanten Volumen- und Kostenreduzierung 2008 AGI-Information
Biologische Reinigungsmethoden in der Abwasserund Abfallbehandlung Möglichkeiten der Biofilm- und Klärschlammdesintegrationsverfahren zur signifikanten Volumen- und Kostenreduzierung 2008 AGI-Information
Wiens Kläranlage wird zum Öko-Kraftwerk
 Wiens Kläranlage wird zum Öko-Kraftwerk Markus Reichel Energiegespräche 29. November 2016, Technisches Museum Wien Gliederung 1. Einleitung: Vorstellung der ebswien hauptkläranlage 2. Steigerung der Energieeffizienz
Wiens Kläranlage wird zum Öko-Kraftwerk Markus Reichel Energiegespräche 29. November 2016, Technisches Museum Wien Gliederung 1. Einleitung: Vorstellung der ebswien hauptkläranlage 2. Steigerung der Energieeffizienz
Power, der die Puste nie ausgeht!
 Fuel Cells Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Power, der die Puste nie ausgeht! Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Die Projektpartner Das Brennstoffzellen-Projekt im Hotelpark Westerwald-Treff
Fuel Cells Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Power, der die Puste nie ausgeht! Die Brennstoffzelle im Westerwald-Treff Die Projektpartner Das Brennstoffzellen-Projekt im Hotelpark Westerwald-Treff
Erklärt euch die Aufgabe. Erklärt euch die Aufgabe gegenseitig noch einmal in euren eigenen Worten. euren eigenen Worten.
 Erklärt euch die Aufgabe gegenseitig noch einmal in euren eigenen Worten. Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist. Erklärt euch die Aufgabe gegenseitig noch einmal
Erklärt euch die Aufgabe gegenseitig noch einmal in euren eigenen Worten. Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist. Erklärt euch die Aufgabe gegenseitig noch einmal
EKSH Energie Olympiade 2013 Fachtagung am Energieeffizienz im Klärwerk Bargteheide
 EKSH Energie Olympiade 2013 Fachtagung am 20.05.2014 Energieeffizienz im Klärwerk Bargteheide Gliederung 1. Ausgangssituation: Vorstellung der Kläranlage Bargteheide 1.1 Kenndaten der KA 1.2 Reinigungsleistung
EKSH Energie Olympiade 2013 Fachtagung am 20.05.2014 Energieeffizienz im Klärwerk Bargteheide Gliederung 1. Ausgangssituation: Vorstellung der Kläranlage Bargteheide 1.1 Kenndaten der KA 1.2 Reinigungsleistung
Förderschwerpunkt Energieeffiziente Abwasseranlagen
 Förderschwerpunkt Energieeffiziente Abwasseranlagen Verbandsgemeinde Weilerbach Energieautarke Gruppenkläranlage Weilerbach Abwasserbehandlungsanlage mit anaerober Schlammstabilisierung, Hochlastfaulung
Förderschwerpunkt Energieeffiziente Abwasseranlagen Verbandsgemeinde Weilerbach Energieautarke Gruppenkläranlage Weilerbach Abwasserbehandlungsanlage mit anaerober Schlammstabilisierung, Hochlastfaulung
Anaerobtechnik. Abwasser-, Schlamm- und Reststoffbehandlung, Biogasgewinnung
 Anaerobtechnik Abwasser-, Schlamm- und Reststoffbehandlung, Biogasgewinnung Bearbeitet von Karl-Heinz Rosenwinkel, Helmut Kroiss, Norbert Dichtl, Carl-Franz Seyfried, Peter Weiland 3. neubearbeitete Auflage
Anaerobtechnik Abwasser-, Schlamm- und Reststoffbehandlung, Biogasgewinnung Bearbeitet von Karl-Heinz Rosenwinkel, Helmut Kroiss, Norbert Dichtl, Carl-Franz Seyfried, Peter Weiland 3. neubearbeitete Auflage
Steuerung der Belüftung Regelungstechnische Grundlagen. KAN - Sprechertag 2007
 Steuerung der Belüftung Regelungstechnische Grundlagen Stefan Lindtner Ingenieurbüro ro kaltesklareswasser KAN - Sprechertag 2007 Seite 1 Einleitung Nur CSB-Abbau und Nitrifikation: bestimmte O2-Konzentration
Steuerung der Belüftung Regelungstechnische Grundlagen Stefan Lindtner Ingenieurbüro ro kaltesklareswasser KAN - Sprechertag 2007 Seite 1 Einleitung Nur CSB-Abbau und Nitrifikation: bestimmte O2-Konzentration
Dipl.-Ing. Alicja Schlange
 Funktionalisierung neuartiger Kohlenstoffmaterialien und deren Einsatz in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften vorgelegt von
Funktionalisierung neuartiger Kohlenstoffmaterialien und deren Einsatz in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften vorgelegt von
Thermische Verwertung von Klärschlamm
 Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbh Thermische Verwertung von Klärschlamm Dr. Thomas Siekmann, Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbh VKU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz Arbeitskreis
Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbh Thermische Verwertung von Klärschlamm Dr. Thomas Siekmann, Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbh VKU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz Arbeitskreis
Universität der Bundeswehr München J*, Institut für Wasserwesen
 Universität der Bundeswehr München J*, Institut für Wasserwesen Mitteilungen INSTITUT WAR Bibliothek - Wasserversorgung, Abwassertechnik Heft 86 / 2003 Abfalltechnik wie!'raumplanung Technische Universitär
Universität der Bundeswehr München J*, Institut für Wasserwesen Mitteilungen INSTITUT WAR Bibliothek - Wasserversorgung, Abwassertechnik Heft 86 / 2003 Abfalltechnik wie!'raumplanung Technische Universitär
Energieeffizienz in der Abwassertechnik
 Energieeffizienz in der Abwassertechnik Dipl.-Ing.(FH) Bastian Niazi Technische Hochschule Mittelhessen Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und anaerobe Verfahrenstechnik KompetenzZentrum Energie- und
Energieeffizienz in der Abwassertechnik Dipl.-Ing.(FH) Bastian Niazi Technische Hochschule Mittelhessen Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und anaerobe Verfahrenstechnik KompetenzZentrum Energie- und
Verhalten der endokrin wirksamen Substanz Bisphenol A bei der kommunalen Abwasserentsorgung
 Dissertation Verhalten der endokrin wirksamen Substanz Bisphenol A bei der kommunalen Abwasserentsorgung Herausgeber Prof. Dr.-Ing. B. Bilitewski Prof. Dr. rer. nat. P. Werner Beiträge zu AbfallwirtschaftlAltlasten
Dissertation Verhalten der endokrin wirksamen Substanz Bisphenol A bei der kommunalen Abwasserentsorgung Herausgeber Prof. Dr.-Ing. B. Bilitewski Prof. Dr. rer. nat. P. Werner Beiträge zu AbfallwirtschaftlAltlasten
Martin Kaleß Wasserverband Eifel-Rur, Düren 50 Jahre Oswald Schulze-Stiftung , Münster
 Kohlenstoffausschleusung mit der Huber Feinstsiebtechnologie Martin Kaleß Wasserverband Eifel-Rur, Düren, Münster Gliederung des Vortrags chemisch gebundene Energie im Abwasser Menge Herkunft Verbleib
Kohlenstoffausschleusung mit der Huber Feinstsiebtechnologie Martin Kaleß Wasserverband Eifel-Rur, Düren, Münster Gliederung des Vortrags chemisch gebundene Energie im Abwasser Menge Herkunft Verbleib
Biomasse als Chemikalienlieferant
 Von der Grünalge zur Biobrennstoffzelle - Zukunftstechnologien in der Abwassernutzung Uwe Schröder, Nachhaltige Chemie und Energieforschung, Institut für ökologische Chemie Prof. Dr. Uwe Schröder Nachhaltige
Von der Grünalge zur Biobrennstoffzelle - Zukunftstechnologien in der Abwassernutzung Uwe Schröder, Nachhaltige Chemie und Energieforschung, Institut für ökologische Chemie Prof. Dr. Uwe Schröder Nachhaltige
Volkmar Neitzel Uwe Iske. Abwasser. Technik und Kontrolle WILEY-VCH. Weinheim Berlin New York Chicriester Brisbane Singapore Toronto
 Volkmar Neitzel Uwe Iske Abwasser Technik und Kontrolle WILEY-VCH Weinheim Berlin New York Chicriester Brisbane Singapore Toronto Inhalt 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4
Volkmar Neitzel Uwe Iske Abwasser Technik und Kontrolle WILEY-VCH Weinheim Berlin New York Chicriester Brisbane Singapore Toronto Inhalt 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4
Anaerobe Schlammstabilisierung kleiner Anlagen Pilotprojekt Bad Abbach
 Lehrerbesprechung 2014 der Kanal- und Kläranlagennachbarschaften 13. Februar 2014 Anaerobe Schlammstabilisierung kleiner Anlagen Pilotprojekt Bad Abbach Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Lehrerbesprechung 2014 der Kanal- und Kläranlagennachbarschaften 13. Februar 2014 Anaerobe Schlammstabilisierung kleiner Anlagen Pilotprojekt Bad Abbach Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Einführung in die Biochemie Wirkungsweise von Enzymen
 Wirkungsweise von en Am Aktiven Zentrum kann ein nur in einer ganz bestimmten Orientierung anlegen, wie ein Schlüssel zum Schloss. Dieses Prinzip ist die Ursache der spezifität von en. Dies resultiert
Wirkungsweise von en Am Aktiven Zentrum kann ein nur in einer ganz bestimmten Orientierung anlegen, wie ein Schlüssel zum Schloss. Dieses Prinzip ist die Ursache der spezifität von en. Dies resultiert
Ressourcenschonende Herstellung von Feinchemikalien
 Projektverbund Ressourcenschonende Biotechnologie in Bayern Projektpräsentation Ressourcenschonende Herstellung von Feinchemikalien Christoph Mähler, Dr. Kathrin Castiglione, Prof. Dr.-Ing. Dirk Weuster-Botz
Projektverbund Ressourcenschonende Biotechnologie in Bayern Projektpräsentation Ressourcenschonende Herstellung von Feinchemikalien Christoph Mähler, Dr. Kathrin Castiglione, Prof. Dr.-Ing. Dirk Weuster-Botz
Schlammbilanz für simultan aerobe und getrennt anaerobe Schlammstabilisierungsanlagen
 TECHNISCHE UNIVERSIÄT WIEN Vienna University of Technology Institut für Wassergüte Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft Schlammbilanz für simultan aerobe und getrennt anaerobe Schlammstabilisierungsanlagen
TECHNISCHE UNIVERSIÄT WIEN Vienna University of Technology Institut für Wassergüte Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft Schlammbilanz für simultan aerobe und getrennt anaerobe Schlammstabilisierungsanlagen
Mathematische Modellierung von anaeroben Abbauprozessen unterschiedlicher Substrate auf Basis des "Anaerobic Digestion Model No.
 Mathematische Modellierung von anaeroben Abbauprozessen unterschiedlicher Substrate auf Basis des "Anaerobic Digestion Model No. 1" Von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm
Mathematische Modellierung von anaeroben Abbauprozessen unterschiedlicher Substrate auf Basis des "Anaerobic Digestion Model No. 1" Von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)
 Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
EinFaCh 1. Studienvorbereitung Chemie. Einstieg in Freibergs anschauliches Chemiewissen Teil 1: Redoxreaktionen und Elektrochemie.
 Studienvorbereitung Chemie EinFaCh 1 Einstieg in Freibergs anschauliches Chemiewissen Teil 1: Redoxreaktionen und Elektrochemie www.tu-freiberg.de http://tu-freiberg.de/fakultaet2/einfach Was ist eine
Studienvorbereitung Chemie EinFaCh 1 Einstieg in Freibergs anschauliches Chemiewissen Teil 1: Redoxreaktionen und Elektrochemie www.tu-freiberg.de http://tu-freiberg.de/fakultaet2/einfach Was ist eine
Praxisergebnisse der elektrokinetischen Desintegration beim Abwasserverband Obere Iller
 Verbandskläranlage: - Inbetriebnahme 1983 - Ausbaugröße 150.000 EW - Inbetriebnahme der Erweiterung zur Nährstoffelimination 1999 - Konzept: Belebungsverfahren mit vorgeschalteter Denitrifikation Bio-P-Elimination,
Verbandskläranlage: - Inbetriebnahme 1983 - Ausbaugröße 150.000 EW - Inbetriebnahme der Erweiterung zur Nährstoffelimination 1999 - Konzept: Belebungsverfahren mit vorgeschalteter Denitrifikation Bio-P-Elimination,
Energieeffizienz auf Kläranlagen in Mecklenburg - Vorpommern
 Nutzung der Energiepotenziale aus dem Abwasser 25.08.2011 Grevesmühlen Energieeffizienz auf Kläranlagen in Mecklenburg - Vorpommern Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Stand der Energieeffizienz auf Kläranlagen
Nutzung der Energiepotenziale aus dem Abwasser 25.08.2011 Grevesmühlen Energieeffizienz auf Kläranlagen in Mecklenburg - Vorpommern Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Stand der Energieeffizienz auf Kläranlagen
Die Wirkungsweise einer Brennstoffzelle. Ein Vortrag von Bernard Brickwedde
 Die Wirkungsweise einer Brennstoffzelle Ein Vortrag von Bernard Brickwedde Inhalt Allgemein Definition Geschichte Anwendungsgebiete Aufbau Theoretische Grundlagen Redoxreaktion Wirkungsgrad Elektrochemische
Die Wirkungsweise einer Brennstoffzelle Ein Vortrag von Bernard Brickwedde Inhalt Allgemein Definition Geschichte Anwendungsgebiete Aufbau Theoretische Grundlagen Redoxreaktion Wirkungsgrad Elektrochemische
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Strom aus Obst? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Strom aus Obst? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 18 6. Wir bauen eine Zitronenbatterie (Kl. 9/10) Chemische
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Strom aus Obst? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 18 6. Wir bauen eine Zitronenbatterie (Kl. 9/10) Chemische
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
Effizienzsteigerung bei der Ethanolherstellung durch Einsatz von Membranverfahren
 Effizienzsteigerung bei der Ethanolherstellung durch Einsatz von Membranverfahren in der Abwasserreinigung genehmigte Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades genieurwissenschaften an der Fakultät Bauingenieurwesen
Effizienzsteigerung bei der Ethanolherstellung durch Einsatz von Membranverfahren in der Abwasserreinigung genehmigte Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades genieurwissenschaften an der Fakultät Bauingenieurwesen
Biofilmaktivität in Scheibentauchkörpern - Grundlagen, Anpassung und Anwendung des Dehydrogenasentests
 Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) Bereich Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Justyna Homa Biofilmaktivität in Scheibentauchkörpern
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) Bereich Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Justyna Homa Biofilmaktivität in Scheibentauchkörpern
Scripts Precision and Microproduction Engineering Band 4. Henning Zeidler. Schwingungsunterstützte Mikro Funkenerosion
 Scripts Precision and Microproduction Engineering Band 4 Henning Zeidler Schwingungsunterstützte Mikro Funkenerosion Impressum Schwingungsunterstützte Mikro Funkenerosion Autor: Henning Zeidler Herausgeber:
Scripts Precision and Microproduction Engineering Band 4 Henning Zeidler Schwingungsunterstützte Mikro Funkenerosion Impressum Schwingungsunterstützte Mikro Funkenerosion Autor: Henning Zeidler Herausgeber:
1 Auswirkungen der Entwicklungen des Energiemarktes auf den Kläranlagenbetrieb 1. 2 Zielsetzung der Arbeit 8
 Inhaltsverzeichnis 1 Auswirkungen der Entwicklungen des Energiemarktes auf den Kläranlagenbetrieb 1 2 Zielsetzung der Arbeit 8 3 Biogaspotenziale kommunaler Klärschlämme 11 3.1 Charakterisierung von Biogaspotenzialen
Inhaltsverzeichnis 1 Auswirkungen der Entwicklungen des Energiemarktes auf den Kläranlagenbetrieb 1 2 Zielsetzung der Arbeit 8 3 Biogaspotenziale kommunaler Klärschlämme 11 3.1 Charakterisierung von Biogaspotenzialen
Kläranlage Haselünne Anaerobe Vorbehandlung eines Industrieabwassers
 Kläranlage Haselünne Anaerobe Vorbehandlung eines Industrieabwassers DWA-Erfahrungsaustausch Norddeutscher Kläranlagen- und Kanalnachbarschaften Dipl.-Ing. Ralf Seeßelberg 7. September 2016 Leistungsspektrum
Kläranlage Haselünne Anaerobe Vorbehandlung eines Industrieabwassers DWA-Erfahrungsaustausch Norddeutscher Kläranlagen- und Kanalnachbarschaften Dipl.-Ing. Ralf Seeßelberg 7. September 2016 Leistungsspektrum
23. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich. Betriebsjahr 2015
 23. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Betriebsjahr 2015 Stefan Lindtner KAN-Teilnehmer und Datenlieferung 2015 Österreich kommunal: 859 ARAs bzw. 22,3 Mio. EW davon Südtirol: 25 ARAs bzw. 1,87 Mio. EW
23. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Betriebsjahr 2015 Stefan Lindtner KAN-Teilnehmer und Datenlieferung 2015 Österreich kommunal: 859 ARAs bzw. 22,3 Mio. EW davon Südtirol: 25 ARAs bzw. 1,87 Mio. EW
behr Labor-Technik Biologische Abbaubarkeit Laborkläranlagen für die Wasseranalyse ABWASSER
 behr Labor-Technik Biologische Abbaubarkeit Laborkläranlagen für die Wasseranalyse ABWASSER behrotest Laborkläranlagen Laborkläranlagen kommen in der Abwasseranalytik bei Belebtschlamm-Simulationstests
behr Labor-Technik Biologische Abbaubarkeit Laborkläranlagen für die Wasseranalyse ABWASSER behrotest Laborkläranlagen Laborkläranlagen kommen in der Abwasseranalytik bei Belebtschlamm-Simulationstests
20. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Rückblick Ergebnisse 2012
 20. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Rückblick Ergebnisse 2012 Gerhard Spatzierer 20 Jahre Gewässerschutz Entwicklung der Abwasserreinigung in Österreich Information für die Öffentlichkeit Motivation
20. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Rückblick Ergebnisse 2012 Gerhard Spatzierer 20 Jahre Gewässerschutz Entwicklung der Abwasserreinigung in Österreich Information für die Öffentlichkeit Motivation
Auf dem Weg zur Energieautarkie - Betriebsergebnisse der GKA Weilerbach
 Auf dem Weg zur Energieautarkie - Betriebsergebnisse der GKA Weilerbach Dipl.-Ing Stefan Krieger HYDRO-Ingenieure Energie & Wasser GmbH 03.11.2016 Seite 1 Folie 1 Gliederung Ausgangssituation Ziele Technische
Auf dem Weg zur Energieautarkie - Betriebsergebnisse der GKA Weilerbach Dipl.-Ing Stefan Krieger HYDRO-Ingenieure Energie & Wasser GmbH 03.11.2016 Seite 1 Folie 1 Gliederung Ausgangssituation Ziele Technische
Dipl.-Ing. Karsten Golde. FG Hochspannungstechnik Prof. Dr.-Ing. Volker Hinrichsen TU Darmstadt Landgraf-Georg-Str. 4 D Darmstadt, Germany
 Grundsatzuntersuchungen zum Schalten in Flüssig- Stickstoff-Umgebung zur Anwendung in zukünftigen Hochtemperatur-Supraleitungs-(HTS)- Mittelspannungsnetzen der elektrischen Energieversorgung Dipl.-Ing.
Grundsatzuntersuchungen zum Schalten in Flüssig- Stickstoff-Umgebung zur Anwendung in zukünftigen Hochtemperatur-Supraleitungs-(HTS)- Mittelspannungsnetzen der elektrischen Energieversorgung Dipl.-Ing.
Mikrobielle Brennstoffzellen auf kommunalen Kläranlagen
 Bochumer Workshop 8. September 2016 RUB, Bochum Mikrobielle Brennstoffzellen auf kommunalen Kläranlagen Förderung: Fachliche Begleitung: Heinz Hiegemann, Manfred Lübken, Marc Wichern 1. Funktionsweise:
Bochumer Workshop 8. September 2016 RUB, Bochum Mikrobielle Brennstoffzellen auf kommunalen Kläranlagen Förderung: Fachliche Begleitung: Heinz Hiegemann, Manfred Lübken, Marc Wichern 1. Funktionsweise:
Mikrobiologie des Abwassers
 Mikrobiologie des Abwassers Kläranlage (Belebtschlamm und Faulturm) www.klaeranlage-online.de Aufbau einer Kläranlage Kläranlage Schwerte Abbildung aus Mudrack, 1988 Daten zur Kläranlage Oldenburg (Wehdestraße
Mikrobiologie des Abwassers Kläranlage (Belebtschlamm und Faulturm) www.klaeranlage-online.de Aufbau einer Kläranlage Kläranlage Schwerte Abbildung aus Mudrack, 1988 Daten zur Kläranlage Oldenburg (Wehdestraße
Expertise. Wissenschaftlich-technische Analyse von neuartigen Brennstoffzellen für maritime Anwendungen, vorrangig für den Unterwassereinsatz
 Expertise Wissenschaftlich-technische Analyse von neuartigen Brennstoffzellen für maritime Anwendungen, vorrangig für den Unterwassereinsatz Bearbeitungszeitraum: Oktober-Dezember 2002 AMT Analysenmesstechnik
Expertise Wissenschaftlich-technische Analyse von neuartigen Brennstoffzellen für maritime Anwendungen, vorrangig für den Unterwassereinsatz Bearbeitungszeitraum: Oktober-Dezember 2002 AMT Analysenmesstechnik
Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2011/12
 Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 211/12 Teil des Moduls MN-C-AlC Dr. Matthias Brühmann Dr. Christian Rustige Inhalt Montag, 9.1.212, 8-1 Uhr, HS III Allgemeine Einführung in die Quantitative
Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 211/12 Teil des Moduls MN-C-AlC Dr. Matthias Brühmann Dr. Christian Rustige Inhalt Montag, 9.1.212, 8-1 Uhr, HS III Allgemeine Einführung in die Quantitative
Leitfaden und Regelwerke zur Energieeffizienz auf Kläranlagen. Dr.-Ing. Manja Steinke, Bochum
 Leitfaden und Regelwerke zur Energieeffizienz auf Kläranlagen Dr.-Ing. Manja Steinke, Bochum Osnabrück - 10. Oktober 2011 Gliederung Energiepotentiale der Wasserwirtschaft Wesentliche Leitfäden und Regelwerke
Leitfaden und Regelwerke zur Energieeffizienz auf Kläranlagen Dr.-Ing. Manja Steinke, Bochum Osnabrück - 10. Oktober 2011 Gliederung Energiepotentiale der Wasserwirtschaft Wesentliche Leitfäden und Regelwerke
Elektrizität. = C J m. Das Coulomb Potential φ ist dabei:
 Elektrizität Die Coulombsche potentielle Energie V einer Ladung q im Abstand r von einer anderen Ladung q ist die Arbeit, die aufgewendet werden muss um die zwei Ladungen aus dem Unendlichen auf den Abstand
Elektrizität Die Coulombsche potentielle Energie V einer Ladung q im Abstand r von einer anderen Ladung q ist die Arbeit, die aufgewendet werden muss um die zwei Ladungen aus dem Unendlichen auf den Abstand
Schlammfaulung statt aerober Stabilisierung?
 Schlammfaulung statt aerober Stabilisierung? Dr.-Ing. Klaus Siekmann Warum muss Klärschlamm stabilisiert werden? Klärschlamm hoher Anteil organischer Substanzen Kohlenhydrate Fette Eiweiß Nährboden für
Schlammfaulung statt aerober Stabilisierung? Dr.-Ing. Klaus Siekmann Warum muss Klärschlamm stabilisiert werden? Klärschlamm hoher Anteil organischer Substanzen Kohlenhydrate Fette Eiweiß Nährboden für
METTLER TOLEDO Prozessanalytik. Online-Prozessund Reinwassersysteme. Leitfaden für Online-Leitfähigkeitsmessungen Theorie und Praxis
 Leitfaden Schulexperimente Leitfähigkeit METTLER TOLEDO Prozessanalytik Online-Prozessund Reinwassersysteme Leitfaden für Online-Leitfähigkeitsmessungen Theorie und Praxis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Leitfaden Schulexperimente Leitfähigkeit METTLER TOLEDO Prozessanalytik Online-Prozessund Reinwassersysteme Leitfaden für Online-Leitfähigkeitsmessungen Theorie und Praxis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Biofilme für die Prozessintensivierung
 Projektverbund Ressourcenschonende Biotechnologie in Bayern Projektpräsentation Biofilme für die Prozessintensivierung Prof. Dr. Ruth Freitag (Leitung) Prof. Dr. Andreas Greiner Universität Bayreuth Lehrstuhl
Projektverbund Ressourcenschonende Biotechnologie in Bayern Projektpräsentation Biofilme für die Prozessintensivierung Prof. Dr. Ruth Freitag (Leitung) Prof. Dr. Andreas Greiner Universität Bayreuth Lehrstuhl
Anwendung der Verdünnte Verbrennung für regenerativ beheizte Glasschmelzwannen Eine Möglichkeit zur NO x -Reduzierung
 Anwendung der Verdünnte Verbrennung für regenerativ beheizte Glasschmelzwannen Eine Möglichkeit zur NO x -Reduzierung Dr.-Ing. Anne Giese, Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner 24. Deutscher Flammentag Postersession
Anwendung der Verdünnte Verbrennung für regenerativ beheizte Glasschmelzwannen Eine Möglichkeit zur NO x -Reduzierung Dr.-Ing. Anne Giese, Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner 24. Deutscher Flammentag Postersession
Vom. Klärwerk zum Kraftwerk
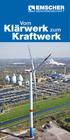 Vom Klärwerk zum Kraftwerk Klärschlammfaulung Bei der Abwasserreinigung auf Kläranlagen fällt Klärschlamm an, der sich aus den absetzbaren Stoffen des Abwassers und Bakterienmasse aus der biologischen
Vom Klärwerk zum Kraftwerk Klärschlammfaulung Bei der Abwasserreinigung auf Kläranlagen fällt Klärschlamm an, der sich aus den absetzbaren Stoffen des Abwassers und Bakterienmasse aus der biologischen
Vorlesung 3: Elektrodynamik
 Vorlesung 3: Elektrodynamik, georg.steinbrueck@desy.de Folien/Material zur Vorlesung auf: www.desy.de/~steinbru/physikzahnmed georg.steinbrueck@desy.de 1 WS 2015/16 Der elektrische Strom Elektrodynamik:
Vorlesung 3: Elektrodynamik, georg.steinbrueck@desy.de Folien/Material zur Vorlesung auf: www.desy.de/~steinbru/physikzahnmed georg.steinbrueck@desy.de 1 WS 2015/16 Der elektrische Strom Elektrodynamik:
P-Rückgewinnung aus Klärschlamm in Neuburg an der Donau. Dr. Ing. Ralf Mitsdoerffer
 P-Rückgewinnung aus Klärschlamm in Neuburg an der Donau Dr. Ing. Ralf Mitsdoerffer Tätigkeitsfelder Infrastruktur n Energie n Gebäude Umweltschutz-Ziele der Stadtentwässerung Neuburg a.d. Schutz der Gewässer
P-Rückgewinnung aus Klärschlamm in Neuburg an der Donau Dr. Ing. Ralf Mitsdoerffer Tätigkeitsfelder Infrastruktur n Energie n Gebäude Umweltschutz-Ziele der Stadtentwässerung Neuburg a.d. Schutz der Gewässer
-1 (außer in Verbindung mit Sauerstoff: variabel) Sauerstoff -2 (außer in Peroxiden: -1)
 1) DEFINITIONEN DIE REDOXREAKTION Eine Redoxreaktion = Reaktion mit Elektronenübertragung sie teilt sich in Oxidation = Elektronenabgabe Reduktion = Elektronenaufnahme z.b.: Mg Mg 2 + 2 e z.b.: Cl 2 +
1) DEFINITIONEN DIE REDOXREAKTION Eine Redoxreaktion = Reaktion mit Elektronenübertragung sie teilt sich in Oxidation = Elektronenabgabe Reduktion = Elektronenaufnahme z.b.: Mg Mg 2 + 2 e z.b.: Cl 2 +
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
Einsparpotentiale durch anaerobe Abwasserbehandlung
 Seite 1 Einsparpotentiale durch anaerobe Abwasserbehandlung Anselm J. Gleixner / Stefan Reitberger, INNOVAS GbR, Vortrag im Zentrum Energie, TerraTec 99, Leipzig am 02. März 1999 Einleitung Biogas wird
Seite 1 Einsparpotentiale durch anaerobe Abwasserbehandlung Anselm J. Gleixner / Stefan Reitberger, INNOVAS GbR, Vortrag im Zentrum Energie, TerraTec 99, Leipzig am 02. März 1999 Einleitung Biogas wird
Scale up Vom Laboraufbau zur technischen Anlage
 19. Oktober 2007 Workshop Kavitation Bad Honnef Scale up Vom Laboraufbau zur technischen Anlage Dr.-Ing. Klaus Nickel & Prof. Dr.-Ing. Uwe Neis Inhalt 1. Ultraschallanwendungen in der Umwelttechnik 2.
19. Oktober 2007 Workshop Kavitation Bad Honnef Scale up Vom Laboraufbau zur technischen Anlage Dr.-Ing. Klaus Nickel & Prof. Dr.-Ing. Uwe Neis Inhalt 1. Ultraschallanwendungen in der Umwelttechnik 2.
Forschungsvorhaben. Bentonitentwässerung mit Hilfe der Elektroosmose
 Forschungsvorhaben Bentonitentwässerung mit Hilfe der Elektroosmose Bearbeiter: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. (FH) Bernd Ulke (ulke@geotechnik.rwth-aachen.de) Problemstellung und Ziele des F+E Vorhabens Bentonitsuspensionen
Forschungsvorhaben Bentonitentwässerung mit Hilfe der Elektroosmose Bearbeiter: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. (FH) Bernd Ulke (ulke@geotechnik.rwth-aachen.de) Problemstellung und Ziele des F+E Vorhabens Bentonitsuspensionen
Untersuchung zur Gleichwertigkeit des LOVIBOND CSB vario Küvettentest mit dem Hach * CSB Küvettentest
 Untersuchung zur Gleichwertigkeit des LOVIBOND CSB vario Küvettentest mit dem CSB Küvettentest Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung und Zielsetzung 1 Verwendete Methoden, Reagenzien und Geräte 1 Teil I
Untersuchung zur Gleichwertigkeit des LOVIBOND CSB vario Küvettentest mit dem CSB Küvettentest Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung und Zielsetzung 1 Verwendete Methoden, Reagenzien und Geräte 1 Teil I
Realisierung eines thermoelektrischen Generators für die Stromerzeugung aus Niedertemperatur
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Jahresbericht 3. Dezember 2009 Realisierung eines thermoelektrischen Generators für die Stromerzeugung
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Jahresbericht 3. Dezember 2009 Realisierung eines thermoelektrischen Generators für die Stromerzeugung
Direkt- oder Indirekteinleitung von Industrieabwasser Behandlungsverfahren für die Nahrungsmittelindustrie
 1 Direkt- oder Indirekteinleitung von Industrieabwasser Behandlungsverfahren für die Nahrungsmittelindustrie 2 Inhalt: Definition Indirekteinleiter Direkteinleiter Gesetzliche Vorgaben in Deutschland Vorbehandlungsverfahren
1 Direkt- oder Indirekteinleitung von Industrieabwasser Behandlungsverfahren für die Nahrungsmittelindustrie 2 Inhalt: Definition Indirekteinleiter Direkteinleiter Gesetzliche Vorgaben in Deutschland Vorbehandlungsverfahren
HUBER CarbonWin -Verfahren
 WASTE WATER Solutions HUBER CarbonWin -Verfahren Verfahren für alle Anwendungsfälle zur Kohlenstoff ausschleusung aus Rohabwasser Optimierung der Energiebilanz von Kläranlagen Umstellung von aerober hin
WASTE WATER Solutions HUBER CarbonWin -Verfahren Verfahren für alle Anwendungsfälle zur Kohlenstoff ausschleusung aus Rohabwasser Optimierung der Energiebilanz von Kläranlagen Umstellung von aerober hin
Klimaschutzteilkonzept Erstellung und Umsetzung auf der KA - Dessau
 Klimaschutzteilkonzept Erstellung und Umsetzung auf der KA - Dessau Gliederung 1. Einführung 2. Projekt Klimafreundliche Kläranlage 3. Diskussion 22.11.2017, Rico Röder DWA - Kanalnachbarschaft 1 1. Einführung
Klimaschutzteilkonzept Erstellung und Umsetzung auf der KA - Dessau Gliederung 1. Einführung 2. Projekt Klimafreundliche Kläranlage 3. Diskussion 22.11.2017, Rico Röder DWA - Kanalnachbarschaft 1 1. Einführung
Ansätze für eine energieeffiziente Abwasserwirtschaft
 Ansätze für eine energieeffiziente Abwasserwirtschaft 2. Internationale Symposium Abwasser-Recycling Braunschweig, 04. 06.11.2009 Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz Lehrstuhl Siedlungswasserwirtschaft und
Ansätze für eine energieeffiziente Abwasserwirtschaft 2. Internationale Symposium Abwasser-Recycling Braunschweig, 04. 06.11.2009 Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz Lehrstuhl Siedlungswasserwirtschaft und
TerraNova Energy Clean Energy beyond Coal
 TerraNova Energy Clean Energy beyond Coal Biokohle aus Reststoffbiomasse und Klärschlamm durch Hydrothermale Karbonisierung (HTC) TerraNova Energy - Anlagenbauer für dezentrale HTC-Anlagen zur Verwertung
TerraNova Energy Clean Energy beyond Coal Biokohle aus Reststoffbiomasse und Klärschlamm durch Hydrothermale Karbonisierung (HTC) TerraNova Energy - Anlagenbauer für dezentrale HTC-Anlagen zur Verwertung
Was ist Elektrochemie? Elektrochemie. Elektrochemie ist die Lehre von der Beziehung
 Was ist Elektrochemie? Elektrochemie Elektrochemie ist die Lehre von der Beziehung zwischen elektrischen und chemischen Prozessen. 131 Stromleitung in einem Metall Wir haben gelernt, dass die Stromleitung
Was ist Elektrochemie? Elektrochemie Elektrochemie ist die Lehre von der Beziehung zwischen elektrischen und chemischen Prozessen. 131 Stromleitung in einem Metall Wir haben gelernt, dass die Stromleitung
Abwasser. Rundgang Kläranlage
 Abwasser Rundgang Kläranlage Mit dem Bau der Kläranlage Geiselbullach wurde 1964 begonnen und über Jahrzehnte entstand eine hochmoderne, innovative Anlage, ausgelegt für 250.000 Einwohner der 10 Verbandskommunen.
Abwasser Rundgang Kläranlage Mit dem Bau der Kläranlage Geiselbullach wurde 1964 begonnen und über Jahrzehnte entstand eine hochmoderne, innovative Anlage, ausgelegt für 250.000 Einwohner der 10 Verbandskommunen.
BHKW Gysenbergpark. Hochschule Ruhr West. Projektarbeit. Bachelormodul Projektmanagement Studiengang Energie- und Umwelttechnik
 Hochschule Ruhr West Bachelormodul Studiengang Energie- und Umwelttechnik Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sylvia Schädlich Kooperationspartner: Gebäudetechnik Molke GmbH Ansprechpartner: Dipl. Ing. Bernd Molke
Hochschule Ruhr West Bachelormodul Studiengang Energie- und Umwelttechnik Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sylvia Schädlich Kooperationspartner: Gebäudetechnik Molke GmbH Ansprechpartner: Dipl. Ing. Bernd Molke
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
Meine Energiequelle. das effizienteste Kleinkraftwerk der Welt
 Meine Energiequelle das effizienteste Kleinkraftwerk der Welt Aus Gas wird Strom Innovative Brennstoffzellen-Technologie Der BlueGEN wird mit Ihrem Gasanschluss verbunden und erzeugt aus Erdgas oder Bioerdgas
Meine Energiequelle das effizienteste Kleinkraftwerk der Welt Aus Gas wird Strom Innovative Brennstoffzellen-Technologie Der BlueGEN wird mit Ihrem Gasanschluss verbunden und erzeugt aus Erdgas oder Bioerdgas
KLARANLAGE EBERSBERG
 KLARANLAGE EBERSBERG MICROGASTURBINE UND FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGEN ZUR STROMPRODUKTION Das Energiekonzept der Kläranlage Ebersberg Energieproduktion und Energieeffizienz steigern durch Kraft-Wärmekopplung
KLARANLAGE EBERSBERG MICROGASTURBINE UND FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGEN ZUR STROMPRODUKTION Das Energiekonzept der Kläranlage Ebersberg Energieproduktion und Energieeffizienz steigern durch Kraft-Wärmekopplung
Bayerisches Landesamt für Umwelt. - Konsequenzen für Wasserrecht und Abgabe
 Fremdwasser - Konsequenzen für Wasserrecht und Abgabe Fremdwasser Inhalt 1. Rechtliche Grundlagen 2. Auswirkungen von FW im Wasserrecht 3. Auswirkungen von FW auf fdie Abwasserabgabe b b 2 Rechtliche Grundlagen
Fremdwasser - Konsequenzen für Wasserrecht und Abgabe Fremdwasser Inhalt 1. Rechtliche Grundlagen 2. Auswirkungen von FW im Wasserrecht 3. Auswirkungen von FW auf fdie Abwasserabgabe b b 2 Rechtliche Grundlagen
Energieautarke Kläranlagen als aktiver Beitrag zum Gewässerschutz
 3. Internationale Kreislaufwirtschaftskonferenz Rheinland-Pfalz Innovation in der Wasserwirtschaft: Energieautarke Kläranlagen als aktiver Beitrag zum Gewässerschutz 17. Oktober 2012 Stefan Krieger Dr.
3. Internationale Kreislaufwirtschaftskonferenz Rheinland-Pfalz Innovation in der Wasserwirtschaft: Energieautarke Kläranlagen als aktiver Beitrag zum Gewässerschutz 17. Oktober 2012 Stefan Krieger Dr.
UIP-Projekt Kläranlage Schwalmstadt-Treysa: Steigerung der Ressourcen und Energieeffizienz der Kläranlage Treysa
 UIP-Projekt Kläranlage Schwalmstadt-Treysa: Steigerung der Ressourcen und Energieeffizienz der Kläranlage Treysa Dipl.-Ing. Susanne Brants Stadtwerke Schwalmstadt Dipl.-Ing. Barbara Retamal Pucheu Dipl.-Ing.
UIP-Projekt Kläranlage Schwalmstadt-Treysa: Steigerung der Ressourcen und Energieeffizienz der Kläranlage Treysa Dipl.-Ing. Susanne Brants Stadtwerke Schwalmstadt Dipl.-Ing. Barbara Retamal Pucheu Dipl.-Ing.
Landkreis Harburg Betrieb Abfallwirtschaft. Nachsorge der Deponie Dibbersen, Landkreis Harburg
 Landkreis Harburg Betrieb Abfallwirtschaft Nachsorge der Deponie Dibbersen, Landkreis Harburg Gutachterliches Konzept zur weiteren Deponienachsorge unter Berücksichtigung flankierender Maßnahmen zur Verbesserung
Landkreis Harburg Betrieb Abfallwirtschaft Nachsorge der Deponie Dibbersen, Landkreis Harburg Gutachterliches Konzept zur weiteren Deponienachsorge unter Berücksichtigung flankierender Maßnahmen zur Verbesserung
Inhalt. History Prinzip der Brennstoffzelle Wasserstoff-Sauerstoff-BZ. Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell Direct Methanol Fuel Cell.
 Brennstoffzellen Inhalt History Prinzip der Brennstoffzelle Wasserstoff-Sauerstoff-BZ Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell Direct Methanol Fuel Cell o Stacks o Anwendung o Fazit History Erste BZ vor
Brennstoffzellen Inhalt History Prinzip der Brennstoffzelle Wasserstoff-Sauerstoff-BZ Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell Direct Methanol Fuel Cell o Stacks o Anwendung o Fazit History Erste BZ vor
BIOKATGAS. Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage
 BIOKATGAS Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage Was ist Bio-Kat-Gas? Bio-Kat-Gas ist ein rein pflanzliches, vollkommen biologisch abbaubares Produkt aus einer speziellen Mischung von Katalysatoren
BIOKATGAS Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage Was ist Bio-Kat-Gas? Bio-Kat-Gas ist ein rein pflanzliches, vollkommen biologisch abbaubares Produkt aus einer speziellen Mischung von Katalysatoren
Redoxgleichungen: Massenerhaltung Elektronenaufnahme/ -abgabe Halbreaktion: Getrennter Prozess (Reduktion, Oxidation getrennt anschauen)
 AChe 2 Kapitel 20: Elektrochemie Oxidationszahlen: Ladung des Atomes wenn es als Ion vorliegen würde. Oxidation: OX-Zahl steigt, Reduktion: OX-Zahl sinkt. Redoxgleichungen: Massenerhaltung Elektronenaufnahme/
AChe 2 Kapitel 20: Elektrochemie Oxidationszahlen: Ladung des Atomes wenn es als Ion vorliegen würde. Oxidation: OX-Zahl steigt, Reduktion: OX-Zahl sinkt. Redoxgleichungen: Massenerhaltung Elektronenaufnahme/
IEE. Modellierung und Simulation der Zelleigenschaften auf Basis von zeitvarianten Stoffdaten (GEENI)
 Problem: Eine erfolgreiche Modellierung von Lithium-Ionen-Batterien muss alle physikalischen und elektrochemischen Vorgänge, wie beispielsweise die elektrochemischen Reaktionen an den Elektroden, die Diffusion
Problem: Eine erfolgreiche Modellierung von Lithium-Ionen-Batterien muss alle physikalischen und elektrochemischen Vorgänge, wie beispielsweise die elektrochemischen Reaktionen an den Elektroden, die Diffusion
UIP-Projekt Kläranlage Schwalmstadt-Treysa: Vom Stromverbraucher zum Heizkraftwerk
 UIP-Projekt Kläranlage Schwalmstadt-Treysa: Vom Stromverbraucher zum Heizkraftwerk Dipl.-Ing. Barbara Retamal Pucheu iat Darmstadt Dipl.-Ing. Susanne Brants Stadtwerke Schwalmstadt Inhalt Ausgangssituation
UIP-Projekt Kläranlage Schwalmstadt-Treysa: Vom Stromverbraucher zum Heizkraftwerk Dipl.-Ing. Barbara Retamal Pucheu iat Darmstadt Dipl.-Ing. Susanne Brants Stadtwerke Schwalmstadt Inhalt Ausgangssituation
Dr. A. Kuntze Sensoren SENSOREN
 Dr. A. Kuntze Sensoren SENSOREN GLAS GLAS IST NICHT GLEICH GLAS... Glas ist nicht gleich Glas Neben ihrer Fähigkeit, ph-änderungen zu registrieren, muss die ph-membran noch eine Reihe weiterer Eigenschaften
Dr. A. Kuntze Sensoren SENSOREN GLAS GLAS IST NICHT GLEICH GLAS... Glas ist nicht gleich Glas Neben ihrer Fähigkeit, ph-änderungen zu registrieren, muss die ph-membran noch eine Reihe weiterer Eigenschaften
Kläranlagen als Energiepuffer für Stromnetze
 Kläranlagen als Energiepuffer für Stromnetze Klaus-Michael Mangold DECHEMA-Forschungsinstitut ERWAS-Abschlusskonferenz, Berlin, 15. - 16. Mai 2017 1 ERWAS-Statusseminar, Essen, 02.- 03.02.2016 Projektidee:
Kläranlagen als Energiepuffer für Stromnetze Klaus-Michael Mangold DECHEMA-Forschungsinstitut ERWAS-Abschlusskonferenz, Berlin, 15. - 16. Mai 2017 1 ERWAS-Statusseminar, Essen, 02.- 03.02.2016 Projektidee:
Das Hybridkraftwerk Prenzlau. Aktueller Stand
 Das Hybridkraftwerk Prenzlau Aktueller Stand Dresden, 21.11.2011 D Grundsteinlegung 21.04.2009 2 Inbetriebnahme 25.10.2011 www.enertrag.com 3 Übersicht 1. Motivation 1. Grundkonzeption Hybridkraftwerk
Das Hybridkraftwerk Prenzlau Aktueller Stand Dresden, 21.11.2011 D Grundsteinlegung 21.04.2009 2 Inbetriebnahme 25.10.2011 www.enertrag.com 3 Übersicht 1. Motivation 1. Grundkonzeption Hybridkraftwerk
Recycling von Metallionen aus Lithiumionenbatterien durch Flüssigmembranpermeation mit gestützten Membranen
 Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik Recycling von Metallionen aus Lithiumionenbatterien durch Flüssigmembranpermeation mit gestützten Membranen, Matthäus Siebenhofer Institut für
Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik Recycling von Metallionen aus Lithiumionenbatterien durch Flüssigmembranpermeation mit gestützten Membranen, Matthäus Siebenhofer Institut für
