Wissenschaftliche Informationen für die regionale Praxis. Bioenergie in der Region Göttingen
|
|
|
- Willi Hofmeister
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wissenschaftliche Informationen für die regionale Praxis Bioenergie in der Region Göttingen
2 Impressum Herausgeber Energieagentur Region Göttingen e.v. Berliner Straße Göttingen Ansprechpartner: Winfried Binder Netzwerk Regenerative Energien binder@energieagentur-goettingen.de Projektmanagement: Linda Hartmann Bioenergie-Regionen stärken (BEST) linda.hartmann@posteo.de Layout & Druck Blackbit neue Werbung GmbH, Göttingen SUSTAINMENT Spezialisierte Kommunikation für Nachhaltiges, Kilian Rüfer, Göttingen Bild Titelseite Agrarlandschaft mit Mais, Getreide und Kurzumtriebsplantage Foto: N. Lamersdorf 1. Auflage, August 2014 Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier Impressum
3 Inhalt Strukturreicher Mischwald, Bild: R. Steffens Bioenergie aus der Region in Wissenschaft & Praxis 4 Was ist Bioenergie? 4 Bioenergielandschaft in der Region Göttingen 6 Landschaftsbild und Akzeptanz von Bioenergie 10 Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen 13 Flächenkonkurrenz 13 Naturschutz 13 Umweltschutz 17 Stoffliche und energetische Nutzung von Holz 18 Wirtschaftlichkeit 19 Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen 21 - Konflikte entschärfen Energiebedarf senken 21 Biomasseangebot steigern 21 Beratungswerkzeug: Flächen und Machbarkeit für holzige Biomasse identifizieren 26 Information und Beratung 29 Inhalt
4 bioenergie aus der region in wissenschaft & praxis Was ist Bioenergie? Als Bioenergie bezeichnet man Strom, Wärme und Kraftstoffe, die aus organischen Stoffen von Pflanzen oder Tieren (= Biomasse) gewonnen werden. Bioenergie zählt zu den erneuerbaren Energien, da sich Biomasse innerhalb von überschaubaren Zeiträumen regeneriert. Biomasse ist der zurzeit am stärksten genutzte erneuerbare Energieträger in Deutschland. Im Jahr 2012 betrug der Anteil der Bioenergie an der Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien ca. 66 %. Zur Energiegewinnung werden hauptsächlich Holz, Energiepflanzen wie Mais, Getreide und Raps, landwirtschaftliche Reststoffe sowie Bioabfälle genutzt. Sonnenlicht Sauerstoff Kohlendioxid Wasser Zucker Biomasse entsteht durch die Photosynthese. Aus Kohlendioxid, Wasser und Sonnenlicht werden energiereiche Kohlenstoffverbindungen wie Zucker und Stärke aufgebaut. Letztlich wird diese gespeicherte Energie bei einer Verbrennung freigesetzt. Holz, Gas und Kraftstoffe sind gut speicherbar bzw. lagerfähig. Biogas kann durch eine bedarfsorientierte Verstromung gewisse Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Durch die Nutzung von Biomasse wird CO 2 freigesetzt, welches zuvor durch das Wachstum der Pflanze gespeichert wurde. Demzufolge hat Energie aus Biomasse eine deutlich bessere CO 2 -Bilanz im Vergleich zu fossilen Energieträgern (z.b. Erdöl). Die CO 2 -Blianz ist jedoch nicht komplett ausgeglichen, da beim Energiepflanzenanbau und beim Betrieb der Anlage Treibhausgas-Emissionen entstehen. Wo stehen wir heute? Im Jahr 2013 betrug in Deutschland der Anteil der Bioenergie am Endenergieverbrauch (Wärme und Strom) 7,6 %. Ähnliche Zahlen ergeben sich für das Bundesland Niedersachsen. Von den erneuerbaren Energien wurden 2013 in Niedersachen 91 % der Wärme mit Bioenergie gewonnen. Holz spielt dabei eine besonders große Rolle. 91 % der erneuerbaren Wärme in Niedersachsen aus Biomasse Bioenergie aus der Region in Wissenschaft & Praxis 4
5 Grundsätzlich unterscheidet man drei Formen von Biomasse, aus denen in unterschiedlichen Verfahren Strom, Wärme und Kraftstoff gewonnen wird: Feste Biomasse: Zur festen Biomasse zählen z.b. Holz und Großgräser aus denen Wärme und Strom gewonnen wird. Häufig geschieht dies durch Verbrennung z.b. in privaten Heizungen und in industriellen Heizwerken oder Heiz-Kraftwer- ken. Ebenfalls kann durch eine Verschwelung Holzgas gewonnen werden, welches in Blockheizkraftwerken umgewandelt wird. Flüssige Biomasse-Produkte: Pflanzenöle, Biodiesel und Bioethanol sind flüssige Produkte aus Biomasse. An der Kraftstoffnutzung machten diese 2012 einen Anteil von 5,7 % aus. Pflanzenöle können aber auch zur Wärmegewinnung verbrannt werden. Biodiesel wird insbesondere aus Rapsöl produziert und macht den größten Anteil an Biokraftstoffen aus. Bioethanol wird durch Vergärung von Stärke oder Zucker gewonnen. In Deutschland werden meist Getreide oder Zuckerrüben vergoren. Sowohl Biodiesel als auch Bioethanol werden hauptsächlich den fossilen Kraftstoffen beigemischt. Gasförmige Biomasse-Produkte: Biogas wird in Biogasanlagen durch den mikrobiellen Abbau von organischen Stoffen gewonnen und besteht hauptsächlich aus Methan und Kohlendioxid. Biogas kann über eine Kraft-Wärme-Kopplung in Strom und Wärme umgewandelt werden oder nach entsprechender Aufbereitung in das Erdgasnetz eingespeist werden. Biomethan kann außerdem als Kraftstoff für erdgasbetriebene Fahrzeuge dienen. Zur Biogasproduktion können nachwachsende Rohstoffe wie Mais oder Roggen, Gülle und Abfälle dienen. Ebenfalls gibt es Deponie- und Holzgas. Brennholz, Bild: 3N e.v. Biogasanlage in Jühnde, Bild: C. Mühlhausen / Landpixel 5 Bioenergie aus der Region in Wissenschaft & Praxis
6 Bioenergielandschaft in der Region Göttingen Mit der Kombination aus innovativem Wissenschaftsstandort und ländlich geprägtem Umland bietet die Region Göttingen gute Voraussetzungen für den Ausbau der regenerativen Energien und insbesondere auch der Bioenergie. Sowohl die Georg-August-Universität als auch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) sind in diesem Bereich aktiv ging im Landkreis Göttingen als erstes Bioenergiedorf Deutschlands Jühnde in Betrieb. Das Dorf produziert heute doppelt so viel Strom aus erneuerbarer Energie, wie es selber verbraucht und versorgt ca. 70 % der Haushalte über ein Nahwärmenetz. Das Pilotprojekt wurde vom Interdisziplinären Zentrum für Nachhaltige Entwicklung an der Universität Göttingen unterstützt. Inzwischen sind im Landkreis Göttingen 5 Bioenergiedörfer im Betrieb (Jühnde, Barlissen, Wollbrandshausen, Krebeck und Reiffenhausen). Beim Bioenergiedorfkonzept wird möglichst die gesamte Wärme- und Stromversorgung eines Ortes auf Basis von Biomasse zur Verfügung gestellt. Die Grundbausteine sind meist eine Biogasanlage mit einem Blockheizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung sowie eine Holzhackschnitzel-Heizanlage zur Wärmeerzeugung. Über ein Nahwärmenetz ist die überwiegende Anzahl der Haushalte an das Wärmeversorgungskonzept angeschlossen. Das Besondere an den Bioenergiedorfkonzepten der Region Göttingen ist, dass die Bürger in die Projektgestaltung eingebunden wurden. Die Energieversorgungsanlagen befinden sich (in Form einer Genossenschaft) überwiegend im Eigentum der Wärmekunden sowie der Biomasse liefernden Landwirte. Die Wertschöpfungskette der Energieversorgung bleibt auf diese Weise in der Region. Der im Bereich Bioenergie in die Wege geleitete Partizipationsprozess war ein Grundbaustein für die Entstehung des Netzwerkes Regenerative Energien, welches von der Energieagentur Region Göttingen betreut wird. Die Energieagentur initiiert und betreut Projekte und informiert zu den Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Mit ihrer Unterstützung findet ein Austausch zwischen vielfältigen Akteuren aus Wissenschaft und Praxis statt. Über das Teilprojekt Wissenstransfer in die Bioenergie-Region Göttinger Land ist die Energieagentur auch an dem Verbundprojekt BEST (Bioenergie-Regionen stärken) beteiligt. Seit 2012 besteht eine Partnerschaft zur Bioenergie-Region Wendland-Elbetal. Im Mittelpunkt der Kooperation stehen gemeinsame Aktivitäten, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit z.b. zu Themen wie Bioenergie und Naturschutz oder Optimierung von Nahwärmenetzen. Bioenergiedorf Jühnde, Bild: E. Fangmeier Bioenergie aus der Region in Wissenschaft & Praxis 6
7 Agroforst: Grünland im Wechsel mit Weidenstreifen im Landkreis Göttingen, Bild: M. Ehret Diese Broschüre ist im Rahmen des Verbundprojektes BEST ( entstanden, das seit 2010 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Innerhalb von BEST wurden regional angepasste Konzepte und innovative Systemlösungen zur Produktion von Biomasse entwickelt und im Hinblick auf ökologische und ökonomische Auswirkungen bewertet. Insbesondere die Produktion und Nutzung von holziger Biomasse in der Region Göttingen stand dabei im Vordergrund der Betrachtung. Die Region Göttingen umfasst sowohl den Landkreis Göttingen, als auch die Stadt Göttingen. Ergebnisse aus der vierjährigen Forschungslaufzeit werden in dieser Broschüre dargestellt. Göttingens Bioenergie heute Trotz der günstigen Rahmenbedingungen hat der aus Biomasse erzeugte Anteil an Strom und Wärme bisher nur einen geringen Anteil am Gesamtenergieverbrauch in der Region Göttingen (Ldk. Gö. etwa 5 % im Jahr 2011, Stadt Gö. etwa 1,5 % im Jahr 2011). Rund 9 % des gesamten im Landkreis Göttingen genutzten Stroms wird in Biomasseanlagen erzeugt. Insgesamt sind 13 Biogasanlagen in Betrieb, für die nächsten Jahre sind weitere in Planung. In der Stadt Göttingen trägt die Nutzung von regional erzeugtem Biogas zu rund 2 % zur Strom- bzw. 1 % zur Wärmebedarfsdeckung bei. Zur unabhängigen Wärmeversorgung werden in der Region Göttingen zahlreiche Feuerungsanlagen betrieben. Im Landkreis Göttingen tragen diese Anlagen zu rund 4 % und in der Stadt Göttingen zu rund 1 % zur Deckung des Wärmebedarfs bei. In den letzten Jahren konnte eine deutliche Zunahme an kleinen Feuerstätten beobachtet werden, sodass auch in Zukunft davon ausgegangen werden kann, dass holzige Biomasse eine bedeutende Rolle bei der Wärmeversorgung spielen wird. Wie viel Holz hat die Region? Rund 30 % der Fläche im Landkreis und in der Stadt Göttingen sind Wälder. Im Rahmen des Projektes BEST wurde das energetisch nutzbare Holzpotenzial für Waldrestholz, Offenlandgehölze und Kurzumtriebsplantagen in der Region Göttingen ermittelt. Waldrestholz Um die Möglichkeiten und Grenzen der nachhaltigen Erschließung des Waldrestholzpotenziales aufzuzeigen, wurden von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW- FVA) auf Grundlage von Forsteinrichtungsinformationen Modellbestände für die gesamte Region Göttingen generiert und mit dem Waldwachstumssimulator Waldplaner ab 2011 für 30 Jahre fortgeschrieben. Die Gesamtwaldfläche der Projektregion Göttingen betrug ha. Auf der niedersächsischen Waldbaustrategie (LÖWE - langfristige ökologische Waldentwicklung) basierend wurde das im Simulationszeitraum anfallende Waldholz sortimentiert und das Energieholzpotenzial aus Derb- und Schwachholz abgeschätzt. Das Derbholzpotenzial setzte sich aus Restholz über 7 cm Enddurchmesser und dem 17 Energie Bioenergie aus Flur aus und der Wald Region in in Wissenschaft und & Praxis
8 Nachhaltigkeit für die Zukunft unserer Kinder, Bild: Niedersächsische Landesforsten energetisch genutzten Teil des Industrieholzsortimentes zusammen. Restholz bezeichnete den Holzanteil, der nicht als Industrie- oder Stammholz sortimentiert wurde. Auf einer Auswertung des Nutzungsverhaltens der letzten 10 Jahre basierend wurde angenommen, dass 45,5 % des Laub- und 13,4 % des Nadel-Industrieholzes energetisch genutzt wurden (Wördehoff, bisher unveröffentlicht). Das Restholz unter 7 cm Durchmesser wurde als Schwachholzpotenzial bilanziert. Mit Blick auf den mit der Nutzung von Schwachholz verbundenen überproportionalen Nährstoffaustrag wurde das Schwachholz nur auf ausreichend nährstoffversorgten Standorten in angepasster zeitlicher Auflösung bilanziert. Das Gesamtpotenzial aus dem energetisch genutzten Industrieholz und dem Waldrestholz beläuft sich im Simulationszeitraum auf durchschnittlich t Trockenmasse pro Jahr. Unter der Annahme, dass die Holzfeuchte beim Verbrennen des Holzes 20 % beträgt, entspricht dies etwa GWh pro Jahr. Dies entspricht in etwa der Hälfte des jährlichen Energiebedarfs im Landkreis Göttingen (ohne Stadt). Welches Holz ist nachhaltig? Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Sie können auf regionale Ressourcen und regionale Anbieter zurückgreifen und machen sich damit unabhängig von Energieimporten. Ob die Nutzung von Holz nachhaltig ist, hängt von dessen Herkunft ab. Insgesamt sind die natürlichen Vorkommen und Anbaumöglichkeiten für Holz begrenzt. Damit die Ressource Holz langfristig für die Nutzung als Werkstoff und Enegieträger zur Verfügung stehen kann, bedarf es einer nachhaltigen Forstwirtschaft und eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Holz. Achten Sie beim Brennstoffeinkauf darauf, dass das Holz möglichst aus der Nähe stammt. So unterstützen Sie die regionale Wertschöpfung und es entstehen keine unnötigen Transportwege. Lohnt sich Waldrestholz aus der Region? Die Holzbereitstellung muss neben den ökologischen Gesichtspunkten auch ökonomisch rational sein. Wie die Analyse der Bereitstellungsprozesse für Waldschwachholz und die sozioökonomische Bewertung im Rahmen des BEST-Projektes zeigten, ist eine Bereitstellung von schwachem Waldrestholz nach einer Derbholznutzung in der Regel sehr energieaufwendig und selten kostendeckend. Das angegebene Potenzial weist demnach die Maximalenergiemenge aus, die sich je nach Bereitstellungsaufwand noch verringert. Hackschnitzelproduktion am Waldrand bei Waake, Bild: W. Schmidt Energie Bioenergie aus aus Flur der und Region Wald in Wissenschaft und & Praxis 18
9 Agroforst: Getreide im Wechsel mit Weiden- und Pappelstreifen in der Stadt Göttingen, Bild: L. Hartmann Offenlandgehölze Zu den Offenlandgehölzen zählen Hecken, Feldgehölze, Baumreihen, Alleen und Einzelbäume bzw. Büsche. Diese multifunktionalen Bestandteile (z.b. Windschutz, Erosionsschutz, Biotopverbund, Ästhetik) der Landschaft können auch energetisch genutzt werden. Im Rahmen von BEST wurden die maximalen Potenziale für die Region Göttingen abgeschätzt. Demnach ergeben sich für die Stadt und den Landkreis gemeinsam etwa 86 GWh pro Jahr, die unter Berücksichtigung geeigneter Nutzungskonzepte bereitgestellt werden könnten. Kurzumtriebsplantagen Unter Kurzumtriebsplantagen (KUP) versteht man den Anbau von schnellwachsenden Gehölzen wie Pappel und Weide auf landwirtschaftlichen und vormals primär ackerbaulich genutzten Flächen, die im mehrjährigen Rhythmus und nach Wiederaustrieb geerntet werden. Solange KUP innerhalb von 20 Jahren mindestens einmal geerntet werden, stellt diese Form der Landnutzung eine landwirtschaftliche Flächennutzung (Dauerkultur) dar und gilt nicht als Aufforstung. Ziel des KUP-Anbaus ist die Erzeugung von holziger Biomasse für die thermische oder stoffliche Verwertung. Eine spezielle Variante des KUP- Anbaus ist die Mischung von KUP-Streifen mit Ackerkulturen auf derselben landwirtschaftlichen Fläche. Bei dieser gemischten Nutzungsform von ein- und mehrjährigen Kulturen spricht man von Agroforst (AF). Wieviel Holz kann vom Acker kommen? Untersuchungen im Rahmen von BEST zeigen, dass rund 58 % der Ackerflächen im Stadtgebiet Göttingen und rund 89 % im Landkreis Göttingen aus naturräumlicher Sicht für den produktiven Anbau (> 8 t Trockenmasse pro ha und Jahr) von schnellwachsenden Gehölzen geeignet sind. Der Biomasseertrag und das damit einhergehende Primärenergiepotenzial hängen stark von der Standortwahl ab. Analysen von Busch und Thiele (2014) im Rahmen des BEST-Projekts zeigen, dass Pappel-KUP im 5-jährigen Umtrieb erst ab mittleren Erträgen von mehr als 14 t Trockenmasse pro ha und Jahr konkurrenzfähig gegenüber einer Raps-Winterweizen-Wintergerste-Fruchtfolge sind. Diese konkurrenzfähigen KUP-Flächen sind in der Region Göttingen vorhanden. Unter der Annahme, dass 10 % dieser Ackerstandorte in der Region Göttingen zum Anbau von KUP genutzt werden, ergibt sich ein energetisches Potenzial von knapp 22 GWh pro Jahr (277 ha) im Stadtgebiet und rund 333 GWh pro Jahr (4.060 ha) für den Landkreis Göttingen. 19 Energie Bioenergie aus Flur aus und der Wald Region in in Wissenschaft und & Praxis
10 Derzeit sind in der Region Göttingen ca. 15 ha an KUP bzw. AF zu finden. Geht man von 12 t Trockenmasse pro ha und Jahr als Durchschnittsertrag aus (diese Größe wurde als mittlerer Ertrag von Pappel-KUP auf Ackerflächen in 5-jährigem Umtrieb für die Region Göttingen berechnet), so lassen sich jährlich rund 890 MWh an Primärenergie gewinnen. Landschafts- und Baumpflegeholz Holz das bei Pflegarbeiten und Baumschnittaktivitäten anfällt wird bisher in der Region Göttingen kaum genutzt. Dabei stellt das Landschaftspflegeholz eine wertvolle Energieressource dar, die thermisch genutzt werden könnte. Derzeit fallen jährlich schätzungsweise 4-5 t an Frischmasse im Landkreis Göttingen an, die einen Beitrag von MWh zur thermischen Energieversorgung liefern könnten. Biodiesel aus unserer Region Im Landkreis Göttingen wird auch Bioenergie in Form von Biodiesel aus Raps gewonnen. Dieser wird auf einer landwirtschaftlichen Fläche von ha (2011) produziert und ergibt einen jährlichen Energieertrag von 82 GWh. Aus Raps wird auch Biodiesel gewonnen, Bild: W. Binder Landschaftsbild und Akzeptanz von Bioenergie Der Anbau von Energiepflanzen kann nicht pauschal als positiv oder negativ für das Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft angesehen werden. Es gibt eine Vielzahl von Energiepflanzen, die sich in Bezug auf Höhe, Blüte und Anbausystem und damit auch in ihrer Wirkung auf das Landschaftsbild unterscheiden. Beispielsweise wirken die in Deutschland häufigsten Energiepflanzen Mais und Raps visuell sehr unterschiedlich. Durch neue und wenig verbreitete Energiepflanzen kann zusätzliche Vielfalt in die Landschaft gebracht werden. Besonders positiv für das Landschaftsbild sind z.b. Blühpflanzenmischungen, die sich durch eine hohe strukturelle Vielfalt und Farbdiversität auszeichnen. Auch Kurzumtriebsplantagen können die Strukturvielfalt in der Landschaft erhöhen. In gewissen Maßen können streifenförmige KUP Hecken ersetzen, die durch Flurbereinigungsmaßnahmen in der Vergangenheit als wertvolle Elemente der Kulturlandschaft verloren gegangen sind. Energie Bioenergie aus aus Flur der und Region Wald in Wissenschaft und & Praxis 101
11 Visualisierung einer Agrarlandschaft. Der Anbau von Mais in hohen Flächenanteilen wird oft negativ beurteilt, Bild: T. Boll Aufgrund ihrer Höhe können KUP ähnlich wie Mais allerdings die Sicht in die Landschaft beeinträchtigen. Regionale Situation und Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus Die Auswirkungen von Energiepflanzen auf das Landschaftsbild unterscheiden sich auch je nachdem in welcher Landschaft die Energiepflanzen angebaut werden und welche Anteile sie in der Landschaft einnehmen. In der Region Göttingen ist der Anbau von Energiepflanzen bisher nicht stark verbreitet. Damit steht das Göttinger Land im Gegensatz zu Landkreisen z.b. im nördlichen Niedersachsen, in denen auf über 50 % der Ackerfläche Mais angebaut wird. Obwohl dieser Mais nicht nur als Energiepflanze genutzt wird, führt eine Erhöhung des Maisanteils durch den Bau weiterer Biogasanlagen zu negativen Folgen für das Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft. Die landschaftliche Vielfalt wird durch den intensiven Anbau einer Pflanzenart (Monokultur) stark verringert. Im Fall von Mais spricht man auch von einer Vermaisung der Landschaft. Dieser Begriff zeugt von einer geringen Akzeptanz von Mais und Monokulturen. Neben dem Anteil in der Landschaft ist auch die Höhe der Maispflanze von Bedeutung, die in den Sommermonaten deutlich über 2 m erreicht. Damit übersteigt Mais die Augenhöhe von Erholungssuchenden und schränkt den Blick in die Landschaft ein, was wiederum das Landschaftserleben negativ beeinflusst. In der getreidereichen Göttinger Agrarlandschaft, in der vergleichsweise wenig Mais (7 % im Landkreis) vorhanden ist, sind die negativen Wirkungen des Maises allerdings kaum relevant, da diese erst bei hohen Maisanteilen entstehen. Im Gegenteil: Ein Anbau von Mais kann in der Region Göttingen zu einer Erhöhung der landschaftlichen Vielfalt beitragen und den Abwechslungsreichtum der Landschaft erhöhen. In Deutschland hat Mais mittlerweile allerdings ein schlechtes Image, sodass auch in Regionen wie dem Göttinger Land, in denen Mais eigentlich positive Auswirkungen auf das Landschaftsbild hätte, Vorurteile vorhanden sind. Dass Mais in anderen Regionen durchaus positiv bewertet wird, zeigt eine vergleichende Befragung unterschiedlicher Ackerkulturen in der Schweiz, in der Mais beispielsweise positiver als Getreide wie Weizen oder Gerste bewertet wurde. Getreideernte in Lödingsen, Bild: Kilian Rüfer 11 Energie Bioenergie aus Flur aus und der Wald Region in in Wissenschaft und & Praxis
12 Visualisierung von streifenförmigen Kurzumtriebsplantagen aus Pappeln. Diese sind Sichtbarrieren und verleihen der Landschaft Struktur, Bild: T. Boll Auswirkungen des Anbaus von Kurzumtriebsplantagen In einer Onlinebefragung mit 3D Visualisierungen untersuchte das Institut für Umweltplanung der Universität Hannover im Rahmen des Projektes AgroForNet die Präferenzen der Bevölkerung in Bezug auf unterschiedliche Szenarien des Anbaus von KUP für unterschiedliche Landschaftstypen. Bewohner des Göttinger Landes beurteilen offene Landschaften ohne Gehölzstrukturen in der Landschaft (offene Agrarlandschaften, grünlandreiche Landschaften) deutlich negativer als Bewohner aus anderen Regionen Deutschlands. Den Anbau von KUP beurteilen Göttinger insgesamt ähnlich wie andere Befragte. Der Anbau von KUP in offenen Agrarlandschaften wird von Göttingern als eine deutliche Aufwertung des Landschaftsbildes beurteilt. Aufgrund ihrer Größe und Dreidimensionalität bringen KUP neue Strukturen in die offene Landschaft. Besonders positiv wird der Anbau von KUP in Streifenform gesehen. Durch streifenförmigen Anbau können Sichtbeziehungen zwischen den Streifen erhalten bleiben und die KUP wirkt nicht wie eine Wand (Bild oben). In anderen Landschaftstypen mit einem sehr hochwertigen Landschaftsbild kann der Anbau von KUP hingegen negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben. In kleinstrukturierten Kulturlandschaften mit vielen Hecken und Säumen, die im Göttinger Land noch zahlreich vorhanden sind, wird der Anbau von KUP von Göttingern negativ beurteilt. Hier werden die vorhandenen Landschaftselemente durch den Anbau von KUP überlagert und die besondere Eigenart der Landschaft kann verloren gehen. Geringe Anteile von KUP von unter 20 % der landwirtschaftlichen Fläche haben in den meisten Landschaften keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Auch in relativ hochwertigen wald-, heide- und grünlandreichen Landschaften ergeben sich negative Auswirkungen erst bei höheren Anteilen von KUP in der Landschaft. Bioenergie aus der Region in Wissenschaft & Praxis 12
13 Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher interessen Flächenkonkurrenz Die steigende Nachfrage nach Energiepflanzen, der Anbau von Nahrungsmitteln und Pflanzen zur stofflichen Verwertung führen zur Konkurrenz um landwirtschaftliche Nutzflächen. Eine verstärkte Nachfrage nach Agrarflächen führt zu steigenden Preisen. Laut dem Landesamt für Statistik Niedersachsen stiegen die Pachtpreise für landwirtschaftlich genutzte Flächen in Niedersachsen zwischen 2010 und 2013 um 22 %. Dabei sind rund 50 % der Flächen eines niedersächsischen Betriebes Pachtflächen. Ernährung Umwelt- u. Naturschutz begrenzte Agrarfläche Verschiedene Interessen auf begrenzten Agrarflächen Energie Stoffliche Nutzung In Deutschland wurden 2013 auf rund 2,1 Mio. ha Energiepflanzen angebaut. Verschiedene Szenarien prognostizieren, dass der Flächenbedarf für Bioenergie bis 2020 auf 4 Mio. ha ansteigen kann. Durch eine Veränderung im Mobilitätsverhalten (z.b. Nutzung von ÖPNV und Fahrrad, Bildung von Fahrgemeinschaften), kann der Verbrauch an Kraftstoffen verringert und somit dem steigenden Bedarf an Flächen aktiv entgegen gewirkt werden. Zur Flächenkonkurrenz tragen ebenfalls die Ernährungsgewohnheiten bei. So werden beispielsweise für die Erzeugung von 1 kg Rindfleisch rund 8 kg an Getreide benötigt. Etwa 60 % der landwirtschaftlichen Flächen Deutschlands werden zur Produktion von Futtermitteln genutzt. Durch die Senkung des Fleischkonsums könnten große Anbauflächen, die bisher zur Herstellung von Futtermitteln dienen, anderweitig genutzt werden. Auch der Flächenbedarf für die Produktion von Nahrungsmitteln kann verringert werden, indem künftig mit Lebensmitteln sachgerecht umgegangen wird. So werden schätzungsweise 25 % der Lebensmittel von den deutschen Endverbrauchern nicht verzehrt, sondern weggeworfen. Eine Reduktion der Nahrungsmittelverluste um 50 % durch die deutschen Endverbraucher würde den Flächenbedarf für die Futter- bzw. Nahrungsmittelversorgung um 1,2 Mio. ha verringern. Naturschutz Seit der Jungsteinzeit hat der Mensch die Landschaft im heutigen Deutschland geprägt, indem er Land für Ackerbau urbar machte und Viehhaltung betrieb. Äcker, Wiesen und Weiden entstanden und haben sich durch die menschliche Bewirtschaftung im Laufe der Jahrtausende zu dynamischen, artenreichen Ökosystemen entwickelt. Viele Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind an diese Lebensräume gebunden und können nicht auf Wildnislebensräume, wie z.b. Wälder, ausweichen. Viele Pflanzenarten, die typisch für Äcker sind, können nur bei regelmäßiger Bodenbearbeitung keimen. Die Tier- und Pflanzenarten der Grünländer brauchen offene Lebensräume ohne Beschattung. In Deutschland betrifft dies etwa 50 % aller einheimischen Pflanzen und viele Vogel- und Säugetierarten. Bedingt durch die immer intensivere 131 Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen
14 Nutzung und den damit verbundenen Verlust an geeignetem Lebensraum wurde jedoch in den letzten Jahrzehnten ein drastischer und weiterhin anhaltender Rückgang der Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen verzeichnet. Weniger intensiv (=extensiv) bewirtschaftete Flächen wie Ackerbrachen, Getreidefelder ohne den Einsatz von Düngern und chemischen Unkrautvernichtungsmitteln oder ungedüngte Wiesen und Weiden sind die letzten Rückzugsräume für viele Arten in leergeräumten, intensiv agrarisch genutzten Gebieten. Extensive Bewirtschaftung Die Erhebungen im Rahmen des BEST-Projektes haben gezeigt, dass die Zahl der Beikrautarten in extensiven Getreidefeldern 4-5 mal höher ist als in konventionell bewirtschafteten Beständen. Diese extensive Bewirtschaftung ist jedoch für Landwirte zunehmend finanziell unattraktiv, da hohe Gewinne durch den Anbau von Energiemais und Wintergetreide erzielt werden können. Um mehr Fläche für den Anbau von Energiepflanzen bereitzustellen, wurde zudem 2009 die gesetzliche Verpflichtung einen bestimmten Anteil der Felder aus der Nutzung zu nehmen (die sogenannte Stilllegungsverpflichtung ) abgeschafft. Diese Entwicklung hat bundesweit dazu geführt, dass Ackerbrachen wieder in die intensive landwirtschaftliche Produktion aufgenommen wurden. Zusätzlich kam es in vielen Teilen von Deutschland zu großen Verlusten an artenreichem Grünland, da viele Viehweiden und Mähwiesen in Ackerland umgewandelt wurden, um Mais zu produzieren. In der Öffentlichkeit ist diese Art und Weise die Energiewende voranzutreiben in den letzten Jahren deshalb immer stärker in die Kritik geraten. Im Rahmen des BEST-Projektes wurden neben Mais deshalb auch Kurzumtriebsplantagen als alternative Energieträger untersucht. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Plantagen kein geeigneter Ersatz für Brachen oder Grünlandlebensräume sind, da die Bestände rasch hohe Dichten erreichen, sodass nur noch wenig Licht den Bestandsboden erreicht. In dichten Altbeständen konnten nur noch sehr geringe Artenzahlen (7-19 Arten je Untersuchungsfläche) nachgewiesen werden. Werden KUP jedoch auf zuvor intensiv bewirtschafteten Äckern angebaut, kann ggf. ein Mehrwert für die Artenvielfalt erzielt werden. Hierfür sollten die Tipps zum naturverträglichen Anbau von schnellwachsenden Hölzern (Seite 15) beachtet werden. Da die landwirtschaftlich nutzbare Fläche insgesamt begrenzt ist, kommt es durch die vielfältigen Nutzungsansprüche in modernen Kulturlandschaften häufig zu Konfliktsituationen. Neue Forschungsansätze suchen deshalb nach Lösungen, wie man die Erzeugung von erneuerbaren Energien, die Nahrungsmittelproduktion und den Erhalt der Artenvielfalt im ländlichen Raum miteinander vereinbaren kann. In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen unserer Forschung erhebliche Zweifel daran laut, ob die Anlage von KUP die bereits bestehenden Nutzungskonkurrenzen wirkungsvoll entschärfen kann. Eine vermehrte Anlage von KUP wird nicht direkt zu einem Rückgang des Maisanbaus führen, da Mais als Substrat zur Biogaserzeugung und Holzhackschnitzel von KUP hingegen zur Verbrennung in Feuerungsanlagen verwendet werden. Durch die Forderung, KUP auf Grenzertragsstandorten anzulegen, sind zudem zusätzliche Flächenkonflikte mit dem Naturschutz zu er- Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen 14 1
15 Bodenerosion bei Duderstadt (2. IX. 2007), Bild: W. Rohe warten, da diese Standorte häufig die letzten artenreichen Brachlebensräume in intensiv genutzten Kulturlandschaften sind. Die Ergebnisse im Rahmen des BEST-Projektes haben jedoch auch Lösungsmöglichkeiten für diese Konfliktsituation aufgezeigt, die keinesfalls kompliziert und schwer umsetzbar sein müssen (Seite 16). Trotzdem erfordern sie ein gewisses Maß an Experimentierfreude, Mut und Durchhaltevermögen sowie neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Verpächtern, Betreibern von Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken, einschlägigen Verbänden und Behörden. Kurzumtriebsplantagen naturverträglich gestalten KUP kleinflächig (max. 1 ha) oder in Form von Gehölzstreifen im Acker (Agroforst) anlegen, da die Randbereiche eine besonders hohe Artenvielfalt aufweisen. Bei größeren KUP Ernte von Teilflächen in verschiedenen Jahren durchführen. KUP nur auf Ackerflächen und nicht auf Grünland oder Brachflächen anlegen. In besonders intensiv genutzten, strukturarmen Agrarlandschaften ist die positive Wirkung von KUP auf die Artenvielfalt höher als in vielfältigen, reich strukturierten Landschaften. KUP nicht zusätzlich düngen. So kann die Ausbreitung von besonders stickstoffliebenden Problemunkräutern wie Quecke, Ackerkratzdistel oder Brennnessel vermindert werden. Diese können Dominanzbestände ausbilden, welche die Etablierung einer vielfältigen Artengemeinschaft verhindern. Mechanische Beikrautregulierung während der Etablierungsphase durchführen, kein Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. KUP mit kurzen Umtriebszeiten (ca. 3 Jahre), breitem Reihenabstand (mind. 1,5 m) und Lücken im Kronendach sind besonders förderlich für die Biodiversität. Die schützenswerten Pflanzen des Offenlandes benötigen viel Licht für ihr Wachstum. In alten, sehr dichten Beständen kann sich keine erosionsmindernde und bodenschützende Beikrautdecke zwischen den Pflanzreihen ausbilden, da es zu dunkel ist. Das Fehlen einer vielfältigen Begleitvegetation vermindert den Wert der Plantagen als Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere. Einheimische Baumarten wählen (z.b. Pappel oder Weide). 151 Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen
16 Was kann ich als Landwirt tun? Wichtige grundlegende Maßnahmen Erhalt der verbleibenden artenreichen Äcker, Wiesen und Weiden. Aufwertung von Bioenergielandschaften durch die Anlage von Rückzugsräumen für Tier- und Pflanzenarten. Als Rückzugsräume sind besonders Ackerbrachen, extensive Getreidefelder und extensives Grünland geeignet, da diese sowohl den typischen Pflanzen als auch den typischen Tieren der Agrarlandschaften eine Lebensgrundlage bieten. Unterstützende Maßnahmen Auswahl von Bioenergiepflanzen, die im Anbau nur wenig Düngung erfordern und möglichst ohne den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln auskommen. Vorzug von mehrjährigen, einheimischen Kulturen wie schnellwachsenden Gehölzen (z.b. Pappeln und Weiden), Kleegras- oder Wildpflanzenmischungen. Nutzung von vielfältigen Substratmischungen mit hohen Anteilen an Mist und Gülle, landwirtschaftlichen Reststoffen und Landschaftspflegematerial. Was können Politik, Behörden und Gesellschaft leisten? Verbesserung der Beratung für Landwirte in Fragen des Naturschutzes. Ausgleich finanzieller Einbußen für den Landwirt, die durch die Anlage von Rückzugsräumen für Flora und Fauna entstehen. Die entsprechenden Agrarumweltprogramme müssen flexibel auf den jeweiligen regionalen Kontext zuschneidbar und ausreichend mit finanziellen Mitteln ausgestattet sein. Ausrichtung der Förderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (Seite 19) auf naturverträgliche Anbauformen. Lenkung des Ausbaus der erneuerbaren Energien durch die Raum- und Landschaftsplanung. Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen 16 1
17 Im blühenden Rapsacker, der winterlichen KUP und im Weizenacker wird mithilfe von Bodenkammern der Ausstoß von Treibhausgasen gemessen, die im Boden entstehen, Bilder: K. Walter Umweltschutz Die einseitige Ausrichtung der Bioenergieproduktion auf einjährige Kulturen kann die Fruchtbarkeit und Struktur des Bodens gefährden. Insbesondere der intensive Anbau von Mais birgt einige Risiken. Durch den späten Aussaattermin und die langsame Jugendentwicklung der Pflanzen ist der Boden lange Zeit unbedeckt, sodass Bodenmaterial mit dem Wind oder Wasser abgetragen werden kann. Mit dem Verlust an Bodenmaterial können Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel in die Gewässer gelangen und diese belasten. Durch die streifenförmige Integration von Gehölzen in die einjährigen Kulturen (Agroforst) kann dem Bodenabtrag entgegengewirkt werden. Durch die Entwicklung eines intensiven Wurzelsystems wird der Boden stabilisiert, der im Herbst stattfindende Laubeintrag reduziert die Aufprallenergie der Regentropfen und trägt zur Rückführung der Nährstoffe in den Boden bei. Ferner können Agrarholzstreifen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Windrichtung so ausgerichtet werden, dass die Windgeschwindigkeit und somit der Bodenabtrag wirkungsvoll reduziert wird. In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass bei einer Baumhöhe von 2,5 m sich die Windgeschwindigkeit um ca. 60 % verringerte. Agroforstsysteme in Kombination mit einjährigen Kulturen wie z.b. Mais vereinen verschiedene Funktionen wie den Erosionsschutz, die Energie- und/oder Nahrungsmittelproduktion. Durch Bioenergie soll außerdem der Ausstoß an klimawirksamen Gasen im Vergleich zu fossilen Energieträgern verringert und so das Klima geschützt werden. Die Menge der während der Produktion und Nutzung ausgestoßenen klimawirksamen Gase hängt stark von der Art der genutzten Bioenergie ab. In BEST wurde untersucht ob die Nutzung von Holz aus KUP stärker zum Klimaschutz beiträgt als die Nutzung von Bioenergie aus einjährigen Kulturen wie Mais oder Raps. Insbesondere der Ausstoß von bodenbürtigem Lachgas wurde dabei betrachtet, da es ca. 300-mal klimawirksamer ist als Kohlendioxid. Lachgas wird von Mikroorganismen in allen Böden gebildet und an die Luft abgegeben. Auf der BEST-Versuchsfläche in Reiffenhausen wurde untersucht, ob in den Böden der Pappel-Kurzumtriebsplantagen und des ungedüngten Grünlands (Kleegras) weniger Lachgas produziert wird als in den intensiv genutzten Ackerböden mit Raps und Weizen. Dazu wurde der Lachgasausstoß im ersten halben Jahr nach der Anlage der Versuchsflächen und ein Jahr später für ein komplettes Jahr im wöchentlichen Rhythmus bestimmt. Kurz nach Anlage der KUP waren die Lachgasemissionen von Grünland, KUP und Acker vergleichbar. Auch die Gehalte an mineralischem Stickstoff im Boden unter Grünland und KUP unterschieden sich hier nur wenig von denen des Ackers. Das liegt auch daran, dass der Raps während dieser Zeit von Mai bis November 2011 nicht gedüngt wurde und die noch kleinen Pappeln und Gräser anfangs wenig Stickstoff aufnahmen. Im zweiten Messjahr, von November 2012 bis November 2013, waren die Unterschiede in den Lachgasemissionen deutlich größer. Die Böden der KUP gaben mit 0,04 kg N 2 O-N pro ha nur 171 Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen
18 Aussaat von Wildpflanzen in Gieboldehausen, Bild: K. Rüfer Besichtigung der einjährigen Wildpflanzenfläche auf dem Klostergut Reinshof, Bild: L. Hartmann wenig Lachgas an die Luft ab, der Boden des gedüngten Weizenackers mit 1,55 g N 2 O-N pro ha deutlich mehr. Insbesondere kurz nach der Düngung wurde im Acker besonders viel Lachgas produziert. Wenn man zudem beachtet, dass bei jeder Bewirtschaftungsmaßnahme durch die Verbrennung in den Maschinen Treibhausgase ausgestoßen werden wird deutlich, dass vor allem die KUPs in Hinblick auf die Treibhausgasemissionen positiv abschneiden. 2.0 Mai - Nov `11 Im Vergleich zu den einjährigen Kulturen werden KUP und AF extensiv bewirtschaftet. Auch der Anbau von Wildpflanzen als Energieträger ist ein extensives Bewirtschaftungssystem. Lediglich bei der Flächenvorbereitung, Anlage und Ernte kommen Maschinen zum Einsatz. Während des restlichen Bewirtschaftungszeitraumes ist, abgesehen von eventuellen Düngerausbringungen, die Befahrung und Bearbeitung der Böden deutlich reduziert. Nov `12 - Nov `13 In der Region Göttingen wurden 2014 in Zusammenarbeit mit der Bioenergie-Region Wendland-Elbetal insgesamt 5,3 ha an Wildpflanzenkulturen als Substrat für Biogasanlagen angelegt. Die ausgebrachten Kulturen enthalten bis zu 20 verschiedene Arten, die in ihrer Kombination gute Biogaserträge liefern und einen hohen ökologischen Nutzen bieten. Im ersten Jahr wachsen einjährige Blühpflanzen wie Sonnenblumen auf, die ab dem zweiten Jahr von mehrjährigen Stauden wie der wilden Malve abgelöst werden. Stoffliche und energetische Nutzung N 2 O-N (kg / ha) 1,5 1,0 0,5 0,0 Gras KUP Raps Gras KUP Weizen Summierte Lachgasemissionen der Versuchsfläche in Reffenhausen, Bild: K. Walter Die steigende Holznachfrage, besonders nach Nadelholz, ist keine Neuerscheinung des 21. Jahrhunderts. Der abnehmenden Rohstoffverfügbarkeit versucht die Forst- und Holzwirtschaft seit Jahrzehnten entgegenzuwirken. Die Laubhölzer, besonders die Buche, sind neben der stofflichen Verwertung auch für die energetische Nutzung beliebt. Vorwiegend die Span- und Faserplattenindustrie, aber auch die Papierindustrie nutzen geringwertiges Buchenholz für ihre Produktion. Bislang Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen 18 1
19 Kaskadennutzung: Dasselbe Holz nacheinander mehrfach nutzen Holz Spanplatte Mittel-Dichte Faserplatte Holz-Kunststoff- Verbindung Altholz für Heizwerke Beispiel für eine Kaskadennutzung, Bild: K. Krause & F. Friese, 3N e.v. werden bei den Spanplatten beispielsweise bis zu 8 % an Industrieläubhölzern, besonders Buchenholz, verarbeitet. Durch das zugenommene Heizen mit Holz besteht ein Wettbewerb zur Holzwerkstoffindustrie sowie der Papier- und Zellstoffindustrie. Nach der Holzrohstoffbilanzierung für das Jahr 2010 wurde deutlich, dass bereits mehr als 50 % der Holzverwendung energetisch genutzt werden. Eine maßvolle energetische Holznutzung ist möglich und sinnvoll, wenn dabei gleichzeitig auf eine effiziente Nutzung des Brennstoffes geachtet wird. Kaskadennutzung Ein Lösungsansatz für den sich abzeichnenden Holzmangel und den Klimaschutz ist die Kaskadennutzung. Das Prinzip einer ressourcenschonenden Kaskadennutzung beruht auf der möglichst langfristigen Bindung von CO 2. In einer Kaskadenkette werden mehrere stoffliche Verwertungen (siehe oben) und eine abschließende energetische Nutzung hintereinander geschaltet. Beispiele für Holzprodukte in der Kaskadennutzung sind recycelte Spanplatten, Faser- oder Dämmplatten oder auch Holz- Kunststoff-Verbindungen. Erst in der letzten Phase der Kaskadennutzung werden die Holzprodukte dem energetischen Gebrauch zugeführt. Somit erzielt man eine Steigerung der Rohstoffeffizienz und eine Optimierung der Kohlenstoffbindung. Schadstoffe im Brennmaterial minimieren Die Schadstoffbelastungen aus den Verbrennungsprozessen der recycelten Holzprodukte, Althölzer und Resthölzer, im letzten Schritt der Kaskade, werden über entsprechend erforderliche Maßnahmen, wie Vorsortierungen, Abtrennen von z.b. Lacken und Gewebefiltertechnologien in den Verbrennungsanlagen so gut wie möglich reduziert. Nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) werden die Holzabfälle bezüglich ihrer Herkunftsbereiche kategorisch sortiert (A I - A IV) und gemäß der Verordnung entsorgt. In verschiedenen laufenden Studien (u.a. vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) und Situationsanalysen erfolgen Schadstoffbelastungsuntersuchungen und weitere Diskussionen für eine emissionsärmere Verarbeitung der Recyclingprodukte und die Einhaltung der Schwellenwerte. Wirtschaftlichkeit Die wirtschaftliche Machbarkeit unterschiedlicher Bioenergiekonzepte wird durch die Förderpolitik geprägt. Aufgrund der begrenzten Fördermittel sollten künftig Maßnahmen verstärkt umgesetzt werden, die einen effektiveren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dafür sind Vergleiche der verschiedenen Bioenergie-Linien anhand der CO 2 - Vermeidungskosten nötig. Diese geben an zu welchem Preis die jeweiligen Bioenergie-Linien CO 2 -Emissionen reduzieren. Je niedriger die CO 2 -Vermeidungskosten ausfallen, desto effizienter kann Klimaschutz betrieben werden. Nach der Wachstumsphase im Sektor Biogas ist mit der Reform des Erneuerbare-Energien- Gesetzes (EEG) der Bonus für nachwachsende Rohstoffe gestrichen und der jährliche Ausbau auf 100 MW installierte Leistung gedeckelt worden, was den Bau neuer Biogasanlagen erheblich erschwert. Damit wird auch der Mais weniger gefördert, der in seiner CO 2 - Vermeidung im Vergleich z.b. zu KUP teurer ist. Beim Biogas soll man sich nun auf Abfallund Reststoffe konzentrieren. Offen bleibt, ob 191 Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen
20 effiziente Konzepte wie z.b. die kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung mit Hackschnitzeln aus Waldrestholz oder KUP künftig stärker gefördert werden. Pappelkulturen im Kurzumtrieb und mehrjährige Miscanthuskulturen (z.b. Chinaschilf ) werden mit steigendem Interesse als relevante Alternativen bei der Erzeugung regenerativer Energien betrachtet. Jedoch ist bisher die Bereitschaft der möglichen Anbauer zur Umstellung noch zurückhaltend. Aus diesem Grunde beschreibt ein Teilprojekt von BEST unter anderem die Wirtschaftlichkeit und das Risikoprofil der Kulturen im Vergleich zum konventionellen Ackerbau. Es wird eine Handlungsempfehlung für einen Anbauer gegeben, der sich zwischen der Beibehaltung einer konventionellen Fruchtfolge, bestehend aus Winterweizen, Wintergerste und Winterraps, oder dem Anbau von Pappeln im Kurzumtrieb oder Miscanthus entscheiden kann. Dabei stellt sich heraus, dass die Pappelkultur gegenüber der konventionellen Ackerbestellung nachteilig ist. Bei einer guten Bestandsentwicklung hat Miscanthus das Potenzial sowohl gegenüber der Pappelkultur als auch gegenüber der Fruchtfolge vorzüglich zu sein. Europäische Agrarpolitik - Greening Durch sich ändernde politische Rahmenbedingungen kann der Anbau schnellwachsender Gehölze attraktiver werden. Im Zuge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wird die Bereitstellung von Fördermitteln (Direktzahlungen) künftig stärker an Umweltmaßnahmen (Greening) geknüpft. Zum Greening zählen: (1) Anbaudiversifizierung: Vielfalt beim Anbau von Kulturen und Ackerflächen, (2) Erhalt von Dauergrünlandflächen, (3) Flächennutzung im Umweltinteresse: Bereitstellung ökologischer Vorrangflächen. Um Direktzahlungen komplett zu erhalten, müssen landwirtschaftliche Betriebe ab 2015 mindestens 5 % ihres Ackerlandes als ökologische Vorrangfläche bereitstellen. Nach derzeitigem Stand werden in Deutschland als ökologische Vorrangflächen Agroforst und KUP anerkannt. Die genaue Ausgestaltung, z.b. welche Baumarten im Detail anerkannt werden, soll im Rahmen einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Nähere Informationen werden im Direktzahlungen-Durchführungsgesetz zu finden sein. Bioenergie im Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen 20 1
21 Unsere Bioenergieregion ZUKUnftsfähig machen - konflikte entschärfen Energiebedarf senken Die Stadt Göttingen und der Landkreis Göttingen möchten in Zukunft die Energieversorgung zu großen Teilen mit regionalen erneuerbaren Energien decken, um den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren. Um diese Ziele zu erreichen müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut und der Energieverbrauch gesenkt werden. Rund 30 % der bereitgestellten Energie in der Region Göttingen wird von Privathaushalten in Form von Wärme, Warmwasser und Strom genutzt. Der größte Anteil des Energieverbrauchs der Privathaushalte entfällt dabei auf den Raumwärmebedarf. Durch den Einsatz von effizienten Anlagen und Wärmeschutzmaßnahmen kann der Energiebedarf wirkungsvoll gesenkt werden. Auch der bewusste Umgang mit Energie im Haushalt kann zur Energieeinsparung führen. Die Energieagentur Region Göttingen informiert zu den Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Informationen die vom energieeffizienten Bauen und Sanieren bis hin zum sinnvollen Einsatz von Holz als Heizmittel reichen, werden in Form von Beratungen, Veranstaltungen, Broschüren usw. zur Verfügung gestellt. In Verbindung mit energieeffizienten Gebäuden, sinnvollen Gesamtenergiekonzepten und einer nachhaltigen Forstwirtschaft ist die Holzenergienutzung ein wichtiger Baustein im Energiemix mit erneuerbaren Energien. Je besser die Wärmedämmung von Gebäuden und je effizienter die Verbrennung, desto mehr Häuser können mit Holz beheizt werden. Biomasseangebot steigern In diesem Abschnitt werden Möglichkeiten dargestellt, um das Biomasseangebot nachhaltig zu steigern, indem die Ansprüche des Naturschutzes, Bodenschutzes etc. berücksichtigt werden. Mobilisierung ungenutzter Biomasse Die steigende Nachfrage nach Holz beeinflusst die Waldbewirtschaftung und erfordert neue Nutzungskonzepte bezüglich einer kurzfristigen und dauerhaften Bereitstellung holziger Biomasse. Mögliche Ansatzpunkte sind hierbei die Reaktivierung historischer Waldnutzungsformen wie Nieder- und Mittelwald, die schon vor Jahrhunderten zur Brennholzerzeugung genutzt wurden. Der Niederwald besteht überwiegend aus Laubhölzern, die einschichtig und gleichaltrig im Stockausschlagsverfahren bewirtschaftet werden. Die Ernte erfolgt kahlschlagartig auf kleinen Flächen mit dem Ziel möglichst schnell Brennholz zu gewinnen. Der Mittelwald hat sich aus dem Niederwald entwickelt. Er kombiniert einen einschichtigen gleichaltrigen Unterstand (siehe Niederwald) von Laubhölzern (Hainbuche, Feldahorn, Hasel etc.) im Stockausschlag mit einem ungleich alten Oberstand (Eiche, Bergahorn, Esche, Wildobst) meist aus Samen entstanden, die einzelstammweise genutzt werden. Brennholz- und Nutzholzerzeugung wurden auf derselben Fläche verbunden. 121 Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen - wie lösen - Konflikte wir die entschärfen Konflikte?
22 Ein Forwarder transportiert die am Waldrand von Waake geschlagenen Bäume und Sträucher zu einem Sammelplatz, wo sie u.a. zu Energieholz (Hackschnitzel) weiterverarbeitet werden. Bild: W. Schmidt Von der Rückverlegung des Waldrandes bei Waake profitiert der davorliegende artenreiche Halbtrockenrasen. Er kann jetzt wieder beweidet oder gemäht werden, Bild: W. Schmidt Mögliche Standorte für diese Waldbausysteme sind landwirtschaftlich unattraktive Flächen (u.a. Hanglagen, flachgründige oder steinige Böden), forstwirtschaftliche Grenzertragsstandorte, Flächen mit Infrastruktureinrichtungen (Stromtrassen, Verkehrssicherungsflächen entlang von Straßen oder Eisenbahnlinien), Waldrandbereiche usw. Durch die Intensivierung der Landnutzung geriet die Bewirtschaftung der Waldränder zunehmend in Vergessenheit. Früher wurden die Gehölze in einem zeitlichen Abstand von Jahren auf Stock gesetzt und als Brennholz genutzt, wodurch ein wertvoller Lebensraum für viele licht- und wärmeliebende Pflanzen- und Tierarten entstand. Auch in Waake am Rand des Göttinger Waldes ist der Waldrand immer weiter in Richtung Wiese und Acker vorgerückt. Junge Bäume konnten m weit ins Offenland vordringen und erreichen heute Durchmesser von bis zu 25 cm. Im Zuge der Waldrandrückverlegung in Waake, die im Winter 2013/2014 kostenneutral durchgeführt wurde, konnte Industrie- und Energieholz unter Berücksichtigung von naturschutzfachlichen Belangen gewonnen werden. Vorteile der nieder- und mittelwaldartigen Bewirtschaftung sind im geringen Arbeitsaufwand und der erheblichen Betriebssicherheit der Flächen zu sehen. Biomassepotenzial (durchschnittlicher Gesamtzuwachs in Festmeter): Niederwald = 1,6 4,3 t pro ha und Jahr Mittelwald = 2,3 4,3 t pro ha und Jahr Ein Bestand in Barterode, der im Mittelwaldbetrieb von der Genossenschaft bewirtschaftet wird, zeigte in einer Untersuchung im Rahmen von BEST Biomassepotenziale von 2,3 t pro ha und Jahr. Im Landkreis Göttingen grenzen über ha Waldfläche auf 305 km Randlänge an Straßen mit Verkehrssicherungspflicht an. Würde man auf diesen Flächen eine 25 m breite mittelwaldartige Waldrandbewirtschaftung wie im Beispiel Waake durchführen, könnten auf über ha Biomasse geerntet werden. Die theoretisch nutzbare Biomasse dieser Fläche beläuft sich auf ca t Trockenmasse pro Jahr. Betrachtet man diese Menge im Vergleich zum Gesamtbiomassepotenzial des Hochwaldes im Landkreis Göttingen wird ersichtlich, dass nur rund 4 % an Biomasse durch die mittelwaldartige Waldrandbewirtschaftung gewonnen werden kann. Eine nieder- oder mittelwaldartige Bewirtschaftung von Waldflächen kann gegenüber der klassischen Hochwaldbewirtschaftung bezogen auf die erzielbaren Biomassepotenziale nur einen geringen Beitrag leisten. Unter dem Aspekt des Natur- und Landschaftsschutzes ist diese Bewirtschaftungsform besonders wertvoll. Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen - Konflikte entschärfen 22
23 Höhe (cm) Pappel (1.Jahr) Pappel (2.Jahr) Weide (1.Jahr) Weide (2.Jahr) Die Boxplots zeigen das Höhenwachstums der ersten beiden Wuchsjahre. Darstellung nach Baumart und Versuchsfläche getrennt H = Versuchsfläche Holzerode, N = Versuchsfläche Nesselröden Bild: I. Schmiedel H N H N H N H N Ungenutzte Flächen erschließen Um dem Problem der Flächenkonkurrenz zu begegnen, sollten Flächen die mit Schadelementen wie z.b. Arsen, Cadmium und Blei belastet sind zur Produktion von Biomasse in Betracht gezogen werden. Forschungen am Interdisziplinären Zentrum für Nachhaltige Entwicklung an der Georg-August-Universität Göttingen im Rahmen des Projektes Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft (BiS) beschäftigen sich mit diesen potenziell bis zu 10 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche umfassenden belasteten Standorten. Zumindest auf den mittel und stark belasteten Flächen sollte keine Lebens- und Futtermittelproduktion mehr stattfinden. Zu den betroffenen Flächen zählen beispielsweise die Auenbereiche von Flüssen, die Umgebung von einigen Industriestandorten und Abwasser-Rieselfelder. Auf diesen Flächen könnten Pflanzen mit hohen Biomasseerträgen und gleichzeitig geringer Schadelementaufnahme angebaut werden. Insbesondere Roggen und Mais gehören zu den Kulturen mit geringem Aufnahmepotenzial. Diese Pflanzen können anschließend in die Biogasanlage gegeben werden und somit zur Strom- und Wärmeproduktion beitragen. Es sollte jedoch stets bedacht werden, dass sich diese Schadelemente im Gärrest anreichern. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollte jedoch der Gärrest als Dünger auf die Flächen zurückgebracht werden. Deponieflächen In einem Forschungsprojekt (KUPAD) an der HAWK Göttingen, Fakultät Ressourcenmanagement wird die Eignung bisher ungenutzter Deponieflächen als Standort für Kurzumtriebsplantagen geprüft. Neben der Durchführung einer Flächenpotenzialanalyse für Niedersachsen, wurden vier 0,5 ha große Kurzumtriebsplantagen mit jeweils einem Weidenklon (Inger) und einem Pappelklon (Max 1) im Pflanzverband 1,8 x 0,5 m angelegt. Zwei dieser Flächen, Holzerode und Nesselröden, befinden sich auf Altdeponien im Landkreis Göttingen. Bei der Fläche in Holzerode handelt es sich um eine stillgelegte Tongrube, in der vorwiegend Hausmüll eingelagert wurde. In Nesselröden wurde der Hausmüll noch von einer Schicht Bauschutt überlagert. Beide Standorte wurden Ende der 1970er Jahre abgeschlossen und mit Rekultivierungsschichten in unterschiedlicher Mächtigkeit überdeckt. Die Böden beider Standorte sind hinsichtlich ihrer bodenchemischen und bodenphysikalischen Parameter annähernd vergleichbar (Seite 24). Beide Standorte weisen eine sehr gute Nährstoffversorgung auf. Der Standort Holzerode verfügt über höhere Kohlenstoffund Stickstoffvorräte im Boden, die höhere Erträge erwarten lassen. Allerdings konnten im Zuge der Schwermetallanalyse des Bodens für den Standort Holzerode mehr als dreimal so hohe Werte für Cadmium, Kupfer und Blei im Vergleich zum Standort Nesselröden nachgewiesen werden. Auch die Nickelvorkommen im Boden waren leicht höher als in Nesselröden. Auf dem Standort Nesselröden konnten hingegen höhere Chromgehalte festgestellt werden. Bei den hohen ph-werten auf beiden Flächen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Metalle immobil im Boden vorliegt und somit keine Gefahr für die Umwelt besteht. Auch scheinen die 1 Hinweise 23 für die Planung und Umsetzung Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen - wie lösen - Konflikte wir die entschärfen Konflikte? 20
24 KUP im ersten Standjahr auf einer Deponiefläche, Bild: I. Schmiedel erhöhten Schwermetallvorkommen keine Auswirkungen auf das Wachstum der Pflanzen zu haben, denn der Standort Holzerode zeigte von allen Flächen die größten Zuwächse. Im Zuge der Winterbonituren der ersten beiden Wuchsjahre wurden das Höhen- und Durchmesserwachstum der Bäume dokumentiert. Hinsichtlich des Dickenwachstums war in Holzerode die Pappel etwas stärker als die Weide, die Weide erreichte im Mittel jedoch eine etwas größere Höhe (Seite 23). Auf dem Standort Nesselröden zeigte die Weide sowohl in der Höhe als auch im Durchmesser größere Zuwächse. Standort Flächenkategorie Mächtigkeit der Rekultivierungsschicht Bodenart ph-wert Kohlenstoffgesamtgehalt Stickstoffgesamtgehalt Kalium Natrium Magnesium Calcium Cadmium Chrom Kupfer Blei Nickel nutzbare Wasserspeicherkapazität [Volumenanteil] Lagerungsdichte Skelettanteil Holzerode Altdeponie mit Hausmüllablagerungen 50 cm mittel sandiger Lehm Bodenchemie 7,6 3,7 % 0,2 % Nährstoffvorkommen [mg/kg Trockensubstanz] 292,2 10,7 101,9 3355,9 Schwermetallvorkommen [mg/kg Trockensubstanz] 0,5 44,4 34,4 96,5 27,7 Bodenphysik 23,1 % Bodeneigenschaften der Göttinger Standorte, I.Schmiedel 1,2 g/cm³ 10 % Nesselröden Altdeponie mit Bauschuttablagerungen 80 cm schwach sandiger Lehm 7,7 1,1 % 0,1 % 185,2 12,9 126, ,4 0,1 46,9 12,2 21,2 21,3 22,8 % 1,5 g/cm³ 8 % Unsere 21 Bioenergieregion zukunftsfähig machen - wie lösen - Konflikte wir den entschärfen konflikt? Hinweise für die Planung und Umsetzung 24 1
25 Splitterflächen am Beispiel Friedland Flächen die aufgrund ihrer Größe, Entfernung zum landwirtschaftlichen Betrieb oder ihres Zuschnitts unattraktiv für die landwirtschaftliche Produktion geworden sind, sollten künftig als Option für den Anbau von Kurzumtriebsplantagen geprüft werden. KUP bieten den Vorteil, dass sie nach erfolgreicher Bestandsbegründung bis zur Ernte nicht weiter bewirtschaftet werden müssen. In der Nähe zur Ortschaft Friedland wurde im Rahmen des Projektes BEST eine ca. 2 ha große Fläche mit Pappeln angelegt (siehe rechts). Bis zur Anlage der KUP war dieser Standort, aufgrund seines ungünstigen Flächenzuschnitts (Dreiecksform), ca. 6 Jahre lang ungenutzt. Unmittelbar nach der maschinellen Pflanzung im Mai 2012 wurde ein Vorauflaufmittel appliziert. Im Jahresverlauf wurden weitere Maßnahmen zur Begleitwuchsregulierung ergriffen wie Fräsen, Mähen und die Applikation eines Nachauflaufmittels. Als Pflanzverband wurden Einzelreihen mit einem Abstand von 2,7 m zwischen den Reihen und 0,4 m innerhalb der Pflanzreihe gewählt, sodass sich eine Bestandsdichte von Pappeln pro ha ergibt. Nach zweijähriger Standdauer konnte ein Gesamtertrag von ca. 14 t trockene Biomasse pro ha erzielt werden, wobei rund 90 % der Pappeln erfolgreich angewachsen sind. Zweijährige Kurzumtriebsplantage mit Pappeln in Friedland, Bild: L. Hartmann & F. Jüngling Projekt ELKE Inwieweit sich Naturschutz und der Anbau von Energiepflanzen vereinbaren lassen, wird am Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) der Fachhochschule Trier im Rahmen des Projektes Entwicklung extensiver Landnutzungskonzepte für die Produktion nachwachsender Rohstoffe als mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (ELKE) geprüft. Ziel ist es auf Ausgleichsflächen nachwachsende Rohstoffe extensiv anzubauen unter der Berücksichtigung ökologischer und wirtschaftlicher Belange. Dazu werden in Bayern, Hessen, Saarland und Niedersachsen auf über 100 ha Mehrnutzungskonzepte umgesetzt und erforscht, die diese verschiedenen Ansprüche auf derselben Fläche effizient zusammenführen. Mit den ELKE-Kulturen (KUP neben heimischen Gehölzen auf einer Fläche) schafft man ein Refugium für Lebewesen (Untersuchungsschwerpunkte: Käfer, Spinnen und Vögel), deren Lebensraum durch intensive Landwirtschaft minimiert worden ist. Zusätzlich erzeugt man mit Holzhackschnitzeln ein wirtschaftlich verwertbares Produkt. 125 Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen - wie lösen - Konflikte wir die entschärfen Konflikte?
26 Regionale - Konzepte - Strategien - Szenarien Holzige Biomasse - Erträge - Kosten - Preise - Ökosystemleistungen - Restriktionen - Ziele Potenziale und Raumwirkung Ergebnisdarstellung Schematischer Bewertungsablauf im Beratungswerkzeug, Bild: G. Busch Durch derartige Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen (z.b. neben dem Eingriff, einer Baumaßnahme) käme es also nur bedingt zu einem weiteren Verlust landwirtschaftlicher Fläche. Das Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe (3N e.v.) hat dies im Emsland in der Samtgemeinde Spelle geplant und umgesetzt. Beratungswerkzeug: Flächen und Machbarkeit für holzige Biomasse identifizieren Das im Rahmen von BEST entwickelte Beratungswerkzeug dient dazu, energetische Nutzungspotenziale von holziger Biomasse zu erfassen, durch Simulationen zu analysieren und die Ergebnisse durch interaktive Karten darzustellen. Ziel ist es, einen regionalen Dialog zu Fragen der nachhaltigen Landnutzung und des Klimaschutzes zu unterstützen und verschiedene Perspektiven von regionalen Akteuren (z.b. Landwirte, Fachbehörden, Umweltverbände) zu integrieren. Durch die Integration von ökonomischen Faktoren und ökologischen Kriterien können Anwender die Wechselwirkungen zwischen Ihren Zielvorstellungen (ökonomisch, ökologisch) und den resultierenden Potenzialen (Fläche, Biomasse, Energie) analysieren. Das Beratungswerkzeug berücksichtigt drei Energieholzquellen: Landschaftspflegeholz (LPflHolz), Wald(rest)holz und Kurzumtriebsplantagen auf Ackerflächen. Der Schwerpunkt der Szenarioentwicklung und simulation liegt dabei auf dem Bereich KUP. Hier werden räumlich explizite Simulationen auf Schlagebene durchgeführt und ausgewählten Feldfruchtfolgen vergleichend gegenübergestellt. Auch für die Bereiche LPflHolz und Wald(rest)holz sind die Eingangsdaten für die Region Göttingen räumlich explizit erhoben worden, diese werden jedoch aus Datenschutzgründen im System nur räumlich über die Region aggregiert weiterverarbeitet. Potenzielle KUP-Flächen auf Ackerstandorten können dabei vom Nutzer unter einer Vielzahl von Gesichtspunkten ausgewählt werden. Hierzu zählen beispielsweise Erträge, Preise und Kosten, die ins Verhältnis zu einjährigen Kulturen (Weizen, Gerste, Raps) gesetzt werden können. Darüber hinaus kann der Nutzer die Raumwirkung einer potenziellen KUP-Verteilung weitgehend steuern, indem Restriktionen wie z.b. Natura 2000-Flächen als Ausschlussgebiete definiert werden, maximale Flächenanteile von KUP Berücksichtigung finden, oder bestimmte Ökosystemleistungen (z.b. Schutz vor Wassererosion oder Nitratauswaschungsgefährdung) als Auswahlkriterien bestimmt werden. Die vielfältige Ergebnisdarstellung in Form von Tabellen, Grafiken und interaktiven Karten mit eingebetteten Web-Mapping-Services ermöglicht sowohl eine umfangreiche Auswertung als auch einen schnellen Überblick um erneute Simulationen unter geänderten Annahmen durchzuführen. Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen - wie lösen - Konflikte wir den entschärfen konflikt? 26 1
27 Ergebnisse Im Frühjahr 2014 wurde das Werkzeug in einem regionalen Workshop vorgestellt. Gemeinsam mit Landwirten, Regionalplanern, Förster sowie Vertretern der Fachbehörden von Landkreis und Stadt Göttingen wurde ein regionales Szenario für den Landkreis Göttingen simuliert. Mit dem Werkzeug konnte dargestellt werden, dass auch bei Beschränkung auf 10 % der Ackerfläche, ein beachtliches Potenzial an ökonomisch konkurrenzfähigen KUP- Flächen in der Region Göttingen vorhanden ist (Seite 28). Dies ist ein wichtiger Schlüssel, um aktuell vorhandene Umsetzungs- und Anbauhemmnisse abzubauen. Die größten Flächenpotenziale finden sich in den Gemeinden Dransfeld, Gleichen, Gieboldehausen und Duderstadt (Seite 28). Gleichzeitig zeigten die Simulationsergebnisse, dass rund 50 % der ökonomisch konkurrenzfähigen, potenziellen KUP-Standorte multiple ökologische Synergieeffekte bereitstellen - so z.b. Kombinationen aus Erosionsschutz, Verbesserung der Landschaftsstruktur, Grund- und Oberflächenwasserschutz (nicht dargestellt). Aufgrund des Flächenpotenzials und der hohen Produktivität der ausgewählten Flächen kann KUP einen wichtigen Beitrag zur regionalen erneuerbaren Energieversorgung leisten und damit eine Ergänzung/Alternative zur Biogasproduktion darstellen. Einige weitere Ergebnisse in Stichpunkten: Die Konkurrenzfähigkeit von KUP zu Ackerkulturen ist in der Region nicht auf marginalen Standorten sondern auf mittleren bis guten Standorten (45-75 Bodenpunkte) gegeben! Auf 10 % der Ackerfläche lassen sich rund 350 GWh Primärenergie produzieren das entspricht 25 % des regenerativen Energieangebots im moderaten Szenario des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Göttingen. Bei Erträgen > 14 t Trockenmasse pro ha und Jahr kann in der Region Göttingen von der Konkurrenzfähigkeit zu Raps/Gerste/ Weizen ausgegangen werden. Das verfügbare Bodenwasser sollte bei diesen Erträgen mindestens 160 mm pro Jahr betragen. 127 Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig - machen wie lösen - Konflikte wir die Konflikte? entschärfen
28 Räumliche Verteilung von potenziellen KUP-Flächen auf Ackerstandorten in der Region Göttingen, Bild: G. Busch Unsere Bioenergieregion zukunftsfähig machen - wie lösen - Konflikte wir den konflikt? entschärfen 281
29 Information und Beratung Ausgewählte Beratungsstellen Arbeitsgemeinschaft Agroforst Deutschland Norbert Lamersdorf Bioenergie-Regionen stärken (BEST) Christian Ammer Michael Bredemeier Norbert Lamersdorf Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen e.v. Reinhard Urner Büro für angewandte Landschaftsökologie und Szenarienanalyse (BALSA) Gerald Busch Centrum Neue Energien Heiko Lohrengel Energieagentur Region Göttingen e.v. Winfried Binder Inga Mölder Landkreis Göttingen Patrick Nestler - Klimaschutzbeauftragter nestler@landkreisgoettingen.de Stadt Göttingen Nina Hemprich - Klimaschutzmanagerin n.hemprich@goettingen.de Hanna Naoumis - Klimaschutzmanagerin h.naoumis@goettingen.de HAWK Hildesheim-Holzminden-Göttingen Fakultät Ressourcenmanagement Achim Loewen loewen@hawk-hhg.de Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung Hans Ruppert hrupper@gwdg.de 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen - Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe e.v. Michael Kralemann kralemann@3-n.info Landschaftspflegeverband Landkreis Göttingen e.v. Ute Grothey ute.grothey@lpv-goettingen.de 29 information Information und Beratung
30 Landvolk Göttingen Kreisbauernverband e.v. Achim Hübner Landwirtschaftskammer Niedersachsen Klaus-Dieter Golze Leader Regionalmanagement Göttinger Land Landkreis Göttingen Hartmut Berndt Maschinenring Göttingen e.v. Jan Hampe NABU Samtgemeinde Dransfeld e.v. Jürgen Endres Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Kai Husmann Weiterführendes Informationsmaterial: Virtuelle Fachbibliothek (BEST) Recherchieren Sie im Internet rund um die Bioenergie. Sie finden Quellen und einfache Zusammenfassungen aus der Forschung zu den Bereichen: - Landwirtschaft - Forstwirtschaft - Landschaftspflege - Anlagenplanung und -bau - Anlagenbetrieb An der Erstellung der Broschüre haben mitgewirkt: Redaktion Linda Hartmann, Energieagentur Region Göttingen e.v. Bioenergielandschaft in der Region Göttingen Dedo von Krosigk, e4 Consult Ulrike Kubersky, GEO-NET Umweltconsulting Kai Husmann, Projekt BEST, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Benjamin Krause, Projekt BEST, Abt. Naturschutz und Landschaftspflege, Georg-August- Universität Göttingen Gerald Busch, Projekt BEST, BALSA - Büro für angewandte Landschaftsökologie und Szenarienanalyse Landschaftsbild und Akzeptanz von Bioenergie Thiemen Boll, Projekt AgroForNet, Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover Information und Beratung 30
31 Naturschutz Charlotte Seifert, Projekt BEST, Abt. Vegetationsanalyse und Phytodiversität, Georg-August-Universität Göttingen Umweltschutz Günther Helberg, Umweltamt, Landkreis Göttingen Katja Walter, Projekt BEST, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz Dorothea Angel, Bioenergie-Region Wendland-Elbetal, Regionalmanagement, Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg Stoffliche und energetische Nutzung von Holz Franziska Friese, Projekt BEST, AG Chemie und Verfahrenstechnik von Verbundwerkstoffen, Georg-August-Universität Göttingen Wirtschaftlichkeit Achim Hübner, Landvolk Göttingen Kreisbauernverband e.v. Jan Hampe, Maschinenring Göttingen e.v. Matthias Wolbert-Haverkamp, Projekt BEST, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, Georg-August-Universität Göttingen Energiebedarf senken Patrick Nestler, Amt für Kreisentwicklung und Bauen/ Klimaschutzbeauftragter, Landkreis Göttingen Hanna Naoumis, Fachdienst Hochbau, Klimaschutz und Energie/ Klimaschutzmanagerin, Stadt Göttingen Biomasseangebot steigern Katja Albert, Projekt BEST, Abt. Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen Wolfgang Schmidt, Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen e.v. Benedikt Sauer, Projekt BiS, IZNE - Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung, Georg-August-Universität Göttingen Iris Schmiedel, Projekt KUPAD, Fakultät Ressourcenmanagement, HAWK Hochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen Finn Ahrens, Projekt ELKE, 3N e.v. Beratungswerkzeug: Flächen und Machbarkeit für holzige Biomasse identifizieren Gerald Busch, Projekt BEST, BALSA - Büro für angewandte Landschaftsökologie und Szenarienanalyse Jan C. Thiele, Projekt BEST, Abt. Ökoinformatik, Biometrie und Waldwachstum, Georg-August-Universität Göttingen 31 information und Beratung
32 Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:
Ökologische Bewertung von Kurzumtriebsplantagen
 Pflanzenproduktion / Thüringer Zentrum Nachwachsende Rohstoffe Ökologische Bewertung von Kurzumtriebsplantagen Manuela Bärwolff Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft manuela.baerwolff@tll.thueringen.de
Pflanzenproduktion / Thüringer Zentrum Nachwachsende Rohstoffe Ökologische Bewertung von Kurzumtriebsplantagen Manuela Bärwolff Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft manuela.baerwolff@tll.thueringen.de
Energie aus Biomasse. vielfältig nachhaltig
 Energie aus Biomasse vielfältig nachhaltig Was haben weggeworfene Bananenschalen, Ernterückstände und Hofdünger gemeinsam? Sie alle sind Biomasse. In ihnen steckt wertvolle Energie, die als Wärme, Strom
Energie aus Biomasse vielfältig nachhaltig Was haben weggeworfene Bananenschalen, Ernterückstände und Hofdünger gemeinsam? Sie alle sind Biomasse. In ihnen steckt wertvolle Energie, die als Wärme, Strom
Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung
 Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung Dr. Günther Hälsig Zielstellungen zum Biomasseanbau Ziele der EU bis 2020 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 20 Prozent Reduzierung
Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung Dr. Günther Hälsig Zielstellungen zum Biomasseanbau Ziele der EU bis 2020 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 20 Prozent Reduzierung
Vorstellung des Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe
 Veranstaltung Energie und Rohstoffe aus landwirtschaftlichen Reststoffen Hydrothermale Carbonisierung ein geeignetes Verfahren? Vorstellung des Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe Dr.-Ing. Andreas
Veranstaltung Energie und Rohstoffe aus landwirtschaftlichen Reststoffen Hydrothermale Carbonisierung ein geeignetes Verfahren? Vorstellung des Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe Dr.-Ing. Andreas
Biomasse Nein danke!
 Biomasse Nein danke! Mit der Nutzung von Biomasse als Energieträger sind auch Nachteile verbunden. Der Anbau von Biomasse kann dem Nahrungsmittelanbau Konkurrenz machen. Die starke Preissteigerung von
Biomasse Nein danke! Mit der Nutzung von Biomasse als Energieträger sind auch Nachteile verbunden. Der Anbau von Biomasse kann dem Nahrungsmittelanbau Konkurrenz machen. Die starke Preissteigerung von
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Schleswig-Holstein
 Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Wege zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Winfried Binder
 Wege zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Winfried Binder Netzwerk Regenerative Energien Die Energieagentur Region Göttingen e.v. Die Energieagentur Region Göttingen e.v. ist ein gemeinnütziger, eingetragener
Wege zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Winfried Binder Netzwerk Regenerative Energien Die Energieagentur Region Göttingen e.v. Die Energieagentur Region Göttingen e.v. ist ein gemeinnütziger, eingetragener
Viernheim: Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner.
 Thema: Wildpflanzen zu Biogas Viernheim: 16.4.15 Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner. Eine Möglichkeit, sich
Thema: Wildpflanzen zu Biogas Viernheim: 16.4.15 Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner. Eine Möglichkeit, sich
Kaminabend Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit Energiebilanzen und die Produktion von Nachwachsenden Rohstoffen
 Kaminabend Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit 01.06.2011 Energiebilanzen und die Produktion von Nachwachsenden Rohstoffen Was ändert sich grundlegend in den Szenarien? Weniger Viehhaltung GESUNDE ERNÄHRUNG
Kaminabend Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit 01.06.2011 Energiebilanzen und die Produktion von Nachwachsenden Rohstoffen Was ändert sich grundlegend in den Szenarien? Weniger Viehhaltung GESUNDE ERNÄHRUNG
Energetische und ökologische Bilanzierung der regional angepassten Bioenergiekonzepte
 Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen Energetische und ökologische Bilanzierung der regional angepassten Bioenergiekonzepte M.Eng. Dipl.-Ing (FH) Prof.
Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen Energetische und ökologische Bilanzierung der regional angepassten Bioenergiekonzepte M.Eng. Dipl.-Ing (FH) Prof.
Bioenergie kompakt BIO
 Bioenergie kompakt Inhalt 3 Was ist Bioenergie? 4 Warum ist Bioenergie klimaneutral? 5 Welche Rolle spielt Bioenergie in Zukunft? 6 Was kann Bioenergie leisten? 7 Bioenergie zu Hause 8 Bioenergie in der
Bioenergie kompakt Inhalt 3 Was ist Bioenergie? 4 Warum ist Bioenergie klimaneutral? 5 Welche Rolle spielt Bioenergie in Zukunft? 6 Was kann Bioenergie leisten? 7 Bioenergie zu Hause 8 Bioenergie in der
Natur- und raumverträglicher Anbau von Energiepflanzen
 Natur- und raumverträglicher Anbau von Energiepflanzen Biomassenutzung in der Region Hannover Hannover 17. Juli 2006 Gefördert durch Deutsche Bundesstiftung Umwelt Land Niedersachsen Volkswagen AG ! Fossile
Natur- und raumverträglicher Anbau von Energiepflanzen Biomassenutzung in der Region Hannover Hannover 17. Juli 2006 Gefördert durch Deutsche Bundesstiftung Umwelt Land Niedersachsen Volkswagen AG ! Fossile
Klimaschutz und regionale Wertschöpfung für Kommunen Der ländliche Raum als Energiespeckgürtel Ralf Keller
 Klimaschutz und regionale Wertschöpfung für Kommunen Der ländliche Raum als Energiespeckgürtel 31.05.2011 Ralf Keller Global denken lokal handeln Klimaschutz ist eine globale Thematik. Von G 20 über Europa
Klimaschutz und regionale Wertschöpfung für Kommunen Der ländliche Raum als Energiespeckgürtel 31.05.2011 Ralf Keller Global denken lokal handeln Klimaschutz ist eine globale Thematik. Von G 20 über Europa
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Dienstsitz in Bonn mit Außenstellen in Hamburg Weimar und München www.ble.de Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist eine Anstalt des
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Dienstsitz in Bonn mit Außenstellen in Hamburg Weimar und München www.ble.de Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist eine Anstalt des
Agroforstsysteme Alternative Rohstoffquelle für Biomasseanlagen
 Agroforstsysteme Alternative Rohstoffquelle für Biomasseanlagen Christian Böhm, Michael Kanzler, Dirk Freese Fachgebiet für Bodenschutz und Rekultivierung, BTU Cottbus-Senftenberg Christoph Liebig (1825)
Agroforstsysteme Alternative Rohstoffquelle für Biomasseanlagen Christian Böhm, Michael Kanzler, Dirk Freese Fachgebiet für Bodenschutz und Rekultivierung, BTU Cottbus-Senftenberg Christoph Liebig (1825)
1 Warum brauchen wir Biotreibstoffe?
 1 Warum brauchen wir Biotreibstoffe? Weil unsere Vorräte an Erdöl begrenzt sind Weil wir CO 2 -Emissionen reduzieren müssen Um ein Einkommen für die regionale Landund Forstwirtschaft zu schaffen Weil unsere
1 Warum brauchen wir Biotreibstoffe? Weil unsere Vorräte an Erdöl begrenzt sind Weil wir CO 2 -Emissionen reduzieren müssen Um ein Einkommen für die regionale Landund Forstwirtschaft zu schaffen Weil unsere
Biomassenutzung in Brandenburg Wohin geht die Reise?
 Biomassenutzung in Brandenburg Wohin geht die Reise? Sabine Blossey 7. Infoveranstaltung Tag des Bodens 25.11.2009 Prenzlau Energiestrategie 2020 Land Brandenburg Ausbauziel EE PJ 140,00 120,00 Stand 2004
Biomassenutzung in Brandenburg Wohin geht die Reise? Sabine Blossey 7. Infoveranstaltung Tag des Bodens 25.11.2009 Prenzlau Energiestrategie 2020 Land Brandenburg Ausbauziel EE PJ 140,00 120,00 Stand 2004
Landnutzungswandel in ländlichen Räumen
 Landnutzungswandel in ländlichen Räumen Prof. Dr. Peter Thünen-Institut für Ländliche Räume Erfolgreich Wirtschaften durch Nachhaltiges Landmanagement, Begleitveranstaltung des Verbands der Landwirtschaftskammern
Landnutzungswandel in ländlichen Räumen Prof. Dr. Peter Thünen-Institut für Ländliche Räume Erfolgreich Wirtschaften durch Nachhaltiges Landmanagement, Begleitveranstaltung des Verbands der Landwirtschaftskammern
NAWARO BioEnergie AG Biogas keine Konkurrenz zu Lebensmitteln. Nature.tec 2011 Berlin, 24. Januar 2011
 NAWARO BioEnergie AG Biogas keine Konkurrenz zu Lebensmitteln Nature.tec 2011 Berlin, 24. Januar 2011 BioErdgas Vorteile Alleskönner Biogas Höchste Flächeneffizienz aus der Agrarfläche Ideal für Regelenergie,
NAWARO BioEnergie AG Biogas keine Konkurrenz zu Lebensmitteln Nature.tec 2011 Berlin, 24. Januar 2011 BioErdgas Vorteile Alleskönner Biogas Höchste Flächeneffizienz aus der Agrarfläche Ideal für Regelenergie,
104.DVW-Seminar Klimawandel und Landentwicklung
 104.DVW-Seminar Klimawandel und Landentwicklung Beispiele aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien Dipl.-Ing. Martin Schumann Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Folie 1 Gliederung Grundlagen
104.DVW-Seminar Klimawandel und Landentwicklung Beispiele aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien Dipl.-Ing. Martin Schumann Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Folie 1 Gliederung Grundlagen
Ermittlung des Potenzials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg
 Ermittlung des Potenzials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg Auftraggeber: Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe Tagung Biologische
Ermittlung des Potenzials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg Auftraggeber: Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe Tagung Biologische
Biomasse: Chancen und Risiken aus Naturschutzsicht
 Biomasse: Chancen und Risiken aus Naturschutzsicht Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Außenstelle Leipzig FGL in Erneuerbare Energien, Berg- und Bodenabbau Vortrag am 12.03.2007 in der Reihe Naturschutz
Biomasse: Chancen und Risiken aus Naturschutzsicht Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Außenstelle Leipzig FGL in Erneuerbare Energien, Berg- und Bodenabbau Vortrag am 12.03.2007 in der Reihe Naturschutz
BGA (Biogasanlage) Aufbau & Funktionsweise der Biogasanlage:
 BGA (Biogasanlage) So entsteht Biogas: Als Grundstoffe für die Biogaserzeugung kommen alle Arten von Biomasse in Frage, also alle organischen Materialien, die aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten bestehen.
BGA (Biogasanlage) So entsteht Biogas: Als Grundstoffe für die Biogaserzeugung kommen alle Arten von Biomasse in Frage, also alle organischen Materialien, die aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten bestehen.
Anforderungen an eine Weiterentwicklung der Bioenergie-Förderung
 Anforderungen an eine Weiterentwicklung der Bioenergie-Förderung Florian Schöne NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin Die Grenzen des Wachstums?! Biomasse ist nicht unerschöpflich Akzeptanzprobleme bei Jägern,
Anforderungen an eine Weiterentwicklung der Bioenergie-Förderung Florian Schöne NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin Die Grenzen des Wachstums?! Biomasse ist nicht unerschöpflich Akzeptanzprobleme bei Jägern,
Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs. Fachtagung Energie Graz
 Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs Fachtagung Energie 25.01.2013 Graz Future strategy and 2020 and related projects C-II-2 Biogas im Umbruch Europa wächst österreichischer und deutscher
Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs Fachtagung Energie 25.01.2013 Graz Future strategy and 2020 and related projects C-II-2 Biogas im Umbruch Europa wächst österreichischer und deutscher
Möglichkeiten und Grenzen bei Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe
 Möglichkeiten und Grenzen bei Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe Claudia Viße, MLUR 1 Verluste in der Lebensmittelkette Gemäß UNEP gehen weltweit 56% der möglichen Energieeinheiten (kcal) entlang
Möglichkeiten und Grenzen bei Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe Claudia Viße, MLUR 1 Verluste in der Lebensmittelkette Gemäß UNEP gehen weltweit 56% der möglichen Energieeinheiten (kcal) entlang
Der neue Kraftstoff vom Lande Nutzung von Biogas als Kraftstoff
 Nutzung von Biogas als Kraftstoff LEADER+ - Elbtalaue Raiffeisen Jameln aktuell LEADER+ - Elbtalaue Raiffeisen Jameln aktuell Was hat uns zu der Investition in eine Biogasreinigungsanlage bewogen? Ausgangspunkt
Nutzung von Biogas als Kraftstoff LEADER+ - Elbtalaue Raiffeisen Jameln aktuell LEADER+ - Elbtalaue Raiffeisen Jameln aktuell Was hat uns zu der Investition in eine Biogasreinigungsanlage bewogen? Ausgangspunkt
Präsentation: Helmut Koch. Fachreferent für den Dienst auf dem Lande in der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
 Präsentation: Helmut Koch Fachreferent für den Dienst auf dem Lande in der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck In der Aufzählung fehlt? 2 Unser täglich Brot gib uns heute (Vaterunser) Brot steht in der Christenheit
Präsentation: Helmut Koch Fachreferent für den Dienst auf dem Lande in der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck In der Aufzählung fehlt? 2 Unser täglich Brot gib uns heute (Vaterunser) Brot steht in der Christenheit
ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE
 ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Hirschfeld, 06. Oktober 2014, Geschäftsführer, Projektmanager Agenda 2 ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Hirschfeld, 06. Oktober 2014,
ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Hirschfeld, 06. Oktober 2014, Geschäftsführer, Projektmanager Agenda 2 ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Hirschfeld, 06. Oktober 2014,
Dr. Karsten Block. Besuch des ungarischen Landwirtschaftsministers Josef Graf, LZ Haus Düsse, 05. Februar Dr. Karsten Block. Dr.
 Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW Eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 1 Besuch des ungarischen Landwirtschaftsministers Josef Graf,
Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW Eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 1 Besuch des ungarischen Landwirtschaftsministers Josef Graf,
Wald, Holz und Kohlenstoff
 Wald, Holz und Kohlenstoff Dr. Uwe Paar Landesbetrieb HESSEN-FORST Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Gliederung Bedeutung des Waldes Leistungen nachhaltiger Forstwirtschaft Wie entsteht Holz?
Wald, Holz und Kohlenstoff Dr. Uwe Paar Landesbetrieb HESSEN-FORST Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Gliederung Bedeutung des Waldes Leistungen nachhaltiger Forstwirtschaft Wie entsteht Holz?
Sonnen- und Schattenseiten der Biokraftstoffpolitik László Maráz, Forum Umwelt und Entwicklung 10. Ölmüllertage in Fulda, 25.2.
 Sonnen- und Schattenseiten der Biokraftstoffpolitik László Maráz, Forum Umwelt und Entwicklung 10. Ölmüllertage in Fulda, 25.2.2014 Ausgangssituation Der Mensch nimmt immer mehr Flächen für Landwirtschaft,
Sonnen- und Schattenseiten der Biokraftstoffpolitik László Maráz, Forum Umwelt und Entwicklung 10. Ölmüllertage in Fulda, 25.2.2014 Ausgangssituation Der Mensch nimmt immer mehr Flächen für Landwirtschaft,
Rechtliche Rahmenbedingungen für Kurzumtriebsplantagen (KUP)
 Rechtliche Rahmenbedingungen für Kurzumtriebsplantagen (KUP) Dr. Henning Kurth Koordinierungsstelle Nachwachsende Rohstoffe Forst Workshop Bioenergie aus KurzUmtriebsPlantagen 23. März 2010 Göttingen EU-Rahmenbedingungen
Rechtliche Rahmenbedingungen für Kurzumtriebsplantagen (KUP) Dr. Henning Kurth Koordinierungsstelle Nachwachsende Rohstoffe Forst Workshop Bioenergie aus KurzUmtriebsPlantagen 23. März 2010 Göttingen EU-Rahmenbedingungen
Was ist Sunfuel? Sunfuel ist ein synthetischer Kraftstoff, der aus Biomasse hergestellt wird und dadurch die Ressourcen schont.
 Was ist Sunfuel? Sunfuel ist ein synthetischer Kraftstoff, der aus Biomasse hergestellt wird und dadurch die Ressourcen schont. Durch ihn kann im CO 2 -Kreislauf eine annähernd ausgeglichene Kohlendioxid-Bilanz
Was ist Sunfuel? Sunfuel ist ein synthetischer Kraftstoff, der aus Biomasse hergestellt wird und dadurch die Ressourcen schont. Durch ihn kann im CO 2 -Kreislauf eine annähernd ausgeglichene Kohlendioxid-Bilanz
Themenbereiche: UBA. Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz. Rosemarie Benndorf et al. Juni 2014
 Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 Herausgeber/Institute: UBA Autoren: Rosemarie Benndorf et al. Themenbereiche: Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz Datum: Juni 2014 Seitenzahl:
Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 Herausgeber/Institute: UBA Autoren: Rosemarie Benndorf et al. Themenbereiche: Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz Datum: Juni 2014 Seitenzahl:
Bioenergie in Brandenburg: Chance auf qualitative Verbesserung nutzen
 Bioenergie in Brandenburg: Chance auf qualitative Verbesserung nutzen Sabine Blossey Strategiepapiere Land Brandenburg Energiestrategie 2030 und Katalog der strategischen Maßnahmen (2012) Maßnahmenkatalog
Bioenergie in Brandenburg: Chance auf qualitative Verbesserung nutzen Sabine Blossey Strategiepapiere Land Brandenburg Energiestrategie 2030 und Katalog der strategischen Maßnahmen (2012) Maßnahmenkatalog
Wärmenutzung aus Biogasanlagen und Bioenergiedörfer eine Bestandsaufnahme für Baden-Württemberg
 Wärmenutzung aus Biogasanlagen und Bioenergiedörfer eine Bestandsaufnahme für Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien
Wärmenutzung aus Biogasanlagen und Bioenergiedörfer eine Bestandsaufnahme für Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien
Bioenergie ja aber wie? Bioenergie in Kommunen Bernburg-Strenzfeld, 30. September 2008
 Bioenergie ja aber wie? Bioenergie in Kommunen Bernburg-Strenzfeld, 30. September 2008,, Gliederung Warum Bioenergieprojekte in Kommunen? Mögliche Leitlinien zur Umsetzung von Bioenergieprojekten in Kommunen
Bioenergie ja aber wie? Bioenergie in Kommunen Bernburg-Strenzfeld, 30. September 2008,, Gliederung Warum Bioenergieprojekte in Kommunen? Mögliche Leitlinien zur Umsetzung von Bioenergieprojekten in Kommunen
Peter Maske Deutscher Imkerbund e.v. Präsident
 Bienenweide im Greening Chancen dafür durch die GAP-Reform 2014-2020 05.07.2015 Peter Maske Deutscher Imkerbund e.v. Präsident Ist die Biene in Gefahr? September 2010 Peter Maske Deutscher Imkerbund e.v.
Bienenweide im Greening Chancen dafür durch die GAP-Reform 2014-2020 05.07.2015 Peter Maske Deutscher Imkerbund e.v. Präsident Ist die Biene in Gefahr? September 2010 Peter Maske Deutscher Imkerbund e.v.
Gute Gründe für mehr Bio im Benzin. Warum wir Biokraftstoffe brauchen
 Gute Gründe für mehr Bio im Benzin Warum wir Biokraftstoffe brauchen Im Jahr 2009 wurde die Beimischung von Biodiesel zum Dieselkraftstoff von 5 auf 7 Prozent erhöht. Alle Dieselfahrzeuge tanken B7-Diesel
Gute Gründe für mehr Bio im Benzin Warum wir Biokraftstoffe brauchen Im Jahr 2009 wurde die Beimischung von Biodiesel zum Dieselkraftstoff von 5 auf 7 Prozent erhöht. Alle Dieselfahrzeuge tanken B7-Diesel
Verbundprojekt Lebendige Agrarlandschaften Landwirte gestalten Vielfalt!
 Verbundprojekt Lebendige Agrarlandschaften Landwirte gestalten Vielfalt! KONTAKT ADRESSE Steffen Pingen Deutscher Bauernverband Dr. Tania Runge Claire-Waldoff-Straße 7 Katja Zippel 10117 Berlin Internet:
Verbundprojekt Lebendige Agrarlandschaften Landwirte gestalten Vielfalt! KONTAKT ADRESSE Steffen Pingen Deutscher Bauernverband Dr. Tania Runge Claire-Waldoff-Straße 7 Katja Zippel 10117 Berlin Internet:
Bioenergie im 100 % Erneuerbare Energie Szenario
 Bioenergie im 100 % Erneuerbare Energie Szenario 1 Bedeutung der Bioenergie bei 100 % Erneuerbare Energien - Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt => Dezember 2015 100 % Erneuerbare
Bioenergie im 100 % Erneuerbare Energie Szenario 1 Bedeutung der Bioenergie bei 100 % Erneuerbare Energien - Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt => Dezember 2015 100 % Erneuerbare
Energie vom Acker. Miscanthus Giganteus
 Energie vom Acker Durch die ständig ansteigenden Preise für fossile Brennstoffe (Erdgas, Erdöl) steigen auch die Preise für die Energieproduktion. Es ist zu erwarten, daß diese Preise noch weiter steigen
Energie vom Acker Durch die ständig ansteigenden Preise für fossile Brennstoffe (Erdgas, Erdöl) steigen auch die Preise für die Energieproduktion. Es ist zu erwarten, daß diese Preise noch weiter steigen
Energetische Nutzung halmgutartiger Biobrennstoffe
 Energetische Nutzung halmgutartiger Biobrennstoffe Dr.-Ing. Andrej Stanev Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. Energetische Nutzung halmgutartiger Biobrennstoffe Seite: 1 Gliederung Ziele der Bundesregierung
Energetische Nutzung halmgutartiger Biobrennstoffe Dr.-Ing. Andrej Stanev Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. Energetische Nutzung halmgutartiger Biobrennstoffe Seite: 1 Gliederung Ziele der Bundesregierung
Energiewende in Lörrach
 Biomasse im Energiemix der Stadt Lörrach Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach Energiewende in Lörrach European Energy Award: Kommunale Handlungsfelder Stadtplanung Kommunale Gebäude und Anlagen
Biomasse im Energiemix der Stadt Lörrach Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach Energiewende in Lörrach European Energy Award: Kommunale Handlungsfelder Stadtplanung Kommunale Gebäude und Anlagen
Fachgespräch: Nachhaltige Erzeugung von Bioenergie
 1 Fachgespräch: Nachhaltige Erzeugung von Bioenergie Auswirkungen auf den Erhalt der Biodiversität - Beispiel Feldvögel Dr. Krista Dziewiaty Ergebnisse aus dem Vorhaben: Erprobung integrativer Handlungsempfehlungen
1 Fachgespräch: Nachhaltige Erzeugung von Bioenergie Auswirkungen auf den Erhalt der Biodiversität - Beispiel Feldvögel Dr. Krista Dziewiaty Ergebnisse aus dem Vorhaben: Erprobung integrativer Handlungsempfehlungen
Generation Biomasse. Wie geht es weiter?
 Generation Biomasse. Wie geht es weiter? Biomasse mit anderen Augen sehen. 3 Teller oder Tank? Ich kann das nicht mehr hören. Denn wir müssen doch beides hin kriegen. 6,6 Milliarden Menschen müssen täglich
Generation Biomasse. Wie geht es weiter? Biomasse mit anderen Augen sehen. 3 Teller oder Tank? Ich kann das nicht mehr hören. Denn wir müssen doch beides hin kriegen. 6,6 Milliarden Menschen müssen täglich
Stromerzeugung aus Biomasse Nachhaltige Nutzung von Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung. FVS-Workshop Systemanalyse im FVS
 FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf die Biodiversität
 Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf die Biodiversität Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz FGL in Erneuerbare Energien, Berg- und Bodenabbau BUND-Forum am 08.03.08 in Hofgeismar Übersicht
Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf die Biodiversität Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz FGL in Erneuerbare Energien, Berg- und Bodenabbau BUND-Forum am 08.03.08 in Hofgeismar Übersicht
Handlungsfeld Torfersatz
 Niedersächsische Moorlandschaften Handlungsfeld Torfersatz Strukturen und Arbeitsweise des Forums Nachhaltiger Torfersatz aus Nachwachsenden Rohstoffen für den Gartenbau 11. Mai 2016 Hannover 1 Treiber
Niedersächsische Moorlandschaften Handlungsfeld Torfersatz Strukturen und Arbeitsweise des Forums Nachhaltiger Torfersatz aus Nachwachsenden Rohstoffen für den Gartenbau 11. Mai 2016 Hannover 1 Treiber
Unsere Landwirtschaft Erfolgswege zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt?
 Unsere Landwirtschaft Erfolgswege zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt? Dr. Rainer Oppermann Institut für Agrarökologie und Biodiversität(ifab), Mannheim Vortrag am 13. Juli 2017 in Bad Boll 1
Unsere Landwirtschaft Erfolgswege zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt? Dr. Rainer Oppermann Institut für Agrarökologie und Biodiversität(ifab), Mannheim Vortrag am 13. Juli 2017 in Bad Boll 1
Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf. Stroh zur thermischen Nutzung Rohstoffverfügbarkeit und ackerbauliche Grenzen
 Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf Stroh zur thermischen Nutzung Rohstoffverfügbarkeit und ackerbauliche Grenzen Vortrag von Dr. Norbert Clement anlässlich der ALB Tagung Energetische Strohnutzung Chancen
Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf Stroh zur thermischen Nutzung Rohstoffverfügbarkeit und ackerbauliche Grenzen Vortrag von Dr. Norbert Clement anlässlich der ALB Tagung Energetische Strohnutzung Chancen
Ökonomische und ökologische Optimierung des Anbaus und der Verwertung von Energiepflanzen
 Ökonomische und ökologische Optimierung des Anbaus und der Verwertung von Energiepflanzen Konrad Scheffer Fachkonferenz Perspektiven der BioEnergiewirtschaft in der Region Uckermark-Barnim, 7.11.06, Prenzlau
Ökonomische und ökologische Optimierung des Anbaus und der Verwertung von Energiepflanzen Konrad Scheffer Fachkonferenz Perspektiven der BioEnergiewirtschaft in der Region Uckermark-Barnim, 7.11.06, Prenzlau
Aktuelle Herausforderungen der naturverträglichen Erzeugung Erneuerbarer Energien
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Aktuelle Herausforderungen der naturverträglichen Erzeugung Erneuerbarer Energien Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Leiterin des Fachgebiets Erneuerbare Energien,
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Aktuelle Herausforderungen der naturverträglichen Erzeugung Erneuerbarer Energien Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Leiterin des Fachgebiets Erneuerbare Energien,
Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach. Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof
 Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof Der Mensch beeinflusst das Klima 2 Wie decken wir die Energie 3 Was kommt an?! 4 14 200 PJ jedes Jahr nach D! Ein
Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof Der Mensch beeinflusst das Klima 2 Wie decken wir die Energie 3 Was kommt an?! 4 14 200 PJ jedes Jahr nach D! Ein
Dr. Krista Dziewiaty. Energiepflanzen Vogelschutz
 Energiepflanzen und Vogelschutz Maßnahmen zur Verbesserung der Artenvielfalt Dr. Krista Dziewiaty BMU 27: Auswirkungen zunehmender Biomassenutzung auf die Artenvielfalt - Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
Energiepflanzen und Vogelschutz Maßnahmen zur Verbesserung der Artenvielfalt Dr. Krista Dziewiaty BMU 27: Auswirkungen zunehmender Biomassenutzung auf die Artenvielfalt - Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Biomasse und Biogas in NRW
 Biomasse und Biogas in NRW Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Veredelung und Futterbau im Wettbewerb zu Biogas Martin Hannen Referat Pflanzenproduktion, Gartenbau Gliederung 1. Stand der Biomasse-
Biomasse und Biogas in NRW Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Veredelung und Futterbau im Wettbewerb zu Biogas Martin Hannen Referat Pflanzenproduktion, Gartenbau Gliederung 1. Stand der Biomasse-
Position von Roche zum Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks im Nonnenwald. Infoveranstaltung Stadt Penzberg
 Position von Roche zum Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks im Nonnenwald Infoveranstaltung Stadt Penzberg - 17.09.2012 Politische Situation in Deutschland Energiewende Bis zum Jahr 2050 soll die Energiewende
Position von Roche zum Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks im Nonnenwald Infoveranstaltung Stadt Penzberg - 17.09.2012 Politische Situation in Deutschland Energiewende Bis zum Jahr 2050 soll die Energiewende
Biomassenutzung. Dipl.-Ing. Matthias Funk
 Biomassenutzung Dipl.-Ing. Matthias Funk Agenda Was ist Biomasse? Biomassenutzung Biomassepotenzial im LK Gießen Biomassenutzung am Beispiel Queckborn Vergleich verschiedener Heizsysteme Fazit Was ist
Biomassenutzung Dipl.-Ing. Matthias Funk Agenda Was ist Biomasse? Biomassenutzung Biomassepotenzial im LK Gießen Biomassenutzung am Beispiel Queckborn Vergleich verschiedener Heizsysteme Fazit Was ist
Biomassemitverbrennung in KWK-Anlagen Vattenfall Europe Wärme AG. Controller Arbeitskreis Berlin
 Biomassemitverbrennung in KWK-Anlagen Vattenfall Europe Wärme AG Controller Arbeitskreis Berlin H. Koch W-ESL 07.10.2010 W-ESL, Hr. Koch 1 Klassifizierung von Biomasse Biomasse Pflanzenart Strom & Wärme
Biomassemitverbrennung in KWK-Anlagen Vattenfall Europe Wärme AG Controller Arbeitskreis Berlin H. Koch W-ESL 07.10.2010 W-ESL, Hr. Koch 1 Klassifizierung von Biomasse Biomasse Pflanzenart Strom & Wärme
Biomasseanbau in Deutschland - Standpunkte und Positionen
 M. Renger DRL Koppelweg 3 37574 Einbeck Biomasseanbau in Deutschland - Standpunkte und Positionen Der Anbau von Energiepflanzen bietet die Chance boden- und umweltschonende Anbauverfahren zu entwickeln
M. Renger DRL Koppelweg 3 37574 Einbeck Biomasseanbau in Deutschland - Standpunkte und Positionen Der Anbau von Energiepflanzen bietet die Chance boden- und umweltschonende Anbauverfahren zu entwickeln
Biomasse/Biomüll. Biogas/Biogasanlage. Blockheizkraftwerk. Müllheizkraftwerk. Pelletheizung
 Biomasse/Biomüll Biogas/Biogasanlage Blockheizkraftwerk Müllheizkraftwerk Pelletheizung Christoph Hennemann 10 a 09.03.2010 Biomasse: Als Biomasse wird die gesamte organische Substanz bezeichnet. Basis
Biomasse/Biomüll Biogas/Biogasanlage Blockheizkraftwerk Müllheizkraftwerk Pelletheizung Christoph Hennemann 10 a 09.03.2010 Biomasse: Als Biomasse wird die gesamte organische Substanz bezeichnet. Basis
Erneuerbare Energien und Klimaschutz!?
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Erneuerbare Energien und Klimaschutz!? Claudia Hildebrandt Bundesamt für Naturschutz, AS Leipzig FG II 4.3 Naturschutz und erneuerbare Energien Erneuerbare Energien
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Erneuerbare Energien und Klimaschutz!? Claudia Hildebrandt Bundesamt für Naturschutz, AS Leipzig FG II 4.3 Naturschutz und erneuerbare Energien Erneuerbare Energien
Energiewende. Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz. Kristin Drenckhahn Deutsche Wildtier Stiftung Netzwerk Lebensraum Feldflur
 Energiewende Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz Kristin Drenckhahn Deutsche Wildtier Stiftung Netzwerk Lebensraum Feldflur www. Lebensraum-Feldflur.de Gliederung Einleitung Energiewende in Deutschland
Energiewende Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz Kristin Drenckhahn Deutsche Wildtier Stiftung Netzwerk Lebensraum Feldflur www. Lebensraum-Feldflur.de Gliederung Einleitung Energiewende in Deutschland
WINGAS PRODUKTE BIO- ERDGAS. Ein Multitalent im Einsatz.
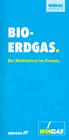 WINGAS PRODUKTE BIO- ERDGAS. Ein Multitalent im Einsatz. Neue Energiekonzepte. Die Zeichen stehen auf Erneuerung denn die Energiewende hat Deutschland so stark beeinflusst wie wenig vergleichbare politische
WINGAS PRODUKTE BIO- ERDGAS. Ein Multitalent im Einsatz. Neue Energiekonzepte. Die Zeichen stehen auf Erneuerung denn die Energiewende hat Deutschland so stark beeinflusst wie wenig vergleichbare politische
B 3. Der Beitrag von Biogas zur Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg. BioenergieBeratungBornim GmbH
 Der Beitrag von Biogas zur Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg Matthias Plöchl 7. Master Class Conference Renewable Energies 6. Dezember 2012, Berlin Wer sind wir? Eine Ausgründung des Leibniz
Der Beitrag von Biogas zur Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg Matthias Plöchl 7. Master Class Conference Renewable Energies 6. Dezember 2012, Berlin Wer sind wir? Eine Ausgründung des Leibniz
Mögliche Auswirkungen der Energiewende auf die Gesundheit
 Für Mensch & Umwelt Fortbildungsveranstaltung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 2014 Mögliche Auswirkungen der Energiewende auf die Gesundheit Judith Meierrose Fachgebiet II 1.1 / Übergreifende Angelegenheiten
Für Mensch & Umwelt Fortbildungsveranstaltung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 2014 Mögliche Auswirkungen der Energiewende auf die Gesundheit Judith Meierrose Fachgebiet II 1.1 / Übergreifende Angelegenheiten
Thema. Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015*
 Thema Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015* Stand *vorbehaltlich weiterer Änderungen und Detailregulierungen durch ausstehende BundesVO 1 Ziele der GAP-Reform (EU) Ernährungssicherheit EU muss Beitrag
Thema Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015* Stand *vorbehaltlich weiterer Änderungen und Detailregulierungen durch ausstehende BundesVO 1 Ziele der GAP-Reform (EU) Ernährungssicherheit EU muss Beitrag
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein
 Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Sonnenstrom für Puchheim Pro und contra PV-Freiflächenanlagen
 Pro und contra PV-Freiflächenanlagen Warum sind PV- Freiflächenanlagen ein Thema für den Umweltbeirat? Warum sind PV- Freiflächenanlagen ein Thema für den Umweltbeirat? Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes
Pro und contra PV-Freiflächenanlagen Warum sind PV- Freiflächenanlagen ein Thema für den Umweltbeirat? Warum sind PV- Freiflächenanlagen ein Thema für den Umweltbeirat? Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes
Daten und Fakten Bioenergie 2011
 Daten und Fakten Bioenergie 2011 Jörg Mühlenhoff 14.07.2011 Daten und Fakten Bioenergie 2011 Anteil der Bioenergie am deutschen Energieverbrauch 2010 Strom Wärme Kraftstoffe Quelle: BMU, AG EE-Stat, März
Daten und Fakten Bioenergie 2011 Jörg Mühlenhoff 14.07.2011 Daten und Fakten Bioenergie 2011 Anteil der Bioenergie am deutschen Energieverbrauch 2010 Strom Wärme Kraftstoffe Quelle: BMU, AG EE-Stat, März
Ausschreibungen/Marktanalyse. Biomasse
 Ausschreibungen/Marktanalyse Biomasse Gliederung 1. Ausbaustand und bisherige Marktentwicklung a. Feste Biomasse b. Flüssige Biomasse c. Biogas/Biomethan d. Klärgas e. Deponiegas f. Biomasse außerhalb
Ausschreibungen/Marktanalyse Biomasse Gliederung 1. Ausbaustand und bisherige Marktentwicklung a. Feste Biomasse b. Flüssige Biomasse c. Biogas/Biomethan d. Klärgas e. Deponiegas f. Biomasse außerhalb
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel
 Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Energieholzanbau auf regionalen Flächen zur langfristigen Sicherung von Holzbrennstoffen in Volumen und Preis
 Energieholzanbau auf regionalen Flächen zur langfristigen Sicherung von Holzbrennstoffen in Volumen und Preis Jan Grundmann Energy Crops GmbH Veranstaltung Kommunale Wertschöpfung durch Wärmewende, 24.
Energieholzanbau auf regionalen Flächen zur langfristigen Sicherung von Holzbrennstoffen in Volumen und Preis Jan Grundmann Energy Crops GmbH Veranstaltung Kommunale Wertschöpfung durch Wärmewende, 24.
Biomasse wird zunehmend für Verkehr und Industrie genutzt
 Strom 2030 Trend 8 Biomasse wird zunehmend für Verkehr und Industrie genutzt Schlussfolgerungen Sitzung der Plattform Strommarkt AG 3 am 8. Dezember 2016 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Basis
Strom 2030 Trend 8 Biomasse wird zunehmend für Verkehr und Industrie genutzt Schlussfolgerungen Sitzung der Plattform Strommarkt AG 3 am 8. Dezember 2016 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Basis
NEUE ENERGIEN FORUM FELDHEIM
 2) Batteriespeicher (in Planung) Speicherung überschüssiger mengen, die die Energieversorgungssicherheit garantiert. 1 ha Energiepflanzen z.b. Mais, Getreide, Schilfgras Vergorene Reststoffe werden als
2) Batteriespeicher (in Planung) Speicherung überschüssiger mengen, die die Energieversorgungssicherheit garantiert. 1 ha Energiepflanzen z.b. Mais, Getreide, Schilfgras Vergorene Reststoffe werden als
LANDonline Transnationales Netzwerk Erneuerbare Energien und Speichertechnologien
 LANDonline Transnationales Netzwerk Erneuerbare Energien und Speichertechnologien BioEnergie Kyritz - Potenziale in der Land- und Forstwirtschaft zur Wärme-, Strom- und Treibstoffversorgung - Friedrich
LANDonline Transnationales Netzwerk Erneuerbare Energien und Speichertechnologien BioEnergie Kyritz - Potenziale in der Land- und Forstwirtschaft zur Wärme-, Strom- und Treibstoffversorgung - Friedrich
Lösungen aus der Sicht der Wissenschaft
 Lösungen aus der Sicht der Wissenschaft Wer viel fragt, bekommt viel Antwort M. Narodoslawsky Was Sie erwartet Hier ist die Lösung Was sind eigentlich die Probleme? Die zukünftige Rolle der Biomasse in
Lösungen aus der Sicht der Wissenschaft Wer viel fragt, bekommt viel Antwort M. Narodoslawsky Was Sie erwartet Hier ist die Lösung Was sind eigentlich die Probleme? Die zukünftige Rolle der Biomasse in
Sehr geehrte Damen und Herren,
 Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema "Landwirtschaft in der Uckermark - Heute und Morgen" verlangt zuerst einmal die Betrachtung der Entwicklung in den letzten Jahren. Mit der Gründung des Landkreises
Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema "Landwirtschaft in der Uckermark - Heute und Morgen" verlangt zuerst einmal die Betrachtung der Entwicklung in den letzten Jahren. Mit der Gründung des Landkreises
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
 Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
Die Herausforderungen des Klimawandels
 Die Herausforderungen des Klimawandels Andreas Krug und Henrike von der Decken Abteilung Integrativer Naturschutz und nachhaltige Nutzung, Gentechnik des Bundesamtes für Naturschutz Trockenes Frühjahr,
Die Herausforderungen des Klimawandels Andreas Krug und Henrike von der Decken Abteilung Integrativer Naturschutz und nachhaltige Nutzung, Gentechnik des Bundesamtes für Naturschutz Trockenes Frühjahr,
FORSCHUNGSFÖRDERUNG ZU NACHHALTIGER LANDNUTZUNG UND AGRARHOLZPRODUKTION
 Webseite FORSCHUNGSFÖRDERUNG ZU NACHHALTIGER LANDNUTZUNG UND AGRARHOLZPRODUKTION 4. Forum Agroforstsysteme 03.12.2014 Frauke Urban Aufgaben der FNR Förderung von Forschung und Entwicklung BMEL-Förderprogramm
Webseite FORSCHUNGSFÖRDERUNG ZU NACHHALTIGER LANDNUTZUNG UND AGRARHOLZPRODUKTION 4. Forum Agroforstsysteme 03.12.2014 Frauke Urban Aufgaben der FNR Förderung von Forschung und Entwicklung BMEL-Förderprogramm
MISCANTHUS-ANBAU. Die vielseitige Lösung. Gennen Jerome
 MISCANTHUS-ANBAU Die vielseitige Lösung Gennen Jerome Aufbau der Präsentation Miscanthus als Biogas-Substrat Bewertung des Anbaus von Miscanthus aus Sicht des Boden-, Wasser-, und Klimaschutzes Miscanthusanbau
MISCANTHUS-ANBAU Die vielseitige Lösung Gennen Jerome Aufbau der Präsentation Miscanthus als Biogas-Substrat Bewertung des Anbaus von Miscanthus aus Sicht des Boden-, Wasser-, und Klimaschutzes Miscanthusanbau
Erneuerbare Energien die Rolle der Bioenergie
 Energie aus Biomasse Ethik und Praxis Sommerkolloquium, Straubing, 28.06.2012 Erneuerbare Energien die Rolle der Bioenergie Dr. Bernhard Leiter Technologie- und Förderzentrum Folie 1 Energie aus Biomasse
Energie aus Biomasse Ethik und Praxis Sommerkolloquium, Straubing, 28.06.2012 Erneuerbare Energien die Rolle der Bioenergie Dr. Bernhard Leiter Technologie- und Förderzentrum Folie 1 Energie aus Biomasse
Greening in der 1. Säule: Welche Anforderungen sollten ökologische Vorrangflächen erfüllen?
 Greening in der 1. Säule: Welche Anforderungen sollten ökologische Vorrangflächen erfüllen? GAP ab 2014 Mehr Biodiversität im Ackerbau?, Vilm, 02.-05.Mai 2012 Dipl. Biologin Nadja Kasperczyk 1 Projekt:
Greening in der 1. Säule: Welche Anforderungen sollten ökologische Vorrangflächen erfüllen? GAP ab 2014 Mehr Biodiversität im Ackerbau?, Vilm, 02.-05.Mai 2012 Dipl. Biologin Nadja Kasperczyk 1 Projekt:
Die Bioenergie-Region Mecklenburgische Seenplatte. startet nach erfolgreicher erster Projektphase in die zweite Runde
 Die Bioenergie-Region Mecklenburgische Seenplatte startet nach erfolgreicher erster Projektphase in die zweite Runde 1 Gliederung 1) Der Wettbewerb Bioenergie-Regionen des BMELV - Projekte 1. Projektphase
Die Bioenergie-Region Mecklenburgische Seenplatte startet nach erfolgreicher erster Projektphase in die zweite Runde 1 Gliederung 1) Der Wettbewerb Bioenergie-Regionen des BMELV - Projekte 1. Projektphase
Für helle Momente Strom natürlich aus Harsefeld. Direkt aus Ihrer Nachbarschaft transparent, fair und zukunftssicher.
 Für helle Momente Strom natürlich aus Harsefeld Direkt aus Ihrer Nachbarschaft transparent, fair und zukunftssicher. www.hhb-strom.de HHB Strom ein Projekt mit und für die Zukunft 100 % ECHTER REGIONALSTROM
Für helle Momente Strom natürlich aus Harsefeld Direkt aus Ihrer Nachbarschaft transparent, fair und zukunftssicher. www.hhb-strom.de HHB Strom ein Projekt mit und für die Zukunft 100 % ECHTER REGIONALSTROM
Die Energiewende naturverträglich gestalten
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Die Energiewende naturverträglich gestalten Prof. Dr. Beate Jessel Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz Thüringen Erneuer!bar 2016-6. Erneuerbare-Energien-Konferenz
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Die Energiewende naturverträglich gestalten Prof. Dr. Beate Jessel Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz Thüringen Erneuer!bar 2016-6. Erneuerbare-Energien-Konferenz
Biodiesel. Als Unterrichtsthema in der Sekundarstufe I
 Biodiesel Als Unterrichtsthema in der Sekundarstufe I Warum soll man Biodiesel im 1. Ist für die Schüler besonders relevant, weil das Thema den Schülern sehr häufig in den Medien begegnet. Brandenburg
Biodiesel Als Unterrichtsthema in der Sekundarstufe I Warum soll man Biodiesel im 1. Ist für die Schüler besonders relevant, weil das Thema den Schülern sehr häufig in den Medien begegnet. Brandenburg
Workshop. Bewässerung von Kurzumtriebsplantagen mit (gereinigtem) Abwasser
 Veranstaltung des Verbundprojektes RePro Ressourcen vom Land mit Unterstützung des Wissenschaftlichen Begleitvorhabens (Modul B) Workshop Bewässerung von Kurzumtriebsplantagen mit (gereinigtem) Abwasser
Veranstaltung des Verbundprojektes RePro Ressourcen vom Land mit Unterstützung des Wissenschaftlichen Begleitvorhabens (Modul B) Workshop Bewässerung von Kurzumtriebsplantagen mit (gereinigtem) Abwasser
Biogasanlage Eggertshofen bei Pulling
 Biogasanlage Eggertshofen bei Pulling Im Prinzip werden in einer Biogasanlage die Vorgänge im Kuhmagen nachgeahmt. Auch die Temperaturen sind fast gleich. Je besser die Nahrung ist, umso mehr Milch gibt
Biogasanlage Eggertshofen bei Pulling Im Prinzip werden in einer Biogasanlage die Vorgänge im Kuhmagen nachgeahmt. Auch die Temperaturen sind fast gleich. Je besser die Nahrung ist, umso mehr Milch gibt
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen,
 1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
Wald und Biodiversität in der Sicht des staatlichen Naturschutzes
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen NW-FVA-Symposium Forstwirtschaft im Spannungsfeld vielfältiger Ansprüche Wald und Biodiversität in der Sicht des staatlichen Naturschutzes Dr. Manfred Klein Biodiversität
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen NW-FVA-Symposium Forstwirtschaft im Spannungsfeld vielfältiger Ansprüche Wald und Biodiversität in der Sicht des staatlichen Naturschutzes Dr. Manfred Klein Biodiversität
eifel energie zentrum
 Bürger gegen Nachtflug e.v. Bitburg eifel energie zentrum die Alternative zum Verkehrslandeplatz Bitburg Mai 2009 Inhalt Verkehrslandeplatz Bitburg eine kritische Bilanz Das Gelände Schwerpunkt 1: Photovoltaik
Bürger gegen Nachtflug e.v. Bitburg eifel energie zentrum die Alternative zum Verkehrslandeplatz Bitburg Mai 2009 Inhalt Verkehrslandeplatz Bitburg eine kritische Bilanz Das Gelände Schwerpunkt 1: Photovoltaik
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und Wärmenetzen auf Basis fester Biomasse. Uwe Gährs Senior Manager
 Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und Wärmenetzen auf Basis fester Biomasse Uwe Gährs Senior Manager Agenda I Abgrenzung feste Biomasse II Nutzungsmöglichkeiten III Praxisbeispiele IV
Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und Wärmenetzen auf Basis fester Biomasse Uwe Gährs Senior Manager Agenda I Abgrenzung feste Biomasse II Nutzungsmöglichkeiten III Praxisbeispiele IV
Greening in der Landwirtschaft
 Greening in der Landwirtschaft Umsetzung von Ökologischen Vorrangflächen und Wirkungen für Vegetation und Tierwelt Dr. Rainer Oppermann Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab), Mannheim Vortrag
Greening in der Landwirtschaft Umsetzung von Ökologischen Vorrangflächen und Wirkungen für Vegetation und Tierwelt Dr. Rainer Oppermann Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab), Mannheim Vortrag
Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit Zusammenfassung der Ergebnisse
 1 Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit Zusammenfassung der Ergebnisse Matthias Zessner "Gesunde ERnährung und Nachhaltigkeit" Präsentation eines Projektes im Rahmen des provision-programmes Wien am 21.06.2011
1 Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit Zusammenfassung der Ergebnisse Matthias Zessner "Gesunde ERnährung und Nachhaltigkeit" Präsentation eines Projektes im Rahmen des provision-programmes Wien am 21.06.2011
Bioenergie, Biomasse und die Biotreibstoffe der 2. Generation
 Bioenergie, Biomasse und die Biotreibstoffe der 2. European Business School International University Schloss Reichartshausen 3. Juli 2008 1 - - - - Biokraftstoffbedarf u. weitere Entwicklung von Bioenergie,
Bioenergie, Biomasse und die Biotreibstoffe der 2. European Business School International University Schloss Reichartshausen 3. Juli 2008 1 - - - - Biokraftstoffbedarf u. weitere Entwicklung von Bioenergie,
