KREIS. Der Ministerprasident des Landes Nordrhein-Westfalen. Copyright Sauerlander Heimatbund. Gefordert durch. Sauerländer Heimatbund
|
|
|
- Alexander Lehmann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gefordert durch Der Ministerprasident des Landes Nordrhein-Westfalen KREIS
2 ISSN Sauerländer Heimatbund Nr. 1/Marz 2002 Zeitschrift des Sauerlander ^^^^ Heimatbundes K2767
3 Ohne Umwege direkt zum Ziel! Wir bieten Ihnen Komplett-Losungen fur: Werbeprospekte Kataloge Prospekt- und Katalogdesi: Satz und Bildbearbeituns rnet-seitengestaltung Zeitschriften Geschaftsdrucksachen Direktwerbung ktwerbung ' '-^T^Hii^J'^ftS^D^I.,../. Becker G..Cif'-rFo-r afie Arnsberg Tel / Fax / info@b-sign.de» F. W. Becker GmbH Druckerei und Verlag GrafenstraBe Arnsberg Tel / Fax / lnfo@becker-druck-verlag.de Copyright Saueriander Heimatbund
4 NR. 1/2002 Nr. 1/Marz 2002 Zeitschrift des Sauerlander Heimatbundes "Y) epragt vom Geist der Aufi^--iklarung und dem Bewusst- V^-::, ysein einer miindigen, selb- standigen Burgerschaft wird in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts in Westfalen die Sakularisation (Auf- hebung klosterli- chen Vermogens und kirchlichen Grundbesitzes) zugunsten der Re- form des Schulwesens und ande- t oof rer dem offentli- I chen Wohl dienenden Einrichtungen eingeleitet. Zu den ersten MaEnahmen im kur- kolnischen Sauerland gehorte 1782/83 die Umgestaltung der Klosterschule der Pramonstraten- serabtei Wedinghausen in eine staatliche Lehranstalt. Mit der militarischen Besetzung der Hauptstadt Arnsberg des Herzog- tums Westfalen durch den neuen Landesherrn, Landgraf Ludwig X. von Hessen-Darmstadt am 6. Ok- tober 1802, begann eine Sakularisierungswelle, von der 19 Kloster und Stifte mit etwa 280 Insassen betroffen waren. Mit dem Untergang des Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation durch den Reichsdeputations- hauptschluss vom wur- de das staatliche Gefuge in seinen politischen und rechtlichen Grund- zugen entscheidend verandert. ^tm IjiftotnfdjCtt Grund genug, dass der Sauerlander Heimatbund diesen bedeutungsvol- len kirchlichen, kulturellen und heimatgeschichtlichen Wandlungspro- zess auch in der Zeitschrift SAUER- LAND durch den differenzierten...«..,,.... ~ -, Artikel iiber den i Bewusstseins- QQ wandel von Frau Dr. Richter in den Blickfang nimmt und sich dariiber hinaus j an der geplanten ^ Initiative des Landschaftsverbandes zum Thema Sakularisation in den westfali- schen Regionen" beteiligen wird. Des Weiteren unterstiitzen wir die ins Auge gefasste Ausstellung im Sauerland-Museum in Arnsberg un- ter der Leitidee: Vom Kurkolnischen Krummstab uber den Hessi- schen Lowen zum PreuBischen Ad- ler" sowie geplante Sonderveran- staltungen an ausgewahlten, da- mals besonders betroffenen Orten im kurkolnischen Herzogtum West- falen. Auf der diesjahrigen Mitgliederver- sammlung des Sauerlander Heimat- bundes in Drolshagen am 31. Au- gust 2002 wird der Festredner, Herr Prof. Dr. Karl Hengst, das vielschichtige Thema Sakularisation" naher beleuchten. Dieter Wurm Aus dem Inhalt: Scite Monche und Nonnen in der Sakularisation 4 NachguB einer historischen Glocke 7 ER fiihrt - wir gehen Die Olper Franziskanerinnen - heute - 8 Die Stiftung Bruchhauser Steine Eine Raritat im kurkolnischen Westfalen Termine Auferstehungsfeier in St. Vincenz, Menden/Sauerland Ober alien Gipfeln ist Ruh"... aber wie lange noch? Zur Geschichte des Warsteiner Erzbergbaus Zentrum fur landliche Entwicklung Jahresprogramm der Christine Koch Gesellschaft e. V. Kreuzwege in der Landschaft Eine tragische Geschichte aus den letzten Kriegstagen in Langenholthausen 44 Ein liebes Kerlchen? 47 Die Bibel - aktuell erschlossen 49 BUCHER SCHRIFTTUM 51 PERSONALIEN 58 Unser Titelbild FrUhling im Seufzertal bei Arnsberg Foto; F. Ackermann Mitarbciter dieses Heftes: Dieter Wurm, Meschede; Dr. Erika Richter, Meschede; Franz-Josef ScbiJtte, Lennestadt; Sr Mediatrix Nies OSF, Olpe; Barbel Michels, Olsberg; Friedhelm Sommer, Ruthen; Franz Rosen, Menden; Friedhelm Ackermann, Arnsberg; Maria Grunwald, Menden; Dr Marieluise Scheibner- Herzog, Brilon; Theresia Imberg, Niedersfeld; Franz-Josef Rickert, Frechen; Dieter Wiethoff, Meschede; Julia Hesse und Uta Schmitt, Hannover; Studiendirektor a.d. Friedhelm Crete, Neuenrade-Affeln; Heinz Raulf; Wolfgang Frank, Arnsberg; Prof. Dr Hubertus Halbfas, Drolshagen; Alexander von Elverfeldt, Canstein; Knut Friedrich Platz, Olpe; Anton Trippe, Kaarst; Dr. Adalbert MtiUmann, Brilon; Dr. Theo Bonemann, Menden; Heinz-Josef Padberg, Meschede; Walter Schulte, Meschede; Walter Schulte, Eslohe
5 NR. 1/2002 Monche und Nonnen in der Sakularisation Stimmen zur Zeitcnwende" in den sauerlandischen Klostern von Dr. Erika Richter Fernsehprogramme sind als Zeitzeugnisse aufschlukreich. Sie dokumentieren, was nach der Einschatzung der Medienmacher ankommt", was die Zuschauer bewegt, einen bestimmten Sender einzuschalten und was daher Quoten bringt. Schauen wir die Programme der beiden groren offentlichen Sendeanstalten im Januar 2002 an: am gleichen Abend bringt der eine Der kleine Monch", eine Krimiserie mit einem verschmitzten Star in der Monchskutte, der andere Um Himmels willen", eine Serie, in der eine couragierte Nonne schwungvoll-unorthodox kompiizierte Situationen bewaltigt. Die Quotenzahler wissen offenbar: neben Arzten oder Forstern sind auch Nonnen und Monche attraktive Serienheldinnen und -helden - vorausgesetzt sie agieren pfiffig und munter Das mag im Sauerland, wo die Kloster heute eine weithin positive Ausstrahlung besitzen, nicht besonders verwundern. Aber in anderen deutschen Gebieten, wo die Kirchenferne der Bevolkerung in steigendem MaRe zunimmt und sich eine immer starkere Sakularisierung", also eine Verweltlichung und Entchristlichung in alien Bereichen nachweisen labt, ist die Beliebtheit von Ordensleuten erstaunlich. MijRten die Menschen heute eine ausgesprochen leibfeindlich-unmoderne" Lebensweise nicht kopfschuttelnd ablehnen, sie als total iiberholt disqualifizieren? Stimmen zum Klosterwesen in der Vergangenheit Konnte man daher nicht eher erwarten, dab folgende Urteile uber die Monchsorden aus gegenwartigen Quellen stammen?: Sie (die Monche sind gemeint), leben nur, um immer stupider zu werden, wer den hochsten Grad der Verstandesverleugnung unter ihnen erreicht, ist der vollkommenste", oder als Urteil uber Orden, die sich der religiosen Betrachtung widmen:"...ein Stand, der im Nichtstun seine Heiligkeit und im Schmutz seine Erhabenheit setzt".,. oder Qber den EinfluB der Bettelmonche auf die Laien..." dieser ungebildeten Klasse von geistlichen Vagabunden iiberlakt man sorglos die Leitung der Gewissen". Aber diese AuBerungen stammen nicht aus dem 21., sondern dem 18. Jahrhundert und einem damals geschlossen katholischen Raum: dem Sau- Franz Wilhelm Freiherr uon Spiegel zum Desenberg ( ) erland. Ihr Verfasser ist Freiherr Franz Wilhelm von Spiegel, 1752 auf SchloB Canstein geboren, 1815 dort gestorben, seit 1786 kurkolnischer Hofkammerprasident in Bonn. Die Zitate sind seiner Denkschrift Gedanken iiber die Auf hebung der Kloster und geistlichen Stifter im Herzogthum Westphalen" entnommen,i> die er 1802 der neuen hessischen Landesbehorde zustellte. Er wubte, dak sie fur antimonchische Kritik ein offenes Ohr hatte, ging es doch um die Sakularsationsbefugnisse uber die Kloster in ihrem Entschadigungsland", dem Herzogtum Westfalen, das sie gerade besetzte. Die Abwertung der Kloster mubte um so schwerer wiegen, weil der Verfasser selbst Katholik, ja ein Domherr war und in seiner Denkschrift auch betonte, dab er darin nur seit langem gehegte Wiinsche der katholischen Glaubigen ausspreche: Jeder Catholik, der den gelauterten Principien seiner Religion folgen wollte, wunsche sich schon langst die Aufhebung der Kloster". Was verstand Spiegel unter den gelauterten Principien"? Hier mussen wir den geistesgeschichtlichen Hintergrund, der die Wurzel der Klosterverachtung bildete: die Aufklarung, kurz erwahnen. Das 18. Jahrhundert als aufgeklartes" Zeitalter, in dem bekanntlich die Herrschaft der Vernunft die zentrale Rolle spielte, braucht nicht im einzelnen dargestellt zu werden. Ideen der Aufklarung gehorten langst zum Gedankengut der sogenannten Gebildeten in weiten Teilen Europas, aber die Faszination dieser Gei- stesstromung ergriff nach und nach auch viele Mitglieder des Katholizismus, obwohl er mit seinen Dogmen, der Lehre von Gnade und Erlosung und dem Mysteriencharakter von Messe und Sakramenten dem aufklarerischen Denken stark widersprach.2) Wer nun den Rationalismus als Leitidee akzeptierte und dem Nutzlichkeitsdenken hochsten Stellenwert einraumte, wer die Verbesserung der Volksbildung als hohes Ziel propagierte, fur den mueten vor allem die beschaulichen und die Almosen sammelnden Bettelorden ein Argernis sein, aber auch die Klosterschulen, in denen ein ganz veraltetes scholastisches Lehrsystem weiter praktiziert wurde. So wollte Spiegel schon Jahrzehnte vor dem Beginn der politischen Umwalzung. die als Sakularisation" die geistlichen Territorien in weltlichen Besitz brachte, seine aufgeklarten Principien" verwirklichen. Er stand mit seiner Klosterkritik ubrigens nicht allein, fast gleichzeitig mit ihm hatte der Geheime Referendar Wreden geschrieben.." zu wunschen ist es, dar Mendikantenkloster (Kloster der Bettelorden) aus der Reihe der Weesen vertilget werden."3) Vor allem in Suddeutschland gab es damals eine unvorstellbar gehassige Kritik an einzelnen Orden. Monche werden mit Ratten, Mausen und anderem Ungeziefer verglichen. das vernunftigerweise beseitigt werden miisse.*' Wenn Freiherr von Spiegel auch soweit nicht geht, so nennt er doch den Kaiser Joseph II, der seit seinem Regierungsantritt 1780 mehr als 700 Kloster im habsburgischen Reich aufloste, ausdrucklich einen Menschenfreund"... Das Trommelfeuer der antiklosterlichen Propaganda" 5) kam aus der Feder der sog. Gebildeten. Wie nahm die katholische Bevolkerung im Sauerland es auf, als die Sakularisation tatsachlich einsetzte und die zum Teil viele Jahrhunderte alten Kloster von den neuen hessischen Machthabern aufgehoben wurden? Die Quellen dariiber flieeen sparlich, es gab wohl nur wenig Schreibkundige unter den Bauern. Doch hat uns ein Grafschafter Monch, der als Geistlicher in Kirchrarbach eingesetzt war, einen Band mit bisher nur handschriftlich ijberlieferten Tagebuchnotizen hinterlassen. Seine Chronik von enthalt interessante Bemerkungen iiber ein spannungsvolles Verhaltnis der Bauern
6 NR. 1/2002 Sauerländer Heimatbund zum Grafschafter Kloster, dem sie ja zu Abgaben und Diensten verpflichtet waren. Der Verfasser Pater Odilo Girsch erwahnt Z.B., nachdem er schon 1777 iiber einige,,aufruhrerische" Bauern berichtet hatte, in den Anmerkungen zu 1791:...Den 3. des Monats starb zu Schmallenberg P. Isidorus Plebs, wirklicher Pfarrer. Die vielen MiEhandlungen wie zum Beispiel die Schmallenberger ihm ein abgezogenes Pferd vor das Haus und ein totes Kalb in den Brunnen warfen, einige Male die Fenster einschlugen u.a. verursachten ihm eine Auszehrung. Ihm folgte P. Emericus Becker, der von den Schmallenberger Canibalen nicht besser behandelt wurde." Diese Bemerkungen Girschs, der allerdings an den Stellen seines Wirkens in Rarbach.Velmede, Dorlar selbst immer wieder mit den Bauern aneinander geriet und offensichtlich ein schwieriger Zeitgenosse war, sie deuten auf ein keineswegs konfliktfreies Verhaltnis der bauerlichen Bevolkerung zum Kloster. Seine Notizen durfen naturlich nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. Aber die Abhangigkeit der Bauern von den Patres lier ihnen die Sakularisation, wodurch die Klostergiiter in staatliche Domanen umgewandelt wurden, wohl in vielen Fallen nur als bloren Besitzerwechsel erscheinen, der keine fur ihre konkreten Lebensverhaltnisse entscheidende Veranderungen hervorrief und daher nicht zu Protesten fuhrte. Das Erlebnis der Klosteraufhebungen Wie aber reagierten die direkt Betroffenen, die Monche und Nonnen in der sauerlandischen Klosterlandschaft? Sie war damals reich bestuckt mit Klostern der verschiedensten Art. Der Historiker Harm Klueting hat den Gesamtvorgang der regionalen Sakularisation in einer 1980 erschienenen, beispielhaft grundlichen Untersuchung Die Sakularisation im Herzogtum Westfalen " analysiert, vor allem unter der Fragestellung nach der wirtschaftlichen und sozialgeschichtlichen Auswirkung des Prozesses (die er iibrigens als relativ folgenlos einschatzt) ^l Er listet 17 fundierte (d.h. mit Grundbesitz ausgestattete) und 7 Mendikanten - d.h. den Orden der Bettelmonche zugehorige Kloster (Minoriten, Kapuziner, Franziskaner) auf und zahlt Konvents- und Ka- Die 1173 gegrundete Prdmonstratenserabtei Wedinghausen in Arnsberg pitelmitglieder ohne die wenigen Novizen und Laien, Bei einer ca zahlenden Bevolkerung des Herzogtums also ein recht kleiner Anteil von 0,27 %. der Betroffenen. Wie vollzog sich der gravierende Einschnitt in ihr Leben? Die Aufhebung der Kloster begann nach der hessischen Inbesitznahme im Herbst Hessische Beauftragte erschienen in den Klostern, verlasen das Okkupationspatent und nahmen die Verpflichtung zum Gehorsam gegenuber dem neuen Landesherren mit Handschlag an Eides statt" von den jeweiligen Abten, Abtissinnen oder Priorinnen entgegen. In der feierlichen, formelreichen Sprache der Zeit heibt es dab sie Sr. des Herrn Landgrafen hochfiirstlichen Durchlaucht und hochstdero Nachfolgern am Regiment treu, hold und gewartig seyn, auch den Befehlen Serenissimi und der von hochstdenenselben angeordneten offentlichen Gewalten behoriges und schuldiges Genuge leisten wollten." Dann kommt das fur die Aufhebungsbeamten Wichtigste: eine moglichst genaue Aufnahme der Vermogensverhaltnisse, also den,, status activorum et passivorum" der finanziellen Situation, da einige der zwar an Grundbesitz reichen Kloster z.b. auch Grafschaft hoch verschuldet waren. Die Ergebnisse dieser Priifungen sind bei Klueting,der die bisher unveroffentlichten Archivalien uber die Vermogensver- haltnisse prazise wiedergibt, (S seines Buches) im einzelnen nachzulesen. Die Monche und Nonnen erhielten eine jahrlich auszuzahlende Pension in unterschiedlicher Hohe z.b. der Grafschafter Abt 2000 Florin, die dortigen Patres im allgemeinen 300 Florin. Nicht aufgehoben wurden iibrigens das adlige Damenstift Geseke und die Deutschordenskommende Miilheim, der erst Napoleon 1809 ein Ende setzte... Die Sakularisation veranderte mit der Beseitigung der geistlichen Furstentumer nicht nur die Struktur des Heiligen Romischen Reiches deutscher Nation einschneidend, sie brachte auch eine gewaltige Besitzumschichtung mit sich, auch das bei Klueting ausfuhrlich dargestellt. Die Besitzungen der Kloster wurden iiberwiegend in staatliche Domanen umgewandelt, einige gelangten allerdings auch in Privatbesitz und dienten unterschiedlichen Zwecken, gelegentlich versuchte man Fabriken in ihnen einzurichten. Die Klostergebaude wurden teilweise als Wohnungen der neuen Beamtenschaft, mehrfach als Schulhauser, einige als Wohnmoglichkeit fur soziale Problemfalle wie Armenhauser oder - wie in Marsberg - fur die Unterbringung von Geisteskranken verwendet. Da der neue hessische Landesherr als Kunstliebhaber bekannt war, wurden ihm kostbare mittelalterliche Handschriften wie die Bredelarer Bibel oder
7 NR. 1/2002 der Hitda-Codex aus Meschede fur sein Museum", wie er seine Schatzkammer nannte, zugestellt - ein bleibender Verlust fiir das Sauerland! Wie viele Kunstschatze als Folge der Sakularisation in unserem Raum insgesamt verloren gingen, ist wohl bisher noch nirgends erfabt. Doch ist auch die Frage offen geblieben, wie die Reaktion der Klosterinsasssen aussah, die plotzlich ihre hergebrachte Lebensform aufgeben mubten.dazu bietet die Uberlieferung, soweit sie uns zuganglich ist, ein ganz uneinheitiiches Bild. Einige Beispiele seien festgehalten. Im Kloster Grafschaft vollzog sich die Aufhebung nach der offiziellen Quelle am 17. Februar Doch baten die Monche flehentlich", wie es in einer Darstellung heibt, doch bis zum Namenstag ihres Ordensgriinders Benedikt am 21. Marz zu warten. Der Aufschub wurde ihnen gewahrt, nach dem Festhochamt verlieben der Abt und seine Ordensbriider unter Tranen die ihnen lieb gewordene klosterliche Heimat."''' Dagegen seien die Benediktinerinnen in Odaker - so zumindest der Bericht des Aufhebungskommissars - von Ungedult nach Auflosung ihres Klosters erfiillt". Von den Zisterzienserinnen in Drolshagen wird berichtet, dab Abtissin und Conventualinnen den Wunsch geaubert hatten, dab das Kloster je eher je lieber aufgehoben und ihnen eine billigmabige (angemessene) Pension zugesichert werde.^' Die Priorin von Oelinghausen - wo vor der Sakularisation allerdings ein offenbar sehr lockeres Leben geherrscht hatte - verlieb nach der Aufhebung des Klosters Ende Marz 1803 schon im Mai Oelinghausen.^) Ganz anders die Dominikanerinnen von Galilaea, die offenen Widerstand gegen die Aufhebung ihres Klosters leisteten. Es murte tatsachlich belagert werden, und die Nonnen wurden regelrecht ausgehungert, ehe sie 1810 ihr Kloster raumten. Aber auch in Rumbeck bewirkte die Priorin des Pramonstratenserklosters, dab sie und ihre Ordensschwestern bis zu ihrem Aussterben" in Rumbeck bleiben durften. Und obwohl sie eine relativ niedrige Pension erhielten, konnten sie noch einen Fonds fiir arme Schulkinder in Rumbeck, Oeventrop und Freienohl und arme Gym- Die 1072 von Erzbischof Anno II. von Koln gegrundete Benediktinerabtei Grafschaft/Schmallenberg Fotos: Friedhelm Ackermann nasiasten in Arnsberg und arme Einwohner von Rumbeck" einrichten und damit ihre soziale Gesinnung beweisen.io' Uber die Einstellung der Wedinghauser Pramonstratenser zur Klosterauflosung ist wenig bekannt, aber hier war die Monchsgemeinde auch schon vor der Sakularisation zeitweise sehr zerstritten. Eine Monchsgruppe opponierte heftig gegen den despotischen" Abt und wollte ihre grundsatzliche Kritik am Monchswesen durch mehr Freiheit verwirklichen. Wortfiihrer war der besonders widerspenstige Georg Friedrich Pape, der 1791 das Kloster verlier und ein prominenter Jakobiner in Mainz wurde.^i' Ein einheitiiches Stimmungsbild von den Wedinghauser Monchen ist daher kaum zu erwarten, wie auch in den vielen anderen nicht genannten Klostern die Einstellung wohl durchaus unterschiedlich war. Unser Gewahrsmann Odilo Girsch, der das Sakularisationsgeschehen von Rarbach aus beobachtete, schreibt zusammenfassend 1803, nachdem er eine Reihe der Klosteraufhebungen erwahnt: Diese grausame Art, Menschen ohnverdient von ihrem Eigentum zu verjagen, sich damit zu entschadigen, mogen nur jene gutheiben, welche offentliche Diebstahle rechtfertigen konnen. Und ob dem Staate dadurch besser gedient sei, wenn diese Besitzungen in den Handen des Landesherren sind, als wenn die vertriebenen geistlichen Herren dort geblieben waren, mag die traurige Erfahrung das Publikum belehren." Die kontroverse Vielfalt der Stimmen zum SakularisationsprozeB in unserem Raum labt sich bis in die Gegenwart fortsetzen. Ganz emotional abwertend reagierte 1957 der geistliche Rat und Doktor der Theologie Friedrich Albert Groeteken in seiner Geschichte der Benediktiner-Abteil Grafschaft unter der Uberschrift: Das traurige Ende Durch einen rohen ehrlosen Gewaltstreich grorten AusmaEes seitens deutscher Fursten ging am sowohl das kurkolnische Herzogtum Westfalen wie auch 111 andere deutsche Gebiete aller seiner Jahrhunderte alten Rechte mit einem Federstrich verlustig. Damit wurden die vielen der Kirche gehorenden Manner- und Frauenkloster dieser einfach gewaltsam genommen und an katzbuckelnde deutsche Fursten zur Ausplunderung ausgeliefert."'^) Einen anderen Tenor hat das Gruf^wort von Joachim Kardinal Meisner zur Ausstellung..Zuflucht zwischen Zeiten ", in der an die Verbringung der Schatze des Kolner Doms vor den Franzosen in das rechtsrheinische Arnsberg erinnert wurde. Kardinal Meisner charakterisiert die Umbruchphase von
8 NR. 1/ mit ihrem Ende der alten Ordnung und dem wenig spater folgenden Ende von Reich und Kaisertum: Ja, gerade ftir die Seelsorge sollte sich die Zeiten^ wende bald als erheblicher Gewinn herausstellen, nicht zuletzt, weil die Bischofe sich nun frei von ihrer Burde als Territorial- und Reichspolitiker ganz der Sorge fur die Kirche und das Seelenheil der ihnen anvertrauten Glaubigen widmen konnten,"i3) Wer denkt da nicht an den schlichten Bauernsohn aus Velmede Franz Hengsbach, der Kardinal des Ruhrgebiets wurde. Vor der Sakularisation konnten nur Mitglieder des Hochadels Kirchenfursten werden wie Prinz Clemens August von Wittelsbach u. a. fur Koln, sicher mehr Territorialpolitiker als Seelsorger. Auch zur Einschatzung der Kloster gab es in der Zeitenwende der Sakularisation einen deutlichen Bewu tseinswandel, der sich schnell auch literarisch niederschlug. Jahrzehntelang hatte die antimonchische Kritik und Satire den Markt (iberschwemmt, dann aber eroffnete der Dichter Wilhelm Wackenroder 1797 mit den HerzensergieRungen eines kunstliebenden Klosterbruders" die deutsche Romantik. Das Bild von Monchen und Nonnen wurde nun eher verklart als verachtet. Und wenn auch im 19. Jahrhundert (Kulturkampf) und im 20. Jahrhundert (NS-Herrschaft) von Regierungsseite antimonastische Kampagnen und MaKnahmen den Orden schwere Schaden zufiigten, so blieben diese von oben gesteuerten Aktionen doch nur zeitweise wirksam. Die Orden selbst haben sich nach der Zeitenwende" um 1800 auch insgesamt in ihrer Lebensweise und Wirksamkeit bewubt so verandert, dab sie mit ihrem vergangenen Erscheinungsbild nicht verglichen werden konnen. Das hat ihr Bild im 5ffentlichen BewuRtsein gepragt. Mutter Theresa oder Edith Stein seien als leuchtende Beispiele genannt. Diesem BewuRtseinswandel, von dem sich die Klosterfeindlichkeit der Sakularisationsepoche wohl nichts traumen lie, kommen selbst die gegenwartigen Unterhaltungsmedien nach - womit wir zum Textbeginn zuriickgekehrt waren. Anmerkungen: 1) Harm Klueting:Fran2 Wilhelm uon Spiegel und sein Sakularisationsplan fur die Kloster des Herzogtums Westfalen in: Westf.Zeitschrift 1981/82, Bd. 131/132 S. 47^69 2' Eduard Hegel: Die katholische Kirche Deutsch lands unter dem EinfluB der Aufklarung des 18. Jhts. Opladen 1975, S. 5 ^' Harm Klueting: Die Sakularisation im Herzogtum Westfalen , Koln S. 72 "H Hans-Wolf Jager: Monchskritik und Klostersatire in der deutschen Spataufklarung, in: H. Klueting (Hg.): Katholische Aufklarung - Aufklarung im kath. Deutschland, Hamburg 1993, S ) Hegel wie Anm. 2 *^) Klueting wie Anm. 3 " Frenn Wiethoff: Kloster Grafschaft und Wilzenberg, Schmallenberg 1975, S.116. Ich danke P. Michael Hermes OSB fiir Informationen und Unterlagen zum Kloster Grafschaft s) Klueting wie Anm. 3, S. 102 " Werner Saure:Cadlia Dietz- letzte Priorin in Oelinghausen, in: Zuflucht zwischen Zeiten , Arnsberg 1994 S "" Fritz Timmermann: Maria Franziska Peters - letzte Priorin in Rumbeck, in Zuflucht wie Anm. 9, S "I Elisabeth Schumacher: Das kolnische Westfalen im Zeitalter der Aufklarung, Olpe 1967, S. 254 ff. 121 Friedrich Albert Groeteken: Die Benediktiner-Abtei Grafschaft, die Pfarrei Grafschaft und ihre Tochtergemeinde Gleidorf, 1957 S. 58 ff. 1^' Joachim Kardinal Meisner: GrulSwort in: Zuflucht wie Anm. 9, S. 5 NachguB einer historischen Glocke Eine der altesten Glocken in Westfalen - die Schweineglocke" aus Grevenbruck-Forde - wird als NachguK bald wieder erklingen. Das Original aus dem 12. Jahrhundert in der charakteristischen Bienenkorbform gehort derweil zu den wertvollen Exponaten im Westfalischen Landesmuseum in Munster. Das alte Stuck wurde 1887 von der Kirchengemeinde Forde fur 800 Mark an das damalige Provinzial-Museum verkauft, um Geld fur ein neues Gelaut zu beschaffen. Nach einer alten Sage soil die Glocke einst als Burgglocke auf der Peperburg" der reichen Edelherren von Gevore (= Forde) bei Grevenbriick gehangen haben. Jahrhunderte nach dem Zerfall der Burg haben der Sage gemab wiihlende Schweine die geborstene Glocke in einer morastigen Wiese wieder freigelegt. - Nach Ansicht mancher Historiker konnte die Glocke aber eher in der alten Forder Kapelle gehangen haben, deren Grundung in die gleiche Zeit fallt wie der GuR der Glocke. Nachdem sich der Heimat- und Verkehrsverein Grevenbruck in den vergangenen Jahren vergeblich bemiiht hatte, das alte Gelaut als Leihgabe wieder an seinen Ursprungsort zuruckzuholen, fand Robert Brill, ein Grevenbrticker Unternehmer, eine ebenso geniale wie generose Losung: er lier aus AnlaR seines SOjahrigen Firmenjubilaums im vergangenen Jahr bei der Firma Petit und Gebr. Edelbrock in Gescher kurzerhand einen originalgetreuen NachguE der Schweineglocke" anfertigen und stiftete ihn dem ruhrigen Grevenbrucker Heimatverein. Fiir mehrere Wochen konnte die 450 kg schwere Glocke in einem professionell gezimmerten Glockenstuhl in den Raumen der ortlichen Volksbank der Bevolkerung vorgestellt werden. Bald wird sie ihren Platz in einem schlichten Glockenturm vor dem schmucken Stadtmuseum in Grevenbruck finden. Franz-Josef Schutte
9 NR. 1/2002 ER fiihrt - wir gehen Die Olper Franziskanerinnen - heute - von Sr. Mediatrix Nies OSF Das Leben kann nur in der Schau nach riickwarts verstanden werden, aber in der Schau nach vorwarts gelebt werden" (Soren Kierkegaard). Was bedeutet uns diese Schau nach riickwarts? Sollen wir festhalten an dem, was hinter uns liegt? Sicher nicht, wir wiirden sonst erstarren, und wo ware dann Raum fur das Leben, das auch wieder Leben hervorbringt? Wir konnen und wir mussen manchmal zuruckschauen, um das Leben fur heute zu lernen. Und da gibt es viel zu lernen! Nicht die Asche eines Feuers soil uns beschaftigen, sondern es geht darum, die noch vorhandene Glut zu entdecken und sie wieder ans Brennen zu bringen. So blicken auch wir zuruck und fragen: Wie war die Situation des Anfangs? Was waren die Beweggrijnde, was war das Charisma und welche Spiritualitat pragte die Frauen der ersten Stunde", die in Olpe eine neue klosterliche Gemeinschaft grundeten? Und was bedeutet das fur uns heutige? Wo ist unser Platz, unsere Aufgabe? Auf welche Zeichen der Zeit haben wir heute zu antworten? Welche Antwort wiirde die Grilnderin heute geben? Was wurde sie tun? Die Griinderin Mutter Maria Theresia Bonzel Es gibt viele Berichte und Aufzeichnungen, aus denen wir heute zumindest erahnen konnen, mit wieviel Weisheit, Umsicht und Klugheit unsere Griinderin, Mutter Maria Theresia Bonzel, die Zeichen ihrer Zeit erkannte und darauf reagierte. Schon sehr friih wurde eine Biographie geschrieben, die spater uberarbeitet wurde. Und als dann 1961, auf Drangen der Schwestern und auch vieler Verehrer, der Seligsprechungsprozess von Mutter M. Theresia eroffnet wurde, an dem auch zz. wieder sehr intensiv gearbeitet wird, schrieb Pater Lothar Hardick das Buch: Er fiihrt, ich gehe". Dieser Titel war das Leitwort Mutter Theresias, das sie immer wieder zitierte und nach dem sie selber lebte. Sie war so etwas wie eine Symbolfigur des Vertrauens in Gott und seine Fuhrung. Nichts konnte sie erschuttern, da fur sie nichts geschah, ohne dass Gott da war, und sie fiihlte sich immer sicher und geborgen in seiner Hand. Diesen Glauben und dieses Vertrauen versuchte sie an die Schwestern weiterzugeben und an die Menschen, denen sie begegnete. Mutter Maria Tlieresia Bonzel GrQnderin der Franzisl<:anerinnen von der ewigen Anbetung in Olpe Das bedeutete aber nicht, daf^ sie untatig geblieben ware. Nein, mit offenen Augen und einem weiten Herzen sah und erkannte sie die Herausforderungen des ganz alltaglichen Lebens, und sie handelte oft sehr spontan und direkt, vor allem aber auch mit einem sorgenden Blick in die Zukunft. Die Anfange der Gemeinschaft und auch die weitere Geschichte waren recht bewegt und erforderten immer wieder schwerwiegende Entscheidungen. Gleich zu Anfang gab es die Notwendigkeit, sich nach einem neuen Standort des Mutterhauses umzusehen. Mit Schwester Clara Pfander, der ersten Oberin der Gemeinschaft, entschied man sich fur ein Haus in Salzkotten. Ob es nun die Entfernung war, durch die Missverstandnisse aufkamen, oder ob es wirklich grundsatzliche Meinungsverschiedenheiten gab, lasst sich heute nur noch schwer nachvollziehen. Jedenfalls wurde durch ein bischofliches Reskript am 20. Juli 1863 die in Olpe zuruckgebliebene Gruppe der Schwestern zu einer selbstandigen Ordensgemeinschaft, deren Oberin dann Schwester Maria Theresia war, und darum ist sie die Griinderin unserer Gemeinschaft. Die von ihr entworfenen Statuten wurden 1865 anerkannt, und seitdem nannte sich die junge Gemeinschaft dann Arme Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung". Es gab und gibt seitdem die Salzkottener Franziskanerinnen" und die 01per Franziskanerinnen". Beide Gemeinschaften haben sich zu groeen, internationalen Kongregationen entwickelt und konnen mit Stolz an ihre Grunderinnen denken und auf ihre Geschichte zuruckblicken. Die Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung zu Olpe Fur uns ist diese Geschichte sehr eng mit der Stadt Olpe verbunden. denn Mutter M. Theresia, am 17. September 1830 in Olpe als Aline Bonzel geboren, war hier aufgewachsen. Es waren Olper Burger, die sich dafiir einsetzten, dass nicht alle Schwestern nach Salzkotten zogen, sondern eine kleine Gruppe in Olpe zuruckblieb, die wegen der Betreuung der Kinder, bald liebevoll..waisenschwestern" genannt wurden. Nach einigen Wohnungswechseln wurde das Mutterhaus in der Nahe der Pfarrkirche gebaut und immer wieder den neuen Situationen angepasst. Heute erinnert das Alte Lyzeum" neben dem Rathaus als letztes der ehemaligen Gebaude an diese Zeit und die Pioniertat, die damals die Madchenbildung bedeutete, und an die bald hinzugetretene Krankenpflege. In den Jahren 1960 bis 1966 wurde ein neues Mutterhaus auf dem Kimickerberg geplant, gebaut und bezogen. Damit wurde ein Wunsch, den bereits Mutter M. Theresia hatte, viele Jahre spater realisiert. Der neue Erinnerungsraum" im Mutterhaus Um Geschichte nicht nur nachlesen zu konnen, sondern auch die Moglichkeit zu haben, sich bildliche Vorstellungen zu machen, Gegenstande und Schriften konkret anzuschauen und in Zusammenhang mit einer bestimmten Zeit zu bringen, haben wir im Mutterhaus im letzten Jahr, dem groben Jubilaumsjahr 2000, einen..ennnerungsraum" eingerichtet, der nicht nur den Schwestern, sondern auch unseren Gasten und alien geschichtlich Interessierten of fen steht. Mit viel Sorgfalt und Liebe haben einige Schwestern in diesen Raum alles, was ihnen wertvoll erschien, so geschickt und ansprechend angeordnet, dass jeder, der den Raum betritt, einen lebendigen Eindruck vom Leben der Schwestern in den verschie-
10 NR. 1/2002 0slermo^r^[ ny a/i^ cier ^-o/)&taairca& ^Jh. ^Setmsy and j(m/reaasy in ^ri/on^ Foto: Friedhelm Ackermann
11 10 NR. 1/2002 Kirche des Mutterhauses der Franziskanerinnen in Olpe-Biggesee denen Zeiten und Lebensraumen bekommt. Hier findet sich nicht nur das Kofferchen, mit dem Mutter M. Theresia zu den Schwestern nach Amerika reiste, sondern auch Handarbeiten und typische Gegenstande aus Brasilien, von den Philippinen und aus der Indianermission in Amerika. Sie sind vielfaltig und bunt wie das Leben selbst. Auffallend sind auch die Tafeln mit den langen Namenslisten, die um die tragenden Saulen" angeordnet sind, die mitten im Raum stehen. Bei naherem Hinsehen wird klar, dass das die Namen der verstorbenen Schwestern sind. So wichtig, wie diese Saulen fur das Gebaude sein mogen, so - oder noch sehr viel wichtiger - sind all die Schwestern, die vor uns diesen Weg gegangen sind. Die Anordnung der Namen symbolisiert also, dass die je nachfolgenden Generationen auf den vorhergehenden aufbauen und auf dieser Basis ihre Zeit gestalten. Wenn ich diesen Raum betrete, kommt mir der Gedanke: Wer sich seiner Vergangenheit bewusst ist, wird auch Zukunft haben, und ich frage mich: Welche Zukunft haben wir? Diese Frage zu beantworten ist nicht so ganz leicht, wenn ich mich nur hier in Deutschland umsehe. Seit einigen Jahren batten wir hier keinen Eintritt", und von den Frauen, die vorher kamen, haben einige auch wieder aufgegeben. Aber haben wir darum keine Zukunft? Das glaube ich nicht! Auch wir haben Zukunft. Doch wir haben noch einiges zu lernen, bis die Glut unter der Asche wieder brennt und zu einem lodernden Feuer wird. Und es ist da schon wohltuend zu sehen und zu erfahren, dass die Situation unserer Gemeinschaft auf den Philippinen und auch in Brasilien eine andere ist. Dort ist mehr von dem Feuer zu sehen, und das ist eine Ermutigung, aber auch Herausforderung ftir uns, dass wir uns nicht nur mit der Asche vergangener Zeiten beschaftigen, sondern an die Glut, die ja durchaus spiirbar ist, auch glauben. Krise als Herausforderung begreifen Nachdem am 25. November 1875 die ersten Schwestern nach Nordamerika geschickt worden waren, weil sie infolge des Kulturkampfes in Deutschland nicht mehr wirken durften, ubernahmen sie dort die gleichen Dienste wie hier. Am 6. Februar 1905 starb Mutter M. Theresia. Etwa 1500 Schwestern unterstijtzten zu dieser Zeit ihre Tatigkeit und begeisterten sich fur ihre Ideale: Gott verherrlichen und ihn anbeten, im gemeinsamen und personlichen Gebet und im Dienst am Nachsten. Heute wirken und arbeiten noch rund 600 Schwestern in Deutschland, in Nordamerika, auf den Philippinen und in Brasilien. Sie sind organisiert in der deutschen Provinz mit Sitz in Koln und den drei Pro- vinzen in Baybay auf der Insel Leyte (Philippinen), in Mishawaka (Indiana, USA) und in Colorado Springs (Colorado, USA). Es ist eine Tatsache, dass sich unsere klosterliche Lebensform in Mitteleuropa in der grof^ten Krise seit ca. 200 Jahren befindet. Wir wissen aber auch, dass Krise nicht direkt gleichbedeutend ist mit Katastrophe. Krise ist Ubergang und Entscheidung, ist also eine Herausforderung. Es wird viel daruber nachgedacht und diskutiert, was denn nun getan werden soil, damit junge Menschen auch wieder das Ordensleben als einen Entwurf ihres Lebens annehmen und wahlen konnen, dass sie sich wieder trauen, auf den eigenen inneren Ruf, die Berufung zu horen und einen alternativen Weg zu Ehe und Familie wahlen und gehen in Gemeinschaft mit anderen, gleichgesinnten Menschen. Den.,Stein der Weisen" hat bisher noch keiner gefunden - oder vielleicht doch? Sicher ist, dass wir uns heute nicht mehr uber unsere Werke und Institutionen definieren konnen und durfen. Meist ist das ja auch gar nicht mehr moglich, da wir viele unserer Einrichtungen aufgeben mussten und fiir die Zukunft ganz andere Entscheidungen notig wurden. So haben wir bereits 1996 die Maria Theresia Bonzel-Stiftung" gegrundet und in sie nahezu alle unsere Einrichtungen eingebracht, also das Kinderheim, das Franziskus-Gymnasium, das Mutter-Kind-Haus Aline" und das erste Kinderhospiz Deutschlands in Olpe, das Altenheim in Drolshagen sowie Krankenhauser und andere Einrichtungen in Westfalen und im Rheinland. Sie werden nun in einer der Stiftung gehorenden GmbH von entsprechend ausgebildetem Personal verwaltet und organisiert. Dadurch sind wir befreit worden von der wirtschaftlichen Verantwortung vor Ort. Aber haben wir darum keine Aufgabe und keine Verantwortung mehr? Zunachst einmal haben wir die Einrichtungen und Institutionen ja nicht einfach abgegeben, sondern uber die Stiftung und den Aufsichtsrat der GmbH haben wir die Moglichkeit, Fragen zu stellen, Vorschlage einzubringen und darauf zu achten, dass der Geist unserer Grijnderin, und somit christlicher Geist, die notwendigen Entscheidungen bestimmt. Es war und ist uns bis heute ein
12 NR. 1/ Anliegen, dafiir zu sorgen, class auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einer christlichen Grundeinstellung heraus den Menschen begegnen und ihren Dienst versehen. Dazu miissen naturlich Hilfen und Anregungen angeboten und vermittelt werden. Gemeinschaften des Gebetes AuEerdem glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit ist es so wichtig wie kaum zuvor, dass wir kleine oder grorere Gebetsgemeinschaften sind, die zu Oasen werden konnen fur die Menschen, die zu uns kommen - und das ist eine Moglichkeit, die vollig unabhangig vom Alter ist. Es geht um Gemeinschaften wirklich geistlichen Lebens, in denen Gott die Mitte ist und mit IHM auch immer die Menschen, die uns gerade begegnen oder die unsere Hilfe brauchen. Denn der wichtigste Mensch ist immer der, der gerade vor mir steht. Und Kontemplation ist wichtig, das heibt immer auch: die Dinge - und dazu gehoren alle Ereignisse des alltaglichen Lebens - so lange anzuschauen, bis ich begriffen und verstanden habe, was sie mir sagen wollen und was ich zu tun habe, weil ich glaube, dass Gott es mir sagen wird und dab ER mich fiihren wird, auch bei meinen manchmal spontanen Aktionen. Fiir Mutter Maria Theresia stand die eucharistische Anbetung im Mittelpunkt ihres Lebens, von dort ging sie aus und nach dort kam sie zuruck, und auch alles, was dazwischen lag, war Anbetung und Verherrlichung Gottes, war Dienst vor Gott durch den Dienst am Menschen, das war und ist ihre Spiritualitat. Berufung in die Nahe Gottes ist gleichzeitig auch Sendung zu den Menschen. So konnen wir bereits im AT nachlesen (vgl. Ex. 3; Jes. 6; Jer. 1) und auch Jesus schickt seine Junger mit seiner Botschaft zu den Menschen (z.b. Mk. 3,13 ff.). Naturlich weib ich auch um die Spannung vorgegebener" und aufgegebener" Gemeinschaft, und ich weib recht gut, mit welchen Schwierigkeiten wir uns oft auseinandersetzen mussen. Aber wenn wir schon einen alternativen Weg vorleben wollen, dann miissten wir uns auch andere MaBstabe in der Beurteilung gefallen lassen und diese als Ansporn, gerade fiir den guten Umgang mit Konflikten, annehmen. Es gibt die ideale Gemeinschaft nicht, sondern wir bleiben immer miteinander auf einem Weg. Doch es ist neben der taglichen Herausforderung auch eine Chance der personlichen und geistlichen Reifung jeder einzelnen, der wir uns gemeinsam stellen sollten und die gelebt werden muss. Aber das ist ja nicht allein eine Aufgabe der Ordenschristen, sondern es hat ja wohl grundsatzlich etwas mit unserem Menschsein zu tun. Vernetzung unseres Handelns weltweit Da wir aber zu den Menschen gesandt sind, sollten wir auch zu den Menschen hingehen und besonders dort anwesend sein, wo Menschen am Rande der Gesellschaft stehen oder wo sie Opfer unguter Machtstrukturen oder erbarmungsloser Ausbeutung geworden sind. So ist zu beobachten, dass es in Deutschland, in Amerika, auf den Philippinen und in Brasilien schon viele Aktivitaten gibt, die sich gerade um die Menschen am Rande unserer Gesellschaften bemuhen. Da geht es um die Arbeit mit und fur Obdachlose, mit Behinderten, mit Sterbenskranken in den unterschiedlichen Formen der Hospizarbeit, mit und fiir Frauen und Kinder in den weltweit Blick in die AussteUung sehr vielfaltigen Noten und Problemen, und um die Unterstiitzung der Aktionen fiir Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schopfung. Bei all diesen Aktivitaten spielt inzwischen die Vernetzung unterschiedlicher Ordensgemeinschaften auf nationaler und internationaler Ebene eine immer grower werdende Rolle. Wir erleben die unterschiedlichen Kulturen auch als Bereicherung fiir unser Leben und mochten gerade dieser Erfahrung weiten Raum geben. Die Zusammenarbeit mit Franciscans international", sicher eine der einflussreichsten NGO's (Non government organization) in New York, ist inzwischen zu einer Selbstverstandlichkeit geworden, und auf diesem Weg bekommen wir weltweite Informationen. Wir konnen auf vielfaltige Weise diese Arbeit unterstiitzen, zumindest durch ein weit gespanntes Gebetsnetz, in das auch gerade unsere alteren Schwestern mit einbezogen werden. Denn auch wir wissen, dass wir nur gemeinsam wirklich stark sind - und da sind wir stark! Immerhin gibt es weltweit etwa eine halbe Million katholische Ordensfrauen. Und zusatzlich halten wir Ausschau nach anderen Gruppierungen, Organisationen oder
13 12 SAUURLAND NR. 1/2002 Hohe Auszeichnung fiir Sauerlanddorfer Milchenbach gewinnt zum zweiten Mai Bundesgold Elleringhausen erhalt einzige Sibermedaille in NRW Milchenbach am FuRe des Rothaargebirges Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Kiinast zeichnete in Berlin die 41 schonsten Dorfer in Deutschland aus. Diese Orte batten sich beim letzten Wettbewerb Unser Dorf soil schoner werden" unter 5200 Kandidaten durchgesetzt. Insgesamt llmal gab es Bronze, llmal Silber und 19 mal Gold. Dem Lennestadter Dorf Milchenbach gelang das Kunststuck, als einzigem Bewerber zum zweiten Mal Bundesgold zu gewinnen. Die einzige Silbermedaille in NRW in diesem Wettbewerb erhielt Elleringhausen bei Winterberg. Foto: Friedhelm Ackermann Institutionen, auch uber die Konfessionsgrenzen hinaus, die ahnliche Ziele haben, so dass auch dadurch eine immer bessere und intensiv wirksame Vernetzung entstehen kann. Da gibt es wirklich Ansatze einer sehr positiven Form von Globalisierung. Mit einer VerheiBung im Herzen die Zukunft bauen Ich hoffe, dass wir immer wieder den Mut und das notige Vertrauen haben und mit Martin Luther sagen konnen: Wenn morgen die Welt unterginge, wtirde ich heute noch ein Apfelbaumchen pflanzen." So blelbe ich denn auch dabei, dass wir zwar zuruckschauen miissen, um fiir den heutigen Tag zu lernen und damit die Zukunft zu gestalten, zugleich aber miissen wir weitergehen, um der Glut unter der Asche wieder eine lodernde Flamme zu entlocken - und ich schliebe mit einigen Gedanken von Giocondo Belli aus Lateinamerika: Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus zu dem wir die Welt betreten. Aber gestalten konnen wir diese Welt, worin das Samenkorn wdchst, das wir in uns tragen. Sr. Mediatrix Nies OSF ist Generaloberin der Franziskanerinnen von der ewigen Anbctung zu Olpe. Maria- Theresia-Str 32, Olpe, wo auch die Zeitschrift Mutter Tlieresias Ruf" erscheint. Internetadresse: HYPERLINK http;// P.Kahl@
14 NR. Sauerländer 1/2002 Heimatbund 13 Die Stiftung Bruchhauser Steine von Barbel Michels Uber 850 Jahre befanden sich die Bruchhauser Steine allein in Besitz und Obhut des Gutes und Hauses Bruchhausen. Den Rittern von Bruchhausen folgten seit 1475 in direkter familiarer Linie die Freiherrn von Gaugreben, und schliel^lich ubernahm der Freiherr von Furstenberg-Gaugreben das Anwesen mit den dazugehorenden Besitzungen. Ein kulturgeschichtlich und naturwissenschaftlich so bedeutendes Areal wie das an den Bruchhauser Steinen verlangt vielseitige und ganz besondere Pflege, um es fur spatere Generationen zu erhalten. Das dafur notige umfassende Engagement wurde fur die Eigentumerfamilie zunehmend schwieriger, da die unterschiedlichsten Interessengruppen ihre Anspruche immer vehementer geltend machten. Es gab manche Meinungsverschiedenheit zwischen den Vertretern des Naturschutzes, der Bodendenkmalpflege und des Fremdenverkehrs. Besonders das alpine Klettern wurde zu einem Streitpunkt. Damit alien interessierten Biirgern der Zugang - auch im iibertragenen Sinne - zu den Besonderheiten der Bruchhauser Steine optimal ermoglicht werden kann, suchte Hubertus Freiherr von Furstenberg-Gaugreben nach einer geeigneten Losung. Das daraus resultierende zielgerichtete Zusammenwirken des Eigentumers mit zustandigen Vertretern des Landes Nordrhein-Westfalen fuhrte am 29. Januar 1992 dazu, dass eine allgemeine selbstandige, rechtsfahige und gemeinnutzige Stiftung ins Leben gerufen wurde. Sie fiihrt den Namen STIF- TUNG BRUCHHAUSER STEINE des Freiherrn von Fijrstenberg-Gaugreben und des Landes Nordrhein-Westfalen" mit Sitz in Olsberg-Bruchhausen. Prasident des Stiftungsvorstandes ist der Freiherr von Furstenberg, stellvertretender Vorsitzender ein vom Land NRW bestimmter Vertreter. AuBerdem gehoren der Landrat des Hochsauerlandkreises und der Burgermeister der Stadt Olsberg dem Vorstand an. Als beratendes Gremium stehen dem Vorstand noch ein Vertreter des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe fur die Bodendenkmalpflege zur Seite, ein Vertreter der NRW- Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, ein Vertreter der Naturschutzund Heimatverbande sowie zwei weitere Der Istenberg, Uberragt von den Bruchhauser Steinen Aufstieg zum Feldstein, dem hochstgelegenen Felsen
15 14 NR. 1/2002 Mitglieder, die der Freiherr von Furstenberg bestimmt. Der Zweck der Stiftung ist es, auch in Zukunft Schutz und Sicherung der Bruchhauser Steine und deren Zugang fiir die Offentlichkeit zu gewahrleisten, MaBnahmen zur Erhaltung des Naturschutzgebietes als Lebensraum fiir seltene Pflanzen und Tiere sowie des Bodenund Kulturdenkmals als archaologisches Reservat durchzufuhren. Aber gleichzeitig werden alle uber Jahrhunderte gewachsenen gewohnheitsrechtlichen Nutzungen und Brauche auf dem Areal anerkannt und garantiert. Dazu zahlen besonders die Sicherung und der Erhalt des Kreuzes auf dem Feldstein wie auch die traditionellen Feiern und Begegnungen der Kirchengemeinde Bruchhausen. In der Praxis geht es also urn die Unterhaltung und Pflege von Wegen, Hinweisen und sonstigen Einrichtungen, um die wissenschaftliche Erforschung und ErschlieEung des Naturschutzgebietes und Bodendenkmals, um sinnvollen Natur- und Landschaftsschutz, um die Planung und Durchfuhrung von LandschaftspflegemaBnahmen einschlierlich der forstfachlichen Waldpflege sowie um sachkundige Information zum Naturund Landschaftsschutz. Das bedingt Rucksichtnahme und Verstandnis der Besucher fiir einige Verbote. Um die dafur notige Einsicht zu erreichen, wurden inhaltsreiche, ansprechende Broschuren als Leitfaden durch das Natur- Feldstein 4- Ravenstein 4- Dxe Wallaiilagen. daticri auf die Zeit zwischen 627 und 548 vor Christi Geburt schutzgebiet und archaologische Reservat sowie zu Flora und Vegetation des Stiftungsgebietes herausgegeben, an Besucherwegen jeweils thematisch zugeordnete Schautafeln angebracht und eine hervorragend konzipierte Ausstellung im Informations- und Service Center aufgebaut. Beschreibung Von Winterberg bis an den Sudrand der Briloner Hochflache verlauft in durchschnittlich 800m Hohe ein lang gestreckter Gebirgsriicken, der in unterschiedlichster Weise von besonderer Bedeutung ist. Er bildet sowohl die Wasserscheide zwischen Rhein und Weser als sad Ost Well Nord auch die Sprachgrenze zwischen dem westfalischen und hessischen Dialekt und seit der Reformation dazu die Glaubensgrenze zwischen Katholiken und Protestanten. Dieser Hohenzug trennte die Stamme der Sachsen und Franken und war spater die naturliche Staatsgrenze zwischen Kurkoln und Waldeck. Am Nordauslaufer des Gebirgszuges erhebt sich der 727 m hohe Istenberg, dessen Waldbestand von vier markanten, bis zu 92 m hohen Felsblocken uberragt wird: den Bruchhauser Steinen. Diese sind nicht nur ein Naturdenkmal, sondern Dank der alten Wallanlagen auch ein Kulturdenkmal. Das archaologische Reservat ist ebenso Naturschutzgebiet, ^ '^^..ezjbte ^ ~~"\^'y'^ ^^^Hi^fli ^ ^ ^J ^^^h^r M-""^-^ / Die Felsblocke sind Zeugnisse untermeerischer Vulkanausbruche, im Laufe der Zeit durch WitterungseinflUsse freigelegt Hinweisschild auf dem..arctiaologischen Pfad" Frelgelegte. rekonstruierte Befestigungsanhge
16 NR. 1/ Das feucht-kuhle Klima schafft gunstige Voraussetzungen fiir zahlreiche sehene Moose, Flechten, Fame, Bdrlappgewdchse und Blutenpflanzen da die Vegetation dort ein botan!sches Kleinod internationalen Ranges darstellt". Seltene Moose und Flechten, Farne und bluhende Pflanzen, einige davon sogenannte Eiszeitrelikte", die sonst nur in der Arktis und in den Alpen oberhalb der Baumgrenze zu finden sind, gehoren zu der empfindlichen Lebensgemeinschaft an den Bruchhauser Steinen. Auch der seit 1970 in Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Wanderfalke hat sich 1989 dort wieder angesiedelt. Ein Gebiet mit so vielen Merkwurdigkeiten und Besonderheiten wird zwangslaufig zu einem gem aufgesuchten Ort. Doch Naturschutz und grobe Besucherstrome verursachen Konfliktsituationen. Nur bei entsprechenden MaRnahmen zur Erhaltung und Pflege kann man den unterschiedlichen Interessen gerecht werden. Entstehungsgeschichte - geologisch und sagenhaft Die vier machtigen Felsblocke der Bruchhauser Steine wurden im Laufe von Jahrmillionen von den sie umgebenden Tonschiefern freigelegt und uberra^ gen heute als weithin sichtbares Wahrzeichen die Baumwipfel des Istenberges. Ihre Namen: Bornstein, Goldstein, Ra- ^-,f TUanbcrfalkm-^chuii: jdjxnc_ji6jnh^ich ^j3flan5cn 'B\iic nur auf bm bcsdnlbprtcn lucgrn.nichtijbcrbie?lbsperrungi?n gchm. Fur so empfindliche Lebensgemeinschaften sind besondere SchutzmaBnahmen erforderlich venstein und Feldstein. Sie gelten als die altesten Zeugnisse untermeerischer Vulkanausbriiche aus der Vorzeit des Sauerlandes. Die zahlreichen kleineren Felsblocke, die im Wald und unterhalb des Istenberges auf den Weiden liegen, sind Absprengsel der Bruchhauser Steine, entstanden unter dem Einfluss von Wasser und Frost. Fruher fehlte den Menschen das Wissen uber die geologischen Zusammenhange, die das Gesicht der Erde pragen. Aber natiirlich regten so auffallende Felsformationen schon immer die Phantasie an. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass es auch eine sagenhafte Erklarung zur Entstehung der Bruchhauser Steine gibt. Sie lautet folgendermaben: Als der liebe Gott eines Abends nach Bruchhausen kam, gewahrte ihm keiner der Einwohner Unterkunft. Da ging er auf Willingen zu, ergriff voll Zorn machtige Felsblocke und schleuderte sie in Richtung Bruchhausen. Doch die Steine erreich- Wanderfalken galten seit 1970 in NRW als ausgestorben lied sich erstmals wieder ein Paar an den Bruchhauser Steinen nieder; seitdem wurden hier 21 Jungvogel fliigge ten den Ort nicht und blieben als, Bruchhauser Steine' liegen."2) Der Sage nach gab es urspriinglich sechs gewaltige Felsbrocken auf dem Istenberg. Im Mittelalter soil auf dem nahe gelegenen Borberg ein Nonnenkloster gestanden haben, worin auch Schwester Pia, eine Tochter des Grafen von Bruchhausen lebte. Die Ordensregeln verboten ihr, die Klostermauern zu verlassen. Dennoch nahm sie einst heimlich an der Trauung ihrer geliebten Schwester in der Burgkapelle teil, gekleidet in das Gewand einer einfachen Magd; niemand erkannte sie. Die Reue Uber ihren Ungehorsam belastete sie schwer. Sie bat Gott sogleich um Vergebung und hot ihr Leben zur Sijhne fiir ihren Frevel. Schon auf dem Nachhauseweg erfolgte die Strafe Gottes. Blitz und Donner verkiindeten nahes Unheil, und Schwester Pia kam unter den herniederstiirzenden Trummern des sechsten Felsens der Bruchhauser Steine ums Leben. 3) Boden- und Kulturdenkmal Die Bruchhauser Steine sind nicht nur ein grokartiges Naturdenkmal, sondern auch ein eindrucksvolles Kulturdenkmal, denn sie sind als Eckbastionen einer groben vorgeschichtlichen Befestigung Teil einer Wallanlage". Grabungsfunde - mogen sie auch sparlich sein - belegen, dass die vier groken Porphyrfelsen bereits vor ca Jahren von Menschen aufgesucht worden sind. Aus der Jungsteinzeit (4. Jahrtausend v. Chr.) stammt eine kleine Axt, die auf dem Istenberg gefunden wurde. Tonscherben und Bruchstucke eines bronzenen Armreifs aus der spaten Hallstatt-Zeit (6.-5. Jahrhundert v. Chr.) sind weitere Fundstucke. Die Wallburganlage gibt noch viele Ratsel auf. Vom hoch gelegenen Feldstein zieht sich liber 345 m bis zum Goldstein eine altertiimlich anmutende Befestigung. Im Abstand von 25 bis 75 m verlauft davor ein weiterer Wall, ebenfalls mit vorgelagertem Graben. Diese beiden Mauerwalle schijtzen das Areal um die Steine nach Suden und Osten. Obendrein sind die einzelnen Felsen mit kaum erkennbaren Teilbefestigungen versehen. Im Gegensatz zu mittelalterlichen Steinwallen bestehen die Befestigungen an den Bruchhauser Steinen Liberwie-
17 16 NR. 1/2002 gend aus so genannten Holz-Erde-Mauern, bei denen man hinter einer kunstlich geschaffenen, senkrechten Holzfront einen aus Steinen und Erde bestehenden Wall angeschuttet hatte".*) Die Wissenschaftler vermuten, dass die Holzfront mindestens 2,5 m, wahrscheinlich aber sogar 3,5 m hoch war. Die ganze Wallanlage stellte eine logistische Meisterleistung dar: Rund cbm Material mussten bewegt werden; bei 1,5 cbm Arbeitsleistung pro Mann und Tag waren also Mann/Tage fur den Wallbau notwendig.*' Im Laufe der Jahrhunderte brachen die Mauern zusammen und verfielen zu unscheinbaren Terrassen und Erdwallen. Zunacfist war eine sicfiere Altersbestimmung der Walle unmoglicfi. Erst die 1996/97 durchgefuhrten Grabungen der Altertumskommission fur Westfalen und des Westfalischen Museums fur Archaologie gaben naheren Aufschluss. Dank des so genannten 14C - Verfahrens, einer speziellen naturwissenschaftlichen Untersuchung von nicht verkohlten Holzresten, konnten nun Haupt- und Vorwall auf die Zeit zwischen 548 und 627 V. Chr. datiert werden. Eine sichere Datierung der Teilbefestigungen war noch nicht moglich.*) Da sich die Gesamtanlage an den Bruchhauser Steinen deutlicfi von den etwa 30 vergleichbaren westfalischien Befestigungen unterschieidet, ist laut Grabungsbericht nicht auszuschlieben, dass (sie)...weniger eine Burg, sondern eher einen zentralen Platz oder einen Versammlungsort kenntlich gemacht ha^ ben konnte".'" Der alteste schriftliche Hinweis auf die Bruchhauser Steine findet sich auf einer 1620 in Koln erschienenen Karte des Herzogtums Westfalen; Ducatus Westphaliae. Cum annexis. - Der Eintrag bezieht sich allerdings lediglich auf einen der Felsen - wohl auf den Bornstein - und lautet: Hier auf dem Gipfel des Pelsens eine kristallklare Quelle".5> In wissenschaftlichen Berichten finden die Bruchhauser Steine erst seit 200 Jahren starkere Beachtung. Unter anderem liee Furst Friedrich von Waldeck 1819 fur die Physische Privatgesellschaft in Gottingen eine Beschreibung der Felsen und ihrer Schanzen anfertigen. Darin auberte er die inzwischen widerlegte Vermu- %\'4 ;.;.^ '" P' 3ruchhausen an den Steinen nach einem Stick von 1789 tung, die Befestigung sei gemacht worden,...wo Widukind die vielen Einfalle in Westfalen getan hat".^' Zunachst interessierten sich hauptsachlich die Geologen fur die Entstehung und Zusammensetzung der Steine. Erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Walle als historisches Denkmal bedeutsam. Felsen und Walle wurden nun vermessen, Obersichtsplane angelegt und anschauliche Berichte verfasst. Nach dem 1. Weltkrieg, aber auch 1935, 1938 und 1949 wurden im Auftrag der Altertumskommission groke Untersuchungen durchgefuhrt, um Naheres uber Aufbau und Alter der kunstlichen Befestigungen zu erfahren. Aufschluss brachten aber erst die jungsten Untersuchungen 1996/97. Die Befestigung an den Bruchhauser Steinen gilt als die alteste Wallanlage des Sauerlandes, und die archaologischen Funde werden als die altesten aus einer vorgeschichtlichen Burg angesehen. Aber noch sind viele Fragen of fen. Erst wenn zugehorige Siedlungsgebiete und Grabfelder entdeckt worden sind, kann Zeichner: Guerad; Stecher: Thelott die Bedeutung der alten Wallanlagen eindeutig geklart werden. Naturschutzgebiet Die Vegetation einer Gemarkung hangt einerseits von den naturlichen Umweltfaktoren Gestein, Boden, Hohenlage und Klima ab und andererseits von der jeweiligen Nutzung durch den Menschen. Wahrend die Felskopfe der Bruchhauser Steine aus dem harten Quarz-Porphyr bestehen, bildet devonischer Schiefer das umgebende Grundgestein. Durch Verwitterung bildeten sich daraus basenarme Braunerden. Die Boden sind marig sauer und maf^ig nahrstoffreich. Als typische Bodensaureanzeiger" wachsen auf diesen kalkfreien Standorten u.a. Heidelbeere und Drahtschmiele. Ohne menschlichen Eingriff waren alle kalkarmen, nicht zu feuchten Gebiete des Sauerlandes oberhalb von 200 m u. NN mit Hainsimsen-Buchenwald aus ungleich alten Baumen bedeckt, da sich der Baumbestand naturlich verjungte. Die im Sauerland haufige Fichte wurde hier erst vor ca. 200 Jahren eingefuhrt. Im Stif-
18 NR. 1/2002 Sauerländer Heimatbund 17 tungsgebiet wird heute die so genannte Plenterwirtschaft" betrieben, eine umweltgerechte forstliche Nutzung, bei der nur einzelne Baume entfernt werden und auf grorflachigen Kahlschlag verzichtet wird. Urn eine Laubholz-Naturverjungung zu fordern, werden gezielt Nadelbaume gefallt. Das Areal hat eine Hohenlage von 580 m bis 756 m u. NN. Westliche Winde bringen durchschnittlich zwischen 1100 mm und 1300mm Jahresniederschlag. Die Durchschnittstemperatur liegt trotz relativ milder Winter aufgrund der Hohenlage nur bei 6 Grad Celsius. Das feucht-kuhle Klima schafft gunstige Lebensbedingungen fur zahlreiche Flechten und Moose sowie bestimmte Fame und Blutenpflanzen. Selbst Gewachse, die normalerweise im nordlichen Europa oder in den Alpen beheimatet sind, wie z.b. der Tannen-Barlapp, der Sprossende Barlapp oder die Quirlblattrige Weil^wurz finden an den Bruchhauser Steinen hervorragende Wachstumsbedingungen. Zu den ganz groken floralen Besonderheiten gehoren die sogenannten Eiszeitrelikte", Pflanzen, die wahrend der letzten Eiszeit im damals noch nicht vereisten, aber baumfreien Mitteleuropa weit verbreitet waren. Als sich dann vor ca Jahren das Klima wieder langsam erwarmte, wurden die Pflanzen meist durch andere Arten verdrangt. Doch an den schattigen kalten Felswanden von Bornstein und Ravenstein konnte sich z. B. die kleine weir bluhende Alpen-Gansekresse halten. Sonst findet man sie nur noch in den Alpen, im Riesengebirge und auf der Schwabischen Alb. Das Blasse Habichtskraut gait in ganz NRW als ausgestorben bzw. als verschollen, wurde vor kurzem aber auf dem Feldstein wieder entdeckt. Solche isoliert vorkommenden Pflanzen sind deshalb besonders schijtzenswert, weil sie sich aufgrund schrittweiser Veranderung des Erbgutes deutlich von den Spezies im Hauptverbreitungsgebiet unterscheiden. Wurden sie durch Wanderer oder Kletterer abgepfluckt, ausgegraben oder zertreten, ware diese Art fur immer verbren. An den Bruchhauser Steinen findet sich eine einzigartige Moos- und Flechtenfauna, deren Hauptverbreitungsge- biet z.t. in der Arktis und in den Alpen oberhalb der Baum- ^^ grenze liegt. Nicht uberall sind diese Pflanzchen beliebt; oft werden sie einfach ubersehen oder gar als storend empfunden, wenn sie in Mauerritzen, Plattenfugen oder auf Dachbedeckungen wachsen. Dabei sind Moose kleine Konstruktionswunder und Uberlebenskunstler, welche sich den unterschiedlichsten Umweltbedingungen angepasst haben". Flechten geben sogar recht genau Auskunft uber die Schadstoffbelastung der Luft.''' Moose besitzen keine Wurzeln; zur Verankerung auf dem Untergrund dienen ihnen lediglich Zellfaden mit einer wurzelahnlichen Beschaffenheit. Aufgrund ihrer Zellstruktur sind sie auf auf^eren Wassertransport angewiesen und nicht vor Wasserverlust durch Verdunstung geschutzt. Dennoch ertragen sie oft wochenlange Trockenheit und hohe Temperaturen und konnen sich nach Niederschlagen innerhalb von Minuten oder Stunden vollstandig erholen. Dank dieser Fahigkeit konnen sie uberall dort ausdauernde Bestande bilden, wo die Lebensbedingungen fur hohere Pflanzen zu ungunstig sind, wie z.b. auf den Felskopfen der Bruchhauser Steine oder auf den zahllosen kleineren Felsblocken im dunklen Schatten der Buchenkronen unterhalb der Hauptfelsen. Um das Oberleben solch empfindlicher Lebensgemeinschaften zu sichern, sind bestimmte SchutzmaBnahmen erforderlich. Schon in den 1930er Jahren unterstand das ganze Gebiet dem Naturschutz. Trotzdem zeigte sich 1989 ein starker Ruckgang der gefahrdeten Moosund Flechtenvegetation. Da sich obendrein ohne menschliche Einflussnahme - am Bornstein ein Wanderfalkenpaar niederlier (genau an dem Platz, der 1970 als letzter Horst aufgegeben worden war), wurden 1990 alle Felsen im Naturschutzgebiet fur den bislang erlaubten Klettersport gesperrt. Bis 1997 Bornstein, Nordwand. Die Blocke stehen auf dem Gipfel des Berges und schauen uber die Baumwipfeh wie Saul iiber das Volk Gottes... " (Annette uon Droste-^Hulshoff) wurden allein im Horst an den Bruchhauser Steinen 21 Jungvogel flugge. Wie der Klettersport ist auch das Befahren des Naturschutzgebietes mit Motorfahrzeugen oder Fahrradern streng verboten. Dagegen steht ein bestimmter Hang unterhalb der Steine Drachen- und Gleitschirmfliegern zur Verfugung. Fur Wanderer und Spazierganger gilt ein striktes Wegegebot, um jede Storung der Natur zu vermeiden. Touristenziel Die erlaubten Besucherwege sind thematisch angelegt. Der Waldpfad" macht mit der alten Kohlerkunst bekannt und gibt Erklarungen zu den vorhandenen Waldbaumen. Am Forstplatz" erfahrt der interessierte Besucher manches iiber die Eigenschaften und Verwendungsmoglichkeiten der verschiedenen Holzer. Der Jagersteig" informiert uber das ein-
19 18 NR. 1/2002 Das WasserschlolS am FuSie der Bruchhauser Steine heimische Wild, dessen Hege und die Jagd. Auf dem Geologischen Pfad" erlangt man Kenntnis uber die Entstehung der Felsen und die Bedeutung des Wassers, da der Weg auch zur Ewigen Quelle" unterhalb des Feldsteins fuhrt, Der Archaologische Pfad" fuhrt zu einem lehrreichen Wallschnitt mit Rekonstruktion und verstandlicher Erklarung, und auf dem Botanischen Platz" finden sich Hinweise zur Flora und Felsvegetation. Trotz mancher Verbote zum Schutz der Natur bietet eine Wanderung zu den Bruchhauser Steinen nicht nur prachtige Ausblicke, sondern auch erlebnisreiche Abwechslung und Information. Im Winter locken das nahe Skigebiet Sternrodt" und die Wiesengrundloipe, mit Anbindung iiber die Hochheide nach WiF lingen, zusatzliche Besucher ins Europagolddorf" Bruchhausen. Eine Jugendherberge existiert nicht mehr; dafiir gibt es zahlreiche Pensionen und Ferienwohnungen. Zu den beiden traditionsreichen Gasthofen gesellte sich inzwischen die Gutsschanke" in der alten Meierei der Schlossanlage. Hier kann der Gast neben einem standig wechselnden Speisenangebot auch das Bornsteiner Landbier aus der Freiherr von Fiirstenberg- Gaugreben'schen Hofbrauerei probieren und anschliebend noch das freiherrliche Kutschen- und Schlittenmuseum besuchen. Foto: Grobbel, Fredeburg Im Dorf locken Bauern- und Krautergarten, ein altes Wasserrad und das interessante Nagelschmiedemuseum. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Bruchhausen taglich bis (!) Nagel in freier Hantierung produziert und zwar Sattelzwicken, Schuh-, Schloss-, Rad-, Dielen- und Deckennagel. Fast in jedem Haus war eine Schmiede, worin die besitzlosen Einwohner nahezu ganzjahrig, die Bauern wahrend der Wintermonate, wenn die Feldarbeit ruhte, arbeiteten. 20) Das pramiierte Dorf mit seinen blumengeschmuckten Fachwerkhausern und das alte romantische Wasserschloss am FuBe der Bruchhauser Steine sind eingebunden in die umgebende Landschaft, ein lohnendes Ausflugs- und Urlaubsziel. Die Hauptwanderstrecke 2 des SGV, die von Brilon nach Siegen fuhrt, bringt viele Wanderer nach Elleringhausen, Bruchhausen und zu den Steinen. Der im Jahr 2000 neu angelegte Rothaarsteig bietet einen weiteren Anreiz und fuhrt direkt zum Informations- und Service Center Bruchhauser Steine". Informations- und Service Center Um den Besuchern der Bruchhauser Steine deren Entstehung, Geschichte sowie die Belange des Naturschutzes naher zu bringen, wurde 1997 unterhalb der Steine ein Informations- und Service Center eroffnet. In dem eigens fur diese Aufgabenstellung konzipierten Gebaude wird in didaktisch wie gestalterisch uberzeugender Weise liber Geologie, Archaologie. Fauna und Flora an den Felsen informiert. Damit soil das notige Verstandnis fur die Einschrankungen durch den Natur- und Landschaftsschutz geweckt werden. Die Zufahrt zum Info-Center erfolgt iiber eine PrivatstraBe mit Parkplatzen. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Wer allerdings die Anlagen der Bruchhauser Steine selbst oder mit dem Auto weiter bis zum Naturschutzgebiet fahren mochte, entrichtet eine Parkplatz- und Besuchergebuhr. Das Info-Center ist taglich geoffnet, je nach Saison zwischen 10 und 18 Uhr. Die Besucher konnen dort auch einen Imbiss einnehmen und sich in aller Ruhe nach einem geeigneten Mitbringsel umsehen, von kunsthandwerklich gefertigten Holz- und Tonarbeiten uber Brennmaterial aus dem Gaugreben'schen Wald bis zu Ansichtskarten, Bildern und themenbezogener Spezialliteratur. Die Stiftung Bruchhauser Steine 1992 wurde die Stiftung im guten, einvernehmlichen Zusammenwirken zwischen privatem und offentlichem Stifter gegrundet. Heute blicken die Initiatoren zufrieden auf das bisher Erreichte zuriick und schauen hoffnungsvoll in die Zukunft. Auf einer Bronzetafel am Feldstein, die an den Stiftungstag und seine historischen Bezuge erinnert, lautet der passende Schlusssatz: Die historischen Leistungen sollen in der gemeinsamen Stiftung ihre zukunftsorientierte und gesicherte Fortsetzung finden". 21 Sauermann, D. in Zusammenarbeit mit Greilich, S.: Sagenhafte Statten - Ein Begieiter durch die Sagenwelt Westfalens, S.140, Munster 1993 '" Groeteken, A. : Sagen des Sauerlandes, S. 71 ff., Dortmund 1921 ^1 Bericht der Grabungskommission u. 1996/97 a s. Anm. 1, S.15 5)s. Anm. 1,S.16 <>) Tacitus in Kaminski, H. : Die Gotter des Landes Vestfalen, Der Wormbacher Tierkreis - Schlussel zur Keltisch - Germanischen Kultstatte, S. 8, Fredeburg 1988 ') Grundmann, M. / Liinterbusch, Ch. : Botanischer Fuhrer zu den Brucl^hauser Steinen - Ein Leitfaden zur Flora und Vegetation des Stiftungsgebietes im gleichnamigen Naturschutzgebiet Bruchhauser Steine, S. 13 ^"1 u. Droste - Padberg, Die statistischen Verhaltnisse des Kreises Brilon, 1865, S. 134 in : Homberg, A, : Siedlungsgeschichte des oberen Sauerlandes, S. 113, Munster 1938
20 NR. 1/ ^ ^ Foto: l-'r^ ^-/~l Friedhelm Pi-iionnotm Ackermann
21 20 NR. 1/2002 Eine Raritat im kurkolnischen Westfalen Heimatverein Ruthen erneuerte historisches Caravaca-Kreuz mit zeitgemaber Sinngebung von Friedhelm Sommer Kontinuitat des Ungewohnlichen Im Oktober 2001 nahm der Ruthener Pfarrer Klemens Becker in Anwesenheit seines protestantischen Amtsbruders Bernd Vorderwisch (Ruthen), des Soester Kreisheimatpflegers Dr. Wolfgang Maron und zahlreicher Ruthener Burger die Einsegnung eines aurergewohnlichen Flurkreuzes vor. Der Ruthener Heimatverein e.v. hatte unter Federfiihrung seines Vorsitzenden Hermann Kramer das durch die Witterung anfallig gewordene Vorgangerkreuz mit Unterstutzung der Stadt Ruthen (Lieferung der Eichenbalken) durch eine originalgetreue Nachfolgekonstruktion ersetzt. Damit wurde in der Ruthener Feldflur Am huilternen Kruiz" eine ortliche Wegekreuz-Tradition fortgesetzt, die mittlerweile wohl eine Raritat in Westfalen darstellt. Bereits 1963 lieb die Stadt Ruthen auf Initiative des damaligen Heimatvereins an der StraBe zwischen Ruthen und Hemmern, -t-s/c,! <«-.* 'f\ f^yl' >- \ > 1 I i <^ *' «* S-, tj^i-l^ I/-7 h6 ^ Skizze und Mallangaben des Landschreibers Johannes Wordehoff von 1650 ' Stadtarchiv Rutlien Besondere Kennzeichen: extravagante Monumentalitdt, doppelte Querbalken und die Leidenswerkzeuge Christi am sudlichen Abhang des Haarstrangs, ein scheinbar iiberdimensionales holzernes Wegekreuz errichten, das an eben dieser Stelle ein dort seit alter Zeit bis dato bestehendes, mittlerweile aber stark verfallenes Feldkreuz ersetzte. Dieses sich in GroBe, Format und Bestiickung von den zahlreichen, allgemein bekannten Flurkreuzen unterscheidende religiose Monument gab den meisten der vorbeikommenden Betrachtern allerdings stets einige Deutungsratsel auf. Der Zweck: Element kurkolnischer Rekatholisierung Am 11. Juli 1650 erhielt die Stadt Ruthen in ihrer Eigenschaft als Vorort des Ruthener Quartiers" im Herzogtum Westfalen uber den Landdrosten Dietrich von Landsberg einen Erlass des Kolner Kurfursten Ferdinand von Baiern, wonach der Landesherr ahnbefohlen, alien und jeden pastoren oder kirchenmeistern dieses fiirstenthumbs Westvalen anzufiigen, das dieselbe uberall vor stetten, flecken, dorfferen undt ihm felde, sonderlich an dennen ortern, da bei zeiten der processionen die stationes gehalten werden, auf guter und andachtiger intention und meinung dem Allmechtigen und seinem heiligen creutz zu ehren formam crucis Cavarravacanae [richtig: Caravacanae - damals wie heute wohl ein westf. Zungenbrecher"!], wie beigefugter abrie davon Ruthener Volksblatt nachrichtung gibt, aus holtz verfertiget. auffrichten. die vorhin gewesene und zerfallene wieder restauriren laren, die kosten aus den kirchen gefellen, gemeiner beisteuren oder sonsten aus andern gemeinen mittelen nehmen sollen, maben die felder, da dergleichen creutzer zu finden, von blix [=Blitz] und donnerschlagen mehrers verschonet und davon umbeschadigt bleiben sollen." Neben den kirchlichen Amtspersonen wurden auch die Richter, Burgermeister und Ortsvorsteher zur genauen Befolgung des kurfiirstlichen Willens angehalten. dessen korrekte Ausfiihrung der Landesherr bei seinen bevorstehenden Durchreisen demnachst selbst in Augenschein nehmen wollte. Eine genaue Skizze der gewiinschten Kreuzform mit den vorgeschriebenen MaBen hatte der aus Ruthen stammende Landschreiber Johannes Wordehoff seiner Ausfertigung des kurfurstlichen Erlasses fur die Vaterstadt und andere Adressaten vorsorglich beigefugt. Die damit verbundenen Absichten des Kurfursten sind sicherlich im Zusammenhang mit seinen weiteren Bemuhungen zur Rekatholisierung (Klostergrundungen, Liturgiereformen etc.) in seinen Territorien nach den religissen Wirrnissen des 30-jahrigen Krieges zu werten. Name u. Form: Die Begegnung von Christentum u. Islam Dieses sogen. Caravaca-Kreuz, spater in den Ruthener Archivakten auch als
22 NR. 1/ spanisches" bzw. italienisches" Kreuz oder mundartlich-schlicht als hulternes kruitz" bezeichnet, fuhrte seine besondere Form (Kreuzstamm mit zwei Querbalken) und Bezeichnung auf ein goldenes, doppelbalkiges Partikelkreuz in der im Siidosten Spaniens gelegenen Stadt Caravaca zuruck. Der Legende nach wurde dieses seit dem Fruhmittelalter auch als Patriarchenkreuz" bezeichnete Glaubenssignum 1232 durch Engel aus seiner Stammheimat Jerusalem in die Stadt Caravaca anlaklich der dortigen Taufe eines maurischen Emirs uberfuhrt und in der Folgezeit als wundertatig verehrt. Der obere, kurzere Querbalken dieses also aus dem christlichen Orient stammenden Kreuzes soil sich angeblich ikonographisch von der bekannten Inschrifttafel am Kreuz Christi herieiten. Seit 1934 gilt das originale Caravaca- Kreuz als verschollen. Bischofswille - Volkesstimmung Der erwahnte Erlass des Kolner Kurfiirsten scheint allerdings in der Stadt Riithen zunachst kaum gefruchtet zu haben, sicherlich weniger beeinflusst durch den baldigen Tod des Landesherrn auf dem Schloss Arnsberg am 13. September 1650 als wohl mehr durch die aufwendige Herstellung dieser Kreuze, die einen Holzstamm von 1 FuB Breite, 18 FuB Lange und adequate Querbalken von 6 1/4 FuB bzw. 5 FuB erforderten. Zudem sollten mit solchen Holzmonumenten die zahlreich vorhandenen Prozessionsstationen in der Feldmark ausgestattet werden. Dies war wohl auch fur eine waldreiche Stadt wie Ruthen ein durchaus kostspieliges und unwillkommenes Unterfangen in einer Zeit, die mit den direkten Kriegsauswirkungen (Truppeneinquartierungen bis 1654, grobe Stadtverschuldung, Verarmung der Bevolkerung, zerstorte u. beschadigte Bausubstanz usw.) immer noch schwer belastet war! So melden erst die Riithener Stadtrechnungen von 1659 u die Fertigstellung von 9 solcher Kreuze auf unseren feldgrentzen" werden sie in den Quellen als italienische creutze", 1683 als hagelkreutze" bezeichnet. Die vielfaltig-ornamentale Gestaltungsfreude und detailreiche Darstellungsliebe der Barockzeit, verbunden mit einem besonderen volksreligiosen Deutungswillen, versah diese Kreuze, von denen in den Jahren nach 1650 wohl einige Hundert Vor einem barockzeitlichen Kulturgut mit modemer Sinngebung: Heimatuerein Ruthen, ortliche CeistUchkeit u. Kreisheimatpfleger Dr. Wolfgang Maron (2. v.r.j bei der Einweihung Ruthener Volksblatt im kurkolnischen Westfalen entstanden, im Sinne einer dadurch noch verstarkten Gehaltssymbolik auch im Ruthener Bereich zusatzlich mit den nachgebildeten Leidenswerkzeugen Christi (Dornenkrone, Lanzen, Ruten) und als Zeichen obrigkeitlicher Konformitat mit dem Stadtwappen. Primar verordnet als glaubensstarke Beschirmung vor Unwetter, musste ihr auffalliges Erscheinungsbild zugleich aber auch als bewusste religiose Propaganda" gegen alle andersglaubigen Richtungen verstanden werden. Die doch wohl dem Volk schlieblich zu fremdartig anmutenden holzernen Caravaca-Kreuze selbst aber haben sich nicht lange an den Wegen und Feldern in Westfalen gehalten. Veranderungen des religiosen Lebens und seiner Brauche, die starke Witterungsanfalligkeit aufgrund ihrer besonderen technischen Konstruktion und damit nicht zuletzt der hohe Aufwand fur ihre Erneuerung lieben sie nach und nach im Erscheinungsbild der heimischen Landschaft verschwinden. Schon bald wurden die
23 22 NR. 1/2002 machtigen Doppelkreuze als Prozessionsstationen durch steinerne Bildstocke ersetzt, die den individuellen Gestaltungsabsichten barocker Kunstler von Material und Flache her eher entgegen kamen und zudem eine langere Lebensdauer versprachen. Monument der Barockzeit mit modernem Gehalt Urn so hoher ist die vom Heimatverein RiJthen mit viel Muiien durchgefuhrte WiederaufbaumaKnahme des wohl letzten in Westfalen noch vorhandenen Caravaca-Kreuzes zu bewerten, stellt es doch an seinem Standort die historisch originalgetreue Bewahrung einer religionsgeschichtlichen Raritat aus dem barockzeitlichen kurkolnischen Westfalen dar. Mit seiner Rekonstruktion wurde somit ein besonderes Zeugnis und Monument des heimischen religiosen Volkslebens aus langst vergangenen Zeiten gesichert. Heute erinnert es den geschichtsbewussten Betrachter durch sachkundige wie einfuhlsame Interpretation seiner ausgefallenen Form und Darstellung und mit dem Wissen um seine Ursprunge wie auch lokale Funktion an die Herkunft des Christentums aus dem orientalischen Raum, die Zeiten der Christianisierung des Abendlandes, aber auch an seine oft blutige Expansion in den Kreuzziigen des Mittelalters, an die Reconquista in Spanien, die Inquisition und die Religionskriege in Europa. Die ausgepragte Wunderglaubigkeit und Volksfrommigkeit der Barockzeit machten es schlieblich auch zum Schutzschild fur die lebenswichtigen heimischen Feldfriichte. Mehr denn je sollte uns seine neue, zeitgemabe Botschaft wieder mit seinen Urspriingen verbinden", so Pfarrer Becker bei der Einsegnung am 19. Ok^ tober 2001,,,und uns an die notwendig tolerante Begegnung der verschiedenen Religionen und Kulturen mahnen, an ihren offenen und respektvollen Dialog und Austausch miteinander und an ihre sicher befruchtende Kooperation fur eine gottgewollte, friedliche Welt." Quellen und Literatun Stadtarchiv Ruthen, Stadt RUthen Urkunden Nr u a.a. O., Stadt Ruthen Akten A, S 8 (Stadtrechnungen von 1659, 1660, 1663 u. 1683) Wagner, Georg, Barockzeitlicher Passionskult in Westfalen, Munster 1967, S Termine Termine Termine noch bis 7. April 5. Marz Marz 1 7. Marz 10. April 6. April 13. April 21. April- 16. Juni 28. April 6. Mai 15./16. Juni 23. Juni August 7. Juli Juli 31. August I. September November 6. Oktober Oktober 27. Oktober Marz 2003 II. bis 20. Oktober Goldene Zeiten - Sauerlander Wirtschaftsburger vom Jahrhundert. Ausstellung im Sauerland-Museum Arnsberg Verein fur Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn: Vortrag Dr. Gerd Dethlefs: zerbrochen sind die Fesseln des Schlendrians! Westfalen um Lebenswelten im Wandel". Einfuhrung in die Ausstellung im Westfalischen Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte Munster. Paderborn, Theologische Fakultat Uhr Der Osterspaziergang" 10. Korbecker Osterausstellung Ostereier - Osterschmuck - Osterbrauchtum". Altes Fachwerkhaus Stockebrand Ausstellung des Kunstvereins Sudsauerland im GroBen Saal des Kreishauses Olpe: Ursula Daphi (Osnabruck) Jahreshauptversammlung des Vereins fiir Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn, in Brilon-Alme. Studienfahrt zu Eisengewerkenhausern in Brilon, 01sberg und Thiilen sowie den Kirchen in Scharfenberg und Thiilen Bundesversammlung des Sauerlander Schiitzenbundes in Ruthen Wat de Buer nich kennt " Haushalt vor 100 Jahren. Ausstellung im Sauerland-Museum Arnsberg 1200 Jahre Husten: Historischer Festzug 100 Jahre Wohnungsgenossenschft im Kreis Olpe, Sudsauerland. Festakt in der Stadthalle Olpe 54. Tag der Westfalischen Geschichte auf der Wevelsburg Werke von Carl Siebert, Paris, geb in Schmallenberg. Ausstellung im Sauerland-Museum Arnsberg Ausstellung des Kunstvereins Sudsaueriand im GroBen Saal des Kreishauses Olpe: 7. Jahresausstellung mit dem Kunstlerbund Sudsauerland Mitgliederversammlung des Sauerlander Heimatbundes in Drolshagen Kulturgut Sport - Kunstlerische Arbeiten. Ausstellung im Sauerland-Museum Arnsberg Ausstellung des Kunstvereins Siidsauerland im GroBen Saal des Kreishauses Olpe: Erna Schmidt-Caroll ( ) zerbrochen sind die Fesseln des Schlendrians". Westfalens Aufbruch in die Moderne. Ausstellung im Westfalischen Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte Munster 1200 Jahre Hiisten: Ausstellung Historischer Kutschen Die Redaktion bittet um Mitteilung weiterer Termine
24 NR. 1/ Auferstehungsfeier in St. Vincenz, Menden/Sauerland Man mufi heute schon nahezu sechzig Jahre alt sein, urn sich noch an die Gesange in der Osternacht bzw. am sehr friihen Ostermorgen in der St. Vincenzkirche zu Menden zu erinnern. Prof Dr. Gregor Vedder, sein Voter war viele Jahrzehnte -er selbst uon 1952bisl960-hauptamtlicher Organist an der Urpfarre St. Vincenz in Menden -hat versucht, den Ursprung dieser alten Gesange zur Auferstehungsfeier, die bis in das Mittelalter zuruckgehen, zu erforschen. Nirgends waren die Noten dieser Gesdnge der Engel am Grab" aufgezeichnet. Da er selbst als Bub und als MeMiener morgens mitgesungen und spater den Chor geleitet und die Gesange eingeilbt hat, ist Gregor Vedder der bests Gewdhrsmann fur diese Aufzeichnungen. Damit ein Teil des Mendener Brauchtums zumindest schriftlich der Nachwelt erhalten bleibt, werden die Aufzeichnungen hier abgedruckt. Franz Rose Ostern 1955, Auferstehungsfeier in der St. Vincenzkirche zu Menden. Eine kleine Schar von Me/Jdienern, eingekleidet in knochellange Chorr5cke, erinnert mit ihrem Gesang vor dem zum HI. Grab umgewandelten festlich geschmijckten rechten Seitenaltar an den Besuch der Grabstatte des Herrn durch die drei Marien, der Visitatio sepulchri". Die ganze Fastenzeit hindurch batten die 11 bis 14jahrigen Jungen zweimal in der Woche fur diesen Auftritt geiibt und waren vom Regens in den Vorgang, wie ihn das Evangelium berichtet, eingewiesen worden. Immer wieder muijte die vom Regens vorgesungene Melodie wiederbolt werden; es gab nicht einmal ein Notenblatt, auf dem man das Auf und Ab der Melodie verfolgen und sich so leichter einpragen konnte. Der Schreiber dieses Artikels fuhlte sich in die Jahre zuriickversetzt, in denen er selbst an der Ausgestaltung der Auferstehungsfeier teilnahm und ihm durch die jahrliche Einiibung und Wiederholung des Gesanges die Melodie ins Gedachtnis geschrieben wurde. Heute weik er auch, weshalb in den Ubungsstunden keine Notenstimmen ausgegeben wurden: Es gab keine. Immerhin war er jetzt imstande, die mundlich tradierten Weisen, so, wie sie in Menden gesungen wurden, in Noten zu fassen. Wie weit sich im Laufe der Zeit durch Unkenntnis, Nachlassigkeit und Zersingen Abweichungen von der Originalweise ergeben haben, lart sich heute nicht mehr eruieren. Nur das Alleluja nach dem Hymnus ist eindeutig wiederzuer- kennen: es ist identisch mit dem Alleluja aus der Medicea-Ausgabe des Graduate Romanum, dak das Celebrans in dreifacher Steigerung in der Karsamstagsliturgie nach der Epistel anstimmt. Bedenken im kirchlichen Bereich, die durch ubertriebene Neuerungstendenzen und allzu starres Festhalten an traditionellem Gut durch die liturgische Bewegung in der Kirche schon seit der Wende zum 19. Jahrhundert hervorgerufen waren, losten eine Stellungnahme des Vatikans aus. Durch seine Enzyklika Mediator Dei fiihrte Papst Pius XII eine Liturgiereform herbei, die auch die Erneuerung der Osternacht und der Heiligen Woche, der Karwoche, anging. Im Laufe der Geschichte hatte sich die Ostervigil (Nachtwache, Nachtgottesdienst) seit dem 10. Jahrhundert auf den nachmittag und seit dem 14. Jahrhundert auf den Vormittag des Karsamstag veriegt. Durch den kirchlichen Rundbrief Pius XII wurde die gest6rte Ordnung" durch Ruckverlegung der Vigilfeier in die Osternacht 1951 fakultativ und 1955 definitiv wiederhergestellt. In der Folgezeit wurde in Menden die Osterliturgie unterschiedlich von 19 bis 24 Uhr in der Nacht gefeiert, bis sie auf 6 Uhr am Ostermorgen festgelegt wurde. Die Visitatio sepulchri" fand in der Osteriiturgie keinen Platz mehr. Der vorllegende Text gibt den Besuch der drei Marien am Grab Christi wieder. Er ist unter der Bezeichnung Osterfeier" in die Literatur eingegangen. Die friihesten bekannten Texte der Osterfeier" sind bis in das 10. Jahrhundert belegt. Zusammen mit Textentlehnungen aus der Matutin, einem Teil des Stun- dengebetes der Kirche, bilden sie die Grundlage fiir das sich anbahnende geistliche Drama. Der Text der Dichtung der Osterfeier gehort der Gattung der Tropen an. Der Tropus ist eine charakteristische Form der Ausschmuckung als auch der Einbringung in iiberlieferte mittelalterliche liturgische Gesange (Gregorianischer Choral). Er tritt nicht als selbstandiger Gesang auf, sondern immer in Verbindung mit der Stamm-Melodie. Ein alter Ostertropus lautet Engei. Quern quaeritis in sepulchro, christicolae? Frauen: Jesum Nazarenum, o coelicolae. Engel: Non est hic; surrexit sicut praedixerat." Diesem Tropus wurde beilaufig eine Antiphone (meist biblischer Kehrvers der Gemeinde vor und nach Psalmen) beigefiigt: Ite, nuntiale fratribus meis, ut ecant in Galilaeam; ibi me videbunt." (Ubersetzung: Engel: Wen suchet ihr im Grabe, ihr Christgldubigen? Frauen: Jesus von Nazareth, ihr Himmlischen; Engel: Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Engel, Antiphone: Geht, sagt meinen Jungern, dass sie nach Galilaea gehen, dort werden sie mich finden). Im 12. Jahrhundert erfolgte eine Ausweitung des tropischen Textes. Aus der Prim (kirchliches Stundengebet) des Ostersonntags stellte sich ihm die Antiphone vorab: Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti? Quem tegere sanctum cerimus sepulchrum? (Ubersetzung: Wer walzt uns den Stein vom Grabe, der die hi. Statte schutzt.?). Zu gleich hangte man aus dem 1. Responsorium der Nocturn des Osterfestes den Textteil: Venite et videte locum, ubi positus erat Domnius, Alleluja. (Ubersetzung: Kommt und seht, wo der Herr gelegen hat) an. Den BeschluB der Osterfeier bildete das Te deum. Neben diesem Grundtyp, dessen Kennzeichen die Tropen sind, hat sich ein zweiter Grundtyp der Osterfeier ent-
25 Sauerländer 24 Heimatbund NR. 1/2002 Ergebnis. Im Pfarrarchiv sind keine Hinweise vorhanden. Dr. Gregor Vedder Ubersetzung des lateinischen Gesangtextes: Frauen: Wer wdlzt uns den Stein vom Eingang des Grabmals? Engeh Wen suchet ihr zitternden und weinenden Frauen in diesem Grabmal? Frauen: Wir suchen Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Engel: Er ist nicht hier, den ihr sucht; doch eilt und verkundet seinen Jiingern und dem Petrus, dali Jesus auferstanden ist. Kommt und seht die Stelle. wo der Herr gelegen war AUeluja Kreuztracht am Karfreitag in Menden wickelt, der bei anderer Auswahl der Zusammenstellung der Gesange auch gemeinsame Textstellen, z. B. aus den Evangelien, enthalt. Die Tropen wechselten mit auberliturgischen Formen. An die Stelle Ite, nuntiate..." trat nun der Versus des Responsoriums Maria et alia Maria-ferebant...'' namlich sed cito euntes nuntiate discipulis eius..." Die Osterfeier schliert ab mit dem Hymnus Surrexit Christus hodie..." (Siehe Mendener Auferstehungsfeier). Beide Arten der Osterfeier haben sich seit dem 12. Jahrhundert ijber Europa ausgebreitet und sich bis ins 16. Jahrhundert und teilweise darijber hinaus erhalten. Der in St. Vincenz gesungene Text deckt sich mit dem zweiten Typ der Osterfeier. Er ist einzig veroffentlicht im Mendener Anhang zum Sursum corda", dem Geang- und Gebetbuch der Erzdiozese Paderborn, das erstmalig 1874 verlegt wurde. Der Anhang wurde mit Druckgenehmigung des Erzbischoflichen Generalvikariates Paderborn vom Foto: Friediieim Ackermann 2. Marz 1914 in der Mendener Druckerei Drees und Bockelmann gefertigt und dem Sursum corda" beigebunden. Ein Vergleich der Melodie der Mendener Osterfeier mit Osterfeiern oder Osterspielen, in denen die Visitatio sepulchri" eingegangen war, in Alsfeld, Bozen, Frankfurt, Wurzburg, Tours, Salzburg..., um nur einige wahllos zu nennen, lassen keine Ubereinstimmungen in den Melodien erkennen. Einzig bei der Osterfeier im Kloster Nottuln bei Munster stimmt die Melodie der Textstelle Venite et videte locum" mit dem in Menden gesungenen Stimmverlauf uberein. In zwei Versen grenzt sich die Mendener Feier von alien anderen bekannten Osterfeiern ab: Die Frauen tragen in Menden ihren Text im Rezitationston vor. Es ist nicht erkennbar, ob hier eine Liicke in der Oberlieferung der Melodie vorliegt oder der Gesang in der heutigen Form des Vortrags tradiert ist. Forschungen, seit wann die Osterfeier in der Mendener Osterliturgie verankert ist, fuhrten bisher noch zu keinem Hymnus:Heute ist Christus zum Heil der Menschheit auferstanden. AUeluja Ihr zitternden Frauen geht nach Galilaea. AUeluja Verkundet den Jiingern, dar der Herr auferstanden ist. AUeluja Der Dreieinigkeit sei Preis in alle Ewig keit. AUeluja. ffluujttt: ^) Uls n-»ol-oetiwbi0 ttt-pi-bsm ob o-sti-o mo- nu-mra-ti? Qufm i)ua{-ri-ti6,o tre-mn-l«mu-u- «-rts,inhot tu'tnu-lo plo-ran-fcsf ^f=i 3t "Sum Tla-sa-rf-num nv.-ci-fyc-vm mmt-ri-mus. Bnotlas: _ ilonesrhic.ipm i)uaf-ri-ti9,ses a-to e-im-ctsnun- ci-a-tf dis-ti-fa-tis e-ius d^-tm, ijai-a sur-rt?- EEgE it^tsw. t-ni-te tt ut-bt-tt to-tutti,u-bij)o-si-iiis 1.5ar-it5r-itflpi-rfusl)0-li«t)n-mn'iiopni3»-IaTm-ii». 1 Wu-li-r-tts 0 frt - mu-toi in 6a-U-ta»-am ptr-ji-tc. Jite-ci-M-lis f)ikli-ti-t, ijui-a sm-tcjt-it rtjtjto-ri-ot. H.ll-nitri-no siljlu-ri-a instm-jri-ttr-naait-cu-ta. l-tjitrs: ^l- U- 111-ja. 2totrt)dunsijtmrinT)E
26 Sauerländer NR. 1/2002 Heimatbund 25 Uber alien Gipfeln ist Ruh"... aber wie lange noch? Die uralte Kulturlandschaft des Sauerlandes wird zerstort! uon Friedhelin Ackermann Die erste Zeile des oben zitierten goetheschen Gedichtes drangt sich auf, dab es mit der Ruhe iiber den Gipfeln Sauerlander Berge nicht mehr gut bestellt ist, wo doch iiberall in unserem Land Windkraftanlagen an exponierten Stellen aus dem Boden sprief^en. Keine noch so reizvolle Gegend ist vor der explositionsartigen Ausbreitung dieser Stromfabriken sicher. Die Griinde dieser Entwicklung liegen in den wirtschaftlich interessanten und hoch subventionierten Strom preisen, die den Betreibern von Wind kraftaniagen von den groben Elek Die beeindruckende unuerdnderte Landschaft bei Wilde Wiese mit Blick iiber die Berge des Lennetals bei Finnentrop troversorgungsunternehmen gezahlt werden miissen. Der politische Wille nach sogenannter,,sauberer Energie" hat in wenigen Jahren zu einem Wildwuchs von Windkraftanlagen gefuhrt. So ist die ehemals charakteristische Bordelandschaft zwischen Werl und Paderborn schon unubersehbar in weiten Teilen zerstort. Die fruher stille Gegend, seit Jahrhunderten von der Landwirtschaft gepragt, ist in wenigen Jahren zu einem Industriegebiet fiir Windkraftanlagen mutiert. Bis zum Horizont drehen sich nervos rotierende Fliigel auf spargelartigen FuEen. Bei dem gewaltsamen Eingriff in diese alte Kulturlandschaft Windkraftanhgen auf dem Haarstrang bei Ense hinter der Kulisse des FUrstenberges bei Neheim
27 26 NR. 1/2002 Massierung der Windkraftanlagen am Haarstrang Die Landschaft am Rande des Mohnesees, das fruher harmonische Zusammenspiel uon See und altem Kulturland, ist Idngst zerstort. mul? schon die Frage erlaubt sein, wie so ausgerechnet diejenigen, die Landschaftund Naturschutz als erste Prioritat ihrer politischen Ziele artikulieren, die heftigsten Protagonisten dleser Entwicklung sind und somit verantwortlich fur diese Landschaftszerstorung. In wenigen Jahren wurde so in der Borde eine Kulturlandschaft in eine Industrielandschaft umgewandelt. Die Betreiber dieser Anlagen sind ausschlierlich okonomisch motiviert. Sie interessiert offensichtlich auch nicht das MiRverhaltnis von Landschaftszerstorung und vergleicfisweiser geringer Ausbeute sogenannter sauberer Energie. Wieso die so geschaffene Energie als sauber" bezeichnet wird, ist ein Glanzstuck von Heucfielei und Tatsachenverdrehung. Das, was sich in wenigen Jahren in der Borde ereignet hat, bricht jetzt auch ijber das Kerngebiet des Sauerlandes herein. Im sogenannten Schmallenberger Sauerland hat ein Landwirt den Antrag auf die Genehmigung vonvier 140 Metern hohen Windkraftanlagen auf engstem Raum gestellt. Die Hohe von 140 Metern Qbersteigt alles, was bisher gebaut worden ist. Auf Grund der giiltigen gesetzlichen Gegebenheiten sind die
28 NR. 1/ Blick auf den EUenberg faei Schmallenberg, auj dem 4 riesige 140 Meter hohe Windkraftanlagen uor dem Rothaargebirge errichtet werden souen. SoUte dieser Plan Wirklichkeit werden, wurde das sogenannte Schmallenberger Sauerland in weiten Bereichen auf immer geschddigt. Chancen des Landwirts nicht schlecht. Aber der Widerspruch zu den Bemuhungen der Fremdenverkehrsforderung, wie zum Beispiel der Rothaarsteig u.a., ist offenkundig. Der Standort dieser gewaltigen Anlagen zwischen den uralten Dorfern Berghausen und Wormbach mit ihren einzigartigen Kulturgutern kann widerspruchlicher nicht sein. Den Initiator dieses Projektes interessiert aber nur der wirtschaftliche Effekt. Das gibt er auch of fen zu. Doch jetzt formiert sich Widerstand. So trafen sich am 14. Februar d.j. 20 Burger aus Berghausen, dem Dorf, das in diesem Fall am schwersten betroffen ware, zu einer Grlindungsinitiative gegen die Industriealisierung dieser Landschaft. Die Initiatoren Franz-Josef Voss, Manfred Schulte, Bernhard Friedhoff und Hans Georg Schauerte aus Berghausen wollen im Rahmen eines gemeinniitzigen Vereins die Protestbewegung institutionalisieren. In der Zeitschrift Heimatpflege in Westfalen" des Westfalischen Heimatbundes spricht Horst.-D. Krus in einem breit angelegten Artikel tiber die unheilige Allianz von Ignoranz, Ideologie und Profit: Windkraftanlagen sind eine oko-
29 28 NR. 1/2002 Oft zerstort erne einzige Aniage mit einer unbedeutenden Ausbeute eine Landschaft auf uiele Kilometer. logisch sinnlose, okonomisch unsinnige und unsoziale Landschaftszerstorung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. Februar d.j. sieht eine Verspargelung des Sauerlandes heraufziehen. Die Westfalenpost vom 11. Dezember beforchtet ein Windindustriegebiet im Sauerland, wenn weiter ungehindert Windkraftwerke in unserer reizvollen Mittelgebirgslandschaft installiert werden. Der Sauerlandische Gebirgsverein wendet sich in seiner Vereinszeitschrift Kreuz und Quer" an seine Mitglieder mit einer Resolution gegen den ungehinderten Bau von Windkraftanlagen. Er unterstiitzt und begrilet aile MaBnahmen des Bundes und der Lander, die geeignet sind, im Sinne der Agenda 21 Energie einzusparen oder energiesparende Handlungsweisen von Industrie, Handel und Gewerbe sowie im Privathaushalt zu fordern. Er lehnt jedocfi die einseitige For- Foto: Hans Grunwald derung von WKA's ab, weil sich bereits jetzt im zunehmenden Maiie abzeichnet, dass mit der Errichtung dieseranlagen uberwiegend nur wirtschaftliche Interessen verbinden. Die Belange des Landscfiafts- und Naturschutzes treten dabei zunehmend in den Hintergrund. Beeintracfitigungen des Landschaftsbildes und nicht akzeptierbare Verunstaltungen bedeutender Raume Wmhmimr Der Fruliling reicht den kleinen Finger im gelben Winterling Der goldene Hoffnungsstern im Schnee gibt neuen Mut Gerne nahmen wir die ganze Hand docfi Weniges ist jetzt viel Maria Grunwald unserer Kulturlandschaft sind die Folge. Der Sauerlander FJeimatbund erklart sich mit der immer starker werdenden Protestbewegung solidarisch. Dieser breite Widerstand richtet sich nicht gegen die Windkraftenergie im allgemeinen. Aber dort, wo der Preis fur Windenergie die Zerstorung der Landschaft ist. wird diese angeblich saubere Technologie ad absurdum gefiihrt. Sollte die Ausbreitung dieser Stromfabriken in unserer Region nicht gestoppt werden, wird sich bei uns die Geschichte des Ruhrgebiets im 19. Jahrhundert wiederholen. Die ungehinderte Ausbreitung der Montanindustrie ohne Rucksicht auf Landschaft- und Naturschutz mub in unseren Tagen teuer bezahlt werden. AUe Fotos: Friedhelm Ackermann
30 NR. 1/ Zur Geschichte des Warsteiner Erzbergbaus von Dr. Marieluise Scheibner-Herzog Wenn heute die Kalksteinindustrie das Bild der Stadt Warstein pragt, so denkt kaum noch jemand daran, dass die Entwicklung der Stadt auf Eisenerzgewinnung, auf Hammer- und Htittenwesen zur Herstellung von Eisenwaren beruhte. Sieht man von der nachweislich friihgeschichtlichen Eisenverhtittung im Bilsteintal ab, so sind die Alte Kaule" auf dem Rothen Land" und der Suttbrauk" oberhalb Suttrops als alteste Erzgewinnungsstatten zu betrachten. Die Bezeichnung,,auf dem Rothen Land" oder Rothland", seit altersher fiir die sudwestlich der Stadt gelegene Feldmark belegt, weist auf fruhmittelalterliche Kenntnis und Verarbeitung des roten Eisensteins bin. Wenn im Jahre 1364 ein Ritter Johann von Huckelheim und Erben zu Warstein von Graf Gottfried IV. von Arnsberg mit einem Schmiedewerk" belehnt wird, vormals den Rittern von Suttrop zugefiorig, so lasst dies auf eine bereits seit langerem bestehende Schmiede schlieeen. Die Unterhaltung eines Schmiedewerks wiederum setzte die Belieferung mit Eisenerz voraus. Das Rothe Land" ist fur die Eisengewinnung bei Warstein ausscfilaggebend gewesen. Bei der altesten Erzfundstelle nahe des Hohlenrestaurants wurde mit Beginn des 19. Jahrhunderts zwar nochmals ein bergbaulicher Versuch unter der Grubenbezeiclinung St. Christoph" und..caroline" gemacht, wo man im wesentlichen Glaskopf und Eisenglanz fand, jedoch von grol^erer Bedeutung war sicherlich das Vorkommen Alte Kaule". Hier fand man Eisenglanz und vor allem Roteisenstein, womit wahrscheinlich auch schon das Schmidtwerkslehen (Schmiedewerk) beliefert worden ist. Seit dem 14. Jafirhundert, als entlang der Bachlaufe Hammer entstanden, wurde das Erz naturlich nicht mehr allein an den Fundstellen geschmolzen, sondern mit Fuhrwerken zu den Hiitten geschafft. Etwa bis zum 17./18. Jahrhundert fand an der Alten Kaule" Tagebau statt, bis man zu Stollen und Gesenken iiberging. Von da ab gilt die Katasterbezeichnung Eisenkuhle". Da iiber den Erzbergbau Warsteins erst in Bergakten ab 1791 genaue Daten vorliegen, basieren alle fruheren Angaben auf Ausgrabungen und Erwahnungen in fremden Dokumenten (wie Arnsberg, Dortmund, Soest). Ab dem 16. Jahrhundert war der Bedarf an Eisenerz so gewachsen, dass in- zwischen die Roteisenstein-Zufuhr vom Roten Land" nicht mehr ausreichte, die Hammer an der Waster zu belief em. Zu dieser Zeit diirfte der Tageabbau auf dem Suttbrauk" (= Sudbruch, heute Suttrop) bereits stattgefunden haben. Ende des 18. Jahrhunderts wurde namlich dort schon reger Tiefbau betrieben. Ein Entwasserungsstollen fuhrte zur Lormecke. Nach einer alten Grubenkarte bestand der Suttbrauk" ursprunglich aus von der Kur-Kolnischen Bergordnung (1669) verliehenen Einzellehen, u.a. Philemon", Elisabeth", Knick", welche spater vereinigt wurden. Wahrend zu Suttrop auber Suttbruch" mit seinen Einzellehen zahlreiche andere Gruben wie Wilhelm", Rom", Hirschfeld", Josephine", Haardt", um nur einige zu nennen, gehorten, zahlten zur Alten Kaule" die Vorkommen St. Christoph", David", Siebenstern", Kunigunde", Zuversicht" und andere. Von diesen diirften die meisten als Verleihungen auf die Kur-Kolnische Bergordnung vom 4. Januar 1669 zuruckgegangen sein. - Aber auch unterhalb der Alten Kirche, im Stillenberg und im Oberhagen wurde Roteisenstein gefunden. Viele kleine Halden, verstiirzte Stollen und Schachte erinnern an die Christiansgluck"-Grube in Warstein 1945
31 30 NR. 1/2002 Vergangenheit aktiver Grubentatigkcit. - Nach den Forschungen des Bergingenieurs Herbert HERZOG in den Jahren wurden im Mittelalter bei Warstein Erze nur Unter der Bleiche" geschmolzen. Spater vermutete er noch eine kleine HUtte am Huttenteich im Rangewinkel. Es war nun einmal die Eisengewinnung und -verarbeitung, welche Warstein zu einem wichtigen Lieferanten von Eisenwaren machten. Diese bestand einmal aus der Herstellung von Sensen, Sicheln, Pflugscharen und anderem Ackergerat, aber auch im Guss zu Flatten, Of en, ja sogar Geschiitzen. Am verbreitetsten aber soil nach B, WIEMEYER das Gewerbe der Nagelschmiede gewesen sein. Hauptabnehmer war bis zum 30- jahrigen Krieg wohl die Hansestadt Soest. Doch auch spater noch diirfte die Bezeichnung Eisenmarkt" bei der Soester Allerheiligenkirmes ein wichtiger Handelsplatz fur die Warsteiner Betriebe geblieben sein. - Die Nachfrage nach Eisen und der Auftrieb des Handels hatten naturlich eine Steigerung der Erzeugung zur Folge. Die sogenannten Blas6fen" - alteste Vorganger der Hochofen - losten die mittelalterlichen Stuck6fen" ab. Mit der Erfindung des Blasofens konnte nun ein Schmelzen alien Erzes zu Roheisen erfolgen, woraus dann je nach Bedarf Stahl oder Schmiedeeisen gewonnen wurde. Erst dieser ProzeB der Roheisengewinnung fiihrte zum Entstehen der zahlreichen Hutten und Hammer im Sauer- und Siegerland. AuBer dem bereits erwahnten Schmidtwerkslehen", bestehend aus einem oder mehreren Schmiedehammern, einem Tagebau zugehorig, und der Hutte Unter der Bleiche", hatten sich (aber erst im 18./19. Jahrhundert) mehrere Hammer entlang der Waster angesiedelt. Als Blech- und Reckhammer dienten diese der Weiterverarbeitung, nicht mehr der Verhuttung. Dem Kupferhammer" ging ein friiherer Eisenhammer voraus (17. Jht.), und der Puddelhammer", gegriindet von dem Gewerker Bergenthal, erhielt diese Bezeichnung erst im 19. Jahrhundert nach einem aus England iibernommenen Verfahren. Fruhstuck im StoUen der Crube Christiansgliick Jahre Suttroper Eisenhiitte" Die Griindung der Suttroper Eisenhiitte, spater St. Wilhelmshiitte", im Jahre 1739 erfolgte sicher im wesentlichen aufgrund der Roteisensteinvorkommen im Oberhagen. Im 18./19. Jahrhundert wurde hier unter den Grubenbezeichnungen Wilhelm" und Rom" nach den Regeln alter klassischer Bergbaukunst abgebaut: die 20 bis 60 m tiefen Stollen wurden mit Hilfe einer Wasserkunst entwassert. Wasserrader, von den aufflierenden Grubenwassern angetrieben, setzten sie (bestehend aus einem Holzgestange und holzernen Rohren als Pumpsatzen) in Bewegung. Diese Wasserkunst soil als Vorbild fiir eine zweite bei Tacken Muhle" gedient haben, welche die Stadt Warstein mit Wasser versorgte. Bei der Grundung dieser Hutte am wurde ihr durch ein Privileg des Kurfiirsten Clemens August von Koln der Alleinbesitz samtlichen Eisensteins im Umkreis von zwei Meilen um die Hutte" zugesprochen. Seit 1533 gait in Westfalen die Churfurstliche Bergordnung". Waren vormals die Grafen von Arnsberg fiir die Vergabe von Dienstmannslehen zustandig, wie z.b bei dem Schmittwerkslehen, so entschieden jetzt die Erzbischofe von Koln, seit die Grafschaft Arnsberg dem Hochstift Koln unterstand. Sicher bedeutete die Grundung der Eisenhiitte fur das Schmittwerkslehen eine Konkurrenz, doch bestand das verbriefte Erblehen auf Erz, Verhuttung und Weiterverarbeitung weiterhin. Die Suttroper Eisenhiitte genob ebenfalls das Erzprivilegium" des Kurfiirsten Clemens August. Sie hatte starkes Triebwasser und die gunstige Lage des Terrassenbetriebes. Ab 1835 erhielt sie den Namen St. Wilhelmshutte". AuBer 19 Eisensteinverleihungen besar sie 2 Hochofen. Nachdem Westfalen unter preubische Oberhoheit gekommen war, erkannte das PreuBische Ministerium das Privileg des Kolner Kurfursten nicht an, da in der Urkunde die Gegenzeichnung des Domkapitels fehlte. Das PreuBische Staatsministerium verlieh 1849 jedoch der Hiitte das Eisendistriktfeld Sauerland", dessen Grenzen urkundlich genau festgelegt wurden. Sie umfassten die Gemarkungen Suttrop, Ruthen. Kallenhardt, Warstein, Meschede. teilweise auch Nuttlar und Brilon. In den Folgejahren entstand der St. Wilhelmshiitte durch die Gewerker Peter ULRICH, Brilon und Theodor ULRICH aus Bredelar, welche insgesamt etwa 21 Grubenfelder im Distrikt Sauerland" besaben, eine Konkurrenz, gegen die sie erfolglos ankampfte. Am wurde die St. Wilhelmshutte mit alien Liegenschaften, Werken und sonstigem Zubehor von den Besitzern an die Warsteiner Grubenund Huttenwerke A.G." veraubert. Mit dem Besitzerwechsel erfolgte ein letzter
32 NR. 1/ Versuch, mit den inzwischen veralterten Hochofen gegen die technisch fortschrittlicheren im Ruhrgebiet zu konkurrieren. Doch schon 1881 war eine endgiiltige Stillegung angesagt. Von den leistungsfahigen Eisenerzgruben arbeitete die Grube Suttbruch" bis Nur auf der Grube David / Christiansgluck" wurde bis 1949 noch Eisenerz gefordert. Grube «David» - Gewerkschaft «Christiansgliick» Die letzte Eisenerzgrube im Warsteiner Revier Ab 1899 wurde der bei Warstein betriebene Eisenerzbergbau auf dem roten Lande" - bis dahin zur Versorgung der Eisenschmelzen genutzt - durch Grundung der GEWERKSCHAFT vom Huttenbetrieb getrennt. Denn bei der nunmehr einsetzenden modernen Verhuttung mit Koks wurde das Eisen nicht mehr in Warstein gewonnen, vielmehr von auswarts bezogen und in den Warsteiner Hammern und Schmieden weiter verarbeitet. Die Hammerwerke erlebten eine Bliitezeit, von welcher die eisenverarbeitenden Betriebe profitierten und eine rasche Entwicklung nahmen. - Wie aber war es zu dieser Zeit um die Erzgewinnung der Grube David" bestellt, die sich trotz weitaus grorerer Vorkommen anderwarts, trotz der weiten zeit- und kostenaufwendigen Transporte mit Fuhrwerken bis zur Verladung Richtung Ruhrgebiet als konkurrenzfahig erweisen konnte, zumal das Warsteiner Erz hohe Phosphoranteile enthalt? Obwohl erst mit der Erfindung des BESSEMER-Verfahrens (1854) ein problemloses Ausscheiden des Phosphors moglich wurde, konnte die Grube David" nach 1923, als auch noch die Grube Suttbruch" ihren Betrieb einstellen musste, als letzte der vielen vom Bergamt registrierten Beleihungen uberleben. In einem ortlichen Zeitungsbericht vom uber Ein Schachtprojekt der Gewerkschaft Sauerland" wird sogar enthusiastisch von einer geplanten Modernisierung der Grubenanlage berichtet: von neuen Schachtanlagen, einem eisernen Forderturm (anstelle des holzernen), von Waschkauen fur die Bergleute, einem Zechenhaus, - ja von einem Seilbahnprojekt ab Forderungsort bis zum Erzverlad in Warstein. Seilbahn uon der Grube Christiansgliick zur Erzverladestation in Warstein Foto: Ernst Fischi Was jedoch kurz darauf tatsachlich eintrat, war ein Konkursverfahren und eine Zwangsversteigerung der Grubenfelder vor dem Amtsgericht Arnsberg im Jahr Schon ab 1932 zeigte die Deutsch-Niederlandische Handels- und Schiffahrtsgesellschaft" mit Sitz in Dusseldorf Interesse an den Grubenfeldern und erwarb diese im Zwangsversteigerungsverfahren, nunmehr als Gewerkschaft Christiansgluck". Unter den neuen Eigentumern wurden dann auch die schon vor einem Jahrzehnt geplanten Modernisierungen durchgefiihrt. Mit Beginn des zweiten Weltkrieges steigerte sich noch einmal das Interesse an der Eisenerzgewinnung. Durch den Bau einer Seilbahn (1938), die das Erz vom Forderungsort bis zum Hillenberg/Warstein transportierte, von wo aus es direkt zu den Hochofen im Ruhrgebiet geliefert wurde, endete der Transport mit Pferd und Wagen. Dass der zweite Weltkrieg sich - trotz des Interesses an mehr Eisengewinnung - hemmend auf die Forderung auswirkte, was vor allem auf die Reduzierung von Bergleuten durch Einberufung, auf beschrankte Material- und Maschinenzuweisungen zuriickzufuhren war, beweisen die rucklaufigen Zahlen. So forderte die Grube David" z.b t, 1941 nur noch t Eisenerz. Das Oberbergamt erwog eine Stillegung. Ungliicklicherweise war im Winter 1941 noch die Seibahnstation abgebrannt, was einen dreimonatigen Forderausfall zur Folge hatte. Jedoch wurde die Grube nicht stillgelegt aufgrund der hohen AnIagewerte und im Hinblick auf eine wieder zu erwartende Monatsforderung von 2000 t. Auch der kurze Schienentransportweg von nur 90 km von Warstein nach Hagen bedeutete ein Plus fur die Grube. Das auf Grube Christiansgliick/ David" geforderte sogenannte Weisseisenerz" diente zur Herstellung von THOMASSTAHL, woran die Klockner-Werke in Hagen-Haspe besonders interessiert waren. AuBerdem entstand bei dem Verfahren als Nebenprodukt die fur Diingezwecke begehrte THOMASCHLACKE. Ab Januar 1944 wurde trotz des Bedarfs die Zulieferung ins Ruhrgebiet durch den Krieg blockiert. Die Grube war gezwungen, auf Halde zu fordern. In einem Bericht des Grubenbetriebsfuhrers H. Herzog vom 05. Oktober 1945 an die Industrie- und Handelskammer Arnsberg heil^t es: Auf der Grube lagern zur Zeit rund Eisenerz, die zu 2/3 bereits bezahltes Eigentum der Klockner-Werke sind." - Obwohl mittlerweile billigere Erzlieferungen aus dem Ausland bevorzugt wurden, was bereits Ende des 19. Jahrhunderts zur Stillegung vieler Gruben- und Hammerbetriebe gefuhrt hatte, traf dieses Schicksal die Grube Christiansgluck" erst Mit ihrer Schlie- Rung endete das Kapitel Warsteiner Eisenerzbergbau" endgiiltig. Quelle: Unveroffentlichte Berichte und Aufzeichnungen von Bergingenieur Herbert Herzog. Zur Veroffentlichung zur Verfugung gestellt von Dr Marieluise Scheibner, Itzelstein 8, Brilon
33 32 NR. 1/2002 / dca/na//e/? 6er^ Foto: Friedhelm Ackermann
34 NR. 1/ En Dag imme Froejohr von Theresia Imberg, Niedersfeld En Froejohrsmuaurgen briket ane. Dammerunge lieget noch iiwer Bidrg un Dal. Heag imme Gebiarge finget me noch hii un do Schnaueplecke. Tusker didn Boemen hanget Niebelfetzen. Daue Winter was harte. Schnaue un Riagenschieern hadden siek in didn lesten Dagen miet Sunnenstrohlen aweweselt. Ijet didn Bidrgen jlutt dot Schmeltewater un op didn Wiesen un Widgen sind dauepe Kumpe. Awwer nije kann me formlik dat Froejohr rueken. Do, en Ton schwebet dodr dat Rierdal. Daue Koster lutt didn Engel des Heeren. Op enner Ddnnenspitze sittet daue Drotsel un studidrt en Laued in. Saue well et bidter maken asse de Kidrkenglocken, awwer se kiimet nit do gieger ane. Nije kiimet de Sunne hinger didm Biggestdn hidr vor e kruepen. Daue Hiemel flammet rejet op. Twd Dummpapen sittet imme Hahnenpoppelkenbusk. Se kdwwelen un tidrgen siek. En Igel strijpet liinterig dodr didn Gohren. Daue Winterschlop is verbii. Haue hidt en wahnen Schmacht. Imme alien Kirschboem hanget en Mauesenkasten. En Kleiber sittet stodeg ope me Aste. Daue Strunzer druwet miet flaueten un remdnteren sinne Frogge ter Arwet ane. De Frogge bugget didn Mauesenkasten iimme. Runds iimme dat Influgloak klauwet se Schiett. Unger didm Kakollerkenbusk blogget all de Schnaueglockerlerken Se stidket idhre witten Koppe ijet didm fossigen Grass. Wamme gende lieesket, hort me, bije se dat Froejohr innelutt. Imme Rappelspringe sittet en Waterhauneken op me Kirlingstdne. Sinn witte Buaust blitzet dodr de BUske. Et wippet ropp un rinner, stortet siek int Water un sittet balle wieer op me Stdne. Dat Bad hidt siek e lohnt. Spdtnommedags tilt vamme Siiden hidr en Tropp Schlackergoese amme Hiemel. Akkerot bije ne dene flauget se Uwer Niesfelle. Miet greetem Rossewd un Geschrdgele verschwinget se hinger didm Sterenrodt. Didn Sumer Uwer biqwet se nije imme Norden. De Sunne gidht hinger didm Kahlenbidrge unger Ijet didm Schalloweken hort me ne Walduele rdepen. Lautlos striiket se dodr de Luft, stott rinner, - un de Miees hort didn Kuckuck nit mehr rdepen Et is nije all duester Asse ne EatUchte hanget daue Mond in Hennecken Aeke. WQ hdtt didn desten Froejohrs - VuUmond. Tinnen Sundag is Eastern. Diese Gedanken zum Fruhling in unserem Land sind in der plattdeutschen Sprache entstanden, die in Niedersfeld heute noch ublich ist.
35 34 NR. 1/2002 Reinhard Kohne erhalt Arbeitsstipendium des LWL Reinhard Kohne aus Meschede (Hochsauerlandkreis) erhalt in diesem Jahr das mit 3100 Euro dotierte Arbeitsstipendium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) fur westfalische, Landesforschung. Der 1934 in Plettenberg (Markischer Kreis) geborene ehemalige Leiter der Realschule Meschede erhalt das Stipendium aufgrund seiner besonderen Verdienste um die westfalische Landeskunde.,, Reinhard Kohne ist es mit seinen Arbeiten gelungen, der Regionalforschung bei historisch-geographisch ausgerichteten Fragestellungen wertvolle neue Impulse zu geben", urteilt der Rat fur Westfalische Landeskunde, der Kohne fiir das Arbeitsstipendium vorgeschlagen hat. Seit vielen Jahren sucht das Mitglied des Sauerlander Heimatbundes nach Spuren, die prahistorische Menschen im Sauerland hinterlassen haben. Dabei entdeckte er 134 bedeutende Fundplatze zu denen Ackerterrassen ebenso gehoren wie alte Stollen und Verhiittungsplatze. Kohne stier aber auch auf Relikte aus der Altsteinzeit. Damit konnten erstmals im oberen Ruhrtal unter freiem Himmel Rastplatze der Neanderthaler nachgewiesen werden, die hier Werkzeuge hergestellt und in einer offenen Tundrenlandschaft gejagt haben. Das Arbeitsstipendium, das der LWL jahrlich vergibt, ist fiir Personen gedacht, die nicht an einer Universitat tatig sind und in ihrer Freizeit Landesfor- schung betreiben. Es soil diejenigen unterstiitzen, die meist ohne den ideellen und finanziellen Ruckhalt eines Institutes wesentliche Arbeitsergebnisse erbringen. Die feierliche Verleihung des Stipendiums fand am 8. Marz 2002 im Kreishaus Meschede statt. Im Anschluss an die BegriiKung durch den Landrat des Hochsauerlandkreises, Franz-Josef Leikop, nahm der Vorsitzende der Landschaftsversammlung, Dieter Wurm, die Auszeichnung vor In meiner Doppelfunktion als Vorsitzender der Landschaftsversammlung und als Vorsitzender des Sauerlander Heimatbundes freut es mich auberordentlich, die Verleihung des Arbeitsstipendiums an den Heimatfreund und Ortsheimatpfleger der Stadt Meschede, Herrn Reinhard Kohne, vornehmen zu diirfen. Eine verdiente Anerkennung fiir das vielfaltige Engagement des Preistragers und eine besondere Auszeichnung fur das Sauerland", so Dieter Wurm, nachdem die Entscheidung uber den Stipendiaten gefallen war. Die Wurdigung der Arbeiten von Reinhard Kohne nahm der Vorsitzende der Altertumskommission, Dr. Bendix Trier, vor Zerbrochen sind die Fesseln des Schlendrians" Vor 200 Jahren - Westfalens Aufbruch in die Moderne Wir sind nicht auf der Welt, um stillzustehen und sie zu genieren, sondern um fortzuschreiten." Dieser Satz von Friedrich Harkort, dem Grunder der ersten deutschen Dampfmaschinenfabrik, ist bezeichnend fiir das beginnende Industriezeitalter. Die Zeit von 1700 bis 1830 ist gepragt von stetiger Veranderung und Fortschritt, von Umbruch und Aufbruch. So bemerkte der Dortmunder Zeitungsverleger Arnold Mallinckrodt schon 1801 zur Jahrhundertwende: Ein Jahrhundert ist an uns voriibergerauscht." Ein Buch zur groben Ausstellung in Miinster im Herbst Damit Leben und Geschehnisse jener schnellen und unbestandigen Zeit nicht In eigener Sachc! Wir erlauben uns unsere Leser und Abonennten schon jetzt darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedsbeitrage im April 2002 abgebucht werden. an uns voruberrauschen", fangt diese Epoche ein Bildband ein, den das Westfalische Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte Munster 2002 herausbringt. Er bereitet die Ausstellung Zerbrochen sind die Fesseln des Schlendrians - Westfalens Aufbruch in die Moderne" vor, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vom 27. Oktober 2002 bis zum 16. Marz 2003 in seinem Landesmuseum zeigt. Auf mehr als 300 Seiten beschaftigt sich das Buch vor allem mit den Menschen der Epoche. 400 meist farbige Abbildungen dokumentieren ihren Weg in die Moderne. Besorgnis, Angste, aber auch Euphorie sind die bestimmenden Reaktionen auf die Veranderungen einer von Standeskultur bestimmten Lebenswelt. Schwerpunktthema des Buches ist, ebenso wie Mittelpunkt der Ausstellung, der Lebens- und Mentalitatenwandel zwischen 1700 und Ob nun technische Revolutionen, politische Reformen oder die neue biirgerliche Kultur - der Bildband greift die wichtigsten Themen der Ausstellung auf und erganzt sie durch eine Zusammenstellung neuerer Arbeiten und Forschungsansatze. LWL/PI. Ab Februar 2002 ist der Bildband zu einem Preis von 57,- Marl^/29,- Euro im Buchhandel erhaltlich. Informationen zu Ausstellung und Publikation gibt es unter der Telefonnummer 02 51/ Auch online ist die Bestellung unter moglich. Westfalisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte MUnster (Hrsg.):Zerbrochen sind die Fesseln des Schlendrians. Westfalens Aufbruch in die Moderne, 300 Seiten, 400 meist farbige Abbildungen. Verlag Kettler, Bonen ,- Euro.
36 NR. 1/ Zentrum fur landliche Entwicklung Kontaktborse fiir Informationsvermittlung und Anlaufstelle fiir den Erfahrungsaustausch im landlichen Raum Vor kurzem trat das Zentrum fur landliche Entwicklung (ZeLE) zum ersten mal in unserer Region Hochsauerlandkreis/Kreis Soest an die Offentlichkeit. Das Zentrum versteht sich als Kontaktborse fur Informationsvermittlung und Anlaufstelle fur den Erfahrungsaustauscfi im landlichen Raum. Dr. Michael Schaloske, der Leiter des ZeLE, hatte zur Auftaktveranstaltung alle, die im Ehrenamt oder im Beruf zur Dorfentwicklung beitragen" in Osthofs Deele nach Welver- Recklingsen eingeladen. In gepflegt rustikalem Ambiente konnten die ca. 80 Teilnehmer der Veranstaltung dort sogleich einen guten Eindruck davon gewinnen, wie sich im Einzelfall dorfliche Strukturveranderungen erfolgreich durchfuhren lassen. Familie Osthof-Dahlhoff hat mit Mut und Gespur fur eine Marktlucke die richtige Entscheidung zur weiteren Nutzung ihres unter Denkmalschutz stehenden Rinderstalles getroffen. Vor drei Jahren wurde dieser in eine Deele fur Feste und Feiern umgebaut. Auch als Tagungsraum ist die Deele geeignet, in der das Fachwerk aus altem Eichenholz und die weiii getunchten Deckenbogen die Kunstfertigkeit und die Schonheiten vergangener baucrlicher Architektur offenbaren. Voll ausgebucht ist der Terminkalender von Osthofs Deele. Das bedeutet ein gutes Zubrot fur die Familie, die ihren Hot im ubrigen als landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb weiterfuhrt. Zwei Teilzeitarbeitskrafte unterstutzen die Landwirtsfamilie bei der Bewirtung der Gaste, die auf Wunsch auch die lukullischen Genusse der deftigen Hausmannskuche kosten konnen. Heinz Diisenberg berichtet Osthofs Deele - neue Nutzung im alien Ambiente Alles in allem also eine gelungene Veranderung einer am Dorfrand gelegenen bauerlichen Hofstelle, bei der mit tatkraftiger Unterstutzung des Amtes fur Agrarordnung Soest ursprungliche Probleme gelost und zum Vorteil fur die Bauernfamilie und das ganze Dorf umfunktioniert wurden. So wurde einerseits mit der Sicherung und dem Herausarbeiten der denkmalwurdigen Bauteile dem Denkmalschutz Genuge getan und andererseits dem Landwirt eine zusatzliche Einkommensquelle erschlossen. Daruberhinaus sind neue Arbeitsplatze geschaffen und Abwechslung ins dorfliche Leben gebracht worden. Den Besuchern der Veranstaltung wurde noch eine Reihe anderer positiver Beispiele erfolgreicher Dorfentwicklung nahe gebracht. Bellersen im Kreis Hoxter wurde mehrfach im Wettbwerb Unser Dorf soil schoner werden" ausgezeichnet. Es erhielt im Rahmen der Expo den Titel Dorf der Zukunft" und darf sich Tourismus-Musterdorf" nennen. Heinz Dusenberg, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins in Bellersen, berichtete den aufmerksamen Zuhorern von den Erfolgen einer aukerst aktiven Dorfgemeinschaft und den unzahligen Einzelheiten, die diese Erfolge begrunden. Neben vielen Entsiegelungs- und RenaturierungsmaRnahmen wurden alte Gebaude von Franz-Josef Rickert* (Fotos: Amt fiir Agmrordnung Soest) renoviert und teilweise anderen Nutzungsarten zugefuhrt. Dabei wurden vielfach gezielt Dorferneuerungs- und Denkmalpflegegelder eingesetzt. So konnten ein Dorf museum, eine Schnapsbrennerei, eine Topferwerkstatt und ein Kreativhof eingerichtet werden. Ein Wohnmobilhafen, ein Weg der Sinne und ein agrarhistorischer Rundweg vervollstandigen das touristische Angebot Bellersens. Dies alles, so machte Heinz Dusenberg deutlich, gedeiht erfolgreich in einem Bundnis fiirs Dorf, in dem sich viele engagierte Burger zusammenfinden. Der aufmerksame Zuhorer konnte aber auch heraushoren, dass solch segensreiche dorfliche Entwicklungsprozesse in der Regel aus der Initiative einzelner engagierter Personlichkeiten hervorgehen. Sind die Prozesse erst in Gang, entstehen aus ihnen oft neue Ideen fiir weitere Entwicklungen, die aber immer wieder des Antriebs und der Koordination durch die unermudlichen Initiatoren bediirfen. Als niedersachsiches Dorfentwicklungsprojekt mit Vorbildcharakter w.njrde das Modell Dorf-Region Lintelner Geest" vorgestellt. Vor zehn Jahren haben sich in ihm fiinf Ortschaften der aus siebzehn Ortsteilen bestehenden Gemeinde Kirchlinteln zusammengefunden, um den Prozess des Dorfersterbens umzu-
37 36 NR. 1/2002 Projekte, deren Verwirklichung jungen Familien das Ansiedeln im Dorf wieder attraktiv machen. Insbesondere die Rettung des nicht mehr genutzten Bahnhofs vor dem Verfall und sein beispielhaft gelungener Umbau in einen Kindergarten vervollstandigte das Bild von einer positiven Dorfentwicklung, Besichtigung der Landbdckerei Biicker kehren. Mit einer Reihe dorfiibergreifender Projekte wurde die dorfliche Strukur gestarkt und den Einwohnern das Leben in den kleinen Ortschaften lebenswerter gemacht. Heute bietet ein Nachbarschaftsladen Gelegenheit zum Einkauf im Dorf. Im selben Gebaude ist auch die Filiale der ortlichen Genossenschaftsbank untergebracht. Postalische Service-Leistungen des Laden-Personals komplettieren das ortsnahe Angebot. FOr die direkte Nahversorgung mit bauerlichen Produkten wurde ein Belieferungssystem (ABC-Kistensystem) aufgebaut, das hervorragend floriert. Eine privat gefuhrte Lohnmosterei verarbeitet ortsnah das in der Lintelner Geest geerntete Obst. So profitieren Erzeuger und Verbraucher gleichermaben von der eingeleiteten Entwicklung. Zum Mittelpunkt der dorf lichen Aktivitaten wurde ein gemeinsam eingerichtetes Kulturhaus, welches fiir gemeinschaftliche und private Nutzungen zur Verfiigung steht. Erfolgreiche Projekte funktionierender Dorfgemeinschaften entfalten Signalwirkung und machen die Einwohnerschaft often fur integrative Prozesse, die dann wiederum insgesamt der Dorfgemeinschaft zugute kommen. Ein mustergultiger Beweis dafur liegt in einer Betreuungsstatte fiir Behinderte, die auf zwei ehemaligen Bauernhofen in der Lintelner Geest eingerichtet werden konnten. Auf diese Weise wird die sinnvoile Nutzung dieser Gehofte gesichert. Da dort aber auch behinderte Tagesgaste zur stunden- oder tageweisen Entlastung der Angehorigen betreut werden, machen immer mehr Familien mit behinderten Angehorigen Urlaub in der Lintelner Geest. Auch zur Verwirklichung dieses erfolgreichen Dorfentwicklungsprozesses war zunachst die Initiative einzelner Personlichkeiten, die Schaffung eines Wir-Gefuhls" und die tatkraftige Unterstutzung durch die Behorden erforderlich. Klaus Karweik vom Amt fiir Agrarordnung in Verden hat diesen Prozess mit begleitet und sehr anschaulich von Erfolgen und Schwierigkeiten berichtet. Wer nach den Vortragen von Heinz Dusenberg und Klaus Karweik neugierig auf weitere gelungene Dorfentwicklungsprojekte geworden war, konnte sich nachmittags in den Ortschaften Flierich und Lenningsen, der Gemeinde Bonen, im Kreis Unna, davon ijberzeugen lassen, dass Dorfgemeinschaften ihre Dorfer auch ohne die Zielrichtung Tourismusforderung lebens- und liebenswerter gestalten konnen. Ortsvorsteher Heinz Schlockermann verwies bei seiner humorvoll und anschaulich gehaltenen Fuhrung voll Stolz auf die Geschichte dieser Orte und viele Der Besuch von..buckers Backhaus" in Benninghausen, Kreis Soest, bildete den Abschluss eines informativen Tages fur die ehrenamtlichen und professionellen Dorfentwicklungs-Forderer. Eine Bauernfamilie mit den typischen Problemen der Hofnachfolge und die Liaison der Bauerntochter mit einem Backer bildeten beste Voraussetzungen fur eine wirtschaftlich stabile und attraktive Neuorientierung einer bauerlichen Hofstelle. Else und Josef Mackenberg standen vor der Frage, wie ihr Hof in Zukunft weiter bewirtschaftet werden wurde. als ihr Schwiegersohn Reinhard Bucker die Idee hatte, in dem alien Rinderstall eine moderne Backstube mit holzbeheiztem Steinbackofen einzurichten. Seit sieben Jahren ist die Hofbackerei in Betrieb, mit einem Erfolg, auf den die Familien Mackenberg und Bucker zu recht stolz sind. Die hohe Qualitat der Backwaren aus uberwiegend hofeigenem Getreide hat sich herumgesprochen. Neben einer stabilen Stammkundschaft aus den umliegenden Orten ist die Nahe der westfalischen Bader Sassendorf und Westernkotten eine gute Voraussetzung, um auch Laufkundschaft aus anderen Regionen (teilweises sogar aus dem Ruhrgebiet) zu gewinnen. Die Wochenproduktion von etwa 800 Broten findet ohne Probleme ihre Abnehmer, Dazu kommen Kleingeback, Kuchen, Torten, Pralinen und Brotchen in groben Mengen. Zu Anfang des Jahres mubie die Backstube vergrobert werden, um der Nachfrage standhalten zu konnen. AuBerdem wurden ein Backergeselle sowie zwei Verkauferinnen eingestellt. Reinhard Bucker macht aus seiner Backkunst kein Geheimnis. Bereitwillig erklart er seinen Kunden, womit er die hohe Qualitat seiner Backwaren gewahrleistet. Auch fuhrt er in seiner Backstube Kurse z.b. zur Hefeteig- oder Pralinenherstellung durch. Vor allem die Landfrauenverbande nehmen diese Kurse gerne an. Copyright Saueriander Heimatbund
38 NR. 1/ Interessiertes Publikum bei der Auftaktveranstaltung in Recklingsen Ideenreichtum und FleiE zahlen sich haufig in weiteren Erfolgen aus. So auch bei Biickers. Ehefrau Birgit Biicker hat mit tatkraftiger Unterstiitzung ihres Vaters ihre Reit-Passion zum zweiten wirtschaftlichen Standbein gemacht: Der andere Teil des ehemaligen Rinderstalles wurde in eine Pferdepension umgebaut. Mit EUR je Stellplatz und Monat sind die Kosten gedeckt, Putter und Betreuung eingesclilossen. AuRerdem bleibt auch noch etwas fijrs Familienbudget iibrig. Die Benutzung der neu errichteten Reithalle ist im Pensionspreis inbegriffen. Reinhard Bucker bereut bereits, die Reithalle nicht den internationalen WettkampfmaBen entsprechend gebaut zu haben. Um das finanzielle Risiko iiberblicken zu konnen, hatte er sich fur etwas kleinere AusmaKe entschieden. Die Sorge um die Finanzen haben ihm seine Kunden genommen. Innerhalb weniger Wochen waren alle Boxen belegt und auch externe Reiter nutzen die Reithalle gerne zu einen Entgelt von 20-EUR je Monat. Nach einem insgesamt interessanten und informativen Tag fragt sich der sauerlandische Tagungsteilnehmer naturlich nach dem tieferen Sinn einer solchen Veranstaltung. Gibt es im Sauerland mit seinen putzsauberen und x-fach ausgezeichneten Dorfern uberhaupt Bedarf fur die vom ZeLE angebotenen Unterstutzungen? Eine Antwort gibt bereits der Einladungstext: Fur die nachhaltige Dorf- und Regionalentwicklung ist der dauernde Erfahrungs- und Informationsaustausch von grober Bedeutung. Das Wissen ist immer noch der beste Garant fur die Mobilisierung stiller Initiativen, Durch den Dialog soil das burgerschaftliche Engagement im lokalen Raum tatkraftig unterstutzt werden. Das Zentrum fur landliche Entwicklung will fur die Betroffenen, Forderer und Interessenten ein Forum zu alien Fragen der Dorfentwicklung bieten. Dabei soil der Blick uber Grenzen hinausgehen. Durch das Kennenlernen Osthofs Deele...bis auf den letzten Platz besetzt. erfolgreicher Beispiele und der Menschen, die dahinter stehen, konnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Motivation und Erfahrung fur ihre Arbeit vor Ort gewinnen." Betrachten wir also die Moglichkeiten, die das Zentrum fur landliche Entwicklung seit dem 1. Mai 2001 unseren Dorfern bietet: Der landliche Raum riickt immer mehr in den Fokus der Politik: Seit langerem hat man in Briissel, Berlin und Dusseldorf erkannt, dass die strukturellen Veranderungen der landlichen Regionen zu einem Ausbluten des Aachen Landes und damit zu erheblichen gesellschaftspolitischen Problemen fuhren konnen. Neben einer Reihe von Wettbewerben wie z.b. Unser Dorf soil schoner werden" oder gezielten Forderprogrammen gibt es nun in Nordrhein- Westfalen als neue Initiative des Umweltministeriums das Zentrum fur landliche Entwicklung. ZeLE - so die amtliche Abkiirzung, ist mit alien offiziellen Segnungen versehen. Seine Grundung wurde eigens mit einem Runderlass des Hohn-Ministeriums veroffentlicht, in dem Ziele und Aufgaben beschrieben sind. Augenfallig ist, dass es diesmal weniger darum geht, Gelder fur BaumaBnahmen oder Plaketten fur Wettbewerbssieger zu verteilen. Stattdessen werden Ziele und Aufgaben formuliert, die eher einer Moderatorenrolle gleichkommen. ZeLE soil die nachhaltige Entwicklung des landlichen Raums unterstutzen und begleiten und zwar durch Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit zu alien Fragen des landlichen Raums. ZeLE versteht sich somit als Kontaktborse fur Informationsvermittlung und als Bindeglied zwischen den im landlichen Raum aktiven gesellschaftlichen Gruppen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Stellen. Auch Vorbereitung und Unterstutzung konkreter FordermaBnahmen zur landlichen Entwicklung sind ausdrijcklich im Aufgabenkatalog aufgefiihrt. Lassen Sie uns also die Moglichkeiten, die ZeLE bietet, vorbehaltlos zum Wohl unseres schonen landlichen Raumes nutzen, indem wir die angebotenen Kontakte aufnehmen: ' Franz-Josef Rickert ist zustandig fur Regionalmanagement im Fachdienst fur Strukturforderung und Regionalentwicklung beim Hochsauerlandkreis
39 38 NR. 1/2002 Zentrum fur Idndliche Entwicklung Schwannstr Dusseldorf Telefon 02 11/ Telefax: 02 11/ zele@munlv.nrw.de Internet: weitere Auskunfte erteilen auch das fiir unsere Region zustandige Amt fiir Agrarordnung Soest Amt fiir Agrarordnung Siegen StiftstraRe 53 Postfach Soest Siegen Telefon / Telefon 02 71/ Telefax / Telefax 02 71/ Hochsauerlandkreis Regional management SteinstraBe Meschede Telefon 02 91/ Telefax 02 91/ Kreis Olpe Kdmmerei u. Wirtschaftforderung Danziger StraRe Olpe Telefon / Telefax / regiom@hochsauerlandkreis.de b-siemen@olpe.de Selbstverstandlich stehen als Ansprechpartner fur Dorfentwicklungsprojekte jederzeit auch die entsprechenden Dienststellen der Stadt- und Gemeindever-^ waltungen zur Verfugung. Jahresprogramm der Christine Koch Gesellschaft e.v. Die Christine Koch Gesellschaft e.v. - Gesellschaft zur Forderung der Literatur im Sauerland - mit Sitz in Schmallenberg legt fur das Jahr 2002 ein vielseitiges, abwechslungsreiches Programm vor. Es umfasst insgesamt 13 Veranstaltungen, die sich iiber das Sauerland verteilen und zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, nachmittags, abends oder auch den ganzen Tag iiber. Drei dieser Veranstaltungen sind vom Inhalt her retrospektiv, biographisch-literarisch: die gemeinsame Literaturfahrt am Samstag, dem , zum neuen Museum fur Westfalische Literatur im Haus Nottbeck bei Stromberg, die Vortrage und Lesungen am Samstag, dem zu Peter Paul Althaus ( ), dessen Vorfahren aus Medebach stammen, sowie am Wochenen- von Dieter Wiethoff de 14./ zum 175. Geburtstag des Assinghauser Dichters Friedrich Wilhelm Grimme ( ). Die ganz iiberwiegende Zahl der Veranstaltungen ist bewusst den Gegenwartsautoren der Region gewidmet. Moglichst viele von ihnen sollen im Jahr 2002 zu Wort kommen, sei es mit eigenen Texten, sei es mit Texten ihrer Lieblingsdichter. Mit dieser Programmaus- richtung verfolgen Vorstand und Beirat der Gesellschaft das Ziel, eine breitere Basis fiir die Literaturforderung im Sauerland zu schaffen. Bisher nicht oder weniger bekannte heimische Autoren sollen in der..kleinen Reihe" in dem neuen Band 9 vorgestellt werden, der am im iiblichen Rahmen im Golf-Cafe Deimann in Schmallenberg- Winkhausen prasentiert wird. Die Autoren der Kleinen Reihe" werden spater noch einmal lesen und zwar am Samstag, dem im Sauerlandmuseum des Hochsauerlandkreises in Arnsberg unter dem bewahrten Motto..Sauerlander Literatur stellt sich vor". Auf drei aurergewohnliche Veranstaltungen sei besonders hingewiesen: auf die Jahrestagung Samstag, den , zu dem Thema..Pferdegeschichten - Traumpferde" in dem dafur wie geschaffenen Ambiente der Warsteiner Reitsportanlage auf dem Pliickers Hoff, auf die Poetry-Schiffsfahrt mit Musik und Lesungen Samstag, den , auf dem Mohnesee und auf die Literaturreise vom , die im Anschluss an den Poetischen Fruhling Sauerland polnisch/deutsche Autorenbegegnungen" den Gegenbesuch der Sauerlander im Ermland/Masuren darstellt. Erfreulich ist es, dass Anke Velmeke fur eine Lesung in ihrem Geburtsort Olsberg gewonnen werden konnte und zwar am ; die heute in Geisenheim lebende Autorin erhielt im Jahr 2001 den Forderpreis fiir Literatur, gestiftet von der Gesellschaft zur Forderung der Westfalischen Kulturarbeit e.v. in Munster. Die im Vorjahr begonnene Reihe Saueriander Autoren lesen Weltliteratur - Grafschafter Literaturabende" wird mit Unterstutzung der Volksbank Sauerland e.g. am und am fortgesetzt. In enger Abstimmung mit der Literaturkommission fiir Westfalen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Munster ist es gelungen. fur die Literaturveranstaltungen stets kompetente Fachleute zu finden. Ober Einzelheiten des Jahresprogramms informiert ein Faltblatt, welches iiber die Geschaftsstelle der Christine Koch Gesellschaft e.v., Postfach 11 40, Schmallenberg, Tel.-Nr.: / , Fax-Nr.: / zu beziehen ist.
40 SAURRLAND NR. 1/ Kreuzwege in der Landschaft von Julia Hesse und Uta Schmitt Alljahrlich zur Fastenzeit laden in vielen Ortschaften des Sauerlandes Stationswege die Glaubigen zum Gebet ein. Kreuzwege sind Zeugnisse gelebter Volksfrommigkeit. Sie verbinden Landschaftserleben, Gehen und Meditation liber den Leidensweg Christi. Seit Generationen ist diese landschaftsbezogene Gebetsform Bestandteil des religiosen Lebens im Sauerland. Kreuzwege haben daher viel zu berichten vom Glauben der Vorfahren und ihrer Beziehung zur Landschaft, in und mit der sie lebten. Daneben filhren uns moderne Kreuzwege aktuelle Interpretationen der Passionsgeschichte vor Augen und verraten etwas uber unser heutiges Verhaltnis zur naturlichen Umgebung. Die Geschichtc der Kreuzwege Das Kreuzwegbrauchtum hat seine Wurzeln in den Wallfahrten nach Jerusalem. Berichte von Pilgern und Kreuzrittern fiihrten in Europa seit dem fruhen Mittelalter zum Nachbau von Orten wie dem Heiligen Grab als Andachtsstatten in der Landschaft. Ab dem 15. Jahrhundert wurde nach einzelnen Passionsereignissen auch der Leidensweg Christi selbst verehrt. Man schritt einen Weg ab und hielt an einzelnen Punkten inne, um der Leiden Christi zu gedenken. Die Haltepunkte waren zunachst noch nicht gekennzeichnet, so dass die Gebetswege nur aus Anfangs- und Endpunkt bestanden. Das fruheste deutsche Beispiel hierfiir ist der 1468 in Liibeck errichtete Weg vom Burgtor zum Jerusalemberg aurerhalb der Stadt. Die Weglange sollte der des historischen Leidenswegs Christi gleichen. Bald ging man dazu iiber, die Haltepunkte durch Bildstocke zu bezeichnen. Hieraus entwickelten sich die Sieben FuBfalle, ein Passionsweg mit sieben Stationen. Der erste bekannte FuBfallweg in Deutschland wurde um 1500 in Nurnberg am Weg zum Johannifriedhof errichtet. In Westfalen waren die FuEfallwege v.a. nach dem DreiKigjahrigen Krieg ( ) sehr beliebt. Sie wurden an fast alien Wallfahrtsund sonstigen Andachtsorten errichtet, im kurkolnischen Sauerland unter anderem in Scharfenberg, Obermarsberg und Olpe. Daneben gab es auch Passionswege mit anderen Stationszahlen. Mit der Betreuung der Kreuzwegandacht wurde der Franziskanerorden be- Blick auf Station XII des Kreuzwegs in Dudinghausen traut, der bereits fiir die Andachtsstatten im Heiligen Land zustandig war Aus diesem Grund durften Kreuzwege fruher nur von Oberen des Franziskanerordens eingeweiht werden. Nach der Reformation blieb die Errichtung religioser Zeichen in der Landschaft nur in katholischen Gegenden Brauch, so auch im kurkolnischen Sauerland. Im Jahre 1731 erkannte Papst Clemens XII. den Kreuzweg als kirchliche Andacht an. Hierbei legte er die Zahl der Stationen auf die heute iiblichen vierzehn fest. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts erlebte der FuEfall- und Kreuzwegbau eine Blutezeit. Aus dieser Zeit stammen auch die altesten erhaltenen Anlagen im Sauerland. Die uberwiegende Zahl der heute vorhandenen Kreuzwege wurde jedoch in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts errichtet. Zu dieser Zeit verstarkte die katholische Kirche ihre Bemuhungen um die Volksmission und setzte dazu auch die anschaulichen und bilderreichen Stationswege ein. Die bisher letzte und noch andauernde Phase Station Kreuzweg Clindfeld
41 40 NR. 1/2002 Barocke Station des FuBfallweges in Obermarsberg des Kreuzwegbaus begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Wichtig fur das Vorhandensein von Kreuzwegen in der sauerlandischen Landschaft ist die traditionell katholische Konfession des Gebiets. Entscheidend hierfur war, dass das kurkolnische Sauerland zur Zeit der Glaubensstreitigkeiten nach der Reformation zum Erzbistum Koln gehorte wurde beim Augsburger Religionsfrieden" unter anderem festgelegt, dass die noch katholischen Fiirstbistumer weiterhin katholisch bleiben sollten. Dieser Beschluss wurde im Erzbistum Koln in der Folgezeit auch durchgesetzt. Als das kurkolnische Sauerland bei der Auflosung der geistlichen Fiirstentumer im Jahre 1803 zunachst an Hessen- Darmstadt und spater an PreuBen fiel, waren die konfessionellen Verhaltnisse in der Region schon so gefestigt, dass sie sich durch die Eingliederung in protestantische Territorien nicht mehr anderten. Daher werden im ehemals kolni- schen Teil des Sauerlandes bis heute Kreuzwege und auch Fuf$fallwege errichtet. Die Vielfalt der sauerlandischen Kreuzwege Im Laufe der Jahrhunderte entstand eine groke Anzahl von Kreuzwegen, die auf vielfaltige Art und Weise gestaltet und in ihre landschaftliche Umgebung eingebunden sind. Allein in den Kreisen Hochsauerland und Olpe finden sich ca. 90 Kreuzwege, von denen im Folgenden einige Beispiele vorgestellt werden sollen. Die altesten erhaltenen Anlagen stammen aus dem Barock. Ein Beispiel hierfiir ist der Kreuzweg vom Kreuzherrenkloster Glindfeld auf einen als Kahlen" bezeichneten Berg bei Medebach. Auf dessen Kuppe erbauten die Kreuzherren im Jahre 1720 eine Kapelle zu Ehren der.,schmerzhaften Muttergottes". Im Jahre 1722 stiftete der Burgermeister von Medebach eine Heiliggrabkapelle ein wenig unterhalb der Pieta-Kapelle liel? Rudolf Lefarth, Prior von Glindfeld, zwei Kreuzwege zum Kahlen erbauen, die die letzten drei Stationen gemeinsam haben. Der eine Weg beginnt am Kloster Glindfeld, der andere bei der Stadt Medebach. Im 19. Jh. versah man den Kreuzweg von Medebach zum,.kahlen" mit neuen Bildstocken. Der Glindfelder Weg hingegen wurde seit seiner Erbauung kaum verandert. Daneben gibt es Reste barocker FuBfallwege, die nachtraglich auf vierzehn Stationen erganzt wurden. wie z. B. in Obermarsberg und Altenbiiren. Der Kreuzweg von Obermarsberg beginnt innerorts am..benediktusbogen" der Stiftskirche und fuhrt aus dem Ort hinaus zu einer Heiliggrabkapelle auf dem sog. Kalvarienberg", der niedriger als die Stadt gelegen ist. Der barocke Teil der Bildstocke stammt aus der Zeit zwischen 1683 und In Altenbiiren wurden die barocken Bildstocke zwischen 1756 und 1826 von verschiedenen Stiftern zunachst unabhangig voneinander in der Feldflur errichtet. Im Jahre 1826 wurden sie zu einem FuBfallweg auf dem Windsberg angeordnet und 1931 auf vierzehn Stationen erweitert. Von anderen barocken Passionswegen sind nur noch die letzten Stationen Kreuzweg auf dem Wilzenberg bei Grafschaft, rechts die Heiliggrabkapelle
42 NR. 1/ erhalten, die als Kapellen gestaltet wurden. Die schlichten Gebaude iiberlebten den Verfall bzw. Abriss der urspriinglichen Bildstocke und wurden spater in die neugestalteten Anlagen einbezogen. Solche barocken Kapellen finden sich an den Kreuzwegen in Bodefeld, in Hallenberg und auf dem Wilzenberg bei Grafschaft. Der bekannte Bodefelder Kreuzberg geht auf die Initiative des Pfarrers Johann Heinrich Montanus ( ) zuriick. Er liej? 1729 auf der Wahr" eine Kreuzkapelle erbauen. Im folgenden Jahr wurden Bildstocke fur Sieben Ful^falle" zur Kapelle erbaut und im Jahr darauf FuKfallreliefs sowie Inschriften von Montanus eingesetzt, die unter anderem Lehren zur Uberwindung der sieben Hauptlaster enthielten errichtete man an der Kreuzkapelle am Ende des Weges eine Grabkapelle und 1754 direkt daneben eine Kapelle der Schmerzhaften Mutter". Beide sind heute noch vorhanden. Ab 1856 erfolgte der Ausbau des Weges auf vierzefin Stationen. Der steil ansteigende Wegverlauf wurde beibehalten, die Stationen bestehen heute jedoch aus modernen Bildhauschen. In Hallenberg lieren zwischen 1725 und 1729 die dortigen Ortsseelsorger, die Bruder Johann Jakob und Johann David Morchen, aus eigenen Mitteln auf dem Urberg eine Kreuzkapelle" sowie Sieben FuBfalle" am Aufstieg dorthin erbauen. Als letzte Station der FuEfalle wurde eine Heiliggrabkapelle etwas unterhalb der Kreuzkapelle errichtet. Im Jahre 1768 erweiterte man den Weg auf vierzehn Stationen. Die heutigen Bildstocke im Stil des 19. Jh. sind vermutlich jungeren Datums. Auch auf dem Wilzenberg bei Grafschaft sind noch einzelne Kapellen eines barocken Kreuzwegs vorhanden und in einen modernen Kreuzweg integriert. Die dortige Kapelle Maria Heimsuchung" stammt von Im Jahre 1773 wurde an der Kapelle ein Kreuzweg erbaut, dessen vierzehnte Station, eine Heiliggrabkapelle, ebenfalls erhalten blieb. Von den zahlreich vorhanden Kreuzwegen aus dem 19. Jh. kann hier nur eine kleine Auswahl vorgestellt werden. Den Kreuzwegen dieser Zeit ist ei- ne Vorliebe fur historisierende Formen bei den Bildstocken und fur realitatsnahe Bilddarstellungen -meist mit zahlreichen Figuren- gemeinsam. Ein sehr farbenfrohes Beispiel fur einen Kreuzweg aus dem 19. Jh. findet sich in Niedermarsberg. Die Anlage wurde 1873 errichtet und fuhrt vom Friedhof von Niedermarsberg zum Aussichtsturm auf dem Bilstein. Der Kreuzweg in Eslohe wurde im Jahr 1885 auf dem alten Friedhof, der heutigen Kuranlage, eingeweiht versetzte man ihn auf den neuen Friedhof am Dornseifferweg, 1968 wiederum an seinen heutigen Standort zwischen Eslohe und der St. Rochus-Kapelle. In den 90er Jahren wurden die Stationen restauriert. Im 20. Jahrhundert folgte man bei der Gestaltung oft traditionellen Vorbildern, in manchen Fallen wurden neue Formen erprobt. Eine sehr abstrakte Darstellungsweise zeigt der Kreuzweg in Wulmeringhausen, auf dessen Bildern die menschlichen Figuren zu Strichen aus Holzstabchen stilisiert sind und Bewegungen durch ein Abknicken dieser Striche veranschaulicht werden. Daneben werden die Entkleidung Jesu und seine Verwandlung in der Auferstehung durch Farbveranderungen angedeutet. Eine Zwischenform zwischen FuBfallund Kreuzweg stellt die Anlage in Stockum dar Sie wurde 1970 als Ersatz fur einen alteren Stationsweg erbaut. Der Weg hat nur acht Stationen aufzuweisen, von denen die achte die Auferstehung darstellt. Er ware daher den FuBfallwegen zuzuordnen, wenn nicht an jedem der ersten sieben Bildstocke je zwei kleine holzerne Kreuze angebracht waren: Die kirchenrechtlichen Regelungen besagen, dass eigentlich diese Ablasskreuze die Stationen ausmachen. Eine auberst ungewohnliche Form hat der 1995 errichtete Kreuzweg in Rixen. Er besteht aus drei organisch geformten Skulpturen, auf denen jeweils vier bis sechs ineinander verschlungene Kreuzwegszenen zu erkennen sind. Die zum Teil farbig bemalten Bildwerke aus Rtlthener Sandstein schuf der Kiinstler Jurgen Suberg aus Elleringhausen. //. Station des Kreuzweges in Niedermarsberg Kreuzweg in Eslohe, I. Station
43 42 NR. 1/2002 Zuletzt zu einem Kreuzweg, der sich je^ der Einordnung entzieht: Der Bergmannskreuzweg bei Elpe besteht aus etwa zweihundert Jahre alten Buchen, in die zur Kennzeichnung der Stationen die romischen Stationszahlen mit einem Kreuz dariiber eingeritzt sind. Die Entstehungszeit des Kreuzwegs ist unbekannt. Er wurde von Bergleuten aus dem Ruhr- und Negertal an ihrem taglichen Weg zur Arbeit in den Gruben auf dem Hulsberg geschaffen. So konnten sie vor Beginn der Schicht oder auf dem Heimweg dort beten. Die erste Skulptur des Kreuzwegs in Rixen Nach der SchlieBung der Gruben wurde der Kreuzweg vergessen und erst in den 1990er Jahren wiederentdeckt. Der Kreuzweg ist gerade in seiner Schlichtheit beeindruckend, da er von den in der Grube arbeitenden Bergleuten mit den wenigen ihnen zur Verfiigung stehenden Mitteln gestaltet wurde. Wie diese wenigen Beispiele zeigen, hat jeder Weg seinen eigenen unverwechselbaren Charakter, der sowohl aus der Form seiner Bildstocke, als auch aus seiner Einbindung in die Landschaft hervorgeht. ///. Station des Bergn^annskreuzwegs bei Elpe Kreuzweg und Landschaft Der Brauch, Kreuzwege in der Landschaft zu errichten, entspringt nicht allein dem Wunsch, sichtbare Zeichen fur den eigenen Glauben zu setzen. Vielmehr ist die Landschaft ein wichtiger Bestandteil des Kreuzwegs und tragt zu seiner Wirkung bei. Das Kreuzweggebet ist Meditation im Gehen. Zwar geniigt auch die Fortbewegung im Innenraum einer Kirche, bei kleinen Gotteshausern und vielen Betenden ist das Element des Weges aber kaum erlebbar. Die sinnliche Erfahrung des Gehens hat die Funktion, das Nachvollziehen des Leidenswegs Jesu zu erleichtern. Dementsprechend fuhren die meisten Kreuzwege bergauf, da der Ort der Kreuzigung der Oberlieferung nach ein Berg war. Im Barock wahlte man auf^erdem bewusst steile Berge fur die Aniage von Kreuzwegen, da diese Gelegenheit zu spiirbaren Buf^iibungen boten. In einzelnen Fallen sind die Bildstocke so gesetzt, dass sich die zwolfte Station mit der Kreuzigung als Hohepunkt des Passionsgeschehens auch am hochsten Punkt des Kreuzwegs befindet. Zudem liegen Kreuzwege meist aurerorts oder fuhren aus der Bebauung hinaus. Die Abgeschiedenheit eines Kreuzwegs in der Landschaft und das Verlassen des alltaglichen Lebensbereichs fordern Besinnung und meditative Stimmung. Hinzu kommt das Landschaftserlebnis. Angesichts der Schonheit der Schopfung kann ein tiefes Gefiihl der Verbundenheit mit dem Schopfer entstehen. Kreuzwege in der Landschaft bieten also die Moglichkeit, sich in Meditation im Gehen zu versenken, im wahrsten Sinne des Wortes in sich zu gehen". Ausblick Von dieser Form des Gebets fuhlen sich auch heute noch zahlreiche Menschen angesprochen. In einzelnen Orten wie Menden oder Stockum bei Sundern wird noch der alte karfreitagliche Brauch der Kreuztracht gepflegt. Hierbei tragen zwei als Jesus und Simon von Gyrene verkleidete Manner ein schweres Holzkreuz den Kreuzweg hinauf. Das lebendige Kreuzwegbrauchtum und der Einsatz vieler Gemeindemitglieder bei der Pflege der Kreuzwege haben diese vor Vergessen und Verfall bewahrt.
44 NR. 1/ Leserbrief Unser Mitglied Ludger Frieling, Miilheim - Ruhr, schickt uns auf unseren Bildbericht Baume sterben aufrecht" uber die legendare Buche im Arnsberger Wald in Heft 3/2001 das untenstehende Foto aus seinem Familienarchiv, das um 1900 entstanden sein durfte. Dafiir herzlichen Dank. Red. mm; Glindfelder Kreuzweg, Steil ansteigender Wegverlauf mit Station IX Die Kreuzwege im Sauerland befinden sich daher uberwiegend in gutem Zustand. Nur in wenigen Fallen waren Schaden durch Vandalismus zu verzeichnen. Fiir die zukunftige Erhaltung der Kreuzwege ist nicht nur ihre Nutzung fur religiose Zwecke, sondern auch ihre Bedeutung als Bestandteil der sauerlandischen Landschaft entscheidend. Im Rahmen der Bemuhungen um den Erhalt regionaltypischer Orts- und Landschaftsbilder konnten die Kreuzwege und andere christliche Wegmale in der Landschaft zum Gegenstand des Heimatschutzes werden. Es steht zu hoffen, dass dieses Interesse an Kreuzwegen auch in Zukunft anhalt. Literaturhinweise: Heimatmuseum Schmallenberg-Holthausen). Schmallenberg-Holthausen 1993 Wagner, G.: Barockzeitlicher Passionskult in Westfalen. Munster 1967 Hesse, J. und Schmitt, U.; Kreuzwege in der Landschaft. Erfassung und Dokumentation der Kreuzwege im kurkolnischen Sauerland. 4. Projeki am Institut fur Landsctiaftspflege und Naturscfiutz der Universitat Hannover. Hannover (Die unveroffentlictite Studienarbeit ist im Kreisarcliiv in Meschede einzusehen.) Kramer, E.: Kreuzweg und Kalvarienberg, StraKburg 1957 Senger, M. et al.: Patrone und Heilige im kurkolnischen Sauerland. (herausgegeben vom Schieferbergbau- und Schneeschmeize von Elise Niklas Die Kunstlerin wurde 1931 in Siedlinghausen geboren. Sie verstarb 1995 in Attendorn. Seit 1992 war sie Mitglied im KUnstlerbund Siidsauerland.
45 44 NR. 1/2002 Eine tragische Geschichte aus den letzten Kriegstagen in Langenholthausen uon Studiendirektor a.d. Friedhelm Crote Es lebe meine Frau, es lebe mein schones Rheinland' Es gibt Eriebnisse, die lassen einen das game Leben nicht mehr los, man mochte die Hintergrunde erkennen, mit Freunden und Zeitzeugen daruber reden und schlieblich sie aufschreiben. damit sie der Nachwelt als Erinnemng und Warnung erhalten bleiben. Ober ein solches Eriebnis mochte ich im Folgenden berichten. In den letzten Kriegstagen des zweiten Weltkrieges zogen in groken Karawanen Zivilisten auf der Flucht, Reste der deutschen Wehrmacht auf dem Ruckzug vor der von Osten her nachruckenden Front der Amerikaner durch unser Dorf. Englische Jagdbomber schossen auf alles, was sichi am Boden bewegte. Ich war gerade einmal 11 Jahre alt und hielt mich aus Sicherheitsgrunden im Wesentlichen im Haus auf. Dennoch erfuhr ich davon, dab in Simons Schweinestall" neben der Schmiede ein deutscher Soldat inhaftiert sei. Ich erinnere mich dann noch, dab wir Kinder durch ein vergittertes Fenster in den Raum sehen konnten, sahen einen jungen Soldaten in seiner Uniform auf einem Schemel sitzen, die Schulterklappen hatte man ihm von seinem Uniformrock gerissen. Vor der Stalltur sal? ein deutscher Soldat mit seinem Gewehr und hielt Wache.Unser Vater erzahite uns am nachsten Tag, der inhaftierte Soldat sei von deutschen Soldaten auf dem Kasberg erschossen worden. Soweit reicht meine Erinnerung an dieses Geschehen. Wenn ich spater in den Semesterferien oder zu Besuch in Langenholthausen war, habe ich haufiger mit alten Schulkameraden und Freunden Ober diesen Vorfall gesprochen. In alien Gesprachen wurde immer wieder betont, der Soldat sei vollig unschuldig nur wegen einer Bemerkung uber die Sinnlosigkeit des Krieges durch ein militarisches Standgericht verurteilt und dann hingerichtet worden. Alle waren auch Jahre spater noch sehr betroffen. In dem Buch: Geschichten aus der alten Zeit," herausgegeben vom Arbeitskreis Rumanienhilfe der Kolpingfamilie Balve, Balve 1995, fand ich eine erste Quelle in einem Beitrag von Gertrud Schafer aus Langenholthausen. Sie schreibt auf den Seiten 206 f.: Einige Tage vor Kriegsende passierte in Langenholthausen eine furchtbare Sache. Ein deutscher Soldat wurde von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Was war geschehen? Es waren im Dorf verschiedene Einheiten stationiert. Vor der Schmiede war es unter Soldaten zu einem Disput gekommen, und dieser Soldat hatte zu einem SS-Mann aus Osterreich gesagt: Du kommst daher, wo alle Verbrecher herkommen." Der Soldat, ein alterer Mann, wurde sofort im Schweinestall festgesetzt und scharf bewacht. Wir alle, wir waren ja fast nur Frauen, waren auber uns. Wir wollten dem Mann helfen und konnten es nicht. Hohe Offiziere kamen angefahren, und bei Habbels in der groben Fremdenstube wurde Gericht gesessen und der Mann zum Tode verurteilt. Weil die Front sich naherte, wartete man nicht die vorgeschriebenen drei Tage bis zur Vollstreckung ab. Der Soldat war ein Mann aus Wuppertal, hatte spat geheiratet, war Kaufmann und hatte nur gesagt, was alle dachten. Im Wald wurde das Grab ausgehoben. Von jeder Einheit mubten Soldaten mit. Sie waren alle ganz schrecklich aufgeregt und entsetzt. Dann wurde der Mann abgefuhrt, den Weg zur Muhle runter und in den Wald. Der Priester ging mit ihm, das Kreuz in der Hand. Wir weinten alle, das Bild vergibt man Ort des tragischen Geschehe sein Lebtag nicht. Was batten wir tun sollen. Was ware geworden, wenn wir uns alle dazwischengeworfen batten. Viele Fragen, die man immer wieder stellt." Die Darstellung von Gertrud Schafer spornte mich an, weiter zu forschen. Einige Aussagen pabten mit meinen Kenntnissen nicht uberein. Da ich wubte, dab der Soldat aus dem Grab im Wald spater umgebettet wurde und auf dem Friedhof der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Langenholthausen beigesetzt wurde, nahm ich mit Genehmigung des Pastors Epkenhans Einsicht in das Tauf- und Sterberegister der Kirchengemeinde. Im Band /96 fand ich im Sterberegister 1945, unter der fortlaufenden Nr. 6 folgende Eintragung:..Adams. Peter Jakob, Unteroffizier, geb in Krefeld (Rhid), katholisch. Wurde am abends 8 1/2 Uhr durch Erschiessen hingerichtet, nachdem er tags zuvor durch Standgericht zum Tode verurteilt war wegen Landesverrat. Der Wunsch nach einem kath. Geistlichen wurde ihm gewahrt. Adams ging nach 1 stiindiger Vorbereitung (Beichte und Communion) mannlich u. ganz gefasst seinen letzten Gang zum Kasberg hinauf. Es lebe meine Frau, es lebe mein schones Rheinland, waren seine letzten Worte.
46 NR. 1/2002 Sauerländer Heimatbund 45 Die Leiche wurde zuerst am Hinrichtungsplatze im Walde begraben. Am wurde sie exhumiert und in einem Sarge auf dem Friedhof kirchlich beerdigt. IV./Feldjag.Rgt. (mot) 1" Froh war ich Uber die gefundene Quelle, die in kurzer Form Auskunft uber das Geschehen gab. So wurte ich jetzt den Namen des Soldaten, sein Alter und seine Herkunft. Die Angaben von Gertrud Schafer konnte ich so neu bestimmen und in wesentlichen Punkten korrigieren. In Gesprachen mit den Zeitzeugen Alfred und Werner Schroer, die zu dieser Zeit in einem Haus des Grafen von Landsberg-Veelen auf dem Kasberg wohnten, wurde der Zeitpunkt der ErschieRung am Abend gegen Uhr am bestatigt. Sie konnten mir auch beschreiben, wo das Ganze stattgefunden hatte. Ich fand sogar einen der beiden MeBdiener, Alfons Hoberg, der zusammen mit Josef MeBler den Priester Pater Hubertus Vogt, geburtig aus Amecke, aus dem Dominikanerkloster Walberberg, begleitete und in einem gebuhrenden Abstand das Geschehen im Langenloh, einem Waldstiick hinter dem Kasberg gelegen, mitverfolgen konnte. Da es sich um einen Buchenwald handelt, ist der Ort des Geschehens heute noch gut bestimmbar. Das Standgericht hat nach Aussagen von Franz-Josef Gaststdtte Habbel in Langenholthausen Habbel in der guten Stube" der Familie Habbel getagt und ein Urteil gefallt. Dieses Wohnzimmer war schon einige Wochen vorher als Standortkommandantur von der deutschen Wehrmacht benutzt bzw. besetzt worden. Nach Franz-Josef Habbel wurde Peter Adams von einem Mitglied der Organisation Todt denunziert. Die Organisation Todt (nach Dr. Fritz Todt, Generalinspekteur fiir das deutsche StraRenwesen) bestand vornehmlich aus Technikern und Bauleuten. MR yj^*^ f Die ehemalige Schmiede von Franz Simon Diese bauten Bunker, Panzersperren, Schutzengraben u.a. Fine Einheit soil in dieser Zeit im Raum Balve stationiert gewesen sein. Grundlage fur die Standgerichtsentscheidung sei gewesen,dies bestatigte auch Mathilde Gierse, geb. Habbel, aus Altenaffeln, dae Adams den englischen Feindsender gehort habe. Das allein genugte damals, um standrechtlich erschossen zu werden. Es ist kaum zu begreifen, daf? es so etwas gab. Viele Menschen horten damals den Feindsender, aber sicherlich nur bei verschlossenen Turen. Das Fremdenzimmer der Familie Habbel hatte einen Zugang vom Eingangsflur aus und eine zweite Tur zur Kuche hin. Von hier aus konnte man den ProzeRverlauf gut mithoren, so dab die Aussagen dieser beiden Zeitzeugen mit annahernder Wahrscheinlichkeit den Tatsachen entsprechen durften. Das Bundesarchiv als Zentralnachweisstelie in Aachen und die Deutsche Dienststelle in Berlin haben mir schriftlich mitgeteilt, dar sie keine Unterlagen uber Standgerichte bzw. ein Kriegsgerichtsurteil vorliegen haben. Nach einer Ruckfrage beim Standesamt in Krefeld wurde mir geantwortet, da der Sterbefall von Peter Adams dort beurkundet sei, die Deutsche Dienstelle in Berlin gab noch nahere Angaben dazu an, namlich dae die Beurkundung am unter der Reg.- Nr. 849/1945 auf mundliche Anzeige der
47 46 NR. 1/2002 Ehefrau unter Zugrundelegung einer Bescheinigung des Pfarrers der Gemeinde Langenholthausen vom " erfolgte. Die Ehefrau Anna Adams lebt heute noch in Krefeld. Eingekerkert war Peter Adams im Schweinestall der Familie von Franz Simon. Die Tochter Margret erzahlte mir voller Anteilnahme, dab sie damals dem Inhaftierten noch ein Essen, wie es auch die ubrigen Familienmitgliederbekamen, brachte, sie war gerade 9 Jahre alt. Aus Langenholthausen war an diesem Geschehen nach meiner Kenntnis niemand beteiligt. Wer hier das Urteil sprach und wie es genau begriindet wurde, wird wohl ftir immer im Dunkeln bleiben.ich konnte es leider nicht herausfinden. Es steht fest, dar Peter Adams sinnlos sterben mul^te. Alle so Verurteilten miissen im Sinne einer Gerechtigkeit rehabilitiert werden....lieber GANZ ALTER SCHNEIDER" H.&F. SCHNEIDER KORNBRENNEREI NUTTLAR-HOCH Wir durfen ihr Schicksal und das ihrer Angehorigen nicht vergessen. Sie sind einen menschlich richtigen Weg gegangen und mubten einen sinnlosen Tod sterben. Einen Tag nach der Hinrichtung fuhren die schweren Panzer der amerikanischen Armee durch das Dorf Langenholthausen. Darin zeigte sich besonders die Sinnlosigkeit dieses Geschehens. Am 8. Mai 1945 schlieblich, am Tag der Kapitulation der deutschen Armee, wurde Peter Adams auf dem Friedhof in Langenholthausen kirchlich beigesetzt. Die Angehorigen haben ihn spater in seine geliebte Heimatstadt Krefeld ijberfiihren lassen. Ich habe der Dorfgemeinschaft vorgeschlagen, an das Schicksal des Peter Adams in Langenholthausen an sichtbarer Stelle zu erinnern und seiner zu gedenken. Alle Fotos von Felicitas Grote, Frechen bei Koln Dai Euro, uese nigge Geld Luie, haort tau, wat kost't de Welt? Niu iesetdao, dat nigge Geld I Dal D-Mark gilt nix ma, dat ies waohr, sal hiat iutdennt, nao dreiunfiftig (53) Jaohr. Eurofaiwerwaswiakenlang. Volksopklamngbul jederbank. Unjederoineetniu kennt, dat Nigge, - dian Euro un dian Cent. Aokiek was niggeliek unfit un harr rechttutig saon (Starterkit.) Daotau nao, im Seniorenklub, klare saon Kal van der Kasse op. Schoine Scliuine, Munzen, blanke Dinger, dai Euro, hai lagget guet tusker de Finger. Un gloiwetmi,et iesnitverkahrt, dai Euro, hai niesaok wat wart. Hai ies jao vandage nao rectit Jung, un dennt aok der Vdlkerverstandigung. Twialw Lanner maket in Europa met un alle siekwuohlwunsket hat, dat Wirtschaft, Opschwung un aok Friaen, beschieden, - dubr dian Euro wabrn. Heinz Raulf Literaturpreis fiir Siegfried Kessemeier Den Wilhelmine-Siefkes-Preis 2002 der ostfriesischen Stadt Leer erhielt nach einstimmiger Entscheidung der Jury Siegfried Kessemeier (Munster). Der mit 2500 Euro dotierte Preis wird fur zeitgenossische niederdeutsche Literatur verliehen. Kessemeier bekommt ihn fiir neue, noch unveroffentlichte Gedichte in sauerlandischer Mundart. Der 1930 in Oeventrop/Sauerland geborene Autor ist bereits mehrfach fur sein literarisches Schaffen ausgezeichnet worden, so 1975 mit dem Klaus-Groth-Preis der Stiftung FVS Hamburg und 1997 mit dem Kulturpreis des Hochsauerlandkreises. Seinen Gedichtsammlungen..gloipe inner dor" (1971), genk goiht" (1977) und spur der zeit - landskop" (1994) soil bald eine weitere mit dem Titel orte blicke" folgen. Besondere Beachtung fand Kessemeier auch mit dem Tonwerk..ropper dedal - Jazz und Lyrik niederdeutsch", einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks von 1990, die 1998 als CD erschien (Pendragon Verlag Bielefeld). esuchen Sie ans im Interne w.sauerlaender-heimatbund.de
48 NR. 1/ Ein liebes Kerlchen? von Wolfgang Frank Friih schon fiel er mir auf dieser Vogel mit den wei/jen Streifen im Flugel, dem blaugrauen Kopf und der rotbraunen Vorderseite. Meist traf ich ihn auf den damals vielfach noch nicht asphaltierten Stra en und Wegen unserer Stadt. Er trippelte vor mir her, pickte hier und da etwas auf und lie mich zu meiner Freude ziemlich nah herankommen. Doch wenn ich nnich ihm zu sehr naherte, flog er kurz auf, um den Abstand wieder zu vergrobern, und das Spiel fing von vorn an. So ein liebes, zutrauliches Kerlchen, dachte ich mir. In dieser Zeit machte ich mir wintertags meine erste Futterglocke zurecht und hangte sie im Garten auf. Meisen kamen und begriffen bald, wie sie sich an das Haltestielchen klammern mul^ten, um einen Sonnenblumensamen aus der Glocke ziehen zu konnen. Spatzen flogen herbei und balgten sich um die Samen und Fettbrocken, die aus der Glocke auf den Boden fielen. Einigen gelang es nach angestrengtem Uben, selbst etwas aus der Glocke herauszupicken. Das meiste fiel hinunter und loste ein weiteres Geschilpe und Geraufe aus. Auch eine Amsel kam hinzu. Dann war auf einmal der Vogel mit den weiken Streifen in den Flugeln da. Still nahm er die winzigen Futterbrockchen auf, die von den anderen Vogeln ubersehen worden waren. Ehe er den Schauplatz verlieb, nannte er seinen Namen: Fink" und nochmal Fink", sagte er und flog fort. Wie nett und friedlich, dachte ich mir und schatzte den Buchfinken, um diesen handelte es sich bei meinem Freund, nun noch mehr. Doch als ich dann spater ofter beobachtete, wie zwei Buchfinkenmannchen um ein Brutrevier kampften, wie sie sich am Boden und auf- und absteigend in der Luft wutend mit Flugeln, Krallen und Schnabel bearbeiteten oder wie im Winter am Futterplatz im Garten aus einer Finkenschar plotzlich ein Mannchen aufflog und zielsicher auf einen ihm mil^liebigen Genossen losschok und ihn abstrafte, verlor der Vogel viel Glanz von seinem in meiner Vorstellung entstandenen Heiligenschein. Der Lockruf des Buchfinken gleicht dem der Kohlmeise sehr. Selbst erfahrene Vogelkundler konnen diese Rufe manchmal nicht sicher unterscheiden. Nicht von ungefahr wird die Kohlmeise in manchen Gegenden auch Finkmeise genannt. Das Fink" des Buchfinken klingt etwas barter und kiirzer als das Finnk" der Kohlmeise. So ahnlich die Lockrufe der beiden Vogel sind, so ver- schieden zeigen sie sich in anderen Dingen: Die Kohlmeise nimmt als Nahrung meist Insekten sowie deren Larven und Eier. Der Buchfink lebt uberwiegend von allerlei Samereien.- Die Kohlmeise ist ein Hohlenbruter, der Buchfink dagegen ein Freibruter, d. h. er baut sein Nest im Geast und Gezweig von Baumen und Buschwerk.Die Kohlmeise ist durchweg Standvogel, der Buchfink Teilzieher. Die Kohlmeise tragt ihr farbenkraftigstes Federkleid im September. Verstandlich, dann hat sie ja gerade den Federwechsel (Mauser) hinter sich. Das neue Feder- kleid des Buchfinken jedoch zeigt sich nach der Mauser noch nicht in voller Schonheit. Das bewirken die olivgrauen, haarahnlichen Federsaume, die iiberall etwas aus dem Gefieder hervorschauen und dasselbe gleich einem feinen Schleier uberziehen. Im Laufe von Herbst und Winter werden die Saume z. B beim Bewegen im Gestrtipp und Gezweig oder beim Putzen des Gefieders allmahlich abgescheuert, so dae die kraftigen Farben der Federfahnen sichtbar werden. Das kann man besonders beim Buchfinkenmannchen sehen, das rechtzeitig zu Beginn der Brutzeit eine saubere blaugraue Kappe und eine weinrot leuchtende Vorderseite vorweisen kann. Fringilla coelebs ist der wissenschaftliche Name unseres Finken. Coelebs bedeutet ehelos. Ist hier dem Namengeber, dem bertihmten Carl v. Linne, ein Irrtum unterlaufen? Nein, denn die Finkendamen nehmen sich zu einem guten Teil im Herbst eine Auszeit und ziehen mit den Jungvogeln nach Siidwesteuropa, teils bis an die Mittelmeerkuste. Die gestandenen Herren der Finkenfamilien bleiben unbeweibt hier bei uns. Sie bekommen allerdings bald die recht zahlreiche Gesellschaft von Buchfinken aus Nordosteuropa, Fur diese ist unser Land der SLiden", wo sie sich wohlfuhlen und auch gem zu den Futterstellen in unseren Garten kommen. Kohlmeisen und Blaumeisen beginnen oft schon Ende Januar mit dem Fruhlingsgesang. Sie bringen ihre Strophen recht schnell sauber heraus. Die Buchfinken fangen irgendwann im Februar an zu singen. Doch es sind zunachst nur angestrengte Singversuche, die sich einige Wochen hinziehen. Manche meinen, die stiimpernden Sanger seien nur die einjahrigen Mannchen. Aber dann mukte man neben ihnen die alteren Vogel mit ihrem ausgereiften Gesang horen. Ja, man mubte sie eigentlich sogar vor den jungen Finken vernehmen. Doch beides ist nicht der Fall. Es wird wohl so sein, daii auch die mehrjahrigen Finken nicht ohne vorbereitende Stimmubungen auskommen. -
49 48 NR. 1/2002 Wenn das Buchfinkenweibchen im Marz sich bei dem Mannchen einfindet, wird es mit dem fertig einstudierten Finkenschlag begrurt. In Silben konnte man diesen Gesang mit tititi..terroitur" wiedergeben, in Worten vielleicht mit Bin ich nicht ein schoner Brautigam!" oder besser mit Hier, hier, hier bin ich der Herr!" Ja, das Brutrevier ist schon in Besitz genommen, der Nistplatz ausgeguckt worden. Das Weibchen braucht nur noch alles zu begutachten und sein Einverstandnis zu erklaren. Nach einigen Tagen beginnt es in dem dafiir vorgesehenen Baum mit dem Nestbau. Es baut meist allein. Ein Kunstwerk entsteht. Sorgfaltig wird es auf dem Ast und an den davon ausgehenden Zweigen befestigt. Moos und Halme werden miteinander verflochten und zudem mit Spinnweben und anderen Gespinsten verwoben. AuBen uberzieht die Baumeisterin das Nest mit Baumflechten, so dab es sich der Baumrinde angleicht und einem Astknorren ahnlich sieht. Das Buchf inkenweibchen vergibt nicht, die tiefe Nestmulde mit Harchen und Federn auszupolstern.- Nicht lange danach, meist im April, legt es 4-6 Eier und be^ brutet sie 13 Tage lang. Wahrend der ganzen Zeit des Nestbaus und Brutens hat das Mannchen nichts anderes zu tun, als z.b. mit argerlichem Geschimpfe vor der Katze zu warnen, den Oberflug eines Greifs zu melden sowie immer wieder mit lautem Gesang sein Revierbesitzrecht anzuzeigen und notfalls einen fremden Buchfinkenhahn wegzuschlagen. Das alles sieht das Weibchen sicherlich nicht als uberfliissiges Gehabe an. Vielmehr fiihlt es sich dadurch sicherer und kann sich so auf sein Tun konzentrieren. Wenn die Jungen geschlupft sind und hungrig im Nest hocken, holen beide Altvogel die Nahrung herbei. Fur die zarten Nestlinge wurden Samereien schadlich sein. Sie benotigen z.b. kleine Insekten und deren Larven. Es ist nicht einfach fiir die Kornerfresser mit den dicken Schnabeln, so etwas herbeizuschaffen. Aber es gelingt ihnen. So kann man sie beobachten,wie sie im Garten geschickt und ausdauernd Blattlause fur die Jungen einsammeln. In ihren ersten Nestlingstagen und auch spater bei ungunstiger Witterung nimmt das Weibchen die Jungen schutzend unter die Flijgel. Fur diese Zeit mur das Mannchen doppelte Ar- Miin(ihen19fi? Slullfjarl 1991 Ralf Majhchneidernieisler beit leisten namlich die Futtersuche ganz ubernehmen. Wen verwundert's, dab es dann seine musikalischen Darbietungen voriibergehend einschrankt. - Bei Buchfinkens gibt es meist 2 Jahresbruten. Wir horten schon von den weiben Streifen in den Fliigeln des Buchfinken, Sie und der griine Biirzel sind wichtige Erkennungsmerkmale beim Buchfinken. Das braungriine, unscheinbare Weibchen tragt sie auch und wird so als der Art zugehorig ausgewiesen. Solche Merkmale gelten deshalb als Artmerkmale. Beim Distelfinken z. B. sind die gelbe Binde im schwarzen Flugel, beim Dompfaffen die schwarze Kappe und der kurze Schnabel, bei der Wacholderdrossel der graue Kopf und der graue Burzel oder bei der Mehlschwalbe der weibe Burzel und die weibbefiederten FUBe die Artmerkmale. - Unser Buchfink fijhlt sich fast uberall zu Hause: im Tiefland und im Mittelgebirge, in der Nahe der Menschen und im einsamen Hochgebirgswald. Wahrscheinlich ist er heute in Deutschland der haufigste Singvogel. In den Hausgarten allerdings uberwiegt an Zahl die Amsel. Im Herbst und im Winter sucht der Fink - manchmal in groberen Trupps - in den Waldern nach Bucheckern. (Daher hat er wohl den ersten Teil seines Namens.) Mafikleidung fiir huclisle Anspriiche Ausfeinsien Sloffenfcihf>cn wir lluv iiuliviiliielle Danicn- und Herrciunode. Unsere Sloffe kommen mis den hesten Wehereien. In unsercm Lager finden Sie iinier anderem rcines schollisclies Caslimeie, superfcine englische Kanwigarne und reine Seide cms ikdien. Unsere qualifizierten Fachkrdfte scltneidern nacii alter Handwerkskunsi aufsiepcrsiinlicli angepajiie < Kleidnng, Fiir iinser Konnen spreclien viele Goldmedailleii und Aiiszeiclmungen, die l>ei nationalen und inlernalionalen Kongressen und Ausslellungen verlielten wurden. 01) Sie die klassisclie Linie oder modernes Design lievorzugen. wir heralen Sie, mildeii mil lltnen Sloffe aus undferligen linen eigenen Slil. Individualildl fdngl hei der Kleidnng an. Wicmeriii^haiisen Olsberg Ihcrgstiafie 26 - Tel. (02985) 239 Mafigebend iiber das Sauerland hinaiis! Nie aber zeigt er sich in so grorer Zahl wie sein naher nordischer Verwandter der Bergfink. (Artmerkmale: weifter Unterriicken und Burzel, heller Bauch.) Durch die reiche Bucheckernernte angezogen, erschienen im Herbst und Winter 2000/2001 die Bergfinken in riesigen Scharen. Allein im Raum Arnsberg wurden um die (dreihunderttausend!) dieser Vogel in den Waldern oder beim Uberflug beobachtet. (Bei der Zahlenangabe beziehe ich mich besonders auf die Informationen durch Peter Noseleit und Erich NeuB, zwei erfahrene, fachkundige Beobachten) Am Futterplatz in meinem Garten finden sich, unabhangig von den Masseninvasionen, in jedem Winter einige Bergfinken ein. Sie sind sehr scheu, vertragen sich jedoch recht gut mit den Buchf inken, Grunf inken und Sperlingen. Der Bergfink brutet in den Waldern Skandinaviens, Finnlands und NordruBlands. Dort laet er naturlich seinen Gesang horen. Dieser soil dem des Buchfinken bei weitem nachstehen. Dies konnte ein kleiner AnstoR fiir uns sein, im Fruhjahr einmal intensiver dem Gesang unseres Buchfinken zu lauschen. Gelegenheit gibt er uns genug, singt er doch bis in den Sommer hinein seine frischen, aufmunternden Strophen.
50 NR. 1/ Die Bibel - aktuell erschlossen Hubertus Halbfas antwortet auf Fragen von Knut Friedrich Platz Anfang Oktober erschien im Patmos Verlag, Dusseldorf, eine ungewohnliche Bibelausgabe von unserem Redaktionsrnitglied Prof. Dr. Hubertus Halbfas. Darir) fuhrt Halbfas den Laser nicht nur durch die biblischen Bucher und Zeiten, sondern bezieht auch Religions- und Kulturgeschichte, Literatur und Kunst in einer Weise ein, welche die Bibel in einen tiefen Dialog mit heutigen Fragen bringt. Knut Friedrich Platz sprach mit Hubertus Halbfas uber sein Werk in Drolshagen. Herr Professor Halbfas, Sie haben kurzlich eine Bibel mit dem Untertitel Erschlossen und kommentiert von Hubertus Halbfas" vorgelegt, ein groeformatiges Werk, das Ihnen einigejahre Arbeit gekostet hat. Was hat Sie dazu bewogen? Seit wenigstens zweihundertfiinfzig Jahren richten sich historisch-kritische Fragen auf die Bibel. Es entwickelten sich Wissenschaften und Methoden, die Entstehung und die Intentionen der biblischen Schriften zu erforschen. Die Ergebnisse haben das kirchliche Glaubensverstandnis immer wieder erschreckt. Irritierte anfangs nur die Erkenntnis, dab Mose die nach ihm benannten Funf Bucher Mose" nicht geschrieben haben kann, so verwirrte spater die Exegese mit Resultaten, die in Spannung zu traditionellen Glaubensvorstellungen stehen. Predigt und Religionsunterricht haben sich bisher nicht wirklich getraut, die gesicherten Erkenntnisse der theologischen Forschung aufzugreifen, ihre Konsequenzen zu reflektieren und in angemessener Vermittlung weiterzugeben. Schon 1959 hat der evangelische Neutestamentler Hans Conzelmann gesagt: Die Kirche lebt praktisch davon, dab die Ergebnisse der wissenschaftlichen Leben-Jesu-Forschung in ihr nicht publik sind." Diese Situation einer doppelten Wahrheit" - eine fur die Wissenschaft und eine fiir das Volk - mochte meine Bibelausgabe uberwinden. Fiir welche Leser haben Sie IhrBuch geschrieben? Far alle, die wissen wollen, was heute Stand der Forschung ist. Das mogen Christen wie Nichtchristen sein, Neugierige jedweder Herkunft, aber auch Pfarrer und Lehrer; uberall besteht ein grower Nachholbedarf. Konnte es sein, dae viele Menschen den christlichen Glauben mit ihrem Weltverstdndnis und Lebensgefiihl nicht mehr in Ubereinstimmung bringen, well ein uberholtes Vorverstdndnis unerledigt bleibt?die zunehmende Entleerung unserer Kirchen mue ja Griinde haben. Die Bibel fssen und Ek^Timehtiert von (ubertus Halbfas Die Bibel ist das christliche Grunddokument. Wenn sich das Verstandnis dieser Quelle nicht mehr mit dem Wissen unserer Zeit verbinden lakt, entstehen Spannungen, derer sich viele durch Distanzierung entziehen. Wie arrangieren Sie mit Ihrem Buch denn den Bruckenschlag zwischen der Bibel und unserer Zeit? Das erste Mittel heibt Information. Ich verbinde Bibeltext und Kommentar. Die diversen wissenschaftlichen Kommentarreihen lassen sich in Metern messen; niemand kann alle Bande lesen, ganz davon zu schweigen, dafj hier eine komplizierte Fachsprache geschrieben wird. Wollte man dennoch wissen, wie sich die Bibel mit ihren alt- und neutestamentlichen Schriften dem historischen Blick erschliebt, mukte man sich durch viele Bucher durcharbeiten. Hier will meine Bibelausgabe eine Abhilfe schaffen. Der Leser bekommt in einem einzigen Band eine klare Orientierung in grundlegenden Texten, dazu eine Religions- und Sozialgeschichte Israels, sowie Einblick in den heutigen Kenntnisstand zur Entstehung des Christentums. Insgesamt ein tiefenscharfes Bild, das mehrfach hinter den Text zuruckftihrt. Ihr Buch kann naturlich nicht den gesamten Textbestand der Bibel wiedergeben. Welche Auswahl haben Sie getroffen und wie begrilnden Sie diese? Ich habe mich zunachst auf eine Auswahl beschrankt, deren Kenntnis zur Allgemeinbildung gehort. Zum anderen habe ich mich bemtiht, mit der Linie dieser Textauswahl eine Geschichte Israels beschreiben zu konnen. Deshalb kommen die nachexilischen Jahrhunderte mehr zur Geltung, als dies ansonsten geschieht. Im Neuen Testament werden die Evangelien je gesondert vorgestellt, jedoch so, dab der Leser ein deutliches Profil eines jeden Evangeliums gewinnt und dann weie, worin sich zum Beispiel Markus von Matthaus oder Lukas unterscheidet. Ihre Bibel bietet allerdings noch mehr als Text und Kommentierung. In den mitlaufenden Randspalten findet man ein Lexikon wichtiger Begriffe und Namen, sodann religionsgeschichtliche Parallelen, die Vergleiche gestatten, zum Beispiel zwischen der biblischen Sintflut-Erzahlung und seiner bab\jlonischen Version im Gilgamesch-Epos. Ebenfalls stehen hier Texte moderner Schriftsteller und Zitate von judischen wie christlichen Theologen. Die Bibel soil in ein vielseitiges Gesprach einbezogen werden. Daran beteiligen sich alte und neue Autoren. Bisweilen widersprechen moderne Schriftsteller dem alten Text und kammen ihn gegen den Strich. Das schadet dem Bibeltext nicht, denn durch solche Herausforderungen gewinnt er fiir den Leser neue Aktualitat. Auch die oft beigefiigten theologischen Positionen - nicht zuletzt jene judischer Gelehrter - riicken die Bibel in ein erweiterndes und anregendes Gesprach. Die Vielfalt solcher Stimmen ladt zum Kreuz- und Querlesen ein. Das stiftet Neugier und Interesse. Nicht zuletzt dienen historische Karten und iiber
51 50 NR. 1/2002 vierhundert Bilder der Perspektiwielfalt. Dabei handelt es sich einerseits um Bilddokumente aus den verschiedenen biblischen Zeiten und Raumen. Vor allem aber sollen unverbrauchte Bilder, die mehr als Illustrationen" sind, der Bibel eine neue Wahrnehmung geben. Sie beleuchten die Wirkungsgeschichte der Texte oder holen sie aus ihrer Vergangenheit in unsere Zeit. Das stiftet eine andere Form der Teilhabe. In meinem Religionsunterricht vor 50 Jahren habe ich gelernt, das Alte Testament vom Neuen Testament her zu verstehen; es also gewissermaben uom spateren Geschehen her zu deuten, um so die Person und das Schicksa! Jesu als uorherbestimmt zu zeigen. Demgegenuber sehe ich bei Ihnen die Judische Bibel enorm aufgewertet, ja es scheint mir, als konnte in Ihrem Verstandnis das Neue Testament nur auf der Folie des Alien Testaments zur Sprache kommen. Herz/u^er Gnffi aus dem Hochsauerland 35%V0l CMi/ekaMii i* R SCIINKIOKR KORNBRKNN p:'-nurn.ak-hociisaueriand", ;.:.; DEUTSCHKS KKZFIKiiNIS :' So ist es. Die heutige Exegese sieht sich beispielsweise angesichts der Passionsgeschichte vor der Frage, ob die Vorgange, die zur Hinrichtung Jesu fuhrten, erinnerte Geschichte oder historisierte Prophezeiung sind. Viele Forscher sind der Ansicht, dab erst die Befragung des Alten Testaments zu jenen Textfassungen gefiihrt hat, wie sie in den Passionserzahlungen vorliegen. Dabei erortern Sie auch die Frage. ob es uberhaupt zu einem offiziellen judischen Prozefi gegen Jesus vor dem Hohen Rat gekommen ist und fuhren Argumente an, die das verneinen. Die Evangelien sind im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts entstanden, das heirt in einer Zeit heftiger Auseinandersetzung mit dem Judentum. Die damals wechselseitig geubte Polemik zwischen Juden und Judenchristen ist mit in die Darstellung eingeflossen und hat in ihrer spateren Wirkungsgeschichte eine blutige Spur zuruckgelassen. Davon weib selbst die Geschichte im Sauerland vielfaltig zu erzahlen. Der Blick auf judisches Schicksal in der eigenen Heimat zeigt auch, dab die Aufarbeitung der biblischen Tradition fur ein problemsichtiges heutiges BewuRtsein unmittelbar relevant ist. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land - steht das nicht auch in der Bibel? Ja bei Markus 6,4 in Bezug auf Jesus. Sie haben ReligionsbUcher fur die Schulen und umjangreiche Lehrerhandbucher in den letzten zwanzig Jahren erarbeitet. Sind Sie mit Ihrer Resonanz im Sauerland zufrieden? Oder konnte es sein, dab Sie in anderen deutschsprachigen Ldndern aufmerksamer rezipiert werden als bei uns? Selbstverstandlich gibt es regionale Unterschiede im Umgang mit meinem Unterrichtswerk. Ich erfahre in anderen Regionen, selbst in der Schweiz, eine intensivere Rezeption. Das liegt an einer je unterschiedlichen kirchlichen Offenheit. an der jeweiligen Konzeption der Religionslehrerfortbildung, die ich bei uns als defizient ansehe, oder auch an der Schullandschaft im allgemeinen. Beispielsweise haben wir im Sauerland eine ziemlich monotype Schulstruktur, wahrend im Rheinland zwischen Aachen, Koln und Dusseldorf den Regelschulen ein Spektrum alternativer Konzepte gegeniibersteht, die auf die gesamte Schullandschaft positiven EinfluR nehmen. Im schulischen wie im kirchlichen Bereich konnten wir mehr Innovation gebrauchen. Ihre Bibelausgabe scheint gleich vom Start her eine breite Beachtung zu finden. Wie schdtzen sie die Fernwirkung Ihres Werkes ein? Leser die bereits ein Vorverstdndnis exegetischer Fragen mitbringen, mogen sich von diesem Buch abgeholt und weitergefilhrt finden. Aber wie mag die Wirkung auf theologisch unvorbereitete Leser sein? Jedes Buch trifft auf unterschiedliche Leserschichten. Auch die Bibel. Die judische Tradition erzahlt die Legende von Mose, der mehr als tausend Jahre spater den Rabbi Akiba die Bibel auslegen horte und seine eigene nicht wiedererkannte. Das heibt, man war sich bewubt, die Bibel immer wieder neu schaffen zu mussen. Dieser Aufgabe stelle ich mich ebenfalls und verkenne nicht, dak meine Bibelausgabe jenen Menschen, die ihr theologisches Wissen allein dem friihen Religionsunterricht und der Sonntagspredigt verdanken, einen anspruchsvollen LernprozeB zumutet. Unbestritten ist unser kurkolnisches Sauerland eine Region eingewurzelten Christentums. Aber nichts bleibt wie es ist. Derzeit vollzieht sich ein epochaler Traditionsbruch, von dem wir noch nicht wissen, wie er die religiose Situation verwandelt. Das Christentum wird bei uns nur dann Zukunft haben, wenn es nicht mumifiziert, sondern aus seinen Quellen heraus neu verstanden und gewissermaben immer wieder neu geschaffen wird. Ich kann nicht verfiigen, welchen Weg die kunftige Entwicklung nimmt. Aber ich hoffe, mit meiner Arbeit Voraussetzungen filr ein neu zu iiberdenkendes und sich neu konkretisierendes Christentum bereitstellen zu konnen. Die Bibel, erschlossen und kommentiert von Hubertus Halbfas. 600 Seiten mit 414 Abbildungen und 16 Karten. Durchgehend farbig gedruckt. Grol?-Format 19,5 X 26 cm. Leineneinband mit Schutzumschlag. Patmos Verlag, Dijsseldorf Einfiihrungspreis (bis 30. Juni) 50.- Euro.
52 NR. 1/ BUCHER. SCHRIFTTUM Gutsherrliche Rechtsprechung im kurkolnischen Herzogtum Westfalen Wer als Ruhestandler von siebzig Jahren seinen Doktor der Rechte erwirbt, muss ein aurergewohnliches Interesse an seinem Thema haben. Bei Dr. Hermann Freiherr von Wolff Metternich ist das der Fall. Als Mitglied einer westfalischen Adelsfamilie war er schon in seiner Schulzeit im heimischen Raum durch gute Lehrer an die Faszination von Geschichte herangefuhrt worden. Als Jurist beim Bundesverband der Deutschen Industrie trat er durch zahlreiche Veroffentlichungen zur westfalischen Landesgeschichte hervor. Nach der Wende wurde er als juristischer Berater in Greifswald tatig. Im Gesprach mit dem dortigen Dekan der juristischen Fakultat, Professor Regge, reifte der Plan, eine Doktorarbeit uber die Patrimonialgerichitsbarkeit zu schreiben. Herr Dr. Horst Conrad vom westfalischen Archivamt in Munster machte ihin auf das fast vollstandig erhaltene Archivmaterial des Patrimonialgerichtes der efiemaligen Herrschaft Canstein im 5stlichien Sauerland aufmerksam. In Zusammenarbeit mit diesem und der Besitzerfamilie von Elverfeldt hat er am Beispiel dieses Gerichtes seine obengenannte Arbeit erstellt, fiir die ihm die Universitat Greifswald den Doktortitel verlieh. Wer als juristischer Laie glaubt, ein solches Fachbuch sei eine fiir ihn langweilige Lekture, der irrt sich sehr. Dr. Hermann v. Wolff Metternich schreibt Fachliteratur in einem gut lesbaren und das Interesse weckenden Stil. Er beginnt sein Werk mit einer lesenswerten Abhandlung iiber die Geschichte des Herzogtums Westfalen. In ihr wird die Entwicklung der Kultur dieses Raumes aus dem sachsischen Stamm dargestellt, der mit der Achtung Heinrichs des Lowen in die Oberhoheit der Kolner Bischofe ubergeht, die bis zum Beginn des 19ten Jahrhunderts Landesherren bleiben. Der Autor macht an Hand zahlreicher Akten und Briefwechsel klar, dass die Macht der Kolner Bischofe und spateren Kurfursten vor Ort im Zustandigkeitsbereich der Landstande begrenzt war. Im Bereich der Patrimonialgerichte, die vor Ort Recht sprachen, herrschte nur im geringen MaEe die im Nachhinein verurteilte dem Prinzip der Gewaltenteilung widersprechende Willkur des Grundherrn. Wie die Beispiele aus den Akten des Cansteiner Gerichtes zeigen, wurden Rechtshandel und strafbare Handlungen der Einwohner der Herrschaft von einem sachkundigen Richter rasch behandelt und abgeurteilt. Der Gutsherr trat dabei nur in Sonderfallen als Richter auf. Die Bevolkerung bevorzugte diese ortsnahe Rechtsprechung und wandte sich nur selten an die weit entfernte hohere kurkolnische Gerichtsbarkeit in Arnsberg. Besonders interessant und erstaunlich ist die Tatsache, dass die Rechtsgrundlage der Bindung der Patrimonialgerichtsbarkeit an die Grundherrschaft auf keinem Gesetzeswerk fuete, sondern direkt auf sachsische Gebrauche aus der Zeit vor Karl dem Grossen zuruckzufiihren ist. Unser sudostwestfalischer Raum blieb vom Einfluss des Absolutismus und seiner Zentralisierung der Staatsgewalt bis zum 19ten Jahrhundert frei. Das Selbstbewusstsein und die von der Obrigkeit unabhangige Einstellung der Grundherrn und der Bauern vor Ort war stark ausgepragt. Am Beispiel des Halsgerichtsverfahrens in Canstein gegen den notorischen Einbruchdieb Jakob Rehling und seine Familie, das der Autor eingehend behandelt, werden diese Fakten deutlich. Das Gnadenrecht des Kurfursten, an das Jakob Rehling appelliert, wird ohne Ahndung beiseite geschoben. Das schimpfliche Hangenlassen des Delinquenten am Galgen wird praktiziert, obwohl es in den Rechtsvorschriften nicht mehr enthalten ist. Als dann unter der preussischen Regierung die Patrimonialgerichte aufgehoben werden, argumentierten ihre letzten Verteidiger mit der Orts- und Biirgernahe, den geringen Kosten und der raschen Vergleichs- oder Urteilsfindung. Wie der Autor am Schluss seiner Arbeit darstellt nicht ganz zu Unrecht, wenn man die modernen Bestrebungen, die Kosten und den Zeitaufwand der Gerichtsbarkeit durch Schiedsmanner vor Ort und die Privatisierung mancher Dienste zu verringern, betrachtet. Ein lesenswertes Buch fur den heimatkundlich und an Geschichte interessierten Leser. Alexander uon Elverfeldt Wolff Metternicfi, Hermann von: Gutsherrliche Rechtsprechung im kurkolnischen Herzogtum Westfalen: Ideengeschichte - Lebenswirklichkeit, Munster: Agenda Verlag. 2001, 183 S., Euro 18,50. ISBN Archaologischer Fiihrer fiir den Kreis Soest Der fruchtbare Lossboden der Soester Borde, die Salzquellen der Stadt und seines Umlandes sowie die Rohstoffe des sudlich angrenzenden Berglandes begunstigten schon in der Jungeren Steinzeit bauerliche Siedlung und spater, durch den Handel, die wirtschaftliche Entwicklung des Raumes. Regionale Adelsgeschlechter entfalteten weitraumige Wirksamkeit. Im Mittelalter entwickelten die Stadte, alien voran Soest, biirgerliche Kultur und trugen sie weit in den Hanseraum hinein. Die reiche Zahl archaologischer Zeugnisse und Baudenkmaler sudlich und nordlich des Hellwegs sind Anlass und Grundlage fur diesen Fuhrer zu archaologischen Denkmalern. Eine Karte und eine Zeittafel erleichtern die Orientierung. Im ersten Teil des Buches werden sehr ubersichtlich Geologie, Archaologie und Geschichte des Raumes in elf Beitragen behandelt, darunter der des kurzlich verstorbenen Dr. Philipp R. Homberg uber den heutigen Stand der archaologischen Forschung. Andere behandein die Epochen von der Alteren Steinzeit bis ins Mittelalter, die Burgen und Schlosser, Kirchen und Kloster, die Wiistungen sowie die politische Geschichte des Kreises Soest. Im zweiten Hauptteil des handlichen Buches sind zwanzig ausgewahlte Boden- und Baudenkmaler beschrieben. Von diesen interessieren hier insbesondere sieben: Die Oldenburg auf dem Fur-
53 52 NR. 1/2002 stenberg bei Ense-Hoingen beschreibt Ph. R. Homberg und ordnet sie den spatsachsischen Ringwallanlagen Westfalens zu, in die zeitliche Nahe der in den Frankischen Reichsannalen mehrfach genannten Sigiburg" (Hohensyburg) und Eresburg bei Marsberg. - Die katholische Pfarrkirche St. Lambertus in Bremen (O. Ellger) wird heute wegen ihres erhalten gebliebenen romanischen Sijdportals gem aufgesucht. - Der Druggelter Kapelle in der Gemeinde Mohnesee, die noch heute von Laien vielfaltig und missverstandlich gedeutet wird, ist eine bau- und kunstgeschichtliche Skizze gewidmet, die ihre Erbauung mit zwei Urkunden von 1217 und 1227 des Grafen Gottfried II. von Arnsberg in Verbindung bringt (U. Lobbedey). Bei Sichtigvor (Warstein) ist der Ringwall Loermund eine vermutlich bereits seit der Eisenzeit genutzte Befestigungsanlage, die, in spateren Jahrhunderten mehrfach genutzt, auch Sitz der im 12. Jahrhundert ausgestorbenen Edelherrenfamilie von Mulheim gewesen sein konnte (Ph. R. Homberg). - Der Hohie Stein bei Kallenhardt, Stadt Ruthen, war eine zeitweise bewohnte Hohle der mittelsteinzeitlichen Ahrensburger Rentierjager (B.Ruschoff-Thale). - Der Abschnittswall Schafskoppen auf dem Ohningsberg bei Kallenhardt reprasentiert eine kleine Burg, die zu den westfalischen Ringwallanlagen der Vorromischen Eisenzeit des gebirgigen siidlichen und ostlichen Westfalens gehort (Ph. R. Homberg). - Das Romer- lager von Kneblinghausen (Stadt Ruthen), zwischen den Flussen Alme und Mohne auf einem etwa 410 m hohen Bergrucken in einer Grof^e von ca. 450 m mal 245 m errichtet, kann den fruhekaiserzeitlichen Germanenkriegen (12 v. Chn bis 16 n. Chr.) zugeordnet werden (J.-S. Kuhlborn). Sowohl die einleitenden als auch die Beitrage iiber die einzelnen Denkmaler sind mit vorzuglichen Kartenausschnitten und Abbildungen versehen. Einhei- mische und Besucher finden die ausgewahlten Orte leicht, wenn sie den Zufahrtsbeschreibungen folgen. Freilich gilt insbesondere fiir den archaologisch Interessierten auch hier: man sieht nur, was man weib. Dank den Autoren, den Herausgebern und dem Verlag! Knut Friedrich Platz Der Kreis Soest. Fuhrer zu archaologischen Denkmalern in Deutschland, Band 39. Herausgegeben uom Nordwestdeutschen Verband fur Altertumsforschung e.v.. vom West- und Suddeutschen Verband fijr Altertumsforschung e.v. und vom Mittel- und Ostdeutschen Verband filr Altertumsforschung e.v. in Verbindung mit dem Westfalischen Museum fijr Archaologie, Amt fur Bodendenfcmalpflege. Munster. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag S. mit 122 Abb Die Trippe'sche Sippe in Medebach In mehreren Jahrzehnten hat Anton Trippe eine Geschichte seiner Sippe erarbeitet, die er im Selbstverlag in Kaarst bereithalt. Die beiden Bande Geschichte der Trippe'sche Sippe in Medebach und Umgebung von 1446 bis 1969" umfassen 317 Seiten und kosten in Fotokopie 67,80. Nahere Auskunft: Anton Trippe, Tel Ausgabe der Winterberger Fitterkiste" Der Sauerlander Heimatbund wird seine Mitgliederversammlung im nachsten Jahr auf Einladung der Stadt in Winterberg abhalten. Dann besteht Gelegenheit, die Arbeit des riihrigen Winterberger Heimat- und Geschichtsvereins unmittelbar kennenzulernen. Einen guten Einblick in diese Arbeit auf dem Dach des Sauerlandes" gibt die von Rainer Braun gestaltete neue Ausgabe der Fitterkiste". Unsere Leser und Leserinnen werden sich vielleicht daran erinnern. dab die Fitterkiste der Korb war, aus dem die Winterberger Handelsleute auf ihren Reisen in deutsche und angrenzende Lander ihre Waren anboten. Dr. Werner Herold und Erich Vollmecke befassen sich in ihrem Beitrag Wie alt ist Winterberg?" mit den fiir diese Frage wichtigen Geschichtsquellen. Sie kommen zu dem Ergebnis, daii Winterberg vermutlich zwischen 1248 und 1253 zur Stadt erhoben wurde, so dab man im nachsten Jahr das 750jahrige Stadtjubilaum feiern konnte. Unser bewahrter Heimatfreund Paul Aust versetzt sich in seinem Aufsatz in die Rolle des im Jahre 1418 im Orketal bei Winterberg geborenen Heiner Stracke und schildert in erfreulich kurzweiliger Form dessen Lebensweg. Dadurch lernt man gleichzeitig viele Einzelheiten aus der Orts- und Regionalgeschichte kennen. Unsere Heimatvertriebenen werden sich freuen, dar Alfon Winkler sein schlesisches Heimatdorf Zottwitz, Kreis Ohlau, vorstellt, aus dem etwa 100 Bewohner nach dem 2. Weltkrieg eine neue Heimat in Winterberg gefunden haben. Msgr. Dr Wilhelm Kuhne, unseren Leserinnen und Lesern aus vielen heimatbezogenen Beitragen bekannt, berichtet iiber die Vernichtung..echter bodenstandiger Volkskunst". Nach einem lesenswerten geschichtlichen Exkurs, ausgehend vom alttestamentlichen Bilderverbot bis zu der modernistischen Zerstorung barocker Einrichtung in unseren romanischen und gotischen Kirchen, schildert er die Vernichtung wertvoller Schiefergrabsteine auf dem Gronebacher Friedhof. Zum Gluck sind die meisten Inschriften erhalten, die von einer anriihrenden kindlichen Frommigkeit zeugen. Ulrich Lange aus Gronebach stellt in einem durch ubersichtliche Karten angereicherten Bericht die alte HeidenstraBe" vor, die zugleich ein Teil des Jakobsweges war und die fruhmittelalterliche Verkehrsverbindung zwischen Koln und Leipzig darstellte. Unsere Heimatfreunde werden es begriiben, daii zugleich sachdienliche Hinweise auf empfehlenswerte Wanderungen gegeben werden. Aufsatze von Emil Stahlschmidt uber Prozessionen in der Pfarrgemeinde St. Lambertus in Gronebach, von Franz Mickus uber die Ziege als Grundversorger in schwerer Zeit, von Dr. Friedrich Opes uber die Forstnebennutzungen in den Gemeindewaldungen von Elkeringhausen und schlief^lich. noch einmal von Franz Mickus, uber Geschichte und Bedeutung der Negerkirche - mit erfreulich umfassendem Quellenmaterial -
54 NR. 1/ runden den insgesamt uberzeugenden Inhalt der nun zum 11. Mai erschienenen Ausgabe ab. Dr. Adalbert Mullmann Arnsberger Heimatblatter 2001 Wer die Heimatblatter des Arnsberger Heimatbundes in die Hand nimmt, freut sich zunachst Uber das ansprechende AuBere. Dieses vorbildliche Layout ist unserem Heimatfreund Hans Wevering zu danken, der bekanntlich seit vielen Jahren auch fiir die technische Redaktion unserer Zeitschrift Sauerland" verantwortlich zeichnet. In seinem Vorwort weist der Vorsitzende des Heimatbundes Friedhelm Ackermann darauf hin, dae der Heimatbund im April 80 Jahre alt wird. Wenn man dann Ruckschau auf die vergangenen Jahre halt, werden sicher auch die..heimatblatter" angemessen gewurdigt werden. Wie in den fruheren Ausgaben, bringt auch die vorliegende einen informativen Uberblick uber die weitgespannten Aktivitaten des Heimatbundes. Viktoria Lukas behandelt unter dem Titel Aufgaben und Ziele der Denkmalpflege in Arnsberg" die rechtlichen Rahmenbedingungen und bringt - anhand konkreter, durch Photos und Skizzen erlauterter - Beispiele ihrer Durchfiihrung in der Praxis. In die Geschichte des Dorfes Wennigloh fiihrt Georg Feldmann ein, und zwar auf der Grundlage der Aufzeichnungen seines GroRvaters, der bis 1943 als Lehrer in Wennigloh gewirkt hatte. Dabei finden die altvertrauten Flurnamen besondere Beriicksichtigung. Unser Heimatfreund Heinz Pardun befabt sich in einem grundlegenden Beitrag mit der Entwicklung der Verwaltungsstruktur der Stadt Arnsberg vom Mittelalter bis zum Obergang an PreuBen. Mit Interesse lesen wir, dal? die bekannte Stein'sche Stadteordnung von 1808 weder im Rheinland noch in Westfalen geltendes Recht gewesen ist. Ein ungewohnlichesthema beriihrt der Archivar Michael Gosmann unter dem Thema Eiserne Hand". Es handelt sich um eine Handprothese aus dem DreiBigjahrigen Krieg von hoher handwerklicher Qualitat, die sich seit einigen Monaten im Arnsberger Sauerlandmuseum befindet. Schon das sollte einen Museumsbesuch lohnen. Uber Kanonenkugeln am SchloBberg" berichtet Ferdi Reuther, gleichzeitig AnlaB, die BeschieBung des Arnsberger Schlosses im April 1763 zeichnerisch darzustellen. Hans Becker geht den Beziehungen Annette von Droste-Hulshoffs zu Arnsberg nach, ausgehend von ihrer einem Arnsberger Graf en gewidmeten Ballade. Dr. Reiner Haehling von Lanzenauer berichtet uber die Schicksale seiner weitverzweigten Familie, die lange in Arnsberg ansassig war und nicht nur hohe Beamte und Offiziere, sondern auch einen Paderborner Weihbischof stellte. In die Geschichte der Arnsberger Schulen fuhren zwei personlich gefarbte Aufsatze ein. Hilde Herborn geb. Ringleb berichtet zum Thema Erinnerungen an meine Schulzeit im Evangelischen Lyzeum in Arnsberg" uber ihre Erlebnisse in den dreibiger Jahren. Gudrun Miiller schildert das Leben der Arnsberger Lehrerin Karoline KeBler, die im Jahre 1937 wegen ihrer regimefeindlichen aufrechten Haltung zwangsweise in den Ruhestand versetzt wurde. Besondere Beachtung sollte man dem von Werner Buhner ins Deutsche ubersetzten Aufsatz eines britischen Historikers zur M6hnekatastrophe 1943" schenken. Der Blick hinter die Kulissen" zeigt, wie sorgfaltig die Englander den Angriff auf die Talsperre vorbereitet batten. Es sei angemerkt, dab auch Winston Churchill in seinen Memoiren sich ausflihrlich mit der Problematik dieses Angriffs befabt hat. Aufsatze von Anneliese Welling iiber den Kreuzweg in der Arnsberger Liebfrauenkirche und von Peter Noseleit uber die verdienstvolle Arbeit des im vergangenen Jahr verstorbenen Forstmannes Otto Schockemohle schlieben sich an. Beachtung verdienen auch die Anregungen des Arnsberger Burgermeisters Hans-Josef Vogel zur naturnahen Gestaltung des Arnsberger Anteils am FluBlauf der Ruhr. Unser Heimatfreund Friedhelm Ackermann steuert unter anderem ein eindrucksvolles - zweiseitiges! - Foto iiber das letzte Teilstuck der Autobahn A 46 zwischen Arnsberg-Uentrop und Oeventrop bei. Im iibrigen weist er in seinem abschliebenden Tatigkeitsbericht als Vorsitzender mit unverkennbarem, aber auch berechtigtem Stolz darauf hin, dab der Arnsberger Heimatbund in den nun achtzig Jahren seines Bestehens mit rund Mitgliedern zum grobten ortlichen Heimatverein im kurkolnischen Sauerland geworden ist. Respekt, Respekt! Dr Adalbert Mullmann Ein Landrat verbunden mit Blut und Boden" Er verspricht ein tiichtiger Landrat zu werden, dem es namentlich an der notwendigen Verbindung mit Blut und Boden seines Bezirks nicht mangeln wird", so urteilt der Regierungsprasident von Arnsberg uber Dr. jur. Herbert Evers im Jahr 1935 auf ministerielle Anforderung, als es darum geht, ob dieser seit November 1933 vertretungsweise als Landrat des Kreises Olpe Amtierende nun endgultig dort Landrat werden soil. Ein Amt, das er - unterbrochen nur von Januar 1941 bis September 1944, als er als Kriegsverwaltungsbeamter in Frankreich war -, bis zum Ende des Dritten Reiches" innehatte. Es ist das Verdienst von Hans-Bodo Thieme, in einer grundlichen und differenzierten Biographic das Leben und Wirken Evers vorgestellt zu haben: ein,,poiitisches Leben in Widerspriichen" nennt er seine Studie im Untertitel. Er fullt damit eine Lucke, denn trotz vieler Einzeluntersuchungen zur NS-Zeit in unserer Region fehlen noch immer Biographien iiber fiihrende Vertreter der nationalsozialistischen Funktionarsschicht. Der Verfasser schildert zunachst den Lebensweg des 1902 in Forde Grevenbruck als Sohn eines Betriebsingenieurs geborenen Herbert Evers.Er machte in Altena Abitur,studierte Jura, promovierte 1929 mit einer Dissertation uber Arbeitnehmer-Erfindungen in Gottingen und legte 1930 sein Assessorexamen ab. Der 1930 in die NSDAP Eingetretene lieb sich 1931 als Rechtsanwalt in Altena nieder, wo er wie in Grevenbrtick in der SA aktiv an den damaligen Wahlkampfen mitwirkte und erreichte, dab sein Heimatort Grevenbruck den grob-
55 54 NR. 1/2002 ten Zulauf an NSDAP-Wahlern im Kreis OIpe hatte. Die Weltanschauung" des jungen Evers analysiert Thieme ausfiihrlich (S ) u.a. mit einem spezielllen Exkurs liber Evers und den Sauerlander Heimatbund, ein fur -Leser besonders interessantes Kapitel. Evers war mit Franz Hoffmeister schon Mitglied der" Vereinigung Studierender Sauerlander", aus der 1921 bekanntlich der Sauerlander Heimatbund entstand, und stets ein engagiertes Mitglied des SHB. DaR Hoffmeister 1934 die Fuhrung des SHB an Evers iibergab, war laut Thieme nicht nur im Weggang Hoffmeisters nach Bochum begriindet. Er sei wohl zur Demission gedrangt worden"(s.45), denn in der nun angebrochenen braunen Ara war ein Alter Kampfer" wie der Olper Landrat viel geeigneter zur Fuhrung des Heimatbundes als ein parteiloser Geistlicher. Der Heimatgedanke hatte Hoffmeister und Evers verbunden, wie sehr er aber bei dem Landrat fanatisiert wurde, veranschaulicht Thieme anhand von Appellen Evers an NS-Amtswalter im Jahr Darin beschwor er Heimat als Ursprung und Gradmesser, vor dem unsere Willensreglung, unsere Gemutsempfindung und unser verstandesmabiges Denken gewertet wird... Ware Adolf Hitler 1933 nicht zur Macht gekommen, so hatten wir auch im Sauerland keine Heimat mehr.. Ihm und seiner Partei gebuhrt daher immer und ewig die Dankespflicht der sauerlandischen Heimatbewegung." (S. 50) Dieser Verabsolutierung des Heimatgedankens, entspricht auch ein Rechtsverstandnis, das sich nur noch an deutschem Denken und Fijhlen schule", wie es Evers in einer Rede nach dem sog. Rohmputsch artikulierte. Thieme untersucht dann die Tatigkeit des Landrats in alien Bereichen seines Amtes, worin er juristischen Sachverstand, Engagement, aber auch ausgepragten Fiihrungswillen und hohes SelbstbewuRtsein bewies. Da er einen ausgesprochen brutalen Kreisleiter neben sich hatte, konnte er selbst betont sachorientiert und vorschriftsmakig wirken, viele seiner Entscheidungen schlugen sich nur in den Akten nieder und wurden der Offentlichkeit nicht bewuf^t, so daf$ er weithin als anstandiger, idealistischer Nationalsozialist" gait, was ihm bei der spateren Entnazifizierung zugute kam und sein Bild bei den Zeitgenossen bis heute bestimmt. Anhand der schriftlichen Zeugnisse untersucht Thieme das Verhalten des Landrats z.b. gegenuber den Geistlichen und Kirchen. gegeniiber den Juden und bei der..reichskristallnacht", die seiner Ablehnung von Krawall" allerdings gar nicht entsprach. Nach seiner Ruckkehr aus der franzosischen Etappe im Herbst 1944 bemuhte er sich dann verantwortungsbewurt um das Uberleben der Bevolkerung seines Kreises, wie er z.b. mitwirkte. daj^ der Befehl zur Sprengung der Listertalsperre nicht ausgefuhrt wurde. Diese Initiativen trugen dazu bei, dab er nach seiner Internierung viele positive Urteile tiber sein Verhalten im..dritten Reich" sammeln konnte. So wurde er schliebiich als Mitlaufer" in Kategorie IV eingereiht. Sein ausftihriich geschildertes Bestreben um berufliche Rehabilitierung ab 1948 war 1954 von der Berufung als Stadtdirektor von Neheim-Hiisten gekront ( ). Diese Karriere entsprach dem Klima der 50er Jahre, in dem die NS-Zeit weitgehend verdrangt wurde. Wer als heutiger Leser z.b. das Dokument im SchluBteil Rechtsgestaltung und Rechtssehnsucht" verfolgt, eine Rede Evers vor dem NS-Juristenbund Bezirk Siegen vom , wird nicht zweifeln, dab heute allein ein derart tiefbraunes Bekenntnis eines Juristen den Landrat fiir ein verantwortungsvolles Amt im demokratischen Staat untragbar gemacht hatte. Ja, nicht nur das vor uns liegende geschriebene Recht ist heute Gesetz, sondern auch das, was in den programmatischen Erklarungen des Fiihrers steht, ist Recht. Und Recht ist das, was dem Volke nutzt, und Unrecht das, was ihm schadet." (S. 272) Die Wiedergabe derartiger Originaldokumente ist ein wichtiger Bestandteil der Biographie des Landrats, die dem von Thieme insgesamt differenziert gestalteten Bild des Sauerlanders eine weitere Tiefenscharfe gibt. Das gut geschriebene Buch verdient Verbreitung und vor allem Resonanz bei denjenigen, deren Urteil liber Evers mit dem des Historikers nicht iibereinstimmt. Dr. Erika Richter Hans-Bodo Thieme: Herbert Evers, Landrat des Kreises Olpe von Ein politisches Leben in Widerspruchen, Olpe S , fur Mitglieder des Olper Heimatbundes 11,50. Schmallenberger Almanach 2002 Kalender gehorten friiher. als Gedrucktes teuer und daher selten war, neben den Gesangbuchern zum sparlichen Buchbesitz der landlichen Bevolkerung. Sie enthielten neben dem Kalendarium kurze Beitrage zur Belehrung und Unterhaltung und waren als Dorfchronik begehrter Lesestoff. Der Almanach Schmallenberger Sauerland" 2002 herausgegeben vom Westfalischen Schieferbergbaumuseum Holthausen und dem Heimat-und Geschichtsverein Schmallenberger Sauerland e.v. fiihrt alte Zielsetzungen in bewubt moderner Form fort. Er informiert nicht nur liber wichtige ortliche Einrichtungen, sondern auch liber grobere kommunale Zusammenhange wie die Beziehungen zum Hochsauerlandkreis. die Wirksamkeit des Landschaftsverbandes und uberregionale Institutionen wie hier das Fraunhoferinstitut in Grafschaft.Leider kann bei sehr begrenztem Raum eine Wiedergabe der Inhalte dieser Artikel nicht erfolgen. Auf einen entscheidenden Unterschied zu den Chroniken alten Stils sei aber nachdrucklich hingewiesen. Wahrend die alten Kalender nur.,handfeste" Informationen - das Religiose einmal ausgenommen - brachten, raumt der Almanach heute kunstlerischen Aspekten betont viel Raum ein. Bildende Kunstler der Gegenwart wie Hinrich Grauenhorst und Carl Siebert werden vorgestellt wie auch aus dem 19. Jahrhundert der Maler Josef Bergenthal. Daneben bringen Lyrikbeispiele, vorwiegend jahreszeitlich bestimmt, einen poetischen Ton in die Sammlung informativer Beitrage. Aber auch der historisch Interessierte findet Ungewohnliches wie den Originalbericht liber den Urkundenkasten auf dem Rittersitz Fredeburg 1597 mit hilfreichem Kommentar, auberdem vielfaltige Ausziige aus der Lokalzeitung des Jahres Den AbschluB bildet eine reich illustrierte Chronik 2001, die das Ortsgeschehen anschaulich festhalt. So konnen sich Freunde der Vergangenheit wie der Gegenwart in der Schatztruhe des Almanachs befriedigt wiederfinden. Dr. Erika Richter
56 NR. 1/ Cansteiner Erinnerungen III Wenn wir das nicht hatten, das Bilderbuch der Erinnerungen" sagte Hermann Hesse,"...ware es klaglich und elend. So aber sind wir reich." Gut gewahlt setzt Alexander von Elverfeldt den hier nur verkiirzt wledergegebenen Ausspruch Hesses dem 3. Tell seiner Autoblographle voran. Er hatte das Bilderbuch" seiner Erinnerungen schon vor Jahren aufgeblattert und uns zuerst den Zauber seiner Kindheit In Cansteln vermlttelt. Im 2. Tell schllderte er seinen Werdegang aus dem Sauerland hinaus bis in die USA und bis zu seiner EheschlielJung. Nun hat er seinen welteren Lebensweg 1957 bis 1990 dargestellt, und die Wiedergabe dieses vie! breiteren zeitlichen Abschnltts hat verstandlicherwelse Ihre elgene Schwierlgkelt. Hatte das Bllderbuch der Erinnerungen" In seinen ersten Teilen elnen zentralen Kern, so lassen die wachsenden dlverglerenden Aufgabenberelche kelne inhaltliche Geschlossenheit mehr zu. Das hat der Verfasser Im Untertltel selbst benannt: Familie, Betrieb, Ehrenamter. In seiner bekannten Erzahlfreude schildert er seine beruflichen Aktivitaten zuerst Im Familienunternehmen Metallwerke Neheim, dann seit 1962 In der Betriebsleitung des Gutes Cansteln. Auch der gutwlllige Leser wird da wohl stellenweise passen, wenn er die Probleme des Fertigungsablaufs der Metallfabrik oder spater in Cansteln die des Waldwegebaus genauestens erlautert bekommt. Aber er konstatiert, mlt welchem Engagement der Autor alle Ihm begegnenden Fragen angeht. Menschllch anriihrend die elterllche Freude uber die In kurzen Abstanden In den 60er Jahren geborenen drel Jungen und das Tochterchen. Mlt tiefer Zuneigung wird das Blld der jungen Mutter Helga v. Elverfeldt gezelchnet: strahlend helter und lebensfroh, klnderlieb, gastfreundlich und allem Schonen aufgeschlossen. Fine ihre Lleblingsbeschaftigungen, das Klettern auf Baume, wird bel einem Besuch Ihrer schleslschen Helmat geschlldert, die sle neunjahrig verlassen mubte. Dlese Ruckkehr in ihre Kinderwelt nennt der Verfasser eines der schonsten Erlebnlsse unserer Ehe". Rundbrlefe uber die Famillenerelgnlsse In den 70er Jahren sind eine heltere Chronik der zahlreichen Relsen und Gastbesuche aus aller Welt. Eln schmerzlicher Verlust fur die ganze Familie - der Jungste, das 6. Kind erst neunjahrig - 1st Helgas Krebstod 1984.Alexander v. Elverfeldt heiratet spater Ihre Nichte und lebt mlt ihr und zwel Madchen aus dleser Ehe an anderer Stelle in Cansteln, nachdem der alteste Sohn das Gut ubernommen hat. Der brelte Abschnltt uber die zahlreichen Ehrenamter (S ) In landund forstwirtschaftllchen und politischen Gremlen Ia t sich auch nicht annahernd wiedergeben. Er beeindruckt durch seine Vlelfalt und amuslert durch gelegentlich elngeschobene elgene Verse des Verfassers bel Jubllaen der jewelllgen Vereinsvorsltzenden. Erwahnenswert Elverfeldts Aufstleg zum Prasidenten des Deutschen Forstwlrtschaftsrates gerade als das Waldsterben die forstlichen Probleme In den Mittelpunkt offentllchen Interesses riickte und er dabei in vorderster Front" stand. Auch die welten Relsen in alle Kontinente werden lebendig berichtet, sle hler zu referieren wiirde jeden Rahmen sprengen. Insgesamt also eln wirkllch buntes" Erlnnerungsblld, das dem Leser veranschaullcht, wle das stllle, abgelegene Cansteln immer bewegter und weltoffener geworden ist. Dr. Edka Richter Alexander, I. Frh. von Elverfeldt, Cansteiner Erinnerungen (3) , 272 S., 13,-. Zu beziehen ijber: A. v. Elverfeldt sen., Am Echelnstein 12, Marsberg. Redaktionsschluss fiir die nachste Ausgabe ist der 15. Mai 2002 Altes Westfalen-Gedicht O, wle schoin is moln Westfalen. Lochtet wolt moin Helmatland. Wat iek segge IB keln prohlen, dorop giew iek deu de Hand. Aiken wasset do, stlur und machtlg, Roggen, Walten, Gerst und FlaB Und dal Menskenschlag sao deftig, dal kennt Ahrbet und aok SpaB. In derm Grund do sittet dat Oissen, Koulen foir de ganze Welt, und dat Val IE no te proisen wenn et slek um Schwolne halt. Un dai Mettwourst man recht droige, schlcket voi woltwlag orwern Rholn. Use Schinken sind de Tuige, denn voi trekket dat beste Schwoln. Aok beriihmt sind dal Saldoten, Isset Frieden, isset Krolg, dal mertet no met ollen Mohten, bo dai kummet, do gierret Sleg. Werner Konig aus Sundern Hovel bekam dieses Gedicht von einem heimatverbundenen Nachbarn und sandte es der Redaktion zu. Anmerkung der Redaktion: Das Gedicht ist wohl ein Produkt der Kaiserzeit. Heutige Westfalen wurden sich von einem derartigen Soldatenlob" entschieden distanzieren. Neue Mitglieder bzw. Abonnenten Wolfgang Wiebelhaus, Muhlhelm/Ruhr Beate Hummeler, Rottenbach Erhard Schafer, Arnsberg Christa Maas, Meschede Margret Worring, Meschede Maria VoB, Bestwlg-Nuttlar Heinz Brlnkmann, Soest Bernhard Kresin, Riithen Heinrich Thiesbrummel, RUthen Albrecht Holtmeler, Meschede Wolfgang Radin, Ruthen-Kallenhardt Dr. Josef Sauer, Balve Jurgen Schindler, Paderborn Lothar Schwarz, Meschede Magdalena Fischer-Brauckmann, Niederteufen (Schwelz) Johanna Reiter, Rodinghausen Clemens Becker-Jostes, Sundern Gottfried Pieper, Sundern Luzie Tigges, Sundern Ursula Schockemohle, Sundern Ferdi Pott, Sundern Mathilde Kordes, Sundern
57 56 NR. 1/2002 Dcr Schwammkloppcr Fredeburger Heimatblatter, 2002 Das jungste Heft des Arbeitskreises Heimat der SGV Abteilung Bad Fredeburg widmet sich auf 80 Seiten in 30 Aufsatzen einer Vielfalt regionaler Themen. Der inhaltliche Bogen ist weit gespannt. So finden sich meist kurzere Aufsatze mit den folgenden Schwerpunkten: Aniasse (Jubilaum der Frauengemeinschaft, Vorstellung eines Modells eines Schwammkloppers, Einweihung eines Brunnens, Ski-Club-Fredeburg), verschiedene Lebensbilder, historische Themata (Diebstahl von Futterklee , Jahrmarkte , Glocken in Fredeburg, Schutzpatron, Schwammklopper, Fostgeschichte, Schieferbergbau), Neuund Umbauten von Gebauden, Jugendund Angleraktivitaten, Dienstleistungen (Gastronomie, Gesundheitswesen). Dabei wahlen die Autoren als Mittel ihrer Tatigkeit auber der Darstellung auch mahnend kritische Worte. Sie geben Einblick in schwierige historische Lebensverhaltnisse. Das heutige Gemeinwesen spiegein gemeinschaftliche Tatigkeiten wieder, die dem Wohl aller Burger der Stadt dienen. Historische und aktuelle Fotos erganzen das inhaltlich ansprechende, liebevoll gestaltete und von jeglicher Reklame frei gehaltene Heft. Dr. Theo Bonemann Alme feiert Geburtstag 1050 Jahre wird das Dorf Almundoraf, Ort bei den Ulmen", wie es in einer Urkunde Kaiser Ottos L von 952 heibt, nun alt.grund genug fiir den Arbeitskreis Unser altes Alme", die Geschichte des Grenzortes zwischen Kurkoln und dem Hochstift Paderborn in grorformatiger Buchform zu prasentieren. Er konnte dabei auf das bisher nur maschinenschriftlich vorliegende Manuskript des geistlichen Oberstudienrates Dr. Josef Grafe (Jg. 1891) zuruckgreifen, das er 1962 vollendete, nachdem er seit 1956 aus dem Schuldienst im Ruhrgebiet verabschiedet war und in Alme seinen Lebensabend bis zu seinem Tod 1963 verbrachte. Grafe hat sich seinem Thema intensiv gewidmet. Er gliedert es in zwei Teile I. Das Dorf und II. Die Pfarrei. Er beginnt mit geologischen Erlauterungen, spurbar um eine auch fiir Laien verstandliche Vermittlung erdgeschichtlicher Prozesse bemijht. Es folgt ein breiterer Abschnitt Vorgeschichtliches", veranschaulicht auch durch Zeichnungen von im Aimer Raum gefundenen jungsteinzeitlichen Artefakte. Gelegentlich verrat die Darstellung den theologisch-moralisch wertenden Historiker..." zwar erreichte die religios-sittliche Verwilderung schon in der Mitte der jungeren Altsteinzeit (um 8000 v.chr.) ihren Tiefstand... Erst die Vollkultur fand um 600 v.chr langsam zu den religiosen Grundlagen der Urkultur zuruck und Weii die Menschen so reif werden fur die Erlosung" (S.14). Die geschichtliche Entwicklung im Mittelalter kennzeichnet er zunachst relativ ausfiihrlich,spatere historische Ereignisse sind dann nur in groben Zugen erwahnt. Eine sehr viel detailliertere, urkundengestiitzte Darstellung gilt anschliebend dem fur das Dorf wichtigen, weitverzweigten Geschlecht der von Meschede zu Alme, das sich seit dem spaten Mittelalter eine ausgedehnte Grundherrschaft um Ober- und Niederalme ausbaute. Nach wechselvollen Schicksalen ging sie 1769 in die Familie v. Buchholtz IJber Die Geschichte der Pfarrei Alme scheint den Autor personlich noch starker interessiert zu haben. Hier fordert er dem Leser stellenweise Geduld ab, wenn er auf vielen Textseiten verfolgen soil, wo etwa die erste Aimer Kirche gestanden hat. Da freut er sich, dar das Buch durch eine Fulle von Fotos (z.b. zahlreiche sehr instruktive Luftaufnahmen) Anschaulichkeit in den zuweilen sproden Text bringt. Sehr ausfiihrlich hat Grafe neben Aspekten wie Patronatsrecht, Kirchhof, Schule, Armenhaus und die Bedeutung des Archidiakonats Hallinghausen die Geschichte des Kirchengebaudes und seiner Innenausstattung erlautert, auch hier reich durch Fotos und Zeichnungen veranschaulicht. Der SchluB stellt Alme als Grenzort noch einmal in die Landesgeschichtc: seine konflikttrachtige Position zwischen Kurkoln und Paderborn, die mit der Bulle von 1821 ihr Ende findet, als das ehemalige Herzogtum Westfalen an die Diozese Paderborn fiel. Eine wertvolle Erganzung des Textes bietet Friedrich Gerhard Hohmann mit einer Biographie des Autors Josef Grafe. Den SchluR bildet die anschauliche Darstel- lung der Urkunde Kaiser Ottos I., die Alme zuerst erwahnt,fur den Leser noch einmal eine Erinnerung an die grobe Vergangenheit des Geburtstagskindes. Dr. Erika Richter Dr, Josef Grafe, Alme.Grenzort zwischen Kurkoln und dem Hocfistift Paderborn, Brilon 2001, Veriag Podzun. 103 S., 14,90 Euro. JOSEFA BERENS-TOTENOHL KINDERMARCHEM Neuauflage Das Schieferbergbau und Heimatmuseum Schmallenberg-Holthausen hat eine Neuauflage Die goldenen Eier", ein Marchenbuch mit 13 Marchen von Josefa Berens-Totenohl, versehen mit Scherenschnitten von Holde Overmann, herausgebracht. Die Erstauflage (1950) fiel einem Verlagsbrand zum Opfer. Nur wenige Exemplare sind vorhanden und sind antiqarisch kaum, oder iiberteuert aufzutreiben. Die jetzige Neuauflage umfasst 600 Exemplare. Das Bucli ist zu beziehen uber das Schieferbergbau und Heimatmuseum, Schmallenberg-Holthausen, ist 76 Seiten stark, mit einem Vorwort versehen und kostet 15,- Euro zzgl.verpackung und Versandkosten. BesachQn. ie uns im int«rn ^w.sauerlaender-heimatbiin
58 NR. 1/ Jahrbuch Hochsauerlandkrcis Berichte, Erzahlungen, Aufsatze, Gedichte Ausgabe 2002 Die 18. Ausgabe des Jahrbuch Hochsauerlandkreis 2002" bietet in 25 Beitragen eine breite Palette abwechslungsreicher Themen aus der Gegenwart und der Geschichte des Kreises. Zahlreiche ausdrucksstarke Bilder machen den Band nicht nur lesens- sondern auch sehenswert, was besonders auf den Bildbeitrag von Georg Hennecke Freizeitvergniigen im Sauerland" zutrifft. Zu einem der Schwerpunktthemen des vorliegenden Bandes uber Aktivitaten zur Integration unserer auslandischen MitbiJrger verfasste Dr. Erika Richter den Beitrag Wer versteht, wird verstanden". Heinz Pardun beleuchtet als ausgezeichneter Geschichtskenner das Zeitalter der Aufklarung und die Sakularisation der Kloster im Herzogtum Westfalen. Dr. Erika Richter wiederum erinnert an die Inbesitznahme des Sauerlandes durch Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt vor 200 Jahren. Ein sehr aktuelles Thema greift Michael Schmitt auf mit seinen Anmerkungen zu den Pastoralverbiinden im Erzbistum Paderborn. Was ware ein Jahrbuch ohne die Erinnerung an beruhmte Personlichkeiten aus der Region? Msgr. Dr. Wilhelm Kuhne bezeichnet Weihbischof Dr. Bernhard Prick als den grol^ten Sohn Hachens, und Josef Georg Pollmann verfasste einen Beitrag iiber den Forstwissenschaftler Bernhard Danckelmann zum hundertsten Todestag. Dr. Magdalena Padberg erinnert an den 175. Todestag von Friedrich Wilhelm Grimme und Dr. Gunther Gronau zeigt auf, dass Franz KeBler mehr als nur ein Heimat- und Geschichtsforscher war. Vor 100 Jahren wurde Ferdinand Wagener geboren. Mit dem Schriftsteller, Herausgeber und Verleger heimatbezogenen Schrifttums beschaftigt sich Dieter Wiethoff. Mit Ehrenamt und Null Bock auf Vereinsarbeit setzt sich Msgr. Dr. Konrad Schmidt auseinander. In seinem Beitrag Kulturgut Buch" tritt Herbert Somplatzki daftir ein,dass wir uns wieder mehr dem geschriebenen Wort zuwenden. Karl B. Thomas blattert in Amtsblattern und weist auf die groue Not vagabundiererder Kinder am Anfang des 19. Jahrhunderts hin. In dem Dienstvorschriften-Buch des Gendamerie-Wachtmeisters Franz Schmidt blattert Hans-Joachim Basse und findet manche zum Schmunzeln anregende Verordnung. Erst Kloster, dann Forstamt - was nun?" Clemens Muller beschaftigt sich mit der ungewissen Zukunft des Klosters Glindfeld. Carola Matthiesen erinnert an eine Kindheit im Sauerland und Dieter Wurm wiirdigt diese Schriftstellerin als Senryn- Meisterin. Uber die Verleihung des Wirtschaftpreises des HSK an Dieter Henrici berichtet Heinz Koerdt. Das Westdeutsche Wintersport-Museum in Winterberg-Neuastenberg stellt Barbel Michels vor und zeichnet seine Entstehung auf. In einem unterhaltsamen Beitrag erinnert sich Gerd Schulte an die Seifenkistenrennen in Neheim. Uber das Steinbildhauer-Symposium 2001 in Marsberg berichtet Stefanie Kochling. Den Metallbaumeister stellt Christine Kluge vor und den Steinbildhauermeister Helmut Gordes besucht Kathrin Dictus in seiner Werkstatt. Die Bob- und Rodelbahn Winterberg Hochsauerland feiert 25jahriges Jubilaum. Frank Kleine-Nathland weist in seinem Beitrag auf die Geschichte, zahlreiche Hohepunkte und Meisterschaften hin. Im Ruckblick aus dem Kreisarchiv aus der Zeit von 802 bis 2002 stellte Norbert Fockler interessante Daten und Fakten zusammen. Das Jahrbuch ist im Podszun-Verlag erschienen und im heimischen Buchhandel erhaltlich. Heinz-Josef Padberg Stadt und Land im Wandel Mit der Baugeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts in Menden und Lendringsen befal^t sich Theo Bonemann in einem aus den geschichtlichen Quellen gut dokumentierten Buch. Dabei geht die Arbeit iiber die nur bauliche Erforschung hinaus und stellt sie in ubergreifende Zusammenhange, um Wechselwirkungen zwischen Hausbau, wirtschaftlicher Entwicklung und Bev5lkerungsentwicklung deutlich zu machen. Der generalisierenden These, die Mendener Bautradition dem Typ eines Ackerburgerstadtchens" zu unterstellen, widerspricht Bonemann. Er sieht in den vorkommenden Haustypen eine soziale Hierarchie" gespiegelt, die sich in den Gebauden der Geistlichkeit, der Handler, Handwerker, Bauern, Tagelohner und Armen darstellt. Dementsprechend reicht ihm auch nicht die typisierende Gegeniiberstellung von Bauernhaus und Burgerhaus, weil in diesem Schema der tatsachliche Hausbestand jener Zeiten nicht einzuordnen ist. Nach einer Beschreibung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen im 18. und 19. Jahrhundert, der darin wurzelnden Berufsstruktur und dem sich im 19. Jahrhundert ereignenden Wandel, werden Hausbau und Wohnen in Lendringsen und Menden mit zahlreichen Beispielen beschrieben. Die je vorgestellten Hauser sind Hofe und Kotten, Hallenhaus und Kleinhaus, Hospital und Pfarrhaus. Die untersuchten Gebaude werden in exzellenten, meist historischen Fotos vorgestellt, mit GrundriBzeichnungen beschrieben und mit Angaben zu Alter, Funktion, wechselnden Besitzverhaltnissen und Geschichte sorgfaltig charakterisiert. Alle vorgestellten Hauser, seien sie stattlich oder bescheiden, bestechen durch eine Ausstrahlung, die Identifikation erlaubt. Leider enden viele Bildbeschreibungen mit dem Hinweis auf einen erfolgten AbriK in den letzten Jahrzehnten. Die Untersuchung schliert ihrerseits einen Blick auf die Entwicklung von Menden und Lendringsen im letzten Jahrhundert aus. Was die geschichtsvergessenen sechziger und siebziger Jahre insgesamt an regionaler Identitat getilgt haben, bleibt Ortsunkundigen auf diese Weise verborgen, wird aber auch dem Einheimischen nicht expressis verbis in einem Ausblick vor Augen gestellt. Theo Bonemann hat mit diesem Buch iiber Menden hinaus einen MaBstab ge- Fortsetzung auf Seite 58
59 58 NR. 1/2002 PERSONALIEN Paul MuUer f Am 8. Dezember 2001 starb im Alter von 76 Jahren Paul Miiller aus Eslohe. Er war / Mitgriinder des plattdeutschen Arbeitskreises Eslohe im Jahre 1976 und iibcr 23 Jahre Vorsitzender des plattdeutschen Arbeitskreises. Dieser hat Paul Muller viel zu verdanken. Sein grores Anliegen gait dem Erhalt der plattdeutschen Sprache. Innerhalb der Kolpingsfamilie war er ein besonderer Freund des Theaters und brachte oftmals auch plattdeutsche Stucke und Sketche zur Auffuhrung. Ferner sorgte er dafiir, dass regelmabig plattdeutsche Messen und Andachten gehalten wurden. Er regte plattdeutsche Lesewettbewerbe in den Schulen an und war gem gesehener Gast beim Unterricht in plattdeutscher Sprache vor allem in der Christine-Koch-Hauptschule in Eslohe. Gerade hier verstand er es mit seinen fesselnden Geschichten und seiner humorigen Art junge Menschen fiir die plattdeutsche Sprache zu begeistern. Unvergessen sind die schonen plattdeutschen Abende unter Leitung von Paul Miiller, seine sauerlandische Art und sein gesunder Humor. Gem zeigte er sich als Gastgeber, wenn der Sauerlander Heimatbund den plattdeutschen Tag in Eslohe veranstaltete. Er hielt auch den Kontakt zu vielen plattdeutschen Freunden im ganzen kurkolnischen Sauerland durch seine Vorstandsarbeit bei den Plattdeutschen im Saueriander Heimat- Fortsetzung uon Seite 57 setzt, wie die Geschichte des Bauens und Wohnens in Dorf und Stadt aufgearbeitet und vermittelt werden kann. Auf der Basis solcher Untersuchungen bildet sich ein aktives GeschichtsbewuBtsein, das detaillierte Kenntnis mit Verantwortung fur alle baulichen Vorgange der Gegenwart verbindet. Insofem ware zu wunschen, dab solche Arbeiten auch anderen Orts entstehen als Grundlage fur den Denkmalschutz, fur Ortssatzungen und bund. Den plattdeutschen Arbeitskreis Eslohe vertrat er in diesem Gremium bis zum Schluss. Wir alle konnen Paul Miiller am besten danken, wenn wir in seinem Sinne uns fur den Erhalt des Plattdeutschen im Sauerland einsetzen. Walter Schulte Frau Dr. Marieluise Scheibner, stellv. Vorsitzende des Briloner Heimatbundes, vollendete am 16. November 2001 das 70. Lebensjahr. Nach dem Studium der Romanistik. Germanistik und Geologie wurde sie Dozentin an den Goethe-lnstituten in Bad Aibling und in Brilon. Mit vorbildlichem Engagement hat sie sich fur den Ausbau des Briloner Stadtmuseums und besonders der Abteilung Geologie"eingesetzt. Ihrsind auch verschiedene wissenschaftlich fundierte Beitrage zum sauerlandischen Schrifttum zu danken. So durfen wir auf ihren in der vorliegenden Ausgabe unserer Zeitschrift enthaltenen Aufsatz Zur Geschichte des Warsteiner Erzbergbaus" hinweisen. Dr. A. M. Unser Heimatfreund Edward Kersting, einer der bekanntesten Unternehmer im kurkolnischen Sauerland, wurde am 26. Januar Jahre alt. Als langjahriger Vorsitzender des Unternehmensverbandes slldostliches Westfalen und als Vizeprasident der Industrie- und Handelskammer Arnsberg hat er sich mit Erfolg fur die Forderung der mittelstandischen Wirtschaft in unserer sauerlandischen Heimat eingesetzt. Die von ihm geleitete 01sberger Hiitte" zahlt mit ihrer uber 400 jahrigen alle damit verbundenen Gestaltungsfragen. Hervorzuheben ist die gute Ausstattung des Buches: die Fotos sind hervorragend wiedergegeben, die typografische Gestaltung ist nobel, Papier und Druck beachtenswert. Prof. Dr. Hubertus Halbfas Theo Bonemann, Stadt und Land im Wandel. Bauen. Wohnen und Wirtschaften im 18. und 19. Jahrhundert in Menden und Lendringsen. Menden Seiten. fester Einband. Selbstuerlag Bonemann, SauerlandstraBe 15, Menden. Geschichte zu den altesten Industriebetrieben Deutschlands. Fur seine Verdienste, zu denen auch seine ehrenamtlichen Aktivitaten im kirchlichen, sozialen und heimatkundlichen Bereich gehoren, wurde er 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Dr A. M.. Zeitsctirift des Sauerlander Heimatbundes (fruher Trutznachtigall, Heimwacht und Sauerlandruf) 35. Jahrgang Heft 1 Mijrz 2002 ISSNO Herausgeber und Verlag: Saueriander Heimatbund e. v.. Postfach 14 65, Meschede Vorsitzender: Dieter Wurm, Am Hainberg 8 a, Meschede, Tel. (02 91) p. Fax (02 91) p d. Fax Stellv, Vorsitzende: Wilma Ohly, Goerdelerweg 7, Olpe. Tel. ( ) Ehrenvorsitzender: Dr. Adalbert MUllmann. Jupiterweg Brilon, Tel. ( ) Geschaftsstelle: Hochsauerlandkreis. Fachdienst Kultur/Musikschule, Thomas Schmidt. Tel. (02 91) UUa Schmalt, Tel. (02 91) , Telefax (02 91) , kultur@hochsauerlandkreis.de, Postfach Meschede Internet: Konten: Sparkasse Arnsberg-Sundern (BLZ ) Jahresbeitrag zum Sauerlander Heimatbund einschliel^lich des Bezuges dieser Zeitschrift Einzelpreis 5,-. Erscheinungsweise vierteljahrlich. Redaktion: Friedhelm Ackermann, Arnsberg. Gunther Becker. Lennestadt. Susanne Falk. Lennestadt, Professor Dr Hubertus Halbfas. Drolshagen. Heinz Lettermann, Bigge-Olsberg. Dr. Adalbert MUllmann. Brilon. Heinz-Josef Padberg, Meschede. Knut Friedrich Platz, Olpe. Dr. Erika Richter, Meschede. Michael Schmitt, Sundern. Dieter Wiethoff. Meschede. Schlussredaktion: Friedhelm Ackermann, Kohlerweg 1, Arnsberg, Tel. ( ) Fax ( ) , frackermann@t-online.de. Hans Wevering, SchloBstraRe 54, Arnsberg. Tel. ( ) 32 62, Fax ( ) hanswevering@cityweb.de. Redaktionsanschrift: Sauerlander Heimatbund, Postfach 14 65, Meschede Layout und techn. Redaktion: Hans Wevering, Schlo8stra(5e 54, Arnsberg, Tel. ( ) 32 62, Fax ( ) , hanswevering@cityweb.de. Anzeigenverwaltung: F. W. Becker GmbH, GrafenstraBe 46, Arnsberg, Tel. ( ) , Fax ( ) Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr 8 vom 1, Januar Gesamtherstellung: F. W. Becker GmbH. Druckerei und Verlag, GrafenstraBe 46, Arnsberg, Tel. ( )
60 WARTEN SIE NICL FUR SIE SORGT. SPARKASSEN-PRIVATVORSORGE. Sparkasse Rechtzeitig fur den Ruhestand vorsorgen. Mit Pramiensparen, Immobilien, Lebensversicherung, DekaConcept. Und wir rechnen auch fur Sie aus, was so zu Ihrer Rente dazukommt. Die sprivatvorsorge. Wenn's unn Geld geht - Sparkasse s
61 \ JS-'T^r: estheimer v^e/nyi>m Graflich zu Stolberg'sche Brauerei Westheim im Sauerland Kasseler StraKe Marsberg-Westheim Telefon / Fax prost@brauerei-westheim.de k ">s C/f 'err a^s^^"-"^ ^^^ (77 :^.-^
Institut St. Josef Schulen der Kreuzschwestern am Ardetzenberg, Feldkirch Leitbild
 Institut St. Josef Schulen der Kreuzschwestern am Ardetzenberg, Feldkirch Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Vorarlberger Mittelschule Leitbild Präambel
Institut St. Josef Schulen der Kreuzschwestern am Ardetzenberg, Feldkirch Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Vorarlberger Mittelschule Leitbild Präambel
Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert
 Geschichte Julia Schriewer Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S. 3 2. Der Weg ins Kloster S. 5 3. Das Leben im Kloster
Geschichte Julia Schriewer Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S. 3 2. Der Weg ins Kloster S. 5 3. Das Leben im Kloster
R U F B E R U F B E R U F U N G
 R U F B E R U F B E R U F U N G Foto: EstherBeutz Wo leben Ordensfrauen? Ordensfrau was ist das? Das Leben der Ordensfrauen ist vielfältig und zeitlos. Ordensfrauen eint, dass sie in Gemeinschaft leben.
R U F B E R U F B E R U F U N G Foto: EstherBeutz Wo leben Ordensfrauen? Ordensfrau was ist das? Das Leben der Ordensfrauen ist vielfältig und zeitlos. Ordensfrauen eint, dass sie in Gemeinschaft leben.
PREDIGT: Epheser Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
 PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
Anton Josef Binterim ( )
 Anton Josef Binterim (1779-1855) Libelli Rhenani Schriften der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek zur rheinischen Kirchen- und Landesgeschichte sowie zur Buch- und Bibliotheksgeschichte Herausgegeben
Anton Josef Binterim (1779-1855) Libelli Rhenani Schriften der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek zur rheinischen Kirchen- und Landesgeschichte sowie zur Buch- und Bibliotheksgeschichte Herausgegeben
Hirtenwort des Erzbischofs
 Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs zur Veröffentlichung des Pastoralen Orientierungsrahmens Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs
Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs zur Veröffentlichung des Pastoralen Orientierungsrahmens Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs
Ich, der neue Papst! II
 Ich, der neue Papst! II 3 Jeder Papst hat sein eigenes Wappen. Gestalte dein eigenes Wappen. Denke dabei an die Dinge, die du in deinem Profil geschrieben hast. 4 Was möchtest du mit der Gestaltung deines
Ich, der neue Papst! II 3 Jeder Papst hat sein eigenes Wappen. Gestalte dein eigenes Wappen. Denke dabei an die Dinge, die du in deinem Profil geschrieben hast. 4 Was möchtest du mit der Gestaltung deines
Willkommen! In unserer Kirche
 Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
 André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
Predigt über die Lutherrose 22. So n Trin, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
 Predigt über die Lutherrose 22. So n Trin, 29.10.2017 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein feste Burg ist unser Gott das ist wohl das bekannteste
Predigt über die Lutherrose 22. So n Trin, 29.10.2017 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein feste Burg ist unser Gott das ist wohl das bekannteste
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen Weltreligionen - Die fünf Weltreligionen für Kinder aufbereitet Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen Weltreligionen - Die fünf Weltreligionen für Kinder aufbereitet Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8
 Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8 Charles Henry Mackintosh Heijkoop-Verlag,online seit: 28.10.2003 soundwords.de/a780.html SoundWords 2000 2017. Alle
Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8 Charles Henry Mackintosh Heijkoop-Verlag,online seit: 28.10.2003 soundwords.de/a780.html SoundWords 2000 2017. Alle
Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen.
 Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen. Lieber Leser Die Welt ist voll von Menschen, die sich die Frage ihrer Existenz stellen. Es gibt viele gute Ansätze, wie man darüber nachsinnt, was nach dem Tode
Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen. Lieber Leser Die Welt ist voll von Menschen, die sich die Frage ihrer Existenz stellen. Es gibt viele gute Ansätze, wie man darüber nachsinnt, was nach dem Tode
Thema: Maria Magdalena Frage an Alle: Was wisst ihr über Maria Magdalena?
 1 Thema: Maria Magdalena Frage an Alle: Was wisst ihr über Maria Magdalena? Das erste Mal wird sie in Lukas 8,2 erwähnt.... und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden
1 Thema: Maria Magdalena Frage an Alle: Was wisst ihr über Maria Magdalena? Das erste Mal wird sie in Lukas 8,2 erwähnt.... und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING LUDWIGSHAFEN
 KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING 52 67069 LUDWIGSHAFEN 1. ALLGEMEINER TEIL DER KINDERTAGESSTÄTTEN ST. ALBERT, MARIA KÖNIGIN, ST. MARTIN 1 & ST. MARTIN 2 SEITE 2 TRÄGERSCHAFT DIE TRÄGERSCHAFT
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING 52 67069 LUDWIGSHAFEN 1. ALLGEMEINER TEIL DER KINDERTAGESSTÄTTEN ST. ALBERT, MARIA KÖNIGIN, ST. MARTIN 1 & ST. MARTIN 2 SEITE 2 TRÄGERSCHAFT DIE TRÄGERSCHAFT
LEITBILD. Kloster Gemünden. Kreuzschwestern Bayern. Provinz Europa Mitte
 LEITBILD Kloster Gemünden Kreuzschwestern Bayern Provinz Europa Mitte Kloster Gemünden Präambel Die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz (Kreuzschwestern) sind eine internationale franziskanische
LEITBILD Kloster Gemünden Kreuzschwestern Bayern Provinz Europa Mitte Kloster Gemünden Präambel Die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz (Kreuzschwestern) sind eine internationale franziskanische
Zieh dir eine Frage an Martin Luther oder stelle ihm eine eigene Frage, die dich interessiert:
 Zieh dir eine Frage an Martin Luther oder stelle ihm eine eigene Frage, die dich interessiert: Wann hast du Geburtstag? Ich wurde am 10. November 1483 geboren. Wie alt bist du geworden? Ich wurde 62 Jahre
Zieh dir eine Frage an Martin Luther oder stelle ihm eine eigene Frage, die dich interessiert: Wann hast du Geburtstag? Ich wurde am 10. November 1483 geboren. Wie alt bist du geworden? Ich wurde 62 Jahre
Mariae Aufnahme in den Himmel - LJ C 15. August 2013
 Mariae Aufnahme in den Himmel - LJ C 15. August 2013 Lektionar III/C, 429: Offb 11,19a; 12,1 6a.10ab; 2. L 1 Kor 15,20 27a; Ev Lk 1,39 56 Heute feiern wir so etwas wie unser aller Osterfest, denn das Fest
Mariae Aufnahme in den Himmel - LJ C 15. August 2013 Lektionar III/C, 429: Offb 11,19a; 12,1 6a.10ab; 2. L 1 Kor 15,20 27a; Ev Lk 1,39 56 Heute feiern wir so etwas wie unser aller Osterfest, denn das Fest
Er E ist auferstanden
 Er ist auferstanden Zeugnisse über Jesus Christus Das Zeugnis von Johannes dem Täufer Jesus Christus ist einmalig! Er starb am Kreuz, um Sünder zu erretten. Doch drei Tage danach ist Er aus dem Tod auferstanden.
Er ist auferstanden Zeugnisse über Jesus Christus Das Zeugnis von Johannes dem Täufer Jesus Christus ist einmalig! Er starb am Kreuz, um Sünder zu erretten. Doch drei Tage danach ist Er aus dem Tod auferstanden.
Predigt zu Römer 8,32
 Predigt zu Römer 8,32 Wie frustrierend muss das sein, wenn man so ein schönes Geschenk hat und niemand möchte es annehmen. Ich hoffe, dass euch so etwas nicht passiert schon gar nicht heute am Heilig Abend.
Predigt zu Römer 8,32 Wie frustrierend muss das sein, wenn man so ein schönes Geschenk hat und niemand möchte es annehmen. Ich hoffe, dass euch so etwas nicht passiert schon gar nicht heute am Heilig Abend.
Alt und Neu in Lauperswil
 Alt und Neu in Lauperswil In Ihren Händen halten Sie das neue Leitbild der Kirchgemeinde Lauperswil. In einem spannenden Prozess haben Mitarbeitende, Kirchgemeinderat und Pfarrpersonen die für die Kirchgemeinde
Alt und Neu in Lauperswil In Ihren Händen halten Sie das neue Leitbild der Kirchgemeinde Lauperswil. In einem spannenden Prozess haben Mitarbeitende, Kirchgemeinderat und Pfarrpersonen die für die Kirchgemeinde
Bibel-Teilen Schriftgespräch als eine Form, Liturgie zu feiern
 Bibel-Teilen Schriftgespräch als eine Form, Liturgie zu feiern Der hier empfohlene Bibeltext spricht von den Zeichen der Zeit. Im Hintergrund steht die Mahnung Jesu zur Umkehr, um dem drohenden Gericht
Bibel-Teilen Schriftgespräch als eine Form, Liturgie zu feiern Der hier empfohlene Bibeltext spricht von den Zeichen der Zeit. Im Hintergrund steht die Mahnung Jesu zur Umkehr, um dem drohenden Gericht
Das feiern wir heute, am Fest der heiligsten Dreifaltigkeit.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Silbernen Priesterjubiläum von Herrn Prof. Knut Backhaus in Kirchdorf an der Amper am 19. Mai 2013 Kein Mensch kann in den
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Silbernen Priesterjubiläum von Herrn Prof. Knut Backhaus in Kirchdorf an der Amper am 19. Mai 2013 Kein Mensch kann in den
1. Bibel verstehen: 18 Stunden
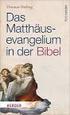 Curriculum für das Fach Katholische Religionslehre (Fassung vom September 2009) KLASSE 10: 1. Bibel verstehen: 18 Stunden - Voraussetzungen für einen kritischen, wissenschaftlich reflektierten Umgang mit
Curriculum für das Fach Katholische Religionslehre (Fassung vom September 2009) KLASSE 10: 1. Bibel verstehen: 18 Stunden - Voraussetzungen für einen kritischen, wissenschaftlich reflektierten Umgang mit
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER
 ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ARBEITSHILFE FUR DEN TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS 2015
 ARBEITSHILFE FUR DEN TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS 2015 Fest der Darstellung des Herrn Tag des Gott geweihten Lebens 2. FEBRUAR ABENDLOB FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN, TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS Leitwort
ARBEITSHILFE FUR DEN TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS 2015 Fest der Darstellung des Herrn Tag des Gott geweihten Lebens 2. FEBRUAR ABENDLOB FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN, TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS Leitwort
Gnade sei mit euch. Liebe Gemeinde! Immer auf den Stern schauen, alles andere wird sich finden.
 Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde! Immer auf den Stern schauen, alles andere wird sich finden. Das Evangelium für den Epiphaniastag steht bei Matthäus, im 2. Kapitel: Da Jesus geboren war zu Bethlehem
Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde! Immer auf den Stern schauen, alles andere wird sich finden. Das Evangelium für den Epiphaniastag steht bei Matthäus, im 2. Kapitel: Da Jesus geboren war zu Bethlehem
Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben<<
 Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben
Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben
Maria Mutter der Menschen
 Maiandacht mit eigenen Texten und Texten aus dem Gotteslob Maria Mutter der Menschen (Hinweis zur Durchführung: Die Maiandacht kann auch gekürzt werden, in dem das Rosenkranzgebet entfällt. Außerdem können
Maiandacht mit eigenen Texten und Texten aus dem Gotteslob Maria Mutter der Menschen (Hinweis zur Durchführung: Die Maiandacht kann auch gekürzt werden, in dem das Rosenkranzgebet entfällt. Außerdem können
seit dem 1. Juli 2014 hat der Seelsorgebereich Neusser Süden keinen leitenden
 Sperrfrist bis 18. Mai 2016 An alle Gemeindemitglieder der Pfarreien in den Seelsorgebereichen Neusser Süden und Rund um die Erftmündung sowie die Pastoralen Dienste und die kirchlichen Angestellten Köln,
Sperrfrist bis 18. Mai 2016 An alle Gemeindemitglieder der Pfarreien in den Seelsorgebereichen Neusser Süden und Rund um die Erftmündung sowie die Pastoralen Dienste und die kirchlichen Angestellten Köln,
MISSIONARIN DER NÄCHSTENLIEBE Heilige Mutter Teresa von Kalkutta
 Heilige Mutter Teresa von Kalkutta Eine Ausstellung mit Fotos von Karl-Heinz Melters Am 26. August 1910 wird Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje im heutigen Mazedonien geboren. Schon mit 12 Jahren will sie
Heilige Mutter Teresa von Kalkutta Eine Ausstellung mit Fotos von Karl-Heinz Melters Am 26. August 1910 wird Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje im heutigen Mazedonien geboren. Schon mit 12 Jahren will sie
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
+ die Kirche. Eine Einführung. M.E., September Alle Bilder selbst produziert oder Gemeingut/Public Domain.
 + die Kirche Eine Einführung. M.E., September 2012. Alle Bilder selbst produziert oder Gemeingut/Public Domain. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist allmächtig er kann alles tun, was er will. Er
+ die Kirche Eine Einführung. M.E., September 2012. Alle Bilder selbst produziert oder Gemeingut/Public Domain. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist allmächtig er kann alles tun, was er will. Er
bindet Gott Maria unlösbar an Jesus, so dass sie mit ihm eine Schicksalsgemeinschaft bildet.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
St. Maria Magdalena. Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße. Teil 1 -bis 1390-
 St. Maria Magdalena Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße Teil 1 -bis 1390- Seit wann gab es in (Ober)-Bergstraße eine Kapelle? Wo hat sie gestanden? Wie hat sie ausgesehen? Größe? Einfacher Holzbau
St. Maria Magdalena Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße Teil 1 -bis 1390- Seit wann gab es in (Ober)-Bergstraße eine Kapelle? Wo hat sie gestanden? Wie hat sie ausgesehen? Größe? Einfacher Holzbau
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zum Pfingstfest in der Abteikirche Kloster Ettal am 8.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zum Pfingstfest in der Abteikirche Kloster Ettal am 8. Juni 2014 In der Klosterbibliothek von Melk findet sich ein Bild, das
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zum Pfingstfest in der Abteikirche Kloster Ettal am 8. Juni 2014 In der Klosterbibliothek von Melk findet sich ein Bild, das
16. Februar 2014; Andreas Ruh. 1. Petrus 2,9; Luk. 5,1-11
 16. Februar 2014; Andreas Ruh 1. Petrus 2,9; Luk. 5,1-11! Einführung in die Herzschlag Kampagne! Wer bist du? (Nicht was machst du?) Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid
16. Februar 2014; Andreas Ruh 1. Petrus 2,9; Luk. 5,1-11! Einführung in die Herzschlag Kampagne! Wer bist du? (Nicht was machst du?) Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid
13 Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren
 Predigt von Bischof Prof. Dr. Martin Hein im Gottesdienst zur Namensgebung der Evangelischen Grundschule Schmalkalden am 06.04.2008 (Miserikordias Domini) in der Stadtkirche St. Georg zu Schmalkalden (
Predigt von Bischof Prof. Dr. Martin Hein im Gottesdienst zur Namensgebung der Evangelischen Grundschule Schmalkalden am 06.04.2008 (Miserikordias Domini) in der Stadtkirche St. Georg zu Schmalkalden (
Spiritualität im Alltag Ettaler. Klostergespräche. Katholisches Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e.v.
 2016 2017 Spiritualität im Alltag Ettaler Klostergespräche Katholisches Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e.v. Spiritualität im Alltag Ettaler Klostergespräche Mit unseren Ettaler Klostergesprächen
2016 2017 Spiritualität im Alltag Ettaler Klostergespräche Katholisches Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e.v. Spiritualität im Alltag Ettaler Klostergespräche Mit unseren Ettaler Klostergesprächen
Wir feiern heute ein ganz außergewöhnliches Jubiläum. Nur sehr wenige Kirchengebäude
 Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Bewegung, liebe Gemeinde, ist Zeichen und Ausdruck von Leben und Lebendigkeit!
 1 Predigt über Ex. 13, 21+22 zum Abschlussgottesdienst des 2. Tages rheinischer Presbyterinnen und Presbyter am 9. Mai in Koblenz von Präses Nikolaus Schneider liebe Gemeinde, Bewegung ist gut und tut
1 Predigt über Ex. 13, 21+22 zum Abschlussgottesdienst des 2. Tages rheinischer Presbyterinnen und Presbyter am 9. Mai in Koblenz von Präses Nikolaus Schneider liebe Gemeinde, Bewegung ist gut und tut
1 B Kloster: Gelübde. 1 A Kloster: Mönch. Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters?
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? 1 C Kloster: Nonne Wie nennt
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? 1 C Kloster: Nonne Wie nennt
O Seligkeit, getauft zu sein
 Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr die Zeit, in der die Freude
Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr die Zeit, in der die Freude
Trier-Wallfahrt Hl. Messe am Vorabend von Christi Himmelfahrt (24. Mai)
 Hl. Messe am Vorabend von Christi Himmelfahrt (24. Mai) P: Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Segen spendende Gegenwart tragen wir dir unsere Anliegen vor: V: Hilf uns, Wege des Glaubens zu finden,
Hl. Messe am Vorabend von Christi Himmelfahrt (24. Mai) P: Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Segen spendende Gegenwart tragen wir dir unsere Anliegen vor: V: Hilf uns, Wege des Glaubens zu finden,
B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden. A Mönch C Nonne D Augustiner-Orden
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
Entscheidungen. Inspiration herbeiführen
 Wozu bist Du da, Kirche in, wenn Diskussionen nur um Besitzstände kreisen? Wann ist eine Entscheidung geistlich? Mit Gleichgesinnten unterwegs sein. Entscheidungen durch Beteiligung und geistliche Inspiration
Wozu bist Du da, Kirche in, wenn Diskussionen nur um Besitzstände kreisen? Wann ist eine Entscheidung geistlich? Mit Gleichgesinnten unterwegs sein. Entscheidungen durch Beteiligung und geistliche Inspiration
JAHRESPLANUNG Schulstufe 1
 JAHRESPLANUNG Schulstufe 1 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Wer bin ich? Wer ich für andere bin LP / Kompetenzen 1 Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und
JAHRESPLANUNG Schulstufe 1 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Wer bin ich? Wer ich für andere bin LP / Kompetenzen 1 Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und
Päpstliche Missionswerke in Österreich. Gebete
 Päpstliche Missionswerke in Österreich Gebete 2 Noch nie hatte die Kirche so wie heute die Möglichkeit, das Evangelium durch das Zeugnis und das Wort allen Menschen und allen Völkern zukommen zu lassen.
Päpstliche Missionswerke in Österreich Gebete 2 Noch nie hatte die Kirche so wie heute die Möglichkeit, das Evangelium durch das Zeugnis und das Wort allen Menschen und allen Völkern zukommen zu lassen.
Gott ist Geist und Liebe...
 Gott ist Geist und Liebe... Lasst uns Ihn anbeten und Ihm gehorchen gemäss dem, was Er ist 11/21/05 Ein Brief von Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören Denkt daran, wenn ihr das Wort Gottes
Gott ist Geist und Liebe... Lasst uns Ihn anbeten und Ihm gehorchen gemäss dem, was Er ist 11/21/05 Ein Brief von Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören Denkt daran, wenn ihr das Wort Gottes
HIMMELFAHRT bis TRINITATIS
 HIMMELFAHRT bis TRINITATIS Samstag nach Exaudi Die wartende Gemeinde Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Joh 12,32 Eröffnung [Zum Entzünden einer Kerze:
HIMMELFAHRT bis TRINITATIS Samstag nach Exaudi Die wartende Gemeinde Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Joh 12,32 Eröffnung [Zum Entzünden einer Kerze:
Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung
 Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung VORSCHALG FÜR EINE EUCHARISTISCHE ANBETUNGSSTUNDE* 1. SEPTEMBER 2015 *Vorbereitet vom Päpstlichen Rat Iustitia et Pax.
Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung VORSCHALG FÜR EINE EUCHARISTISCHE ANBETUNGSSTUNDE* 1. SEPTEMBER 2015 *Vorbereitet vom Päpstlichen Rat Iustitia et Pax.
Weihnachtsgeschichte. Die. Jesus Christus wurde geboren, um für DICH zu sterben!
 Die Weihnachtsgeschichte Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Schon Wochen vorher bereiten sich die Menschen auf das Weihnachtsfest vor. Im Adventskalender werden die Tage gezählt. Und wenn es dann
Die Weihnachtsgeschichte Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Schon Wochen vorher bereiten sich die Menschen auf das Weihnachtsfest vor. Im Adventskalender werden die Tage gezählt. Und wenn es dann
4. Sonntag im Jahreskreis C Jesus in Nazareth 2. Teil. an den beiden vergangenen Sonntag hörten wir davon, wie Jesus erstmalig öffentlich
 4. Sonntag im Jahreskreis C 2010 Jesus in Nazareth 2. Teil Liebe Schwestern und Brüder, an den beiden vergangenen Sonntag hörten wir davon, wie Jesus erstmalig öffentlich auftrat, wie Er in einer Predigt
4. Sonntag im Jahreskreis C 2010 Jesus in Nazareth 2. Teil Liebe Schwestern und Brüder, an den beiden vergangenen Sonntag hörten wir davon, wie Jesus erstmalig öffentlich auftrat, wie Er in einer Predigt
Wechselseitige Taufanerkennung Geschichte und Bedeutung
 Wechselseitige Taufanerkennung Geschichte und Bedeutung Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens
Wechselseitige Taufanerkennung Geschichte und Bedeutung Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens
Zeichen des Heils - Die Sakramente verstehen II BnP am
 Zeichen des Heils - Die Sakramente verstehen II BnP am 17.4.2016 Mt 28:16-20 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm
Zeichen des Heils - Die Sakramente verstehen II BnP am 17.4.2016 Mt 28:16-20 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm
Vorwort.... Die Gemeinde Ebersheim Geschichtliches über Ebersheim Ur- und Frühgeschichte von Ebersheim Leben und arbeiten in der Gemeinde Alte Ansicht
 VERGANGENES AUF BILDERN FESTGEHALTEN HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH ECKERT Vorwort.... Die Gemeinde Ebersheim Geschichtliches über Ebersheim Ur- und Frühgeschichte von Ebersheim Leben und arbeiten in der
VERGANGENES AUF BILDERN FESTGEHALTEN HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH ECKERT Vorwort.... Die Gemeinde Ebersheim Geschichtliches über Ebersheim Ur- und Frühgeschichte von Ebersheim Leben und arbeiten in der
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29.
 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG WARUM TAUFEN WIR: MT 28,16-20
 GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
ALTENHEIM ST. JOSEF Brandtstraße Hattingen Telefon / Telefax /
 ALTENHEIM ST. JOSEF B 51 L 705 L 924 L 924 B 51 A3 ALTENHEIM ST. JOSEF Brandtstraße 9 45525 Hattingen Telefon 0 23 24 / 59 96 0 Telefax 0 23 24 / 59 96 60 altenheim.st.josef@t-a-s.net www.t-a-s.net Anfahrt
ALTENHEIM ST. JOSEF B 51 L 705 L 924 L 924 B 51 A3 ALTENHEIM ST. JOSEF Brandtstraße 9 45525 Hattingen Telefon 0 23 24 / 59 96 0 Telefax 0 23 24 / 59 96 60 altenheim.st.josef@t-a-s.net www.t-a-s.net Anfahrt
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Pfingstfest am 4. Juni 2017 in St. Michael-Berg am Laim
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Pfingstfest am 4. Juni 2017 in St. Michael-Berg am Laim Was hat unser heutiges Pfingstfest mit dem Pfingsten vor 2000 Jahren
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Pfingstfest am 4. Juni 2017 in St. Michael-Berg am Laim Was hat unser heutiges Pfingstfest mit dem Pfingsten vor 2000 Jahren
Domvikar Michael Bredeck Paderborn
 1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
Freiheit Wahrheit Evangelium : große Reformationsausstellung ab 14. September
 UNESCO-Denkmal Kloster Maulbronn Freiheit Wahrheit Evangelium : große Reformationsausstellung ab 14. September Am 14. September öffnet im Kloster Maulbronn die Ausstellung Freiheit Wahrheit Evangelium.
UNESCO-Denkmal Kloster Maulbronn Freiheit Wahrheit Evangelium : große Reformationsausstellung ab 14. September Am 14. September öffnet im Kloster Maulbronn die Ausstellung Freiheit Wahrheit Evangelium.
"Peinliche Befragung, Tortur und Autodafé". Die Inquisition.
 "Peinliche Befragung, Tortur und Autodafé". Die Inquisition. Teil 1 5 Ö1 Betrifft: Geschichte Mit Friedrich Edelmayer (Institut für Geschichte, Universität Wien) Redaktion: Martin Adel und Robert Weichinger
"Peinliche Befragung, Tortur und Autodafé". Die Inquisition. Teil 1 5 Ö1 Betrifft: Geschichte Mit Friedrich Edelmayer (Institut für Geschichte, Universität Wien) Redaktion: Martin Adel und Robert Weichinger
- Anrede - Es gilt das gesprochene Wort. I. Begrüßung
 - Sperrfrist: 26.09.2013, 15.00 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, beim Festakt zum Abschluss der
- Sperrfrist: 26.09.2013, 15.00 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, beim Festakt zum Abschluss der
LEITBILD. Sozialpädagogische Einrichtungen. Kreuzschwestern Bayern. Provinz Europa Mitte
 LEITBILD Sozialpädagogische Einrichtungen Kreuzschwestern Bayern Provinz Europa Mitte Sozialpädagogische Einrichtungen Kinderkrippe Kindergarten Kinder- und Jugendhort Tagesheim Internat Heilpädagogische
LEITBILD Sozialpädagogische Einrichtungen Kreuzschwestern Bayern Provinz Europa Mitte Sozialpädagogische Einrichtungen Kinderkrippe Kindergarten Kinder- und Jugendhort Tagesheim Internat Heilpädagogische
25. Sonntag im Jahreskreis - LJ B 20. September 2015 Lektionar II/B, 344: Weish 2,1a ; Jak 3,16 4,3; Mk 9,30 37
 25. Sonntag im Jahreskreis - LJ B 20. September 2015 Lektionar II/B, 344: Weish 2,1a.12.17 20; Jak 3,16 4,3; Mk 9,30 37 Wir sind es gewohnt vorwärts zu kommen, darauf gepolt Ziele zu erreichen. Das kann
25. Sonntag im Jahreskreis - LJ B 20. September 2015 Lektionar II/B, 344: Weish 2,1a.12.17 20; Jak 3,16 4,3; Mk 9,30 37 Wir sind es gewohnt vorwärts zu kommen, darauf gepolt Ziele zu erreichen. Das kann
100 Jahre Fatima. und heller als die Sonne" gewesen.
 100 Jahre Fatima Am 13. Mai 2017 werden es 100 Jahre, dass die drei Kinder Lucia, Francisco und Jacinta im äußersten Westen Europas, in Portugal in einem kleinen Ort Dorf Namens Fatima eine Frau gesehen
100 Jahre Fatima Am 13. Mai 2017 werden es 100 Jahre, dass die drei Kinder Lucia, Francisco und Jacinta im äußersten Westen Europas, in Portugal in einem kleinen Ort Dorf Namens Fatima eine Frau gesehen
Predigt zu Philipper 4, 4-7
 Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Religion ist ein organisiertes Glaubenssystem mit Regeln, Zeremonien und Gott/Götter.
 Religion ist ein organisiertes Glaubenssystem mit Regeln, Zeremonien und Gott/Götter. Jesus hasste Religion und stellte sich gegen die Frömmigkeit der religiösen Elite. Wir sind mit unseren Traditionen,
Religion ist ein organisiertes Glaubenssystem mit Regeln, Zeremonien und Gott/Götter. Jesus hasste Religion und stellte sich gegen die Frömmigkeit der religiösen Elite. Wir sind mit unseren Traditionen,
13.n.Tr Mk.3, Familie mit allen Ehe für alle?!
 1 13.n.Tr. 10.9.2017 Mk.3,31-35 Familie mit allen Ehe für alle?! Wie stand es bei Jesus selbst um die Ehe und die Familie? Aus binnen-familiärer und eigentlich auch aus binnen-kirchlicher Sicht ist unser
1 13.n.Tr. 10.9.2017 Mk.3,31-35 Familie mit allen Ehe für alle?! Wie stand es bei Jesus selbst um die Ehe und die Familie? Aus binnen-familiärer und eigentlich auch aus binnen-kirchlicher Sicht ist unser
Bibelabende in der Fastenzeit
 Bibelabende in der Fastenzeit http://www.st-maria-soltau.de/bibelabende.html In der Zeit bis Ostern finden jeden Dienstag um 19.30 Uhr hier im Pfarrheim Bibelabende statt. An jedem der Abende betrachten
Bibelabende in der Fastenzeit http://www.st-maria-soltau.de/bibelabende.html In der Zeit bis Ostern finden jeden Dienstag um 19.30 Uhr hier im Pfarrheim Bibelabende statt. An jedem der Abende betrachten
Welche Wundertätige Medaille ist echt?
 Welche Wundertätige Medaille ist echt? Erscheinung der hl. Katharina Labouré Immer wieder werden wir mit Kritik konfrontiert, unsere Medaillen seien nicht echt und somit ungültig, weil die Anzahl der Zacken
Welche Wundertätige Medaille ist echt? Erscheinung der hl. Katharina Labouré Immer wieder werden wir mit Kritik konfrontiert, unsere Medaillen seien nicht echt und somit ungültig, weil die Anzahl der Zacken
Montag, 26. Mai Vesper
 Montag, 26. Mai 2014 Vesper Oh Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Montag, 26. Mai 2014 Vesper Oh Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Cembalo: Bärbel Mörtl
 Ausstellungseröffnung in St. Jakob am Anger am 1. Juni 2008 Die Stadt München feiert ihren 850. Geburtstag. Diese 850 Jahre Stadtgeschichte sind auch 850 Jahre Kirchen und Glaubensgeschichte. Dass die
Ausstellungseröffnung in St. Jakob am Anger am 1. Juni 2008 Die Stadt München feiert ihren 850. Geburtstag. Diese 850 Jahre Stadtgeschichte sind auch 850 Jahre Kirchen und Glaubensgeschichte. Dass die
STERNSTUNDEN IM ADVENT
 STERNSTUNDEN IM ADVENT Meine Reise nach Betlehem Unterwegs 14. Dezember 2015 Ein grünes Tuch am Anfang des Weges - Bilder der Heimat, des Zuhauses. Ein braunes Tuch als Weg endend vor der Schwärze einer
STERNSTUNDEN IM ADVENT Meine Reise nach Betlehem Unterwegs 14. Dezember 2015 Ein grünes Tuch am Anfang des Weges - Bilder der Heimat, des Zuhauses. Ein braunes Tuch als Weg endend vor der Schwärze einer
Hochfest HL. JOSEF, BRÄUTIGAM DER GOTTESMUTTER MARIA
 WGD März 2017 Seite 1 WORTGOTTESDIENST IM MÄRZ 2017 Hochfest HL. JOSEF, BRÄUTIGAM DER GOTTESMUTTER MARIA ( grüne Farbe: ALLE ) Gebärdenlied HERR DU uns GERUFEN WIR HIER. WIR DEIN GAST DEIN EVANGELIUM wir
WGD März 2017 Seite 1 WORTGOTTESDIENST IM MÄRZ 2017 Hochfest HL. JOSEF, BRÄUTIGAM DER GOTTESMUTTER MARIA ( grüne Farbe: ALLE ) Gebärdenlied HERR DU uns GERUFEN WIR HIER. WIR DEIN GAST DEIN EVANGELIUM wir
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich. 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz. am 23. November 2009 im Spiegelsaal
 Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
1. Kor. 2, Pfingsten 2000 Gottes Geist steht über Menschengeist Einführung der Kirchenvorstandes
 1 1. Kor. 2, 12-16 Pfingsten 2000 Gottes Geist steht über Menschengeist Einführung der Kirchenvorstandes Text: 12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, daß wir
1 1. Kor. 2, 12-16 Pfingsten 2000 Gottes Geist steht über Menschengeist Einführung der Kirchenvorstandes Text: 12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, daß wir
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1
 2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
Leben und Sterben vor Gottes Angesicht Predigt zu Röm 14,7-9 (Drittletzter So n Trin, )
 Leben und Sterben vor Gottes Angesicht Predigt zu Röm 14,7-9 (Drittletzter So n Trin, 6.11.16) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde,
Leben und Sterben vor Gottes Angesicht Predigt zu Röm 14,7-9 (Drittletzter So n Trin, 6.11.16) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde,
Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen
 Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge,
 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Ansprache in der Andacht zum Festakt 150 Jahre Bethel 16. November 2017, St. Nikolai Kirche Potsdam, Mt
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Ansprache in der Andacht zum Festakt 150 Jahre Bethel 16. November 2017, St. Nikolai Kirche Potsdam, Mt
Der Schöpfer und die Menschen in ihren Sünden Warum ein Menschenopfer nötig war (Teil 1)
 Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Joh 1,37 Wie alles begann... Der Schöpfer und die Menschen in ihren Sünden Warum ein Menschenopfer nötig war (Teil 1) 2014 Jahrgang 1 Heft
Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Joh 1,37 Wie alles begann... Der Schöpfer und die Menschen in ihren Sünden Warum ein Menschenopfer nötig war (Teil 1) 2014 Jahrgang 1 Heft
Weihbischof Wilhelm Zimmermann. Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus
 Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Der Ruf nach Hoffnung
 Der Ruf nach Hoffnung Gebet des Monats Dezember 2015 1.- Einfûhrung Advent ist eine Zeit, um auf den Ruf nach Hoffnung zu antworten. Die Hoffnung, die wir haben, ist die Hoffnung, welche die Geburt Jesu
Der Ruf nach Hoffnung Gebet des Monats Dezember 2015 1.- Einfûhrung Advent ist eine Zeit, um auf den Ruf nach Hoffnung zu antworten. Die Hoffnung, die wir haben, ist die Hoffnung, welche die Geburt Jesu
Zur Kirche, die geprägt ist durch die frohe Botschaft des Evangeliums. Wie wird es sein, wenn Du stirbst und Du mußt vor Gottes Gericht erscheinen?
 Keine Kirche der Angst. Predigt am Reformationsfest, 6. November 2016, in der Petruskirche zu Gerlingen Das ist es, was Martin Luther aufgegangen ist. Ja, wenn man versucht, es ganz schlicht auf den Punkt
Keine Kirche der Angst. Predigt am Reformationsfest, 6. November 2016, in der Petruskirche zu Gerlingen Das ist es, was Martin Luther aufgegangen ist. Ja, wenn man versucht, es ganz schlicht auf den Punkt
Erzbischof Dr. Ludwig Schick. O Seligkeit, getauft zu sein
 Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Liebe Schwestern und Brüder! Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr
Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Liebe Schwestern und Brüder! Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr
Die biblische Taufe Seite Seite 1
 Die biblische Taufe Seite Seite 1 1. Was bedeutet das Wort "taufen"? Die Wortbedeutung nach dem Duden bzw. Herkunftswörterbuch rterbuch lautet: "Das mhd. toufen, ahd. toufan, got. daupjan ist von dem unter
Die biblische Taufe Seite Seite 1 1. Was bedeutet das Wort "taufen"? Die Wortbedeutung nach dem Duden bzw. Herkunftswörterbuch rterbuch lautet: "Das mhd. toufen, ahd. toufan, got. daupjan ist von dem unter
Predigt zu Matthäus 3,13-17/ 4,1-11
 Predigt zu Matthäus 3,13-17/ 4,1-11 Liebe Gemeinde, noch war Jesus nicht groß in Erscheinung getreten bis zu dem Tag, an dem er sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen lies. Von diesem Tag an begann
Predigt zu Matthäus 3,13-17/ 4,1-11 Liebe Gemeinde, noch war Jesus nicht groß in Erscheinung getreten bis zu dem Tag, an dem er sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen lies. Von diesem Tag an begann
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Siegen und Lüdenscheid Dienst am Wort 16. April 2017 (Siegen) Ostersonntag Auferstehung Jesu Christi
 Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Siegen und Lüdenscheid Dienst am Wort 16. April 2017 (Siegen) Ostersonntag Auferstehung Jesu Christi Apostelgeschichte 10,34-43 Anteil am Leben Jesu Liebe Gemeinde, Jesus
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Siegen und Lüdenscheid Dienst am Wort 16. April 2017 (Siegen) Ostersonntag Auferstehung Jesu Christi Apostelgeschichte 10,34-43 Anteil am Leben Jesu Liebe Gemeinde, Jesus
LANGE NACHT DER KIRCHEN Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt Rätselralley für Kinder (2014)
 Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017
 Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
11. Sonntag im Jahreskreis Lj A 18. Juni 2017 Lektionar I/A, 268: Ex 19,2 6a Röm 5,6 11 Mt 9,36 10,8
 11. Sonntag im Jahreskreis Lj A 18. Juni 2017 Lektionar I/A, 268: Ex 19,2 6a Röm 5,6 11 Mt 9,36 10,8 Der christliche Blick auf die Bibel darf nie die Perspektive unserer älteren Glaubensbrüder, die Juden,
11. Sonntag im Jahreskreis Lj A 18. Juni 2017 Lektionar I/A, 268: Ex 19,2 6a Röm 5,6 11 Mt 9,36 10,8 Der christliche Blick auf die Bibel darf nie die Perspektive unserer älteren Glaubensbrüder, die Juden,
Hildegard von Bingen
 Jugendgottesdienst 17. September Hildegard von Bingen Material: (http://home.datacomm.ch/biografien/biografien/bingen.htm) Bilder Begrüßung Thema Typisch für die Katholische Kirche ist, das wir an heilige
Jugendgottesdienst 17. September Hildegard von Bingen Material: (http://home.datacomm.ch/biografien/biografien/bingen.htm) Bilder Begrüßung Thema Typisch für die Katholische Kirche ist, das wir an heilige
Wie finde ich Gott? William Booth
 Wie finde ich Gott? William Booth Wie finde ich Gott? William Booth, der Gründer der Heilsarmee, lebte und arbeitete gegen Ende des 19. Jahrhunderts in England. Er verhalf unzähligen suchenden Menschen
Wie finde ich Gott? William Booth Wie finde ich Gott? William Booth, der Gründer der Heilsarmee, lebte und arbeitete gegen Ende des 19. Jahrhunderts in England. Er verhalf unzähligen suchenden Menschen
Reich Gottes Kultur. Definition von Kultur:
 Definition von Kultur: Kultur ist der Inbegriff aller kollektiv verbreiteten Glaubens-, Lebens- und Wissensformen, die sich Menschen im Zuge der Sozialisation aneignen und durch die sich eine Gesellschaft
Definition von Kultur: Kultur ist der Inbegriff aller kollektiv verbreiteten Glaubens-, Lebens- und Wissensformen, die sich Menschen im Zuge der Sozialisation aneignen und durch die sich eine Gesellschaft
Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter bei der Eucharistiefeier und Segnung der Ehepaare am 30. September 2007 im Mariendom zu Freising
 Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter bei der Eucharistiefeier und Segnung der Ehepaare am 30. September 2007 im Mariendom zu Freising Als ich vor kurzem eine Trauung hielt, wünschte sich das
Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter bei der Eucharistiefeier und Segnung der Ehepaare am 30. September 2007 im Mariendom zu Freising Als ich vor kurzem eine Trauung hielt, wünschte sich das
Inhalt Warum wir das Buch zusammen geschrieben haben
 Inhalt Warum wir das Buch zusammen geschrieben haben 1. Herr, hilf mir, dich zu suchen 2. Die Angst der Ablehnung ablehnen 3. Ich will schön sein 4. Gott bei Verlusten vertrauen 5. Ich brauche immer einen
Inhalt Warum wir das Buch zusammen geschrieben haben 1. Herr, hilf mir, dich zu suchen 2. Die Angst der Ablehnung ablehnen 3. Ich will schön sein 4. Gott bei Verlusten vertrauen 5. Ich brauche immer einen
