|
|
|
- Ferdinand Keller
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Mühlenordnung Bis zur Einführung der Handelsmüllerei, die in Lippe in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts allmählich einsetzt, war die Getreidemüllerei eine sogenannte "Kundenund Tauschmüllerei". Der Kunde brachte sein Getreide, meist in kleinen Mengen, die zum unmittelbaren Verzehr vorgesehen waren, zur herrschaftlichen Mühle und hielt sich dort solange auf, bis dieses vermahlen oder geschrotet war. Die Abfertigung der Kunden geschah in der Reihenfolge in der sie die Mühle betraten. Wahrscheinlich wurde die Reihenfolge vom Müller auf einer Schiefertafel festgehalten. 1 Während des Mahlvorganges hatte der Mahlgast das Recht, sein Getreide selbst auf den Mahlgang aufzuschütten und bis zum Beuteln und anschließenden Absacken des Mehls, der Kleie, des Schrotes usw. zugegen zu sein. 2 Die Mühle, besonders aber die herrschaftliche Mühle, stellte also einen öffentlichen Raum dar, in dem sich der Kunde zur Kontrolle der rechtmäßigen Behandlung seines Eigentums frei bewegen konnte. 3 Brachte der Kunde größere Mengen an Getreide zur Mühle, konnte er, um lange Wartezeiten zu vermeiden, sein Mahlgut gegen auf der Mühle vorrätiges Mehl oder Schrot eintauschen. Die Dienstleistung des Müllers bestand also vorwiegend aus der Bereitstellung eines funktionstüchtigen Mahlganges und Beutelganges, sowie dem richtigen Stellen des Mahlganges und Beutelganges, zur Gewinnung einwandfreien Mehls oder Schrotes. Der herrschaftliche Müller erhob für die Nutzung seiner Mühle kein Geld, sondern einen festgelegten Anteil des zur Vermahlung auf die Mühle gebrachten Getreides, die sogenannte "Matte" oder "Metze". 4 Die Matte entnahm der Müller im Beisein des Kunden dem angelieferten Getreide mittels eines Hohlgefäßes, dem Mattengefäß. Verwendet wurden hölzerne, kupferne und eiserne Mattengefäße. Ihre Form war zylindrisch. Bis etwa zur Mitte des 18.Jahrhunderts waren sie oft hölzern und hatten wegen ihres geringen Durchmessers einen schlanken hohen Körper. Die seit der Mitte des 18.Jahrhunderts amtlich ausgegebenen Mattengefäße waren eisern und hatten wegen ihres größeren Durchmessers eine gedrungene Form. Es war allgemein üblich, zum Messen des Getreides Körpermaße zu nutzen. Im Amt Varenholz war das in der Vogtei Langenholzhausen genutzte Körpermaß der Himten (= 29,427 Ltr. beim Roggenhimten), in der Vogtei Hohenhausen der Scheffel (= 44,291 Ltr. beim Roggenscheffel) 5. Der Anteil 1 Die sich durch den Analphabetismus ergebenden Probleme - auch die Müller großer Mühlen wie der Niedernmühle in Kalldorf waren häufig im 18.Jahrhundert noch Analphabeten - wurden wahrscheinlich so gelöst, daß anstatt der Namen sogenannte Hausmarken verwendet wurden, die aus einigen Initialen des Namens gebildet waren. Die Ehefrau des Müllermeisters Wiele aus Kalldorf wußte in einem Gespräch mit dem Autor noch zu berichten, daß um 1900 in Kalldorf die Brotlaibe, die zum Dorfbäcker zum Backen gebracht wurden, zur späteren Identifizierung mit einem "Nameneisen" von ihren Besitzern gekennzeichnet wurden. Wahrscheinlich handelte es sich hier um Hausmarken. Auskunft Ehepaar Wiele vom StADt L 92 C Tit.1 Nr "In Preußen gab es ein Gesetz, welches vorschrieb, daß die Mühlen genügend Fenster haben müßten, die es dem Mahlgast ermöglichten, den Mahlgang rundherum zu kontrollieren." Lange, F., Mühlen im Hannoverschen Wendland, (1989), Seite Vgl. Exkurs II, Mattenbuch des Erbpachtmüllers Friedrich Wilhelm Bauer (*1755 / ) von der Erbpachtmühle Langenholzhausen. 5 Verdenhalven, F., Alte Maße, Münzen und Gewichte, (1968).
2 der Matte betrug in der Vogtei Langenholzhausen 1/16, in der Vogtei Hohenhausen 1/24. 6 Da das Mattengefäß keinen Griff oder Henkel besaß, handhabte der Müller es so, dass er seine Hand auf den Rand des Gefäßes legte und es mit seinen vier Fingern außen und dem Daumen innen festhielt und das Getreide aus dem Sack schöpfte. Das Aufhäufeln des Getreides über den Rand des Mattengefäßes hinaus war nicht erlaubt. Diese einfachen, uralten und ungeschriebenem Recht entstammenden "Geschäftsbedingungen" bargen eine Vielzahl von Konflikten zwischen Müller und Mahlgast: Wird die Reihenfolge eingehalten, sind die Mengenangaben des Mahlgastes richtig, mattet der Müller ehrlich, hat das Mattengefäß das richtige Volumen, ist der Mahlgang sauber, wie viel Schrot, wie viel Mehl und Kleie erhält der Mahlgast nach dem Mahlen zurück, wie hoch ist der Abgang an Staubmehl, an welche Instanz ist sich im Streitfall zu richten? Es ist deshalb verständlich, daß der frühneuzeitliche Territorialstaat allmählich in dieses alte Recht, das bedeutend älter als er selbst war, eingriff und versuchte neue Regelungen durchzusetzen. Mit dem Aufkommen des Kameralismus im 18.Jahrhundert und seiner Entwicklung eines umfassenden "Policey"- Begriffes 7 drang der absolustische Staat mit einer Vielzahl neuer Rechtsregeln immer tiefer in das Leben seiner Untertanen ein. Die Folgen beim Mühlenrecht waren zunehmende Reglementierungen und stärkeres Engagement des Staates, was in Lippe schließlich in der Schaffung einer umfangreichen Mühlenordnung mündete. Dabei zeigte sich, daß das "alte Recht" sehr zählebig war und nur allmählich durch neue Rechtsetzungen verdrängt werden konnte. Bei der Landbevölkerung zeigte sich, wie etwa bei der beharrlichen Weigerung die überkommenen Körpermaße durch Gewichtsmaße zu ersetzen, ein stark konservativer Zug, der den neuen Regelungen Widerstand entgegensetzte. Auch hatte der Staat große Widerstände zu überwinden, um die Gewichte, die Maße, die Matte usw. auf seinem Territorium zu vereinheitlichen. Die älteste, dem Autor bekannte schriftliche Setzung von Mühlenrecht in der Grafschaft Lippe findet sich in einer am 2.Juli 1537 zwischen der Landesherrschaft und der Stadt Lemgo geschlossenen Verabredung 8. Unter Punkt 11 werden dort die Beamten des Amtes Brake verpflichtet, darauf zu achten, dass "die Müller allenthalbenn die Malgeste nicht beschwerenn", d.h. zu deren Nachteil falsch matten. Weiter sind zu gehalten zu verhindern, daß die Müller ihren Mahlgästen Essen und Trinken anbieten "und dergleichen Neuwerungen machenn, sondern innen gleich undt recht thun". Brau-, Brenn- und Schankkonzessionen waren bei den Müllern als Zusatzgeschäft sehr beliebt. 6 Zum Vergleich: Im Wendland (Niedersachsen) betrug die Matte 1/16 bis 1/20. Lange, F., Mühlen im Hannoverschen Wendland, (1989), Seite 67 f.. Im Herzogtum Schleswig betrug die Matte zwischen 1/12 und 1/28 mit den weiteren Abstufungen 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, 1/24. Petersen, H., Mühlen zwischen Eider und Königsau, (1988), Seite 65 f.. In der Stadt Preußisch Oldendorf betrug die Matte für Mehl 1/24, für Viehschrot 1/32. Besserer, D., Mühlengeschichte der Stadt Preuß. Oldendorf, (1982), Seite12. Im Jahre 1305 betrug die Matte in Göttingen 1/21; im Jahre /16. Göbel, I., Die Mühle in der Stadt, (1993), Seite Unter dem "Policey" - Begriff faßten die Kameralisten alles, "was zur Sicherheit, Bequemlichkeit, guter Zucht, Ordnung, Nahrung, Bevölkerung und Reichthum des Staates nur immer für dienlich erachtet", wurde. Moser, Johann Jacob: Von der Landeshoheit in Policey - Sachen, Bd. VI. : In Policey - Sachen, Frankfurt/Leipzig 1773, S. 4f. Zitat bei: Nitschke, P., Verbrechensbekämpfung und Verwaltung, (1990), Seite 31. Zum "Policey" - Begriff ausführlich: ebd., Seite StAL A 62.
3 Während die Mahlgäste in der warmen Mühlenstube im angeregten Gespräch auf ihre Abfertigung warteten, tranken sie gerne das eine oder andere Glas Branntwein oder Bier. Die Müller bei denen Mängel zu beanstanden sind, seien zu bestraffen und die Mängel abzuschaffen. Außerdem haben die Beamten den ordnungsgemäßen Zustand der Mühlsteine, der gehenden Werke und der Mühlengebäude zu überwachen, so daß "die von Lemgo sich davon mit Billigkeit nicht mögen zu beklagen haben".die "Policei - Ordnung von 1620" 9 (Abb.14) dokumentiert u.a. den Versuch, die Gewichte und Maße in der Grafschaft zu vereinheitlichen (" XXIX. Titul. von Gewichten, Ellen und Maaßen" Paragraph 1). Im XXIX.Titul." Paragraph 2 ordnete sie die Anschaffung von Waagen - "Mehlgewichte" - in denherrschaftlichen Mühlen an, auf denen das Korn vor und das Mehl nach dem Vermahlen gewogen werden sollte. Wie im folgenden darzustellen sein wird, gelang es der Landesherrschaft bis weit in das 19.Jahrhundert hinein aus unterschied- Abb.14 Policei-Ordnung von 1620, XXIX. Titul. 2. Anschaffung von Mehlgewichten in den herrschaftlichen Mühlen. LV (Lippische Landesverordnungen, Bd. I, S. 384) lichen Gründen nicht Regelung allgemein durchzusetzen stand die Anschaffung geeichter Waagen in den Mühlen auf der Tagesordnung des lippischen Landtages. Der Landtagsabschied 10 in dieser Sache lautete: "Es soll auf der Policeyordnung und vor erwehnter unsers Großelter Herrn Vatters Verordnung gemes, eine Waage bey einer jeglichen Mühlen angeordnet, welche in den Städten aufm Marckte aufgehenget, und darauff Korn und Meell auß- und eingewogen, auch der Ausweger mit gewöhnlichen Gelübden und Eyden belegt werden. Detmold den 1.May 1668." 11 Der Landtagsabschied 9 Landesverordnungen der Grafschaft Lippe (im folgenden LV) Bd.I, S Zum Begriff "Landtagsabschied" und zum Landtag allgemein: Nordrhein - Westfälisches Staatsarchiv Detmold, Der Lippische Landtag, (1984). 11 StADt L 108 Varenholz Nr.134.
4 forderte also die Durchsetzung der entsprechenden Bestimmung der "Policei - Ordnung von 1620". Mit Schreiben vom 23.April 1669 wies Graf Simon Henrich deshalb die Ämter und Städte an, "... unverzüglich ein probirtes (geprüftes, Anm. Autor) Gewichte verfertigen, undt solches in die Mühlen auf dem Lande sollet verschaffen, auf das durchgehents die Mahlgeste darauf ihr Korn ein- undt außmeßen können, in den Städten aber sol solch Gewichte, dem Landschluß gemeß, auf die Marckte werden aufgehenget." Diese Anordnung ging aber über den Landtagsabschied hinaus und verfügte weiter: "Wegen Abgang des Staubes aber undt was an dem Mühlenstein müchte hangenbleiben, sol forderlichst ein billiches determiniret, undt das quantum euch zugeschicket, auch menniglichen vermittelst öffentlichen patents sich darnach haben zurichten, dieses verkündet werden." 12 Der Landesherr beabsichtigte also über den Landtagsabschied hinaus, Tabellen herauszugeben, die den Abgang an Staubmehl festsetzen sollten. Allerdings scheint dieses Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt worden zu sein, denn in den gesichteten Quellen finden sich keine weiteren Hinweise, die auf die Existenz derartiger Listen hinweisen. Der Landtagsabschied blieb also ohne große Resonanz. Im Amt Varenholz sind vermutlich erstmals 1751 auf den herrschaftlichen Mühlen Waagen angeschafft worden, denn 1751 ordnete die Rentkammer an, daß die herrschaftlichen Mühlen Langenholzhausen und die Niedernmühle Kalldorf Waagen - "Mehl - Waagen" - anzuschaffen haben. Jeder Mahlgast dürfe dann sein Korn, ehe es auf die Mühle geschüttet werde, auf die Waage legen, was in Gegenwart des Müllers geschehen müsse verfügte die Regierung die Einführung geeichter Mahlmatten, die von den Ämtern ausgegeben werden sollten. In der "Verordnung wegen der Mahl - Matten, von 1753" heißt es, daß "... alle und jede Müllers in dieser Grafschaft, ohne Ausnahme, keine andere Mahl - Matten gebrauchen sollen, als welche mit der Lippischen Rose bei hiesigem Amtman Lucan gestempelt oder gezeichnet worden,... Müller die eine andere als die neu gestempelte Mahl - Matte bedienen, erhalten Strafe von 10 Goldfl." 14 Wie bei Verordnungen üblich wurde sie von allen Kirchenkanzeln herab verkündet. Die Amtsbeamten erhielten zusätzlich von der Regierung den Auftrag in den Mühlen Visitationen vorzunehmen und vorgefundene, nicht geeichte Mahlmatten einzuziehen. Sie hatten sie dann bis zur nächsten Sitzung des Gogerichts aufzubewahren und die betreffenden Müller einzuwrugen. Die neuen geeichten Mahlmatten hatten alle Müller bei der Amtsverwaltung abzuholen. 15 Eine gleichlautende Verordnung erging im Jahre 1779, da anscheinend immer noch nicht alle Mühlen mit den neuen Mahlmatten bestückt waren. 16 Im Jahre 1771 findet sich in den gesichteten Quellen erstmals eine Tabelle, die die Matte im Gewichtsmaß berechnet und zusätzlich den Abgang an Staubmehl berücksichtigt. Sie beruht offensichtlich auf in einer Detmolder Mühle unternommenen praktischen Versuchen: "Der Abgang der Matten beym Wiegen des Getreides in den Mühlen ist laut protoc. vom 11ten dieses folgendermaßen bestimmet: 1.Vom Weitzen Scheffel 5 Pf StADt L 108 Varenholz Nr StADt L 108 Varenholz Nr LV Bd.II, S StADt L 92 C Tit.1 Nr StADt L 108 Varenholz Nr Da ein Scheffel Weizen etwa 40 kg wiegt und das alte lippische Pfund 468 gr. betrug,
5 2.Rocken wenn er durch einen ordinairen Beutel kommt 5 Pf. 18 wird solcher aber durch 2 Beutels gebeutelt 6 Pf Der Gerste, wenn sie geschrotet wird 3 1/2 Pf. 20 wird sie aber gebeutelt 4 1/2 Pf Maltz mit dem Staubmehl 2 1/2 Pf. 5.Haber (Hafer) und Drespe mit dem Staubmehl 2 1/2 Pf. 22 Wann über diese Pfunde an dem Mehl was fehlen solte, ist der Müller schuldig, das fehlende Quantum so fort dabey zu thun. Detmold d. 12ten May 1771." ging die Regierung durch die Einführung neuer Mattengefäße gegen die von ihr den Müllern unterstellte und angeblich weit verbreitete Unsitte der Müller vor, beim Matten das Getreide über den Rand des Mattengefäßes hinaus aufzuhäufeln. 24 An den neuen Mattengefäßen hatte nun, an einer Kette befestigt, ein "eiserner Streicher" zu hängen. Diesen hatte der Müller über den Rand des mit Korn gefüllten Mattengefäßes zu ziehen, um so das Häufeln zu verhindern. Die Ämter wurden von der Regierung angewiesen, den Müllern bei Strafe zu befehlen "jedes mal die Matte zu streichen". Auf der anderen Seite müssten sich die Mahlgäste aber gefallen lassen, auf Aufforderung des Müllers ihr Getreide messen zu lassen. 25 Dazu sollten in der Vogtei Hohenhausen die Müller ein geeichtes Scheffelgefäß und in der Vogtei Langenholzhausen ein geeichtes Himtengefäß anschaffen. Da die Streicher in vielen Mühlen anscheinend schnell wieder bei Seite gelegt worden sind, dies war zumindest die Meinung der Regierung, erging am eine weitere Verordnung `wegen der MattengefäßeA. 26 Die Ämter erhielten wiederum die Anweisung die Mühlen zu visitieren und die säumigen Müller zur Strafe einzuwrugen vertrat die Rentkammer gegenüber der Regierung die Ansicht, daß ein "Policey - Gesetz zur Abwendung der Betrügereien der Müller" notwendig sei. Den Grund für die von der Rentkammer unterstellte Zunahme der Betrügereien sah sie in den hohen Mühlenpachten, welche die Müller zu diesen Taten "reizten". Es helfe nur eine "scharfe läßt sich eine Matte von etwa 1/17 berechnen. 18 Das entspräche ebenfalls einer Matte von 1/ Das entspräche einer Matte von etwa 1/14. Das Beuteln - Sichten - des Mehls gestaltete sich für den Mahlgast durch den Abgang an Staubmehl also recht teuer. Wahrscheinlich enthält diese Matte zusätzlich eine extra Entlohnung für den Beutelvorgang. 20 Die Matte beträgt etwa 1/24 (1 Scheffel Gerste gleich 39 kg). 21 Das entspricht einer Matte von etwa 1/ Das entspricht einer Matte von etwa 1/22 (1 Scheffel Hafer gleich 26 kg). 23 StADt L 108 Varenholz Nr StADt L 77 A Nr StADt L 108 Varenholz Nr StADt L 77 A Nr StADt L 108 Varenholz Nr.46.
6 Policey", da die Untertanen ohne Kontrolle zu "sehr vervorteilt" würden. 28 Um das Jahr beschloss der Lippische Landtag die Abfassung einer allgemeinen Mühlenordnung. Der Entwurf sollte dem Landtag dann im folgenden Jahr vorgelegt werden. Man hatte sich also entschlossen, daß bisher durch altes Recht und die Landesverordnungen seit 1620 gesetzte Mühlenrecht zusammenzufassen und auf weitere Einzelregelungen zu verzichten. Die Grafschaft Lippe zählt damit zu den deutschen Territorien, die sehr spät eine Mühlenordnung schufen. Gerade das 18.Jahrhundert ist reich an neu erlassenen Mühlenordnungen, es existieren jedoch auch wesentlich ältere. 29 Allerdings war die von 161 bis 17 regierende Nebenlinie Lippe-Brake wesentlich fortschrittlicher. Im Jahre 1700 setzte sie eine Mühlenordnung für ihre Mühlen30 in die Welt. Sie setzte die Matte auf den 24 te(n) theil eines gestrichenen Lippischen Scheffel fest. Sie regelte die Verluste an Staubmehl und setzte das Beutelgeld auf max. 4 gr. fest. Das Trinkgeldnehmen durch die Mühlenknechte verbot die Mühlenordnung. Auch sollte keiner dem anderen beim Mahlen vorgezogen werden. Nach dem Schärfen der Steine war dem Müller vorgegeben als erstes Kleie über die Mühle zu schicken. Ferner waren unter Aufsicht richtige Waagegewichte, kupferne mühlenmaas oder matte anzuschaffen. An dem mühlkasten in den das Mattenkorn gefüllt wurde, durfte nichts verdächtiges sein.31 Bei ihrem Entwurf einer Mühlenordnung orientierte sich die Lippische Regierung offensichtlich an dem Preußischen Mühlenreglement von Ein Exemplar findet sich jedenfalls in der entsprechenden Akte. 32 Zu Beginn des Jahres lag der Entwurf der Regierung vor. Ehe er dem Landtag vorgelegt wurde, wurden der Rentkammer und den Ämtern der Entwurf zur Beurteilung übergeben. Auf einige interessante Kommentare des Amtes Varenholz zu einzelnen Punkten des Entwurfes soll weiter unten im Text noch 28 StADt L 92 C Tit.1 Nr.1a. 29 Beispiele: 1582 Kurpfalz - Landesverordnung, in der auch eine Mühlenordnung erlassen ist. Zusammenfassung bei: Weber, F. W., Geschichte der Mühlen und des Müllerhandwerks der Pfalz", (1978), Seite "Bäcker- und Mühlenordnung" der Stadt Speyer. Abdruck bei: ebd., Seite Mühlenordnung der Stadt Neustadt a.d.haardt in Kurpfalz. Zusammenfassung bei: ebd., Seite122 f älteste landesherrliche Mühlenordnung in Hessen. Zusammenfassung bei: Jacob, B., Fürstliches Mühlenwesen in Hessen, (1980), Seite Zur Modifikation dieser Mühlenordnung aus dem Jahre 1722 siehe: ebd., Seite "Mühlenordnung für die Mühlen an der Weiseritz und Elbe" in Kursachsen. Erwähnt bei: Krünitz, J. G., Encyklopädie, 96.Teil (1804), Seite 491 f "Königlich-Preußisches Mühlen-Reglement für das Fürstentum Minden auch die Grafschaften Ravensberg, Tecklenburg und Lingen". Abdruck bei: Besserer, D., Mühlengeschichte der Stadt Preuß. Oldendorf, (1982), Seite "Mühlenordnung des Herrn Administratoris der Chur Sachsen, Prinzen Xaverii Königl. Hoheit, für die Stadt Colditz und dasige, an der Mulde gelegene Amts-Mühle". Abdruck bei: Krünitz, J. G., Encyklopädie, 96.Teil (1804), Seite Diese Mühlenordnung ist mit 117 Paragraphen die ausführlichste, die dem Autor bekannt ist. Eine große Anzahl, z.t. mittelalterlicher Mühlenordnungen aus den Städten Göttingen, Hameln und Hildesheim finden sich bei: Göbel, I., Die Mühle in der Stadt, (1993). 30 Die Lemgoer Mühlen (Johannistormühle, Neue Mühle vor dem Heutor, Langenbrücker Mühle und die beim Braker Schloß gelegene Mahlmühle). 31 StAdt L 92 C Tit. 9 Nr StADt l 108 Varenholz Nr.134.
7 näher eingangen werden verabschiedete der Landtag die Mühlenordnung (Abb.15). Von allen Beteiligten wurde die ausschließliche Ausrichtung der Mühlenordnung auf Gewichtsmaße als besonders problematisch angesehen. Man war sich darüber einig, Abb.15 Lippische Mühlenordnung vom , Deck- und Rückblatt. daß in vielen Mühlen trotz aller bisherigen Landesverordnungen überhaupt keine Waagen vorhanden waren und die Einführung der Gewichtsmaße erst allmählich erfolgen konnte. Deshalb beschloss der Landtag auch "Waagen und Gewichte vorerst nach und nach in den städtischen und größeren herrschaftlichen Mühlen einzuführen". 33 Überhaupt sollte, wie die Regierung der Rentkammer mitteilte, die Mühlenordnung "nach und nach, zuerst in den größeren, und zwar izt gleich in den hiesigen städtischen Mühlen eingeführt werden". 34 Wegen der Umsetzbarkeit in den Ämtern wurden diese um Gutachten gebeten. Das Amt Varenholz wurde u.a. gefragt, ob in der Vogtei Langenholzhausen, die ja eine abweichende Matte und andere Körpermaße hatte, die Mühlenordnung überhaupt umsetzbar wäre. Allgemein wurde gefragt, ob in den Mühlen überhaupt genug Raum für das Aufstellen von Waagen vorhanden sei und ob die Mühlen ausreichend frequentiert würden. Schließlich blieb es bei der Einführung der Mühlenordnung zur Probe auf den herrschaftlichen Mühlen in Detmold. 35 Die Mühlenordnung, die zwar gedruckt vorliegt, ist 33 StADt L 108 Varenholz Nr StADt L 92 C Tit.1 Nr Aber auch hier gab es große Probleme bei der Umsetzung, wie besonders das ausführliche Schreiben der Müllerin Brandt vom aufzeigt. U.a. berichtet sie, daß die Mahlgäste den Müllern nicht zutrauten, daß sie das Wiegen richtig verstünden.
8 niemals veröffentlicht und in die Lippischen Landesverordnungen aufgenommen worden, hat also für die Grafschaft Lippe nie Gesetzeskraft erlangt. 36 Die Mühlenordnung besteht aus 10 Paragraphen. In der Vorrede werden zur Begründung des Erlasses einer Mühlenordnung die, trotz Einführung geeichter Körpermaße und Mahlmatten mit Streichern, nicht zu unterbindenden Betrügereien der Müller angegeben. Mit der Mühlenordnung seien sie zu unterbinden, da sie die Zweifel über das Gewicht des Mehls bzw. Schrotes beseitige, denn neben der Matte werde auch der Abgang des Staubmehls festgelegt. Paragraph 1 ordnet die Anschaffung von geeichten Waagen in allen herrschaftlichen Mühlen und konzessionierten Mühlen, die für Fremde mahlen dürfen, an. Paragraph 2 regelt den Ablauf der Wiegeprozedur. Paragraph 3 regelt das Quantum von Matte und Staubmehl. Um die Berechnung für Müller und Mahlgast zu erleichtern, ist der Mühlenordnung eine Tabelle über den "Abgang für Matten und Staub von Schroot und Mehl" beigegeben (Abb.16). Paragraph 4 verpflichtet den Müller, daß nach dem Schroten, Mahlen oder Beuteln eventuell fehlende Gewicht unverzüglich in Schrot zu ersetzen. Dazu hat auf jeder Mühle ein mit `untadelhaftena Schrot gefüllter Kasten vorhanden zu sein. Paragraph 5 untersagt das Mahlen auf allen Mühlen, die keine Konzession besitzen, für Fremde mahlen zu dürfen. Paragraph 6 untersagt dem Mahlgast dem Müller vorzuschreiben, aus welchem Sack er zu matten habe, wenn er Mengegetreide oder verschiedene Fruchtarten auf die Mühle bringt. Paragraph 7 regelt die Reihenfolge bei der Abfertigung der Mahlgäste. Paragraph 8 bestimmt die Instanz, an die sich Mahlgast und Müller bei Streitigkeiten zu wenden haben. In den Bauerschaften ist dies in der Regel der Bauerrichter, in den Städten vom Rat zu ernennende Unterbediente. Deren Vorgesetzte haben dann nach erfolgter Information den Streit zu entscheiden. Paragraph 9 verpflichtet den Müller die Einrichtung seiner Mühle in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Geregelt wird auch das Säubern des Mahlganges nach dem Schärfen. Um die Feuchtigkeit in den Wassermühlen zu senken, sollen die Fenster StADt L 92 C Tit.1 Nr Gedruckte Exemplare finden sich: StADt L 77 A Nr.4506.
9 Abb. 16 Tabelle über den Abgang für Matten und Staub von Schroot und Mehl. Die Tabelle sollte Müller und Mahlgast helfen, konfliktfrei den Abgang an Staubmehl und die Matte zu berechnen. (Sammlung Autor) zur Wasserseite hin mit Glas oder Klappen verschlossen werden. Die Schweinehaltung in den Mühlen wird untersagt. Verdirbt der Müller das Gemahl hat er den Schaden zu ersetzen. Paragraph 10 verbietet den Müllern die Vermahlung von verunreinigten und verschimmelten Getreide. Besonders erwähnt wird mit Mutter- oder Brandkorn befallenes Getreide 37. Solches Getreide ist vor der Vermahlung zu reinigen. Ferner wird die Behandlung ausgewachsenen Korns geregelt. Im Folgenden seien noch einige interessante Einwendungen des Amtes Varenholz vom zu der Mühlenordnung erwähnt 38, die noch einmal verdeutlichen werden, 37 Siehe hierzu auch: LV, Bd.II, Seite 368. Verordnung wegen des Mutter- oder Brandkorn, von Da im Erntejahr 1770 der Roggen mit dem sogenannten Mutter-, Brand- oder Kummerkorn stark verunreinigt war, wies die Regierung in einem Zirkular sämtliche Amtsverwaltungen und Städte an, die obige Verordnung in den Kirchen erneut von den Kanzeln verlesen zu lassen und den Müllern zu untersagen, das verunreinigte Korn zu vermahlen. StADt L 77 A Nr StADt L 108 Varenholz Nr.134.
10 weshalb die Mühlenordnung nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte. Um wirklich alle Betrügereien der Müller zu unterbinden sei die Einstellung von "Wagemeisters" in sämtlichen herrschaftlichen und zu fremden Gemahl konzessionierten Mühlen erforderlich. Die entstehenden Kosten seien aber viel zu hoch. Der Vorschlag, Wagemeister durch die Ausstellung von "Wagezettel" durch die Müller entbehrlich zu machen (Paragraph 2), ließe sich nicht umsetzen, da viele Müller nicht schreiben könnten. Auch hätten die Müller kaum Zeit sich mit derartigen Schreibarbeiten zu befassen. Vorhandene Waagen könnten aber dem Mahlgast erlauben, sich durch selbst vorgenommenes Wiegen gegen die "groben Betrügereien" der Müller zu schützen. Aber, "den Einfältigen können auch die vortrefflichsten Anstalten davor nicht sichern". Die Differenzierung der Matte und des Staubmehls beim Schroten und Mahlen ließe sich kaum durchsetzen (Paragraph 3). Denn es sei in den Mühlen des Amtes Varenholz "hergebracht, daß beim Schroten, obgleich weniger Zeit und Mühe dazu erfordert wird, die nehmliche Matte wie beim Mahlen genommen werde, welches Recht sich so wenig Hochgräfl. Kammer (Rentkammer, Anm. Autor), als die Privateigentümer (konzessionierte Müller, Anm. Autor) werden nehmen lassen". Da sich die Mühlenordnung in der Praxis nicht umsetzen ließ, blieb alles beim alten und die Regierung versuchte weiter die ihr wichtig erscheinenden Dinge durch Landesverordnungen zu regeln kommt im Zusammenhang mit einem Circular der Rentkammer an die Ämter noch einmal der Vorwurf des `HäufelnsA durch die Müller beim Matten auf. 39 Einigermaßen rätselhaft erscheint die Behauptung der Rentkammer in diesem Schreiben, im Fürstentum Lippe sei nur eine Mahlmatte, nämlich der "24. Teil vom ganzen Scheffel" gebräuchlich. Denn noch im Jahre 1859 klagt die Regierung, daß die Matte im Amt Varenholz im Verhältnis zu den anderen Mühlen des Landes immer noch beträchtlich höher sei; gesetzlich bestimmt sei eine Matte von 1/24, im Amt Varenholz betrage sie 1/ In der Beantwortung des Circulars weist das Amt Varenholz auf das Problem beim Matten von halben Scheffeln hin, wodurch die Müller Gelegenheit hätten, stärker zu matten als ihnen zukäme. Halbe Scheffel würden häufig von den "armen Untertanen", den im Amt zahlreich lebenden unterbäuerlichen Familien, auf die Mühlen gebracht. Zum Matten ständen den Müllern aber nur Mattengefäße für ganze Scheffel zur Verfügung, so dass sie nach Meinung des Amtes in den zu großen Mattengefäßen zu Lasten der Mahlgäste matten könnten. Das Amt schlug deshalb vor, nach den Verordnungen von 1753 und 1779 halbe Mattengefäße einzuführen. Außerdem sollte ihre Form so verändert werden, dass sie oben spitz seien, "da doch nicht gestrichen" würde. Mit den spitzen Mattengefäßen wollte man also das den Müllern unterstellte Häufeln unterbinden 41. Am erfolgte schließlich eine "Verordnung, die Einführung halber Mahlmatten betreffend". 42 In der "Verordnung, die Bestimmung der Normal-, Längen-, Kannen- und Scheffel-Maaße betreffend" vom , 39 StADt L 92 C Tit.1 Nr StADt L 92 C Tit.1 Nr findet sich in einem Schreiben der Regierung folgender Hinweis: "Früher war die Form des Mattengefäßes hoch und eng, jetzt aber in fast allen Mühlen flach und weit. Wenn das daran hängende Streichholz mitunter in Vergessenheit kommt, so wird auf einer größeren Fläche sich mehr Korn anhäufeln lassen, als auf den mit kleineren Durchmesser." StADt L 92 C Tit.1 Nr LV, Bd.VI, S LV, Bd.VII, S.252.
11 werden u.a. der Roggen- und der Haferscheffel vereinheitlicht. Ausdrücklich wird zudem erwähnt, dass das Himtenmaß zwar nicht sofort abgeschafft, aber dessen Abschaffung zugunsten des Scheffelmaßes betrieben werden sollte. Weiter wird das Eichen der Scheffelgefäße und die Einstellung eines Eichmeisters im Fürstentum Lippe angeordnet. Das Mattengefäß - hier Mahlmetze genannt -wird auf eine Höhe von 3 Zoll 6 Linien "Lipp. Maaß" (etwa 8,5 cm) und einen Durchmesser von 6 Zoll 11 Linien (etwa 17 cm) lichtes Maß genormt. Im Landtagsabschied von 1847 forderte der Lippische Landtag die "wegen der Übervorteilungen der Untertanen durch die Müller 1787 propagierte Mühlenordnung, die aber damals nicht allgemein zur Ausführung gekommen sei, mit den erforderlichen Modifikationen zu erlassen." Abb.17 Lippische Mühlenordnung vom (LV, Bd. XII, Seite 511 ff.) Nicht allgemein eingeführt worden sei die Mühlenordnung, so der Landtagsabschied, weil sich ergab, "daß das Publicum von der ihm dargebotenen Controle wenig Gebrauch machte". Auch seien "bei unserer Regierung nur selten Klagen wegen Uebervortheilung durch die Müller, oder Anträge auf Einführung von Controlmaßregeln dagegen
12 vorgekommen".44 Interessant ist, daß sich die Regierung bei der Prüfung der Mühlenordnung von 1787 auf die Polizeiordnung von 1620 besinnt und die Meinung vertritt, da die Anschaffungen von Waagen ja bereits vorgeschrieben sei, sei lediglich eine neue Anordnung erforderlich, aber keine Mühlenordnung. Allerdings sah man bei der Ausführung Schwierigkeiten bei den kleinen und räumlich beengten Mühlenbetrieben. Wie die Regierung sah auch die Rentkammer die alte Mühlenordnung als noch brauchbar an, meldete allerdings Zweifel an, was den praktischen Nutzen betraf. Gegen Nachlässigkeiten und Betrügereien der Müller werde es "durchgreifend nicht helfen". Besser wirke da die Konkurrenz, "welche bei den Mühlen im hiesigen Lande durch Vermehrung dieser Anlagen und durch Verbesserung der Wage immer mehr in Wirksamkeit tritt". Und es wirke "dagegen auch Moralität und Bildung die sich, wie überall, so auch bei den Müllern seit 1787 wesentlich gebessert haben".45 Die Mühlenordnung, über deren Nutzen man bei den hohen Landesbehörden also unterschiedlicher Meinung war und deren Notwendigkeit der Landtag in seinem Abschied eigentlich negiert - die Untertanen fühlten sich anscheinend nur in Einzelfällen als Opfer betrügerischer Müller - wurde erst im August 1859 veröffentlicht (Abb. 17), wobei es zweifelhaft ist, diese Verordnung überhaupt noch mit dem Begriff "Mühlenordnung" zu belegen.46 Von der Mühlenordnung des Jahres 1787 findet sich lediglich ein geringer Rest. Geblieben ist das Bemühen, die Mahlgäste vor dem falschen Matten zu schützen. Unter Punkt drei befindet sich zu diesem Punkt eine "Kannbestimmung": Die "Bezirksobrigkeit kann die Müller anhalten, an einer geeigneten Stelle in der Mühle zur Benutzung für die Mahlgäste eine nach gesetzlicher Vorschrift eingerichtete Waage nebst Gewichtsstücken aufzustellen". Zur Berechnung und Kontrolle des Abganges an Matte und Staubmehl enthält die Verordnung eine entsprechende Tabelle (Abb.18). Schwerpunkt der Verordnung bildet eine neue, von der Regierung konstatierte "Belästigung" der Mahlgäste durch die Müller, das sogenannte "Trinkgeldnehmen". Auf diese "Belästigung" soll im folgenden näher eingegangen werden, da in diesem Zusammenhang einige Details über Arbeit und Arbeitsbedingungen auf den lippischen 44 Schreiben der Regierung an die Rentkammer vom ; Extract aus dem Landtagsabschied vom StADt L 92 C Tit.1 Nr Schreiben der Rentkammer an die Regierung vom StADt L 92 C Tit.1 Nr "Bekanntmachung und Verordnung in Bezug auf das Mühlengewerbe, vom 9.August 1859". LV, Bd.XII, S.511 ff..
13 Abb.18 Lippische Mühlenordnung vom Tabelle über den Abgang für Matten und Staub von Schrot und Mehl. (LV, Bd. XII, Seite 511 ff.) Mühlen in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu erfahren sind. Als Quelle dient eine Akte der Regierung mit dem Titel "Trinkgeldgeben auf Mühlen"47. Sie enthält die Voruntersuchungen zu der Verordnung von Allgemein stellte sich das Trinkgeldnehmen48 auf den lippischen Mühlen wie folgt dar: Empfänger der von den Mahlgästen gegebenen Trinkgelder waren die auf den Mühlen beschäftigten "Müllerburschen" und "Müllergesellen". Trinkgelder einfordern durften sie nicht. Bei besonderen Hilfeleistungen, wie das Auf- und Abladen des Korns, besonders für Großkunden wie Bäcker und Brenner und dem Beaufsichtigen des Korns in der Mühle, war es üblich, ein Trinkgeld zu geben. Die Masse der Mahlgäste, die kleine Mengen zum eigenen Verbrauch vermahlen ließen, und die die Vermahlung und das Beuteln in der Regel selbst vornahmen, gab kein Trinkgeld. Es sollte ihnen nach Ansicht der Regierung auch nicht einfallen, solches zu tun. Weiter war das Trinkgeldgeben üblich bei der Anund Ablieferung durch den Müllerwagen bei den Bäckern. Von den Müllern, deren Mühlen über eine große Anzahl von Mahlgästen und vielen Bäckerkunden verfügten, wurde den Gesellen nur ein relativ geringer Lohn gezahlt, da die Entlohnung zum großen Teil durch 47 StADt L 92 C Tit.1 Nr Vgl. zum Trinkgeldnehmen auf städtischen Mühlen: Göbel, I., Die Mühle in der Stadt, (1993), Seite 101 ff..
14 die Trinkgelder erfolgte. Bei kleineren Mühlen dagegen war der fixierte Lohn höher. Weiter wurde für das Beuteln des Weizenschrotes pro Scheffel von den Mahlgästen 1 sgr. gezahlt, wenn sie diese Arbeit nicht selber vornahmen. Im Amt Varenholz stellte sich das Trinkgeldnehmen nach Erkundigungen des Amtes wie folgt dar: Für das Mahlen erhielten die Müllergesellen nur höchst selten ein Trinkgeld. Wenn es gegeben würde, betrage es je Himten höchsten 5 Pf. Allerdings verlangten die Müller für das Beuteln ein "Beuteloder Florgeld" von 5 Pf. bzw. 10 Pf., da sie nach ihrer Ansicht für die Matte nur zu Schroten, aber nicht zu Beuteln - was jetzt allgemein im Brauch sei - verpflichtet seien. Das Florgeld zahlten die Mahlgäste auch ohne Widerrede. Auch wird berichtet, daß die Müller den Wunsch hätten, die Matte abzuschaffen und durch eine Geldabgabe zu ersetzen. Auf der herrschaftlichen Niedernmühle Kalldorf war es üblich, dass für das Floren von einem Himten Weizen 10 Pf. "Mahlgeld", für das Beuteln von einem Himten Roggen 5 Pf. genommen wurden, egal ob der Mahlgast selbst aufschüttete oder nicht. Besorgte der erste Geselle diese Arbeit ohne Mitwirkung des Mahlgastes, forderte er zwar kein Trinkgeld ein, erhielt aber solches von einigen Mahlgästen. Die für Beuteln und Floren eingehenden Gelder erhielt der erste Geselle nach einem Abzug von 27 sgr., die er wöchentlich dem Meister geben musste. Einen sonstigen Lohn erhielt der erste Geselle nicht. Für das Schroten wurde kein Mahlgeld und kein Trinkgeld gezahlt. Einen Anteil von der Matte - der erste Geselle mattete auch - erhielt dieser nicht. Einen Müllerwagen unterhielt die Niedernmühle nicht. Der zweite Geselle musste das eingenommene Mahlgeld an den ersten Gesellen abliefern. Er erhielt dagegen einen Wochenlohn von 1 Rtlr.. Matten durfte der zweite Geselle nicht. Die Mahlgäste wurden der Reihe nach wie sie auf die Mühle kommen bedient. Auf der Langenholzhauser Erbpachtmühle herrschten folgende Regelungen: Das Trinkgeldgeben an die Gesellen war nicht üblich, kam aber ab und an vor. Gefordert wurde dagegen ein Trinkgeld in Höhe von 1 Pf. pro Himten Schrotkorn von dem Pächter der Domäne Hellinghausen für das Aussacken. Für das Schroten wurde nur die Matte erhoben. Für das Beuteln von Gerste, Weizen und Roggen erhob der Müller 5 Pf. je Himten. Das eingenommene `Beutel- oder FlorgeldA musste der Geselle jeden Sonnabend beim Meister abliefern. Als Entlohnung erhielt der Geselle wöchentlich 1 Tlr. 20 sgr.. Die Einnahme aus dem Beutelgeld betrug jährlich Rtlr.. Matten durfte, wie auf der Niedernmühle, neben dem Meister nur der erste Geselle. Der erste Geselle gab an, daß wenn "die Mühle voll" sei, also viele Mahlgäste auf ihre Abfertigung warteten, einige ein Trinkgeld zahlten, um eher bedient zu werden. Dies geschähe aber selten. Die meisten Mahlgäste mahlten zudem ihr Korn selbst. Die Verordnung von 1859 beschäftigt sich unter Punkt 1 mit dem Trinkgeld und untersagt, solches für das Floren von Weizenmehl zu nehmen. Mahlgäste die ein freiwilliges Trinkgeld zahlten, dürften deshalb nicht bevorzugt bedient werden. Punkt zwei droht den Müllern und den Müllergesellen, die die Reihenfolge der Mahlgäste nicht einhalten ein Strafgeld, oder bei Vermögenslosigkeit eine Gefängnisstrafe, an. Die Verordnung von 1859 war die erste und zugleich letzte Setzung einer für das ganze lippische Territorium geltenden Mühlenordnung durch die lippische Regierung. Die weiteren Regelungen des Müllergewerbes erfolgten nach der Reichsgründung von 1871 durch die Reichsgesetzgebung.49 Das Matten wurde jedoch nicht generell zugunsten des Mahllohnes abgeschafft. Noch in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts war das Matten in einigen lippischen Mühlen durchaus üblich. Nach Auskunft des Kalldorfer Müllermeisters Wiele ließen die "großen Bauern" lieber matten. Die Matte betrug beim Schroten 6 Pfund je 49 Weiterführende Literatur: Luther, G., Entwicklung des deutschen Mühlengewerbes, (1909), Seite 85 ff..
15 Zentner, was einer Matte von rund 1/16 entspricht.50 Kommen wir zum Schluss noch einmal auf den zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Konservatismus von großen Teilen der Landbevölkerung zurück. War der Widerstand gegen die Vereinheitlichung der Maße und die Einführung von Gewichtsmaßen zu Ungunsten von Körpermaßen tatsächlich fortschrittsfeindlich? Wie ist diese Haltung zu interpretieren, wenn man mit ihr keine falschen Vorstellungen verbinden will? Ein Erklärungsmuster für den Konservatismus, den wir für den Großteil der ländlichen Bevölkerung konstatieren müssen, ist, daß die Bauern Reformen und Innovationen dann aufgeschlossen gegenüber standen, wenn sie erkennen konnten, daß sie davon Vorteile haben würden.51 Wenn sie die von der Landesherrschaft propagierten Gewichtsmaße und die Mehlwaagen nicht annahmen, im Amt Varenholz war dies bis weit in das 19.Jahrhundert hinein der Fall, so sahen sie in der Reform keine Vorteile und keine Verbesserungen für sich. Die Feststellung des massenhaften Betruges der Mahlgäste durch die Müller, den Regierung, Rentkammer und Landtag häufig erhoben, ist deshalb kritisch zu bewerten. Was motivierte Verwaltung und Landstände seit der Mitte des 18.Jh. immer wieder diesen Tatbestand als Motivation zum Erlass von Landesverordnungen anzuführen? Die Erklärung findet sich in der "Policey - Theorie" jener Epoche, mit der die "Policierung" aller Seinsbereiche betrieben wurde. Auf diesem Wege machte sich die Obrigkeit "immer mehr zum Maß aller Dinge und vertrat in ihren "Policey - Ordnungen" einen Ausschließlichkeitsanspruch, dem sich die Untertanen zu beugen hatten. Eben weil sich die Obrigkeit mit Hilfe des Policey - Gedankens um das Wohl ihrer Untertanen intensiv kümmerte, stand diesen kein Urteil mehr zu, ob diese "ihre" Glücksbestimmung für sie auch tatsächlich die richtige war".52 Betrachtet man den eklatanten Widerspruch in der Einschätzung der Betrügereien der Müller, wie sie bei der Obrigkeit und den angeblichen Betrugsopfern festzustellen ist, ist man versucht hinzuzufügen: Was die Wirklichkeit auf den Mühlen war, bestimmte die ferne Obrigkeit, die den Untertanen wenig oder keine (Er-) Kenntnis derselben zutraute. Im Gegensatz zu den Getreidemühlen waren die anderen Mühlenarten in Lippe nur selten Objekt staatlicher Regelungen. 50 Mündliche Mitteilung Müllermeister Wiele (+), Kalldorf, vom Rösener, W., Die Bauern, (1993), Seite Maier, Hans: Zur Genesis des Obrigkeitsstaates in Deutschland, in: Stimmen der Zeit 174, Zitat bei: Nitschke, P., Verbrechensbekämpfung und Verwaltung, Seite 31.
16 Exkurs I "Verzeichniß der aus dem Kirchspiel Talle zu Mühlenfuhren an die Steinmühle pflichtige bespannten Colonen.A53 Brschft. Bavenhausen Dorf Bavenhausen 2 Gespanne Dorf Röntrup (Röntorf, Anm. Autor) 1 Gespann Dorf Huxol 2 Gespanne Brschft. Brüntorf Dorf Brüntorf 3 3/4 Gespanne Dorf Istrup 1 Gespann Brschft. Matorf 2 3/4 Gespanne Brschft. Osterhagen 2 Gespanne Brschft. Talle 1 Gespann Brschft. Welstorf Dorf Welstorf 2 Gespanne Dorf Pillenbruch 2 Gespanne Summe 19 1/2 Gespanne" Mühlenfuhren aus dem Kirchspiel Talle von 1809 für die Steinmühle: 1809 wg. durch starken Wassers beschädigten Mühlenwerkes: aus der Brschft. Talle 1 Fuhr aus der Brschft. Osterhagen 1 Fuhr aus der Brschft. Bavenhausen 1 Fuhr 1810 Anfahrung Kalck vom Lipp. Walde Brschft. Matorf Brschft. Brüntorf Zur Anfahrung Ziegelsteine von Lemgo Brschft. Welstorf 1811 zur Anfahrung 2 Büchenblöcke Bedarfsholz Bauerschaft Bavenhausen 1814 zur Anfahrung eines Mühlensteins von Rinteln Brschft. Talle Zur Kalckanfuhr Brschft. Osterhagen 1 Fuhr 1 Fuhr 1 Fuhr 1 Fuhr 1815 zur Anfahrung Bauholzes Brschft. Bavenhausen Brschft. Matorf Brschft. Welstorf 3 Fuhren 1 Fuhr 1816 zum Holzanfahren aus dem Rotenberg Brschft. Brüntorf 53 StADt L 92 C Tit.9 Nr.30 Vol.II.
17 1817 zum Mühlensteinfahren von Erder Brschft. Osterhagen 1 Fuhr 1818 zum Kiel- und Bauholz fahren aus dem Lipp. Walde Brschft. Matorf 1 Fuhr Brschft. Welstorf 1819 zum Kiel- und Bauholz fahren aus dem Lipp. Walde Brschft. Brüntorf zum Kiel- und Bauholz fahren Brschft. Bavenhausen 3 Fuhren 1821 zum nemlichen Behuf Brschft. Talle Brschft. Osterhagen 1 Fuhre 1 Fuhre 1822 zum nemlichen Behuf Brschft. Brüntorf 1825 zum nemlichen Behuf Brschft. Matorf 1826 Anfahren eines Mühlensteins von Feldrom Brschft. Welstorf 1 Fuhr 1827 zum Anfahren von Kiel- und Bauholz Brschft. Bavenhausen 1828 zum nemlichen Behuf Brschft. Brüntorf 1829 zum Anfahren von 2 Büchenblöcken Brschft. Osterhagen Zur Anfahrung von 3/4 Ruthen Steine Brschft. Bavenhausen Brschft. Matorf Brschft. Talle 3 Fuhren 1 Fuhre 1830 zur Anfahrung von Büchenblöcken vom Lipp. Walde Brschft. Matorf und Welstorf 1831 zur Anfahrung Kiel- und Bauholz aus dem Lipp. Walde Brschft. Brüntorf "
18 Exkurs II Mattenbuch des Erbpachtmüllers Friedrich Wilhelm Bauer, Erbpächter der Erbpachtmühle Langenholzhausen von Im Mai 1784 legt Erbpachtmüller Bauer ein Mattenbuch an, in daß er die Matte "Über den Rokken so in der Langenholzhauser Mühle ist verdienet" verzeichnet. Er führt das Mattenbuch über einen Zeitraum von exakt vier Jahre bis Ende April 1788 (Abb.19). Zur Erfassung der eingenommenen Matte unterteilt Bauer jeden berücksichtigten Monat in vier Abschnitte von jeweils sieben Tage (vgl. Abb.19 linke Spalte). Die in den vier Abschnitten eines Monats nicht erfassten Monatstage zählt er jeweils zum ersten Abschnitt des folgenden Monats hinzu. Die Einteilung in Abschnitte von jeweils sieben Tagen nimmt Bauer als Erfassungsgrundlage, da er anscheinend nach jeweils sieben Tagen die Mattenkiste, in der die Matte gesammelt wird, aufschließt, entleert und den Roggen ausmisst. Seine Berechnungsgrundlage ist der in der Vogtei Langenholzhausen verwendete Himten, ein Körpermaß, daß beim Roggenhimten 29,427 Ltr. beträgt. Die Höhe der Matte beträgt 1/16. Die Menge des auf die Langenholzhauser Erbpachtmühle gebrachten Roggens lässt sich so durch eine einfache Multiplikation ermitteln. Für jeden Abschnitt von sieben Tagen verzeichnet Bauer die ausgemessene Matte im Mattenbuch (vgl. Abb.19 rechte Spalte). Nach jeweils vier Abschnitten ermittelt er durch eine Addition die Summe der im jeweiligen Monat eingenommenen Matte. Weiter verzeichnet er für jeden Monat den Verkaufspreis des Roggenhimten. Dieser Eintrag, jeweils neben dem Monatsnamen zu finden (vgl. Abb.19), wird jeweils nachträglich von Bauer eingetragen, da er ja zu Beginn eines Monat die Roggentaxe noch nicht kennen kann. Zur Ermittlung seines Verdienstes addiert Bauer die eingenommene Matte über einen Zeitraum vom 1.Mai bis zum 30. April des folgenden Jahres. Den Geldwert ermittelt er aus der monatlich verzeichneten Roggentaxe, indem er für die zwölf Monate einen Durchschnittswert ansetzt, den er mit der Anzahl der eingenommenen Himten multipliziert. Die folgende Tabelle zeigt die von Bauer in sein Mattenbuch eingetragenen Werte: Mattenbuch "über den Rokken so in der Langenholtzhauser Mühle ist verdienet und zwar von 1.ten Mey 1784 an." Jahr Monat Himten Wert Himten 1784 Mai 32 1 Tlr. 3 gr Juni 1 Tlr. 6 gr Juli 1784 August September Oktober November Dezember 79 Januar 56 Februar 62 März 72 April 69 "1.Mey 1784 bis Mai verdienet an Rokken 10 Fuder 4 Malter 54 StADt D 71 Nr.522.
19 den Himpten im Durchschnitt zu, macht 496 Tlr." Mai 50 Juni 67 Juli 48 August 53 September 61 Oktober gr. November gr. Dezember gr. Januar gr. Februar gr. März gr. April gr. Mai bis Mai 10 Fuder 2 Malter 2 Himten Im Durchschnitt zu 25 gr. 509 Tlr. 26 gr. Mai gr. Juni gr. Juli gr. August 60 1 Tlr. September gr. Oktober gr. November gr. Dezember gr Januar gr Februar gr März gr April gr. Mai bis Mai Fuder 10 Malter 1 Himten Im Durchschnitt zu 30 gr. 650 Tlr. 30 gr Mai gr Juni gr Juli gr August gr September gr Oktober gr November gr Dezember gr Januar gr Februar gr März gr April gr. Mai 1787 bis Mai Fuder "weniger 3 Himten" Das Fuder zu 54 Tlr. 540 Tlr. Folgende Aussagen lassen sich zu den im Mattenbuch aufgeführten Werten machen: - Die Roggentaxe unterliegt z.t. starken Schwankungen. Sie liegt z.b. im Jahr 1784 zwischen 42 gr. im Juni und im August. Im Juni, besonders aber im Juli ist der Preis so hoch (unmittelbar vor der Erntezeit!), daß Bauer die eingenommene Matte nicht in sein Mattenbuch einträgt. Er vermerkt zu diesen Monaten, daß er wegen des hohen Preises den Roggen sofort wieder aus der Mattenkiste
20 verkauft und die Menge nicht festgehalten hat. Zwischen August 1784 und April zeigt sich der Preis nahezu stabil und schwankt nur um 2 gr.. Von April bis Mai steigt der Preis dagegen um 4 gr.; von Juni bis Juli nochmals um 4 gr., um dann im August 36 gr. zu erreichen. Anschließend pendelt er sich bis April 1787 auf relativ hohe 34 gr. ein. Von Mai 1787 bis April 1788 fällt die Taxe dann kontinuierlich bis auf 26 gr. ab. - Die Menge des zur Vermahlung auf die Mühle gebrachten Roggens ist kaum abhängig vom Roggenpreis. In jedem der von Bauer erfassten Jahre bewegt sich die eingenommene Matte um zehn Fuder. Sie fällt nur zwischen Mai 1787 und April 1788 um drei Himten unter 10 Fuder. Zwischen Mai und April 1787 ist der Durchschnittspreis je Roggenhimten mit 30 gr. am höchsten; es ist aber auch das Jahr mit der höchsten Menge an eingenommener Matte. Eine merkliche Zurückhaltung beim Roggenkonsum zeigen die Mahlgäste der Langenholzhauser Mühle nur im Mai Der Preis von über einem Tlr. kann oder will ein Teil der Mahlgäste, der Roggen von Bauer kaufen muss, nicht bezahlen. Lange können sie ihren Roggenkonsum ohne zu hungern nicht einschränken, wie die oben besprochenen jährlichen Umsatzzahlen zeigen. Ein Substitut, etwa Kartoffeln, scheint noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden zu sein. Abb.19 Mattenbuch des Erbpachtmüllers Friedrich Wilhelm Bauer von der Erbpachtmühle Langenholzhausen, hier Einträge Januar bis April. (StADt D71 Nr. 522) - Der Verdienst Müller Bauers unterliegt relativ großen Schwankungen. Der Verdienst ist in erster Linie nicht von der Menge der eingenommenen Matte abhängig - diese gestaltet sich in den vier erfassten Jahren annähernd gleich - sondern von der Höhe des Roggenpreises. Von Mai bis Mai 1787 ist bei einer Durchschnittstaxe von 30 gr. der Verdienst in Geld mit Abstand am höchsten.
21 - Von dem Verdienst, den Bauer aus der Roggenmatte erzielt, kann er nicht leben. Von Mai 1784 bis April liegt sein täglicher Verdienst bei 1 Tlr. 13 gr. (496 Tlr. : 365). Von Mai bis April bei 1 Tlr. 14 gr.. Von Mai bis April 1787 bei 1 Tlr. 28 gr.. Von Mai 1787 bis April 1788 bei 1 Tlr. 17 gr.. Von diesem Verdienst sind die nicht näher zu beziffernden Unterhaltskosten für die Mühle, die zu diesem Zeitpunkt drei Mahlgänge umfasst, die Erbpacht in Höhe von 410 Tlr. und der Weinkauf zu entrichten. Allein für die Erbpacht hat Müller Bauer täglich 1 Tlr.4 gr. aufzubringen. Die Einnahme aus der Roggenmatte wird in etwa die Ausgaben für die Mühle gedeckt haben. Der Verdienst Müller Bauers muss von diesem aus dem Vermahlen anderer Früchte erzielt werden. Exkurs III Zeit- und Erbpacht an herrschaftlichen Mühlen: Rendite und Besitzverhältnisse.55 In der Frühen Neuzeit entwickelten sich zwei Formen der Verpachtung herrschaftlicher Mühlen, die Zeitpacht und die Erbpacht. Die Zeitpacht war, soweit die gesichteten Quellen diese Aussage zulassen, die ursprüngliche Form. Ihr Hauptmerkmal ist das Vorhandensein einer Relation zwischen Ertragslage der Mühle auf der einen Seite und der Höhe des Zeitpachtzinses auf der anderen. Dem Eigentümer der Mühle bot sie den Vorteil guter Rendite. Die kurzfristige Laufzeit erlaubte es bei jeder Neuverpachtung die Pachtabgaben an die tatsächliche Ertragslage der Mühle anzupassen und so deren Rentabilität zu gewährleisten. (Zur Rentabilitätsberechnung der Lüdenhauser Windmühle siehe Tabelle I). Die im Fall der Lüdenhauser Windmühle zu verzeichnende hohe Rendite im Jahre 1616 erklärt sich aus der sehr guten Ertragslage der Mühle. Sie ist jedoch dahingehend zu relativieren, dass dem lippischen Landesherrn als Verpächter, die Reparatur - und Unterhaltskosten, u.a. die teuren Mühlsteine, zur Last fielen. Die geringe Rentabilität im Jahr 1704 erklärt sich aus den ungewöhnlich hohen Baukosten der im gleichen Jahr errichteten modernen Mühle und dem in Relation geringen Pachtzins, der sich aus der ungünstigen Ertragslage der Mühle erklärt. Diese Rendite ist jetzt dahingehend zu relativieren, daß dem Verpächter keine Unterhalts- und Reparaturkosten mehr entstanden. Auch die Mühlsteine hatte laut Zeitpachtvertrag nun der Zeitpächter anzuschaffen. Tabelle I Rentabilitätsberechnung Windmühle Lüdenhausen Jahr Wert der Mühle Zeitpacht Jährliche Rendite Tlr Tlr. 37,5 % Tlr.3 40 Tlr. 3,4 %4 Anmerkungen: 1) Verkaufserlös ) Pachtgeld : Wert = Rendite. 3) Neubaukosten ) Unterhalts- und Reparaturkosten zu Lasten Zeitpächter. Holz frei. Die Erbpacht, bei der der Erbpächter Eigentümer der Mühle wurde, brachte einen entscheidenden Wandel mit sich. Die Relation zwischen Ertragslage auf der einen und Höhe des Erbpachtzinses auf der anderen Seite wurde aufgehoben. Denn ein 55 Literatur: Dubler, A.-M., Müller und Mühlen, (1978), Seite 28 ff..
1. Einleitung. 2. Gesetzliche Grundlage
 Inhalt 1. Einleitung........................................ 5 2. Gesetzliche Grundlage.............................. 5 3. Auskunftspflicht der Parteien......................... 12 4. Höhe des Unterhalts................................
Inhalt 1. Einleitung........................................ 5 2. Gesetzliche Grundlage.............................. 5 3. Auskunftspflicht der Parteien......................... 12 4. Höhe des Unterhalts................................
Autohaus U. Das Auto bleibt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung Eigentum des U.
 Autohaus U Unternehmer U betreibt ein Autohaus. Um das Rechtsverhältnis zum Kunden umfassend zu regeln, lässt U von seinem Rechtsanwalt standardisierte Vertragsbedingungen verfassen, die er bei jedem Verkauf
Autohaus U Unternehmer U betreibt ein Autohaus. Um das Rechtsverhältnis zum Kunden umfassend zu regeln, lässt U von seinem Rechtsanwalt standardisierte Vertragsbedingungen verfassen, die er bei jedem Verkauf
Die Coll'sche Wassermühle in Eindhoven
 Die Coll'sche Wassermühle in Eindhoven Ansicht aus dem Norden, vor erneuter Aufstellung des zweiten Wasserrades. Einleitung Die Collse Wassermühle ist Eigentum der Gemeinde Eindhoven. Im letzten Jahr des
Die Coll'sche Wassermühle in Eindhoven Ansicht aus dem Norden, vor erneuter Aufstellung des zweiten Wasserrades. Einleitung Die Collse Wassermühle ist Eigentum der Gemeinde Eindhoven. Im letzten Jahr des
Das Gericht. PD. Dr. Peter Rackow Wintersemester 2008 / 2009
 Das Gericht PD. Dr. Peter Rackow Wintersemester 2008 / 2009 Überblick Art 92 GG: Ausübung der rechtsprechenden Gewalt durch von der Exekutive getrennte Gerichte; Art 97 GG: richterl. Unabhängigkeit: a)
Das Gericht PD. Dr. Peter Rackow Wintersemester 2008 / 2009 Überblick Art 92 GG: Ausübung der rechtsprechenden Gewalt durch von der Exekutive getrennte Gerichte; Art 97 GG: richterl. Unabhängigkeit: a)
Äußerst wissenswert: Man braucht hierzulande weder einen Führerschein, noch eine Fahrerlaubnis
 Äußerst wissenswert: Man braucht hierzulande weder einen Führerschein, noch eine Fahrerlaubnis Was wir mit diesem Artikel mitzuteilen haben, wird die meisten Leserinnen und Leser wohl mal wieder völlig
Äußerst wissenswert: Man braucht hierzulande weder einen Führerschein, noch eine Fahrerlaubnis Was wir mit diesem Artikel mitzuteilen haben, wird die meisten Leserinnen und Leser wohl mal wieder völlig
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Mietpreisbremse gilt ab dem : So sehen die neuen Mietrechtsvorschriften aus
 Mietpreisbremse gilt ab dem 1.6.2015: So sehen die neuen Mietrechtsvorschriften aus Foto: Haramis Kalfar - Fotolia.com Überall und jeder redet über die Mietpreisbremse und was sie bedeutet. Allerdings
Mietpreisbremse gilt ab dem 1.6.2015: So sehen die neuen Mietrechtsvorschriften aus Foto: Haramis Kalfar - Fotolia.com Überall und jeder redet über die Mietpreisbremse und was sie bedeutet. Allerdings
BESCHLUSS. BVerwG 5 B OVG 2 A 1147/99. In der Verwaltungsstreitsache
 B U N D E S V E R W A L T U N G S G E R I C H T BESCHLUSS BVerwG 5 B 38.02 OVG 2 A 1147/99 In der Verwaltungsstreitsache - 2 - hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 14. Mai 2002 durch den Vorsitzenden
B U N D E S V E R W A L T U N G S G E R I C H T BESCHLUSS BVerwG 5 B 38.02 OVG 2 A 1147/99 In der Verwaltungsstreitsache - 2 - hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 14. Mai 2002 durch den Vorsitzenden
Vom Leichtesten zum Schwersten Sortieralgorithmen
 Aktivität 7 Vom Leichtesten zum Schwersten Sortieralgorithmen Zusammenfassung Häufig verwendet man Computer dazu Listen von Elementen in eine bestimmte Ordnung zu bringen. So kann man beispielsweise Namen
Aktivität 7 Vom Leichtesten zum Schwersten Sortieralgorithmen Zusammenfassung Häufig verwendet man Computer dazu Listen von Elementen in eine bestimmte Ordnung zu bringen. So kann man beispielsweise Namen
Ausschluss der Sachmängelhaftung beim Verkauf durch eine Privatperson
 Ausschluss der Sachmängelhaftung beim Verkauf durch eine Privatperson Aus gegebenem Anlass wollen wir nochmals auf die ganz offensichtlich nur wenig bekannte Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom
Ausschluss der Sachmängelhaftung beim Verkauf durch eine Privatperson Aus gegebenem Anlass wollen wir nochmals auf die ganz offensichtlich nur wenig bekannte Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom
Statische Spiele mit vollständiger Information
 Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Alkoholkranke (Testaufgabe)
 Alkoholkranke (Testaufgabe) In einer Zeitschrift ist zu lesen: ''Untenstehende Graphik demonstriert, dass die Anzahl der Alkoholkranken in der Stadt X von 2007 bis 2008 stark zugenommen hat.'' Ist diese
Alkoholkranke (Testaufgabe) In einer Zeitschrift ist zu lesen: ''Untenstehende Graphik demonstriert, dass die Anzahl der Alkoholkranken in der Stadt X von 2007 bis 2008 stark zugenommen hat.'' Ist diese
Der Begriff Tag im Sinne der Verordnungen. EuGH, Urteil vom C-394/ 92
 EuGH, Urteil vom 09.06.1994 - C-394/ 92 Leitsätze 1. Die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Strassenverkehr umfasst die Lenkzeit,
EuGH, Urteil vom 09.06.1994 - C-394/ 92 Leitsätze 1. Die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Strassenverkehr umfasst die Lenkzeit,
Urheberrecht letzte Folie
 Urheberrecht letzte Folie Rechtsverletzungen, Rechtsübertragung, Lehrstuhl für Zivilrecht, Wirtschaftsrecht, Geistiges Eigentum Prof. Dr. Michael Hassemer 97 Unterlassung und Schadensersatz (1) Wer das
Urheberrecht letzte Folie Rechtsverletzungen, Rechtsübertragung, Lehrstuhl für Zivilrecht, Wirtschaftsrecht, Geistiges Eigentum Prof. Dr. Michael Hassemer 97 Unterlassung und Schadensersatz (1) Wer das
Geschäftsordnung des Bundesarbeitsgerichts
 Geschäftsordnung des Bundesarbeitsgerichts in der vom Bundesrat am 11. April 2003 bestätigten Fassung 1 Senate (1) Die Senate führen die Bezeichnung Erster Senat, Zweiter Senat usw. (2) Jeder Berufsrichter
Geschäftsordnung des Bundesarbeitsgerichts in der vom Bundesrat am 11. April 2003 bestätigten Fassung 1 Senate (1) Die Senate führen die Bezeichnung Erster Senat, Zweiter Senat usw. (2) Jeder Berufsrichter
10 Bundesverkehrsministerium verstößt gegen haushaltsrechtliche Vorschriften und unterrichtet den Haushaltsausschuss unzutreffend
 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Einzelplan 12) 10 Bundesverkehrsministerium verstößt gegen haushaltsrechtliche Vorschriften und unterrichtet den Haushaltsausschuss unzutreffend
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Einzelplan 12) 10 Bundesverkehrsministerium verstößt gegen haushaltsrechtliche Vorschriften und unterrichtet den Haushaltsausschuss unzutreffend
Schulranzen. Kann das stimmen? Die Ranzen deiner Klasse wiegen zusammen mehr als 250 Kilogramm. Schule. Ruwisch/Schaffrath
 Kann das stimmen? Schule A 1 Schulranzen Die Ranzen deiner Klasse wiegen zusammen mehr als 250 Kilogramm. Ruwisch/Schaffrath Fragenbox Mathematik vpm/ LERNBUCHVERLAG 2009 Kann das stimmen? Schule A 1 Federmäppchen
Kann das stimmen? Schule A 1 Schulranzen Die Ranzen deiner Klasse wiegen zusammen mehr als 250 Kilogramm. Ruwisch/Schaffrath Fragenbox Mathematik vpm/ LERNBUCHVERLAG 2009 Kann das stimmen? Schule A 1 Federmäppchen
Gebrauchtwagenkauf. Student S verkauft seinen alten Wagen an Privatmann P. Bei Vertragsschluss
 Gebrauchtwagenkauf Student S verkauft seinen alten Wagen an Privatmann P. Bei Vertragsschluss unterschreibt P einen von S mitgebrachten Formularvertrag, in den zuvor die für den Verkauf nötigen Angaben
Gebrauchtwagenkauf Student S verkauft seinen alten Wagen an Privatmann P. Bei Vertragsschluss unterschreibt P einen von S mitgebrachten Formularvertrag, in den zuvor die für den Verkauf nötigen Angaben
Beschlossen: Bekannt gemacht: in Kraft getreten:
 S a t z u n g über die Unterhaltung und Benutzung von Übergangsheimen für die vorläufige Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Unterbringungssatzung für ausländische Flüchtlinge) Beschlossen: 17.06.2009
S a t z u n g über die Unterhaltung und Benutzung von Übergangsheimen für die vorläufige Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Unterbringungssatzung für ausländische Flüchtlinge) Beschlossen: 17.06.2009
I N F O R M A T I O N S B R I E F
 SCHWARZ THÖNEBE & KOLLEGEN RECHTSANWÄLTE Elisenstr. 3 Telefon: 089/ 91 04 91 05 80335 München Telefax: 089/ 91 04 91 06 E-MAIL: info@ra-schwarz-thoenebe.de www.ra-schwarz-thoenebe.de I N F O R M A T I
SCHWARZ THÖNEBE & KOLLEGEN RECHTSANWÄLTE Elisenstr. 3 Telefon: 089/ 91 04 91 05 80335 München Telefax: 089/ 91 04 91 06 E-MAIL: info@ra-schwarz-thoenebe.de www.ra-schwarz-thoenebe.de I N F O R M A T I
Erbrechtsänderungsgesetz 2015 aus der Sicht der Pflichtteilsberechtigten
 Newsletter Private Clients Issue 4 2016 Erbrechtsreform Teil 4 Erbrechtsänderungsgesetz 2015 aus der Sicht der Pflichtteilsberechtigten Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015) tritt am 1.1.2017
Newsletter Private Clients Issue 4 2016 Erbrechtsreform Teil 4 Erbrechtsänderungsgesetz 2015 aus der Sicht der Pflichtteilsberechtigten Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015) tritt am 1.1.2017
BGB 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
 Bürgerliches Gesetzbuch Buch 4 - Familienrecht ( 1297-1921) Abschnitt 2 - Verwandtschaft ( 1589-1772) Titel 5 - Elterliche Sorge ( 1626-1698b) BGB 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
Bürgerliches Gesetzbuch Buch 4 - Familienrecht ( 1297-1921) Abschnitt 2 - Verwandtschaft ( 1589-1772) Titel 5 - Elterliche Sorge ( 1626-1698b) BGB 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
Die Lohnlücke ist kleiner als gedacht
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Gender Pay Gap 13.06.2016 Lesezeit 4 Min. Die Lohnlücke ist kleiner als gedacht Frauen verdienen in Deutschland noch immer gut ein Fünftel weniger
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Gender Pay Gap 13.06.2016 Lesezeit 4 Min. Die Lohnlücke ist kleiner als gedacht Frauen verdienen in Deutschland noch immer gut ein Fünftel weniger
Archimedes Prinzip einfach Best.- Nr. MD gleiche Markierung am Kraftmesser. verdrängtes Flüssigkeitsvolumen
 Archimedes Prinzip einfach Best.- Nr. MD03054 I. Zielsetzung Mit Hilfe der hier beschriebenen Versuchsanordnungen wird die von den Lehrplänen erwünschte Aktualisierung des Archimedes Prinzips erreicht.
Archimedes Prinzip einfach Best.- Nr. MD03054 I. Zielsetzung Mit Hilfe der hier beschriebenen Versuchsanordnungen wird die von den Lehrplänen erwünschte Aktualisierung des Archimedes Prinzips erreicht.
Kämpfen um Gerechtigkeit von Bodo Doering
 Kämpfen um Gerechtigkeit von Bodo Doering Da ist eine Sache, die mich schon lange bewegt, eigentlich eine Kleinigkeit, aber auf Jahre gesehen dennoch eine durchaus diskutable Angelegenheit. Ich hatte während
Kämpfen um Gerechtigkeit von Bodo Doering Da ist eine Sache, die mich schon lange bewegt, eigentlich eine Kleinigkeit, aber auf Jahre gesehen dennoch eine durchaus diskutable Angelegenheit. Ich hatte während
Hitler - Der Architekt
 Geschichte Matthias Heise Hitler - Der Architekt Studienarbeit Hitler - Der Architekt Hauptseminar Hitler - Eine Biographie im 20. Jh. " Dr. M. Gailus, Technische Universität Berlin, WS 2003/2004 Matthias
Geschichte Matthias Heise Hitler - Der Architekt Studienarbeit Hitler - Der Architekt Hauptseminar Hitler - Eine Biographie im 20. Jh. " Dr. M. Gailus, Technische Universität Berlin, WS 2003/2004 Matthias
Unterwegs betrachtete er das Brot: Vollkornbrot, dachte er, wo wächst das wohl?
 Das Brot. Eine Geschichte zum Erntedankfest im Jahr2000. Geschrieben von Anna Siebels / Willmsfeld. Diese Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen der heißt Hans. Er ist sieben Jahre alt und wird im
Das Brot. Eine Geschichte zum Erntedankfest im Jahr2000. Geschrieben von Anna Siebels / Willmsfeld. Diese Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen der heißt Hans. Er ist sieben Jahre alt und wird im
morgens manchmal viel zu lange zu schlafen und dadurch den halben Tag verpasst.
 Hallo liebe(r) Leser(in), in der heutigen Lektion soll es um Deine Gewohnheiten gehen und dabei vor allem darum, was Du tun solltest, damit Du schlechte Angewohnheiten hinter Dir lassen und stattdessen
Hallo liebe(r) Leser(in), in der heutigen Lektion soll es um Deine Gewohnheiten gehen und dabei vor allem darum, was Du tun solltest, damit Du schlechte Angewohnheiten hinter Dir lassen und stattdessen
Getreideanbau früher (vor 100 Jahren)
 Essen verändert die Welt Ernährung früher, heute und morgen Getreide immer noch ein wichtiges Lebensmittel? anhand eines Mühlenbesuchs klären. Getreideanbau früher (vor 100 Jahren) Die Körner werden in
Essen verändert die Welt Ernährung früher, heute und morgen Getreide immer noch ein wichtiges Lebensmittel? anhand eines Mühlenbesuchs klären. Getreideanbau früher (vor 100 Jahren) Die Körner werden in
DANZIG I. GESETZ ÜBER DEN UNTERRICHT DER POLNISCHEN MINDERHEIT VOM 20. DEZEMBER 1921.
 DANZIG I. GESETZ ÜBER DEN UNTERRICHT DER POLNISCHEN MINDERHEIT VOM 20. DEZEMBER 1921. Abschnitt I. Von den öffentlichen Volksschulen mit polnischer 1. Väter oder erziehungsberechtigte Mütter polnischer
DANZIG I. GESETZ ÜBER DEN UNTERRICHT DER POLNISCHEN MINDERHEIT VOM 20. DEZEMBER 1921. Abschnitt I. Von den öffentlichen Volksschulen mit polnischer 1. Väter oder erziehungsberechtigte Mütter polnischer
Das Positions-Papier zur Änderung der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung in Leichter Sprache. Wer sind wir?
 Das Positions-Papier zur Änderung der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung in Leichter Sprache Dies ist ein Positions-Papier. Das bedeutet: Wir schreiben hier unsere Meinung auf. Wir haben hier unsere Meinung
Das Positions-Papier zur Änderung der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung in Leichter Sprache Dies ist ein Positions-Papier. Das bedeutet: Wir schreiben hier unsere Meinung auf. Wir haben hier unsere Meinung
Stellungnahme der Verbraucherzentrale Nordrhein- Westfalen e.v.
 Düsseldorf, 14.03.2016 Stellungnahme der Verbraucherzentrale Nordrhein- Westfalen e.v. zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Umweltinformationsgesetzes NRW (UIG NRW) Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, 14.03.2016 Stellungnahme der Verbraucherzentrale Nordrhein- Westfalen e.v. zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Umweltinformationsgesetzes NRW (UIG NRW) Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
CA/49/15 Orig.: en München, den
 CA/49/15 Orig.: en München, den 05.06.2015 BETRIFFT: VORGELEGT VON: EMPFÄNGER: Übergangsbestimmungen zur Anwendung des neuen Laufbahnsystems auf Personen, die gemäß Artikel 11 (3) des Europäischen Patentübereinkommens
CA/49/15 Orig.: en München, den 05.06.2015 BETRIFFT: VORGELEGT VON: EMPFÄNGER: Übergangsbestimmungen zur Anwendung des neuen Laufbahnsystems auf Personen, die gemäß Artikel 11 (3) des Europäischen Patentübereinkommens
Haftungsbegrenzungsklauseln in Versicherungsmakler-AGB
 Haftungsbegrenzungsklauseln in Versicherungsmakler-AGB von RA Stephan Michaelis LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht (Kanzlei Michaelis) Kaum ein Maklervertrag kommt heutzutage ohne Haftungsbegrenzungen
Haftungsbegrenzungsklauseln in Versicherungsmakler-AGB von RA Stephan Michaelis LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht (Kanzlei Michaelis) Kaum ein Maklervertrag kommt heutzutage ohne Haftungsbegrenzungen
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle (Gutachterausschussgebührensatzung)
 Stadt Bad Dürrheim Landkreis Schwarzwald-Baar S A T Z U N G über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle (Gutachterausschussgebührensatzung)
Stadt Bad Dürrheim Landkreis Schwarzwald-Baar S A T Z U N G über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle (Gutachterausschussgebührensatzung)
Merkblatt 1 Elternunterhalt/Sozialregress
 Merkblatt 1 Elternunterhalt/Sozialregress Die Unterbringung der Eltern oder eines Elternteils in einem Alten- oder Pflegeheim kann teuer werden. Die Betroffenen selbst müssen dafür Renten, sonstige Einnahmen
Merkblatt 1 Elternunterhalt/Sozialregress Die Unterbringung der Eltern oder eines Elternteils in einem Alten- oder Pflegeheim kann teuer werden. Die Betroffenen selbst müssen dafür Renten, sonstige Einnahmen
21. MÄRZ Gesetz zur Regelung der Installation und des Einsatzes von Überwachungskameras
 21. MÄRZ 2007 - Gesetz zur Regelung der Installation und des Einsatzes von Überwachungskameras (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 20. November 2007) Diese deutsche Übersetzung ist von der
21. MÄRZ 2007 - Gesetz zur Regelung der Installation und des Einsatzes von Überwachungskameras (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 20. November 2007) Diese deutsche Übersetzung ist von der
Art.3 des Gesetzes regelt sodann die Abstimmungsmodalitäten, welche den Regelungen des BWahlG entsprechen.
 Sachverhalt Fall 9 Sachverhalt Der Bundestag berät einen in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Gesetzentwurf zur Reform der sozialen Sicherungssysteme. Da die Struktur der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung
Sachverhalt Fall 9 Sachverhalt Der Bundestag berät einen in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Gesetzentwurf zur Reform der sozialen Sicherungssysteme. Da die Struktur der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung
Berufungsentscheidung
 Außenstelle Linz Senat 9 GZ. RV/0230-L/06 Berufungsentscheidung Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des F und der E Bw, Landwirte in Adresse, vertreten durch Holzinger & Partner Steuer- und
Außenstelle Linz Senat 9 GZ. RV/0230-L/06 Berufungsentscheidung Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des F und der E Bw, Landwirte in Adresse, vertreten durch Holzinger & Partner Steuer- und
Eine Übersicht über den Nichtraucherschutz in Deutschland Stand: August 2014
 Eine Übersicht über den Nichtraucherschutz in Deutschland Stand: August 2014 Bunweit Am 01.09.2007 tritt das Gesetz zur Einführung eines es in en Bun und öffentlichen Verkehrsmitteln (Bunnichtraucherschutzgesetz-BNichtrSchG)
Eine Übersicht über den Nichtraucherschutz in Deutschland Stand: August 2014 Bunweit Am 01.09.2007 tritt das Gesetz zur Einführung eines es in en Bun und öffentlichen Verkehrsmitteln (Bunnichtraucherschutzgesetz-BNichtrSchG)
Verein der Freunde und Förderer der Goethe Schule Flensburg e.v. Satzung. Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
 Verein der Freunde und Förderer der Goethe Schule Flensburg e.v. Satzung 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen Verein der Freunde und Förderer der Goethe-Schule Flensburg
Verein der Freunde und Förderer der Goethe Schule Flensburg e.v. Satzung 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen Verein der Freunde und Förderer der Goethe-Schule Flensburg
Muster- Geschäftsordnung des Vereins (nachfolgend Verein genannt)
 Muster- Geschäftsordnung des Vereins (nachfolgend Verein genannt) Wichtig: Alle müssen als Ergänzung zur Satzung des Vereins betrachtet werden und es darf keinen Widerspruch zu Satzungsbestimmungen geben.
Muster- Geschäftsordnung des Vereins (nachfolgend Verein genannt) Wichtig: Alle müssen als Ergänzung zur Satzung des Vereins betrachtet werden und es darf keinen Widerspruch zu Satzungsbestimmungen geben.
V O R L A G E für die Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland am 11. und 12. Februar 2016 in Berlin
 ARK 2/2016 V O R L A G E für die Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland am 11. und 12. Februar 2016 in Berlin Antrag der Dienstgeberseite zum Beschluss einer Arbeitsrechtsregelung
ARK 2/2016 V O R L A G E für die Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland am 11. und 12. Februar 2016 in Berlin Antrag der Dienstgeberseite zum Beschluss einer Arbeitsrechtsregelung
Willensvollstrecker und Vermögensverwaltung. Inhalt
 Willensvollstrecker und Vermögensverwaltung Inhalt Aufgaben des Willensvollstreckers Abgrenzung Willensvollstrecker/Erbschaftsverwaltung Rechtsgrundlagen Willensvollstreckung Massgeblicher Wille Zeitliche
Willensvollstrecker und Vermögensverwaltung Inhalt Aufgaben des Willensvollstreckers Abgrenzung Willensvollstrecker/Erbschaftsverwaltung Rechtsgrundlagen Willensvollstreckung Massgeblicher Wille Zeitliche
Ordnung über das Auswahlverfahren. Universität Göttingen. 1 Anwendungsbereich
 Veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 6 vom 16.06.2006 Nach Beschluss des Fakultätsrats der Juristischen Fakultät am 03.05.2006 hat der Senat der Georg-August-Universität Göttingen am 17.05.2006
Veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 6 vom 16.06.2006 Nach Beschluss des Fakultätsrats der Juristischen Fakultät am 03.05.2006 hat der Senat der Georg-August-Universität Göttingen am 17.05.2006
Donnerstag, 11. Dezember 03 Satz 2.2 Der Name Unterraum ist gerechtfertigt, denn jeder Unterraum U von V ist bzgl.
 Unterräume und Lineare Hülle 59 3. Unterräume und Lineare Hülle Definition.1 Eine Teilmenge U eines R-Vektorraums V heißt von V, wenn gilt: Unterraum (U 1) 0 U. (U ) U + U U, d.h. x, y U x + y U. (U )
Unterräume und Lineare Hülle 59 3. Unterräume und Lineare Hülle Definition.1 Eine Teilmenge U eines R-Vektorraums V heißt von V, wenn gilt: Unterraum (U 1) 0 U. (U ) U + U U, d.h. x, y U x + y U. (U )
Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003
 Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 3 2. Feststellungen
Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 3 2. Feststellungen
Gesetz, mit dem das Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz geändert wird. Artikel I
 Gesetz, mit dem das Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz geändert wird Der Wiener Landtag hat beschlossen: Artikel I Das Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz, LGBl. für Wien Nr. 39/1987, zuletzt geändert
Gesetz, mit dem das Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz geändert wird Der Wiener Landtag hat beschlossen: Artikel I Das Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz, LGBl. für Wien Nr. 39/1987, zuletzt geändert
21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02)
 21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 21.0 Der Gesetzgeber hat die Träger der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand zu senken
21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 21.0 Der Gesetzgeber hat die Träger der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand zu senken
Gesetz über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer
 LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 15. Wahlperiode Drucksache 15/1924 10.05.2011 Neudruck Gesetzentwurf der Fraktion der SPD der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE Gesetz über die Festsetzung
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 15. Wahlperiode Drucksache 15/1924 10.05.2011 Neudruck Gesetzentwurf der Fraktion der SPD der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE Gesetz über die Festsetzung
Die amtliche Begründung zur HOAI 2009 beginnt mit folgendem Satz:
 Sehr geehrte Damen und Herren, Die amtliche Begründung zur HOAI 2009 beginnt mit folgendem Satz: Nach der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 soll die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Sehr geehrte Damen und Herren, Die amtliche Begründung zur HOAI 2009 beginnt mit folgendem Satz: Nach der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 soll die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Vom Getreidekorn zum Brot
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Vom Getreidekorn zum Brot Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2.-6. Schuljahr Gabriela Rosenwald
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Vom Getreidekorn zum Brot Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2.-6. Schuljahr Gabriela Rosenwald
Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt. Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt
 Kategorie Ecolier Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 3. 4 595 36,3 4. 7 107 44,4 Kategorie Benjamin Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 5. 21 590 39,7 6. 22 414 47,8 Bei Untersuchung
Kategorie Ecolier Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 3. 4 595 36,3 4. 7 107 44,4 Kategorie Benjamin Schulstufe Teilnehmer/innen Punktedurchschnitt 5. 21 590 39,7 6. 22 414 47,8 Bei Untersuchung
Kapitel 4 http://www.patentfuehrerschein.de Seite 1
 Kapitel 4 http://www.patentfuehrerschein.de Seite 1 4. Kapitel Nachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln im Wesentlichen mit den Grundsätzen des Patentrechts sowie mit den Voraussetzungen für die Erteilung
Kapitel 4 http://www.patentfuehrerschein.de Seite 1 4. Kapitel Nachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln im Wesentlichen mit den Grundsätzen des Patentrechts sowie mit den Voraussetzungen für die Erteilung
Forderungseinzug. Rechtsanwalt Christopher Langlotz
 Forderungseinzug Ausstehende Forderungen Viele Unternehmen haben Probleme mit der Zahlungsmoral ihrer Kunden. Ein erheblicher Teil der Insolvenzen in Deutschland geht auf das Konto säumiger Zahler. Aber
Forderungseinzug Ausstehende Forderungen Viele Unternehmen haben Probleme mit der Zahlungsmoral ihrer Kunden. Ein erheblicher Teil der Insolvenzen in Deutschland geht auf das Konto säumiger Zahler. Aber
Berliner Stiftungsgesetz. (StiftG Bln) in der Fassung vom 22. Juli 2003
 Berliner Stiftungsgesetz (StiftG Bln) in der Fassung vom 22. Juli 2003 Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind die rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts, die ihren Sitz in Berlin haben. (1)
Berliner Stiftungsgesetz (StiftG Bln) in der Fassung vom 22. Juli 2003 Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind die rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts, die ihren Sitz in Berlin haben. (1)
6 Bundessozialministerium und Rentenversicherung nehmen seit Jahren falsche Rentenberechnungen in Kauf (Kapitel 1113 Titelgruppe 02)
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Einzelplan 11) 6 Bundessozialministerium und Rentenversicherung nehmen seit Jahren falsche Rentenberechnungen in Kauf (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 6.0 Das Bundessozialministerium
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Einzelplan 11) 6 Bundessozialministerium und Rentenversicherung nehmen seit Jahren falsche Rentenberechnungen in Kauf (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 6.0 Das Bundessozialministerium
der Stadt Sankt Augustin über die Unterhaltung und Benutzung von Obdachlosenunterkünften
 S A T Z U N G der Stadt Sankt Augustin über die Unterhaltung und Benutzung von Obdachlosenunterkünften Beschlossen: 10.07.2013 Bekanntgemacht: 17.07.2013 in Kraft getreten: 01.01.2014 I N H A L T S V E
S A T Z U N G der Stadt Sankt Augustin über die Unterhaltung und Benutzung von Obdachlosenunterkünften Beschlossen: 10.07.2013 Bekanntgemacht: 17.07.2013 in Kraft getreten: 01.01.2014 I N H A L T S V E
DEUTSCHE BUNDESBANK Seite 1 Z 10-8. Prüfzifferberechnungsmethoden zur Prüfung von Kontonummern auf ihre Richtigkeit (Stand: September 2015)
 DEUTSCHE BUNDESBANK Seite 1 Z 10-8 Prüfzifferberechnungsmethoden zur Prüfung von Kontonummern auf ihre Richtigkeit (Stand: September 2015) 00 Modulus 10, Gewichtung 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Die Stellen
DEUTSCHE BUNDESBANK Seite 1 Z 10-8 Prüfzifferberechnungsmethoden zur Prüfung von Kontonummern auf ihre Richtigkeit (Stand: September 2015) 00 Modulus 10, Gewichtung 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Die Stellen
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Vorschlag für RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
 EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endgültig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Vorschlag für RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG
EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endgültig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Vorschlag für RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG
Neue Fakten zur Lohnentwicklung
 DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
Der Labeling Approach
 Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Berufungsentscheidung
 Außenstelle Wien Senat 12 GZ. RV/2475-W/10 Berufungsentscheidung Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., gegen den Bescheid des Finanzamtes Wien 8/16/17 betreffend Abweisung eines Antrages
Außenstelle Wien Senat 12 GZ. RV/2475-W/10 Berufungsentscheidung Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., gegen den Bescheid des Finanzamtes Wien 8/16/17 betreffend Abweisung eines Antrages
Vorlage für die Sitzung des Senats am Auflösung der Stiftung Wohnliche Stadt
 Anlage 1 Der Senator für Inneres 12. November 2015 Herr Schirmbeck Tel. 361-9006 Vorlage für die Sitzung des Senats am 10.11.2015 Auflösung der Stiftung Wohnliche Stadt - Änderung des Gesetzes über die
Anlage 1 Der Senator für Inneres 12. November 2015 Herr Schirmbeck Tel. 361-9006 Vorlage für die Sitzung des Senats am 10.11.2015 Auflösung der Stiftung Wohnliche Stadt - Änderung des Gesetzes über die
Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen
 Deutscher Bundestag 6. Wahlperiode Drucksache VI/2028 Sachgebiet 450 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler I/4 (II/2) 350 07 Ze 1/71 Bonn, den 29. März 1971 An den Herrn Präsidenten des Deutschen
Deutscher Bundestag 6. Wahlperiode Drucksache VI/2028 Sachgebiet 450 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler I/4 (II/2) 350 07 Ze 1/71 Bonn, den 29. März 1971 An den Herrn Präsidenten des Deutschen
Satzung. über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutacherausschuß - Gutachterausschuß-Gebührensatzung -
 1 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutacherausschuß - Gutachterausschuß-Gebührensatzung - Rechtsgrundlage: 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in
1 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutacherausschuß - Gutachterausschuß-Gebührensatzung - Rechtsgrundlage: 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in
Anhang 6. Eingangstest II. 1. Berechnen Sie den Durchschnitt von 6 + 3,9 + 12, 0 = 2. Berechnen Sie: : = 3. Berechnen Sie: = 3 und 6
 Anhang 6 Eingangstest II 1. Berechnen Sie den Durchschnitt von 6 + 3,9 + 12, 0 = 8 4 2. Berechnen Sie: : = 3 1 2x x 3. Berechnen Sie: = 9 9 4. Wie groß ist die Summe von 4 3 und 6?. Berechnen Sie: 3 (
Anhang 6 Eingangstest II 1. Berechnen Sie den Durchschnitt von 6 + 3,9 + 12, 0 = 8 4 2. Berechnen Sie: : = 3 1 2x x 3. Berechnen Sie: = 9 9 4. Wie groß ist die Summe von 4 3 und 6?. Berechnen Sie: 3 (
G e m e i n d e v e r o r d n u n g
 G e m e i n d e v e r o r d n u n g zum Schutze des Bestandes an Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde Bad Füssing (Baumschutz-Verordnung) Auf Grund des Art.
G e m e i n d e v e r o r d n u n g zum Schutze des Bestandes an Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde Bad Füssing (Baumschutz-Verordnung) Auf Grund des Art.
Kommunalrecht. Klausur für den Angestelltenlehrgang I, Sekretäranwärter, Verwaltungsfachangestellte
 Kommunalrecht Klausur für den Angestelltenlehrgang I, Sekretäranwärter, Verwaltungsfachangestellte Dauer: 90 Minuten Sachverhalt Der Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinde S. (20.000 Einwohner) im
Kommunalrecht Klausur für den Angestelltenlehrgang I, Sekretäranwärter, Verwaltungsfachangestellte Dauer: 90 Minuten Sachverhalt Der Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinde S. (20.000 Einwohner) im
Verkündung Veröffentlicht am Donnerstag, 19. November 2015 BAnz AT 19.11.2015 V1 Seite 1 von 5
 Seite 1 von 5 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Verordnung zur Durchführung einer befristeten Sonderbeihilfe im Tierhaltungssektor (Tiersonderbeihilfenverordnung TierSoBeihV) Vom 17. November
Seite 1 von 5 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Verordnung zur Durchführung einer befristeten Sonderbeihilfe im Tierhaltungssektor (Tiersonderbeihilfenverordnung TierSoBeihV) Vom 17. November
Vom 1. November Schutzraumunterhaltsverordnung
 Verordnung betreffend Kontrolle und Unterhalt (Wartung, Reparatur und Revision) a) der Anlagen der örtlichen Schutzorganisation, der Schutzanlagen der Betriebe, der privaten Schutzräume, b) der geschützten
Verordnung betreffend Kontrolle und Unterhalt (Wartung, Reparatur und Revision) a) der Anlagen der örtlichen Schutzorganisation, der Schutzanlagen der Betriebe, der privaten Schutzräume, b) der geschützten
Satzung. der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen-Immenstaad
 S A T Z U N G über die Erhebung von Gebühren durch den Gutachterausschuss Aufgrund des 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den 2, 11, 12 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg
S A T Z U N G über die Erhebung von Gebühren durch den Gutachterausschuss Aufgrund des 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den 2, 11, 12 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg
Spiegeleier. Kriminell gut rechnen
 5 15 20 25 30 35 40 Es war wie verhext. Nun geschah schon der dritte Wohnungseinbruch in Folge und die Polizei hatte bisher nicht den allerkleinsten Erfolg bei der Aufklärung zu verzeichnen. Nicht den
5 15 20 25 30 35 40 Es war wie verhext. Nun geschah schon der dritte Wohnungseinbruch in Folge und die Polizei hatte bisher nicht den allerkleinsten Erfolg bei der Aufklärung zu verzeichnen. Nicht den
Tenor. Tatbestand. FG München, Urteil v. 13.01.2015 2 K 3067/12. Titel: (Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften)
 FG München, Urteil v. 13.01.2015 2 K 3067/12 Titel: (Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften) Normenketten: 42 FGO 351 AO 171 Abs 10 AO 10d EStG 2002 175 Abs 1 S 1 Nr 1 AO 23 Abs 1 S 1 Nr 1 EStG 2002
FG München, Urteil v. 13.01.2015 2 K 3067/12 Titel: (Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften) Normenketten: 42 FGO 351 AO 171 Abs 10 AO 10d EStG 2002 175 Abs 1 S 1 Nr 1 AO 23 Abs 1 S 1 Nr 1 EStG 2002
Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten
 Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten CONTAX HANNOVER Steuerberatungsgesellschaft Partnerschaftsgesellschaft mbb Dr. Horst Garbe Christina Haß Gerhard Kühl Hans-Böckler-Allee 26 30173 Hannover Telefon
Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten CONTAX HANNOVER Steuerberatungsgesellschaft Partnerschaftsgesellschaft mbb Dr. Horst Garbe Christina Haß Gerhard Kühl Hans-Böckler-Allee 26 30173 Hannover Telefon
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstattung von Gutachten
 Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstattung von Gutachten 1) Geltung Die Rechtsbeziehungen des Sachverständigen zum Auftraggeber bestimmen sich nach den folgenden Vertragsbedingungen. Davon abweichende
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstattung von Gutachten 1) Geltung Die Rechtsbeziehungen des Sachverständigen zum Auftraggeber bestimmen sich nach den folgenden Vertragsbedingungen. Davon abweichende
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN. Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES
 KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 16.12.2003 KOM(2003) 825 endgültig 2003/0317 (CNS) Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG mit dem Ziel der
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 16.12.2003 KOM(2003) 825 endgültig 2003/0317 (CNS) Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG mit dem Ziel der
1) Ansprüche des L gegen E auf Herausgabe der Maschine gemäß 985 BGB
 Lösung Fall 4: Wissender Empfänger I. Anspruch auf Herausgabe 1) Ansprüche des L gegen E auf Herausgabe der Maschine gemäß 985 BGB Da E Eigentümer der Sache ist, scheidet ein solcher Anspruch aus. 2) Anspruch
Lösung Fall 4: Wissender Empfänger I. Anspruch auf Herausgabe 1) Ansprüche des L gegen E auf Herausgabe der Maschine gemäß 985 BGB Da E Eigentümer der Sache ist, scheidet ein solcher Anspruch aus. 2) Anspruch
Übereinkommen 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958
 Internationale Arbeitsorganisation (ILO) Übereinkommen 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958 Dieses Übereinkommen ist am 15. Juni 1960 in Kraft getreten. Die Allgemeine Konferenz
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) Übereinkommen 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958 Dieses Übereinkommen ist am 15. Juni 1960 in Kraft getreten. Die Allgemeine Konferenz
Satzung der Stadt Angermünde über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
 Satzung der Stadt Angermünde über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer Aufgrund des 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg - Gemeindeordnung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober
Satzung der Stadt Angermünde über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer Aufgrund des 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg - Gemeindeordnung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober
Abschlussbericht Landesprojekt 2009 Sozialvorschriften im Straßenverkehr Schwerpunktaktion Busse im Linienverkehr 2009
 Abschlussbericht Landesprojekt 2009 Sozialvorschriften im Straßenverkehr Schwerpunktaktion Busse im Linienverkehr 2009 Einleitung Eine der Schwerpunktaktionen der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht
Abschlussbericht Landesprojekt 2009 Sozialvorschriften im Straßenverkehr Schwerpunktaktion Busse im Linienverkehr 2009 Einleitung Eine der Schwerpunktaktionen der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN. Empfehlung für eine ENTSCHEIDUNG DES RATES
 KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 8.1.2003 SEK (2003) 9 endgültig EU EINGESCHRÄNKTE VERTEILUNG Empfehlung für eine ENTSCHEIDUNG DES RATES über das Bestehen eines übermäßigen Defizits
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 8.1.2003 SEK (2003) 9 endgültig EU EINGESCHRÄNKTE VERTEILUNG Empfehlung für eine ENTSCHEIDUNG DES RATES über das Bestehen eines übermäßigen Defizits
Lösung Fall 8 a. I. Beschränkte Geschäftsfähigkeit, 2, 106 BGB
 Lösung Fall 8 a B hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 50 aus 433 II BGB, wenn zwischen B und K ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist. A. Angebot Ein wirksamer Kaufvertrag
Lösung Fall 8 a B hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 50 aus 433 II BGB, wenn zwischen B und K ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist. A. Angebot Ein wirksamer Kaufvertrag
Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bundesfernstraßenrecht
 Bundesrat Drucksache 206/14 15.05.14 Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bundesfernstraßenrecht A. Problem Windenergieanlagen können mittlerweile
Bundesrat Drucksache 206/14 15.05.14 Gesetzesantrag des Freistaates Sachsen Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bundesfernstraßenrecht A. Problem Windenergieanlagen können mittlerweile
9. Mathematik Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 9 Saison 1969/1970 Aufgaben und Lösungen
 9. Mathematik Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 9 Saison 1969/1970 Aufgaben und Lösungen 1 OJM 9. Mathematik-Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 9 Aufgaben Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen
9. Mathematik Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 9 Saison 1969/1970 Aufgaben und Lösungen 1 OJM 9. Mathematik-Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 9 Aufgaben Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen
Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder
 Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder HAUSANSCHRIFT TEL FAX E-MAIL
Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder HAUSANSCHRIFT TEL FAX E-MAIL
Die Ägypter stellten schon vor über 5.000 Jahren Brot her, es war ihr Hauptnahrungsmittel. So gab man den Ägyptern in der Antike auch den Beinamen
 Einst haben auch in Bremerhaven und umzu viele Windmühlen gestanden. Einige haben als Museum den Sprung in die Gegenwart geschafft, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Nur noch die Namen von Straßen
Einst haben auch in Bremerhaven und umzu viele Windmühlen gestanden. Einige haben als Museum den Sprung in die Gegenwart geschafft, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Nur noch die Namen von Straßen
Diagnostische Probe zur Erfassung des Zielsetzungsverhaltens
 Diagnostische Probe zur Erfassung des Zielsetzungsverhaltens Quelle: Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2000). Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten: Training der Motivation - Training
Diagnostische Probe zur Erfassung des Zielsetzungsverhaltens Quelle: Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2000). Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten: Training der Motivation - Training
I. Gegenstand der Verordnung. Vom 1. November 1977 (Stand 1. Januar 2009) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,
 Verordnung betreffend Kontrolle und Unterhalt (Wartung, Reparatur und Revision) a) der Anlagen der örtlichen Schutzorganisation, der Schutzanlagen der Betriebe, der privaten Schutzräume, b) der geschützten
Verordnung betreffend Kontrolle und Unterhalt (Wartung, Reparatur und Revision) a) der Anlagen der örtlichen Schutzorganisation, der Schutzanlagen der Betriebe, der privaten Schutzräume, b) der geschützten
GEMEINDE BAIERSBRONN LANDKREIS FREUDENSTADT
 GEMEINDE BAIERSBRONN LANDKREIS FREUDENSTADT Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) vom 21. Februar 1995
GEMEINDE BAIERSBRONN LANDKREIS FREUDENSTADT Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) vom 21. Februar 1995
OGD Schweiz Entscheidgrundlage: Nutzungsbedingungen OGD Portal Definition OGD
 OGD Schweiz Entscheidgrundlage: Nutzungsbedingungen OGD Portal Definition OGD Anne Wiedmer, Corinna Seiberth, 13. März 2015 Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangslage... 3 2. Öffentlich-rechtliche Nutzungsbedingungen
OGD Schweiz Entscheidgrundlage: Nutzungsbedingungen OGD Portal Definition OGD Anne Wiedmer, Corinna Seiberth, 13. März 2015 Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangslage... 3 2. Öffentlich-rechtliche Nutzungsbedingungen
Dienstliche Beurteilung: Berücksichtigung behinderungsbedingter Minderleistungen
 RECHT AKTUELL GKS-Rechtsanwalt Florian Hupperts informiert Beamte über aktuelle Probleme aus dem Beamten- und Disziplinarrecht Rechtsanwalt Florian Hupperts Dienstliche Beurteilung: Berücksichtigung behinderungsbedingter
RECHT AKTUELL GKS-Rechtsanwalt Florian Hupperts informiert Beamte über aktuelle Probleme aus dem Beamten- und Disziplinarrecht Rechtsanwalt Florian Hupperts Dienstliche Beurteilung: Berücksichtigung behinderungsbedingter
I M N A M E N D E R R E P U B L I K! Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des. Dr. K o r i n e k, Dr. B i e r l e i n
 Verfassungsgerichtshof Judenplatz 11, 1010 Wien V 109/03-13 I M N A M E N D E R R E P U B L I K! Präsidenten Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des Dr. K o r i n e k, in Anwesenheit der Vizepräsidentin
Verfassungsgerichtshof Judenplatz 11, 1010 Wien V 109/03-13 I M N A M E N D E R R E P U B L I K! Präsidenten Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des Dr. K o r i n e k, in Anwesenheit der Vizepräsidentin
Fernsehgesetz von 1996
 Fernsehgesetz von 1996 1996 Kapitel 55 Kodex zur Versorgung von Gehörlosen und Sehbehinderten 20. (1) Die Kommission soll einen Kodex aufsetzen und von Zeit zu Zeit überprüfen, der Anleitung gibt hinsichtlich
Fernsehgesetz von 1996 1996 Kapitel 55 Kodex zur Versorgung von Gehörlosen und Sehbehinderten 20. (1) Die Kommission soll einen Kodex aufsetzen und von Zeit zu Zeit überprüfen, der Anleitung gibt hinsichtlich
NWT Projekt Jannik Karl NWT Projekt Arbeit Legoroboter
 NWT Projekt Arbeit Legoroboter Inhalt Projekt 1: - Aufgabe - Planung - Umsetzung - Optimierung - Programm - Endergebnis Projekt 2: - Aufgabe - Planung - Umsetzung - Optimierung - Programm 1 - Programm
NWT Projekt Arbeit Legoroboter Inhalt Projekt 1: - Aufgabe - Planung - Umsetzung - Optimierung - Programm - Endergebnis Projekt 2: - Aufgabe - Planung - Umsetzung - Optimierung - Programm 1 - Programm
In der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2002 (GVBl. I S. 676)
 Seite 1 von 6 Wahlprüfungsgesetz In der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2002 (GVBl. I S. 676) 1 WahlprüfG - Landesrecht Hessen Das Wahlprüfungsgericht beim Landtag besteht aus dem Präsidenten
Seite 1 von 6 Wahlprüfungsgesetz In der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2002 (GVBl. I S. 676) 1 WahlprüfG - Landesrecht Hessen Das Wahlprüfungsgericht beim Landtag besteht aus dem Präsidenten
Beilage Arbeitshilfe Nr. 8
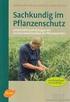 Beilage Arbeitshilfe Nr. 8 Aufgrund neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) sowie der Veröffentlichung eines neuen Emittentenleitfadens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Beilage Arbeitshilfe Nr. 8 Aufgrund neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) sowie der Veröffentlichung eines neuen Emittentenleitfadens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz. Teil 4: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
 Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz Von Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann, Düsseldorf Patentanwalt und Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft
Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz Von Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann, Düsseldorf Patentanwalt und Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Der Antrag" von Gabriele Wohmann - Mehrschrittige Interpretation
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Der Antrag" von Gabriele Wohmann - Mehrschrittige Interpretation Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Der Antrag" von Gabriele Wohmann - Mehrschrittige Interpretation Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
