Nutzung von Windenergieüberschüssen durch Einsatz von Wasserstoffspeichern
|
|
|
- Bernhard Schuster
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik Nutzung von Windenergieüberschüssen durch Einsatz von Wasserstoffspeichern Wind2H Analyse der potentiell zur Verfügung stehenden Überschüsse aus Windenergie und Beurteilung von Wasserstoffspeichern als mögliche Lösung zur Deckung des Speicherbedarfs Abschlussbericht Autor: Carolin Heiter Sterzinger Straße Nürnberg Matrikel-Nr.: Prüfer: Korrektor: Prof. Dr.-Ing. Matthias Popp Lisa Herrmann Eingereicht am: Unterschrift:
2 Abstract In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern sich die aufgrund der Volatilität von Windenergie ausbildenden Überschüsse mithilfe von Wasserstoffspeichern nutzen lassen, um Defizite auszugleichen. Dabei wird sich vor allem auf das Klimaziel der Europäischen Metropolregion Nürnberg bezogen, bis zum Jahr 2030 bereits 60 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken. Basierend auf den Merra-2 Daten der NASA, sowie den Netzdaten der Main-Donau Netzgesellschaft, werden Überschüsse und Defizite im Windenergieverlauf sowohl für das Jahr 2017 als auch für 2030 ermittelt. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen technologischen Verfahren der Wasserelektrolyse hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit in Zusammenhang mit regenerativen Energieträgern erklärt und verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Speichern im Jahr 2030 eine notwendige Voraussetzung ist, um das Klimaziel zu erreichen und gleichzeitig eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten. II
3 Inhaltsverzeichnis Abstract... II Abbildungsverzeichnis... IV Abkürzungsverzeichnis... V 1. Einleitung Zielsetzung und Forschungsfragen Stand der Technik Windenergie Wasserstoffspeicher Elektrolyse allgemein Alkalische Elektrolyse Polymerelektrolyt-Elektrolyse Hochtemperatur-Wasserdampf-Elektrolyse Vergleich der Elektrolyseverfahren Pilotprojekte Datenaufbereitung und auswertung Stromverbrauch in der EMN Windenergie - Verläufe Potentiell verfügbare Windenergie vs. Stromverbrauch (Szenario 2030) Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (Szenario 2030) Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (aktueller Zustand) Analyse des Speicherbedarfs Speicherbedarf EMN Speicherbedarf Wald-Windpark Reichertshüll Fazit Ausblick Literaturverzeichnis III
4 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Stromerzeugung aus Windenergie 2017 (Bundesverband WindEnergie, 2018) Abbildung 2: Verteilung der EinsMan-Maßnahmen nach Energieträgern (Bundesnetzagentur, 2018a) Abbildung 3: Alkalische Elektrolyse mit mobilem Elektrolyt (Kurzweil und Dietlmeier, 2015, S. 433)- 7 - Abbildung 4: Verlauf Stromverbrauch der EMN im Jahr Abbildung 5: Verlauf potentiell verfügbare Windenergie in der EMN (Vergleichsjahr 2017, 642 zusätzliche WEA) Abbildung 6: Stromverbrauch (Windanteil 38,7%) vs. potentiell verfügbare Windenergie (zusätzliche 642 WEA) Abbildung 7: Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (Szenario 2030) Abbildung 8: Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (aktuell, Windanteil 9,7%) Abbildung 9: Verlauf der Windenergieüberschüsse und -defizite (Szenario 2030) IV
5 Abkürzungsverzeichnis AEL BHKW EEG EMN FAE HTES KWKG PEM SOEL SPE WEA Alkalische Elektrolyse Blockheizkraftwerk Erneuerbare-Energien-Gesetz Europäische Metropolregion Nürnberg fixed alkaline electrolysis high temperature electrolysis of steam Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz proton exchange membrane solid oxide electrolysis solid polymer electrolyte Windenergieanlage V
6 1. Einleitung Das Thema Energiewende stellt für die Bundesregierung derzeit ein hochaktuelles Thema dar. Indem verstärkt auf erneuerbare Energien gesetzt wird, soll der Einsatz von Kernkraft und Kohle als Energieträger nach und nach verringert werden (Die Bundesregierung, 2018). Im Jahr 2017 betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bereits 36,2 Prozent (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018). Dabei wurde insbesondere in Projekte im Bereich der Photovoltaik und Windenergie investiert (Die Bundesregierung, 2018). Die Umstellung auf erneuerbare Energien bringt allerdings auch neue Herausforderungen mit sich. Da sich die regenerative Energiebereitstellung nicht am Bedarf orientiert, werden Lösungen zur Speicherung benötigt, um den Ausgleich von Spitzen- und Defizitzeiten möglich zu machen. Darüber hinaus bringt die Umstellung der Energieversorgung auch einen strukturellen Wandel mit sich. Die Versorgung wird zunehmend dezentral, da regenerative Energieträger überall vorhanden sind und somit zahlreiche kleine Anlagen entstehen können (Gailing und Röhring, 2015). Die dort erzeugte Energie wird im Gegensatz zu Großprojekten nicht ins Hochspannungsnetz eingespeist, sondern direkt in Erzeugungsnähe verbraucht. Das Thema Dezentralisierung wird von der Bundesregierung daher als eine der großen Herausforderungen der Energiewende betrachtet (Die Bundesregierung, 2018). Auch die Metropolregion Nürnberg schenkt dem Thema Energiewende besondere Aufmerksamkeit. In dem zuletzt 2017 aktualisierten Klimapakt setzt sie es sich zum Ziel, die CO 2 -Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 95 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 zu reduzieren (Metropolregion Nürnberg, 2017). Die EMN beabsichtigt so eine Vorreiterrolle für die dezentrale Energiewende in Deutschland einzunehmen
7 2. Zielsetzung und Forschungsfragen Grundlage für die Erstellung der vorliegenden Studienarbeit bilden die Zielsetzungen des Klimapaktes der EMN. Dieser wurde bereits im Jahr 2012 beschlossen, allerdings im Jahr 2017 erneut aktualisiert, nachdem bei der im Jahr 2015 stattfindenden Klimakonferenz in Paris eine neue Klimaschutzvereinbarung verabschiedet wurde (Metropolregion Nürnberg, 2017). Der aktualisierte Klimapakt betrachtet als maßgebliche Kennzahlen den Endenergieverbrauch, den Anteil an regenerativen Energien sowie an Kraft-Wärme-Kopplung und die CO2-Emissionen. Um in diesen Bereichen die Zielsetzungen zu realisieren, ist es unter anderem notwendig die erneuerbaren Energieträger auszubauen und sich mit neuen Speichertechnologien und Netzstrukturen auseinanderzusetzen. Aufbauend auf diesen Herausforderungen erstellen die Studenten der Technischen Hochschule Nürnberg, Fakultät Maschinenbau mit Studienschwerpunkt Energietechnik, Projektarbeiten, die unterschiedliche Themenbereiche näher beleuchten und deren Ziel es ist, Lösungsansätze zum Thema Energiewende der EMN zu erarbeiten. Die vorliegende Projektarbeit untersucht, welchen Beitrag die Windenergie durch Nutzung der Überschüsse in Verbindung mit Wasserstoffspeichern im Jahr 2030 zur Energieversorgung der Metropolregion leisten kann. Die notwendigen Daten zum Windenergieverlauf liefert dabei die Datenbank MERRA-2 der NASA, Daten zum Stromverbrauch in der EMN werden über die Main-Donau-Netzgesellschaft bezogen. Zunächst ist es daher wichtig, die beiden Datensätze so aufzubereiten, dass sie anschließend in einen direkten Vergleich gebracht werden können. So soll der Windenergieverlauf in der EMN bestimmt werden und anschließend dem Stromverbrauch gegenübergestellt werden, der im Jahr 2030 durch Windenergie gedeckt werden soll. Auch kann so erfasst werden, wie sich die gegenwärtige Situation in der EMN gestaltet. Darüber hinaus werden die Verläufe näher analysiert, indem die Energiemengen von Überschüssen und Defiziten ermittelt werden. Dies führt zum nächsten Punkt der Arbeit, der Frage nach Speicheroptionen. In diesem Sinne werden Wasserstoffspeicher und die damit verbundenen Wasserelektrolyseverfahren näher betrachtet und auf ihre Einsatztauglichkeit in Verbindung mit regenerativen Energieträgern hin untersucht. Mittels der berechneten Defizite kann außerdem eine Aussage darüber getroffen werden, welche Speicherkapazitäten notwendig wären. Anhand von bereits existierenden - 2 -
8 Pilotprojekten kann abschließend bewertet werden, ob der Einsatz von Wasserstoffspeichern auch in der EMN eine in Zukunft realistische Option ist. Die im Folgenden behandelten Forschungsfragen lauten somit: 1. Welche Überschüsse und Defizite gibt es in der EMN aufgrund des Potentials an Windenergie für das Vergleichsjahr 2017? 2. Wie bilden sich die Überschüsse durch Windenergie in Gegenden der EMN, in welchen bereits Windenergieanlagen stehen, aus? 3. Welche Speicherkapazitäten wären zur Speicherung der Überschüsse notwendig? 4. Sind Wasserstoffspeicher eine realistische Option und gibt es in der Metropolregion Windkraftanlagen, wo deren Einsatz sinnvoll wäre? - 3 -
9 3. Stand der Technik 3.1 Windenergie Bundesweit befinden sich in Deutschland knapp Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von circa Megawatt (Bundesverband WindEnergie, 2018). Der Anteil der Windenergie an der deutschen Stromproduktion betrug im Jahr 2017 im Schnitt 18,8 Prozent. Allein im Jahr 2017 wurden 1792 neue WEA errichtet, was der bislang größten Anzahl an neu errichteten WEA seit dem Beginn der Entwicklung von Windenergie entspricht (Deutsche WindGuard, 2017). Dies ist unter anderem auf kurze energetische Amortisationszeiten und neue technische Entwicklungen zurückzuführen (Umweltbundesamt, 2014). So können WEA mittlerweile nicht mehr nur in Küstenregionen oder auf Freiflächen errichtet und wirtschaftlich betrieben werden, sondern aufgrund der mittlerweile erreichten möglichen Nabenhöhen auch in Waldgebieten eingesetzt werden. Bezogen auf das Jahr 2017 hatte die durchschnittliche WEA eine Nabenhöhe von 128 Meter, einen Rotordurchmesser von 113 Meter und eine Anlagenleistung von Kilowatt. Aktuelle WEA liefern jedoch schon höhere Nennleistungen. Auch die für den Ausbauplan in der Metropolregion betrachteten WEA gehen von einer Anlagenleistung von 4,1 Megawatt aus. Der fluktuierende Verlauf der Windenergie macht Speichermöglichkeiten zu einem wichtigen Thema. Die Volatilität ist bereits im stündlichen Verlauf deutlich erkennbar, aber auch die monatlich erzeugten Energiemengen weisen starke Differenzen auf. Abbildung 1 zeigt die schwankende Einspeisung nach Monaten in Deutschland für das Jahr Abbildung 1: Stromerzeugung aus Windenergie 2017 (Bundesverband WindEnergie, 2018) - 4 -
10 Wie daraus ersichtlich wird, steht in den Wintermonaten mehr Windenergie zur Verfügung als im Sommer. Jedoch zeigen sich auch beim Vergleich der einzelnen Wintermonate schon starke Unterschiede. Trotz der noch steigenden Anzahl an WEA kommt es bei den bestehenden immer wieder zu Abregelungen. Der hinter dieser Maßnahme stehende Begriff nennt sich Einspeisemanagement. Wenn zu viel Strom produziert wird und es daher zu Netzengpässen kommt, sieht das EEG sowie das KWKG vor, dass zunächst die konventionellen Kraftwerke abgeregelt werden (Bundesnetzagentur, 2018b). Erst als letzte Maßnahme darf die Abregelung der EE-Anlagen erfolgen. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland vom ersten bis zum dritten Quartal GWh abgeregelt. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, sind Windenergieanlagen am häufigsten von den Maßnahmen infolge des Einspeisemanagements betroffen. Abbildung 2: Verteilung der EinsMan-Maßnahmen nach Energieträgern (Bundesnetzagentur, 2018a) - 5 -
11 3.2 Wasserstoffspeicher Die Speicherfrage ist eine der zentralen Bestandteile der Energiewende. Überschüssige Energien können so Defizitzeiten ausgleichen, die regenerative Energiebereitstellung kann regelbar gemacht werden und somit Netzstabilität garantieren. Vor allem in chemischen Speichern werden zukünftige Lösungsansätze gesehen. Dabei spielt Wasserstoff eine der Hauptrollen. Im Folgenden werden die verschiedenen Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Wasserstoff und deren Bedeutung in Zusammenhang mit nachhaltiger Energieerzeugung näher betrachtet Elektrolyse allgemein Das grundsätzliche Prinzip der Elektrolyse besteht darin, dass durch das Anlegen eines elektrischen Stroms Wasser zersetzt wird. Da reines Wasser kein elektrischer Leiter ist, ist stets das Zugeben einer Säure oder Lauge notwendig (Kurzweil und Dietlmeier, 2015). Die Zersetzungsspannung muss theoretisch mindestens 1,23 Volt betragen. Dabei findet an der Kathode (Minuspol) die Abscheidung des Wasserstoffs und an der Anode (Pluspol) die Abscheidung des Sauerstoffs statt. Die derzeit gängigen drei Elektrolyseverfahren sind die alkalische Elektrolyse, die Polymerelektrolyt-Elektrolyse sowie die Hochtemperatur- Wasserdampf-Elektrolyse Alkalische Elektrolyse Die alkalische Elektrolyse kann nach zwei unterschiedlichen Verfahren ablaufen. Dabei wird [nach] der mechanischen Beweglichkeit des Elektrolyten [ ] unterschieden (Kurzweil und Dietlmeier, 2015, S. 432). Dieser liegt entweder mobil oder fixiert vor. Bei der mobilen Variante zirkuliert der Elektrolyt im Anoden- und Kathodenraum (vgl Abb. 3), welche durch eine Membran getrennt sind
12 Abbildung 3: Alkalische Elektrolyse mit mobilem Elektrolyt (Kurzweil und Dietlmeier, 2015, S. 433) Der Wasserstoff entsteht durch die kathodenseitig ablaufende Reaktion (Sterner und Stadler, 2017, S. 356): 2H 2 O + 2e H 2 + 2OH Die entstandenen Wasserstoffmoleküle liegen nun gasförmig vor, steigen aufgrund der Schwerkraft auf und treten aus dem Elektrolyt aus. Die Hydroxidionen wandern durch die Membran zur Anode und reagieren dort zu Wasser und Sauerstoff: 2OH 1 2 O 2 + H 2 O + 2e Auch die Sauerstoffmoleküle verlassen den Elektrolyten durch gasförmiges Aufsteigen. Das elektrochemisch verbrauchte Wasser wird lediglich nachgefüllt. Bei der fixierten Variante der alkalischen Elektrolyse (FAE) wird der Elektrolyt durch Kapillarkräfte in einer porösen Matrix festgehalten. Gasblasen können diese Matrix problemlos verlassen, da sie einer geringeren Oberflächenspannung unterliegen. Das verbrauchte Wasser muss der Matrix mittels Wasserdampfpermeation zugeführt werden Polymerelektrolyt-Elektrolyse Das zweite Elektrolyseverfahren wird als SPE- oder PEM-Elektrolyse bezeichnet. Grund hierfür ist, dass einerseits eine protonenleitende Membran (PEM) und andererseits ein polymerer Festelektrolyt (SPE) vorliegen. Bei diesem Verfahren wird das Wasser - 7 -
13 üblicherweise an der Anodenseite zugeführt. Dort entstehen zunächst Sauerstoffmoleküle und Protonen (Sterner und Stadler, 2017, S. 358): H 2 O 1 2 O 2 + 2H + + 2e Die Protonen diffundieren durch die Membran und reagieren kathodenseitig zu Wasserstoff: 2H + + 2e H Hochtemperatur-Wasserdampf-Elektrolyse Die Hochtemperatur-Wasserdampf-Elektrolyse (HTES) ist auch unter der Abkürzung SOEL bekannt, da sie unter Verwendung keramischer Festelektrolyte abläuft. Da bei diesem Verfahren nicht Wasser, sondern Wasserdampf gespalten wird, sinkt die theoretische Zersetzungsspannung um mehr als 0,5 V. Die Zersetzungsreaktionen lauten dabei wie folgt (Sterner und Stadler, 2017, S. 360): Kathodenseitig: H 2 O + 2e H 2 + O 2 Anodenseitig: O 2 2e + 1 O 2 2 Eine Besonderheit bei der HTES ist, dass aufgrund einer Nebenreaktion die direkte Erzeugung von Synthesegas möglich ist. Darüber hinaus ist die HTES reversibel, das bedeutet, die zur Elektrolyse notwendigen Komponenten können ebenfalls als Brennstoffzelle verwendet werden Vergleich der Elektrolyseverfahren Generell ist die Elektrolyse aufgrund ihrer Flexibilität ein geeignetes Verfahren, um in Kombination mit regenerativen Energieträgern Wasserstoff herzustellen. Ein Vergleich zwischen den Verfahren zeigt, dass die alkalische Elektrolyse die am stärksten verbreitete Technologie darstellt. Das System ist langzeitig am besten erprobt und erforscht und wird daher vor allem bei Anlagen im Megawattbereich eingesetzt (Kurzweil und Dietlmeier, 2015, S.446). Gleichzeitig ist es auch das kostengünstigste Verfahren. Die Lebensdauer alkalischer Elektrolysesysteme beträgt bis zu 30 Jahre, wobei nach zehn Jahren eine Generalüberholung notwendig ist. Allerdings ist aufgrund des Laugenkreislaufes die Reinigung sehr aufwändig. Des Weiteren ist ein Betrieb im unteren Teillastbereich kritisch, da sich die durch Fremdgase entstehenden Verunreinigungen in diesem Bereich prozentual mehr ausprägen
14 PEM Elektrolyseure finden aktuell noch vorwiegend im kleinen Leistungsbereich (bis 160 kw) Anwendung. Einer der größten Vorteile gegenüber der AEL besteht in der weitaus besseren Teillastfähigkeit, da es selbst im Teillastbereich nahe der null Prozent aufgrund des Festelektrolyten keine Gasverunreinigungen gibt und die Systeme verzögerungsfrei auf Lastschwankungen reagieren (Kurzweil und Dietlmeier, 2015, S.455). Die Lebensdauer der Systeme beträgt derzeit bis zu 20 Jahre. Nachteilig sind bei diesem Verfahren vor allem die hohen Werkstoffkosten. Die HTES/SOEL ist im Vergleich zur AEL und PEM Elektrolyse weniger erforscht (Smolinka et al., 2010, S. 15). Ein intermittierender Betrieb ist nachteilig, da die daraus resultierenden mechanischen Belastungen die Lebensdauer des Systems stark reduzieren. Da ein schnelles dynamisches Verhalten für die Speicherung regenerativer Energie ausschlaggebend ist, ist die HTES für diesen Einsatzbereich eher ungeeignet. Das technisch am besten geeignete Elektrolyseverfahren zur Umwandlung erneuerbarer Energien ist somit die PEM Elektrolyse
15 3.3 Pilotprojekte Derzeit existieren in Deutschland sieben Forschungs- und Pilotprojekte, die sich explizit mit der Thematik der Wasserstoffspeicherung in Kombination mit regenerativen Energieträgern beschäftigen (Deutsche Energie-Agentur, 2018). Davon sind bereits fünf in Betrieb. Auf zwei dieser Projekte, den Energiepark Mainz sowie die Multi-Energie-Tankstelle H2BER, wird im Folgenden näher eingegangen. Der Energiepark Mainz verfügt über drei Elektrolyseure mit Protonen-Austausch-Membran, die eine Spitzenleistung von je zwei Megawatt erbringen können. Betrieben werden diese mit Strom, der aus überschüssiger Windenergie eines naheliegenden Windparks bezogen wird. Es ist das weltweit erste Projekt, dass die PEM-Elektrolyse in dieser Größenordnung anwendet. Die Wahl dieser Technologie wird vom Energiepark Mainz durch die hochdynamische Fahrweise, wie sie bei einer Stromversorgung aus erneuerbaren Energien benötigt wird (Energiepark Mainz, 2018) begründet. In Betrieb genommen wurde die Anlage im Jahr 2015, zwei Jahre später wurde in den Regelbetrieb übergegangen. Ziel des Projekts ist einerseits die erneuerbaren Energien durch Speicherung regelbar zu machen und so ins lokale Netz integrieren zu können und andererseits auch die weitere Erforschung neuer Technologien der Elektrolyse (Deutsche Energie-Agentur, 2018). Der Energiepark Mainz sieht sich daher in einer Vorreiterrolle für ganz Deutschland: Die Anlage kann bis zu 6 Megawatt Strom aufnehmen und hat damit eine für Engpässe im Verteilnetz relevante Leistungsklasse. Ähnliche Anlagen könnten daher in Zukunft an vielen Standorten sinnvoll eingesetzt werden. (Energiepark Mainz, 2018) Der Elektrolyseur der Wasserstofftankstelle H2BER wird mit dem erzeugten Strom eines angrenzenden Windparks sowie einiger Solarmodule betrieben (Deutsche Energie-Agentur, 2018). Die Zielsetzung des Projekts ist dabei, die Kosten der Wasserstoffgewinnung durch Optimierung einzelner Anlagenbestandteile soweit wie möglich zu reduzieren. Das gewählte Verfahren ist in diesem Projekt die alkalische Druckelektrolyse (45 bar). Die Leistung beträgt 500 Kilowatt. Der Wasserstoff wird vorrangig durch die Wasserstofftankstelle als Kraftstoff genutzt, kann jedoch auch im benachbarten BHKW zur Gewinnung von Strom und Wärme weiter verwertet werden (Reiner Lemoine Institut, 2018). Das Projekt nutzt dabei sowohl Druckspeicher als auch Feststoffspeicher. Letztere werden derzeit intensiv erforscht, da sie eine große Sicherheit bieten und große Mengen Wasserstoff mit hoher Dichte bei niedrigem Druck ( ) speichern [können]. (Scheiner, 2014)
16 Verbrauch in [kw] 4. Datenaufbereitung und auswertung 4.1 Stromverbrauch in der EMN Die Ermittlung des Stromverbrauchs erfolgte über die online verfügbaren Daten der Main- Donau-Netzgesellschaft für das Jahr 2017 (Main-Donau Netzgesellschaft, 2018). Dabei musste sowohl die über die vorgelagerte Ebene, der Bayernwerk AG, bezogene Höchstentnahmelast als auch die dezentrale Netzeinspeisung mit einbezogen werden. Im dezentralen Netz wurden die einzelnen Einspeisungen aufsummiert. Hinzuaddiert wurden anschließend die aus dem überregionalen Verteilnetz (110 kv) bezogenen Höchstentnahmelasten. Zu beachten ist, dass das Netzgebiet der Main-Donau-Netzgesellschaft nicht mit dem Gebiet der EMN übereinstimmt. Das Netzgebiet umfasst knapp 1,3 Millionen Einwohner (Main- Donau Netzgesellschaft, 2018) wohingegen die EMN über 3,5 Millionen Einwohner zählt (Metropolregion Nürnberg, 2018). Daher wurde die Annahme getroffen, dass der Stromverbrauch entsprechend der Einwohnerzahl hochskaliert werden kann. So ließ sich der stündliche Stromverbrauch in der EMN für das Jahr 2017 bestimmen. Dargestellt ist dieser in der Abbildung 4, der Verlauf wurde mit einem Polynom sechsten Grades angenähert Stromverbrauch EMN für das Jahr Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Apr. 17 Jun. 17 Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17 Dez. 17 Feb. 18 Abbildung 4: Verlauf Stromverbrauch der EMN im Jahr
17 Der Stromverbrauch zeigt den erwarteten Verlauf. So ist im Sommer ein geringerer Verbrauch als im Winter zu verzeichnen. Das jeweils zum Jahreswechsel auftretende Verbrauchstief kann durch die Weihnachtsfeiertage und damit einhergehende Betriebsschließungen begründet werden. Da im Folgenden ein Vergleich zwischen dem Stromverbrauch und der potentiell in der EMN vorhandenen Windenergie hergestellt werden soll, ist es notwendig nur den Anteil des Stromverbrauchs zu betrachten, der als Zielwert für das Jahr 2030 vorgesehen ist. Das durch die EMN definierte Ziel ist es 60 Prozent des erzeugten Stroms aus regenerativen Energieträgern zu gewinnen. Da der Anteil an Energie durch Wasserkraft beziehungsweise Biomasse als nicht mehr ausbaufähig angenommen wird, kann dieser weiterhin mit circa 14 Prozent mit einberechnet werden, folglich 7,9 Prozent bezogen auf das 60-Prozent-Ziel. Der restliche Stromanteil soll durch Wind und Sonne erzeugt werden, wobei der Mix 70 Prozent Windenergie und 30 Prozent Photovoltaik betragen soll. So ergibt sich letztendlich ein prozentualer Anteil an Windenergie von 38,7 Prozent. Aufbauend auf diesem Ergebnis kann so im folgenden Abschnitt der durch Windenergie erzeugte Stromverbrauch dargestellt werden und in einen direkten Vergleich mit der potentiell vorhandenen Windenergie gebracht werden
18 4.2 Windenergie - Verläufe Die Daten zur Windenergie wurden mithilfe der MERRA-2 Datenbank der NASA ermittelt. Insgesamt wurden so 20 Rastergebiete definiert, die ungefähr der EMN entsprechen. Für diese Rastergebiete lag jeweils die spezifische Windenergie vor. Dabei wurde die spezifische Windenergie in einer Höhe von 80 Metern für die folgenden Berechnungen zugrunde gelegt, da die in der durchschnittlichen Nabenhöhe von 130 Metern vorliegende spezifische Windenergie zu hoch ist und nicht der Realität entspricht. Dies liegt vor allem daran, dass Bodeneinflüsse nicht weiter beachtet werden. Im nächsten Schritt ließ sich die von einer Anlage erzeugte Leistung ermitteln, indem ein durchschnittlicher Rotordurchmesser von 150 Meter vorausgesetzt wurde. Die potentiell vorliegende Windenergie wurde gesamt definiert als die im Jahr 2017 durchschnittlich verbrauchte Windenergie, die durch bereits bestehende WEA erzeugt wurde, zusätzlich der Windenergie die mithilfe des Ausbauplans gewonnen werden könnte. Dieser sieht vor, dass potentiell weitere 642 Windenergieanlagen in der EMN errichtet werden können 1. Somit konnte die gesamte in der EMN verfügbare Windenergie berechnet werden. Beispielrechnung zur Bestimmung der Windenergie: P WEA,80m = 49,5 W m 2 Unter Berücksichtigung einer Durchschnittsrotorfläche von A=17.671,46 m² und potentiell 642 weiterer WEA: P WEA,1890 Anlagen = 49,5 W m ,46 m2 642 = 561,6 MW Da in der EMN im Jahr 2017 gesamt 2371 GWh Strom aus Windenergie erzeugt wurden, betrug die durchschnittliche vorliegende Leistung: P Wind,EMN,2017 = 2371 GWh 8760 h = 270,66 MW Die potentiell zusätzlich verfügbare Windenergie wurde anschließend zur durchschnittlich vorliegenden Leistung addiert. Somit kann das Windenergiepotential, das in der EMN im Jahr 2017 vorlag, näherungsweise dargestellt werden (siehe Abb. 5). 1 Anzahl an potentiell möglichen WEA sind der Projektstudie von Lisa Herrmann entnommen
19 in [kw] Potentiell vorhandene Windenergie in der EMN Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Apr. 17 Jun. 17 Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17 Dez. 17 Feb. 18 potentiell verfügbare Windenergie, angenäherter Verlauf Abbildung 5: Verlauf potentiell verfügbare Windenergie in der EMN (Vergleichsjahr 2017, 642 zusätzliche WEA) Der angenäherte Verlauf, der durch Mittelwertbildung erzeugt wurde, zeigt, dass die im Sommer verfügbare Windenergie etwas geringer ist und die größten potentiellen Erzeugungsspitzen in den Wintermonaten vorkommen Potentiell verfügbare Windenergie vs. Stromverbrauch (Szenario 2030) Die potentiell verfügbare Windenergie wurde nun in einen direkten Vergleich mit dem im Jahr 2017 in der EMN gegebenen Stromverbrauch gestellt (siehe Abb. 6). Dabei wurde nur der Anteil am Stromverbrauch betrachtet, der als Windenergieanteil für das Jahr 2030 prognostiziert wird
20 in [kw] Vergleich Stromverbrauch - potentiell vorhandene Windenergie, EMN Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Apr. 17 Jun. 17 Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17 Dez. 17 Feb. 18 potentiell verfügbare Windenergie, angenäherter Verlauf Stromverbrauch (Windanteil 38,7%), angenäherter Verlauf Abbildung 6: Stromverbrauch (Windanteil 38,7%) vs. potentiell verfügbare Windenergie (zusätzliche 642 WEA) Wie in aus dem Diagramm ersichtlich wird, bilden sich in dem für 2030 gebildeten Szenario deutliche Überschüsse, aber auch Defizite aus. Beachtet werden muss an dieser Stelle, dass der Stromverbrauch des Jahres 2017 als Referenz genommen wurde. Es muss mit einkalkuliert werden, dass dieser bis zum Jahr 2030 noch ansteigt. Daher ist davon auszugehen, dass sich Überschüsse und Defizite weitestgehend gleichmäßig verteilen. Soll der durch Windenergie erzeugte Strom den zu deckenden Strombedarf von 38,7 Prozent im Jahr 2030 entsprechen, wird dies nur mithilfe von Speichermöglichkeiten umsetzbar sein. Andererseits müsste zu jedem Zeitpunkt eine über dem Strombedarf liegende Windenergie verfügbar sein, das bedeutet eine weit höhere Anzahl benötigter WEA und es wäre von zahlreichen Abregelungen aufgrund von Netzengpässen auszugehen. Dass der fluktuierende Verlauf ebenfalls durch einen optimalen Sonne-Wind-Energiemix ausgeglichen werden kann, wird bei dieser Betrachtung außer Acht gelassen Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (Szenario 2030) Gesamt stehen in der EMN aktuell 627 Windenergieanlagen. Diese sind weitestgehend gleichmäßig verteilt, weswegen die Betrachtung eines speziellen Rastergebietes der MERRA 2 Daten keinen Sinn macht. Daher wurde der aktuelle Windenergieverlauf über die gesamte EMN betrachtet und mit dem Stromverbrauch in der EMN verglichen (siehe Abb. 7). Der Stromverbrauch reflektiert wieder nur den Windenergieanteil und bezieht sich prozentual auf
21 in [kw] das Szenario Für die Berechnung wurde erneut mit den Windenergiedaten des Jahres 2017 gerechnet. Allerdings wurde nun eine Leistung für die 627 WEA errechnet, unter der Annahme eines Rotordurchmessers von 113 m, da die bisher angenommenen 150 m zwar in Bezug auf zukünftige WEA realistisch sind, jedoch nicht für die derzeitige Situation verwendet werden können. Stromverbrauch (Anteil Wind, Prognose 2030) vs. Windenergie vorhandener Windenergieanlagen Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Apr. 17 Jun. 17 Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17 Dez. 17 Feb. 18 Vorhandene Windenergie Stromverbrauch EMN (Szenario 2030) Abbildung 7: Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (Szenario 2030) Wie im Diagramm erkennbar ist, liegt die durch bestehende WEA bereitgestellte Energie fast durchgehend unterhalb des durch Windenergie erzeugten Stromverbrauchs, der bezogen auf den optimalen Mix im Jahr 2030 benötigt wäre. Unter diesen Umständen ist eine Speicherung daher nicht notwendig, da es zu keinem Zeitpunkt zu Überschüssen kommt, die Netzengpässe nach sich ziehen könnten Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (aktueller Zustand) Da dieser Zustand jedoch nicht der gegenwärtigen Situation entspricht, wurde zusätzlich untersucht, inwiefern sich Überschüsse ausbilden, wenn der derzeitige durch Windenergie erzeugte Stromverbrauch betrachtet wird. Hierzu wurde zunächst der regenerative Stromanteil aus Windenergie ermittelt. Wie bereits berechnet, betrug der gesamte Stromverbrauch in der EMN ,4 GWh, davon waren 2371 GWh regenerativ durch Windenergie erzeugt. Das ergibt einen Anteil von 9,7 Prozent
22 in [kw] In Abbildung 8 sind die sich hieraus ergebenden Verläufe von Windenergie und Stromverbrauch zu sehen. Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch EMN (aktueller Zustand) Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Apr. 17 Jun. 17 Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17 Dez. 17 Feb. 18 Stromverbrauch EMN (aktueller Zustand) Vorhandene Windenergie Abbildung 8: Vorhandene Windenergie vs. Stromverbrauch (aktuell, Windanteil 9,7%) Aus der Abbildung wird erkenntlich, dass auch derzeit schon Überschüsse vorliegen. Allerdings existieren in der EMN zum aktuellen Zeitpunkt viele WEA mit nur ein oder zwei Windrädern, größere Windparks sind aufgrund der 10-H-Regelung noch eine Seltenheit. Bezüglich der vergleichsweise geringen Leistungseinspeisungen kommt es bisher aber kaum zu Netzengpässen und die Fluktuation kann durch konventionelle Energieträger gut ausgeglichen werden. Die Speicherungsfrage stellt daher auch in diesem Fall kein Thema dar, mit Ausnahme der wenigen großen Windparks, die gesondert betrachtet werden müssen
23 in [kw] 5. Analyse des Speicherbedarfs Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, lohnt sich eine Speicherung vor allem in Bezug auf das Klimaziel Werden 60 Prozent des Stromverbrauchs regenerativ bereitgestellt, ist es nicht mehr ausreichend den Strommix bezüglich Wind- und Sonnenenergie anzupassen, sondern es werden zusätzlich Speichermöglichkeiten benötigt, um einen Ausgleich von Überschuss- und Defizitzeiten zu gewährleisten. 5.1 Speicherbedarf EMN Im Folgenden wird das in Abschnitt beschriebene Szenario für 2030 näher untersucht. Die sich hierfür ausbildenden Überschüsse und Defizite sind in Abbildung 9 dargestellt Verlauf von Überschüssen und Defiziten aus Windenergie (Szenario 2030) 0 Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Apr. 17 Jun. 17 Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17 Dez. 17 Feb Überschüsse Defizite Abbildung 9: Verlauf der Windenergieüberschüsse und -defizite (Szenario 2030) Wie aus dem Diagramm ersichtlich wird, sind die vorliegenden Überschüsse stärker ausgeprägt als die Defizite. Die rechnerische Ermittlung ergibt für den Jahresüberschuss eine Energiemenge von 4044 GWh gegenüber der Energiemenge des Jahresdefizits von 2180 GWh
24 Im Jahr 2017 wurden in der EMN GWh Strom verbraucht. Der darauf bezogene voraussichtlich im Jahr 2030 aus Windenergie erzeugte Strom läge somit bei 9453 GWh. Dieser Wert kann nun mit dem Ausmaß der Defizite verglichen werden. Die Energiemenge der Defizite spielt dabei die wesentliche Rolle, da diese ausgeglichen werden müssen, um am Ende das Ziel der 60 prozentigen Energieversorgung durch regenerative Anlagen zu erreichen. Aus der Gegenüberstellung der beiden Energiemengen wird ersichtlich, dass die Defizite in etwa ein Viertel des Gesamtwindenergiebedarfs betragen. Wird dieser Gedanke weiterverfolgt, so würde dies bedeuten, dass für jedes vierte Windrad ein Elektrolyseur zur Verfügung steht, der bei Volllastleistung des Windrads den erzeugten Strom aufnimmt und umwandelt
25 5.2 Speicherbedarf Wald-Windpark Reichertshüll Der Wald-Windpark Reichertshüll im Raitenbucher Forst ist in der EMN aktuell der Windpark mit der größten Gesamtleistung. Er verfügt über elf WEA vom Typ Nordex N131 mit einer Anlagenleistung von je 3,3 MW (Ostwind, 2018). Da der Windpark erst im Jahr 2017 in Betrieb genommen wurde, war es in Bezug auf die vorliegende Projektarbeit nicht möglich, Daten zum Energiemengenumfang von Abregelungsmaßnahmen zu erhalten. Allerdings kann in der bereits erwähnten allgemeinen Überlegung bezüglich des Stromverbrauch-Defizit- Verhältnisses die Annahme getroffen werden, dass sich die Ausbildung von Überschüssen und Defiziten von der EMN auf einzelne Anlagen übertragen lässt. Dass würde bedeuten, dass bei einer gesamten Windparkleistung von 36,3 MW ein oder mehrere Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von ungefähr 9 MW benötigt werden würden. Für die bestehenden Pilotprojekte konnten keine Angaben zur Leistung des zugehörigen Energieparks in Erfahrung gebracht werden, weswegen an dieser Stelle kein Vergleich gezogen werden kann. Die gesamte Auslegung einer Elektrolyseanlage würde darüber hinaus den Umfang der vorliegenden Arbeit übersteigen und kann auch nicht verallgemeinernd angenommen werden. Es wäre allerdings denkbar, dies in Verbindung mit definierten Ausbauplänen für das Jahr 2030 in Bezug auf einen bestimmten Wind- oder Energiepark in zukünftigen Arbeiten weiterführend zu untersuchen
26 6. Fazit Die derzeitige Situation der Stromerzeugung in der EMN erfordert aufgrund der prozentualen Verteilung von regenerativen und konventionellen Energieträgern keine Speicherkapazität. Die konventionellen Kraftwerke können die Volatilität der erneuerbaren Energieträger ausreichend ausgleichen, um eine dauerhafte Versorgungssicherheit zu garantieren. Im Jahr 2030 wird dieser Ausgleich bei einem 60 prozentigen Anteil an erneuerbaren Energieträgern nicht mehr möglich sein. Der Einsatz von Speichern ist dann zur Sicherstellung der Versorgung unerlässlich. Da die Wirtschaftlichkeit von Elektrolyseanlagen dem aktuellen Stand der Technik zufolge mit steigender Leistungsklasse zunimmt, ist es insbesondere ratsam die Speicher in großen Windparks einzusetzen (Smolinka et al., 2010, S.32). Vorstellbar ist ebenfalls den zur Elektrolyse benötigten Strom nicht ausschließlich aus Windenergie, sondern ebenfalls aus Solarenergie zu beziehen. Dafür sind jedoch die zukünftigen Ausbaupläne der erneuerbaren Energieträger maßgeblich, anhand derer dann ein sinnvoller Einsatz von Speichern festgelegt werden kann. Abschließend können daher zwei Parameter benannt werden, die den entscheidenden Einfluss auf die Frage haben, inwiefern der Einsatz von Speichern sinnvoll ist: zum einen spielt der prozentuale Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch eine wichtige Rolle. Denn mit steigendem Anteil wächst auch die Häufigkeit der Abregelungen, infolge des Einspeisemanagements, wie es sich in anderen Bundesländern bereits zeigt. Desweiteren können die konventionellen Kraftwerke keinen Ausgleich mehr bewerkstelligen und somit die Versorgung sicherstellen. Zum anderen ist der Einsatz von Elektrolyseuren und Speichern hinsichtlich der Kosten nur in Verbindung mit großen Wind- oder Energieparks wirtschaftlich
27 7. Ausblick Die vorliegende Arbeit ist dazu gedacht den Prozess der Speicherung durch Wasserelektrolyse als Teilprozess einer zukünftigen regenerativen Stromerzeugung näher zu betrachten. Allerdings ist für eine Umsetzung des Konzeptes eine umfangreiche Sichtweise erforderlich, die nicht nur die Speicherung, sondern ebenfalls die Rückspeisung in das Stromnetz miteinbezieht. Die Möglichkeiten sind hier vielfältig, von Gasturbinen und Blockheizkraftwerken bis hin zu Brennstoffzellen. Dies ist nur einer der Gründe, weswegen die Arbeit wirtschaftliche Aspekte nicht weiter untersucht. Denn der hundertprozentige Umstieg auf eine regenerative Stromerzeugung bis zum Jahr 2050 ändert die Rahmenbedingungen grundlegend. Daher liefert die derzeitige Situation kein vergleichbares Bild, anhand dessen eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit übertragbar und sinnvoll wäre. Darüber hinaus bedarf es auch geeigneter politischer Randbedingungen, um ein Gelingen der Energiewende zu bewerkstelligen. Somit wird am Ende der flexible Einsatz von Erneuerbaren Energien möglich und stellt eine realistische Option für eine zukünftig hundertprozentige grüne Stromversorgung dar
28 Literaturverzeichnis Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2018): Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr Grafiken und Diagramme unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat). Bundesnetzagentur (Hg.) (2018a): Aktueller Bericht zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen (2. und 3. Quartal 2017). Quartalsbericht in Zahlen. Online verfügbar unter n/versorgungssicherheit/netz_systemsicherheit/netz_systemsicherheit_node.html, zuletzt geprüft am Bundesnetzagentur (Hg.) (2018b): Leitfaden Einspeisemanagement. Online verfügbar unter n/erneuerbareenergien/einspeisemanagement/einspeisemanagement-node.html, zuletzt geprüft am Bundesverband WindEnergie (Hg.): Überblick: Windenergie in Deutschland. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Deutsche Energie-Agentur (Hg.): Strategieplattform Power to Gas. Energiepark Mainz. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Deutsche Energie-Agentur (Hg.): Strategieplattform Power to Gas. Multi-Energie-Tankstelle H2BER. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Deutsche Energie-Agentur (Hg.): Strategieplattform Power to Gas. Pilotprojekte. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Deutsche WindGuard (2017): Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. BWE; VDMA. Online verfügbar unter / _factsheet_status_windenergieausbau_an_land_2017.pdf, zuletzt geprüft am Die Bundesregierung (Hg.): Energiewende im Überblick. Online verfügbar unter Buehne/buehnenartikel-links-energiewende-im-ueberblick.html, zuletzt geprüft am Die Bundesregierung (Hg.) (2018): Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende. Online verfügbar unter energieforschung.html, zuletzt geprüft am Energiepark Mainz (Hg.): Technologie. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Gailing, Ludger; Röhring, Andreas (2015): Was ist dezentral an der Energiewende? Infrastrukturen erneuerbarer Energien als Herausforderungen und Chancen für ländliche Räume. In: Raumforsch Raumordn 73 (1), S DOI: /s
29 Kurzweil, Peter; Dietlmeier, Otto K. (2015): Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, rechtliche Grundlagen. Wiesbaden: Springer Vieweg. Online verfügbar unter Main-Donau Netzgesellschaft (Hg.) (2018): Veröffentlichungen - Strom. Netzkennzahlen & Netzrelevante Daten. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Metropolregion Nürnberg (2017): Klimapakt der Europäischen Metropolregion Nürnberg, Metropolregion Nürnberg (Hg.) (2018): Daten & Fakten. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Ostwind (Hg.) (2018): Wald-Windpark Reichertshüll. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Reiner Lemoine Institut (2018): H2BER2 Entwicklung und Erprobung von Betriebsstrategien für die H2-Tankstelle am Flughafen BER. Online verfügbar unter entwicklung-und-erprobung-von-betriebsstrategien-fuer-die-h2-tankstelle-am-flughafen-ber/, zuletzt geprüft am Scheiner, Jens (2014): GKN und McPhy kooperieren bei Wasserstoffspeichern. Hg. v. Automobil Industrie. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am Smolinka, Tom; Günther, Martin; Garche, Jürgen (2010): NOW-Studie: Stand und Entwicklungspotenzial der Wasserelektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff aus regenerativen Energien. Kurzfassung des Abschlussberichts. Fraunhofer ISE. Sterner, Michael; Stadler, Ingo (Hg.) (2017): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. 2. korrigierte und ergänzte Auflage. Berlin: Springer Vieweg. Online verfügbar unter Umweltbundesamt (Hg.) (2014): Windenergie. Online verfügbar unter zuletzt geprüft am
Nutzung von Windenergieüberschüssen durch Einsatz von Wasserstoffspeichern
 Energiekonferenz TH Nürnberg & N-Ergie Nutzung von Windenergieüberschüssen durch Einsatz von Wasserstoffspeichern Analyse der potentiell zur Verfügung stehenden Überschüsse aus Windenergie und Beurteilung
Energiekonferenz TH Nürnberg & N-Ergie Nutzung von Windenergieüberschüssen durch Einsatz von Wasserstoffspeichern Analyse der potentiell zur Verfügung stehenden Überschüsse aus Windenergie und Beurteilung
Windkraftanlagen: Potentialanalyse und Technologievergleich
 TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik Windkraftanlagen: Potentialanalyse und Technologievergleich WindpowerToEnergy Analyse des Windpotentials in der
TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik Windkraftanlagen: Potentialanalyse und Technologievergleich WindpowerToEnergy Analyse des Windpotentials in der
Energiewende mit Power-to-Gas
 Energiewende mit Power-to-Gas Sektorenkopplung mit Wasserstoff 9. Netzwerktreffen der Energiekümmerer in SH Bad Malente 30. April 2016 Dr. Lars Jürgensen Agenda. Herausforderungen zukünftiger Energiesysteme
Energiewende mit Power-to-Gas Sektorenkopplung mit Wasserstoff 9. Netzwerktreffen der Energiekümmerer in SH Bad Malente 30. April 2016 Dr. Lars Jürgensen Agenda. Herausforderungen zukünftiger Energiesysteme
Erneuerbare Energien 2008 Chancen und Perspektiven Hybrid-Kraftwerk. BUND Brandenburg
 Erneuerbare Energien 2008 Chancen und Perspektiven Hybrid-Kraftwerk BUND Brandenburg 21.06.2008 E ENERTRAG 600 MW bzw. 400 Anlagen am Netz Stromproduktion 1,3 TWh pro Jahr Service für 1000 Anlagen 825
Erneuerbare Energien 2008 Chancen und Perspektiven Hybrid-Kraftwerk BUND Brandenburg 21.06.2008 E ENERTRAG 600 MW bzw. 400 Anlagen am Netz Stromproduktion 1,3 TWh pro Jahr Service für 1000 Anlagen 825
GEHT NICHT GIBT S NICHT: 100 % ERNEUERBARE ALS ZIEL. Martin Rühl Stadtwerke Wolfhagen GmbH 02. März 2016
 GEHT NICHT GIBT S NICHT: 100 % ERNEUERBARE ALS ZIEL Martin Rühl Stadtwerke Wolfhagen GmbH 02. März 2016 Stadtwerke Wolfhagen GmbH Versorgung von 13.500 Wolfhager Bürgern mit Strom, Wasser und Gas + 4.500
GEHT NICHT GIBT S NICHT: 100 % ERNEUERBARE ALS ZIEL Martin Rühl Stadtwerke Wolfhagen GmbH 02. März 2016 Stadtwerke Wolfhagen GmbH Versorgung von 13.500 Wolfhager Bürgern mit Strom, Wasser und Gas + 4.500
Studienvergleich. Titel. Zielsetzung und Fragestellung
 Studienvergleich Titel Kombikraftwerk 2. Abschlussbericht Zielsetzung und Fragestellung Das Forschungsprojekt Kombikraftwerk 2 untersucht, inwieweit die Versorgungszuverlässigkeit und Versorgungsqualität
Studienvergleich Titel Kombikraftwerk 2. Abschlussbericht Zielsetzung und Fragestellung Das Forschungsprojekt Kombikraftwerk 2 untersucht, inwieweit die Versorgungszuverlässigkeit und Versorgungsqualität
WindpowerToEnergie. Analyse des Windkraftpotentials in der Europäischen Metropolregion Nürnberg im Hinblick auf die Energiewende
 Energiekonferenz TH Nürnberg & N-Ergie WindpowerToEnergie Analyse des Windkraftpotentials in der Europäischen Metropolregion Nürnberg im Hinblick auf die Energiewende Referent: Kontakt: Lisa Herrmann herrmannli64343@th-nuernberg.de
Energiekonferenz TH Nürnberg & N-Ergie WindpowerToEnergie Analyse des Windkraftpotentials in der Europäischen Metropolregion Nürnberg im Hinblick auf die Energiewende Referent: Kontakt: Lisa Herrmann herrmannli64343@th-nuernberg.de
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/ Wahlperiode
 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/4079 18. Wahlperiode 2016-04-27 Kleine Anfrage des Abgeordneten Oliver Kumbartzky (FDP) und Antwort der Landesregierung Minister für Energiewende, Landwirtschaft,
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/4079 18. Wahlperiode 2016-04-27 Kleine Anfrage des Abgeordneten Oliver Kumbartzky (FDP) und Antwort der Landesregierung Minister für Energiewende, Landwirtschaft,
Ganzheitliche Bewertung des Umwelteinflusses der Windenergie
 Ganzheitliche Bewertung des Umwelteinflusses der Windenergie André Sternberg, André Bardow 7. Ökobilanz-Werkstatt, 20. - 22. September 2011 Kennzahlen Windenergie Stromerzeugung [TWh] 120 100 80 60 40
Ganzheitliche Bewertung des Umwelteinflusses der Windenergie André Sternberg, André Bardow 7. Ökobilanz-Werkstatt, 20. - 22. September 2011 Kennzahlen Windenergie Stromerzeugung [TWh] 120 100 80 60 40
Welche Rolle spielt die Speicherung erneuerbarer Energien im zukünftigen Energiesystem?
 Welche Rolle spielt die Speicherung erneuerbarer Energien im zukünftigen Energiesystem? Prof. Dr. Jürgen Schmid, Dr. Michael Specht, Dr. Michael Sterner, u.a. Inhalt Das Energiekonzept 2050 Fluktuationen
Welche Rolle spielt die Speicherung erneuerbarer Energien im zukünftigen Energiesystem? Prof. Dr. Jürgen Schmid, Dr. Michael Specht, Dr. Michael Sterner, u.a. Inhalt Das Energiekonzept 2050 Fluktuationen
Das folgende Kapitel soll dabei als kurze Standortbestimmung für Deutschland dienen.
 B. Erneuerbare Energien Erster Teil - Wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen. Vorbemerkung zu den Erneuerbaren Energien Die Energiewende für Deutschland gilt als beschlossen. Allerdings wird
B. Erneuerbare Energien Erster Teil - Wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen. Vorbemerkung zu den Erneuerbaren Energien Die Energiewende für Deutschland gilt als beschlossen. Allerdings wird
Die nachfolgenden Daten basieren auf den jährlichen Meldungen der Übertragungsnetzbetreiber sowie der monatlichen Meldungen der Bundesnetzagentur.
 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16.Wahlperiode Drucksache 16/2276 25. 04. 2013 K l e i n e A n f r a g e des Abgeordneten Josef Dötsch (CDU) und A n t w o r t des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16.Wahlperiode Drucksache 16/2276 25. 04. 2013 K l e i n e A n f r a g e des Abgeordneten Josef Dötsch (CDU) und A n t w o r t des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie
Sustainable Urban Infrastructure Intelligente Energieversorgung für Berlin Kooperationsprojekt von Siemens, Vattenfall, TU Berlin
 Sustainable Urban Infrastructure Intelligente Energieversorgung für Berlin 2037 Kooperationsprojekt von Siemens, Vattenfall, TU Berlin Studie zeigt, wie Berlin mit regenerativem Strom versorgt werden kann
Sustainable Urban Infrastructure Intelligente Energieversorgung für Berlin 2037 Kooperationsprojekt von Siemens, Vattenfall, TU Berlin Studie zeigt, wie Berlin mit regenerativem Strom versorgt werden kann
Speicher im Stromnetz - Stand, Perspektiven und zukünftige Anforderungen
 Speicher im Stromnetz - Stand, Perspektiven und zukünftige Anforderungen Stromnetz Hamburg GmbH Bramfelder Chaussee 130 22177 Hamburg 24.01.2019 Inhaltsverzeichnis 1 Stromnetz Hamburg 2 Sachstand Speicher
Speicher im Stromnetz - Stand, Perspektiven und zukünftige Anforderungen Stromnetz Hamburg GmbH Bramfelder Chaussee 130 22177 Hamburg 24.01.2019 Inhaltsverzeichnis 1 Stromnetz Hamburg 2 Sachstand Speicher
Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland: Juni 2015
 Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland: Juni 2015 Der Stromverbrauch in Baden-Württemberg (10,5 Millionen
Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland: Juni 2015 Der Stromverbrauch in Baden-Württemberg (10,5 Millionen
Das Energie-und Klimaquiz. Uwe Nestle Neustadt am Rübenberge, 7. Juni 2014
 Das Energie-und Klimaquiz Uwe Nestle Neustadt am Rübenberge, 7. Juni 2014 Was ist das Quiz? Häufig auftretende Fragen in der Energie- und Klimadiskussion Jeder Frage wird mit einem Mini-Hintergrund eingeführt
Das Energie-und Klimaquiz Uwe Nestle Neustadt am Rübenberge, 7. Juni 2014 Was ist das Quiz? Häufig auftretende Fragen in der Energie- und Klimadiskussion Jeder Frage wird mit einem Mini-Hintergrund eingeführt
Energiewende Nordhessen Hessenforum / 100 % EE-Kongress
 Energiewende Nordhessen Hessenforum / 100 % EE-Kongress 26.9.2012 Dr. Thorsten Ebert, SUN Katharina Henke, Fraunhofer IWES Folie 1 26.9.2012 Energiewende Nordhessen Szenarien für den Umbau der Stromversorgung
Energiewende Nordhessen Hessenforum / 100 % EE-Kongress 26.9.2012 Dr. Thorsten Ebert, SUN Katharina Henke, Fraunhofer IWES Folie 1 26.9.2012 Energiewende Nordhessen Szenarien für den Umbau der Stromversorgung
Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland
 Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland Der Stromverbrauch in Baden-Württemberg (10,5 Millionen Einwohner)
Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland Der Stromverbrauch in Baden-Württemberg (10,5 Millionen Einwohner)
Optimaler Mix aus regenerativen Energien der EMN 2030
 Optimaler Mix aus regenerativen Energien der EMN 2030 EMN-Mix2030 Analyse des besten Stromversorgungsmix aus Solar- und Windenergie in Bezug auf das Klimaziel der Europäischen Metropolregion Nürnberg 2030
Optimaler Mix aus regenerativen Energien der EMN 2030 EMN-Mix2030 Analyse des besten Stromversorgungsmix aus Solar- und Windenergie in Bezug auf das Klimaziel der Europäischen Metropolregion Nürnberg 2030
Faktenpapier Energiespeicher. Dr. Rainer Waldschmidt Geschäftsführer HA Hessen Agentur GmbH
 Faktenpapier Energiespeicher Dr. Rainer Waldschmidt Geschäftsführer HA Hessen Agentur GmbH Die Faktencheck-Reihe: Im Rahmen des HMWEVL-Projektauftrags Bürgerforum Energieland Hessen klärt die Hessen Agentur
Faktenpapier Energiespeicher Dr. Rainer Waldschmidt Geschäftsführer HA Hessen Agentur GmbH Die Faktencheck-Reihe: Im Rahmen des HMWEVL-Projektauftrags Bürgerforum Energieland Hessen klärt die Hessen Agentur
Vergleich: EinsMan und KKW-Einspeisung VERGLEICH DES EINSPEISEMANAGEMENTS UND STROMERZEUGUNG NORDDEUTSCHER KERNKRAFTWERKE
 VERGLEICH DES EINSPEISEMANAGEMENTS UND STROMERZEUGUNG NORDDEUTSCHER KERNKRAFTWERKE Für Greenpeace Energy eg Fabian Huneke, Philipp Heidinger Berlin, 8. Juni 218 Ausfallarbeit EinsMan in GWh Vergleich:
VERGLEICH DES EINSPEISEMANAGEMENTS UND STROMERZEUGUNG NORDDEUTSCHER KERNKRAFTWERKE Für Greenpeace Energy eg Fabian Huneke, Philipp Heidinger Berlin, 8. Juni 218 Ausfallarbeit EinsMan in GWh Vergleich:
Energieversorgung morgen. mit Erdgas/Biogas/erneuerbaren Gasen
 Energieversorgung morgen mit Erdgas/Biogas/erneuerbaren Gasen 1 Leistungsvergleich: Strom-Transportleitung bei 380 kv: 2000 MW Gas-Transportleitung bei 64 bar: 20 000 MW Markierungstafel einer unterirdisch
Energieversorgung morgen mit Erdgas/Biogas/erneuerbaren Gasen 1 Leistungsvergleich: Strom-Transportleitung bei 380 kv: 2000 MW Gas-Transportleitung bei 64 bar: 20 000 MW Markierungstafel einer unterirdisch
Grüner Wasserstoff als Bindeglied zwischen Energiewende und nachhaltiger Mobilität»
 Grüner Wasserstoff als Bindeglied zwischen Energiewende und nachhaltiger Mobilität» Life Needs Power Produkt-/Angebotsmanagement und Digitalisierung Dr. Alexander Conreder, Geschäftsentwicklung 28. April
Grüner Wasserstoff als Bindeglied zwischen Energiewende und nachhaltiger Mobilität» Life Needs Power Produkt-/Angebotsmanagement und Digitalisierung Dr. Alexander Conreder, Geschäftsentwicklung 28. April
Beitrag der Stülpmembranspeichertechnologie für den Strombedarf bei einer 100% regenerativen Versorgung der Metropolregion Nürnberg
 Energiekonferenz TH Nürnberg & N-Ergie Beitrag der Stülpmembranspeichertechnologie für den Strombedarf bei einer 100% regenerativen Versorgung der Metropolregion Nürnberg Referent: Kevin Gerstberger Kontakt:
Energiekonferenz TH Nürnberg & N-Ergie Beitrag der Stülpmembranspeichertechnologie für den Strombedarf bei einer 100% regenerativen Versorgung der Metropolregion Nürnberg Referent: Kevin Gerstberger Kontakt:
Dezentrale Energiewende
 Dezentrale Energiewende Diskussion der VDE-Studie Der zellulare Ansatz Dr. Werner Neumann Sprecher des Bundesarbeitskreis Energie Wissenschaftlicher Beirat des BUND Warum dezentral und was ist dezentral?
Dezentrale Energiewende Diskussion der VDE-Studie Der zellulare Ansatz Dr. Werner Neumann Sprecher des Bundesarbeitskreis Energie Wissenschaftlicher Beirat des BUND Warum dezentral und was ist dezentral?
Speichertechniken für die zukünftige Energieversorgung Energiespeicher-Symposium Stuttgart 06./07. März Ulrich Wagner
 Speichertechniken für die zukünftige Energieversorgung Energiespeicher-Symposium Stuttgart 06./07. März 2012 Ulrich Wagner Energiespeicher strategische Elemente des zukünftigen Energiesystems - Energiekonzept
Speichertechniken für die zukünftige Energieversorgung Energiespeicher-Symposium Stuttgart 06./07. März 2012 Ulrich Wagner Energiespeicher strategische Elemente des zukünftigen Energiesystems - Energiekonzept
TH-E Box der Weg zur solargestützten Energieautonomie
 TH-E Box der Weg zur solargestützten Energieautonomie 9. Innovationstagung der Randenkommission Franz Reichenbach ISC Konstanz e.v. 28. November 18 Ertragsschwankungen einer PV-Anlage 12 24 36 48 72 84
TH-E Box der Weg zur solargestützten Energieautonomie 9. Innovationstagung der Randenkommission Franz Reichenbach ISC Konstanz e.v. 28. November 18 Ertragsschwankungen einer PV-Anlage 12 24 36 48 72 84
SEKTORKOPPLUNG UND SYSTEMINTEGRATION - SCHLÜSSELELEMENTE AUF DEM WEG IN DAS ZUKÜNFTIGE ENERGIESYSTEM
 SEKTORKOPPLUNG UND SYSTEMINTEGRATION - SCHLÜSSELELEMENTE AUF DEM WEG IN DAS ZUKÜNFTIGE ENERGIESYSTEM Prof. Dr. Hans-Martin Henning Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Summit»Energie«2017
SEKTORKOPPLUNG UND SYSTEMINTEGRATION - SCHLÜSSELELEMENTE AUF DEM WEG IN DAS ZUKÜNFTIGE ENERGIESYSTEM Prof. Dr. Hans-Martin Henning Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Summit»Energie«2017
Sektorkopplung Der Schlüssel zur Energiewende
 Sektorkopplung Der Schlüssel zur Energiewende Agenda 1) Kurzvorstellung EWE NETZ 2) Der Sachzwang zur Sektorkopplung 4) Ein erstes konkretes Umsetzungsbeispiel im EWE-Netz 5) Rechtliche Bewertung und Fazit
Sektorkopplung Der Schlüssel zur Energiewende Agenda 1) Kurzvorstellung EWE NETZ 2) Der Sachzwang zur Sektorkopplung 4) Ein erstes konkretes Umsetzungsbeispiel im EWE-Netz 5) Rechtliche Bewertung und Fazit
Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven der großtechnischen Wasserstoffspeicherung aus erneuerbaren Energien in Salzkavernen
 Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven der großtechnischen Wasserstoffspeicherung aus erneuerbaren Energien in Salzkavernen Jan Michalski, Dr.-Ing. Ulrich Bünger Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, Ottobrunn,
Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven der großtechnischen Wasserstoffspeicherung aus erneuerbaren Energien in Salzkavernen Jan Michalski, Dr.-Ing. Ulrich Bünger Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, Ottobrunn,
Stromspeicher in der Energiewende
 Stromspeicher in der Energiewende Ergebnisse der Studie TIM DREES (IAEW) DANIEL FÜRSTENWERTH (AGORA ENERGIEWENDE) BERLIN, 11.12.2014 Überblick: Inhalte und Konsortium Analysen Konsortium I Speicher im
Stromspeicher in der Energiewende Ergebnisse der Studie TIM DREES (IAEW) DANIEL FÜRSTENWERTH (AGORA ENERGIEWENDE) BERLIN, 11.12.2014 Überblick: Inhalte und Konsortium Analysen Konsortium I Speicher im
Laufende Evaluierung der Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Stand 11/2014
 11. Quartalsbericht Laufende Evaluierung der Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien Stand 11/2014 Monitoring 1. November 2014 Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
11. Quartalsbericht Laufende Evaluierung der Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien Stand 11/2014 Monitoring 1. November 2014 Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Die chemische Industrie im Konflikt: Zwischen Effizienz und fluktuierender Stromversorgung Dr. Jochen Wilkens, 1. November 2016
 Die chemische Industrie im Konflikt: Zwischen Effizienz und fluktuierender Stromversorgung Dr. Jochen Wilkens, 1. November 2016 Energieeffizienz eine ständige Herausforderung Übersicht Energieverbrauch
Die chemische Industrie im Konflikt: Zwischen Effizienz und fluktuierender Stromversorgung Dr. Jochen Wilkens, 1. November 2016 Energieeffizienz eine ständige Herausforderung Übersicht Energieverbrauch
Audi und Power-to-Gas: Langstrecken-Mobilität mit der Energiewende im Erdgastank
 Audi und Power-to-Gas: Langstrecken-Mobilität mit der Energiewende im Erdgastank Klimaverträgliche Mobilität, Neumünster 08. Mai 2014 Tobias Block, Audi AG Auf dem Weg der CO 2 -Reduzierung müssen neue
Audi und Power-to-Gas: Langstrecken-Mobilität mit der Energiewende im Erdgastank Klimaverträgliche Mobilität, Neumünster 08. Mai 2014 Tobias Block, Audi AG Auf dem Weg der CO 2 -Reduzierung müssen neue
Fachverband Elektro- und Informationstechnik Sachsen / Thüringen. Energiewende Chancen und Herausforderungen an das Elektrohandwerk
 Energiewende Chancen und Herausforderungen an das Elektrohandwerk 10. Mai 2012 Berufsständige Organisation Fachverband Elektro- und Umsatz 2011 3,15 Mrd. EUR + 7 % davon 47 % Industrie und Gewerbe 26 %
Energiewende Chancen und Herausforderungen an das Elektrohandwerk 10. Mai 2012 Berufsständige Organisation Fachverband Elektro- und Umsatz 2011 3,15 Mrd. EUR + 7 % davon 47 % Industrie und Gewerbe 26 %
Strommix in Deutschland: Die Erneuerbaren auf Rekordkurs
 Strommix in Deutschland: Die Erneuerbaren auf Rekordkurs Im Sektor Strom ist die Energiewende auf einem guten Weg. Während des ersten Halbjahrs 2017 stieg der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen
Strommix in Deutschland: Die Erneuerbaren auf Rekordkurs Im Sektor Strom ist die Energiewende auf einem guten Weg. Während des ersten Halbjahrs 2017 stieg der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen
Stromspeicher in der Energiewende
 Stromspeicher in der Energiewende Ergebnisse der Studie MATTHIAS DEUTSCH FRANKFURT, 14.06.2016 Das Stromsystem muss sich immer mehr an eine stark schwankende Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen
Stromspeicher in der Energiewende Ergebnisse der Studie MATTHIAS DEUTSCH FRANKFURT, 14.06.2016 Das Stromsystem muss sich immer mehr an eine stark schwankende Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen
Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen und Bedeutung dieser Ziele für den Windenergieausbau
 Kurzstellungnahme Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen und Bedeutung dieser Ziele für den Windenergieausbau Februar 2011 Im Auftrag: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Kurzstellungnahme Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen und Bedeutung dieser Ziele für den Windenergieausbau Februar 2011 Im Auftrag: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Die Rolle der Windkraft in der Energiewende
 Die Rolle der Windkraft in der Energiewende Bedeutung für die Energieversorgung und den Klimaschutz Christof Timpe (c.timpe@oeko.de) Informationsabend des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach Winden, 1.03.2016
Die Rolle der Windkraft in der Energiewende Bedeutung für die Energieversorgung und den Klimaschutz Christof Timpe (c.timpe@oeko.de) Informationsabend des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach Winden, 1.03.2016
Studien auf regionale/lokaler Ebene und Zwischenbilanz
 Studien auf regionale/lokaler Ebene und Zwischenbilanz Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der zukünftigen Energieversorgung Freiburg, 21.03.2013 Dipl. Ing. Christian Neumann Energieagentur Regio Freiburg
Studien auf regionale/lokaler Ebene und Zwischenbilanz Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der zukünftigen Energieversorgung Freiburg, 21.03.2013 Dipl. Ing. Christian Neumann Energieagentur Regio Freiburg
Status, Strategien und Perspektiven des Smart Village Rainau im Rahmen der Energiewende
 Status, Strategien und Perspektiven des Smart Village Rainau im Rahmen der Energiewende Informationsabend am Montag, 25. September 2017 Prof. Dr.-Ing. Martina Hofmann Inhalte des Vortrags Aktueller Stand
Status, Strategien und Perspektiven des Smart Village Rainau im Rahmen der Energiewende Informationsabend am Montag, 25. September 2017 Prof. Dr.-Ing. Martina Hofmann Inhalte des Vortrags Aktueller Stand
Energiewende Nordhessen
 Energiewende Nordhessen Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes Stand 12. November 2013 Dr. Thorsten Ebert, Vorstand Städtische Werke AG Energiewende Nordhessen:
Energiewende Nordhessen Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes Stand 12. November 2013 Dr. Thorsten Ebert, Vorstand Städtische Werke AG Energiewende Nordhessen:
Steffen Philipp Die Verwendung von Speichersystemen für die Integration der Windenergie in die elektrische Energieversorgung
 Steffen Philipp Die Verwendung von Speichersystemen für die Integration der Windenergie in die elektrische Energieversorgung EUROSOLAR, WCRE, Science Park, Gelsenkirchen 30. Oktober 2006 Die Gesellschafter
Steffen Philipp Die Verwendung von Speichersystemen für die Integration der Windenergie in die elektrische Energieversorgung EUROSOLAR, WCRE, Science Park, Gelsenkirchen 30. Oktober 2006 Die Gesellschafter
Power-to-Gas: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Sensitivitätsanalyse. Dr.-Ing. Peter Missal Geschäftsführer, e-rp GmbH Alzey
 Power-to-Gas: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Sensitivitätsanalyse Dr.-Ing. Peter Missal Geschäftsführer, e-rp GmbH Alzey 6. Lautrer Energieforum, SWK AG Kaiserslautern, 12.03.2014 1 Überblick 1. Energiepolitische
Power-to-Gas: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Sensitivitätsanalyse Dr.-Ing. Peter Missal Geschäftsführer, e-rp GmbH Alzey 6. Lautrer Energieforum, SWK AG Kaiserslautern, 12.03.2014 1 Überblick 1. Energiepolitische
Die zunehmenden Einspeisung aus Erneuerbaren Energien
 Die zunehmenden Einspeisung aus Erneuerbaren Energien Einfluss auf die (Strom-)Netze in Mitteldeutschland Mitgliederversammlung der Energiegemeinschaft Mitteldeutschland e.v. 27.04.2010 Dipl.-Ing. Ulf
Die zunehmenden Einspeisung aus Erneuerbaren Energien Einfluss auf die (Strom-)Netze in Mitteldeutschland Mitgliederversammlung der Energiegemeinschaft Mitteldeutschland e.v. 27.04.2010 Dipl.-Ing. Ulf
Entwicklungen in der deutschen Stromund Gaswirtschaft 2013
 Entwicklungen in der deutschen Stromund Gaswirtschaft 2013 BDEW Pressekonferenz 14. Januar 2013 www.bdew.de Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern 2013 Brutto-Stromerzeugung 2013 in Deutschland: 629
Entwicklungen in der deutschen Stromund Gaswirtschaft 2013 BDEW Pressekonferenz 14. Januar 2013 www.bdew.de Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern 2013 Brutto-Stromerzeugung 2013 in Deutschland: 629
Dezentrale Energieversorgung, aber wie? Herten, Thorsten Rattmann, GF Hertener Stadtwerke
 Dezentrale Energieversorgung, aber wie? Herten, 29.10.2015 Thorsten Rattmann, GF Hertener Stadtwerke Digitalisierung / Dezentralisierung Der nächste große Umbruch in der Energiewirtschaft Wettbewerb 1994
Dezentrale Energieversorgung, aber wie? Herten, 29.10.2015 Thorsten Rattmann, GF Hertener Stadtwerke Digitalisierung / Dezentralisierung Der nächste große Umbruch in der Energiewirtschaft Wettbewerb 1994
Die Rolle der Wasserkraft im zukünftigen bayerischen Energiemix
 Die Rolle der Wasserkraft im zukünftigen bayerischen Energiemix Iller-Laufwasserkraftwerk der Allgäuer Überlandwerke GmbH, Kempten Bildrecht: AÜW 2010 Rudolf Escheu 3. Bayerisches Wasserkraftforum Landshut,
Die Rolle der Wasserkraft im zukünftigen bayerischen Energiemix Iller-Laufwasserkraftwerk der Allgäuer Überlandwerke GmbH, Kempten Bildrecht: AÜW 2010 Rudolf Escheu 3. Bayerisches Wasserkraftforum Landshut,
Pumpspeicherwerke als wichtiger Baustein für die Energiewende. Prof. Dr. Dieter Sell 26. August 2015
 Pumpspeicherwerke als wichtiger Baustein für die Energiewende Prof. Dr. Dieter Sell 26. August 2015 Stromimport- und Transitland Thüringen Zur Deckung des Thüringer Strombedarfs muss die Hälfte der benötigten
Pumpspeicherwerke als wichtiger Baustein für die Energiewende Prof. Dr. Dieter Sell 26. August 2015 Stromimport- und Transitland Thüringen Zur Deckung des Thüringer Strombedarfs muss die Hälfte der benötigten
Kraft-Wärme-Kopplung-Energieversorgungssysteme auf Basis von Windenergie und Wasserstoff
 Kraft-Wärme-Kopplung-Energieversorgungssysteme auf Basis von Windenergie und Wasserstoff Dr.-Ing. Gerhard Buttkewitz Wasserstofftechnologie-Initiative Mecklenburg-Vorpommern e. V. Schonenfahrerstraße 5
Kraft-Wärme-Kopplung-Energieversorgungssysteme auf Basis von Windenergie und Wasserstoff Dr.-Ing. Gerhard Buttkewitz Wasserstofftechnologie-Initiative Mecklenburg-Vorpommern e. V. Schonenfahrerstraße 5
HALBJAHRESPROGNOSE ZUR ENERGIEBILANZ HESSEN 2018
 HALBJAHRESPROGNOSE ZUR ENERGIEBILANZ HESSEN 2018 SCHÄTZUNG DER IM 1. HALBJAHR 2018 VON EEG GEFÖRDERTEN ANLAGEN IN HESSEN ERZEUGTEN STROMMENGEN UND SCHÄTZUNG AKTUELLER DATEN ZU ENERGIEERZEUGUNG UND ENERGIEVERBRAUCH
HALBJAHRESPROGNOSE ZUR ENERGIEBILANZ HESSEN 2018 SCHÄTZUNG DER IM 1. HALBJAHR 2018 VON EEG GEFÖRDERTEN ANLAGEN IN HESSEN ERZEUGTEN STROMMENGEN UND SCHÄTZUNG AKTUELLER DATEN ZU ENERGIEERZEUGUNG UND ENERGIEVERBRAUCH
Erneuerbare Energien 2017
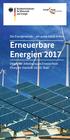 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Energiebericht 2014 Strom für die Stadt Delbrück
 Energiebericht 2014 Strom für die Stadt Delbrück 06.05.2015 Workshop Erneuerbare Energie Klimaschutzkonzept Stadt Delbrück Mike Süggeler Westfalen Weser Netz AG / 03.04.2014 UNTERNEHMENSSTRUKTUR - Stromnetz
Energiebericht 2014 Strom für die Stadt Delbrück 06.05.2015 Workshop Erneuerbare Energie Klimaschutzkonzept Stadt Delbrück Mike Süggeler Westfalen Weser Netz AG / 03.04.2014 UNTERNEHMENSSTRUKTUR - Stromnetz
Wirtschaftsrat 7. Juniorentag am 30. Oktober 2010 Podium I Energiemix 2020 Zwischen Populismus und Vernunft Thomas Bareiß MdB, Energiekoordinator der
 Wirtschaftsrat 7. Juniorentag am 30. Oktober 2010 Podium I Energiemix 2020 Zwischen Populismus und Vernunft Thomas Bareiß MdB, Energiekoordinator der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kurzstatement Mit dem Energiekonzept
Wirtschaftsrat 7. Juniorentag am 30. Oktober 2010 Podium I Energiemix 2020 Zwischen Populismus und Vernunft Thomas Bareiß MdB, Energiekoordinator der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kurzstatement Mit dem Energiekonzept
Power-to-gas aus Energiesystemperspektive
 Informationsveranstaltung Power-to-gas Power-to-gas aus Energiesystemperspektive 26. Oktober 2015 Dr. Peter Stenzel, SolaRE e.v. Inhalt Energiewende und Bedarf an Langzeitspeichern Power-to-gas als sektorübergreifende
Informationsveranstaltung Power-to-gas Power-to-gas aus Energiesystemperspektive 26. Oktober 2015 Dr. Peter Stenzel, SolaRE e.v. Inhalt Energiewende und Bedarf an Langzeitspeichern Power-to-gas als sektorübergreifende
Die Zukunft der Energieversorgung
 Die Zukunft der Energieversorgung Smart Home Day Die Zukunft der Energieversorgung Historischer Rückblick Energieversorgung in Darmstadt Erster Lehrstuhl für Elektrotechnik der Welt an der TH Darmstadt
Die Zukunft der Energieversorgung Smart Home Day Die Zukunft der Energieversorgung Historischer Rückblick Energieversorgung in Darmstadt Erster Lehrstuhl für Elektrotechnik der Welt an der TH Darmstadt
Netzstudie M-V Ziele, Methoden; Beispiel Windenergie. 8. GeoForum MV , Rostock-Warnemünde
 Netzstudie M-V 2012 Ziele, Methoden; Beispiel Windenergie 8. GeoForum MV 2012 17.04.2012, Rostock-Warnemünde Dipl.-Wirt.-Ing. Philipp Kertscher Dipl.-Ing. Axel Holst Netzstudie M-V 2012 1. Struktur der
Netzstudie M-V 2012 Ziele, Methoden; Beispiel Windenergie 8. GeoForum MV 2012 17.04.2012, Rostock-Warnemünde Dipl.-Wirt.-Ing. Philipp Kertscher Dipl.-Ing. Axel Holst Netzstudie M-V 2012 1. Struktur der
100 Prozent erneuerbare Energieerzeugung in Costa Rica Eine Möglichkeit?
 1 100 Prozent erneuerbare Energieerzeugung in Costa Rica Eine Möglichkeit? Erneuerbare Energien Analyse B.Sc. Betreuer: M.Sc. Karthik Bhat Advisor: Prof. Udo Bachhiesl 16.02.2018 u www.tugraz.at 2 Überblick
1 100 Prozent erneuerbare Energieerzeugung in Costa Rica Eine Möglichkeit? Erneuerbare Energien Analyse B.Sc. Betreuer: M.Sc. Karthik Bhat Advisor: Prof. Udo Bachhiesl 16.02.2018 u www.tugraz.at 2 Überblick
ERNEUERBARE ENERGIESZENARIEN FÜR DIE GEMEINDE RAINAU
 ERNEUERBARE ENERGIESZENARIEN FÜR DIE GEMEINDE RAINAU Vortragende: Annette Steingrube Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE ENsource / KEFF Workshop Forschung Innovation - Praxis Aalen, 27.09.2017
ERNEUERBARE ENERGIESZENARIEN FÜR DIE GEMEINDE RAINAU Vortragende: Annette Steingrube Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE ENsource / KEFF Workshop Forschung Innovation - Praxis Aalen, 27.09.2017
Strom zu Gas-Technologie (power-to-gas) der Demonstrationsanlage ist für. Energiespeicher sind ein Schlüssel zum Gelingen der Energiewende
 Presse-Mitteilung Ihre Ansprechpartnerin: Cornelia Benesch Leiterin Mediale Kommunikation 26.09.2012 0821 9002-360 Fax: 0821 9002-365 erdgas schwaben baut mit Unternehmen der Thüga-Gruppe Demonstrationsanlage
Presse-Mitteilung Ihre Ansprechpartnerin: Cornelia Benesch Leiterin Mediale Kommunikation 26.09.2012 0821 9002-360 Fax: 0821 9002-365 erdgas schwaben baut mit Unternehmen der Thüga-Gruppe Demonstrationsanlage
Stefan Wagner, ENERTRAG
 Stefan Wagner, ENERTRAG ENERTRAG AG - I 600 MW am Netz 400 Anlagen 1,3 TWh pro Jahr Service für 1000 Anlagen 825 Mio. investiert 250 Millionen Euro Jahresumsatz 250 Mitarbeiter, 150 davon im Service 12
Stefan Wagner, ENERTRAG ENERTRAG AG - I 600 MW am Netz 400 Anlagen 1,3 TWh pro Jahr Service für 1000 Anlagen 825 Mio. investiert 250 Millionen Euro Jahresumsatz 250 Mitarbeiter, 150 davon im Service 12
Gewinn InfoDay 1
 21.11.2017 Gewinn InfoDay 1 Strom aus Erneuerbaren Energien: Mythen und Realität Dr. Harald Proidl Energie-Control Austria Wien, November 2017 By J.M. White & Co., photographer. [Public domain], via Wikimedia
21.11.2017 Gewinn InfoDay 1 Strom aus Erneuerbaren Energien: Mythen und Realität Dr. Harald Proidl Energie-Control Austria Wien, November 2017 By J.M. White & Co., photographer. [Public domain], via Wikimedia
Vorteile von Power-to-Gas für die Übertragungsnetze?
 Vorteile von Power-to-Gas für die Übertragungsnetze? Power-to-Gas Energieinfrastruktur als Energiespeicher Dr.-Ing. Frank Golletz Technischer Geschäftsführer 50Hertz Transmission GmbH Berlin, 22.11.2011
Vorteile von Power-to-Gas für die Übertragungsnetze? Power-to-Gas Energieinfrastruktur als Energiespeicher Dr.-Ing. Frank Golletz Technischer Geschäftsführer 50Hertz Transmission GmbH Berlin, 22.11.2011
Erdgasnetz als Energiespeicher
 Erdgasnetz als Energiespeicher 13. Brandenburger Energietag André Plättner Technologiemonitoring / F&E 15. September 2011 Engagement als europäischer Erdgasgroßhändler Die Vorgabe Politische Zielrichtung
Erdgasnetz als Energiespeicher 13. Brandenburger Energietag André Plättner Technologiemonitoring / F&E 15. September 2011 Engagement als europäischer Erdgasgroßhändler Die Vorgabe Politische Zielrichtung
Wasserstoffgewinnung aus Klärgas. Prof. Dr. Burkhard Teichgräber; Dr. Daniel Klein, Emschergenossenschaft, Essen
 Wasserstoffgewinnung aus Klärgas Prof. Dr. Burkhard Teichgräber; Dr. Daniel Klein, Emschergenossenschaft, Essen GLIEDERUNG Projektaktivitäten der Emschergenossenschaft im Bereich H 2 EuWaK: WaStraK: Erdgas
Wasserstoffgewinnung aus Klärgas Prof. Dr. Burkhard Teichgräber; Dr. Daniel Klein, Emschergenossenschaft, Essen GLIEDERUNG Projektaktivitäten der Emschergenossenschaft im Bereich H 2 EuWaK: WaStraK: Erdgas
Stromspeicher in der Energiewende
 Stromspeicher in der Energiewende Ergebnisse der Studie MATTHIAS DEUTSCH WIEN, 10.03.2016 Überblick: Inhalte und Konsortium Analysen Konsortium I Speicher im Strommarkt zum Ausgleich von Erzeugung und
Stromspeicher in der Energiewende Ergebnisse der Studie MATTHIAS DEUTSCH WIEN, 10.03.2016 Überblick: Inhalte und Konsortium Analysen Konsortium I Speicher im Strommarkt zum Ausgleich von Erzeugung und
Flexibilitätsbedarf in zukünftigen Energieversorgungssystemen
 FRAUNHOFER IWES ENERGIESYSTEMTECHNIK Tagung Speicher für die Energiewende, Hannover, 29.09.2017 Flexibilitätsbedarf in zukünftigen Energieversorgungssystemen Diana Böttger Seite 1 AGENDA Motivation Langfristige
FRAUNHOFER IWES ENERGIESYSTEMTECHNIK Tagung Speicher für die Energiewende, Hannover, 29.09.2017 Flexibilitätsbedarf in zukünftigen Energieversorgungssystemen Diana Böttger Seite 1 AGENDA Motivation Langfristige
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im ersten Quartal 2017
 Stand: 18. Mai 217 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im ersten Quartal 217 Quartalsbericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) * Erstellt durch das Zentrum für
Stand: 18. Mai 217 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im ersten Quartal 217 Quartalsbericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) * Erstellt durch das Zentrum für
Energie für Haushalte, Gewerbe und Industrie
 Energie für Haushalte, Gewerbe und Industrie Energiestrategie 2050 bringt Vorteile Erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Speicherung sind Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen Energieversorgung. Mit
Energie für Haushalte, Gewerbe und Industrie Energiestrategie 2050 bringt Vorteile Erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Speicherung sind Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen Energieversorgung. Mit
Die Rolle von Gasnetzen in der Energiewende
 Die Rolle von Gasnetzen in der Energiewende - und Ergänzung durch andere Netze Dr. Jochen Arthkamp, ASUE e.v. Berlin, 25. Mai 2012 Herausforderungen an Transport und Speicherung Transport In der Vergangenheit
Die Rolle von Gasnetzen in der Energiewende - und Ergänzung durch andere Netze Dr. Jochen Arthkamp, ASUE e.v. Berlin, 25. Mai 2012 Herausforderungen an Transport und Speicherung Transport In der Vergangenheit
Speicherung von erneuerbarem Strom durch Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz Erhebung des Potentials in Österreich
 Speicherung von erneuerbarem Strom durch Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz Erhebung des Potentials in Österreich 14. Symposium Energieinnovation Graz DI(FH) Markus Schwarz PMSc. Dr. in Gerda Reiter
Speicherung von erneuerbarem Strom durch Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz Erhebung des Potentials in Österreich 14. Symposium Energieinnovation Graz DI(FH) Markus Schwarz PMSc. Dr. in Gerda Reiter
Projektarbeit Nr. 2. Nachhaltige Wärmeversorgung von öffentlichen Einrichtungen
 Projektarbeit Nr. 2 Nachhaltige Wärmeversorgung von öffentlichen Einrichtungen -Hallenbad- Sporthalle- Kindertagesstätte- Feuerwehr- In Kooperation mit Einleitung: Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 16,2%
Projektarbeit Nr. 2 Nachhaltige Wärmeversorgung von öffentlichen Einrichtungen -Hallenbad- Sporthalle- Kindertagesstätte- Feuerwehr- In Kooperation mit Einleitung: Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 16,2%
Power to gas Dezentrale Energieversorgung einer Modellstadt
 Power to gas Dezentrale Energieversorgung einer Modellstadt Ein Projekt des Don-Bosco-Gymnasiums im Rahmen des 3malE-Schulwettbewerbs Energie mit Köpfchen 2017/2018 H2 H2 Bis 2050 (Vorgabe EU) vollständige
Power to gas Dezentrale Energieversorgung einer Modellstadt Ein Projekt des Don-Bosco-Gymnasiums im Rahmen des 3malE-Schulwettbewerbs Energie mit Köpfchen 2017/2018 H2 H2 Bis 2050 (Vorgabe EU) vollständige
Power-to-Gas-Anlage in Betrieb genommen. Schlüsseltechnologie zum Gelingen der Energiewende
 Power-to-Gas-Anlage in Betrieb genommen Schlüsseltechnologie zum Gelingen der Energiewende Am Viessmann Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) wird erstmals Methan, das mithilfe eines biologischen Verfahrens
Power-to-Gas-Anlage in Betrieb genommen Schlüsseltechnologie zum Gelingen der Energiewende Am Viessmann Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) wird erstmals Methan, das mithilfe eines biologischen Verfahrens
Solarstrom aus Spanien für Vaterstetten? Vision oder Illusion? Auszug aus einem Vortrag von Dr. Martin Riffeser am in Vaterstetten
 Solarstrom aus Spanien für Vaterstetten? Vision oder Illusion? Auszug aus einem Vortrag von Dr. Martin Riffeser am 10.10.2012 in Vaterstetten Dezentrale regenerative Versorgung von Vaterstetten möglich?
Solarstrom aus Spanien für Vaterstetten? Vision oder Illusion? Auszug aus einem Vortrag von Dr. Martin Riffeser am 10.10.2012 in Vaterstetten Dezentrale regenerative Versorgung von Vaterstetten möglich?
Netzintegration von Windenergie
 Netzintegration von Windenergie 1 ENERTRAG ENERTRAG ist ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes europäisches Energieunternehmen Projektierung von Windfarmen in DE, F, BG, PL, IT, UK Errichtung und Instandhaltung
Netzintegration von Windenergie 1 ENERTRAG ENERTRAG ist ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes europäisches Energieunternehmen Projektierung von Windfarmen in DE, F, BG, PL, IT, UK Errichtung und Instandhaltung
Energiewende Umbau der Energieversorgung
 Umbau der Energieversorgung Zeit für neue Energien. Thüringen Erneuer!bar 2013. 25. Februar 2013 www.bdew.de Ausgangslage Michael Metternich 15.08.11 Seite 2 Das Ziel ist formuliert: ein Marktdesign und
Umbau der Energieversorgung Zeit für neue Energien. Thüringen Erneuer!bar 2013. 25. Februar 2013 www.bdew.de Ausgangslage Michael Metternich 15.08.11 Seite 2 Das Ziel ist formuliert: ein Marktdesign und
Überblick zu Stromspeichertechniken
 Überblick zu Stromspeichertechniken 7. Energieeffizienztisch der Energieeffizienzkooperation Bayerngas am 16. Oktober 2014 bei Südzucker AG Dr.-Ing. Thomas Gobmaier 1 Gliederung 1. Technologieübersicht
Überblick zu Stromspeichertechniken 7. Energieeffizienztisch der Energieeffizienzkooperation Bayerngas am 16. Oktober 2014 bei Südzucker AG Dr.-Ing. Thomas Gobmaier 1 Gliederung 1. Technologieübersicht
Elektrolyse an Wasserstofftankstellen eine geeignete Anwendung von Power to Gas?
 Elektrolyse an Wasserstofftankstellen eine geeignete Anwendung von Power to Gas? Fabian Grüger 20.06.2017 Jahreskonferenz Power to Gas Off-Grid Systems at RLI off-grid@rl-institut.de Agenda 1 Sind Wasserstofftankstellen
Elektrolyse an Wasserstofftankstellen eine geeignete Anwendung von Power to Gas? Fabian Grüger 20.06.2017 Jahreskonferenz Power to Gas Off-Grid Systems at RLI off-grid@rl-institut.de Agenda 1 Sind Wasserstofftankstellen
Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003
 Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003 Gesamte Brutto-Stromerzeugung 597 TWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren 46,3 TWh Kernenergie 27,6 % Braunkohle 26,6 % Steinkohle 24,5 %
Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003 Gesamte Brutto-Stromerzeugung 597 TWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren 46,3 TWh Kernenergie 27,6 % Braunkohle 26,6 % Steinkohle 24,5 %
Erfahrungen aus Power to Gas Projekten. René Schoof, Uniper Energy Storage GmbH Berlin , H2Mobility Kongress
 Erfahrungen aus Power to Gas Projekten René Schoof, Uniper Energy Storage GmbH Berlin 12.04.2016, H2Mobility Kongress Flexibilität und Schnittstellen Erzeugung Netze Power Speicher Wind/Sonne zu Strom
Erfahrungen aus Power to Gas Projekten René Schoof, Uniper Energy Storage GmbH Berlin 12.04.2016, H2Mobility Kongress Flexibilität und Schnittstellen Erzeugung Netze Power Speicher Wind/Sonne zu Strom
Ergebnisse des Forscherteams Energie des 2 Campus 2016
 Wie ist es möglich das elektrolytische Verfahren Power-to-Gas hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz zu optimieren? Ergebnisse des Forscherteams Energie des 2 Campus 2016 WWF Deutschland Westfälische
Wie ist es möglich das elektrolytische Verfahren Power-to-Gas hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz zu optimieren? Ergebnisse des Forscherteams Energie des 2 Campus 2016 WWF Deutschland Westfälische
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim
 Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Themenbereiche: UBA. Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz. Rosemarie Benndorf et al. Juni 2014
 Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 Herausgeber/Institute: UBA Autoren: Rosemarie Benndorf et al. Themenbereiche: Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz Datum: Juni 2014 Seitenzahl:
Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 Herausgeber/Institute: UBA Autoren: Rosemarie Benndorf et al. Themenbereiche: Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz Datum: Juni 2014 Seitenzahl:
Pressekonferenz. Windenergie an Land Marktanalyse Deutschland 1. Halbjahr 2016
 Pressekonferenz Windenergie an Land Marktanalyse Deutschland 1. Halbjahr 2016 1. Halbjahr 2016 STATUS DES WINDENERGIEAUSBAUS AN LAND IN DEUTSCHLAND Im Auftrag von: Status des Windenergieausbaus an Land
Pressekonferenz Windenergie an Land Marktanalyse Deutschland 1. Halbjahr 2016 1. Halbjahr 2016 STATUS DES WINDENERGIEAUSBAUS AN LAND IN DEUTSCHLAND Im Auftrag von: Status des Windenergieausbaus an Land
Power-to-X: Technologien, Business Cases und regulatorische Hindernisse. aus ökonomischer Sicht eines Entwicklers / IPPs
 Power-to-X: Technologien, Business Cases und regulatorische Hindernisse aus ökonomischer Sicht eines Entwicklers / IPPs Strommarkttreffen, Berlin, 6. April 2018 Agenda Vorstellung ENERTRAG AG Künftiges
Power-to-X: Technologien, Business Cases und regulatorische Hindernisse aus ökonomischer Sicht eines Entwicklers / IPPs Strommarkttreffen, Berlin, 6. April 2018 Agenda Vorstellung ENERTRAG AG Künftiges
INFRASTRUKTUREN VERBINDEN. Kurzbotschaften zur infrastrukturellen Kopplung von Strom- und Gasnetz
 INFRASTRUKTUREN VERBINDEN Kurzbotschaften zur infrastrukturellen Kopplung von Strom- und Gasnetz Gase und Gasinfrastrukturen sind durch ihr hohes Dekarbonisierungspotenzial notwendige Bestandteile eines
INFRASTRUKTUREN VERBINDEN Kurzbotschaften zur infrastrukturellen Kopplung von Strom- und Gasnetz Gase und Gasinfrastrukturen sind durch ihr hohes Dekarbonisierungspotenzial notwendige Bestandteile eines
Photovoltaik-Module mm Länge eines Moduls 4.1A Strom bei max. Leistung
 Photovoltaik-Module Photovoltaik-Module wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dazu nutzen Solarzellen den photoelektrischen Effekt, der mittels Absorption von Sonnenlicht Elektronen in Bewegung
Photovoltaik-Module Photovoltaik-Module wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dazu nutzen Solarzellen den photoelektrischen Effekt, der mittels Absorption von Sonnenlicht Elektronen in Bewegung
Energiestrategie 2050 Sicht heute
 Energiestrategie 2050 Sicht heute 15. Januar 2019, Nick Zepf, Leiter Corporate Development Axpo Energiestrategie 2050 - Sicht heute, Nick Zepf, Axpo, 15.01.2019 1 Einleitung und Ausgangslage ES 2050 vom
Energiestrategie 2050 Sicht heute 15. Januar 2019, Nick Zepf, Leiter Corporate Development Axpo Energiestrategie 2050 - Sicht heute, Nick Zepf, Axpo, 15.01.2019 1 Einleitung und Ausgangslage ES 2050 vom
Solarstrom aus Spanien für Vaterstetten? Vision oder Illusion? Auszug aus einem Vortrag von Dr. Martin Riffeser am in Vaterstetten
 Solarstrom aus Spanien für Vaterstetten? Vision oder Illusion? Auszug aus einem Vortrag von Dr. Martin Riffeser am 10.10.2012 in Vaterstetten Dezentrale regenerative Versorgung von Vaterstetten möglich?
Solarstrom aus Spanien für Vaterstetten? Vision oder Illusion? Auszug aus einem Vortrag von Dr. Martin Riffeser am 10.10.2012 in Vaterstetten Dezentrale regenerative Versorgung von Vaterstetten möglich?
Pressekonferenz Windenergie an Land Marktanalyse Deutschland 2016
 Pressekonferenz Windenergie an Land Marktanalyse Deutschland 2016 Bild: Vestas Jahr 2016 STATUS DES WINDENERGIEAUSBAUS AN LAND IN DEUTSCHLAND Anna-Kathrin Wallasch Deutsche WindGuard GmbH Im Auftrag von:
Pressekonferenz Windenergie an Land Marktanalyse Deutschland 2016 Bild: Vestas Jahr 2016 STATUS DES WINDENERGIEAUSBAUS AN LAND IN DEUTSCHLAND Anna-Kathrin Wallasch Deutsche WindGuard GmbH Im Auftrag von:
Strom, Wärme, Verkehr Das technologische Potential von Wasserstoff
 Strom, Wärme, Verkehr Das technologische Potential von Wasserstoff NIP-Vollversammlung Berlin Dr. Uwe Albrecht Geschäftsführer, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH LBST - Unabhängige Expertise seit über 30
Strom, Wärme, Verkehr Das technologische Potential von Wasserstoff NIP-Vollversammlung Berlin Dr. Uwe Albrecht Geschäftsführer, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH LBST - Unabhängige Expertise seit über 30
Regulatorischer Rahmen und Förderung von Speichern
 Regulatorischer Rahmen und Förderung von Speichern Dr. Ralf Sitte Referat III C 4 Flexibilität der Nachfrage, Technische Systemintegration, Speicher www.bmwi.de Herausforderungen Technische und wirtschaftliche
Regulatorischer Rahmen und Förderung von Speichern Dr. Ralf Sitte Referat III C 4 Flexibilität der Nachfrage, Technische Systemintegration, Speicher www.bmwi.de Herausforderungen Technische und wirtschaftliche
Stromversorgung mit 100%Erneuerbaren. Dr. Wilfried Attenberger LAK Energie Bayern
 Stromversorgung mit 100%Erneuerbaren Dr. Wilfried Attenberger LAK Energie Bayern Einleitung 100% EE Konsens im Bund Naturschutz Simulation in Zeitauflösung Ermittlung des Speicherbedarfs Ermittlung der
Stromversorgung mit 100%Erneuerbaren Dr. Wilfried Attenberger LAK Energie Bayern Einleitung 100% EE Konsens im Bund Naturschutz Simulation in Zeitauflösung Ermittlung des Speicherbedarfs Ermittlung der
Deutschland Energiewende jetzt!
 Deutschland Energiewende jetzt! Erneuerbare Energien? Finden Sie sinnvoll. Aber... Sie bezweifeln, dass Deutschland mit Wind, Sonne & Co. seinen Energiehunger stillen kann? Sie denken, das sei utopisch,
Deutschland Energiewende jetzt! Erneuerbare Energien? Finden Sie sinnvoll. Aber... Sie bezweifeln, dass Deutschland mit Wind, Sonne & Co. seinen Energiehunger stillen kann? Sie denken, das sei utopisch,
Kommunale Energiewende europäisch denken. Prenzlau Stadt der erneuerbaren Energien Thematik. Dr. Andreas Heinrich 2.
 Kommunale Energiewende europäisch denken Prenzlau Stadt der erneuerbaren Energien 24.04. Thematik Dr. Andreas Heinrich 2. Beigeordneter Prenzlau Bundesland Brandenburg / Landkreis Uckermark 100 km nördlich
Kommunale Energiewende europäisch denken Prenzlau Stadt der erneuerbaren Energien 24.04. Thematik Dr. Andreas Heinrich 2. Beigeordneter Prenzlau Bundesland Brandenburg / Landkreis Uckermark 100 km nördlich
