Einwohnergemeinde Oensingen Kanton Solothurn
|
|
|
- Carin Dittmar
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einwohnergemeinde Oensingen Kanton Solothurn Energieplanung Planungsbericht Energieplanung Seite 2 2. Energienachfrage Oensingen 2010 Seite 3 3. Potenziale der erneuerbaren Energie Seite 4 4. Arten der Energieerzeugung, Eignung Seite 7 5. Leitungsgebundene Energieträger Seite 8 6. Prioritäten der Energieversorgung Seite 9 7. Gebiete höherer Wärmedichte, Prioritätsgebiete Seite Empfohlene Massnahmen Seite 12 Infrastruktur 1: Energieplan 1: Werner Stooss Ing. REG A 4702 Oensingen Seite 1 von 14
2 1. Energieplanung 1.1 Zweck Mit der Energieplanung werden die lokalen Voraussetzungen für eine sinnvolle Nutzung der ökologischen Potenziale auf dem Gemeindegebiet geschaffen. Die Energieplanung besteht aus dem Energieplan, der die Visualisierung der Festlegungen beinhaltet und dem zugehörigen Planungsbericht, der die Interessenabwägung wiedergibt und Massnahmen formuliert. Für Oensingen ist zunächst die Stufe Richtplan sinnvoll vor der definitiven Aufnahme in den OP. Dies hat den Vorteil, dass die dringlichen Anliegen bereits heute als Vorarbeit für die OP bearbeitet werden können. 1.2 Energieplan Der Energieplan wird nach Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben Teil der OP und wird nach Prüfung durch das Amt für Raumplanung öffentlich aufgelegt. Er wird grundeigentümerverbindlich. Eine neue kantonale Bauverordnung ist in Arbeit. Sie wird für die Energieplanung erweiterte Rechtsgrundlagen geben. Folgendes ist im Energiegesetz (Stand 1. Juli 2005) bereits geregelt: 7 Energieversorgung in den Gemeinden Die Gemeinden können durch Erschliessungspläne und Reglemente Versorgungsgebiete für - und Wärmeversorgung ausscheiden, die Wärmeversorgung mit Gemeinschaftsanlagen vorschreiben und das Verwenden von bestimmten nicht erneuerbaren Energien in abgegrenzten Versorgungsgebieten ausschliessen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetz Richtplan Der Richtplan ist nach einem positiven GR-Beschluss behördenverbindlich. Der GR-Beschluss soll enthalten, dass der Richtplan in den OP integriert wird, wenn nötig in überarbeiteter Form. Bei Gestaltungsplanpflicht kann ein Energiekonzept verlangt werden, das Lösungen nach vorgegebener Wertung der Energieträger prüft, angelehnt an den Entwurf kantonale Energiefachstelle (siehe Kapitel 6). Ist Fernwärme vorhanden, muss bei Neubauten belegt werden, dass konkurrenzierende Energieträger energetisch sinnvoller sind. Bei Sanierungen im Fernwärmegebiet gilt das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. 1.4 Gemeindereglemente Dringliche Massnahmen können bereits in den entsprechenden Gemeindereglementen verbindlich festgelegt werden. Seite 2 von 14
3 2. Energienachfrage Oensingen 2010 Werte aus der Erhebung 2010 für Oensingen in GWh/a. (Witterung normalisiert nach langjährigem Mittel). Energieträger 2010 Anteil GWh/a Heizöl Haushalte % Heizöl Industrie/Gewerbe % Erdgas % Strom Haushalte % Strom Industrie/Gewerbe % Strom öffentl. Beleuchtung % Brennholz/Schnitzel % Total Nachfrage % Auffallend ist der hohe Anteil an Strom für Industrie und Gewerbe. Seite 3 von 14
4 3. Potenziale der erneuerbaren Energie 3.1 Potenziale zur Wärmeerzeugung Bereits genutzte erneuerbare Energien 2012 Klärgas, Biogas Klärgas aus ARA Falkenstein und Biogas aus der Kompogas AG. Das BHKW ist stromgeführt und liefert Strom ins Netz und Wärme an die ARA. >Wärme = 1.2 GWh/a Energieholz - Brennholz/Schnitzel aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. >Wärme = 2.7 GWh/a - Schnitzel für Fernwärme Leuenfeld, Prognose 2012: 315 WE, nach Angaben AEK >Wärme = 1.7 GWh/a Erdwärme m. Ausserhalb Grundwasserschutzzonen. Bewilligung für 16 Bohrungen sind erteilt. 34 WE à 4.75 MWh/a >Wärme = 0.16 GWh/a Grundwasser - Im Areal der Vebo, Werkhofstr. 8 wird Grundwasser zu Heizzwecken genutzt und wieder zurückgeführt. Jahresmenge 135'500 m3/a. Maximale Entnahmemenge 1866 l/min. Kühlung um 3 K. Konzessionen von 1979/2006, gültig bis >Wärme = 0.47 GWh/a - Die Firma Stebler nutzt Grundwasser zum Kühlen. Jahresmenge 37'290 m3/a. Max. Entnahmemenge 300 l/min. Erwärmung um max, 3 K. Konzession >Wärme = 0.13 GWh/a - Im Staadacker II wird Grundwasser von 9-11 C zu Heizzwecken genutzt und wieder zurückgeführt. Jahresmenge 60'000 m3/a. Maximale Entnahmemenge 450 l/min. Kühlung um 5 K. Konzession >Wärme = 0.35 GWh/a Sonnenenergie, thermisch 8 Wohneinheiten (WE) für WW, 16 WE mit Heizungsunterstützung. Total 215 m2 >Wärme = 0.07 GWh/a Total genutzte Wärme 2012 = 6.77 GWh/a Seite 4 von 14
5 Noch ungenutzte erneuerbare Energien Abwärme Aus Abwasserkanälen. Anforderung: Abwasser höher als 10 C, Menge über 15 l/min. - Bell AG: Jahresmenge 150'000 m3/a = 285 l/min. à C, Kühlung auf 10 C. >Wärme = 1.6 GWh/a - Bourquin: Option Kalte Fernwärme >Wärme =? Klärgas, Biogas Das BHKW der Kompogas AG ist stromgeführt. >Potenzial ausgeschöpft Energieholz - Brennholz/Schnitzel >Potenzial ausgeschöpft - Schnitzel für Fernwärme (Endausbau 7.0 GWh, 1.7 GWh bereits genutzt) >Wärme = 5.3 GWh/a Erdwärme m Theoretisch überall möglich ausser in Grundwasserschutzzone und Karstgebieten. Gewässerschutzrechtliche Bewilligung notwendig. Potenzial: 300 WE à 6.0 MWh/a = 1.8 GWh (wovon 0.16 GWh bereits genutzt) Grundwasser Es sind weitere ähnliche Anlagen möglich, je nach hydrologischen Gegebenheiten und Lage zu anderen Bohrungen. Annahme: 5 zusätzliche Anlagen à 0.35 GWh/a >Wärme = 1.64 GWh/a >Wärme = 1.75 GWh/a Sonnenenergie, thermisch Alle Anlagen künftig mit Heizungsunterstützung. Annahme pro WE: Deckungsgrad 30% von 9.0 MWh/a = 2.7 MWh/a. SK-Fläche bei Ertrag von 300 kwh/m2a => 9 m2/we Potential: 240 WE (10 % von WE) à 9 m2 => 2160 m2 240 à 2.7 MWh/a = 0.65 GWh/a (wovon 0.07 GWh bereits genutzt) >Wärme = 0.58 GWh/a Total ungenutzte Wärme = GWh/a Potenzial für Wärmeerzeugung = GWh/a Seite 5 von 14
6 3.2 Potenziale zur Stromproduktion Bereits genutzte erneuerbare Energien 2012 BHKW der Kompogas AG. Stromgeführt >Strom = 4.2 GWh/a Sonnenenergie, Fotovoltaik - Anlagen der Heizzentrale Brüggmatt (750 m2) und der Kompogas AG (ca m2). Jährlicher Stromertrag pro Solar-Pannel 110 kwh/m2. >Strom = 0.30 GWh/a - Weitere Anlagen in Altmatt 1 und Bifang 22 (ca. 750 m2) >Strom = 0.08 GWh/a Total produzierter Strom = 4.58 GWh/a Noch ungenutzte erneuerbare Energien Klärgas, Biogas BHKW der Kompogas AG Sonnenenergie, Fotovoltaik Potenzial vorhanden (Privat, Industrie). Schätzung: Deckung von 5% des Strombedarfs der Haushalte (5% von 12.6 GWh). Dazu sind 5'700 m2 erforderlich. Wasserkraft Kleinkraftwerk Dünnern (Vorprojekt Alpiq). Ausbauwassermenge 3.8 m3/s, Höhe 3.0 m, max. Leistung 85 kw. Mittlerer Ertrag >Potenzial ausgeschöpft >Strom = 0.63 GWh >Strom = 0.38 GWh/a Total ungenutzter Strom = 1.01 GWh/a Potenzial für Ökostrom = 5.59 GWh/a Seite 6 von 14
7 3.3 Potenziale erneuerbare Energie in GWh/a (Zusammenfassung) 3.4 Bereitstellungen der erneuerbaren Energie Es wird zwischen dem realisierten Potenzial 2012 und dem technischen und raumplanerischen Potenzial (bis 2050) unterschieden. Das theoretische Potenzial ist nicht erreichbar. realisiertes Potenzial technisches und raum- Bereitstellung bis 2012 planerisches Potential gesamt Wärme Strom Wärme Strom GWh GWh GWh GWh Abwärme, industriell 1.6 Energieholz ca. 5'300 m3 Biogas, Klärgas ca. 2.7 Mio. m3 Sonne, thermisch '160 m2 Sonne, Fotovoltaik '200 m2 Erdwärme m ca. 200 Sonden Grundwasser ca. 45 m ca. 8 Brunnen Wasserkraft Dünnern m Gefälle Gesamt Seite 7 von 14
8 4. Arten der Energieerzeugung, Eignung 4.1 Holzfeuerungen Der optimale Einsatzbereich von Holzfeuerungen liegt vor allem in der Wärmeversorgung (Heizen, Warmwasser) von bestehenden, weniger gut gedämmten Gebäuden, aber auch von Neubauten. Holzschnitzelfeuerungen werden eher bei Mehrfamilien- und Schulhäusern eingesetzt; bei kleineren Gebäuden und Einfamilienhäusern bewähren sich automatische Pelletsfeuerungen. Die Verbrennung erfolgt CO2-neutral; hingegen werden grössere Mengen an Luftschadstoffen ausgestossen, insbesondere Feinstaub (PM10), Stickoxide (NOx) und Kohlenmonoxid (CO). Schadstoffbelastete Gebiete sind daher zu meiden. Das Potenzial Energieholz ist momentan noch nicht ausgeschöpft, bei Vollausbau der Fernwärme wird das Potenzial erreicht. Nach wie vor gilt, dass die stoffliche Verwertung von Holz Vorrang vor der energetischen Verwertung hat. 4.2 Fossile Feuerungen Feuerungen mit Heizöl oder Erdgas sollen künftig nur noch für die Erzeugung von Hochtemperaturwärme oder zur Spitzendeckung bei WP-Anlagen eingesetzt werden. Da bei der Verbrennung viel CO2 ausgestossen wird, sind fossile Feuerungen auf spezielle Anwendungen, beispielsweise unstete Hochtemperaturprozesse, zu beschränken. Die Feuerungstechnik wurde in den letzten Jahren laufend verbessert. Durch die Wärmenutzung der Abgase im Kondensationskessel (Brennwertkessel) wird der Wirkungsgrad erhöht. Bei einem Kesselersatz ist der Brennwertkessel heute Vorschrift. 4.3 Wärmepumpen Die Wärmepumpen (WP) nutzen Wärmepotenziale mit niedriger Temperatur. Diese Form der Wärmeerzeugung ist insofern raumwirksam, als ortsgebundene Wärmequellen aus unmittelbarer Umgebung Erdreich, Oberflächenwasser und Grundwasser verfügbar sind. Ausserdem kann Abwärme aus dem Abwasser für Heizzwecke und Warmwasser genutzt werden, was z.b. bei Bell AG möglich wäre. Je geringer der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und dem Heizsystem ist, umso weniger Hilfsenergie (Strom, Erdgas) wird für den WP-Antrieb benötigt. WP eignen sich für die Erzeugung von Raumwärme in Neubauten oder energetisch sanierten Altbauten, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen im Heizungskreislauf auskommen (Bodenheizungen). Grundwasser Ab 50 kw Verdampferleistung. Maximale Abkühlung um 4 K. Ganzjährig hohe Temperatur des Grundwassers >Arbeitszahl der WP 4-5 möglich. Anforderungen der Fachstelle Grundwasserbewirtschaftung beachten (Merkblatt). Erdsonden Ökologisch immer sinnvoll. Ganzjährig hohe Temperatur der Wärmequelle >Arbeitszahl der WP 3-4 möglich. Bohrtiefe m, Richtkosten Fr pro Bohrmeter. Erdsonden nicht in Karstgebieten. Erdsonden werden künftig auch im Grundwassergebiet gestattet. Gewässerschutzrechtliche Bewilligung im Rahmen des Baugesuchs einholen (Antragsformular vorhanden). Umgebungsluft Nur bei Kleinanlagen sinnvoll, da während der Heizperiode tiefe Aussenlufttemperaturen herrschen >Arbeitszahl der WP 2-3. Allenfalls Spitzendeckung mit Holzöfen. Elektrisch Zusatzheizungen sind nicht mehr gestattet. Seite 8 von 14
9 4.4 Wärmekraftkopplung Wärmekraftkoppelungsanlagen (WKK) erzeugen über einen Verbrennungsmotor Strom und liefern zugleich nutzbare Abwärme. Je nach Nachfrage ist ein wärmegeführter oder ein stromgeführter (nur bei Grossanlagen) Betrieb möglich. Die Heizleistung sollte mindestens 50 kw betragen. Als Verbrennungsmotoren sind motoren mit Biogas den Dieselmotoren vorzuziehen. Ein rationeller Betrieb ist auf eine hohe Betriebsstundenzahl angewiesen. Anwendung für Nahwärmeverbund in Wohnsiedlungen oder bei grösseren Einzelgebäuden. 4.5 Nutzung von Sonnenenergie, thermisch Die Sonnenenergie kann mit Sonnenkollektoren auf dem Dach oder an einer Gebäudefassade zur Erzeugung von Wärme genutzt werden. Die gewonnene Wärme wird zur Bereitstellung des Brauchwarmwassers sowie für die Vorwärmung im Heizsystem verwendet. Letzteres sollte bei genügend grosser Dachfläche angestrebt werden. Je nach Ausrichtung der Sonnenkollektoren (Neigungswinkel und Orientierung) und der örtlichen Sonneneinstrahlung lassen sich unterschiedlich hohe Energieerträge erzielen. 4.6 Fotovoltaik Mit Solar-Paneel kann Strom für Eigengebrauch und für die Einspeisung ins Netz produziert werden. Wegen den hohen Investitionskosten eher für grossflächige Anlagen, z.b. Flachdächer von Industriebetrieben oder Dächer von Ökonomiegebäuden. Payback- Zeiten von 20 Jahren bei der Einspeisung ins Netz mit kostendeckender Einspeisevergütung. Das Netz muss die Leistungsspitze bei sonnigen Tagen aufnehmen können, was vielfach einen Netzausbau erfordert. Seite 9 von 14
10 5. Leitungsgebundene Energien Leitungsgebundene Energien (Erdgas, Fernwärme) eignen sich zur Versorgung ganzer Siedlungsgebiete. Im Infrastrukturplan ist das bestehende netz (Stand 2011), das Fernwärmegebiet Leuenbach, das Fernwärmegebiet Zentrum und der Fernwärmeast zum Schulhaus Oberdorf festgehalten. Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten müssen die Gestehungskosten der Wärmeerzeugung, Wärmebezugsdichte, Gebäudebestand und die Kosten der Verteilung geprüft werden. 5.1 Fernwärme Ein -Gebiet sollte bei bestehenden Bauten mindestens eine AZ von bei 75% Anschlussgrad und bei Neubauten eine AZ grösser 0.75 aufweisen. Höhenunterschiede von mehr als 30 m verlangen erhöhten Druck und führen zu Mehrkosten. Für die Wärmeverteilung wird mit Amortisationszeiten von rund 40 Jahren gerechnet; für die Wärmeerzeugung mit 15 bis 20 Jahren. Die Leitungskosten betragen bei der Fernwärme zwischen 600 und Fr./Tm (Tm = Trassemeter); die Kosten für Erdgasleitungen liegen tiefer. 5.2 Erdgas Zwingend ist eine Koordination der Fernwärmeversorgung mit einer bestehenden Erdgasversorgung. Eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien ist bei ähnlicher Wärmedichte einer Erdgasversorgung vorzuziehen (CO2-frei, Versorgungssicherheit, etc.) Seite 10 von 14
11 6. Prioritäten der Energieversorgung Für die Wärmeversorgung (Prozesswärme und Gebäudewärme) ergeben sich, angelehnt an den Entwurf der kantonalen Energiefachstelle, folgende Prioritäten: P Energieträger Bemerkung 1 Ortsgebundene hochwertige Abwärme Abwärmenutzung aus Abwasser Abwärme aus Abwasser von Industrie direkt mit Wärmetauscher z.b. heisses Abwasser von Bell AG. Regional gebunden 2 Erneuerbare Energie Fernwärme aus Heizzentrale, holzbefeuert Heizzentrale mit Schnitzelbefeuerung in der Brüggmatt. Staubfilter, Netztemperatur 90/70. Die Fernwärme ist CO2-neutral, Hilfsenergie aus Photovoltaik. Fernwärmegebiete sind das Leuenfeld, das Schulhaus Oberdorf, das Zentrumsgebiet mit Bienken, Inneres Mühlefeld 1 und 2; Äusseres Mühlefeld, Kreisschule und Felmatt (geplantes Schwerverkehrszentrum SVKZ). Die Versorgung dieser Gebiete ist einer Erdgasversorgung vorzuziehen. In Gestaltungsplänen kann Anschlusszwang vorgeschrieben werden. Holzfeuerungen Holz ist einheimisch, nachwachsend und CO2-neutral. Holzfeuerungen stossen grössere Mengen Luftschadstoffe aus. Einzelanlagen sind meist in älteren, schlecht gedämmten Gebäuden anzutreffen. In kleineren Gebäuden und Einfamilienhäusern bewähren sich automatische Pelletsfeuerungen. Holzschnitzelfeuerungen eher in grösseren Gebäuden und Schulanlagen. Staubfilter ab 70 kw Heizleistung erforderlich. Klärgas, Biogas BHKW Klärgas und Biogase sind erneuerbar und CO2-neutral. Wärmeerzeugung und Stromerzeugung im BHKW. Bei fehlenden Wärmebezügern stromgeführt. 3 Ungebundene Umweltwärme Sonnenenergienutzung Sonnenkollektoren sind überall zulässig, sofern die Bauvorschriften es gestatten. Sie bedürfen einer Baupublikation (Überarbeitung KBV wird dies neu regeln!). Die Anlagen sollen nebst der Warmwasseraufbereitung möglichst auch für die Vorwärmung im Heizsystem angewendet werden. Wärmepumpe mit Erdwärmenutzung Erdwärmenutzung ist praktisch überall möglich mit Ausnahme der Grundwasserschutzzone und in Karstgebieten. Die Möglichkeit, Erdsonden im Grundwassergebiet einzusetzen wird momentan vom Kanton geprüft. Eignet sich eher in Gebieten geringer Wärmedichte. Hohe Effizienz, da ganzjährig hohe Temperatur der Wärmequelle. Jahresarbeitszahl der WP mindestens 3.5 Wärmepumpe mit Grundwasser GW-Wärmenutzung ist grundsätzlich möglich im ausgeschiedenen Grundwasserperimeter. Er ist im Energieplan ausgeschieden und hat informativen Charakter. Mindestgrösse: 50 kw Verdampferleistung. Beim Kanton ist Seite 11 von 14 Ausgeschiedene Fernwärmezone Anschlusszwang Alle Bauzonen Standort ARA Alle Bauzonen Kant. Bewilligung Hilfsenergie Elektrizität Konzession Hilfsenergie Elektrizität /
12 eine Konzession zu beantragen. Jahresarbeitszahl der WP mindestens 3.5. Wärmepumpe mit Umgebungsluft Nutzung der Umgebungsluft nur bei Kleinanlagen mit guter Wärmedämmung sinnvoll. Niedrige Effizienz wegen tiefen Aussentemperaturen im Winter. Spitzendeckung mit Elektroheizungen nicht gestattet. Jahresarbeitszahl der WP mindestens 3. Alle Bauzonen, Hilfsenergie Elektrizität 4 Ortsgebundene niederwertige Abwärme und Umweltquellen Abwärmenutzung aus Abwasser Abwärme aus Abwasser von Industrie mit WP unter Umständen in Wärmeverbund. z.b. Abwasser von Bell AG. Regional gebunden 5 Leitungsgebundene fossile Energieträger Wärmekraftkoppelung mit motor Hauptsächlich bei grösseren Objekten zur Wärmeversorgung in der Industrie mit Wärmeverbund. Der erzeugte Strom wird zur Eigennutzung verwendet oder ins Netz eingespiesen. Der motor ist dem Dieselmotor wegen geringerem CO2-Ausstoss vorzuziehen. netz mit feuerungen Überall, ausgenommen Fernwärmeperimeter. Versorgung von EFH, MFH, Industrie und Gewerbe. 6 Ungebundene fossile Brennstoffe Wärmekraftkoppelung mit Dieselmotoren Hauptsächlich bei grösseren Objekten zu Wärmenutzung in der Industrie mit Wärmeverbund. Der erzeugte Strom wird zur Eigennutzung verwendet oder ins Netz eingespiesen. Höherer CO2- Ausstoss als beim motor. Ölfeuerungen Bei bestehenden Anlagen sind spätestens nach Verfügung der Feuerungskontrolle die Anlagen durch Brennwertkessel zu ersetzen. Bei Neuanlagen mit Niedertemperatur- Heizungen sind Ölfeuerungen weniger geeignet. Ans netz gebunden Ausgenommen Fernwärmezone Ausserhalb netz Alle Bauzonen Feuerungskontrolle / WS Rev BLC Seite 12 von 14
13 7. Gebiete höherer Wärmedichte, Prioritätsgebiete Nach einer Analyse des gültigen Zonenplans wurden Gebiete höherer Wärmedichte ausgeschieden. Mit dem Übersichtsplan Infrastruktur (Erdgasnetz, Fernwärmenetz) und mit Angaben über das nutzbare Grundwassergebiet für Wärmeerzeugung und Kühlung konnten die Prioritätsgebiete der Energieträger bestimmt werden. Die Ergebnisse sind in der Tabelle und im Energieplan informativ festgehalten. Gebiet Gebiet höherer Zonen Energieträger Nr. Wärmedichte 2012 Priorität 1 Galgenacker W3, W4 2 Chäpelismatt Gs3 3 Lehnrütti W3, W4 4 Hirsacker W2, W3 5 sfeld Gs3 GW,EW 6 Bitterten Gw1 GW,EW 7 Von Rollstrasse W4 8 Wohnzone Leuenfeld, GP 9 Schachen W4 10 Grabenacker Gw1 11 Solothurnstrasse KOb 12 Roggenpark / KG Mitte ÖBA 13 Inneres Mühlefeld 1+ 2 Gs3 14 Mühlefeld W4, Gw3 15 Stadacker (Suva), GP Gs3, W3, W2 GW, EW 16 Äusseres Mühlefeld (Vebo) Gw1, Sn GW 17 Bifang W4, KOb 18 Unterdorf KOb 19 Oltenstrasse Gw1 EW 20 Brüggmatt Sn 21 Industrie Moos In GW 22 Freihaltezone Moos 23 SH Oberdorf ÖBA Holz 24 UNES Gs3 25 KSB Bechburg ÖBA 26 SVKZ 27 Postcenter Gs2 Holz 28 + Bienkensaal ÖBA = Fernwärme GW =Grundwasser EW = Erdwärme Seite 13 von 14
14 8. Empfohlene Massnahmen / Anträge 8.1 Rechtlich verbindliche Vorschriften a) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie Bei der Planung von Bauten ist auf eine für die aktive und passive Sonnenenergienutzung günstige Anordnung zu achten. b) Ausnützungsziffer-Bonus Der Ausnützungszuschlag von 1/10 wird nur bei Einhaltung des Minergie-Standards gewährt. c) Energieversorgung Die Energieversorgung soll den im Energierichtplan gebietsweise festgelegten Prioritäten entsprechen. Bei Gestaltungsplänen ist ein Energiekonzept vorzulegen. d) Anschlusspflicht Innerhalb des im Zonenplan bezeichneten Fernwärmeperimeters sind Neubauten an das Fernwärmenetz anzuschliessen. Bestehende Bauten im Fernwärmeperimeter sind beim Ersatz der Wärmeerzeugungsanlagen für Heizung und/oder Warmwasser an das bestehende Fernwärmenetz anzuschliessen, sofern nicht ein unverhältnismässig hoher zusätzlicher Aufwand nachgewiesen wird. e) Anschlussgebühren, Baubewilligungsgebühren Vom Kanton finanziell geförderte Anlagen (Sonnenenergieanlagen) sind nicht gebührenpflichtig. Regelung im entsprechenden Reglement ändern. Eventuell Schreiben an Verband soloth. Einwohnergemeinden, Hr. Ueli Bucher, mit Bitte um Koordination unter den Gemeinden. 8.2 Freiwillige Vereinbarungen und Verträge Um Gebietskonflikte im Vornherein zu vermeiden, sind die Beteiligten (, Fernwärme, Strom) zu einer Koordinationssitzung einzuladen. Ziel ist eine Vereinbarung zu erzielen. 8.3 Kommunikationen, Information Orientierung der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, eventuell Mitwirkung. Themen: Abwärme, Wärmeverbund, Mobilität. 8.4 Energiepolitisches Leitbild: Ziele (Absenkungspfad SIA) Energieeffizienz Gesamtwärmebedarf 100% < 80% 50% Gesamtstrombedarf 100% < 110% 50% Anteil erneuerbare Energien 13.5% > 16% 30% Zur Kenntnis genommen durch den Gemeinderat mit Traktandum Nr vom 23. Januar Erstellt: 22. Dezember 2011 / Werner Stooss Seite 14 von 14
15 N Legende: Fernw rme Erdgas Bahn A1, T5, Sammelstrasse Grundwasserschutzzonen Situation 1: Gemeinde Oensingen Infrastruktur m Oensingen, Gez.: evw Gr.: A4 CAD-File: M:\Oensingen\9803_073 Bauverwaltung Oensingen\Fernw rme\infrastruktur.dgn Biberist Oensingen Grenchen Schliern/Bern Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax BSB + Partner Ingenieure und Planer bsb +
16 Legende: H here W rmedichte Grundwasser nutzbar (W rmeerzeugung / K hlung) Grundwasserschutzzone, nicht nutzbar Bahn A1, T5, Sammelstrasse Gebiet Gebiet h here Zone Energietr ger Priorit t Nr. W rmedichte Galgenacker W3, W4 2 Ch pelismatt Gs3 3 Lehnr tti W3, W Hirsacker sfeld W2, W3 Gs3 GW, EW 6 Bitterten Gw1 GW, EW 7 Von Rollstrasse W4 8 Wohnzone Leuenfeld, GP 9 Schachen W4 10 Grabenacker Gw1 11 Solothurnstrasse KOb 12 Roggenpark / KG Mitte BA N Inneres M hlefeld 1+2 M hlefeld Gs3 W4, Gw3 15 Stadacker (Suva), GP Gs3, W3, W2 GW, EW GW 16 usseres M hlefeld (Vebo) Gw1, Sn GW Situation 1: Gemeinde Oensingen Energieplan Bifang Unterdorf Oltenstrasse Br ggmatt Industrie Moos Freihaltezone Moos W4, KOb KOb Gw1 Sn In EW GW m 23 SH Oberdorf BA Holz 24 UNES GS3 Oensingen, Gez.: evw Gr.: A4 CAD-File: M:\Oensingen\9803_073 Bauverwaltung Oensingen\Fernw rme\energieplan.dgn 25 KSB Bechburg BA 26 SVKZ Biberist Oensingen Grenchen Schliern/Bern Tel Tel Tel Fax Fax Tel Fax Fax BSB + Partner bsb Ingenieure und Planer Postcenter Feuerwehr + Bienkensaal Gs2 Holz BA = Fernw rme, GW = Grundwasser, EW = Erdw rme
Räumliche Energieplanung
 Information für Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 4: Energiepotenziale
Information für Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 4: Energiepotenziale
Fernwärme, die naheliegende Alternative!
 Uzwil, 16. September 2010 Fernwärme, die naheliegende Alternative! Was können Gemeinden tun? Reto Dettli, Partner econcept AG, Zürich Inhalt Welche Voraussetzungen braucht es für ein Wärmenetz? Was kann
Uzwil, 16. September 2010 Fernwärme, die naheliegende Alternative! Was können Gemeinden tun? Reto Dettli, Partner econcept AG, Zürich Inhalt Welche Voraussetzungen braucht es für ein Wärmenetz? Was kann
Räumliche Energieplanung
 Information für kommunale Behörden und Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärme- und Kälteversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage
Information für kommunale Behörden und Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärme- und Kälteversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage
Energiekonzept und Holzenergiestrategie des Kantons Solothurn
 Energiekonzept und Holzenergiestrategie des Kantons Solothurn Fachveranstaltung: Planung und Betrieb von bestehenden und zukünftigen grösseren Holzenergieprojekten Christoph Bläsi, Stv. Leiter Energiefachstelle
Energiekonzept und Holzenergiestrategie des Kantons Solothurn Fachveranstaltung: Planung und Betrieb von bestehenden und zukünftigen grösseren Holzenergieprojekten Christoph Bläsi, Stv. Leiter Energiefachstelle
Lokale Energiequellen - ein immenses Potenzial
 LOKALE, ERNEUERBARE ENERGIE: IST ALLES MÖGLICH? Lokale Energiequellen - ein immenses Potenzial 250 Bruno Hoesli, Dipl. Bauingenieur HTL, Raumplaner NDS HTL FSU 200 150 100 Planer REG A 0 Wärmebedarf (GWh/a)
LOKALE, ERNEUERBARE ENERGIE: IST ALLES MÖGLICH? Lokale Energiequellen - ein immenses Potenzial 250 Bruno Hoesli, Dipl. Bauingenieur HTL, Raumplaner NDS HTL FSU 200 150 100 Planer REG A 0 Wärmebedarf (GWh/a)
Kommunale Energieplanung Instrument und Vorgehen
 Energie Apéro Luzern _ 8. März 2010 Instrument und Vorgehen Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung - zur räumlichen Koordination der Wärmeversorgung Ziele Energienutzung
Energie Apéro Luzern _ 8. März 2010 Instrument und Vorgehen Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung - zur räumlichen Koordination der Wärmeversorgung Ziele Energienutzung
Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung. 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014
 Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014 Ver- und Entsorgung - Inhalte Übergeordnete Themeneinbindung Kapitel 5.2
Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014 Ver- und Entsorgung - Inhalte Übergeordnete Themeneinbindung Kapitel 5.2
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
9. Energiebericht 2014
 Einwohnergemeinde Oensingen, März 2015 9. Energiebericht 2014 Erhobene Daten Tabellen 1 bis 4 Seite 2,3 Energiebilanz Tabelle 5 mit Grafik Seite 4 Erneuerbare Energie Tabelle 6 Seite 5 CO2-Emission Tabelle
Einwohnergemeinde Oensingen, März 2015 9. Energiebericht 2014 Erhobene Daten Tabellen 1 bis 4 Seite 2,3 Energiebilanz Tabelle 5 mit Grafik Seite 4 Erneuerbare Energie Tabelle 6 Seite 5 CO2-Emission Tabelle
Kommunale Energieplanung
 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Energiepolitik in der Gemeinde _ Handlungsspielraum nutzen! Olten, 27. Oktober 2009 Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung
Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Energiepolitik in der Gemeinde _ Handlungsspielraum nutzen! Olten, 27. Oktober 2009 Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung
Energieraumplanung Ein Schlüssel zur Energiewende?
 SMART CITY Round Table Brunch Energieraumplanung Ein Schlüssel zur Energiewende? 1. Juli 2016 Energierichtplanung in der Schweiz SMART CITY Round Table Brunch 1. Juli 2016, Salzburg DI Ulrich Nyffenegger
SMART CITY Round Table Brunch Energieraumplanung Ein Schlüssel zur Energiewende? 1. Juli 2016 Energierichtplanung in der Schweiz SMART CITY Round Table Brunch 1. Juli 2016, Salzburg DI Ulrich Nyffenegger
Mehr dämmen oder erneuerbare Energie wie und was fördern bzw. fordern die Kantone? Suisse Public, Bern, 19. Juni 2015
 Mehr dämmen oder erneuerbare Energie wie und was fördern bzw. fordern die Kantone? Suisse Public, Bern, 19. Juni 2015 Ulrich Nyffenegger Amtsvorsteher Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons
Mehr dämmen oder erneuerbare Energie wie und was fördern bzw. fordern die Kantone? Suisse Public, Bern, 19. Juni 2015 Ulrich Nyffenegger Amtsvorsteher Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons
Vollzugshilfen Kanton Luzern (Energieordner) Nachweis der energetischen Massnahmen (Energienachweis)
 Vollzugshilfen Kanton Luzern (Energieordner) Nachweis der energetischen Massnahmen (Energienachweis) Teil E Höchstanteil nichterneuerbarer Energien Stand: 1.1.2017 Inhalt und Zweck der Vollzugshilfen Die
Vollzugshilfen Kanton Luzern (Energieordner) Nachweis der energetischen Massnahmen (Energienachweis) Teil E Höchstanteil nichterneuerbarer Energien Stand: 1.1.2017 Inhalt und Zweck der Vollzugshilfen Die
Potentialabschätzung erneuerbare Energien als Basis der Energieplanung Pius Hüsser
 Potentialabschätzung erneuerbare Energien als Basis der Energieplanung Pius Hüsser Ohne sorgfältige Planung sind Bauten wie diese nicht möglich Verkehrsplanung ist unverzichtbar 3 Und wie steht es mit
Potentialabschätzung erneuerbare Energien als Basis der Energieplanung Pius Hüsser Ohne sorgfältige Planung sind Bauten wie diese nicht möglich Verkehrsplanung ist unverzichtbar 3 Und wie steht es mit
KU r ZFASSUnG KoMMUnAlE EnE rg i EplAn U n G
 Fachgruppe Energie KU r ZFASSUnG KoMMUnAlE EnE rg i EplAn U n G www.uster.ch Stadtrat Thomas Kübler Abteilungsvorsteher Bau, Vorsitzender Fachgruppe Energie «Die Weichenstellung für eine zukunftsgerichtete
Fachgruppe Energie KU r ZFASSUnG KoMMUnAlE EnE rg i EplAn U n G www.uster.ch Stadtrat Thomas Kübler Abteilungsvorsteher Bau, Vorsitzender Fachgruppe Energie «Die Weichenstellung für eine zukunftsgerichtete
Ungenutzte Ab- und Umweltwärme, ein vergessenes Energiepotential
 Ungenutzte Ab- und Umweltwärme, ein vergessenes Energiepotential Hanspeter Eicher Studienleiter CAS Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz FHNW VR Präsident Dr. Eicher + Pauli AG Seite 2 Inhalt GIS
Ungenutzte Ab- und Umweltwärme, ein vergessenes Energiepotential Hanspeter Eicher Studienleiter CAS Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz FHNW VR Präsident Dr. Eicher + Pauli AG Seite 2 Inhalt GIS
Biomassenstrategie des Kantons Bern
 Biomassenstrategie des Kantons Bern WSED Wels, 25.2.2009 Ulrich Nyffenegger Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern, CH Projektleiter Energie Der Kanton Bern in Zahlen - 1 Mio. Einwohner -
Biomassenstrategie des Kantons Bern WSED Wels, 25.2.2009 Ulrich Nyffenegger Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern, CH Projektleiter Energie Der Kanton Bern in Zahlen - 1 Mio. Einwohner -
Heizungsersatz. Christian Leuenberger. Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse Zürich
 Heizungsersatz Christian Leuenberger Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse 31 8005 Zürich www.leupro.ch Inhaltsverzeichnis 1. Wie gehe ich vor? 2. Energieträger und Heizsysteme: Nahwärme,
Heizungsersatz Christian Leuenberger Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse 31 8005 Zürich www.leupro.ch Inhaltsverzeichnis 1. Wie gehe ich vor? 2. Energieträger und Heizsysteme: Nahwärme,
Energieleitbild und kommunaler Energieplan
 Kurzfassung Energieleitbild und kommunaler Energieplan Mit der Revision der bisherigen Energieplanung von Fällanden wird diese aktualisiert und auf die neuen kantonalen und nationalen Ziele ausgerichtet.
Kurzfassung Energieleitbild und kommunaler Energieplan Mit der Revision der bisherigen Energieplanung von Fällanden wird diese aktualisiert und auf die neuen kantonalen und nationalen Ziele ausgerichtet.
Neustart oder Status Quo?
 Wärmekraftkopplung Neustart oder Status Quo? Prof. Dr. Hp. Eicher, VR Präsident eicher + pauli AG Energieforum Zürich, 13. März 22 Seite 2 Inhalt Politische Ausgangslage Das kann die WKK Technik heute
Wärmekraftkopplung Neustart oder Status Quo? Prof. Dr. Hp. Eicher, VR Präsident eicher + pauli AG Energieforum Zürich, 13. März 22 Seite 2 Inhalt Politische Ausgangslage Das kann die WKK Technik heute
Wärmeerzeugung Infoanlass 17. November 2017
 STUBERHOLZ LÖSUNGEN WACHSEN Wärmeerzeugung Infoanlass 17. November 2017 1 Wärmeerzeugung für EFH und MFH aus Sicht der Kantonalen Energiegesetzgebung Hinweis zum folgenden Foliensatz: Der Fokus ist auf
STUBERHOLZ LÖSUNGEN WACHSEN Wärmeerzeugung Infoanlass 17. November 2017 1 Wärmeerzeugung für EFH und MFH aus Sicht der Kantonalen Energiegesetzgebung Hinweis zum folgenden Foliensatz: Der Fokus ist auf
Wärmeversorgung mit Weitsicht planen Aufgaben und Handlungsspielräume der Gemeinde
 Wärmeversorgung mit Weitsicht planen Aufgaben und Handlungsspielräume der Gemeinde 16. Januar 2019 Regina Bulgheroni, Brandes Energie AG Wir haben ein Ziel! Kostenreduktion: Energie kostet Versorgungssicherheit:
Wärmeversorgung mit Weitsicht planen Aufgaben und Handlungsspielräume der Gemeinde 16. Januar 2019 Regina Bulgheroni, Brandes Energie AG Wir haben ein Ziel! Kostenreduktion: Energie kostet Versorgungssicherheit:
DIV / Energie Energiepolitische Ziele, Energierecht und Förderprogramm
 Energiepolitische Ziele, Energierecht und Förderprogramm Bernard Dubochet Abteilung Energie Kanton Thurgau Förderung einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung Sicherstellung einer volkswirtschaftlich
Energiepolitische Ziele, Energierecht und Förderprogramm Bernard Dubochet Abteilung Energie Kanton Thurgau Förderung einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung Sicherstellung einer volkswirtschaftlich
Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050
 Raumplanungsgruppe Nordostschweiz des VLP-ASAN Frauenfeld, 18. September 2012 Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050 Reto Dettli Managing Partner Inhalt Die neue Energiestrategie:
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz des VLP-ASAN Frauenfeld, 18. September 2012 Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050 Reto Dettli Managing Partner Inhalt Die neue Energiestrategie:
Weiterbildungstag Feuerungskontrolleure Zeljko Lepur Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz
 Zeljko Lepur Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz Übersicht: MUKEN 2014 - «Wie sieht die Heizung der Zukunft aus?» ErP-Richtlinie «Was bedeutet das für die Haustechnik?» Hoval AG 2 Was bedeutet MuKEn?....Die
Zeljko Lepur Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz Übersicht: MUKEN 2014 - «Wie sieht die Heizung der Zukunft aus?» ErP-Richtlinie «Was bedeutet das für die Haustechnik?» Hoval AG 2 Was bedeutet MuKEn?....Die
Ein Blick über die Grenze: Klimaschutz in Basel und der Schweiz
 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt Amt für Umwelt und Energie Ein Blick über die Grenze: Klimaschutz in Basel und der Schweiz Matthias Nabholz, Dipl. Natw. ETH Leiter
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt Amt für Umwelt und Energie Ein Blick über die Grenze: Klimaschutz in Basel und der Schweiz Matthias Nabholz, Dipl. Natw. ETH Leiter
Energieversorgung 2050 die Umsetzung
 Energieversorgung 2050 die Umsetzung 21. März 2014 Franz Sprecher Leiter Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik der Die Ziele für das Jahr 2050 beeinflussen die Bauprojekte bereits heute Die Sanierungsquote
Energieversorgung 2050 die Umsetzung 21. März 2014 Franz Sprecher Leiter Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik der Die Ziele für das Jahr 2050 beeinflussen die Bauprojekte bereits heute Die Sanierungsquote
Holzenergie-Tagung 2016 BEO HOLZ, Wimmis,
 Holzenergie-Tagung 2016 BEO HOLZ, Wimmis, 14.10.2016 Holzenergie, Zukunftsträger oder Auslaufmodell? Ulrich Nyffenegger Vorsteher Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern Energiestrategie
Holzenergie-Tagung 2016 BEO HOLZ, Wimmis, 14.10.2016 Holzenergie, Zukunftsträger oder Auslaufmodell? Ulrich Nyffenegger Vorsteher Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern Energiestrategie
Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons
 Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler
Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler
DIV / Abteilung Energie. Der Kanton Thurgau steigt in die Champions League der Energiepolitik auf
 DIV / Abteilung Energie Der Kanton Thurgau steigt in die Champions League der Energiepolitik auf Programm Minuten Auftrag, Konzept, Ziele, Schwerpunkte Kaspar Schläpfer 15 und volkswirtschaftliche Effekte
DIV / Abteilung Energie Der Kanton Thurgau steigt in die Champions League der Energiepolitik auf Programm Minuten Auftrag, Konzept, Ziele, Schwerpunkte Kaspar Schläpfer 15 und volkswirtschaftliche Effekte
für die Zukunft. EBL Wärmesysteme
 Für mich, für Dich und für die Zukunft. EBL Wärmesysteme Erdwärmebohrungen «Wärme von unten». Die EBL Wärmesysteme plant und realisiert seit Jahren erfolgreich Erdsondenbohrungen. Höchste Qualität in Engineering
Für mich, für Dich und für die Zukunft. EBL Wärmesysteme Erdwärmebohrungen «Wärme von unten». Die EBL Wärmesysteme plant und realisiert seit Jahren erfolgreich Erdsondenbohrungen. Höchste Qualität in Engineering
Teilrevision kantonales Energiegesetz (KEnG)
 Teilrevision kantonales Energiegesetz (KEnG) Medienorientierung vom 14. Dezember 2006 Daniel Klooz Amtsleiter Amt für Umweltkoordination und Energie, Kt. Bern 1 Umsetzung Energiestrategie: Schrittweises
Teilrevision kantonales Energiegesetz (KEnG) Medienorientierung vom 14. Dezember 2006 Daniel Klooz Amtsleiter Amt für Umweltkoordination und Energie, Kt. Bern 1 Umsetzung Energiestrategie: Schrittweises
Überkommunaler Richtplan Energie
 Überkommunaler Richtplan Energie Ausgangslage Der Kantonale Richtplan sieht vor, dass Ortsplanungen mit der Energieversorgung abgestimmt werden. Der Kanton unterstützt die Gemeinden dabei. In den energierelevanten
Überkommunaler Richtplan Energie Ausgangslage Der Kantonale Richtplan sieht vor, dass Ortsplanungen mit der Energieversorgung abgestimmt werden. Der Kanton unterstützt die Gemeinden dabei. In den energierelevanten
Energetische Potenziale von Wärmepumpen kombiniert mit Wärme-Kraft-Kopplung Für maximale CO 2. -Reduktion und für fossile Stromerzeugung mit CO 2
 Energetische Potenziale Bereichsleitung Bundesamt für Energie BFE von Wärmepumpen kombiniert mit WKK Umgebungswärme, WKK, Kälte Sektion erneuerbare Energien Zusammenfassung, Juni 2005 Energetische Potenziale
Energetische Potenziale Bereichsleitung Bundesamt für Energie BFE von Wärmepumpen kombiniert mit WKK Umgebungswärme, WKK, Kälte Sektion erneuerbare Energien Zusammenfassung, Juni 2005 Energetische Potenziale
Energiebilanzierung bei Gebäuden - 380/1 & Heizungen. VSSH à jour 20. Juni 2017
 Energiebilanzierung bei Gebäuden - 380/1 & Heizungen VSSH à jour 20. Juni 2017 Inhaltsübersicht Einstieg/Anforderungen Gebäudehülle Gebäudetechnik (Heizung) Neubau Sanierung 2 Migranten SES, ZAHW, 2014
Energiebilanzierung bei Gebäuden - 380/1 & Heizungen VSSH à jour 20. Juni 2017 Inhaltsübersicht Einstieg/Anforderungen Gebäudehülle Gebäudetechnik (Heizung) Neubau Sanierung 2 Migranten SES, ZAHW, 2014
SPATENSTICH WÄRMEZENTRALE CHAMPAGNE
 ENERGIE SERVICE BIEL/BIENNE UND AEK ENERGIE AG SPATENSTICH WÄRMEZENTRALE CHAMPAGNE Fernwärme aus Grundwasser Biel, 13.10.2017 AGENDA 1. Begrüssung durch Gemeinderätin Barbara Schwickert Stadt Biel 5 2.
ENERGIE SERVICE BIEL/BIENNE UND AEK ENERGIE AG SPATENSTICH WÄRMEZENTRALE CHAMPAGNE Fernwärme aus Grundwasser Biel, 13.10.2017 AGENDA 1. Begrüssung durch Gemeinderätin Barbara Schwickert Stadt Biel 5 2.
Info-Tagung 2017 Arealwärme und Energienetze. Dominik Noger Leiter Verbundwärme, Hoval AG, Schweiz
 Info-Tagung 2017 Arealwärme und Energienetze Dominik Noger Leiter Verbundwärme, Hoval AG, Schweiz Inhalt Arealwärme - Vernetzte Wärmeversorgung in Siedlungen Energieoptionen in Arealen Info-Tagung 2017
Info-Tagung 2017 Arealwärme und Energienetze Dominik Noger Leiter Verbundwärme, Hoval AG, Schweiz Inhalt Arealwärme - Vernetzte Wärmeversorgung in Siedlungen Energieoptionen in Arealen Info-Tagung 2017
Energie Wasser Bern Gross-Wärmepumpenkongress Zürich, 8. Mai 2019 Martin Jutzeler, CU
 1 Energie Wasser Bern Gross-Wärmepumpenkongress Zürich, 8. Mai 2019 Martin Jutzeler, CU Agenda Kurzporträt Martin Jutzeler Auftrag ewb in der Stadt Bern Richtplan Energie 2035: Herausforderungen und aktueller
1 Energie Wasser Bern Gross-Wärmepumpenkongress Zürich, 8. Mai 2019 Martin Jutzeler, CU Agenda Kurzporträt Martin Jutzeler Auftrag ewb in der Stadt Bern Richtplan Energie 2035: Herausforderungen und aktueller
WKK als Baustein zur Energiewende?
 Dezentrale Stromproduktion: WKK als Baustein zur Energiewende? Referent: Daniel Dillier VR-Präsident IWK und Vize-Präsident V3E Seite 1 Ja, WKK ist «ein effizienter, ökologischer und sofort verfügbarer»
Dezentrale Stromproduktion: WKK als Baustein zur Energiewende? Referent: Daniel Dillier VR-Präsident IWK und Vize-Präsident V3E Seite 1 Ja, WKK ist «ein effizienter, ökologischer und sofort verfügbarer»
Bericht zum Energieplan Dachsen
 GEMEINDE DACHSEN Kommunale Energieplanung Bericht zum Energieplan Dachsen November 2016 Kurzfassung Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse 31 8005 Zürich Inhalt 1 Zum Energieplan...
GEMEINDE DACHSEN Kommunale Energieplanung Bericht zum Energieplan Dachsen November 2016 Kurzfassung Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse 31 8005 Zürich Inhalt 1 Zum Energieplan...
EnergiePraxis-Seminar
 EnergiePraxis-Seminar 2018-1 Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz Hoval Jun-18 Verantwortung für Energie und Umwelt 2 Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz 1 Gesamtenergie- Effizienz nach GEAK
EnergiePraxis-Seminar 2018-1 Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz Hoval Jun-18 Verantwortung für Energie und Umwelt 2 Produktmanager Feuerungen Hoval AG Schweiz 1 Gesamtenergie- Effizienz nach GEAK
Kommunale Energieplanung Stadt Zürich
 Kommunale Energieplanung Stadt Zürich Forum Energie Zürich vom 9. Januar 2018 Seite 1 2018: Startschuss für grosse Energieprojekte Ausbau Fernwärme aus KVA Energienutzung aus Abwasser Versorgung Hochschulgebiet
Kommunale Energieplanung Stadt Zürich Forum Energie Zürich vom 9. Januar 2018 Seite 1 2018: Startschuss für grosse Energieprojekte Ausbau Fernwärme aus KVA Energienutzung aus Abwasser Versorgung Hochschulgebiet
Bericht zum Energieplan Zuchwil
 1. Kurzfassung Kommunale Energieplanung der Gemeinde Zuchwil Bericht zum Energieplan Zuchwil Dezember 2014 Leuenberger Energie- und Umweltprojekte 05.12.2014 Inhalt 1 Zum Energieplan... 1 2 Ist-Zustand
1. Kurzfassung Kommunale Energieplanung der Gemeinde Zuchwil Bericht zum Energieplan Zuchwil Dezember 2014 Leuenberger Energie- und Umweltprojekte 05.12.2014 Inhalt 1 Zum Energieplan... 1 2 Ist-Zustand
Nutzung der Sonnenergie in Zofingen
 Nutzung der Sonnenergie in Zofingen Pius Hüsser, Energieberater, Aarau Inhalt Potential der Sonnenenergie Nutzungsarten Was ist in Zofingen möglich Wie gehe ich weiter? Wie lange haben wir noch Öl? Erdölförderung
Nutzung der Sonnenergie in Zofingen Pius Hüsser, Energieberater, Aarau Inhalt Potential der Sonnenenergie Nutzungsarten Was ist in Zofingen möglich Wie gehe ich weiter? Wie lange haben wir noch Öl? Erdölförderung
Koordinierte Energienutzung aus Gewässern
 Koordinierte Energienutzung aus Gewässern PEAK-Vertiefungskurs Heizen und Kühlen mit Seen und Flüssen, 8. Nov. 2017, Kastanienbaum Felix Schmid, Energieplaner der, felix.o.schmid@zuerich.ch Seite 1 Aufgabe
Koordinierte Energienutzung aus Gewässern PEAK-Vertiefungskurs Heizen und Kühlen mit Seen und Flüssen, 8. Nov. 2017, Kastanienbaum Felix Schmid, Energieplaner der, felix.o.schmid@zuerich.ch Seite 1 Aufgabe
Umsetzung Massnahmen Richtplan Energie - Stolpersteine und Erfahrungen -
 Workshop «Kommunale Energieplanung», AUE 24. März 2017, Bern Umsetzung Massnahmen Richtplan Energie - Stolpersteine und Erfahrungen - Martin Niederberger Leiter Bauabteilung Münsingen Inhalt Präsentation
Workshop «Kommunale Energieplanung», AUE 24. März 2017, Bern Umsetzung Massnahmen Richtplan Energie - Stolpersteine und Erfahrungen - Martin Niederberger Leiter Bauabteilung Münsingen Inhalt Präsentation
Energierichtplan und Baureglement
 Parallel-Session 3 Energierichtplan und Baureglement NEnergietag 2015 Bern, 30. Oktober 2015 Matthias Haldi Projektleiter Energie Stv. Abteilungsleiter Quelle: AGR, J. Pintor Kombikraftwerk 2 - Stabiler
Parallel-Session 3 Energierichtplan und Baureglement NEnergietag 2015 Bern, 30. Oktober 2015 Matthias Haldi Projektleiter Energie Stv. Abteilungsleiter Quelle: AGR, J. Pintor Kombikraftwerk 2 - Stabiler
2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
 Energie-Apéro Luzern Beat Marty, Leiter Abt. Energie, Luft und Strahlen 11. März 2013 2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
Energie-Apéro Luzern Beat Marty, Leiter Abt. Energie, Luft und Strahlen 11. März 2013 2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
EnergiePraxis-Seminar 2/2008. Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2008: Haustechnik
 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2008: Haustechnik Antje Christoph Heinrich Gmür Gesamtenergieverbrauch Schweiz Erdöl-Reserven Der Grossteil der erkundeten Welterdölreserven befindet
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2008: Haustechnik Antje Christoph Heinrich Gmür Gesamtenergieverbrauch Schweiz Erdöl-Reserven Der Grossteil der erkundeten Welterdölreserven befindet
Energiestrategie 2050 Rolle des Kantons bei der Umsetzung
 Säntis Energie AG, Energie-Treffen am Säntis Schwägalp, 22. März 2018 Energiestrategie 2050 Rolle des Kantons bei der Umsetzung Michael Eugster, Amtsleiter Marcel Sturzenegger, Leiter Energiefachstelle
Säntis Energie AG, Energie-Treffen am Säntis Schwägalp, 22. März 2018 Energiestrategie 2050 Rolle des Kantons bei der Umsetzung Michael Eugster, Amtsleiter Marcel Sturzenegger, Leiter Energiefachstelle
Energieleitbild Wald. Ausgangslage und Vision. Energiestadt Wald. Handlungsmaxime. Pfeiler des Energieleitbildes. Suter von Känel Wild AG
 Ausgangslage und Vision Energiestadt Wald Pfeiler des Energieleitbildes Die Gemeinde Wald ist Energiestadt und bekennt sich zu einer umweltschonenden und nachhaltigen Energiepolitik. Seit sie das Label
Ausgangslage und Vision Energiestadt Wald Pfeiler des Energieleitbildes Die Gemeinde Wald ist Energiestadt und bekennt sich zu einer umweltschonenden und nachhaltigen Energiepolitik. Seit sie das Label
Moderne Heizsysteme vom Keller bis aufs Dach. Urs Jaeggi Jaeggi Gmünder Energietechnik AG
 Moderne Heizsysteme vom Keller bis aufs Dach Urs Jaeggi Jaeggi Gmünder Energietechnik AG Installationsbetrieb mit fachübergreifenden Kompetenzen 2015 entstanden aus Management-Buyout der Ausführungsabteilung
Moderne Heizsysteme vom Keller bis aufs Dach Urs Jaeggi Jaeggi Gmünder Energietechnik AG Installationsbetrieb mit fachübergreifenden Kompetenzen 2015 entstanden aus Management-Buyout der Ausführungsabteilung
Infoanlass Mitwirkung Donnerstag, 02. November 2017
 Richtplan Energie Ostermundigen Infoanlass Mitwirkung Donnerstag, 02. November 2017 Matthias Haldi Projektleiter Energieplanung Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) Quelle: www.energiesparenleichtgemacht.de
Richtplan Energie Ostermundigen Infoanlass Mitwirkung Donnerstag, 02. November 2017 Matthias Haldi Projektleiter Energieplanung Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) Quelle: www.energiesparenleichtgemacht.de
Swissbau Focus 2014 Swissbau Focus 2014
 Swissbau Focus 2014 Swissbau Focus 2014 1 Swissbau Focus 2014 «Energie aus dem Erdreich für die Wärmeversorgung der Zukunft» Claude Minder El.-Ing. HTL Abteilungsleiter Wärmecontracting 2 Swissbau Focus
Swissbau Focus 2014 Swissbau Focus 2014 1 Swissbau Focus 2014 «Energie aus dem Erdreich für die Wärmeversorgung der Zukunft» Claude Minder El.-Ing. HTL Abteilungsleiter Wärmecontracting 2 Swissbau Focus
Heizöl verlässlicher Partner im nachhaltigen Energiemix
 Heizöl verlässlicher Partner im nachhaltigen Energiemix Statt sie gegeneinander auszuspielen, macht es energietechnisch viel mehr Sinn, fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien zusammen zu führen.
Heizöl verlässlicher Partner im nachhaltigen Energiemix Statt sie gegeneinander auszuspielen, macht es energietechnisch viel mehr Sinn, fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien zusammen zu führen.
Informationsanlass für Bauherren Kantonale Energieförderung und pronovo. 24. Oktober 2018, Stadtsaal Wil Lorenz Neher, Leiter Energieförderung
 Informationsanlass für Bauherren Kantonale Energieförderung und pronovo 24. Oktober 2018, Stadtsaal Wil Lorenz Neher, Leiter Energieförderung Ziele der Energiepolitik bis 2020 Kanton St.Gallen Gesamtenergieeffizienz
Informationsanlass für Bauherren Kantonale Energieförderung und pronovo 24. Oktober 2018, Stadtsaal Wil Lorenz Neher, Leiter Energieförderung Ziele der Energiepolitik bis 2020 Kanton St.Gallen Gesamtenergieeffizienz
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) für Eigentümer von Neubauten
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) für Eigentümer von Neubauten Regeln im Energieland Hessen Nutzungspflicht
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) für Eigentümer von Neubauten Regeln im Energieland Hessen Nutzungspflicht
Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren. Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014)
 Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) Inhaltsübersicht Stromverbrauch und Einflussmöglichkeiten Anforderungen
Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) Inhaltsübersicht Stromverbrauch und Einflussmöglichkeiten Anforderungen
Bruno Bébié, Energiebeauftragter Stadt Zürich Der Beitrag der erneuerbaren Energien
 Bruno Bébié, Der Beitrag der erneuerbaren Energien Der Beitrag der erneuerbaren Energien - Projekt Energieversorgungskonzept 2050 der Projekt: Eckpunkte eines räumlichen Konzepts für eine 2000-Wattkompatible
Bruno Bébié, Der Beitrag der erneuerbaren Energien Der Beitrag der erneuerbaren Energien - Projekt Energieversorgungskonzept 2050 der Projekt: Eckpunkte eines räumlichen Konzepts für eine 2000-Wattkompatible
Ihr Rundum-Partner auf dem Weg zur Energiewende. 29. April 2014, Hauptversammlung Hausverein Ostschweiz Philipp Egger, Geschäftsleiter
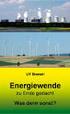 Ihr Rundum-Partner auf dem Weg zur Energiewende 29. April 2014, Hauptversammlung Hausverein Ostschweiz Philipp Egger, Geschäftsleiter Kantonales Energiekonzept 5 Schwerpunkte Gebäude: Effizienz und erneuerbare
Ihr Rundum-Partner auf dem Weg zur Energiewende 29. April 2014, Hauptversammlung Hausverein Ostschweiz Philipp Egger, Geschäftsleiter Kantonales Energiekonzept 5 Schwerpunkte Gebäude: Effizienz und erneuerbare
Grundlagen für räumliche Energieplanungen. Moritz Kulawik, Umwelt und Energie Sascha Brunner, Raum und Wirtschaft 26. Juni 2017
 Grundlagen für räumliche Energieplanungen Moritz Kulawik, Umwelt und Energie Sascha Brunner, Raum und Wirtschaft 26. Juni 2017 Energiestrategie 2050 Bund 2000 Watt Gesellschaft 1-Tonne CO 2 -Gesellschaft
Grundlagen für räumliche Energieplanungen Moritz Kulawik, Umwelt und Energie Sascha Brunner, Raum und Wirtschaft 26. Juni 2017 Energiestrategie 2050 Bund 2000 Watt Gesellschaft 1-Tonne CO 2 -Gesellschaft
Solarthermie. Nachteile. Vorteile. Gebäudevoraussetzungen. Klimabilanz. mind mind Solarkollektoren. Wärmespeicher.
 Solarthermie Emissions- und brennstofffreie Wärme aus dem Solarteil Regionale Wertschöpfung statt Import von Öl und Gas Über Speicher mit sämtlichen Heizsystemen kombinierbar Weniger Abhänigkeit von Preisentwicklung
Solarthermie Emissions- und brennstofffreie Wärme aus dem Solarteil Regionale Wertschöpfung statt Import von Öl und Gas Über Speicher mit sämtlichen Heizsystemen kombinierbar Weniger Abhänigkeit von Preisentwicklung
Ökowärme in Oberösterreich. Dr. Gerhard Dell
 Ökowärme in Oberösterreich TU Wien, 23.03.2011 Dr. Gerhard Dell Energiebeauftragter des Landes OÖ GF O.Ö. Energiesparverband Ziele Energieeffizienz Erneuerbare Energieträger Neue Technologien Organisation
Ökowärme in Oberösterreich TU Wien, 23.03.2011 Dr. Gerhard Dell Energiebeauftragter des Landes OÖ GF O.Ö. Energiesparverband Ziele Energieeffizienz Erneuerbare Energieträger Neue Technologien Organisation
Die Rolle der PV im Gebäudeenergiekonzept gemäss MuKEn Christian Mathys, AUE BS
 Die Rolle der PV im Gebäudeenergiekonzept gemäss MuKEn 2014 Christian Mathys, AUE BS MuKEn 2014 verabschiedet von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) am 9. Januar 2015 Christian Mathys, AUE
Die Rolle der PV im Gebäudeenergiekonzept gemäss MuKEn 2014 Christian Mathys, AUE BS MuKEn 2014 verabschiedet von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) am 9. Januar 2015 Christian Mathys, AUE
Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle. Energieförderprogramm
 Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle Energieförderprogramm 1/2017 Wichtiges in Kürze Förderprogramme im Bereich Energie sind für Private, Unternehmen und Gemeinden bestimmt. Förderung kommt
Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle Energieförderprogramm 1/2017 Wichtiges in Kürze Förderprogramme im Bereich Energie sind für Private, Unternehmen und Gemeinden bestimmt. Förderung kommt
Erneuerbare Energien
 Erneuerbare Energien Energiewochen Zürcher Kantonalbank 6./7./8 November 2017 Prof. Dr. Hanspeter Eicher VR Präsident eicher+pauli www.eicher-pauli.ch 1 Erneuerbare Energien Elektrizität Wärme Kälte 2
Erneuerbare Energien Energiewochen Zürcher Kantonalbank 6./7./8 November 2017 Prof. Dr. Hanspeter Eicher VR Präsident eicher+pauli www.eicher-pauli.ch 1 Erneuerbare Energien Elektrizität Wärme Kälte 2
Die Neuerungen der KEnV im Detail. Informationsveranstaltung zur Teilrevision KEnV 2016
 Die Neuerungen der KEnV im Detail Informationsveranstaltung zur Teilrevision KEnV 2016 Matthias Haldi Projektleiter Energie Gebäude stv. Abteilungsleiter Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) Revision
Die Neuerungen der KEnV im Detail Informationsveranstaltung zur Teilrevision KEnV 2016 Matthias Haldi Projektleiter Energie Gebäude stv. Abteilungsleiter Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) Revision
Renovationsprojekt La Cigale
 ZIG Planertagung 25.3.2015, Luzern Renovationsprojekt La Cigale Dr. Lukas Küng Hochschule Luzern, 25.3.2015 1 Inhalt Über BG Wieso energetische Renovationen? Überblick "la cigale" Genf Vergleich der Heizsysteme
ZIG Planertagung 25.3.2015, Luzern Renovationsprojekt La Cigale Dr. Lukas Küng Hochschule Luzern, 25.3.2015 1 Inhalt Über BG Wieso energetische Renovationen? Überblick "la cigale" Genf Vergleich der Heizsysteme
ANERGIENETZE. PV, Geothermie, Abwärme und Abwasserenergie als Bausteine für eine nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung im urbanen Neubaugebiet
 ANERGIENETZE PV, Geothermie, Abwärme und Abwasserenergie als Bausteine für eine nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung im urbanen Neubaugebiet Forschungsprojekt Urban PV+geotherm Beispiel Nordwestbahnhof
ANERGIENETZE PV, Geothermie, Abwärme und Abwasserenergie als Bausteine für eine nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung im urbanen Neubaugebiet Forschungsprojekt Urban PV+geotherm Beispiel Nordwestbahnhof
«Information Energiekonzept»
 ENERGIEPLANUNG PFYN «Information Energiekonzept» 29. September 2018 Sven Fitz M.Sc. Geowissenschaften sven.fitz@bhateam.ch RESSOURCENVERKNAPPUNG 2 Woche der Begegnung, Wilen 10.06.2015 KLIMAWANDEL Was
ENERGIEPLANUNG PFYN «Information Energiekonzept» 29. September 2018 Sven Fitz M.Sc. Geowissenschaften sven.fitz@bhateam.ch RESSOURCENVERKNAPPUNG 2 Woche der Begegnung, Wilen 10.06.2015 KLIMAWANDEL Was
Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle. Energieförderprogramm
 Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle Energieförderprogramm 11/2017 Wichtiges in Kürze Förderprogramme im Bereich Energie sind für Private, Unternehmen und Gemeinden bestimmt. Förderung kommt
Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle Energieförderprogramm 11/2017 Wichtiges in Kürze Förderprogramme im Bereich Energie sind für Private, Unternehmen und Gemeinden bestimmt. Förderung kommt
Konzept Energieversorgung 2050 der Stadt Zürich
 Konzept Energieversorgung 2050 der mit Fokus auf die Energienutzung aus Gewässern und aus dem Erdreich Tagung cercl eau 13. Juni 2013, La Neuveville Felix Schmid, Stv. der, felix.schmid@zuerich.ch Cerc
Konzept Energieversorgung 2050 der mit Fokus auf die Energienutzung aus Gewässern und aus dem Erdreich Tagung cercl eau 13. Juni 2013, La Neuveville Felix Schmid, Stv. der, felix.schmid@zuerich.ch Cerc
Erneuerbare Energien im Kanton St.Gallen
 Erneuerbare Energien im Generalversammlung Waldwirtschaftsverband St.Gallen & Lichtenstein Alfons Schmid, Oktober 2012 Projektleiter Erneuerbare Energie Baudepartement Vier Fragen zum Start 1.Warum erneuerbare
Erneuerbare Energien im Generalversammlung Waldwirtschaftsverband St.Gallen & Lichtenstein Alfons Schmid, Oktober 2012 Projektleiter Erneuerbare Energie Baudepartement Vier Fragen zum Start 1.Warum erneuerbare
Fernwärme DIE KOMFORT-ENERGIE
 Fernwärme DIE KOMFORT-ENERGIE Minergie schliesst Fernwärme nicht aus Fernwärme und kälte in Minergiegebieten Werner Müller, Geschäftsleiter Triplex Energieplaner AG Stimmt das? Fazit von Hansruedi Kunz
Fernwärme DIE KOMFORT-ENERGIE Minergie schliesst Fernwärme nicht aus Fernwärme und kälte in Minergiegebieten Werner Müller, Geschäftsleiter Triplex Energieplaner AG Stimmt das? Fazit von Hansruedi Kunz
Die Neuerungen der KEnV im Detail. Informationsveranstaltung zur Teilrevision KEnV 2016
 Die Neuerungen der KEnV im Detail Informationsveranstaltung zur Teilrevision KEnV 2016 Matthias Haldi Projektleiter Energie Gebäude stv. Abteilungsleiter Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) Revision
Die Neuerungen der KEnV im Detail Informationsveranstaltung zur Teilrevision KEnV 2016 Matthias Haldi Projektleiter Energie Gebäude stv. Abteilungsleiter Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) Revision
THERMISCHE NETZE FÜR EINE ERNEUERBARE ENERGIEVERSORGUNG
 FERNWÄRME IN KÜRZE THERMISCHE NETZE FÜR EINE ERNEUERBARE ENERGIEVERSORGUNG FERNWÄRME UND FERNKÄLTE Neben Fernwärmenetzen existieren auch Fernkältenetze deshalb verwendet man heute den allgemeineren Begriff
FERNWÄRME IN KÜRZE THERMISCHE NETZE FÜR EINE ERNEUERBARE ENERGIEVERSORGUNG FERNWÄRME UND FERNKÄLTE Neben Fernwärmenetzen existieren auch Fernkältenetze deshalb verwendet man heute den allgemeineren Begriff
Wieso ein Heizungsersatz?
 Wieso ein Heizungsersatz? wie gehört Behördliche Verfügung (Emissionen, Sicherheit, ) Anlage nähert sich langsam dem Lebensende (15-20 Jahre) Motivation: etwas Gutes tun (ökologische Verbesserung) Anlage
Wieso ein Heizungsersatz? wie gehört Behördliche Verfügung (Emissionen, Sicherheit, ) Anlage nähert sich langsam dem Lebensende (15-20 Jahre) Motivation: etwas Gutes tun (ökologische Verbesserung) Anlage
Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld. Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Energieförderung im Kanton St.Gallen. Gebäudemodernisierung mit Konzept
 Energieförderung im Kanton St.Gallen Gebäudemodernisierung mit Konzept Stand Januar 2017 Der detaillierte Beratungsbericht die Grundlage für energetische Gebäudemodernisierungen Eine Gebäudemodernisierung
Energieförderung im Kanton St.Gallen Gebäudemodernisierung mit Konzept Stand Januar 2017 Der detaillierte Beratungsbericht die Grundlage für energetische Gebäudemodernisierungen Eine Gebäudemodernisierung
Überkommunaler Richtplan Energie Bödeli
 Bönigen Interlaken Matten Unterseen Wilderswil Überkommunaler Richtplan Energie Bödeli Kurzfassung für die Mitwirkung Anlass Nachhaltige Entwicklung Abstimmung und Steuerung der künftigen Energieversorgung
Bönigen Interlaken Matten Unterseen Wilderswil Überkommunaler Richtplan Energie Bödeli Kurzfassung für die Mitwirkung Anlass Nachhaltige Entwicklung Abstimmung und Steuerung der künftigen Energieversorgung
Umsetzung der MuKEn in den Kantonen. Robert Küng Regierungsrat
 Umsetzung der MuKEn in den Kantonen Robert Küng Regierungsrat Luzern, 24. November 2016 Energie Aufgaben und Kompetenzen Bund (Art. 89 Abs. 3 BV) Der Bund erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch
Umsetzung der MuKEn in den Kantonen Robert Küng Regierungsrat Luzern, 24. November 2016 Energie Aufgaben und Kompetenzen Bund (Art. 89 Abs. 3 BV) Der Bund erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch
Wir versorgen Sie mit Wärme
 Wir versorgen Sie mit Wärme sauber erneuerbar massgeschneidert Kennen Sie das zukunftsweisende Projekt Circulago? Circulago Wärme und Kälte aus dem Zugersee Circulago ist ein zukunftsweisendes Projekt
Wir versorgen Sie mit Wärme sauber erneuerbar massgeschneidert Kennen Sie das zukunftsweisende Projekt Circulago? Circulago Wärme und Kälte aus dem Zugersee Circulago ist ein zukunftsweisendes Projekt
Anergienetze und Wärmepumpen. Marco Nani
 Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
Nutzen/Möglichkeiten der Einbindung von Wärmepumpen, Beispiel Anergienetze. Gianluca Brullo Productmanager, Hoval AG, Schweiz
 Nutzen/Möglichkeiten der Einbindung von Wärmepumpen, Beispiel Anergienetze Gianluca Brullo Productmanager, Hoval AG, Schweiz Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von
Nutzen/Möglichkeiten der Einbindung von Wärmepumpen, Beispiel Anergienetze Gianluca Brullo Productmanager, Hoval AG, Schweiz Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von
Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz Umsetzbarkeitsstudie von Standardlösungen
 EnergiePraxis-Seminar Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz Umsetzbarkeitsstudie von Standardlösungen Jörg Drechsler, St.Gallen Energieingenieur FH/NDS MAS in nachhaltigem Bauen Neue fossil beheizte
EnergiePraxis-Seminar Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz Umsetzbarkeitsstudie von Standardlösungen Jörg Drechsler, St.Gallen Energieingenieur FH/NDS MAS in nachhaltigem Bauen Neue fossil beheizte
Umbau des Energiesystems in Basel
 Umbau des Energiesystems in Basel Ausbau Angebot erneuerbare Energie und Anpassung gesetzliche Rahmenbedingungen novatlantis Bauforum Basel, 21. Juni 2017 Aeneas Wanner Gute Ausgangslage: Energiepolitik
Umbau des Energiesystems in Basel Ausbau Angebot erneuerbare Energie und Anpassung gesetzliche Rahmenbedingungen novatlantis Bauforum Basel, 21. Juni 2017 Aeneas Wanner Gute Ausgangslage: Energiepolitik
Klimaschutzkonzept Memmingen Klimaschutzkonzept Memmingen CO2-Bilanz, Potentiale
 Klimaschutzkonzept Memmingen CO2-Bilanz, Potentiale 12.06.2012 Dr. Hans-Jörg Barth Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1 Agenda TOP 1 TOP 2 TOP 3 Zusammenfassung CO2-Bilanz Ergebnisse Potenziale Bürgerbefragung
Klimaschutzkonzept Memmingen CO2-Bilanz, Potentiale 12.06.2012 Dr. Hans-Jörg Barth Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1 Agenda TOP 1 TOP 2 TOP 3 Zusammenfassung CO2-Bilanz Ergebnisse Potenziale Bürgerbefragung
MuKEn 2014 und LRV Bedeutung für Heizölbranche? Beat Gasser Leiter Wärmetechnik
 MuKEn 2014 und LRV Bedeutung für Heizölbranche? Beat Gasser Leiter Wärmetechnik Worum geht es? Schweizer Kesselmarkt 2004-2013 Alle Heizungen im Vergleich 40'000 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000
MuKEn 2014 und LRV Bedeutung für Heizölbranche? Beat Gasser Leiter Wärmetechnik Worum geht es? Schweizer Kesselmarkt 2004-2013 Alle Heizungen im Vergleich 40'000 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000
Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien. Einwohnerzahl: Anzahl Erwerbstätige: 1.221
 Gemeinde Emmering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 1.094 ha Einwohnerzahl: 6.318 Anzahl Erwerbstätige: 1.221 Besiedelungsdichte:
Gemeinde Emmering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 1.094 ha Einwohnerzahl: 6.318 Anzahl Erwerbstätige: 1.221 Besiedelungsdichte:
Nahwärmekonzept 4.0. Bisher ungenutzte Niedertemperatur- Abwärme aus Industrie und Gewerbe. 28/06/17 ratioplan GmbH 1
 Nahwärmekonzept 4.0 Bisher ungenutzte Niedertemperatur- Abwärme aus Industrie und Gewerbe 28/06/17 ratioplan GmbH 1 Inhalt ratioplan GmbH Nutzung von Abwärme zur Nahwärmeversorgung Potenzial von Niedertemperaturabwärme
Nahwärmekonzept 4.0 Bisher ungenutzte Niedertemperatur- Abwärme aus Industrie und Gewerbe 28/06/17 ratioplan GmbH 1 Inhalt ratioplan GmbH Nutzung von Abwärme zur Nahwärmeversorgung Potenzial von Niedertemperaturabwärme
Gemeinde Kottgeisering
 Gemeinde Kottgeisering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 821 ha Einwohnerzahl: 1.593 Anzahl Erwerbstätige: 49 Besiedelungsdichte:
Gemeinde Kottgeisering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 821 ha Einwohnerzahl: 1.593 Anzahl Erwerbstätige: 49 Besiedelungsdichte:
Verordnung zum Energiereglement (Energieverordnung) Vom 27. Juni (Stand 1. April )
 Einwohnergemeinde Cham 650. Verordnung zum Energiereglement (Energieverordnung) Vom 27. Juni 2005 (Stand. April 208 ) Der Gemeinderat beschliesst gestützt auf des Reglements zur Förderung umweltverträglicher
Einwohnergemeinde Cham 650. Verordnung zum Energiereglement (Energieverordnung) Vom 27. Juni 2005 (Stand. April 208 ) Der Gemeinderat beschliesst gestützt auf des Reglements zur Förderung umweltverträglicher
Infoveranstaltung März Förderprogramme der Gemeinde Lohn-Ammannsegg
 Infoveranstaltung - 25. März 2019 Förderprogramme der Gemeinde Lohn-Ammannsegg Die Energieregion Bern - Solothurn Seit Gründung im 2011: Energieeffizienz verbessern Fördern von erneuerbaren Energien Lokale
Infoveranstaltung - 25. März 2019 Förderprogramme der Gemeinde Lohn-Ammannsegg Die Energieregion Bern - Solothurn Seit Gründung im 2011: Energieeffizienz verbessern Fördern von erneuerbaren Energien Lokale
Überkommunaler Richtplan Energie Agglomeration Biel Gemeinden Biel/Bienne, Brügg, Ipsach, Nidau, Port. Medienkonferenz, 3.
 Überkommunaler Richtplan Energie Agglomeration Biel Gemeinden Biel/Bienne, Brügg, Ipsach, Nidau, Port Medienkonferenz, 3. Februar 2015 Überkommunaler Richtplan Energie Agglomeration Biel Gemeinden Biel/Bienne,
Überkommunaler Richtplan Energie Agglomeration Biel Gemeinden Biel/Bienne, Brügg, Ipsach, Nidau, Port Medienkonferenz, 3. Februar 2015 Überkommunaler Richtplan Energie Agglomeration Biel Gemeinden Biel/Bienne,
Neuerungen Förderprogramm Kanton Luzern ab Energie Apéro Luzern Mo, 13. Januar 2014, HSLU Wirtschaft Cyrill Studer Korevaar, uwe
 Neuerungen Förderprogramm Kanton Luzern ab 1.1.2014 Energie Apéro Luzern Mo, 13. Januar 2014, HSLU Wirtschaft Cyrill Studer Korevaar, uwe Übersicht Förderprogramme ab 1.1.14 Photovoltaik** Solarwärme Fensterersatz*
Neuerungen Förderprogramm Kanton Luzern ab 1.1.2014 Energie Apéro Luzern Mo, 13. Januar 2014, HSLU Wirtschaft Cyrill Studer Korevaar, uwe Übersicht Förderprogramme ab 1.1.14 Photovoltaik** Solarwärme Fensterersatz*
ERFA Vorgehensberatung Juni 2015 Silvia Gemperle Leiterin Energie und Bauen
 ERFA Vorgehensberatung 2015 22. Juni 2015 Silvia Gemperle Leiterin Energie und Bauen Neuerungen in der Energieförderung Erneuerbare Energien Stromeffizienz Bildung Planung und Qualitätssicherung Seite
ERFA Vorgehensberatung 2015 22. Juni 2015 Silvia Gemperle Leiterin Energie und Bauen Neuerungen in der Energieförderung Erneuerbare Energien Stromeffizienz Bildung Planung und Qualitätssicherung Seite
Energiekonzept des Kantons St. Gallen
 Energiekonzept des Kantons St. Gallen 2000 W Energieeffizienz im Gebäudebereich steigern Erneuerbare Energiequellen vermehrt nutzen 1 Energiepolitik im Kanton St.Gallen weil die Ressource Energie eine
Energiekonzept des Kantons St. Gallen 2000 W Energieeffizienz im Gebäudebereich steigern Erneuerbare Energiequellen vermehrt nutzen 1 Energiepolitik im Kanton St.Gallen weil die Ressource Energie eine
Wärmeverbundlösungen mit erneuerbaren Energien
 Energie Apéro Nr. 10 27. März 2014 Wärmeverbundlösungen mit erneuerbaren Energien Bruno Liesch, Geschäftsleiter Wärmeverbund Marzili Bern AG Wärmeverbund Marzili Bern AG Gründung 1996 und 1997 1999 Bau
Energie Apéro Nr. 10 27. März 2014 Wärmeverbundlösungen mit erneuerbaren Energien Bruno Liesch, Geschäftsleiter Wärmeverbund Marzili Bern AG Wärmeverbund Marzili Bern AG Gründung 1996 und 1997 1999 Bau
Das Gebäudeprogramm des Kantons Basel-Landschaft. Dr. Alberto Isenburg Leiter Amt für Umweltschutz und Energie
 Das Gebäudeprogramm des Kantons Basel-Landschaft Dr. Alberto Isenburg Leiter Amt für Umweltschutz und Energie Gliederung der Präsentation 1. 2. 3. Ziele Fordern Fördern Bund Kantone Kanton BL Kanton BL
Das Gebäudeprogramm des Kantons Basel-Landschaft Dr. Alberto Isenburg Leiter Amt für Umweltschutz und Energie Gliederung der Präsentation 1. 2. 3. Ziele Fordern Fördern Bund Kantone Kanton BL Kanton BL
Potenziale der Energieversorgung. Balz Halter, VRP 6. März 2017
 Potenziale der Energieversorgung Balz Halter, VRP 6. März 2017 Wir identifizieren Entwicklungspotenziale von Arealen, Grundstücken, Bauprojekten, Liegenschaften und setzen sie um. Kosten Die grössten Potenziale
Potenziale der Energieversorgung Balz Halter, VRP 6. März 2017 Wir identifizieren Entwicklungspotenziale von Arealen, Grundstücken, Bauprojekten, Liegenschaften und setzen sie um. Kosten Die grössten Potenziale
