Frank Janning Katrin Toens (Hrsg.) Die Zukunft der Policy-Forschung
|
|
|
- Eugen Junge
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Frank Janning Katrin Toens (Hrsg.) Die Zukunft der Policy-Forschung
2 Frank Janning Katrin Toens (Hrsg.) Die Zukunft der Policy-Forschung Theorien, Methoden, Anwendungen
3 Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über < abrufbar.. 1. Auflage 2008 Alle Rechte vorbehalten VS Verlag für Sozialwissenschaften GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008 Lektorat: Frank Schindler Der VS Verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Druck und buchbinderische Verarbeitung: Krips b.v., Meppel Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in the Netherlands ISBN
4 Inhaltsverzeichnis Frank Janning und Katrin Toens Einleitung... 7 Teil I: Theorieentwicklung und Forschungsperspektiven Michael Th. Greven "Politik" als Problemlösung - und als vernachlässigte Problemursache. Anmerkungen zur Policy-Forschung Thomas Saretzki Policy-Analyse, Demokratie und Deliberation: Theorieentwicklung und Forschungsperspektiven der "Policy Sciences of Democracy" Volker Schneider Komplexität, politische Steuerung, und evidenz-basiertes Policy-Making Katrin Toens und Claudia Landwehr Imitation, Bayesianisches Updating und Deliberation: Strategien und Prozesse des Politiklernens im Vergleich Friedbert Rüb Policy-Analyse unter Bedingungen von Kontingenz. Konzeptuelle Überlegungen zu einer möglichen Neuorientierung Frank Janning Regime in der regulativen Politik. Chancen und Probleme eines Theorietransfers Diana Panke und Tanja Börzel Policy-Forschung und Europäisierung Reimut Zohlnhöfer Stand und Perspektiven der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung
5 6 Inhaltsverzeichnis Nicolai Dose Wiederbelebung der Policy-Forschung durch konzeptuelle Erneuerung Teil II: Methodenfragen und Anwendungsaspekte Sylvia Kritzinger und Irina Michalowitz Methodologische Triangulation in der europäischen Policy-Forschung Maarten Hajer Diskursanalyse in der Praxis: Koalitionen, Praktiken und Bedeutung Achim Lang und Philip Leifeld Die Netzwerkanalyse in der Policy-Forschung: Eine theoretische und methodische Bestandsaufnahme Claudius Wagemann Qualitative Comparative Analysis und Policy-Forschung Christine Trampusch Sequenzorientierte Policy-Analyse. Warum die Rentenreform von Walter Riester nicht an Reformblockaden scheiterte Nicole Deitelhoff und Anna Geis Sicherheits- und Verteidigungspolitik als Gegenstand der Policyund Governance-Forschung Silke Bothfeld Politiklernen in der Elternzeitreform: Ein Beispiel für deliberatives Politikhandeln Frank Bönker Interdependenzen zwischen Politikfeldern die vernachlässigte sektorale Dimension der Politikverflechtung Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
6 Einleitung Frank Janning und Katrin Toens Die Policy-Forschung hat sich als theoriegeleitete Politikfeldanalyse und vergleichende Staatstätigkeitsforschung bedeutend weiter entwickelt und ein eigenständiges Set an Methoden und Forschungsansätzen etabliert (Janning 2006; Schneider/Janning 2006). Die Etablierung der Policy-Forschung als Subdisziplin der Politikwissenschaft in Deutschland mutet aus heutiger Sicht dabei fast etwas überraschend an. Selbst in den USA dem Heimatland der Policy-Forschung ist das Verhältnis zwischen Policy Analysis und Politikwissenschaft merkwürdig ambivalent geblieben. Der Wegbereiter der modernen Policy- Forschung Harold Lasswell war in gewissem Sinne ein paternalistischer Reformer, der an die Rationalisierbarkeit von politischen Entscheidungen glaubte und dem Staat eine hervorragende Rolle bei der Demokratisierung der modernen Gesellschaft zusprach, andererseits wollte er die Geltungsansprüche der Policy-Forschung, die den Staat zu mehr politischer Rationalität befähigen sollte, selbst demokratisieren und sprach sich für einen interdisziplinären und diskursiven Ansatz in der Policy-Forschung aus (Prätorius 2004; Torgerson 1985). Hier wird der Spagat zwischen einer Fachwissenschaft der empirischen Staats- und Institutionenanalyse und einer auf die Beratung der Entscheidungspraxis konzentrierten politiknahen Beratungstätigkeit angelegt. Entsprechend entwickelten sich in den USA zwei parallele Stränge mit nur wenigen Berührungspunkten: einerseits der anwendungsorientierte technokratische Zweig der Policy-Analyse mit den berühmten Budget- und Programmanalysen (PPBS) basierend auf komplizierten Kosten-Nutzen-Kalkulationen (Lyden/Miller 1967), andererseits ein genuin politikwissenschaftlicher Strang (Dror 1968; Dye 1972; Lindblom 1968). Der praxisorientierte, technokratische Zweig versorgt bis heute die Verwaltungsakteure und politischen Entscheidungsträger mit zielgerichteten Modellanalysen und Berechnungen, die wissenschaftliche Policy-Forschung verfügt nur über den begrenzten Wirkungskreis des akademischen Feldes und hat sich aber von den Handlungsperspektiven der politischen Akteure emanzipiert. Erst in jüngster Zeit finden diese beiden Stränge wieder stärker zusammen und zwar in den Ansätzen der sog. partizipativen Policy- Forschung, in denen wissenschaftliche Analysen mit einem breit verstandenen Aufklärungs- und Beratungsanspruch verknüpft werden (Fischer 2003; Saretzki in diesem Band). In Deutschland wurde die Policy-Forschung nach 1968 von Politikwissenschaftlern eher skeptisch beäugt, den älteren Fachvertretern erschien sie zu wenig normativ und zu behavioristisch, den jüngeren, marxistisch orientierten Politikwissenschaftlern war sie zu wenig herrschaftskritisch und viel zu stark durch eine dienende, zuarbeitende Rolle in der Politikberatung geprägt (rückblickend: Fach 1982; Greven 1985; Hennis 1985). Verdanken sich diese Einschätzungen auch diverser Missverständnisse und Unkundigkeiten, so haben sie dazu geführt, dass die Policy-Forschung erst einmal in den frühen 70er Jahren nicht von dem Mainstream des Faches rezipiert, sondern statt dessen hauptsächlich von einer Gruppe sozialwissenschaftlicher Planungsforscher adaptiert wurde (Böhret 1970; Lompe 1971; Mayntz/Scharpf 1973; Scharpf 1973). Der Einsatz der Policy-Analyse als Instrument in umfassenden Planungs- und administrativen Reformkonzepten währte bekanntlich nicht lange. Bereits Mitte der 70er Jahre ebbte mit der Ölkrise und den internen Problemen innerhalb der sozialliberalen Koalition die Reformeuphorie ab, was auch den Planungsopti-
7 8 Frank Janning und Katrin Toens mismus abschwächte (Bleek 2001: 383). In einzelnen Politikfeldern wurden aber auch konkrete Erfahrungen mit Umsetzungsproblemen und Blockadehaltungen bei den Reformen gemacht. Als neuer wissenschaftlicher Forschungsgegenstand wurde nun von Politikern und Wissenschaftlern der Implementationsprozess erkannt. Schon in den USA der 60er Jahre hatten sich Policy-Forscher dezidiert mit der Umsetzung insbesondere der teuren und aufwändigen Welfare Programs der Johnson-Administration beschäftigt bzw. als Policy-Experten die Umsetzung dieser Programme begleitet (Moynihan 1969). In Deutschland wird nun allgemeiner und weniger politikfeldspezifisch die Implementation als Durchführungs- und Anwendungsprozess von Gesetzen oder anderen politischen Handlungsprogrammen analysiert (Mayntz 1977; Mayntz 1980; Windhoff-Héretier 1980). Die Beschäftigung mit Implementationsstrukturen und prozessen verändert tendenziell aber auch die vormalige Staatsfixiertheit beim Einsatz der Policy-Forschung, kommen doch nun die Blockaden und Abhängigkeiten für das staatliche Handeln in den Blick. Denn ein nur durch administrative bzw. staatliche Interaktionspartner bestimmtes Vollzugssystem im Kontext einer spezifischen Problemmaterie erscheint höchstens als ein untypischer Ausnahmefall. Viel wahrscheinlicher ist die Beteiligung von gesellschaftlichen Organisationen am Implementationsprozess. Dieser Umstand leitet für die Policy-Forschung eine Umorientierung der Untersuchungsfragen an, z.b. anstatt der Frage nach dem weisungsgetreuen Verhalten nachgeordneter Behörden die Frage, wie eine Mehrzahl nicht durch formale oder gar hierarchische Beziehungen verknüpfter Organisationen zur notwendigen aufgabenbezogenen Kooperation zusammenfindet (Mayntz 1980: 10). Insofern dokumentiert die Umorientierung der Forschungsfragen für die Policy-Analyse von der Planungstheorie zur Implementationsforschung eine bedeutsame Veränderung der Analyseperspektive: Gingen vorher in dem planerischen Politikmodell - die relevanten Reformanstöße von einer zentralistisch organisierten, planenden Staatsverwaltung aus, die freilich unter dem Primat der politischen Leitung steht, und konnte der politische Prozess somit nur aus einer Top-Down- Perspektive erfasst werden, so lässt die Implementationsforschung alle Hoffnungen auf einen hierarchischen Politikstil fahren und situiert den Staat als einen an der Implementation bloß mitbeteiligten Akteur, dessen Zentralposition und steuernde Rolle im Programmvollzug erst empirisch aufzuweisen ist. In gewissem Sinne wird damit bereits eine Forschungsperspektive für die Policy- Forschung markiert, die erst in den späteren Debatten über Politische Steuerung und Governance der frühen 90er Jahre in ihren Konsequenzen bedacht wurde: Die Policy- Forschung hat nämlich im Anschluss an die Implementationsforschung mit zahlreichen Fallstudien zu politischen Entscheidungsprozessen und dem Gelingen und Versagen von staatlichen Steuerungsversuchen über unterschiedliche Probleme der regulativen Politik zu dem Aufkommen der Governance-Debatte maßgeblich beigetragen. Detaillierte Fallanalysen zeigen beispielsweise, dass sich umweltbewusstes Handeln von Unternehmen und Bürgern nicht einfach durch Gesetz verordnen lässt. Eine wirkungsvolle oder gar nachhaltige Umweltpolitik muss stattdessen mit Steuervergünstigungen und Investitionsanreizen operieren, um Unternehmen zu einem entsprechenden Umbau ihrer Produktionsanlagen zu bewegen (Decker 1994; Jänicke 1986). Andererseits ist es notwendig dass sich ökologisch sinnvolles Verhalten auch in der Alltagspraxis von Konsumenten durchsetzt, was nur durch Aufklärungskampagnen und umweltbewusste Erziehung erreicht werden kann. In den Politikfeldern der Privatisierung ehemaliger staatlicher Infrastrukturmonopole (Radio/Fernsehen, Post, Telekommunikation, Energie) lässt sich eine ähnliche Entwicklung aus umge-
8 Einleitung 9 kehrter Richtung prognostizieren: zwar wird die Privatisierung von staatlicher Seite mit marktwirtschaftlicher Propaganda begleitet, die höchstens teilprivatisierten Policy-Sektoren werden aber weiterhin von staatlichen Kontroll- und Regulierungsbehörden überwacht, wobei sowohl ein zu großer Preiswettbewerb als auch die Monopolbildung durch Konzerne in den Infrastrukturbereichen verhindert werden soll (Böllhoff 2005; Müller 2002; Schneider 1999). Fallstudien zu diesen und ähnlichen Problemen weisen auf Einschränkungen der staatlichen Handlungsfähigkeit durch Eigenheiten und Struktureigenschaften des jeweiligen Politikfeldes hin (z.b. die Blockadehaltung von mobilisierungsmächtigen zentralistischen Verbänden, die Adressierung der öffentlichen Meinung durch Bürgerinitiativen und neue soziale Bewegungen). Die wissenschaftliche Diskussion über die Voraussetzungen und Kontexte von politischer Steuerung hat aber auch Erkenntnisse darüber hervorgebracht, wie sich staatliche Politik in den unübersichtlichen Interessenkonstellationen von Politikfeldern Geltung verschaffen kann. Policy-Forscher verweisen auf Steuerungserfolge durch selektive Einbindung relevanter Policy-Akteure, wobei hier die Organisations- und Mobilisierungsmacht dieser Akteure instrumentalisiert wird, oder durch Installierung von Verhandlungsrunden, die auch schwach organisationsfähigen Interessen Zugang gewähren und so die Nutzung der relevanten, im Politikfeld verteilten Wissensressourcen und die Zusammenarbeit mit offiziellen und nicht-offiziellen Policy-Experten gewährleisten (Grande 1993; Mayntz 1993; Scharpf 1993). Politische Steuerung erscheint aus dieser Perspektive nicht mehr als Einbahnstraße ausschließlich politischer Machtdurchsetzung, sondern als ein komplexes Arrangement von wechselseitigen Kooperationsangeboten und möglichst inklusiven Verhandlungslösungen unter Berücksichtigung der Selbststeuerungskompetenzen nicht-staatlicher Akteure (Kooiman 2003). Statt von politischer Steuerung wird deshalb vermehrt von Governance in der Politikwissenschaft gesprochen. Der Governance-Begriff rekurriert darauf, dass sich die konventionellen Steuerungsprinzipien wie Staat und Markt nicht mehr einfach in den komplexen Wirkungszusammenhängen (spät)moderner Gesellschaften zur Anwendung bringen lassen bzw. dass Typologien von Steuerungs- und Koordinationsmechanismen, die noch an den konventionellen Top-Down und Bottom-Up Perspektiven ansetzen, wenig erkenntnisträchtig erscheinen (Benz 2004; Schneider/Kenis 1996). Das Governance-Konzept privilegiert deshalb kein idealtypisches Steuerungsprinzip, sondern geht von der Ergänzung, Vermischung und Integration unterschiedlicher Steuerungs- und Koordinationsmechanismen in der sozialen und politischen Wirklichkeit aus. Die Auseinandersetzung mit der heutigen Gestalt staatlichen Handelns und politischer Steuerung bzw. Governance rückt allerdings Politikfelder als genuinen Forschungsgegenstand der Policy-Forschung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (Janning 1998; Schneider/Janning 2006): Politikfelder sind das Ergebnis von staatlichen Bemühungen um Problemlösungen in einer ausdifferenzierten Gesellschaft. Problemmaterien, politische Entscheidungen und die Interessen und Aktivitäten von problemrelevanten Akteuren (mit und ohne formalem politischen Gestaltungs- bzw. Vertretungsauftrag) gruppieren sich zu Policy-Konfigurationen mit eigenen Regeln, Ressourcenströmen und Struktureigenschaften, die sich häufig klar von anderen Politikfeldern unterscheiden lassen. Nichtsdestotrotz existieren Unschärfen bei der Zuordnung von Problemthemen (issues) auf einzelne Politikfelder (z.b. die sog. Riester-Rente als Thema für die Renten- und Sozialpolitik sowie für die Verbraucherschutzpolitik), und häufig entbrennt ein Kampf zwischen Ministerien oder zwischen anderen relevanten Akteuren unterschiedlicher Politikfelder um die Zuständigkeit und Deutungshoheit bei überlappenden Problemstellungen. Die Politikfeldanalyse versucht diese
9 10 Frank Janning und Katrin Toens ausdifferenzierten Problem- und Akteurkonstellationen mit eingespielten Verfahrensabläufen und Verhaltensregeln zu untersuchen und deren Funktionalität, Stabilität oder Veränderbarkeit und demokratische Rationalität zu beschreiben. Die Politikfeldanalyse setzt hierfür zunehmend auf Struktur- und Gesamtbeschreibungen, um einzelne Programmdebatten und Entscheidungen einem Grundmuster des Politikfeldes zurechnen und Struktureigenschaften, die sich in einzelnen Interaktionen abbilden, herausarbeiten zu können. Für die Fortentwicklung der Politikfeldanalyse haben vier Forschungsansätze eine große Rolle gespielt: der akteurzentrierte Institutionalismus, die Politiknetzwerkanalyse, der Advocacy Koalitionen-Ansatz und die Analyse von Policy-Diskursen (Schneider/Janning 2006). Diese Ansätze teilen die Einschätzung, dass für die wissenschaftliche Analyse tendenziell von Phasen- und Zyklus-Modellen, die stark an einem formalen Ablauf von politischen Entscheidungsprozessen innerhalb der gewaltenteilig organisierten politischen Institutionen und Entscheidungsgremien angelehnt bleiben, abstrahiert werden muss. Insofern erhebt sich auch Kritik an der Implementationsforschung und der Vorstellung, Betroffene und Adressaten von policies werden erst in der Umsetzungsphase am politischen Prozess beteiligt (Sabatier 1993). Auch für diese Analysen bleiben konkrete issues ein wichtiger Bezugspunkt, ihr Hauptaugenmerk gilt aber dem Versuch, Politiknetzwerke, Verhandlungskonstellationen, Programmkoalitionen bzw. Diskurskoalitionen zu identifizieren, die darüber entscheiden, wie und ob überhaupt ein gesellschaftliches Problem zu einem issue in einem Politikfeld wird. Neben den komplexen Ansätzen in der Politikfeldanalyse hat sich in Deutschland in den 70er und 80er Jahren ein besonderer Strang der vergleichenden Policy-Forschung herausgebildet: die vergleichende Staatstätigkeitsforschung. Die Staatstätigkeitsforschung fragt ebenfalls nach der Wirkungsmacht genuin politischer Faktoren die Rolle von Regierungsparteien, die Besonderheiten des politischen Institutionensystems, die selektive Heranziehung und Bevorzugung von Interessenverbänden durch politische Akteure auf die Politikergebnisse (policies) (Zohlnhöfer in diesem Band). Diese Faktoren werden im Rahmen der Beantwortung der allgemeineren Frage, welche Makrovariablen bestimmte öffentliche Politiken (die selbst mit diversen Aggregatdaten wie Staatsausgaben, Transferzahlungen, Privatisierungserlöse, etc. gemessen werden) beeinflussen, analysiert. Von den verschiedenen theoretischen Strömungen, die sich seit den 70er Jahren entwickeln, fallen die Antworten jedoch ganz unterschiedlich aus. In einer häufig zitierten Übersicht des theoretischen Terrains unterscheidet Manfred G. Schmidt (1993) vier Strömungen, die den Fokus auf recht unterschiedliche Determinanten legen: Die Theorie der sozioökonomischen Determination, die Parteienherrschaftstheorie, die Theorie der Machtressourcen organisierter Interessen und die politisch-institutionalistische Theorie. In den letzten Jahren ist diese Liste um zwei weitere Posten erweitert worden: Ansätze, die einerseits historische Nachwirkungen auf politische Entscheidungen und andererseits neue Zwänge, die sich aus internationalen Entwicklungen (wie z.b. Globalisierung und Europäisierung) ergeben (Schmidt 2000). In der Theorienentwicklung der Staatstätigkeitsforschung lässt sich durchaus ein Muster erkennen, in dem die einzelnen Ansätze bzw. die hervorgehobenen Determinanten abwechselnd dominierten (Schneider/Janning 2006: 84). In der ersten Phase (1960er-Jahre) wurden innerpolitische Erklärungsfaktoren stark in Zweifel gezogen und Determinanten aus der Umwelt des politischen Systems als eigentlich relevante Wirkungsgrößen betrachtet (Dye 1966). In der zweiten Phase (1970er-Jahre) wurde diese Perspektive wieder umgekehrt und ein großes Augenmerk auf innerpolitische Erklärungsvariablen gelegt. Besondere
10 Einleitung 11 Prominenz erreichte dabei die Frage nach den Auswirkungen von partei- und interessenpolitischen Spannungslinien und Strukturen in einzelnen Politikfeldern (Schmidt 1982). In der dritten Phase (1980er-Jahre) wird der Fokus auf die inneradministrativen, binnenpolitischen Faktoren noch weiter ausdifferenziert. Stärker als auf Parteipolitik wird nun auf die Wirkung von institutionellen Zuständigkeiten und Kompetenzüberschneidungen, von politischen Steuerungsmitteln und von besonderen Verteilungs- und Ausstattungsinteressen politikrelevanter Akteure rekurriert. Die institutionellen und innerpolitischen Faktoren stellen nunmehr intervenierende Variablen dar, die zwischen sozialen oder wirtschaftspolitischen Besonderheiten und den Policy-Outcomes in einzelnen Politikfeldern vermitteln. In der vierten Phase (seit den 1990er-Jahren) wird der analytische Fokus insofern noch erweitert, als historische und internationale Determinanten bei der Erklärung von Politiken einbezogen werden. Historische Determinanten sind z.b. ähnliche politische Erfahrungen, die Ländergruppen auf ihrem politischen Entwicklungspfad gemacht haben oder die Herausbildung ähnlicher Kontexte, die dann prägend für spätere politische Entscheidungen und Problemlösungen werden. Internationale Determinanten sind Zwänge und Restriktionen, die sich aus der zunehmenden internationalen wirtschaftlichen und politischen Verflechtung ergeben. Neue Herausforderungen für die Zukunft der Policy-Forschung Wenngleich Politikfeldanalyse und vergleichende Staatstätigkeitsforschung auf viele fruchtbare Forschungsergebnisse und bahnbrechende Studien zurückblicken können und sich als empirische Zugpferde bestens in den politikwissenschaftlichen Mainstream integriert haben, stehen beide Forschungsstränge doch vor großen Herausforderungen, die auch auf Defizite der bisherigen Forschung hinweisen: Es gibt berechtigte Zweifel, ob das bestehende Theoriearsenal der Politikfeldanalyse wie der Staatstätigkeitsforschung auf die überbordende Komplexität resultierend aus Politikfeldinterdependenzen und/oder Mehrebenenverflechtungen bereits angemessen reagieren kann. Die Einforderung einer noch komplexeren und fallbezogenen Konzeptbildung riskiert aber die Aufgabe einer typisierenden und vergleichenden Betrachtungsweise. Die stark typisierende Perspektive kann allerdings häufig das spezifisch Neue eines Problems oder Phänomens in einem Politikfeld nicht mehr erkennen. Die vergleichende Staatstätigkeitsforschung hat wegweisende Erkenntnisse über nationale Sonderwege und parallele Entwicklungen in einzelnen Politikfeldern geliefert. In aufwendigen Vergleichen wurden spezifische Erklärungsfaktoren für die Varianz bzw. Ähnlichkeit (inter)nationaler Entwicklungen herausgearbeitet. Weniger Berücksichtigung findet bisher aber der Tatbestand einer transnationalen Vernetzung, die durch internationale Regime, Bündnisse und politische Mehrebenensysteme (EU) hervorgerufen wird und insbesondere Politikfelder der regulativen Politik (Umweltpolitik, Verbraucherschutz) betrifft. Die Forschungen zu Angleichungsprozessen (Policy- Konvergenz und Transfer) und Politikfeld-Interdependenzen (z.b. zwischen Bildungs-, Sozial und Wirtschaftspolitik) befinden sich noch am Anfang und weisen konzeptuelle und methodische Schwächen auf.
11 12 Frank Janning und Katrin Toens In der Politikfeldanalyse stehen sich quantitative und qualitative Forschungsansätze sowie erklärende und verstehende Wissenschaftskonzeptionen diametral gegenüber. Quantitative Netzwerkforscher und die Betrachter von Policy-Narrativen oder Policy- Diskursen sind sich der Beschränkung ihrer jeweiligen Forschungsrichtung bewusst. Dennoch wird nur selten ein Methoden-Mix in Fallstudien praktiziert, um die blind spots eines rein quantitativen oder rein qualitativen Vorgehens auszubessern. Die avancierten Forschungsansätze in der Politikfeldanalyse sind stark an statischen Strukturbeschreibungen orientiert und gehen kaum auf die Entstehung und Verarbeitung von Programminnovationen sowie auf die vorhandenen Lernkapazitäten bzw. Lernblockaden von Policy-Akteuren ein. Der Anstoß für grundlegende Veränderungen in Politikfeldern wird demgemäß häufig auf exogene Faktoren (Regierungswechsel, soziale und ökonomische Krisen) projiziert. Policy-Wandel muss allerdings als ein Prozess verstanden werden, auf den die Eigenschaften der betroffenen Politikfelder einwirken und in den die relevanten Akteure und Koalitionen eingreifen können. Die Akteure agieren dabei allerdings vor dem Hintergrund von zunehmend komplexen Problemmaterien und eines stetig wachsenden Zeitdrucks, hervorgerufen von den sich immer weiter ausdehnenden politischen Entscheidungsverantwortungen und von der kaum noch zu bewältigenden Masse an relevanten Informationen. Im Gegensatz zu den USA hat die Policy-Forschung in Deutschland nur einen relativ geringen Stellenwert in der wissenschaftlichen Politikberatung erringen können. Dafür ist sie als Subdisziplin der Politikwissenschaft hervorragend etabliert. Woran orientieren sich aber die wissenschaftlichen Ziele der Policy-Forschung, wenn sie über eine bloße Wissensmehrung hinausgelangen soll? Inwieweit sind mit dem heutigen Stand der Forschung noch normative Leitorientierungen einer Machtkritik oder einer Selbstaufklärung der Demokratie in Verbindung zu bringen? Mutet andererseits die Politikabstinenz der Policy-Forschung nicht verantwortungslos an angesichts der Tatsache, dass politische Entscheider und ihre Berater immer wieder Policy-Lösungen als Option diskutieren und heranziehen, die von Politikfeldanalyse und Implementationsforschung als praktisch folgenlos oder in ihrer Wirkung als höchst kontextabhängig eingestuft wurden? Als das Programm für den jüngsten Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) Staat und Gesellschaft fähig zur Reform? diskutiert wurde, entstand bei den Herausgebern schnell die Idee, dort die Reformperspektiven der Policy-Forschung und die Potentiale und Grenzen ihrer wissenschaftlichen Analysebeiträge grundlegend zu diskutieren und dabei die oben gekennzeichneten Herausforderungen zu thematisieren. 1 1 Die Herausgeber danken Jörg Bogumil und Frank Nullmeier als Sprecher der DVPW-Sektion Staatslehre und Politische Verwaltung für die Bereitschaft, unsere Ad hoc-gruppe Die Zukunft der Policy-Forschung institutionell anzudocken. Darüber hinaus geht ein großer Dank an David Born für die professionelle Gestaltung des Typoskripts und an Linda Grüber für Korrekturarbeiten.
12 Einleitung 13 Überblick über die Beiträge Die in diesem Buch versammelten Aufsätze sind deshalb zu einem großen Teil aus einer Veranstaltung der Ad-hoc-Gruppe "Die Zukunft der Policy-Forschung" hervorgegangen, die sich im September 2006 auf dem DVPW-Kongress in Münster erstmals konstituierte. Es handelt sich um ein relativ breites Spektrum an Beiträgen zu dem aktuellen Stand und den Zukunftsperspektiven der Policy-Forschung, die gleichsam aus einem konzeptionellen, methodischen und empirischen Blickwinkel reflektiert werden. Im ersten Teil des Buches zu den Theorieentwicklungen und Forschungsperspektiven werden konzeptionelle Zugänge zum Thema diskutiert. Michael Th. Greven erinnert einleitend an die frühe Rezeption der Policy-Analyse in der Bundesrepublik. Obwohl die Rede von Alltagspraktiken des Regierens, Politikfeldern und Policies" in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zunächst noch verunsicherte, fügte sie sich doch relativ reibungslos in den gesellschaftspolitischen Trend einer finanzpolitisch erzwungenen Konsolidierung einzelner Politikfelder ein. Die Forderung einer Professionalisierung der Disziplin durch die methodisch versierte Erforschung konkreter Politikabläufe passte zur technokratischgouvernementalen Problemlösungsperspektive in der Politik. Lässt sich diese Beobachtung als ein erster Umdeutungsprozess politikwissenschaftlicher Forschung beschreiben, wie er zumindest in Teilen der Disziplin vorgenommen wurde, so verweist Greven auf eine zweite Veränderung innerhalb der Policy-Analyse. Die frühe, etwa durch Harold D. Lasswell inspirierte, Policy-Forschung hatte sich anfänglich noch eine in Ansätzen herrschafts- und machtkritische Haltung gegenüber den Regierungspraktiken des politischen Alltagsgeschäfts bewahrt. Dass Politik Probleme nicht nur löst, sondern diese auch verstärken oder gar erzeugen kann, wurde jedoch im Zuge der 1980er und 1990er Jahre im Mainstream der Policy-Forschung zusehends verdrängt. Auch Thomas Saretzki befasst sich rückblickend mit der Entwicklung policyanalytischer Forschung im Ausgang von Lasswell. Dabei wird deutlich, dass sich die amerikanische Policy-Analyse im Spannungsverhältnis zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen von Demokratieförderung und Wissenschaftlichkeit ausdifferenziert hat. Die Unterteilung der Theorieentwicklung in drei Phasen veranschaulicht ein Hin- und Herpendeln wesentlicher policy-analytischer Entwicklungsstränge zwischen diesen beiden Polen. Weist das ursprüngliche Konzept der "policy sciences of democracy" dem selbstkritisch reflektierenden "policy scientist" eine intellektuell führende Rolle bei der Sicherung der Zukunft liberaler Demokratie zu, so setzen die Kritiker am positivistisch verkürzten und ökonomisch dominierten Hauptstrom der Policy-Analyse dem Konzept der "policy analysis for democracy" die Forderung nach der Demokratisierung der Policy-Analyse ("policy analysis by democracy") entgegen. Schließlich führt die Frage nach der Integration dieser Formen von Policy-Analyse in die etablierten Institutionen politischer Problemverarbeitung zum Konzept einer demokratisierten "Policy-Analyse in der Demokratie", was Saretzki zufolge Anlass gibt zu der stärkeren Rückbesinnung auf ein kontextorientiertes, (selbst-) kritisches Verständnis von Policy Sciences, dessen Elemente bereits bei Lasswell vorfindbar sind. Volker Schneider beginnt seinen Beitrag mit der Beschreibung einer Paradoxie. Obwohl die Policy-Forschung dauernd neue Erkenntnisse produziert, werden diese von der Politik kaum nachgefragt. Das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit der Policy-Forschung wird auf drei mögliche Ursachen hin diskutiert, und zwar erstens die
13 14 Frank Janning und Katrin Toens Überkomplexität von Gesellschaften, zweitens die Restriktionen interessen- und machtbasierter Politik, und drittens die Empirieferne und methodische Unterentwicklung der Sozialund Politikwissenschaft. Das Ergebnis lautet, dass die Gründe für die mangelnde Nachfrage policy-analytischer Forschung woanders liegen, nämlich erstens in den geringen Zeitfenstern für empirisch fundiertes und quasi-experimentelles politisches Entscheiden, das im mediengerecht angeheizten demokratischen Wettbewerb auch noch künstlich unter Zeitund Leistungsdruck gesetzt werde, und zweitens dem gesellschaftlichen Misstrauen gegenüber wissenschaftlich generierten Lösungen, dem durch die zunehmende Kommerzialisierung der Wissenschaft Vorschub geleistet werde. Schließlich plädiert Schneider für die Entschleunigung und Entkommerzialisierung der Politik, um dann doch noch eine evidenzbasierte Policy-Forschung empfehlen zu können, mit der er einerseits am Anspruch der Überlegenheit wissenschaftlich generierten Wissens festhält, andererseits jedoch auch die Notwendigkeit des experimentellen Testens wissenschaftlich vorformulierter Lösungen betont. Claudia Landwehr und Katrin Toens befassen sich mit dem Stand und den Herausforderungen der aktuellen policy-analytischen Debatte zum Thema Politiklernen. Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die Feststellung einer Vernachlässigung der Frage nach den Prozessen und Strategien des Politiklernens in den bisherigen konzeptuellen Debatten. Die sich daraus ergebende Forschungslücke steht im Widerspruch zum wachsenden politikwissenschaftlichem Interesse an der Komplexität des Politiklernens, das zunehmend auch über die Grenzen einzelner Länder und Politikfelder hinweg (cross-national, cross-sectoral learning) untersucht wird. In neueren Policy-Analysen der IB- und Europaforschung bleibe daher häufig unklar, inwiefern Politikwandel als das Ergebnis von Lern- statt bloßen Anpassungsprozessen bezeichnet werden kann. Gegen das Missverhältnis von inflationärer Verwendung und konzeptueller Unterentwicklung des Lernbegriffs führen die Autorinnen den systematischen Vergleich der einschlägigen Lernstrategien Imitation, Bayesianisches Updating und Deliberation ins Feld. Im Rückgriff auf den normativen Lernbegriff des Verbesserungslernens werden diese Lernstrategien als mehr oder weniger voraussetzungsvolle Lernprozesse mit unterschiedlichen Potentialen und Risiken beschrieben. Friedbert Rüb rückt die Frage nach dem Zusammenhang von Kontingenz und politischem Entscheiden in den Vordergrund seiner Überlegungen. Hatte diese Verknüpfung im frühneuzeitlichen politischen Denken Machiavellis noch einen zentralen Platz eingenommen, so ist seine Vernachlässigung heutzutage häufig die Kehrseite des scientistischen Zugangs zur Politikanalyse. Ausgehend von der These, dass die Politik gegenwärtig von der zielorientierten Rationalität auf "zeitorientierte Reaktivität" umstellt, spürt der Autor der Radikalisierung gesellschaftlicher Kontingenzerfahrung in den fünf Dimensionen räumlich, kognitiv, interaktiv, institutionell und temporal nach. Auf diese zeitdiagnostischen Ausführungen folgt die Weiterentwicklung der kontingenzsensibilisierten Policy-Analyse von John Kingdon und Nikolaos Zahariadis. Zu Ende gedacht sind die Implikationen für die Policy-Analyse dann vielfach weit reichender als eingangs vermutet, denn diese müsste nicht nur gründlich von der technokratischen Problemlösungsperspektive auf die Politik Abschied nehmen, sondern ferner auch den Anspruch einer möglichst umfassenden Rekonstruktion kausaler Wirkungsmechanismen aufgeben. Frank Janning beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dem Ertrag und den möglichen Problemen eines Theorietransfers. In aktuellen Studien zur nationalen wie transnationalen regulativen Politik wird vermehrt auf das Regime-Konzept zurückgegriffen. Dieses Kon-
14 Einleitung 15 zept und die Erforschung internationaler Regime hatte in den 80er Jahren in der Analyse der internationalen Beziehungen eine große Popularität erlangt. Die Verwendung des Regime-Konzeptes in den neuen Analysekontexten regulativer Politikfelder verdeutlicht allerdings einen gewissen Perspektivenwechsel. Regime werden hier nicht nur als für Regimemitglieder verbindliche Regelsysteme verstanden, vielmehr verbindet sich mit diesem Leitkonzept eine neue Vorstellung von politischer Autorität in Politikfeldern. Diese Autorität wird von staatlicher Seite an Politikfeld-Akteure delegiert oder im Politikfeld selbst generiert. Die Beschäftigung mit regulativen Regimes zwingt deshalb zu einer Neubewertung der staatlichen regulativen Politik und deren Steuerungspotentiale. Diana Panke und Tanja Börzel untersuchen die Bedeutung aktueller Policy-Forschung für die Europäisierungsdebatte. Dass Policy-Variablen bisher in der Europäisierungsforschung nicht explizit berücksichtigt wurden, führt dazu, dass Varianzen und Erfolgsunterschiede europäischer Politik in den unterschiedlichen Politikfeldern, auf denen die EU gesetzgeberisch tätig ist, nicht hinreichend erklärt werden können. Ausgehend von der Beschreibung verschiedener Forschungsstränge innerhalb der Europäisierungsdebatte, die sowohl top-down wie auch bottom-up Mechanismen der Wechselwirkung zwischen EU und nationalstaatlicher Politik in den Blick nimmt, konzentrieren sich die Autorinnen auf die Untersuchung der Bedeutung von Policy-Variablen in der Analyse europäischer Rechtssetzung und mitgliedstaatlicher Implementation. Im Ergebnis zeigt sich, dass Policy- Faktoren vielfach eine Rolle spielen. Als intervenierende Variablen beeinflussen sie die Erfolgsbedingungen für den durch die EU ausgelösten innerstaatlichen Wandel und die Übertragung nationalstaatlicher Politik in das Sekundärrecht der EU, als abhängige Variablen differenzieren Policy-Faktoren politikfeldspezifische Ausmaße der Europäisierung. Reimut Zohlnhöfer gibt einen Überblick über Stand und Perspektiven der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung. Die vergleichende Staatstätigkeitsforschung wurde im Umfeld von Manfred G. Schmidt entwickelt und fokussiert auf die vergleichende Analyse der Regierungspolitik vornehmlich westlicher Länder. Unter der besonderen Berücksichtigung der Makrozusammenhänge des Regierens steht hier die Frage im Vordergrund, wie länderspezifische Unterschiede im jeweils betrachteten Politikfeld zustande kommen. Im Anschluss an die Darstellung theoretischer und methodischer Prämissen dieses Ansatzes charakterisiert Zohlnhöfer empirische Forschungsergebnisse sowie Defizite und zukünftige Lösungsperspektiven. Sein Beitrag macht deutlich, dass (a) die vergleichende Staatstätigkeitsforschung eine Vielzahl an unterschiedlichen Bestimmungsfaktoren des Regierens anhand der Kombination verschiedener Theorieansätze untersucht, und (b) die prinzipielle Offenheit gegenüber anschlussfähigen Theorien und Methoden ein Entwicklungspotential dieser Denkschule darstellt, das ihr bei noch ausstehenden Aufgaben und zu lösenden Problemen zum Vorteil gereichen kann. Nicolai Dose verweist mit seinem Beitrag auf eine spezifische Ambivalenz in der deutschen Policy-Forschung, die zwar einerseits den Anspruch der Problemlösung aus dem amerikanischen Pragmatismus übernimmt, andererseits jedoch praxisuntaugliche Lösungen formuliert. Er empfiehlt daher die eigene Praxis- und Beratungsrelevanz durch Komplexitätsreduzierung und ergebnisorientierte Politikempfehlungen zu befördern und zu optimieren. Da Politikentscheidungen zusehends unter Zeitdruck gefällt werden müssen, steht auch die Policy-Forschung unter dem Druck, binnen kürzester Zeit aussagekräftige Analysen zu liefern. Die Rückbesinnung auf "einfache" Modelle aus der amerikanischen Implementations- und Evaluationsforschung, die Steuerungskonzeptionen in Kausal-, Interventions-, und
15 16 Frank Janning und Katrin Toens Aktionshypothese zerlegt, soll hier weiterhelfen und der Politik griffige Anleitungen zur Problemlösung und Überwindung gesellschaftlicher Widerstände gegen Policies an die Hand geben. Mit Blick auf die meisten anderen Beiträge des Bandes, die gesellschaftliche Komplexität zum Anlass der konzeptuellen Fortentwicklung policy-analytischer Forschung nehmen, dürfte dieser Vorschlag allerdings zu einigen Diskussionen Anlass geben. Der zweite Teil des Buches thematisiert Methodenfragen und Anwendungsaspekte. Sylvia Kritzinger und Irina Michalowitz zeigen wie die Erforschung komplexer Politikzusammenhänge im Mehrebenesystem der EU von der Zusammenführung qualitativer und quantitativer Methoden profitieren kann. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen zur methodischen Triangulation bildet die Beobachtung, dass die europäische Policy-Forschung trotz vielfacher Lippenbekenntnisse zum Methodenmix immer noch unter der methodischen Engführung des Entweder-oder leidet. Dabei zeigen die Autorinnen, dass die jeweiligen Instrumente der beiden Methodenstränge nur eingeschränkte Analysen liefern können. Der Tiefenstruktur des Policy-Wandels im europäischen Mehrebenensystem ist ihnen zufolge nur durch die Triangulation qualitativer und quantitativer Methoden beizukommen. Anhand der exemplarischen Anwendung des vorgeschlagenen Methodenpluralismus auf zwei fiktive Fallstudien werden die Synergieeffekte dieser Vorgehensweise veranschaulicht. Dabei wird deutlich, dass dieser insbesondere mit Blick auf schwierige empirische Forschungsgegenstände, wie beispielsweise die "Informalisierung der Politik", zielführend sein kann. Marteen A. Hajer befasst sich mit der Bedeutung der Argumentativen Diskursanalyse für die Policy-Forschung. Wie er am Beispiel der Verhandlungen zur Wiederbebauung des Ground Zero zeigt, dient diese Methode vor allem dem Sichtbarmachen sprachlicher bzw. symbolischer Bedeutungsdimensionen von Politik und politischem Handeln, die Interessenkonflikte nicht ausschließen, diese aber oftmals transzendieren. Mit Sprache wird Politik gemacht. Fragen nach dem wie und zu wessen Gunsten können jedoch nur basierend auf der Identifikation unterschiedlicher Bedeutungsdimensionen der relevanten politischen Interaktionen angegangen werden. Je nachdem ob Ground Zero als "gewöhnlicher Baugrund", "Friedhof", "Nachbarschaft" oder "Amerikas Phönix aus der Asche" betrachtet wurde, sind ein und demselben Gegenstand völlig unterschiedliche Bedeutungen beigemessen worden. Diskurskonstruktionen, wie Metaphern, Narrative und Erzählverläufe dienen der Argumentativen Diskursanalyse als Schlüsselkonzepte der Policy-Analyse. Schließlich listet Hajer die methodischen Möglichkeiten der Argumentativen Diskursanalyse auf, mit der speziell das Ziel verfolgt wird, Argumentation im besonderen Kontextgefüge interaktiver Handlungen zu analysieren. Achim Lang und Philip Leifeld leisten eine theoretische und methodische Bestandsaufnahme der Netzwerkanalyse. Ausgehend von der Annahme, dass neuere politikwissenschaftliche Theorieansätze relativ stark auf beziehungsstrukturellen Annahmen und Hypothesen aufbauen, wird auf die wachsende Bedeutung der Netzwerkanalyse für die Policy-Forschung verwiesen. Die Autoren geben einen Überblick über die Theorielandschaft, auf der viele Netzwerkanalysen aufbauen. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Theorieansätzen (z.b. Tauschtheorie, Elitentheorie, Sozialkapital- und Partizipationstheorien, Governance- und Interessenforschung), untersuchten Beziehungsformen und verwendeten Methoden deutlich. Im Ergebnis kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es in der Zukunft nicht einer eigenen Netzwerktheorie bedarf, um die Wirkungsweise von Netzwerken zu analysieren. Vielmehr werden die bereits vorhandenen beziehungsstrukturellen
16 Einleitung 17 Annahmen und Hypothesen in Kombination mit den netzwerkanalytischen Methoden als hinreichend für die Durchführung von Metaanalysen betrachtet. Claudius Wagemann diskutiert den Nutzen der Forschungsmethode des strukturierten Fallvergleichs als Qualitative Comparative Analysis (QCA) für die Policy-Forschung. Wie die amerikanischen Sozialwissenschaftler King, Keohane und Verba startete auch Charles Ragin mit der Entwicklung und Anwendung von QCA den Versuch, das bis dahin ungelöste Problem einer wissenschaftlichen Systematik in qualitativer Sozialforschung anzugehen. Der Beitrag diskutiert insbesondere die Idee der Kausalität und räumt übliche Missverständnisse von QCA aus dem Weg. Dabei wird insbesondere auf die Anwendungsmöglichkeiten der fuzzy-set-variante von QCA hingewiesen. Sie eignet sich besonders für die Analyse komplexer, nicht einfach quantifizierbarer Phänomene, wie sie für die Policy-Forschung ja typisch sind. Da jedoch auch QCA für das Problem vieler Variablen und weniger Fälle keine abschließende Lösung bereithält, ist Komplexität zugleich die Ursache für Anwendungsprobleme, die sich lediglich durch die sparsame und vorsichtige Verwendung von QCA eindämmen lassen. Christine Trampusch erprobt am empirischen Beispiel der Riester-Rente die analytische Reichweite der sequenzorientierten Policy-Analyse. Die Sequenzorientierte Policy- Analyse eignet sich besonders zur Erklärung innovativen Politikwandels. Anders als die am Rationalitätswahlansatz orientierte Interaktionsanalyse betrachtet die Sequenzanalyse Politik dynamisch und stellt die Selbsttransformation von gesellschaftlichen Problemen, Präferenzen und institutionellen Rahmenbedingungen aufgrund von Rückkoppelungseffekten in Rechnung. Dadurch werden die Ursachen für innovativen Politikwandel nicht wie in den Interaktionsanalysen üblich exogenisiert, sondern neben exogen bedingten Präferenzen ebenso endogene Ursachen für Präferenzwandel identifiziert. Aus dieser Analyseperspektive können Prozesse der schöpferischen Selbstzerstörung des bundesdeutschen Sozialversicherungssystems in den Blick genommen werden, die dann einzusetzen schien, als die sozialintegrative Wirkung herkömmlicher Policies nicht mehr gewährleistet war. Um den kritischen Punkt der erschöpften sozialintegrativen Wirkung von Policies aufspüren zu können, müsste sich die Policy-Analyse in Zukunft stärker neueren Analysekonzepten des institutionellen Wandels öffnen, die die Bedeutung graduellen institutionellen Wandels für radikalen Politikwandel betonen. Die sequenzorientierte Policy-Analyse bietet eine Möglichkeit dazu. Nicole Deitelhoff und Anna Geis thematisieren die Grenzen aktueller Policy- und Governance-Forschung, die den Autorinnen zufolge Defizite einer einseitig an Outputs orientierten Politik nicht angemessen in den Blick nehmen kann. Der Beitrag beschreibt Prozesse der Ver- und Entstaatlichung in der aktuellen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die zu Lasten der demokratischen Kontrolle politischer Entscheidungen innerhalb dieses Politikfeldes gehen. Zur Analyse derartiger Prozesse bedarf es einer kritischen politikwissenschaftlichen Perspektive, die die technokratische Governance-Perspektive der Regierenden nicht einfach übernimmt. Die Governance-Forschung halten die Autorinnen zwar insofern für instruktiv, als sie unter anderem dazu geführt hat, die erkenntnishemmende kategoriale Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik aufzulösen. Allerdings führt der Problemlösungs-Bias, den die Governance-Forschung von der Policy-Analyse übernommen hat, dazu, dass wesentliche Aspekte von Herrschaft und Demokratie dieser Output-Orientierung untergeordnet werden. Die Frage, ob sich das Governance-Paradigma im Sinne einer kon-
17 18 Frank Janning und Katrin Toens struktiven Verknüpfung mit machttheoretischen Ansätzen für die herrschaftskritische Analyse nutzen lässt, wird in diesem Beitrag jedoch bewusst offen gelassen. Silke Bothfeld diskutiert Politiklernen am Beispiel der Elternzeitreform. Ähnlich wie Landwehr und Toens grenzt sich auch Bothfeld von policy-analytischen Ansätzen ab, die jegliche Form kognitiv bedingten Politikwandels als Lernen bezeichnen. In Auseinandersetzung mit der Elternzeitreform geht es Bothfeld um die Entwicklung eines handlungsund demokratietheoretisch anschlussfähigen kritischen Lernbegriffs. Im Rückgriff auf sozialkonstruktivistische Ansätze, den Foucaultschen Diskursbegriff und Deliberationstheorien entwirft sie ein Analyse-Konzept zur Untersuchung deliberativen Lernens, das Mikro- Aspekte organisationalen Handelns berücksichtigen kann. Maßgeblich sind unterschiedliche Stufen im Lernprozess, von der responsiven Problemthematisierung bis zur koordinierten Prioritätensetzung, an denen sich deliberatives Handeln von Organisationen festmachen lässt. Schließlich zeigt Bothfeld am Beispiel der Elternzeitreform, dass die Deliberation eine extrem voraussetzungsvolle Form des Politiklernens darstellt. Frank Bönker nimmt sozialpolitische Entwicklungen seit Beginn der 1990er Jahre zum Anlass der Thematisierung von Interdependenzen zwischen Politikfeldern. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Policy-Analyse Aspekte der Politikfeldverflechtung bisher eher vernachlässigt hat, werden unterschiedliche Dimensionen sektoraler Verflechtung aufgezeigt. Dabei geht es Bönker um die Entwicklung eines Analyserahmens zur Untersuchung der Verflechtung sektoraler Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Maßgeblich dafür ist die Unterscheidung zwischen vier Verflechtungsformen: wechselseitige Anpassung, positive Koordination, sektorales Lernen und die Intervention politikfeldexterner Akteure. Die Illustration und Überprüfung des Analyserahmens am Beispiel bundesdeutscher Sozialversicherungspolitiken im Zeitverlauf zeigt, dass die Verflechtung der Diskussions- und Entscheidungsprozesse innerhalb der Sozialpolitik zugenommen hat und vermutlich weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wie sich die sektorale Politikverflechtung zu anderen Formen der Politikverflechtung im internationalen Handlungsrahmen verhält, und inwieweit auch andere Politikbereiche von ihrer Zunahme betroffen sind, das sind offene Fragen, denen sich die Policy-Forschung in der Zukunft stärker widmen sollte. Literatur Benz, Arthur, 2004: Governance Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? in: Benz, Arthur, (Hrsg.): Governance Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung, Wiesbaden: VS. S Bleek, Wilhelm, 2001: Geschichte der Politikwissenschaft in Deutschland. München: Beck. Böhret, Carl, 1970: Entscheidungshilfen für die Regierung, Opladen: Westdeutscher. Böllhoff, Dominik, 2005: The Regulatory Capacity of Agencies. A Comparative Study of Telecoms Regulatory Agencies in Britain and Germany, Berlin: BWV. Decker, Frank, 1994: Umweltschutz und Staatsversagen. Eine materielle Regierbarkeitsanalyse, Opladen: Leske + Budrich. Dror, Yehezkel, 1968: Public Policy-Making Re-examined, San Francisco: Chandler. Dye, Thomas, 1972: Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Fach, Wolfgang, 1982: Verwaltungswissenschaft ein Paradigma und seine Karriere, in: Hesse, Joachim Jens, (Hrsg.): Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft. PVS-Sonderheft 13, Opladen: Westdeutscher. S
18 Einleitung 19 Fischer, Frank, 2003: Reframing Public Policy. Discursive Politics and Deliberative Practices, Oxford: Oxford University Press. Grande, Edgar, 1993: Die neue Architektur des Staates, in: Czada, Roland/Schmidt, Manfred G., (Hrsg): Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Festschrift für Gerhard Lehmbruch, Opladen: Westdeutscher. S Greven, Michael Th., 1985: Macht, Herrschaft und Legitimität. Eine Erinnerung der Politologen an die Grund-fragen ihrer Disziplin. in: Hartwich, Hans-Hermann, (Hrsg.), Policy-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Selbstverständnis und ihr Verhältnis zu den Grundfragen der Politikwissenschaft, Opladen: Westdeutscher. S Hennis, Wilhelm, 1985: Über die Antworten der eigenen Wissenschaftsgeschichte und die Notwendigkeit, zentrale Fragen der Politikwissenschaft stets neu zu überdenken, in: Hartwich, Hans- Hermann, (Hrsg.), Policy-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Selbstverständnis und ihr Verhältnis zu den Grundfragen der Politikwissenschaft, Opladen: Westdeutscher. S Jänicke, Martin, 1986: Staatsversagen. Die Ohnmacht der Politik in der Industriegesellschaft, München/Zürich: Piper. Janning, Frank, 1998: Das politische Organisationsfeld. Politische Macht und soziale Homologie in komplexen Demokratien, Opladen: Westdeutscher. Janning, Frank, 2006: Koexistenz ohne Synergieeffekte? Über das Verhältnis zwischen Policy- Forschung und Verwaltungswissenschaft, in: Bogumil, J./Jann, W./Nullmeier, F., (Hrsg.): Politik und Verwaltung, PVS Sonderheft 37/2006, Wiesbaden: VS. S Kooiman, Jan, 2003: Governing as Governance, London: Sage. Lindblom, Charles, 1968: The Policy-Making Process, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Lompe, Klaus, 1971: Gesellschaftspolitik und Planung. Probleme politischer Planung in der sozialstaatlichen Demokratie, Freiburg: Rombach. Lyden, Fremont J./Miller, Ernest G., (Hrsg.), 1967: Planning, Programming, Budgeting. A Systems Approach to Management, Chicago: Markham. Mayntz, Renate, 1977: Die Implementation politischer Programme: Theoretische Überlegungen zu einem neuen Forschungsgebiet. Die Verwaltung. 10: Mayntz, Renate, 1980: Die Entwicklung des analytischen Paradigmas der Implementationsforschung., in: Mayntz, Renate, (Hrsg.): Implementation politischer Programme. Empirische Forschungsberichte, Königstein: Athenäum. S Mayntz, Renate, 1993: Policy-Netzwerke und die Logik von Verhandlungssystemen., in: Héretier, Adrienne (Hrsg.): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung. PVS-Sonderheft 24, Opladen: Westdeutscher. S Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W., 1973: Kriterien, Voraussetzungen und Einschränkungen aktiver Politik, in: Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W., (Hrsg.): Planungsorganisation. Die Diskussion um die Reform von Verwaltung und Regierung des Bundes, München: Piper. S Moynihan, Daniel P., 1969: Maximum Feasible Misunderstanding, New York: Free Press. Müller, Markus M., 2002: The New Regulatory State in Germany, Birmingham: University of Birmingham Press. Prätorius, Rainer, 2004: U.S.-amerikanische Prägungen der Policy-Forschung, in: Holtmann, Everhard, (Hrsg.): Staatsentwicklung und Policyforschung. Politikwissenschaftliche Analysen der Staatstätigkeit, Wiesbaden: VS. S Sabatier, Paul A., 1993: Advocacy-Koalitionen, Policy-Wandel und Policy-Lernen: Eine Alternative zur Phasenheuristik, in: Héretier, Adrienne, (Hrsg.): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung. PVS Sonder-heft 24, Opladen: Westdeutscher. S Scharpf, Fritz W., 1973: Planung als politischer Prozess. Aufsätze zur Theorie der planenden Demokratie. Frankfurt: Suhrkamp. Scharpf, Fritz W., 1993: Positive und negative Koordination in Verhandlungssystemen, in: Héretier, Adrienne, (Hrsg.): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung. PVS Sonderheft 24, Opladen: Westdeutscher Verlag. S
Sascha Koch Michael Schemmann (Hrsg.) Neo-Institutionalismus in der Erziehungswissenschaft
 Sascha Koch Michael Schemmann (Hrsg.) Neo-Institutionalismus in der Erziehungswissenschaft Organisation und Pädagogik Band 6 Herausgegeben von Michael Göhlich Sascha Koch Michael Schemmann (Hrsg.) Neo-Institutionalismus
Sascha Koch Michael Schemmann (Hrsg.) Neo-Institutionalismus in der Erziehungswissenschaft Organisation und Pädagogik Band 6 Herausgegeben von Michael Göhlich Sascha Koch Michael Schemmann (Hrsg.) Neo-Institutionalismus
Dirk Lange Gerhard Himmelmann (Hrsg.) Demokratiebewusstsein
 Dirk Lange Gerhard Himmelmann (Hrsg.) Demokratiebewusstsein Dirk Lange Gerhard Himmelmann (Hrsg.) Demokratiebewusstsein Interdisziplinäre Annäherungen an ein zentrales Thema der Politischen Bildung Bibliografische
Dirk Lange Gerhard Himmelmann (Hrsg.) Demokratiebewusstsein Dirk Lange Gerhard Himmelmann (Hrsg.) Demokratiebewusstsein Interdisziplinäre Annäherungen an ein zentrales Thema der Politischen Bildung Bibliografische
Markus M. Müller Roland Sturm. Wirtschaftspolitik kompakt
 Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Hellmuth Lange (Hrsg.) Nachhaltigkeit als radikaler Wandel
 Hellmuth Lange (Hrsg.) Nachhaltigkeit als radikaler Wandel Hellmuth Lange (Hrsg.) Nachhaltigkeit als radikaler Wandel Die Quadratur des Kreises? Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Hellmuth Lange (Hrsg.) Nachhaltigkeit als radikaler Wandel Hellmuth Lange (Hrsg.) Nachhaltigkeit als radikaler Wandel Die Quadratur des Kreises? Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Frank Hillebrandt. Praktiken des Tauschens
 Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens Wirtschaft + Gesellschaft Herausgegeben von Andrea Maurer und Uwe Schimank Beirat: Jens Beckert Christoph Deutschmann Susanne Lütz Richard Münch Wirtschaft und
Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens Wirtschaft + Gesellschaft Herausgegeben von Andrea Maurer und Uwe Schimank Beirat: Jens Beckert Christoph Deutschmann Susanne Lütz Richard Münch Wirtschaft und
Dieter Flader Sigrun Comati. Kulturschock
 Dieter Flader Sigrun Comati Kulturschock Dieter Flader Sigrun Comati Kulturschock Interkulturelle Handlungskonflikte westlicher Unternehmen in Mittelost- und Südosteuropa Eine Untersuchung an den Beispielen
Dieter Flader Sigrun Comati Kulturschock Dieter Flader Sigrun Comati Kulturschock Interkulturelle Handlungskonflikte westlicher Unternehmen in Mittelost- und Südosteuropa Eine Untersuchung an den Beispielen
Arnd-Michael Nohl. Interview und dokumentarische Methode
 Arnd-Michael Nohl Interview und dokumentarische Methode Qualitative Sozialforschung Band 16 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Arnd-Michael Nohl Interview und dokumentarische Methode Qualitative Sozialforschung Band 16 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Jutta Ecarius Carola Groppe Hans Malmede (Hrsg.) Familie und öffentliche Erziehung
 Jutta Ecarius Carola Groppe Hans Malmede (Hrsg.) Familie und öffentliche Erziehung Jutta Ecarius Carola Groppe Hans Malmede (Hrsg.) Familie und öffentliche Erziehung Theoretische Konzeptionen, historische
Jutta Ecarius Carola Groppe Hans Malmede (Hrsg.) Familie und öffentliche Erziehung Jutta Ecarius Carola Groppe Hans Malmede (Hrsg.) Familie und öffentliche Erziehung Theoretische Konzeptionen, historische
Christine Schlickum. Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa
 Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Eine quantitative Studie zum Umgang von Schülerinnen
Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Eine quantitative Studie zum Umgang von Schülerinnen
Katja Wohlgemuth. Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe
 Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Annäherung an eine Zauberformel Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Annäherung an eine Zauberformel Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland
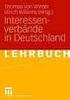 Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Michael Bayer Gabriele Mordt. Einführung in das Werk Max Webers
 Michael Bayer Gabriele Mordt Einführung in das Werk Max Webers Studienskripten zur Soziologie Herausgeber: Prof. Dr. Heinz Sahner, Dr. Michael Bayer und Prof. Dr. Reinhold Sackmann begründet von Prof.
Michael Bayer Gabriele Mordt Einführung in das Werk Max Webers Studienskripten zur Soziologie Herausgeber: Prof. Dr. Heinz Sahner, Dr. Michael Bayer und Prof. Dr. Reinhold Sackmann begründet von Prof.
8 Frank R. Pfetsch. Inhalt. Das neue Europa
 8 Frank R. Pfetsch Das neue Europa 8 Frank R. Pfetsch Das neue Europa 8 Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
8 Frank R. Pfetsch Das neue Europa 8 Frank R. Pfetsch Das neue Europa 8 Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit
 Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen
Christian Wipperfürth. Russlands Außenpolitik
 Christian Wipperfürth Russlands Außenpolitik Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) Bernhard Frevel
Christian Wipperfürth Russlands Außenpolitik Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) Bernhard Frevel
Thomas Brüsemeister. Bildungssoziologie
 Thomas Brüsemeister Bildungssoziologie Soziologische Theorie Hrsg. von Thomas Kron Editorial Board: Matthias Junge Andrea Maurer Uwe Schimank Johannes Weyer Theorien sind, in der Metapher des soziologischen
Thomas Brüsemeister Bildungssoziologie Soziologische Theorie Hrsg. von Thomas Kron Editorial Board: Matthias Junge Andrea Maurer Uwe Schimank Johannes Weyer Theorien sind, in der Metapher des soziologischen
Olaf Leiße (Hrsg.) Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon
 Olaf Leiße (Hrsg.) Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon Olaf Leiße (Hrsg.) Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Olaf Leiße (Hrsg.) Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon Olaf Leiße (Hrsg.) Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Gotlind Ulshöfer Gesine Bonnet (Hrsg.) Corporate Social Responsibility auf dem Finanzmarkt
 Gotlind Ulshöfer Gesine Bonnet (Hrsg.) Corporate Social Responsibility auf dem Finanzmarkt Gotlind Ulshöfer Gesine Bonnet (Hrsg.) Corporate Social Responsibility auf dem Finanzmarkt Nachhaltiges Investment
Gotlind Ulshöfer Gesine Bonnet (Hrsg.) Corporate Social Responsibility auf dem Finanzmarkt Gotlind Ulshöfer Gesine Bonnet (Hrsg.) Corporate Social Responsibility auf dem Finanzmarkt Nachhaltiges Investment
Otger Autrata Bringfriede Scheu. Soziale Arbeit
 Otger Autrata Bringfriede Scheu Soziale Arbeit VS RESEARCH Forschung, Innovation und Soziale Arbeit Herausgegeben von Bringfriede Scheu, Fachhochschule Kärnten Otger Autrata, Forschungsinstitut RISS/Universität
Otger Autrata Bringfriede Scheu Soziale Arbeit VS RESEARCH Forschung, Innovation und Soziale Arbeit Herausgegeben von Bringfriede Scheu, Fachhochschule Kärnten Otger Autrata, Forschungsinstitut RISS/Universität
Olaf Struck. Flexibilität und Sicherheit
 Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Forschung Gesellschaft Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Empirische Befunde, theoretische Konzepte und institutionelle Gestaltung von Beschäftigungsstabilität
Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Forschung Gesellschaft Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Empirische Befunde, theoretische Konzepte und institutionelle Gestaltung von Beschäftigungsstabilität
Reiner Keller. Diskursforschung
 Reiner Keller Diskursforschung Qualitative Sozialforschung Band 14 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung Praktiken Methodologien
Reiner Keller Diskursforschung Qualitative Sozialforschung Band 14 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung Praktiken Methodologien
Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.) Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert
 Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.) Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.)
Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.) Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.)
Georg Auernheimer (Hrsg.) Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität
 Georg Auernheimer (Hrsg.) Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität Interkulturelle Studien Band 13 Herausgegeben von Georg Auernheimer Wolf-Dietrich Bukow Christoph Butterwegge Hans-Joachim
Georg Auernheimer (Hrsg.) Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität Interkulturelle Studien Band 13 Herausgegeben von Georg Auernheimer Wolf-Dietrich Bukow Christoph Butterwegge Hans-Joachim
Christiane Schiersmann. Berufliche Weiterbildung
 Christiane Schiersmann Berufliche Weiterbildung Christiane Schiersmann Berufliche Weiterbildung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Christiane Schiersmann Berufliche Weiterbildung Christiane Schiersmann Berufliche Weiterbildung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Andrea Hausmann. Kunst- und Kulturmanagement
 Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kunst- und Kulturmanagement Herausgegeben von Andrea Hausmann Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kompaktwissen
Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kunst- und Kulturmanagement Herausgegeben von Andrea Hausmann Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kompaktwissen
Arnulf Deppermann. Gespräche analysieren
 Arnulf Deppermann Gespräche analysieren Qualitative Sozialforschung Band 3 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung Praktiken Methodologien
Arnulf Deppermann Gespräche analysieren Qualitative Sozialforschung Band 3 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung Praktiken Methodologien
Manfred Kühn Heike Liebmann (Hrsg.) Regenerierung der Städte
 Manfred Kühn Heike Liebmann (Hrsg.) Regenerierung der Städte Manfred Kühn Heike Liebmann (Hrsg.) Regenerierung der Städte Strategien der Politik und Planung im Schrumpfungskontext Bibliografische Information
Manfred Kühn Heike Liebmann (Hrsg.) Regenerierung der Städte Manfred Kühn Heike Liebmann (Hrsg.) Regenerierung der Städte Strategien der Politik und Planung im Schrumpfungskontext Bibliografische Information
Ivonne Küsters. Narrative Interviews
 Ivonne Küsters Narrative Interviews Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe Hagener Studientexte zur Soziologie will eine
Ivonne Küsters Narrative Interviews Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe Hagener Studientexte zur Soziologie will eine
Wolfgang Gerß (Hrsg.) Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum
 Wolfgang Gerß (Hrsg.) Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum Wolfgang Gerß (Hrsg.) Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum Datenquellen und Methoden zur quantitativen Analyse Bibliografische Information
Wolfgang Gerß (Hrsg.) Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum Wolfgang Gerß (Hrsg.) Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum Datenquellen und Methoden zur quantitativen Analyse Bibliografische Information
Karin Altgeld Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Qualitätsmanagement in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung
 Karin Altgeld Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Qualitätsmanagement in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung Karin Altgeld Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Qualitätsmanagement in der frühkindlichen
Karin Altgeld Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Qualitätsmanagement in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung Karin Altgeld Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Qualitätsmanagement in der frühkindlichen
Ralf Bohnsack Iris Nentwig-Gesemann Arnd-Michael Nohl (Hrsg.) Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis
 Ralf Bohnsack Iris Nentwig-Gesemann Arnd-Michael Nohl (Hrsg.) Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis Ralf Bohnsack Iris Nentwig-Gesemann Arnd-Michael Nohl (Hrsg.) Die dokumentarische Methode
Ralf Bohnsack Iris Nentwig-Gesemann Arnd-Michael Nohl (Hrsg.) Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis Ralf Bohnsack Iris Nentwig-Gesemann Arnd-Michael Nohl (Hrsg.) Die dokumentarische Methode
Isabel Kusche. Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System
 Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Bibliografische
Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Bibliografische
Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Vergleichende politikwissenschaftliche
 Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Vergleichende politikwissenschaftliche Methoden Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Vergleichende politikwissenschaftliche
Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Vergleichende politikwissenschaftliche Methoden Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Vergleichende politikwissenschaftliche
Margret Johannsen. Der Nahost-Konflikt
 Margret Johannsen Der Nahost-Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart Bernhard Frevel Klaus Schubert Suzanne S. Schüttemeyer Die ELEMENTE DER POLITIK sind eine politikwissenschaftliche
Margret Johannsen Der Nahost-Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart Bernhard Frevel Klaus Schubert Suzanne S. Schüttemeyer Die ELEMENTE DER POLITIK sind eine politikwissenschaftliche
Peter Heintel (Hrsg.) betrifft: TEAM
 Peter Heintel (Hrsg.) betrifft: TEAM Schriften zur Gruppen- und Organisationsdynamik Band 4 Herausgegeben von Ewald E. Krainz Beirat: Ralph Grossmann Peter Heintel Karin Lackner Ruth Simsa Helmut Stockhammer
Peter Heintel (Hrsg.) betrifft: TEAM Schriften zur Gruppen- und Organisationsdynamik Band 4 Herausgegeben von Ewald E. Krainz Beirat: Ralph Grossmann Peter Heintel Karin Lackner Ruth Simsa Helmut Stockhammer
Simone Kimpeler Michael Mangold Wolfgang Schweiger (Hrsg.) Die digitale Herausforderung
 Simone Kimpeler Michael Mangold Wolfgang Schweiger (Hrsg.) Die digitale Herausforderung Simone Kimpeler Michael Mangold Wolfgang Schweiger (Hrsg.) Die digitale Herausforderung Zehn Jahre Forschung zur
Simone Kimpeler Michael Mangold Wolfgang Schweiger (Hrsg.) Die digitale Herausforderung Simone Kimpeler Michael Mangold Wolfgang Schweiger (Hrsg.) Die digitale Herausforderung Zehn Jahre Forschung zur
Andreas Hadjar Rolf Becker (Hrsg.) Die Bildungsexpansion
 Andreas Hadjar Rolf Becker (Hrsg.) Die Bildungsexpansion Für Walter Müller, den herausragenden Bildungsforscher, der den Anstoß für dieses Buch gegeben hat. Andreas Hadjar Rolf Becker (Hrsg.) Die Bildungsexpansion
Andreas Hadjar Rolf Becker (Hrsg.) Die Bildungsexpansion Für Walter Müller, den herausragenden Bildungsforscher, der den Anstoß für dieses Buch gegeben hat. Andreas Hadjar Rolf Becker (Hrsg.) Die Bildungsexpansion
Henning Schluß. Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse
 Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Analysen zum Verhältnis von Pädagogik und Religion Bibliografische Information der
Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Analysen zum Verhältnis von Pädagogik und Religion Bibliografische Information der
Jo Reichertz Carina Jasmin Englert. Einführung in die qualitative Videoanalyse
 Jo Reichertz Carina Jasmin Englert Einführung in die qualitative Videoanalyse Qualitative Sozialforschung Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Jo Reichertz Carina Jasmin Englert Einführung in die qualitative Videoanalyse Qualitative Sozialforschung Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Peter Bleckmann Anja Durdel (Hrsg.) Lokale Bildungslandschaften
 Peter Bleckmann Anja Durdel (Hrsg.) Lokale Bildungslandschaften Peter Bleckmann Anja Durdel (Hrsg.) unter Mitarbeit von Mario Tibussek und Jürgen Bosenius Lokale Bildungslandschaften Perspektiven für Ganztagsschulen
Peter Bleckmann Anja Durdel (Hrsg.) Lokale Bildungslandschaften Peter Bleckmann Anja Durdel (Hrsg.) unter Mitarbeit von Mario Tibussek und Jürgen Bosenius Lokale Bildungslandschaften Perspektiven für Ganztagsschulen
Henrike Viehrig. Militärische Auslandseinsätze
 Henrike Viehrig Militärische Auslandseinsätze Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen Herausgegeben von Thomas Jäger Henrike Viehrig Militärische Auslandseinsätze Die Entscheidungen europäischer
Henrike Viehrig Militärische Auslandseinsätze Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen Herausgegeben von Thomas Jäger Henrike Viehrig Militärische Auslandseinsätze Die Entscheidungen europäischer
Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft
 Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Für Thomas Heinze Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Perspektiven aus Theorie und
Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Für Thomas Heinze Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Perspektiven aus Theorie und
Sylvia Marlene Wilz (Hrsg.) Geschlechterdifferenzen Geschlechterdifferenzierungen
 Sylvia Marlene Wilz (Hrsg.) Geschlechterdifferenzen Geschlechterdifferenzierungen Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe
Sylvia Marlene Wilz (Hrsg.) Geschlechterdifferenzen Geschlechterdifferenzierungen Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe
Johannes Bilstein Jutta Ecarius Edwin Keiner (Hrsg.) Kulturelle Differenzen und Globalisierung
 Johannes Bilstein Jutta Ecarius Edwin Keiner (Hrsg.) Kulturelle Differenzen und Globalisierung Johannes Bilstein Jutta Ecarius Edwin Keiner (Hrsg.) Kulturelle Differenzen und Globalisierung Herausforderungen
Johannes Bilstein Jutta Ecarius Edwin Keiner (Hrsg.) Kulturelle Differenzen und Globalisierung Johannes Bilstein Jutta Ecarius Edwin Keiner (Hrsg.) Kulturelle Differenzen und Globalisierung Herausforderungen
Herbert Obinger Emmerich Talos. Sozialstaat Osterreich zwischen Kontinuitat und Umbau
 Herbert Obinger Emmerich Talos Sozialstaat Osterreich zwischen Kontinuitat und Umbau Forschung Politik Herbert Obinger Emmerich Tales Sozialstaat Osterreich zwischen Kontinuitat und Umbau Eine Bilanz der
Herbert Obinger Emmerich Talos Sozialstaat Osterreich zwischen Kontinuitat und Umbau Forschung Politik Herbert Obinger Emmerich Tales Sozialstaat Osterreich zwischen Kontinuitat und Umbau Eine Bilanz der
Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien
 Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Zur Darstellung und Wirkung eines
Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Zur Darstellung und Wirkung eines
Egbert Jahn. Frieden und Konflikt
 Egbert Jahn Frieden und Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) Bernhard Frevel (Fachhochschule
Egbert Jahn Frieden und Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) Bernhard Frevel (Fachhochschule
Gertrud Brücher. Pazifismus als Diskurs
 Gertrud Brücher Pazifismus als Diskurs Gertrud Brücher Pazifismus als Diskurs Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Gertrud Brücher Pazifismus als Diskurs Gertrud Brücher Pazifismus als Diskurs Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Stephan Rietmann Gregor Hensen (Hrsg.) Tagesbetreuung im Wandel
 Stephan Rietmann Gregor Hensen (Hrsg.) Tagesbetreuung im Wandel Stephan Rietmann Gregor Hensen (Hrsg.) Tagesbetreuung im Wandel Das Familienzentrum als Zukunftsmodell 2., durchgesehene Auflage Bibliografische
Stephan Rietmann Gregor Hensen (Hrsg.) Tagesbetreuung im Wandel Stephan Rietmann Gregor Hensen (Hrsg.) Tagesbetreuung im Wandel Das Familienzentrum als Zukunftsmodell 2., durchgesehene Auflage Bibliografische
Gudrun HentgeS. Hans-Wo!fgang P!atzer (Hrsg.) quo
 Gudrun HentgeS. Hans-Wo!fgang P!atzer (Hrsg.) quo Gudrun Hentges Hans-wolfgang Platzer (Hrsg.) Eurapa - qua vadis? Ausgewählte Problemfelder der europäischen Integrationspol itik I VS VERLAG Bibliografische
Gudrun HentgeS. Hans-Wo!fgang P!atzer (Hrsg.) quo Gudrun Hentges Hans-wolfgang Platzer (Hrsg.) Eurapa - qua vadis? Ausgewählte Problemfelder der europäischen Integrationspol itik I VS VERLAG Bibliografische
Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik
 Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik Familienwissenschaftliche Studien Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik
Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik Familienwissenschaftliche Studien Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik
Uwe Hunger Can M. Aybek Andreas Ette Ines Michalowski (Hrsg.) Migrations- und Integrationsprozesse in Europa
 Uwe Hunger Can M. Aybek Andreas Ette Ines Michalowski (Hrsg.) Migrations- und Integrationsprozesse in Europa Uwe Hunger Can M. Aybek Andreas Ette Ines Michalowski (Hrsg.) Migrations- und Integrationsprozesse
Uwe Hunger Can M. Aybek Andreas Ette Ines Michalowski (Hrsg.) Migrations- und Integrationsprozesse in Europa Uwe Hunger Can M. Aybek Andreas Ette Ines Michalowski (Hrsg.) Migrations- und Integrationsprozesse
Vera King Hans-Christoph Koller (Hrsg.) Adoleszenz Migration Bildung
 Vera King Hans-Christoph Koller (Hrsg.) Adoleszenz Migration Bildung Vera King Hans-Christoph Koller (Hrsg.) Adoleszenz Migration Bildung Bildungsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrationshintergrund
Vera King Hans-Christoph Koller (Hrsg.) Adoleszenz Migration Bildung Vera King Hans-Christoph Koller (Hrsg.) Adoleszenz Migration Bildung Bildungsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrationshintergrund
Sabine Hering (Hrsg.) Bürgerschaftlichkeit und Professionalität
 Sabine Hering (Hrsg.) Bürgerschaftlichkeit und Professionalität Sozial Extra Zeitschrift für Soziale Arbeit Sonderheft 8 2007 Sabine Hering (Hrsg.) Bürgerschaftlichkeit und Professionalität Wirklichkeit
Sabine Hering (Hrsg.) Bürgerschaftlichkeit und Professionalität Sozial Extra Zeitschrift für Soziale Arbeit Sonderheft 8 2007 Sabine Hering (Hrsg.) Bürgerschaftlichkeit und Professionalität Wirklichkeit
Thomas Schäfer. Statistik I
 Thomas Schäfer Statistik I Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof. Dr.
Thomas Schäfer Statistik I Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof. Dr.
Walther Müller-Jentsch. Strukturwandel der industriellen Beziehungen
 Walther Müller-Jentsch MLiller-Jentsch Strukturwandel der industriellen Beziehungen Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Wemer Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jager, Jäger, Uwe Schimank
Walther Müller-Jentsch MLiller-Jentsch Strukturwandel der industriellen Beziehungen Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Wemer Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jager, Jäger, Uwe Schimank
Markus Ottersbach Claus-Ulrich Prölß (Hrsg.) Flüchtlingsschutz als globale und lokale Herausforderung
 Markus Ottersbach Claus-Ulrich Prölß (Hrsg.) Flüchtlingsschutz als globale und lokale Herausforderung Beiträge zur Regional- und Migrationsforschung Herausgegeben von Thomas Geisen Migrationsprozesse sind
Markus Ottersbach Claus-Ulrich Prölß (Hrsg.) Flüchtlingsschutz als globale und lokale Herausforderung Beiträge zur Regional- und Migrationsforschung Herausgegeben von Thomas Geisen Migrationsprozesse sind
Klaus Merten. Konstruktion von Kommunikation in der Mediengesellschaft
 Konstruktion von Kommunikation in der Mediengesellschaft (Hrsg.) Konstruktion von Kommunikation in der Mediengesellschaft Festschrift für Joachim Westerbarkey Bibliografische Information der Deutschen
Konstruktion von Kommunikation in der Mediengesellschaft (Hrsg.) Konstruktion von Kommunikation in der Mediengesellschaft Festschrift für Joachim Westerbarkey Bibliografische Information der Deutschen
Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung
 Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele 2., vollständig
Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele 2., vollständig
Sünne Andresen Mechthild Koreuber Dorothea Lüdke (Hrsg.) Gender und Diversity: Albtraum oder Traumpaar?
 Sünne Andresen Mechthild Koreuber Dorothea Lüdke (Hrsg.) Gender und Diversity: Albtraum oder Traumpaar? Sünne Andresen Mechthild Koreuber Dorothea Lüdke (Hrsg.) Gender und Diversity: Albtraum oder Traumpaar?
Sünne Andresen Mechthild Koreuber Dorothea Lüdke (Hrsg.) Gender und Diversity: Albtraum oder Traumpaar? Sünne Andresen Mechthild Koreuber Dorothea Lüdke (Hrsg.) Gender und Diversity: Albtraum oder Traumpaar?
Inka Bormann Gerhard de Haan (Hrsg.) Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung
 Inka Bormann Gerhard de Haan (Hrsg.) Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung Inka Bormann Gerhard de Haan (Hrsg.) Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung Operationalisierung, Messung,
Inka Bormann Gerhard de Haan (Hrsg.) Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung Inka Bormann Gerhard de Haan (Hrsg.) Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung Operationalisierung, Messung,
Martin Sebaldt. Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie
 Martin Sebaldt. Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie Martin Sebaldt Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie counterinsurgency als normative und praktische Herausforderung III VSVERLAG
Martin Sebaldt. Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie Martin Sebaldt Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie counterinsurgency als normative und praktische Herausforderung III VSVERLAG
Birger P. Priddat. Politische Ökonomie
 Birger P. Priddat Politische Ökonomie Birger P. Priddat Politische Ökonomie Neue Schnittstellendynamik zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Birger P. Priddat Politische Ökonomie Birger P. Priddat Politische Ökonomie Neue Schnittstellendynamik zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Elias Jammal (Hrsg.) Vertrauen im interkulturellen Kontext
 Elias Jammal (Hrsg.) Vertrauen im interkulturellen Kontext VS RESEARCH Perspectives of the Other: Studies on Intercultural Communication Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Henze, Humboldt-Universität zu
Elias Jammal (Hrsg.) Vertrauen im interkulturellen Kontext VS RESEARCH Perspectives of the Other: Studies on Intercultural Communication Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Henze, Humboldt-Universität zu
Regine Gildemeister Günther Robert. Geschlechterdifferenzierungen in lebenszeitlicher Perspektive
 Regine Gildemeister Günther Robert Geschlechterdifferenzierungen in lebenszeitlicher Perspektive Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank
Regine Gildemeister Günther Robert Geschlechterdifferenzierungen in lebenszeitlicher Perspektive Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank
Reiner Keller Werner Schneider Willy Viehöver (Hrsg.) Diskurs Macht Subjekt
 Reiner Keller Werner Schneider Willy Viehöver (Hrsg.) Diskurs Macht Subjekt Interdisziplinäre Diskursforschung Herausgegeben von Reiner Keller, Achim Landwehr, Wolf-Andreas Liebert, Martin Nonhoff Seit
Reiner Keller Werner Schneider Willy Viehöver (Hrsg.) Diskurs Macht Subjekt Interdisziplinäre Diskursforschung Herausgegeben von Reiner Keller, Achim Landwehr, Wolf-Andreas Liebert, Martin Nonhoff Seit
Hans Zehetmair (Hrsg.) Politik aus christlicher Verantwortung
 Hans Zehetmair (Hrsg.) Politik aus christlicher Verantwortung Hans Zehetmair (Hrsg.) unter Mitarbeit von Philipp W. Hildmann Politik aus christlicher Verantwortung Bibliografische Information Der Deutschen
Hans Zehetmair (Hrsg.) Politik aus christlicher Verantwortung Hans Zehetmair (Hrsg.) unter Mitarbeit von Philipp W. Hildmann Politik aus christlicher Verantwortung Bibliografische Information Der Deutschen
Bertram Scheufele Alexander Haas. Medien und Aktien
 Bertram Scheufele Alexander Haas Medien und Aktien Bertram Scheufele Alexander Haas Medien und Aktien Theoretische und empirische Modellierung der Rolle der Berichterstattung für das Börsengeschehen Bibliografische
Bertram Scheufele Alexander Haas Medien und Aktien Bertram Scheufele Alexander Haas Medien und Aktien Theoretische und empirische Modellierung der Rolle der Berichterstattung für das Börsengeschehen Bibliografische
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager
 Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Wissen, Kommunikation und Gesellschaft
 Wissen, Kommunikation und Gesellschaft Schriften zur Wissenssoziologie Reihe herausgegeben von H.-G. Soeffner, Essen, Deutschland R. Hitzler, Dortmund, Deutschland H. Knoblauch, Berlin, Deutschland J.
Wissen, Kommunikation und Gesellschaft Schriften zur Wissenssoziologie Reihe herausgegeben von H.-G. Soeffner, Essen, Deutschland R. Hitzler, Dortmund, Deutschland H. Knoblauch, Berlin, Deutschland J.
Karin Sanders Andrea Kianty. Organisationstheorien
 Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Eine Einführung Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Eine Einführung Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Marion Baldus Richard Utz (Hrsg.) Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten
 Marion Baldus Richard Utz (Hrsg.) Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten Marion Baldus Richard Utz (Hrsg.) Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten Faktoren. Interventionen. Perspektiven
Marion Baldus Richard Utz (Hrsg.) Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten Marion Baldus Richard Utz (Hrsg.) Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten Faktoren. Interventionen. Perspektiven
Claudia Steckelberg. Zwischen Ausschluss und Anerkennung
 Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Lebenswelten wohnungsloser Mädchen und junger Frauen Bibliografische Information der Deutschen
Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Lebenswelten wohnungsloser Mädchen und junger Frauen Bibliografische Information der Deutschen
Carsten Rohlfs Marius Harring Christian Palentien (Hrsg.) Kompetenz-Bildung
 Carsten Rohlfs Marius Harring Christian Palentien (Hrsg.) Kompetenz-Bildung Carsten Rohlfs Marius Harring Christian Palentien (Hrsg.) Kompetenz-Bildung Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen
Carsten Rohlfs Marius Harring Christian Palentien (Hrsg.) Kompetenz-Bildung Carsten Rohlfs Marius Harring Christian Palentien (Hrsg.) Kompetenz-Bildung Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen
Helmut K. Anheier Andreas Schröer Volker Then (Hrsg.) Soziale Investitionen
 Helmut K. Anheier Andreas Schröer Volker Then (Hrsg.) Soziale Investitionen Soziale Investitionen Herausgegeben von Helmut K. Anheier, Andreas Schröer, Volker Then Bürgerschaftliches Engagement und Stiftungsförderung,
Helmut K. Anheier Andreas Schröer Volker Then (Hrsg.) Soziale Investitionen Soziale Investitionen Herausgegeben von Helmut K. Anheier, Andreas Schröer, Volker Then Bürgerschaftliches Engagement und Stiftungsförderung,
Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann. Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor
 Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Institutionenkonflikt,
Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Institutionenkonflikt,
Thomas Kern. Soziale Bewegungen
 Thomas Kern Soziale Bewegungen Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe Hagener Studientexte zur Soziologie will eine größere
Thomas Kern Soziale Bewegungen Hagener Studientexte zur Soziologie Herausgeber: Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz Wieland Jäger, Uwe Schimank Die Reihe Hagener Studientexte zur Soziologie will eine größere
Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke Miriam Schroer Stefan Wink. Mediation an Schulen
 Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke Miriam Schroer Stefan Wink Mediation an Schulen Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke
Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke Miriam Schroer Stefan Wink Mediation an Schulen Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke
Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft
 Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft Herausgegeben von G. Bentele, Leipzig, Deutschland H.-B. Brosius, München, Deutschland O. Jarren, Zürich, Schweiz Herausgeber und Verlag streben mit
Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft Herausgegeben von G. Bentele, Leipzig, Deutschland H.-B. Brosius, München, Deutschland O. Jarren, Zürich, Schweiz Herausgeber und Verlag streben mit
Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit
 Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Benjamin Benz Günter Rieger Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Eine Einführung Benjamin Benz Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EFH
Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Benjamin Benz Günter Rieger Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Eine Einführung Benjamin Benz Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EFH
Friedhelm Vahsen Gudrun Mane. Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit
 Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Bibliografische Information
Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Bibliografische Information
Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem
 Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem VS RESEARCH Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem Von der Fürsorgeschule
Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem VS RESEARCH Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem Von der Fürsorgeschule
Georg Weißeno (Hrsg.) Politik besser verstehen
 Georg Weißeno (Hrsg.) Politik besser verstehen Georg Weißeno (Hrsg.) Politik besser verstehen Neue Wege der politischen Bildung I VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN - + I I VS VERLAG FOR SOZIAlWI$SENSCHAnEN
Georg Weißeno (Hrsg.) Politik besser verstehen Georg Weißeno (Hrsg.) Politik besser verstehen Neue Wege der politischen Bildung I VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN - + I I VS VERLAG FOR SOZIAlWI$SENSCHAnEN
Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule
 Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule Schule und Gesellschaft Band 54 Herausgegeben von Franz Hamburger Marianne Horstkemper Wolfgang Melzer Klaus-Jürgen Tillmann Philipp
Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule Schule und Gesellschaft Band 54 Herausgegeben von Franz Hamburger Marianne Horstkemper Wolfgang Melzer Klaus-Jürgen Tillmann Philipp
Christoph Butterwegge Gudrun Hentges (Hrsg.) Massenmedien, Migration und Integration
 Christoph Butterwegge Gudrun Hentges (Hrsg.) Massenmedien, Migration und Integration Interkulturelle Studien Band 17 Herausgegeben von Georg Auernheimer Wolf-Dietrich Bukow Christoph Butterwegge Hans-Joachim
Christoph Butterwegge Gudrun Hentges (Hrsg.) Massenmedien, Migration und Integration Interkulturelle Studien Band 17 Herausgegeben von Georg Auernheimer Wolf-Dietrich Bukow Christoph Butterwegge Hans-Joachim
Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis. Kompetenz in der Hochschuldidaktik
 Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in der Hochschuldidaktik Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in
Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in der Hochschuldidaktik Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in
Dagmar Simon Andreas Knie Stefan Hornbostel (Hrsg.) Handbuch Wissenschaftspolitik
 Dagmar Simon Andreas Knie Stefan Hornbostel (Hrsg.) Handbuch Wissenschaftspolitik Dagmar Simon Andreas Knie Stefan Hornbostel (Hrsg.) Handbuch Wissenschaftspolitik Bibliografische Information der Deutschen
Dagmar Simon Andreas Knie Stefan Hornbostel (Hrsg.) Handbuch Wissenschaftspolitik Dagmar Simon Andreas Knie Stefan Hornbostel (Hrsg.) Handbuch Wissenschaftspolitik Bibliografische Information der Deutschen
Karin Lenhart. Soziale Bürgerrechte unter Druck
 Karin Lenhart Soziale Bürgerrechte unter Druck Karin Lenhart Soziale Bürgerrechte unter Druck Die Auswirkungen von Hartz IV auf Frauen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Karin Lenhart Soziale Bürgerrechte unter Druck Karin Lenhart Soziale Bürgerrechte unter Druck Die Auswirkungen von Hartz IV auf Frauen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Thomas Heinze. Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus
 Thomas Heinze Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus Thomas Heinze Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus Ein Leitfaden für Kulturmanager 4. Auflage Bibliografische Information
Thomas Heinze Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus Thomas Heinze Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus Ein Leitfaden für Kulturmanager 4. Auflage Bibliografische Information
Peter A. Berger Karsten Hank Angelika Tölke (Hrsg.) Reproduktion von Ungleichheit durch Arbeit und Familie
 Peter A. Berger Karsten Hank Angelika Tölke (Hrsg.) Reproduktion von Ungleichheit durch Arbeit und Familie Sozialstrukturanalyse Herausgegeben von Peter A. Berger Peter A. Berger Karsten Hank Angelika
Peter A. Berger Karsten Hank Angelika Tölke (Hrsg.) Reproduktion von Ungleichheit durch Arbeit und Familie Sozialstrukturanalyse Herausgegeben von Peter A. Berger Peter A. Berger Karsten Hank Angelika
Bernhard Schmidt. Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer
 Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive
Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive
Martin Rothland (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf
 Martin Rothland (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Martin Rothland (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Modelle, Befunde, Interventionen Bibliografische Information Der Deutschen
Martin Rothland (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Martin Rothland (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Modelle, Befunde, Interventionen Bibliografische Information Der Deutschen
Oskar Niedermayer (Hrsg.) Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009
 Oskar Niedermayer (Hrsg.) Die Parteien nach der Oskar Niedermayer (Hrsg.) Die Parteien nach der Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Oskar Niedermayer (Hrsg.) Die Parteien nach der Oskar Niedermayer (Hrsg.) Die Parteien nach der Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft
 Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Methoden
Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft Susanne Pickel Gert Pickel Hans-Joachim Lauth Detlef Jahn (Hrsg.) Methoden
Wolf-Dietrich Bukow Claudia Nikodem Erika Schulze Erol Yildiz (Hrsg.) Was heißt hier Parallelgesellschaft?
 Wolf-Dietrich Bukow Claudia Nikodem Erika Schulze Erol Yildiz (Hrsg.) Was heißt hier Parallelgesellschaft? Interkulturelle Studien Band 19 Herausgegeben von Georg Auernheimer Wolf-Dietrich Bukow Christoph
Wolf-Dietrich Bukow Claudia Nikodem Erika Schulze Erol Yildiz (Hrsg.) Was heißt hier Parallelgesellschaft? Interkulturelle Studien Band 19 Herausgegeben von Georg Auernheimer Wolf-Dietrich Bukow Christoph
Christina Holtz-Bacha (Hrsg.) Stereotype?
 Christina Holtz-Bacha (Hrsg.) Stereotype? Christina Holtz-Bacha (Hrsg.) Stereotype? Frauen und Männer in der Werbung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Christina Holtz-Bacha (Hrsg.) Stereotype? Christina Holtz-Bacha (Hrsg.) Stereotype? Frauen und Männer in der Werbung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Ludger Pries. Transnationalisierung
 Ludger Pries Transnationalisierung Ludger Pries Transnationalisierung Theorie und Empirie grenzüberschreitender Vergesellschaftung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Ludger Pries Transnationalisierung Ludger Pries Transnationalisierung Theorie und Empirie grenzüberschreitender Vergesellschaftung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit
 Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionelles Handeln
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionelles Handeln
