Vielfältig lesen und schreiben lernen
|
|
|
- Adolf Diefenbach
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Förderkonzept Vielfältig lesen und schreiben lernen Materialien für die inklusive Praxis
2 Vielfältig lesen und schreiben lernen Anregungen für die inklusive Praxis auf der Basis von Meine Fibel unter wissenschaftlicher Beratung von Katrin Liebers, Annedore Prengel, Ute Geiling Illustration Illustration der Seiten: Jens Reinert Illustration Umschlag, S. 15: Tanja Székessy Layout Umschlaggestaltung und Layoutkonzept: Corinna Babylon Layout und technische Umsetzung: Corinna Babylon, Saskia Klemm Redaktion Monika Gade Auflage, 1. Druck Cornelsen Verlag / Volk und Wissen Verlag, Berlin Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den 46, 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Druck: Druckhaus Berlin-Mitte GmbH P L Inhalt gedruckt auf säurefreiem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
3 Gliederung 1 Einleitung 4 2 Grundlagen der inklusiven Praxis Pädagogische Grundlagen: Warum sollen alle Kinder als gleich und als verschieden anerkannt werden? Grundlagen des Rahmenlehrplans: Wie sind Standardisierung und Individualisierung auszubalancieren? Didaktische Grundlagen: Wie arbeitet man im inklusiven Unterricht? Die Fibel als Grundlage einer inklusiven Didaktik? 9 3 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik Weshalb sind Lernstandsanalysen hilfreich für inklusive Didaktik? In welchen Stufen lernen Kinder lesen und schreiben? Wie kann man im Alltag feststellen, auf welcher Stufe des Schriftspracherwerbs sich ein Kind befindet? Wie arbeitet man mit dem Stufenmodell? 17 4 Pädagogische Angebote zu den Stufen des Schriftspracherwerbs mit Meine Fibel und weiteren Ergänzungsmaterialien 18 5 Kooperation und Entlastung Entlastung durch Zusammenarbeit im Team Zusammenarbeit mit Eltern Entlastung bei Verhaltensproblemen im ersten Schuljahr 30 6 Ausblick 32 7 Literatur 33 8 Anhang: Kopiervorlagen, Tabellen, Bilderlesebild und Kinderbuchempfehlungen 37 3
4 Kap. 1 Einleitung Seit die UN-Behindertenrechtskonvention am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist, ist in allen Bereichen des Bildungswesens eine neue Aufmerksamkeit für die Heterogenität von Lerngruppen entstanden. Jetzt geht es darum, niemanden mehr auszuschließen und alle Lernenden in eine gemeinsame Schule aufzunehmen. Das Bildungswesen soll inklusiv werden. Schulische Inklusion lässt sich sehr einfach definieren: Inklusiv ist ein Unterricht, der mit seinen pädagogischen Angeboten jedes Kind willkommen heißt. Das Gleichheitsrecht auf Bildung und die Individualität der Lebenslagen und Lernwege sollen anerkannt werden. Inklusive Didaktik fordert dabei jedes Kind in seiner persönlichen Leistungsfähigkeit heraus. 4
5 Grundlagen der inklusiven Praxis Kap Pädagogische Grundlagen: Warum sollen alle Kinder als gleich und als verschieden anerkannt werden? Für den Anfangsunterricht sind folgende Einsichten grundlegend: Schulanfänger unterscheiden sich in ihren Lebenserfahrungen und Lernvoraussetzungen. Kinder haben, wenn sie eingeschult werden, auch zur Welt der gesprochenen und der geschriebenen Sprache ganz verschiedene Zugänge entwickelt. Dazu gehört, dass die sprachlichen Entwicklungs - stände unterschiedlich sind oder dass manche Kinder Deutsch als zweite Sprache erst noch erlernen müssen. Wenn in inklusiv arbeitenden Grundschulen z. B. auch Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung willkommen geheißen werden, wird es vorkommen, dass Einzelne die Schriftsprache nicht oder nur in Ansätzen für sich erschließen können. Diese Vielfalt der sprachlichen und schriftsprachspezifischen Lernvoraussetzungen geht einher mit einer Fülle anderer Differenzen, die das Leben und Lernen der Schulanfänger prägen: Kinder haben sehr verschiedene vorschulische Erfahrungen in den Bereichen der späteren Fächer in der Grundschule gemacht, so dass manche hinsichtlich der Lernvoraussetzungen in allen schulischen Bereichen schon weit und andere durchschnittlich entwickelt sind, während noch andere sich erst langsam herantasten. Kinder haben sehr verschiedene Erfahrungen als Mädchen und Jungen gemacht. Auch innerhalb jedes Geschlechts finden wir große Unterschiede, denn manche wollen typische Mädchen und Jungen sein, während andere genau das nicht wollen und Geschlechtergrenzen überschreiten. Kinder haben sehr verschiedene Erfahrungen mit ihrer sozialen Herkunft gemacht. Manche Kinder leiden unter materieller Armut und andere leben im Überfluss, viele Kinder werden relativ ange - messen versorgt. Kinder haben sehr verschiedene Erfahrungen in ihren Familien gemacht, denn manche genießen eine sichere, vertrauensvolle Bindung an ihre Eltern, an Großeltern und Geschwister; andere leiden unter emotionaler Unzuverlässigkeit. In Ausnahmefällen erleiden kleine Kinder sogar Gewalt in Form von Vernachlässigungen, Misshandlungen, psychischen Verletzungen oder sexuellem Missbrauch. Kinder haben gegebenenfalls sehr verschiedene Erfahrungen als Angehörige unterschiedlicher Kulturen gemacht und gehen verschieden mit ihren kulturellen Erfahrungen und ihrem Leben in der heutigen Einwanderungsgesellschaft um. Kinder haben sehr verschiedene Erfahrungen mit anderen Kindern gemacht, so dass manche viele Freundinnen und Freunde haben und andere in der Kindergruppe einsam sind oder Ablehnung erfahren. Gerade Kinder, die zu Hause wenig Halt haben, neigen dazu, entweder kontaktscheu oder aggressiv zu werden; das führt dazu, dass gerade diejenigen, die gute Beziehungen zu Gleichaltrigen am dringendsten brauchen, eher von diesen abgelehnt werden. Kinder haben verschiedene Erfahrungen mit den eigenen körperlichen und geistigen Möglichkeiten gesammelt. Manche Kinder haben sich unter der Bedingung körperlicher, seelischer, geistiger oder Sinnesbeeinträchtigung zum Schulkind entwickelt. Wenn in der Bildungstheorie diese vielfältigen Differenzen thematisiert werden, spricht man von sogenannten Heterogenitätsdimensionen, die sich über schneiden. Denn wie alle anderen Menschen werden neu eingeschulte Kinder gleichzeitig mehreren ganz verschiedenen sozialen Gruppierungen zugerechnet. Heterogenität ist ein bedeutendes Thema der Pädagogik geworden und hat sich in der Gestaltung zahlreicher Lernmedien und Schulbücher niedergeschlagen. So kommt es auch in der Fibel Meine Fibel in Bildern und Texten zum Ausdruck, da die 5
6 Kap. 2 Grundlagen der inklusiven Praxis abgebildeten Menschen in ihrer Verschiedenheit zu erkennen sind. Aus der Entwicklungspsychologie und aus pädagogischen Theorien wissen wir, dass jedes Kind von klein auf Anerkennung braucht. Kinder können sich nur gut entwickeln, wenn sie von den für sie wichtigen Menschen, den Erwachsenen und Kindern in ihrer Umgebung, verlässlich anerkannt werden. Auch die in der Erziehung notwendigen Anforderungen, Zumutungen und Grenzen müssen von einer solchen grundsätzlichen, Halt gebenden Anerkennung getragen sein. Kognitives Lernen gelingt in allen Lernbereichen umso besser, je klarer jedes Kind die Erfahrung macht, angenommen zu sein. Wenn Kinder in ihren ersten Versuchen beginnen, etwas zu lesen und etwas zu schreiben, ist es für sie äußerst wichtig, dass andere Menschen, Kinder und Erwachsene, anerkennend und bestärkend darauf reagieren. In ganz hohem Maße gilt das für Kinder, die am Anfang ihrer schriftsprachlichen Entwicklung stehen und deren Versuche noch vorsichtig und tastend sind, so dass Lehrkräfte in allen Aktivitäten und Produkten des Kindes die Anstrengung oder den Fortschritt erkennen und würdigen sollten. Aus den hier erläuterten pädagogischen und ethischen Grundlagen folgt: Jedes Kind braucht Anerkennung bei seinen Versuchen, sich der Schriftsprache anzunähern. Das gilt auch dann, wenn einem Kind zum Beispiel der Zugang zur Schriftsprache auf Grund langfristiger, gravierender Beeinträchti gungen voraussichtlich nicht vollständig gelingen wird. Und in jedem Kind, auch in den Kindern, die wir als sehr schulschwach empfinden, sind schon Kompetenzen angelegt, auf denen die nächsten Lernschritte aufbauen können. Darum gilt als Leitsatz einer inklusiven Pädagogik: Jedes Kind ist auf seiner Stufe kompetent. Zugleich haben Lehrerinnen und Lehrer die Aufgabe, bei der Akzeptanz bestehender kindlicher Kompetenzen nicht stehen zu bleiben, sondern Kinder zum Erreichen der Zone der nächsten Entwicklung, und damit zum Erwerb von neuen Kompetenzen, anzuleiten und anzuspornen. Daraus folgen konkrete Regeln für die Art und Weise, wie man professionell Rückmeldung gibt auf schriftliche oder mündliche Leistungen von Kindern: 1. Die vorgelegte Leistung sachlich benennen. (Beispiel: Ich sehe, du hast die Buchstaben, die Wörter geschrieben. Ich sehe, du kannst jetzt ). Entsprechend kann auch in einem Dialog das Kind selbst seine Leistung benennen (Beispiel: Sag mir, was du geschrieben hast oder Warum hast du das so geschrieben? ). Dabei kann die Lehrerin auch ihre Wertschätzung oder Freude zum Ausdruck bringen. 2. Eine erbrachte Leistung nicht negativ kommentieren! (zum Beispiel Wendungen wie die folgenden vermeiden: Gefällt mir noch nicht, wie du geschrieben hast, Was du geschrieben hast, ist falsch ) 3. Die darauf aufbauende Anforderung ermutigend benennen. (Beispiel: Als Nächstes möchte ich, dass du wieder einen Text schreibst und dabei den Rand einhältst, oder dass du jeden Satz mit einem groß geschriebenen Wort beginnst ). Entsprechend kann auch das Kind selbst seine nächste Anforderung benennen (Beispiel: Sag mir, was du als Nächstes noch besser machen kannst. Sag mir, was du als Nächstes schreiben möchtest. Im Dialog mit dem Kind kann geantwortet werden: Ja, das ist jetzt eine gute Idee. Oder: Diesen Vorschlag finde ich jetzt nicht so sinnvoll, es ist mir wichtig, dass du zuerst noch einmal übst. ) 4. Wenn der Eindruck entsteht, dass ein Kind keine Leistung erbracht hat, geht es darum danach zu fragen, was es beschäftigt und Anforderungen zu formulieren, die an seinem Leistungsvermögen und an seinen Interessen anknüpfen. Eine solche Form der sachlichen Rückmeldung kann im Anfangsunterricht auf Unzufriedenheit verzichten und gerade deshalb Kinder zu Anstrengungsbereit- 6
7 Grundlagen der inklusiven Praxis Kap. 2 schaft und guten Leistungen motivieren. In der zweischrittigen Form des Lehrerkommentars, in Worte fassen, was das Kind jetzt kann und in Worte fassen, was das Kind als Nächstes bearbeiten soll, beziehungsweise, was es bearbeiten will, kommt ein Herzstück einer anerkennungsbasierten inklusiven Didaktik zum Ausdruck. Diese Art des Umgangs mit Kindern ist nicht zu verwechseln mit Lobhudelei oder Laisser-faire, sie stellt vielmehr hohe Anforderungen an die Kinder und die Lehrpersonen und beruht auf der Beobachtung, dass Kinder sich am Schulanfang danach sehnen, in ihrer Tüchtigkeit und Leistungsbereitschaft anerkannt zu werden. 2.2 Grundlagen des Rahmenlehrplans: Wie sind Individualisierung und Standardisierung auszubalancieren? Die Anerkennung der individuell verschiedenen Kompetenzen wird im gemeinsamen Rahmenlehrplan für die Grundschulen der Länder Brandenburg, Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern beschrieben. Dort heißt es: Die Grundschule ist Lernstätte und Lebensraum für Schülerinnen und Schüler mit einer großen Heterogenität hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten (Rahmenlehrpläne 2004, S. 3). Zugleich finden sich im Rahmenlehrplan selbstverständlich auch Angaben dazu, was die Schülerinnen und Schüler lernen sollen. So heißt es: In den Rahmenlehrplänen beschreiben Standards, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den Fächern bis zum Ende der Grundschulzeit entwickelt haben müssen (Rahmenlehrpläne 2004, S. 6). Für Kinder mit besonderen Förderschwerpunkten gelten bei zielgleicher Inklusion die Standards ebenfalls, bei zieldifferenter Inklusion in adaptierter Form. Wenn man die beiden Zitate aus dem Rahmenlehrplan liest, stellt man sich die Frage, ob darin nicht ein großer Widerspruch, der Lehrerinnen und Lehrer sehr belasten kann, angelegt ist: Einerseits sollen die Lehrkräfte jedes Kind individuell anerkennen, andererseits sollen sie so unterrichten, dass alle Kinder gleiche Kompetenzen bis zum Ende der Grundschulzeit entwickelt haben. Wie man oben sehen kann, wird sogar formuliert, dass Kinder diese Kompetenzen entwickeln müssen. Konkret wird zum Schriftspracherwerb in den Anforderungen zum Ende der Jahrgangsstufe 2 erwartet, dass Kinder geübte Texte flüssig lesen, einen Übungs- bzw. Mindestwortschatz richtig schreiben und erste Lese- und Rechtschreibstrategien und Arbeitstechniken ausgebildet haben. Zugleich bedeutet die Realisierung von inklusiver Pädagogik aber auch, dass Verschiedenheit ganz normal dazugehört und dass Kinder, die sich auf anderen, früheren oder späteren, Stufen des Schriftspracherwerbs befinden genauso akzeptiert werden. Individualisierung und Kompetenzorientierung lassen sich dann verknüpfen, wenn daran gearbeitet wird, dass jedes Kind, soweit es irgend möglich ist, in seinem Lernprozess vorankommt. Daraus folgt für den Schriftspracherwerb, dass für alle Kinder die gleichen Lernziele bezogen auf die Anforderungen zum Lesen- und Schreibenlernen gelten, dass diese Ziele jedoch zu individuell unterschiedlichen Zeiten, auf unterschiedlichen methodischen Wegen, mit unterschiedlichen Hilfen durch die Lehrerinnen und anhand unterschiedlicher Lernmittel erreicht werden können. Das ist eine Möglichkeit beim Schriftspracherwerb Individualisierung und Standardisierung in der Arbeit mit heterogenen Lerngruppen auszubalancieren. Zukünftige Rahmenlehrpläne werden diese Gedanken noch stärker aufgreifen und auf heterogene Lernausgangslagen deutlicher Bezug nehmen, um inklusive Lernangebote im Anfangsunterricht abzubilden. Die Auseinandersetzung mit den Standards des Rahmenlehrplans macht bewusst, dass die Anerkennung von Heterogenität nicht etwa gleichzusetzen ist mit einer Akzeptanz für die bei den Kindern gegebenen Lernausgangslagen oder gar Resignation angesichts fehlender Voraussetzungen bedeutet. 7
8 Kap. 2 Grundlagen der inklusiven Praxis Sie muss vielmehr einhergehen mit dem hohem Engagement und großer Anstrengung der Lehrer und Kinder für die Verbesserung der Schulleistungen. 2.3 Didaktische Grundlagen: Wie arbeitet man im inklusiven Unterricht? Für inklusive Didaktik gelten allgemeine didaktische Annahmen, die prinzipiell für jeden guten Unterricht grundlegend sind. Dabei erscheint ein an der Lernentwicklung orientiertes Vorgehen als besonders erfolgversprechend. Ein solcher Unterricht hat unter pädagogischer Perspektive die Förderung der Persönlichkeit des Kindes und seiner Leistungsentwicklung im Blick, aus didaktischer Perspektive ergibt sich daraus eine Orientierung an den Leistungsständen jedes einzelnen Kindes. Das Konzept eines an der Entwicklung orientierten Unterrichts, nimmt die jeweiligen Lernvoraussetzungen, das Wissen und die Strategien von Kindern in den Blick, um darauf aufbauend Lernangebote bereitzustellen, die individuell passfähig sind. Das Lernen jedes Kindes wird durch Prozessdiagnostik begleitet, denn didaktisch vorrangig sind beim Schriftspracherwerb Denkaktivitäten der Kinder und ihre kognitiven Strategien. Eine solche Didaktik beruht auf vier Leitfragen: Wie ist der aktuelle Lernstand des Kindes? Welche Deutung habe ich dazu vor dem Hintergrund meines Wissens über das Kind, seine Interessen und Themen und sein Umfeld? Was könnten Nahziele im Hinblick auf die in Standards formulierten Fernziele sein? Mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen kann das Kind diese Ziele erreichen? Ein entwicklungsorientierter, inklusiver Unterricht lässt sich durch zwei komplementäre Grundmuster beschreiben, nämlich individualisierte Lernsituationen auf der einen Seite, die sich streng an den Lernbedürfnisse eines Kindes orientieren und gemeinsame Lernsituationen auf der anderen Seite, die das gemeinsame Arbeiten der Kinder herausfordern und Kooperation verlangen. Individualisierender Unterricht ermöglicht es jedem Kind auf seinem Niveau und mit seinen aktuellen Möglichkeiten Fähigkeiten aufzubauen, erfolgreich zu üben, Fertigkeiten zu sichern und stellt dafür aus reichende Zeit zur Verfügung, z.b. durch tägliche Zeiten der Arbeit mit einem Tages- oder Wochenplan nach eigenem Programm. Basis für derart individuelle Lerngänge sind in der Regel adaptive Lernmaterialien, die aufeinander aufbauen und Lernbegleithefte oder Portfolios, in denen das persönliche Fortschreiten dokumentiert werden kann. Eine theoretische Perspektive, die hinter dieser Didaktik steht, ist der Ansatz von Wygotski (1934), der das Voranschreiten von der Zone der aktuellen Leistung zur Zone der nächsten Entwicklung fokussiert und damit eine Anleitung für die Gestaltung individueller Lernsituationen gibt. Neben der oben beschriebenen individuellen Förderung in koexistenten Lernsituationen, in denen Kinder zur gleichen Zeit und im gleichen Raum an unterschiedlichen Zielen zum Beispiel des Schriftspracherwerbs arbeiten, braucht ein inklusiver Unterricht nach Wocken (1998) auch gemeinsame Lernsituationen, die das soziale Miteinander der Kinder fördern und Kooperationen verlangen. Dazu gehören: A Kooperative Lernsituationen In kooperativen Lernsituationen arbeiten die Schüler an gemeinsamen Zielen und Aufgabenstellungen, wozu jeder Schüler seinen Beitrag leistet (solidarische Lernsituationen). Diese Beiträge können sich in der 8
9 Grundlagen der inklusiven Praxis Kap. 2 Zusammenschau ergänzen, d. h. nicht alle Kinder machen das Gleiche. Wenn Lesetexte der Fibel bearbeitet werden, können Kinder je nach ihrer Lesefähigkeit unterschiedliche Aufgaben zum Textverstehen übernehmen. Manche Kinder werden nur kleine Abschnitte lesetechnisch bewältigen oder etwas zum Text malen können, andere können Fragen zum Text mündlich und schriftlich beantworten oder eigene Fragen an den Text formulieren, Fortsetzungsgeschichten schreiben oder ein erstes Lesetagebuch führen. In einer abschließenden gemeinsamen Präsentation können alle diese Beiträge zusammen zu einem vertieften Textverständnis für alle Kinder führen. Kooperatives Lernen kann auch bedeuten, dass Kinder eigene Ziele verfolgen, dafür aber Kooperationspartner benötigen, z. B. beim Partnerdiktat oder bei Freiarbeitsangeboten (komplementäre Lernsituationen). Ebenso können Kinder im Stationenlernen oder in Sprach- und Lesewerkstätten Verantwortung für einzelne Aufgaben oder Stationen, also einen Expertenstatus, übernehmen. Die jeweiligen Experten für eine Station oder eine Aufgabe überprüfen die Lösungen anderer Kinder und helfen ihnen gegebenenfalls bei der Bearbeitung. B Subsidiäre Lernsituationen In subsidiären Lernsituationen helfen sich Schüler gegenseitig zum Beispiel durch Patenschaften oder auch durch spontane Kooperationen, in dem sie z. B. Tipps und Hinweise bei schriftlichen Arbeiten im Tagesplan geben, Denkanstöße für Aufgabenlösungen und Motivationen unterstützen, dabei aber weiter ihre eigenen Ziele und Aufgaben verfolgen. C Kommunikative Lernsituationen In kommunikativen Lernsituationen steht weniger ein didaktisch geplanter Inhalt im Mittelpunkt, sondern es werden Themen aus dem gemeinsamen Handeln miteinander zum Gegenstand des Austauschs. Diese Form des Austauschs ereignet sich oft spontan und findet Raum in Pausen, im Morgenkreis und im offenen Anfang. Hieraus können für den Schriftspracherwerb jedoch persönlich bedeutsame Inhalte abgeleitet werden, z. B. das Schreiben von Einladungen und kleinen Entschuldigungsbriefen oder die Auswahl gemeinsamer Vorlese-Literatur, in der ähnliche Sachverhalte eine Rolle spielen (siehe auch Anhang zu empfohlener Kinderliteratur). 2.4 Die Fibel als Grundlage einer inklusiven Didaktik? Ein Fibellehrgang ist eine alte und bewährte didaktische Methode, um auf gesicherten Wegen in überschaubaren Schritten Kinder einer Klasse lesen zu lehren und Wege zum Schreiben zu bereiten. Vorteile des Fibellehrgangs liegen darin, dass jedes Kind über ein eigenes bedeutsames Buch verfügt, mit dem abgesichert werden soll, dass alle Buchstaben und Laute in methodisch bewährter Abfolge angeboten werden und für eine vollständige Analyse und Synthese der Sprachwörter beim Erlesen und beim Schreiben verfügbar sind. Nach dem Prinzip Isolation der Schwierigkeiten werden zunächst einfache, lautgetreue Wörter im Lehrgang eingeführt. Zur schnellen Bildung von sinnvollen Sätzen werden zugleich vier Ganzwörter eingeführt. Schwierige Buchstabenverbindungen (st, sp, sch, ng, nk ) kommen erst später hinzu. Auch die Silbenarbeit findet Berücksichtigung. Im inklusiven Unterricht erfordert die Arbeit mit der Fibel die Einsicht, dass jedes Kind in seinem Tempo und auf seinen Wegen zur Schriftsprache gelangt. Ein von der Lehrerin gestalteter Leselehrgang, der die individuellen Zugänge von Kindern zur Schriftsprache 9
10 Kap. 2 Grundlagen der inklusiven Praxis berücksichtigen will, wird nicht gleichschrittig voranschreiten können, weil ein solcher Unterricht nur für einen Teil der Kinder einer Klasse passend wäre. Sonst werden diejenigen Schülerinnen und Schüler überfordert, die sich noch auf einer sehr frühen Vorstufe des Schriftspracherwerbs befinden und andere Kinder werden unterfordert, die schon selbstständig lesen können. Viele Lehrkräfte stellen sich darum folgende Fragen: Wie kann ich in einem lehrgangsorientierten Anfangsunterricht mit der Fibel arbeiten und gleichzeitig den verschiedenen kindlichen Lernausgangslagen in meiner Klasse gerecht werden? Wie kann ich die individuelle Eigentätigkeit der Kinder und für sie bedeutsame Inhalte mit meiner systematischen Anleitung der gesamten Klasse verbinden? sind. Es muss jedoch sehr darauf geachtet werden, dass sie nicht zu Misserfolgserlebnissen gedrängt werden, indem sie zum Vorlesen aufgerufen werden, obwohl sie diese Stufe noch gar nicht erreicht haben. Inklusive Didaktik im Anfangsunterricht, die ernst nimmt, dass Kinder auf ihrem Weg zum Lesen und Schreiben bisher sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, hat Konsequenzen für die pädagogische Diagnostik. Wenn Lehrerinnen und Lehrer mit ihren pädagogischen Angeboten die Kinder erreichen wollen, müssen sie wissen, was die verschiedenen Kinder in ihrer Klasse schon können und was sie noch nicht können. Die Fibel selbst nutzt unterschiedliche Darbietungsformen des sprachlichen Materials innerhalb des Lehrgangs. Sie enthält auf vielen Seiten Differenzierungsangebote. Spezielle Wiederholungsseiten (S. 16/17, 38/39, 54/55, 68/69, 80/81) bieten sich zum Verweilen an und festigen erneut den Stoff. Die Seiten können auch der Lernstandserfassung dienen. Zudem liefert die Reihe Meine Fibel eine Vielzahl von Zusatzmaterialien, die individuelle pädagogische Angebote unterstützen. Hierzu zählen zum Beispiel der Förderkoffer, indem sich handlungsorientierte didaktische Spielmaterialien befinden, differenzierte Arbeitshefte, der handlungsorientiert ausgerichtete Arbeitsblock, das Lese-Mal-Heft, die CD-ROM, die Ideenbox für jahrgangsübergreifenden Unterricht sowie das Heft Meine kleine Fibel. Die Fibel Meine Fibel bietet von der logographemischen Stufe an Arbeitsmöglichkeiten für alle folgenden Stufen des Schriftspracherwerbs. Kinder, die sich noch auf den Vorstufen befinden, profitieren davon, dass sie die Arbeit der anderen Kinder mit der Fibel miterleben und selbst im Besitz des gleichen Buches 10
11 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik Kap Weshalb sind Lernstandsanalysen eine Grundlage der inklusiven Didaktik? Lernstandsanalysen dienen dazu, auf die erste Leitfrage einer inklusiven Didaktik eine Antwort geben zu können, indem sie die vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen der Kinder ermitteln. Diese Aufgabe ist nicht einfach, denn sie schließt vielschichtige Aspekte des kindlichen Lernens ein. Dazu gehören neben den verschiedenen Lernausgangslagen auch verschiedene Lerngeschwindigkeiten, verschiedene Lernstile, verschiedenen Themen und Interessen der Kinder sowie die Erfahrungen aus ihrer Lebenswelt, mit denen ein Zugang zu ihrem Lernen hergestellt werden kann. Die Lernstandsanalyse ist darum keine einmalige Angelegenheit zu Beginn des ersten Schuljahres, sondern eine wiederkehrende Lehreraktivität während des gesamten Schuljahres. Die Frage nach dem aktuellen Lernstand des Kindes schließt deshalb zum Beispiel folgende Dimensionen im Bereich Schriftsprache mit ein: 1. Bisherige Erfahrungen mit Büchern und Schriftkultur sowie Buchstaben- und Wortkenntnisse eines jeden Kindes am Anfang (Grund: Die Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche Voraussetzungen und Vorerfahrungen.) 2. Lese- und Schreibkompetenzen eines Kindes zu verschiedenen Zeitpunkten im Schuljahr und beobachtbare Fortschritte (Grund: Die Schülerinnen und Schüler kommen verschieden schnell in Erwerb, Entfaltung und Automatisierung voran.) 3. Gegenwärtig für das Kind wichtige Themen und Interessen (Grund: Die Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche Interessen, Vorlieben, soziale, familiäre und kulturelle Erfahrungen, deren Berücksichtigung die Motivation, die Aufmerksamkeit für Texte und die Ausdauer beim Üben unterstützen können.) Auf der Basis der Ergebnisse der Lernstandsanalyse können dann die bereits auf S. 8 genannten Fragen inklusiver Didaktik beantwortet und ein Unterricht geplant werden, der an den individuellen Lernvoraussetzungen anschließt und passfähige Angebote für jedes Kind bereitstellt. Um die anspruchsvolle Aufgabe der Lernstandsanalysen im ersten Schuljahr zu erleichtern, gibt es mehrere Hilfsmittel. So können Beobachtungen mithilfe von Stufenmodellen ausgewertet werden. Die Tabellen für die Hand der Lehrkräfte können ergänzt werden um Lernpässe für die Hand der Kinder (vgl. Anhang), so dass auch die Kinder selbst wissen, wo sie stehen und welche nächsten Schritte anstehen. Tabellen und Lernpässe sind auch hilfreich für informative Gespräche mit den Eltern. (siehe Punkt 5.2) 3.2 In welchen Stufen lernen Kinder lesen und schreiben? Wenn Lehrkräfte die Lernstände ihrer Erstklässler kennenlernen möchten, können sie auf ein sehr nützliches Hilfsmittel zurückgreifen: auf Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs. In solchen entwicklungsorientierten Stufenmodellen wird der Erwerb von kog nitiven Strategien auf dem Weg zur Schrift beschrieben. Zugleich werden damit wissenschaftlich fundierte Formulierungen zur Verfügung gestellt, die dazu dienen, die verschiedenen kindlichen Kompetenzen in der Zone der aktuellen Entwicklung angemessen in Worte zu fassen und daraus zu jeder Stufe passende pädagogische Angebote abzuleiten. Allerdings können sie allein noch nicht nächste Lernschritte erklären. Unter Berücksichtigung der Lebenssituation des Kindes, seiner individuellen und familiären Ressourcen sowie seiner Interessen können Lehrer innen im Hinblick darauf, was das Kind als Nächstes lernen soll, Ideen und Hypothesen über weitere För der angebote konzipieren. Für das Verständnis von Stufenmodellen ist wichtig, dass sie nur Hilfsmittel sind, um den Weg der Kinder zur Schrift annähernd zu verstehen. Wir müssen uns klarmachen, dass Kinder nicht immer so gradlinig Stufe für Stufe voranschreiten, wie es im Modell veranschau- 11
12 Kap. 3 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik licht wird. Lernen findet oft auch durch Umwege, Rückschritte, Sackgassen, in Spiralen und manchmal auf Überholspuren statt. Es ist also selbstverständlich, dass das, was Sie in der Realität des Klassenraums erleben, stark vom gewählten Stufenmodell abweichen kann. Dennoch können diese Modelle überaus hilfreiche Orientierung für individuelle Lernwege von Kindern geben. In den wissenschaftlichen Forschungen zur Didaktik des Erstunterrichts Deutsch wurden zwar mehrere Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs entwickelt, sie weisen aber in wesentlichen Merkmalen Gemeinsamkeiten auf (vgl. z.b. Helbig u. a. 2005; Scheerer-Neumann u.a. 2009; Dehn 2007). In den folgenden Abschnitten präsentieren wir ein vereinfachtes, klares, im Schulalltag praktikables Modell aus sechs Stufen, das auf den Untersuchungen zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beruht und auf diejenigen Stufen fokussiert, die im inklusiven Anfangsunterricht wichtig sind. Deswegen sind die Stufen populärer Modelle hier ergänzt um ausdifferenzierte Vorstufen, um für alle Kinder in inklusiven Klassen Kompetenzen beschreiben zu können. Diese Stufen des Schriftspracherwerbs sind nicht an bestimmte Altersstufen, sondern an erworbene Einsichten in die Struktur der Schriftsprache gebunden. Sie beschreiben Strategien des Umgehens mit Schrift. Damit sind sie unabhängig vom Alter für jeden Leseund Schreiblernprozess aussagefähig. Teilweise überschneiden sich die Stufen. So kann es vorkommen, dass ein Kind noch nicht vollständig alphabetisiert ist, also noch nicht alle Buchstaben entsprechenden Lauten zuordnen kann, und gleichzeitig schon häufig gelesene oder persönlich wichtige Wörter flüssig lesen kann. Andererseits können auch geübte Leser bei wenig geläufigen Wörtern auf das buchstabenweise Erlesen zurückgreifen. Deshalb wird von dominierenden Strategien gesprochen, die das Kind nutzt, zugleich greift es immer wieder auch auf frühere Strategien zurück oder nutzt bereits erworbene Elemente nachfolgender Strategien. Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung von Lesen und Schreiben nicht gleichzeitig erfolgen muss; es kommt vor, dass Kinder beim Lesen weiter fortgeschrittene Strategiestufen nutzen als beim Schreiben und umgekehrt. 1 Basale Strategien Auf dieser frühen Entwicklungsstufe, die gleich nach der Geburt einsetzt, werden visuelle, akustische und haptische Erfahrungen mit Situationen, Personen, Sachen und Sprache gemacht. Kinder erleben, dass alle diese Dinge Bedeutungen für ihr Leben haben und können diese zunehmend erschließen. So können Kinder Blickkontakt zu Bedeutungsträgern (Baby-Bilderbuch, Gesten) richten und Situationen deuten sowie erste Spuren, zum Beispiel im Sand, selbst erzeugen, auch wenn diese noch nicht mit konkreten Bedeutungen belegt sein müssen. 2 Präliterale Strategien Kinder auf dieser Stufe haben erste Einsichten in die kommunikative Funktion von Zeichen und Schrift entwickelt. Sie wissen, dass Symbole und Zeichen, z. B. eine Eistüte, Logos und Markennamen konstante und wiederabrufbare Bedeutungen tragen, die mithilfe von Sprache wiedergegeben werden können. Sie können sich Bilderbücher anschauen, zwischen Bildern und Text unterscheiden und Abbildungen deuten und kommentieren. Kinder erkennen Zeichen, Symbole und Schrift in ihrer alltäglichen Umgebung und haben erste Vorstellungen zu Buchstaben, Wörtern und Texten ent wickelt. In spielerischen Situationen werden Lesen und Schreiben als bedeutungsvolle Tätigkeiten imitiert, z. B. in Kritzelbriefen, Arztrezepten oder Speisekarten. Beim sogenannten Als-ob-Lesen sitzen Kinder in Lesehaltung mit dem Buch, das durchaus auch verkehrt herum gehalten werden kann, und sprechen im verfremdeten Erzählstil. Sie lesen manchmal auch erstaunlich lange Passagen korrekt auswendig gelernt vor. 12
13 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik Kap. 3 3 Logografemische Strategie Kinder auf dieser Stufe erkennen Buchstaben und Wörter bereits ganzheitlich wieder, insbesondere an markanten Buchstaben- oder Wortformen, z.b. Zoo oder Taxi. Die Buchstaben und Wörter werden weitgehend als visuelle Bilder geschrieben und gelesen, ohne dass der Lautwert der verwendeten Buchstaben schon im Einzelnen bewusst ist. Die phonlogische Bewusstheit im weiten Sinne entfaltet sich. Kinder beschäftigen sich nun unabhängig vom konkreten Inhalt mit der Struktur der Sprache; so gelingen das Reimen und Silbenklatschen zunehmend besser. Eine Vielzahl von Kindern kann den eigenen Namen weitgehend richtig aufschreiben und erkennen. Viele Kinder können auch den Namen von Geschwistern und Freunden sowie für sie wichtige Wörter wie z.b. Mama, Papa und Oma aus dem Gedächtnis schreiben, ohne dass ihnen das alpha betische Prinzip der Schriftsprache schon zugänglich ist. Es kann also gut vorkommen, dass Buchstaben des Namens in variabler Reihenfolge, auch in spiegelschriftlicher Form und mit Wiederholungen aneinandergereiht werden. 4 Beginnende alphabetische Strategie Kinder, die beginnen, die alphabetische Strategie zu nutzen, haben den Zusammenhang von Gesprochenem und Geschriebenen erkannt und ver - fügen damit bereits über entwickelte Vorstellungen zur kommunikativen Funktion und zum Aufbau von Schrift, z. B. die Links-Rechts-Orientierung. Dabei ist zu beachten, dass manche Kinder mit Schrifterfahrungen aus dem arabischen Sprachraum auch eine Rechts-Links - Orientierung ausbilden. Beobachtet werden kann weiter, dass Kinder mit Linkshändigkeit aus der Beo bachtung von rechtshändig Schreibenden eine Rechts-Links-Orientierung aufbauen können. Diese Entwicklungen sind zunächst als kognitive Strukturent deckungen eines aktiv lernenden Kindes zu bewerten und zu achten. Zugleich müssen aber diese Kinder die geltenden Konventionen kennen lernen und sich die in unserem Sprachraum gültige Links-Rechts- Orientierung aneignen. Die phonologische Bewusstheit im engen Sinne bildet sich auf dieser Stufe heraus, d.h. Kinder können aus gesprochenen Wörtern zunehmend sicherer Laute heraushören bzw. ganze Wörter in einzelne Laute aufgliedern, was als eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb gilt. Beim Lesen erfolgt ein buchstabenweises Erlesen lautgetreuer Wörter, d. h. Kinder analysieren beim Lesen die Wörter Buchstabe für Buchstabe, übersetzen sie in Laute und fügen sie anschließend zu Wörtern zusammen. Zuweilen wird auch versucht, Wörter aufgrund prägnanter Merkmale und Sinnzusammenhänge ganzheitlich zu entschlüsseln. Beim Schreiben nutzen Kinder ihnen bekannte Buchstaben und zerlegen Gesprochenes kleinschrittig in seine lautlichen Bestandteile, denen dann ein Buchstabe zugeordnet wird. Oftmals schreiben Kinder zunächst noch skeletthaft nur einzelne Buchstaben (Konsonanten und/oder Vokale) für ganze Wörter (F für Frosch, HS für Hase). Auch Spiegelschreibungen kommen vor. Auch hier gilt, dass die Fehler beim Schreiben gleichsam ganz positiv als Entdeckungen des Kindes auf dem Wege zur alphabetischen Struktur unserer Schriftsprache interpretierbar sind. 5 Entfaltete alphabetische Strategie Kinder mit entfalteter alphabetischer Strategie können die Analyse und Synthese beim Lesen vollständig anwenden und zunehmend längere Wörter in bekanntem Kontext erlesen, da immer mehr Wörter sicher im Gedächtnis verankert sind und schneller erkannt werden können. Bei komplizierteren Wörtern erfolgt zum Teil noch ein Dehnlesen mit etwas verzögerter Sinnentnahme. Beim Schreiben können Kinder alle gehörten Laute weitgehend vollständig verschriften, dabei beziehen sie sich auf ihre eigene phonetische Artikulation, z.b. Buta für Butter. In einer Art Recht- 13
14 Kap. 3 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik schreibsprache werden manchmal schreibbegleitend alle Laute des Wortes überdeutlich betont und dann auch so geschrieben, z.b. Khint für Kind. In einigen Fällen erfolgen Übergeneralisierungen von ersten rechtschreiblichen Regeln, bei denen Regeln auch auf Wörter übertragen werden, bei denen sie nicht zutreffen (z.b. Himmbeere). 6 Beginnende lexikalische/orthografische Strategie Kinder mit beginnender lexikalischer Strategie können komplexe Buchstaben-Laut-Beziehungen zunehmend sicherer erfassen. Sie können nun flüssiger lesen, weil ganze Buchstabengruppen und Silben in den Blick genommen und automatisiert gelesen werden. Betonung und Aussprache werden entfaltet. Kinder nutzen den Kontext für die Korrektur von eigenen Lesefehlern. Lesefehler können zum Beispiel aus semantisch und syntaktisch passenden Wortergänzungen bestehen. In der weiteren Entwicklung erfolgt dann eine Automatisierung der vorhandenen Strategien und deren flexible Verwendung, wobei die Textebene für das Verstehen des Gelesenen immer wichtiger wird. Im Hinblick auf das Schreiben berücksichtigen Kinder auf der Stufe der entfalteten orthografischen Strategie orthografische Strukturen und orthografisches Wissen über Wörter und verinnerlichen dabei Schriftmuster. Es entsteht bei den Kindern eine rechtschreibliche Sensibilität. Sie entwickeln Strategien zur Fehlervermeidung und Fehlerkorrektur. In der weiteren Entwicklung werden eine orthografisch korrekte Gestaltung von Texten und die Wahl sprachlicher Mittel für die Kinder bedeutsam. Dieser Text thematisiert diese Stufe nicht ausführlich, weil er sich auf das erste Schuljahr bezieht, in dem Kinder auf einer solch fortgeschrittenen Stufe selten zu finden sind. 3.3 Wie kann man im Alltag feststellen auf welcher Stufe des Schriftspracherwerbs sich ein Kind befindet? Lehrerinnen und Lehrer sehen und hören jeden Tag immer wieder, was die Kinder ihrer Klasse sagen, tun und produzieren. Zugleich geschieht im Klassenraum so viel gleichzeitig, dass es unmöglich ist, stets alle Kinderaktivitäten wahrzunehmen, die für die Analyse von Lernständen bedeutsam sind. Für die Lernstandsanalysen ist darum die Kombination von zwei Zugängen zum kindlichen Lernen hilfreich: Die Analyse kindlicher Leistungen im alltäglichen Unterrichtsgeschehen Die Analyse kindlicher Leistungen anhand von systematischen Instrumenten der pädagogischen Diagnostik Wenn Sie in den ersten Schultagen sehen, wie Kinder malen und kritzeln, wie sie das Schreiben ihres Namens spontan bewältigen, wie sie erste Buchstaben benennen und wie sie darüber hinaus auch sprechen und singen, gewinnen Sie zahlreiche Eindrücke über die individuellen Entwicklungsstände kindlicher Kompetenzen in Ihrer Klasse. In Ergänzung zu den Erkenntnissen, die aus den mündlichen und schriftlichen Äußerungen der Kinder Tag für Tag im Unterricht ersichtlich werden, können auch bestimmte Instrumente der pädagogischen Diagnostik eingesetzt werden. Einige dieser Instrumente werden im Folgenden beschrieben. Einen ersten schnellen Eindruck über die vorhandenen Lesefähigkeiten können Sie mit dem Bild-Lese- Blatt zur Analyse des Standes der Leseentwicklung gewinnen. Die meisten Kinder möchten zeigen, was sie schon alles können. Sie sind stolz auf ihre bereits erworbenen Lese- und Schreibfähigkeiten. Manche Kinder werden jedoch auch Ermutigung benötigen. Das Lese-Bild-Blatt ist so konzipiert, dass jedes Kind der heterogenen Lerngruppe seine Kompetenzen zeigen kann. 14
15 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik Kap. 3 Mo Mimi Mama Papa Oma Opa Sofia Max Mimi und Mo malen. Tim und Mia schreiben Namen mit Kreide. A M I O N L U P R S T E Bild-Lese-Blatt 15
16 Kap. 3 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik Vorgehensweise: Die Lehrerin legt dem Kind das Lese-Bild zu Beginn ihrer Leseanalysen vor. Dies kann innerhalb der ersten Schulwochen, aber auch schon früher, z. B. im Rahmen des Schnuppertages oder in der ersten kleinen Stunde nach der Einschulungsfeier und auch später nach dem Einsetzen des Schriftsprachlehrgangs geschehen. Die Lehrerin fordert das Kind auf, zu erzählen, was auf dem Bild zu sehen ist und alles vorzulesen, was vom Kind schon gelesen werden kann (alle Zeichen, Logos, Buchstaben und Wörter). Gegebenenfalls fragt die Lehrerin gezielt nach einzelnen Zeichen, Logos, Buchstaben und Wörtern. Anhand der Ergebnisse kann ein erster Rückschluss darauf erfolgen, welche Stufe des Lesens vom Kind bereits erworben wurde. Einige Kinder, die bislang noch kaum Interesse und Verständnis für den Aufbau der Schriftsprache entwickeln konnten, werden zum Lese-Bild erzählen und evtl. Bildzeichen und Logos erkennen. Sie befinden sich vermutlich auf einer Vorstufe des Schriftspracherwerbs. Wenn die Kinder bereits auf den Aufbau und die Funktion von Schriftsprache aufmerksam geworden sind, haben sie die logografemische Stufe des Schriftspracherwerbs erreicht. Diese Kinder können Buchstaben aus der Buchstabenreihe am unteren Blattrand benennen oder einige der im Bild enthaltenen Namen und Wörter, wie Zoo und Taxi, lesen, ohne die Laut-Buchstaben-Verbindung im einzelnen zu beherrschen. Andere Kinder sind bereits in der Lage, mithilfe der alphabetischen Strategie zu lesen und können sich einige Wörter oder den ersten Satz auf der Tafel erlesen. In einigen Fällen haben Kinder noch weiter reichende Lesekompetenzen und können bereits den ganzen Text auf der Tafel lesen. Vertiefend können dann feinere Analysen folgen mit Verfahren zur phonologischen Bewusstheit, mit individuellen Lernstandsanalysen, wie sie z.b. mit ILEA 1 im Internet vorliegen, und Verfahren zur Feststellung der Lesefähigkeit wie zum Beispiel den Beobachtungsbögen zur Analyse und Diagnose der Lernentwicklung in den Klassen 1/2 aus den Kopiervorlagen zu Meine Fibel. Wenn Kinder bereits beim Schulstart alphabetische Strategien zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass Lernvoraussetzungen im Bereich der phonologischen Bewusstheit ausgeprägt vorhanden sind. Eine systematische Analyse dieses Bereichs ist eher bei Kindern notwendig, deren Leistungen im Bereich der Vorstufen vermutet werden und für die eventuell gezielte Übungen im Bereich der phonologischen Bewusstheit entwicklungsfördernd eingesetzt werden müssen. Ergänzend kann mit den Kindern das leere Blatt zum Feststellen des Standes der Schreibentwicklung eingesetzt werden, auf dem Kinder alles aufschreiben, was sie schon schreiben können oder etwas malen. Dieses kann auch in Partnerarbeit erfolgen und ebenso nach dem oben beschriebenen Stufenmodell ausgewertet werden. Mo Mimi Sofia Max Mimi und Mo malen. Tim und Mia schreiben Namen mit Kreide. Mama Papa Oma Opa A M I O N L U P R S T E 16
17 Die Stufen des Schriftspracherwerbs ein Instrument der pädagogischen Diagnostik Kap Wie arbeitet man mit dem Stufenmodell? Das oben erläuterte sechsphasige Stufenmodell zum Schriftspracherwerb kann tabellarisch ver anschaulicht werden. Tabellen können dazu dienen, für jedes Kind festzuhalten, auf welcher Stufe es sich zu Anfang des Schuljahres befindet und wann es im Laufe des Schuljahres die folgenden Stufen erreicht. Die Tabellen zum Ausfüllen gibt es im An hang in drei Formen. 1. Als Grobanalyse für die Klassenübersicht (Tabelle 1) 2. Als Feinanalyse zu einzelnen Kindern (Tabelle 2) 3. Als Lernpass für die Hand der Kinder (Tabelle 3) Die tabellarische Dokumentation kann um zwei weitere Medien der pädagogischen Diagnostik ergänzt werden: Leseproben von Kindern auf Tonband oder MP3- Player Sammelmappen mit Kinderarbeiten, die jederzeit direkten Einblick in die Schreibprodukte der Kinder erlauben Notizen in einem Lehrertagebuch, in dem Sie in eigenen Worten wichtige Beobachtungen und Erfahrungen mit den Kindern festhalten können. Sobald Sie Einsicht in die Fähigkeiten der Kinder Ihrer Klasse gewonnen haben, können Sie das entsprechende Datum in den Tabellen festhalten. Eine sorgfältige Dokumentation der Leistungsstände bringt vielfältige Erleichterungen mit sich, da sie hilft, didak tisch gut begründete Entscheidungen zu treffen und fundierte Elterngespräche zu führen. Für die Arbeit mit dem tabellarischen Überblick gilt die weiter oben bereits vorgestellte Regel: Jede Leistung, die ein Kind auf seiner Stufe erbringt, muss anerkannt und gewürdigt werden. Eine Leistung darf nicht als schlecht bezeichnet werden, auch dann nicht, wenn sie nicht den üblichen Erwartungen an Schulanfänger entspricht. Stets gilt, dass die erbrachte Leistung benannt wird. Für eine solche kriteriale, das heißt sachbezogene Rückmeldung, können die Formulierungen des Stufenmodells Anregungen geben. Dazu ein zentrales Beispiel: Auf der alphabetischen Stufe muss das Schreiben nach Gehör ausreichend anerkannt werden, auch wenn es noch nicht den orthographischen Regeln genügt. Wenn Kinder beginnen zu lautgetreu zu schreiben (z.b. Khint für Kind), dürfen ihre Wörter und Sätze nicht als falsch bezeichnet und auch nicht mit dem Rotstift angestrichen werden. Erst nach und nach gewinnen orthographische Strategien und Regeln immer mehr an Bedeutung. Tabelle 1 Klassenübersicht zur Lernstandsanalyse im Bereich Schriftspracherwerb, Klasse: Stufen und Ergebnisse Name Bemerkungen Ich kann Bedeutungen von Situationen, Gesten etc. deuten: Diese Tabelle ermöglicht eine grobe Übersicht zu heterogenen Leistungsständen einer Klasse. Anleitung: In die erste Spalte die Namen eintragen. In die folgenden Spalten das Datum eintragen, an dem Sie beobachten, dass das Kind diese Stufe erreicht. Basale Strategien richtet Blickkontakt auf Personen/Gegenstände liest Situationen, Gesten, Mimik hantiert unspezifisch mit Büchern Namen basale Stufe präliterale logografemische beginnende entfaltete orthograph. Stufe Stufe alph. Stufe alph. Stufe Stufe verwendet Gesten und Mimik erzeugt Spuren Ich kann Spuren erzeugen und wahrnehmen: 1. Präliterale Strategien 2. deutet Zeichen, Symbole in hört Geschichten zu deutet Bilder im Buch 3. der Umgebung 4. schaut sich Bilderbuch an tut als ob es liest spricht in Erzählsprache 5. Ich kann Bilderbücher anschauen: 6. erzeugt bedeutungs- tut als ob es schreibt rzeugt buchstabenähnliche 7. tragende Spuren Zeichen/Symbole 8. Logografemische Strategie hält Buch richtig und blättert liest seinen Namen als liest Ganzworte mit markanten Buchstaben Seite für Seite Ganzwort benennt einzelne Buchstabennamen bildet Reime klatscht/malt Silbenbögen schreibt einzelne Buchstaben schreibt einzelne Wörter schreibt seinen Namen als aus dem Kopf aus dem Kopf Ganzwort Beginnende alphabetische Strategie ordnet Buchstaben Laute zu erliest lautgetreue Wörter hört (Anfangs-) Laute aus buchstabenweise Wörtern heraus ordnet Lauten Buchstaben zu schreibt Wörter mit verfügbaren Buchstaben Laute zerlegt Wörter in einzelne : Entfaltete alphabetische Strategie erliest längere Wörter erliest komplexe Wörter verfügt über automatisierte Wörter gedehnt schreibt alle gehörten Laute schreibt komplexe Worte verfügt über Lernwörter/erste in lauttreuen Worten weitgehend vollständig Einsichten Mor-phemkonstanz verfügt über Lernwörter/ erste Einsichten Morphemkonstanz erliest komplexere Wörter erkennt häufige Wörter/ betont beim Lesen Wortteile sicher, flüssig nutzt Einsichten in orthografische Strukturen vermeidung nutzt Strategien zur Fehler Ich kann Bilderbücher kommentieren: Ich kann in Bilderbüchern Bilder und Text unterscheiden: Ich kann Laute in Wörtern hören: Den ersten Laut Einzelne Laute im Wort Den letzten Laut Tabelle 1 von Seite 37 Tabelle 2 von Seite 38 Tabelle 3 von Seite 39 17
18 Kap. 4 Pädagogische Angebote zu den Stufen des Schriftspracherwerbs mit Meine Fibel und weiteren Ergänzungsmaterialien Inklusive Didaktik lebt von den auf Lernstandsanalysen beruhenden passenden Materialangeboten. Auf jeder Stufe des Schriftspracherwerbs lassen sich didaktische Materialien und Aktivitäten einsetzen, die jeweils an der vorhandenen Lernausgangslage anknüpfen und dazu dienen, dass die Kinder im individuell möglichen Tempo die nächste Stufe erreichen. Teils wählen die Kinder selbst das passende Lernmaterial, teils wird es von der Lehrperson für ein Kind ausgewählt. In diesem Kapitel werden vielfältige Anregungen gegeben. Sie enthalten nur eine exemplarische Auswahl der immensen Möglichkeiten des Deutschunterrichts im ersten Schuljahr. Unsere Anregungen zeigen, wie ein auf dem Stufenmodell des Schrifts pracherwerbs aufbauender binnendifferenzierender Unterricht anhand von Meine Fibel und der vielfältigen Ergänzungsmaterialien aufgebaut werden kann. Die Fibel Meine Fibel orientiert sich an der analytisch-synthetischen Leselernmethode und bietet eine systematische sukzessive Buchstabeneinführung. Die vier Ganzwörter ist, sind, und, ruft werden eingeführt, um das Lesen sinnvoller Sätze frühzeitig zu ermöglichen. Ergänzend kommen ein Leseanhang und ein Jahreszeitenanhang sowie eine Anlauttabelle hinzu. Die Fibel Meine Fibel bietet damit von der logographemischen Stufe an Arbeitsmöglichkeiten für alle folgenden Stufen des Schriftspracherwerbs. Kinder, die sich noch auf den Vorstufen befinden, profitieren davon, dass sie die Arbeit der anderen Kinder mit der Fibel miterleben und selbst im Besitz des gleichen Buches sind, das sie an die Welt der Buchstaben heran - führt. Es muss jedoch sehr darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht zu Misserfolgserlebnissen gedrängt werden, etwa indem sie zum Vorlesen aufgerufen werden, obwohl sie diese Stufe noch gar nicht erreicht haben. Diese Kinder müssen für ihre Aktivitäten auf den Vorstufen, zum Beispiel Kritzelbriefe schreiben, gelobt und anerkannt werden, damit sie Freude am Umgang mit Schrift entwickeln. Schulkinder, die schon alphabetisiert sind, profitieren davon, dass sie im Leseteil von Meine Fibel stöbern können. Die Fibel Meine Fibel enthält auch Angebote für differenzierendes Arbeiten, so dass bewährte analytisch-synthetische und offene Vorgehensweisen methodenintegrativ kombiniert werden, um so entwicklungsorientiert Angebote für alle Kinder bereitstellen zu können. Die Ideenbox Meine Fibel für jahrgangsübergreifendes Lernen in Klasse1/2 bietet grundsätzliche Anregungen und praktische Unterrichtsbeispiele für Lernen in heterogenen Gruppen in Karteikartenform. Diese Vorschläge sind für jede heterogene Lerngruppe im Anfangsunterricht geeignet. Sie sind auch leicht erweiterbar für die inklusive Arbeit mit Kindern auf basaler und präliteraler Stufe. Das Arbeitsheft Meine Fibel Differenzieren und Fördern bietet zahlreiche Übungsanregungen zu den einzelnen Fibelseiten. Auf jeder Seite des Arbeitsheftes werden drei verschiedene Übungsvorschläge unterbreitet. Die Übungen setzen ein mit Vorschlägen für Kinder auf der logographemischen Stufe, enthalten Vorschläge für beginnend alphabetische Kinder sowie Übungen für Kinder, die bereits entfaltet alphabetisch lesen und schreiben können. Auf den hinteren Seiten steht die beginnende orthographische Strategie im Mittelpunkt. Das Heft Meine kleine Fibel Vorübungen zum Schreiben- und Lesenlernen bietet insbesondere vertiefte Übungen zur phonologischen Bewusstheit, zur Be griffsbildung, zur feinmotorischen Übung und optischen Differenzierung. Es ist insbesondere für Kinder auf der präliteralen und logografemischen Stufe geeignet. Weitere Arbeitsmaterialien wie der Arbeitsblock Meine Fibel sowie die Kopiervorlagen Meine Fibel bieten Übungen zu Lauten und Buchstaben sowie ersten Wörtern und Sätzen, Übungen zur Arbeit mit der Anlauttabelle sowie Impulse zum freien Schreiben für Kinder auf dem Weg von der logografemischen zur entfalteten alphabetischen Stufe. 18
19 Mimi ruft Pädagogische Angebote zu den Stufen des Schriftspracherwerbs mit Meine Fibel und weiteren Ergänzungsmaterialien Kap. 4 In der folgenden Tabelle werden für jede der unter 3.2 erläuterten sechs Stufen des Schriftspracherwerbs angemessene pädagogische Angebote beschrieben. Viele dieser pädagogischen Angebote wachsen mit, wenn man die Anforderungen den Strategiestufen anpasst, so kann zum Beispiel das Ich-Buch jeder Stufe entsprechend eingesetzt und Schritt für Schritt erweitert werden. Die hier vorgestellten offenen Angebote beinhalten die Chance, die Themen der Kinder und die vielfältigen Heterogenitätsdimensionen wie Geschlecht, kulturelle und familiäre Herkunft zu berücksichtigen. Dabei kann jedes einzelne Kind seine vielfältigen Interessen zum Ausdruck bringen und persönlich bedeutsame Zugänge zur Schrift entwickeln. Auch können viele der hier präsentierten pädagogischen Angebote in unterschiedlichen Sozialformen bearbeitet werden, dazu gehören Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit sowie die Arbeit im Plenum der ganzen Klasse. Aktuelle Stufe Prozessbegleitende Analyse Zentrale Ziele auf dem Weg zum Schriftspracherwerb Geeignete Fibel-Materialien (VWV) zur Förderung pädagogische Angebote zur individuellen Förderung ergänzend zur Fibel Ziel der Arbeit mit Kindern, die sich auf der basalen Stufe befinden, ist, dass sie Einsicht gewinnen in die elementare Bedeutung von Zeichen in der Kommunikation. Wichtig ist, dass Lehrkräfte sich klar machen, dass in der inklusiven Schule immer wieder Kinder eingeschult werden, die solche elementaren Erfahrungen mit Sprache noch nicht ausreichend erwerben konnten. Basale Strategie Beobachtungen in Spiel-, Vorlese- und Gesprächssituationen Handpuppe Mimi Förderkoffer: Bildkarten Fibelfiguren Reime Meine Fibel: 118/119 Ideenbox: Geräusche hören (35), Schriftspaziergang (9) Blickkontakt herstellen und halten; Gestik und Mimik (zum Beispiel lachen, weinen) zur Kommunikation nutzen; alltägliche Handlungen mit Sprache begleiten; zur Aufmerksamkeit auf Gegenstände, Bilder und Sprache anregen; rhythmische Bewegungen zur Musik machen lassen; Hörgeschichten hören; Herstellen von Kindervisitenkarten mit Fotos und Symbolen, z. B. Arbeitsblock letzte Seite; Bilderbücher betrachten; Reim- und Fingerspiele spielen; Spuren mit verschiedenen Materialien erzeugen lassen, z. B. im Sand, im Wasser Präliterale Strategie Ziel der Arbeit mit Kindern, die sich auf der präliteralen Stufe befinden, ist, dass sie herangeführt werden an Funktionen und Merkmale von Schriftsprache. Sie verstehen zunehmend, dass Schrift in Büchern, Zeitungen, Computern, Briefen usw. verwendet wird und Informationen übermittelt. Die Kinder Interesse dafür entwickeln, sich zunächst spielerisch mit Schriftsprache auseinanderzusetzen, eine persönliche Beziehung zu Schrift aufzubauen, um danach an den Fibellehrgang herangeführt zu werden. Beobachtungen in Spiel-, Vorlese- und Gesprächssituationen Bild-Lese-Blatt Leeres Blatt Meine kleine Fibel Förderkoffer Meine Fibel, Bildkarten, Reimwörter- Tangram (Bild-Bild) CD-ROM, Vorübungen zu Meine Fibel Platzieren vielfältiger Schriftangebote in der Klasse, z. B. Namenskarten als Aufsteller, Geburtstagsliste, Ämter- und Stundenplan, beschriftete Garderoben und Regale, als Leporello die Namen der Kinder und Namensschilder in der Klasse zuordnen...; Bilder in der Umwelt suchen und lesen ; z. B. Körpersprache, Piktogramme, Symbole, Logos...; 19
20 Kap. 4 Pädagogische Angebote zu den Stufen des Schriftspracherwerbs mit Meine Fibel und weiteren Ergänzungsmaterialien Präliterale Strategie MÜSC Arbeitsblock: 3 (Ganzwortnamen), 37 (Würfelspiel), 39 (Rätsel), 49/50 (Zungenbrecher), 65 Namenskarten Ideenbox: Ich-Buch (2), Schriftspaziergang (9), Geräusche hören (35), Zeilenreime (38), Wenn das M (39), Zungenbrecher (33), Was ich kann (8) MÜT Zeichen und Schrift in der Klasse, in der Schule, in der Umgebung suchen, abzeichnen und sammeln, z. B. Straßennamen, Firmenlogos, Autokennzeichen Nummernschilder, Gerätenamen ;Sammeln von Schriftformen in Katalogen, Zeitschriften, Werbeprospekten Ausprobieren unterschiedlicher Schreibgeräte, z. B. Fingerfarbe, Pinsel, Kreide, Stifte... und Schreibflächen, z. B. Tafel, Schiefertafel, Straße, Tapetenrolle, Hefte,...; den eigenen Namen immer wieder schreiben und lesen ; ein erstes Ich-Buch anlegen; erste Wörter aus dem Gedächtnis schreiben; spielerisch Formulare ausfüllen ( Als-ob-Schreiben : Post, Sparkasse Quittungen, Lottoscheine, Kreuzworträtsel usw.); Lieblingsbuchstaben und -wörter in einer Schatzkiste sammeln; älteren Kindern/Erwachsenen etwas diktieren und es sich vorlesen lassen, Schriftproben in der Familie sammeln; Situationen erleben und benennen, in denen etwas geschrieben oder gelesen werden muss; pantomimische Darstellungen von Lesen und Schreiben in unterschiedlichen Situationen erraten lassen; vereinbarte Symbole und bekannte Buchstaben/Wörter für Notizen und Nachrichten verwenden; Spiele zum Hören und Erkennen von Geräuschen und Lauten; Spiele zum Reimen und Silbenklatschen; Herstellen von Kindervisitenkarten, Kinderausweisen usw.; Arbeit mit Magnetbuchstaben, Holzbuchstaben, Buchstabenstempel, Schuldruckerei; Buchstabenmemory, Buchstabenlotto, Buchstabenfest Logografemische Strategie Ziel der Arbeit mit Kindern, die die logografemische Strategie anwenden, ist, dass sie Einsicht in die Laut-Buchstaben-Beziehungen gewinnen. Kinder sollen lernen aus gesprochenen Wörtern zunehmend Laute herauszuhören, ganze Wörter in einzelne Laute aufzugliedern und Buchstaben Lauten zuzuordnen. Die phonologische Bewusstheit im weiten Sinne, also das Reimen und Silbengliedern, sollte gesichert und phonologische Bewusstheit im engen Sinne, wie zum Beispiel das Heraushören von Anlauten, intensiv gefördert werden. Einzelne Buchstaben und die dazugehörigen Laute werden erarbeitet und durch vielfältige Übungen gefestigt (Leselehrgang Meine Fibel und Arbeitsheft sowie Kopiervorlagen). Beobachtungen in Spiel-,Vorlese- und Gesprächssituationen Bild-Lese-Blatt Leeres Blatt MÜSC (Förderkoffer meine Fibel) Meine Fibel: 4 6 Förderkoffer: Buchstabenkarten, Lautkarten, Domino, Anlaut-Quartett, Reimwörter-Tangram (Bild-Wort) Lautbilder/Anlauttabelle/Plakat mit der Lauttabelle Meine kleine Fibel: 1 5 Kopiervorlagen 1, 2, 3, 4, 5 CD-ROM, Vorübungen Kopiervorlage 19 für phonematische Übungen Wörter lesen und schreiben, in denen diese Buchstaben vorkommen; mit der Anlauttabelle arbeiten; Laut- Buchstabe-Zuordnungsspiele wie das Geräuschelotto, Buchstabenmemory und -lotto spielen ; Spiele zum Training der phonologischen Bewusstheit im weiten und engen Sinne wie Reimen, Silbenklatschen, Anlaute hören. Z. B. Bildkarten nach Reimen, Silben, Anlauten ordnen, Reime zu Schlüsselwörtern suchen, Abzählverse und kurze Gedichte lernen usw.; Sprechübungen vor dem Spiegel; in Zeitungen/ Zeitschriften auf die Suche nach vorgegebenen/bekannten Buchstaben gehen, verschiedene Varianten ausschneiden und sammeln 20
ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele
 ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl
 Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Anleitungen Einzelsituation
 5 Anleitungen Einzelsituation 5.1 Lesen Seite 30 5.1.1 Einzelbuchstaben benennen Seite 30 5.1.2 Übungsblätter Einzelbuchstaben benennen Seite 32 5.1.3 Buchstaben zusammenziehen Seite 33 5.1.4 Übungsblätter
5 Anleitungen Einzelsituation 5.1 Lesen Seite 30 5.1.1 Einzelbuchstaben benennen Seite 30 5.1.2 Übungsblätter Einzelbuchstaben benennen Seite 32 5.1.3 Buchstaben zusammenziehen Seite 33 5.1.4 Übungsblätter
Selbstreflexion für Lehrpersonen Ich als Führungspersönlichkeit
 6.2 Selbstreflexion für Lehrpersonen Ich als Führungspersönlichkeit Beschreibung und Begründung In diesem Werkzeug kann sich eine Lehrperson mit seiner eigenen Führungspraxis auseinandersetzen. Selbstreflexion
6.2 Selbstreflexion für Lehrpersonen Ich als Führungspersönlichkeit Beschreibung und Begründung In diesem Werkzeug kann sich eine Lehrperson mit seiner eigenen Führungspraxis auseinandersetzen. Selbstreflexion
Mehr Geld verdienen! Lesen Sie... Peter von Karst. Ihre Leseprobe. der schlüssel zum leben. So gehen Sie konkret vor!
 Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen
Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen
Arbeitshilfe "Tipps für Gespräche mit Vorgesetzten und KollegInnen" Was gilt für mich?
 Arbeitshilfe "Tipps für Gespräche mit Vorgesetzten und KollegInnen" Mit dieser Arbeitshilfe können Sie Gespäche über Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz wirkungsvoll vorbereiten. Tipps Bereiten Sie sich
Arbeitshilfe "Tipps für Gespräche mit Vorgesetzten und KollegInnen" Mit dieser Arbeitshilfe können Sie Gespäche über Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz wirkungsvoll vorbereiten. Tipps Bereiten Sie sich
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation
 Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
A. Werkstattunterricht - Theoretisch 1. Zum Aufbau der Werkstätten
 A. Werkstattunterricht - Theoretisch 1. Zum Aufbau der Werkstätten Die vorliegenden Werkstätten sind für die 1. Klasse konzipiert und so angelegt, dass eine handlungsorientierte Erarbeitung möglich ist.
A. Werkstattunterricht - Theoretisch 1. Zum Aufbau der Werkstätten Die vorliegenden Werkstätten sind für die 1. Klasse konzipiert und so angelegt, dass eine handlungsorientierte Erarbeitung möglich ist.
Fortbildungsangebote für Lehrer und Lehrerinnen
 Thema Besonders geeignet für Schwerpunkte Inklusion von Schülern mit gravierenden Problemen beim Erlernen der Mathematik Schulen/ Fachschaften, die sich in Sinne der Inklusion stärker den Schülern mit
Thema Besonders geeignet für Schwerpunkte Inklusion von Schülern mit gravierenden Problemen beim Erlernen der Mathematik Schulen/ Fachschaften, die sich in Sinne der Inklusion stärker den Schülern mit
Laborschule des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität Bielefeld Primarstufe und Sekundarstufe I. Ulrich Bosse für das gesamte Dokument
 Laborschule des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität Bielefeld Primarstufe und Sekundarstufe I Ulrich Bosse für das gesamte Dokument Leistungsbewertung und Lernberichte 1. Die äußere Struktur
Laborschule des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität Bielefeld Primarstufe und Sekundarstufe I Ulrich Bosse für das gesamte Dokument Leistungsbewertung und Lernberichte 1. Die äußere Struktur
Kreativ visualisieren
 Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Infos über. die Schulungen von. Prüferinnen und Prüfern für Leichte Sprache
 Infos über die Schulungen von Prüferinnen und Prüfern für Leichte Sprache Inhalts-Verzeichnis Darum geht es Seite Einleitung 3 Das ist das Wichtigste für die Schulungen! 4 Die Inhalte: Das lernen Prüferinnen
Infos über die Schulungen von Prüferinnen und Prüfern für Leichte Sprache Inhalts-Verzeichnis Darum geht es Seite Einleitung 3 Das ist das Wichtigste für die Schulungen! 4 Die Inhalte: Das lernen Prüferinnen
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Das Leitbild vom Verein WIR
 Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
 Checkliste für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Gliederung eines Gutachtens 1. Nennung des Auftraggebers und Fragestellung des Auftraggebers. 2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
Checkliste für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Gliederung eines Gutachtens 1. Nennung des Auftraggebers und Fragestellung des Auftraggebers. 2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
Wärmebildkamera. Aufgabe 1. Lies ab, wie groß die Temperatur der Lippen (am Punkt P) ist. ca. 24 C ca. 28 C ca. 32 C ca. 34 C
 Wärmebildkamera Ob Menschen, Tiere oder Gegenstände: Sie alle senden unsichtbare Wärmestrahlen aus. Mit sogenannten Wärmebildkameras können diese sichtbar gemacht werden. Dadurch kann man die Temperatur
Wärmebildkamera Ob Menschen, Tiere oder Gegenstände: Sie alle senden unsichtbare Wärmestrahlen aus. Mit sogenannten Wärmebildkameras können diese sichtbar gemacht werden. Dadurch kann man die Temperatur
INFORMATION FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
 LEITFADEN COACHING-ORIENTIERTES MITARBEITER/INNENGESPRÄCH INFORMATION FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE Inhalt: A: Allgemeines zum coaching-orientierten MitarbeiterInnengespräch B: Vorbereitung C: Ein Phasenkonzept D.
LEITFADEN COACHING-ORIENTIERTES MITARBEITER/INNENGESPRÄCH INFORMATION FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE Inhalt: A: Allgemeines zum coaching-orientierten MitarbeiterInnengespräch B: Vorbereitung C: Ein Phasenkonzept D.
Gutes Leben was ist das?
 Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Kulturelle Evolution 12
 3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben
 Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse dargestellt?
Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse dargestellt?
Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky
 #upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
#upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig?
 Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Übergänge- sind bedeutsame Lebensabschnitte!
 Übergänge- sind bedeutsame Lebensabschnitte! Liebe Eltern, Ihr Kind kommt nun von der Krippe in den Kindergarten! Auch der Übergang in den Kindergarten bedeutet für Ihr Kind eine Trennung von Vertrautem
Übergänge- sind bedeutsame Lebensabschnitte! Liebe Eltern, Ihr Kind kommt nun von der Krippe in den Kindergarten! Auch der Übergang in den Kindergarten bedeutet für Ihr Kind eine Trennung von Vertrautem
Bürgerhilfe Florstadt
 Welche Menschen kommen? Erfahrungen mit der Aufnahme vor Ort vorgestellt von Anneliese Eckhardt, BHF Florstadt Flüchtlinge sind eine heterogene Gruppe Was heißt das für Sie? Jeder Einzelne ist ein Individuum,
Welche Menschen kommen? Erfahrungen mit der Aufnahme vor Ort vorgestellt von Anneliese Eckhardt, BHF Florstadt Flüchtlinge sind eine heterogene Gruppe Was heißt das für Sie? Jeder Einzelne ist ein Individuum,
Produktionsplanung und steuerung (SS 2011)
 Produktionsplanung und steuerung (SS 2011) Teil 1 Sie arbeiten seit 6 Monaten als Wirtschaftsingenieur in einem mittelständischen Unternehmen in Mittelhessen. Das Unternehmen Möbel-Meier liefert die Büroaustattung
Produktionsplanung und steuerung (SS 2011) Teil 1 Sie arbeiten seit 6 Monaten als Wirtschaftsingenieur in einem mittelständischen Unternehmen in Mittelhessen. Das Unternehmen Möbel-Meier liefert die Büroaustattung
Erhalt und Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer
 Markieren Sie so: Korrektur: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung
Markieren Sie so: Korrektur: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung
Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken?
 UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
Leitfaden zum Personalentwicklungsgespräch für pflegerische Leitungen
 Leitfaden zum Personalentwicklungsgespräch für pflegerische Leitungen auf der Grundlage des Anforderungs- und Qualifikationsrahmens für den Beschäftigungsbereich der Pflege und persönlichen Assistenz älterer
Leitfaden zum Personalentwicklungsgespräch für pflegerische Leitungen auf der Grundlage des Anforderungs- und Qualifikationsrahmens für den Beschäftigungsbereich der Pflege und persönlichen Assistenz älterer
Zum Konzept dieses Bandes
 Zum Konzept dieses Bandes Zu jedem der 16 Kapitel zu Sach- und Gebrauchstexten erfolgt das Bearbeiten der Texte mithilfe von Lesestrategien in drei Schritten: 1. Schritt: Informationstext kennenlernen
Zum Konzept dieses Bandes Zu jedem der 16 Kapitel zu Sach- und Gebrauchstexten erfolgt das Bearbeiten der Texte mithilfe von Lesestrategien in drei Schritten: 1. Schritt: Informationstext kennenlernen
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
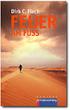 Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Einstieg in die Physik / 1.-2. Schuljahr
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einstieg in die Physik / 1.-2. Schuljahr Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort 4 Hinweise zum Einsatz
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einstieg in die Physik / 1.-2. Schuljahr Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort 4 Hinweise zum Einsatz
Geht dir ein Licht auf? Grundkenntnisse zum Thema Strom und Stromsparen
 Geht dir ein Licht auf? Grundkenntnisse zum Thema Strom und Stromsparen Ein Leben ohne Strom ist undenkbar, denn im Alltag können wir kaum auf Strom verzichten. In dieser Unterrichtseinheit für eine Vertretungsstunde
Geht dir ein Licht auf? Grundkenntnisse zum Thema Strom und Stromsparen Ein Leben ohne Strom ist undenkbar, denn im Alltag können wir kaum auf Strom verzichten. In dieser Unterrichtseinheit für eine Vertretungsstunde
Welche Gedanken wir uns für die Erstellung einer Präsentation machen, sollen Ihnen die folgende Folien zeigen.
 Wir wollen mit Ihnen Ihren Auftritt gestalten Steil-Vorlage ist ein österreichisches Start-up mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in IT und Kommunikation. Unser Ziel ist, dass jede einzelne Mitarbeiterin
Wir wollen mit Ihnen Ihren Auftritt gestalten Steil-Vorlage ist ein österreichisches Start-up mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in IT und Kommunikation. Unser Ziel ist, dass jede einzelne Mitarbeiterin
LehrplanPLUS Bayern. ... die Reise beginnt! Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
 Neu! LehrplanPLUS Bayern... die Reise beginnt! Liebe Lehrerinnen und Lehrer, zum Schuljahr 2014/2015 tritt für Bayerns Grundschulen ein neuer Lehrplan in Kraft. Das stellt Sie vor neue und höchst spannende
Neu! LehrplanPLUS Bayern... die Reise beginnt! Liebe Lehrerinnen und Lehrer, zum Schuljahr 2014/2015 tritt für Bayerns Grundschulen ein neuer Lehrplan in Kraft. Das stellt Sie vor neue und höchst spannende
Mind Mapping am PC. für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement. von Isolde Kommer, Helmut Reinke. 1. Auflage. Hanser München 1999
 Mind Mapping am PC für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement von Isolde Kommer, Helmut Reinke 1. Auflage Hanser München 1999 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 21222 0 schnell
Mind Mapping am PC für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement von Isolde Kommer, Helmut Reinke 1. Auflage Hanser München 1999 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 21222 0 schnell
2.1 Präsentieren wozu eigentlich?
 2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
Grundlagen der Theoretischen Informatik, SoSe 2008
 1. Aufgabenblatt zur Vorlesung Grundlagen der Theoretischen Informatik, SoSe 2008 (Dr. Frank Hoffmann) Lösung von Manuel Jain und Benjamin Bortfeldt Aufgabe 2 Zustandsdiagramme (6 Punkte, wird korrigiert)
1. Aufgabenblatt zur Vorlesung Grundlagen der Theoretischen Informatik, SoSe 2008 (Dr. Frank Hoffmann) Lösung von Manuel Jain und Benjamin Bortfeldt Aufgabe 2 Zustandsdiagramme (6 Punkte, wird korrigiert)
Aussagen zur eigenen Liebe
 Aussagen zur eigenen Liebe 1. Themenstrang: Ich liebe Dich 1.1 Liebesäußerung Die schreibende Person bringt mit dieser Aussage ihre Liebe zum Ausdruck. Wir differenzieren zwischen einer Liebeserklärung,
Aussagen zur eigenen Liebe 1. Themenstrang: Ich liebe Dich 1.1 Liebesäußerung Die schreibende Person bringt mit dieser Aussage ihre Liebe zum Ausdruck. Wir differenzieren zwischen einer Liebeserklärung,
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
3.2.6 Die Motivanalyse
 107 3.2 Die Bestimmung von Kommunikations-Zielgruppen 3.2.6 Die Motivanalyse Mit dem Priorisierungsschritt aus Kapitel 3.2.5 haben Sie all jene Personen selektiert, die Sie für den geplanten Kommunikationsprozess
107 3.2 Die Bestimmung von Kommunikations-Zielgruppen 3.2.6 Die Motivanalyse Mit dem Priorisierungsschritt aus Kapitel 3.2.5 haben Sie all jene Personen selektiert, die Sie für den geplanten Kommunikationsprozess
Gemeindienstprojekt 2003/2004 RC Amberg
 Vom RC Amberg erreichte uns ein interrasantes Gemeindienstprojekt, welches wir den Clubs im Distrikt 1880 nachfolgend vorstellen wollen. Es handelt sich um eine Projekt, welches sich mit der weit verbreiteten
Vom RC Amberg erreichte uns ein interrasantes Gemeindienstprojekt, welches wir den Clubs im Distrikt 1880 nachfolgend vorstellen wollen. Es handelt sich um eine Projekt, welches sich mit der weit verbreiteten
Kurzanleitung für eine erfüllte Partnerschaft
 Kurzanleitung für eine erfüllte Partnerschaft 10 Schritte die deine Beziehungen zum Erblühen bringen Oft ist weniger mehr und es sind nicht immer nur die großen Worte, die dann Veränderungen bewirken.
Kurzanleitung für eine erfüllte Partnerschaft 10 Schritte die deine Beziehungen zum Erblühen bringen Oft ist weniger mehr und es sind nicht immer nur die großen Worte, die dann Veränderungen bewirken.
L E I T B I L D A M E. als gemeinsame Orientierung hinsichtlich Auftrag Lehren und Lernen Schulkultur
 L E I T B I L D A M E als gemeinsame Orientierung hinsichtlich Auftrag Lehren und Lernen Schulkultur Auftrag Matura für Erwachsene: Auf dem 2. Bildungsweg zur Hochschule Die AME ermöglicht erwachsenen
L E I T B I L D A M E als gemeinsame Orientierung hinsichtlich Auftrag Lehren und Lernen Schulkultur Auftrag Matura für Erwachsene: Auf dem 2. Bildungsweg zur Hochschule Die AME ermöglicht erwachsenen
Die Post hat eine Umfrage gemacht
 Die Post hat eine Umfrage gemacht Bei der Umfrage ging es um das Thema: Inklusion Die Post hat Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gefragt: Wie zufrieden sie in dieser Gesellschaft sind.
Die Post hat eine Umfrage gemacht Bei der Umfrage ging es um das Thema: Inklusion Die Post hat Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gefragt: Wie zufrieden sie in dieser Gesellschaft sind.
50. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Klasse 11 13. 501322 Lösung 10 Punkte
 50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
Und nun kommt der wichtigste und unbedingt zu beachtende Punkt bei all deinen Wahlen und Schöpfungen: es ist deine Aufmerksamkeit!
 Wie verändere ich mein Leben? Du wunderbarer Menschenengel, geliebte Margarete, du spürst sehr genau, dass es an der Zeit ist, die nächsten Schritte zu gehen... hin zu dir selbst und ebenso auch nach Außen.
Wie verändere ich mein Leben? Du wunderbarer Menschenengel, geliebte Margarete, du spürst sehr genau, dass es an der Zeit ist, die nächsten Schritte zu gehen... hin zu dir selbst und ebenso auch nach Außen.
Zwischenablage (Bilder, Texte,...)
 Zwischenablage was ist das? Informationen über. die Bedeutung der Windows-Zwischenablage Kopieren und Einfügen mit der Zwischenablage Vermeiden von Fehlern beim Arbeiten mit der Zwischenablage Bei diesen
Zwischenablage was ist das? Informationen über. die Bedeutung der Windows-Zwischenablage Kopieren und Einfügen mit der Zwischenablage Vermeiden von Fehlern beim Arbeiten mit der Zwischenablage Bei diesen
M03a Lernstraße für den Unterricht in Sekundarstufe I
 M03a Lernstraße für den Unterricht in Sekundarstufe I 1. Station: Der Taufspruch Jedem Täufling wird bei der Taufe ein Taufspruch mit auf den Weg gegeben. Dabei handelt es sich um einen Vers aus der Bibel.
M03a Lernstraße für den Unterricht in Sekundarstufe I 1. Station: Der Taufspruch Jedem Täufling wird bei der Taufe ein Taufspruch mit auf den Weg gegeben. Dabei handelt es sich um einen Vers aus der Bibel.
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
2 Aufbau der Arbeit und wissenschaftliche Problemstellung
 2 Aufbau der Arbeit und wissenschaftliche Problemstellung Nach der Definition der grundlegenden Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden, soll die Ausbildung, wie sie von der Verfasserin für Schüler
2 Aufbau der Arbeit und wissenschaftliche Problemstellung Nach der Definition der grundlegenden Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden, soll die Ausbildung, wie sie von der Verfasserin für Schüler
Sprachenportfolio. 1) Sprachenpass. 2) Sprachenbiografie 6 7 8 9 10. 3) Dossier. Name. Portfolio angelegt am
 Name Portfolio angelegt am Sprachenlernen macht Freude. Das Berliner Platz Portfolio soll Ihnen helfen, über Ihre Lernziele und -methoden, Ihre Lernerfahrungen und -fortschritte nachzudenken und sie zu
Name Portfolio angelegt am Sprachenlernen macht Freude. Das Berliner Platz Portfolio soll Ihnen helfen, über Ihre Lernziele und -methoden, Ihre Lernerfahrungen und -fortschritte nachzudenken und sie zu
Hausaufgabenkonzept der Brenscheder Schule
 Stand 10.03.2010 Hausaufgabenkonzept der Brenscheder Schule Inhalt 1. Voraussetzungen...... 1 2. Grundthesen... 2 3. Verantwortlichkeiten... 3 a) Kinder, Lehrer, Eltern... 3 b) Kinder, Lehrer, Eltern,
Stand 10.03.2010 Hausaufgabenkonzept der Brenscheder Schule Inhalt 1. Voraussetzungen...... 1 2. Grundthesen... 2 3. Verantwortlichkeiten... 3 a) Kinder, Lehrer, Eltern... 3 b) Kinder, Lehrer, Eltern,
Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund.
 Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund. Das ist eine Erklärung in Leichter Sprache. In einer
Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund. Das ist eine Erklärung in Leichter Sprache. In einer
Spracherwerb und Schriftspracherwerb
 Spracherwerb und Schriftspracherwerb Voraussetzungen für ein gutes Gelingen Tipps für Eltern, die ihr Kind unterstützen wollen Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Menschen zur Freiheit bringen, heißt
Spracherwerb und Schriftspracherwerb Voraussetzungen für ein gutes Gelingen Tipps für Eltern, die ihr Kind unterstützen wollen Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Menschen zur Freiheit bringen, heißt
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Verständnisfragen. Was bedeutet Mediation für Sie?
 Bearbeitungsstand:10.01.2007 07:09, Seite 1 von 6 Mediation verstehen Viele reden über Mediation. Das machen wir doch schon immer so! behaupten sie. Tatsächlich sind die Vorstellungen von dem, was Mediation
Bearbeitungsstand:10.01.2007 07:09, Seite 1 von 6 Mediation verstehen Viele reden über Mediation. Das machen wir doch schon immer so! behaupten sie. Tatsächlich sind die Vorstellungen von dem, was Mediation
Fernsehen gehört zu unserem Alltag
 Fernsehen gehört zu unserem Alltag Vorbereitung Stellen Sie die Flipchart-Tafel auf und legen Sie passende Stifte bereit. Legen Sie Stifte und Zettel für alle Teilnehmerinnen bereit. Legen Sie das kopierte
Fernsehen gehört zu unserem Alltag Vorbereitung Stellen Sie die Flipchart-Tafel auf und legen Sie passende Stifte bereit. Legen Sie Stifte und Zettel für alle Teilnehmerinnen bereit. Legen Sie das kopierte
Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter!
 Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit
Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit
Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft
 -1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht
-1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht
Kindergarten Schillerhöhe
 Kindergarten Schillerhöhe Kontaktdaten: Mozartstr. 7 72172 Sulz a.n. 07454/2789 Fax 07454/407 1380 kiga.schillerhoehe@sulz.de Kindergartenleitung: Marion Maluga-Loebnitz Öffnungszeiten: Montag, Dienstag,
Kindergarten Schillerhöhe Kontaktdaten: Mozartstr. 7 72172 Sulz a.n. 07454/2789 Fax 07454/407 1380 kiga.schillerhoehe@sulz.de Kindergartenleitung: Marion Maluga-Loebnitz Öffnungszeiten: Montag, Dienstag,
Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann
 UNIVERSITÄT ZU KÖLN Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Psychologie Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann Ablauf eines Referates Einleitung Gliederung
UNIVERSITÄT ZU KÖLN Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Psychologie Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann Ablauf eines Referates Einleitung Gliederung
Der Gabelstapler: Wie? Was? Wer? Wo?
 Schreibkompetenz 16: schlusszeichen (Fragezeichen) sprechen zeichen Um eine Frage zu kennzeichnen, wird ein Fragezeichen (?) gesetzt. Fragewörter (zum Beispiel wo, wer, was, wie) zeigen an, dass ein Fragezeichen
Schreibkompetenz 16: schlusszeichen (Fragezeichen) sprechen zeichen Um eine Frage zu kennzeichnen, wird ein Fragezeichen (?) gesetzt. Fragewörter (zum Beispiel wo, wer, was, wie) zeigen an, dass ein Fragezeichen
Qualitätsbereich. Mahlzeiten und Essen
 Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
Inhalt. 1. Einleitung Hilfe, mein Kind kann nicht richtig schreiben und lesen! Seite
 Inhalt 1. Einleitung Hilfe, mein Kind kann nicht richtig schreiben und lesen! 2. Praxisbeispiele Wie sieht ein Kind mit Legasthenie? Wie nimmt es sich wahr? 3. Begriffsklärung Was bedeuten die Bezeichnungen
Inhalt 1. Einleitung Hilfe, mein Kind kann nicht richtig schreiben und lesen! 2. Praxisbeispiele Wie sieht ein Kind mit Legasthenie? Wie nimmt es sich wahr? 3. Begriffsklärung Was bedeuten die Bezeichnungen
Ein Buch entsteht. Ein langer Weg
 Ein Buch entsteht ilo 2003 Ein langer Weg Wenn ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin eine Geschichte schreibt, dann ist das noch ein langer Weg bis daraus ein Buch wird. Der Autor Alles fängt damit
Ein Buch entsteht ilo 2003 Ein langer Weg Wenn ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin eine Geschichte schreibt, dann ist das noch ein langer Weg bis daraus ein Buch wird. Der Autor Alles fängt damit
Projekt- Management. Landesverband der Mütterzentren NRW. oder warum Horst bei uns Helga heißt
 Projekt- Management oder warum Horst bei uns Helga heißt Landesverband der Projektplanung Projektplanung gibt es, seit Menschen größere Vorhaben gemeinschaftlich durchführen. militärische Feldzüge die
Projekt- Management oder warum Horst bei uns Helga heißt Landesverband der Projektplanung Projektplanung gibt es, seit Menschen größere Vorhaben gemeinschaftlich durchführen. militärische Feldzüge die
Lehrgang zur Kaufmann/-frau für Büromanagement
 Lehrgang zur Kaufmann/-frau für Büromanagement Der Kaufmann / Die Kauffrau im Büromanagement ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz und vereint die drei Berufe Bürokauffrau/-mann,
Lehrgang zur Kaufmann/-frau für Büromanagement Der Kaufmann / Die Kauffrau im Büromanagement ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz und vereint die drei Berufe Bürokauffrau/-mann,
Denken und Träumen - Selbstreflexion zum Jahreswechsel
 1 Denken und Träumen - Selbstreflexion zum Jahreswechsel Welches sinnvolle Wort springt Ihnen zuerst ins Auge? Was lesen Sie? Welche Bedeutung verbinden Sie jeweils damit? 2 Wenn Sie an das neue Jahr denken
1 Denken und Träumen - Selbstreflexion zum Jahreswechsel Welches sinnvolle Wort springt Ihnen zuerst ins Auge? Was lesen Sie? Welche Bedeutung verbinden Sie jeweils damit? 2 Wenn Sie an das neue Jahr denken
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
TESTEN SIE IHR KÖNNEN UND GEWINNEN SIE!
 9 TESTEN SIE IHR KÖNNEN UND GEWINNEN SIE! An den SeniorNETclub 50+ Währinger Str. 57/7 1090 Wien Und zwar gleich in doppelter Hinsicht:!"Beantworten Sie die folgenden Fragen und vertiefen Sie damit Ihr
9 TESTEN SIE IHR KÖNNEN UND GEWINNEN SIE! An den SeniorNETclub 50+ Währinger Str. 57/7 1090 Wien Und zwar gleich in doppelter Hinsicht:!"Beantworten Sie die folgenden Fragen und vertiefen Sie damit Ihr
Was tust du auf Suchmaschinen im Internet?
 Was tust du auf Suchmaschinen im Internet? Ergebnisse aus der Befragung auf der Suchmaschine fragfinn Wir bedanken uns bei allen Kindern, die zwischen dem 25. Januar und dem 7. Februar 2011 bei der Befragung
Was tust du auf Suchmaschinen im Internet? Ergebnisse aus der Befragung auf der Suchmaschine fragfinn Wir bedanken uns bei allen Kindern, die zwischen dem 25. Januar und dem 7. Februar 2011 bei der Befragung
Unterrichtsreihe für die Grundschule. Mädchen und Jungen. gleichberechtigt, nicht gleichgemacht. Band 5. www.muecke.de
 Unterrichtsreihe für die Grundschule Mädchen und Jungen gleichberechtigt, nicht gleichgemacht Band 5 www.muecke.de Mädchen und Jungen gleichberechtigt, nicht gleichgemacht Mädchen und Jungen kommen bereits
Unterrichtsreihe für die Grundschule Mädchen und Jungen gleichberechtigt, nicht gleichgemacht Band 5 www.muecke.de Mädchen und Jungen gleichberechtigt, nicht gleichgemacht Mädchen und Jungen kommen bereits
4. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN
 4. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN Zwischen Tabellen können in MS Access Beziehungen bestehen. Durch das Verwenden von Tabellen, die zueinander in Beziehung stehen, können Sie Folgendes erreichen: Die Größe
4. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN Zwischen Tabellen können in MS Access Beziehungen bestehen. Durch das Verwenden von Tabellen, die zueinander in Beziehung stehen, können Sie Folgendes erreichen: Die Größe
Die richtigen Partner finden, Ressourcen finden und zusammenführen
 Kongress Kinder.Stiften.Zukunft Workshop Willst Du mit mir gehen? Die richtigen Partner finden, Ressourcen finden und zusammenführen Dr. Christof Eichert Unsere Ziele: Ein gemeinsames Verständnis für die
Kongress Kinder.Stiften.Zukunft Workshop Willst Du mit mir gehen? Die richtigen Partner finden, Ressourcen finden und zusammenführen Dr. Christof Eichert Unsere Ziele: Ein gemeinsames Verständnis für die
Elternzeit Was ist das?
 Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das
Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das
Volksbank BraWo Führungsgrundsätze
 Volksbank BraWo Führungsgrundsätze Präambel Die Führungsgrundsätze wurden gemeinsam von Mitarbeitern und Führungskräften aus allen Bereichen der Bank entwickelt. Dabei war allen Beteiligten klar, dass
Volksbank BraWo Führungsgrundsätze Präambel Die Führungsgrundsätze wurden gemeinsam von Mitarbeitern und Führungskräften aus allen Bereichen der Bank entwickelt. Dabei war allen Beteiligten klar, dass
Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP.
 Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen
Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen
Anleitung. Empowerment-Fragebogen VrijBaan / AEIOU
 Anleitung Diese Befragung dient vor allem dazu, Sie bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Anhand der Ergebnisse sollen Sie lernen, Ihre eigene Situation besser einzuschätzen und eventuell
Anleitung Diese Befragung dient vor allem dazu, Sie bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Anhand der Ergebnisse sollen Sie lernen, Ihre eigene Situation besser einzuschätzen und eventuell
Information zum Projekt. Mitwirkung von Menschen mit Demenz in ihrem Stadtteil oder Quartier
 Information zum Projekt Mitwirkung von Menschen mit Demenz in ihrem Stadtteil oder Quartier Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Wir führen ein Projekt durch zur Mitwirkung von Menschen mit Demenz in
Information zum Projekt Mitwirkung von Menschen mit Demenz in ihrem Stadtteil oder Quartier Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Wir führen ein Projekt durch zur Mitwirkung von Menschen mit Demenz in
Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache
 Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen - Wittgenstein/ Olpe 1 Diese Information hat geschrieben: Arbeiterwohlfahrt Stephanie Schür Koblenzer
Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen - Wittgenstein/ Olpe 1 Diese Information hat geschrieben: Arbeiterwohlfahrt Stephanie Schür Koblenzer
I.O. BUSINESS. Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate
 I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Telefonieren ermöglicht die direkte Kommunikation
I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Telefonieren ermöglicht die direkte Kommunikation
Zahlenwinkel: Forscherkarte 1. alleine. Zahlenwinkel: Forschertipp 1
 Zahlenwinkel: Forscherkarte 1 alleine Tipp 1 Lege die Ziffern von 1 bis 9 so in den Zahlenwinkel, dass jeder Arm des Zahlenwinkels zusammengezählt das gleiche Ergebnis ergibt! Finde möglichst viele verschiedene
Zahlenwinkel: Forscherkarte 1 alleine Tipp 1 Lege die Ziffern von 1 bis 9 so in den Zahlenwinkel, dass jeder Arm des Zahlenwinkels zusammengezählt das gleiche Ergebnis ergibt! Finde möglichst viele verschiedene
1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - 08.09.2010 19:00 Uhr
 1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Vogelsang, sehr geehrter Herr Strunz, und meine sehr geehrte Damen und Herren, meine
1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Vogelsang, sehr geehrter Herr Strunz, und meine sehr geehrte Damen und Herren, meine
Was ist Sozial-Raum-Orientierung?
 Was ist Sozial-Raum-Orientierung? Dr. Wolfgang Hinte Universität Duisburg-Essen Institut für Stadt-Entwicklung und Sozial-Raum-Orientierte Arbeit Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Sozialräume
Was ist Sozial-Raum-Orientierung? Dr. Wolfgang Hinte Universität Duisburg-Essen Institut für Stadt-Entwicklung und Sozial-Raum-Orientierte Arbeit Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Sozialräume
Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte Gesetzliche Unfallversicherung
 Ihre Unfallversicherung informiert Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte Gesetzliche Unfallversicherung Weshalb Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte? 1 Als Sicherheitsbeauftragter haben Sie
Ihre Unfallversicherung informiert Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte Gesetzliche Unfallversicherung Weshalb Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte? 1 Als Sicherheitsbeauftragter haben Sie
Sprachförderkonzept der Kindertagesstätte St. Raphael
 Sprachförderkonzept der Kindertagesstätte St. Raphael Inhalt: 1. Einleitung 2. Zielsetzung 3. Rolle der Erzieherin als Sprachbegleiter 4. Rolle der Erzieherin als Sprachvorbild 5. Spezielle Sprachförderung
Sprachförderkonzept der Kindertagesstätte St. Raphael Inhalt: 1. Einleitung 2. Zielsetzung 3. Rolle der Erzieherin als Sprachbegleiter 4. Rolle der Erzieherin als Sprachvorbild 5. Spezielle Sprachförderung
* Ich bin müde. Meine Mutter hat mich vor anderthalb Stunden geweckt. Im Auto bin ich
 Dipl.-Psych. Ann Kathrin Scheerer, Hamburg, Psychoanalytikerin (DPV/IPV) Krippenbetreuung - aus der Sicht der Kinder Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 11.2.2008 Wenn wir die Sicht der Kinder in dieser
Dipl.-Psych. Ann Kathrin Scheerer, Hamburg, Psychoanalytikerin (DPV/IPV) Krippenbetreuung - aus der Sicht der Kinder Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 11.2.2008 Wenn wir die Sicht der Kinder in dieser
DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
 DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG von Urs Schaffer Copyright by Urs Schaffer Schaffer Consulting GmbH Basel www.schaffer-consulting.ch Info@schaffer-consulting.ch Haben Sie gewusst dass... >
DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG von Urs Schaffer Copyright by Urs Schaffer Schaffer Consulting GmbH Basel www.schaffer-consulting.ch Info@schaffer-consulting.ch Haben Sie gewusst dass... >
Welches Übersetzungsbüro passt zu mir?
 1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,
1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,
Persönlichkeit und Persönlichkeitsunterschiede
 9 Persönlichkeit und Persönlichkeitsunterschiede 1 Inhalt Die Beschäftigung mit der menschlichen Persönlichkeit spielt in unserem Alltag eine zentrale Rolle. Wir greifen auf das globale Konzept Persönlichkeit
9 Persönlichkeit und Persönlichkeitsunterschiede 1 Inhalt Die Beschäftigung mit der menschlichen Persönlichkeit spielt in unserem Alltag eine zentrale Rolle. Wir greifen auf das globale Konzept Persönlichkeit
Charakteristikum des Gutachtenstils: Es wird mit einer Frage begonnen, sodann werden die Voraussetzungen Schritt für Schritt aufgezeigt und erörtert.
 Der Gutachtenstil: Charakteristikum des Gutachtenstils: Es wird mit einer Frage begonnen, sodann werden die Voraussetzungen Schritt für Schritt aufgezeigt und erörtert. Das Ergebnis steht am Schluß. Charakteristikum
Der Gutachtenstil: Charakteristikum des Gutachtenstils: Es wird mit einer Frage begonnen, sodann werden die Voraussetzungen Schritt für Schritt aufgezeigt und erörtert. Das Ergebnis steht am Schluß. Charakteristikum
Grundschule des Odenwaldkreises. Rothenberg. Fortbildungskonzept
 Grundschule des Odenwaldkreises Rothenberg Fortbildungskonzept Rothenberg, im Oktober 2008 INHALTSVERZEICHNIS 1. PRÄAMBEL... 3 2. FORTBILDUNGSPLANUNG DER SCHULE... 3 3. FORTBILDUNGSPLANUNG DER KOLLEGEN...
Grundschule des Odenwaldkreises Rothenberg Fortbildungskonzept Rothenberg, im Oktober 2008 INHALTSVERZEICHNIS 1. PRÄAMBEL... 3 2. FORTBILDUNGSPLANUNG DER SCHULE... 3 3. FORTBILDUNGSPLANUNG DER KOLLEGEN...
Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräch (MAG) für Vorgesetzte
 UNIVERSITÄT HOHENHEIM DER KANZLER Miteinander Aktiv - Gestalten Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräch (MAG) für Vorgesetzte Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden in nächster Zeit mit Ihrem Mitarbeiter/Ihrer
UNIVERSITÄT HOHENHEIM DER KANZLER Miteinander Aktiv - Gestalten Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräch (MAG) für Vorgesetzte Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden in nächster Zeit mit Ihrem Mitarbeiter/Ihrer
Nina. bei der Hörgeräte-Akustikerin. Musterexemplar
 Nina bei der Hörgeräte-Akustikerin Nina bei der Hörgeräte-Akustikerin Herausgeber: uphoff pr-consulting Alfred-Wegener-Str. 6 35039 Marburg Tel.: 0 64 21 / 4 07 95-0 info@uphoff-pr.de www.uphoff-pr.de
Nina bei der Hörgeräte-Akustikerin Nina bei der Hörgeräte-Akustikerin Herausgeber: uphoff pr-consulting Alfred-Wegener-Str. 6 35039 Marburg Tel.: 0 64 21 / 4 07 95-0 info@uphoff-pr.de www.uphoff-pr.de
Meine Lernplanung Wie lerne ich?
 Wie lerne ich? Zeitraum Was will ich erreichen? Wie? Bis wann? Kontrolle Weiteres Vorgehen 17_A_1 Wie lerne ich? Wenn du deine gesteckten Ziele nicht erreicht hast, war der gewählte Weg vielleicht nicht
Wie lerne ich? Zeitraum Was will ich erreichen? Wie? Bis wann? Kontrolle Weiteres Vorgehen 17_A_1 Wie lerne ich? Wenn du deine gesteckten Ziele nicht erreicht hast, war der gewählte Weg vielleicht nicht
Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen Ihre Selbstachtung zu wahren!
 Handout 19 Interpersonelle Grundfertigkeiten Einführung Wozu brauchen Sie zwischenmenschliche Skills? Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen
Handout 19 Interpersonelle Grundfertigkeiten Einführung Wozu brauchen Sie zwischenmenschliche Skills? Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen
Alle gehören dazu. Vorwort
 Alle gehören dazu Alle sollen zusammen Sport machen können. In diesem Text steht: Wie wir dafür sorgen wollen. Wir sind: Der Deutsche Olympische Sport-Bund und die Deutsche Sport-Jugend. Zu uns gehören
Alle gehören dazu Alle sollen zusammen Sport machen können. In diesem Text steht: Wie wir dafür sorgen wollen. Wir sind: Der Deutsche Olympische Sport-Bund und die Deutsche Sport-Jugend. Zu uns gehören
Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
 Schulleitungskonferenzen des MBWJK im Schuljahr 2009/10 Folie 1 Die Schulstrukturreform in der Sekundarstufe I - neue Chancen für die Gestaltung der Übergänge Folie 2 Der von der Grundschule in die weiterführende
Schulleitungskonferenzen des MBWJK im Schuljahr 2009/10 Folie 1 Die Schulstrukturreform in der Sekundarstufe I - neue Chancen für die Gestaltung der Übergänge Folie 2 Der von der Grundschule in die weiterführende
