Das Fastentuch von Bendern
|
|
|
- Alexandra Friederike Scholz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Das Fastentuch von Bendern Felix Marxer
2 VORWORT Als Pfarrer Albert Schlatter im Jahre 1947 die Seelsorge in der Pfarrei Bendern übernahm, fand er auf der Heubühne des zu einem Wirtschaftsgebäude umgebauten alten Pfarrhauses das Hungertuch von Bendern in völlig verwahrlostem Zustande. Er reinigte es sorgfältig und hängte es nach altem Brauch, der in seiner Pfarrei noch bekannt war, jeweils zur Fastenzeit wieder im Chor der Kirche auf. Dies bedeutete eine Rettung des für unser Land einzigartigen Stückes in letzter Stunde. In den nachfolgenden Ausführungen geht es darum, das Fastentuch und die auf ihm dargestelten Motive des alten und neuen Testamentes zu beschreiben und wenn nötig zu erläutern, Sinn und Bedeutung der Altarverhüllung klarzumachen und die glaubensmässigen Hintergründe aufzuzeigen, die im Mittelalter den Gebrauch von Fastenvelen entstehen Hessen. Es soll auch versucht werden, das Verschwinden des Brauches nach der Reformation zu begründen und das Fastentuch von Bendern kirchengeschichtlich und kunsthistorisch einzuordnen. 1
3 CO s T <L) X> <: OD bß co M +J N <u bjj 60 c N <*? OJ "?! bß r CO N M ^H CD O O U W CD SP» : cn p> 1) >-. O, <D CO T. w bß C fi :0 <u o Q -ö c o CO CO e 'S n <D O bß < C T O c co o, U X> CD O CO 0) bß CO «4-1 Ü <D bß bß <u Ü co CO > w bc s CO - 1 M 2 «!H : SP T = M JH <D > bß cn CD X> U cö bo bß 14
4
5
6 BESCHREIBUNG Die gemalte Fläche des Benderer Fastentuches hat eine Breite von 60 cm und eine Höhe von 470 cm. Die ursprünglich in der Mitte geteilte Leinwand wurde 1971 bei der Restauration zusammengesetzt und auf neues Leinen genäht. Die Bilder sind in 4 Reihen zu je 6 Darstellungen angeordnet und durch geriefelte jonische Säulen, Attribute der Renaissance, getrennt. In der ersten Bildreihe sind die Säulen rotbraun, die Säulenbasen gelb. Die übrigen Säulen sind weiss, gelb oder zum Teil auch weiss und gelb umrandet. Kapitelle und Basen sind gelb. Die Säulen sind von unterschiedlichem Durchmesser. Die Bildbreite ohne Säulen beträgt cm, die Höhe ca. 100 cm. Die Säulen der untersten Bildreihe stehen auf einem nach unten sich stufenweise verbreiternden Sockel. Unter jedem Bild ist auf einem beiderseits eingerollten weissen Schriftband in gotischer Schrift eine Legende mit Angabe der entsprechenden Bibelstelle angebracht. Die Bilder sind mit wasserlöslicher Farbe auf braune Leinwand gemalt, die aus 10 Bahnen zusammengesetzt ist. ZUM BILDINHALT 1. Reihe (alle Bilder sind besonders im oberen Teil stark beschädigt). la Erschaffung Evas, Sündenfall, Austreibung aus dem Paradies Das Bild erzählt in drei Szenen die Geschehnisse im Paradiesgarten. Gott erschafft Eva aus der Seite des schlafenden Mannes. Auf einer Anhöhe, rechts im Hintergrund, ist der Sündenfall dargestellt. Eva steht unter einem Baum und reicht Adam den Apfel. Die Schlange ist kaum mehr erkennbar. Am linken Bildrand fliehen Adam und Eva aus dem Paradies. In einem Bild wird das Geschehen zusammengefasst, gleichsam die Exposition zum nachfolgend ausführlich geschilderten Drama der Erlösung, das mit dem Kreuzestod Christi seinen Höhepunkt findet. lb Die Arche Noatis Mit zum Himmel erhobenen Händen kniet Noah am rechten Bildrand vor der Arche. Die Tiere ziehen paarweise in das Schiff, wäh- 15
7 rend sich am Himmel dunkle Wolken zusammenziehen. Andere Tiere warten auf den Einzug, so auch ein Einhornpaar. Das Einhorn ist ein in der christlichen Mystik oft vorkommendes Fabeltier, dessen gedrehtem Horn magische Fähigkeiten zugeschrieben werden. Es wurde häufig als Wappentier verwendet. Der aufsteigende Rauch könnte von einem nicht sichtbaren Opferaltar stammen. Die barokken Formen der Arche beherrschen das Bild. lc Isaakopfer Das Schwert über seinem Haupte gezückt, steht Abraham in starker Bewegung, die besonders im flatternden roten Mantel zum Ausdruck kommt, vor dem Opferaltar, auf dem Isaak, ihm den Rücken zuwendend, kniet. In einem vasenartigen Topf mit breitem Rand rechts vom Altar schwelt die Glut, die er zum Entzünden des Holzstosses mitgebracht hat. Von links oben kommt der Engel, der die Hand auf die Schneide des Schwertes legt. ld Speisung des irsraelischen Volkes in der Wüste Moses steht mit Aron auf der linken Seite erhöht und weist mit beiden Händen auf das Wunder des Mannaregens. Die Israeliten sammeln das Brot vom Himmel in Körbe. Das Manna ist ein Hinweis auf die Eucharistie. Im Hintergrund sind die Zelte des Lagers sichtbar. le Gesetzgebung an Moses In blauem Gewände kniet Moses auf dem Berge Sinai, dessen Gipfel von Wolken verhüllt ist und von feurigem Scheine erstraht. Aus den Wolken ragen Trompeten. Rund um den Berg knien die Israeliten in grosser Furcht mit erhobenen Händen. lf Die eherne Schlange Die am Kreuz erhöhte eherne Schlange ist das Vorbild des am Kreuz erhöhten Christus (Joh., 15). Um das Kreuz auf der rechten Bildseite ringelt sich die Schlange, den Blick Moses mit dem Stab zugewandt. Unter dem Kreuz liegt ein Sterbender, um dessen Arm sich eine Schlange windet. Im Hintergrund eine Gestalt, die von einer Schlange bedroht zurückweicht und den Blick vertrauensvoll zum Kreuze hebt. 16
8 2. Reihe 2a Verkündigung Ein Engel mit dem Stab in der linken Hand, um den ein Schriftband mit dem «englischen Gruss» gewunden ist, tritt von der linken Bildseite zu Maria, die unter einem grünen Baldachin in einem Betstuhle kniet. Über dem Engel schwebt eine weisse Wolke, aus der Strahlen auf Maria fallen, die in demütiger Haltung, die Augen niedergeschlagen, die rechte Hand auf dem Herzen, die Verkündigungsbotschaft entgegennimmt. Ihr Haupt umstrahlt ein Heiligenschein. Das Geschehen ist deutlich von den dunklen Blau- und Grüntönen des Hintergrundes und dem Mattrosa der Fliesen abgehoben, auf dem der Engel halb schreitend, halb schwebend auf Maria zukommt. 2b Geburt 2c Christi Die Randsäulen sind in die Architektur einbezogen. Vor der Krippe mit dem Kinde knien anbetend Maria und zwei Engel. Hinter dieser Gruppe steht Josef mit geneigtem Haupt. Links im Bild stehen oder knien Hirten. Unter einem Pultdach, auf der rechten oberen Bildseite, steht der Esel vor der Heuraufe. Die Komposition scheint dem Maler nicht recht gelungen. Die Figuren sind steif, ohne rechten Bezug zueinander und mit groben Verstössen gegen die Anatomie gezeichnet. Recht sorglose Ausbesserungen und Übermalungen haben ausserdem die Wirkung dieses Bildes stark beeinträchtigt. Beschneidung Auf einem runden Tisch, der auf einem Podium aus starken Bohlen steht und mit einem weissen Tuch bedeckt ist, sitzt der Knabe auf einem Kissen, das wiederum auf einer bis zum Boden reichenden verzierten Stoffbahn liegt. Ein Priester, gekennzeichnet mit der Mitra, ist im Begriff, die Beschneidung vorzunehmen, ausserdem befinden sich noch 2 Männer mit dem Stab in der Hand auf dem Bild, wovon der rechtsstehende dem Kind beruhigend die Hand auf die Schulter legt, das von Josef gehalten wird. Rechts vor dem Tisch steht eine Frau mit einem bis zum Boden hängenden streifenförmigen Wickeltuch. Ihr bis zu den Knöcheln reichendes steifes Gewand ist im unteren Teil glockig erweitert. In der unnatürlich gewundenen Haltung des Hohenpriesters zeigt sich ein gewisses Unvermögen in 17
9 der Körperbehandlung. Im Hintergrund ist der Tempeleingang zu sehen. 2d Epiphanie Maria mit grossem Kopfnimbus, vor einem dunklen Pfeiler sitzend, hält das Kind auf ihrem Schoss. Rechts daneben steht mit einem Stab Josef. Von links treten die Weisen in den Raum und bringen, einer von ihnen kniend, ihre Geschenke dar. Das Kind breitet die Arme aus. 2e Einzug in Jerusalem Der Einzug Jesu in Jerusalem ist das Vorspiel zur Leidensgeschichte. Christus, recht jugendlich dargestellt, in weissem Gewand mit rotem Umhang, reitet auf einem Esel in die Stadt ein. Ein alter Mann ist im Begriff, ein blaues Tuch auf der Strasse auszubreiten. Im Gefolge im Vordergrund Petrus, dahinter weitere Jünger Christi. Im Hintergrund sind Stadtmauern zu erkennen. 2f Abendmahl Rund um den Tisch sind die Apostel in Gruppen aufgeteilt, die unter sich im Gespräch stehen. Besonders hervorgehoben sind Johannes, dessen Kopf auf der Schulter Christi ruht, und Judas mit roten Haaren und rotem Bart, dessen eine Hand unter dem Tischrand den Geldbeutel hält. Vor Christus befinden sich auf dem Tische Brote und der Kelch. Rechts unten steht eine barocke Wasserkanne, vielleicht die Fusswaschung andeutend. a Christus am Ölberg Das Bild ist in drei Ebenen aufgebaut: die schlafenden Jünger, der zum Himmel aufblickende leidende Christus und der von oben kommende Engel mit dem Kelch. Im Hintergrund sind Mauern und Türme einer Stadt angedeutet, der eine Gruppe von Menschen, vermutlich die geflohenen Jünger, zustrebt. b Gefangennahme Von links drängen unter Führung eines Hohenpriesters die Häscher mit Lanzen, Helebarden und Morgensternen herein. In der Bildmitte steht Judas, den Beutel umfassend, neben Christus, der mit einer 18
10 c d Handbewegung die Soldaten zurückhält. Rechts eine bewegte Szene: Petrus hat den Malchus zu Boden geworfen und fällt mit dem Schwert über ihn her. Geisselung Christus ist an einem in der Mitte des Raumes stehenden Pfeiler mit den Händen auf den Rücken festgebunden. Die beiden Henkersknechte stehen links und rechts der Säule und holen, die Oberkörper stark gedreht, zum Schlage aus. Pilatus steht links von der Szene mit einem mitraähnlichen Hut, Zeichen seiner Macht und Würde, auf dem Kopf. Er hebt die rechte Hand. Rechts Priester als Vertreter der anklagenden Behörde. Dornenkrönung In der Mitte des Bildes sitzt Christus vor einer Säule, angetan mit dem Spottmantel, die Hände gefesselt, das Haupt mit Dornen gekrönt. Zwei Schergen drücken ihm mit Stäben die Dornenkrone aufs Haupt, ein dritter reicht ihm mit einem Fussfall das Rohr. Auf der linken Bildseite Pilatus, der einen Stab in der Hand hält, mit einem Priester und einem Schild und Lanze tragenden Soldaten. e Ecce homo Auf einem zweistufigen Podest steht Christus, bekleidet mit dem Spottmantel, in der Hand das Rohr. Handelnde Figur ist Pilatus, der, in der Mitte des Bildes stehend den Priestern und dem von rechts nachdrängenden Volk Christus vorstellt. Ein Priester hebt den Mantel zur Seite und zeigt, den Kopf zur Seite gewandt, dem Volk den zerschlagenen Leib Christi. Im Hintergrund ragen Lanzen auf. Das emporgehobene Kreuz symbolisiert die Gesinnung der Menge, die den Tod am Kreuze fordert. f Kreuztragung Der tiefgebeugt schreitende Christus hat das Kreuz auf dem Boden aufgestützt. Veronika, von rechts kommend, ist ins Knie gesunken. Sie hält das Schweisstuch mit dem Bilde Christi dem Beschauer zugekehrt. Simon von Cyrene hilft, das Kreuz zu tragen, auf das ein Henker, der einen Knüppel schwingt, in roher Gebärde seinen Fuss setzt. Vor dem Kreuze her geht ein nackter Mann mit auf dem Rücken 19
11 gebundenen Händen, begleitet von zwei Soldaten. Es ist ein Schacher, der ebenfalls zur Kreuzigung geführt wird. Von links kommend reiten zwei Vertreter der Priesterschaft gegen eine Gruppe von Soldaten. Der ikonographische Schwerpunkt der stark bewegten Komposition ist die Begegnung Christi mit Veronika. 4. Reihe 4a 4b 4c Kreuzigung Unter düsterem Himmel steht das Kreuz, an dessen Fuss Schädel und Knochen liegen. Das Haupt Christi ist nach Art der gotischen Darstellungen nach rechts gewendet. Der linke Schenkel ist über den rechten gelegt, die Knie und der linke Arm sind etwas eingewinkelt. Beide Füsse sind mit nur einem Nagel durchbohrt. Auf die Durchbildung der Körperformen wurde kein besonderes Gewicht gelegt. Das Ende des Lendentuches ragt unnatürlich gebauscht in den Raum. Maria und Johannes stehen mit gefalteten Händen in reich drapierten Gewändern unter dem Kreuz. Alle Köpfe tragen grosse weisse Aureolen. Grablegung Der Leichnam Christi wird auf der Grabkufe von Josef von Arimathia und Nikodemus mit Tüchern umwickelt. Hauptthema des Bildes ist die Begegnung Marias mit ihrem toten Sohn. Von Johannes gestützt neigt sie sich in Trauer zu Jesus. Im Hintergrund, von rechts kommend, schaut eine Gruppe von drei Begleitpersonen dem Geschehen zu. Sie geben ihre Ergriffenheit durch Verschränken der Arme und Neigen des Hauptes Ausdruck. Der Hintergrund ist eine in düsterem Braunschwarz gehaltene Felswand, die nur links oben einen Durchblick gestattet. Vor der Grabkufe liegen drei Nägel, die Dornenkrone und eine Schale für die Spezereien. Auferstehung Christus als Triumphierender steht auf der Grabkufe, ums Haupt die Aureole, umgetan mit einem flatternden roten Mantel, in der linken Hand die Fahne mit dem Kreuzeszeichen, die rechte erhoben und die Nagelwunde zeigen. Vier Wächter umlagern das Grab, zwei 140
12 davon schlafend, zwei erschrocken aufwachend. Ein fünfter flieht nach rechts, wobei sein geschulterter Spiess ins Bild ragt. 4d Himmelfahrt Christus hat sich von einer grünen Hügelkuppe in eine Wolke erhoben, so dass nur noch die Füsse und der untere Teil des roten Mantels sichtbar sind. Um den Hügel sind Maria und die Jünger versammelt, die auf den Knien liegend am wunderbaren Geschehen Anteil nehmen. Aus den Wolken blicken die Halbfiguren zweier Engel, die eine Hand mit gestrecktem Zeigefinger zu Christus erhoben. 4e Pfingsten In einer riesigen Gloriole schwebt der heilige Geist in Gestalt einer Taube über dem Raum. Die rahmenden Säulen sind im Hintergrund, auf hohen Sockeln stehend, wiederholt. Maria, als Hauptfigur mit grossem Nimbus, sitzt im Kreise der Apostel, alle in der Haltung des Gebetes. Über den Häuptern aller Versammelten schweben «feurige Zungen«. Das Pfingstbild trägt auch das Monogramm des Malers IGC und die Jahreszahl f Weltgericht Eine Wolke teilt das Bild in zwei Teile, in einen oberen, gleichsam überirdischen, und einen unteren, auf dem sich die Geschehnisse des Weltgrichtes abspielen. Über der Wolke steht Christus auf der Weltkugel, links von seinem Haupte ein feuriges Schwert, rechts eine Lilie. Auf der Wolke kniend Maria und Johannes der Täufer. Auf der Erde weist ein Engel in hellem Gewände die Guten auf die rechte Seite, ein zweiter in dunklem Mantel jagt die Bösen in den Abgrund der feuerflammenden Hölle, wo sie vom Teufel in Empfang genommen werden. Der Eingang zur Hölle ist der Rachen eines scheusslichen Untiers, aus dem ein geschwänzter und gehörnter Teufel tritt, Darstellungen, die der Dämonenvorstellung des Mittelalters entstammen. Im Vordergrund entsteigen drei Menschen dem Grabe. 141
13 GEBRAUCH UND RELIGIÖSE BEDEUTUNG Das Fastentuch ist ein grosser Vorhang, der seit dem 10./II. Jahrhundert zuerst in den Kathedral-, Kollegiats- und Stiftskirchen, später auch in den Pfarrkirchen beim Beginn der Fastenzeit zur Verhüllung des Altares aufgehängt wurde. 1 Es wurde am Aschermittwoch oder schon am Vorabend, an manchen Orten auch am ersten Fastensonntag, 2 zwischen dem Altar und dem Schiff der Kirche, in der Regel am Triumphbogen angebracht. Gewöhnlich wurde es am Mittwoch der Karwoche entfernt, der schon 1091 als Beginn der Fastenzeit festgelegt wurde. Es hätte bei den Zeremonien der folgenden liturgiereichen Tage gestört. Es gibt Belege für die Abnahme am Gründonnerstag während den Worten der Passion: «Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei», (Luk. 2,45). Aber auch die Entfernung am Karfreitag ist sporadisch bezeugt. 4 An den Sonntagen wurde es zurückgezogen, weil der Sonntag kein Fasttag war und an die Auferstehung Christi erinnert, 5 oder die Messe wurde nur an den unverhüllten Seitenaltären gelesen. 6 Auf die Frage nach dem Sinn der Altarverhüllung sei hier kurz eingegangen. Die mystische Verhüllung des Göttlichen und kultischer 1 Johann Schneider, Kärntner Fastentücher. In: Heiliger Dienst, herausgegeben vom Institutum Liturgicum, Erzabtei St. Peter, Salzburg, XIV. Jahr 1960, Folge 1. S H. Samson, Das Fastentuch. In: Pastor Bonus, Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und Praxis, Trier, 7 (1895), S Karl Hölker, Das Telgter Hungertuch. In: Das schöne Münster, Jg. 5, Heft 5, Münster 19, S Johannes Emminghaus, Die westfälischen Hungertücher aus nachmittelalterlicher Zeit und ihre liturgische Herkunft, Münster 1949, S. 41. F. Schober, Das Fasten- oder Hungertuch im Münster U. L. F. in Freiburg i. B. In: Schau-in's Land 28, Freiburg i. B 1901, S. 19. Columban Buholzer, Vom Fastentuch. In: Bündnerisches Monatsblatt 1942, Nr. 12, Chur 1942, S. 71. Josef M. Hasler, Fasten- und Hungertücher. In: Allgemeine Kölnische Rundschau, 2 (1949), Nr. 44, S Samson, a. a. O., S Hermann Handel-Mazetti, Die Hungertücher und ihre historische Entwicklung. In: Christliche Kunst, 16. Jg., München 1919/1920, S
14
15
16 Handlungen ist ein religiöses Urphänomen, das in allen Religionen, besonders in deren Frühform in Erscheinung tritt. Die Tendenz zur Verhüllung entstammt der ehrfurchtsvolen Scheu vor der geheimnisvollen Gottheit, die alle menschlichen Grenzen sprengt und weder geschaut noch begriffen werden kann. 7 Der Anblick des Zeus, des höchsten Gottes der Griechen, war für das menschliche Auge unerträglich. Die Bundeslade der Juden und das Allerheiligste des Tempels waren durch einen Vorhang verhüllt. Das Christentum stammt aus der gleichen religiösen Grundhaltung. In der Ostkirche hatten Velen den liturgischen Zweck, den Klerus vom Volk abzusondern und auf den Mysteriencharakter der liturgischen Feier hinzuweisen. Der grosse Einfluss des Ostens auf das Abendland in der Frühzeit des Christentums ist allgemein anerkannt. In der kirchlichen Architektur, deren Bauformen aus dem Morgenlande stammen, zeigt sich von Anfang an die Neigung, den Kultraum, in dem sich das Mysterium vollzieht, vom Laienraum zu trennen. Für den Menschen der Spätantike bis zum Mittelalter ist das sinnlich Wahrnehmbare nicht das eigentlich Wirkliche. Religiöse Erkenntnisse erlangt der Mensch nicht durch rationale Durchdringung sondern durch mystische Versenkung. In der Ehrfurcht vor dem undurchdringlichen Geheimnis ist die Begründung für kultische Verhüllungen aller Religionen zu suchen. Der Mensch ist nicht würdig, Gott zu schauen. Das Fastentuch symbolisiert einen Aspekt dieser religiösen Grundeinstellung. Zur Zeit der Gotik ist ein Umschwung in der Volksfrömmigkeit festzustellen. Die Sucht, das Heilige zur Schau zu stellen und zu schauen, nimmt Überhand. Das sinnliche Wahrnehmen durch das Auge wird zu einem wichtigen Moment des religiösen Lebens. Die Einführung des Fronleichnamsfestes durch Papst Urban VI. im Jahre 1264 für die ganze Kirche beleuchtet schlagartig diese mittelalterliche Geisteshaltung. Die Sichtbarkeit des Kultes setzt sich durch. Gegenüber dem Bestreben, das Mysterium schauen zu wollen, bedeutet nun der Gebrauch des Fastentuches, das in dieser Zeit eine starke Verbreitung findet, eine Strafe und Busse. Es ist wirklich Askese und nicht äusseres Symbol der Zeit des Fastens und Verzichtens. Daraus 7 Emminghaus, a. a. O., S. 6. Ich folge hier im wesentlichen seiner Darstellung. 14
17 erklärt sich auch die Beschränkung seiner Verwendung auf die Fastenzeit. Das Fastentuch ist also im Zusammenhang mit der kirchlichen Bussdisziplin zu sehen. Wegen seiner Sünden ist der Gläubige nicht würdig, das Allerheiligste zu schauen. Die alte Kirche kannte zur Zeit ihrer reinsten Disziplin nur die öffentliche Busse. Als Busszeit galt vor allem die Fastenzeit zwischen dem Aschermittwoch als Tag der Bussauflegung und der Ausscheidung der Büsser aus der Gemeinschaft der Gläubigen und dem Gründonnerstag als dem Tag der Versöhnung und Lossprechung. 8 Diese strenge Bussordnung erhielt sich neben der Privatbeichte bis ins 14. Jahrhundert. Aber schon seit dem 10. Jahrhundert wurde die geweihte Asche bei Beginn der Fastenzeit von allen Gläubigen empfangen. Das Allerheiligste durften sie während der Busszeit nicht schauen. Es wurde ihren Blicken durch das Fastentuch entzogen. Alle wurden dadurch an den Ernst der Zeit erinnert und zur Einkehr gemahnt. Das Fastentuch bekam die sinnbildliche Bedeutung von Busse und Reue. 0 GESCHICHTE UND VERBREITUNG Der Brauch, Fastentücher aufzuhängen, scheint von Burgund ausgegangen zu sein. Er verbreitete sich im 11. Jahrhundert über das ganze Abendland. In England waren die Fastentücher besonders häufig. Dort war ihre Verwendung durch Synodalbestimmungen vorgeschrieben. 10 Das Konzil zu Exeter (1287) bestimmte für jeden Altar, an dem zelebriert wurde ein velum quadragesimale (Tuch der vierzig Tage). 11 In Italien wurde es weniger gebraucht. Eine Anzahl von Fastentüchern hat sich in Kärnten erhalten. Von besonderer Bedeutung ist das Hungertuch von Gurk. 12 In Vorarlberg gibt es noch drei Fastentücher, die alle dem Vorarlberger Landesmuseum gehören. Eines davon, aus dem 18. Jahrhundert 8 Emminghaus, a. a. O., S Schneider, a. a. O., S Hölker, a.a.o., S Elisabeth Hohmann, Das Telgter Hungertuch. In: Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd., Berlin 196, S Schneider, a.a.o., S.4 ff. 144
18 aus Bregenz, hängt derzeit als Leihgabe in der St. Gebhardskirche in Bregenz-Schendlingen. Die beiden anderen, wovon eines aus Lustenau, 1686, und eines aus Schnepfau, um 1740, befinden sich in Verwahrung im Museum selbst. 1 Das älteste in der Literatur genannte Hungertuch ist das in der Radbert-Chronik erwähnte velum Optimum des St. Galler Abtes Hartmodus (t895), das ihm von seiner Schwester Richlin geschenkt wurde. 14 Aus der Schweiz sind eine ganze Anzahl noch vorhandener Fastentücher bekannt. Das Schweizerische Landesmuseum in Zürich bewahrt vier Fastentücher auf, das älteste davon stammt aus Ems. Das Rätische Museum in Chur besitzt zwei Fastentücher, die beide aus Brigels, Bündner Oberland, stammen. 15 Steinen, Kt. Schwyz, besitzt ein sehr gut erhaltenes Fastentuch, das sich im historischen Museum in Schwyz befindet. Ein ähnliches Tuch aus der Kirche in Kerns wird im historischen Museum in Samen aufbewahrt. Silenen besitzt ein Fastentuch, und dasjenige von Unterschächen befindet sich im historischen Museum zu Altdorf. Dort werden auch die Fragmente des ältesten Fastentuches der Schweiz aufbewahrt, das aus Erstfeld stammt. 16 Die grösste Verbreitung scheint der Brauch, mit dem Fastentuch den Altar zu verhüllen, im 14. und 15. Jahrhundert gehabt zu haben. Zur Reformationszeit ist seine Blüte vorbei. Die Bilderfeindlichkeit, die Verwerfung der Transsubstantiation und der Realpräsenz Christi unter der Gestalt des Brotes lassen das Fastentuch für die neue Lehre sinnlos erscheinen. Luther lehnt das Fastentuch ausdrücklich ab und bezeichnet es als «Gaukelwerk». 17 So verschwindet das Fastentuch in protestantischen Kreisen im 16. Jahrhundert mehr und mehr. In Frankreich macht die Aufklärung seiner Verwendung bis auf wenige Ausnahmen ein Ende. Die Spätformen 1 Freundliche Mitteilung von Dr. E. Heinzle, Bregenz, 14 So bei Buholzer, a.a.o., S. 79; Emminghaus, a.a.o., S. 24; Schneider, a. a. O., S. 1 und Schober, a. a. O., S. 10. Emminghaus deutet dieses in der Literatur oft als erstes Fastentuch genannte Velum als eine Kreuzeshülle. 15 Fritz Jecklin, Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden, Jahrgang 1906, Chur 1907, XXXIII v. u. S. XXXIV. 16 Buholzer, a. a. O., S Martin Luther, Deutsche Schriften, Jenaer Ausgabe, III. Band, 1565, zit. nach Emminghaus. 145
19 der Hungertücher zeigen jedoch, dass auch beim katholischen Kirchenvolk die symbolische Bedeutung der Altarverhüllung nicht mehr verstanden wird. Immer mehr wird das anfänglich schlichte und einfarbige Tuch in barocker Erzählfreude mit Bildern geschmückt, so dass sein liturgischer Sinn schliesslich ganz in den Hintergrund tritt. Die Bemalung wird allgemein üblich. Farbige Schilderungen biblischen Geschehens in grosser Zahl beschäftigen das Auge des Betrachters. Der Busscharakter des Brauches, der in einer «Askese der Augensinnlichkeit» 18 bestanden hat, verschwindet aus dem Bewusstsein der Gläubigen. Das Fastentuch ist zur Bilderbibel für das Volk und zu einem blossen Symbol für die herrschende Fastenzeit herabgesunken. Es kann noch zur Belehrung und frommen Betrachtung dienen, ist aber seines eigentlichen Sinnes entleert. 19 Trotzdem hält es sich hauptsächlich in bäuerlichen, konservativen Gegenden bis ins 19. Jahrhundert. Versuche neuerer Zeit, den Brauch der Aufhängung des Fastentuches aufleben zu lassen, blieben ohne Erfolg, da sie im Gegensatz stehen zu den Erneuerungsbestrebungen der Kirche, die die Opferfeier für den Gläubigen verständlicher machen will und den Gedanken der Mahlgemeinschaft wieder aufnimmt. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an die Messfeier gegen das Volk, die Verwendung der Volkssprache und die neuen Ansätze im Kirchenbau mit der Tendenz, die Trennung zwischen Priesterund Laienraum aufzuheben. DIE HERKUNFT Das Benderer Hungertuch wurde der Überlieferung zufolge von zwei Jungfrauen aus dem Haag der Kirche von Bendern geschenkt. 20 Woher 18 Emminghaus, a. a. O., S Emminghaus, a. a. O., S. 26. Die Rendensart «am Hungertuch nagen» taucht seit Anfang des 16. Jahrhunderts auf. Dabei ist das «nagen» wohl eine Verdrehung von najen = nähen. Diese Deutung wird nahegelegt durch die Rendensart: «Am Hungertuch flicken». Der Name Hungertuch ist gerechtfertigt durch die Strenge der früheren Fastengebote. Es gibt gestickte und bedruckte Fastentücher. Schliesslich wird die Bemalung allgemein üblich. 20 Johann Baptist Büchel, Die Geschichte der Pfarrei Bendern, JBL 2, 192, S. 21 u. S
20
21
22 J. B. Büchel diese Information bezogen hat, ist nicht nachzuprüfen. Die damaligen kirchlichen Verhältnisse lassen eine solche Stiftung jedoch als möglich erscheinen. Bendern ist eine der ältesten Pfarreien unseres Landes. Nach Urkunden des Kaisers Heinrich II. vom Jahre 1045 und des Papstes Alexander III. von 1177 gehörte die Kirche samt ihren Gütern und der Pfarrpfründe dem 809 gegründeten Frauenkloster zu Schänis. Bendern war durch den Grafen Humfried von Churrätien an Schänis gekommen. Am Ende des 12. Jahrhunderts war es im Besitze des schwäbischen Ritters Rüdiger von Limpach. Dieser schenkte seine Besitzungen 1194 dem Kloster St. Luzi in Chur. Mehr als 600 Jahre lang, bis 1816, verwalteten Patres von St. Luzi die sehr ausgedehnte Pfarrei. Zu ihr gehörten Bendern, Gamprin, Ruggell, Schellenberg und der Weiler Abberg, und jenseits des Rheines Haag, Salez und im Mittelalter auch Sennwald. Die Pfründe Sennwald, deren Kollatur ebenfalls das Kloster St. Luzi besass, wurde im Jahr 1422 gegründet. Die Pfarrei reichte also vom Gantenstein bis an den Fuss der Kreuzberge und des Hohen Kastens. 21 Als die Mönche des Klosters St. Luzi 158 infolge der Reformationswirren Chur verlassen mussten, nahmen sie für 100 Jahre Zuflucht in Bendern, wo sie neben dem bestehenden Pfarrhause eine Abtswohnung erbauten. Unter den Freiherren von Sax, zu deren Herrschaftsgebiet Sax, Frümsen, Sennwald, die obere Lienz, Salez und Haag gehörten, war im Bendern gegenüberliegenden Rheintal im 16. Jahrhundert die neue Lehre eingeführt worden. Nur Haag war hartnäckig beim katholischen Glauben geblieben wurde die verschuldete Herrschaft an Zürich verkauft. Aber noch 1624 berichtet Landvogt Holzhab, dass die Haager je länger je halsstarriger werden und allen Versuchen, sie zum Übertritt zu bewegen, systematischen Widerstand entgegenstellen. 22 Erst 167 traten die Haager zum reformierten Bekenntnis über. Die Grafen von Sulz hielten die Reformation von ihren Herrschaftsgebieten fern. 161 gingen die verschuldeten Landschaften Vaduz und Schellenberg an Graf Kaspar von Hohenems über. 21 Büchel, a. a. O., S.5 ff. 22 Richard Aebi, Geschichte der evangelischen Kirchgemeinden Sennwald- Lienz, Sax-Frümsen und Salez-Haag, Buchs SG
23 Zur Zeit der Entstehung des Fastentuches residierte in Bendern der 160 in Roggenburg zum Abt von St. Luzi gewählte P. Simon Maurer, ein angesehener und tatkräftiger Mann, der sich um die Wiederaufrichtung des Klosters in Chur sehr bemühte. Er starb 1624 in Bendern. 28 Seit dem Jahre 1608 war bekannt, dass Graf Ludwig von Sulz die Absicht hatte, die Herrschaft Vaduz und Schellenberg zu veräussern. Es wurden Verhandlungen mit Österreich und dem Fürstabt von St. Gallen geführt trat auch Kaspar von Hohenems als Interessent für die beiden Herrschaften auf, die er 161 in seinen Besitz brachte. 24. Auf dem Pfingstbild des Benderer Hungertuches ist ausser der Jahrzahl 1612 auch das Monogramm des Künstlers angebracht, das aus den Buchstaben IGC besteht. 25 In Feldkirch wirkte zu Anfang des 17. Jahrhunderts der Maler Johann Georg Clesi, der von Graf Kaspar mehrmals mit Aufträgen betraut wurde liess der Graf, der die Vogtei Feldkirch übernommen hatte, die Schlosskapelle in der Schattenburg erneuern. Für diese Kapelle malte in seinem Auftrag Meister «Hans Jerg Klaissin» eine grosse Tafel. 27 Gemäss einer Notiz im Ausgabenbuch Graf Kaspars zum Februar 1618 werden dem «Clesle Maler» zu Feldkirch wiederum für eine Tafel in der Schlosskapelle 8 fl. angewiesen. Aus einer Eintragung im Januar 2 Büchel, a. a. O., S Siehe auch: Otto Seger, Aus den Zeiten des Herrschaftsüberganges von Brandis zu Sulz und von Sulz zu Hohenems, JBL 60, S. 69 f. 25 Erwin Poeschel, Die Kunstdenkmäler des Fürstentums Liechtenstein, Sonderband aus der Reihe: Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Basel 1950, S Poeschel bringt die Initialen in der Reihenfolge ICG. 26 Den Hinweis auf den Maler Clesi im Zusammenhang mit dem Benderer Fastentuch verdanke ich Herrn a. Stadtarchivar Dr. E. Somweber, Feldkirch. Auf Akten aus dem Stadtarchiv und dem Domarchiv zu Feldkirch findet er folgende Schreibweisen des Namens: «Hanns Georg Cläsi», «Hanß Jerg Cläsin», «Hanns Georg Kleßin», «Hanß Jerg Clesin». 27 Dr. Ludwig Welti, Der Feldkircher Maler Hans Jerg Cläsi und die neue Schlosskapelle auf der Schattenburg. In: Montfort, Zeitschrift für Geschichte, Heimat- und Volkskunde Vorarlbergs, 1949, Heft 4/12, S
24 dieses Jahres ergibt sich, dass er etwas an einen «Conterfeth» (Portrait) zu machen hatte. 28 Dr. Ludwig Welti weiss von dem Maler weiterhin zu berichten: «Im Urbar der Herrschaft Feldkirch von 1618 wird Meister Hans Georg Kläsi, Bürger und Maler zu Feldkirch, als Zinser und Hausbesitzer aufgeführt. Sein Haus mit Hofstatt in der Stadt grenzte zu der einen Nebenseite an Hans Ulrich Mayers und seines Schwagers Andreas Zelfis Haus, zur anderen Seite an das Gässelin, hinten an Stoffel Strahls Haus und Höfle, vorne an die gemeine Gasse. Nach den von Dr. E. Somweber im Stadtarchiv durchgeführten dankenswerten Erhebungen ist Hans Georg Cläsi bereits im August 1604 und dann wieder 1615 in Musterregistern als ein wehrhafter, mit einer Muskete, einer Rüstung und 2 langen Spiessen bewaffneter, in der oberen Schmiedgasse wohnender Bürger nachweisbar. Da 1642 seine Witwe als Steuerträgerin genannt ist, muss er vor diesem Zeitpunkt das Zeitliche gesegnet haben. Wir dürfen den aus einer alten Feldkircher Patrizierfamilie stammenden Meister wohl der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Blüte gestandenen Malerschule von Moritz und Jörg Frosch zurechnen, die mit den ebenfalls über den Bereich der Stadt hinaus beschäftigt gewesenen guten Meistern der Bildhauerei Lazarus und Heinrich Arnoldt und Erasmus Kern den von Wolf Huber begründeten Ruhm Feldkirchs als Kunststadt vermehrten.» 29 «Nach P. Joller gehörten die Clessin (Cläsin, Cläsi) zu den ältesten, im 19. Jahrhundert noch in Blüte gestandenen, jetzt aber ausgestorbenen Bürgerfamilien in Feldkirch kommt dort ein Barbier Hans Cläsi vor, 1522 wird Johann Claesi «alias Tischmacher» aus Feldkirch als Kaplan zu St. Valentin in Rüti genannt. Um 1590 werden Matthias Cläsi und der Wundarzt Lienhart Cläsin als Bürger von Feldkirch öfter erwähnt. Goldschmied Franz Clessin (f 1671), Ratsherr zu Feldkirch renovierte 1684 das alte silberne Kreuz in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus.» 0 «Hans Jorg Clessi moller» war von oder 1619 Meister in 28 Welti, Feldkircher Künstler und Kunsthandwerker der Frühbarockzeit. In: Montfort, 1947, Heft 7/12, S Welti, a. a. O., Montfort, Heft 4/12, S. 18 u Ebenda, Anm
25 der Hammerzunft in Feldkirch. Diese Zunft besteht in Feldkirch heute noch als Grosshammerzunft. Ihr gehörten früher auch Maler und Bildhauer an, z. B. Erasmus Kern von Die Beziehung Cläsis zu unserem Land zeigt sich in folgender Eintragung in einem Lehrlingsbuch dieser Zunft: «Hans Georg Cleßj hat einen Leriung haist Johannes Chrisostomus Boß von Baltzers A 1612.» Bei 1619 heisst es «Hans Jorg Clessis sellig witib». 1 Der Maler muss also 1618 oder 1619 gestorben sein. Die kulturellen Beziehungen unseres Landes zur Stadt Feldkirch waren im 16. und 17. Jahrhundert besonders rege. Ein grosser Teil der künstlerischen Ausstattung unserer Kirchen stammt aus Feldkirch. Hier sind besonders die Bildhauer Erasmus Kern und Ignatius Joseph Bin und der Maler Hans Huber, nach einer Vermutung Erwin Poeschels der Vater Wolf Hubers, zu nennen. Aus der Werkstätte der Clessin stammen auch, wie Poeschel feststellen konnte, einige Werke der Goldschmiedekunst, die noch erhalten und zum Teil noch in unseren Kirchen in Gebrauch sind. 2 Eine Anzahl kirchlicher Malereien oder Skulpturen unseres Landes, die aus stilistischen Gründen dem süddeutschen Räume zuzuordnen sind, können noch nicht einem bestimmten Meister zugewiesen werden, da besonders die Malerei des 17. Jahrhunderts in unserer Region zu wenig erforscht ist. Das Fastentuch von Bendern gehört sicher in diese Stilrichtung. Ein dokumentarisch gesichertes Bild Clessins ist zwar noch nicht entdeckt worden. Aus der Übereinstimmung der Initialen und der mehrfach belegten Zeit seines Wirkens in Feldkirch, aus dem Verhältnis des Malers zum regierenden Grafen Kaspar von Hohenems, aus den kulturellen Beziehungen unserer Landesgegend mit Feldkirch und aus stilistischen Gründen kann mit einiger Sicherheit geschlossen werden, dass Johann Georg 1 Stadtarchiv Feldkirch, Grosshammerzunft. Mitgeteilt von Dr. E. Somweber. 2 Poeschel, a. a. O., S. 102, S. 278 u. S. 26. Dazu auch: Reinald Fischer, Der Maler Dietrich Meuss von Feldkirch im Dienste der Fürstabtei St. Gallen und des Landes Appenzell Innerrhoden, Separatdruck aus der Festgabe für Paul Staerkle zu seinem 80. Geburtstag am 26. März 1972, hrsg. vom Staats- und Stiftsarchiv St. Gallen, S
26
27 Clessin der Maler des Benderer Fastentuches ist. Es wäre somit das einzige bis heute bekannte und signierte Werk des bisher wenig beachteten Feldkircher Meisters. DER HEUTIGE ZUSTAND DES FASTENTUCHES Jahrhundertelanger Gebrauch, Feuchtigkeit und unsachgemässe Behandlung haben die Malereien stark beschädigt. Durch eine, vielleicht auch mehrere ungeschickte Übermalungen haben sie unerwünschte Änderungen erfahren. Vor allem wurden ursprünglich rote Flächen der Gewänder, die vermutlich zu einem rotbraun nachgedunkelt waren, recht schematisch und ohne Differenzierung neu aufgetragen. So wurden auch, ohne jede Einfühlung, schadhafte Stellen der Farbtöne grün, blau und hellbraun erneuert. Undeutliche Konturen wurden mit kräftigen Strichen nachgezogen, die dem malerischen Aufbau der Bilder nicht Rechnung tragen und hart wirken. Mit einer kräftigen braunschwarzen Farbe wurde bei mancher Darstellung ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Bildaufbau der Hintergrund nachgedunkelt, um eine Kontrastwirkung zu erzielen. Gesichter wurden entstellt, und der Faltenwurf der Kleider wurde zum Teil durch Überdeckung ausgelöscht oder doch wesentlich gestört. Vermutlich war das Tuch zum Zeitpunkt der Überholung schon so schadhaft, dass in manchen Feldern die Konzeption des Malers nicht mehr ganz erkennbar war. Daraus und aus einem fachlichen Unvermögen sind die willkürlichen, oft entstellenden und den koloristischen Gesamteindruck störenden Eingriffe in die malerische Struktur der Bilder zu erklären. Ohne Zweifel haben dem Maler des Benderer Fastentuches Holzschnitte und andere Gemälde als Vorbilder gedient. Seine manieristischen Darstellungen bewegen sich durchaus im Rahmen des damals Üblichen. Die verwendeten Trachten sind die dem Zeitgeschmack entsprechenden alttestamentlichen Gewandungen, während die Architekturstaffage sich an Vorbilder der Renaissance anlehnt. Bewaffnung und Rüstungen entsprechen dem Stand des 16. Jahrhunderts. Die Darstellung des Leidens Christi erinnert an die im Mittelalter und bis in die neueste Zeit beliebten Passionsspiele. Die künstlerischen Fähigkeiten des Malers reichen nicht immer aus, um die formalen Probleme, die sich 151
28 jeweils vom Thema her stellen, zu bewältigen. Reste der ersten Fassung der Bilder zeigen jedoch in der Komposition, in der Bewegung der Figuren, in der Anwendung der malerischen Mittel und in der Behandlung von Einzelheiten handwerkliche Erfahrung und ein gewisses Gespür für die Bildwirkung. Abgesehen von seinen künstlerischen Qualitäten steht jedoch die grosse kulturhistorische Bedeutung des Benderer Fastentuches ausser Zweifel. Auf Veranlassung des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein wurde es im Jahre 1971 vom Österreichischen Bundesdenkmalamt in Wien sachgemäss restauriert. Die ganze bemalte Fläche wurde auf eine neue Leinenunterlage übertragen, wobei für die stark beschädigte oberste Bildreihe ganz besondere Sorgfalt aufgewendet werden musste. Wieder Erwarten gelang es der versierten Restauratorin Frau Maria Deed, alle 24 Bilder des Tuches zu erhalten. Es ist im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz ausgestellt. 152
Aus welchen zwei großen Teilen besteht die Bibel? Wie heißen die vier Evangelisten im neuen Testament? Wie nennt man die fünf Bücher Mose auch?
 Wie heißen die vier Evangelisten im neuen Testament? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Aus welchen zwei großen Teilen besteht die Bibel? Altes und Neues Testament Wie nennt man die fünf Bücher Mose
Wie heißen die vier Evangelisten im neuen Testament? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Aus welchen zwei großen Teilen besteht die Bibel? Altes und Neues Testament Wie nennt man die fünf Bücher Mose
Der Altar der Stiftskirche
 Der Altar der Stiftskirche Der Altar der Stiftskirche ist in Braunschweig (Braunschweiger Madonnenmeister) entstanden und wurde 1501 fertiggestellt. In seinem jetzigen Zustand handelt es sich um einen
Der Altar der Stiftskirche Der Altar der Stiftskirche ist in Braunschweig (Braunschweiger Madonnenmeister) entstanden und wurde 1501 fertiggestellt. In seinem jetzigen Zustand handelt es sich um einen
Christliches Symbol -> Brot
 Christliches Symbol -> Brot In vielen Kulturen ist es das wichtigste Nahrungsmittel. Es ist ein Symbol für das Leben und ein Symbol für die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus hat kurz vor seinem Tod
Christliches Symbol -> Brot In vielen Kulturen ist es das wichtigste Nahrungsmittel. Es ist ein Symbol für das Leben und ein Symbol für die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus hat kurz vor seinem Tod
JAHRESPLANUNG Schulstufe 3
 JAHRESPLANUNG Schulstufe 3 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Gott schenkt Zukunft: Josef und seine Brüder: Gen 37-44 Das Auf und Ab im Leben - Josef und seine Familie - Josef wird verkauft - Josef im
JAHRESPLANUNG Schulstufe 3 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Gott schenkt Zukunft: Josef und seine Brüder: Gen 37-44 Das Auf und Ab im Leben - Josef und seine Familie - Josef wird verkauft - Josef im
Der Altar der Stiftskirche
 Der Altar der Stiftskirche Der Altar der Stiftskirche ist in Braunschweig (Braunschweiger Madonnenmeister) entstanden und wurde 1501 fertiggestellt. In seinem jetzigen Zustand handelt es sich um einen
Der Altar der Stiftskirche Der Altar der Stiftskirche ist in Braunschweig (Braunschweiger Madonnenmeister) entstanden und wurde 1501 fertiggestellt. In seinem jetzigen Zustand handelt es sich um einen
Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst
 1 Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Text einblenden) 29 Am nächsten Tag sieht
1 Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Text einblenden) 29 Am nächsten Tag sieht
Schwandkapelle P. Theodor P. Karl
 Schwandkapelle Die alte Kapelle in der Schwand wurde im Jahre 1673 erbaut. Nach 300 Jahren genügte das schlichte Heiligtum den Aufgaben, die ihm die Stifter gestellt hatten, nicht mehr. Die Schwander wünschten
Schwandkapelle Die alte Kapelle in der Schwand wurde im Jahre 1673 erbaut. Nach 300 Jahren genügte das schlichte Heiligtum den Aufgaben, die ihm die Stifter gestellt hatten, nicht mehr. Die Schwander wünschten
Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen.
 Ratespiel n n n n n n n n n n n n n n n n n Rückseite seite 1 Ratespiel n Bischof Bischofsstab Pfarrei Pfarrsekretärin Kirchensteuer Firmung Religionsunterricht Taufe Blut Christi Tabernakel Hl. Petrus
Ratespiel n n n n n n n n n n n n n n n n n Rückseite seite 1 Ratespiel n Bischof Bischofsstab Pfarrei Pfarrsekretärin Kirchensteuer Firmung Religionsunterricht Taufe Blut Christi Tabernakel Hl. Petrus
Wir beten den Rosenkranz
 Wir beten den Rosenkranz FUSSWALLFAHRT www.wallfahrt-werne-werl.de Wie bete ich den Rosenkranz? Schon vor langer Zeit begannen die Menschen mit Hilfe einer Gebetsschnur zu beten. Später nannten sie es
Wir beten den Rosenkranz FUSSWALLFAHRT www.wallfahrt-werne-werl.de Wie bete ich den Rosenkranz? Schon vor langer Zeit begannen die Menschen mit Hilfe einer Gebetsschnur zu beten. Später nannten sie es
JAHRESPLANUNG Schulstufe 1
 JAHRESPLANUNG Schulstufe 1 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Wer bin ich? Wer ich für andere bin LP / Kompetenzen 1 Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und
JAHRESPLANUNG Schulstufe 1 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Wer bin ich? Wer ich für andere bin LP / Kompetenzen 1 Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und
Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz
 Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 1942 Vom Fastentuch Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte
Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 1942 Vom Fastentuch Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte
LANGE NACHT DER KIRCHEN Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt Rätselralley für Kinder (2014)
 Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Hartwig Ohnimus Christliche Mystik Mensch, rette Deine Seele
 Hartwig Ohnimus Christliche Mystik Mensch, rette Deine Seele Band 2 Jesus Christus und Das Neue Testament 2011 / 2015 Verlag: Hartwig Ohnimus Lüneburger Institut für Erwachsenenbildung und Bewusstseins-Erweiterung
Hartwig Ohnimus Christliche Mystik Mensch, rette Deine Seele Band 2 Jesus Christus und Das Neue Testament 2011 / 2015 Verlag: Hartwig Ohnimus Lüneburger Institut für Erwachsenenbildung und Bewusstseins-Erweiterung
FROHE BOTSCHAFT AUS WITTENBERG
 FROHE BOTSCHAFT AUS WITTENBERG Der Maler Lucas Cranach d. Ä. war der wichtigste Öffentlichkeitsarbeiter der Reformation. Seine Gemälde machten die Menschen mit den Köpfen der Bewegung bekannt. Und sie
FROHE BOTSCHAFT AUS WITTENBERG Der Maler Lucas Cranach d. Ä. war der wichtigste Öffentlichkeitsarbeiter der Reformation. Seine Gemälde machten die Menschen mit den Köpfen der Bewegung bekannt. Und sie
Die Bedeutung der Farben
 Osterfestkreis Johannistag Ostern Osterfestkreis Station 5 Die Bedeutung der Farben Trinitatiszeit Erntedank Michaelistag Trinitatis Pfingsten Buß- und Bettag Reformationstag Himmelfahrt Ewigkeitssonntag
Osterfestkreis Johannistag Ostern Osterfestkreis Station 5 Die Bedeutung der Farben Trinitatiszeit Erntedank Michaelistag Trinitatis Pfingsten Buß- und Bettag Reformationstag Himmelfahrt Ewigkeitssonntag
Gottesdienst Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14, Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat
 Gottesdienst 22.5.16 Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14,1-7.16-17.26.27 Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat es in sich. Seit uralten Zeiten ist sie die Zahl der
Gottesdienst 22.5.16 Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14,1-7.16-17.26.27 Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat es in sich. Seit uralten Zeiten ist sie die Zahl der
1. Wird beim Abendmahl Blut getrunken? Wie ist es mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums? 16
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Wird beim Abendmahl Blut getrunken? 13 2. Warum gilt Abraham als der Urvater des Glaubens? 14 3. Wie ist es mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums? 16 4. War Adam
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Wird beim Abendmahl Blut getrunken? 13 2. Warum gilt Abraham als der Urvater des Glaubens? 14 3. Wie ist es mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums? 16 4. War Adam
Das Kirchenjahr im Überblick. Advent Weihnachten Epiphanias Dreikönigstag 24. Dezember 6. Januar
 Das Kirchenjahr im Überblick Advent Weihnachten Epiphanias Dreikönigstag 24. Dezember 6. Januar Aschermittwoch Passionszeit Palmsonntag Gründonnerstag Trinitatis Dreifaltigkeitsfest Ostersonntag Christi
Das Kirchenjahr im Überblick Advent Weihnachten Epiphanias Dreikönigstag 24. Dezember 6. Januar Aschermittwoch Passionszeit Palmsonntag Gründonnerstag Trinitatis Dreifaltigkeitsfest Ostersonntag Christi
Hochaltar in der Fastenzeit Passionstriptychon
 Hochaltar in der Fastenzeit Passionstriptychon Jesus spricht: Ich habe dich in der Wüste mit Manna gespeist; du aber hast mich ins Gesicht geschlagen und gegeißelt. Liebe Schwestern und Brüder! Unser Fastentuch
Hochaltar in der Fastenzeit Passionstriptychon Jesus spricht: Ich habe dich in der Wüste mit Manna gespeist; du aber hast mich ins Gesicht geschlagen und gegeißelt. Liebe Schwestern und Brüder! Unser Fastentuch
Unterrichtsmaterial Oberstufe, Quiz
 Unterrichtsmaterial berstufe, Quiz Arbeitsblätter mit Wissensfragen -> Rundgang mit 14 Szenen Palmsonntag (Nr. 5, Allemann, Neugasse) Traditionsgemäss strömen viele Menschen zum nach. Kurz vor dem Dorf
Unterrichtsmaterial berstufe, Quiz Arbeitsblätter mit Wissensfragen -> Rundgang mit 14 Szenen Palmsonntag (Nr. 5, Allemann, Neugasse) Traditionsgemäss strömen viele Menschen zum nach. Kurz vor dem Dorf
Harte Fragen an die Bibel: Gott, sein Charakter, seine Entscheidungen 29
 Inhaltsverzeichnis Das Alte und Neue Testament 9 1. Kann man der Bibel heute noch glauben? 11 2. Wie verbindlich ist das Alte Testament? 13 3. Wenn Kain und Abel nach Adam und Eva die ersten Menschen waren,
Inhaltsverzeichnis Das Alte und Neue Testament 9 1. Kann man der Bibel heute noch glauben? 11 2. Wie verbindlich ist das Alte Testament? 13 3. Wenn Kain und Abel nach Adam und Eva die ersten Menschen waren,
Petrus und die Kraft des Gebets
 Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
D i e F r e u d e n r e i c h e n G e h e i m n i s s e
 D i e F r e u d e n r e i c h e n G e h e i m n i s s e I. Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Hl. Geist empfangen hast Unversehrte Jungfrau Maria, Du Königin der Familien Erbitte bei Gott durch das Geheimnis
D i e F r e u d e n r e i c h e n G e h e i m n i s s e I. Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Hl. Geist empfangen hast Unversehrte Jungfrau Maria, Du Königin der Familien Erbitte bei Gott durch das Geheimnis
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29.
 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Rosenkranzandacht. Gestaltet für Kinder. Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach
 Rosenkranzandacht Gestaltet für Kinder Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach Die Geschichte vom Rosenkranz Vor langer Zeit, im 15. Jahrhundert, also vor ungefähr
Rosenkranzandacht Gestaltet für Kinder Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach Die Geschichte vom Rosenkranz Vor langer Zeit, im 15. Jahrhundert, also vor ungefähr
Die Auferstehung Jesu
 Die Auferstehung Jesu Quellen: Lukas 24,13-32; 24,50-53; Johannes 20,24-29; 21,1-15 Schon vor seinem Tod hat Jesus gesagt, dass er auferstehen wird, aber nicht alle hatten ihn verstanden. Am Sonntag geht
Die Auferstehung Jesu Quellen: Lukas 24,13-32; 24,50-53; Johannes 20,24-29; 21,1-15 Schon vor seinem Tod hat Jesus gesagt, dass er auferstehen wird, aber nicht alle hatten ihn verstanden. Am Sonntag geht
Orte in der Bibel. Jerusalem Grabeskirche. [oibje01007]
![Orte in der Bibel. Jerusalem Grabeskirche. [oibje01007] Orte in der Bibel. Jerusalem Grabeskirche. [oibje01007]](/thumbs/61/46020357.jpg) Orte in der Bibel Jerusalem Grabeskirche 1 Die Grabeskirche Die Grabeskirche in der Altstadt Jerusalems soll die Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu Christi sein. Entsprechend mehrerer spätantiker
Orte in der Bibel Jerusalem Grabeskirche 1 Die Grabeskirche Die Grabeskirche in der Altstadt Jerusalems soll die Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu Christi sein. Entsprechend mehrerer spätantiker
Petrus und die Kraft des Gebets
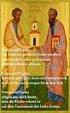 Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Kirchenführer. Westerham
 Kirchenführer der Filialkirche St. Johannes, Westerham Filialkirche St. Johannes Westerham Etwa zur gleichen Zeit, in der der Streit zwischen dem Bischof von Freising und dem Abt von Herrenchiemsee entschieden
Kirchenführer der Filialkirche St. Johannes, Westerham Filialkirche St. Johannes Westerham Etwa zur gleichen Zeit, in der der Streit zwischen dem Bischof von Freising und dem Abt von Herrenchiemsee entschieden
bindet Gott Maria unlösbar an Jesus, so dass sie mit ihm eine Schicksalsgemeinschaft bildet.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
Das feiern wir heute, am Fest der heiligsten Dreifaltigkeit.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Silbernen Priesterjubiläum von Herrn Prof. Knut Backhaus in Kirchdorf an der Amper am 19. Mai 2013 Kein Mensch kann in den
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Silbernen Priesterjubiläum von Herrn Prof. Knut Backhaus in Kirchdorf an der Amper am 19. Mai 2013 Kein Mensch kann in den
Willkommen! In unserer Kirche
 Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
Mariae Aufnahme in den Himmel - LJ C 15. August 2013
 Mariae Aufnahme in den Himmel - LJ C 15. August 2013 Lektionar III/C, 429: Offb 11,19a; 12,1 6a.10ab; 2. L 1 Kor 15,20 27a; Ev Lk 1,39 56 Heute feiern wir so etwas wie unser aller Osterfest, denn das Fest
Mariae Aufnahme in den Himmel - LJ C 15. August 2013 Lektionar III/C, 429: Offb 11,19a; 12,1 6a.10ab; 2. L 1 Kor 15,20 27a; Ev Lk 1,39 56 Heute feiern wir so etwas wie unser aller Osterfest, denn das Fest
Feste im. Jahreskreis
 Feste im Jahreskreis www.lehrmittelboutique.net Bild: Gerd Altmann / pixelio Dietlind Steuer Neujahr ist am ersten Kalendertag eines neuen Jahres. Das Neujahrsfest wird in fast allen Kulturen, allerdings
Feste im Jahreskreis www.lehrmittelboutique.net Bild: Gerd Altmann / pixelio Dietlind Steuer Neujahr ist am ersten Kalendertag eines neuen Jahres. Das Neujahrsfest wird in fast allen Kulturen, allerdings
Johannes 18,1-19,2. Leichte Sprache
 Johannes 18,1-19,2 Leichte Sprache Jesus erzählte den Menschen von Gott. Aber Jesus erzählte nicht nur von Gott. Jesus sagte sogar: Ich komme selber von Gott. Gott ist mein Vater. Ich bin selber Gott.
Johannes 18,1-19,2 Leichte Sprache Jesus erzählte den Menschen von Gott. Aber Jesus erzählte nicht nur von Gott. Jesus sagte sogar: Ich komme selber von Gott. Gott ist mein Vater. Ich bin selber Gott.
Sinnzeichen für Ostern
 Gruppe 1 Sinnzeichen für Palmsonntag Gründonnerstag Karfreitag Ostersonntag 1 Es gibt eine Menge Osterbräuche. Welche kennt ihr? 2 Zeichnet die Sinnzeichen vom Blattanfang in Euer Heft. Überlegt Euch,
Gruppe 1 Sinnzeichen für Palmsonntag Gründonnerstag Karfreitag Ostersonntag 1 Es gibt eine Menge Osterbräuche. Welche kennt ihr? 2 Zeichnet die Sinnzeichen vom Blattanfang in Euer Heft. Überlegt Euch,
Symbole in der christlichen Religion
 Symbole in der christlichen Religion Name:.. Ökumenischer Religionsunterricht 5. Klasse 2015_2016 F I S C H Der Fisch ist das... Die Buchstaben des griechischen Wortes "Fisch" (... ) stehen als Abkürzung
Symbole in der christlichen Religion Name:.. Ökumenischer Religionsunterricht 5. Klasse 2015_2016 F I S C H Der Fisch ist das... Die Buchstaben des griechischen Wortes "Fisch" (... ) stehen als Abkürzung
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst
 34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
Predigt am Extra für mich Lukas 2, Szene: Der Evangelist Lukas
 Predigt am 24.12.2017 Extra für mich Lukas 2,1-21 1. Szene: Der Evangelist Lukas Auf der Faltkarte, die die Kinder am Anfang des Gottesdienstes bekommen haben, ist ein großes aufgeschlagenes Buch abgebildet.
Predigt am 24.12.2017 Extra für mich Lukas 2,1-21 1. Szene: Der Evangelist Lukas Auf der Faltkarte, die die Kinder am Anfang des Gottesdienstes bekommen haben, ist ein großes aufgeschlagenes Buch abgebildet.
Bibelstellen zum Wort Taufe und "verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
 Bibelstellen zum Wort Taufe und "verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Mt 3,7 Als Johannes sah, daß viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen,
Bibelstellen zum Wort Taufe und "verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Mt 3,7 Als Johannes sah, daß viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen,
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Osterfest am 16. April 2017 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Osterfest am 16. April 2017 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München Vor einem Monat wurde die Renovierung des hl. Grabes in der
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Osterfest am 16. April 2017 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München Vor einem Monat wurde die Renovierung des hl. Grabes in der
Die Dreikönigskirche Bad Bevensen
 Die Dreikönigskirche Bad Bevensen Ein kleiner Kirchenführer Herzlich willkommen in der Dreikönigskirche Bad Bevensen! Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht; sie befinden sich an einem
Die Dreikönigskirche Bad Bevensen Ein kleiner Kirchenführer Herzlich willkommen in der Dreikönigskirche Bad Bevensen! Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht; sie befinden sich an einem
Predigt am Ostersonntag, Taufgottesdienst Baptistengemeinde Mollardgasse, Wien Pastor Lars Heinrich Römer 6,3-9
 1 Predigt am 12.04.2009 Ostersonntag, Taufgottesdienst Baptistengemeinde Mollardgasse, Wien Pastor Lars Heinrich Römer 6,3-9 Anrede - Ugo, Familie Uwakwe, Freunde und Gäste Gemeinde Wunderschöne Verbindung:
1 Predigt am 12.04.2009 Ostersonntag, Taufgottesdienst Baptistengemeinde Mollardgasse, Wien Pastor Lars Heinrich Römer 6,3-9 Anrede - Ugo, Familie Uwakwe, Freunde und Gäste Gemeinde Wunderschöne Verbindung:
Symbol: Weg/Fußspuren. Was mir heilig ist
 2017/18 September Anfangsgottesdienst Oktober Erntedank Kompetenz 1 Das eigene Selbstund Wertverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und im Gespräch zum Ausdruck bringen. Lebensfragen 9 Andere
2017/18 September Anfangsgottesdienst Oktober Erntedank Kompetenz 1 Das eigene Selbstund Wertverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und im Gespräch zum Ausdruck bringen. Lebensfragen 9 Andere
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Weihnachtsfest 2013 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Weihnachtsfest 2013 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München In der Christmette hörten wir vom Kind, das in Windeln gewickelt in
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Weihnachtsfest 2013 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München In der Christmette hörten wir vom Kind, das in Windeln gewickelt in
Hineingenommen in sein Geheimnis
 Hineingenommen in sein Geheimnis Gebetsstunde in Verbundenheit mit der Weltkirche und Papst Franziskus im Jahr des Glaubens 2013 Gesang zur Eröffnung Einführungswort Aussetzung des Allerheiligsten 2 Immanuel
Hineingenommen in sein Geheimnis Gebetsstunde in Verbundenheit mit der Weltkirche und Papst Franziskus im Jahr des Glaubens 2013 Gesang zur Eröffnung Einführungswort Aussetzung des Allerheiligsten 2 Immanuel
ZUR HOFFNUNG ERZIEHEN
 Regine Schindler ZUR HOFFNUNG ERZIEHEN Gott im Kinderalltag VERLAG ERNST KAUFMANN THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH INHALT Vorwort 13 Religion oder Religionen für Kinder? Eine persönliche Hinführung 16 I. ZUR
Regine Schindler ZUR HOFFNUNG ERZIEHEN Gott im Kinderalltag VERLAG ERNST KAUFMANN THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH INHALT Vorwort 13 Religion oder Religionen für Kinder? Eine persönliche Hinführung 16 I. ZUR
Wo weht der Geist Gottes?
 Wo weht der Geist Gottes? Aufgabenblatt 5 a Wo weht der Geist Gottes? - Vom Wesen und Wirken des Heiligen Geistes 1. Wo im Alten Testament hören wir zuerst etwas vom Geist Gottes? Was wirkt Gott allgemein
Wo weht der Geist Gottes? Aufgabenblatt 5 a Wo weht der Geist Gottes? - Vom Wesen und Wirken des Heiligen Geistes 1. Wo im Alten Testament hören wir zuerst etwas vom Geist Gottes? Was wirkt Gott allgemein
wir haben die Heilig-Geist-Kirche erkundet und diesen Kinder-Kirchenführer erstellt.
 Liebe Kinder, wir haben die Heilig-Geist-Kirche erkundet und diesen Kinder-Kirchenführer erstellt. Nun könnt Ihr durch die Kirche gehen, unsere Texte und Bilder anschauen und die Sachen entdecken. Viel
Liebe Kinder, wir haben die Heilig-Geist-Kirche erkundet und diesen Kinder-Kirchenführer erstellt. Nun könnt Ihr durch die Kirche gehen, unsere Texte und Bilder anschauen und die Sachen entdecken. Viel
Karwoche. 3 SuS. SuS: Schülerinnen und Schüler P: Priester GL: Gottesdienstleiter/in
 Karwoche SuS: Schülerinnen und Schüler P: Priester GL: Gottesdienstleiter/in Lied: Im Namen des Vaters 36 Begrüßung:+++ Bald ist Ostern. Davor aber begehen wir Christen die Karwoche. Kar bedeutet traurig.
Karwoche SuS: Schülerinnen und Schüler P: Priester GL: Gottesdienstleiter/in Lied: Im Namen des Vaters 36 Begrüßung:+++ Bald ist Ostern. Davor aber begehen wir Christen die Karwoche. Kar bedeutet traurig.
Christus-Rosenkranz. zum Totengedenken
 Christus-Rosenkranz zum Totengedenken Der Christus-Rosenkranz hat denselben Aufbau wie der marianische Rosenkranz. Dabei wird das Gegrüßet seist du, Maria durch das folgende Gebet ersetzt: V: Sei gepriesen,
Christus-Rosenkranz zum Totengedenken Der Christus-Rosenkranz hat denselben Aufbau wie der marianische Rosenkranz. Dabei wird das Gegrüßet seist du, Maria durch das folgende Gebet ersetzt: V: Sei gepriesen,
Predigt zum Sonntag Laetare über Johannes 6, 51 63
 Predigt zum Sonntag Laetare über Johannes 6, 51 63 Liebe Gemeinde, Was ist ein Versprechen wert? Diese Frage stellt sich in unserem Alltagsleben immer wieder. Da hören wir von den Politikern, der EURO
Predigt zum Sonntag Laetare über Johannes 6, 51 63 Liebe Gemeinde, Was ist ein Versprechen wert? Diese Frage stellt sich in unserem Alltagsleben immer wieder. Da hören wir von den Politikern, der EURO
Arbeitsblatt Tage Fastenzeit
 Arbeitsblatt 156 40 Tage Fastenzeit 40 Tage dauert die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Auf was man verzichtet, wo man fastet, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Ostern, das Fest
Arbeitsblatt 156 40 Tage Fastenzeit 40 Tage dauert die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Auf was man verzichtet, wo man fastet, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Ostern, das Fest
Christentum, Judentum Hinduismus, Islam
 Christentum, Judentum Hinduismus, Islam Christentum Judentum Das Christentum ist vor ca. 2000 Jahren durch Jesus Christus aus dem Judentum entstanden. Jesus war zuerst Jude. Das Judentum ist die älteste
Christentum, Judentum Hinduismus, Islam Christentum Judentum Das Christentum ist vor ca. 2000 Jahren durch Jesus Christus aus dem Judentum entstanden. Jesus war zuerst Jude. Das Judentum ist die älteste
Ostern: Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht. Bild Cattivo
 Ostern: Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht Bild Cattivo Aufgabenblatt 4 Ostern - die Wende in der Menschheitsgeschichte Von der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi
Ostern: Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht Bild Cattivo Aufgabenblatt 4 Ostern - die Wende in der Menschheitsgeschichte Von der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi
Weihnachtskrippe. der Röm.- kath. Pfarrei Heilig Kreuz Binningen-Bottmingen BL. Ein Werk des Holzbildhauers Robert Hangartner, 2009
 Weihnachtskrippe der Röm.- kath. Pfarrei Heilig Kreuz Binningen-Bottmingen BL Ein Werk des Holzbildhauers Robert Hangartner, 2009 Die Krippe in der Pfarrei Heilig Kreuz Die Krippe zu Binningen umfasst
Weihnachtskrippe der Röm.- kath. Pfarrei Heilig Kreuz Binningen-Bottmingen BL Ein Werk des Holzbildhauers Robert Hangartner, 2009 Die Krippe in der Pfarrei Heilig Kreuz Die Krippe zu Binningen umfasst
Wo Himmel und Erde sich berühren
 Einführung: Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema: Wo Himmel und Erde sich berühren Was bedeutet Wo Himmel und Erde sich berühren? Nun, unser Leben ist ein ewiges Suchen nach Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
Einführung: Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema: Wo Himmel und Erde sich berühren Was bedeutet Wo Himmel und Erde sich berühren? Nun, unser Leben ist ein ewiges Suchen nach Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
Geh mit uns. Kreuzweg mit Kindern_B. Liturgiebörse der Diözese Feldkirch
 Geh mit uns Kreuzweg mit Kindern_B Liturgiebörse der Diözese Feldkirch Geh mit uns Karfreitagsfeier für Kinder 29.03.2013 Vorbereitung: Weg mit braunem Tuch legen, darauf Palmzweige vom Palmsonntag legen.
Geh mit uns Kreuzweg mit Kindern_B Liturgiebörse der Diözese Feldkirch Geh mit uns Karfreitagsfeier für Kinder 29.03.2013 Vorbereitung: Weg mit braunem Tuch legen, darauf Palmzweige vom Palmsonntag legen.
Kreuzweg. Heilig-Kreuz Kirche. für die. in Stapelfeld. Elisabeth Pawils & Johanna Berges-Grunert
 Kreuzweg für die Heilig-Kreuz Kirche in Stapelfeld Elisabeth Pawils & Johanna Berges-Grunert Station 1: Christus wird zum Tode verurteilt Elisabeth Pawils Die Menge johlt: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus ist
Kreuzweg für die Heilig-Kreuz Kirche in Stapelfeld Elisabeth Pawils & Johanna Berges-Grunert Station 1: Christus wird zum Tode verurteilt Elisabeth Pawils Die Menge johlt: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus ist
Weihbischof Wilhelm Zimmermann. Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus
 Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Osternachtsgottesdienst mit Abendmahl
 Osternachtsgottesdienst mit Abendmahl Ort: Staufen Osternacht Stille - Musik Stille - Bibeltexte moderner Text - Isabelle Musik Stille - Bibeltexte - Lukas 23, 50-56 moderner Text - Musik Lied: Kirchenraum
Osternachtsgottesdienst mit Abendmahl Ort: Staufen Osternacht Stille - Musik Stille - Bibeltexte moderner Text - Isabelle Musik Stille - Bibeltexte - Lukas 23, 50-56 moderner Text - Musik Lied: Kirchenraum
Leseprobe. Das neue Quiz-Spiel Erstkommunion 80 Fragen & Antworten, 7 Schwierigkeitsstufen. Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.
 Leseprobe Das neue Quiz-Spiel Erstkommunion 80 Fragen & Antworten, 7 Schwierigkeitsstufen 80 Seiten, 7 x 14,5 cm, Spiralbindung, 80 Fragen & Antworten, 7 Schwierigkeitsstufen, durchgehend farbig gestaltet,
Leseprobe Das neue Quiz-Spiel Erstkommunion 80 Fragen & Antworten, 7 Schwierigkeitsstufen 80 Seiten, 7 x 14,5 cm, Spiralbindung, 80 Fragen & Antworten, 7 Schwierigkeitsstufen, durchgehend farbig gestaltet,
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest 2012 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest 2012 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München Das bleibende Geheimnis der Weihnacht Die Gnade Gottes
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest 2012 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in München Das bleibende Geheimnis der Weihnacht Die Gnade Gottes
Orte in der Bibel. Jerusalem St. Jakobus. [oibje01009]
![Orte in der Bibel. Jerusalem St. Jakobus. [oibje01009] Orte in der Bibel. Jerusalem St. Jakobus. [oibje01009]](/thumbs/52/29028959.jpg) Orte in der Bibel Jerusalem St. Jakobus 1 St. Jakobus - Jakobuskirche Die Jakobuskirche im armenischen Viertel von Jerusalem ist die Kirche des armenischen orthodoxen Patriarchen von Jerusalem. Die Kirche
Orte in der Bibel Jerusalem St. Jakobus 1 St. Jakobus - Jakobuskirche Die Jakobuskirche im armenischen Viertel von Jerusalem ist die Kirche des armenischen orthodoxen Patriarchen von Jerusalem. Die Kirche
Treffpunkt Chor Haus von Galen
 Treffpunkt Chor Haus von Galen Markus-Evangelium in unserer Sprache Aufführung am 11.3.2018 in der Johannes-Täufer-Kirche Magstadt Das Leiden Jesu 1.Chor:Geh Jesu Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten
Treffpunkt Chor Haus von Galen Markus-Evangelium in unserer Sprache Aufführung am 11.3.2018 in der Johannes-Täufer-Kirche Magstadt Das Leiden Jesu 1.Chor:Geh Jesu Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten
Die Feier der Eucharistie
 Die Feier der Eucharistie Beim Betreten der Kirche Einzug Begrüßung Schuldbekenntnis kann entfallen Kyrie Die nachfolgenden Texte können variieren. Priester und Ministranten ziehen Orgel ein. wir beginnen
Die Feier der Eucharistie Beim Betreten der Kirche Einzug Begrüßung Schuldbekenntnis kann entfallen Kyrie Die nachfolgenden Texte können variieren. Priester und Ministranten ziehen Orgel ein. wir beginnen
Päpstliche Missionswerke in Österreich. Gebete
 Päpstliche Missionswerke in Österreich Gebete 2 Noch nie hatte die Kirche so wie heute die Möglichkeit, das Evangelium durch das Zeugnis und das Wort allen Menschen und allen Völkern zukommen zu lassen.
Päpstliche Missionswerke in Österreich Gebete 2 Noch nie hatte die Kirche so wie heute die Möglichkeit, das Evangelium durch das Zeugnis und das Wort allen Menschen und allen Völkern zukommen zu lassen.
Wort-Gottes-Feier. Feier am Aschermittwoch
 Wort-Gottes-Feier Feier am Aschermittwoch 2 Ergänzung zu dem Buch: Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag Herausgegeben vom Liturgischen Institut in Freiburg im Auftrag der Bischöfe der deutschsprachigen Schweiz
Wort-Gottes-Feier Feier am Aschermittwoch 2 Ergänzung zu dem Buch: Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag Herausgegeben vom Liturgischen Institut in Freiburg im Auftrag der Bischöfe der deutschsprachigen Schweiz
Orientierungshilfen und Gedanken für Ihren Rundgang durch unsere Zeiträume
 Orientierungshilfen und Gedanken für Ihren Rundgang durch unsere Zeiträume Im Treppenhaus finden Sie Gedanken, Bibeltexte, Gebete und Bilder zu den 24 Stunden eines Tages. Sie hören das Ticken von insgesamt
Orientierungshilfen und Gedanken für Ihren Rundgang durch unsere Zeiträume Im Treppenhaus finden Sie Gedanken, Bibeltexte, Gebete und Bilder zu den 24 Stunden eines Tages. Sie hören das Ticken von insgesamt
Die Heilig-Blut-Legende
 Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Herzlich willkommen in der. Kirche am Markt EV. LUTH. KIRCHENGEMEINDE NIENDORF
 Herzlich willkommen in der Kirche am Markt EV. LUTH. KIRCHENGEMEINDE NIENDORF Dieses Heft möchte Sie durch den Gottesdienst begleiten. Die jeweiligen Lied und Psalmnummern stehen rechts und links an den
Herzlich willkommen in der Kirche am Markt EV. LUTH. KIRCHENGEMEINDE NIENDORF Dieses Heft möchte Sie durch den Gottesdienst begleiten. Die jeweiligen Lied und Psalmnummern stehen rechts und links an den
Lichtfeier und Ostergottesdienst im April 2017
 WGD April 2017 Seite 1 Lichtfeier und Ostergottesdienst im April 2017 (Beamer oder Tageslichtschreiber und Leinwand bereitstellen) 1) E I N Z U G 2) BEGRÜSSUNG 3) LITURGISCHE ERÖFFNUNG Im Namen des Vaters
WGD April 2017 Seite 1 Lichtfeier und Ostergottesdienst im April 2017 (Beamer oder Tageslichtschreiber und Leinwand bereitstellen) 1) E I N Z U G 2) BEGRÜSSUNG 3) LITURGISCHE ERÖFFNUNG Im Namen des Vaters
Grün: Farbe der Hoffnung (normale Werktage).
 Grün: Farbe der Hoffnung (normale Werktage). Rot: weist darauf hin, dass Christus für uns gestorben ist (Palmsonntag, Karfreitag), dass manche Heilige für ihren Glauben an Christus gestorben sind (Märtyrerfeste),
Grün: Farbe der Hoffnung (normale Werktage). Rot: weist darauf hin, dass Christus für uns gestorben ist (Palmsonntag, Karfreitag), dass manche Heilige für ihren Glauben an Christus gestorben sind (Märtyrerfeste),
2.1-2.Schuljahr Thema: Miteinander sprechen Mit Gott reden Material: fse 2 Kapitel 1 Die Schülerinnen und Schüler
 1. Ich, die Anderen, die Welt und Gott nehmen die Welt um sich herum bewusst wahr entdecken ihre eigenen Fähigkeiten und tauschen sich darüber aus erkennen, dass wir von Gott nur bildhaft sprechen können
1. Ich, die Anderen, die Welt und Gott nehmen die Welt um sich herum bewusst wahr entdecken ihre eigenen Fähigkeiten und tauschen sich darüber aus erkennen, dass wir von Gott nur bildhaft sprechen können
Die 14 Kreuzweg-Stationen der katholischen Stadtkirche St. Stephan zu Karlsruhe
 Die 14 Kreuzweg-Stationen der katholischen Stadtkirche St. Stephan zu Karlsruhe Schöpfer dieser Kreuzweg-Stationen ist der Bildhauer Prof. Emil Sutor (18881974). 1907-1909 studierte er an der Kunstakademie
Die 14 Kreuzweg-Stationen der katholischen Stadtkirche St. Stephan zu Karlsruhe Schöpfer dieser Kreuzweg-Stationen ist der Bildhauer Prof. Emil Sutor (18881974). 1907-1909 studierte er an der Kunstakademie
Wer bin ich, dass du mich suchst?
 Wer bin ich, dass du mich suchst? Marienandacht im Mai Kreuzzeichen Zur Eröffnung Maria, dich lieben, ist allzeit mein Sinn GL 594, 1-3 Hinführung Eine Begegnung, die Geschichte machte. Eine Begegnung,
Wer bin ich, dass du mich suchst? Marienandacht im Mai Kreuzzeichen Zur Eröffnung Maria, dich lieben, ist allzeit mein Sinn GL 594, 1-3 Hinführung Eine Begegnung, die Geschichte machte. Eine Begegnung,
Hochgebet mit Bewegungen. Text (3. Hochgebet für Messfeiern mit Kindern)
 Hochgebet mit Bewegungen Text (3. Hochgebet für Messfeiern mit Kindern) Einleitungsdialog P: Der Herr sei mit euch. A: Und mit deinem Geiste. P: Erhebet die Herzen. A: Wir haben sie beim Herrn. P: Lasset
Hochgebet mit Bewegungen Text (3. Hochgebet für Messfeiern mit Kindern) Einleitungsdialog P: Der Herr sei mit euch. A: Und mit deinem Geiste. P: Erhebet die Herzen. A: Wir haben sie beim Herrn. P: Lasset
Grosse Statue des Zascha sitzend. 2 Mus. von Cairo.
 Grosse Statue des Zascha sitzend. 2 Mus. von Cairo. H. 70 cm. Der Mann sitzt auf einem grossen Würfel, der weiss, schwarz u. rot-fleckig bemalt ist, in Nachahmung von Holz. Die Plinthe vorn vor dem Würfel
Grosse Statue des Zascha sitzend. 2 Mus. von Cairo. H. 70 cm. Der Mann sitzt auf einem grossen Würfel, der weiss, schwarz u. rot-fleckig bemalt ist, in Nachahmung von Holz. Die Plinthe vorn vor dem Würfel
Was heißt Bibel übersetzt? a Heilige Schrift b Buch c Buch der Bücher d Heiliges Wort
 13 Was heißt Bibel übersetzt? a Heilige Schrift b Buch c Buch der Bücher d Heiliges Wort 14 Wer darf getauft werden? a nur Kinder b wer über 18 ist c jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt d ausgewählte
13 Was heißt Bibel übersetzt? a Heilige Schrift b Buch c Buch der Bücher d Heiliges Wort 14 Wer darf getauft werden? a nur Kinder b wer über 18 ist c jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt d ausgewählte
Die heilige Messe (Quelle: Arbeitsmaterial zum katholischen Religions-Unterricht an den Grundschulen in Bobenheim-Roxheim)
 Die heilige Messe (Quelle: Arbeitsmaterial zum katholischen Religions-Unterricht an den Grundschulen in Bobenheim-Roxheim) I. Eröffnung 1. Begrüßung Wir stehen P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und
Die heilige Messe (Quelle: Arbeitsmaterial zum katholischen Religions-Unterricht an den Grundschulen in Bobenheim-Roxheim) I. Eröffnung 1. Begrüßung Wir stehen P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und
3. Die Feier des Gottesdienstes, Teil I
 3. Die Feier des Gottesdienstes, Teil I MATERIAL: Schere, Klebestift, Buntstifte EINFÜHRUNG ZUM THEMA: Wir schauen uns den ersten Teil des Gottesdienstes näher an. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass
3. Die Feier des Gottesdienstes, Teil I MATERIAL: Schere, Klebestift, Buntstifte EINFÜHRUNG ZUM THEMA: Wir schauen uns den ersten Teil des Gottesdienstes näher an. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass
Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014
 Wortgottesdienst März 2014 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014 2. Sonntag der Fastenzeit Lesejahr A (auch an anderen Sonntagen in der Fastenzeit zu gebrauchen)
Wortgottesdienst März 2014 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014 2. Sonntag der Fastenzeit Lesejahr A (auch an anderen Sonntagen in der Fastenzeit zu gebrauchen)
háåçéêâêéìòïéö= Elemente für einen Kindergottesdienst Liturgiebörse der Diözese Feldkirch
 háåçéêâêéìòïéö= Elemente für einen Kindergottesdienst Liturgiebörse der Diözese Feldkirch Kinderkreuzweg 6.4.2012, 16.00 Uhr Pfarrkirche St. Gebhard Begrüßung vor der Kirche Wir wollen heute, am Karfreitag,
háåçéêâêéìòïéö= Elemente für einen Kindergottesdienst Liturgiebörse der Diözese Feldkirch Kinderkreuzweg 6.4.2012, 16.00 Uhr Pfarrkirche St. Gebhard Begrüßung vor der Kirche Wir wollen heute, am Karfreitag,
Den Kreuzweg beten nach Art des Rosenkranzes
 Den Kreuzweg beten nach Art des Rosenkranzes Sie beginnen mit der Einleitung am Glaube Liebe Hoffnung Absatz Ihres Rosenkranzes. Dann folgen Sie den Stationen mit den dazugehörenden Gesätzen (Clausulae)
Den Kreuzweg beten nach Art des Rosenkranzes Sie beginnen mit der Einleitung am Glaube Liebe Hoffnung Absatz Ihres Rosenkranzes. Dann folgen Sie den Stationen mit den dazugehörenden Gesätzen (Clausulae)
Kirchweihfest 2009 Das Altarkreuz
 Kirchweihfest 1/13 Kirchweihfest 2009 Das Altarkreuz zentraler Punkt Über dem Altarraum unserer Kirche dominiert ein großes Kreuz mit dem Heiland, der uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat. Das dürfen
Kirchweihfest 1/13 Kirchweihfest 2009 Das Altarkreuz zentraler Punkt Über dem Altarraum unserer Kirche dominiert ein großes Kreuz mit dem Heiland, der uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat. Das dürfen
Das Kreuzzeichen. Das Vater unser. DerLobpreis des Dreieinigen Gottes. Im Namen des Vaters + Und des Sohnes + Und des Heiligen Geistes. + Amen.
 Das Kreuzzeichen Im Namen des Vaters + Und des Sohnes + Und des Heiligen Geistes. + Das Vater unser Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel
Das Kreuzzeichen Im Namen des Vaters + Und des Sohnes + Und des Heiligen Geistes. + Das Vater unser Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel
WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli )
 ( grüne Farbe: ALLE ) WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli ) KREUZZEICHEN - LITURGISCHER GRUSS Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und das
( grüne Farbe: ALLE ) WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli ) KREUZZEICHEN - LITURGISCHER GRUSS Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und das
Die Antworten in der Heiligen Messe
 Die Antworten in der Heiligen Messe Auf den folgenden Seiten findest du Karten mit den Antworten in der Heiligen Messe. Sie sind ungefähr groß, wie dein Mess-Leporello. Du kannst sie ausdrucken, bunt anmalen
Die Antworten in der Heiligen Messe Auf den folgenden Seiten findest du Karten mit den Antworten in der Heiligen Messe. Sie sind ungefähr groß, wie dein Mess-Leporello. Du kannst sie ausdrucken, bunt anmalen
Offenbarung hat Folgen Predigt zu Mt 16,13-19 (Pfingsten 2015)
 Offenbarung hat Folgen Predigt zu Mt 16,13-19 (Pfingsten 2015) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir die
Offenbarung hat Folgen Predigt zu Mt 16,13-19 (Pfingsten 2015) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir die
Ostern ist die Botschaft, dass der Tod nicht das Letzte ist
 Ostern ist die Botschaft, dass der Tod nicht das Letzte ist Berlin (4. April 2015) - Ostereier bemalen und verstecken, Ostersträuße schmücken, eine Osternacht mit anschließendem Osterfrühstück feiern all
Ostern ist die Botschaft, dass der Tod nicht das Letzte ist Berlin (4. April 2015) - Ostereier bemalen und verstecken, Ostersträuße schmücken, eine Osternacht mit anschließendem Osterfrühstück feiern all
Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,55) Unsere Sterblichkeit und der Glaube an die Auferstehung. Impuls-Katechese, Altötting
 Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,55) Unsere Sterblichkeit und der Glaube an die Auferstehung Impuls-Katechese, Altötting 14.10.2017 Die Angst vor dem Tod Heb. 2:14 Da nun die Kinder Menschen von Fleisch
Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,55) Unsere Sterblichkeit und der Glaube an die Auferstehung Impuls-Katechese, Altötting 14.10.2017 Die Angst vor dem Tod Heb. 2:14 Da nun die Kinder Menschen von Fleisch
Jesus als Sohn Abrahams, Mt 1,1. 1. Abraham mit seinen Frauen und Kindern als Modell von heiliger Familie
 Tisch 1 Jesus als Sohn Abrahams, Mt 1,1 1. Abraham mit seinen Frauen und Kindern als Modell von heiliger Familie Erklärungstext zur Aufstellung der Szene Abraham gilt in der Bibel als Stammvater: - mit
Tisch 1 Jesus als Sohn Abrahams, Mt 1,1 1. Abraham mit seinen Frauen und Kindern als Modell von heiliger Familie Erklärungstext zur Aufstellung der Szene Abraham gilt in der Bibel als Stammvater: - mit
Joh 20, Biblische Sprechmotette: Der Ostermorgen
 1 Joh 20,1-10 1 Biblische Sprechmotette: Der Ostermorgen Erzähler A; Erzähler B; Erzähler C; Maria; Engel; Jesus; Thomas Engel: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster
1 Joh 20,1-10 1 Biblische Sprechmotette: Der Ostermorgen Erzähler A; Erzähler B; Erzähler C; Maria; Engel; Jesus; Thomas Engel: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster
Kreuzweg mit Verkehrszeichen
 Seite 1 von 12 Kreuzweg mit Verkehrszeichen Material zur Unterstützung Verkehrszeichen und Bibelstellen zum Ausdrucken Seite 2 von 12 Seite 3 von 12 Seite 4 von 12 Seite 5 von 12 Seite 6 von 12 Seite 7
Seite 1 von 12 Kreuzweg mit Verkehrszeichen Material zur Unterstützung Verkehrszeichen und Bibelstellen zum Ausdrucken Seite 2 von 12 Seite 3 von 12 Seite 4 von 12 Seite 5 von 12 Seite 6 von 12 Seite 7
Herzlich willkommen im. Immanuel - Haus EV. LUTH. KIRCHENGEMEINDE NIENDORF
 Herzlich willkommen im Immanuel - Haus EV. LUTH. KIRCHENGEMEINDE NIENDORF Dieses Heft soll Sie durch den Gottesdienst begleiten. Die jeweiligen Lied und Psalmnummern stehen an der Tafel neben dem Eingang.
Herzlich willkommen im Immanuel - Haus EV. LUTH. KIRCHENGEMEINDE NIENDORF Dieses Heft soll Sie durch den Gottesdienst begleiten. Die jeweiligen Lied und Psalmnummern stehen an der Tafel neben dem Eingang.
Die Missionsreisen des Apostels Paulus. Apostelgeschichte 13-26
 Die Missionsreisen des Apostels Paulus 13-26 Die Missionsreisen des Apostels Paulus Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Einführung in die 1. Missionsreise 2. Missionsreise 3. Missionsreise Reise nach Rom
Die Missionsreisen des Apostels Paulus 13-26 Die Missionsreisen des Apostels Paulus Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Einführung in die 1. Missionsreise 2. Missionsreise 3. Missionsreise Reise nach Rom
Die biblische Taufe Seite Seite 1
 Die biblische Taufe Seite Seite 1 1. Was bedeutet das Wort "taufen"? Die Wortbedeutung nach dem Duden bzw. Herkunftswörterbuch rterbuch lautet: "Das mhd. toufen, ahd. toufan, got. daupjan ist von dem unter
Die biblische Taufe Seite Seite 1 1. Was bedeutet das Wort "taufen"? Die Wortbedeutung nach dem Duden bzw. Herkunftswörterbuch rterbuch lautet: "Das mhd. toufen, ahd. toufan, got. daupjan ist von dem unter
Papst Benedikt XVI. über Gemeinschaft Gedanken zur Heiligen Eucharistie - Teil 1 -
 Papst Benedikt XVI. über Gemeinschaft Gedanken zur Heiligen Eucharistie - Teil 1 - Christus ist der König Predigt beim Pastoralbesuch in der römischen Pfarrei "San Lorenzo fuori le mura", 30. November
Papst Benedikt XVI. über Gemeinschaft Gedanken zur Heiligen Eucharistie - Teil 1 - Christus ist der König Predigt beim Pastoralbesuch in der römischen Pfarrei "San Lorenzo fuori le mura", 30. November
Versöhnt mit dem Vater. Über das Geheimnis der Beichte - Teil II Believe andpray,
 Versöhnt mit dem Vater Über das Geheimnis der Beichte - Teil II Believe andpray, 02.10.2016 Wiederholung Der Weg Sünde ist Zustand der Entfernung von Gott einerseits und konkrete Tat andererseits Der Zustand
Versöhnt mit dem Vater Über das Geheimnis der Beichte - Teil II Believe andpray, 02.10.2016 Wiederholung Der Weg Sünde ist Zustand der Entfernung von Gott einerseits und konkrete Tat andererseits Der Zustand
