Boden, Wasser, Baugrund Durchführungspläne für die Beweissicherung zum Bewilligungsbescheid zur Entnahme von Grundwasser
|
|
|
- Klemens Vogt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Boden, Wasser, Baugrund Durchführungspläne für die Beweissicherung zum Bewilligungsbescheid zur Entnahme von Grundwasser 5. Auflage Raissi, F., Weustink, A., Müller, U., Nix, T., Meesenburg, H. & Rasper, M. September 2009 Die Auswirkungen von Grundwasserentnahmen auf den Bodenwasserhaushalt und auf die Bodennutzung sollten durch ein geeignetes Beweissicherungsverfahren ermittelt werden. In einem Beweissicherungsdurchführungsplan müssen je nach Bodennutzung konkrete Schritte beschrieben werden, um nachhaltig negative Wirkungen auf den Bodenwasserhaushalt und die Vegetation zu ermitteln und angemessen auszugleichen oder zu entschädigen. Grundwasserentnahme, Grundwasserabsenkung, Beweissicherungsverfahren, Durchführungspläne: Hydrogeologie, Bodenkunde, Land- und Forstwirtschaft, naturschutzrechtliche Belange, Beweissicherung Fließgewässer und Bauwerke. 1. Allgemeines In der Regel werden mit der Erteilung der Bewilligung für die Grundwasserentnahme Auflagen verbunden. Hierdurch sollen u. a. auch Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf die Umwelt festgestellt und ggf. angemessen ausgeglichen oder entschädigt werden (NWG 2007; DVWK 1986; JOSOPAIT, RAISSI & ECKL 2009; RAISSI & MÜLLER 2009a, 2009b; RAISSI, MÜLLER & MEESENBURG 2009; MÜLLER & RAISSI 2002; HILLMANN et al. 2009a, 2009b, ECKL & RAISSI 2009). Vorgaben dazu werden im wasserrechtlichen Bescheid oder in einem speziellen Durchführungsplan für die Grundwasserbeweissicherung geregelt. Dem Wasserversorger (Wasserrechtsinhaber) können Verpflichtungen auferlegt werden. Dazu gehören im Regelfall Grundwassermengenmessung, Installation von Betriebsstundenzählern, Wasserstandsmessungen in Entnahmebrunnen und Grundwassermessstellen, Niederschlags- und Lysimetermessungen, Erweiterung und Optimierung des Grundwassermessstellennetzes, hydrologische Untersuchungen zum Wasserstand und (Basis-)Abfluss, Ermittlung von Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf Land- und Forstwirtschaft, grundwasserabhängige Biotope, Altbaumbestände und Hecken sowie Einzelbaumbestände. Es kann aber auch zweckmäßig sein, die Fließgewässer (Fischbestand und Gewässerlimnologie) sowie Gebäudebeweissicherungen mit aufzunehmen. Die vorgenannte Aufzählung möglicher Beweissicherungsmaßnahmen wird den Erfordernissen des Einzelfalls der Wasserentnahme angepasst werden müssen. Die durchzuführenden Untersuchungen sollen so konzipiert sein, dass sie gesicherte Aussagen (aus wasserwirtschaftlicher, hydrogeologischer, bodenkundlicher und land- und forstwirtschaftlicher Sicht im Hinblick auf den Naturschutz sowie für andere potenziell Betroffene und Einwender) ermöglichen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten für die Grundwasserbeweissicherung aus hydrogeologischer, bodenkundlicher, land- und forstwirtschaftlicher sowie pflanzensoziologischer Sicht. 2. Grundlagen Die folgende Zusammenstellung wurde auf Grundlage langjähriger Erfahrungen zu Wasserrechtsverfahren in niedersächsischen Lockergesteinsgebieten abgeleitet (s. Abb. 1). Als Grundlage für eine Beweissicherung ist die hydrogeologische und bodenkundliche Situation zu betrachten. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine Grundwasserabsenkung stattgefunden hat und wie hoch ihr Ausmaß ist. 1
2 Abb. 1: Hinweise zur Aufstellung des Durchführungsplanes (modifiziert nach BUWAL 2004). 2.1 Hydrogeologie Die Ermittlung von Grundwasserstandsveränderungen sollte durch einen Vergleich der aktuellen Grundwasserstände (aktuelle Grundwassergleichenkarte des entnahmebedingten Förderzustandes) mit dem Nullzustand (unbeeinflusster Zustand ohne Grundwasserentnahme) mittels Grundwasserdifferenzenplänen erfolgen. Zur Erfassung der größten vorkommenden Grundwasserabsenkung in der Umgebung einer Fassungsanlage werden Betriebsspiegelpläne, die der genehmigten maximalen Tages- und/oder Jahresentnahmemenge entsprechen (Prognosezustand), einem Ruhewasserspiegelplan (Nullzustand) gegenüber gestellt. Dabei ist das Bild des Absenkungstrichters mittels Absenkungsplänen (Differenzenplänen) darzustellen. Die Zeit, bis sich der Absenkungstrichter im Fall einer größeren Grundwasserentnahmemenge ausreichend ausgebildet hat ( quasi stationär ), kann im Extremfall einige Jahre betragen. Ein Absenkungstrichter gilt im 2 Allgemeinen als vollständig ausgebildet, wenn der zu erwartende Restabsenkungsbetrag 10 cm ist. Die Zeitspanne bis zum Erreichen des Beharrungszustandes kann aus bereits durchgeführten Pumpversuchen abgeschätzt werden. Der Betriebsspiegelplan der größten Grundwasserentnahmemenge (Prognosezustand) sollte zu einem Zeitpunkt niedriger Grundwasserstände ermittelt werden. Es ist auch möglich, Betriebsspiegelpläne klimabereinigt darzustellen, indem durch die Heranziehung vieljähriger Messreihen unbeeinflusster Vergleichsmessstellen die einzelnen Wasserstandswerte der Pläne auf mittlere Grundwasserstände (außerhalb der Absenkung) korrigiert werden. Klimatische Unterschiede im Grundwassergewinnungsgebiet können durch geeignete Referenz- Messstellen mit langjährigen Beobachtungszeiträumen und deren Auswertung mit statistischen Verfahren berücksichtigt werden. Für die Ermittlung von Veränderungen wird der Zeitraum des
3 höchsten Wasserbedarfs der Pflanzen (z. B. im Juni) und damit der höchsten Auswirkungen auf den Pflanzenertrag gewählt. Eine weitere Möglichkeit der Auswertung ergibt sich bei Betrachtung des Zeitraums des niedrigsten Grundwasserstandes und höchster Wasserentnahme. Die vorhandenen Daten sollen eine Interpretation der Grundwasserfließrichtung, des Ausmaßes und der Reichweite der Grundwasserabsenkung und Aussagen zur Grundwasserbeschaffenheit ermöglichen. Für die Beweissicherung ist es erforderlich, dass der räumliche Aussagebereich über den Absenkungsbereich hinausgeht. Es ist ganz entscheidend, den maßgeblichen Vergleichszustand zugrunde zu legen. Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der ehemaligen Bezirksregierungen über den maßgeblichen Vergleichszustand im Rahmen der Grundwasserentnahme (neuer Antrag, erweiterte Entnahme oder Verlängerung einer bestehenden Grundwasserentnahme) sind inzwischen durch das Niedersächsische Umweltministerium eindeutig geregelt worden (NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM 2004). Demnach ist der maßgebende Bezugszustand bei der Beantragung von Wasserrechten für private Nutzungen (Land- und Forstwirtschaft) der so genannte Nullzustand gegenüber dem Prognosezustand. 2.2 Bodenkunde Eine Grundwasserentnahme als Eingriff in die Landschaft kann mit nachteiligen Auswirkungen auf die Vegetation, insbesondere auf den Ertrag land- und forstwirtschaftlicher Nutzpflanzen verbunden sein. Eine bodenkundliche Beweissicherung stellt den Nullzustand vor der Grundwasserentnahme fest. Auch können vegetationsökologische Aufnahmen auf Dauergrünland und in Waldbeständen durchaus zweckmäßig sein (s. DIN 19686, DIN 2003). Die Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes erfolgt durch die hydrogeologische Ermittlung und Festsetzung des Absenkungsgebietes (s. JOSOPAIT, RAISSI & ECKL 2009). Zunächst werden die bodenhydrologischen Verhältnisse und die Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf die Vegetation innerhalb des Absenkungstrichters festgestellt (s. RAISSI & MÜLLER 2009b). Als Bemessungsgrundlage zur Beurteilung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf Land- und Forstwirtschaft gilt die Situation vor der Grundwasserentnahme (auch bei erweiterter Bewilligung). Deshalb sollten bei der Bewertung der Auswirkungen (Beweissicherung) die entnahmebedingten Grundwasserabsenkungen im Vergleich zum Nullzustand (für den Zustand ohne Entnahme) ermittelt und dargestellt werden (s. Kap. 2.1). An Hand der Bodenmerkmale ist es möglich, eine relativ genaue Ermittlung der Grundwasserverhältnisse vor der Absenkung zu rekonstruieren, und dann ursprüngliche und zu erwartende Grundwasserstände bodenhydrologisch zu bewerten (RAISSI & MÜLLER 2009a) Ermittlung der Grundwasseramplitude Ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Auswirkungen von Grundwasserabsenkungen durch Grundwasserentnahme ist die Grundwasseramplitude. Die Ermittlung und Abschätzung der Grundwasseramplitude als Eingangsgröße ist ein unerlässlicher Kennwert für die Bewertung des Bodenwasserhaushalts, z. B. als Kenngröße zum kapillaren Aufstieg (KA), der kapillaren Aufstiegsrate (KR) und des Grenzflurabstands. Neben den aktuellen Grundwasserstandangaben ist es zweckmäßig, die langjährigen Grundwasseramplituden anzugeben. In der Regel lässt sich die Grundwasserschwankung in gut zeichnenden Böden an der Ober- und Untergrenze des Go-Horizontes ablesen und in typischen Grundwasseramplituden darstellen (s. AD-HOC-AG BODEN 1994, 2005). Die Merkmale des Go-Horizontes bleiben in der Regel auch bei Grundwasserabsenkungen erhalten. Ein weiteres Merkmal für die Bestimmung der Grundwasseramplitude ist die Obergrenze des Gr-Horizontes, der ebenfalls bei guten Zeichnereigenschaften des Bodens abgebildet ist. Die Größe der Grundwasseramplitude in Böden hängt im Wesentlichen vom vorherrschenden Grundwasserregime und dem Substrat (Wasserleitfähigkeit) ab. In der Regel kann von ca. 1 m Grundwasseramplitude im Boden ausgegangen werden. Die typischen Grundwasserverläufe können allerdings je nach Bodensubstrat und regionalen Klimaverhältnissen abweichen. Aufgrund umfangreicher Bodenkartierungen und langjähriger Beobachtungen in Bodenregionen mit unterschiedlichen Substraten konnten typische Abweichungen festgestellt werden. Das Ergebnis einer systematischen Auswertung von Bodenprofilen aus der Profildatenbank des NIBIS ist in Tabelle 1 (GEHRT & RAISSI 2008) dargestellt. Die hier angegebenen Grundwasseramplituden gelten nur für die jeweils grundwasserbeeinflussten Böden innerhalb der Bodenregion. 3
4 Tab. 1: Mittlere Grundwasseramplituden [dm] in Abhängigkeit von Bodenregion und Bodenartengruppen. Bodenlandschaft Niedersachsens (aggregiert)*** Verbreitungsgebiete lehmiger Sedimente Verbreitungsgebiete der Lösse und Sandlösse Verbreitungsgebiete der Marschensedimente Geest Bergvorland Bergland Geest Bergvorland Bergland Bodenregion Küstenholozän (Inseln und Marschen) mittlere Grundwasseramplitude [dm] Verbreitungsgebiete der Karbonatgesteine Bergvorland 8 Verbreitungsgebiete der Torfe in allen Bodenregionen 2 6* Verbreitungsgebiete der Niederterrassen- und Auensedimente Verbreitungsgebiete der sandigen Sedimente**** Flusslandschaften Geest Bergvorland Bergland Küstenholozän (Inseln) Geest Bergvorland und Bergland Verbreitungsgebiete der Tonsteine Bergvorland und Bergland 2 6** * in Abhängigkeit von der Entwässerungsmaßnahme ** in Abhängigkeit von der Tiefenlage des Tonsteins *** die Benennung erfolgt in Anlehnung an die konventionell festgelegte Bezeichnung der Bodenlandschaften Niedersachsens **** außerhalb der Auen, Niederterrassen und Marschen Bei der Ableitung von Grundwasseramplituden sollte berücksichtigt werden, dass der Witterungsverlauf eines Jahres den Beginn des Sickerwasserflusses und die Menge des Sickerwassers beeinflusst. Damit werden auch der Grundwasseranstieg und der Grundwasserabfall in erheblichem Maße durch Klima- und Witterungsverlauf gesteuert Beurteilung von Grundwasserständen In der Regel wird der kapillare Aufstieg auf der Basis des mittleren Grundwasserniedrigstandes berechnet (MNGW). Bei der Beurteilung der standörtlichen Grundwasserverhältnisse mit kurzen Vegetationszeiträumen (z. B. Getreideanbau) ist zu empfehlen, zusätzlich eine Berechnung auf Grundlage des mittleren Grundwasserstandes (MGW) durchzuführen. Der mittlere Grundwasserstand ist aus Tabellen (s. AD-HOC-AG BODEN 1994, 2005) bzw. Bodenmerkmalen abzuleiten; er liegt ungefähr in der Mitte des Go-Horizontes. In Tabelle 2 sind die Grundwasserstände aufgeführt, die bei unterschiedlichen Bodennutzungen herangezogen werden können. Tab. 2: Grundwassermerkmale als Parameter zur Berechnung der standörtlichen Grundwasserverhältnisse. Bodennutzung/ Vegetationszeit Getreidebau / Hackfrucht / Grünland / Forst / Grundwasserstände MHGW MGW MNGW Obergrenze Go Mitte Go Obergrenze Gr 4
5 3. Beweissicherung 3.1 Beweissicherung Grundwasser, Gewässer und Bauwerke Grundwasser Um förderbedingte Grundwasserabsenkungen nachzuweisen, ist ein ausreichendes Netz von geeigneten Grundwassermessstellen erforderlich, die bereits vor Inbetriebnahme der Brunnen über einen ausreichenden Zeitraum, mindestens jedoch über ein Jahr, ein- bis zweimal monatlich gemessen wurden. Diese Daten ermöglichen die Erarbeitung eines Grundwassergleichenplans für den unbeeinflussten Zustand (Nullzustand). Nach Inbetriebnahme der Brunnen wird aus den Daten der gleichen Messstellen ein Betriebsspiegelplan entwickelt. Die Differenz der Standrohrspiegelhöhen zwischen Förderzustand (Istzustand) und ohne Entnahme (Nullzustand) wird ermittelt. Der entstehende Grundwasserdifferenzenplan zeigt die flächenmäßige Ausdehnung (die Reichweite) und die Grundwasserabsenkungsbeträge (das Ausmaß) der entstandenen Grundwasserabsenkungen, die ausschließlich auf die Förderung zurückzuführen sind. Die durch Entnahme bedingten Grundwasserabsenkungen müssen unter Verwendung des dargelegten Istzustandes unter der Berücksichtigung klimatischer und entwässerungsbedingter Veränderungen ermittelt werden. Bei erweiterter Bewilligung sollte der Versuch unternommen werden, die bereits eingetretenen Veränderungen sowie deren Auswirkungen auf die oberflächennahen Grundwasserstände darzustellen und zu bewerten. Für die Darstellung des Nullzustandes (ohne Entnahme) können ältere Unterlagen herangezogen werden. Ist dies nicht mehr möglich, muss der Nullzustand anhand geeigneter Vergleichsmessstellen aus der Umgebung abgeschätzt werden. Diese Abschätzung sollte durch einen Bodenkundler im Gelände überprüft werden. In Einzelfällen kann auch die Erstellung eines numerischen Grundwasserströmungsmodells sinnvoll sein (NEUSS & DÖRHÖFER 2000, GEOINFO- METRIC 2004, KADEN et al. 2004). Das Grundwassermodell wird auf der Grundlage des Hydrogeologischen Strukturmodells aufgestellt (vgl. FH- DGG 1999) und anhand der im Gelände gemessenen Daten der Stichtagsmessungen (MNGW) über den Vergleich von im Gelände gemessenen und mit dem Modell berechneten Standrohrspiegelhöhen kalibriert (vgl. KADEN et al. 2004). Auf der Grundlage der Kalibrierung wird die Grundwasserförderung für das Wasserwerk im Modell abgeschaltet, um den Nullzustand (ohne Entnahme) zu rekonstruieren. Mit Hilfe eines Modells können auch Prognosezustände, z. B. bei der Erhöhung der Grundwasserentnahme, erstellt werden. Durch den Vergleich mit dem Nullzustand entsteht ein entsprechender Differenzenplan. Der Differenzenplan zeigt die potenzielle zusätzliche förderbedingte Grundwasserabsenkung gegenüber dem Istzustand durch eine weitere Mehrentnahme (Erhöhung des Wasserrechts) Gewässer Grundwasserentnahmen können je nach Ausmaß und Reichweite Veränderungen im Fließverhalten von stehenden und fließenden Gewässern herbeiführen. Ist die Beweissicherung auch auf die Frage der Beeinträchtigungsmöglichkeit von oberirdischen Gewässern gerichtet, müssen die Standorte und Filterpositionen einiger Grundwassermessstellen dieser Aufgabenstellung besonders angepasst sein. Bei der Überwachung der Grundwasserverhältnisse in der Umgebung von Seen, insbesondere Baggerseen, sind Messstellen vor allem oberstrom und unterstrom der Seen anzuordnen, wo am ehesten mit Wasserstandsänderungen zu rechnen ist. Auch in unmittelbarer Nähe von Fließgewässern (Talauen) können flache Grundwassermessstellen zur Beurteilung der Situation notwendig werden. Infolge von Grundwasserabsenkungen des oberflächennahen Grundwassers kann sich der Abfluss in den Oberflächengewässern mehr oder weniger reduzieren. Die Abflussminderungen können den Lebensraum der aquatischen Fauna und Flora erheblich beeinträchtigen. ELSHOLZ & BERGER (1998) nennen im Rahmen der Beschreibung der Gebietswasserhaushalte für die 32 hydrologischen Landschaften Niedersachsens gebietstypische Richtwerte für Niederschlag, Abfluss (s. Tab. 3) und Verdunstung auf der Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme und Auswertung von Messdaten verfügbarer Oberflächenwasserpegel in Niedersachsen. Die gebietstypischen Abflusshöhen können als Plausibilitätsgrenzwerte für den Gebietswasserhaushalt der relativ großen Räume angesehen werden. Sie beinhalten in vielen Gebieten allerdings bereits vorhandene, z. T. sehr große Grundwasserentnahmen. In vielen Teilgebieten dieser Landschaften, vor allem in den höher gelegenen Einzugsgebieten, sind die Abflusshöhen aber meist wesent- 5
6 lich kleiner, da ein großer Teil des neu gebildeten Grundwassers erst im weiteren Abstrom dem Vorfluter zufließt. Da die Entnahmemengen im Verhältnis zum Grundwasserabstrom meist klein sind, können Beeinflussungen des Abflussverhaltens nur in kleinen Einzugsgebieten eindeutig erkannt werden, in denen die Entnahmemenge im Verhältnis zum Abfluss relativ groß ist. Bei einer andauernden Unterschreitung des Oberflächenwasserabflusses von den gebietstypischen Richtwerten ist eine Beeinflussung des Abflussregimes als Folge einer Grundwasserentnahme zu vermuten. Hier werden im Rahmen der Beweissicherung weitergehende Untersuchungen zur Ü- berwachung des Oberflächenwasserabflusses und abflussstatistische Auswertungen auf der Grundlage mehrjähriger Messreihen (gewässerkundliche Hauptzahlen im Gewässerkundlichen Jahrbuch) empfohlen. Tab. 3: Abflüsse in den hydrologischen Landschaften Niedersachsens, gebietstypische Richtwerte aus Mittelwerten der Reihe (ELSHOLZ & BERGER 1998). Hydrologische Landschaften gebietstypischer Abfluss [mm]/a Schwankungen von bis Altmark Börde Drawehn Ostbraunschweig Ostheide Weser-Aller-Geest Moorgeest Nordostheide Calenberger Vorland Wildeshauser Geest Obere Hunte Obere Leine Bourtanger Moor Harzvorland Carumer Geest Hümling Löninger Höhen Südheide Emsland Nordheide Wümme-Geest Wesermünder Geest Dwergter Geest Zevener Geest Friesische Geest Ith-Hils-Bergland Vechte Osnabrücker Bergland Weserberge Solling Harzrand Oberharz Je nach hydrogeologischer und wasserwirtschaftlicher Situation sollte der Trockenwetterabfluss (Basisabfluss) aus ökologischen Gründen nicht vermindert werden. Die Abflussverhältnisse in den niedersächsischen (Küsten-)Marschen sind bei starker Überprägung (z. B. durch Entwässerung, Zuwässerung, Kanalisierung, Tideschwankungen usw.) bezüglich der Abflusshöhe gesondert zu betrachten. 6
7 3.1.3 Bauwerke Grundwasserspiegelabsenkung Eine Grundwasserentnahme mit der daraus resultierenden Grundwasserabsenkung kann in den entwässerten Bodenschichten Setzungen oder Setzungsunterschiede initiieren. Über die Fundamentierung beispielsweise Einzel-, Streifen- oder Plattenfundamente werden diese Setzungen oder Setzungsunterschiede in die Bausubstanz eingetragen. Tiefgründungen, wie Pfahlgründungen etc., können durch Setzungen überbelastet werden, wenn an den Pfählen negative Mantelreibung aktiviert wird. Hölzerne Fundamentteile, wie beispielsweise historische Holzpfähle, werden wenn sie nicht mehr von Grundwasser umgeben sind zersetzt. In größeren Setzungsmulden treten zudem Pressungen und Zerrungen auf, so dass Verkehrswege, Versorgungsleitungen etc. Zwangsspannungen ausgesetzt sind, die zu Schäden bis hin zum Bruch führen können. Setzungen durch eine Absenkung der Grundwasseroberfläche sind zum einen auf eine Zusatzbelastung des Korngerüstes durch fehlenden Auftrieb (insbesondere in nichtbindigen Sedimenten wie Sanden etc.) und zum anderen auf das Schrumpfen bindiger Böden (Ton, Schluff etc.) durch mit abnehmendem Wassergehalt zunehmende Kapillarspannung zurückzuführen. Maßgebend für eine Einschätzung der Setzungen in nichtbindigen Sedimenten sind die Schichtmächtigkeit, der Steifemodul sowie das Absenkungsmaß der Grundwasseroberfläche. Das Ausmaß von Setzungen in bindigen Sedimenten ist hingegen abhängig von der Schichtmächtigkeit, der Wassergehaltsabnahme und dem Porenanteil. Von diesen Grundlagen ausgehend lassen sich folgende allgemeingültige Zusammenhänge formulieren: Organische/organogene Böden (Mudde, Torf etc.) reagieren auf ein Absinken des Grundwasserspiegels äußerst sensibel. Setzungen sind abhängig vom Grundwasserabsenkungsbetrag und können mehrere Zentimeter bis Dezimeter betragen. Bindige Böden (Lehm, Löss, Ton etc.) reagieren auf ein Absinken des Grundwasserspiegels sensibel. Das Ausmaß der Schrumpfsetzungen kann aus dem linearen Anteil der Schrumpfkurve und der zu erwartenden Wassergehaltsänderung abgeschätzt werden. Setzungen sind abhängig vom Grundwasserabsenkungsbetrag und können mehrere Zentimeter bis Dezimeter betragen. In bindigen Böden sowie im Überlagerungsfall (nichtbindige Böden über bindigen Böden und bindige Böden über nichtbindigen Böden) sind Gebäudeschäden durch Schrumpfsetzungen insbesondere dann zu erwarten, wenn die Grundwasseroberfläche unter die Untergrenze bindiger Schichten absinkt und/oder der kapillare Aufstieg die Wassergehaltsabnahme des Bodens nicht mehr ausgleichen kann. Nichtbindige, mitteldicht- bis dichtgelagerte Böden (Sand, Kies etc.) reagieren auf ein Absinken des Grundwasserspiegels unsensibel. Das Ausmaß der Setzungen aufgrund des fehlenden Auftriebs ist gering. Stärkere Setzungen aufgrund fehlenden Auftriebs sind in locker gelagerten, nichtbindigen Böden (Sand etc.) zu erwarten. In Festgesteinen ist das Ausmaß von Setzungen durch ein Absinken des Grundwasserspiegels zu vernachlässigen. Allerdings sind die Auswirkungen überlagernder bindiger oder nichtbindiger Böden oder ein möglicherweise zu Hebungen führender Kristallisationsdruck (Gips etc.) zu beachten. Bei großem Grundwasserflurabstand sind geringere Setzungen als bei kleinem Grundwasserflurabstand zu erwarten. Liegt das Absenkmaß innerhalb der langjährigen jahreszeitlichen Schwankungsbreite des Grundwasserspiegels, d. h. unterschreitet der sich durch das Absenken der Grundwasseroberfläche einstellende maximale Flurabstand nicht den langjährigen natürlich vorhandenen Flurabstand, so sind die betroffenen Bauwerke nicht zusätzlich gefährdet. Die Setzungsempfindlichkeit eines Bauwerks im Einwirkungsbereich einer Grundwasserentnahme ist in erster Linie von der Steifigkeit des Baumaterials und der Konstruktion abhängig. Ein schlaffes Bauwerk schmiegt sich der entstehenden Setzungsmulde an. Ein biegesteifes Bauwerk ist bestrebt, Setzungsunterschiede und Setzungen durch die Verlagerung von Spannungen auszugleichen. Für die Bewertung der Auswirkungen von Setzungen in Grundwasserabsenkungsbereichen sind dementsprechend weniger die vertikalen Gesamtsetzungen als die zu erwartenden Setzungsunterschiede beispielsweise durch einen variablen geologischen Untergrundaufbau mit Rinnenfüllungen etc. entscheidend. Ein starres Bauwerk erzwingt in solchen Fällen nicht unbedingt gleichmäßige Setzungen; es können Schiefstellungen auftreten. 7
8 Als für die Bausubstanz zulässige Setzungen oder Setzungsunterschiede werden Verformungen bezeichnet, die bauwerksverträglich sind d. h. den Verwendungszweck nicht beeinträchtigen. Bauwerksverträgliche Verformungen garantieren jedoch nicht zwangsläufig Rissfreiheit. Bauwerke für die eine Rissfreiheit zu gewährleisten ist weiße Wannen, Flüssigkeitsbehälter, Wasserbecken etc. erfordern eine gesonderte Betrachtung. Sind durch eine geotechnisch sachverständige Bewertung des Absenkmaßes und der räumlichen Ausdehnung des Absenktrichters, der Schichtmächtigkeit, des Schrumpfverhaltens, der Lagerungsdichte etc. negative Auswirkungen auf den vorhandenen Gebäudebestand und die sonstige bautechnische Infrastruktur nicht auszuschließen, wird empfohlen, ein geotechnisches Gutachten erstellen zu lassen. Der geotechnische Gutachter prüft, ob die vorgesehene Grundwasserentnahme zu Deformationen am vorhandenen Bestand von Gebäuden und bautechnischer Infrastruktur führt (HERTH & ARNDTS 1985; DGGT 1997, 2004). Wenn die zu erwartenden Deformationen über das zulässige, tolerable Ausmaß hinausgehen d. h. den Verwendungszweck beeinträchtigende Schäden an Gebäuden, Versorgungsleitungen und/oder Verkehrswegen zu erwarten sind ist aus bautechnischer Sicht die geplante Grundwasserentnahme in der vorgesehenen Form nicht zulässig. Die geplante Grundwasserentnahmemenge und damit der entstehende Absenktrichter sind zu reduzieren, so dass kritische Baugrundareale nicht unzulässig beeinträchtigt werden. Sind auf der Grundlage des geotechnischen Gutachtens Setzungsauswirkungen auf den vorhandenen Gebäudebestand und die sonstige bautechnische Infrastruktur nicht auszuschließen, wird empfohlen, ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. 8 Grundwasserspiegelanstieg Wird die Wasserentnahme reduziert oder eingestellt, steigt der Grundwasserspiegel wieder an. Die Folge können u. a. Vernässungsschäden an Gebäuden oder Infrastruktur (Kanalisationen etc.) sein, da Geländehebungen oder Geländesenkungen beim Wiederanstieg des Grundwassers nicht reziprok zum Absenkungsprozess erfolgen. Folgende allgemeingültige Zusammenhänge lassen sich formulieren: Setzungen durch Absenkung der Grundwasseroberfläche entstehen in bindigen Sedimenten (Ton etc.) allmählich, in nichtbindigen Sedimenten (Sand etc.) sehr schnell nach Grundwasserspiegelsenkung und dem Erreichen eines Beharrungszustandes. Nach Reduzierung/Einstellung der Grundwasserentnahme und Wiederanstieg der Grundwasseroberfläche auftretende Geländehebungen infolge zunehmenden Auftriebs, Quellung etc. erreichen lediglich 1 10 % (Tone > 10 %) der vorausgegangenen Geländesetzungen (PRINZ 2006). Lokal auftretende organische Einlagerungen Torf, Mudde etc. zersetzen sich bei der Grundwasserabsenkung durch Einwirkung des zutretenden Sauerstoffs und bilden ein poröses Gefüge, welches unter Eigenlast durch Wegfall des Auftriebs oder zusätzliche Auflast konsolidiert. Beim Wiederanstieg des Grundwassers nimmt dieses organische Material viel Wasser auf, die entstehenden Hebungen sind jedoch deutlich geringer als die durch eine Grundwasserabsenkung verursachten Setzungen. Insbesondere in Lössböden, locker gelagerten Sanden etc. sind infolge der Vernässung beim Wiederanstieg des Grundwasserspiegels Setzungen oder Sackungen zu erwarten. Ursache betragsmäßig gravierender Sackungen ist der Verlust scheinbarer Kohäsion (Oberflächenspannung an Kornberührungspunkten) und/oder eine Schwächung beziehungsweise Zerstörung interpartikularer Bindungen (Zementierung, Schichtsilikatbrücken). Sackungen können in locker gelagerten, Sanden oder Löss deutlich größer als die abgeschätzten rein kompressiven Setzungen sein (FEESER, PETH & KOCH 2001). Zur Bewertung möglicher Bodendeformationen ist neben einer Vernässung durch den Anstieg des Grundwasserspiegels auch die Vernässung durch Aufstieg von Kapillarwasser zu berücksichtigen. In trockenen, locker gelagerten, nichtbindigen Sedimenten führt beispielsweise eine erste kapillare Durchfeuchtung zu erheblichen Sackungen, wohingegen nach wiederholter Vernässung deutlich geringere Sackungen auftreten (GRIMMER 2006). Aus den dargestellten Zusammenhängen ergeben sich drei wesentliche beim Wiederanstieg des Grundwasserspiegels zu beachtende Szenarien: Beim Wiederanstieg des Grundwasserspiegels gerät das Korngerüst unter Auftrieb. Hebungen in wiederbenetzten, mitteldicht- bis dicht gelagerten Sanden sowie Hebungen durch das Quellen von Ton, Schluff etc. sind in der Regel
9 geringer als die vorausgegangenen Setzungen. Eine Schädigung der Bausubstanz ist nicht zu erwarten. Wurde die Geländeoberfläche durch Setzungen organischer Böden etc. im Zuge der Grundwasserabsenkung dauerhaft abgesenkt, sind beim Grundwasserwiederanstieg direkte Vernässungsschäden (nasse Keller, aufschwimmende Fundamente etc.) sowohl im Altgebäudebestand als auch bei Neubebauung zu beachten. Infolge der Geländesenkung stellt sich der ansteigende Grundwasserspiegel lokal oberhalb der Geländeoberfläche oder mit geringem Flurabstand ein. In Kellerräume oder Untergeschosse kann aufgrund der relativen Hochlage des Grundwasserspiegels Wasser oder Feuchtigkeit eindringen. In Lössböden oder locker gelagerten Sanden können infolge einer Vernässung durch Grundwasserspiegelwiederanstieg oder Kapillarwasseraufstieg erneute Setzungen/Sackungen und somit weitergehende Bauwerksschäden (s. o.) oder direkte Vernässungsschäden verursacht werden. Maßgebend für die Größenordnung der Setzungen/Sackungen sind bodenphysikalische Faktoren wie Korngröße und Korngrößenverteilung, Kornform, Dichte und Porenzahl, Wassergehalt sowie äußere Faktoren wie Auflastspannung und Zeitpunkt der Benetzung (erstmalig oder wiederholt). Basierend auf Laborversuchen werden für Lössboden unter Auflast relative Sackungen von bis zu 7,75 % und für belastete Donaukiese relative Sackungen von bis zu 5,23 % beschrieben (in GRIMMER 2006). Die aufgeführten Zusammenhänge sind bereits bei der Planung/Genehmigung einer Grundwasserentnahme zu berücksichtigen. Sind auf der Grundlage des geotechnischen Gutachtens (s. o.) beim Grundwasserwiederanstieg weitere Einwirkungen auf den vorhandenen Gebäudebestand und die sonstige bautechnische Infrastruktur nicht auszuschließen, wird empfohlen, ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Beweissicherung Die Beweissicherung von Bauwerken baut auf einer detaillierten Bestandsaufnahme auf. Bauwerksart, Gründungsart (Flach- oder Tiefgründung, historische Gründungsverfahren, Unterkellerung), Vorschäden, besondere Anforderungen an den Verwendungszweck etc. sind zu erfassen. Betroffene Bauwerke sind in angepasste Empfindlichkeitskategorien einzuordnen (beispielsweise historische Gründung, Flachgründung, Tiefgründung) und im Hinblick auf ihre geologische Gründungssituation und ihre Lage im Grundwasserabsenkungs-/Grundwasserwiederanstiegsbereich (beispielsweise bindige Sedimente/zentral, bindige Sedimente/randlich etc.) zu klassifizieren. Die Gefährdung eines Bauwerks ist als Summenparameter der Empfindlichkeit des Bauwerks gegenüber Deformationen, der geologischen Gründungssituation und der Lage des Bauwerks im Grundwasserabsenkungs-/Grundwasserwiederanstiegsbereich zu bestimmen. Zur Beweissicherung der vorhandenen Bausubstanz sind durch den Gutachter vor Beginn der Grundwasserentnahme Vermessungsmarken, Gipsmarken, Rissmonitore etc. an Gebäuden, Versorgungsleitungen und Verkehrswegen zu setzen. Beobachtungspunkte sind einzurichten und über den Zeitraum der Grundwasserentnahme sowie des Grundwasserwiederanstiegs regelmäßig einzumessen. Es ist zu beachten, dass Vermessungsmarken etc. und Beobachtungspunkte sowohl in durch die Grundwasserentnahme beeinflussten als auch durch die Grundwasserentnahme nicht beeinflussten Bereichen gesetzt werden. Durch Grundwassermessstellen ist der Verlauf der Absenkkurve des Absenktrichters nachzuweisen. Abweichungen des tatsächlich beobachteten Absenktrichters vom theoretisch modellierten Absenktrichter sowie jahreszeitliche Schwankungen der Grundwasseroberfläche sind zu dokumentieren und im Hinblick auf resultierende Setzungen und eine Änderung/Erweiterung des Beweissicherungsbereiches zu bewerten. 9
10 3.2 Beweissicherung Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz Landwirtschaft Kann eine Beeinflussung der Vegetation in einem Absenkungsbereich nicht von vornherein ausgeschlossen werden, muss dies überprüft werden. Als Anhaltspunkt für die Festlegung des Untersuchungsgebietes kann in erster Annährung die 2 3 m-grundwasserflurabstandslinie herangezogen werden. Die genaue Abgrenzung und Ermittlung des standortspezifischen Grenzflurabstandes wird in einem bodenkundlichen Beweissicherungsgutachten vorgenommen (RAISSI & MÜLLER 2009b, ECKL & RAISSI 2009). Die Berechnung der Absenkungslinien (±1 dm Genauigkeit) der Situation Istentnahme gegenüber der Situation Nullentnahme ohne Förderung für das obere Grundwasserstockwerk ist für alle Bodennutzungsarten notwendig (s. ECKL & RAISSI 2009). Auf jährlich zu ermittelnde Absenkungstrichter kann unter Umständen verzichtet werden, wenn die klimatische Wasserbilanz für die Vegetationsperiode kein Defizit aufweist (z. B. in einem feuchten Jahr), durch Ermittlung des pflanzenverfügbaren Bodenwassers (Wpfl = nfkwe + kapillarer Aufstieg) kein Bedarf an kapillar aufsteigendem Grundwasser besteht. Für trockene Jahre gelten die o. g. Kriterien nicht. Daher wird empfohlen, für das obere Grundwasserstockwerk die Differenz zwischen dem aktuellen Förderzustand innerhalb der Vegetationszeit (Juni/Juli) und dem Zustand ohne Entnahme zu ermitteln (s. Kap. 2.1 und 3.1.1). Für die übrigen Feuchtjahre werden als Bezugspunkt die Mittelwerte des Kalenderjahres herangezogen. Die Vegetation reagiert auf Änderungen der Niederschlagsverteilung erst mit Verzögerung. Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum sind jährlich zu bewerten (Abb. 2). Ertragsbeeinträchtigungen können in der Regel in Prozent der ortsüblichen Erträge ermittelt werden (RAISSI & MÜLLER 2009b) Ertragsminderung in % Getreide (Korn) Zuckerrüben (Rüben) Grünland (TM ) Auswirkungsgrad Abb. 2: Abschätzung der Ertragsminderung durch Grundwasserabsenkungen (RAISSI & MÜLLER 2009b). Bei sehr hohem Auswirkungsgrad (Stufe 5) bewegen sich die Mindererträge z. B. um ca. 27 % bei Getreide, ca. 20 % bei Hackfrüchten und ca. 35 % bei Grünland. 10
11 3.2.2 Forstwirtschaft Als Anhaltspunkt für die Festlegung des Untersuchungsgebietes kann die 5 m-grundwasserflurabstandslinie herangezogen werden. Die genaue Abgrenzung der betroffenen Forstflächen wird im bodenkundlichen Gutachten zur Beweissicherung nach Vorgaben der KA 4 bzw. KA 5 (AD-HOC-AG BODEN 1994, 2005) und RAISSI, MÜLLER & MEE- SENBURG (2009) hinsichtlich des Grenzflurabstandes vorgenommen. Falls auf Grundlage der örtlichen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die forstliche Vegetationsperiode zwischen Anfang Mai bis Ende September (HILLMANN et al. 2009a, 2009b) ein klimatisches Wasserbilanzdefizit festgestellt wird und die Grundwassertiefstände (MNGW) vor der Grundwasserentnahme oberhalb des Grenzflurabstandes gelegen haben, sollte eine forstliche Beweissicherung für potenziell beeinträchtigungsgefährdet eingestufte Waldbestände angeordnet werden. Ein monetärer Ausgleich kann entweder auf Basis des entnahmebedingten Holzzuwachsverlustes in Festmetern zu marktüblichen Preisen oder auf Basis einer Pauschalentschädigungsregelung erfolgen. Nach Auswertung von Klimadaten der Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Zeitraum (forstliche Vegetationsperiode zwischen Mitte April bis Mitte September) lassen sich im Mittel folgende klimatische Wasserbilanzdefizite ableiten (Tab. 4): Tab. 4: Mittleres klimatisches Wasserbilanzdefizit für ausgewählte Klimastationen des DWD. DWD-Klimastation Friesoythe, Dörpen, Bremervörde, Teufelsmoor und Bad Harzburg Löningen, Jork, Oldenburg, Osnabrück, Holzminden und Unterlüß Lingen, Nordhorn, Soltau, Rotenburg, Bremen, Hildesheim und Hameln Diepholz, Nienburg, Hannover, Uelzen und Celle klimatisches Wasserbilanzdefizit/ forstliche Vegetationsperiode [mm] < Göttingen, Lüneburg und Helmstedt Lüchow 155 Für die Küsten- und Harzregionen besteht kein Defizit. Die nach dem klimatischen Wasserbilanzdefizit fehlende Menge kann entweder über das Speichervermögen der Böden (nfk) abgedeckt werden oder aber auch zusätzlich über den kapillaren Aufstieg aus dem Grundwasser bei grundwassernahen Standorten. In der Regel reicht das Wasserspeichervermögen der Waldböden aus, um ein klimatisches Wasserbilanzdefizit bis zu 80 mm abzudecken. Nach der forstlichen Ertragstafel (SCHOBER 1987) kann auf grundwasserfreien Sandstandorten in Kiefernbeständen ein Holzzuwachs von bis zu sechs Festmetern pro Jahr und ha und auf grundwassernahen Sandstandorten von maximal neun Festmetern pro Jahr und ha zum Zeitpunkt der Zuwachskulmination im Alter von Jahren erzielt werden. Demnach ist als möglicher Eckwert für Minderzuwächse durch Grundwasserabsenkung auf Böden mit ehemaligem Grundwasseranschluss und optimaler Wasserversorgung von ~ 30 % auszugehen. Die finanzielle Ertragsminderung kann jedoch u. a. durch Verschiebung der Sortimentsstruktur höher ausfallen (s. Abb. 3). 11
12 ungeschädigter Bestand Bestandeswert Euro/ha Schadensereignis - 10 % - 20 % - 30 % - 40 % - 50 % Zuwachsverluste geschädigter Bestand Alter Abb. 3: Bestandserwartungswerte in Abhängigkeit vom Bestandsalter bei ungestörtem Wachstum eines Fichtenbestandes (obere Kurve) bzw. bei gestörtem Wachstum als Folge der Grundwasserentnahme, z. B. beginnend im Alter 50. Mit den unterschiedlichen Auswirkungsgraden gehen entsprechende Zuwachsverluste [in %] einher (HILLMANN et al. 2009b) Naturschutz Bei Grundwasserneuerschließungen ist der Zustand von Natur und Landschaft ohne Entnahme zu ermitteln (vgl. RASPER 2004). Für den Zustand mit zukünftiger Grundwasserentnahme kann auf der Basis der hydrogeologischen Einschätzung eine Prognose der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erstellt werden. Bei der Bewilligung einer bereits bestehenden Entnahme wird der Zustand mit Entnahme ermittelt. Soweit die Entnahmemenge geändert wird oder Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft ohne die bisherige Entnahme notwendig sind, muss ebenfalls eine Prognose erstellt werden. Durch Grundwasserentnahme bedingte Veränderungen wertvoller Biotope sollten u. a. durch Vegetationsaufnahmen dokumentiert und Vorschläge zu Minderung der Schäden gemacht werden. Bei empfindlichen Biotoptypen lassen sich jedoch einmal eingetretene Schäden kaum wieder rückgängig machen (z. B. Mineralisierung von entwässertem Niedermoortorf). Erforderliche Auflagen und Maßnahmen zum Ausgleich möglicher Beeinträchtigungen sollten daher vor der Bewilligung festgelegt werden. Dazu gehören die Erfassung und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft (RASPER 2004), 12 Prognose der möglichen Beeinträchtigungen der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege, Prüfung der Möglichkeiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, Festlegung erforderlicher Auflagen und Maßnahmen zum Ausgleich. Festlegung erforderlicher Auflagen und Maßnahmen zur Kompensation (Ausgleich, Ersatz, Ersatzzahlung) im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, s. ECKL & RAISSI (2009). 4. Durchführungspläne 4.1 Durchführungsplan Grundwasser Eine Festlegung der Arbeitsschritte in einem fortzuschreibenden Durchführungsplan Hydrogeologie und Wasserwirtschaft (Datenerfassung und -aufbereitung, Messturnus, Berichtsturnus und Abgabetermine) erfolgt im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid. Vorab ist zu klären (s. Abb. 1), welche Fragestellungen mit welchen Methoden beurteilt werden sollen, welche fachtechnischen Sicherheiten erforderlich sind und welche Messgrößen im Rahmen der Beweissicherung wie häufig und über welchen Zeitraum zu erfassen sind (MÜLLER 1998). Der erforderliche Untersuchungsumfang ist abhängig von der Reichweite und dem Ausmaß der
13 voraussichtlichen Grundwasserabsenkung (Modellprognose) und der Beeinträchtigung mittelbar betroffener Umweltbereiche. Die im Durchführungsplan genannten Untersuchungen werden so lange durchgeführt, bis sich der Absenkungstrichter ausreichend ausgebildet hat. Für die im Durchführungsplan genannten Auflagen zur Abschätzung des Auswirkungsgrades von Grundwasserentnahmen werden in der Regel folgende Maßnahmen durchgeführt: Messung und Auswertung der Grundwasserstände (Monats-, Tageswerte), Ermittlung der Wasserstände und Abflüsse in Fließ- und Stillgewässern (i. d. R. Sommerhalbjahr, Basisabfluss) und der Klimadaten (Witterungsverhältnisse), jährliche Auswertung der Grundwasserganglinien, Darstellung von Extremwerten und der (Druck-)Spiegelschwankungen, Erstellung der Grundwassergleichenpläne für das obere Grundwasserstockwerk für den Vegetationszeitraum und zur Ermittlung der Grundwasserfließrichtung, Bei vorhandener Grundwasserstockwerkstrennung gilt das auch für das untere Grundwasserstockwerk, jedoch werden hier im Regelfall mittlere Wasserstände zur Ermittlung der Grundwasserfließrichtung und des Einzugsgebietes ausreichen. Eine Erstellung der Grundwasserdifferenzenpläne kann je nach Grundwasserkörper entweder eine jährliche oder eine drei- bis fünfjährliche Ermittlung erforderlich machen. Die Berechnung der Differenzenpläne erfolgt durch Vergleich des Istzustandes gegenüber dem Nullzustand zur Darstellung der förderbedingten Absenkung. Erstellung der Grundwasserflurabstandspläne für die Vegetationsperiode, jährliche Qualitätsanalyse des Rohwassers einzelner Förderbrunnen und der Vorfeldmessstellen (NWG 2007), Auswertungen zur Güteentwicklung des Rohwassers (5, 10, Jahre) zur Überwachung der langfristig gewinnbaren Wassermenge, Beurteilung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf die Grundwasserbeschaffenheit, Um Einschränkungen der Grundwasserfördermenge wegen Veränderungen der Grundwasserqualität zu vermeiden, sollten zusätzliche, anlagenbezogene Grundwasseruntersuchungen zu Wasser gefährdenden Stoffen (kontaminierte Standorte, Altlasten) mit einbezogen werden. Bei Grundwasserförderungen im Nahbereich von Süß-Salzwassergrenzen (Küstenversalzung oder Tiefenversalzung) werden in Ergänzung der Rohwasseruntersuchungen einzelner Förderbrunnen auch qualitative Untersuchungen zur Grundwasserversalzung (Ca/Mg- Verhältnis, elektrische Leitfähigkeit) an Sondermessstellen zur Erfassung einer eventuell nutzungsbedingten (durch Druckentlastung initiierten) Verschiebung des hydrostatischen Gleichgewichtes (Salz-/Süßwasser) im halbjährlichen Rhythmus, im Regelfall im unteren Grundwasserstockwerk der Grundwasserförderung, erforderlich sein. Im Rahmen der im Durchführungsplan genannten Grundwasserbeweissicherungsmaßnahmen können ggf. Veränderungen und Optimierungen der Messstellen vorgenommen werden. In Wassergewinnungsgebieten großer Entnahmemengen und großer Messstellendichte wird der Beobachtungsumfang mit Erkenntnisgewinn der fortschreitenden Messungen (durch die Erstellung von Grundwassergleichenkarten) gegebenenfalls reduziert werden. Eine Optimierung von Messnetzen mit großer Messstellenanzahl kann mittels statistischer Verfahren (vgl. LAWA 2000) erreicht werden. Wegen unvermeidlicher Unsicherheiten von Rechenergebnissen und vor allem aus wasserrechtlicher Sicht (Grundwasserbeweissicherungen dienen der Beweisführung von Tatsachen) dürfen Grundwasserstandsmessungen dabei aber nicht durch mathematische Berechnungen ersetzt werden. Auf Grundlage des kalibrierten Grundwassermodells sind Bereiche herauszustellen, die intensivere und engräumigere Wasserstandsmessungen (z. B. bei Wechselwirkungen Grundwasser/Oberflächengewässer) erfordern. Je nach Region und spezieller Situation des Wassergewinnungsgebietes hat die Optimierung/Anpassung des Durchführungsplans Hydrogeologie und Wasserwirtschaft in Abstimmung mit den beteiligten Stellen der wasserrechtlichen Genehmigung zu erfolgen. Die Auswertungen der Ergebnisse der in den Auflagen formulierten Untersuchungen haben zeitnah (Kalenderjahr, hydrologisches Sommer-/Winterhalbjahr) zu erfolgen. Die Überwachung und die Auswirkungen der Grundwasserentnahme werden in einem Jahresbericht dokumentiert. Die Berichtsvorlage sollte zu festen Terminen erfolgen. Die o. g. Auswertungen 13
14 der Grundwasserbeweissicherungsmessungen beinhalten auch eine Erfassung sämtlicher Erhebungen und Messungen in Datenbanken. Eine Überprüfung der Messungen wird anhand der Modellund Prognoseberechnungen des hydrogeologischen Gutachtens vorgenommen. Für die Datenweitergabe und das Berichtswesen sind bereits bei der Auftragsvergabe Absprachen bezüglich Datenhaltung und der Austauschformate mit den zuständigen Stellen der wasserrechtlichen Genehmigung, Fachbehörden und den Gutachterbüros zu treffen. Thematische Grundwasserkarten werden im Regelfall als digitale, GIS-orientierte Information weitergegeben. 4.2 Durchführungsplan Gewässer Die Arbeitsschritte werden in einem fortzuschreibenden Durchführungsplan Gewässer (Datenerfassung und -aufbereitung, Messturnus, Berichtsturnus und Abgabetermine) festgelegt. Es werden in der Regel folgende Maßnahmen durchgeführt: Erfassen der durch die Grundwasserentnahme möglicherweise betroffenen Oberflächengewässer und Quellfassungen innerhalb des Absenkungsgebietes, Auswahl und Festlegung von geeigneten Referenzgewässern, regelmäßige Abflussmessungen-/ Wasserstandsmessungen an Fließgewässerabschnitten zur Ermittlung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf das Gewässersystem, Wasserstandsmessungen durch Latten- und Schreibpegel in Fischteichen und Stillgewässern, biologische Bestandsuntersuchungen (Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten) in den Fließgewässern an verschiedenen Gewässerabschnitten, Auswertung der Abflussmessungen, z. B. in Bezug auf den Basisabfluss, gegebenenfalls Festlegung eines ökologisch begründeten Mindestwasserabflusses. 4.3 Durchführungsplan Bauwerke Die Arbeitsschritte werden in einem fortzuschreibenden Durchführungsplan Bautechnische Beweissicherung (Datenerfassung und aufbereitung, Messturnus, Berichtsturnus und Abgabetermine) festgelegt. Es sind in der Regel folgende Maßnahmen durchzuführen: Definition von Empfindlichkeitskategorien für Bauwerke, Kategorisierung der geologischen Gründungssituation und der Lage von Bauwerken im Grundwasserabsenkungs-/Grundwasserwiederanstiegsbereich, Festlegung von Gefährdungsbereichen, bautechnische Bestandsaufnahme bestehender Bauwerke im Einflussbereich der förderbedingten Grundwasserabsenkung, Setzen der Vermessungsmarken, Gipsmarken, Rissmonitore, Beobachtungspegel etc., Erfassung und Dokumentation der Messergebnisse (Absenkmaß, Setzungen etc.), fortlaufende Dokumentation und Bewertung der Setzungsschäden, Bewertung der vorhandenen und sich entwickelnden Schädigungs- bzw. Gefährdungssituation, prüffähige und zeitgerechte Überstellung der Ergebnisse an die Genehmigungsbehörde. 4.4 Durchführungsplan Landwirtschaft Die Arbeitsschritte werden in einem fortzuschreibenden Durchführungsplan Land- und Forstwirtschaft (Datenerfassung und -aufbereitung, Messturnus, Berichtsturnus und Abgabetermine) festgelegt. Grundlage ist die Ermittlung und kartenmäßige Darstellung der bereits eingetretenen förderbedingten Grundwasserabsenkungen. Es werden in der Regel folgende Maßnahmen durchgeführt: Berechnungen der Grundwasserabsenkungslinie (±1 dm Genauigkeit): Istzustand gegenüber dem Nullzustand ohne Entnahme für das obere Grundwasserstockwerk, z. B. mit einem Grundwassermodell, Einrichtung und Messungen von flachen Grundwassermessstellen (Ablesung in vierzehntägigem Turnus innerhalb der Vegetationsperiode), Messung und Auswertung der DWD- Klimadaten (Niederschlag, Verdunstung, klimatische Wasserbilanz (KWB) während der Vegetationszeit), Ermittlung und Festlegung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf den Bodenwasserhaushalt bei landwirtschaftlicher Bodennutzung (s. Kap. 3.2), 14
15 Bewertung der betroffenen Flächen auf der Grundlage der Absenkungslinie, Bewertung des Auswirkungsgrades der entnahmebedingten Grundwasserabsenkungen (RAISSI & MÜLLER 2009b), Ausgleich der entnahmebedingten Mindererträge im Schadensjahr (RAISSI & MÜLLER 2009b). Bei häufigen Änderungen der Entnahmesituation im Bewilligungszeitrahmen kann auf jährliche Untersuchungen und Bewertungen verzichtet werden, wenn eine maximale Absenkung (höchste Reichweite der Grundwasserabsenkung bei KWB- Defizit der Trockenjahre) zu Grunde gelegt wird. 4.5 Durchführungsplan Forstwirtschaft Die Arbeitsschritte werden in einem fortzuschreibenden Durchführungsplan Forstwirtschaft (Datenerfassung und -aufbereitung, Messturnus, Berichtsturnus und Abgabetermine) festgelegt (s. Kap. 4.4). Grundlage ist die Ermittlung und kartenmäßige Darstellung der bereits eingetretenen förderbedingten Grundwasserabsenkungen. Es werden in der Regel folgende Maßnahmen durchgeführt: Erfassung von Wallhecken und Altbaumbeständen (z. B. Hofeichen), Einrichtung und Messungen von flachen Grundwassermessstellen für die Abschätzung des Wasserhaushaltes der Waldbestände in vierzehntägigem Turnus, Messung und Auswertung der DWD-Klimadaten (Niederschlag, Verdunstung, klimatische Wasserbilanz während der Vegetationszeit), Analyse der Zuwachsunterschiede innerhalb und außerhalb des Absenkungsgebietes, Festlegung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf den Wasserhaushalt der Wälder (s. Kap. 3.2), Ausgleich der entnahmebedingten Zuwachs- Mindererträge im Schadensjahr (HILLMANN et al. 2009b). 4.6 Durchführungsplan Naturschutz Die Arbeitsschritte werden in einem fortzuschreibenden Durchführungsplan Naturschutz (Datenerfassung und -aufbereitung, Messturnus, Berichtsturnus und Abgabetermine) festgelegt. Grundlage ist die Ermittlung und kartenmäßige Darstellung der bereits eingetretenen förderbedingten Grundwasserabsenkungen. Es werden in der Regel folgende Maßnahmen durchgeführt: Messung und Auswertung der DWD-Klimadaten (Niederschlag, Verdunstung), Auswertung der Ergebnisse von Dauerbeobachtungsflächen, Messung von Lattenpegeln sowie flachen Grundwassermessstellen, Feststellung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf den Wasserhaushalt und auf die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege, Durchführung von Erfolgskontrollen. Im Anschluss an das behördliche Zulassungsverfahren zur Grundwasserentnahme sollten im Rahmen der Beweissicherung Erfolgskontrollen (Erstellung/Funktion) der festgelegten Auflagen und Maßnahmen durchgeführt werden. Die Erstellungskontrolle dient der Überprüfung, ob die notwendigen Maßnahmen zeit- und sachgerecht durchgeführt wurden. Sie ist immer erforderlich. Die Funktionskontrolle soll überprüfen, ob durch die Maßnahmen auch das gewünschte Ziel erreicht wurde bzw. wird. Funktionskontrollen sind nicht generell erforderlich. Bei bestehenden Entnahmerechten, die erneut bewilligt werden, sind die Grundwasserentnahmen ohne Mengenänderung keine Eingriffe nach NNatG. Bei häufigen Änderungen der Entnahmesituation im Bewilligungszeitrahmen kann auf jährliche Untersuchungen und Bewertungen verzichtet werden, wenn eine maximale Absenkung (höchste Reichweite der Grundwasserabsenkung bei KWB-Defizit der Trockenjahre) zu Grunde gelegt wird. 15
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
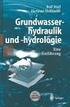 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin
 Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin Titel Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin Runder Tisch Grundwassermanagement, 29. Mai 2012 Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin Inhalt Entwicklung
Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin Titel Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin Runder Tisch Grundwassermanagement, 29. Mai 2012 Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin Inhalt Entwicklung
Temperatur des Grundwassers
 Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Wasserentnahme in der Nordheide
 Wieviel Wasser braucht Hamburg? UWG SG Salzhausen Mittwoch, den 2.05.2012, Gasthof Isernhagen, Gödenstorf Öffentliche Veranstaltung am 9. Mai 2012 im Alten Geidenhof in Hanstedt Beginn 19:30 Wasserförderung
Wieviel Wasser braucht Hamburg? UWG SG Salzhausen Mittwoch, den 2.05.2012, Gasthof Isernhagen, Gödenstorf Öffentliche Veranstaltung am 9. Mai 2012 im Alten Geidenhof in Hanstedt Beginn 19:30 Wasserförderung
Allgemeine Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung
 Allgemeine Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung PD Dr. C. Neukum Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Referat L3.2 Grundwasser- und Abfallwirtschaft, Altlasten Inhalt und Gliederung
Allgemeine Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung PD Dr. C. Neukum Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Referat L3.2 Grundwasser- und Abfallwirtschaft, Altlasten Inhalt und Gliederung
BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz
 BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz MHW Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung und Untersuchungsumfang... 2 2 Schurf und hydrogeologische Verhältnisse... 2 3 Grundwasserstände... 3 4 Mittlerer Grundwasserhochstand...
BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz MHW Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung und Untersuchungsumfang... 2 2 Schurf und hydrogeologische Verhältnisse... 2 3 Grundwasserstände... 3 4 Mittlerer Grundwasserhochstand...
Merkblatt. zur. Ermittlung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstandes beim Einsatz von Ersatzbaustoffen in Hamburg
 Merkblatt zur Ermittlung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstandes beim Einsatz von Ersatzbaustoffen in Hamburg 1. Veranlassung und Geltungsbereich Maßgeblich für die Verwertung von Ersatzbaustoffen
Merkblatt zur Ermittlung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstandes beim Einsatz von Ersatzbaustoffen in Hamburg 1. Veranlassung und Geltungsbereich Maßgeblich für die Verwertung von Ersatzbaustoffen
Erfassungs- und Optimierungsmöglichkeiten des Kühlungspotenzials von Böden der Stadt Bottrop
 DBG Tagung 2013 Quelle: Damm 2011 Erfassungs- und Optimierungsmöglichkeiten des Kühlungspotenzials von Böden der Stadt Bottrop Eva Damm, Masterstudentin Umweltingenieurwissenschaften RWTH Aachen Bachelorarbeit
DBG Tagung 2013 Quelle: Damm 2011 Erfassungs- und Optimierungsmöglichkeiten des Kühlungspotenzials von Böden der Stadt Bottrop Eva Damm, Masterstudentin Umweltingenieurwissenschaften RWTH Aachen Bachelorarbeit
Naturschutz im Klimawandel
 Biodiversität und Klima Vernetzung der Akteure in Deutschland X 8.-9. Oktober 2013 Nadine Nusko Projekt INKA BB www.hnee.de/inkabbnaturschutz Nadine.Nusko@hnee.de Naturschutz im Klimawandel Standortbezogene
Biodiversität und Klima Vernetzung der Akteure in Deutschland X 8.-9. Oktober 2013 Nadine Nusko Projekt INKA BB www.hnee.de/inkabbnaturschutz Nadine.Nusko@hnee.de Naturschutz im Klimawandel Standortbezogene
Bewässerungstag Landwirtschaft Erlaubnisverfahren im Wasserrecht für die Bewässerung
 Bewässerungstag Landwirtschaft 11.02.2014 Erlaubnisverfahren im Wasserrecht für die Bewässerung Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Frau Käfer 11.2.2014 Entnahmen aus Grundwasser und Oberirdischen Gewässern
Bewässerungstag Landwirtschaft 11.02.2014 Erlaubnisverfahren im Wasserrecht für die Bewässerung Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Frau Käfer 11.2.2014 Entnahmen aus Grundwasser und Oberirdischen Gewässern
Anhang XIII: Gliederung und Checkliste einer Zusammenfassung der Angaben nach 11 UVPG
 Umwelt-Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes Anhang XIII, 41 Anhang XIII: Gliederung und Checkliste einer Zusammenfassung der Angaben nach 11 UVPG Die nachfolgende Gliederung kann bei der Erstellung der
Umwelt-Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes Anhang XIII, 41 Anhang XIII: Gliederung und Checkliste einer Zusammenfassung der Angaben nach 11 UVPG Die nachfolgende Gliederung kann bei der Erstellung der
Klimawandel im Offenland und Wald
 Klimawandel im Offenland und Wald Klimawandel Einleitung Deutschland Thüringen und Rhön Ursachen des Klimawandels Ein anthropogener Einfluss wird als gesichert angesehen, da sich der rezente Temperaturanstieg
Klimawandel im Offenland und Wald Klimawandel Einleitung Deutschland Thüringen und Rhön Ursachen des Klimawandels Ein anthropogener Einfluss wird als gesichert angesehen, da sich der rezente Temperaturanstieg
Kurzbegründung zum. Bebauungsplan Nr. 124 Feuerwehr Huntlosen. Gemeinde Großenkneten
 Vorentwurf (Stand: 14.12.2016) Seite 1 Kurzbegründung zum Bebauungsplan Nr. 124 Feuerwehr Huntlosen Gemeinde Großenkneten Vorentwurf (Stand: 14.12.2016) Seite 2 1. PLANAUFSTELLUNG Aufgrund des 1 Abs. 3
Vorentwurf (Stand: 14.12.2016) Seite 1 Kurzbegründung zum Bebauungsplan Nr. 124 Feuerwehr Huntlosen Gemeinde Großenkneten Vorentwurf (Stand: 14.12.2016) Seite 2 1. PLANAUFSTELLUNG Aufgrund des 1 Abs. 3
Verordnung zum Gesetz über die Nutzung von öffentlichem Fluss- und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung)
 Wassernutzungsverordnung 77.50 Verordnung zum Gesetz über die Nutzung von öffentlichem Fluss- und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung) Vom. Juni 00 (Stand. Januar 009) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,
Wassernutzungsverordnung 77.50 Verordnung zum Gesetz über die Nutzung von öffentlichem Fluss- und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung) Vom. Juni 00 (Stand. Januar 009) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,
ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen:
 Sehr geehrter Herr Reuter, ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen: Wie soll man den SGS beurteilen, was ist er in Ihren Augen?
Sehr geehrter Herr Reuter, ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen: Wie soll man den SGS beurteilen, was ist er in Ihren Augen?
Die geänderten Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung nach der Änderung der BetrSichV
 Die geänderten Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung nach der Änderung der BetrSichV Dip.-Ing.(FH) Dipl.-Inform.(FH) Mario Tryba Sicherheitsingenieur Vorbemerkungen: Die Gefährdungsbeurteilung ist
Die geänderten Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung nach der Änderung der BetrSichV Dip.-Ing.(FH) Dipl.-Inform.(FH) Mario Tryba Sicherheitsingenieur Vorbemerkungen: Die Gefährdungsbeurteilung ist
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen. WS 2009/2010 Kapitel 1.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften Band 27
 Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften Band 27 Multifunktionale Agrarlandschaften - Pflanzenbaulicher Anspruch, Biodiversität, Ökosystemdienstleistungen 58. Tagung der Beiträge in
Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften Band 27 Multifunktionale Agrarlandschaften - Pflanzenbaulicher Anspruch, Biodiversität, Ökosystemdienstleistungen 58. Tagung der Beiträge in
Auswirkungen des Erlasses des MLV zur landesplanerischen Behandlung von Tierhaltungsanlagen auf die Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG
 Auswirkungen des Erlasses des MLV zur landesplanerischen Behandlung von Tierhaltungsanlagen auf die Genehmigungsverfahren Allgemeines Tierhaltungsanlagen sind in der Nr. 7.1 des Anhanges zur 4. BImSchV
Auswirkungen des Erlasses des MLV zur landesplanerischen Behandlung von Tierhaltungsanlagen auf die Genehmigungsverfahren Allgemeines Tierhaltungsanlagen sind in der Nr. 7.1 des Anhanges zur 4. BImSchV
Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien
 Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien Jochen Stark Referat Boden und Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung Workshop der MAGPlan - Begleitgruppe 28./29. Juni
Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien Jochen Stark Referat Boden und Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung Workshop der MAGPlan - Begleitgruppe 28./29. Juni
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie
 Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie Monitoring Grundwasser und Seen Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie Die EU-Wasserrahmenrichtlinie Monitoring Seen Die Europäische Folie: 2 Wasserrahmenrichtlinie
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie Monitoring Grundwasser und Seen Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie Die EU-Wasserrahmenrichtlinie Monitoring Seen Die Europäische Folie: 2 Wasserrahmenrichtlinie
ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement. Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A
 ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A Dr. AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 1 Fallbeispiel A: Chemische
ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A Dr. AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 1 Fallbeispiel A: Chemische
Überwachung der Gewässer (Monitoring)
 Regierung von Überwachung der Gewässer (Monitoring) Dr. Andreas Schrimpf Wasserwirtschaftsamt Rosenheim Rosenheim, den 14. Juni 2007 Inhalt Ziele und Zeitplan Gewässerüberwachung Überwachungsprogramme
Regierung von Überwachung der Gewässer (Monitoring) Dr. Andreas Schrimpf Wasserwirtschaftsamt Rosenheim Rosenheim, den 14. Juni 2007 Inhalt Ziele und Zeitplan Gewässerüberwachung Überwachungsprogramme
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Trinkwasserschutzgebiete
 Trinkwasserschutzgebiete Grundlagen der hydrogeologischen Abgrenzung von Wasserschutzgebieten (DVGW-Regelwerk W 101) Dr. Dieter Kämmerer, 29.08.2013 DVGW Regelwerk W 101 wird in fast allen Bundesländern
Trinkwasserschutzgebiete Grundlagen der hydrogeologischen Abgrenzung von Wasserschutzgebieten (DVGW-Regelwerk W 101) Dr. Dieter Kämmerer, 29.08.2013 DVGW Regelwerk W 101 wird in fast allen Bundesländern
von Fußböden (Systemböden)
 Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Betreff: Untersuchungen der Auswirkungen von wasserspeichernden Zusatzstoffen
 Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft Fa. Aquita z.hd. Herrn Ludwig FÜRST Pulvermühlstr. 23 44 Linz Wien, 9. Juni 9 Betreff: Untersuchungen
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft Fa. Aquita z.hd. Herrn Ludwig FÜRST Pulvermühlstr. 23 44 Linz Wien, 9. Juni 9 Betreff: Untersuchungen
GeoBerichte 15. Leitfaden für hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Wasserrechtsverfahren in Niedersachsen
 GeoBerichte 15 LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE Leitfaden für hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Wasserrechtsverfahren in Niedersachsen Niedersachsen GeoBerichte 15 Landesamt
GeoBerichte 15 LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE Leitfaden für hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Wasserrechtsverfahren in Niedersachsen Niedersachsen GeoBerichte 15 Landesamt
WS 2013/2014. Vorlesung Strömungsmodellierung. Prof. Dr. Sabine Attinger
 WS 2013/2014 Vorlesung Strömungsmodellierung Prof. Dr. Sabine Attinger 29.10.2013 Grundwasser 2 Was müssen wir wissen? um Grundwasser zu beschreiben: Grundwasserneubildung oder Wo kommt das Grundwasser
WS 2013/2014 Vorlesung Strömungsmodellierung Prof. Dr. Sabine Attinger 29.10.2013 Grundwasser 2 Was müssen wir wissen? um Grundwasser zu beschreiben: Grundwasserneubildung oder Wo kommt das Grundwasser
EF Q1 Q2 Seite 1
 Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Studienvergleich. Titel. Zielsetzung und Fragestellung
 Studienvergleich Titel Untersuchungen zur Notwendigkeit einer weitergehenden Systemsteuerung zur Einhaltung der Systembilanz Zielsetzung und Fragestellung Die Studie untersucht, inwieweit zusätzliche Maßnahmen
Studienvergleich Titel Untersuchungen zur Notwendigkeit einer weitergehenden Systemsteuerung zur Einhaltung der Systembilanz Zielsetzung und Fragestellung Die Studie untersucht, inwieweit zusätzliche Maßnahmen
Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration
 8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
Schülerexperiment: Messen elektrischer Größen und Erstellen von Kennlinien
 Schülerexperiment: Messen elektrischer Größen und Erstellen von Kennlinien Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Benötigtes Material Volt- und Amperemeter;
Schülerexperiment: Messen elektrischer Größen und Erstellen von Kennlinien Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Benötigtes Material Volt- und Amperemeter;
Hinweise zu Anträgen für Bauwasserhaltungen nach Art. 70 BayWG
 Az: 61/641-2/6 Landratsamt Dachau -Sachgebiet 61- Wasserrecht Weiherweg 16 85221 Dachau Hinweise zu Anträgen für Bauwasserhaltungen nach Art. 70 BayWG Für Bauvorhaben, die in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten
Az: 61/641-2/6 Landratsamt Dachau -Sachgebiet 61- Wasserrecht Weiherweg 16 85221 Dachau Hinweise zu Anträgen für Bauwasserhaltungen nach Art. 70 BayWG Für Bauvorhaben, die in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten
Anwendung verschiedener Steuerungsmodelle für die Bewässerung am Beispiel des Einlegegurkenanbaus in Niederbayern
 Geographie Christoph Seifried Anwendung verschiedener Steuerungsmodelle für die Bewässerung am Beispiel des Einlegegurkenanbaus in Niederbayern Diplomarbeit Diplomarbeit Anwendung verschiedener Steuerungsmodelle
Geographie Christoph Seifried Anwendung verschiedener Steuerungsmodelle für die Bewässerung am Beispiel des Einlegegurkenanbaus in Niederbayern Diplomarbeit Diplomarbeit Anwendung verschiedener Steuerungsmodelle
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan)
 Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Aus der Wolke bis in das Grundwasser wasserwirtschaftliche Untersuchungen und Planungen an einem Beispiel im Dresdener Raum
 Aus der Wolke bis in das Grundwasser wasserwirtschaftliche Untersuchungen und Planungen an einem Beispiel im Dresdener Raum Dipl.-Ing. Bettina Knab BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh Inhaltsübersicht
Aus der Wolke bis in das Grundwasser wasserwirtschaftliche Untersuchungen und Planungen an einem Beispiel im Dresdener Raum Dipl.-Ing. Bettina Knab BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh Inhaltsübersicht
Landwirtschaftskammer Hannover Hannover, Referat: Boden, Düngung, Beregnung Ekkehard Fricke Tel.: 0511/ Fax: 0511/
 Landwirtschaftskammer Hannover Hannover, 16.04.04 Referat: Boden, Düngung, Beregnung Ekkehard Fricke Tel.: 0511/3665 1361 Fax: 0511/3665-1591 Eine gesicherte Wasserversorgung ist existenzentscheidend Das
Landwirtschaftskammer Hannover Hannover, 16.04.04 Referat: Boden, Düngung, Beregnung Ekkehard Fricke Tel.: 0511/3665 1361 Fax: 0511/3665-1591 Eine gesicherte Wasserversorgung ist existenzentscheidend Das
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
28. Februar Geologischer Dienst für Bremen. Praktische Hinweise zur optimalen. Wiedervernässung von Torfabbauflächen. Joachim Blankenburg.
 Geologischer Dienst für Bremen 28. Februar 2012 1 / 17 Übersicht 1 2 3 4 5 6 7 8 2 / 17 Ziel: wachsendes Hochmoor 3 / 17 Entstehungsbedingungen torfbildende Vegetation ständiger Wasserüberschuss konservieren
Geologischer Dienst für Bremen 28. Februar 2012 1 / 17 Übersicht 1 2 3 4 5 6 7 8 2 / 17 Ziel: wachsendes Hochmoor 3 / 17 Entstehungsbedingungen torfbildende Vegetation ständiger Wasserüberschuss konservieren
Minimaler Grundwasserflurabstand zum oberflächennahen Grundwasserleiter in Hamburg
 Minimaler Grundwasserflurabstand zum oberflächennahen Grundwasserleiter in Hamburg 1. Begriffserläuterungen Als Grundwasserflurabstand wird der lotrechte Abstand zwischen einem Punkt der Geländeoberfläche
Minimaler Grundwasserflurabstand zum oberflächennahen Grundwasserleiter in Hamburg 1. Begriffserläuterungen Als Grundwasserflurabstand wird der lotrechte Abstand zwischen einem Punkt der Geländeoberfläche
Ermittlung Hochwasserschadenspotentials und KNU von Hochwasserschutzbauten am Beispiel Radkersburg
 Ermittlung Hochwasserschadenspotentials und KNU von Hochwasserschutzbauten am Beispiel Radkersburg Gabriele Harb Technische Universität Graz, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft Stremayrgasse 10/II,
Ermittlung Hochwasserschadenspotentials und KNU von Hochwasserschutzbauten am Beispiel Radkersburg Gabriele Harb Technische Universität Graz, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft Stremayrgasse 10/II,
Bergamt Südbayern Regierung von Oberbayern
 Bergamt Südbayern Regierung von Oberbayern Umweltverträglichkeitsprüfung in der Geothermie - Workshop zum Geothermie Kongress Essen - 13. November 2014 1 Praktische Aspekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung
Bergamt Südbayern Regierung von Oberbayern Umweltverträglichkeitsprüfung in der Geothermie - Workshop zum Geothermie Kongress Essen - 13. November 2014 1 Praktische Aspekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung
T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters
 Grundpraktikum T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters Autor: Partner: Versuchsdatum: Versuchsplatz: Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen und Aufgabenstellung 2 2 Messwerte und Auswertung
Grundpraktikum T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters Autor: Partner: Versuchsdatum: Versuchsplatz: Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen und Aufgabenstellung 2 2 Messwerte und Auswertung
Klimaänderungen Prognosen Unsicherheiten
 Klimaänderungen Prognosen Unsicherheiten Klimawandel Prof. Dr. Günter Gross Institut für Meteorologie und Klimatologie Fakultät für Mathematik und Physik Leibniz Universität Hannover Klimawandel in Niedersachsen
Klimaänderungen Prognosen Unsicherheiten Klimawandel Prof. Dr. Günter Gross Institut für Meteorologie und Klimatologie Fakultät für Mathematik und Physik Leibniz Universität Hannover Klimawandel in Niedersachsen
BUC Immobilien GmbH Areal Makartstraße Pforzheim. Regenwasserbeseitigungskonzept
 BUC Immobilien GmbH Regenwasserbeseitigungskonzept bei Einhaltung der Grundwasserneubildung ERLÄUTERUNGSBERICHT MIT BERECHNUNGEN Hügelsheim, Juli 2013 WALD + CORBE Infrastrukturplanung GmbH Vers V/13PF
BUC Immobilien GmbH Regenwasserbeseitigungskonzept bei Einhaltung der Grundwasserneubildung ERLÄUTERUNGSBERICHT MIT BERECHNUNGEN Hügelsheim, Juli 2013 WALD + CORBE Infrastrukturplanung GmbH Vers V/13PF
Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld: Das 3D - Modell als Bewirtschaftungswerkzeug. Katja Fürstenberg , Hannover
 Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld: Das 3D - Modell als Bewirtschaftungswerkzeug Katja Fürstenberg 20.02.2014, Hannover Gliederung Veranlassung Fuhrberger Feld - Gebietsbeschreibung Eingangsdaten - Umfang
Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld: Das 3D - Modell als Bewirtschaftungswerkzeug Katja Fürstenberg 20.02.2014, Hannover Gliederung Veranlassung Fuhrberger Feld - Gebietsbeschreibung Eingangsdaten - Umfang
11 DYNAMISCHES GRUNDWASSERMANAGEMENT- SYSTEM
 Kapitel 11: Dynamisches Grundwassermanagementsystem 227 11 DYNAMISCHES GRUNDWASSERMANAGEMENT- SYSTEM 11.1 Übersicht Das entwickelte Optimierungssystem für instationäre Verhältnisse lässt sich in der praktischen
Kapitel 11: Dynamisches Grundwassermanagementsystem 227 11 DYNAMISCHES GRUNDWASSERMANAGEMENT- SYSTEM 11.1 Übersicht Das entwickelte Optimierungssystem für instationäre Verhältnisse lässt sich in der praktischen
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I. WS 2009/2010 Kapitel 2.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
Gefährdung von Bauwerken durch Hoch-, Grund- und Oberflächenwasser
 Gefährdung von Bauwerken durch Hoch-, Grund- und Oberflächenwasser Dipl.Ing. Dr. Stefan Haider Büro Pieler ZT GmbH, Eisenstadt äußere Wassergefahren Hochwasser Hangwasser Grundwasser Rückstau aus Abwasserentsorgung
Gefährdung von Bauwerken durch Hoch-, Grund- und Oberflächenwasser Dipl.Ing. Dr. Stefan Haider Büro Pieler ZT GmbH, Eisenstadt äußere Wassergefahren Hochwasser Hangwasser Grundwasser Rückstau aus Abwasserentsorgung
Richtlinien Dichte Schlitzwände und Bohrpfähle
 Richtlinien Dichte Schlitzwände und Bohrpfähle AUSFÜHRUNG Ing. Erwin GIRSCH Wien, 07.11.2013 Auf Wissen bauen 1 Agenda Was ist neu zu den bisherigen Ausgaben Vorarbeiten für die Planung Projektangaben
Richtlinien Dichte Schlitzwände und Bohrpfähle AUSFÜHRUNG Ing. Erwin GIRSCH Wien, 07.11.2013 Auf Wissen bauen 1 Agenda Was ist neu zu den bisherigen Ausgaben Vorarbeiten für die Planung Projektangaben
VOB/C Homogenbereiche ersetzen Boden- und Felsklassen
 VOB/C Homogenbereiche ersetzen Boden- und Felsklassen Vortrag im Rahmen der 10. Öffentlichkeitsveranstaltung des Netzwerks Baukompetenz München BKM 17. März 2016 Hochschule München Referent Prof. Dipl.-Ing.
VOB/C Homogenbereiche ersetzen Boden- und Felsklassen Vortrag im Rahmen der 10. Öffentlichkeitsveranstaltung des Netzwerks Baukompetenz München BKM 17. März 2016 Hochschule München Referent Prof. Dipl.-Ing.
Biotopverbundplanung auf regionaler Ebene für ausgewählte, vom Klimawandel betroffener Arten
 Biodiversität und Klimawandel -Vernetzung der Akteure -in Deutschland VII vom 29.08 bis 01.09.2010 -BFN-Internat. Naturschutzakademie Insel Vilm Biotopverbundplanung auf regionaler Ebene für ausgewählte,
Biodiversität und Klimawandel -Vernetzung der Akteure -in Deutschland VII vom 29.08 bis 01.09.2010 -BFN-Internat. Naturschutzakademie Insel Vilm Biotopverbundplanung auf regionaler Ebene für ausgewählte,
Überwachungsprogramm gemäß 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz und 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung
 Überwachungsprogramm gemäß 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz und 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung Gemäß 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und 9 Industriekläranlagen-Zulassungs-
Überwachungsprogramm gemäß 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz und 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung Gemäß 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und 9 Industriekläranlagen-Zulassungs-
1. Der Betreiber einer Anlage beauftragt eine Sachverständigen-Organisation nach
 Information über Aufgaben des s, des Sachverständigen und der Behörde im Zusammenhang mit Prüfungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. 19 i WHG und 12 VAwS Diese Information beschreibt
Information über Aufgaben des s, des Sachverständigen und der Behörde im Zusammenhang mit Prüfungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. 19 i WHG und 12 VAwS Diese Information beschreibt
Operatives Monitoring und Integrative Mengenbewirtschaftung für den Grundwasserkörper Fuhse-Wietze. Teilprojekt Wulbeck
 Dr.-Ing. Andreas Matheja Consulting Services Königsberger Str. 5 30938 Burgwedel / OT Wettmar fon: +49 511 / 762-3738 mobil: +49 / 1607262809 fax: +49 511 / 762 4002 email: kontakt@matheja-consult.de HM
Dr.-Ing. Andreas Matheja Consulting Services Königsberger Str. 5 30938 Burgwedel / OT Wettmar fon: +49 511 / 762-3738 mobil: +49 / 1607262809 fax: +49 511 / 762 4002 email: kontakt@matheja-consult.de HM
Rechenverfahren. DGfM. Schallschutz. SA2 Rechenverfahren Seite 1/7. Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung
 Rechenverfahren Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung von Bauteilen Zur allgemeinen Kennzeichnung der frequenzabhängigen Luftschalldämmung von Bauteilen mit einem Zahlenwert wird das bewertete
Rechenverfahren Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung von Bauteilen Zur allgemeinen Kennzeichnung der frequenzabhängigen Luftschalldämmung von Bauteilen mit einem Zahlenwert wird das bewertete
Anna Kirchner Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Koblenz
 GEWÄSSERENTWICKLUNG AKTUELL 2014 LANDWIRTSCHAFTLICHE DRAINAGEN UND GEWÄSSERUNTERHALTUNG Anna Kirchner Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Koblenz Ausgangslage: WRRL und WHG 2010 1. Bewirtschaftungsgrundlagen
GEWÄSSERENTWICKLUNG AKTUELL 2014 LANDWIRTSCHAFTLICHE DRAINAGEN UND GEWÄSSERUNTERHALTUNG Anna Kirchner Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Koblenz Ausgangslage: WRRL und WHG 2010 1. Bewirtschaftungsgrundlagen
Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden
 Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden Uwe Büttner, Dipl.-Hydrologe, Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Das Gebiet Hinsichtlich seiner Gewässernetzstruktur und Lage innerhalb des zentraleuropäischen
Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden Uwe Büttner, Dipl.-Hydrologe, Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Das Gebiet Hinsichtlich seiner Gewässernetzstruktur und Lage innerhalb des zentraleuropäischen
Ergebnisse der Stichproben-Messprogramms Rothenburgsort
 Ergebnisse der Stichproben-Messprogramms Rothenburgsort Vom 15.5.2000 bis zum 7.11.2001 wurden mit dem Messfahrzeug der Behörde für Umwelt und Gesundheit Luftschadstoffmessungen im Gebiet Rothenburgsort
Ergebnisse der Stichproben-Messprogramms Rothenburgsort Vom 15.5.2000 bis zum 7.11.2001 wurden mit dem Messfahrzeug der Behörde für Umwelt und Gesundheit Luftschadstoffmessungen im Gebiet Rothenburgsort
Anforderungen an Deponiegasfackeln und Deponiegasmotoren entsprechend TA Luft 02 1
 Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie Referat 22 Radebeul, den 12.11.05 Bearb.: Herr Poppitz Tel.: 0351 8312 631 Anforderungen an Deponiegasfackeln und Deponiegasmotoren entsprechend TA Luft 02
Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie Referat 22 Radebeul, den 12.11.05 Bearb.: Herr Poppitz Tel.: 0351 8312 631 Anforderungen an Deponiegasfackeln und Deponiegasmotoren entsprechend TA Luft 02
Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos nach EU-HWRM-RL
 LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos nach EU-HWRM-RL Ständiger Ausschuss der LAWA Hochwasserschutz und Hydrologie (AH) Seite 1
LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos nach EU-HWRM-RL Ständiger Ausschuss der LAWA Hochwasserschutz und Hydrologie (AH) Seite 1
2.1 Anzahl der Schulen nach Schulform
 2. Schule 40 II Ausgewählte Daten zur Lebenssituation von jungen Menschen in Niedersachsen 2.1 Anzahl der Schulen nach Schulform Die folgenden drei Karten weisen die Anzahl der Schulen nach Schulformen
2. Schule 40 II Ausgewählte Daten zur Lebenssituation von jungen Menschen in Niedersachsen 2.1 Anzahl der Schulen nach Schulform Die folgenden drei Karten weisen die Anzahl der Schulen nach Schulformen
Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.v.
 Seite 1 von 6 Vorbemerkung Die Druckbehälterverordnung (DruckbehälterV) wurde mit In-Kraft-Treten der Druckgeräteverordnung (14. GSGV) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zurückgezogen. Während
Seite 1 von 6 Vorbemerkung Die Druckbehälterverordnung (DruckbehälterV) wurde mit In-Kraft-Treten der Druckgeräteverordnung (14. GSGV) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zurückgezogen. Während
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb
 Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Biodiversität und Unternehmen
 1.Treffen Kontaktnetzwerk Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 Dipl. - Ing. Peter Smeets Landschaftsarchitekt, BDLA Zehntwall 5-7 50374 Erftstadt 02235 / 685.359-0 kontakt@la-smeets.de Februar 2014 2
1.Treffen Kontaktnetzwerk Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 Dipl. - Ing. Peter Smeets Landschaftsarchitekt, BDLA Zehntwall 5-7 50374 Erftstadt 02235 / 685.359-0 kontakt@la-smeets.de Februar 2014 2
Sicherheitstechnische Prüfungen bei Getränkeschankanlagen
 ASI Sicherheitstechnische Prüfungen bei Getränkeschankanlagen ASI 6.83 ASI - Arbeits-Sicherheits-Informationen - BGN Themenübersicht Vorwort 3 1. Was versteht man unter Prüfung einer Getränkeschankanlage
ASI Sicherheitstechnische Prüfungen bei Getränkeschankanlagen ASI 6.83 ASI - Arbeits-Sicherheits-Informationen - BGN Themenübersicht Vorwort 3 1. Was versteht man unter Prüfung einer Getränkeschankanlage
Bezirksregierung Köln
 Bezirksregierung Köln Verkehrskommission des Regionalrates Sachgebiet: Anfragen Drucksache Nr.: VK 30/2005 Köln, den 22. Februar 2005 Tischvorlage für die 17. Sitzung der Verkehrskommission des Regionalrates
Bezirksregierung Köln Verkehrskommission des Regionalrates Sachgebiet: Anfragen Drucksache Nr.: VK 30/2005 Köln, den 22. Februar 2005 Tischvorlage für die 17. Sitzung der Verkehrskommission des Regionalrates
Abstandsauflagen. (Stand: 30. März 2016) Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern (Naturhaushalt Wasserorganismen-
 Abstandsauflagen Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden! Abstandsauflagen bitte für jedes Mittel prüfen. (Stand: 30. März
Abstandsauflagen Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden! Abstandsauflagen bitte für jedes Mittel prüfen. (Stand: 30. März
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.
 Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Wasserversorgung und Wasserbereitstellung in Mainfranken
 Wasserversorgung und Wasserbereitstellung in Mainfranken 58. Veitshöchheimer Weinbautage Dr. Herbert Walter Wasserwirtschaftsamt Wasserversorgung und Wasserbereitstellung in Mainfranken Text Geobasisdaten:
Wasserversorgung und Wasserbereitstellung in Mainfranken 58. Veitshöchheimer Weinbautage Dr. Herbert Walter Wasserwirtschaftsamt Wasserversorgung und Wasserbereitstellung in Mainfranken Text Geobasisdaten:
Erfahrungen mit dem Bericht über den Ausgangszustand (AZB) aus dem Regierungsbezirk Köln. Oberhausen,
 Erfahrungen mit dem Bericht über den Ausgangszustand (AZB) aus dem Regierungsbezirk Köln Oberhausen, 15.03.2016 Inhalt Genehmigungspraxis in Nordrhein-Westfalen Wer spricht wann mit wem? der AZB im Genehmigungsverfahren
Erfahrungen mit dem Bericht über den Ausgangszustand (AZB) aus dem Regierungsbezirk Köln Oberhausen, 15.03.2016 Inhalt Genehmigungspraxis in Nordrhein-Westfalen Wer spricht wann mit wem? der AZB im Genehmigungsverfahren
Präsentation Bauen und Wassergefahren
 Präsentation Bauen und Wassergefahren Kapitel 4 Gefahrenkarten und regionale Grundlagen Stand November 2013 4. Gefahrenkarten Folie 1 Wissen über Wassergefahren Überflutung durch Hochwasser Gefahrenzonen?
Präsentation Bauen und Wassergefahren Kapitel 4 Gefahrenkarten und regionale Grundlagen Stand November 2013 4. Gefahrenkarten Folie 1 Wissen über Wassergefahren Überflutung durch Hochwasser Gefahrenzonen?
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Bayern
 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Bayern Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung zur Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme Veranstaltungen zum Informationsaustausch zur Maßnahmenplanung
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Bayern Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung zur Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme Veranstaltungen zum Informationsaustausch zur Maßnahmenplanung
FRAGEBOGEN. Thema: Einfluss von Klimaänderungen auf die Wasserressourcen im Einzugsgebiet der Lausitzer Neiße
 FRAGEBOGEN Thema: Einfluss von en auf die Wasserressourcen im Einzugsgebiet der Lausitzer Neiße Informationen zum Projekt NEYMO Die Umfrage findet im Rahmen des sächsisch-polnischen Projektes NEYMO statt.
FRAGEBOGEN Thema: Einfluss von en auf die Wasserressourcen im Einzugsgebiet der Lausitzer Neiße Informationen zum Projekt NEYMO Die Umfrage findet im Rahmen des sächsisch-polnischen Projektes NEYMO statt.
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
 Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Entwicklung erster in Frage kommender Korridore für den SuedOstLink
 Entwicklung erster in Frage kommender Korridore für den SuedOstLink Leipzig, 28.09.2016 Jenny Fernández, Umweltplanerin IBUe Ingenieurbüro Gliederung Strukturierung des Untersuchungsraums Trassenkorridorfindung
Entwicklung erster in Frage kommender Korridore für den SuedOstLink Leipzig, 28.09.2016 Jenny Fernández, Umweltplanerin IBUe Ingenieurbüro Gliederung Strukturierung des Untersuchungsraums Trassenkorridorfindung
Steckbrief Biogeographische Regionen
 Steckbrief Biogeographische Regionen Dirk Hinterlang November 2015 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.
Steckbrief Biogeographische Regionen Dirk Hinterlang November 2015 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.
Retentionskataster. Flussgebiet Orb mit Haselbach
 Retentionskataster Flussgebiet Orb mit Haselbach Flussgebiets-Kennzahl: 247852 / 2478524 Bearbeitungsabschnitt Orb: km + bis km 8+214 Bearbeitungsabschnitt Haselbach: km + bis km 1+83 Retentionskataster
Retentionskataster Flussgebiet Orb mit Haselbach Flussgebiets-Kennzahl: 247852 / 2478524 Bearbeitungsabschnitt Orb: km + bis km 8+214 Bearbeitungsabschnitt Haselbach: km + bis km 1+83 Retentionskataster
Statistik, Geostatistik
 Geostatistik Statistik, Geostatistik Statistik Zusammenfassung von Methoden (Methodik), die sich mit der wahrscheinlichkeitsbezogenen Auswertung empirischer (d.h. beobachteter, gemessener) Daten befassen.
Geostatistik Statistik, Geostatistik Statistik Zusammenfassung von Methoden (Methodik), die sich mit der wahrscheinlichkeitsbezogenen Auswertung empirischer (d.h. beobachteter, gemessener) Daten befassen.
Workshop 2: Boden und Landwirtschaft. Flächenumwandlung und CO 2 -Bilanz
 Workshop 2: Boden und Landwirtschaft Flächenumwandlung und CO 2 -Bilanz Heinrich Höper Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Referat L3.4 Boden- und Grundwassermonitoring Gliederung 1. Bedeutung
Workshop 2: Boden und Landwirtschaft Flächenumwandlung und CO 2 -Bilanz Heinrich Höper Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Referat L3.4 Boden- und Grundwassermonitoring Gliederung 1. Bedeutung
Waldstandorte und Klimawandel
 Waldstandorte und Klimawandel Norbert Asche, Gelsenkirchen 1 AFSV 2009 Waldstandort und seine Merkmale Klima als eine treibende Kraft der Standortentwicklung Klimaentwicklung und Standortmerkmale Ergebnisse
Waldstandorte und Klimawandel Norbert Asche, Gelsenkirchen 1 AFSV 2009 Waldstandort und seine Merkmale Klima als eine treibende Kraft der Standortentwicklung Klimaentwicklung und Standortmerkmale Ergebnisse
Standortsuche für eine Baggergut-Monodeponie in Hamburg Anhang ANHANG 14
 Standortsuche für eine Baggergut-Monodeponie in Hamburg Anhang ANHANG 14 Erläuterung des Deponie-Kostenvergleichs für die Standorte 14, 15, 33 und 36-1 Erläuterungen zum Kostenvergleich der Standorte (Kostenvergleich
Standortsuche für eine Baggergut-Monodeponie in Hamburg Anhang ANHANG 14 Erläuterung des Deponie-Kostenvergleichs für die Standorte 14, 15, 33 und 36-1 Erläuterungen zum Kostenvergleich der Standorte (Kostenvergleich
Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos
 Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler bestimmen experimentell
Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler bestimmen experimentell
Mitte: Christina Schmidt 06421-4056108, 0151-54329578 christina.schmidt@llh.hessen.de
 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Newsletter WRRL Copyright Ansprechpartner Grundberatung Wasserrahmenrichtlinie: Nord: Jan Schrimpf 05622-79777171, 0151-16893214 jan.schrimpf@llh.hessen.de Mitte: Christina
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Newsletter WRRL Copyright Ansprechpartner Grundberatung Wasserrahmenrichtlinie: Nord: Jan Schrimpf 05622-79777171, 0151-16893214 jan.schrimpf@llh.hessen.de Mitte: Christina
Institut für Waldökosysteme. Oberhof, Name des Wissenschaftlers 25. Juni 2014
 Kann man durch Baumartenwahl und Forstmanagement den Wasserhaushalt der Moore beeinflussen? Jürgen Müller, Thünen-Institut für Waldökosysteme, E-Mail: juergen.mueller@ti.bund.de, A.-Möller -Str. 1 16225
Kann man durch Baumartenwahl und Forstmanagement den Wasserhaushalt der Moore beeinflussen? Jürgen Müller, Thünen-Institut für Waldökosysteme, E-Mail: juergen.mueller@ti.bund.de, A.-Möller -Str. 1 16225
Klimawandel in NRW und Strategien zur. Dr. Barbara Köllner
 Klimawandel in NRW und Strategien zur Anpassung Dr. Barbara Köllner Der Klimawandel ist in NRW angekommen nicht drastisch aber stetig - Anstieg der Durchschnittstemperaturen: seit Beginn des Jahrhunderts
Klimawandel in NRW und Strategien zur Anpassung Dr. Barbara Köllner Der Klimawandel ist in NRW angekommen nicht drastisch aber stetig - Anstieg der Durchschnittstemperaturen: seit Beginn des Jahrhunderts
Multimomentaufnahme. Fachhochschule Köln Campus Gummersbach Arbeitsorganisation Dr. Kopp. Multimomentaufnahme. Arbeitsorganisation
 1 Gliederung der Präsentation - Definition - Zeitstudien Einordnung - Prinzip und Verfahrensformen - Genereller Ablauf - Planung von MM-Studien 2 Definition multum momentum viel Augenblick Die besteht
1 Gliederung der Präsentation - Definition - Zeitstudien Einordnung - Prinzip und Verfahrensformen - Genereller Ablauf - Planung von MM-Studien 2 Definition multum momentum viel Augenblick Die besteht
Anhang C Jährliche Überprüfung der Vorgaben
 Anhang C Jährliche Überprüfung der Vorgaben Verfahren und Softwareanforderungen zur Auswahl der Vorgabenstammblätter, die zur jährlichen Überprüfung der Vorgaben anstehen. Für allgemeine (grundlegende)
Anhang C Jährliche Überprüfung der Vorgaben Verfahren und Softwareanforderungen zur Auswahl der Vorgabenstammblätter, die zur jährlichen Überprüfung der Vorgaben anstehen. Für allgemeine (grundlegende)
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Büro- und Verwaltungsgebäude. Prozessqualität Bauausführung Qualitätssicherung der Bauausführung
 Qualitätssicherung der Relevanz und Zielsetzung Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der ist die detaillierte Gebäudedokumentation. Sie dient verschiedensten Akteuren (Bauherr, Eigentümer,
Qualitätssicherung der Relevanz und Zielsetzung Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der ist die detaillierte Gebäudedokumentation. Sie dient verschiedensten Akteuren (Bauherr, Eigentümer,
Bewilligungsverfahren für Erdwärmesonden im Kanton Basel-Landschaft. Merkblatt für Bauherrschaft
 4410 Liestal, Rheinstrasse 29 Telefon 061 552 55 05 Telefax 061 552 69 84 Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Umweltschutz und Energie Bewilligungsverfahren für Erdwärmesonden
4410 Liestal, Rheinstrasse 29 Telefon 061 552 55 05 Telefax 061 552 69 84 Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Umweltschutz und Energie Bewilligungsverfahren für Erdwärmesonden
24. Gewässernachbarschaftstag GN 254 Unstrut/Leine
 24. Gewässernachbarschaftstag GN 254 Unstrut/Leine Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie Bewertung von Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern und in Auen Dipl.-Ing. Marcel Möller Gesetzliche Grundlagen
24. Gewässernachbarschaftstag GN 254 Unstrut/Leine Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie Bewertung von Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern und in Auen Dipl.-Ing. Marcel Möller Gesetzliche Grundlagen
Ableitung von Treibhausgasemissionen aus der Gebietskulisse
 1 Ableitung von Treibhausgasemissionen aus der Gebietskulisse Dr. Heinrich Höper Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Geologischer Dienst für Niedersachsen Der Treibhauseffekt Bedeutung der Treibhausgase
1 Ableitung von Treibhausgasemissionen aus der Gebietskulisse Dr. Heinrich Höper Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Geologischer Dienst für Niedersachsen Der Treibhauseffekt Bedeutung der Treibhausgase
1.Projektverantwortung Einsender 1.2. Bauherr. Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Postfach Offenburg
 Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Postfach 1960 77609 Offenburg Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach 108 WG Baden- Württemberg zur Grundwasserbenutzung zum Betrieb einer
Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Postfach 1960 77609 Offenburg Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach 108 WG Baden- Württemberg zur Grundwasserbenutzung zum Betrieb einer
Das neue Einstufungsverfahren für Stoffe in Wassergefährdungsklassen
 Das neue Einstufungsverfahren für Stoffe in Wassergefährdungsklassen im Rahmen der Informationsveranstaltung 10./11. Oktober 2013 in Berlin Die neue Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Das neue Einstufungsverfahren für Stoffe in Wassergefährdungsklassen im Rahmen der Informationsveranstaltung 10./11. Oktober 2013 in Berlin Die neue Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
1 Hintergrund und Veranlassung
 1. Ergänzung zum Wegekostengutachten 2013 2017 14.04.2014 Mautsatzberechnung als Grundlage für den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes Hinweis: Durch Rundungen
1. Ergänzung zum Wegekostengutachten 2013 2017 14.04.2014 Mautsatzberechnung als Grundlage für den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes Hinweis: Durch Rundungen
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald -
 Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
7 Umweltamt - Untere Wasserbehörde - Brückstraße Dortmund
 7 Umweltamt - Untere Wasserbehörde - Brückstraße 45-44122 Dortmund Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung Für die folgende Gewässerbenutzung beantrage ich eine
7 Umweltamt - Untere Wasserbehörde - Brückstraße 45-44122 Dortmund Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung Für die folgende Gewässerbenutzung beantrage ich eine
INGENIEURBÜRO SCHNEIDER Dipl.- Ing. Frank Schneider
 Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung in der Wohneinheit. (DG),.Straße. in.. Gliederung 1. Grundlage und Auftrag zur Nachweisführung 2. Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung
Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung in der Wohneinheit. (DG),.Straße. in.. Gliederung 1. Grundlage und Auftrag zur Nachweisführung 2. Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung
Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen
 Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen Dr. Barbara Köllner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV Autorenname, Fachbereich Das Klima in NRW (Quelle: DWD) Jahresmitteltemperatur
Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen Dr. Barbara Köllner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV Autorenname, Fachbereich Das Klima in NRW (Quelle: DWD) Jahresmitteltemperatur
Aktuelle Ergebnisse zur N-Düngung von Raps. Dr. Wilfried Schliephake, Abt. 7 - Pflanzliche Erzeugung
 Aktuelle Ergebnisse zur N-Düngung von Raps Dr. Wilfried Schliephake, Abt. 7 - Pflanzliche Erzeugung Schwerpunkte des Vortrages: Notwendigkeit der Optimierung der N-Düngung Biomasseentwicklung im Herbst
Aktuelle Ergebnisse zur N-Düngung von Raps Dr. Wilfried Schliephake, Abt. 7 - Pflanzliche Erzeugung Schwerpunkte des Vortrages: Notwendigkeit der Optimierung der N-Düngung Biomasseentwicklung im Herbst
