UND. SaWaM: Wasserressourcen datenbasiert nutzen. 1. Ausgabe Newsletter des KIT-Zentrums Klima und Umwelt.
|
|
|
- Gabriel Glöckner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ausgabe UND Newsletter des KIT-Zentrums Klima und Umwelt Editorial SaWaM: Wasserressourcen datenbasiert nutzen Die Nachricht haben wir lange erwartet, und sie hat uns doch schockiert: Die USA steigen laut Beschluss des US-Präsidenten Donald Trump aus dem Klimaschutz aus zumindest auf Bundesebene. Das Ziel des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung bei weniger als 2 Grad zu halten, wird damit noch schwieriger erreichbar, als dies bisher schon der Fall war. Trotzdem sollten wir unsere Zuversicht nicht verlieren, wie auch aus unserem neuen Newsletter hervorgeht: Die Weltgemeinschaft hat ja schon einmal bewiesen, dass sie gemeinsam wichtige Lebensbedingungen auf dem Planeten erhalten kann bei der Rettung der Ozonschicht, die gut vorankommt. Wir werden weiter alles dafür tun, damit dies auch beim Thema Erderwärmung gelingt. Unsere Forschungsergebnisse und der Dialog mit der Gesellschaft spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ihr Prof. Dr. Oliver Kraft, Vizepräsident für Forschung 80 Prozent der Weltbevölkerung sind von potenziell unsicherer Wasserversorgung betroffen. Bis 2025 werden nach Schätzung der UN voraussichtlich 1,8 Milliarden Menschen von absoluter Wasserknappheit bedroht sein und weniger als 500 Kubikmeter Wasser pro Person und Jahr zur Verfügung haben. Wie viel Wasser künftig in trockenen und halbtrockenen Regionen der Erde verfügbar sein wird und wie sich Reservoire und bewässerte Landwirtschaft steuern lassen, damit befassen sich Forscher in dem am KIT koordinierten Projekt Saisonales Wasserressourcen-Management in Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter globaler Informationen (SaWaM). Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt macht globale Satelliten- und Modelldaten für das regionale Wassermanagement und die saisonale Vorhersage nutzbar. Besonders relevant ist diese Problematik für Gebiete, die schon jetzt von Wassermangel geprägt sind, sagt Professor Harald Kunstmann, stellvertretender Leiter des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Umweltforschung (IMK-IFU) des KIT in Garmisch-Partenkirchen. Mitglieder des SaWaM-Konsortiums bei ihrem Kickoff-Treffen auf dem KIT Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen. (Foto: Harald Kunstmann) Beobachtungsdaten zum Wasserkreislauf aber sind rar oder mangels Auflösung nur eingeschränkt nutzbar. Mit SaWaM wollen die Forscher nun die Leistungsfähigkeit globaler hydrometeorologischer Datenprodukte untersuchen und durch neu entwickelte Methoden für die Entscheidungsunterstützung optimieren. Besonders wichtig ist die saisonale Vorhersage der zentralen Wasserhaushaltsgrößen für die nächsten sechs bis zwölf Monate. SaWaM wird Informationen über die zukünftige Entwicklung der Wasserverfügbarkeit liefern, vor allem für die Steuerung von Reservoiren und die bewässerte Landwirtschaft, so Kunstmann. Um die Praxisnähe der entwickelten Methoden zu gewährleisten, ist das Projektkonsortium eng mit lokalen Entscheidungsträgern, Forschungseinrichtungen und Unternehmen in den Zielregionen verzahnt. Winter-School bei sommerlichen Temperaturen Seite 2 Modelle zum Wasserressourcen- Management Seite 3 Wie der Ozonabbau der Arktis das Klima beeinflusst Seite 4 Direkt angesprochen Klimawandel: Das Interesse an wissenschaftlichen Fakten ist da! Seite 6 KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft 1
2 FORSCHUNG Winter-School bei sommerlichen Temperaturen den Grundwasserspiegel in der ehemaligen Uferzone des Toten Meeres verändert: Süßwasser dringt in Salzeinschlüsse ein und wäscht diese aus. Dadurch entstehen Hohlräume, die einstürzen und schlimmstenfalls ganze Häuser mit sich reißen können. Abflussmessung bei einer Sturzflut. (Foto: Maren Haid / KIT) Dass der Wasserstand des Toten Meeres dramatisch sinkt, ist hinlänglich bekannt. Welche Folgen das für das Klima, die Menschen oder die Hydrogeologie der Region hat, ist weit weniger gut untersucht. Innerhalb des virtuellen Helmholtz-Instituts DESERVE DEad SEa Research VEnue widmen sich internationale Forscher unter Leitung des KIT diesen und verwandten Fragestellungen. Im vergangenen Dezember richteten die Projektbeteiligten bereits zum zweiten Mal vor Ort eine Winter-School für Nachwuchswissenschaftler aus. Vom 4. bis 15. Dezember 2016 trafen sich im jordanischen Madaba insgesamt 25 Teilnehmer, hauptsächlich Masterstudenten und Doktoranden der DESERVE-Partnerinstitute: neben dem KIT sind das das GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum und das Helmholtz- Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Leipzig sowie Institute in Israel, Jordanien und Palästina. Inhaltlicher Schwerpunkt der Winter-School war die Untersuchung von sogenannten Sinkholes. Diese Einsturzlöcher entstehen, weil der sinkende Wasserspiegel Mithilfe auch von Ballon- und Drohnenflügen erhoben die Teilnehmer zahlreiche Daten zur Charakterisierung der Sinkholes und ihrer Umgebung. Ergänzt wurden die Feldforschungen durch Übungen und durch Vorträge von DESERVE-Wissenschaftlern. Weitere Themen waren mögliche Klimaänderungen infolge des sinkenden Wasserspiegels sowie die seismische Gefährdung der Region. Über die rein wissenschaftliche Fortbildung hinaus ist das für die Doktoranden eine tolle Gelegenheit, einmal die Gegend zu erkunden, erläutert Projekt-Koordinatorin Dr. Manuela Nied. Einige Teilnehmer arbeiten zwar schon länger zum Toten Meer, waren aber zuvor noch nie vor Ort. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung wurden durch das Projekt getragen. Dank einer Kooperation mit der ZKU-Doktorandenschule GRACE konnten einige der Studenten auch ihre Anreise über ein Stipendium finanzieren. Ab in den Untergrund Wärme lässt sich im Boden zwischenspeichern Die Idee ist bestechend einfach: Überschüssige Wärme, die etwa an heißen Sommertagen oder beim Betrieb von Industrieanlagen anfällt, wird so lange im Untergrund gespeichert, bis sie wieder benötigt wird. Aquiferspeicher nennt sich dieses Verfahren, dessen Potenzial Forscher um Jun.-Prof. Dr. Philipp Blum vom Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) des KIT in den kommenden drei Jahren an acht Standorten in Baden-Württemberg ausloten und wirtschaftlich bewerten wollen. Bislang wird diese Technologie in Deutschland noch selten genutzt, obwohl es auch es auch hierzulande zahlreiche Regionen gibt, in denen die geologischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, sagt Blum. Gespeichert wird die überschüssige Wärme in unterirdischen, wasserführenden Schichten, so genannten Aquiferen. Zu den Standorten, dessen Eignung Blum und sein Team untersuchen wollen, gehören ein Schwimmbad in Hockenheim, das städtische Klinikum in Karlsruhe oder die Überschusswärme in der Stadt Überlingen am Bodensee. Gefördert wird das Projekt GeoSpeicher.bw vom baden-württembergischen Umweltministerium. Eigens für das Vorhaben wird eine fachübergreifende Doktorandenschule aufgebaut. Insgesamt acht Doktoranden unterschiedlicher Fachrichtungen des KIT, der Universitäten Heidelberg und Stuttgart sowie der Hochschulen Biberach und Offenburg sollen in den einzelnen Projekten mitarbeiten. Geplant ist eine enge Einbindung sowohl der örtlichen Stadtwerke als auch der Öffentlichkeit. Wir wollen mit diesen Demoprojekten eine breite Öffentlichkeitswirkung schaffen und zeigen, dass die Technik bei hohem Kohlendioxid-Einsparpotenzial wirtschaftlich einsetzbar ist, sagt Blum. WEITERE INFOS: Das Außenbecken der Waldsee-Therme in Bad Waldsee. (Foto: Waldsee-Therme) 2
3 FORSCHUNG Wissenschaftler erkunden die Erdstruktur unter Skandinavien Die Geologie Skandinaviens gibt Forschern Rätsel auf: Warum etwa sind die Berge der Kaledoniden, ein Gebirgszug am westlichen Kontinentalrand, so hoch? Sie sehen geologisch betrachtet viel jünger aus als sie sind. In der Region wirken schon lange keine tektonischen Kräfte mehr, die die Berge zum Beispiel heben würden, erläutert Michael Grund vom Geophysikalischen Institut (GPI) des KIT. Wir versuchen über Messungen seismischer Wellen den Ursachen für das Phänomen auf die Spur zu kommen. Zahlreiche solcher Messstationen registrieren seismische Wellen. (Foto: Michael Grund) Insgesamt 130 temporäre und 115 Festnetzstationen registrieren im Rahmen des internationalen ScanArray-Projekts seismische Wellen in Skandinavien. Das GPI und das GFZ Hemholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum bearbeiten gemeinsam den deutschen Beitrag: LITHOS-CAPP (LITHOSpheric Structure of Caledonien, Archaean and Proterozoic Provinces). Für ihre Untersuchungen stellten Forscher beider Zentren zwischen September 2014 und Oktober 2016 in Finnland und Schweden 20 Breitband- Messstationen auf. Sie registrieren die seismischen Wellen, die durch die Erde laufen, wenn es irgendwo auf der Welt ein Beben gegeben hat. Je nach Struktur und Material des Untergrundes breiten sich seismische Wellen schneller oder langsamer aus oder werden in verschiedene Richtungen abgelenkt, erläutert Grund. Das erlaubt es uns zum einen, ein tomographisches Modell des Untergrunds zu erstellen und zum anderen, die im Untergrund ablaufenden Prozesse besser Die Karte zeigt die Messstationen in Skandinavien. (Foto: Michael Grund) zu charakterisieren. Der deutsche Beitrag zum ScanArray-Projekt soll im Sommer kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin hoffen die Forscher mehr darüber zu wissen, warum Skandinavien so aussieht, wie es aussieht. Modelle zum Wasserressourcen-Management Mit minimaler Datenmenge maximale Aussagekraft erzielen Weltweit gibt es über Stauseen, die nicht nur 20 Prozent der weltweit benötigten Energie produzieren, sondern Millionen von Menschen mit Trinkwasser versorgen. Diese Stauseen sind alles andere als simple Wassersammelbecken. Sie unterliegen ständigen Veränderungen, vor allem im Hinblick auf Wasserstand und Qualität. Durch die zunehmende Urbanisierung ländlicher Räume nehmen etwa Nutzungsdruck und häufig auch Schadstoff-Einträge zu. Wasserknappheit ist eine mögliche Folge. Verschärft wird dies in vielen Regionen der Welt durch Klimaveränderungen, die die Wasserverfügbarkeit beeinflussen. Um die Wasserressourcen adäquat zu managen, benötigt man Modelle, welche die langfristige Entwicklung der Wasserreservoire vorhersagen. Solche Modelle gibt es wie Sand am Meer, erläutert Dr. Stephan Fuchs vom Institut für Wasser und Gewässerentwicklung am KIT. Aber die sind alle sehr komplex und benötigen unzählige Daten. In vielen Regionen der Welt sind sie deshalb nicht vernünftig einsetzbar. Gemeinsam mit Partnern aus Deutschland und Brasilien arbeitet Fuchs an der Bereitstellung neuer, vereinfachter Modelle, die global anwendbar sein sollen. Wir wollen die Modelle so abspecken, dass sie minimale Datenanforderungen benötigen, aber immer noch entscheidungsrelevante Vorhersagen liefern. Ein Ziel ist es, die benötigten Stausee Passauna bei Curitiba das Untersuchungsgebiet in Brasilien. (Foto: Mauricio Scheer, SANEPAR) Daten künftig mit Mitteln der Fernerkundung zu generieren. Aus Satellitendaten ließen sich etwa Angaben über Bodenfeuchte, Landnutzung oder Pflanzenbedeckung generieren, erläutert Fuchs. Als Ausgangspunkt nutzen die Wissenschaftler Daten der bestens dokumentierten Großen Dhünntalsperre im Bergischen Land. Geprüft und weiter angepasst werden die Modelle dann in zwei Wasserreservoiren im Südosten Brasiliens. Das Projekt Multidisziplinäre Datenakquisition als Schlüssel für ein global anwendbares Wasserressourcenmanagement ist innerhalb der BMBF- Förderrichtlinie Globale Ressource Wasser (GROW) angesiedelt. Nach dem Kick-off Meeting der deutschen Partner im Mai sollen die ersten Arbeiten beginnen. Im Herbst dieses Jahres soll es dann in Brasilien einen offiziellen Startschuss für das Projekt geben. WEITERE INFOS: 3
4 FORSCHUNG Wie der Ozonabbau der Arktis das Klima beeinflusst Die Wissenschaftler der POLSTRACC- Kampagne haben alle Hände voll zu tun. Sie werten Messreihen aus, analysieren und interpretieren Daten, fassen die Ergebnisse für Veröffentlichungen zusammen. Wir befinden uns mitten in der Erntephase, sagt Dr. Björn-Martin Sinnhuber vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Spurengase und Fernerkundung (IMK-ASF), der die Kampagne zur Erforschung der Ozonschicht über der Arktis gemeinsam mit seinem Kollegen Hermann Oelhaf koordiniert. Die eigentliche Messkampagne während eines viermonatigen Einsatzes in der Arktis liegt schon mehr als ein Jahr zurück. 18 Forschungsflüge und mehr als 150 Flugstunden absolvierten die Forscher im arktischen Winter 2015/2016. Mit drei Tonnen Nutzlast an Bord hob das deutsche Forschungsflugzeug HALO im Dezember 2015 zunächst von Oberpfaffenhofen Richtung Nordpol ab. Zwischen Januar und März folgten weitere Flüge vom nordschwedischen Kiruna. Mit zahlreichen Messinstrumenten untersuchten die Forscher damals die chemischen Prozesse in etwa acht bis 15 Kilometern Höhe. Fernerkundungsinstrumente an Bord sowie Messungen vom Boden und von Satelliten ergänzten die Charakterisierung der arktischen Atmosphäre. Jetzt heißt es, die Früchte der harten Arbeit einzuholen. Was wir schon sagen können, ist, dass der Ozonabbau in der Polarregion in dem Winter außergewöhnlich stark war, sagt HALO in Kiruna vor dem Start. Auf der Oberseite des Rumpfes sieht man eine Reihe von Lufteinlässen für die in situ Messgeräte, an der Unterseite das GLORIA Infrarod-Spektrometer. (Foto: Björn-Martin Sinnhuber) Sinnhuber. Das liegt daran, dass es in der Stratosphäre in zehn bis 30 Kilometer Höhe extrem kalt war, kälter als jemals zuvor gemessen. Sinken die Temperaturen in dieser Atmosphärenschicht extrem ab, bilden sich sogenannte Stratosphärenwolken. An der Oberfläche dieser Wolken finden chemische Prozesse statt, die einen Abbau des Ozons zur Folge haben. Langfristig erwarten die Forscher weiter sinkende Temperaturen in der Stratosphäre als Folge des Klimawandels: Während steigende Treibhausgas- Konzentrationen in den bodennahen Schichten einen Anstieg der Temperatur zur Folge haben, führen sie in der Stratosphäre zu einer Abkühlung, erläutert Sinnhuber. Seit der Aushandlung des Montreal-Abkommens in den späten 1980er Jahren ist die Emission von ozonzerstörenden chlorund bromhaltigen Chemikalien, wie etwa Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), verboten. Doch diese Substanzen sind langlebig und noch immer in der Atmosphäre zu finden. Ist es über längere Zeit extrem kalt, entfalten sie ihre Wirkung besonders effektiv. So zeigten die Messungen der Forscher, dass etwa die Hälfte des Ozons in dem extrem kalten Winter 2015/16 zerstört wurde. Aus der deutlich kälteren Antarktis kennt man diese Prozesse gut, in der Arktis sind sie aber selten. Haben die Forscher rein zufällig ein besonders kaltes Ausnahmejahr erwischt? Oder treten solche Extreme häufiger auf? Und welche Auswirkungen haben die gemessenen Veränderungen? Noch warten diese Fragen auf eine Antwort. Die zugrundeliegenden chemischen Vorgänge verstehen wir bereits ganz gut, sagt Sinnhuber. Uns interessiert jetzt vor allem: Was ist der Klimaeffekt dieser Veränderungen? Um das herauszufinden, speisen die Forscher die Messdaten in Klimamodelle ein und simulieren so mögliche Folgen. Fest steht schon jetzt: Die Auswirkungen der arktischen Prozesse sind weithin spürbar. Denn die Luft aus der Arktis strömt auch in Bereiche mittlerer Breiten und beeinflusst das dortige Klima also etwa in Mitteleuropa. Das GLORIA-Team bei der Arbeit im Hangar. GLORIA ist unterhalb des Flugzeugrumpfes montiert. (Foto: Björn-Martin Sinnhuber) WEITERE INFOS: 4
5 MENSCHEN das KIT zu wechseln: Ich sehe dadurch viele Möglichkeiten, mich inhaltlich und methodisch gut zu vernetzen. (Foto: Prof. Dr. Johannes Orphal Prof. Dr. Johannes Orphal ist Träger des diesjährigen Gentner- Kastler-Preises, den die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Société Françáise de Physique verleihen jährlich wechselnd an deutsche bzw. französische Physiker. Der Preis erinnert an den Deutschen Wolfgang Gentner und den Franzosen Alfred Kastler, zwei herausragende Physiker, die sich nach dem zweiten Weltkrieg um die Zusammenarbeit Frankreichs und Deutschlands in der physikalischen Forschung verdient gemacht haben. Die Verleihung des Preises an mich hat mich demütig und dankbar gemacht, sagt Orphal, der am KIT das Institut für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Spurengase und Fernerkundung leitet: Ich werde die Auszeichnung nutzen, um die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich im Bereich der Atmosphärenforschung weiter voranzutreiben. KIT-Zentrum Klima und Umwelt Wiss. Sprecher: Stellv. Wiss. Sprecher: Sprecher Topic 1: Sprecher Topic 2: Sprecher Topic 3: Sprecher Topic 4: Sprecher Topic 5: Sprecher Topic 6: (Foto: Prof. Dr. Joaquim Pinto Prof. Dr. Joaquim Pinto hat 2016 die AXA-Stiftungsprofessur für Meteorologie am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Department Troposphärenforschung, übernommen. Ziel ist die systematischen Bewertung von Extremwetterereignissen und den damit verbundenen Risiken in Europa vor dem Hintergrund des Klimawandels, sagt der Meteorologe. Dafür arbeiten Pinto und sein Team sowohl mit Beobachtungsdaten als auch mit Computermodellen: Wir wollen herausfinden, ob und wie sich Wettergefahren in unterschiedlichen Regionen Europas in den kommenden Jahrzehnten verändern können. Das ist auch im Interesse von Versicherungsgesellschaften: Die AXA-Mittel erhöhen unsere Schlagkraft enorm bei vollständiger wissenschaftlicher Unabhängigkeit, freut sich Pinto über das Engagement des international tätigen Versicherungskonzerns. Prof. Dr. Frank Schilling Prof. Dr. Thomas Leisner (Foto: Prof. Dr. Jan Cermak Prof. Dr. Jan Cermak klammert. Das heißt aber nicht, dass er an etwas besonders stark hängt und nicht loslassen kann. Cermak klammert vielmehr in dem Sinne, dass er die beiden Standorte des KIT, den Campus Nord und den Campus Süd, in seiner Arbeit intensiv verbindet: Im Frühjahr hat er die Professur für Geophysikalische Fernerkundung angetreten, die sowohl am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF, Campus Süd) als auch am Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK-ASF, Campus Nord) angesiedelt ist. Die Finanzierung des Lehrstuhls läuft über die Integrationsinitiative, deren Ziel es ist genau solche Klammern zwischen den beiden Standorten des KIT aufzubauen. Das kommt meiner Forschung sehr entgegen, sagt Cermak, und war für mich auch ein ausschlaggebender Grund, von der Ruhr-Universität Bochum an Atmosphäre und Klima: Prof. Dr. Thomas Leisner Wasser: Prof. Dr.-Ing. Franz Nestmann Georessourcen: Prof. Dr. Philipp Blum Ökosysteme: Prof. Dr. Almut Arneth Urbane Systeme und Stoffstrommanagement: Prof. Dr. Stefan Emeis Naturgefahren und Risikomanagement: PD Dr. Michael Kunz Inhaltlich geht es bei Cermaks Arbeit in erster Linie um Wolken. Cermak: Wir untersuchen einerseits die meteorologischen Bedingungen, unter denen sich Wolken bilden, und andererseits, wie Wolken und ihre Eigenschaften räumlich und zeitlich variieren. Dabei verwenden wir vorwiegend Satellitendaten. Einen starken Einfluss auf Wolken haben beispielsweise winzige Stoffpartikel, sogenannte Aerosole. Teilweise entstehen sie durch menschliche Aktivitäten, beispielsweise Autoverkehr oder industrielle Verbrennungsprozesse, teilweise gelangen sie ohne menschliches Zutun in die Luft, z.b. aus Vegetation oder durch Auswehungen. An Aerosolen kondensiert Wasserdampf in der Atmosphäre zu Tropfen. Ein hoher Aerosolgehalt in der Luft kann bewirken, dass sich viele kleine anstatt weniger großer Tropfen bilden, sagt Cermak: Kleine Tropfen reflektieren das Sonnenlicht aber besonders gut. Uns interessiert, welchen Einfluss dies auf die Temperatur der Erde hat. Um solche und ähnliche Fragestellungen bearbeiten zu können, greifen Cermak und sein Team auf Daten zurück, die sie an Messstationen in Deutschland, Portugal und Namibia sowie mithilfe von Satelliten gewinnen. Das KIT bietet dafür technisch beste Voraussetzungen, so Cermak: Und ich finde hier viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich inhaltlich und methodisch austauschen kann sowie Studierende, die sich in unsere Forschung mit Bachelor- und Masterarbeiten einbringen können. Hier kommt alles ideal zusammen. Gute Gründe also zu klammern. 5
6 DIREKT ANGESPROCHEN Klimawandel: Das Interesse an wissenschaftlichen Fakten ist da! von Prof. Peter Braesicke Zeitungen, Fernsehen, Radio: Alle damals relevanten Medien malten in den 1980er- und auch noch in den 1990er-Jahren Horrorszenarien an die Wand: Die Ozonschicht, unser lebensrettender Schutzschirm vor schädlicher UV-Strahlung aus dem Weltall, löst sich auf! Heute kommt das Ozonloch kaum noch als mediales Thema vor, zumindest nicht als Schlagzeile auf Seite 1. Das liegt nicht an der vermeintlichen Kurzatmigkeit der Medien. Vielmehr hat sich beim Schutz der Ozonschicht in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Die Vergrößerung des Ozonlochs in den 1980er Jahren war rasant und tatsächlich Besorgnis erregend: Atmosphärenforscher stellten fest, dass sich über dem Südpol die Ozonkonzentration im antarktischen Frühling stark verringert. Die davon betroffene Fläche nahm schnell zu. Die Erforschung dieses Phänomens machte aber ebenso schnell Fortschritte, und schon bald zeichnete sich ab, dass chemische Substanzen, zu denen auch die Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKWs) gehören, zweifelsfrei seine Verursacher sind. Diese klare Faktenlage machte es möglich, innerhalb weniger Jahre eine internationale Allianz zu schmieden und bereits 1987 das Montrealer Protokoll zu verabschieden: Die unterzeichnenden Staaten verpflichteten sich, Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Ozonschicht zu gewährleisten, und beispielsweise die Produktion der FCKWs zu beenden. Heute sehen wir nun die Erfolge dieser gemeinschaftlichen Anstrengungen. Die Konzentration der ozonabbauenden Substanzen in der Atmosphäre hat deutlich abgenommen. Das Ozonloch stagniert und die Ozonschicht fängt langsam an sich zu erholen. Mitte des Jahrhunderts dürften die Ozonwerte wieder mit denen der frühen 1980er-Jahre vergleichbar sein. Das zeigt, dass Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft durchaus in der Lage sind, in einer für den ganzen Planeten lebenswichtigen Frage gemeinsam das Ruder herumzureißen. Als Berufsoptimist meine ich: Das kann auch beim Klimawandel gelingen wenn wir vom Vorgehen beim Ozonloch lernen. Total-Ozonsäule im September 2016 Die ECMWF Reanalyse des September 2016 Ozonlochs. (Abbildung: P. Braesicke, KIT) Was können wir konkret aus diesem Fallbeispiel für das viel größere Thema Klimawandel ableiten? Zunächst müssen die Probleme auf ein Maß heruntergebrochen werden, das für die Menschen erträglich ist. Beim Ozonloch war das relativ leicht: Verursacher war eine definierte Substanzgruppe, die von einer relativ kleinen Industrie produziert wurde und die in vergleichsweise geschlossenen Stoffkreisläufen zum Einsatz kam. Beim Klimawandel und seinem hauptsächlichen Verursacher Kohlenstoffdioxid ist die Lage vertrackter. CO 2 entsteht bei fast allen Wirtschaftsaktivitäten; jeder ist Mitverursacher. Politisch müssen wir deshalb zunächst an die großen CO 2-Quellen ran beispielsweise Kohlekraftwerke, um sichtbare Erfolge zu erzielen. Zum anderen muss es den Menschen leichter gemacht werden, im täglichen Leben CO 2 einzusparen. Der Individualverkehr ist dafür ein mögliches Betätigungsfeld, aber auch die Art und Weise, wie wir konsumieren. Verzicht ist vielleicht manchmal nötig, etwa bei Fernreisen mit dem Flugzeug. Aber mit einer intelligenteren Nutzung von Ressourcen können wir trotzdem so manchen lieb gewonnenen Luxus behalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Komplexität: Wir müssen die vielschichtigen Klimaprozesse noch besser verstehen. Das ist beim Thema Ozonloch gut gelungen. Dort hatte die abnehmende Ozonkonzentration über der Antarktis einen überraschenden Einfluss auf die Temperaturen. Die antark- tische Halbinsel hat sich stark erwärmt, während sich große Teile der inneren Arktis abgekühlt haben und nicht mit dem Klimawandel wärmer wurden. Diesen Effekt können wir mittlerweile sehr gut erklären. Er hat deutlich gemacht, dass die Dinge nicht so einfach liegen, wie wir das manchmal zunächst vermuten. Im Gegenteil Überraschungen sind die Regel. Aber wir sind in der Lage, solche unvorhergesehenen Ereignisse zu analysieren und lernen dabei immer etwas über das Gesamtsystem. Wir müssen unsere Erkenntnisse zum komplexen System Klima wirksam, also gut verständlich, kommunizieren. Und generell müssen wir Verständnis für Komplexität wecken. Meine Erfahrung ist: Die Menschen auf der Straße interessieren sich dafür, wenn wir Wissenschaftler mit ihnen über solche Vorgänge und wissenschaftlichen Ergebnisse sprechen. Wir müssen rausgehen aus den Instituten auf die Straße dann wird uns diese Aufgabe auch beim Thema Klimawandel gelingen. Genauso wichtig wie die fachfremden Laien sind Politiker. Auch sie sind zwar meist Laien, stellen aber die Weichen in die Zukunft. Mit Blick auf diese Zielgruppe kann ich mit den Erfahrungen vom Montreal-Protokoll ebenfalls sagen, dass das Interesse da ist: Bei der wissenschaftlichen Analyse des Ozonstatus, die in Form des alle vier Jahre herausgegebenen Reports Scientific Assessment of Ozone Depletion dokumentiert wird, erlebe ich es als Mitautor des Reports selbst immer wieder, dass die Erstellung dieses Papiers von der Politik aktiv begleitet wird. Auch im Nachgang führt der Report zu angeregten und konstruktiven Diskussionen. Auch hier kann man also festhalten, dass die meisten Politiker sich der Problematik und des Handlungsbedarfs bewusst sind. Deshalb lautet mein Fazit: Wir müssen die Laien mitnehmen auf die Reise zu einem stabilen Klima! Das Interesse daran ist da. Wir müssen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlich kommunizieren. Dann kann es gelingen, nicht nur die Ozonschicht, sondern das ganze Klima zu retten. 6
7 IN KÜRZE Campus Alpin des KIT tritt Bayerischer Klima-Allianz bei Mit einem Festakt und in Anwesenheit von der bayerischen Umweltministerin, Ulrike Scharf, und des Bereichsleiters IV Natürliche und gebaute Umwelt des KIT, Dr.Ing. Karl-Friedrich Ziegahn, ist das Institut für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Umweltforschung (IMK-IFU) in Garmisch-Partenkirchen am 3. Februar 2017 der Bayerischen Klimaallianz beigetreten. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren baye-rischen Partnern will das Bündnis das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz stärken, z.b. durch Informationsbereitstellung und Aktionen im Sinne eines nachhaltigen Klimaschutzes. Durch ihre wissenschaftlichen Untersuchungen im Zusammenspiel von Klima, Vegetation, Böden und Wasserverfügbarkeit können sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Campus Alpin des KIT als Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis in die Klima- Allianz einbringen. Prof. Hans-Peter Schmid (IMK-IFU, KIT), Frau Ulrike Scharf MdL (Bayerische Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz) und Dr.-Ing. Karl-Friedrich Ziegahn (KIT Bereichsleiter IV) bei der Unterzeichnung der Vereinbarung am (Foto: Marco Schmidt) Peter Braesicke neuer Chair der European Climate Research Alliance ECRA Bei der Sitzung des ECRA Executive Committees Anfang März wurde Prof. Peter Braesicke vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Spurenstoffe und Fernerkundung (IMK-ASF) des KIT zum Chair von ECRA gewählt. Er folgt damit Frau Prof. Lochte (AWI), die diese Position in den vergangenen Jahren innehatte. ECRA ist eine europäische Plattform zum Wissens- und Informationsaustausch für Wissenschaftler, die sich hauptsächlich mit der Erfassung des Klimawandels sowie dessen Auswirkungen auf die Umwelt beschäftigen. Wir gratulieren Herrn Braesicke herzlich. Wolken und Sturmzugbahnen Welche Rolle spielen Wolken für die atmosphärische Zirkulation der mittleren Breiten, und welche Auswirkungen hat das Zusammenspiel von Wolken und Zirkulation auf den regionalen Klimawandel? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die BMBF Nachwuchsgruppe von Dr. Aiko Voigt am Meteorologie und Klimaforschung Department Troposphäre (IMK-TRO) des KIT seit Ende In dem auf fünf Jahre angelegten Projekt werden vor allem Wolkenstrahlungswechselwirkungen untersucht. Geographisch liegt dabei ein besonderes Schwerpunkt auf der nordatlantischen Region. Die Nachwuchsgruppe ist Teil des deutschlandweiten Forschungsprojekts HD(CP)2: High Definition Clouds and Precipitation for Advancing Climate Prediction und wird massgeblich vom BMBF und FONA unterstützt. Wälder im Hitzestress Hitzewellen bringen oft auch große Trockenheit mit sich. Der Kohlenstoff- und Wasserkreislauf der Wälder wird beeinträchtigt. Mit diesem erfüllen die Wälder aber eine wichtige Aufgabe bei der Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels. Je ausgeprägter die Hitze und die Trockenheit, umso länger dauert der Regenerationsprozess der Wälder. Wie wirkt sich eine Abnahme der Regenerationsfähigkeit der Wälder auf den Kohlenstoff- und Wasserkreislauf und damit letztlich auf die Erderwärmung aus? Welches sind die zugrundliegenden Prozesse bei Bäumen und Wäldern? Diesen Fragen widmet sich die Emmy-Noether- Nachwuchsgruppe um Frau Dr. Nadine Rühr am IMK-IFU des KIT, die im Herbst 2016 gestartet ist, mit einem integrativen Ansatz durch die Kopplung von Experimenten mit Modellierung von der Zelle bis zum Ökosystem. Kiefern- Wäldern im Gewächshaus in Garmisch (Foto: N. Rühr) 7
8 KIT-GRACE Mit GRACE ans andere Ende der Welt Die Graduiertenschule GRACE ist aus dem KIT-Zentrum Klima und Umwelt (ZKU) nicht mehr wegzudenken. Werbung braucht es längst nicht mehr: Bei Forschungsanträgen aus dem ZKU wird mit GRACE selbst für die Qualität der Doktorandenausbildung geworben. Der hohe Stellenwert der Graduiertenschule zeigt sich auch in der Bereitschaft des KIT-Präsidiums, eine Übergangsfinanzierung für die Jahre 2018 bis 2020 zu gewährleisten. Grund genug für einen Blick nach vorn: Und wie geht es inhaltlich weiter? Wir wollen in den kommenden Jahren GRACE noch internationaler ausrichten und uns auch verstärkt um Kooperationen mit anderen Graduiertenschulen bemühen, sagt Andreas Schenk, wissenschaftlicher Koordinator von GRACE. Erster Erfolg: die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen der australischen University of Melbourne und dem KIT. Wir entwickeln derzeit ein Cotutelle- Verfahren, das den Doktoranden künftig einen Doppelabschluss an beiden Universitäten ermöglicht. Bereits Ende dieses Jahres werden zwei Doktoranden von Karlsruhe nach Australien aufbrechen. Finanziert wird der dreimonatige Forschungsaufenthalt, mit dem auch die bereits bestehenden Kontakte gestärkt werden sollen, vom Karlsruhe House of Young Scientists (KHYS). Auch Interdisziplinarität wird bei GRACE weiterhin eine große Rolle spielen. Auch in diesem Jahr richten wir eine Sommerschule aus, die unter dem Thema Future Cities Research for a Sustainable Urban Development Nachwuchswissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammenbringt von den Ingenieurs- bis zu den Sozialwissenschaften, sagt Schenk. Prof. Dr. Dick Strugnell von der University of Melbourne (sitzend) und Prof. Dr. Alexander Wanner, Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten am KIT, unterzeichnen die Cotutelle-Vereinbarung. Einer der Höhepunkte der fünftägigen Sommer School zwischen dem 17. und 21. Juli ist das Trifelser Gespräch. Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft werden über das Thema zukunftsorientierte Mobilität zwischen Stadt und Umland diskutieren. Wer dabei sein will, kann sich unter anmelden. WEITERE INFOS: Wie umweltfreundlich ist die Tiefengeothermie? Impressum Herausgeber: Karlsruher Institut für Technologie Kaiserstr Karlsruhe Redaktion: Koordination: Dr. Kirsten Hennrich (kirsten.hennrich@kit.edu) Gestaltung, Layout: Druck: dieumweltdruckerei GmbH, Hannover Download als PDF (dt./engl.) unter Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft Campus Nord Hermann-von-Helmholtz-Platz Eggenstein-Leopoldshafen In Zukunft könnten Geothermieanlagen in Puncto Umweltfreundlichkeit besser abschneiden als die meisten anderen Erneuerbaren. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler um Philipp Blum vom Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) am KIT, nachdem sie den Lebenszyklus der tiefen Geothermie untersucht haben. Noch gibt es weltweit nur wenige kommerziell genutzte Geothermieanlagen mit der so genannten EGS-Technologie (Enhanced Geothermal Systems). Schätzungen zufolge könnte die EGS-Technologie bis 2050 aber 8,3 Prozent des weltweiten Energiebedarfs liefern., so Blum. Das CO 2-Einsparpotenzial ist somit erheblich doch in welchem Verhältnis steht es zu den Umweltbelastungen, die beim Bau und beim späteren Betrieb der Anlagen entstehen? Das lässt sich über sogenannte Lebenszyklusanalysen herausfinden. Solche Untersuchungen wurden bisher nur vereinzelt durchgeführt und nun von Blum und seinem Team unter allgemein geltenden Kriterien neu bewertet. Ergebnis: Im Hinblick auf die Umweltfreundlichkeit ist durchaus großes Verbesserungspotenzial vorhanden. Würde man etwa beim Bohren der zu- und abführenden Wasserleitungen statt mit Dieselantrieb mit Elektrobohrern arbeiten, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden, ließe sich die Lebenszyklus- Bilanz erheblich verbessern, so die an der Studie beteiligten Wissenschaftler. Die zukünftige Weiterentwicklung der Bohrtechnologien lasse erwarten, dass die Geothermie eines Tages auch zur Grundlastversorgung beitragen kann. K. Menberg, S. Pfister, P. Blum, P. Bayer: A matter of meters: state of the art in the life cycle assessment of enhanced geothermal systems. Energy & Environmental Science, 6, 9, DOI: / c6ee01043a Campus Süd Kaiserstraße Karlsruhe KIT-Zentrum Klima und Umwelt, Geschäftsstelle Telefon Juli 2017 Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit Druckfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe, ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel 8
Themenfelder zum Klimawandel
 Themenfelder zum Klimawandel Verändert der Mensch das Klima oder die Sonne? Was sind Ursachen von Klimaänderungen? Wie sieht eine Erwärmung durch die Sonne aus? Wie sieht das Muster der Erwärmung durch
Themenfelder zum Klimawandel Verändert der Mensch das Klima oder die Sonne? Was sind Ursachen von Klimaänderungen? Wie sieht eine Erwärmung durch die Sonne aus? Wie sieht das Muster der Erwärmung durch
Das Ozonloch. Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre Universität Mainz
 Das Ozonloch Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre Universität Mainz Nobelpreis 1995 für Chemie Crutzen - Molina - Rowland Physik und Meteorologie an der Uni Mainz Fachbereich für Physik, Mathematik
Das Ozonloch Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre Universität Mainz Nobelpreis 1995 für Chemie Crutzen - Molina - Rowland Physik und Meteorologie an der Uni Mainz Fachbereich für Physik, Mathematik
Tag der offenen Tür in Garmisch-Partenkirchen
 Tag der offenen Tür in Garmisch-Partenkirchen Atmosphärische Umweltforschung des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung in Garmisch-Partenkirchen feiert 60-jähriges Bestehen mit Festakt am 18. Juli
Tag der offenen Tür in Garmisch-Partenkirchen Atmosphärische Umweltforschung des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung in Garmisch-Partenkirchen feiert 60-jähriges Bestehen mit Festakt am 18. Juli
Klimawandel und die globale Ozonschicht Sonnenbrand oder Vitamin-D-Mangel? Hella Garny DLR Oberpfaffenhofen
 Klimawandel und die globale Ozonschicht Sonnenbrand oder Vitamin-D-Mangel? Hella Garny DLR Oberpfaffenhofen Verschiedenste Prozesse beeinflussen das Klima Der Klimawandel beeinflusst das Leben auf der
Klimawandel und die globale Ozonschicht Sonnenbrand oder Vitamin-D-Mangel? Hella Garny DLR Oberpfaffenhofen Verschiedenste Prozesse beeinflussen das Klima Der Klimawandel beeinflusst das Leben auf der
Geografie, D. Langhamer. Klimarisiken. Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes. Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf.
 Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Klimawandel und Ozonloch
 Klimawandel und Ozonloch Über die Einflüsse der Sonne und menschlicher Aktivitäten auf Veränderungen des Erdklimas Prof. Dr. Martin Dameris Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen Aufbau
Klimawandel und Ozonloch Über die Einflüsse der Sonne und menschlicher Aktivitäten auf Veränderungen des Erdklimas Prof. Dr. Martin Dameris Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen Aufbau
Klimaforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft
 08.-09. Oktober 2013 LMU München Klimaforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Helmholtz
08.-09. Oktober 2013 LMU München Klimaforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Helmholtz
Ergebnisse aus der Klimaforschung: eine Brücke zur kommunalen Praxis
 Ergebnisse aus der Klimaforschung: eine Brücke zur kommunalen Praxis Dr. Hans Schipper SÜDDEUTSCHES KLIMABÜRO / INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG Fotos: Boris Lehner für HLRS Hans Schipper KIT
Ergebnisse aus der Klimaforschung: eine Brücke zur kommunalen Praxis Dr. Hans Schipper SÜDDEUTSCHES KLIMABÜRO / INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG Fotos: Boris Lehner für HLRS Hans Schipper KIT
Begrüßungsrede. von. Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion. Selbstverbrennung oder Transformation.
 Begrüßungsrede von Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion Selbstverbrennung oder Transformation. Mit Kunst und Kultur aus der Klimakrise? am 15. Juli, in
Begrüßungsrede von Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion Selbstverbrennung oder Transformation. Mit Kunst und Kultur aus der Klimakrise? am 15. Juli, in
Weiterbildungsveranstaltung Arktische Klimaänderung Mo Uhr, Talstr. 35, Hörsaal 1
 Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.v. Sektion Mitteldeutschland Leipziger Institut für Meteorologie LIM Stephanstr. 3, 04103 Leipzig Weiterbildungsveranstaltung Arktische Klimaänderung Mo. 12.12.2016
Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.v. Sektion Mitteldeutschland Leipziger Institut für Meteorologie LIM Stephanstr. 3, 04103 Leipzig Weiterbildungsveranstaltung Arktische Klimaänderung Mo. 12.12.2016
Auswirkungen des KlimawandelsIS
 Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
SamstagsUni Münchenstein, Klimawandel in der Schweiz: Die wichtigsten Veränderungen und was sie bewirken Erich Fischer, Dr.
 SamstagsUni Münchenstein, 02.09.2017 Klimawandel in der Schweiz: Die wichtigsten Veränderungen und was sie bewirken Erich Fischer, Dr. Zusammenfassung Die Rekorde purzeln, 2015 und 2016 waren die mit Abstand
SamstagsUni Münchenstein, 02.09.2017 Klimawandel in der Schweiz: Die wichtigsten Veränderungen und was sie bewirken Erich Fischer, Dr. Zusammenfassung Die Rekorde purzeln, 2015 und 2016 waren die mit Abstand
Deutscher Wetterdienst zur klimatologischen Einordnung des Winters 2012/13 Durchschnittlicher Winter und kalter März widerlegen keine Klimatrends
 Deutscher Wetterdienst zur klimatologischen Einordnung des Winters 2012/13 Durchschnittlicher Winter und kalter März widerlegen keine Klimatrends Offenbach, 12. April 2013 Der Winter 2012/2013 erreichte
Deutscher Wetterdienst zur klimatologischen Einordnung des Winters 2012/13 Durchschnittlicher Winter und kalter März widerlegen keine Klimatrends Offenbach, 12. April 2013 Der Winter 2012/2013 erreichte
Prof. Dr. Frank-Michael Chmielewski
 Prof. Dr. Frank-Michael Chmielewski studierte nach seiner Ausbildung zum Technischen Assistenten für Meteorologie von 1982 bis 1987 Meteorologie an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), wo er 1990 über
Prof. Dr. Frank-Michael Chmielewski studierte nach seiner Ausbildung zum Technischen Assistenten für Meteorologie von 1982 bis 1987 Meteorologie an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), wo er 1990 über
Klimawandel: Herausforderung des Jahrhunderts. Senioren-Universität Luzern. Thomas Stocker
 Senioren-Universität Luzern Klimawandel: Herausforderung des Jahrhunderts Thomas Stocker Physikalisches Institut Oeschger Zentrum für Klimaforschung Universität Bern Senioren-Universität Luzern 1. Klimaforschung
Senioren-Universität Luzern Klimawandel: Herausforderung des Jahrhunderts Thomas Stocker Physikalisches Institut Oeschger Zentrum für Klimaforschung Universität Bern Senioren-Universität Luzern 1. Klimaforschung
Das Erdwärme-Projekt der Stadt St.Gallen: Vergleich der Methoden
 Das Erdwärme-Projekt der Stadt St.Gallen: Vergleich der Methoden 3 Erdwärme ist die nachhaltige und zukunftsträchtige Energie aus dem Erdinnern. Es gibt zwei Methoden, tiefe Erdwärme nutzbar zu machen.
Das Erdwärme-Projekt der Stadt St.Gallen: Vergleich der Methoden 3 Erdwärme ist die nachhaltige und zukunftsträchtige Energie aus dem Erdinnern. Es gibt zwei Methoden, tiefe Erdwärme nutzbar zu machen.
Zusatzstation: Klimalexikon Anleitung
 Anleitung Die Lexikonkarten liegen verdeckt vor euch. Mischt die Karten. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Lest die Begriffe auf den Karten. Erklärt die Begriffe euren Mitspielern mit Hilfe des Bildes.
Anleitung Die Lexikonkarten liegen verdeckt vor euch. Mischt die Karten. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Lest die Begriffe auf den Karten. Erklärt die Begriffe euren Mitspielern mit Hilfe des Bildes.
Klimawandel: globale Ursache, regionale Folgen
 Klimawandel: globale Ursache, regionale Folgen Dr. Hans Schipper SÜDDEUTSCHES KLIMABÜRO / INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG Fotos: Boris Lehner für HLRS Hans Schipper KIT Die Forschungsuniversität
Klimawandel: globale Ursache, regionale Folgen Dr. Hans Schipper SÜDDEUTSCHES KLIMABÜRO / INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG Fotos: Boris Lehner für HLRS Hans Schipper KIT Die Forschungsuniversität
Start für das Helmholtz-Institut Ulm
 Nr.006 lg 17.01.2011 Start für das Helmholtz-Institut Ulm Neue Batterietechnologien sind Ziel der Forschungseinrichtung des Karlsruher Instituts für Technologie in Kooperation mit der Universität Ulm Feierlicher
Nr.006 lg 17.01.2011 Start für das Helmholtz-Institut Ulm Neue Batterietechnologien sind Ziel der Forschungseinrichtung des Karlsruher Instituts für Technologie in Kooperation mit der Universität Ulm Feierlicher
Anthropogener Klimawandel - Grundlagen, Fakten, Projektionen
 Anthropogener Klimawandel - Grundlagen, Fakten, Projektionen Dr. Stephan Bakan stephan.bakan@zmaw.de Max-Planck-Institut für Meteorologie KlimaCampus Hamburg Vortrag: Jens Sander, Tornesch, 22.8.2011 Dr.
Anthropogener Klimawandel - Grundlagen, Fakten, Projektionen Dr. Stephan Bakan stephan.bakan@zmaw.de Max-Planck-Institut für Meteorologie KlimaCampus Hamburg Vortrag: Jens Sander, Tornesch, 22.8.2011 Dr.
Fernerkundung der Erdatmosphäre
 Fernerkundung der Erdatmosphäre Dr. Dietrich Feist Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena Max Planck Institut für Biogeochemie Foto: Michael Hielscher Max Planck Institut für
Fernerkundung der Erdatmosphäre Dr. Dietrich Feist Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena Max Planck Institut für Biogeochemie Foto: Michael Hielscher Max Planck Institut für
Wasser und Energie für alle
 Wasser und Energie für alle Jeder 6. Mensch auf der Welt hat keinen Zugang zu Strom. Jeder 4. Mensch auf der Welt hat kein sauberes Trinkwasser. Das ist eine große Gefahr für die Gesundheit. Vor allem
Wasser und Energie für alle Jeder 6. Mensch auf der Welt hat keinen Zugang zu Strom. Jeder 4. Mensch auf der Welt hat kein sauberes Trinkwasser. Das ist eine große Gefahr für die Gesundheit. Vor allem
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klassenarbeit: Klimawandel, Klimaschutz, ökologisches Wirtschaften (erhöhtes Niveau) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klassenarbeit: Klimawandel, Klimaschutz, ökologisches Wirtschaften (erhöhtes Niveau) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Inhalt. Der blaue Planet und seine Geozonen Vorwort
 Inhalt Vorwort Der blaue Planet und seine Geozonen... 1 1 Atmosphärische Grundlagen... 1 1.1 Die Erdatmosphäre Bedeutung, Aufbau, Zusammensetzung... 1 1.2 Globale Beleuchtungsverhältnisse, Strahlungs-
Inhalt Vorwort Der blaue Planet und seine Geozonen... 1 1 Atmosphärische Grundlagen... 1 1.1 Die Erdatmosphäre Bedeutung, Aufbau, Zusammensetzung... 1 1.2 Globale Beleuchtungsverhältnisse, Strahlungs-
Vereinigung Europäischer Journalisten e.v.
 Vereinigung Europäischer Journalisten e.v. Die Antarktis erleben Polar-Ausstellung im Innenhof des Deutschen Museums Wo schläft man während einer Polarexpedition? Wie fühlt sich Kleidung an, die selbst
Vereinigung Europäischer Journalisten e.v. Die Antarktis erleben Polar-Ausstellung im Innenhof des Deutschen Museums Wo schläft man während einer Polarexpedition? Wie fühlt sich Kleidung an, die selbst
Geschichte der Kältemittel gefährlich, umweltbelastend, aber damit innovationstreibend
 1 Geschichte der Kältemittel gefährlich, umweltbelastend, aber damit innovationstreibend Helmut Lotz Vortrag anlässlich der Historikertagung 2015 Gemeinschaftsveranstaltung des HKK und der DKV Senioren
1 Geschichte der Kältemittel gefährlich, umweltbelastend, aber damit innovationstreibend Helmut Lotz Vortrag anlässlich der Historikertagung 2015 Gemeinschaftsveranstaltung des HKK und der DKV Senioren
Das Klima der Welt. 02a / Klimawandel
 02a / Klimawandel Die Klimageschichte beginnt mit der Entstehung der Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Im Anfangsstadium der Erde kurz nach der Entstehung betrug die bodennahe Temperatur etwa 180 C.
02a / Klimawandel Die Klimageschichte beginnt mit der Entstehung der Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Im Anfangsstadium der Erde kurz nach der Entstehung betrug die bodennahe Temperatur etwa 180 C.
Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung
 Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung Irene Roth Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern Ittigen, Mai 2010 Inhalt 1) Einige Fakten zum Klimawandel 2) Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung
Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung Irene Roth Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern Ittigen, Mai 2010 Inhalt 1) Einige Fakten zum Klimawandel 2) Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung
Das Ende der Eis-Zeit?
 Das Ende der Eis-Zeit? Dr. Dirk Notz Max Planck Institut für Meteorologie 13. Juni 2017 September 1979 NASA September 2005 NASA September 2007 NASA September 2012 NASA September 20xx?? Überblick 1 Die
Das Ende der Eis-Zeit? Dr. Dirk Notz Max Planck Institut für Meteorologie 13. Juni 2017 September 1979 NASA September 2005 NASA September 2007 NASA September 2012 NASA September 20xx?? Überblick 1 Die
Das Netzwerk der Regionalen Helmholtz Klimabüros. Andreas Marx
 Das Netzwerk der Regionalen Helmholtz Klimabüros Andreas Marx Klima konkret, IHK Potsdam, 27.06.2013 1 Helmholtz-Mission Weil wir in mehreren Helmholtz-Zentren zum Klimawandel, zur Landnutzung, zum Wassermanagement
Das Netzwerk der Regionalen Helmholtz Klimabüros Andreas Marx Klima konkret, IHK Potsdam, 27.06.2013 1 Helmholtz-Mission Weil wir in mehreren Helmholtz-Zentren zum Klimawandel, zur Landnutzung, zum Wassermanagement
Klimawandel in Sachsen
 Klimawandel in Sachsen Informationsveranstaltung am 05.09.2007 Trend der global gemittelten Lufttemperatur 0,8 2005 war wärmstes Jahr seit über einem Jahrhundert US-Raumfahrtorganisation NASA / Referenz
Klimawandel in Sachsen Informationsveranstaltung am 05.09.2007 Trend der global gemittelten Lufttemperatur 0,8 2005 war wärmstes Jahr seit über einem Jahrhundert US-Raumfahrtorganisation NASA / Referenz
Tagungsdokumentation XI. Potsdamer BK-Tage 2016
 Sehr verehrte Frau Golze, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Unfallversicherungsträgern, Herzlich Willkommen zu den diesjährigen XI. Potsdamer BK-Tagen. Technischer Fortschritt
Sehr verehrte Frau Golze, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Unfallversicherungsträgern, Herzlich Willkommen zu den diesjährigen XI. Potsdamer BK-Tagen. Technischer Fortschritt
Saisonales Wasserressourcen- Management in Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter globaler Informationen (SaWaM)
 Saisonales Wasserressourcen- Management in Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter globaler Informationen (SaWaM) Shushtar, Khuzestan- Iran Prof. Dr. Harald Kunstmann Warum SaWaM? Rückgang der
Saisonales Wasserressourcen- Management in Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter globaler Informationen (SaWaM) Shushtar, Khuzestan- Iran Prof. Dr. Harald Kunstmann Warum SaWaM? Rückgang der
Studium für umweltbewusste Bauingenieure
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/studium-fuerumweltbewusste-bauingenieure/ Studium für umweltbewusste Bauingenieure Umweltchemie, Ingenieurbiologie und Werkstofftechnologie
Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/studium-fuerumweltbewusste-bauingenieure/ Studium für umweltbewusste Bauingenieure Umweltchemie, Ingenieurbiologie und Werkstofftechnologie
Tiefengeothermie in Hessen. Johann-Gerhard Fritsche Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
 Tiefengeothermie in Hessen Johann-Gerhard Fritsche Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie Technisch-wissenschaftliche Umweltbehörde im Geschäftsbereich
Tiefengeothermie in Hessen Johann-Gerhard Fritsche Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie Technisch-wissenschaftliche Umweltbehörde im Geschäftsbereich
Helmholtz KatInfo Task Force Großschadenslagen
 Helmholtz KatInfo Task Force Großschadenslagen Florian Elmer, Tina Kunz-Plapp CENTER FOR DISASTER MANAGEMENT AND RISK REDUCTION TECHNOLOGY KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Helmholtz KatInfo Task Force Großschadenslagen Florian Elmer, Tina Kunz-Plapp CENTER FOR DISASTER MANAGEMENT AND RISK REDUCTION TECHNOLOGY KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Wieviel Asche spuckt ein Vulkan?
 Wieviel Asche spuckt ein Vulkan? Stefan Emeis stefan.emeis@kit.edu INSTITUT für METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG, Atmosphärische Umweltforschung KIT Universität des Landes Baden Württemberg und Nationales
Wieviel Asche spuckt ein Vulkan? Stefan Emeis stefan.emeis@kit.edu INSTITUT für METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG, Atmosphärische Umweltforschung KIT Universität des Landes Baden Württemberg und Nationales
Herzlich Willkommen an der Universität Karlsruhe
 Herzlich Willkommen an der Universität Karlsruhe Sandra Hertlein Assoc. Director, International Office 11 Fakultäten an der Universität Karlsruhe Mathematik Physik Chemie und Biologie Geistes -und Sozialwissenschaften
Herzlich Willkommen an der Universität Karlsruhe Sandra Hertlein Assoc. Director, International Office 11 Fakultäten an der Universität Karlsruhe Mathematik Physik Chemie und Biologie Geistes -und Sozialwissenschaften
Pressekonferenz von Hansestadt Hamburg und Deutschem Wetterdienst (DWD) am 20. November 2015 in Hamburg
 Pressekonferenz von Hansestadt Hamburg und Deutschem Wetterdienst (DWD) am 20. November 2015 in Hamburg Hamburg wird durch Klimawandel wärmer und nasser Erfolgreiche Anpassung an die Folgen der Klimaveränderung
Pressekonferenz von Hansestadt Hamburg und Deutschem Wetterdienst (DWD) am 20. November 2015 in Hamburg Hamburg wird durch Klimawandel wärmer und nasser Erfolgreiche Anpassung an die Folgen der Klimaveränderung
03a / Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Einführung: Die heutige Landwirtschaft und ihre Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit
 Einführung: Die heutige Landwirtschaft und ihre Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit INHALT 1) Über Syngenta 2) Was bedeutet Nachhaltigkeit? 3) Ressourcenknappheit 4) Biodiversität 5) Klimawandel
Einführung: Die heutige Landwirtschaft und ihre Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit INHALT 1) Über Syngenta 2) Was bedeutet Nachhaltigkeit? 3) Ressourcenknappheit 4) Biodiversität 5) Klimawandel
Eis- und Schneebedeckung im Klimasystem
 Experiment-Beschreibung Eis- und Schneebedeckung im Klimasystem Autor: Manuel Linsenmeier Mitarbeit: Tobias Bayr, Dietmar Dommenget, Anne Felsberg, Dieter Kasang Motivation Die Eisbedeckung der Erde erfährt
Experiment-Beschreibung Eis- und Schneebedeckung im Klimasystem Autor: Manuel Linsenmeier Mitarbeit: Tobias Bayr, Dietmar Dommenget, Anne Felsberg, Dieter Kasang Motivation Die Eisbedeckung der Erde erfährt
ERKLÄRUNG DER BUNDESSTAATEN UND REGIONALVERWALTUNGEN ZUM KLIMAWANDEL
 ERKLÄRUNG DER BUNDESSTAATEN UND REGIONALVERWALTUNGEN ZUM KLIMAWANDEL 1. Im Bewusstsein, dass der Klimawandel ein dringendes, globales Problem ist, das eine koordinierte, gemeinschaftliche Antwort zur Verringerung
ERKLÄRUNG DER BUNDESSTAATEN UND REGIONALVERWALTUNGEN ZUM KLIMAWANDEL 1. Im Bewusstsein, dass der Klimawandel ein dringendes, globales Problem ist, das eine koordinierte, gemeinschaftliche Antwort zur Verringerung
Klimawandel für Fussgänger
 Klimawandel für Fussgänger Prof. Dr. Harald Lesch Bayrischer Klimarat LMU München & Hochschule für Philosophie (SJ) Seit 1850 bis heute: Es wird wärmer! Abweichungen der Temperaturen im Jahr 2015 vom
Klimawandel für Fussgänger Prof. Dr. Harald Lesch Bayrischer Klimarat LMU München & Hochschule für Philosophie (SJ) Seit 1850 bis heute: Es wird wärmer! Abweichungen der Temperaturen im Jahr 2015 vom
Zukunftsprojekt Erde Verantwortung in einer globalen Welt im 21. Jahrhundert
 Zukunftsprojekt Erde Verantwortung in einer globalen Welt im 21. Jahrhundert Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Kick-off Veranstaltung zum
Zukunftsprojekt Erde Verantwortung in einer globalen Welt im 21. Jahrhundert Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Kick-off Veranstaltung zum
Spaß & Wissenschaft Fun Science Gemeinnütziger Verein zur wissenschaftlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen
 Spaß & Wissenschaft Fun Science Gemeinnütziger Verein zur wissenschaftlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen www.funscience.at info@funscience.at +43 1 943 08 42 Über uns Spaß & Wissenschaft - Fun
Spaß & Wissenschaft Fun Science Gemeinnütziger Verein zur wissenschaftlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen www.funscience.at info@funscience.at +43 1 943 08 42 Über uns Spaß & Wissenschaft - Fun
CO -Konzentration 2 April 2014
 CO 2 -Konzentration April 2014 CO 2 -Konzentration Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email: klimaagentur@tlug.thueringen.de Internet:
CO 2 -Konzentration April 2014 CO 2 -Konzentration Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email: klimaagentur@tlug.thueringen.de Internet:
Klimawandel Fakten aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft
 Klimawandel Fakten aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft Dipl.-Ing. Bernd Hausmann (LFI-RWTH) Inhalt Fakten zum Klimawandel Gründe für den Wandel Prognosen für die Zukunft - Wie ändert sich
Klimawandel Fakten aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft Dipl.-Ing. Bernd Hausmann (LFI-RWTH) Inhalt Fakten zum Klimawandel Gründe für den Wandel Prognosen für die Zukunft - Wie ändert sich
Die Visualisierung von klimatischen Kenngrößen für die Praxis
 Die Visualisierung von Dr. Hans Schipper SÜDDEUTSCHES KLIMABÜRO / INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Klimawandelanpassung.
Die Visualisierung von Dr. Hans Schipper SÜDDEUTSCHES KLIMABÜRO / INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMAFORSCHUNG KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Klimawandelanpassung.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Arktis und Antarktis - Leben und Forschen in der polaren Zone
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Arktis und Antarktis - Leben und Forschen in der polaren Zone Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de III Kultur-
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Arktis und Antarktis - Leben und Forschen in der polaren Zone Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de III Kultur-
Erfolgreiche Maßnahmen zur Energiewende bereiten den Weg in eine gute Zukunft.
 Sperrfrist: 26. Juni 2017, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung des Zentrums
Sperrfrist: 26. Juni 2017, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung des Zentrums
03a / Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Einführung: Die heutige Landwirtschaft und ihre Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit
 Einführung: Die heutige Landwirtschaft und ihre Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit INHALT 1) Über Syngenta 2) Was bedeutet Nachhaltigkeit? 3) Ressourcenknappheit 4) Biodiversität 5) Klimawandel
Einführung: Die heutige Landwirtschaft und ihre Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit INHALT 1) Über Syngenta 2) Was bedeutet Nachhaltigkeit? 3) Ressourcenknappheit 4) Biodiversität 5) Klimawandel
Klimawandel, sichere Energieversorgung und nachhaltige Mobilität- Herausforderungen für Tourismus
 Klimawandel, sichere Energieversorgung und nachhaltige Mobilität- Herausforderungen für Tourismus Prof. Dr. Claudia Kemfert DIW Berlin und Hertie School of Governance www.claudiakemfert.de Einige Fakten
Klimawandel, sichere Energieversorgung und nachhaltige Mobilität- Herausforderungen für Tourismus Prof. Dr. Claudia Kemfert DIW Berlin und Hertie School of Governance www.claudiakemfert.de Einige Fakten
3. Aufzählung von Folgen des Gletschersterbens
 www.planetschule.de Oberstufe (Z3) Natur und Technik Räume, Zeiten, Gesellschaften Ethik, Religionen, Gemeinschaft Regelunterricht, Projekttage Die Zukunftszenarien beschreiben den SuS die drohenden Gefahren
www.planetschule.de Oberstufe (Z3) Natur und Technik Räume, Zeiten, Gesellschaften Ethik, Religionen, Gemeinschaft Regelunterricht, Projekttage Die Zukunftszenarien beschreiben den SuS die drohenden Gefahren
Klimawandel in Hessen: Vergangenheit und Zukunft
 Klimawandel in Hessen: Vergangenheit und Zukunft Die Klimaänderungen der letzten 50-100 Jahre und die zu erwartenden Klimaänderungen im 21. Jahrhundert Christian-D. Schönwiese Institut für Atmosphäre und
Klimawandel in Hessen: Vergangenheit und Zukunft Die Klimaänderungen der letzten 50-100 Jahre und die zu erwartenden Klimaänderungen im 21. Jahrhundert Christian-D. Schönwiese Institut für Atmosphäre und
Klimawirkungen des Luftverkehrs
 Klimawirkungen des Luftverkehrs Ulrich Schumann DLR Oberpfaffenhofen Stand der Klimaforschung IPCC, 2007: Beobachtungen und Messungen lassen keinen Zweifel, dass das Klima sich ändert. Die globale Erwärmung
Klimawirkungen des Luftverkehrs Ulrich Schumann DLR Oberpfaffenhofen Stand der Klimaforschung IPCC, 2007: Beobachtungen und Messungen lassen keinen Zweifel, dass das Klima sich ändert. Die globale Erwärmung
Fragen der Schüler der Birkenau-Volksschule
 Fragen der Schüler der Birkenau-Volksschule Warum gibt es Klima? Warum gibt es Wärme? Wissenschaftler können die tiefe Frage, warum es etwas überhaupt gibt, meist gar nicht beantworten. Wir befassen uns
Fragen der Schüler der Birkenau-Volksschule Warum gibt es Klima? Warum gibt es Wärme? Wissenschaftler können die tiefe Frage, warum es etwas überhaupt gibt, meist gar nicht beantworten. Wir befassen uns
Ergebnisse der Klimaforschung seit dem IPCC-Bericht 2007
 Ergebnisse der Klimaforschung seit dem IPCC-Bericht 2007 Guy P. Brasseur Climate Service Center (CSC) Helmholtz Zentrum Geesthacht Hamburg Die Pause des Klimawandels Starker Anstieg der globalen Mitteltemperatur
Ergebnisse der Klimaforschung seit dem IPCC-Bericht 2007 Guy P. Brasseur Climate Service Center (CSC) Helmholtz Zentrum Geesthacht Hamburg Die Pause des Klimawandels Starker Anstieg der globalen Mitteltemperatur
Urbane Wärmeinseln im Untergrund. Peter Bayer Ingenieurgeologie, Department für Erdwissenschaften, ETH Zurich
 Urbane Wärmeinseln im Untergrund Peter Bayer Ingenieurgeologie, Department für Erdwissenschaften, ETH Zurich FH-DGG 2014 Bayreuth, 28.05.2014 Ein Phänomen in Atmosphäre Peter Bayer 03.09.2015 2 Ein Phänomen
Urbane Wärmeinseln im Untergrund Peter Bayer Ingenieurgeologie, Department für Erdwissenschaften, ETH Zurich FH-DGG 2014 Bayreuth, 28.05.2014 Ein Phänomen in Atmosphäre Peter Bayer 03.09.2015 2 Ein Phänomen
1150 - P.B.B. - GZ02Z031986M
 Fliegen und Klima Tourismus und Klima Der komplexe und vernetzte Wirtschaftszweig Tourismus ist einerseits vom Klimawandel stark betroffen, er ist andererseits aber auch ein wesentlicher Mit-Verursacher
Fliegen und Klima Tourismus und Klima Der komplexe und vernetzte Wirtschaftszweig Tourismus ist einerseits vom Klimawandel stark betroffen, er ist andererseits aber auch ein wesentlicher Mit-Verursacher
Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet
 Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet Bremen, 5.3.2014 Im Rahmen einer erfolgreichen Forschungsmesskampagne im Auftrag der europäischen Weltraumbehörde
Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet Bremen, 5.3.2014 Im Rahmen einer erfolgreichen Forschungsmesskampagne im Auftrag der europäischen Weltraumbehörde
Klimaänderungen Prognosen Unsicherheiten
 Klimaänderungen Prognosen Unsicherheiten Klimawandel Prof. Dr. Günter Gross Institut für Meteorologie und Klimatologie Fakultät für Mathematik und Physik Leibniz Universität Hannover Klimawandel in Niedersachsen
Klimaänderungen Prognosen Unsicherheiten Klimawandel Prof. Dr. Günter Gross Institut für Meteorologie und Klimatologie Fakultät für Mathematik und Physik Leibniz Universität Hannover Klimawandel in Niedersachsen
Besuchen Sie uns auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL. 24. 27.03.2015 Halle 5.2a, Stand 202. www.bmbf.de
 Besuchen Sie uns auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 24. 27.03.2015 Halle 5.2a, Stand 202 UNSER STAND mit unseren Ausstellern Herzlich WILLKOMMEN! Mit dem Förderschwerpunkt Nachhaltiges Wassermanagement
Besuchen Sie uns auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 24. 27.03.2015 Halle 5.2a, Stand 202 UNSER STAND mit unseren Ausstellern Herzlich WILLKOMMEN! Mit dem Förderschwerpunkt Nachhaltiges Wassermanagement
NaturFreunde in Baden-Württemberg. wasser ist ein menschen recht. hände weg von unserem wasser!
 NaturFreunde in Baden-Württemberg wasser ist ein menschen recht hände weg von unserem wasser! HEIL-BRONNEN FÜR GHANA e.v. NaturFreunde helfen In den Regionen der Erde, die wie Afrika unter Wassermangel
NaturFreunde in Baden-Württemberg wasser ist ein menschen recht hände weg von unserem wasser! HEIL-BRONNEN FÜR GHANA e.v. NaturFreunde helfen In den Regionen der Erde, die wie Afrika unter Wassermangel
Was verträgt unsere Erde noch?
 Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Bayerische Klima-Allianz
 Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und 17:30 SAT.1 Bayern für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 7. April 2017 Bayerische Staatsregierung Bayerische
Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und 17:30 SAT.1 Bayern für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 7. April 2017 Bayerische Staatsregierung Bayerische
Erde aus dem. All. EnergieMix Rolf Emmermann Wissenschaftsjahr 2010: Die Zukunft der Energie
 EnergieMix 2050 Erde aus dem Die Rolle der Geowissenschaften für die zukünftige Energieversorgung All Rolf Emmermann Wissenschaftsjahr 2010: Die Zukunft der Energie Weltenergiebedarf 2009: ~ 530 EJ Weltbevölkerung
EnergieMix 2050 Erde aus dem Die Rolle der Geowissenschaften für die zukünftige Energieversorgung All Rolf Emmermann Wissenschaftsjahr 2010: Die Zukunft der Energie Weltenergiebedarf 2009: ~ 530 EJ Weltbevölkerung
Bayerische Klima-Allianz
 Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung, der FC Bayern München AG und der Allianz Arena München Stadion GmbH für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 11.
Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung, der FC Bayern München AG und der Allianz Arena München Stadion GmbH für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 11.
Tag der offenen Türe Dr. August Kaiser Schadstoffe in der Atmosphäre
 Tag der offenen Türe Dr. August Kaiser Schadstoffe in der Atmosphäre Folie 2 Überblick Meteorologie = Physik der Atmosphäre Dazu gehören auch Luftschadstoffe Wie gelangen Schadstoffe in die Atmosphäre?
Tag der offenen Türe Dr. August Kaiser Schadstoffe in der Atmosphäre Folie 2 Überblick Meteorologie = Physik der Atmosphäre Dazu gehören auch Luftschadstoffe Wie gelangen Schadstoffe in die Atmosphäre?
Anmerkungen zu Ende der Eiszeit und Literaturverzeichnis
 Anmerkungen 1) Vgl. Ahlheim, 1989, S. 10 2) Vgl. Behringer, 2011, S. 264 3) Vgl. Internet: http://www.arctic-report.net/wp-content/uploads/2012/02/awi-interviewzu- Klimadebatte.pdf, S.2, 4) Vgl. Behringer,
Anmerkungen 1) Vgl. Ahlheim, 1989, S. 10 2) Vgl. Behringer, 2011, S. 264 3) Vgl. Internet: http://www.arctic-report.net/wp-content/uploads/2012/02/awi-interviewzu- Klimadebatte.pdf, S.2, 4) Vgl. Behringer,
acatech POSITION > Georessource Wasser Herausforderung Globaler Wandel
 > Georessource Wasser Herausforderung Globaler Wandel Ansätze und Voraussetzungen für eine integrierte Wasserressourcenbewirtschaftung in Deutschland acatech (Hrsg.) acatech POSITION Februar 2012 Titel
> Georessource Wasser Herausforderung Globaler Wandel Ansätze und Voraussetzungen für eine integrierte Wasserressourcenbewirtschaftung in Deutschland acatech (Hrsg.) acatech POSITION Februar 2012 Titel
www.unsichtbarerfeind.de Kinder auf den Spuren des Klimawandels Energiesparen
 www.unsichtbarerfeind.de Blatt 8 Energiesparen Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, sollten wir uns alle überlegen, was wir konkret dagegen unternehmen können. Schließlich wirkt sich beim Klima erst
www.unsichtbarerfeind.de Blatt 8 Energiesparen Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, sollten wir uns alle überlegen, was wir konkret dagegen unternehmen können. Schließlich wirkt sich beim Klima erst
acatech DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN Gründung Hintergrund Fakten Oktober 2011
 acatech DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN Gründung Hintergrund Fakten Oktober 2011 acatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Überblick Die Köpfe Die Organisation Die Arbeit Die Ergebnisse
acatech DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN Gründung Hintergrund Fakten Oktober 2011 acatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Überblick Die Köpfe Die Organisation Die Arbeit Die Ergebnisse
Klima und Treibhauseffekt
 Klima und Treibhauseffekt Lehrerkommentar OST Ziele Lehrplan: Merkbegriffe verstehen und in verschiedenen Zusammenhängen anwenden / Kreisläufe und Wechselwirkungen untersuchen und kennenlernen Umweltprobleme
Klima und Treibhauseffekt Lehrerkommentar OST Ziele Lehrplan: Merkbegriffe verstehen und in verschiedenen Zusammenhängen anwenden / Kreisläufe und Wechselwirkungen untersuchen und kennenlernen Umweltprobleme
ESSEN MACHT KLIMA MACHT ESSEN Oktober 2009 FHNW, Brugg-Windisch
 ESSEN MACHT KLIMA MACHT ESSEN 9.-10. Oktober 2009 FHNW, Brugg-Windisch Wie können ökologische Ansprüche, Schutz des Klimas und Erzeugung ausreichender Nahrung gleichzeitig verwirklicht werden? Dr. Joan
ESSEN MACHT KLIMA MACHT ESSEN 9.-10. Oktober 2009 FHNW, Brugg-Windisch Wie können ökologische Ansprüche, Schutz des Klimas und Erzeugung ausreichender Nahrung gleichzeitig verwirklicht werden? Dr. Joan
Klimawandel in Schleswig-Holstein
 Klimawandel in Schleswig-Holstein Die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen Dr. Insa Meinke Norddeutsches Klimabüro Institut für Küstenforschung GKSS-Forschungszentrum Geesthacht Klimawandel findet statt
Klimawandel in Schleswig-Holstein Die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen Dr. Insa Meinke Norddeutsches Klimabüro Institut für Küstenforschung GKSS-Forschungszentrum Geesthacht Klimawandel findet statt
3. REKLIM-Konferenz Klimawandel in Regionen
 3. REKLIM-Konferenz Klimawandel in Regionen Reinhard F. Hüttl Potsdam, 3. September 2012 REKLIM Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen REKLIM ist ein Verbund von acht Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft
3. REKLIM-Konferenz Klimawandel in Regionen Reinhard F. Hüttl Potsdam, 3. September 2012 REKLIM Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen REKLIM ist ein Verbund von acht Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft
Klimawandel und Klimaveränderungen in Wien
 Klimawandel und Klimaveränderungen in Wien Dialogveranstaltung, 20. März 2017 Andrea Prutsch, Umweltbundesamt GmbH pixabay.com/domeckopol 1 Es ist etwas im Gange Hitze Trockenheit veränderte Pflanzenentwicklung
Klimawandel und Klimaveränderungen in Wien Dialogveranstaltung, 20. März 2017 Andrea Prutsch, Umweltbundesamt GmbH pixabay.com/domeckopol 1 Es ist etwas im Gange Hitze Trockenheit veränderte Pflanzenentwicklung
Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist
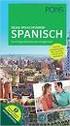 Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
... Publikationen des Umweltbundesamtes. Klimawirksamkeit des Flugverkehrs
 Publikationen des Umweltbundesamtes... Klimawirksamkeit des Flugverkehrs Aktueller wissenschaftlicher Kenntnisstand über die Effekte des Flugverkehrs Claudia Mäder Umweltbundesamt FG I 2.1 Klimaschutz
Publikationen des Umweltbundesamtes... Klimawirksamkeit des Flugverkehrs Aktueller wissenschaftlicher Kenntnisstand über die Effekte des Flugverkehrs Claudia Mäder Umweltbundesamt FG I 2.1 Klimaschutz
Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate?
 Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate? Rolf Ullrich 1), Jörg Rapp 2) und Tobias Fuchs 1) 1) Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima und Umwelt, D-63004 Offenbach am Main 2) J.W.Goethe-Universität,
Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate? Rolf Ullrich 1), Jörg Rapp 2) und Tobias Fuchs 1) 1) Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima und Umwelt, D-63004 Offenbach am Main 2) J.W.Goethe-Universität,
Weniger CO 2 dem Klima zuliebe Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Der CO 2- Kreislauf wird behandelt und die Beeinflussung des Menschen erarbeitet. Die Schülerberichte (Aufgabe 3) dienen als Grundlage zur Diskussion im Plenum. Ziel
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Der CO 2- Kreislauf wird behandelt und die Beeinflussung des Menschen erarbeitet. Die Schülerberichte (Aufgabe 3) dienen als Grundlage zur Diskussion im Plenum. Ziel
Die Klimazonen der Erde
 Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Klimawandel und Wetterkatastrophen
 Klimawandel und Wetterkatastrophen Was erwartet unsere Städte in Mitteleuropa? Prof. Dr. Gerhard Berz, Ludw.-Max.-Universität München, ehem. Leiter GeoRisikoForschung, Münchener Rückvers. Naturkatastrophen
Klimawandel und Wetterkatastrophen Was erwartet unsere Städte in Mitteleuropa? Prof. Dr. Gerhard Berz, Ludw.-Max.-Universität München, ehem. Leiter GeoRisikoForschung, Münchener Rückvers. Naturkatastrophen
Kernbotschaften. Sperrfrist: 7. November 2011, Uhr Es gilt das gesprochene Wort.
 Sperrfrist: 7. November 2011, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Statement des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, bei der Eröffnung des Münchner
Sperrfrist: 7. November 2011, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Statement des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, bei der Eröffnung des Münchner
Abweichungen vom idealen Gasverhalten: van der Waals. Abweichungen vom idealen Gasverhalten: van der
 Abweichungen vom idealen Gasverhalten: van der Abweichungen vom idealen Gasverhalten: van der Waals Der holländische Wissenschaftler J. van der Waals hat in diesem Zusammenhang eine sehr wertvolle Gleichung
Abweichungen vom idealen Gasverhalten: van der Abweichungen vom idealen Gasverhalten: van der Waals Der holländische Wissenschaftler J. van der Waals hat in diesem Zusammenhang eine sehr wertvolle Gleichung
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der Auszeichnung des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig Leibniz-Institut
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der Auszeichnung des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig Leibniz-Institut
Bioökonomie International. Globale Zusammenarbeit für eine biobasierte Wirtschaft
 Bioökonomie International Globale Zusammenarbeit für eine biobasierte Wirtschaft Globales Wissen nutzen - Bioökonomie stärken. Um die Welt nachhaltig mit Nahrungsmitteln, nachwachsenden Rohstoffen und
Bioökonomie International Globale Zusammenarbeit für eine biobasierte Wirtschaft Globales Wissen nutzen - Bioökonomie stärken. Um die Welt nachhaltig mit Nahrungsmitteln, nachwachsenden Rohstoffen und
im Panel Mitigation Rede der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel auf dem VN-GS High Level Event on Climate Change
 NOT FOR FURTHER DISTRIBUTION Rede der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel auf dem VN-GS High Level Event on Climate Change im Panel Mitigation am Montag, 24. September 2007,
NOT FOR FURTHER DISTRIBUTION Rede der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel auf dem VN-GS High Level Event on Climate Change im Panel Mitigation am Montag, 24. September 2007,
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Auftaktveranstaltung Carbon2Chem 27. Juni 2016, Duisburg Es gilt das gesprochene Wort. (Verfügbare
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Auftaktveranstaltung Carbon2Chem 27. Juni 2016, Duisburg Es gilt das gesprochene Wort. (Verfügbare
Bayerische Klima-Allianz
 Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Verbandes der bayerischen Bezirke zu einer Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 13. Februar 2008 2 Bayerische Klima-Allianz
Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Verbandes der bayerischen Bezirke zu einer Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 13. Februar 2008 2 Bayerische Klima-Allianz
Temperaturänderungen in der Metropolregion Hamburg
 Temperaturänderungen in der Metropolregion Hamburg K. Heinke Schlünzen Meteorologisches Institut ZMAW Universität Hamburg Vom globalen zum regionalen Effekt Dynamische Verfeinerung global Europa ECHAM
Temperaturänderungen in der Metropolregion Hamburg K. Heinke Schlünzen Meteorologisches Institut ZMAW Universität Hamburg Vom globalen zum regionalen Effekt Dynamische Verfeinerung global Europa ECHAM
Themen zu den Klimafolgen
 Themen zu den Klimafolgen 1. Wetterextreme: Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme, Hurrikans 2. Meeresspiegel : aktuell, bis 2100, bis 3000, gefährdete Regionen 3. Eis und Klima: Eiszeit, Meereis, Gebirgsgletscher,
Themen zu den Klimafolgen 1. Wetterextreme: Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme, Hurrikans 2. Meeresspiegel : aktuell, bis 2100, bis 3000, gefährdete Regionen 3. Eis und Klima: Eiszeit, Meereis, Gebirgsgletscher,
Aktuelle BMBF-Förderaktivitäten in der Wasserforschung
 Aktuelle BMBF-Förderaktivitäten in der Wasserforschung Dr. Verena Höckele Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit, PTKA Politischer Rahmen Hightech-Strategie der Bundesregierung mit Aktionslinie:
Aktuelle BMBF-Förderaktivitäten in der Wasserforschung Dr. Verena Höckele Projektträgerschaft Ressourcen und Nachhaltigkeit, PTKA Politischer Rahmen Hightech-Strategie der Bundesregierung mit Aktionslinie:
Vor 30 Jahren: Klimasprung in Mittel- und Westeuropa- ein kleiner, kurzatmiger Hüpfer
 Vor 30 Jahren: Klimasprung in Mittel- und Westeuropa- ein kleiner, kurzatmiger Hüpfer Deutschland: Unterschiedlicher Temperaturverlauf im Winter und Sommer Betrachtet man das Temperaturverhalten, beginnend
Vor 30 Jahren: Klimasprung in Mittel- und Westeuropa- ein kleiner, kurzatmiger Hüpfer Deutschland: Unterschiedlicher Temperaturverlauf im Winter und Sommer Betrachtet man das Temperaturverhalten, beginnend
Klimawandel: Konsequenzen der globalen Herausforderung. Klimaevent 2013, Arbon. Thomas Stocker
 Klimaevent 2013, Arbon Klimawandel: Konsequenzen der globalen Herausforderung Thomas Stocker Physikalisches Institut Oeschger Zentrum für Klimaforschung Universität Bern Klimaevent 2013, Arbon 1. Klimaforschung
Klimaevent 2013, Arbon Klimawandel: Konsequenzen der globalen Herausforderung Thomas Stocker Physikalisches Institut Oeschger Zentrum für Klimaforschung Universität Bern Klimaevent 2013, Arbon 1. Klimaforschung
Wald, Holz und Kohlenstoff
 Wald, Holz und Kohlenstoff Dr. Uwe Paar Landesbetrieb HESSEN-FORST Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Gliederung Bedeutung des Waldes Leistungen nachhaltiger Forstwirtschaft Wie entsteht Holz?
Wald, Holz und Kohlenstoff Dr. Uwe Paar Landesbetrieb HESSEN-FORST Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Gliederung Bedeutung des Waldes Leistungen nachhaltiger Forstwirtschaft Wie entsteht Holz?
Bergedorf setzt Klimazeichen Energiewende und Klimaschutz vor Ort
 Bergedorf setzt Klimazeichen Energiewende und Klimaschutz vor Ort Die Wissenschaft ist sich einig: eine erhöhte Konzentration von Treibhausgasen, wie CO₂, in der Atmosphäre führt zu einer Erwärmung der
Bergedorf setzt Klimazeichen Energiewende und Klimaschutz vor Ort Die Wissenschaft ist sich einig: eine erhöhte Konzentration von Treibhausgasen, wie CO₂, in der Atmosphäre führt zu einer Erwärmung der
Dr. Hauke Marquardt, Leiter der neuen Emmy Noether-Nachwuchsgruppe, vor dem Hydrauliksystem einer Hochdruckpresse (rechts im Bild).
 4.699 Zeichen Abdruck honorarfrei Beleg wird erbeten Dr. Hauke Marquardt, Leiter der neuen Emmy Noether-Nachwuchsgruppe, vor dem Hydrauliksystem einer Hochdruckpresse (rechts im Bild). Dynamik im Erdinneren
4.699 Zeichen Abdruck honorarfrei Beleg wird erbeten Dr. Hauke Marquardt, Leiter der neuen Emmy Noether-Nachwuchsgruppe, vor dem Hydrauliksystem einer Hochdruckpresse (rechts im Bild). Dynamik im Erdinneren
Globale Ursachen, regionale Auswirkungen: Klimawandel an der Nordseeküste Kurzbeschreibung Zur Person:
 Globale Ursachen, regionale Auswirkungen: Klimawandel an der Nordseeküste Julia Hackenbruch, Süddeutsches Klimabüro am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Kurzbeschreibung Der Klimawandel hat Auswirkungen
Globale Ursachen, regionale Auswirkungen: Klimawandel an der Nordseeküste Julia Hackenbruch, Süddeutsches Klimabüro am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Kurzbeschreibung Der Klimawandel hat Auswirkungen
Strategien zur Vermeidung der Überwärmung von Städten aus meteorologischer Sicht wie kann das nachhaltig gelingen?
 Strategien zur Vermeidung der Überwärmung von Städten aus meteorologischer Sicht wie kann das nachhaltig gelingen? Stefan Emeis stefan.emeis@kit.edu INSTITUTE OF METEOROLOGY AND CLIMATE RESEARCH, KIT University
Strategien zur Vermeidung der Überwärmung von Städten aus meteorologischer Sicht wie kann das nachhaltig gelingen? Stefan Emeis stefan.emeis@kit.edu INSTITUTE OF METEOROLOGY AND CLIMATE RESEARCH, KIT University
