PENTA PROJECT MODULARE WEITERBILDUNG ERNEUERBARE ENERGIEN MODUL GRUNDLAGEN GEBÄUDE UND ENERGIE LE Unterstützt durch
|
|
|
- Mina Kora Eberhardt
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ERNEUERBARE ENERGIEN PENTA PROJECT MODULARE WEITERBILDUNG MODUL GRUNDLAGEN GEBÄUDE UND ENERGIE LE 11.1
2 Träger Arbeitsgemeinschaft für Solarenergie SWISSOLAR Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz, FWS Haustechnik-Fachlehrvereinigung SSHL Hochschule Technik+ Architektur Luzern, FHZ Holzenergie Schweiz; Holzfeuerungen Schweiz Schweizer Agentur für erneuerbare Energien, AEE Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, SIA Schweizerischer Kaminfegermeister-Verband, SKMV Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-Ingenieuren, SWKI Schweizerischer Verein für Kältetechnik, SVK Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen, usic Schweizerische Vereinigung für Geothermie, SVG SOLAR - Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie SOLAR SUPPORT; Schweizerischer Verband Dach und Wand SVDW; Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen, VSEI Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte, VHP Vereinigung Schweizerischer Sanitär- und Heizungsfachleute, VSSH Hubrainweg 10, 8124 Maur, Tel , Fax info@pentaproject.ch,
3 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Inhaltsverzeichnis 1. Energie und Leistung 3 2. Energieformen 4 3. Energiebilanz 6 4. Planungshinweise 9 5. Gebäudestandards Komfortlüftung Komponenten Komfortlüftung Anforderungen an den Schall Kochstellenabluft Hygiene und Reinigung 23 1
4 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie 2
5 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie 1. Energie und Leistung ENERGIE LEISTUNG kwh MJ kj J kw W EW-Zähler Bauleuchte 1kWh 1h 1000 W 1 kw Wird eine Leistung während einer bestimmten Zeit verrichtet, so erhalten wir die Energie, also Energie = Zeit mal Leistung. Beispiel A: WW-Speicher mit Elektro-Heizeinsatz Ein 300-Liter-WW-Speicher besitzt einen Elektro-Heizeinsatz mit einer Leistung von 4kW. Er wird in 4 Stunden auf 60 C aufgeladen. Es wurde also eine Energiemenge von: 4kW x 4h = 16 kwh in den Speicher abgegeben. Abbildung 1: Warmwasserspeicher mit Elektroeinsatz Beispiel B: WW-Speicher mit Oelkessel Der gleiche Speicher von 300 Liter wird mit einem Ölkessel auf 60 C aufgeladen.dieser Kessel hat eine Leistung von 10kW. Die Energiemenge, die in den Speicher geht, ist gleich gross wie in Beispiel a, nämlich 16kWh. Da jedoch die Leistung des Ölkessels grösser ist als diejenige des Elektroeinsatztes, verkleinert sich die Aufladezeit. Abbildung 2: Warmwasserspeicher mit Ölkessel 3
6 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Energie = Zeit x Leistung Energie = Zeit Leistung Leistung = Energie/Zeit Zeit = Energie/Leistung Energie Leistung = Zeit Energi e 16kWh Zeit = = = 1.6h Aufladezeit Leistung 10kW Abbildung 3: Warmwasserspeicher mit Solaranlage Beispiel C: WW-Speicher mit Solaranlage Der gleiche Speicher von 300 Liter von Beispiel a wird mit 4 m 2 Solarkollektoren aufgeladen. Wie gross ist die durchschnittliche Kollektorleistung, wenn der Speicher von 9Uhr bis nachmittags 16Uhr auf 60 C geladen wird? Die Energiemenge, die in den Speicher geht, ist gleich gross wie in Beispiel a, nämlich 16kWh. 16kWh Leistung = Energie / Zeit = = 2.3kW 7h 2. Energieformen Wir kennen zum Beispiel folgende Energieformen: Wärmeenergie mechanische Energie elektrische Energie Lageenergie Nuklearenergie chemische Energie (alle Brennstoffe) Strahlungsenergie Windenergie Es ist möglich, eine Energieform in eine andere umzuwandeln. So wird in einem Stausee Lageenergie in mechanische Energie umgewandelt und diese wiederum in einem Generator in elektrische Energie. 4
7 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Abbildung 4: Stausee: Energieumwandlung von Lageenergie in elektrische Energie Energie hat die Fähigkeit, eine Arbeit zu verrichten. Beispiel: Mit Wärmeenergie kann ein Warmwasser-Speicher von 10 C auf 60 C erwärmt werden. Mit elektrischer Energie wird ein Lift vom Erdgeschoss in den vierten Stock befördert. Alle diesen Energien haben die gleichen Einheiten: J ( Joule) kj ( kilo-joule) MJ ( Mega-Joule) kwh (kilo-watt-stunde) Obwohl nun alle Energien die gleiche Einheit besitzen, unterscheiden wir verschiedene Wertigkeiten von Energien. Diese Wertigkeiten drücken aus, wie gut sie sich in andere Energieformen umwandeln lassen. Elektrische und mechanische Energie haben beispielsweise eine sehr hohe Wertigkeit, weil sie sich effizient in eine andere Form wie Strahlung oder thermische Energie umwandeln lassen. Beispiel: Wertigkeit Chemische Energie (Brennstoffe) Elektrische Energie Kernenergie Mechanische Energie Wärmeenergie mit einer Temperatur von 150 C Wärmeenergie mit einer Temperatur von 70 C Wärmeenergie mit einer Temperatur von 20 C 5
8 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Beispiel: Ein Verbrennungsmotor wandelt chemische Energie durch den Explosionsprozess in mechanische Energie um. Dabei entsteht auch Wärme, welche über den Kühler als Energie verloren geht. Wirkungsgr ad η = Nutzen Aufwand Bei einer Umwandlung von einer Energieform in eine andere entstehen auch immer Energieformen, welche nicht mehr weiter genutzt werden. Wir sprechen von einem Wirkungsgrad. Er ist das Verhältnis von erwünschter Energieform und zugeführter Energie. Bei einem Verbrennungsmotor sind dies lediglich etwa 25%, die in mechanische Energieform umgewandelt werden. Die restlichen 75% werden als Wärmeenergie über den Kühler an die Umwelt abgegeben. Wirkungsgr ad η = Nutzen Aufwand mechanische Energie 25 % erwünschte Energieform zugeführte Energie = Benzin Abbildung 5: Wirkungsgrad Wärme Lärm 75 % unerwünschte Energieform Verluste Der Wirkungsgrad ist also immer kleiner 1 und wird auch oft in Prozent angegeben. (0.25 = 25%) Ein Sonnenkollektor wandelt Strahlungsenergie in Wärmeenergie um. Nicht die ganze anfallende Globalstrahlung auf einen Kollektor kann dem Speicher als nutzbare Energie zugeführt werden. Es fallen Wärmeverluste am Kollektor, den Leitungen und dem Speicher an und sind somit nicht mehr nutzbar. 3. Energiebilanz Abgeführte Energie = Zugeführte Energie Der Energiehaushalt eines Gebäudes ist ein komplexes Wechselspiel zwischen verschiedenen Einflussgrössen: Raumklima und Benutzerverhalten Aussenklima Baukörper Haustechnikanlagen 6
9 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Die Haustechnik hat diejenigen Beiträge an die Behaglichkeit zu liefern, welche mit dem Baukörper nicht erreicht werden. Das untenstehende Bild zeigt die Jahresenergiebilanz eines Gebäudes. Die Energiebilanz lautet: Abgeführte Energie = Zugeführte Energie Transmissions-Wärmeverluste Q T durch die Hülle Lüftungswärmeverluste Q V infolge Luftwechsel Das an der Zapfstelle bezogene Warmwasser verschwindet meist augenblicklich im Ablauf und damit auch sein Wärmeinhalt Q WW " 4 3Q E- ie Q3 ip E2 Q3 s I 3Q g C Q3 3 Qug K C i E 9 4 / 3Q V 8 -E hww D M M 3 Q hww D M M 1! 3 3Q h D 0 A E M H A > = HB 3Q T 6 3Q t J Q r Q L 2 Q ww 3 M M Abbildung 6: Energiebilanz eines Gebäudes 1 Systemgrenze Heizwärmebedarf 2 Systemgrenze Wärmebedarf für Warmwasser 3 Systemgrenze Heiz- und Warmwassersystem 4 Systemgrenze Gebäude E hww Energiebedarf für Heizung und Warmwasser Q g Wärmegewinne Q h Heizwärmebedarf Q hww Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser Q i interne Wärmegewinne Q ie interne Wärmegewinne Elektrizität Q ip interne Wärmegewinne Personen Q L Wärmeverluste des Heiz- und Warmwassersystems Q r gewonnene Umweltwärme Q s solare Wärmegewinne Q T Transmissionswärmeverluste Q t Gesamtwärmeverlust Q ug genutzte Wärmegewinne Q V Lüftungswärmeverluste Q WW Wärmebedarf für Warmwasser WRG Wärmerückgewinnung 7
10 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Wärmezufuhr zum beheizten Volumen Wärmeinhalt Q WW des an der Zapfstelle bezogenen Warmwassers Wärmegewinne durch Personen, Elektrizitätsverbrauch und Sonneneinstrahlung. Ein Teil des Gewinns wird weggelüftet wegen Ueberheizens. Es bleibt der genutzte Gewinn. Die schliesslich von den Heizflächen zu liefernde Nutzwärme ist der Heizwärmebedarf Q h. Der Energiebedarf E hww ist die dem Gebäude zugeführte Energie in Form von Oel, Gas, Fernwärme, Elektrizität und Solar. Mit standartisierten Rechenverfahren, wie zum Beispiel die SIA-Norm 380/1, lässt sich der theoretische Gesamtwärmeverlust Q t ermitteln. Flächenbezogene Energien Gemäss SIA-Norm 184 werden alle Energien zu Vergleichszwecken auf eine Fläche bezogen. Die Energiebezugsfläche EBF ist die Summe aller Geschossflächen (Aussenmasse), deren Nutzung ein Beheizen oder Klimatisieren notwendig ist. * 8 H> A HA E? D % $ E A H E A H E A H Abbildung 7: Alle zur Energiebezugsfläche EBF zählenden Flächen eines Obergeschosses. Geschosshöhe 2.70 m EBF 69.7 m 2 ' % Teilt man die gesamte jährlich zugeführte Energie durch die EBF, so erhalten wir die notwendige Energiemenge, welche 1m 2 eines Gebäudes verbraucht. Dies ist die Energiekennzahl E und wird in MJ/m 2 a oder kwh/m 2 a angegeben. Die Energiekennzahl setzt sich zusammen aus den Teilenergiekennzahlen der einzelnen Endenergieträger oder der Verwendungszwecke. E = E öl + E Gas + E el + E Holz + E Sonne (zugeführt) E = E Wärme + E LKP = E h + E WW + E LKP (genutzt) E LKP = interne Abwärme von Licht, Kraft und Personen Mit den ermittelten Energiekennzahlen nach der SIA-Norm 380/1 kann ein Gebäude einfach über seinen Energiehaushalt und einen allfälligen Sanierungsbedarf beurteilt werden. 8
11 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Wärmeleistung Die Wärmeleistung besagt nun, wieviel Wärme unser Heizsystem im Extremfall bei tiefen Aussentemperaturen an das Gebäude abgeben muss. Der Wärmleistungsbedarf Q & h des Gebäudes berechnet sich aus: Transmissionsverluste Q & T durch Bauteile (Fenster, Aussenwand, Dach etc.) Lüftungsverlust Q & L durch Undichtheiten des Gebäudes und Lüften Die SIA-Empfehlung 384/2 dient zur Ermittlung der Gebäudewärmleistung- Bedarfes Q & h. 4. Planungshinweise Wärmedämmung und Dichtigkeit In beheizten Gebäuden geht Wärme bei allen Bauteilen zu unbeheizten Räumen oder Aussenklima als sogenannte Transmissionswärme verloren (Aussenwand, Fenster, Kellerdecke, Dach usw.) Diese Bauteile müssen folglich wärmegedämmt werden. Der U-Wert (früher k-wert) beschreibt, wieviel Wärme durch ein Bauteil fliesst. Je kleiner der U-Wert, umso besser die Wärmedämmung. Holzriegelwand, Ausfachung Innenverkleidung Installationsraum Dampfbremse+Luftdichtung Flumroc-Dämmplatte 1 Flumroc-Dämmplatte 1 Flumroc-Dämmplatte SOLO Winddichtung Isolair Hinterlüftungsraum Holzschalung Abbildung 8: Beispiel Wandkonstruktion Kriterien Einheit Dämmstärke in mm Wärmedurchgangskoeffizient U theoretisch, ohne Wärmebrücken W/(m 2 K) Durchschnittswert gemäss SIA Norm 180 W/(m 2 K) Innere Oberflächentemperatur bei aussen -10 C und Raumtemperatur +20 C C
12 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Auf folgende Punkte ist zu achten, um ein Gebäude energetisch zu optimieren: Optimierung der Bauteile bezüglich Wärmeverlust (siehe Tabelle unten) Vermeiden von Wärmebrücken Möglichst luftdichte Ausführung aller Aussenflächen Wenn möglich Ersatz des Cheminées durch Cheminée-Ofen. Ansonsten mit möglichst dichter Klappe ausrüsten. Holzofen mit Frischluftzuführung inklusive Abstellklappe Komfortlüftung Grenz- und Zielwerte für flächenbezogene Wärmedurchgangskoeffizienten U in W/(m 2 K), bei 20 C Raumtemperatur und bei Jahresmitteltemperaturen zwischen 7 C und 10 C (Schweizer Mittelland) Grenzwerte U g Zielwerte U z Bauteil gegen Aussenklima unbeheizte Aussenklima unbeheizte oder weniger Räume oder oder weniger Räume oder als 2 m mehr als 2 m im als 2 m im mehr als 2 m im Bauteil Erdreich Erdreich Erdreich Erdreich Bauteile (Dach, Wand, Boden) 0,30 1) 0,40 1) 0,20 1) 0,30 1) Bauteile mit Flächenheizungen 0,25 1) 0,30 1) 0,20 1) 0,30 1) Fenster, Fenstertüren 1,70 2,00 1,20 1,60 Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern 1,20 2) 1,60 2) 1,00 2) 1,20 2) Unverglaste Türen 2,00 2,00 1,60 2,00 Tore (Türen grösser 4 m 2 ) 2,40 2,40 2,00 2,00 Optimale Gebäudehüllenzahl (A/EBF) Die Würfelform weist ein sehr gutes Gebäudehüllflächen- / Volumenverhältnis auf. Wird eine kompakte Gebäudeform angestrebt, wird die Aussenfläche in Bezug zur Nutzfläche möglichst gering gehalten und dadurch die Transmissionsverluste reduziert. Abbildung 9: A zu EBF 10
13 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Sonnenenergie Sonnenenergie, die durch die Fenster in das Gebäude einstrahlt und so das Gebäude erwärmt, wird als passive Sonnenenergie bezeichnet. Abbildung 10: Gebäudebeispiel mit Südfassade Durch moderne nach Süden ausgerichtete Fenster kommt über das Jahr mehr Wärme durch die Sonnenstrahlung in das Gebäude als durch Transmission der Fenster verloren geht. Dadurch ist es wichtig, die Hauptfassade wenn möglich nach Süden auszurichten. Die Süd-Fensterfläche sollte 20-40% der Bodenfläche des entsprechenden Raumes aufweisen. Wichtig ist, dass sie im Winter nicht beschattet werden ( z. B durch Balkone). Im Sommer wird eine Beschattung notwendig. Hingegen ist die Nordfassade mit kleiner Fensterfläche auszustatten, die Ostund Westfassade je nach Gebäudenutzung. Sonnenbahn Abbildung 11: Jahresverlauf der Sonne 11
14 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Wärmespeicherung Dringt während der Heizsaison Sonnenenergie in den Raum, muss eine Erhöhung der Raumlufttemperatur von 2-4 K zugelassen werden, damit die Gebäudemasse die Energie speichern kann. Als Speichermasse eignen sich alle innenliegenden massiven Bauteile wie Unterlagsboden, Steinboden, Mauerwerke, Gipsbeplankungen usw. 5. Gebäudestandards Anforderungen an den Wärmeschutz Bei der Entscheidung wie gebaut werden soll, sind teilweise philosophische Betrachtungen anzustellen: Betrachtung der Nutzungsdauer werden auch Erstellung, Unterhalt und Betrieb berücksichtigt? Verfügbarkeit der Energieträger Energiepreis Als Grundlage für entsprechende Betrachtungen werden im Folgenden drei unterschiedliche Baustandards einander gegenübergestellt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte; bei den objektspezifischen Nachweisen sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten, die teilweise kantonal voneinander abweichen. Baustandard 1 gesetzliche Vorschriften Bei den gesetzlichen Anforderungen, die den heute gebräuchlichen Baustandard prägen, handelt es sich primär um kantonale Energiegesetze, die sich auf die anerkannten Normen z.b. SIA 180/1 und SIA 380/1 abstützen. Die meisten Kantone schreiben heute die folgenden Wärmedurchlasskoeffizienten U (früher k) vor: Bauteil Mindestanforderungen U-Richtwert in W/m 2 K Bauteile gegen Aussenklima 0.3 Boden mit Flächenheizung Bauteile zu nichtbeheizten Räumen oder Erdreich 0.4 Fenster, Türen und Tore 2.0 Fenster vor Heizflächen 1.2 Baustandard 2 Minergie Der Minergie-Standard steht für rationelle Energieanwendung und für die Nutzung erneuerbarer Energie, bei gleichzeitiger Verbesserung der Behaglichkeit und Senkung der Umweltbelastung. Diese Technik reduziert den Verbrauch von nicht erneuerbarer Energie auf ein nachhaltig tiefes Niveau. 12
15 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Einfamilienhäuser müssen folgende Kriterien erfüllen, damit sie dem Minergie- Standard, welcher ein geschütztes Label darstellt, genügen: Gewichtete Energiekennzahl Wärme Neubauten 42 kwh/m 2 a (150 MJ/m 2 a) Bauten, Baujahr vor kwh/m 2 /a (288 MJ/m 2 a) Es wird nur dem Grundstück zugeführte hochwertige Energie (Brennstoffe, direkt nutzbre Fernwärme) eingerechnet. Zugeführte Elektrizität für Wärmeerzeugung und Belüftung/Klimatisierung wird doppelt gerechent. Mechanische Lufterneuerung Primäranforderung an die Gebäudehülle Neubauten: Heizwärme Q h (Standard) maximal 80 % des Grenzwertes (H g ) der SIA 380/1 (2001) für Neubauten Bauten mit Baujahr vor 1990: Heizwärmebedarf Q h (Standard) maximal 120 % des Grenzwertes (H g ) der SIA 380/1 (2001) für Neubauten. Mehrkosten Dürfen gegenüber konventionellen Vergleichsobjekten höchstens 10 % mehr betragen. Abbildung 12: Beispiel EFH Minergiestandard Massnahmen zur Erreichung des Standards Die Erfahrung zeigt, dass folgende Massnahmen ergriffen werden müssen: architektonische Massnahmen wie kompakte Gebäudehülle (beheizte Nutzfläche zur Gebäudeaussenfläche) und optimale Gebäudeorientierung (grosse Süd- und kleine Nordfenster). guter Wärmeschutz mit gegenüber der Norm SIA 380/1 verbesserten U- Werten und Bauteilübergänge ohne Wärmebrücken. Heute sind in etwa die folgenden Wärmedurchlasskoeffizienten U (früher k) einzuhalten: 13
16 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Bauteil Mindestanforderungen U-Richtwert in W/m 2 K Bauteile gegen Aussenklima 0.2 Bauteile zu nichtbeheizten Räumen oder Erdreich Fenster, Türen und Tore < 1.2 möglichst luftdichte Gebäudehülle während der Heizperiode mechanische Lüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung (WRG) und geringem Stromverbrauch. Einsatz erneuerbarer Energien (Wärmepumpen mit Erdsonden/Grundwasser, Sonnenkollektoren, Holzkessel, Pelletskessel) Baustandard 3 MINERGIE-P MINERGIE -P bedingt ein eigenständiges, am niedrigen Energieverbrauch orientiertes Gebäudekonzept. Als ungenügend erweist sich insbesondere, das Projekt eines Niedrigenergie- oder eines MINERGIE -Hauses mit einer zusätzlichen Wärmedämmschicht einzupacken. Ein Haus, das den sehr strengen Anforderungen von MINERGIE -P genügen soll, ist als Gesamtsystem und in allen seinen Teilen konsequent auf dieses Ziel hin geplant, gebaut und im Betrieb optimiert. Der neue Standard MINERGIE -P stellt hohe Anforderungen an das Komfortangebot, die Wirtschaftlichkeit und die Ästhetik. Zum erforderlichen Komfort gehört namentlich auch eine gute und einfache Bedienbarkeit des Gebäudes, bzw. der technischen Einrichtungen. Die folgenden fünf Anforderungen müssen eingehalten werden: spezifischer Wärmeleistungsbedarf Heizwärmebedarf gewichtete Energiekennzahl Wärme Luftdichtigkeit der Gebäudehülle Haushaltgeräte Abbildung 13: Beispiel MFH im Passivhausstandard 14
17 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie MINERGIE-P-Grenzwerte Es sind die nachfolgenden vier Anforderungen einzuhalten. Es gelten dieselben Anforderungen für Neubauten wie für bestehende Bauten. Heizenergiebedarf nach Norm SIA 380/1 (2001) Q h = 20 % des SIA-Grenzwertes Hg (Q h berechnet mit Standardwerten, jedoch mit Berücksichtigung der Wärmerückgewinnung über die Komfortlüftung) Spezifischer Heizleistungsbedarf q hmax = 10 W/m 2 EBF Dieser Grenzwert gilt als Mittelwert über das gesamte Gebäude. Der spezifische Heizleistungsbedarf in exponierten Räumen darf höher liegen. Massnahmen zur Gewährleistung des Komforts in solchen Räumen sind qualitativ zu beschreiben. Gewichtete Energiekennzahl Wärme in kwh/m 2 a Für Ein- und Mehrfamilienhäuser, E gew = 30 kwh/m 2 a Für Dienstleistungsbauten, E gew = 25 kwh/m 2 a Luftdichtigkeit der Gebäudehülle n L50 = 0.6 h -1 Massnahmen zur Erreichung des Standards Die Erfahrung zeigt, dass folgende Massnahmen ergriffen werden müssen: architektonische Massnahmen wie kompakte Gebäudehülle (beheizte Nutzfläche zur Gebäudeaussenfläche) und optimale Gebäudeorientierung (grosse Süd- und kleine Nordfenster). Extrem guter Wärmeschutz (ca. 40 cm Wärmedämmstärke) und Bauteilübergänge ohne Wärmebrücken. Heute sind in etwa die folgenden Wärmedurchlasskoeffizienten U (früher k) einzuhalten: Bauteil Mindestanforderungen U-Richtwert in W/m 2 K Bauteile gegen Aussenklima Bauteile zu nichtbeheizten Räumen oder Erdreich Fenster, Türen und Tore < 0.85 Verglasung mit hohem Energiedurchlassgrad (g-wert > 0.5) trotz tiefem U-Wert Während der Heizperiode mechanische Lüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung (WRG) und und geringem Stromverbrauch Einsatz erneuerbarer Energien (Wärmepumpen mit Erdsonden/Grundwasser, Sonnenkollektoren, Holzkessel, Pelletskessel) Einsatz von zertifizierten Haushaltgeräten mit geringem Stromverbrauch (Waschmaschine, Kühlschränke usw.) 15
18 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie 6. Komfortlüftung Vorteile einer Komfortlüftung Schadstoffarmes Raumklima Keine zu hohe Luftfeuchte, Vermeidung von Bauschäden, Abtransport der Feuchte im Bad übe 24 Stunden. Gute Luft trotz Abwesenheit und geschlossenen Fenstern Kein Aussenlärm Wirksame Wärmerückgewinnung, Energieeinsparung Filtrierung der Aussenluft Dichtheit Aus Komfortgründen und um Feuchtigkeitsschäden im Baukörper zu vermeiden, ist eine dichte Bauweise erforderlich. Eine Gebäudehülle muss verschiedene Funktionen erfüllen. Einerseits Wärme zurückhalten, die anfallende Raum- Feuchtigkeit abtransportieren, Sauerstoff hereinlassen, jedoch keine Luftschadstoffe oder Lärm. Dass alle diese Anforderungen nicht erfüllt werden können, ist verständlich. Darum ruft dämmen und dichten konsequenterweise nach belüften. CO 2 -Konzentration Wir atmen Sauerstoff und produzieren CO2. Steigt dieser Wert über 1500 ppm (0.15 %), so empfinden wird dies als dicke Luft. Problematisch wird dies vor allem im Schlafzimmer. Hier werden schnell Werte über 3000 ppm gemessen. Luftwechsel Jeder Raum wird mit der aus hygienischer Sicht optimalen Frischluftmenge versorgt. Die Luftfeuchtigkeit ist ausgeglichen. Luftqualität Die Aussenluft wird nach Möglichkeit gefiltert. Schadstoffe im Gebäude (Wohngifte, Tabakrauch, Radon) werden kontinuierlich abgeführt. Ein Lüftungssystem nach Minergie-Standard erfüllt 7 Anforderungen an den Komfort und den Betrieb. Thermischer Komfort Der gezielte Luftaustausch verhindert Zugerscheinungen und ein Auskühlen der Räume. Schallschutz Das Lüftungssystem schützt vor Aussenlärm, Schalldämpfer sorgen dafür, dass die Ventilatoren nicht stören. Energieverbrauch Die Wärmeverluste beim Lüften werden auf ein Minimum beschränkt. Einige Systeme gewinnen aus der Abluft Wärme zu Heizzwecken oder zur Wassererwärmung zurück. Bedienung Der Betrieb erfolgt automatisch. Zeitprogramm und Betriebsstufen sind individuell programmierbar. Zwei- bis viermal jährlich sind die Filter auszuwechseln. Technik Die Bauteile des Lüftungssystems sind für den Dauerbetrieb konzipiert. 16
19 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Ausgewählte Systeme Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung Häufigstes Lüftungssystem in Minergie-Häusern Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Dienstleistungsbauten und Schulen. Geeignet für Altbauten und Neubauten. Wärmerückgewinnung (WRG) zur Reduktion der Lüftungswärmeverluste und zur Vorwärmung der Zuluft. Abbildung 14: Schema Komfortlüftung mit WRG-Gerät Zentrale oder wohnungsweise Anlagen Einstufiger oder mehrstufiger Betrieb Kombination mit Erdregister oder verlängertem Luftansaug möglich: garantiert passiven Frostschutz beim Lüftungsgerät im Winter und komfortable Zulufttemperaturen ohne Nachwärmung Bei Anlagen mit Elektroheizregister zur Zuluftnachwärmung muss der Elektrizitätsverbrauch beim Minergie-Nachweis berücksichtigt werden. Komfortlüftung mit Abluftwärmepumpe Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Dienstleistungsbauten und Schulen. Kombination mit Erdregister empfehlenswert. Zusätzlich zur WRG: Wärmepumpe nutzt Abluftwärme zur Warmwasserbereitung oder Zuluftnachwärmung. Abbildung 15: Schema Komfortlüftung mit Abluftwärmepumpe Luftmengen und Elektrizitätsverbrauch der Ventilatoren höher als bei Komfortlüftung mit WRG. Anlagen mit Luft-Wasser-Wärmepumpen für Einfamilienhäuser fördern mehr Luft, als aus hygienischen Gründen notwendig wäre. Bei Anlagen mit Elektroheizregister zur Zuluftnachwärmung muss der Elektrizitätsverbrauch beim Minergie-Nachweis berücksichtigt werden. 17
20 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie 7. Komponenten Komfortlüftung Aussenluftfassung und Luftregister Der Standort des Luftansauges muss so gewählt werden, dass sich keine Schadstoffe (Autoabgase) oder störende Gerüche in der Nähe der Aussenluftfassung befinden. Zudem muss mittels Schutzgitter sichergestellt werden, dass keine Kleintiere (z.b. Mäuse oder Vögel) in das Erdregister eindringen können. Es sollte ca. 2.5 m über Terrain angesogen werden (max. Schneehöhe beachten). Wegen der möglichen Bodenbelastung ist auf eine zum Erdreich offene Luftfassung zu verzichten. Es sollten innen glattwandige Rohre (HDPE kein PVC), die wasserdicht verschweisst sind eingesetzt werden. Die Rohre sind mit Gefälle zur Hauseinführung zu verlegen. Im Gebäudeinnern ist ein Kondensatablauf vorzusehen. Die Reinigung erfolgt bei Bedarf mittels Durchspülung von der Luftfassung her. Lufterdregister Beim Lufterdregister (=mehrere Rohre im Abstand von min. 5 x Rohrdurchmesser) ist das Ziel, die WRG und den Filter vor Vereisung bzw. Kondensat zu schützen, das heisst der Erdregister Austritt muss bei minimaler Aussenlufttemperatur immer > 0 C sein. Abbildung 16: Lufterdregister aus HPE mit Sammel- und Verteilrohren Lüftungsgerät Lüftungsgeräte bestehen aus Wärmetauscher Zuluftventilator, Abluftventilator Zwei Filtern, meist Grobstaubfilter G3 Bypass Wärmetauscher und Regelung (optional) 18 Kernstück der Wärmerückgewinnung ist ein Plattenwärmetauscher und Rotationswämretauscher, in dem sich die Temperaturdifferenz zwischen der
21 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie warmen Abluft aus den Räumen und der kalten Aussenluft zum grössten Teil ausgleicht. Die Höhe dieses Temperaturausgleichs wird als Wirkungsgrad oder Rückwärmezahl bezeichnet. Gute Geräte weisen Wirkungsgrade von über 80 % aus. Dadurch wird auch eine Nachwärmung der Zuluft hinfällig. Ventilatorleistung Die unten genannten Werte lassen sich praktisch nur mit Ventilatorantrieben mit Gleichstrom- oder EC-Motoren erreichen. Zudem muss das Verteilsystem gemäss diesem Merkblatt dimensioniert sein. Spezifische Leistung für die Luftförderung P el /V Zu- und Abluft mit WRG, einfache Filter (G3 bis F4) 0.35 (W/m 3 /h) Zu- und Abluft mit WRG, Pollenfilter (F5 bis F9) 0.40 (W/m 3 /h) Kontrolle: Die Kontrollmessung zur Bestimmung der Kennzahl P el /V wird mit neuen Filtern durchgeführt. P el : elektrische Aufnahmeleistung in W V: Mittelwert von Zu- und Abluftvolumenstrom in m 3 /h. Abbildung 17: Schnitt durch Komfortlüftungsgerät 19
22 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Abbildung 18: Zellenfilter Filter Aussen- und abluftseitig ist das Gerät mindestens mit Filtern der Klasse G3 ausgerüstet. Bei Wohnungen für Pollen-Allergiker hat die Aussenluftseite einen Filter der Klasse F5 bis F9. Ein Pollenfilter soll in jedem Fall nachrüstbar sein. Die Platzierung als zweite Filterstufe nach dem Gerät (statt als erste Stufe im Gerät) ist hygienisch von Vorteil. Die Filter der ersten Stufe sind spätestens nach einem Jahr zu ersetzen, auch wenn sie optisch sauber erscheinen. Pollenfilter, die als zweite Filterstufe eingesetzt werden, sind spätestens alle zwei Jahre zu ersetzen. Taschenfilter sind zu bevorzugen, da sie einen geringeren Druckverlust aufweisen als Filtermatten. Zu- und Abluftvolumenstrom werden gemäss den folgenden Tabellen zuerst getrennt berechnet. Das grössere Total ist für die Dimensionierung massgebend. Auf der Seite mit dem kleineren Total (z.b. Abluft) werden die Werte pro Raum so erhöht, dass das gleiche Total wie auf der anderen Seite (z.b. Zuluft) entsteht. Wenn das berechnete Total auf der Abluftseite kleiner ist, soll zuerst der Abluftvolumenstrom der Küche erhöht werden (je nach Wohnungsgrösse bis auf 60 bis 80 m 3 /h) und erst in zweiter Priorität die Abluftvolumenströme der übrigen Räume. Beispiel Luftmengenauslegung für eine 4-Zimmer-Wohnung: Minimaler Abluftvolumenstrom gem. Tabelle: 100 m 3 /h (Küche 40 m 3 /h + Bad 40 m 3 /h + WC 20 m 3 /h = 100 m 3 /h) Minimaler Zuluftvolumenstrom gem. Tabelle: 120 m 3 /h (4 Zimmer à je 30 m 3 /h = 120 m 3 /h) Der effektiv gewählte Abluftvolumenstrom wird auf 120 m 3 /h erhöht (Küche Erhöhung auf 60 m 3 /h + Bad 40 m 3 /h + WC 20 m 3 /h). Der Zuluftvolumenstrom bleibt beim Wert, der nach Tabelle ermittelt wurde. Schlaf- und Arbeitszimmer Wohnzimmer im Überströmbereich 30 m 3 /h* keine separate Zuluft Wohnzimmer, nicht im Überströmbereich 30 m 3 /h * Bei Schlafzimmern für eine Person in Einfamilienhäusern: in Absprache mit der Bauherrschaft kann bis auf 20 m 3 /h reduziert werden. 20
23 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie 8. Anforderungen an den Schall Die Lüftung soll in den Wohn- und Schlafzimmern einen Schalldruckpegel von ma. 25 db(a) verursachen. In den übrigen Räumen sind höhere Werte gemäss SIA 181 zulässig, wobei der Schall aus diesen Räumen den Schalldruckpegel in den Wohn- und Schlafzimmern nicht erhöhen darf. Bei der akustischen Dimensionierung ist zu berücksichtigen, dass heutige Wohnungen häufig akustisch hart sind (grosse Nachhallzeiten). Überströmung durch Türspalt Die allfällige Reduktion des Schalldämmmasses der Türen (z.b. durch Weglassen einer Planetdichtung) muss akzeptiert werden. Die Luftgeschwindigkeit im Türspalt soll bei max. 1.5 m/s liegen. Schallgedämmte Überströmdurchlässe Überströmdurchlässe in Wänden mit einer Türe sollen schalldämpfend ausgebildet sein und ein Schalldämmmass von R w > 1 db aufweisen (bezogen auf den Durchlass alleine). Mit diesem Schalldämmmass bewegen sich die Schwächungen der Türen in einer ähnlichen Grössenordnung wie mit einem Türspalt. In Zimmertrennwänden ohne Türe und mit moderaten Schallschutzanforderungen sollen die Überströmdurchlässe ebenfalls ein R w > 10 db aufweisen. Bei speziellen Schallschutzanforderungen ist ein Akustiker beizuziehen. Überströmdurchlässe sollen einen Druckabfall von maximal 3 Pa haben. 9. Kochstellenabluft Die Dunstabzughaube darf nicht an der Abluft der Komfortlüftung angeschlossen werden. Für die Kochstellenabluft stehen folgende Lösungen zur Wahl: Fortlufthaube mit Nachströmung über Fenster oder Nachströmeinrichtung mit Klappe: Die Zuluft strömt durch den von der Abzughaube erzeugten Unterdruck nach. Der Unterdruck soll ma. 10 Pa betragen, bei Wohnungen mit raumluftabhängigen Feuerungen sogar nur 4 Pa. Umlufthaube mit Aktivkohlenfilter Die Kochstelle ist mit einer Umlufthaube mit Aktivkohlenfilter. Die Kochstelle ist mit einer Umlufthaube mit Aktivkohlenfilter ausgerüstet. Kanalnetz Kanäle und Rohre müssen glattwandig und luftdicht sich, um einen kleinen Strömungswiederstand zu erreichen. Eine möglichst geradlinige Führung erleichtert zudem den Reinigungsintervall. Oft kommen verzinkte Spiralfalzrohre und Kanäle oder PE- Rohre zum Einsatz. Auf jeden Fall muss auf eine dichte Ausführung, im speziellen die Verbindungen, geachtet werden. Abbildung 19: Beispiel Kanalnetz 21
24 Lerneinheit LE 11.1: Gebäude und Energie Die Kanalführung kann in Schächten, Betondecken, Unterlagsböden oder bei Umbauten auch in der Aussenwanddämmung geführt werden. Abbildung 20: Reinigung der Luftleitungen muss gewährleistet sein. 10. Hygiene und Reinigung Glattwandige Leitungen sind besser zu reinigen als gewellte oder poröse Oberflächen. Wenn ein Reinigungsabschnitt nur von einer Seite her (z.b. Auslass) zugänglich ist, soll er max. 12 m lang sein. Bei Zugang von beiden Enden ist die doppelte Länge zulässig. Nicht direkt zugängliche Reinigungsabschnitte sind mit Kontrollöffnungen auszurüsten Bögen (1.5 d) können nur bis zu einem Durchmesser von 80 mm gereinigt werden. Bei kleinen Durchmessern sind grosse Radien oder 2 x 45 Bögen zu wählen. Bauteile, die nicht mit einer Rute gereinigt werden können, sollen nicht einbetoniert werden. Dies betrifft z.b. Schalldämpfer, Reduktionen, Verteilerkästen und Armaturen. Unmittelbar nach der Installation sind die Luftdurchlässe staubdicht zu verschliessen. Die Anlage darf erst nach erfolgter Baureinigung in Betrieb gesetzt werden. Ein Leitungsnetz soll alle 5 Jahre kontrolliert werden. Die Reinigung erfolgt nach Bedarf, spätestens nach 10 Jahren. 22
25
26 Hubrainweg 10, 8124 Maur, Tel , Fax ; Träger: Arbeitsgemeinschaft für Solarenergie SWISSOLAR; Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz, FWS; Haustechnik-Fachlehrvereinigung SSHL; Hochschule Technik+ Architektur Luzern, FHZ; Holzenergie Schweiz; Holzfeuerungen Schweiz; Schweizer Agentur für erneuerbare Energien, AEE; Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, SIA; Schweizerischer Kaminfegermeister-Verband, SKMV; Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec); Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-Ingenieuren, SWKI; Schweizerischer Verein für Kältetechnik, SVK; Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen, usic; Schweizerische Vereinigung für Geothermie, SVG; SOLAR - Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie; SOLAR SUPPORT; Schweizerischer Verband Dach und Wand, SVDW; Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen, VSEI; Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte, VHP; Vereinigung Schweizerischer Sanitär- und Heizungsfachleute, VSSH
Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons
 Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler
Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler
Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen
 1 741.111-A1 Anhang 1 zu Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 (Stand 01.09.2016) Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen Grenzwerte U li in W/(m 2 K) Bauteil Bauteil gegen opake Bauteile
1 741.111-A1 Anhang 1 zu Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 (Stand 01.09.2016) Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen Grenzwerte U li in W/(m 2 K) Bauteil Bauteil gegen opake Bauteile
MINERGIE -P. Energie Apéro Luzern 24. März Thema. Reto von Euw Dipl. Ing. HLK FH; Dipl. Sanitärtechniker
 Energie Apéro Luzern 24. März 2004 Thema MINERGIE -P Reto von Euw Dipl. Ing. HLK FH; Dipl. Sanitärtechniker TS Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut Zentrum für Interdisziplinäre Gebäudetechnik (ZIG)
Energie Apéro Luzern 24. März 2004 Thema MINERGIE -P Reto von Euw Dipl. Ing. HLK FH; Dipl. Sanitärtechniker TS Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut Zentrum für Interdisziplinäre Gebäudetechnik (ZIG)
Funktionsweise. Planung & Ausführung
 Komfortlüftung Komfortlüftung Für ein gesundes, angenehmes Raumklima ist regelmäßiges Lüften erforderlich. Der Frischluftbedarf hängt von der Personenanzahl und Raumnutzung ab, die notwendige Lüftungsdauer
Komfortlüftung Komfortlüftung Für ein gesundes, angenehmes Raumklima ist regelmäßiges Lüften erforderlich. Der Frischluftbedarf hängt von der Personenanzahl und Raumnutzung ab, die notwendige Lüftungsdauer
So funktioniert eine Komfortlüftung
 So funktioniert eine Komfortlüftung So einfach funktioniert eine kontrollierte Wohnraumlüftung Das Prinzip einer kontrollierten Lüftung ist einfach: Verbrauchte Luft aus Bad, WC oder Küche wird abgesogen
So funktioniert eine Komfortlüftung So einfach funktioniert eine kontrollierte Wohnraumlüftung Das Prinzip einer kontrollierten Lüftung ist einfach: Verbrauchte Luft aus Bad, WC oder Küche wird abgesogen
Praxistest MINERGIE. Erfolgskontrollen an 52 Wohnbauten Verbrauchsdatenauswertung von 506 Wohnbauten
 Praxistest MINERGIE Erfolgskontrollen an 52 Wohnbauten Verbrauchsdatenauswertung von 506 Wohnbauten Silvia Gemperle Projektleiterin Energie und Bauen Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen Hält
Praxistest MINERGIE Erfolgskontrollen an 52 Wohnbauten Verbrauchsdatenauswertung von 506 Wohnbauten Silvia Gemperle Projektleiterin Energie und Bauen Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen Hält
Das Passivhaus - Funktionsweise
 Das Passivhaus - Funktionsweise Dr. Harald Krause B.Tec Dr. Krause & Kirmayr, Rosenheim www.btec-rosenheim.de 1. Passivhaustagung Tirol 27./28. Juni 2003 1 Grundlagen Projektierung Haustechnik Beispiele
Das Passivhaus - Funktionsweise Dr. Harald Krause B.Tec Dr. Krause & Kirmayr, Rosenheim www.btec-rosenheim.de 1. Passivhaustagung Tirol 27./28. Juni 2003 1 Grundlagen Projektierung Haustechnik Beispiele
Mehr Sonnenenergie in Graubünden. Fördermöglichkeiten. Energie-Apéro
 Mehr Sonnenenergie in Graubünden Fördermöglichkeiten Energie-Apéro 20.06.2007 Andrea Lötscher, Gliederung Energie heute Energie morgen Schwerpunkte der Energiepolitik in Graubünden Fördermöglichkeiten
Mehr Sonnenenergie in Graubünden Fördermöglichkeiten Energie-Apéro 20.06.2007 Andrea Lötscher, Gliederung Energie heute Energie morgen Schwerpunkte der Energiepolitik in Graubünden Fördermöglichkeiten
DAS AUSSTELLUNGS- UND BÜROGEBÄUDE ALS PASSIVHAUS PROJEKTBERICHT DIPL.-ING. OLIVER RÜCKNER G2R ARCHITEKTEN
 AKTIV IN DIE ZUKUNFT M I T D E M B Ü R O U N D A U S S T E L L U N G S H A U S I N P A S S I V H A U S B A U W E I S E FASZINATION PASSIVHAUS ENERGIEEFFIZIENT NACHHALTIG Das Passivhaus hat einen Heizwärmebedarf
AKTIV IN DIE ZUKUNFT M I T D E M B Ü R O U N D A U S S T E L L U N G S H A U S I N P A S S I V H A U S B A U W E I S E FASZINATION PASSIVHAUS ENERGIEEFFIZIENT NACHHALTIG Das Passivhaus hat einen Heizwärmebedarf
Energieeffizienz: statisches versus dynamisches Modell. Werner Waldhauser dipl. HLK-Ing. HTL/SIA Waldhauser Haustechnik, Basel
 Energieeffizienz: statisches versus dynamisches Modell Werner Waldhauser dipl. HLK-Ing. HTL/SIA Waldhauser Haustechnik, Basel Energiebedarfsprognosen Prognose Verbrauch? kleiner U-Wert = kleiner Verbrauch?
Energieeffizienz: statisches versus dynamisches Modell Werner Waldhauser dipl. HLK-Ing. HTL/SIA Waldhauser Haustechnik, Basel Energiebedarfsprognosen Prognose Verbrauch? kleiner U-Wert = kleiner Verbrauch?
Passivhaus in Neufahrn
 Passivhaus in Neufahrn Thermische Solaranlage Südseite Photovoltaikanlagen In der guten alten Zeit benötigte man pro Quadratmeter Wohnfläche noch über 200 kwh an Heizenergie pro Jahr, das entspricht ca.
Passivhaus in Neufahrn Thermische Solaranlage Südseite Photovoltaikanlagen In der guten alten Zeit benötigte man pro Quadratmeter Wohnfläche noch über 200 kwh an Heizenergie pro Jahr, das entspricht ca.
Sanieren nach Minergie. Marco Ragonesi - c/o Ragonesi Strobel & Partner AG - Bauphysik & Technische Kommunikation - Luzern
 Sanieren nach Minergie 1 Sanieren nach Minergie Anforderung 2007 für Wohnen EFH/MFH für Bauten vor 1990 Gebäudehülle: Primäranforderung Q h max. 120 % von H g Gewichtete Energiekennzahl: 80 kwh/m 2 Lüftung:
Sanieren nach Minergie 1 Sanieren nach Minergie Anforderung 2007 für Wohnen EFH/MFH für Bauten vor 1990 Gebäudehülle: Primäranforderung Q h max. 120 % von H g Gewichtete Energiekennzahl: 80 kwh/m 2 Lüftung:
Studie EnEV 2002 BRUCK ZUM GLÜCK GIBT S. Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV
 ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
Passivhaus. Ein Haus mit Zukunft
 Ein Haus mit Zukunft Im Sommer angenehm kühl, im Winter behaglich warm, immer frische Raumluft und das alles dauerhaft bezahlbar, selbst bei steigenden Energiekosten! Was ist ein Passivhaus? Im Prinzip
Ein Haus mit Zukunft Im Sommer angenehm kühl, im Winter behaglich warm, immer frische Raumluft und das alles dauerhaft bezahlbar, selbst bei steigenden Energiekosten! Was ist ein Passivhaus? Im Prinzip
Moosburger Bauseminar Lüften und Energiesparen
 Moosburger Bauseminar Lüften und Energiesparen Hans Stanglmair in Vertretung für Gerhard Scholz Gerhard Scholz Lüftung Solarfreunde Moosburg 1 Warum Lüften? Bild: Bine- Info Gerhard Scholz Lüftung Solarfreunde
Moosburger Bauseminar Lüften und Energiesparen Hans Stanglmair in Vertretung für Gerhard Scholz Gerhard Scholz Lüftung Solarfreunde Moosburg 1 Warum Lüften? Bild: Bine- Info Gerhard Scholz Lüftung Solarfreunde
Warum überhaupt mechanische Lüftung in der Sanierung? Lüftung in der Gebäudesanierung. Kurzporträt solaresbauen GmbH
 Lüftung in der Gebäudesanierung Martin Ufheil solaresbauen GmbH Emmy-Noether-Str. 2 79110 Freiburg Tel.: 0761 / 45688-30 www.solares-bauen.de Kurzporträt solaresbauen GmbH Gebäude Energiekonzepte Bauphysik
Lüftung in der Gebäudesanierung Martin Ufheil solaresbauen GmbH Emmy-Noether-Str. 2 79110 Freiburg Tel.: 0761 / 45688-30 www.solares-bauen.de Kurzporträt solaresbauen GmbH Gebäude Energiekonzepte Bauphysik
380/1-Nachweis :49 Projektwert = 69 MJ/m2
 Akten-Nr: Projekt: Mustergebäude in Zürich Haus: Testbeispiel Eco - Standardgebäude Projektadresse: Musterstrasse 10, 8000 Zürich Kanton: Zürich Bauherrschaft: Kontaktperson: evt. BauherrschaftvertreterIn:
Akten-Nr: Projekt: Mustergebäude in Zürich Haus: Testbeispiel Eco - Standardgebäude Projektadresse: Musterstrasse 10, 8000 Zürich Kanton: Zürich Bauherrschaft: Kontaktperson: evt. BauherrschaftvertreterIn:
VIESMANN VITOVENT 300
 VIESMANN VITOVENT 300 Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOVENT 300 Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung, ohne Bypass-Schaltung Luftvolumenstrom bis 180 m 3 /h Zur bedarfsgerechten
VIESMANN VITOVENT 300 Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOVENT 300 Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung, ohne Bypass-Schaltung Luftvolumenstrom bis 180 m 3 /h Zur bedarfsgerechten
Gesundheit und Behaglichkeit
 Gesundheitsaspekte Gesundheit und Behaglichkeit Mehr als 80% seiner Zeit verbringt der Mensch innerhalb von vier Wänden. Das psychische Wohlbefinden wird massgeblich durch das Raumklima beeinflusst. Eine
Gesundheitsaspekte Gesundheit und Behaglichkeit Mehr als 80% seiner Zeit verbringt der Mensch innerhalb von vier Wänden. Das psychische Wohlbefinden wird massgeblich durch das Raumklima beeinflusst. Eine
Ab jetzt kontrolliert frische Luft atmen! Aquavent kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. So wohnt Frischluft!
 Ab jetzt kontrolliert frische Luft atmen! Aquavent kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung So wohnt Frischluft! Aquavent Wohnqualität ohne Lüftungswärmeverlust Ihre Bedürfnisse unsere Lösungen
Ab jetzt kontrolliert frische Luft atmen! Aquavent kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung So wohnt Frischluft! Aquavent Wohnqualität ohne Lüftungswärmeverlust Ihre Bedürfnisse unsere Lösungen
Anwendungen der Vorschriften bei Umbauten
 1 Anwendungen der Vorschriften bei Umbauten Anwendungen der Vorschriften bei Umbauten Einzelbauteilanforderungen Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien Systemanforderungen Häufige Fragen 2 Nachweisarten
1 Anwendungen der Vorschriften bei Umbauten Anwendungen der Vorschriften bei Umbauten Einzelbauteilanforderungen Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien Systemanforderungen Häufige Fragen 2 Nachweisarten
EnerSearch. Intelligente Lüftungssysteme
 EnerSearch Intelligente Lüftungssysteme Wohlfühlen mit EnerSearch Frische Luft wie in der freien Natur, Wohlfühlen ohne Schadstoffe und vor allem kein Schimmel und keine feuchten Wände die Lüftungssysteme
EnerSearch Intelligente Lüftungssysteme Wohlfühlen mit EnerSearch Frische Luft wie in der freien Natur, Wohlfühlen ohne Schadstoffe und vor allem kein Schimmel und keine feuchten Wände die Lüftungssysteme
5 Jahre nachhaltiges Leben im Passivhaus
 Prof. W. Ertel 1 5 Jahre nachhaltiges Leben im Passivhaus Mittwochseminar Fachhochschule Ravensburg-Weingarten 23.6.2004 Prof. Dr. Wolfgang Ertel Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Postfach 1261 D-88241
Prof. W. Ertel 1 5 Jahre nachhaltiges Leben im Passivhaus Mittwochseminar Fachhochschule Ravensburg-Weingarten 23.6.2004 Prof. Dr. Wolfgang Ertel Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Postfach 1261 D-88241
Anhang 1: Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern (vgl. Art. 14 Abs. 1)
 Anhang 750. Anhang : Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern (vgl. Art. 4 Abs. ) Speicherinhalt in Litern Dämmstärke bei > 0,03 W/mK bis 0,05 W/mK bis 400 0 mm 90
Anhang 750. Anhang : Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern (vgl. Art. 4 Abs. ) Speicherinhalt in Litern Dämmstärke bei > 0,03 W/mK bis 0,05 W/mK bis 400 0 mm 90
VIESMANN VITOVENT 300-W Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung
 VIESMANN VITOVENT 300-W Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOVENT 300-W Zentrales Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung zur bedarfsgerechten
VIESMANN VITOVENT 300-W Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOVENT 300-W Zentrales Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung zur bedarfsgerechten
Anhang 1. unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich [W/ m²k] weniger als 2 m im Erdreich [W/ m² K] Neubau Umbau/ Umnutzung
![Anhang 1. unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich [W/ m²k] weniger als 2 m im Erdreich [W/ m² K] Neubau Umbau/ Umnutzung Anhang 1. unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich [W/ m²k] weniger als 2 m im Erdreich [W/ m² K] Neubau Umbau/ Umnutzung](/thumbs/29/13748808.jpg) Energieverordnung Anhang 1 772.110 Anhang 1 a) Einzelanforderungen an den winterlichen Wärmeschutz Für die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) von flächigen Bauteilen gelten die nachstehenden Grenzwerte.
Energieverordnung Anhang 1 772.110 Anhang 1 a) Einzelanforderungen an den winterlichen Wärmeschutz Für die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) von flächigen Bauteilen gelten die nachstehenden Grenzwerte.
Renovationsprojekt La Cigale
 ZIG Planertagung 25.3.2015, Luzern Renovationsprojekt La Cigale Dr. Lukas Küng Hochschule Luzern, 25.3.2015 1 Inhalt Über BG Wieso energetische Renovationen? Überblick "la cigale" Genf Vergleich der Heizsysteme
ZIG Planertagung 25.3.2015, Luzern Renovationsprojekt La Cigale Dr. Lukas Küng Hochschule Luzern, 25.3.2015 1 Inhalt Über BG Wieso energetische Renovationen? Überblick "la cigale" Genf Vergleich der Heizsysteme
Wärmebrücken bei der Gebäudemodernisierung für typische Wohnbauten vor ERFA September 2014 Silvia Gemperle, Leiterin Energie + Bauen
 Wärmebrücken bei der Gebäudemodernisierung für typische Wohnbauten vor 1980 ERFA September 2014 Silvia Gemperle, Leiterin Energie + Bauen Energetisches Potenzial von Gebäudemodernisierungen im Kanton SG
Wärmebrücken bei der Gebäudemodernisierung für typische Wohnbauten vor 1980 ERFA September 2014 Silvia Gemperle, Leiterin Energie + Bauen Energetisches Potenzial von Gebäudemodernisierungen im Kanton SG
Kontrollierte Wohnraumlüftung
 Kontrollierte Wohnraumlüftung Kontrollierte Wohnraumlüftung Für ein gesundes, angenehmes Raumklima ist regelmäßiges Lüften erforderlich. Der Frischluftbedarf hängt von der Personenanzahl und Raumnutzung
Kontrollierte Wohnraumlüftung Kontrollierte Wohnraumlüftung Für ein gesundes, angenehmes Raumklima ist regelmäßiges Lüften erforderlich. Der Frischluftbedarf hängt von der Personenanzahl und Raumnutzung
Gebäude erneuern Energieverbrauch halbieren. Wie mit gezielten Massnahmen der Energieverbrauch im Einfamilienhaus auf die Hälfte reduziert wird
 Gebäude erneuern Energieverbrauch halbieren Wie mit gezielten Massnahmen der Energieverbrauch im Einfamilienhaus auf die Hälfte reduziert wird Gebäude erneuern Energieverbrauch halbieren Impressum Projektbegleitung
Gebäude erneuern Energieverbrauch halbieren Wie mit gezielten Massnahmen der Energieverbrauch im Einfamilienhaus auf die Hälfte reduziert wird Gebäude erneuern Energieverbrauch halbieren Impressum Projektbegleitung
Energie sparen Lebensqualität gewinnen! Hoval Wohnraumlüftung
 Energie sparen Lebensqualität gewinnen! Hoval Wohnraumlüftung Warum Wohnraumlüftung? Früher hatten wir auch keine Lüftung Warum jetzt? Altbauten Neubau / Sanierung Energiekennzahl ~100 kwh/m²a Energiekennzahl
Energie sparen Lebensqualität gewinnen! Hoval Wohnraumlüftung Warum Wohnraumlüftung? Früher hatten wir auch keine Lüftung Warum jetzt? Altbauten Neubau / Sanierung Energiekennzahl ~100 kwh/m²a Energiekennzahl
Energieberatungsbericht
 Projekt: Einfamilienhaus, Medlerstraße 68, 06618 Naumburg Energieberatungsbericht Gebäude: Medlerstraße 68 06618 Naumburg Auftraggeber: Frau Heidemarie Töpp Medlerstraße 68 06618 Naumburg Erstellt von:
Projekt: Einfamilienhaus, Medlerstraße 68, 06618 Naumburg Energieberatungsbericht Gebäude: Medlerstraße 68 06618 Naumburg Auftraggeber: Frau Heidemarie Töpp Medlerstraße 68 06618 Naumburg Erstellt von:
Anhang 1. Standardlösungen
 Anhang 1 Standardlösungen 1. Verbesserte Wärmedämmung U-Wert der opaken Bauteile gegen aussen höchstens 0,12 W/m 2 K U-Wert der Fenster höchstens 1,0 W/m 2 K 2. Verbesserte Wärmedämmung und Komfortlüftung
Anhang 1 Standardlösungen 1. Verbesserte Wärmedämmung U-Wert der opaken Bauteile gegen aussen höchstens 0,12 W/m 2 K U-Wert der Fenster höchstens 1,0 W/m 2 K 2. Verbesserte Wärmedämmung und Komfortlüftung
EnergiePraxis-Seminar 2 / 2007 Wärmedämmvorschriften (WDV) 2008. Neuerungen und Höchstanteil an nichterneuerbarer Energien.
 Wärmedämmvorschriften (WDV) 2008 Neuerungen und Höchstanteil an nichterneuerbarer Energien Nov./Dez. Zürich, 2007 Übersicht Wärmedämmvorschriften (WDV) 2008 Norm SIA 380/1, Ausgabe 2007 Einzel-U-Werte
Wärmedämmvorschriften (WDV) 2008 Neuerungen und Höchstanteil an nichterneuerbarer Energien Nov./Dez. Zürich, 2007 Übersicht Wärmedämmvorschriften (WDV) 2008 Norm SIA 380/1, Ausgabe 2007 Einzel-U-Werte
Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren. Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014)
 Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) Inhaltsübersicht Stromverbrauch und Einflussmöglichkeiten Anforderungen
Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) Inhaltsübersicht Stromverbrauch und Einflussmöglichkeiten Anforderungen
DPG - Frühjahrstagung Haustechniksystem AEREX für Passivhäuser - Technik und Erfahrungen
 DPG - Frühjahrstagung 2003 Haustechniksystem AEREX für Passivhäuser - Technik und Erfahrungen Dr. Gerhard Kirchner MAICO Ventilatoren Inhalt Motivation Anforderungen an ein Haustechniksystem Umsetzung
DPG - Frühjahrstagung 2003 Haustechniksystem AEREX für Passivhäuser - Technik und Erfahrungen Dr. Gerhard Kirchner MAICO Ventilatoren Inhalt Motivation Anforderungen an ein Haustechniksystem Umsetzung
Energieinstitut Vorarlberg. Moderne Gebäudetechnik bei energieeffizienten Gebäuden. DI (FH) Michael Braun, M.Sc. Energieinstiut Vorarlberg
 Energieinstitut Vorarlberg Moderne Gebäudetechnik bei energieeffizienten Gebäuden Dipl.-Ing. (FH) Michael Braun, M.Sc. DI (FH) Michael Braun, M.Sc. Energieinstiut Vorarlberg Komfortlüftung Verteilung Energieverbrauch
Energieinstitut Vorarlberg Moderne Gebäudetechnik bei energieeffizienten Gebäuden Dipl.-Ing. (FH) Michael Braun, M.Sc. DI (FH) Michael Braun, M.Sc. Energieinstiut Vorarlberg Komfortlüftung Verteilung Energieverbrauch
Vorteile der Komfortlüftung
 - Abfuhr von Feuchtigkeit - Abfuhr von Gerüchen - Frische Luft bei geschlossenen Fenstern: bedeutet Schutz vor - Lärm -Staub - Pollen - kalter/heisser Luft - Schimmelpilz Vorteile der Komfortlüftung Mehr
- Abfuhr von Feuchtigkeit - Abfuhr von Gerüchen - Frische Luft bei geschlossenen Fenstern: bedeutet Schutz vor - Lärm -Staub - Pollen - kalter/heisser Luft - Schimmelpilz Vorteile der Komfortlüftung Mehr
Wirtschaftlichkeit verschiedener Luftführungssysteme in Industriehallen
 Wirtschaftlichkeit verschiedener Luftführungssysteme in Industriehallen Dipl.-Ing. Detlef Makulla Leiter Forschung & Entwicklung der Caverion Deutschland GmbH, Aachen Auswirkungen auf Energiekosten und
Wirtschaftlichkeit verschiedener Luftführungssysteme in Industriehallen Dipl.-Ing. Detlef Makulla Leiter Forschung & Entwicklung der Caverion Deutschland GmbH, Aachen Auswirkungen auf Energiekosten und
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber: Erstellt von: Herr Rainer Nowotny Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Planungsbüro Baukasten Dipl.-Ing. Architekt (FH) Christian
Energieberatungsbericht Gebäude: Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Auftraggeber: Erstellt von: Herr Rainer Nowotny Brüssower Allee 90 17291 Prenzlau Planungsbüro Baukasten Dipl.-Ing. Architekt (FH) Christian
Heizungsersatz. Christian Leuenberger. Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse Zürich
 Heizungsersatz Christian Leuenberger Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse 31 8005 Zürich www.leupro.ch Inhaltsverzeichnis 1. Wie gehe ich vor? 2. Energieträger und Heizsysteme: Nahwärme,
Heizungsersatz Christian Leuenberger Leuenberger Energie- und Umweltprojekte GmbH Quellenstrasse 31 8005 Zürich www.leupro.ch Inhaltsverzeichnis 1. Wie gehe ich vor? 2. Energieträger und Heizsysteme: Nahwärme,
941.22. Anhang 1. Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO)
 Anhang 94.22 Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO) Soweit nicht anderes bestimmt ist, gelten als Stand der Technik:. Norm SIA 80 "Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau", Ausgabe 999 2. Norm SIA 380/ "Thermische
Anhang 94.22 Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO) Soweit nicht anderes bestimmt ist, gelten als Stand der Technik:. Norm SIA 80 "Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau", Ausgabe 999 2. Norm SIA 380/ "Thermische
Anmeldung für thermographische Untersuchungen
 irscat ag bauteil- und bauwerkscanning Aawasserstrasse 10 CH 6370 Oberdorf NW Beiblatt 1: Anmeldung für thermographische Untersuchungen Hiermit erteile ich der irscat ag den Auftrag für die thermographischen
irscat ag bauteil- und bauwerkscanning Aawasserstrasse 10 CH 6370 Oberdorf NW Beiblatt 1: Anmeldung für thermographische Untersuchungen Hiermit erteile ich der irscat ag den Auftrag für die thermographischen
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
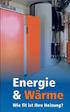 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Mehr Komfort im MINERGIE Haus durch effiziente Luftverteilung
 Mehr Komfort im MINERGIE Haus durch effiziente Luftverteilung Energie Praxis Seminare, 12.11. bis 1.12.2014 1. Die wichtigsten Vorteile im MINERGIE Haus bietet die Komfortlüftung 2. Mit effizienter Luftverteilung
Mehr Komfort im MINERGIE Haus durch effiziente Luftverteilung Energie Praxis Seminare, 12.11. bis 1.12.2014 1. Die wichtigsten Vorteile im MINERGIE Haus bietet die Komfortlüftung 2. Mit effizienter Luftverteilung
EnEV-Praxis 2009 Wohnbau
 Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dr.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis 2009 Wohnbau leicht und verständlich 3., aktualisierte Auflage ~auwerk Inhaltsverzeichnis EnEV-Praxis EnEV 2009 für Wohngebäude -.leicht
Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dr.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis 2009 Wohnbau leicht und verständlich 3., aktualisierte Auflage ~auwerk Inhaltsverzeichnis EnEV-Praxis EnEV 2009 für Wohngebäude -.leicht
Projektbeispiel: Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren
 Projektbeispiel: Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren Baujahr: 1965 Keller: unbeheizt Dachgeschoss: nicht ausgebaut 2 Wohneinheiten je 80m² Ein typisches Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren. Das Projektbeispiel
Projektbeispiel: Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren Baujahr: 1965 Keller: unbeheizt Dachgeschoss: nicht ausgebaut 2 Wohneinheiten je 80m² Ein typisches Zweifamilienhaus aus den 60er Jahren. Das Projektbeispiel
Dr. Annick Lalive d Epinay, Amt für Hochbauten Stadt Zürich Der Beitrag der Gebäude
 Dr. Annick Lalive d Epinay, Amt für Hochbauten Stadt Zürich Der Beitrag der Gebäude 2000-Watt-Gesellschaft Der Beitrag der Gebäude vom 2. Dezember 2011 «Wir bauen die 2000-Watt-Gesellschaft: Erfahrungen
Dr. Annick Lalive d Epinay, Amt für Hochbauten Stadt Zürich Der Beitrag der Gebäude 2000-Watt-Gesellschaft Der Beitrag der Gebäude vom 2. Dezember 2011 «Wir bauen die 2000-Watt-Gesellschaft: Erfahrungen
Massnahmen Gebäudehülle Gebäudehülle erneuern: Vorgehensweise, Tipps und einfache Massnahmen
 Massnahmen Gebäudehülle Gebäudehülle erneuern: Vorgehensweise, Tipps und einfache Massnahmen 1 Energiegewinne und -verluste am Gebäude Energieverluste über die Bauteile, beispielsweise Fenster und Wände
Massnahmen Gebäudehülle Gebäudehülle erneuern: Vorgehensweise, Tipps und einfache Massnahmen 1 Energiegewinne und -verluste am Gebäude Energieverluste über die Bauteile, beispielsweise Fenster und Wände
MASSIVHAUS - PASSIVHAUS
 MASSIVHAUS - PASSIVHAUS Teil 1 Der Passivhaus-Standard OIB-2020 nationaler Plan Dawid Michulec 1991 Darmstadt-Kranichstein; Dr. Wolfgang Feist (1. Passivhaus) 2006 Dreherstrasse, 1110 Wien (Passivhaus)
MASSIVHAUS - PASSIVHAUS Teil 1 Der Passivhaus-Standard OIB-2020 nationaler Plan Dawid Michulec 1991 Darmstadt-Kranichstein; Dr. Wolfgang Feist (1. Passivhaus) 2006 Dreherstrasse, 1110 Wien (Passivhaus)
Frostfreihaltungsstrategien
 Komfortlüftungsinfo Nr. 15 Frostfreihaltungsstrategien Inhalt 1. Allgemeines 2. Wesentliche Frostschutzstrategien 3. Wahl des Vereisungsschutzes Begründung der Reihenfolge 4. Zusammenhang Wärmerückgewinnung
Komfortlüftungsinfo Nr. 15 Frostfreihaltungsstrategien Inhalt 1. Allgemeines 2. Wesentliche Frostschutzstrategien 3. Wahl des Vereisungsschutzes Begründung der Reihenfolge 4. Zusammenhang Wärmerückgewinnung
Einsatzbereiche der Solarenergie
 Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 Kapitelüberschrift Fragen Stichworte Seite Solarenergie aktiv und passiv nutzen Wie kann Solarenergie genutzt werden? Wie wird Solarenergie passiv genutzt? Wie wird Solarenergie
Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 Kapitelüberschrift Fragen Stichworte Seite Solarenergie aktiv und passiv nutzen Wie kann Solarenergie genutzt werden? Wie wird Solarenergie passiv genutzt? Wie wird Solarenergie
EnergiePraxis-Seminar, Herbst/Winter SIA 384/1: Heizungsanlagen in Gebäuden Grundlagen und Anforderungen
 SIA 384/1:2008 EnergiePraxis-Seminar, Herbst/Winter 2008 SIA 384/1: Heizungsanlagen in Gebäuden Grundlagen und Anforderungen Neuerungen für Heizungsanlagen und Wärmepumpen Referenten: Reto Gadola, Heinrich
SIA 384/1:2008 EnergiePraxis-Seminar, Herbst/Winter 2008 SIA 384/1: Heizungsanlagen in Gebäuden Grundlagen und Anforderungen Neuerungen für Heizungsanlagen und Wärmepumpen Referenten: Reto Gadola, Heinrich
Endpräsentation. Energiebedarfserhebung
 Endpräsentation Energiebedarfserhebung Rücklaufquote 9,21 % Danke für die Mitarbeit! Rücklaufquoten Fragebögen Private Haushalte 127 von 1415 8,98 % Landwirts. Haushalte 21 von 225 9,33 % Gewerbe-Betriebe
Endpräsentation Energiebedarfserhebung Rücklaufquote 9,21 % Danke für die Mitarbeit! Rücklaufquoten Fragebögen Private Haushalte 127 von 1415 8,98 % Landwirts. Haushalte 21 von 225 9,33 % Gewerbe-Betriebe
Wärmedämmung und Lüftung im Untergeschoss
 Energie-Apéro, 14. Nov. 2012, Chur / Poschiavo Wärmedämmung und Lüftung im Untergeschoss Alex Herzog, Abt. Energie, AWEL Kanton Zürich Ausgangslage Wo lagern Sie Ihre Wintermäntel im Sommer? Und wo trocknet
Energie-Apéro, 14. Nov. 2012, Chur / Poschiavo Wärmedämmung und Lüftung im Untergeschoss Alex Herzog, Abt. Energie, AWEL Kanton Zürich Ausgangslage Wo lagern Sie Ihre Wintermäntel im Sommer? Und wo trocknet
Münchner Energiespartage im Bauzentrum November 2015 Verschärfung der EnEV für Neubauten ab Was bedeutet das für Kauf und Planung?
 Münchner Energiespartage im Bauzentrum 14. 15. November 2015 Verschärfung der EnEV für Neubauten ab 1.1.2016. Was bedeutet das für Kauf und Planung? Dipl.Ing. Renate Schulz, Architektin Bauherrenberaterin
Münchner Energiespartage im Bauzentrum 14. 15. November 2015 Verschärfung der EnEV für Neubauten ab 1.1.2016. Was bedeutet das für Kauf und Planung? Dipl.Ing. Renate Schulz, Architektin Bauherrenberaterin
Merkblatt «Höchstanteil-Standardlösungen zu SIA 380/1, Ausgabe 2007»
 Merkblatt «Höchstanteil-Standardlösungen zu SIA 380/1, Ausgabe 2007» Dieses Merkblatt zeigt die Anpassungen in den Vorschriften betreffend «Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien» (oft bezeichnet als
Merkblatt «Höchstanteil-Standardlösungen zu SIA 380/1, Ausgabe 2007» Dieses Merkblatt zeigt die Anpassungen in den Vorschriften betreffend «Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien» (oft bezeichnet als
Die Zukunft im Massiv-Passivhaus. Alles aus einer Hand. Das Klas- Passivhaus. klas haus
 Die Zukunft im Massiv-Passivhaus Alles aus einer Hand. Das Klas- Passivhaus klas haus Was ist das Klas-Passivhaus? Dieses Haus stellt die höchste Qualität im Gebäudebau dar. Es ist ein hervorragendes Beispiel
Die Zukunft im Massiv-Passivhaus Alles aus einer Hand. Das Klas- Passivhaus klas haus Was ist das Klas-Passivhaus? Dieses Haus stellt die höchste Qualität im Gebäudebau dar. Es ist ein hervorragendes Beispiel
U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten (SIA-Norm 380/1, Ausgabe 2009)
 Anhang a U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten (SIA-Norm 380/, Ausgabe 2009) Grenzwerte U li in W/(m 2 K) mit Wärmebrückennachweis Grenzwerte U li in W/(m 2 K) ohne Wärmebrückennachweis Bauteil gegen Bauteil
Anhang a U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten (SIA-Norm 380/, Ausgabe 2009) Grenzwerte U li in W/(m 2 K) mit Wärmebrückennachweis Grenzwerte U li in W/(m 2 K) ohne Wärmebrückennachweis Bauteil gegen Bauteil
VIESMANN VITOVENT 300 Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung
 VIESMANN VITOVENT 300 Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOVENT 300 Zentrales Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung zur bedarfsgerechten
VIESMANN VITOVENT 300 Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOVENT 300 Zentrales Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung zur bedarfsgerechten
AccuFloW Zero DREI ZIELE EIN WEG
 ACCUFLOW ZERO DREI ZIELE EIN WEG küchenbelüftung mit wohnraum lüftungsanlage Das ACCUFLOW ZERO Konzept Eine hocheffiziente Lüftungsanlage für die Be- und Entlüftung von Wohngebäuden sowie der Entlüftung
ACCUFLOW ZERO DREI ZIELE EIN WEG küchenbelüftung mit wohnraum lüftungsanlage Das ACCUFLOW ZERO Konzept Eine hocheffiziente Lüftungsanlage für die Be- und Entlüftung von Wohngebäuden sowie der Entlüftung
Ausgangslage für Haustechnikplaner und Installateure
 Ausgangslage für Haustechnikplaner und Installateure Anforderungen Allgemeine Kriterien (Kriterien sind verallgemeinert, sowie Richtlinien und Normen) Hygiene - F7 Filter - Jährlicher Filterwechsel - Aussenluftansaug
Ausgangslage für Haustechnikplaner und Installateure Anforderungen Allgemeine Kriterien (Kriterien sind verallgemeinert, sowie Richtlinien und Normen) Hygiene - F7 Filter - Jährlicher Filterwechsel - Aussenluftansaug
Besser bauen, besser leben
 Häuser mit Gütesiegel Besser bauen, besser leben Eine gute Gebäudehülle und effiziente Technik sorgen für Wohlsein im MINERGIE -Haus. Wohnhäuser, Schulen, Hotels, Büro- und Industriegebäude MINERGIE setzt
Häuser mit Gütesiegel Besser bauen, besser leben Eine gute Gebäudehülle und effiziente Technik sorgen für Wohlsein im MINERGIE -Haus. Wohnhäuser, Schulen, Hotels, Büro- und Industriegebäude MINERGIE setzt
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich gemäss 4 (MuKEn; Auszug)
 Nr. 774-A Anhang (Stand 0.0.04) Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich gemäss 4 (MuKEn; Auszug) B. Wärmeschutz von Gebäuden Art..6 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz Die Anforderungen
Nr. 774-A Anhang (Stand 0.0.04) Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich gemäss 4 (MuKEn; Auszug) B. Wärmeschutz von Gebäuden Art..6 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz Die Anforderungen
Sprechstunde Energie Gebäudesanierung
 Sprechstunde Energie Gebäudesanierung Dipl.-Ingenieur SIA Thayngen 28. November 2013 I. Motivation Gebäudesanierung Klimawandel Energieverbrauch Behaglichkeit Werterhalt Unterhaltsbedarf Um- oder Ausbaupläne
Sprechstunde Energie Gebäudesanierung Dipl.-Ingenieur SIA Thayngen 28. November 2013 I. Motivation Gebäudesanierung Klimawandel Energieverbrauch Behaglichkeit Werterhalt Unterhaltsbedarf Um- oder Ausbaupläne
EnEV-Praxis EnEV-Novelle leicht und verständlich dargestellt
 Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dipl.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis EnEV-Novelle 2004 - leicht und verständlich dargestellt 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage /Bauwerk EnEV-Praxis
Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Liersch Dipl.-Ing. Normen Langner EnEV-Praxis EnEV-Novelle 2004 - leicht und verständlich dargestellt 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage /Bauwerk EnEV-Praxis
Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld. Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Die Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkung auf die Wohnungslüftung
 Die Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkung auf die Wohnungslüftung Dipl.-Ing. Claus Händel. www.kwl-info.de Hd 20.04.01 EnEV_SHK2002-1 5 Dichtheit, Mindestluftwechsel (2) Zu errichtende Gebäude sind
Die Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkung auf die Wohnungslüftung Dipl.-Ing. Claus Händel. www.kwl-info.de Hd 20.04.01 EnEV_SHK2002-1 5 Dichtheit, Mindestluftwechsel (2) Zu errichtende Gebäude sind
Sanierungstag, Wien, Pest Practice Beispiele aus der Sicht des Architekten. Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH.
 Sanierungstag, Wien, 30.10. 2012 Pest Practice Beispiele aus der Sicht des Architekten Georg W. Reinberg Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH. www.reinberg.net Palazzo della Ragione (Basilika) en Vicenza,
Sanierungstag, Wien, 30.10. 2012 Pest Practice Beispiele aus der Sicht des Architekten Georg W. Reinberg Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH. www.reinberg.net Palazzo della Ragione (Basilika) en Vicenza,
Neubau Plusenergiehaus in Passivbauweise in 7132 Frauenkirchen, Burgenland
 Neubau Plusenergiehaus in Passivbauweise in 7132 Frauenkirchen, Burgenland Ausgangslage Im Jahr 2009 begannen die Planungsarbeiten für den Neubau eines Einfamilien-Plusenergiehauses. Dies sollte durch
Neubau Plusenergiehaus in Passivbauweise in 7132 Frauenkirchen, Burgenland Ausgangslage Im Jahr 2009 begannen die Planungsarbeiten für den Neubau eines Einfamilien-Plusenergiehauses. Dies sollte durch
Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien bei Neubauten
 Vollzugshilfe EN-1 Höchstanteil an nichterneuerbaren bei Neubauten Inhalt und Zweck Diese Vollzugshilfe behandelt die an den Höchstanteil an nichterneuerbaren bei Neubauten. Sie legt Definitionen, Grundsätze,
Vollzugshilfe EN-1 Höchstanteil an nichterneuerbaren bei Neubauten Inhalt und Zweck Diese Vollzugshilfe behandelt die an den Höchstanteil an nichterneuerbaren bei Neubauten. Sie legt Definitionen, Grundsätze,
Wärmedämmung von haustechnischen Anlagen
 EnergiePraxis-Seminar, 2/2011 Wärmedämmung von haustechnischen Anlagen Alex Herzog, Energietechnik Inhalt Wärmedämmung von: : und Heizung Heizungs- und Warmwasserleitungen : Kanäle und Lüftungs- / Klimaanlagen
EnergiePraxis-Seminar, 2/2011 Wärmedämmung von haustechnischen Anlagen Alex Herzog, Energietechnik Inhalt Wärmedämmung von: : und Heizung Heizungs- und Warmwasserleitungen : Kanäle und Lüftungs- / Klimaanlagen
[Geschäftsnummer] Der Erlass Kantonale Energieverordnung vom (KEnV) (Stand ) wird wie folgt geändert:
![[Geschäftsnummer] Der Erlass Kantonale Energieverordnung vom (KEnV) (Stand ) wird wie folgt geändert: [Geschäftsnummer] Der Erlass Kantonale Energieverordnung vom (KEnV) (Stand ) wird wie folgt geändert:](/thumbs/51/27428895.jpg) [Geschäftsnummer] Kantonale Energieverordnung (KEnV) Änderung vom [Datum] Erlass(e) dieser Veröffentlichung: Neu: Geändert: 74. Aufgehoben: Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestützt auf Artikel 9 des
[Geschäftsnummer] Kantonale Energieverordnung (KEnV) Änderung vom [Datum] Erlass(e) dieser Veröffentlichung: Neu: Geändert: 74. Aufgehoben: Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestützt auf Artikel 9 des
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich Silvia Gemperle, Energie & Bauen, Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.
 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich - 2008 Silvia Gemperle, Energie & Bauen, Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich SH BS BL AG ZH
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich - 2008 Silvia Gemperle, Energie & Bauen, Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich SH BS BL AG ZH
Der Königsweg der Gebäudesanierung
 Der Königsweg der Gebäudesanierung DIE spezialisten DER GEBÄUDEHÜLLE Der Schweizerische Verband Dach und Wand ist das führende Kompetenzzentrum und der professionelle Dienstleistungs anbieter für die Gebäudehülle.
Der Königsweg der Gebäudesanierung DIE spezialisten DER GEBÄUDEHÜLLE Der Schweizerische Verband Dach und Wand ist das führende Kompetenzzentrum und der professionelle Dienstleistungs anbieter für die Gebäudehülle.
Wärmepumpen mit thermischen Solaranlagen. Merkblatt
 Wärmepumpen mit thermischen Solaranlagen Merkblatt Wärmepumpen mit thermischen Solaranlagen Zur Brauchwasserwärmung oder Heizungsunterstützung können Wärmepumpen und thermische Solaranlage kombiniert werden.
Wärmepumpen mit thermischen Solaranlagen Merkblatt Wärmepumpen mit thermischen Solaranlagen Zur Brauchwasserwärmung oder Heizungsunterstützung können Wärmepumpen und thermische Solaranlage kombiniert werden.
Fragen und Antworten zu unserem
 Fragen und Antworten zu unserem Plus-Energie-Haus Die konsequente Weiterentwicklung unseres Passivhauses. WIE EIN PLUSENERGIEHAUS FUNKTIONIERT 1. Was ist ein Plusenergiehaus? Unser PlusEnergieHaus ist
Fragen und Antworten zu unserem Plus-Energie-Haus Die konsequente Weiterentwicklung unseres Passivhauses. WIE EIN PLUSENERGIEHAUS FUNKTIONIERT 1. Was ist ein Plusenergiehaus? Unser PlusEnergieHaus ist
Komfortlüftung in Neubau und Sanierung In Planung, Montage und Betrieb
 Komfortlüftung in Neubau und Sanierung In Planung, Montage und Betrieb Planung Montage Modernisierung 1 Planung und Montage Komfortlüftung: stellt min. Luftwechsel sicher (850 1350ppm CO 2 ) Keine Auskühlung
Komfortlüftung in Neubau und Sanierung In Planung, Montage und Betrieb Planung Montage Modernisierung 1 Planung und Montage Komfortlüftung: stellt min. Luftwechsel sicher (850 1350ppm CO 2 ) Keine Auskühlung
Lüftung von Wohnungen
 Lüftung von Wohnungen Warum / DIN 1946-6 Joachim Decker, EnergieAgentur.NRW EnergieAgentur.NRW Neutral Unabhängig Nicht kommerziell Energieberatung Kompetenznetzwerke Information und Weiterbildung Folie
Lüftung von Wohnungen Warum / DIN 1946-6 Joachim Decker, EnergieAgentur.NRW EnergieAgentur.NRW Neutral Unabhängig Nicht kommerziell Energieberatung Kompetenznetzwerke Information und Weiterbildung Folie
Energetische Sanierung ganz nebenbei Die zehn cleversten Maßnahmen zum Energiesparen
 Stadt Kassel, Abteilung Klimaschutz und Energieeffizienz Dipl.-Ing. Torben Schmitt Energetische Sanierung ganz nebenbei Die zehn cleversten Maßnahmen zum Energiesparen Grundsätzliches zur energetischen
Stadt Kassel, Abteilung Klimaschutz und Energieeffizienz Dipl.-Ing. Torben Schmitt Energetische Sanierung ganz nebenbei Die zehn cleversten Maßnahmen zum Energiesparen Grundsätzliches zur energetischen
380/4. Elektrische Energie im Hochbau. Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera. Bauwesen /4. Empfehlung Ausgabe 1995
 Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 565 380/4 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur-
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 565 380/4 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur-
SIA 380/1:2007 Ausgewählte Themen für die Anwendung
 :2007 Ausgewählte Themen für die Anwendung Antje Heinrich, Abt. Energie Themen Bestimmung der EBF Thermische Gebäudehülle Einzelbauteilnachweis: Storenkasten Tore Systemnachweis: Verschattungsfaktor PC-Programme
:2007 Ausgewählte Themen für die Anwendung Antje Heinrich, Abt. Energie Themen Bestimmung der EBF Thermische Gebäudehülle Einzelbauteilnachweis: Storenkasten Tore Systemnachweis: Verschattungsfaktor PC-Programme
Inkrafttreten des Gesetzes
 Inkrafttreten des Gesetzes Der Termin zum 01. Januar 2009 wurde verschoben. Die EnEV 2009 soll die Klima-Schutz-Wirkung des EEWärmeGesetzes nicht behindern (Ausschuß Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit;
Inkrafttreten des Gesetzes Der Termin zum 01. Januar 2009 wurde verschoben. Die EnEV 2009 soll die Klima-Schutz-Wirkung des EEWärmeGesetzes nicht behindern (Ausschuß Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit;
Sonderschau Wohnungslüftung. Einfache Planung von Wohnungslüftungsanlagen Dr.-Ing. Johannes Brugmann
 Einfache Planung von Wohnungslüftungsanlagen Dr.-Ing. Johannes Brugmann Fünf gute Gründe Marktübersicht Wohnungslüftunganlagen Wohnungslüftung Freie Lüftung Mechanische Lüftung Fensterlüftung Schachtlüftung
Einfache Planung von Wohnungslüftungsanlagen Dr.-Ing. Johannes Brugmann Fünf gute Gründe Marktübersicht Wohnungslüftunganlagen Wohnungslüftung Freie Lüftung Mechanische Lüftung Fensterlüftung Schachtlüftung
Energieberatungsbericht
 Energieberatungsbericht Gebäude: Auftraggeber: Erstellt von: F.weg 10 a 12345 Berlin Herr Detlef Stumpf F.weg 10 a 12345 Berlin Frank Ludwig Bezirksschornsteinfegermeister Nipkowstr. 34 12489 Berlin Tel.:
Energieberatungsbericht Gebäude: Auftraggeber: Erstellt von: F.weg 10 a 12345 Berlin Herr Detlef Stumpf F.weg 10 a 12345 Berlin Frank Ludwig Bezirksschornsteinfegermeister Nipkowstr. 34 12489 Berlin Tel.:
Passnummer Nr. Aussteller Erstellt am Gültig bis P IP/ Adresse (Straße) Mustermannstrasse, 3694
 geringer Energiebedarf Passivhaus hoher Energiebedarf Die Einstufung in die erfolgt nach dem sogenannten Primärenergiebedarf. Dieser berücksichtigt neben dem Wärmeschutz des Gebäudes auch die verwendete
geringer Energiebedarf Passivhaus hoher Energiebedarf Die Einstufung in die erfolgt nach dem sogenannten Primärenergiebedarf. Dieser berücksichtigt neben dem Wärmeschutz des Gebäudes auch die verwendete
Die Energiezukunft. Energieeffizienz und erneuerbare Energien Angebote und Dienstleistungen des Kantons Zürich. Energieverbrauch und CO 2 - Emissionen
 Die Energiezukunft Ziel Jahr 2050: 2,2 t CO 2 / Kopf und Jahr 1990: 6.0 t CO 2 / Kopf und Jahr 2012: 5.1 t CO 2 / Kopf und Jahr Energieeffizienz in kirchlichen Gebäuden, oeku, 27. Februar 2014, Zürich
Die Energiezukunft Ziel Jahr 2050: 2,2 t CO 2 / Kopf und Jahr 1990: 6.0 t CO 2 / Kopf und Jahr 2012: 5.1 t CO 2 / Kopf und Jahr Energieeffizienz in kirchlichen Gebäuden, oeku, 27. Februar 2014, Zürich
Moderne Heizsysteme vom Keller bis aufs Dach. Urs Jaeggi Jaeggi Gmünder Energietechnik AG
 Moderne Heizsysteme vom Keller bis aufs Dach Urs Jaeggi Jaeggi Gmünder Energietechnik AG Installationsbetrieb mit fachübergreifenden Kompetenzen 2015 entstanden aus Management-Buyout der Ausführungsabteilung
Moderne Heizsysteme vom Keller bis aufs Dach Urs Jaeggi Jaeggi Gmünder Energietechnik AG Installationsbetrieb mit fachübergreifenden Kompetenzen 2015 entstanden aus Management-Buyout der Ausführungsabteilung
ÖKOLOGISCHE MIETWOHNUNGEN SCHULHAUSSTRASSE 11, 13, 15, 3672 OBERDIESSBACH
 ÖOLOGISCHE MIETWOHNUNGEN SCHULHAUSSTRASSE 11, 13, 15, 3672 OBERDIESSBACH UMWELTBEWUSSTES WOHNEN IST JETZT AUCH ALS MIETER MÖGLICH Sie möchten einen Beitrag zur Reduktion der limaerwärmung leisten ohne
ÖOLOGISCHE MIETWOHNUNGEN SCHULHAUSSTRASSE 11, 13, 15, 3672 OBERDIESSBACH UMWELTBEWUSSTES WOHNEN IST JETZT AUCH ALS MIETER MÖGLICH Sie möchten einen Beitrag zur Reduktion der limaerwärmung leisten ohne
Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Bay. Solarinitiativen 2016
 Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Bay. Solarinitiativen 2016 ZENKO Zukunfts-Energie-Konzepte Alois Zimmerer, ZENKO Zukunfts-Energie-Konzepte Elektromeister, ich beschäftige mich seit 1978 mit Solartechnik
Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Bay. Solarinitiativen 2016 ZENKO Zukunfts-Energie-Konzepte Alois Zimmerer, ZENKO Zukunfts-Energie-Konzepte Elektromeister, ich beschäftige mich seit 1978 mit Solartechnik
Forum Energie vom 2. März 2004 Praxistest MINERGIE: Erfolgskontrollen an über 50 Bauten
 Forum Energie vom 2. März 2004 Praxistest MINERGIE: Erfolgskontrollen an über 50 Bauten Severin Lenel Architekt FH / Umweltingenieur NDS HTL / ExecutiveMBA HSG Geschäftsleiter Econum GmbH, St. Gallen MINERGIE
Forum Energie vom 2. März 2004 Praxistest MINERGIE: Erfolgskontrollen an über 50 Bauten Severin Lenel Architekt FH / Umweltingenieur NDS HTL / ExecutiveMBA HSG Geschäftsleiter Econum GmbH, St. Gallen MINERGIE
Ökologie und Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus der Lüftungssysteme. Anna M. Fulterer, A. Knotzer
 Luft_Plus Ökologie und Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus der Lüftungssysteme 12.05.2016 Steiermarkhof Anna M. Fulterer, A. Knotzer AEE Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) A-8200 Gleisdorf,
Luft_Plus Ökologie und Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus der Lüftungssysteme 12.05.2016 Steiermarkhof Anna M. Fulterer, A. Knotzer AEE Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) A-8200 Gleisdorf,
TOOL-Heizwärme. Energie-effiziente Gebäude. Gerhard Faninger. Version 1.0 (Januar 2013) Bewertung der Energie-Effizienz von Gebäuden - 1 -
 TOOL-Heizwärme Bewertung der Energie-Effizienz von Gebäuden Energie-effiziente Gebäude Energie-effiziente Gebäude Wärmerückgewinnung Lüftungsanlage Wärmeschutz Passive Solarwärme Gerhard Faninger Version
TOOL-Heizwärme Bewertung der Energie-Effizienz von Gebäuden Energie-effiziente Gebäude Energie-effiziente Gebäude Wärmerückgewinnung Lüftungsanlage Wärmeschutz Passive Solarwärme Gerhard Faninger Version
Nutzung der Sonnenergie in Zofingen
 Nutzung der Sonnenergie in Zofingen Pius Hüsser, Energieberater, Aarau Inhalt Potential der Sonnenenergie Nutzungsarten Was ist in Zofingen möglich Wie gehe ich weiter? Wie lange haben wir noch Öl? Erdölförderung
Nutzung der Sonnenergie in Zofingen Pius Hüsser, Energieberater, Aarau Inhalt Potential der Sonnenenergie Nutzungsarten Was ist in Zofingen möglich Wie gehe ich weiter? Wie lange haben wir noch Öl? Erdölförderung
Dipl.-Ing. Architekt Martin Böhm
 Dipl.-Ing. Architekt Martin Böhm Bauen für die Zukunft Innovative Energiekonzepte für den Neubau Referent: Dipl.-Ing. Architekt Martin Böhm Überblick 1. Zahlen und Fakten 2. Energiewende 3. Die Energieeinsparverordnung
Dipl.-Ing. Architekt Martin Böhm Bauen für die Zukunft Innovative Energiekonzepte für den Neubau Referent: Dipl.-Ing. Architekt Martin Böhm Überblick 1. Zahlen und Fakten 2. Energiewende 3. Die Energieeinsparverordnung
Wärmedämmung. Ing. Gerhard Puchegger die umweltberatung 02622/ Energiekosten senken trotz steigender Energiepreise!
 Energiekosten senken trotz steigender Energiepreise! Wärmedämmung Ing. Gerhard Puchegger die umweltberatung 02622/26950 Energiesparmaßnahmen die fast nichts kosten Heizungsrohre dämmen. Räume nur auf jene
Energiekosten senken trotz steigender Energiepreise! Wärmedämmung Ing. Gerhard Puchegger die umweltberatung 02622/26950 Energiesparmaßnahmen die fast nichts kosten Heizungsrohre dämmen. Räume nur auf jene
Zukunftssichere Heizsysteme von Schüco. Wärmepumpen für minimale Betriebskosten
 Zukunftssichere Heizsysteme von Schüco Wärmepumpen für minimale Betriebskosten Heizen mit Energie, die in der Luft oder dem Boden vorhanden ist Erdöl und Erdgas werden immer knapper und immer teurer. Bei
Zukunftssichere Heizsysteme von Schüco Wärmepumpen für minimale Betriebskosten Heizen mit Energie, die in der Luft oder dem Boden vorhanden ist Erdöl und Erdgas werden immer knapper und immer teurer. Bei
Nachhaltige Ansätze im Bereich: Wohnen und Bauen
 Nachhaltige Ansätze im Bereich: Wohnen und Bauen Was tun? MINERGIE und MINERGIE-P Persönliches Fallbeispiel Fazit Referat von Werner Hässig Kontakt: haessig@sustech.ch AKU-Klimaforum, 2. Juni 2007 1 Zur
Nachhaltige Ansätze im Bereich: Wohnen und Bauen Was tun? MINERGIE und MINERGIE-P Persönliches Fallbeispiel Fazit Referat von Werner Hässig Kontakt: haessig@sustech.ch AKU-Klimaforum, 2. Juni 2007 1 Zur
Qualitätssicherung für Komfort-lüftungen Der Komfortlüftungsmarkt boomt. Wie kann nachhaltige Qualität geplant, ausgeführt und überwacht
 Qualitätssicherung für Komfort-lüftungen Der Komfortlüftungsmarkt boomt. Wie kann nachhaltige Qualität geplant, ausgeführt und überwacht werden? Josef Ammann Dipl.-Ing.(FH) TechEffekt Anstalt FL-9494 Schaan
Qualitätssicherung für Komfort-lüftungen Der Komfortlüftungsmarkt boomt. Wie kann nachhaltige Qualität geplant, ausgeführt und überwacht werden? Josef Ammann Dipl.-Ing.(FH) TechEffekt Anstalt FL-9494 Schaan
Wärmedämmvorschriften Ausgabe 2009
 Wärmedämmvorschriften Ausgabe 2009 Inhalt I. Grundlagen...1 II. Neubauten: Winterlicher Wärmeschutz...2 Teil 1: Wärmedämmung der Gebäudehülle...2 Teil 2: Höchstanteil nichterneuerbarer Energien...4 III.
Wärmedämmvorschriften Ausgabe 2009 Inhalt I. Grundlagen...1 II. Neubauten: Winterlicher Wärmeschutz...2 Teil 1: Wärmedämmung der Gebäudehülle...2 Teil 2: Höchstanteil nichterneuerbarer Energien...4 III.
