Marc Zintel Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) der Technischen Universität München
|
|
|
- Babette Gerstle
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Epoxidharzbeschichtete Bewehrung in der Praxis Bewertung der Korrosionsschutzwirkung nach 21 Jahren Nutzungsdauer anhand eines deutschen Pilotprojektes Marc Zintel Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) der Technischen Universität München Christoph Gehlen Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) der Technischen Universität München Sylvia Keßler Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) der Technischen Universität München Zusammenfassung Um die Korrosion von Stahl in Beton infolge Chlorideinwirkung zu ver- oder zumindest zu behindern, werden bisher vornehmlich in Nordamerika beachtliche Mengen epoxidharzbeschichteter Bewehrung (ECR) eingesetzt. Die Wirkungsweise und damit das Korrosionsschutzpotential von ECR werden in der Wissenschaft zum Teil kontrovers diskutiert. Im Jahr 1991 wurde diese Art des Korrosionsschutzes in einem deutschen Pilotprojekt an einer Brücke in Leverkusen erstmalig eingesetzt. Nicht zuletzt aufgrund fehlender Informationen über das Langzeitverhalten von ECR fand bisher kein nachhaltiger Technologietransfer nach Deutschland bzw. Europa statt. Die dargestellten Untersuchungsergebnisse im Zuge einer Bauwerksinspektion nach 21 Jahren Nutzungsdauer liefern einen entscheidenden Baustein zur quantitativen Bewertung des Korrosionsschutzpotentials epoxidharzbeschichteter Bewehrung. 1. Einleitung Zur Erzielung einer verbesserten Dauerhaftigkeit von Stahlbetonkonstruktionen werden seit den 70er Jahren vornehmlich in Nordamerika epoxidharzbeschichtete Bewehrungsstähle eingesetzt. Sie sollen eine anodische Eisenauflösung ver- oder behindern. An einigen Bauwerken ging allerdings schon unerwartet früh, diese durch die Epoxidharzbeschichtung erhoffte Korrosionsschutzwirkung verloren (vgl. Korrosionsschäden an den Florida Key Bridges in USA Anfang der 1980er Jahre). Man ging davon aus, dass der vorzeitige Verlust einerseits auf eine mangelhafte Qualität des Epoxidharzes, andererseits auf eine durch fehlerhafte Applikation hervorgerufene hohe Fehlstellenanzahl zurückzuführen ist. Durch Weiterentwicklungen in der Beschichtungstechnologie (u.a. verbesserte Harzsysteme und Verfahrenstechnik der Applikation) sowie durch gestiegene normative Anforderungen (z.b. bezüglich der Mindestschichtdicke) konnten bis heute Fortschritte erzielt werden [1]. Ein einheitlicher wissenschaftlicher Konsens zur Bewertung des Korrosionsschutzpotentials eines solchen Produkts wurde dennoch bisher nicht erreicht. Trotz einer gewissen Zurückhaltung gegenüber diesem Produkt existieren in Nordamerika inzwischen mehr als Brücken mit ECR, die auch hinsichtlich ihrer Korrosionsbeständigkeit Fragen aufwerfen könnten. Ein Technologietransfer nach Europa fand bisher nicht statt. In Deutschland wurde im Jahr 1991 in einem einmaligen Pilotprojekt die neueste Generation epoxidharzbeschichteter Bewehrung in einer Brückenkappe eingesetzt. Im Zuge einer Brückeninspektion im Jahr 2012 wurde speziell die eingesetzte beschichtete Bewehrung untersucht. Vor Ort kamen zerstörende und zerstörungsfreie Prüfmethoden zum Einsatz. Zudem wurden entnommene Bohrkernproben anschließend im Labor quantitativ untersucht. Die vielfältigen Untersuchungsergebnisse liefern die Bewertungsgrundlage zur Einschätzung des Korrosionsschutzpotentials epoxidharzbeschichteter Bewehrung nach einer Nutzungsdauer von 21 Jahren. 2. Schädigungsprozess der chloridinduzierten Korrosion Stahl eingebettet in Beton ist durch die hohe Alkalität der Porenlösung (ph > 12) geschützt. In diesem Milieu bilden die Hydroxid- (OH - ) und Eisenionen eine schützende Oxidschicht auf der Stahloberfläche. Diese so-
2 genannte Passivschicht kann durch das Eindringen von Chloriden (z.b. aus Tausalzen) zerstört werden. Wird eine kritische Chloridkonzentration an der Stahloberfläche erreicht, depassiviert der Stahl und die schützende Passivschicht wird lokal zerstört. Erst nach der Depassivierung kann der eigentliche Korrosionsprozess beginnen. Hierbei gehen Eisenionen (Fe 2+ ) in der Porenlösung in Lösung und freie Elektronen verlassen das Stahlgitter (anodische Eisenauflösung). Dieser Prozess geht mit einem Abfall des elektrochemischen Potentials an der lokalen Anode einher, was zu einer Potentialdifferenz zwischen den anodischen und passiven kathodischen Oberflächen führt. Anoden und Kathoden sind im Normalfall elektrisch verbunden, was zu einem ungehinderten Transport freier Elektronen Richtung kathodischer Bereiche führt. Hier bilden sich Hydroxidionen durch Reaktion von Wasser mit Sauerstoff in der Porenlösung. Die positiv-geladenen Eisenionen und die negativ-geladenen Hydroxidionen streben nach einem Gleichgewicht. Zum Ladungsausgleich werden negative Ladungen von der Kathode zur Anode transportiert. In Bild 1 sind die Zusammenhänge der chloridinduzierten Korrosion in Form einer sogenannten Makrokorrosionszelle zusammengefasst. Bild 1: Schematische Darstellung der Korrosion von Stahl in Beton am Beispiel eines Makrokorrosionselements [2] Mit fortschreitender Korrosion reduziert sich der Stahlquerschnitt. Daneben haben die Korrosionsprodukte (z.b. Fe 2 O 3 ) unterschiedliche Eigenschaften wie das Ausgangsprodukt. Ein größeres Volumen der Korrosionsprodukte (bis zu Faktor 6) im Vergleich zum Stahl verursacht expansionsinduzierte Verformungen in der Betonmatrix, was zu Rissbildung und Abplatzungen führen kann. Im Degradationsverlauf der chloridinduzierte Bewehrungskorrosion unterscheidet man generell zwei Phasen (siehe Bild 2). Bild 2: Zeitliche Entwicklung der Bewehrungskorrosion Während der ersten Phase, der so genannten Einleitungsphase, dringen Chloride infolge unterschiedlicher Transportmechanismen von der Bauteiloberseite in den Beton ein. Eine Schädigung der Bewehrung selbst findet in dieser Phase nicht statt. Die Einleitungsphase endet mit der Depassivierung der Bewehrungsoberfläche. Die Bewehrungskorrosion setzt erst in der an die Depassivierung anschließenden Schädigungsphase ein. Rissbildungen und Abplatzungen der Betondeckung als erste visuell erkennbare Folge der Bewehrungskorrosion treten erst im fortgeschrittenen Stadium auf. 3. Epoxidharzbeschichtete Bewehrung (ECR) 3.1 Herstellungsprozess Epoxidharzbeschichtungen werden aus einem Epoxidharz (meist Bisphenol-A-Epoxidharz) und einem Härter hergestellt. Für zahlreiche Anwendungsfälle können die Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften der reinen Polymere durch Hilfs- und Füllstoffe (z.b. Pigment, Füllstoffe, Additive) maßgeblich beeinflusst werden. Vor der eigentlichen Applikation der Beschichtung wird die Stahloberfläche durch Sandstrahlen gereinigt und angeraut. Danach wird die Bewehrung durch Induktions-Heizspulen auf rd. 250 C erhitzt und in die Beschichtungskabine transportiert. Das elektrostatisch aufgeladene Pulver setzt sich auf der Bewehrung ab, schmilzt, fließt und bildet eine gleichmäßige Schicht. Nach Abkühlung der Beschichtung wird diese mittels Detektoren auf Fehlstellen untersucht. Eine schematische Darstellung der Applikationsanlage ist in Bild 3 dargestellt. Bild 3: Schematische Darstellung einer Applikationsanlage
3 Im Herstellungsprozess werden mittlere Beschichtungsdicken von ca. 250 µm eingestellt. 3.2 Korrosionsschutzpotential Mit der Anwendung von ECR sollen mindestens eine, besser gleich mehrere Voraussetzungen zur Bewehrungskorrosion ausgeschaltet werden: - Depassivierende Medien sollen vom Stahl ferngehalten werden (speziell Chloride) - Das Sauerstoffangebot an der Kathode soll minimiert werden - Der wässrige Elektrolyt (Beton) soll vom Stahl abgeschirmt werden - Die Ausbildung von Potentialdifferenzen soll verhindert werden Alle zuvor genannten Effekte sind eng mit der Dichtigkeit und nicht zuletzt mit dem Beschichtungswiderstand der Epoxidharzbeschichtung selbst verknüpft. Jedoch sind Epoxidharzbeschichtungen, wie auch alle anderen organischen Beschichtungen nur begrenzt undurchlässig gegen Wasser und Sauerstoff. Aus diesem Grund können Korrosionsprozesse unterhalb solcher Beschichtungen nicht komplett ausgeschlossen werden. Die dazugehörigen Transportprozesse sind in der Regel diffusionskontrolliert. Neben den Transportprozessen haben Informationen über die Speichermechanismen von eingeschlossenem Wasser eine wesentliche Bedeutung zur Dauerhaftigkeitsbewertung von Epoxidharzbeschichtungen. Hieraus können wichtige Voraussetzungen zur Garantie eines Korrosionsschutzes gefolgert werden: - Qualität des Materials (Wasserabsorption, Diffusionseigenschaften usw.) - Herstellungsqualität (Beschichtungsdicke, Anzahl und Größe von Fehlstellen usw.) - Qualität der Adhäsion (Verbundfestigkeit zwischen Betonstahl und Beschichtung) Hinsichtlich Verarbeitung und Beständigkeit epoxidharzbeschichteter Bewehrung sind zusätzliche Anforderungen für den praktischen Einsatz unerlässlich: - Alkalibeständigkeit (Betonporenlösung: ph = 13) - Biegefähigkeit (keine Risse, Enthaftung oder Quetschungen) - Verbund (ausreichende Verbundfestigkeit: Betonstahl/Beschichtung und Beschichtung/Beton) - Lagerungsstabilität (Wetter, UV-Strahlung) - Vorschriften zur Handhabung von ECR (im Baustelleneinsatz: z.b. Transport, Lagerung und Installation) - Dynamische Beanspruchung (keine Risse, Schäden) - Alterung (lastabhängig und lastunabhängig) - Möglichkeit zur Inspektion und Instandsetzung (geeignetes Ausbesserungsmaterial) Trotz aller möglichen gemeisterten Herausforderungen kann für einen erfolgreichen Applikationsprozess und der späteren Baustelleninstallation kein komplett fehlstellenfreies Produkt garantiert werden. Die Fragestellung des Korrosionsfortschritts und hierbei speziell die Modellierung ablaufender Korrosionsprozesse eines Systems mit keinen oder gerade noch tolerierbaren Fehlstellen ist derzeit Gegenstand aktueller Forschung. In Bild 4 ist der mögliche Korrosionsschutzeffekt von ECR im Vergleich zu unbeschichtetem Betonstahl über die Lebensdauer schematisch dargestellt. Bild 4: Möglicher Korrosionsschutzeffekt epoxidharzbeschichteter Bewehrung (ECR) im Vergleich zu unbeschichtetem Betonstahl [3] Im Unterschied zu unbeschichtetem Betonstahl beschreibt die Einleitungsphase bei ECR ein fehlstellenfreies Beschichtungssystem, bei dem sich je nach Expositionsbedingung (z.b. infolge Temperatur/ -feuchte und Art des umgebenden Betons) unterschiedliche Feuchtegehalte innerhalb der Beschichtung einstellen. Eine Wasseraufnahme über die Zeit ist eng mit dem Rückgang der elektrisch-isolierenden Wirkung der Beschichtung (Beschichtungswiderstand) verknüpft (vgl. Kap. 4). Die Einleitungsphase endet, sobald sich eine Fehlstelle entwickelt und eine Depassivierung erfolgt (Fehlstelle wirkt als Anode, s. Kap. 2). Die Korrosionsgeschwindigkeit in der nachfolgenden Schädigungsphase wird maßgeblich von der Fehlstellengröße, umso mehr aber vom Ausmaß einer möglichen Fehlstelleninteraktion mit anderen benachbarten Defekten (vgl. Makrokorrosionselementbildung in Kap. 2) bestimmt. 3.3 Bestehende Normen und Richtlinien Die erste (Prüf-)norm, die in Zusammenhang mit epoxidharzbeschichteter Bewehrung im Jahr 1981 in Kraft trat, war die amerikanische Norm ASTM A Die Norm wurde im Laufe der Jahre anhand von Ergebnissen aus intensiven Untersuchungen angepasst und erweitert. Die aktuelle Version stellt die Norm ASTM A 775/A 775M - 07b [4] dar. In Europa wurde epoxidharzbeschichtete Bewehrung bis Ende der 80er Jahre nur in Einzelfällen verbaut. In Großbritannien wurde erstmalig im Jahre 1990 eine Norm BS 7295:1990 eingeführt, die 9 Jahre später durch die heute gültige Norm BS ISO [5] und die BS ISO [6] ersetzt wurde. Dabei bezieht sich die BS ISO ( Epoxidbeschichteter Beton-
4 bewehrungsstahl ) auf das System beschichtete Bewehrung und die BS ISO ( Epoxidpulver und Dichtungsstoffe für die Beschichtung von Stahl für die Bewehrung von Beton ) auf das Epoxidharz selbst. In anderen europäischen Ländern wurden bisher nur Richtlinien eingeführt: - Deutschland, Institut für Bautechnik (DIBt), 1990 [7] - Schweiz, Bundesamt für Straßen (ASTRA), 1991 [8] - Niederlande, CUR Recommendation 29, 1992 [9] 4. Vorversuche zur Wasseraufnahme von epoxidharzbeschichteten Edelstahlplatten Der Zusammenhang von Beschichtungswiderstand und Wasseraufnahme wurde vorab unter Laborbedingungen untersucht. Hierzu wurden drei einseitig mit Epoxidharz beschichtete Edelstahlplatten in einer künstlichen Betonporenlösung (ph=13 und 3% Chlorid) bei 20 C gelagert. Die Beschichtungsdicke, das Gewicht des reinen Beschichtungsmaterials sowie das Gesamtgewicht der Platten wurden vor Versuchsbeginn bestimmt. Der Verlauf der gravimetrischen Gewichtszunahme sowie des Beschichtungswiderstands wurden zyklisch erfasst. Der Versuchsaufbau zur Ermittlung des Beschichtungswiderstands ist in Bild 5 dargestellt. Bild 5: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Bestimmung des Beschichtungswiderstands Bild 6: Zeitlicher Verlauf der Wasseraufnahme bzw. des Beschichtungswiderstands von epoxidharzbeschichteten Edelstahlplatten Bereits nach ca. 20 Tagen wurde eine relative Feuchtesättigung von ca. 2,7 M.-% bezogen auf das Anfangsgewicht der Beschichtung festgestellt. Parallel hierzu entwickelte sich der Beschichtungswiderstand. Der Widerstand sank bis zum 20. Tag von ca. 4,8 auf 2,4 MΩ ab. Eine weitere Wasseraufnahme bzw. Widerstandsänderung konnte bis zum Versuchsende nach ca. 4 Monaten nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass auch noch nach einer Einlagerungsdauer von ca. 4 Monaten sehr hohe Beschichtungswiderstände vorherrschen. Der mittlere spezifische Widerstand betrug nach ca. 4 Monaten immerhin noch mehr als Ωm (vgl. Normalbeton: ca Ωm). 5. Pilotprojekt Brücke Schießbergstraße 5.1 Das Bauwerk Die Brücke Schießbergstraße in Leverkusen ist eine dreifeldrige massive Plattenbrücke mit einer gesamten Spannweite von ca. 53 m (Bild 7). Sie ist 9,70 m breit und die Plattendicke beträgt 1,12 m. Die Brücke ist in Längsrichtung mit nachträglichem Verbund vorgespannt. Die Brücke wurde 1991 hergestellt. Zur Messung wurde ein durchfeuchtetes Filterpapier (d = 8 cm) mittels des Eigengewichts eines Metallstempels vollständig auf die zu untersuchende Beschichtung gepresst. Über ein LCR-Meter wurde der Stempel und die Plattenunterseite elektrisch kontaktiert und so der Beschichtungswiderstand bestimmt. Die Mittelwerte von Gewichtszunahme und Beschichtungswiderstand sind in Bild 6 über die Zeit aufgetragen (inkl. Angabe der mittleren Standardabweichung σ mittel ). Bild 7: Außenansicht der Brücke Schießbergstraße in Leverkusen Um die nicht-tragende Bewehrung in den Brückenkappen vor Tausalzen (Chlorideintrag) zu schützen und damit die Dauerhaftigkeit zu erhöhen, wurden beide Brückenkappen vollflächig mit der damals neusten Generation epoxidharzbeschichteter Bewehrung ausge-
5 führt. Hierbei wurde die obere und untere Bewehrungslage vollflächig beschichtet (siehe Bild 8). Bild 8: Detail Brückenkappe Der eingebaute Beton entsprach einem heutigen C35/37. Neuartig für damalige Verhältnisse war der Einsatz von Hochofenzement (CEM III: 400 kg/m³). Bei einem Wassergehalt von 185 kg/m³ und 1774 kg/m³ Gesteinskörnung (Reinkies, Größtkorn: 16 mm) wurde ein w/z-wert von 0,45 angestrebt. [10] Im Rahmen einer Bauwerksuntersuchung im Mai 2012 wurde die Korrosionsschutzwirkung der eingebauten ECR nach 21 Jahren Nutzungsdauer eingehend untersucht. Neben einer visuellen Begutachtung vor Ort (Rissaufnahme und Kartierung) wurde die Betondeckung zerstörungsfrei gemessen und zahlreiche Bohrkerne mit ECR entnommen und für weiterführende Laboruntersuchungen ans Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) zurücktransportiert. Zuvor wurde der Feuchtezustand der Bohrkerne sofort vor Ort mittels PE-Folie konserviert. Die in Folie verpackten Bohrkerne wurden anschließend am cbm im Laborklima 20 /85% r.f. gelagert. Der Fokus der nachfolgenden Laboruntersuchungen zielte auf Informationen zum Feuchte- und damit zum Beschichtungswiderstand von ECR nach 21 Jahren Praxiseinsatz. Zusätzlich wurden an ausgesuchten Bohrkernen tiefengestaffelte Chloridprofile ermittelt. Ein Überblick zur baulichen Ausführung der Brücke, zu festgestellten Rissen und Entnahmestellen ist in Bild 9 dargestellt. Die Festlegung der Bohrkernentnahmestellen erfolgte auf Grundlage einer zuvor durchgeführten Potentialfeldmessung. So konnten gezielt auffällige Bereiche mit potentiell hoher Korrosionswahrscheinlichkeit beprobt werden. Die größte Rissbreite (0,35 mm) wurde bei Riss R.3 gemessen. Der Bohrkern D wurde beispielsweise direkt im Rissbereich R.3 entnommen (siehe Bild 9). Die genauen Koordinaten der Bohrkernentnahmestelle sind in Tabelle 1 dokumentiert. Der Koordinatenursprung zur Vermaßung wurde auf den Fahrbahnübergang Westseite festgelegt (Bild 9). 6. Ergebnisse am Bauwerk Die erste visuelle Begutachtung der Brückenkappe war durchweg positiv. Es konnten keinerlei korrosionsbedingte Risse oder Abplatzungen festgestellt werden. Lediglich last- bzw. spannungsinduzierte Risse, welche von den Rissbreiten keine Einschränkungen in der Dauerhaftigkeit erwarten lassen (i.d.r. Rissbreiten kleiner 0,30 mm), wurden registriert. Die gemessenen Betondeckungen (Ergebnisse siehe in Bild 8) waren überdurchschnittlich hoch (i.d.r. immer größer als 50 mm). Zudem konnte eine leichte Zunahme der Betondeckung vom Fahrbahnrand hin zur Kappenaußenseite beobachtet werden (d.h. die Entwässerung verläuft Richtung Fahrbahn). Die zum Teil beim Bohren freigelegten beschichteten Stäbe waren alle in einwandfreiem Zustand. Das heißt, es konnten keinerlei Fehlstellen oder Enthaftungen an der Beschichtung bzw. Anzeichen von Korrosion (auch an den Schnittflächen) festgestellt werden. Die ursprünglich glänzend rote Beschichtungsfarbe war auch nach 21 jähriger Einlagerung im alkalischen Milieu des Betons unverändert erhalten. Ein entnommener Bohrkern mit freigelegter ECR ist beispielhaft in Bild 10 dargestellt. Bild 9: Maßstäbliche Darstellung der Brückenoberseite inklusive Bohrkernentnahmestellen (A bis H) und festgestellter Risse (R.1 bis 12)
6 würde. Gemäß Bild 4 befindet sich das Bauwerk hinsichtlich des Schädigungsgrades hierdurch noch eindeutig in der Einleitungsphase. Bild 10: Freigelegte epoxidharzbeschichtete Bewehrung an der Bruchfläche (Unterseite) eines entnommenen Bohrkerns Um in der damaligen Herstellungsphase die Beschichtung möglichst nicht zu beschädigen, wurde zum Verbinden der Stäbe isolierter Bindedraht verwendet, siehe Bild 10. Ergänzende Untersuchungen zum tiefengestaffelten und damit auf Bewehrungshöhe vorliegenden Chloridgehalt wurden anhand entnommener Bohrmehlproben aus den Bohrkernen durchgeführt. In Bild 11 sind vier repräsentative Chloridprofile dargestellt. 7 Labor- vs. Praxisergebnisse Um die Korrosionsschutzwirkung in der Einleitungsphase dennoch beurteilen zu können, wurden die in den Bohrkernen befindlichen epoxidharzbeschichteten Stähle mit Hilfe der elektrochemischer Impedanz Spektroskopie (EIS) untersucht. Die EIS ist ein zerstörungsfreies dynamisches Messverfahren, um Messungen und Analysen elektrochemischer Systeme durchzuführen [12]. Bei Korrosionsvorgängen in Gegenwart von Elektrolyten laufen an der Oberfläche der Bewehrung dynamische elektrochemische Prozesse ab. Für die Untersuchung wird das System durch eine Wechselspannung ( U = 10mV) angeregt, dessen festzulegende Frequenz (ω) innerhalb eines weiten Bereiches variiert wird. Dadurch wird das System aus seiner Gleichgewichtslage gebracht und seine resultierende Reaktion auf diese Auslenkung aufgezeichnet. Die Impedanz Z (Wechselstromwiderstand) lässt sich dabei als frequenzabhängiger Zusammenhang zwischen Erregersignal und Systemantwort definieren. Bei der Auswertung der gemessenen Impedanzspektren versucht man, die systemspezifischen physikalischen Parameter des elektrochemischen Systems durch ein Ersatzschaltbild (ESB) zu beschreiben, welches denselben Frequenzverlauf wie das gemessene Spektrum aufweist. Zur Bewertung einer intakten organischen Beschichtung mit hoher Schutzwirkung kann ein ESB entsprechend dem sogenannten Randles Element verwendet werden [13], siehe Bild 12. Bild 11: Ergebnisse der Chloridanalyse anhand tiefengestaffelter Bohrmehlproben aus repräsentativen Bohrkernen Im Rissbereich R.3 wurden zwei Chloridprofile ermittelt (Bild 11). Das Profil 3.1 repräsentiert den direkten Rissbereich, das Profil 3.2. die Rissflanke (siehe Bild 9). An der Rissflanke (3.2) konnten im Vergleich zum Riss selbst im oberflächennahen Bereich (0-20 mm) erhöhte Chloridwerte gemessen werden. Dieses Phänomen kann durch regenbedingte Auswaschungen der Chloride direkt im Riss erklärt werden. Die Profile für Bohrkern F und H sind repräsentativ für alle restlichen Chloridergebnisse dargestellt. Die relevanten Chloridgehalte auf Bewehrungshöhe (mittlere Betondeckung im Kappenbereich A: ca. 70 mm, siehe Bild 8) liegen alle weit unter dem nach Breit [11] angegeben unteren Grenzwert von ca. 0,25 M.-%/z für den kritischen Chloridgehalt. Das heißt, dass beispielsweise eine obere den Chloriden ausgesetzte unbeschichtete Bewehrungslage auch nach 21 Jahren Nutzungsdauer immer noch passiv vorliegen Bild 12: Schematische Darstellung des verwendeten Ersatzschaltbildes (Randles-Element) für eine intakte Beschichtung Hierbei wird der Elektrolytwiderstand des Betons durch einen vorgeschalteten ohmschen Widerstand R el abgebildet. Der Widerstand der Beschichtung und deren Kapazität werden durch ein parallel geschaltetes R C Element, bestehend aus dem Beschichtungwiderstand R C und der Beschichtungskapazität C C, ausgedrückt, Bild 12. Im Versuch werden Impedanzspektren durch rechnergestützte Messgeräte aufgenommen und ausgewertet. Die numerische Lösung von Transferfunktionen liefert quantitative Ergebnisse für die im ESB verwendeten Elemente, hier speziell für den Beschichtungswiderstand R C. Die Ergebnisse für die einzelnen Elemente im ESB können im Bode-Plot (Ergebnis-Plot) auch graphisch abgelesen werden. Dieser
7 Zusammenhang sowie ein beispielhaftes Versuchsergebnis sind in Bild 13 dargestellt. (unterschiedliche Messtechnik und Elektrodenoberflächen: LCR vs. EIS). Tabelle 1: Ergebnisse der Beschichtungswiderstände von ECR-Proben nach 20 Jahren Nutzungsdauer Bild 13: (a) Ergebnis der Impedanzmessung an Bohrkern C im Bode-Plot (vgl. Tabelle 1). (b) Schematische Darstellung der graphischen Zusammenhänge im Bode-Plot. Die experimentelle Durchführung einer Impedanzmessung setzt einen klassischen Drei-Elektroden- Versuchsaufbau voraus. Im vorliegenden Fall wurde dieser Aufbau gemäß Bild 14 realisiert. Parallel zu den Bohrkernuntersuchungen wurden sechs neue Betonprobekörper (Betondeckung: 20 mm) mit neuwertigen epoxidharzbeschichteten Bewehrungsstäben hergestellt und ab dem 1. Tag in Klima 20 /85% r.f. gelagert. Am Bauwerk und in den neuen Laborversuchen lagen ähnliche Beschichtungsdicken vor. In vergleichbarer Weise zu den Bohrkernen wurden hier zu zwei verschiedenen Zeitpunkten Impedanzmessungen durchgeführt. Die erste Messung wurde noch am Tag der Herstellung durchgeführt und mit 0 d bezeichnet. Nach 30 Tagen ( 30 d ) wurde eine zweite Messung durchgeführt. Alle Ergebnisse (Labor und Praxis) sind in Form von Mittel- und MIN/MAX- Werten in Bild 15 zusammengestellt. Bild 14: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Durchführung einer elektrochemischen Impedanz Spektroskopie (EIS) an einem Bohrkern Der zu untersuchende Bohrkern wurde mit der glatten Betonoberfläche auf einem Titanmischoxidgitter (Gegenelektrode) in einem Wasserbad aus gesättigter KCl- Lösung gelagert. Als Referenzelektrode wurde eine Ag/AgCl-Elektrode verwendet. Zur Vermeidung eines elektrolytischen Kontaktes zwischen der Schnittfläche von ECR (Arbeitselektrode) und dem Beton, wurde der Beton im Randbereich vorsichtig entfernt, Bild 14. Um eine Betonaustrocknung während der Messung zu vermeiden, wurden alle Versuche unter konstanten Klimabedingungen (20 C und 85% r.f.) durchgeführt. Die Ergebnisse der Beschichtungswiderstände der in den Bohrkernen A bis H verbauten ECR-Proben sind in Tabelle 1 dargestellt. Es bleibt zu bemerken, dass die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse zum Beschichtungswiderstand nicht direkt mit denen aus Kap. 4 zu vergleichen sind Bild 15: Durch EIS ermittelte Beschichtungswiderstände von ECR anhand Laborprobekörper nach 0d bzw. 30d im Vergleich zu ECR nach 20 jährigem Praxiseinsatz Das Ergebnis zeigt, dass der Beschichtungswiderstand der entnommenen Bauwerksproben auch nach
8 20 Jahren Praxiseinsatz (natürliche Witterungsbedingungen) mit Laborproben, welche lediglich für 30 Tage in Klima 20 /85% r.f. eingelagert wurden, vergleichbar ist. Der auch noch nach 20 Jahren wirksame Beschichtungswiderstand von im Mittel 5, Ωcm² bedeutet, dass die Beschichtung weder durch den anstehenden ph-wert des umgebenden Betons, noch durch Enthaftungs- oder Alterungsprozesse wesentlich geschädigt wurde. Das heißt, die vorgefundene epoxidharzbeschichtete Bewehrung liegt auch nach 20 Jahren Nutzungsdauer noch neuwertig im Beton vor. Es ist anzunehmen, dass die Beschichtung auch in Zukunft eine hochwirksame Barriere für auf Bewehrungshöhe ankommende Chloride darstellen wird. Dass das Beschichtungsmaterial fast unverändert im Vergleich zum neuwertigen Ursprungsmaterial vorliegt, bestätigten zusätzliche Untersuchungen zur Glasübergangstemperatur T g. Die an Pulverscherben mit Hilfe von DSC (Differential Scanning Calorimetry) ermittelte T g stimmte noch mit dem Ursprungsmaterial überein. Eine Verschiebung von T g hätte ein Indiz für die Alterung bzw. Degradation des Beschichtungsmaterials sein können. 8. Schlussfolgerungen und Ausblick Die zum Teil kontroverse Berichterstattung zur Korrosionsschutzwirkung von ECR im Praxiseinsatz stellte die Motivation zur Untersuchung des einzigen und derzeit letzten deutschen Pilotprojektes dar. Zum Einsatz kam im Jahr 1991 die noch heute aktuellste Generation von Epoxidharzbeschichtungen der Fa. Akzo Nobel Powder Coatings GmbH. Die baupraktische Ausführung und Einbaubedingungen (z.b. erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zur Fehlstellenvermeidung) beruhten auf der damals gültigen Richtlinie des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), [7]. Die damaligen Voraussetzungen (Material, vollflächige Beschichtung, Einbaubedingungen usw.) sowie die über die Zeit vorherrschenden Klimabedingungen vor Ort (Leverkusen), ließen ein bis heute wirksames Korrosionsschutzsystem entstehen. Die Möglichkeit das bestehende Korrosionsschutzsystem nach 20 Jahren Nutzungsdauer mit aktuellen Untersuchungsmethoden (hier: Beschichtungswiderstand über EIS) zu vergleichen, lieferte neue Erkenntnisse zum Langzeitverhalten und damit der Langzeitstabilität des Korrosionsschutzpotentials epoxidharzbeschichteter Bewehrung: Die untersuchte epoxidharzbeschichtete Bewehrung liegt auch nach 20 Jahren Praxiseinsatz wie neu vor! Aufgrund fehlender bzw. nicht feststellbarer Fehlstellen vor Ort und zugleich niedriger Chloridgehalte auf Bewehrungshöhe können mit den dargestellten Untersuchungen nur Aussagen zur Einleitungsphase getroffen werden. Die Korrosionsschutzwirkung von ECR bei vorhandenen Fehlstellen und/oder Chloridgehalten über dem kritischen Chloridgehalt (Schädigungsphase, Bild 4) kann nicht beurteilt werden. Mit dieser Fragestellung und mit dem Gesamtziel das Korrosionsschutzpotential über die gesamte Lebensdauer (Einleitungs- und Schädigungsphase) quantitativ zu bewerten, beschäftigt sich derzeit ein aktuelles Forschungsvorhaben (Projektende: 2013). Innerhalb des Projektes ist eine zweite Brückenuntersuchung in der Schweiz vorgesehen. An dieser Brücke wurden beide monolithisch hergestellten Brüstungen halbseitig mit ECR ausgeführt. Bei der Herstellung im Jahr 1988 wurden gezielt definierte Fehlstellen eingebaut. Hier bestünde die Möglichkeit die Performance von un- und epoxidharzbeschichtetem Bewehrungsstahl an einem Bauwerk in der Schädigungsphase zu vergleichen. Etwaige ausstehende positive Ergebnisse hierzu, würden diesem Korrosionsschutzsystem vielseitige Anwendungsfelder in Zukunft eröffnen. Danksagung Für die Möglichkeit zur Durchführung unserer Untersuchungen vor Ort bedanken wir uns bei der Bayer Real Estate GmbH und der Currenta GmbH & Co. OHG recht herzlich. Ein spezieller Dank gilt Herrn H. Mosblech von den Technischen Betrieben der Stadt Leverkusen AöR für die tatkräftige Unterstützung in der Planungsphase und die Betreuung vor Ort. Literaturverzeichnis [1] Hartley, J. (1994). Improving the performance of fusion-bonded epoxy-coated reinforcement. Concrete, Vol. January/February, pp [2] FIB Bulletin 59. (2011). Condition Control and Assessment of Reinforced Concrete Structures. State-of-Art Report. Switzerland: International Federation for Structural Concrete (fib). [3] Zintel M., Gehlen C., Prust P. (2011). Epoxy- Coated Rein-forcement Life Cycle Cost Considerations. Proceedings of Concrete Solutions 2011, 4th International Conference on Concrete Repair, Dresden, Germany, September. [4] ASTM A 775/A 775M - 07b. (2007). Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars. American Society for Testing and Materials. [5] BS ISO 14654:1999. (1999). Epoxy-coated steel for the reinforcement of concrete. British Standards Institution. [6] BS ISO 14656:1999. (1999). Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete. British Standards Institution. [7] DIBt. (1990). Richtlinie für Prüfungen an Betonstählen mit Epoxidharz-Beschichtung. Deutsches Institut für Bautechnik. [8] ASTRA. (1991). Richtlinien zur Anwendung von epoxidharzbeschichteten Betonstählen. Schweizer Bundesamt für Straßenbau. [9] CUR Aanbeveling 29. (1992). Met Epoxy Bekleed Betonstaal. Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. [10] Wolff R. & Mießeler H.J. (1991). Die Brücke Schießbergstraße in Leverkusen. Beton 4/91.
9 [11] Breit, W. (1997). Untersuchungen zum kritischen korrosionsauslösenden Chloridgehalt von Stahl in Beton. Dissertation, Institut für Bauforschung der RWTH Aachen, Aachen. [12] Ende D., Mangold K.M.(1993). Impedanzspektroskopie. Chemie in unserer Zeit. 27. Jahrg. 1993, Nr.3. [13] Schießl P., Lay S., Gehlen C. (2000). Korrosionsmechanismen bei der Unterrostung von Betonstählen mit Beschichtungen auf organischer und mineralischer Basis. Forschungsbericht F3002/00. Centrum Baustoffe und Materialprüfung der TU München.
Korrosion von Stahl in Beton
 Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke Workshop 29.10.2014 Hamburg Kathodischer Korrosionsschutz von Stahlbeton ein Überblick Dipl.-Ing. M. Bruns Alle Rechte vorbehalten 1 Korrosion von Stahl in Beton
Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke Workshop 29.10.2014 Hamburg Kathodischer Korrosionsschutz von Stahlbeton ein Überblick Dipl.-Ing. M. Bruns Alle Rechte vorbehalten 1 Korrosion von Stahl in Beton
Schäden durch Korrosion der Bewehrung Einleitung
 Schäden durch Korrosion der Bewehrung Einleitung Die Korrosion der Bewehrung in Stahlbeton und aller korrodierbaren, metallischen Einbauteile tritt nur unter bestimmten Randbedingungen auf. Sie kann durch
Schäden durch Korrosion der Bewehrung Einleitung Die Korrosion der Bewehrung in Stahlbeton und aller korrodierbaren, metallischen Einbauteile tritt nur unter bestimmten Randbedingungen auf. Sie kann durch
DBV-Heft Nr. 9. Beschichtung bei Parkhaus- Neubauten. Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.
 DBV-Heft Nr. 9 Beschichtungen Reduktion der Bewehrungsüberdeckung bei vorhandener Beschichtung bei Parkhaus- Neubauten Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V. elbild: Setz-Fließ-Versuch (Slump-Flow-Test)
DBV-Heft Nr. 9 Beschichtungen Reduktion der Bewehrungsüberdeckung bei vorhandener Beschichtung bei Parkhaus- Neubauten Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V. elbild: Setz-Fließ-Versuch (Slump-Flow-Test)
Korrosion der Bewehrung im Bereich von Trennrissen nach kurzzeitiger Chlorideinwirkung
 2. Jahrestagung und 55. Forschungskolloquium des DAfStb Düsseldorf, 26.-27.11.2014 Korrosion der Bewehrung im Bereich von Trennrissen nach kurzzeitiger Chlorideinwirkung Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach,
2. Jahrestagung und 55. Forschungskolloquium des DAfStb Düsseldorf, 26.-27.11.2014 Korrosion der Bewehrung im Bereich von Trennrissen nach kurzzeitiger Chlorideinwirkung Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach,
Untersuchungen zur Wirksamkeit von MasterPel 708 im Hinblick auf einen Frost-Taumittel-Angriff auf Beton
 Untersuchungen zur Wirksamkeit von MasterPel 78 im Hinblick auf einen Frost-Taumittel-Angriff auf Beton I.) Welchen Einfluss hat die MasterPel 78 auf den Frost-Taumittel- Widerstand und die Wasseraufnahme
Untersuchungen zur Wirksamkeit von MasterPel 78 im Hinblick auf einen Frost-Taumittel-Angriff auf Beton I.) Welchen Einfluss hat die MasterPel 78 auf den Frost-Taumittel- Widerstand und die Wasseraufnahme
Betonschäden und Betoninstandsetzung
 Betonschäden und Betoninstandsetzung Bauschäden - Schadenserkennung und Prüfungen am Bauwerk Sicherheit Werterhaltung Standsicherheit des Bauwerks Sicherheit der Nutzer Dauerhaftigkeit des Bauwerks Verwitterungsbeständigkeit
Betonschäden und Betoninstandsetzung Bauschäden - Schadenserkennung und Prüfungen am Bauwerk Sicherheit Werterhaltung Standsicherheit des Bauwerks Sicherheit der Nutzer Dauerhaftigkeit des Bauwerks Verwitterungsbeständigkeit
Korrosionsschutz im Massivbau
 Korrosionsschutz im Massivbau Vermeidung und Sanierung von Korrosionsschäden im Stahl- und Spannbeton Dr.-Ing. habil. Ulf Nürnberger Dr.-Ing. Bernd Isecke Dipl.-Ing. Bernd Neubert Dr.-Ing. Günter Rieche
Korrosionsschutz im Massivbau Vermeidung und Sanierung von Korrosionsschäden im Stahl- und Spannbeton Dr.-Ing. habil. Ulf Nürnberger Dr.-Ing. Bernd Isecke Dipl.-Ing. Bernd Neubert Dr.-Ing. Günter Rieche
Phänomene und Mechanismen P. Linhardt
 Korrosion Phänomene und Mechanismen P. Linhardt BIP (2010) = 284 Mrd. * 3,5% = 10 Mrd. 1.186,- je Einwohner *Quelle: Statistik Austria http://info.tuwien.ac.at/cta/korrosion/ BEGRIFFE (nach ÖNORM EN ISO
Korrosion Phänomene und Mechanismen P. Linhardt BIP (2010) = 284 Mrd. * 3,5% = 10 Mrd. 1.186,- je Einwohner *Quelle: Statistik Austria http://info.tuwien.ac.at/cta/korrosion/ BEGRIFFE (nach ÖNORM EN ISO
Untersuchungen an Brückenbauwerken und materialtechnische Prüfungen der Baustoffe
 Untersuchungen an Brückenbauwerken und materialtechnische Prüfungen der Baustoffe Dr.-Ing. Gesa Haroske KBau MV, Hochschule Wismar Prof. Dr.-Ing. Ulrich Diederichs Universität Rostock KBau MV, Hochschule
Untersuchungen an Brückenbauwerken und materialtechnische Prüfungen der Baustoffe Dr.-Ing. Gesa Haroske KBau MV, Hochschule Wismar Prof. Dr.-Ing. Ulrich Diederichs Universität Rostock KBau MV, Hochschule
Prüfbericht P Nespri-Reinacrylat. gemäß DIN EN Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str Ober-Ramstadt
 Prüfbericht P 5401-1 Prüfauftrag: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität) an dem Beschichtungsstoff Nespri-Reinacrylat gemäß DIN EN 1062-6 Auftraggeber: Caparol Farben Lacke
Prüfbericht P 5401-1 Prüfauftrag: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität) an dem Beschichtungsstoff Nespri-Reinacrylat gemäß DIN EN 1062-6 Auftraggeber: Caparol Farben Lacke
Zerstörungs-freie Feuchtemessung an Baustoffen
 DGZfP-Jahrestagung 2011 - Mo.2.A.9 Zerstörungs-freie Feuchtemessung an Baustoffen ein Akt für 3 Disziplinen : Baustoff Chemie Bau Physik Mess Technik so 10.000 Ziel : Bauwerke ohne Feuchte-Schäden oder
DGZfP-Jahrestagung 2011 - Mo.2.A.9 Zerstörungs-freie Feuchtemessung an Baustoffen ein Akt für 3 Disziplinen : Baustoff Chemie Bau Physik Mess Technik so 10.000 Ziel : Bauwerke ohne Feuchte-Schäden oder
Bauwerksdiagnose bei chloridbelastetem Beton
 Bauwerksdiagnose bei chloridbelastetem Beton Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt Dipl.-Ing. (FH) Stephan Vestner id+v Ingenieurgesellschaft Prof. Dauberschmidt und Vestner mbh Zusammenfassung Die nachfolgenden
Bauwerksdiagnose bei chloridbelastetem Beton Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt Dipl.-Ing. (FH) Stephan Vestner id+v Ingenieurgesellschaft Prof. Dauberschmidt und Vestner mbh Zusammenfassung Die nachfolgenden
Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen
 Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer 1 Einleitung In letzter Zeit werden infolge eines fortschreitenden Bauablaufes unter
Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer 1 Einleitung In letzter Zeit werden infolge eines fortschreitenden Bauablaufes unter
Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen
 Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Kathodischer Korrosionsschutz am Eider-Sperrwerk als Barriere gegen Makroelementkorrosion
 Kathodischer Korrosionsschutz am Eider-Sperrwerk als Barriere gegen Makroelementkorrosion M. Bruns 1 und M. Raupach 2 1 Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff, Aachen 2 Institut für Bauforschung, RWTH Aachen
Kathodischer Korrosionsschutz am Eider-Sperrwerk als Barriere gegen Makroelementkorrosion M. Bruns 1 und M. Raupach 2 1 Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff, Aachen 2 Institut für Bauforschung, RWTH Aachen
Effizienter Schutz für Stahlbeton
 Text steht online unter: pr-nord.de -> Pressezentrum -> Pressetexte /-fotos 01/17-02 Kathodischer Korrosionsschutz: Effizienter Schutz für Stahlbeton Mit dem kathodischen Korrosionsschutz (KKS) können
Text steht online unter: pr-nord.de -> Pressezentrum -> Pressetexte /-fotos 01/17-02 Kathodischer Korrosionsschutz: Effizienter Schutz für Stahlbeton Mit dem kathodischen Korrosionsschutz (KKS) können
Prüfbericht P Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften an dem Bodenbeschichtungssystem. MasterTop 1273 ESD
 Kiwa GmbH Polymer Institut Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 www.kiwa.de Prüfbericht P 10739-1 Prüfauftrag: Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften an dem Bodenbeschichtungssystem
Kiwa GmbH Polymer Institut Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 www.kiwa.de Prüfbericht P 10739-1 Prüfauftrag: Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften an dem Bodenbeschichtungssystem
Neue Erkenntnisse zur Wechselstromkorrosion: Auswirkung auf die Praxis
 Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz Neue Erkenntnisse zur Wechselstromkorrosion: Auswirkung auf die Praxis Dr. Markus Büchler Kathodischer Korrosionsschutz Die Dauerhaftigkeit von Rohrleitungen
Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz Neue Erkenntnisse zur Wechselstromkorrosion: Auswirkung auf die Praxis Dr. Markus Büchler Kathodischer Korrosionsschutz Die Dauerhaftigkeit von Rohrleitungen
Prüfbericht P 7128 SILIKAL RE 517 ESD. SILIKAL GmbH Ostring Mainhausen. J. Magner. 7 Seiten
 Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 Fax +49 (0)61 45-5 97 19 www.kiwa.de Prüfbericht P 7128 Prüfauftrag: Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften
Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 Fax +49 (0)61 45-5 97 19 www.kiwa.de Prüfbericht P 7128 Prüfauftrag: Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften
Auswirkungen externer Streustromquellen auf Pipelinenetze
 Jahrestagung 2017 der BDEW- und DVGW-Landesgruppe Mitteldeutschland Auswirkungen externer Streustromquellen auf Pipelinenetze Begriffe - DIN EN ISO 8044 Fremdstromkorrosion Elektrochemische Korrosion als
Jahrestagung 2017 der BDEW- und DVGW-Landesgruppe Mitteldeutschland Auswirkungen externer Streustromquellen auf Pipelinenetze Begriffe - DIN EN ISO 8044 Fremdstromkorrosion Elektrochemische Korrosion als
KKS in der Brückeninstandsetzung
 KKS in der Brückeninstandsetzung Dipl.-Ing. Bernhard Wietek Kathodischer Korrosionsschutz in Theorie und Praxis by B. Wietek (1031/01) Themen zur Brückeninstandsetzung Korrosion bei Stahlbeton Erhaltungsklassen
KKS in der Brückeninstandsetzung Dipl.-Ing. Bernhard Wietek Kathodischer Korrosionsschutz in Theorie und Praxis by B. Wietek (1031/01) Themen zur Brückeninstandsetzung Korrosion bei Stahlbeton Erhaltungsklassen
Kathodischer Korrosionsschutz
 Kathodischer Korrosionsschutz innogy SE Sparte Netz & Infrastruktur Bereich Netzservice aufrechterhaltung DeR PROzesssicheRheit Betrieb und Instandhaltung Zur Vorbeugung von korrosionsbedingten Ausfällen
Kathodischer Korrosionsschutz innogy SE Sparte Netz & Infrastruktur Bereich Netzservice aufrechterhaltung DeR PROzesssicheRheit Betrieb und Instandhaltung Zur Vorbeugung von korrosionsbedingten Ausfällen
Kathodischer Korrosionsschutz
 Kathodischer Korrosionsschutz innogy SE Sparte Netz & Infrastruktur Bereich Netzservice AUFRECHTERHALTUNG DER PROZESSSICHERHEIT Betrieb und Instandhaltung Zur Vorbeugung von korrosionsbedingten Ausfällen
Kathodischer Korrosionsschutz innogy SE Sparte Netz & Infrastruktur Bereich Netzservice AUFRECHTERHALTUNG DER PROZESSSICHERHEIT Betrieb und Instandhaltung Zur Vorbeugung von korrosionsbedingten Ausfällen
von Fußböden (Systemböden)
 Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Korrosionsschutz durch metallische
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Korrosionsschutz durch metallische
Entwicklung und Erprobung von neuartigen Korrosionsschutzoberflächen für den Einsatz auf Offshore-Bauwerken
 Abschlussbericht für das Projekt Entwicklung und Erprobung von neuartigen Korrosionsschutzoberflächen für den Einsatz auf Offshore-Bauwerken Bewilligungszeitraum: 01.10.2011 31.03.2014 Projektleiter: Prof.
Abschlussbericht für das Projekt Entwicklung und Erprobung von neuartigen Korrosionsschutzoberflächen für den Einsatz auf Offshore-Bauwerken Bewilligungszeitraum: 01.10.2011 31.03.2014 Projektleiter: Prof.
Korrosionsuntersuchungen zum Degradationsverhalten resorbierbarer beschichteter Magnesiumlegierungen
 01.04.2011 Korrosionsuntersuchungen zum Degradationsverhalten resorbierbarer beschichteter Magnesiumlegierungen Vortragender: Dipl.-Ing. Sven Schmigalla, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, IWF 1
01.04.2011 Korrosionsuntersuchungen zum Degradationsverhalten resorbierbarer beschichteter Magnesiumlegierungen Vortragender: Dipl.-Ing. Sven Schmigalla, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, IWF 1
Messbrevier. für. Widerstandsmessungen gegen Erde. von. Fußbodenbeschichtungen und -beläge
 Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim Messbrevier für Widerstandsmessungen gegen Erde von Fußbodenbeschichtungen und -beläge - 2 - Widerstandsmessbrevier für Fußböden - 2011 Messbrevier
Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim Messbrevier für Widerstandsmessungen gegen Erde von Fußbodenbeschichtungen und -beläge - 2 - Widerstandsmessbrevier für Fußböden - 2011 Messbrevier
Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen und Probabilistik am Beispiel der statischen Nachrechnung von Ingenieurbauwerken
 Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen und Probabilistik am Beispiel der statischen Nachrechnung von Ingenieurbauwerken Dr.-Ing. Sascha FEISTKORN (Sascha.Feistkorn@SVTI.ch; Tel.: 044 8776 246) SVTI Schweizerischer
Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen und Probabilistik am Beispiel der statischen Nachrechnung von Ingenieurbauwerken Dr.-Ing. Sascha FEISTKORN (Sascha.Feistkorn@SVTI.ch; Tel.: 044 8776 246) SVTI Schweizerischer
Technische Informationen PTFE-Compound E-Kohle. Dyneon TF 4215 Dyneon TFM 4215 Dyneon TF 4216 Ø10 Ø8,1 1,4 Ø9,3 0,4
 Technische Informationen PTFE-Compound E-Kohle Dyneon TF 4215 Dyneon TFM 4215 Dyneon TF 4216 Ø10 Ø8,1 1,4 Ø9,3 0,4 A A 2013 Dyneon TF 4215 PTFE Rieselfähiges PTFE der 1. Generation für die Pressverarbeitung
Technische Informationen PTFE-Compound E-Kohle Dyneon TF 4215 Dyneon TFM 4215 Dyneon TF 4216 Ø10 Ø8,1 1,4 Ø9,3 0,4 A A 2013 Dyneon TF 4215 PTFE Rieselfähiges PTFE der 1. Generation für die Pressverarbeitung
Patrick Christ und Daniel Biedermann
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Brückenschaltung Gruppe B412 Patrick Christ und Daniel Biedermann 10.10.2009 0. INHALTSVERZEICHNIS 0. INHALTSVERZEICHNIS... 2 1. EINLEITUNG... 2 2. BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Brückenschaltung Gruppe B412 Patrick Christ und Daniel Biedermann 10.10.2009 0. INHALTSVERZEICHNIS 0. INHALTSVERZEICHNIS... 2 1. EINLEITUNG... 2 2. BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN
Diplomarbeit Nachbehandlung von Beton durch Zugabe wasserspeichernder Zusätze 3 Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung
 2,50 Serie 1, w/z=0,45 Serie 3, w/z=0,45, mit FM Serie 5, w/z=0,60 Serie 7, w/z=0,60, mit FM Serie 2, w/z=0,45, mit Stab. Serie 4, w/z=0,45, mit Stab.+FM Serie 6, w/z=0,60, mit Stab. Serie 8, w/z=0,60,
2,50 Serie 1, w/z=0,45 Serie 3, w/z=0,45, mit FM Serie 5, w/z=0,60 Serie 7, w/z=0,60, mit FM Serie 2, w/z=0,45, mit Stab. Serie 4, w/z=0,45, mit Stab.+FM Serie 6, w/z=0,60, mit Stab. Serie 8, w/z=0,60,
Korrosion in der Hausinstallation
 Korrosion in der Hausinstallation Normung Die Normung definiert Korrosion als die Reaktion eines Werkstoffes mit seiner Umgebung. Sie führt zu einer messbaren Veränderung des Werkstoffes und kann eine
Korrosion in der Hausinstallation Normung Die Normung definiert Korrosion als die Reaktion eines Werkstoffes mit seiner Umgebung. Sie führt zu einer messbaren Veränderung des Werkstoffes und kann eine
Beschlussfassung TA-UA ö
 Sitzungsvorlage ö Nr. 002/15/TA-UA 658.52; 023.22/6-zt/6-66-mo TOP: Tiefgarage Schweinemarkt Instandhaltungskonzept Vorstellung der Planung Anlagen: Pläne, Kostenberechnung Bezug: Beschlussfassung TA-UA
Sitzungsvorlage ö Nr. 002/15/TA-UA 658.52; 023.22/6-zt/6-66-mo TOP: Tiefgarage Schweinemarkt Instandhaltungskonzept Vorstellung der Planung Anlagen: Pläne, Kostenberechnung Bezug: Beschlussfassung TA-UA
Auswirkung von Chloriden im Beton, Abhängigkeit von Betoneigenschaften
 Auswirkung von Chloriden im Beton, Abhängigkeit von Betoneigenschaften Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach Institut für Bauforschung der RWTH Aachen,, 1 Einführung Stahl ist bekanntermaßen in ordnungsgemäß
Auswirkung von Chloriden im Beton, Abhängigkeit von Betoneigenschaften Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach Institut für Bauforschung der RWTH Aachen,, 1 Einführung Stahl ist bekanntermaßen in ordnungsgemäß
Warme Kante für Fenster und Fassade
 Seite 1 von 7 Dipl.-Phys. ift Rosenheim Einfache Berücksichtigung im wärmetechnischen Nachweis 1 Einleitung Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 [1] (Fassaden EN 13830 [2]) erfolgt die Berechnung
Seite 1 von 7 Dipl.-Phys. ift Rosenheim Einfache Berücksichtigung im wärmetechnischen Nachweis 1 Einleitung Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 [1] (Fassaden EN 13830 [2]) erfolgt die Berechnung
Technische Informationen PTFE-Compound Glasfaser. Dyneon TF 4103 Dyneon TF 4105 Dyneon TFM 4105 Ø8,4 Ø6,2 2,4 Ø9,8
 Technische Informationen PTFE-Compound Glasfaser Dyneon TF 4103 Dyneon TF 4105 Dyneon TFM 4105 Ø8,4 Ø6,2 1,2 1,2 2,4 Ø9,8 2013 Dyneon TF 4103 PTFE Rieselfähiges PTFE der 1. Generation für die Pressverarbeitung
Technische Informationen PTFE-Compound Glasfaser Dyneon TF 4103 Dyneon TF 4105 Dyneon TFM 4105 Ø8,4 Ø6,2 1,2 1,2 2,4 Ø9,8 2013 Dyneon TF 4103 PTFE Rieselfähiges PTFE der 1. Generation für die Pressverarbeitung
Prüfen Beraten Planen. Prüfen + Planen GmbH. Musterplatten mit Disboxid 972 ESD Multi. Problemstellung. Messung der elektrostatischen Eigenschaften
 Prüfen Beraten Planen Prüfen + Planen GmbH Prüfen + Planen GmbH Schulstraße. 16/1 71717 Beilstein Ingenieurgesellschaft zur Prüfung und Instandhaltung von Bauwerken Schulstr. 16/1 71717 Beilstein 0 70
Prüfen Beraten Planen Prüfen + Planen GmbH Prüfen + Planen GmbH Schulstraße. 16/1 71717 Beilstein Ingenieurgesellschaft zur Prüfung und Instandhaltung von Bauwerken Schulstr. 16/1 71717 Beilstein 0 70
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff
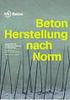 Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
Ergänzung Forschungsvorhaben DIN EN 1995 - Eurocode 5 - Holzbauten Untersuchung verschiedener Trägerformen
 1 Vorbemerkungen Begründung und Ziel des Forschungsvorhabens Die Berechnungsgrundsätze für Pultdachträger, Satteldachträger mit geradem oder gekrümmtem Untergurt sowie gekrümmte Träger sind nach DIN EN
1 Vorbemerkungen Begründung und Ziel des Forschungsvorhabens Die Berechnungsgrundsätze für Pultdachträger, Satteldachträger mit geradem oder gekrümmtem Untergurt sowie gekrümmte Träger sind nach DIN EN
Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie
 Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie Hinweis Viele der in dieser Präsentation gemachten Angaben basieren auf einem vorläufigen Wissenstand. Insbesondere sind die
Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie Hinweis Viele der in dieser Präsentation gemachten Angaben basieren auf einem vorläufigen Wissenstand. Insbesondere sind die
Prüfbericht P J. Magner Dipl.-Ing. O. Ehrenthal. 10 Seiten 1 Anlage
 Dieser Bericht ist elektronisch abgefasst und verteilt worden. Rechtliche Gültigkeit besitzt ausschließlich das Original des Berichtes auf Papier. Prüfbericht P 5242-1 Prüfauftrag: Prüfung von elektrostatischen
Dieser Bericht ist elektronisch abgefasst und verteilt worden. Rechtliche Gültigkeit besitzt ausschließlich das Original des Berichtes auf Papier. Prüfbericht P 5242-1 Prüfauftrag: Prüfung von elektrostatischen
Korrosion und Korrosionsschutz
 Korrosion und Korrosionsschutz Von Tobias Reichelt und Birte Schwan Teil A I. Einleitung II. Thermodynamik III. Kinetik Teil B I. Korrosionsarten (atmosphärischer Korrosion) II. Vermeidungsstrategien III.
Korrosion und Korrosionsschutz Von Tobias Reichelt und Birte Schwan Teil A I. Einleitung II. Thermodynamik III. Kinetik Teil B I. Korrosionsarten (atmosphärischer Korrosion) II. Vermeidungsstrategien III.
Stahlbeton 10.7 Risse und Rissverpressung
 Stahlbeton 10.7 Risse und Rissverpressung FH Münster Baustofflehre (S) SS 2007 Benedikt Grob Inhalt 1. Grundlagen 1.1 Rissursachen 1.2 Rissarten 1.3 Warum müssen Risse geschlossen werden? 2. Rissverfüllung
Stahlbeton 10.7 Risse und Rissverpressung FH Münster Baustofflehre (S) SS 2007 Benedikt Grob Inhalt 1. Grundlagen 1.1 Rissursachen 1.2 Rissarten 1.3 Warum müssen Risse geschlossen werden? 2. Rissverfüllung
Nachweis der Wirksamkeit von HIT-FLON
 - 1 - Nachweis der Wirksamkeit von HIT-FLON Inhalt 1. Einleitung 2. Nachweis der Beschichtung mittels der Rasterelektronenmikroskopie 3. Nachweis der PTFE-Schicht mittels mikroanalytischer Bestimmung von
- 1 - Nachweis der Wirksamkeit von HIT-FLON Inhalt 1. Einleitung 2. Nachweis der Beschichtung mittels der Rasterelektronenmikroskopie 3. Nachweis der PTFE-Schicht mittels mikroanalytischer Bestimmung von
Auf Nummer sicher gehen. Referentenprofil. Dr. Jürgen Stropp. Leitung Labor. WEILBURGER Graphics GmbH Am Rosenbühl Gerhardshofen
 Referentenprofil Dr. Jürgen Stropp Leitung Labor WEILBURGER Graphics GmbH Am Rosenbühl 5 91466 Gerhardshofen Tel.: +49 (0) 9163 9992-64 E-Mail: j.stropp@weilburger-graphics.de WEILBURGER Graphics GmbH
Referentenprofil Dr. Jürgen Stropp Leitung Labor WEILBURGER Graphics GmbH Am Rosenbühl 5 91466 Gerhardshofen Tel.: +49 (0) 9163 9992-64 E-Mail: j.stropp@weilburger-graphics.de WEILBURGER Graphics GmbH
- Erosion als mechanische Zerstörung und Abtragung durch Wasser, Eis und Wind Unter welchen Bedingungen bildet Eisen schützende Überzüge?
 3.2 Metallkorrosion - Veränderung eines metallischen Werkstoffs durch Reaktion mit seiner Umgebung (lat. corrodere = zernagen, zerfressen) - Beeinträchtigungen der Funktion Substanzverlust, Festigkeitsverlust,
3.2 Metallkorrosion - Veränderung eines metallischen Werkstoffs durch Reaktion mit seiner Umgebung (lat. corrodere = zernagen, zerfressen) - Beeinträchtigungen der Funktion Substanzverlust, Festigkeitsverlust,
Kathodischer Korrosionsschutz bei Offshore-Windenergieanlagen. Lisa Herter, M.Sc.
 Kathodischer Korrosionsschutz bei Offshore-Windenergieanlagen Lisa Herter, M.Sc. Steffel KKS GmbH Im Bulloh 6 29331 Lachendorf Tel.: +49 5145 9891310 E-Mail: lisa.herter@steffel.com HTG-Workshop Korrosionsschutz
Kathodischer Korrosionsschutz bei Offshore-Windenergieanlagen Lisa Herter, M.Sc. Steffel KKS GmbH Im Bulloh 6 29331 Lachendorf Tel.: +49 5145 9891310 E-Mail: lisa.herter@steffel.com HTG-Workshop Korrosionsschutz
Beispiel Einsatz KKS-System
 Schadensanalyse Tiefgarage Renaissance Hotel Karlsruhe Beispiel Einsatz KKS-System Andreas Föhl, Matthias Gerold Bürointerner Vortrag 31.07.2014 1 1 Untersuchungen (bis März 2013) 01/2012 Beauftragung,
Schadensanalyse Tiefgarage Renaissance Hotel Karlsruhe Beispiel Einsatz KKS-System Andreas Föhl, Matthias Gerold Bürointerner Vortrag 31.07.2014 1 1 Untersuchungen (bis März 2013) 01/2012 Beauftragung,
Duktiler Beton für die Straßeninfrastruktur
 Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Baustoffe, Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau Forschungskolloquium Betonstraßenbau Wissen schafft Qualität Duktiler Beton für die Straßeninfrastruktur Prof.
Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Baustoffe, Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau Forschungskolloquium Betonstraßenbau Wissen schafft Qualität Duktiler Beton für die Straßeninfrastruktur Prof.
Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau
 Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches
Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches
Betontechnik. Technischer Bericht. TB-BTe B2451-A-1/2014 Untersuchungen an VT05 PAGEL-TURBOVERGUSSMÖRTEL
 Betontechnik VDZ ggmbh Tannenstraße 2 40476 Düsseldorf Telefon: (0211) 45 78-1 Telefax: (0211) 45 78-296 info@vdz-online.de www.vdz-online.de Hauptgeschäftsführer VDZ e.v.: Dr. Martin Schneider Geschäftsführer:
Betontechnik VDZ ggmbh Tannenstraße 2 40476 Düsseldorf Telefon: (0211) 45 78-1 Telefax: (0211) 45 78-296 info@vdz-online.de www.vdz-online.de Hauptgeschäftsführer VDZ e.v.: Dr. Martin Schneider Geschäftsführer:
Elektrolytische Leitfähigkeit
 Elektrolytische Leitfähigkeit 1 Elektrolytische Leitfähigkeit Gegenstand dieses Versuches ist der Zusammenhang der elektrolytischen Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyten mit deren Konzentration.
Elektrolytische Leitfähigkeit 1 Elektrolytische Leitfähigkeit Gegenstand dieses Versuches ist der Zusammenhang der elektrolytischen Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyten mit deren Konzentration.
Mapefloor Parking System. Abdichtungssysteme für Verkehrsflächen
 Mapefloor Parking System Abdichtungssysteme für Verkehrsflächen Anwendungsbeispiele der Mapefloor Parking System Eine Bodenplatte, welche von Fahrzeugen befahren wird und durch Abrieb oder chemische Einflüsse
Mapefloor Parking System Abdichtungssysteme für Verkehrsflächen Anwendungsbeispiele der Mapefloor Parking System Eine Bodenplatte, welche von Fahrzeugen befahren wird und durch Abrieb oder chemische Einflüsse
Sanierung. Im Fokus. von korrodierter Bewehrung in Betonsandwichwänden. Vorgehängte Hinterlüftete Fassade
 Steffen Michael Gross, Weimar Sanierung von korrodierter Bewehrung in Betonsandwichwänden Im Fokus Vorgehängte Hinterlüftete Fassade Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Steffen Michael Gross, Weimar Sanierung von korrodierter Bewehrung in Betonsandwichwänden Im Fokus Vorgehängte Hinterlüftete Fassade Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Schalungskorrosion Ursachen und Vermeidungsstrategien
 Schalungskorrosion Ursachen und Vermeidungsstrategien Dr.-Ing. Till Felix Mayer Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat, München Motivation dieser Arbeit - Fertigteilherstellung rd. 30% des deutschen Gesamtzementverbrauchs
Schalungskorrosion Ursachen und Vermeidungsstrategien Dr.-Ing. Till Felix Mayer Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat, München Motivation dieser Arbeit - Fertigteilherstellung rd. 30% des deutschen Gesamtzementverbrauchs
Prüfbericht P Disboxid 462 EP-Siegel Disbon 973 Kupferband Disboxid 471 AS-Grund Disboxid 972 ESD Multi. 12 Seiten
 Dieser Bericht ist elektronisch abgefasst und verteilt worden. Rechtliche Gültigkeit besitzt ausschließlich das Original des Berichtes auf Papier. Prüfbericht P 4228-1 Prüfungsauftrag: Prüfung von elektrostatischen
Dieser Bericht ist elektronisch abgefasst und verteilt worden. Rechtliche Gültigkeit besitzt ausschließlich das Original des Berichtes auf Papier. Prüfbericht P 4228-1 Prüfungsauftrag: Prüfung von elektrostatischen
Praktikumsbericht. Gruppe 6: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack. Betreuerin: Natalia Podlaszewski 11. November 2008
 Praktikumsbericht Gruppe 6: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack Betreuerin: Natalia Podlaszewski 11. November 2008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theorieteil 3 1.1 Frage 7................................ 3
Praktikumsbericht Gruppe 6: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack Betreuerin: Natalia Podlaszewski 11. November 2008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theorieteil 3 1.1 Frage 7................................ 3
Ingenieurbüro WIETEK A-6073 Innsbruck-Sistrans 290 Tel: +43-512-3781880 Fax: -3781884 e-mail: ibw@a-bau.co.at IBW - CMS
 Korrosion bei Stahl- und Spannbeton Ingenieurbüro WIETEK A-6073 Innsbruck-Sistrans 290 Tel: +43-512-3781880 Fax: -3781884 e-mail: ibw@a-bau.co.at IBW - CMS Korrosion bei Stahl- und Spannbeton Ursachen
Korrosion bei Stahl- und Spannbeton Ingenieurbüro WIETEK A-6073 Innsbruck-Sistrans 290 Tel: +43-512-3781880 Fax: -3781884 e-mail: ibw@a-bau.co.at IBW - CMS Korrosion bei Stahl- und Spannbeton Ursachen
PRÜFBERICHT. CAPAROL Farben und Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt
 PRÜFBERICHT Betrifft Korrosionsschutz auf Stahlbauteilen durch Beschichtungssysteme DIN EN ISO 12944-5 (07/98) Bauaufsichtliche Zulassung gem. Bauregelliste A, Teil 1, ÜHP Ausgabe - 2010/1, lfd. Nr. 4.9.1
PRÜFBERICHT Betrifft Korrosionsschutz auf Stahlbauteilen durch Beschichtungssysteme DIN EN ISO 12944-5 (07/98) Bauaufsichtliche Zulassung gem. Bauregelliste A, Teil 1, ÜHP Ausgabe - 2010/1, lfd. Nr. 4.9.1
3D Konforme Präzisionsbeschichtungen für den Korrosionsschutz effektive Werkzeugbeschichtungen
 3D Konforme Präzisionsbeschichtungen für den Korrosionsschutz effektive Werkzeugbeschichtungen Gliederung Motivation Prozesstechnologie Schichtwerkstoffe Schichtaufbau Eigenschaften Entformungsverhalten
3D Konforme Präzisionsbeschichtungen für den Korrosionsschutz effektive Werkzeugbeschichtungen Gliederung Motivation Prozesstechnologie Schichtwerkstoffe Schichtaufbau Eigenschaften Entformungsverhalten
7 Korrosion und Korrosionsschutz
 7 Korrosion und Korrosionsschutz 7.1 Metallkorrosion lat. corrodere = zernagen, zerfressen Veränderung eines metallischen Werkstoffs durch Reaktion mit seiner Umgebung Beeinträchtigungen der Funktion Substanzverlust,
7 Korrosion und Korrosionsschutz 7.1 Metallkorrosion lat. corrodere = zernagen, zerfressen Veränderung eines metallischen Werkstoffs durch Reaktion mit seiner Umgebung Beeinträchtigungen der Funktion Substanzverlust,
Hinweise zu Betonkonsistenz 2016
 Hinweise zu Betonkonsistenz 2016 Beton-Sortenschlüssel Verdichtungsmass-Klasse Ausbreitmass-Klasse Klasse Verdichtungsmass Klasse Ausbreitmass (Durchmesser in mm) C0 1.46 F1 340 C1 1.45 1.26 F2 350 410
Hinweise zu Betonkonsistenz 2016 Beton-Sortenschlüssel Verdichtungsmass-Klasse Ausbreitmass-Klasse Klasse Verdichtungsmass Klasse Ausbreitmass (Durchmesser in mm) C0 1.46 F1 340 C1 1.45 1.26 F2 350 410
Abdichtungsinjektion mit Acrylatgel und das Korrosionsrisiko für die Bewehrung im Stahlbetonbauwerk
 Abdichtungsinjektion mit Acrylatgel und das Korrosionsrisiko für die Bewehrung im Stahlbetonbauwerk Dipl. Ing. Knut Asendorf; Asendorf Bauchemie Consult Wiesbaden Injektionen mit hydrophilen polymeren
Abdichtungsinjektion mit Acrylatgel und das Korrosionsrisiko für die Bewehrung im Stahlbetonbauwerk Dipl. Ing. Knut Asendorf; Asendorf Bauchemie Consult Wiesbaden Injektionen mit hydrophilen polymeren
DGO Bezirksgruppenabend Stu5gart Dr. Benjamin Fiedler. IFO - Institut für Oberflächentechnik GmbH Schwäbisch Gmünd
 Methoden und Abläufe bei der Untersuchung von Schadensfällen bei einem Prüf- und Analytik-Dienstleister am Beispiel eines Schadenfalls durch Wasserstoffversprödung DGO Bezirksgruppenabend Stu5gart 18.02.2016
Methoden und Abläufe bei der Untersuchung von Schadensfällen bei einem Prüf- und Analytik-Dienstleister am Beispiel eines Schadenfalls durch Wasserstoffversprödung DGO Bezirksgruppenabend Stu5gart 18.02.2016
Versuch 8: Korrosion Werkstoffteil, Herbstsemester 2008
 Versuch 8: Korrosion Werkstoffteil, Herbstsemester 2008 Verfasser: Zihlmann Claudio Teammitglieder: Bachmann Simon, Knüsel Philippe, Schär Louis Datum: 20.11.08 Assistent: Matteo Seita E-Mail: zclaudio@student.ethz.ch
Versuch 8: Korrosion Werkstoffteil, Herbstsemester 2008 Verfasser: Zihlmann Claudio Teammitglieder: Bachmann Simon, Knüsel Philippe, Schär Louis Datum: 20.11.08 Assistent: Matteo Seita E-Mail: zclaudio@student.ethz.ch
Inhaltsverzeichnis. 1. Allgemeines. 2. Untersuchungen an Beton unbewehrt- 2.1 Druckfestigkeit 2.2 Spaltzugfestigkeit 2.
 2 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines 2. Untersuchungen an Beton unbewehrt- 2.1 Druckfestigkeit 2.2 Spaltzugfestigkeit 2.3 Trockenrohdichte 3. Untersuchungen am Holz 3.1 Geruch, Schädlinge, Bewuchs 3.2 Feststellen
2 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines 2. Untersuchungen an Beton unbewehrt- 2.1 Druckfestigkeit 2.2 Spaltzugfestigkeit 2.3 Trockenrohdichte 3. Untersuchungen am Holz 3.1 Geruch, Schädlinge, Bewuchs 3.2 Feststellen
1 Einleitung. Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde
 1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN
 11. Einheit: KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN Sebastian Spinnen, Ingrid Reisewitz-Swertz 1 von 16 ZIELE DER HEUTIGEN EINHEIT Am Ende der Einheit Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen..
11. Einheit: KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN Sebastian Spinnen, Ingrid Reisewitz-Swertz 1 von 16 ZIELE DER HEUTIGEN EINHEIT Am Ende der Einheit Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen..
Mapefloor Parking System. Abdichtungssysteme für Verkehrsflächen
 Mapefloor Parking System Abdichtungssysteme für Verkehrsflächen Anwendungsbeispiele der Mapefloor Parking Systems Eine Bodenplatte, welche von Fahrzeugen befahren wird und durch Abrieb oder chemische Einflüsse
Mapefloor Parking System Abdichtungssysteme für Verkehrsflächen Anwendungsbeispiele der Mapefloor Parking Systems Eine Bodenplatte, welche von Fahrzeugen befahren wird und durch Abrieb oder chemische Einflüsse
Feuerverzinken im Stahl- und Verbundbrückenbau
 Feuerverzinken im Stahl- und Verbundbrückenbau Institut Feuerverzinken GmbH Regionalbüro Nordost Graf-Recke-Straße 82 40239 Düsseldorf Tel.: 0211 6907650 Mobil: 0172-8990700 www.feuerverzinken.com Dipl.-Ing.
Feuerverzinken im Stahl- und Verbundbrückenbau Institut Feuerverzinken GmbH Regionalbüro Nordost Graf-Recke-Straße 82 40239 Düsseldorf Tel.: 0211 6907650 Mobil: 0172-8990700 www.feuerverzinken.com Dipl.-Ing.
Untersuchungsbericht Nr
 Empa Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf T +41 58 765 11 11 F +41 58 765 62 44 www.empa.ch Zürcher Hochschule der Künste Departement Kulturanalyse und Vermittlung Projekt dukta, Serge Lunin Herostrasse
Empa Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf T +41 58 765 11 11 F +41 58 765 62 44 www.empa.ch Zürcher Hochschule der Künste Departement Kulturanalyse und Vermittlung Projekt dukta, Serge Lunin Herostrasse
Die Reaktionen an der Anode des Korrosionselementes verlaufen stets nach folgender Gleichung ab:
 Prof. Dr.Ing. Dirk Werner Dirk.Werner@HTWBerlin.de x11 WPModule Stahlbau Bachelor / Master 9.1.3 Ausgewählte Korrosionselemente und deren Reaktionen Ein (lokales) Korrosionselement entsteht quasi automatisch,
Prof. Dr.Ing. Dirk Werner Dirk.Werner@HTWBerlin.de x11 WPModule Stahlbau Bachelor / Master 9.1.3 Ausgewählte Korrosionselemente und deren Reaktionen Ein (lokales) Korrosionselement entsteht quasi automatisch,
Beschichtungssysteme für LAU- und HBV- Anlagen nach aktuellen Zulassungskriterien
 Beschichtungssysteme für LAU- und HBV- Anlagen nach aktuellen Zulassungskriterien Hannover/Dortmund/Gießen März 2017 Dr. Michael Grebner WHG Fachtagung März 2017 1 Themen: Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
Beschichtungssysteme für LAU- und HBV- Anlagen nach aktuellen Zulassungskriterien Hannover/Dortmund/Gießen März 2017 Dr. Michael Grebner WHG Fachtagung März 2017 1 Themen: Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
Wärmeleitung und thermoelektrische Effekte Versuchsauswertung
 Versuch P2-32 Wärmeleitung und thermoelektrische Effekte Versuchsauswertung Marco A., Gruppe: Mo-3 Karlsruhe Institut für Technologie, Bachelor Physik Versuchstag: 30.05.2011 1 Inhaltsverzeichnis 1 Bestimmung
Versuch P2-32 Wärmeleitung und thermoelektrische Effekte Versuchsauswertung Marco A., Gruppe: Mo-3 Karlsruhe Institut für Technologie, Bachelor Physik Versuchstag: 30.05.2011 1 Inhaltsverzeichnis 1 Bestimmung
Kathodischer Korrosionsschutz als Alternative zur bautechnischen Betonsanierung
 Inserat ReSource Kathodischer Korrosionsschutz Kathodischer Korrosionsschutz als Alternative zur bautechnischen Betonsanierung Thorsten Eichler 1. Einleitung...81 2. Grundlagen...82 3. Beispiele zur praktischen
Inserat ReSource Kathodischer Korrosionsschutz Kathodischer Korrosionsschutz als Alternative zur bautechnischen Betonsanierung Thorsten Eichler 1. Einleitung...81 2. Grundlagen...82 3. Beispiele zur praktischen
Grundpraktikum Physikalische Chemie
 Grundpraktikum Physikalische Chemie Versuch 10: Elektrische Leitfähigkeit von Elektrolyten überarbeitet: Tobias Staut, 2014.07 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbereitung und Eingangskolloquium 3 2 Messung der Überführungszahlen
Grundpraktikum Physikalische Chemie Versuch 10: Elektrische Leitfähigkeit von Elektrolyten überarbeitet: Tobias Staut, 2014.07 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbereitung und Eingangskolloquium 3 2 Messung der Überführungszahlen
1. Elektroanalytik-I (Elektrochemie)
 Instrumentelle Analytik SS 2008 1. Elektroanalytik-I (Elektrochemie) 1 1. Elektroanalytik-I 1. Begriffe/Methoden (allgem.) 1.1 Elektroden 1.2 Elektrodenreaktionen 1.3 Galvanische Zellen 2 1. Elektroanalytik-I
Instrumentelle Analytik SS 2008 1. Elektroanalytik-I (Elektrochemie) 1 1. Elektroanalytik-I 1. Begriffe/Methoden (allgem.) 1.1 Elektroden 1.2 Elektrodenreaktionen 1.3 Galvanische Zellen 2 1. Elektroanalytik-I
optischen Prüfung mit anderen ZfP-Verfahren
 3. Fachseminar Optische Prüf- und Messverfahren - Vortrag 1 1 - Endoskopie im Bauwesen und die Kombination der optischen Prüfung mit anderen ZfP-Verfahren Saskia Frey Dipl.-Ing. Was macht Frey Engineering:
3. Fachseminar Optische Prüf- und Messverfahren - Vortrag 1 1 - Endoskopie im Bauwesen und die Kombination der optischen Prüfung mit anderen ZfP-Verfahren Saskia Frey Dipl.-Ing. Was macht Frey Engineering:
Untersuchung zur Gleichwertigkeit des LOVIBOND CSB vario Küvettentest mit dem Hach * CSB Küvettentest
 Untersuchung zur Gleichwertigkeit des LOVIBOND CSB vario Küvettentest mit dem CSB Küvettentest Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung und Zielsetzung 1 Verwendete Methoden, Reagenzien und Geräte 1 Teil I
Untersuchung zur Gleichwertigkeit des LOVIBOND CSB vario Küvettentest mit dem CSB Küvettentest Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung und Zielsetzung 1 Verwendete Methoden, Reagenzien und Geräte 1 Teil I
Regelgerechter Beton für Bodenplatten genügt das?
 Aachener Baustofftage 2015, 05.02.2015 Regelgerechter Beton für Bodenplatten genügt das? Christian Neunzig Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Lehrstuhl für Baustoffkunde Regelgerechter
Aachener Baustofftage 2015, 05.02.2015 Regelgerechter Beton für Bodenplatten genügt das? Christian Neunzig Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Lehrstuhl für Baustoffkunde Regelgerechter
CEM-II-M-Zemente für nachhaltige Brückenbauwerke (k)ein Widerspruch
 CEM-II-M-Zemente für nachhaltige Brückenbauwerke (k)ein Widerspruch Betontechnologen- u. Mischmeisterschulung 2015 HEIKO ZIMMERMANN Klimawandel, CO 2 - (Energie-) Einsparung Offene Fragen? Wie weit können
CEM-II-M-Zemente für nachhaltige Brückenbauwerke (k)ein Widerspruch Betontechnologen- u. Mischmeisterschulung 2015 HEIKO ZIMMERMANN Klimawandel, CO 2 - (Energie-) Einsparung Offene Fragen? Wie weit können
Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen
 Strength. Performance. Passion. Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen Dr. Peter Lunk Holcim (Schweiz) AG Inhalt Einleitung Betonsorten Expositionsklasse und schweizerische Dauerhaftigkeitsprüfungen
Strength. Performance. Passion. Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen Dr. Peter Lunk Holcim (Schweiz) AG Inhalt Einleitung Betonsorten Expositionsklasse und schweizerische Dauerhaftigkeitsprüfungen
Elektromagnetische Schwingkreise
 Grundpraktikum der Physik Versuch Nr. 28 Elektromagnetische Schwingkreise Versuchsziel: Bestimmung der Kenngrößen der Elemente im Schwingkreis 1 1. Einführung Ein elektromagnetischer Schwingkreis entsteht
Grundpraktikum der Physik Versuch Nr. 28 Elektromagnetische Schwingkreise Versuchsziel: Bestimmung der Kenngrößen der Elemente im Schwingkreis 1 1. Einführung Ein elektromagnetischer Schwingkreis entsteht
ERSETZT. - nicht zutreffend - (Erstausgabe)
 AG-SIL-2017-01-A -DE Calidus Seitenplatten Mastoberteil Kategorie A GÜLTIG AB 01.09.2017 ERSETZT - nicht zutreffend - (Erstausgabe) GÜLTIGKEIT Dieser Service Information Letter gilt für Calidus. FRISTEN
AG-SIL-2017-01-A -DE Calidus Seitenplatten Mastoberteil Kategorie A GÜLTIG AB 01.09.2017 ERSETZT - nicht zutreffend - (Erstausgabe) GÜLTIGKEIT Dieser Service Information Letter gilt für Calidus. FRISTEN
E3 Aktivitätskoeffizient
 Physikalisch-Chemische Praktika E3 Aktivitätskoeffizient Stichworte zur Vorbereitung: Den Kontext der folgenden Stichworte sollten Sie zur Vorbesprechung und während der Durchführung des Praktikumstermins
Physikalisch-Chemische Praktika E3 Aktivitätskoeffizient Stichworte zur Vorbereitung: Den Kontext der folgenden Stichworte sollten Sie zur Vorbesprechung und während der Durchführung des Praktikumstermins
Allgemeine Angaben zu Tiefgaragen
 Allgemeine Angaben zu Tiefgaragen Tiefgaragen sind hoch belastete Bauwerke, die durch den Fahrzeugverkehr stark beansprucht werden und vergleichbaren Umwelteinflüssen wie Brückenbauwerken ausgesetzt sind.
Allgemeine Angaben zu Tiefgaragen Tiefgaragen sind hoch belastete Bauwerke, die durch den Fahrzeugverkehr stark beansprucht werden und vergleichbaren Umwelteinflüssen wie Brückenbauwerken ausgesetzt sind.
LEGI-Galva + Die bessere TRIPLEX-Beschichtung
 LEGI-Galva + Die bessere TRIPLEX-Beschichtung Zink Chrom Lack Bester Schutz Brillante Optik Schnellste Verfügbarkeit LEGI-Galva + Der bessere TRIPLEX-Schutz von LEGI Zink Chrom Lack Ausschließlich im Vollbad
LEGI-Galva + Die bessere TRIPLEX-Beschichtung Zink Chrom Lack Bester Schutz Brillante Optik Schnellste Verfügbarkeit LEGI-Galva + Der bessere TRIPLEX-Schutz von LEGI Zink Chrom Lack Ausschließlich im Vollbad
FOR 1498/0 AKR unter kombinierter Einwirkung. Transport und Lösevorgänge im Gesteinskorn
 FOR 1498/0 AKR unter kombinierter Einwirkung Teilprojekt 5: Univ. Prof. Dr. Ing. H. M. Ludwig Univ. Prof. Dr. Ing. habil. J. Stark Seyfarth / Giebson / Dietsch F.A. Finger Institut für Baustoffkunde Bauhaus
FOR 1498/0 AKR unter kombinierter Einwirkung Teilprojekt 5: Univ. Prof. Dr. Ing. H. M. Ludwig Univ. Prof. Dr. Ing. habil. J. Stark Seyfarth / Giebson / Dietsch F.A. Finger Institut für Baustoffkunde Bauhaus
Bauwerk: AA-Brücke. Fahrbahn neben der Gleisanlage. Datum der Ergebnisfeststellung: 20.Mai 2xxx. Seite 1 von 12
 Bauwerk: AA-Brücke Datum der Ergebnisfeststellung: 20.Mai 2xxx Fahrbahn neben der Gleisanlage Seite 1 von 12 1. Einleitung Die AA-Brücke wird z.zt. saniert. Nach dem Abtragen des Fahrbahnbelages und dem
Bauwerk: AA-Brücke Datum der Ergebnisfeststellung: 20.Mai 2xxx Fahrbahn neben der Gleisanlage Seite 1 von 12 1. Einleitung Die AA-Brücke wird z.zt. saniert. Nach dem Abtragen des Fahrbahnbelages und dem
Bedeutung der Vor-Ort-Messung von Grundwasser- Milieukennwerten Probleme und Lösungen
 Bedeutung der Vor-Ort-Messung von Grundwasser- Milieukennwerten Probleme und Lösungen C. Nitsche BGD Boden- und Grundwasserlabor GmbH Tiergartenstraße 48 01219 Dresden cnitsche@bgd-gmbh.de Grundwassermonitoring
Bedeutung der Vor-Ort-Messung von Grundwasser- Milieukennwerten Probleme und Lösungen C. Nitsche BGD Boden- und Grundwasserlabor GmbH Tiergartenstraße 48 01219 Dresden cnitsche@bgd-gmbh.de Grundwassermonitoring
M. Brianza: Empfehlungen zu den Expositionsklassen XA FSKB Frühjahrstagung FSKB Empfehlungen zu den Expositionsklassen XA
 Frühjahrstagung FSKB 2006 Empfehlungen zu den 1 Beanspruchung von Beton Angriff auf die Bewehrung Schädigung des Betongefüges Meerwasser S F Frost (mit/ohne Taumittel) Chloride D 0 A chemischen Angriff
Frühjahrstagung FSKB 2006 Empfehlungen zu den 1 Beanspruchung von Beton Angriff auf die Bewehrung Schädigung des Betongefüges Meerwasser S F Frost (mit/ohne Taumittel) Chloride D 0 A chemischen Angriff
ZUSAMMENFASSUNG F Schädigung von XF1- und XF2-Betonen im CIF- und CDF-Test - Auswertung vorhandener Versuche und Literaturübersicht
 INSTITUT FÜR BAUFORSCHUNG AACHEN ZUSAMMENFASSUNG F 7050 Schädigung von XF1- und XF2-Betonen im CIF- und CDF-Test - Auswertung vorhandener Versuche und Literaturübersicht Projekt Nr. ZP 52-5-7.276-1258/07
INSTITUT FÜR BAUFORSCHUNG AACHEN ZUSAMMENFASSUNG F 7050 Schädigung von XF1- und XF2-Betonen im CIF- und CDF-Test - Auswertung vorhandener Versuche und Literaturübersicht Projekt Nr. ZP 52-5-7.276-1258/07
Zum Einfluss der Holzfeuchte bei. Nagelplattenverbindungen i
 Zum Einfluss der Holzfeuchte bei Nagelplattenverbindungen i H.J. Blaß, M. Romani 1 Problemstellung - Zielsetzung Die meisten Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften des Holzes werden durch höhere Holzfeuchten
Zum Einfluss der Holzfeuchte bei Nagelplattenverbindungen i H.J. Blaß, M. Romani 1 Problemstellung - Zielsetzung Die meisten Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften des Holzes werden durch höhere Holzfeuchten
Bahnbrücke Eglisau Monitoring an einer über 100 Jahre alten Stahlbrücke in der Schweiz. 3. IHRUS Tagung
 Bahnbrücke Eglisau Monitoring an einer über 100 Jahre alten Stahlbrücke in der Schweiz 3. IHRUS Tagung Christian Meyer 14. November 2013 Bahnbrücke Eglisau Unsere Kompetenzen Das Projekt und seine Herausforderungen
Bahnbrücke Eglisau Monitoring an einer über 100 Jahre alten Stahlbrücke in der Schweiz 3. IHRUS Tagung Christian Meyer 14. November 2013 Bahnbrücke Eglisau Unsere Kompetenzen Das Projekt und seine Herausforderungen
Trinkwasserbehälter Beschichtungen von. Trinkwasser genießen mit epasit
 Trinkwasserbehälter Beschichtungen von Trinkwasser genießen mit epasit Über 30 Jahre Innenbeschichtungen in Trinkwasserbehältern Planung Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser muss sicher gestellt
Trinkwasserbehälter Beschichtungen von Trinkwasser genießen mit epasit Über 30 Jahre Innenbeschichtungen in Trinkwasserbehältern Planung Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser muss sicher gestellt
Versuch Q1. Äußerer Photoeffekt. Sommersemester Daniel Scholz
 Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch Q1 Äußerer Photoeffekt Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt am:
Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch Q1 Äußerer Photoeffekt Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt am:
Mikrosiebe mit foulingabweisenden Nanobeschichtungen und UV-Entkeimung für die Mikrofiltration
 Mikrosiebe mit foulingabweisenden Nanobeschichtungen und UV-Entkeimung für die Mikrofiltration Ilka Gehrke, Volkmar Keuter Fraunhofer UMSICHT nano meets water II, Oberhausen, November 29, 2010 Folie 1
Mikrosiebe mit foulingabweisenden Nanobeschichtungen und UV-Entkeimung für die Mikrofiltration Ilka Gehrke, Volkmar Keuter Fraunhofer UMSICHT nano meets water II, Oberhausen, November 29, 2010 Folie 1
Ausblick beim R-Beton über die Regelwerke hinaus: Ergebnisse aus Laborversuchen und einem Demonstrationsvorhaben
 Themenkreis 4 Ausblick beim R-Beton über die Regelwerke hinaus: Ergebnisse aus Laborversuchen und einem Demonstrationsvorhaben Dipl.-Ing. Ralf Lieber, Dipl.-Geol. Bernhard Dziadek Krieger Beton-Technologiezentrum
Themenkreis 4 Ausblick beim R-Beton über die Regelwerke hinaus: Ergebnisse aus Laborversuchen und einem Demonstrationsvorhaben Dipl.-Ing. Ralf Lieber, Dipl.-Geol. Bernhard Dziadek Krieger Beton-Technologiezentrum
Chemie Protokoll. Versuch 2 3 (RKV) Reaktionskinetik Esterverseifung. Stuttgart, Sommersemester 2012
 Chemie Protokoll Versuch 2 3 (RKV) Reaktionskinetik Esterverseifung Stuttgart, Sommersemester 202 Gruppe 0 Jan Schnabel Maximilian Möckel Henri Menke Assistent: Durmus 20. Mai 202 Inhaltsverzeichnis Theorie
Chemie Protokoll Versuch 2 3 (RKV) Reaktionskinetik Esterverseifung Stuttgart, Sommersemester 202 Gruppe 0 Jan Schnabel Maximilian Möckel Henri Menke Assistent: Durmus 20. Mai 202 Inhaltsverzeichnis Theorie
