MÜNZNAMEN und ihre Herkunft
|
|
|
- Catharina Kopp
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Konrad Klütz MÜNZNAMEN und ihre Herkunft Grundriß einer etymologischen Ordnung der Münznamen money trend Verlag,Wien
3 Copyright by moneytrend Verlag Alle Rechte vorbehalten. Verlag: money trend Verlagsgesellschaft mbh, 3002 Purkersdorf bei Wien und 1180 Wien, Kutschkergasse 42, Gestaltung: Money Trend Verlagsgesellschaft mbh, Wien Verlag Österreichische Bürgermeister-Zeitung Ges.m.b.H., 3002 Purkersdorf bei Wien und 1180 Wien Mitarbeiter: Gerd-Volker Weege (Lektorat) Stephan Hummel, Jan Weber, Michael Tersch (Produktion) Anzeigen: Zuzanna Stauffer Druck: Druckerei Jentzsch & Co. GesmbH, Wien Das Münzbild für den Buchtitel stellte uns freundlicherweise die Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn zur Verfügung. printed in austria 2004 ISBN
4 Auch die Münzen sehnen sich nach lebendig-verstehenden Blicken (Gerhart Hauptmann, 1940)
5 Vorwort In der Mehrzahl der einschlägigen numismatischen Literatur wird die etymologische Deutung der Münznamen nur am Rande, gleichermaßen als Beiwerk, berücksichtigt, obwohl bei intensiverer Untersuchung Münzbezeichnungen eine nicht zu unterschätzende Aussagekraft enthalten. Münznamen sind durchaus keine toten, inhaltsarmen Wortgebilde, sondern sie waren zum Zeitpunkt ihrer Entstehung lebendiger Ausdruck von Zukunftsvisionen, Hoffnungen, Wünschen und Träumen (z. B. der Ewige Pfennig), von Ehrerbietung, Macht und Stärke (wie der Sovereign), aber auch von Verachtung und Abneigung (Wanzen und Seufzer). Sie spiegeln die Glaubenshaltung ganzer Zeitabschnitte wider (Kreuzer, Mariengroschen), oder sie sind, wie in der Antike, schlichte Gewichts- und Zählangaben. Der Münzname ermöglicht zudem einen Einblick in das ethische Werteverständnis der jeweiligen Epoche und ist somit zweifellos auch ein wesentliches kulturhistorisches Zeugnis. Die letzte umfangreichere Arbeit, die Münznamen etwas stärker in den Vordergrund treten läßt, ist das Handwörterbuch der gesammten Münzkunde von Dr. Carl Christoph Schmieder. Es wurde vor ca. 190 Jahren (1811) geschrieben. Eine intensivere Beschäftigung mit dem Klangbild und der Wortgestaltung läßt erkennen, daß der weitaus größte Teil der Münznamen geradezu eine Kurzbeschreibung, oft eine treffende zusammenfassende Charakteristik der Münze in sich birgt. Das trifft augenfällig insbesondere auf die große Zahl der Namen zu, die sich auf das Münzbild, auf den Prägeherrn und auf die Münzbeschriftung beziehen, aber auch auf die Namen, die auf den Prägeanlaß, auf den Verwendungszweck, auf das Aussehen oder auch auf das Material zurückgehen. Nicht minder aussagekräftig sind die Begriffe, die auf den Prägeort, auf das Präge- und Umlaufgebiet oder auch auf die Herstellungsart hinweisen. Eine Sichtung der Münznamen nach ihrer etymologischen Aussage ist m. W. bisher noch nicht erfolgt und war geradezu überfällig. Eine vorrangige Intention dieser Arbeit war, möglichst viele Münznamen und ihre etymologischen Deutungen zusammenzutragen, zusammenzuführen, nach Möglichkeit zu ergänzen, zu vergleichen, verwandtschaftliche Beziehungen aufzudecken und danach in eine Ordnung zu bringen. Eine erste Auswertung wurde vorgenommen und könnte fortgesetzt werden. Die systematisch gegliederte nach Möglichkeit lückenlose Anreihung bestimmter Namensgebiete kommt speziellen Sammlungsinteressen entgegen. Ursprünglich war nur eine Berücksichtigung der Münznamen aus dem europäischkleinasiatischen Raum vorgesehen. Doch eine durch Handel, Kolonisation oder Krieg stattgefundene Verbreitung dieser Münznamen auch auf andere Erdteile stand diesem Vorhaben entgegen, ebenso ein oft interessanter Vergleich ähnlicher
6 Namensentwicklungen in außereuropäischen Gebieten. Sprachschwierigkeiten ließen jedoch insbesondere die Wurzeln afrikanischer und ostasiatischer Münznamen im Dunkeln oder führten möglicherweise zu falschen Ergebnissen, so daß sicher Korrekturen und Ergänzungen notwendig werden. 41 Münznamen, das sind 1,1 %, blieben ohne Deutung. Die Schreibung der Ausdrücke wurde so belassen, wie in den einzelnen Werken vorgefunden, so die Kleinschreibung vieler alter, aber auch die sehr moderner Münznamen. Münzbezeichnungen anderer Schriften wurden möglichst lautgetreu übertragen. Redewendungen, Ausführungen über Münznamen in der Literatur oder Beziehungen zu Kunst und Naturwissenschaft sollen die Bedeutung verschiedener Münzen in ihrer Epoche erhellen. Anmerkungen oder auch intensivere, in die Tiefe gehende etymologische Erläuterungen können Hintergrundinformationen nachhaltig ergänzen. Bei solch einem umfangreichen Vorhaben ist Friedrich Frhr. von Schrötters Wörterbuch der Münzkunde nach wie vor unersetzbar und gibt auch noch nach dem Jahr 2000 zumeist zuverlässige Auskunft. Daneben sind die Nachschlagewerke Fassbenders, Fenglers, Kahnts, Krohas, aber auch noch Halkes besonders hilfreich. Aus den etymologischen Werken fand Wolfgang Pfeifers Etymologisches Wörterbuch des Deutschen bevorzugt Verwendung. Das Einordnen in 16 Rubriken ist nicht immer eindeutig möglich und bei kritischer Betrachtung eventuell auch anders zu sehen; doch erschien es mir wesentlich, Grundzusammenhänge der Entstehung von Münznamen in den verschiedensten Zeiten und Regionen nebeneinanderzustellen und die Ergebnisse zusammenzufassen. In der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt Münznamen berücksichtigt. Davon sind 319 Ausdrücke (8,4%) neu gedeutet. Celle, im Frühjahr 2004
7 Abkürzungen Abk. Abkürzung(en) german. germanisch portugies. portugiesisch Abltg. Ableitung(en) gespr. gesprochen präf. Präfix adj. Adjektiv griech., gr. griechisch präs. Präsens adv. Adverb hebr(ä). hebräisch pron. Pronomen akkad. akkadisch hl. heilige(r) röm. römisch althochd. althochdeutsch holländ. holländisch roman. romanisch angelsächs. angelsächsisch iber. iberisch Rs. Rückseite Anmerkg. Anmerkung indeklin. indeklinabel russ. russisch alban. albanisch insbes. insbesondere Rw. Redewendung alemann. alemannisch ir. irisch s. siehe! altfränk. altfränkisch Jhdt. Jahrhundert s. d. siehe dieses, s. dort! arab. arabisch jidd. jiddisch s. o. siehe oben! armen. armenisch Jts. Jahrtausend s. u. siehe unten! altsächs. altsächsisch karaib. karaibisch schott. schottisch astronom. astronomisch kelt. keltisch schwäb. schwäbisch altslaw. altslawisch latein. lateinisch semit. semitisch bair. bairisch Lit. Literatur sing. Singular balt. baltisch m(ask). Maskulinum skyth. skythisch Bot. Botanik mittelhochd. mittelhochdeutsch siaw. slawisch bzw. beziehungsweise mundartl. mundartlich slowen. slowenisch d. Durchmesser mytholog. mythologisch sog. sogenannt d. h. das heißt Mz-Meister Münzmeister Sprw. Sprichwort d. i. das ist n. Neutrum subst. Substantiv d. s. das sind Nabltg. Namensableitung suff. Suffix d. w. das war, das waren Nhk. Namensherkunft sup. Superlativ dän. dänisch Nverwandtsch. Namensverwandtschaft thrak. thrakisch diminut. Diminutivum Nhw. Namenshinweis u. a. und andere(s), eigtl. eigentlich neuhochd. neuhochdeutsch unter anderem engl. englisch niederd. niederdeutsch u. U. unter Umständen erg. ergänze(n) nord, nordisch umgsspr. umgangssprachlich etc. et cetera num. Numerale (Zahlwort) ursprüngl. ursprünglich euphemist. euphemistisch o. ä. oder ähnlich urverw. urverwandt europ. europäisch O. J. ohne Jahresangabe venezian. venezianisch evtl. eventuell o. O. ohne Ortsangabe verb. Verbum fem. Femininum oberd. oberdeutsch vergl. vergleiche fränk. fränkisch part. perf. Partizip Perfekt verw. verwandt französ. französich part. präs. Partizip Präsens vulgärlat. vulgärlatein gall. gallisch perf. Perfekt Vs. Vorderseite geb. geboren pers. persisch Wortabltg. Wortableitung gegr. gegründet pl. Plural Wortentwicklg. Wortentwicklung gen. Genitiv poln. polnisch Worterklärg. Worterklärung Sprachepochen althochdeutsch: ca. 700 bis ca mittelhochdeutsch: ca bis ca Blütezeit: ca. bis 1250 Neuhochdeutsch: ab ca altenglisch: 5./6. Jhdt. v. Chr. bis ca n. Chr. mittelenglisch: ca bis ca neuenglisch: ab ca. 1500; von mehr als Menschen als Muttersprache gesprochen; daneben Pidgin Englisch Lateinisch: vor dem 3. Jhdt. v. Chr. in Rom und Latium, danach im Römischen Reich und im Römischen Weltreich (bis 476 n. Chr.) im Mittelalter ( ) Sprache der Geistlichen und Gelehrten, in der Gegenwart in wissenschaftlichen Bereichen und in der katholischen Kirche Vulgärlatein: Griechisch: die schriftlich nicht überlieferte lateinische Volkssprache seit dem 14. bis 12. Jhdt. v. Chr. das mykenische Griechisch; 2. Hälfte des 8. Jhdt.s v. Chr. Homerische Dichtungen; der attische Dialekt in Athen (und Umgebung), in der Literatur und als Bildungssprache; offizielle Sprache des Byzantinischen Reiches (395 n. Chr ); im Spätmittelalter - um neben Latein Gelehrtensprache des Humanismus, ab 1518 Grammatik von Erasmus von Rotterdam (1466/ ), Reuchlin ( ), Melanchthon ( ) u. a.
8 Inhalt Münznamen und ihre Herkunft Seite Vorwort 4 Abkürzungen 6 Sprachepochen 6 Wörterverzeichnis 8 Grundriß einer etymologischen Ordnung der Münznamen Vorbemerkungen 304 Übersicht 305 Auflistung nach Gruppen und Rubriken 306 Statistische Auswertung, Gesamtübersicht 332 Auswertung nach Gruppen und Rubriken 333 Zeittafel der Einführung wesentlicher Grundnamen 340 Hauptumlaufzeiten vorherrschender Münznamen in Europa 341 Gemeinschaftsmünzen mit eigenen Münznamen 342 Alphabetisches Literaturverzeichnis 343 Bildernachweis 346
9 Wörterverzeichnis 8 A Aachener Mark ist die Bezeichnung für eines der ersten ausgeprägten silbernen Markstücke der früheren Gewichts- und Recheneinheit Mark (s. d.) und wurde von 1577 bis ca gemünzt (vergl. Lübische Mark; s. auch Ratszeichen). - Nhk.: Das Geldstück wurde von der Reichsstadt Aachen herausgegeben. - Aachen, Stadt in Nordrhein-Westfalen; französ. Aix la Chapelle, latein. Civitas Aquensis, Aquisgranum (3. Jhdt.), Aquasgranum, Granis Aquae, Palatium Aquae, Aquensis urbs u. a. - Deutsche Silben wie ach, aach, aha, deuten auf latein. aqua, Wasser, fließendes Wasser, Fluß, Bad, Heilquelle hin; indogerm. ak; mittelhochd. ahe, Fluß, Wasser ; südd. ache, Bach ; dazu mitelhochd. ach-vart, Wallfahrt nach Aachen ; granus war ein Beiname Apollos, den die Römer an Thermen verehrten. - Anmerkg.: Aachen, Residenzstadt Karls des Großen ( ), mindestens seit dieser Zeit mit Unterbrechungen Münzstätte (s. auch Jungheitsgroschen); 936 bis 1531 deutsche Krönungsstadt, 1166 Marktrecht, 1136 freie Reichsstadt, 1794 französ., 1815 bis 1945 preußisch. Abbasi, Abasi, Abbasen, Abaz, - 1) die Bezeichnung für eine persische Silbermünze, vom 17. bis 19. Jhdt. geprägt, erstmals ) Eine georgische Silbermünze der Jahre 1803 bis ) Eine afghanische Silber- bzw. Billonmünze, 1920 bis 1925 herausgegeben. - Nhk.: benannt nach dem Schah von Persien, Abbâs I., dem Großen ( ). Abbey crown ist der Name einer schottischen Goldmünze zu 20 Shillings (s. d.), ab 1526 unter Jakob V. von Schottland ( ) geschlagen. - Nhk.: Die Krone (s. Crown) wurde statt in Edinburgh in Holyrood-Abbey geschlagen. abbassidische Münzen, verkürzt Abbassiden, sind islamische silberne Dirhems und goldene Dinare (s. d.), vom 8. bis 13. Jhdt. in Bagdad geschlagen. - Nhk.: benannt nach der Kalifendynastie der Abbassiden, die von 750 bis 1258 in Bagdad herrschte. Stammvater und Namensgeber der Dynastie war Abbas ben Abdel Mothalleb ( ), ein Onkel des islamischen Glaubensstifters Mohammed (*570 in Mekka, +632 in Medina), dessen Gegner Abbas zunächst war. - Anmerkg.: Der berühmteste Abbassidenkalif war Harún al Raschid ( ), unter dessen Regierung das Kalifenreich die größte Macht und die höchste kulturelle Blüte erreichte und der in den Erzählungen 1001 Nacht als gerechter und weiser Kalif dargestellt wird. Er pflegte diplomatische und freundschaftliche Beziehungen zu Karl dem Großen ( ) und sandte ihm kostbare Geschenke. ABC-Pfennige sind Nürnberger Rechenpfennige (s. d.) aus der Zeit um Die Vs. zeigt einen Rechenmeister am Rechentisch. - Nhk.: Die Rs. zeigt in fünf Zeilen das ABC, das Alphabet. Abdruck ist die Bezeichnung für die Negativform (einer Münzseite), die zumeist aus einer Stannioloder Aluminiumfolie hergestellt wird oder auch aus Kitt, Plastillin o. ä. - Die Negativform ist eigentlich nur eine Zwischenform, die noch mit Gips, Blei, Zinn o. a. ausgegossen werden muß, so daß ein Münzabguß (s. Abguß) entstehen kann. - Nhk.: Der Ausdruck bezeichnet den Vorgang des Drükkens, das Abdrücken der Stanniolfolie o. ä. auf die Münzoberfläche. Um ein möglichst originalgetreues Münzrelief zu erhalten, wird für den Abdruck eine feinborstige Bürste verwendet. - Weiterer Name: Abformung (s. d.). Abendmahlspfennig ist kein Münzname, sondern eine Bezeichnung für eine von Kirchengemeinden ausgegebene Berechtigungsmarke (s. auch Marke), zumeist aus Zinn oder Blei hergestellt, oft mit Symbolen versehen, die auf das Abendmahl verweisen (wie Kelch, Oblate, Gotteslamm u. a). Der A. soll angeblich von Calvin, Reformator in der Schweiz ( ), eingeführt worden sein. Er hat dann auch in deutschen Städten und Regionen Verwendung gefunden, u. a. in Danzig und in Niedersachsen, ebenfalls in Schottland im 17. Jhdt. und seit der Mitte des 18. Jhdt.s in den USA und in Kanada. - Nhk.: Der A. hatte Legitimations- und Kontrollfunktion bei der Austeilung des Abendmahls, einer gottesdienstlichen Handlung zur Erinnerung an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern (z. B. Matthäus 26, 26-29). - Weiterer Name: Kommunionsmünze (s. d.). Abformung ist eine weitere Bezeichnung für Abdruck (s. d.). - Nhk.: zu abformen, Verb, die Form von einem Original (z. B. in Gips) abnehmen, eine Form nachbilden. Abguß ist die Bezeichnung für das positive Abformungsprodukt aus Gips, Blei oder Zinn, also eine Nachbildung einer Münzseite, die in der negativen Abdruckform (sie ist von der Originalmünze abgedrückt ) entstanden ist. Abgüsse werden zur Komplettierung von unvollständigen Sammlungen gefertigt, zur Zusammenstellung von Phototafeln o. ä. - Nhk.: Der Ausdruck bezeichnet den Vorgang des Ausgießens, den Abguß des flüssigen, breiigen Gipses, des Zinns oder Bleies in die Abdruckform, die zumeist aus Stanniol- oder Aluminiumfolie gefertigt ist (s. auch Abdruck). - Weiterer Name: s.pasten. Ablaßmünzen, insbes. Ablaßtaler haben keinen Geldcharakter, sondern sind Medaillen (s. d.), die von hohen katholischen geistlichen Würdenträgern (z. B. Papst Benedikt XIII., ) ausgegeben wurden. - Nhk.: Ablaß, Nachlaß zeitlicher Sündenstrafen ; althochd. ablaz (9. Jhdt.); mittelhochd. aflat(e), Nachlaß der Sündenschuld, Vergebung der Sünden. Abou, auch Abu, ein arabisches Wort, ist in Verbindung mit einem weiteren - nachgestellten - Substantiv ein Synonym für ein wertvolles Geldstück wie Peso oder Taler (z. B. Abu Tera, Mariatheresientaler ). - Nhk.: abu, arab., Vater. Der Ausdruck hebt die besondere Bedeutung dieser großen silbernen Geldstücke hervor. Der Vater spielt in der arabischen Familie die wichtigste Rolle, er ist das Haupt der Familie.
10 Abschlag, - 1) Bezeichnung für eine Münze oder eine Medaille (s. d.), die zwar mit dem Originalstempel geprägt, für die aber nicht das Orignalmetall verwendet wurde; so z. B. gibt es Bleiabschläge von Originalstempeln silberner Taler (s. d.). - 2) Die Bezeichnung A. wird des öfteren auch für Probeprägungen verwendet, die aus einem anderen Material geschlagen sind als das spätere Endprodukt (s. Probemünze). - 3) Manchmal finden Abschläge auch als Geschenkmünzen (s. d.), als Donative (s. Donatio) Verwendung. - Nhk.: Die Vorsilbe ab wird hier in Verbindung mit dem Verb schlagen im Sinne einer Nachahmung gebraucht wie z. B. bei abmalen, abschreiben. Der Münzabschlag mit dem ausgewechselten Metall ist die Nachahmung der Prägung mit dem Originalmetall. - Spezielle Namen: französ. Piefort; Neuabschlag; Nowodel, s. d. Absolutionstaler ist die Bezeichnung für eine Geschichtsmünze (s. d.), 1595 unter Heinrich IV., dem Großen und Guten, König von Frankreich ( , ermordet), geprägt, auf der Vs. den Papst Clemens VIII. ( ) zeigend, auf der Rs. das Bild des Königs. - Nhk.: Heinrich IV., als Protestant und Hugenottenführer von Papst Sixtus V. ( ) geächtet, trat 1593 zum katholischen Glauben über und erreichte unter Clemens VIII. seine Freisprechung - die Absolution - vom Kirchenbann (latein. absolutio, Freisprechung ). - Anmerkg.: In der Hochzeitsnacht des Königs, der Bartholomäusnacht (23./ ), der Pariser Bluthochzeit, wurden auf Veranlassung der Königinmutter Katharina von Medici, Heinrichs Schwiegermutter, alle etwa in Paris weilenden Hugenotten niedergemetzelt, anschließend wurden auch in der Provinz mindestens bis Hugenotten umgebracht. Erst durch das Edikt von Nantes ( ) erhielten die Hugenotten volle Religionsfreiheit, durften sich militärisch und politisch straff organisieren und sogar 200 Plätze befestigen. Doch dieses Edikt wurde ca. ein Jhdt. später (1685) unter Ludwig XIV. ( ) widerrufen. Den Hugenotten wurde die Religionsausübung und die Auswanderung bei Todesstrafe verboten. Trotzdem gelang ca Hugenotten die Flucht in protestantische Länder, u. a. nach Preußen. Abtsmünzen wurden seit dem Mittelalter in Abteien, die das Münzrecht besaßen, geschlagen, so z. B. in Fulda, in Hersfeld oder in der Abtei von St. Martin von Tours in Frankreich. - Nhk.: Abt, Vorsteher eines Stifts oder Klosters ; von althochd. abbat (9. Jhdt.); mittelhochd. ab(b)et, abt; engl. abbot; aus latein. abba, abbas, Vater ; von bibelgriech. abbas; aramäisch abba, Vater ; vergl. Abu. Abu arba ist eine arabische Bezeichnung für den in Arabien sehr beliebten Carolus-Dollar (s. d.), herausgegeben unter dem spanischen König Carolus IV. ( ). - Nhk.: arabisch abu arba, Vater der Vier. Für die Bewohner der arabischen Länder hatte die auf den Münzen deutlich sichtbare Zahl IIII des Königstitels eine besondere Bedeutung (s. auch Abou). Abu Kelb ist eine arabische Bezeichnung für den niederländischen Löwentaler (s. d.). - Nhk.: abu kelb, arabisch, Vater des Hundes. Der auf der Münze abgebildete Löwe wurde (irrtümlich?) als Hund definiert. Abu, arabisch, Vater, war in Arabien allgemein der Name für eine wertvollere Silbermünze wie Taler oder Peso (s. d. und Abou). Vergl. auch Perra chica und Perra gorda. Abu Kûs(c)h war in Ägypten eine der vielen Bezeichnungen für den Mariatheresientaler (s. d.), d. i. eine Silbermünze mit einem Feingehalt von 833/1000, die nach der österreichisch-bayerischen Konvention von 1753 eingeführt wurde und insbesondere in der Levante ca. 200 Jahre als Handelsmünze eine hervorragende Rolle spielte. - Nhk.: türkisch kusch, Vogel ; Abu Kûs(c)h, Vater des Vogels ; benannt nach dem Vogel, dem österreichischen doppelköpfigen Adler, auf der Rs. der Münze (s. auch Abou). - Weitere Namen: Abu Noukte; Abu Tera (s. d.). Abu Midfa, vulgär Patâka, Putâka sind ägyptische und nordafrikanische Namen für den Peso (s. d.). - Nhk.: die wörtliche arabische Übersetzung nach v. Schrötter Vater der Kanone ; nach Kroha ist diese Namensgebung eine Mißdeutung des Münzbildes; die Säulen wurden als Kanonen gedeutet (s. auch Abou). - Weitere Namen: Abu Taka; Kulunâta; Patâka Kulunâta (s. d.). Abu Noukte war in arabischen Ländern eine der vielen Bezeichnungen für den Mariatheresientaler (s. d.), eine Silbermünze, die insbesondere in der Levante ca. 200 Jahre die vorherrschende Handelsmünze war. - Nhk.: arabisch abu noukte, Vater der Perlen, benannt nach dem Perlenschmuck, der die Büste der Kaiserin Maria Theresia ( ) ziert, dargestellt auf der Vs. der Münze, nämlich neun Perlen auf der Agraffe und sieben Perlen auf dem Diadem (s. auch Abou und Abu Kûs(c)h). Abu Taka, vulgär Patâka, Putâka sind ägyptische und nordafrikanische Namen für den Peso (s. d.). - Nhk.: die wörtliche Übersetzung: für A T. nach v. Schrötter: Vater des Fensters ; auch diese Namensgebung beruht - wie bei Abu Midfa - auf einer Mißdeutung des Münzbildes (s. auch Abou). Die das spanische Wappen flankierenden Herkulessäulen wurden als Fenster angesehen. - Weitere Namen: Abu Midfa ; Kulûnâta, auch Patâka Kulunâta (s. d.). Abu Tera war in arabischen Ländern eine der vielen Bezeichnungen für den Mariatheresientaler (s. d.), eine Silbermünze, die nach der österreichisch-bayerischen Konvention von 1753 eingeführt wurde und insbesondere in der Levante ca. 200 Jahre als vorherrschende Handelsmünze in Umlauf war. - Nhk.: abu tera, arabisch, Vater der Theresia ; Tera ist die Abkürzung für Maria Theresia. Abu (eigtl. Vater ) steht hier für Taler (s. auch Abou und Abu Kûs(c)h). Achtbrüdertaler ist die Bezeichnung für Talervarianten des Herzogtums Sachsen-Weimar aus der Zeit von 1606 bis 1619 mit den Brust- oder Hüftbildern der noch unmündigen Söhne des Herzogs Johann ( ). Die Kinder standen bis 1615 unter der Vormundschaft der Kurfürsten von Sachsen. Sie wurden in den ersten sechs Jahren von Christian II. ( ) betreut, danach von Johann Georg I. ( ). - Es gibt auch Halbund Vierteltaler. - Nhk.: Die A. zeigen entweder alle acht Brüder des Herzogs Johann Ernst vereint auf der Vs. der Münze oder vier Brüder auf der Vs. 9
11 10 und vier Brüder auf der Rs. - Weiterer Name: als Sammelbegriff Familientaler (s. d.). Achtehalber war in Ostdeutschland, insbs. in Ostund Westpreußen von 1722 bis 1873 die volkstümliche Bezeichnung für die brandenburgischen Zwölfteltaler (s. d.), d. s. Doppelgroschen, die ab 1720 über Berlin nach Preußen gelangten. - Nhk.: Die Silbermünzen wurden nach einem Edikt von 1722 im Wert auf 7 1 /2 preußische Groschen gesetzt, der achte Groschen galt also nur noch halb (nach v. Schrötter, 1930; ebenso bereits bei Schmieder, Halke, 1911, nimmt eine Umrechnung von 2 1 /2 Silbergroschen, d. s. 30 Pfennige, in Schillinge zu je 4 Pfennigen vor und kommt so auf 7 1 /2 Schillinge). Achteltaler ist eine andere Bezeichnung für den halben Reichsort (s. d.). - Nhk.: Der A. entsprach dem Achtel eines Talers zu 24 Groschen (s. d.), er war also drei Groschen wert. - Nhw.: Im 16. und 17. Jhdt. enthielt das Reichsadlerbild des halben Reichsortes eine 8 oder auf der Rs. die Aufschrift I halb. Reichsort oder VIII einen Reichstaler. Achtentwintig, - 1) im 16. Jahrhundert eine niederländische Recheneinheit im Wert des Goldguldens zu 28 Stuiver. - 2) Im 17. Jhdt. (ab 1601) eine niederländische Mehrfachmünze des Stuivers (s. d.) mit ständig sinkendem Feingehalt, die 1693 wegen allzu großer Unterwertigkeit aus dem Verkehr gezogen wurde - Nhk.: niederländ. achtentwintig, achtundzwanzig. Die Münze war 28 Stuiver wert. - Nhw.: Die Vs. zeigt häufig den Reichsadler mit 28 als Wertangabe, die Rs. den Provinzialschild mit Wertangabe. - Weitere Namen: silberner Goldgulden; florijn of achtentwintig ( Gulden zu 28 Stuiver ), Achtundzwanzigguldenstück; Klapmuts (s. d.). Achter, - 1) in Braunschweig, Hannover, Westfalen u. a. bis in das 19. Jhdt. hinein eine weitere Bezeichnung für den Mariengroschen (s. d.). - Nhk.: Der Mariengroschen enthielt nicht 12 Pfennige, wie andere Groschen, sondern nur acht Pfennige. - 2) Eine volkstümliche Bezeichnung für die sächsischen Achtpfennigstücke, seit Beginn des 19. Jhdt.s herausgegeben. - 3) Ein Ausdruck für die süddeutschen Halbbatzen (s. Batzen) und für die 2-Kreuzer-Stücke (s. Kreuzer).- Nhk.: Die Stücke hatten ebenfalls einen Wert von acht Pfennigen. - 4) Bezeichnung für den späten Körtling (s. d.) aus dem ausgehenden 18. Jhdt. - Nhk.: Der Wert des Körtlings, evtl. schon im 14. Jhdt herausgegeben, war seit 1480 von 6 Pfennigen auf 7, dann auf 7 1 /2 und Ende des18. Jhdt.s auf 8 Pfennige gestiegen. - Weitere Namen: Achtpfenniger; Achtling. - Nhk.: Auch diese Namen geben - ebenso wie Achter - den Wert der Münze an, nämlich acht Pfennige. Achterstück ist eine deutsche Bezeichnung für den spanischen Peso de á ocho (s. d.), von 1497 bis 1830 geschlagen. - Nhk.: A. ist die freie deutsche Übersetzung von Peso de á ocho, span., Gewicht von acht (Reales); die Münze hatte also einen Wert von acht Realstücken; s.auch Achtreales. Achtienmanneke war seit dem letzten Drittel des 16. Jhdt.s und im 17. Jhdt. in Brabant der volkstümliche Name für das doppelte kupferne Negenmanneke-Stück (s. d.), in der ersten Hälfte des 18. Jhdt.s der Name für das 12-Mijten-Stück (s. Mijt). - Nhk.: niederländ. achtien manneke, achtzehn Männlein. Das Stück zählte ursprünglich 18 Mijten (s. d.), scherzhaft als Männlein bezeichnet. - Weitere Namen: Oorden; Liard (s. d.). Achtheller ist die Bezeichnung für geringwertige Silbermünzen zu 1 /2 Stüber (s. d.), die um die Mitte des 18. Jhdt.s am Niederrhein geprägt wurden, zuletzt nur noch als kupferne Scheidemünzen (s. d.). - Nhk.: benannt nach dem Wert von acht Hellern (s. d.), das waren vier Pfennige (s. d.). - Weiterer Name: Fettmännchen (s. d.). Achtling ist eine weitere Bezeichnung für den Achter, insbes. für den Körtling (s. d.). - Nhk.: s. Achter. Achtpfenniger ist eine weitere Bezeichnung für 8- Pfennig-Stücke.- Nhk.: s. Achter. Achtreales ist eine weitere Bezeichnung für den silbernen spanischen Peso (s. d.), von 1497 bis 1830 geschlagen. - Nhk.: Die Münze hatte den Wert von acht Reales (s. d., s. auch Achterstück). Achtundzwanzigguldenstück ist ein weiterer Name für die niederländische Klapmuts (s. d.), auch Achtentwintig (s. d.) genannt. - Nhk.: Der Name ist irreführend. Er bezeichnet nicht 28 Gulden (s. d.), sondern 28 Stuiver (s. d.) und war ursprünglich einen Goldgulden (s. d.) wert. Achtzehner war im Mittelalter und noch darüber hinaus eine Bezeichnung für den vierten Teil eines Ortstalers (s. d.), also für den 16. Teil eines Talers zu 24 Groschen. - Nhk.: Die viertel Orte wurden Achtzehner genannt,, weil sie den Wert von achtzehn Pfennigen hatten. Die 24 Groschen eines Talers zu je 12 Pfennigen waren 288 Pfennige wert, ein Ort ( ein viertel Taler ) hatte somit 72 Pfennige, ein viertel Ort 18 Pfennige. Achtzerlein hießen im 16. Jhdt. die Spitzgroschen (s. d.) aus Mansfeld, nachdem ihr Wert von ursprünglich 9 über 15 auf 18 Silberpfennige gesetzt worden war. - Nhk.: verkürzt aus achtzehn Pfennig(lein); vergl. auch Fünfzerlein. Achtzehngröscher war die Hauptbezeichnung für eine um die Mitte des 17. Jhdt.s in Polen und Ostpreußen weit verbreitete Silbermünze. - Nhk.: Durch Verminderung des Silbergehaltes infolge des Krieges gegen Schweden ( ) wurde der polnische Vierteltaler (Ort, s. d.) 1654 im Münzfuß von 22 1 /2 Groschen auf 18 Groschen gesenkt und erhielt damit den Namen A. - Weitere Namen: Tympf, Tynf, Timpf, auch Dimpf (s. d.); Fünfteltaler, auch weiterhin Ort (Vierteltaler), obwohl es sich bei dem A. nach der Wertminderung nur noch um einen fünftel Taler handelte. (Der Taler hatte 90 Groschen). S. auch Ephraimiten und Königsberger. Achtzehnpfenniger waren im 17. Jhdt. im norddeutschen Raum, insbes. in Schleswig-Holstein, Bremen und Lübeck Silbermünzen zu 1/16 Taler (s. d.). - Nhk.: Die Stücke galten achtzehn Pfennige. - Weitere Namen: Viertelsort; nach der Kipperzeit ( ) auch Düttchen (s. d.). Ackey ist die einheimische Bezeichnung für eine Silbermünze, die 1796 und 1818 unter Georg III. ( ) von der britischen African Company of Merchants für das Gebiet der Goldküste, am Golf von Guinea in Westafrika, heute Ghana, geprägt worden ist (1 A. = 8 Tackoe, s. d.). - Nhk.: - 1) benannt nach einer Goldgewichtseinheit der
12 Aschanti (Kroha; s. auch Anmerkg. zu Tackoe). - 2) Nach v. Schrötter war Ackey bei den Eingeborenen der Name Guineas.- Weiterer Name: Crown (s. d.). Adelheid(s)-Denar ist ein weiterer Name für den mittelalterlichen Otto-Adelheid(s)-Pfennig (s. d.). - Nhk.: benannt nach der Kaiserin Adelheid (geb. 931, gest. 999). - Anmerkg.: Adelheid, Tochter von Rudolf von Burgund, heiratete mit 16 Jahren König Lothar von Italien, vermählte sich nach dessen Tod 951 mit Otto I. ( ; ab 962 Kaiser), der ihr gegen Lothars Nachfolger Berengar zur Hilfe kam. 962 wurden Otto und Adelheid in Rom zu Kaiser und Kaiserin gekrönt. Nach dem Tod ihres zweiten Gatten und ihres Sohnes hatte sie zusammen mit ihrer Schwiegertochter Theophano, der Gattin Ottos II., die Regentschaft des Reiches für ihren Enkel, Kaiser Otto III. ( ), übernommen, der im Alter von drei Jahren die Königswürde erhielt. Von 991 bis 994 war die Kaiserin alleinige Beraterin. 995 zog sie sich nach Kloster Selz zurück, wo sie 999 starb wurde Adelheid heiliggesprochen. Adlerdollar, Adlerpiaster sind weitere Bezeichnungen für das mexikanische 8-Reales-Stück, den späteren Peso (s. d.), mit diesem Vs.-Bild jedoch erst ab 1823 geprägt (s. Anmerkg.). - Nhk.: Die Vs. der Münze zeigt einen auf einem Kaktus sitzenden Adler (s. auch Anmerkg. zu Adlerpfennige). - Anmerkg.: Mexiko hatte sich 1822 die Unabhängigkeit von Spanien erkämpft und wurde 1824 Republik. Adlergroschen ist die deutsche Bezeichnung für den Aquilino (s. d.), eine kleine silberne Groschenmünze (s. Groschen) aus Tirol und Oberitalien, erstmals 1258 unter Meinhard II. von Görz-Tirol ( ) in Meran zu 18 Berner (s. d.) geschaffen und in den umliegenden Münzstätten vielfach nachgeahmt. - Nhk.: Die Münze zeigt auf der Vs. einen Adler mit nach rechts gerichtetem Kopf (s. auch Anmerkg. zu Adlerpfennige). Adlerpfennige heißen alle Pfennige (s. d.) mit der Darstellung eines Adlers (Nhk.), so z. B. der brandenburgische Hohlpfennig (s. d.) des 14. und des 15. Jhdt.s. - Anmerkg.: Der Adler, der König der Lüfte, gilt als Symbol für Macht und Stärke. Nach alter weit verbreiteter Ansicht ist er der stärkste aller Vögel, er fliegt am höchsten, und die Strahlen der Sonne können ihn nicht blenden. So sahen verschiedene Völker, u. a. die Assyrer, die Babylonier, die Perser, den Adler auch als Sinnbild geistiger Höhe, als Träger göttlicher Majestät und des Sieges. Als Symbol der Allmacht war er Begleiter der höchsten Gottheiten, so auch Jupiters. Er war den römischen Kaisern das Zeichen der Macht, und als Heeresund Feldzeichen genoß er höchste Verehrung. Adlerschilling ist eine deutsche Bezeichnung für den niederländischen Arendschelling.- Nhk.: s. d.; s. auch Anmerkg. zu Adlerpfennige. Administrationsmünzen wurden unter einem Verwalter der Münzhoheit vorübergehend geprägt, so z. B. der Administrationsgulden des Großherzogs von Baden, Karl Friedrich (geb. 1728, selbständig regiert von 1756 bis 1811), vor 1756 unter der Vormundschaft seines Onkels geschlagen. Nhk.: Administration, Verwaltung, Anweisung zur Durchführung (16. Jhdt.); zu latein. administratio, Verwaltung, Hilfeleistung, Regierung. Adolfsd or, auch Adolphsd or sind Bezeichnungen für eine goldene Fünf-Taler-Münze, eine Pistole (s. d.), 1759 in Stralsund herausgegeben. - Nhk.: benannt nach dem Schwedenkönig Adolf Friedrich ( ), der die Münze für den Umlauf in Schwedisch-Pommern prägen ließ (s. auch d or). Adolphin ist ein weiterer Name für ein schwedisches silbernes 2-Mark-Stück (s. Mark), unter König Adolf Friedrich ( ) geprägt. - Nhk.: benannt nach dem vorderen Namensteil des Königs, in Anlehnung an die Münzbezeichnungen der beiden Vorgänger im Amt entstanden (vergl. Frederik und Ulrique). - Weiterer Name: Carolin (s. d.). AE 1, AE 2 usw. sind Bezeichnungen für spätrömische Bronzeprägungen, deren Namen nicht gesichert sind, in der Literatur für Münzen aus der Zeit von ca. 308 n. Chr. bis zum Ende des Weströmischen Reiches (476 n. Chr.) auftretend. - Nhk.: AE steht für latein. aes (s. d.), Erz, Kupfer, Bronze ; die Zahlen geben den ungefähren Durchmesser der Münzen an: AE 1 = über 22 mm, AE 2 = mm, AE 3 = mm, AE 4 = unter 11 mm. Aes, numismatische Abkürzung Æ, hatte im alten Rom und in Italien die Bedeutung des Wertmessers schlechthin und ist dort als älteste Währungsgrundlage zu werten. Der Ausdruck Aes wurde zunächst auf die Vorformen des Geldes aus Kupfer übertragen und später dann auch auf das Geld im allgemeinen. - Nhk.: latein. aes, Erz, Kupfer, Bronze ; dann auch ebenes Gefäß, Geld, Münze. - Nabltg.: latein. aes rude; aes signatum; aes grave (s. d.); aes orichalcum, das mit Zink legierte Kupfer ; aes cyprum, das Erz aus Zypern, daraus cuprum, deutsch Kupfer ; aes alienum, Schulden ; aes militare, Löhnung, Sold (da die Soldzahlung jährlich erfolgte, später auch Dienstjahr, Stipendium ); aes circumforaneum, das auf dem Markt (Forum) von Wechslern geborgte Geld ; aes hordearium, Futtergeld für die Pferde ;aes uxorim, Junggesellensteuer ; aes thermarum, kupferne Glocke in Bädern, deren Läuten das heiße Wasser ankündigte; aerarium, Staatsschatzhaus zu Rom, Schatzkammer, Staatskasse (in der Republikzeit im Tempel des Saturn beheimatet); dazu aestimare, abschätzen. - Wortabltg.: evtl. in Zusammenhang mit dem deutschen Wort Erz stehend; mittelhochd. erze, arze, althochd. erizzi, arizzi, aruz(zi), altniederd. arut, vergl. russ. ruda, ähnl. latein. aes rude, rohes Erz, vermutl. sumer. Lehnwort: sumer. urudu, Kupfer (Mackensen, Wasserzieher). Aes grave ist eine Sammelbezeichnung für die ältesten gegossenen italischen Bronzemünzen des vollen und des mehrfach reduzierten Gewichts, die als Nachfolgemünzen des Aes rudeund des Aes signatum-geldes (s. d.) ab etwa 269 v. Chr. ca. 70 oder 80 Jahre herausgegeben wurden. Ursprüngliche Gewichtseinheit war der librale (pfündige) As (s. d.) zu g, bald zu 273 g, der dann auf die Hälfte (Semilibralfuß) und stufenweise noch weiter reduziert wurde. Mit dem Sextantalfuß nahm die Aes grave-periode mit ihren gegossenen Münzreihen ihr Ende, die Zeit der geprägten Münzen begann (vergl. auch griech. Chalcus). - Nhk.: latein. aes grave, schweres Erz, Schwerkupfer. - Weiterer Name: Schwergeld (s. d.). aes infectum ist ein von den Römern gebrauchter Adlergroschen Tirol 11
13 12 Ausdruck für aes rude (s..d), ein vormünzliches Zahlungsmittel (s. d.). - Nhk.: aes infectum, latein., unverarbeitetes Erz. Aes rude ist ein in Ober- und Mittelitalien sicher nachgewiesenes römisches vormünzliches Zahlungsmittel (s. d.) in Form roher Kupferstücke, das lediglich nach Gewicht bemessen wurde (2 g bis 2,5 kg), manchmal mit eingeschlagenen oder eingeschnittenen Marken versehen. Die Stücke waren vom Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. bis ins dritte Jhdt. v. Chr. hinein in Gebrauch. - Nhk.: latein. aes rude, rohes, unbearbeitetes Erz; Roherz, Rohkupfer. - Weiterer Name: aes infectum, s. d. Aes signatum ist eine Bezeichnung für italische und römische gegossene Münzbarren (im Gewicht von ca g bis 1850 g) und ihrer viel häufigeren Teilstücke aus dem 4. bis 3. Jhdt. v. Chr., zunächst mit einfachen Bilddarstellungen wie Ölzweig, Ähre, Schild, Schwert, Anker, Dreifuß versehen, dann vornehmlich mit Tiersymbolen wie Stier, Elefant, Sau. Das Aes signatum-geld wird als Übergangsform von der Aes rude-periode zur Aes grave-periode (s. d.) angesehen. - Nhk.: latein. aes signatum, signierte Bronze. Affonso de ouro, portugies., Alfonso aus Gold, ist ein weiterer Name für den Cruzado (s. d.). - Nhk.: benannt nach dem Münzherrn dieser Münze, Alfonso (Affonso) V. Africanus, König von Portugal ( ); s. auch d ouro. Afghani, Abk. Afgh., ist seit 1926 Währungsmünze in Afghanistan (1 A. = 100 Puls). - Nhk.: abgeleitet vom Landesnamen Afghanistan. Agio, - 1) eine weitere Bezeichnung für den Aufschlag, um den der Kurs einer Währung oder eines Wertpapiers über dem Nennwert steht. Das Gegenteil heißt Disagio (s. d.). - 2) Bei Auktionen bedeutet A. die zusätzliche Summe (d. s. zumeist 15 %), die über den Zuschlagspreis hinaus zu entrichten ist. - Nhk.: italien. agio, Bequemlichkeit, Spielraum, Aufgeld, Provision ; zu italien. aggiungere, hinzufügen. - Weitere Namen: Aufgeld; Handgeld (s. d.). Agleier sind insbesondere die Nachprägungen der Friesacher Pfennige (s. d.), die die Patriarchen in Aquileia schlagen ließen, dann aber auch die Nachprägungen der Münzstätten anderer Gebiete, so die aus Kärnten, aus Krain, aus Oberitalien oder aus Slowenien. - Nhk.: abgeleitet von Aquileia, dem Prägeort, im Norden des Adriatischen Meeres in der Landschaft Friaul gelegen. - Weitere Namen: Aglaier, Aglyer, Agleyr, Agloier, Agleyger, Agellaerer, latein. denarii Aquilejensis monetae; in späterer Zeit Friauler oder Vrawler Münz (v. Schrötter). Agnel, auch Aignel sind Bezeichnungen für französische Varianten von Goldmünzen aus dem 14. und 15. Jhdt. mit Darstellungen des Gotteslammes, 1311 bis 1313 unter König Philipp IV. ( ) eingeführt, dann u. a. unter Johann dem Guten ( ) nach 1354 geschlagen, zuletzt unter Karl VII. ( ). - Nhk.: bezeichnet nach dem Gotteslamm; abgeleitet von latein. agnus dei, Lamm Gottes, dem Anfang der Bildumschrift AGNUS DEI QUI TOLLIS PECTA MUNDI MISERE NOBIS, Lamm Gottes, das du trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser, beruhend auf dem Ausspruch Johannes des Täufers in Joh. 1, 29: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt! - Weitere Namen: französ. Mouton d`or; niederländ. Gouden Lam, Lam (s. d.); Halbstücke hießen Agnelet oder Agnelot, s. d. Agnelet, Agnelot sind Bezeichnungen für Halbstücke französischer Goldmünzen (aus dem 14. und 15. Jhdt.) mit Gotteslamm-Darstellungen. - Nhk.: französ. agnelet, Lämmchen ; von agneau, Lamm. s. auch Agnel; Aignel; Mouton d`or. Agorah, pl. Agorot, ist seit dem die kleinste israelische Münzeinheit; 100 Agorot = 1 Lirah (s. d.), seit : 100 Neue Agorot = 1 Schekel (s. d.); seit : 100 Agorot = 1 Neuer Schekel. - Nhk.: hebräisch agorah, zu hebräisch agor, versammeln, ansammeln (Morris); vergl. griech. agora, Marktplatz, ein Platz zum Versammeln, zum Handeltreiben. Weitere Namen: s. auch Judäische und Phönizische Münzen. Agrippiner ist eine weitere Bezeichnung für die Kölner Denare (s. d.) und ihrer Nachahmungen aus Friesland, Westfalen, Niedersachsen und den angrenzenden östlichen Ländern, vom ausgehenden 10. bis zum beginnenden 12. Jhdt. geprägt. - Nhk.: benannt nach einem der früheren Namen der Stadt Köln, Colonia (Claudia Ara) Agrippinensis. - Anmerkg.: Die Stadt war um 50 n. Chr. aus einem römischen Lager in eine befestigte Stadt umgewandelt worden und erhielt diesen Namen nach der späteren Kaiserin Agrippina Junior, die 16 n. Chr. in dem Lager geboren worden war. Agrippina Junior (+ 59 n. Chr.) war die Mutter Neros und wurde die vierte Frau des Kaisers Claudius I. (51-54 n. Chr.). Agostaro ist eine weitere Bezeichnung für den Augustalis (s. d.). - Nhk.: abgeleitet von Augustus, dem Ehrentitel der römischen Kaiser; italien. Augusto. Ahmadi Riyal ist der Name eines Riyal (s. d.) aus dem Jemen, unter Imam Ahmad (Achmed, König von ) in Silber und in Gold geprägt. - Nhk.: benannt nach dem Münzherrn. Aignel ist eine abgewandelte Form von Agnel, d. i. eine französische Goldmünze des 14. und 15. Jhdt.s. - Nhk.: s. Agnel. Akce, Aqce (ausgespr. atschke) sind Bezeichnungen für die erste osmanische Silbermünze, ursprünglich im Gewicht von 2,9 g, beiderseits lediglich beschriftet, wahrscheinlich unter dem Sultan Urchan II. ( ), eventuell schon unter seinem Vater Osman I. ( ) eingeführt. Die Münze blieb - bei ständig sinkendem Feingewicht - bis ins 17. Jhdt. hinein die einzige Silbermünze der Türkei. Sie wurde als Scheidemünze noch bis 1835/36 unter Mahmud II. ( ) geprägt. - Nhk.: türk. aqca, weißlich ; zu griech. aspron, weiß ; abgeleitet von Asper (s. d.), dem Namen der kommenischen Vorläufermünze, nach deren Vorbild diese Münze auch entstanden ist. - Weitere Namen: Akce - i - Otmani, verkürzt Otmani (s. d.). Aksa war von 1936 bis 1944 die - niemals ausgeprägte - Währungseinheit in Tannu Tuwa, d. i. ein von Hochgebirgen eingeschlossenes Gebiet zwischen der Mongolischen Volksrepublik und Rußland gelegen (1 Aksa = 100 Kopeken, s. d.). - Nhk.: nicht bekannt; evtl. zu Akce, s. d. Albansgulden ist eine kürzere Bezeichnung für den St. Albansgulden aus Mainz. - Nhk.: s. St. Albansgulden.
14 Albertin ist die Bezeichnung für eine Goldmünze der spanischen Niederlande zu 2 1 /2 Gulden (s. d.), von 1600 bis 1610 unter den Statthaltern Erzherzog Albert von Österreich und dessen Gemahlin Isabella von Spanien ( ) geprägt. - Nhk.: benannt nach dem Prägeherrn, Erzherzog Albert. - Nhw.: Die Vs. der Münze trägt die Umschrift ALBERTUS. ET ISABEL. D:G. - Weitere Namen: niederländ. Albertyn; in deutschen Gebieten Albertus. Albertiner, auch Albertstaler sind weitere Namen für den Albertustaler, eine bedeutende Handelsmünze aus dem 17. und dem 18. Jhdt.- Nhk.: s. d. Albertusdaalder ist eine niederländische Bezeichnung für den Albertustaler.- Nhk.: s. d. Albertustaler ist die Bezeichnung für eine silberne Talermünze (s. Taler) der spanischen Niederlande, erstmals 1612 mit dem spanischen Wappen auf der Vs. und dem Andreaskreuz auf der Rs. herausgegeben, in den Niederlanden bis 1812 geschlagen, wurde im 17. Jhdt. Haupthandelsmünze im Ostseeraum und ist wegen ihrer allgemeinen Geltung in anderen Staaten nach demselben Fuß nachgeprägt worden, u. a. in Brandenburg-Preußen (1767/68 und 1797), in Holstein (1753), in Kurland (1780). - Nhk.: benannt nach Albert VII. (auch Albrecht VII.), dritter Sohn des Kaisers Maximilian II., Albrecht der Fromme, Albertus Pius, Erzherzog von Österreich (1585), Vizekönig von Portugal, vorher Geistlicher und Kardinal. Er gab als Statthalter der Niederlande ( ) zusammen mit seiner Gemahlin Isabella, der Tochter Philipps II. (König von Spanien), den A. heraus. - Weitere Namen: niederländ. Albertusdaalder, zilveren dukaat; Kruisdaalder; Patagon; deutsch Albertt(h)aler, Albertiner, Kreuzt(h)aler, Silberdukat; auch Burgundertaler (bei Meyer und Halke), Burgundischer Taler; Brabanter Taler, Brabanter; Kronentaler; in Rußland Kryzovye oder auch Jefimok (s. d.). - Abltg.: Albertusgroschen (in Livland und Kurland gingen 90 Albertusgroschen auf einen A.). Albus, Akk. alb, war vom 14. bis 16. Jhdt. der Name für eine hochwertige silberne Groschenmünze, vor allem in den Gebieten der rheinischen Kurfürsten von Köln, Mainz, Trier und der Pfalz in vielen Abwandlungen geprägt unter dem Erzbischof von Trier, Kuno von Falkenstein ( ), herausgebracht, wurde der wysse penning (North) ab 1385 für fast 200 Jahre zur wichtigsten rheinischen Währungsmünze, verlor dann im Wert und sank herab zur Scheidemünze (s. d.). Kurtrier gab bis 1793 Silberscheidemünzen mit der Wertbezeichnung Albus heraus (North). - Nhk.: von latein. denarius albus ; mittelhochd. wizer phenninc (Lexus), neuhochd. weißer Pfennig (albus, latein., weiß, hell, licht ). Die Farbe des hochlötigen Silbers gab der Münze den Namen, der seit dem Ende des 15. Jhdt.s amtliche Bezeichnung war (v. Schrötter). - Weitere Namen: Weißpfennig; latein. numus albus, weißer Pfennig ( weißes Geld ); grossus albus, latein., großer weißer (Pfennig); Albpfenning; vergl. Witten; Hvid; aber auch Weißgroschen, Blanc; Blanca; Bianco s. d. - Spezielle Namen: Raderalbus oder Rader, auch Raderschilling, ein besonderer Typ des A. im Rheinischen Münzverein; Petermännchen, eine Albus- Scheidemünze aus Trier; albus novus, latein., neuer Albus ; Reichsalbus; Hessenalbus, auch Elisabether genannt; Blaffert, das war ein Vier-Albus-Stück der Stadt Köln und Jülich; Halbbatzen (s. d.). albus novus ist ein im Oberrheinischen Kreis von 1609 bis 1612 geprägter Albus (s. d.) zu acht schweren Pfennigen (s. d.). - Nhk.: latein. albus novus, neuer Albus. Die Münze wurde nach der Pfennigreform von 1609 neu herausgebracht, deshalb neuer Albus (s. auch Albus). Alchimistentaler, - 1) Bezeichnung für Gepräge, die mit Hilfe des Steines der Weisen aus künstlich hergestelltem Silber gemünzt sein sollen, z. B. ein Taler (s. d.) von Hessen-Darmstadt aus dem Jahre ) Bezeichnung von Münzen mit geheimnisvollen Darstellungen, die auf alchimistische Gepräge hindeuten. Hierzu zählt ein dänischer Halbdukat (s. Dukat) von 1647 mit dem Bildnis einer Brille und der lateinischen Umschrift VIDE MIRA DOMINI, Siehe die Wunder des Herrn. - Nhk.: Alchimist, auch Alchemist, jemand, der sich mit Alchimie beschäftigt ; von Alchimie, mittelalterliche Chemie, insbesondere Goldmacherkunst, schwarze Kunst ; mittelhochd. alchimîe; frühniederd. Alchamie, Alchimey, Alchimy; entlehnt aus span. alquimia; von arab. al-kimiya, Stein der Weisen ; wohl zurückzuführen auf griech. chemeia, Kunst der Metallverwendung (Chemie). Alexandermedaillone sind ansehnliche Goldmedaillen aus der Zeit um ca. 250 v. Chr., die als Siegespreise bei großen Wettkämpfen verliehen wurden. - Nhk.: Die einseitiggeprägten Medaillone (s. d.) zeigen eine Alexanderdarstellung von vorn mit Schild und Lanze. - Weiterer Name: Niketerion (s. d.). Alexandreios ist ein antiker Name für einen griechischen Gold-Stater (s. Stater) aus Makedonien aus dem 4. Jhdt. v. Chr. Die Vs. zeigt den Athenakopf mit korinthischem Helm, die Rs. Nike, nach links schreitend. - Nhk.: griech. Alexandreios (zu erg. statér), Alexanderstater ; benannt nach Alexander dem Großen ( v. Chr.), dem Prägeherrn; s. auch Nhk. Lek. - Weiterer Name: als Sammelbegriff Chrysus (s. d.). Alexandriner ist eine numismatische Bezeichnung für das Provinzialgeld aus der Zeit der Römerherrschaft in Ägypten, geprägt von Augustus (27 v. Chr n. Chr.) bis etwa 296/97 n. Chr. unter Diocletian ( n. Chr.). Zunächst wurde für das Ausmünzen der Tetradrachmen (s. d.) Billon verwendet, zuletzt nur noch Bronze. Aus Bronze waren auch die Drachmen (s. d.) und ihre Unterwerte. Die aufgeprägten Zeichen L (für Jahr) und dahinter ein griechischer Buchstabe (für Regierungsjahrzahl) erleichtern die Einordnung der A. - A. hatten nur in Ägypten Gültigkeit. - Nhk.: abgeleitet von der Hafenstadt Alexandria, in der die einzige Prägestätte Ägyptens war. - Weitere Namen: s. auch Provinzialmünzen und Kolonial- Münzen. - Anmerkg.: Alexandria, unter Alexander dem Großen ( v. Chr.) in den Jahren 332/331 v. Chr. gegründet und nach ihm benannt, arab. El Iskandariya, im 2. Jhdt. n. Chr. Zentrum der Christenheit, ist die wichtigste Handels- und Hafenstadt Ägyptens. Alexiusdor, auch Alexiusd or, Alexius d or sind Bezeichnungen für eine Pistole (s. d.), d. i.eine (verkleinert) Albertustaler 1767 Brandenburg - Preußen (verkleinert) Albertustaler 1797 (verkleinert) 6 Albus 1694 Hanau- Lichtenberg 13
15 14 Goldmünze zu fünf Talern (s. Taler), dem französischen Louis d or (s. d.) nachempfunden, im Herzogtum Anhalt-Bernburg herausgegeben. - Nhk.: benannt nach dem Prägeherrn, Herzog Alexius Friedrich Christian ( ). Alfenid-Münzen sind Gepräge aus einer Neusilberlegierung. Alfenid (auch China-Silber ) ist eine galvanisch versilberte Legierung, bestehend aus 60 % Kupfer, 30 % Zink, 10 % Nickel. - Nhk.: benannt nach dem französischen Chemiker Halfen (19. Jhdt.), dem Erfinder der Legierung (nach Duden, 1993). - Weiterer Name: Neusilbermünzen (s. d.). Alfonsino, - 1) Bezeichnung für einen portugiesischen Dinheiro (s. d.), unter König Alfons IV. ( ) geprägt. - 2) Bezeichnung für einen Gigliato (s. d.), Unter Alfons I. von Aragon, König von Neapel ( ), herausgegeben. - Nhk.: benannt nach den Prägeherren. Alfonsino d oro ist eine weitere Bezeichnung für den Ducatone di oro (s. d.) aus Neapel, unter Alfons I. von Aragon ( ) geprägt. - Nhk.: italien. Alfonsino d oro, goldener Alfonso ; benannt nach dem Prägeherrn. Alfonso d oro ist ein Name für eine spanische Goldmünze, Ende des 19. Jhdt.s geprägt. - Nhk.: benannt nach dem spanischen König Alfons XII. ( ); d oro, span., aus Gold. - Weiterer Name: Centin (s. d.). Alfonso d ouro ist eine weitere Bezeichnung für den portugiesischen goldenen Cruzado (s. d.), im 15. Jhdt. geprägt. - Nhk.: benannt nach dem Prägeherrn der Münze, dem portugiesischen König Alfons V. Africanus ( ); portugies. Alfonso d ouro, goldener Alfonso (vergl. d or). Allianzmünzen sind Bundesmünzen (s. d.), d. s. Gepräge verbündeter Städte im antiken Griechenland. - Nhk.: Allianz, Bündnis, Verbindung, Staatenbund ; aus gleichbedeutend mittelfranzös. alliance; altfranzös. aliance; von altfranzös. alier, französ. allier, vereinigen, verbünden. Almorabitino ist ein weiterer Name für den Marabotino, eine Goldmünze des 12. und des 13. Jhdt.s in Spanien und Portugal. - Nhk.: s. Marabotino. Almosengeld ist ein Sammelbegriff für speziell geprägte Münzen, die als Almosen (Nhk.) von Herrschern, kirchlichen Einrichtungen oder Städten an Bedürftige und Arme verteilt wurden. Bereits unter dem Karolinger-Herrscher Pipin dem Kurzen ( ) gab es Almosen-Denare. - Am bekanntesten ist das englische Maundy Money (s. d.). - Nhk.: Almosen, milde Gabe, gönnerhaft gegebenes Geschenk ; althochd. alamuosan (8. Jhdt.), alamuosa (10. Jhdt.); mittelhochd. almuosen und almuose; kirchenlatein. elêmosina; griech. eleêmosýnê, Mitleid, Erbarmen. Aloetaler sind Medaillen (s. d.) aus dem Jahre 1701, unter den Herzögen Rudolf August ( ) und seinem Mitregenten Anton Ulrich ( ) von Braunschweig-Wolfenbüttel geprägt. - Nhk.: Eine Seite des Gepräges zeigt eine blühende Aloe. Die Aloe-Staude war gerade aus Amerika eingeführt und im Garten des Schlosses Salzdahlum (zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel) zum Blühen gebracht worden. Altilik ist eine türkische Billonmünze, 1833 unter Sultan Mahmud II. ( ) eingeführt. - Nhk.: zu türk. alti, sechs, vergl. tartar. alty, sechs. Das Stück war 6 Piaster (s. d.) wert. Altin ist ein weiterer Name für Altun (s. d.), d. i. eine türkische Goldmünze vom 15. bis 19. Jhdt. Nhk.: türk. altin, Gold ; benannt nach dem Edelmetall der Münze. Altmyslyk hieß im 17. und 18. Jhdt. eine türkische Silbermünze zu 60 Para (s. d.). - Nhk.: türk. altmís, sechzig. Der Name gibt den Wert der Münze an. Altun ist der Name für die erste türkische Goldmünze, 1454 unter Sultan Mehmed II., dem Eroberer ( ), eingeführt und danach bis 1844 geprägt. - Nhk.: alttürk. altun, Gold ; türk. altin, Gold. - Anmerkg.: Mehmed II. eroberte 1453 Konstantinopel und setzte damit dem Byzantinischen Reich ein Ende. - Weitere Namen: Sequino; Altin; Sultani (s. d.). Altýn, Altýnnik, - 1) im zentralen und im östlichen Rußland seit dem letzten Viertel des 14. Jhdt.s eine Rechnungseinheit im Werte von 6 Denga (s. d.), später im Werte von 3 Kopeken (s. d.). - 2) Erstmals ausgeprägt von 1654 bis 1663 unter dem Zaren Alexis ( ), und zwar als Kupfermünze (ein Versuch, Kupfer neben Silber und Gold als Währungsmetall einzuführen). - 3) Unter Alexis und seinen Söhnen Feodor ( ) und Iwan V. ( ) und dann noch einmal unter Iwan V. zusammen mit Peter I. ( ) als Silbermünze herausgegeben. - 4) Nach Beginn der Münzreformen unter Peter dem Großen ( ) wurde der A. noch mehrere Male mit Unterbrechungen von 1698 bis 1725 als Silbermünze zu 3 Kopeken gemünzt, zuletzt mit Doppeladler und der Aufschrift altyn, altyn oder altýnnik versehen. - 5) Noch in moderner Zeit wurden die 3-Kopeken-Stücke - seit 1926 aus Aluminium-Bronze - im Volksmund Altýnnik genannt. - Nhk.: - 1) abzuleiten von tartar. alty, sechs (nach der Rechnungseinheit von 6 Denga); vergl. türk. alti, sechs. - 2) v. Schrötter weist darauf hin, daß der Ausdruck alty manchmal mit Gold gleichgesetzt wird (vergl. Altun). - 3) Die gelegentliche Herleitung von alty tijn, sechs Eichhörnchen, gibt einen Hinweis auf den früheren Pelzhandel. - Nabltg.: P atialtýnnyj (s. d.). Aluminiummünzen, Münzen aus Aluminium (Nhk.), wurden erstmals unter Eduard VII. ( ) als 1/10-Penny-Stücke (s. Penny) in Britisch-Westafrika, als 1-Cent-Stücke (s. Cent) und als 1/2-Cent-Stücke in Ostafrika in Umlauf gesetzt. - Im allgemeinen hatten A. den Charakter von Notmünzen (s. d.), so in Deutschland die Pfennig-Stücke von und die 50-Pfennig-Stücke von Seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ( ) wurden A. von vielen Staaten in zunehmendem Maße als Scheidemünzen (s. d.) - z. T. in verbesserten Legierungen - in Umlauf gesetzt. - Wortentwicklg.: Aluminium, chemisches Zeichen Al, silberweißes Leichtmetall ; von latein. alûmen, Alaun, bitteres Tonerdesalz, aluminiumhaltige Tonerde ; mittellatein. vereinzelt alumium; danach 1808 von dem englischen Chemiker H. Davy alumium genannt, dann 1812 aluminum, im gleichen Jahr in einer anonymen Rezension aluminium; 1855 erstmals als technisches Produkt auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt.
16 Amadeo d oro ist eine Goldlira zu 10 Scudi (s. Lira und Scudo) mit dem Brustbild des Herrschers auf der Vs. und dem Landesschild oder einer Krone mit drei Fahnen auf der Rs., unter Herzog Victor Amadeus I. von Savoyen ( ) geprägt. - Nhk.: benannt nach dem Herrschernamen Amadeus. Amani ist die Bezeichnung für eine afghanische Goldmünze aus der Zeit von 1919 bis 1925 (1 A. = 30 Afghani, s. d.). - Nhk.: benannt nach dem Schöpfer der Münze, König Aman Ullah Khan ( ). Ambrosino ist eine Bezeichnung für Gold- und Silbermünzen der Stadt Mailand aus dem 13. bis 15. Jhdt. - 1) Ambrosino d oro, italien., Gold-Ambrosino, eine Goldmünze, nach dem Vorbild des Fiorino d oro (s. d.) aus Florenz während der ersten Republikzeit zwischen 1250 und 1310 und von 1447 bis 1450 geprägt. - 2) Ambrosino d argento, italien., Silber-Ambrosino, Bezeichnung verschiedener Grosso- und Soldo-Münzen (s. d.) aus der Zeit des 13. bis 15. Jhdt.s. - Nhk.: benannt nach dem Schutzpatron Mailands, St. Ambrosius, der auf einer Seite der Münze dargestellt ist. - Anmerkg.: Ambrosius Aurelius, *333 oder 339 in Trier, in Mailand; Kirchenlehrer, von 373 bis 397 Bischof von Mailand; Heiliger, Berater der Kaiser, doch unparteiisch; verteidigte die Selbständigkeit der Kirche, Anwalt der Notleidenden, stritt gegen den Arianismus, verfaßte die erste christliche Ethik, Hymnendichter, Vater des abendländischen Kirchengesanges, zählt neben Augustinus, Gregor I. dem Großen und Hieronynus zu den vier abendländischen Kirchenvätern. Ameisenmünzen sind Bronzenachbildungen von Kaurischnecken (s. d.) in China. - Nhk.: diese Frühformen von Münzen waren auch Totenbeigaben. Sie wurden dem Verstorbenen in die Nasenlöcher gesteckt, um zu verhindern, daß Ameisen in den toten Körper eindrangen. - Weitere Namen: Ameisennasengeld; Geistergesichtsmünzen; I Pi (s. Pi); engl. Ant Coin. Amulett-Münzen, Amulett-Medaillen sind Bezeichnungen für gelochte oder gehenkelte Münzen oder Medaillen mit religiösen Motiven oder auch mit Sinnsprüchen, magischen Formeln oder Figuren, wie sie seit der Antike als (Zauber-)Schutzmittel gegen böse Mächte getragen werden. Sie sollen Krankheit und Unglück fernhalten, den bösen Blick verbannen und die geistigen und physischen Abwehrkräfte stärken. A.-M. aus altgriechischer und altrömischer Zeit zeigen vorwiegend Darstellungen aus der Göttermythologie, A.-M. aus christlicher Zeit stellen u. a. den Heiligen Georg dar, das Gotteslammm (agnus dei) oder die Mutter Maria (s. Mariengeld). - Besonders beliebt sind A.-M. bei den Mohammedanern. - Nhk.: - 1) Amulett, wahrscheinlich vor 1600 entlehnt aus latein. amuletum, ursprüngl. Speise, Brei aus Kraftmehl ; mittellatein. amylum, aus griech. ámylon, nicht auf der Mühle gemahlenes Mehl ; dazu latein. moles, Last, Mühe, Not ; griech. môlos, Mühsal ; dazu latein. amoliri, abwenden, (Unangenehmes) aus dem Wege räumen ) nach Meyer (1861) eventuell auch von arab. hamalet, Anhängsel. Nach Maaler, 1561, (so bei Kluge) ist ein Amulett eine Artzney so man sich ann Hals henckt. - Spezielle Namen: Andreasmünzen; Georgsmünzen; Martinstaler; Mariengeld; Konstantinata; Touch piece, s. d. - Anmerkg.: Selbst die griechische Göttin Arhene verzichtete nicht auf ein abschreckendes Amulett. Sie trug auf der Brust das Gorgoneion, das von Perseus abgeschlagene schlangenhaarige Haupt der Medusa. Anchor money ist die Bezeichnung für britisches Kolonialgeld (s. d.), von 1820 bis 1822 als 1/2-, 1/4-, 1/8- und 1/16-Peso-Stücke (s. Peso) zunächst für Mauritius (ostwärts von Madagaskar), dann auch für die Westindischen Inseln geprägt. - Nhk.: engl. anchor money, Ankergeld ; benannt nach dem gekrönten Anker auf der Rs. der Münzen. - Weiterer Name: Ankergeld. Anconetano grosso, Agontano grosso (s. Grosso) sind Bezeichnungen für eine Groschenmünze aus dem 13. Jhdt. mit dem hl. Quiriacus auf der Vs. und einem Kreuz auf der Rs. - Nhk.: benannt nach dem Prägeort Ancona, an der Ostküste Italiens gelegen. - Anmerkg.: Quiriacus, auch Cyriacus, Heiliger, + um 309 n. Chr., Stadtheiliger von Ancona, u. a. Schutzheiliger der Zwangsarbeiter, Patron gegen Versuchungen und böse Geister, einer der 14 Nothelfer; half den Zwangsarbeitern bei dem Bau der Thermen des Kaisers Diokletian ( ) in Rom, wurde dafür selbst zu dieser Fronarbeit verurteilt, heilte die Tochter des Diokletian von der Besessenheit; wurde unter Maximinus Daia ( ) mit seinen Gefährten zu Tode gemartert. Reliquien befinden sich u. a. im Dom zu Bamberg (10. Jhdt.) und seit dem 9. Jhdt. in der Kathedrale S. Ciriaco in Ancona. Tag: 9.8. Andreas-Hofer-Kreuzer heißen Ein- und Zwanzig-Kreuzer-Stücke, die 1809 in Hall während des Freiheitskampfes der Tiroler gegen die französische Besatzung geschlagen wurden. - Nhk.: benannt nach dem Freiheitskämpfer Andreas Hofer (*1767, +1810). - Anmerkg.: Andreas Hofer, Besitzer des Gasthauses am Sand im Passeiertal, war 1808 Oberkommandant und zeitweise Regent von Tirol. Er kam durch Verrat in Gefangenschaft und wurde auf Befehl Napoleons ( /15) am in Mantua standrechtlich erschossen. Andreas-Münzen, - 1) schottische goldene Münzen, genannt St Andrew (s. d.), geprägt unter Robert III. ( ) bis Jakob IV. ( ). - Weiterer Name: Lion (s. d.). - 2) Die zuerst unter Karl dem Kühnen ( ) in den burgundischen Niederlanden geprägten Andriesgulden (s. d.), ähnlich noch einmal 1561 bis 1571 herausgegeben (Kroha). - 3) Die aus dem Silber der Andreasgrube in Andreasberg im Harz geprägten Andreasthaler, erstmals um 1535 unter dem Grafen Ernst von Hohnstein ( ) geschlagen, ab 1594 unter den Braunschweig-Lüneburger Herzögen und den Kurfürsten von Hannover bis 1773, danach - bis Anfang des 19. Jhdt.s unter Kurfürst Georg III. von Hannover ( ) - nur noch als Teilstücke, z. B. als 1/3 oder 1/6 Thaler oder auch als kupferne Andreaspfennige. Ein Teil dieser Harzer Münzen wurde als Ausbeutemünzen (s. d.) geprägt. - 4) Russische Dukaten, goldene Doppel- Ambrosino, Mailand ( ) 15
17 16 rubel, russisch Dwuchrublewik, als Handelsmünzen unter Peter dem Großen ( ) und seiner Tochter Elisabeth I. ( ) herausgegeben. - Nhk.: - 1) A.-M. zeigen den das Kreuz tragenden bzw. den vor oder hinter dem Kreuz stehenden Heiligen Andreas. - 2) Die Erzgrube in Andreasberg im Harz weist sich kreuzende Erzgänge aus, die ebenfalls auf das Andreaskreuz hinweisen und die Namengebung unterstützen (Cunz). - Anmerkg.: Andreas war einer der zwölf Jünger Jesu, Bruder des Petrus, Fischer aus Bethsaida am See Genezareth. Andreas soll in Skythien (nördlich des Schwarzen Meeres) gepredigt haben und am schräggestellten Kreuz gemartert worden sein (das schräggestellte Kreuz, das X-Kreuz, heißt deshalb Andreaskreuz ). Andreas ist der Schutzpatron Rußlands, Schottlands und Burgunds (deshalb ist das X-Kreuz auch das Wappen der Burgunder und trägt den zusätzlichen Namen Burgundisches Kreuz). - A.-M. wurden gerne als Amulette getragen. Der Andreastag (30.11.) war früher der Zahltag. In der Andreasnacht (vom 29. zum ) sollen Bitten an den Heiligen Andreas in Erfüllung gehen. Andriesgulden ist der niederländische Name für eine in den burgundischen Niederlanden geprägte Goldmünze aus dem 15. und 16. Jhdt. - Nhk.: niederländ. Andries, Andreas ; benannt nach dem Münzbild mit dem Heiligen Andreas und seinem Attribut, dem Schrägkreuz (s. Andreas-Münzen). Ange (d or) ist eine Bezeichnung für eine frühe französische Goldmünze, 1342 unter König Philipp VI. ( ) zu 75 Sous Tournois (s. d.) herausgegeben, 1386 unter Philipp dem Kühnen von Flandern ( ) nachgeahmt, dann noch einmal unter Johanna von Brabant ( ). - Nhk.: französ. ange d or, Goldengel ; französ. ange, Engel ; engl. angel; got. aggilos; latein. angelus; von griech. ángelos; Bote ; im Neuen Testament Bote Gottes. Die ursprüngliche Münze zeigt auf der Vs. den Erzengel Michael, der mit der Lanze einen Drachen durchbohrt. - Nabltg.: wahrscheinl. Von engl. Angel, Angelet, Angelot; niederländ. Gouden Engel (s. d.). - Anmerkg.: Im Alten Testament (Daniel 10,13) ist Michael der Beschützer des Gottesvolkes Israel, im Neuen Testament (Offenbarung des Johannes 12,7) Führer der himmlischen Heerscharen und Besieger des Satansheeres (in der Kunst als Drache dargestellt). Michael ist der Schutzpatron der Deutschen ; am 29.9 ist das Michaelisfest. - Aus Michael wurde die oberdeutsche Kurzform Michel; der Begriff vom gutmütigen, braven deutschen Michel ist erst nach 1848 entstanden. Angel, - 1) Bezeichnung für eine englische Goldmünze, erstmals im Werte von 6 Shillings 8 Pence 1465 unter König Eduard IV. ( ; ) wohl in Anlehnung an den Ange d or (s. d.) geschlagen, zuletzt 1634 unter Karl I. ( ) herausgegeben. Die Rs.n-Darstellung - ein Schiff mit Mast und Landesschild - erinnert an die Vorgängermünze, den Nobel (s. d.). - Nhk.: aus griech. angelos, latein. angelus, Bote ; engl. angel, Götterbote, Engel. Die Vs. zeigt den drachentötenden Erzengel Michael (Näheres s. Anmerkg. zu Ange d`or). - Weitere Namen: Touch piece; Angelot; dän. Eng(e)lot (s. d.). - Anmerkg.: Die Münze war seit der Regierung Heinrichs VII. ( ) bis weit in das 18. Jhdt. hinein als Touch piece ( Berührungsmünze, beruhend auf Markus 1,40 u. 41, Heilung des Aussätzigen) von besonderer Bedeutung. Die Berührung durch die Hand des Königs versprach Genesung von Krankheiten, insbes. von the king s evil, d. i. eine Art Aussatz. Das vom König angefaßte Goldstück wurde, um eine Wiederkehr der Krankheit zu vermeiden oder um einer Ansteckung vorzubeugen, an einer weißen Schnur um den Hals getragen. - 2) Eine Goldmünze der Insel Man, ab 1984 als Konkurrenzmünze zum Krügerrand (s. d.) herausgegeben, der wegen der Apartheidspolitik in den 80er Jahren an Popularität verloren hatte und dessen Einfuhr von vielen Ländern verboten war. Die Münze gleicht in bezug auf Größe, Gewicht, Reinheit und Goldanteil exakt dem Krügerrand.- Nhk.: engl. angel, Götterbote,Engel (Näheres s. Anmerkg. zu Ange d`or). Die Rs. der Münze zeigt ebenfalls den mit dem Drachen kämpfenden Erzengel Michael, darunter die Aufschrift FINE GOLD 1 ANGEL OUNCE.- Wortentwicklg.: zu latein. angelus; von griech. ángelos, Bote ; vermutlich zu griech. ángaros, reitender persischer Bote, also evtl. orientalischen Ursprungs (Pfeifer). Angelet ist eine Bezeichnung für das Halbstück des englischen Angel (s. d. und Angelot), zuerst im Werte von 3 Shillings 4 Pence geschlagen, zusammen mit dem Angel bis 1526 Hauptgoldprägung des Landes, 1619 zuletzt herausgegeben. - Nhk.: engl. Angelet, kleiner Engel, Diminutiv von Angel; benannt nach der Engeldarstellung auf der Vs. der Münze, die dem Angel (s. d.) entspricht. Angelhakengeld ist die deutsche Bezeichnung für Larinen (s. Lari) auf Ceylon, ein vormünzliches Zahlungsmittel. - Nhk.: Diese Larinen weisen an den Enden hakenförmige Biegungen auf, so daß diese spezielle Sorte Angelhakengeld genannt wird. Es handelt sich also nicht um Gerätegeld (s. d.). Angelot, - 1) Bezeichnung für eine engl.-französ. Goldmünze im Werte von 15 Sous (s. d.), unter König Heinrich VI. von England ( ; ) während des Hundertjährigen Krieges geschlagen. - Anmerkg.: Im Hundertjährigen Krieg ( mit Unterbrechungen) wurden die Engländer erst unter König Karl VII. ( ) mit Hilfe der Jungfrau von Orleans 1429 verdrängt. - 2) Noch einmal 1467 unter Ludwig XI. von Frankreich ( ) herausgegeben. - Nhk.: französ. angelet oder angelot, Engelchen ; diminut. zu französ. ange, Engel (s. auch Nhk. Angel). Die Münze zeigt auf der Vs. ein Engelsbrustbild über dem englischen und dem französischen Schild. - 3) Bezeichnung für eine englische Nachprägung der französischen Goldmünze Ange d`or (s. d.), ab 1472 mit dem Erzengel Michael (Nhk.) auf der Vs. herausgegeben. - Weiterer Name: Angel (s. d.). - Nabltg.: Angelet; dän. Eng(e)lot (s. d.). Angevin, - 1) die Bezeichnung für einen französischen Denier (s. d.) der Grafen von Anjou und Maine (südl. der Normandie), vom 10. bis 13. Jhdt. geschlagen. - 2) Der Name wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jhdt.s auf ein Viertel-Denier-Stück des Bistums und der Stadt Metz übertragen. - Nhk.: abgeleitet von dem Stadtnamen Angers, früher Andegavum, auch Andegavis, das war die Hauptstadt der alten Andegaver. In Angers wurde der Denier von 987 bis 1290 geprägt.
18 Anglicus ist der latinisierte Name für den Engelstetter, auch Englisch (s. d.) genannt, z. B. als Anglicus pro VII hall(er) 1331 in Trier erwähnt (v. Schrötter). - Nhk.: latein. anglicus, Bote, Engel ; doch eigtl. aus angelsächs. Englisc, über Engle, Angle; abgeleitet von den Angeln, dem germanischen Volksstamm, der im 5. und 6. Jhdt. n. Chr. in Britannien gesiedelt hatte. - Anmerkg: In der Zeit Heinrichs I. ( ) behauptete sich der Name Anglia ( England ) für das ganze Land. änglisker ist ein schwedischer Name für den englischen Sterling (s. d.) und dessen Nachahmungen. - Nhk.: schwed. änglisk, aus England stammend. Angster, auch Angsterpfennig waren zunächst Bezeichnungen für eine kleine schweizerische Silbermünze, später nur noch als Scheidemünze in Billon oder Kupfer geprägt, ab ca in Basel, dann auch in anderen Städten der Schweiz, zuletzt 1846 in Schwyz (Kroha) herausgegeben. - Nhk.: -1) Gegenwärtig wird die Ableitung des Namens von angustus, latein., schmal, eng, dünn, vorgezogen. Halke spricht von numi angusti, von schlanken, kleinen Pfennigen. - 2) Die Herkunft des Namens von Angesicht - auf den frühen Angstern ist häufig ein Bischofsangesicht dargestellt - wird heute angezweifelt. Jedoch scheint die Benennung Bäggeli- Angster für den Luzerner Angster mit dem pausbackigen Leodogar-Gesicht mehr für den Ursprung des Wortes Angesicht zu sprechen (zu mittelhochd. angesihte). - 3) Die Herleitung von augustorum (effigies), latein., Bildnis der Kaiser, ist abwegig. - 4) Die Zurückführung des Namens auf die Ortschaft Augst (ostwärts von Basel) wäre nur sinnvoll, wenn ein Zusammenhang zwischen der Münze und dem Ort nachweisbar wäre. - Nhw.: Auf den Rs.n späterer Münzen dieses Namens erscheint der Ausdruck ANGSTER als Schriftbild. - Spezieller Name: Vierzipfliger Angster, s. Vierzipflige Pfennige. Angsttaler wird ein Taler (s. d.) des Großherzogs Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin ( ) aus dem Revolutionsjahr 1848 genannt. Auf der Vs. des Talers fehlt in der Umschrift die allgemein übliche Buchstabenfolge V G G ( Von Gottes Gnaden ). - Nhk.: Das Fehlen der Buchstaben wurde in der Bevölkerung als Angst vor revolutionären Übergriffen während der Märzrevolution 1848 gedeutet. - Diese Deutung wird in der Literatur jedoch damit zurückgewiesen, daß bereits der Vorgänger des Großherzogs, Paul Friedrich ( ), auf die Buchstabenfolge verzichtet hat. - Anmerkg.: Auffällig ist der fast gleichzeitige Verzicht auf das Gottesgnadentum auf englischen Münzen, nämlich 1849, s. Godless coinage. Ankergeld ist die deutsche Bezeichnung für das britische Anchor money (s. d.). - Nhk.: engl. anchor money, Ankergeld. Anlaßmünze ist ein weiterer Name für Ereignismünze (s. d.). - Nhk.: A.n sind Denkmünzen (s. d.), die zu einem besonderen Anlaß (wie z. B. Geburt, Heirat oder Tod eines Herrschers) ausgegeben werden (Anlaß, Ursache, Grund ; mittelhochd. anelâz, anlaz, Anfang, Beginn, Punkt, von dem ein Wettrennen ausgeht, Anreiz, Gelegenheit ). Anna, - 1) Bezeichnung für eine kupferne Teileinheit der alten indischen Rupie (16 A. = 1 Rupie) und von 1862 bis 1917 wurden unter der britischen Krone auch 2-Anna-Stücke in Silber herausgegeben. Annas (daneben halbe und viertel A.s) kursierten bis zur Einführung des Dezimalsystems im Jahre 1947 in Indien. - 2) Von 1949 bis 1960 war A. Währungseinheit in Pakistan (ebenfalls 16 A. = 1 Rupie). - Nhk.: - 1) Volumenmaß (2634,25 l) und Massemaß (2540 kg) für Salz in Bombay (Indien) ) Massemaß für Perlen in Bombay (1 A. = g). - 3) Massemaß für Edelmetalle in Kalkutta (1 A. = 0,729 g). - 4) Gold- und Silbergewicht in Bengalen; ein Handelsgewicht in Hindostan. - 5) Reismaß oder Gewicht auf Ceylon. Annataler ist die Bezeichnung für einen Taler der Grafen von Schlick (s. Taler und Schlicktaler), der zwischen 1627 und 1663 und in den Jahren 1716, 1759 und 1767 geprägt worden ist. - Nhk.: Die Münzen zeigen auf der Vs. über dem Wappen der Grafen von Schlick die hl. Anna-Selbdritt. - Anmerkg.: Anna, griechische Form des hebräischen Hanna, Channa, die Heilige, die Holdselige ; nach dem Protoevangelium Jakobs (200 n. Chr.) Gemahlin des hl. Joachim (s. Joachimstaler), Mutter der Jungfrau Maria, Großmutter Jesu; seit dem 4. Jhdt. verehrt, Darstellung als Anna-Selbdritt mit Tochter Maria und Enkel Jesus. Hochblüte der Verehrung gegen Ende des Mittelalters (um 1500); ); Patronin insbes. der Mütter und der Bergleute, weil sie Kostbares in ihrem Schoße barg. Fest: Das Haupt der hl. Anna soll sich seit 1501/1502 in der St.-Anna-Kirche in Düren befinden (Dammer). Annengroschen ist ein Name für Silbergroschen von Hannover und Hildesheim aus dem Jahre 1501 und von Braunschweig aus den Jahren 1533 bis 1541, geprägt nach dem Hildesheimer Münzvertrag von Nhk.: Auf der Rs. der Münze ist die hl. Anna mit einem Kind auf jedem Arm (Maria und Christus) dargestellt, die Anna-Selbdritt (s. Anmerkg. zu Annataler). - Nhw.: Die A. von Hannover zeigen auf der Rs. die Anna selbdritt mit der Umschrift ANNA MATER VIRGINIS MARIAE (latein., Anna, Mutter der Jungfrau Maria ). Anselmino, Anselmo ist eine Silbermünze, unter Vincenz I. von Mantua ( ) geprägt. - Nhk.: Die Münze zeigt auf der Vs. den hl. Anselm, Schutzpatron von Mantua. - Anmerkg.: Anselm, Heiliger, *1033, +1109, Kirchenlehrer und Benediktiner, einer der wichtigsten Kirchenschriftsteller, Vater der Scholastik, 1073 Abt zu Bec (Nordfrankreich), 1093 Erzbischof von Canterbury, 1494 heiliggesprochen. Fest: Ant Coin ist der englische Name für die chinesische Ameisenmünze (s. d.). - Nhk.: engl. ant, Ameise ; engl. coin, Münze. antike Münzen, - 1) im engeren Sinne nach traditionell humanistischer Auffassung die Münzen des griechisch-römischen Altertums. Auch sie sind - neben anderen Kulturgütern - Zeugnis und Ausdruck der Grundlagen abendländischer Kultur, hervorgebracht in dem Zeitraum des 7. Jhdt.s v. Chr. bis zum Untergang des Weströmischen Reiches, 476 n. Chr. - 2) Im weiteren Sinne werden auch Münzen der anderen Kulturen des Altertums den antiken Münzen zugeordnet, so die Münzen der Perser, der Kelten, der Juden, die Münzen der Völkerwanderungsstämme und - mit Einschränkung - auch die des Byzantinischen Reiches, 17
19 Antoninian lulianus (284/285) 18 obwohl in der Mehrzahl im Mittelalter geprägt. - Nhk.: Antike, das klassische Altertum ; zu antik, adj., das Altertum betreffend, altertümlich (17. Jhdt.); aus gleichbedeutend französ. antique; von latein. antiquus, vormalig, alt ; Nebenform zu latein. anticus, der Vordere ; zu latein. ante, vor, vorher. - Spezielle Namen: griechische Münzen; römische Münzen (s. d.). Antireformationstaler, Gegenreformationstaler wurden 1730 unter dem Grafen Anton III. von Montfort-Tettnang ( ) mit dem hl. Johannes von Montfort auf der Vs. und der hl. Jungfrau Maria auf der Rs. geschlagen. Die Rs. trägt den Spruch: Durch Gott unter Mariae Schutz wurde dies getruckt dem Feind zu Trutz. - Nhk.: Die A. wandten sich gegen die Festveranstaltungen der evangelischen Fürsten und Städte zur 200jährigen Wiederkehr der Augsburger Konfession von Das Augsburger Bekenntnis war für die Protestanten für den Fortgang der Reformation von außerordentlicher theologischer und kirchenpolitischer Bedeutung. Anmerkg.: Der hl. Johannes von Montfort stammt aus dem Geschlecht der Grafen von Montfort bei Feldkirch (Vorarlberg). Als Tempelritter im Heiligen Land erlitt er im Kampf gegen die Sarazenen eine Verwundung, an der er um 1200 in Famagusta (Zypern) starb. Sein unverwester Leib wurde in Nikosia (ebenfalls auf Zypern) bis zur Besetzung durch die Türken (1571) verehrt. Gedächtnistag: 24. Mai. Antoninian, latein. Antoninianus, ist ein Ausdruck der modernen Numismatik für eine unter Kaiser Caracalla ( ) im Jahre 214 herausgebrachte römische Silbermünze, den Doppeldenar, zu erkennen an der Strahlenkrone des Kaisers auf der Vs. der Münze bzw. an der Mondsichel als Schmuck der Kaiserinnenbüste (vergl. Doppelsesterz; Dupondius). Der A. wurde von vielen Kaisern bis zur Münzreform Diocletians ( ) - zuletzt nur noch mit einem Silbersud versehen oder ganz aus Kupfer - geprägt. - Nhk.: abgeleitet von einem der Vornamen Caracallas, Marcus Aurelius Antoninus. - Weitere Namen: bei Halke auch Argenteus Antoninianus, Argenteus Aurelianus und - unverständlicherweise - denarius minutulus (s. Argenteus und Minutulus); Radiat (s. d., Sammelbegriff). Antoniustaler wurden 1697 bis 1701 unter dem Hildesheimer Bischof Jost Edmund von Brabeck ( ) geschlagen. - Nhk.: A. sind Ausbeutetaler (s. d.) aus dem Silber der St. Antonius- Grube bei Hahnenklee im Harz. Sie zeigen auf der Rs. den hl. Antonius. - Anmerkg.: hl. Antonius von Padua, *1195, +1231, Grab zu Padua; u. a. Patron von Hildesheim, Schutzheiliger der Bergleute, der Armen und der Eheleute; knapp ein Jahr nach seinem Tod heiliggesprochen. Antonius wurde von Franz von Assisi (*um 1181/1182, +1226) zum ersten Theologen seines Ordens ernannt. Er war ein erfolgreicher Prediger wurde er zum Kirchenlehrer erhoben. Fest: Antrittsmünzen wurden zum Antritt einer Regierung (Nhk.) herausgegeben. - Weitere Namen: Krönungsmünzen, Huldigungsmünzen, Proklamationsgeld (s. d.). Apfeldreiling ist der Name eines Drei-Pfennig- Stückes, 1573 unter Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel ( ) geprägt. Die Vs. zeigt ein gekröntes I H (Julius Herzog?). - Nhk.: benannt nach der Rs. mit einem Reichsapfel, darin eine 3 (s. auch Dreiling und Pfennig). Apfelgroschen wurden vom 16. bis 18. Jhdt. nach der Reichsmünzordnung von 1571 geschlagen. - Nhk.: Die Münzen zeigen auf der Rs. den Reichsapfel mit der Zahl 24 (für 1/24 Reichstaler). - Spezieller Name: Dreimattier (s. d.). Apfelgulden sind goldene Gulden (s. d.) des 15. und des 16. Jhdt.s. Sie wurden in Reichsstädten wie Basel oder Frankfurt a. M. geprägt. - Nhk.: Sie zeigen auf der Rs. den Reichsapfel im Dreipaß. Aposteltaler sind Schautaler (s. Schaumünze), unter Kaiser Rudolf II. ( ) geprägt. - Nhk.: Die Rs. gibt die Namen der zwölf Apostel wieder, die Vs. zeigt die Wappen der zwölf Königreiche Böhmen, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Neapel, Polen Portugal, Schottland, Schweden, Spanien und Ungarn. Apulienses sind konkave Denare (s. d.), im Königreich beider Sizilien erstmals unter Wilhelm II., dem Guten ( ), in Palermo oder in Salerno geschlagen. - Nhk.: benannt nach dem Umlaufgebiet Apulien, im Südosten Italiens gelegen (s. auch Tercenarius). Aqce, Akce sind Namen für türkische Münzen, als Silbermünzen unter Osman I. ( ) oder unter seinem Nachfolger Urchan ) geschaffen. Sie wurden bis in das 19. Jhdt. hinein (zuletzt in Billon) herausgegeben. - Nhk.: türk. akca, weißlich ; nach dem Vorbild der byzantinischen Asper geprägt (s. d. und Akce). Aquilino, pl. Aquilini, ist eine oberitalienische silberne Groschenmünze zu 18 Bernern (s. d.), unter Graf Meinhard II. von Görz-Tirol ( ) geschaffen, nachweislich in Meran von 1258 bis Ende des 13. Jhdt.s geprägt, in anderen oberitalienischen Städten wie Mantua, Treviso und Verona nachgeahmt. - Nhk.: von italien. aquila, Adler, abgeleitet. Die Münze trägt auf der Vs. einen Adler nach dem Vorbild der Adlerdarstellungen auf den Augstalen (s. d.) des Stauferkönigs Friedrichs II. ( ). Der Münzherr Graf Meinhard II. von Görz-Tirol ( ) hatte die Witwe Konrads IV. von Hohenstaufen ( ) geheiratet und war so zu reichsgräflichen Ehren gekommen. - Weitere Namen: Aguglino (v. Schrötter); latein. grossus aquilinus; deutsch Adlergroschen (s. d., s. auch Anmerkg. zu Adlerpfennige). Arapcik hießen im 19. Jhdt. in Rußland der holländische Dukat (s. d.) und seine russischen Nachahmungen (s. auch Tscherwonez). - Nhk.: zu russ. arab, Araber ; wohl nach der Reiterdarstellung auf der Münze benannt. Ardite ist eine in Barcelona geprägte Billon- und Kupfermünze, unter Philipp III. ( ) und Philipp IV. ( ) von Spanien und unter Ludwig XIV. ( ) erschienen. - Nhk.: - 1) abzuleiten von Hardi (Hardi d argent, Hardi d or, s. d.). Der Hardi ist von der Guyenne (Südfrankreich) über die Pyrenäen nach Aragon- Catalonien in die catalonische Sprache eingedrungen (so z. B. bei Cervantes) und noch in der Redensart No vale un ardites (keinen Ardite wert)
20 erhalten (Burckhardt). - 2) Die Ableitung von den beiden Buchstaben A-R (Aragoniae Rex) neben dem Kopf der Könige ist nicht überzeugend. Arendrijksdaalder sind niederländische Taler (s. d.) des 16. und 17. Jhdt.s, nach dem Talerfuß des deutschen Reiches geprägt. - Nhk.: niederländ. arendrijksdaalder, Reichsadlertaler. Die Münzen tragen auf einer Seite den deutschen Reichsadler; s. auch Rijksdaader und Anmerkg. zu Adlerpfennige. Arendschelling, niederländ., Adlerschilling, ist ein niederländischer Schilling (s. d.), eine 1536 unter Kaiser Karl V. ( ) eingeführte Silbermünze im Werte von vier Stübern (s. d.), später (1586) auf sechs Stüber heraufgesetzt. Ab 1600 wurde die Münze als Achteltaler noch in vielen Städten - so in Münster bis häufig geprägt. - Nhk.: Die Münzen tragen auf einer Seite den gekrönten Doppeladler (s. auch Anmerkg. zu Adlerpfennige). - Wortentwicklg.: althochd. aro; got. ara; german. ara; mittelhochd. ar und arn; mittelniederd. arn(e); mittelniederländ. aren(t); niederländ. arend; urverwandt mit griech. órnis, Vogel (vergl. Ornithologie, Vogelkunde ); erst seit dem 12. Jhdt. im Zusammenhang mit der Falknerei adelar(e), mittelhochd., edler Aar (althochd. adal, edel), im 16. Jhdt. Adeler.- Weitere Namen: Vlieger; Krabbelaer; Blamüser; Malschilling; ab 17. Jhdt. Krummsteert; Schrickelborger (s. d.). Arenkopf, Arnekopf, Arenkoppe sind Goslarer Hohlpfennige (s. d.) zu einem Scherf (1/2 Pfennig) aus dem 15. Jhdt. - Nhk.: benannt nach dem Adlerkopf als Münzbild; Adler, mittelhochd. adelar(n), adlar, adler; eine Zusammensetzung aus mittelhochd. adel ( edel ) und ar ( Aar, Adler ); altsächs. arn; mittelniederd. arn(e), ar(e)nt. - Weitere Namen: Hanenkoppe; Gösger, Gosler (s. d.). Argenteus (nummus), - 1) in der römischen Antike ein Sammelbegriff für alle Silbermünzen. Durch Hinzufügen eines Adjektivs zum substantivierten Adjektiv Argenteus wurden spezielle Argentei benannt, z. B. Argenteus minutulus, Argenteus Antoninianus, Argenteus Aurelianus (s. d.). - 2) Der bei Halke (1909) noch mit Argenteus Antoninianus bezeichnete Doppeldenar von Caracalla ( ) wird heute allgemein verkürzt Antoninianus (s. d.) genannt. - 3) Unter A. versteht man derzeit schlechthin speziell die kurzlebige, verhältnismäßig seltene Silbermünze von 3,4 g, die Diocletian ( ) im Jahre 294 durch eine Münzreform eingeführt hat und bis ca. 310 unter einigen Tetrarchen geprägt wurde. Der zeitgenössische Name der Münze ist unbekannt. - Nhk.: latein. argenteus, silbern, versilbert, silberweiß ; latein. argenteus nummus, silberne Münze ; daraus verkürzt Argenteus, der Silberne ; zu latein. argentum, Silber. Argentino ist der Name einer argentinischen Goldmünze zu 5 Pesos (s. d.), von 1881 bis 1896 geprägt. Halbe A.s wurden von 1881 bis 1884 geschlagen. - Nhk.: Die Münze zeigt auf der Vs. den Kopf der Argentina, den Freiheitskopf, Sinnbild der Republik, auf der Rs. das Landeswappen. Armellino ist der Name einer neapolitanischen Groschenmünze zu 1 /2 Carlino (s. d.) aus dem letzten Drittel des 15. Jhdt.s. - Nhk.: zu italien. armellino, Hermelin ; benannt nach dem Münzbild, das ein Hermelin zeigt, nach dem Wappen des Ritterordens zum Hermelin gestaltet. - Weiterer Name: Volpetta (s. d.). Arnaldenses sind Denare des Bistums Agen in Frankreich, erstmals 1040 unter Bischof Arnold I. von Bonneville geschlagen. - Nhk.: benannt nach dem Bischof Arnold. Arnoldusgulden, Arnoldsgulden waren minderwertige Goldgulden (s. d.) des Herzogs von Geldern, Arnold von Egmont ( ), deren Feingehalt nur der Hälfte des Rheinischen Guldens (s. d.) entsprach. - Nhk.: benannt nach dem Prägeherrn Arnold. arsakidische Münzen, verkürzt Arsakiden, sind die Gepräge einer mächtigen Dynastie des Partherreiches, der Arsakiden, die von 250 v. Chr. bis 226 n. Chr. das Reich beherrschten. Die Münzen sind verhältnismäßig uniform gestaltet: Auf der Vs. Ist der Kopf des Königs dargestellt, die Rs. zeigt fast ausschließlich einen Bogenschützen im Schriftbild, nach rechts sitzend. - Nhk.: benannt nach dem Begründer der Herrscherdynastie, Arsakes (ca v. Chr.). - Weitere Namen: parthische Münzen, Parther (s. d.). Artig, pl. Artiger (arthege), ist die Bezeichnung für eine kleine baltische Silbermünze mit einem Durchmesser von 12 bis 14 mm, im 14. und im 15. Jhdt. von den Bischöfen von Dorpat, den Erzbischöfen von Riga und dem Schwertbrüderorden von Livland herausgegeben. - Nhk.: abgeleitet von Örtug (s. d.), ursprüngl. eine skandinavische Gewichtseinheit, dann Rechnungseinheit, später Währungseinheit. Artiluk war eine Silbermünze der Republik Ragusa (heute Dubrownik), von 1627 bis 1701 geprägt. - Nhk.: abgeleitet von türk. altilik, Sechser ; zu tartar. alty, sechs ; vergl. Altilik. Die Münze galt sechs Para (s. d.). Artisien, Artesien, Artoisien sind Namen von Denaren (s. d.), die unter den Grafen von Artois Argenteus (südwestlich von Flandern), seit dem Ende des 10. z. Zt. des Jhdt.s geprägt worden sind. - Nhk.: benannt nach Diocletianus dem Umlaufgebiet Artois Artug ist die russische Bezeichnung für Örtug (s. d.), d. i. eine schwedische Münze aus dem 14. Jhdt. A. war von 1410 bis 1420 neben dem Witten (s. d.) die einzige offizielle Münze in Nowgorod. - Nhk.: abgeleitet von Örtug, eine frühere skandinavische Gewichtseinheit. As, pl. Asses, war zunächst die Bezeichnung für eine altrömische Maß- und Gewichtseinheit, als Längenmaß Fuß, als Flächenmaß Morgen und als Gewichtsmaß as libriarius (das leichte Pfund zu 272, 88 g, das schwere Pfund zu 327,63 g) mit sehr vielen Unterteilungen, von denen die wesentlichen auch auf die ebenfalls auf Kupfer basierende Münzeinheit As übergingen. - Die ersten Asse aus der Aes-Grave-Periode (s. Aes grave), die bald nach (verkleinert) 300 v. Chr. in Rom, Etrurien, Umbrien, Picenum und As (Kupfer) Apulien ihren Anfang nahm, waren gegossene Divus Augustus um grobe, schwere Kupfermünzen - vorher gab es Kupferbarren - im Originalgewicht des Pfundes. Ihr Gewicht wurde jedoch nach und nach - insbesonde- 19
Münzen der Helvetischen Republik
 Münzen der Helvetischen Republik Als Folge der französischen Revolution brach Ende des 18. Jahrhunderts die Alte Eidgenossenschaft zusammen. Im Januar 1798 fielen die Franzosen in die Waadt ein und liessen
Münzen der Helvetischen Republik Als Folge der französischen Revolution brach Ende des 18. Jahrhunderts die Alte Eidgenossenschaft zusammen. Im Januar 1798 fielen die Franzosen in die Waadt ein und liessen
Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich
 Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich Name Lebenszeit König Kaiser Karl der Große Sohn des Königs Pippin d. J. Ludwig I. der Fromme Jüngster Sohn Karls d. Großen Lothar I. Ältester Sohn Ludwigs
Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich Name Lebenszeit König Kaiser Karl der Große Sohn des Königs Pippin d. J. Ludwig I. der Fromme Jüngster Sohn Karls d. Großen Lothar I. Ältester Sohn Ludwigs
Warenangebot slist e
 M1025 Bayern 1632, die 2 Kreuzer als Kursmünze aus Silber, "Reichsapfel + Wappen mit Umschrift" und ist in guter VZ+ Qualität mit noch einen guten Avers + Revers. KM-Nr.: 128 M0946 M1021 M1020 M1024 M1144
M1025 Bayern 1632, die 2 Kreuzer als Kursmünze aus Silber, "Reichsapfel + Wappen mit Umschrift" und ist in guter VZ+ Qualität mit noch einen guten Avers + Revers. KM-Nr.: 128 M0946 M1021 M1020 M1024 M1144
Übersicht über die Herrscher in der Mark Brandenburg
 Übersicht über die Herrscher in der Mark 1157-1918 1. Herrschaft der Askanier (1157-1320) Die Askanier waren ein in Teilen des heutigen Sachsen-Anhalt ansässiges altes deutsches Adelsgeschlecht, dessen
Übersicht über die Herrscher in der Mark 1157-1918 1. Herrschaft der Askanier (1157-1320) Die Askanier waren ein in Teilen des heutigen Sachsen-Anhalt ansässiges altes deutsches Adelsgeschlecht, dessen
Deutschland im Goldrausch: Die teuersten Sammlermünzen
 Deutschland im Goldrausch: Die teuersten Sammlermünzen Inflationsangst und mangelnde Anlagealternativen: Anleger decken sich zurzeit eifrig mit Goldmünzen ein. Die zehn Edelmetallmünzen, die in den vergangenen
Deutschland im Goldrausch: Die teuersten Sammlermünzen Inflationsangst und mangelnde Anlagealternativen: Anleger decken sich zurzeit eifrig mit Goldmünzen ein. Die zehn Edelmetallmünzen, die in den vergangenen
Schweizerische Bundesmünzen solide und bewährt
 Schweizerische Bundesmünzen solide und bewährt In der EU steht die Schweiz abseits. Eine Währungsunion hat aber auch sie erlebt. Denn mit einem Schlag setzte die erste Bundesverfassung von 1848 dem zersplitterten
Schweizerische Bundesmünzen solide und bewährt In der EU steht die Schweiz abseits. Eine Währungsunion hat aber auch sie erlebt. Denn mit einem Schlag setzte die erste Bundesverfassung von 1848 dem zersplitterten
Römisch Deutsches Reich
 4 Römisch Deutsches Reich Haus Habsburg Ferdinand I. 1521 1564 1 Taler o.j., Hall. 28,2 g. Voglh. 48/I. Dav. 8026... Korrodiert, schön 80,- 2 Prager Groschen 1541, Kuttenberg. 2,8 g. Dietiker 16.... Dunkle
4 Römisch Deutsches Reich Haus Habsburg Ferdinand I. 1521 1564 1 Taler o.j., Hall. 28,2 g. Voglh. 48/I. Dav. 8026... Korrodiert, schön 80,- 2 Prager Groschen 1541, Kuttenberg. 2,8 g. Dietiker 16.... Dunkle
Münzen aus aller Welt
 Münzen aus aller Welt In unserer Online-Galerie präsentieren wir Ihnen eine Auswahl von Edelmetall-Münzen aus aller Welt. Münzen aus folgenden Ländern finden Sie im Inhalt: Australien Belgien Chile China
Münzen aus aller Welt In unserer Online-Galerie präsentieren wir Ihnen eine Auswahl von Edelmetall-Münzen aus aller Welt. Münzen aus folgenden Ländern finden Sie im Inhalt: Australien Belgien Chile China
Der Fiorino d'oro die erste internationale Goldmünze Europas
 Der Fiorino d'oro die erste internationale münze Europas Eine gelungene Sache reizt immer zum Nachahmen. So auch der Fiorino d oro, die erste münze, die die Stadtrepublik Florenz 1252 ausgab. Imitiert
Der Fiorino d'oro die erste internationale münze Europas Eine gelungene Sache reizt immer zum Nachahmen. So auch der Fiorino d oro, die erste münze, die die Stadtrepublik Florenz 1252 ausgab. Imitiert
Münzen: Legierung und Herstellung. 24. Oktober 2008
 Münzen: Legierung und Herstellung 24. Oktober 2008 Überblick 2 Geschichtliches Erste Münzen ohne Prägung aus Elektron zwischen 650 und 600 v. Chr. in Lydien Ab etwa 550 v. Chr. tauchten Münzen aus Gold,
Münzen: Legierung und Herstellung 24. Oktober 2008 Überblick 2 Geschichtliches Erste Münzen ohne Prägung aus Elektron zwischen 650 und 600 v. Chr. in Lydien Ab etwa 550 v. Chr. tauchten Münzen aus Gold,
Die, Witteisbacher in Lebensbildern
 Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
Gold Antike. Deutschland, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Reichsmünzen. Kelten Belgica, Ambiani. Schlesien-Liegnitz-Brieg, Herzogtum
 Gold Antike Kelten Belgica, Ambiani 4 Dukat 1787, Wien. 3,37 g. +19% Her. 29, Jl. 21, Fbg. 439. Kopf re. / Gekr. Doppeladler. Fassungsspuren ss 100,- 1 Stater. (65-55 v.chr.). 6,09 g. Delestrée/Tache 236.
Gold Antike Kelten Belgica, Ambiani 4 Dukat 1787, Wien. 3,37 g. +19% Her. 29, Jl. 21, Fbg. 439. Kopf re. / Gekr. Doppeladler. Fassungsspuren ss 100,- 1 Stater. (65-55 v.chr.). 6,09 g. Delestrée/Tache 236.
Zahlenverhältnisse als Gestaltungskriterium Eine Medaille Friedrichs des Weisen
 1 Zahlenverhältnisse als Gestaltungskriterium Eine Medaille Friedrichs des Weisen "Locumtenensthaler werden die Thaler und Medaillen des Churfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen genannt, welche zum
1 Zahlenverhältnisse als Gestaltungskriterium Eine Medaille Friedrichs des Weisen "Locumtenensthaler werden die Thaler und Medaillen des Churfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen genannt, welche zum
Alexander der Grosse Vater der ersten internationalen Währung
 Alexander der Grosse Vater der ersten internationalen Währung Alexander der Grosse ist für die Münzgeschichte von grosser Bedeutung. Nachdem er im jugendlichen Alter von zwanzig Jahren nach dem Tod seines
Alexander der Grosse Vater der ersten internationalen Währung Alexander der Grosse ist für die Münzgeschichte von grosser Bedeutung. Nachdem er im jugendlichen Alter von zwanzig Jahren nach dem Tod seines
HABSBURGISCHE ERBLANDE - ÖSTERREICH
 1833 Wilhelm I., 1816-1864 Doppeltaler 1846. Verm. D. 13 Juli 1846. AKS 122; Th.438; Kahnt 591. Patina, f. 1834 Kronentaler 1833. Handelsfreiheit. AKS 67; Th.435; Kahnt 587. kl. Flecken, - 450,- 1844 Franz
1833 Wilhelm I., 1816-1864 Doppeltaler 1846. Verm. D. 13 Juli 1846. AKS 122; Th.438; Kahnt 591. Patina, f. 1834 Kronentaler 1833. Handelsfreiheit. AKS 67; Th.435; Kahnt 587. kl. Flecken, - 450,- 1844 Franz
DOWNLOAD VORSCHAU. Die 16 Bundesländer. zur Vollversion. Jens Eggert. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Jens Eggert Die 16 Bundesländer Downloadauszug aus dem Originaltitel: Die 16 Bundesländer 21 Seit dem Tag der Wiedervereinigung gibt es insgesamt 16 Bundesländer. 1. Nimm einen Atlas und suche
DOWNLOAD Jens Eggert Die 16 Bundesländer Downloadauszug aus dem Originaltitel: Die 16 Bundesländer 21 Seit dem Tag der Wiedervereinigung gibt es insgesamt 16 Bundesländer. 1. Nimm einen Atlas und suche
Sonderliste Februar 2016 münzen von der antike bis zur gegenwart MÜNZHANDLUNG
 Sonderliste Februar 2016 münzen von der antike bis zur gegenwart MÜNZHANDLUNG RITTER Immermannstr. 19-40210 düsseldorf tel.: 0211-367800 / fax: 0211-36780 25 info@muenzen-ritter.de www.muenzen-ritter.de
Sonderliste Februar 2016 münzen von der antike bis zur gegenwart MÜNZHANDLUNG RITTER Immermannstr. 19-40210 düsseldorf tel.: 0211-367800 / fax: 0211-36780 25 info@muenzen-ritter.de www.muenzen-ritter.de
Münzen allgemein Oktober 4th, Anfänge in Kleinasien, Griechenland und China
 Münzen allgemein Oktober 4th, 2012 Anfänge in Kleinasien, Griechenland und China Die ersten Funde von vermutlichem Metallgeld stammen aus dem Mittelmeerraum und datieren um die Zeit 2000 v. Chr. Es handelt
Münzen allgemein Oktober 4th, 2012 Anfänge in Kleinasien, Griechenland und China Die ersten Funde von vermutlichem Metallgeld stammen aus dem Mittelmeerraum und datieren um die Zeit 2000 v. Chr. Es handelt
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen II. Herkunft und Ansehen der Karolinger
 Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Vorbericht Auktion 66
 Vorbericht Auktion 66 Am 17. und 18. November 2011 veranstaltet die Numismatische Abteilung des Hauses Emporium Hamburg die 66. Münzen- und Medaillenauktion im Goedeke-Michel-Saal des Störtebeker-Hauses,
Vorbericht Auktion 66 Am 17. und 18. November 2011 veranstaltet die Numismatische Abteilung des Hauses Emporium Hamburg die 66. Münzen- und Medaillenauktion im Goedeke-Michel-Saal des Störtebeker-Hauses,
Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach
 Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach Überarbeitet: Juli 2000 Ergänzt: Juli 2000 a) Ritter von Rheinbach, Stadt- und Schöffensiegel im Bereich der heutigen Stadt Rheinbach 1 Lambert I. (1256-1276,
Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach Überarbeitet: Juli 2000 Ergänzt: Juli 2000 a) Ritter von Rheinbach, Stadt- und Schöffensiegel im Bereich der heutigen Stadt Rheinbach 1 Lambert I. (1256-1276,
3501* Friedrich I Mark 1875 A. Jaeger 179. sehr schön/vorzüglich 2.000,-
 Reichsgoldmünzen Anhalt 3502 3501 3503 3501* Friedrich I. 1871-1904. 20 Mark 1875 A. Jaeger 179. sehr schön/vorzüglich 2.000,- 3502* 10 Mark 1901 A. Jaeger 180. vorzüglich/stempelglanz 2.000,- 3503* 20
Reichsgoldmünzen Anhalt 3502 3501 3503 3501* Friedrich I. 1871-1904. 20 Mark 1875 A. Jaeger 179. sehr schön/vorzüglich 2.000,- 3502* 10 Mark 1901 A. Jaeger 180. vorzüglich/stempelglanz 2.000,- 3503* 20
zeitreise 1 Ernst Klett Schulbuchverlag leipzig Stuttgart Düsseldorf
 zeitreise 1 Ernst Klett Schulbuchverlag leipzig leipzig Stuttgart Düsseldorf Thematisches Inhaltsverzeichnis Das Fach Geschichte 10 1 Wir leben alle mit Geschichte 12 2 Methode: Einen Stammbaum erstellen
zeitreise 1 Ernst Klett Schulbuchverlag leipzig leipzig Stuttgart Düsseldorf Thematisches Inhaltsverzeichnis Das Fach Geschichte 10 1 Wir leben alle mit Geschichte 12 2 Methode: Einen Stammbaum erstellen
Zeittafel Römisch-Deutsche Kaiser und Könige 768 bis 1918
 Röm.Deut. Kaiser/König Lebenszeit Regierungszeit Herkunft Grabstätte Bemerkungen Karl der Große Fränkischer König Karl der Große Römischer Kaiser Ludwig I., der Fromme Römischer Kaiser Lothar I. Mittelfränkischer
Röm.Deut. Kaiser/König Lebenszeit Regierungszeit Herkunft Grabstätte Bemerkungen Karl der Große Fränkischer König Karl der Große Römischer Kaiser Ludwig I., der Fromme Römischer Kaiser Lothar I. Mittelfränkischer
Eine dicke Münze: Der Grosso Gros Groot Groat Groschen
 Eine dicke Münze: Der Grosso Gros Groot Groat Groschen Weil der entwertete Denar oder Pfennig zu Beginn des 13. Jahrhunderts den Bedürfnissen der wachsenden Städte Oberitaliens nicht mehr genügte, prägten
Eine dicke Münze: Der Grosso Gros Groot Groat Groschen Weil der entwertete Denar oder Pfennig zu Beginn des 13. Jahrhunderts den Bedürfnissen der wachsenden Städte Oberitaliens nicht mehr genügte, prägten
Nikolaus Orlop. Alle Herrsc Bayerns. Herzöge, Kurfürsten, Könige - von Garibald I. bis Ludwig III. LangenMüller
 Nikolaus Orlop Alle Herrsc Bayerns Herzöge, Kurfürsten, Könige - von Garibald I. bis Ludwig III. LangenMüller Inhalt Vorwort zur ersten Auflage 11 Vorwort zur zweiten Auflage 13 Überblick über die bayerische
Nikolaus Orlop Alle Herrsc Bayerns Herzöge, Kurfürsten, Könige - von Garibald I. bis Ludwig III. LangenMüller Inhalt Vorwort zur ersten Auflage 11 Vorwort zur zweiten Auflage 13 Überblick über die bayerische
Das Reich Karls des Großen zerfällt
 THEMA Das Reich Karls des Großen zerfällt LERNZIELE Erkennen, dass das Reich Karls des Großen zunächst in drei Teile aufgeteilt wurde: Westfranken, Ostfranken und Lotharingien (Italien und Mittelreich).
THEMA Das Reich Karls des Großen zerfällt LERNZIELE Erkennen, dass das Reich Karls des Großen zunächst in drei Teile aufgeteilt wurde: Westfranken, Ostfranken und Lotharingien (Italien und Mittelreich).
DIE RÖMER 1. Das römische Reich wurde ca in Legionen unterteilt. 2 Das römische Heer war... hieß Vindobona. 4. Ein römischer Soldat musste...
 DIE RÖMER Das römische Reich wurde ca....... in Legionen unterteilt. Das römische Heer war...... hieß Vindobona. Ein römischer Soldat musste...... 00 v. Chr. gegründet. Das Lager an der Donau...... heißt
DIE RÖMER Das römische Reich wurde ca....... in Legionen unterteilt. Das römische Heer war...... hieß Vindobona. Ein römischer Soldat musste...... 00 v. Chr. gegründet. Das Lager an der Donau...... heißt
! # % &! # % ( ) +, ...,
 ! # % &! # % ( ) +,..., DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871 DEUTSCHES KAISERREICH 2129 Taler 1630. Madonna mit Zepter und Kind über Wappen / Kniebild des hl. Rudbertus mit Attributen über Wappen. Dav.3504; Probzst
! # % &! # % ( ) +,..., DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871 DEUTSCHES KAISERREICH 2129 Taler 1630. Madonna mit Zepter und Kind über Wappen / Kniebild des hl. Rudbertus mit Attributen über Wappen. Dav.3504; Probzst
Die Reise. in die. Baden-Württemberg 5/6 Differenzierende Ausgabe. Herausgegeben von Hans Ebeling und Prof. Dr. Wolfgang Birkenfeld
 Die Reise in die Vergangenheit Baden-Württemberg 5/6 Differenzierende Ausgabe Herausgegeben von Hans Ebeling und Prof. Dr. Wolfgang Birkenfeld Bearbeitet von: Katja Bienert, Andreas Bosch, Dieter Christoph,
Die Reise in die Vergangenheit Baden-Württemberg 5/6 Differenzierende Ausgabe Herausgegeben von Hans Ebeling und Prof. Dr. Wolfgang Birkenfeld Bearbeitet von: Katja Bienert, Andreas Bosch, Dieter Christoph,
DIE UMSATZSTEUER IHRE GESCHICHTE UND GEGENWARTIGE GESTALTUNG IM IN- UND AUSLAND. von PROFESSOR DR. DR. ROLF GRABOWER. Oberfinanzpräsident a. D.
 DIE UMSATZSTEUER IHRE GESCHICHTE UND GEGENWARTIGE GESTALTUNG IM IN- UND AUSLAND von PROFESSOR DR. DR. ROLF GRABOWER Oberfinanzpräsident a. D. DETLEF HERTING Oberfinanzpräsident a. D. Fachanwalt für Steuerrecfjt
DIE UMSATZSTEUER IHRE GESCHICHTE UND GEGENWARTIGE GESTALTUNG IM IN- UND AUSLAND von PROFESSOR DR. DR. ROLF GRABOWER Oberfinanzpräsident a. D. DETLEF HERTING Oberfinanzpräsident a. D. Fachanwalt für Steuerrecfjt
DOWNLOAD VORSCHAU. Europa: Ländersteckbriefe gestalten. zur Vollversion. Basiswissen Erdkunde einfach und klar. Jens Eggert
 DOWNLOAD Jens Eggert Europa: Ländersteckbriefe gestalten Basiswissen Erdkunde einfach und klar auszug aus dem Originaltitel: 32 Persen Verlag, Buxtehude 1. Fläche: Quadratkilometer Deutschland grenzt an
DOWNLOAD Jens Eggert Europa: Ländersteckbriefe gestalten Basiswissen Erdkunde einfach und klar auszug aus dem Originaltitel: 32 Persen Verlag, Buxtehude 1. Fläche: Quadratkilometer Deutschland grenzt an
www.tempelhofer-muenzenhaus.de 3
 www.tempelhofer-muenzenhaus.de 3 Fränkisches Reich Ludwig der Fromme 814 840 Karolinger 1 Denar, Melle 1,62 g Morrison/ Grunthal 398 var.... Sehr schön 150,- Karl der Kahle 840 877 2 Denar(ab 864), Blois
www.tempelhofer-muenzenhaus.de 3 Fränkisches Reich Ludwig der Fromme 814 840 Karolinger 1 Denar, Melle 1,62 g Morrison/ Grunthal 398 var.... Sehr schön 150,- Karl der Kahle 840 877 2 Denar(ab 864), Blois
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/
 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.
LANGE NACHT DER KIRCHEN Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt Rätselralley für Kinder (2014)
 Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
die Schlacht am Teutoburger Wald, in der die germanischen Verbände von dem cheruskischen Fürstensohn Hermann (wenn er denn so hieß in die deutschen
 die Schlacht am Teutoburger Wald, in der die germanischen Verbände von dem cheruskischen Fürstensohn Hermann (wenn er denn so hieß in die deutschen Sagen hat er als Siegfried Einzug gehalten) befehligt
die Schlacht am Teutoburger Wald, in der die germanischen Verbände von dem cheruskischen Fürstensohn Hermann (wenn er denn so hieß in die deutschen Sagen hat er als Siegfried Einzug gehalten) befehligt
Im Original veränderbare Word-Dateien
 Der Anfang deutscher Geschichte Q1 Kaisersiegel Ottos I: Otto mit Krone, Zepter und Reichsapfel Q2 Kaisersiegel Ottos II.: Otto hält einen Globus in der Hand. Aufgabe 1 Q3 Kaiser Otto III. mit Reichsapfel
Der Anfang deutscher Geschichte Q1 Kaisersiegel Ottos I: Otto mit Krone, Zepter und Reichsapfel Q2 Kaisersiegel Ottos II.: Otto hält einen Globus in der Hand. Aufgabe 1 Q3 Kaiser Otto III. mit Reichsapfel
Das Modell der Gewaltenteilung nach Montesquieu
 Politik Michael Brandl Das Modell der Gewaltenteilung nach Montesquieu Studienarbeit 1.) Einleitung... 2 2.) Biographie... 2 3.) Das Englandkapitel in Vom Geist der Gesetze... 3 3.1.) Allgemeines... 3
Politik Michael Brandl Das Modell der Gewaltenteilung nach Montesquieu Studienarbeit 1.) Einleitung... 2 2.) Biographie... 2 3.) Das Englandkapitel in Vom Geist der Gesetze... 3 3.1.) Allgemeines... 3
BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
 P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1989 Ausgegeben am 22. September 1989 186. Stück 455. Beschluß Nr. 2/89 des Gemischten Ausschusses
P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1989 Ausgegeben am 22. September 1989 186. Stück 455. Beschluß Nr. 2/89 des Gemischten Ausschusses
Einführung und Überblick. Prof. Dr. Thomas Rüfner. Materialien im Internet:
 Privatrechtgeschichte der Neuzeit Vorlesung am 09.04.2008 Einführung und Überblick Prof. Dr. Thomas Rüfner Materialien im Internet: http://ius-romanum.uni-trier.de/index.php?id=20787 Die geschichtliche
Privatrechtgeschichte der Neuzeit Vorlesung am 09.04.2008 Einführung und Überblick Prof. Dr. Thomas Rüfner Materialien im Internet: http://ius-romanum.uni-trier.de/index.php?id=20787 Die geschichtliche
Vertretungsaufgaben in der Jahrgangsstufe 6 im Fach Geschichte
 Vertretungsaufgaben in der Jahrgangsstufe 6 im Fach Geschichte Obligatorik: Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein Westfalen (2007) Von dem Beginn der Menschheit bis zum Mittelalter
Vertretungsaufgaben in der Jahrgangsstufe 6 im Fach Geschichte Obligatorik: Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein Westfalen (2007) Von dem Beginn der Menschheit bis zum Mittelalter
2. Reformation und Dreißigjähriger Krieg
 THEMA 2 Reformation und Dreißigjähriger Krieg 24 Die Ausbreitung der Reformation LERNZIELE Voraussetzung der Ausbreitung der Reformation kennenlernen Die entstehende Glaubensspaltung in Deutschland anhand
THEMA 2 Reformation und Dreißigjähriger Krieg 24 Die Ausbreitung der Reformation LERNZIELE Voraussetzung der Ausbreitung der Reformation kennenlernen Die entstehende Glaubensspaltung in Deutschland anhand
Bis vor kurzem hieß unser Geld ja noch D-Mark. Zwei Mark sind etwas mehr wert als ein Euro. Und ein Cent ist in etwa so viel wert wie zwei Pfennige.
 Das Geld Das Geld Das ist jetzt unser Geld: Der Euro. Euro-Münzen gibt es im Wert von 1 Euro oder 2 Euro. Und dann gibt es noch den Cent: 100 Cent sind 1 Euro. Cent-Münzen gibt es im Wert von 1 Cent, 2
Das Geld Das Geld Das ist jetzt unser Geld: Der Euro. Euro-Münzen gibt es im Wert von 1 Euro oder 2 Euro. Und dann gibt es noch den Cent: 100 Cent sind 1 Euro. Cent-Münzen gibt es im Wert von 1 Cent, 2
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die 16 Bundesländer. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
DOWNLOAD. Basiswissen Erdkunde einfach und klar. Jens Eggert Europa: Ländersteckbriefe gestalten. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Jens Eggert Europa: Ländersteckbriefe gestalten Basiswissen Erdkunde einfach und klar auszug aus dem Originaltitel: Name: Ländersteckbrief Deutschland 28a. Fläche: Quadratkilometer Deutschland
DOWNLOAD Jens Eggert Europa: Ländersteckbriefe gestalten Basiswissen Erdkunde einfach und klar auszug aus dem Originaltitel: Name: Ländersteckbrief Deutschland 28a. Fläche: Quadratkilometer Deutschland
Albert Hourani DIE GESCHICHTE DER ARABISCHEN VÖLKER
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Albert Hourani DIE GESCHICHTE DER ARABISCHEN VÖLKER S.Fischer INHALT
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Albert Hourani DIE GESCHICHTE DER ARABISCHEN VÖLKER S.Fischer INHALT
Zum Archivale der Vormonate bitte scrollen!
 Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden. A Mönch C Nonne D Augustiner-Orden
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
AUSLÄNDISCHE MÜNZEN & MEDAILLEN
 127 Peru Republik seit 1822 2636 8 Escudos 1863, Lima. GOLD. (23,63g FEIN). KM 183. Fb. 68....Sehr schön* 900,- 2637 Sol 1870 YJ. KM 196.3... Sehr schön+ 24,- 2638 Peseta 1880; 5 Peseten 1880; 1/5 Sol
127 Peru Republik seit 1822 2636 8 Escudos 1863, Lima. GOLD. (23,63g FEIN). KM 183. Fb. 68....Sehr schön* 900,- 2637 Sol 1870 YJ. KM 196.3... Sehr schön+ 24,- 2638 Peseta 1880; 5 Peseten 1880; 1/5 Sol
Ein Referat von: Christina Schmidt Klasse:7a Schule: SGO Fach: Geschichte Thema: Hundertjähriger Krieg England gegen Frankreich Koordination: Der
 Ein Referat von: Christina Schmidt Klasse:7a Schule: SGO Fach: Geschichte Thema: Hundertjähriger Krieg England gegen Frankreich Koordination: Der Konflikt zwischen England und Frankreich INHALT 1. Warum
Ein Referat von: Christina Schmidt Klasse:7a Schule: SGO Fach: Geschichte Thema: Hundertjähriger Krieg England gegen Frankreich Koordination: Der Konflikt zwischen England und Frankreich INHALT 1. Warum
VORANSICHT. Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg
 Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Sonnenkönig Ludwig XIV. und der Absolutismus - Regieren zwischen Ehrgeiz, Macht und Prunksucht Das komplette Material finden Sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Sonnenkönig Ludwig XIV. und der Absolutismus - Regieren zwischen Ehrgeiz, Macht und Prunksucht Das komplette Material finden Sie
Entwicklung der Studierendenzahlen seit dem Wintersemester 1993/94
 Entwicklung der Studierendenzahlen seit dem Wintersemester 1993/94 35000 30000 25000 20000 17462 18558 19876 21137 22833 23812 24485 25454 26553 27997 30170 31021 31173 29668 29021 28098 28596 28333 28125
Entwicklung der Studierendenzahlen seit dem Wintersemester 1993/94 35000 30000 25000 20000 17462 18558 19876 21137 22833 23812 24485 25454 26553 27997 30170 31021 31173 29668 29021 28098 28596 28333 28125
Englands Münzgeschichte weg vom Kontinent, hin zur Isolation?
 Englands Münzgeschichte weg vom Kontinent, hin zur Isolation? England frönte seiner Splendid Isolation nicht seit jeher und gab einst viel dafür, auch ein Stück Europa zu bekommen. Das zeigt schon die
Englands Münzgeschichte weg vom Kontinent, hin zur Isolation? England frönte seiner Splendid Isolation nicht seit jeher und gab einst viel dafür, auch ein Stück Europa zu bekommen. Das zeigt schon die
La Tßractka fcfta Catnßicrtura"
 La Tßractka fcfta Catnßicrtura" Europäischer Zahlungsverkehr vom 14. bis zum 17. Jahrhundert Von Markus A. Denzel 1994 In Kommission bei Franz Steiner Verlag Stuttgart INHALTSVERZEICHNIS Zum Geleit Vorwort
La Tßractka fcfta Catnßicrtura" Europäischer Zahlungsverkehr vom 14. bis zum 17. Jahrhundert Von Markus A. Denzel 1994 In Kommission bei Franz Steiner Verlag Stuttgart INHALTSVERZEICHNIS Zum Geleit Vorwort
Die Ur- und Frühgeschichte Ein Überblick 22
 Inhalt Geschichte 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan 12 Geschichte und Zeit 14 Aus der eigenen Geschichte 16 Geschichtswissenschaftler Kriminalkommissare, die in der Vergangenheit ermitteln? 17 Spuren
Inhalt Geschichte 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan 12 Geschichte und Zeit 14 Aus der eigenen Geschichte 16 Geschichtswissenschaftler Kriminalkommissare, die in der Vergangenheit ermitteln? 17 Spuren
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Care-Paket Vor- und Frühgeschichte. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Care-Paket Vor- und Frühgeschichte Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Vor- und Frühgeschichte Arbeitsblätter
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Care-Paket Vor- und Frühgeschichte Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Vor- und Frühgeschichte Arbeitsblätter
D A S N O M E N (Ü B U N G E N 2)
 D A S N O M E N (Ü B U N G E N 2) 1 Ü B U N G 1: Achte jeweils auf die Form des Artikels und trage in die Klammer den richtigen Fall ein. Benütze folgende Abkürzungen: Nominativ = Nom, Genitiv = Gen, Dativ
D A S N O M E N (Ü B U N G E N 2) 1 Ü B U N G 1: Achte jeweils auf die Form des Artikels und trage in die Klammer den richtigen Fall ein. Benütze folgende Abkürzungen: Nominativ = Nom, Genitiv = Gen, Dativ
Inhalt. Vorwort 4 Didaktische Überlegungen 5
 Inhalt Vorwort 4 Didaktische Überlegungen 5 1. Beginn der Neuzeit 6 2. Christoph Kolumbus 7 3. Buchdruck mit beweglichen Lettern 8 4. Die erste Weltumsegelung 9 5. Cortez erobert Mexiko 10 6. Die Schätze
Inhalt Vorwort 4 Didaktische Überlegungen 5 1. Beginn der Neuzeit 6 2. Christoph Kolumbus 7 3. Buchdruck mit beweglichen Lettern 8 4. Die erste Weltumsegelung 9 5. Cortez erobert Mexiko 10 6. Die Schätze
Die Heilig-Blut-Legende
 Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Download Ursula Lassert
 Download Ursula Lassert Damals bei den Römern: Zeitleiste Schwerpunkt Römisches Reich Grundschule Ursula Lassert Damals bei den Römern Die sach- und kindgerechte Kopiervorlagensammlung für die 3./ 4. Klasse
Download Ursula Lassert Damals bei den Römern: Zeitleiste Schwerpunkt Römisches Reich Grundschule Ursula Lassert Damals bei den Römern Die sach- und kindgerechte Kopiervorlagensammlung für die 3./ 4. Klasse
Download. Damals bei den Römern: Zeitleiste. Damals bei den Römern. Schwerpunkt Römisches Reich. Ursula Lassert. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 Download Ursula Lassert Damals bei den Römern: Zeitleiste Schwerpunkt Römisches Reich Damals bei den Römern Die sach- und kindgerechte Kopiervorlagensammlung für die 3./ 4. Klasse Grundschule Ursula Lassert
Download Ursula Lassert Damals bei den Römern: Zeitleiste Schwerpunkt Römisches Reich Damals bei den Römern Die sach- und kindgerechte Kopiervorlagensammlung für die 3./ 4. Klasse Grundschule Ursula Lassert
Einladung. Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 Postfach 384 9490 Vaduz Liechtenstein
 1962 11.08 Die liechtensteinischen Gold- und Silbermünzen von 1862 bis 2006. Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 Postfach 384 9490 Vaduz Liechtenstein Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22
1962 11.08 Die liechtensteinischen Gold- und Silbermünzen von 1862 bis 2006. Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 Postfach 384 9490 Vaduz Liechtenstein Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22
Block III. Kapitel II. Das Mittelalter (II)
 Block III Kapitel II Das Mittelalter (II) Inhaltsverzeichnis Abschnitt 2 Das Heilige Römische Reich deutscher Nation Abschnitt 3 Die mittelalterliche deutsche Gesellschaft Abschnitt 3 Die mittelalterliche
Block III Kapitel II Das Mittelalter (II) Inhaltsverzeichnis Abschnitt 2 Das Heilige Römische Reich deutscher Nation Abschnitt 3 Die mittelalterliche deutsche Gesellschaft Abschnitt 3 Die mittelalterliche
Gold für einen zu wenig bekannten großen Mediziner Österreichs
 Veröffentlichung: 14.12.2010 15:03 Verkauf der Pummerin - aber nur als Silbermünze Veröffentlichung: 08.11.2010 15:50 Maria Theresia und die magische Stephanskrone Veröffentlichung: 14.10.2010 09:14 Mitteilung
Veröffentlichung: 14.12.2010 15:03 Verkauf der Pummerin - aber nur als Silbermünze Veröffentlichung: 08.11.2010 15:50 Maria Theresia und die magische Stephanskrone Veröffentlichung: 14.10.2010 09:14 Mitteilung
Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig
 Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
de
 Münzhandlung Ritter GmbH Immermannstrasse 19 40210 Düsseldorf Deutschland / Germany Tresor 2013-01 Deutsche Münzen Tel: +49 / (0) 211 / 36 78 00 Fax: +49 / (0) 211 / 36 780 25 Email: info@muenzen-ritter.
Münzhandlung Ritter GmbH Immermannstrasse 19 40210 Düsseldorf Deutschland / Germany Tresor 2013-01 Deutsche Münzen Tel: +49 / (0) 211 / 36 78 00 Fax: +49 / (0) 211 / 36 780 25 Email: info@muenzen-ritter.
ÜBUNG 1 WOHER? ÜBUNG 2 WOHIN?
 ÜBUNG 1 WOHER? Woher kommen Sie? Ich komme aus Dänemark. Ich komme aus Dänemark Aus der Türkei. Aus der Türkei. 1. Woher kommen Sie?... + Ich komme aus Dänemark....... + Aus der Türkei.... 2. Woher kommen
ÜBUNG 1 WOHER? Woher kommen Sie? Ich komme aus Dänemark. Ich komme aus Dänemark Aus der Türkei. Aus der Türkei. 1. Woher kommen Sie?... + Ich komme aus Dänemark....... + Aus der Türkei.... 2. Woher kommen
Die Habsburger eine Dynastie prägt 650 Jahre europäische Geschichte
 Die Habsburger eine Dynastie prägt 650 Jahre europäische Geschichte Das Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 Kapitel 1 Die Herkunft Feudalherrschaften um 1200 Ursprünge 11. Jh. Havechtsberch (= Habichtsberg)
Die Habsburger eine Dynastie prägt 650 Jahre europäische Geschichte Das Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 Kapitel 1 Die Herkunft Feudalherrschaften um 1200 Ursprünge 11. Jh. Havechtsberch (= Habichtsberg)
20 Die deutsche Sprache in Raum und Zeit
 melbezeichnung für verwandte und ähnliche Dialekte als für eine einheitliche Sprache. In der althochdeutschen Zeit entstand etwas für die deutsche Sprachgeschichte bahnbrechend Neues, denn zum ersten Mal
melbezeichnung für verwandte und ähnliche Dialekte als für eine einheitliche Sprache. In der althochdeutschen Zeit entstand etwas für die deutsche Sprachgeschichte bahnbrechend Neues, denn zum ersten Mal
Brakteaten die dünnsten Münzen der Geldgeschichte
 Brakteaten die dünnsten Münzen der Geldgeschichte Brakteaten waren zweifellos die eigenartigste und interessanteste Erscheinung im Münzwesen des deutschen Mittelalters. Während herkömmliche Pfennige auf
Brakteaten die dünnsten Münzen der Geldgeschichte Brakteaten waren zweifellos die eigenartigste und interessanteste Erscheinung im Münzwesen des deutschen Mittelalters. Während herkömmliche Pfennige auf
Stammbaum der Landgrafen von Leuchtenberg /1634
 Stammbaum der Landgrafen von Leuchtenberg 1180 1586/1634 Kerngebiet der Leuchtenberger an der Naab zwischen Pfreimd und Weiden i.d.opf. im Jahr 1646 Das Hl. Römische Reich in seinen Gliedern. Links: 2.
Stammbaum der Landgrafen von Leuchtenberg 1180 1586/1634 Kerngebiet der Leuchtenberger an der Naab zwischen Pfreimd und Weiden i.d.opf. im Jahr 1646 Das Hl. Römische Reich in seinen Gliedern. Links: 2.
Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur. Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg
 Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
VORANSICHT. Alexander der Große strahlender Held oder gnadenloser Eroberer? Das Wichtigste auf einen Blick. Andreas Hammer, Hennef
 Antike Beitrag 8 Alexander der Große (Klasse 6) 1 von 24 Alexander der Große strahlender Held oder gnadenloser Eroberer? Andreas Hammer, Hennef m Alexander III. von Makedonien ranken Usich zahlreiche Mythen.
Antike Beitrag 8 Alexander der Große (Klasse 6) 1 von 24 Alexander der Große strahlender Held oder gnadenloser Eroberer? Andreas Hammer, Hennef m Alexander III. von Makedonien ranken Usich zahlreiche Mythen.
IV. Papsttum und Kirche im Zeitalter der Karolinger und Ottonen
 IV. Papsttum und Kirche im Zeitalter der Karolinger und Ottonen 1. Das päpstlich-karolingische Bündnis im 8. und 9. Jahrhundert 2. Römische Reliquien und päpstliche Politik 3. Papsttum und Ottonen Wiederholung
IV. Papsttum und Kirche im Zeitalter der Karolinger und Ottonen 1. Das päpstlich-karolingische Bündnis im 8. und 9. Jahrhundert 2. Römische Reliquien und päpstliche Politik 3. Papsttum und Ottonen Wiederholung
Bayerns Könige privat
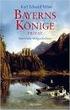 Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Chinesische Silberbarren
 Chinesische barren Ein wesentliches Merkmal der chinesischen Geldgeschichte ist das fast völlige Fehlen von Münzen aus Edelmetallen, sei es aus Gold oder. Über 2000 Jahren beherrschten hier Kupfermünzen
Chinesische barren Ein wesentliches Merkmal der chinesischen Geldgeschichte ist das fast völlige Fehlen von Münzen aus Edelmetallen, sei es aus Gold oder. Über 2000 Jahren beherrschten hier Kupfermünzen
Größte Mächte und Reiche
 Liste historischer Großmächte Jahrhundert Vor 10. Jahrhundert v. Chr. Größte Mächte und Reiche 10. Jahrhundert v. Chr. Assyrien, Elam 9. Jahrhundert v. Chr. Assyrien, Elam 8. Jahrhundert v. Chr. Assyrien,
Liste historischer Großmächte Jahrhundert Vor 10. Jahrhundert v. Chr. Größte Mächte und Reiche 10. Jahrhundert v. Chr. Assyrien, Elam 9. Jahrhundert v. Chr. Assyrien, Elam 8. Jahrhundert v. Chr. Assyrien,
Edelmetallschalterkurse
 Goldmünzen aus aller Welt Platin/USD 926,40 927,10 g % Australien 1 Kg Känguru/Nugget 3000 $ 1000,00 36,81 0 35.340,00 36.810,00 10 Oz Känguru/Nugget 1000 $ 311,00 37,54 0 10.960,00 11.675,00 2 Oz Känguru/Nugget
Goldmünzen aus aller Welt Platin/USD 926,40 927,10 g % Australien 1 Kg Känguru/Nugget 3000 $ 1000,00 36,81 0 35.340,00 36.810,00 10 Oz Känguru/Nugget 1000 $ 311,00 37,54 0 10.960,00 11.675,00 2 Oz Känguru/Nugget
Inhaltsverzeichnis. Geschichte und Gegenwart 10. Unseren Vorfahren auf der Spur 28. Die ersten Spuren der Menschheit 32
 Inhaltsverzeichnis Geschichte und Gegenwart 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan Geschichte 12 Geschichte und ihre Epochen Eine Reise auf der Zeitleiste 14 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte
Inhaltsverzeichnis Geschichte und Gegenwart 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan Geschichte 12 Geschichte und ihre Epochen Eine Reise auf der Zeitleiste 14 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte
Edelmetallschalterkurse
 Goldmünzen aus aller Welt Platin/USD 961,60 962,40 g % Australien 1 Kg Känguru/Nugget 3000 $ 1000,00 37,15 0 35.660,00 37.150,00 10 Oz Känguru/Nugget 1000 $ 311,00 37,89 0 11.065,00 11.785,00 2 Oz Känguru/Nugget
Goldmünzen aus aller Welt Platin/USD 961,60 962,40 g % Australien 1 Kg Känguru/Nugget 3000 $ 1000,00 37,15 0 35.660,00 37.150,00 10 Oz Känguru/Nugget 1000 $ 311,00 37,89 0 11.065,00 11.785,00 2 Oz Känguru/Nugget
Edelmetallschalterkurse
 Goldmünzen aus aller Welt Platin/USD 971,49 979,00 g % Australien 1 Kg Känguru/Nugget 3000 $ 1000,00 37,42 0 35.890,00 37.420,00 10 Oz Känguru/Nugget 1000 $ 311,00 38,17 0 11.135,00 11.870,00 2 Oz Känguru/Nugget
Goldmünzen aus aller Welt Platin/USD 971,49 979,00 g % Australien 1 Kg Känguru/Nugget 3000 $ 1000,00 37,42 0 35.890,00 37.420,00 10 Oz Känguru/Nugget 1000 $ 311,00 38,17 0 11.135,00 11.870,00 2 Oz Känguru/Nugget
Österreichische Geschichte von den Anfängen bis ca Peter Rauscher Sommersemester 2015
 Österreichische Geschichte von den Anfängen bis ca. 1815 Peter Rauscher Sommersemester 2015 4. Länder und Landesherrschaft im Hoch und Spätmittelalter Was ist ein Land? Otto Brunner: Rechts und Friedensgemeinschaft
Österreichische Geschichte von den Anfängen bis ca. 1815 Peter Rauscher Sommersemester 2015 4. Länder und Landesherrschaft im Hoch und Spätmittelalter Was ist ein Land? Otto Brunner: Rechts und Friedensgemeinschaft
Deutsche Biographie Onlinefassung
 Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Meuting (Meitting, Mütting) Augsburger Kaufmannsfamilie. Leben Die M., die aus dem niederen Landadel stammten und Anfang des 14. Jh. in Augsburg eingewandert
Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Meuting (Meitting, Mütting) Augsburger Kaufmannsfamilie. Leben Die M., die aus dem niederen Landadel stammten und Anfang des 14. Jh. in Augsburg eingewandert
Roms Frühzeit und die frühe Republik
 Die Römische Antike Roms Frühzeit und die frühe Republik Um 800 v. Chr. Ansiedlung der Etrusker in Mittelitalien Gründung Roms bereits vor 753 v.chr. etruskische Könige bis Ende des 6. Jh. v. Chr. seit
Die Römische Antike Roms Frühzeit und die frühe Republik Um 800 v. Chr. Ansiedlung der Etrusker in Mittelitalien Gründung Roms bereits vor 753 v.chr. etruskische Könige bis Ende des 6. Jh. v. Chr. seit
213. DAWO-Auktion. Katalogteil: Münzen (Kat-Nr. 218-229)
 213. DAWO-Auktion 21.9. - 24.9.2016 Katalogteil: Münzen (Kat-Nr. 218-229) -maschinell erstellter Katalog (einer Kategorie) mit vereinfachtem Satz und standardisiertem Bildformat- Den vollständigen Katalog
213. DAWO-Auktion 21.9. - 24.9.2016 Katalogteil: Münzen (Kat-Nr. 218-229) -maschinell erstellter Katalog (einer Kategorie) mit vereinfachtem Satz und standardisiertem Bildformat- Den vollständigen Katalog
Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst
 1 Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Text einblenden) 29 Am nächsten Tag sieht
1 Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Text einblenden) 29 Am nächsten Tag sieht
Begriff der Klassik. classicus = röm. Bürger höherer Steuerklasse. scriptor classicus = Schriftsteller 1. Ranges
 Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
! # %! # & ( ( ) ( + ,,,+ ( +
 ! # %! # & ( ( ) ( +,,,+ ( + Belgien AG 18917 AG 19015 Griechenland AG 19013 12194 Deutschland Frankreich AG 18935 AG 19075 Finnland EURO-KURSMÜNZENSÄTZE UND GEDENKMÜNZEN Sollten Sie von Ihnen gesuchte
! # %! # & ( ( ) ( +,,,+ ( + Belgien AG 18917 AG 19015 Griechenland AG 19013 12194 Deutschland Frankreich AG 18935 AG 19075 Finnland EURO-KURSMÜNZENSÄTZE UND GEDENKMÜNZEN Sollten Sie von Ihnen gesuchte
R E I C H S M Ü N Z E N. Reichsmünzen GOLD
 95 Reichsmünzen GOLD Preussen, Königreich Friedrich III. 1888 1004 248 20 Mark 1888... Vorzüglich prägefrisch* 250,- Wilhelm II. 1888 1918 1005 250 20 Mark 1889...Sehr schön* 230,- 1006 253 20 Mark 1914...
95 Reichsmünzen GOLD Preussen, Königreich Friedrich III. 1888 1004 248 20 Mark 1888... Vorzüglich prägefrisch* 250,- Wilhelm II. 1888 1918 1005 250 20 Mark 1889...Sehr schön* 230,- 1006 253 20 Mark 1914...
Geschichte Österreichs
 Ländergeschichten Geschichte Österreichs Bearbeitet von Alois Niederstätter 1. Auflage 2007. Buch. 300 S. Hardcover ISBN 978 3 17 019193 8 Format (B x L): 14,2 x 21,5 cm Gewicht: 440 g Weitere Fachgebiete
Ländergeschichten Geschichte Österreichs Bearbeitet von Alois Niederstätter 1. Auflage 2007. Buch. 300 S. Hardcover ISBN 978 3 17 019193 8 Format (B x L): 14,2 x 21,5 cm Gewicht: 440 g Weitere Fachgebiete
- Durch die Magna Charta Libertatum, ein Mitspracherecht, das bereits seit dem Mittelalter existiert.
 A1: Der Lückentext informiert über das englische Parlament. Setze die Wörter richtig ein: Magna Charta Libertatum, Abgeordnete, Bürgertum, Einkommen, Lords, Männer. Das Parlament bestand aus dem Oberhaus
A1: Der Lückentext informiert über das englische Parlament. Setze die Wörter richtig ein: Magna Charta Libertatum, Abgeordnete, Bürgertum, Einkommen, Lords, Männer. Das Parlament bestand aus dem Oberhaus
Christentum, Judentum Hinduismus, Islam
 Christentum, Judentum Hinduismus, Islam Christentum Judentum Das Christentum ist vor ca. 2000 Jahren durch Jesus Christus aus dem Judentum entstanden. Jesus war zuerst Jude. Das Judentum ist die älteste
Christentum, Judentum Hinduismus, Islam Christentum Judentum Das Christentum ist vor ca. 2000 Jahren durch Jesus Christus aus dem Judentum entstanden. Jesus war zuerst Jude. Das Judentum ist die älteste
ZENTRALE KLASSENARBEIT 2009 SEKUNDARSCHULE. Deutsch. Schuljahrgang 6
 ZENTRALE KLASSENARBEIT 2009 5 SEKUNDARSCHULE Deutsch Schuljahrgang 6 10 Arbeitszeit: 45 Minuten 15 20 25 Name, Vorname: 30 Klasse: Seite 1 von 5 Lies den Text gründlich! Bearbeite anschließend alle Aufgaben
ZENTRALE KLASSENARBEIT 2009 5 SEKUNDARSCHULE Deutsch Schuljahrgang 6 10 Arbeitszeit: 45 Minuten 15 20 25 Name, Vorname: 30 Klasse: Seite 1 von 5 Lies den Text gründlich! Bearbeite anschließend alle Aufgaben
Das älteste Währungssystem der Welt
 Das älteste Währungssystem der Welt Es ist für uns heute selbstverständlich, dass der Schweizer Franken in 100 Rappen unterteilt ist und dass wir einen bestimmten Geldbetrag mit verschiedenen Münzeinheiten
Das älteste Währungssystem der Welt Es ist für uns heute selbstverständlich, dass der Schweizer Franken in 100 Rappen unterteilt ist und dass wir einen bestimmten Geldbetrag mit verschiedenen Münzeinheiten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter - Das Leben von Bauern, Adel und Klerus kennen lernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter - Das Leben von Bauern, Adel und Klerus kennen lernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz
 Karl Erhard Schuhmacher Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz Lebensbilder aus dem Hochmittelalter verlag regionalkultur Inhaltsverzeichnis Einleitung... 6 Mathilde von England: Kaiserin
Karl Erhard Schuhmacher Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz Lebensbilder aus dem Hochmittelalter verlag regionalkultur Inhaltsverzeichnis Einleitung... 6 Mathilde von England: Kaiserin
Jahresplan Geschichte Realschule Klasse 6 mit zeitreise 1
 Jahresplan Geschichte Realschule Klasse 6 mit zeitreise Inhalt Zeitreise Methoden, Projekte, Wiederholung Stundenzahl Bildungsstandards Geschichte Klasse 6 Arbeitsbegriffe Das Fach Geschichte Aufgaben
Jahresplan Geschichte Realschule Klasse 6 mit zeitreise Inhalt Zeitreise Methoden, Projekte, Wiederholung Stundenzahl Bildungsstandards Geschichte Klasse 6 Arbeitsbegriffe Das Fach Geschichte Aufgaben
Voransicht. Karl der Große Vater Europas? Das Wichtigste auf einen Blick. Stefanie Schwinger, Bühl
 Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse 6) 1 von 18 Karl der Große Vater Europas? Stefanie Schwinger, Bühl arl der Große ist die wohl bekannteste KHerrscherpersönlichkeit des Mittelalters. Wer war
Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse 6) 1 von 18 Karl der Große Vater Europas? Stefanie Schwinger, Bühl arl der Große ist die wohl bekannteste KHerrscherpersönlichkeit des Mittelalters. Wer war
