|
|
|
- Angelika Böhler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Historische Windkraftanlagen in Lippe Eine jede Maschine zur Erleichterung und Verkürzung ist ein Beitrag zum Menschenwohl. Derjenige, der daran zweifelt, müßte auch alle zeitherigen Maschinen verwünschen und vertilgen. Was sind Pflüge, Ackergeräthe, Fabriken und Mühlen anders als Maschinen? Heinrich Ernst, Mühlenbauer. 1 Einführung Wenn sich unter einem geschätzten Bestand von etwa 350 bis 400 Mühlenstandorten in Lippe lediglich 13 Windmühlenstandorte finden, kann ohne Übertreibung den lippischen Windmühlen ein marginaler Status zugesprochen werden. Gleichwohl haben diese riesigen, weithin sichtbaren Maschinen, ganz unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, einen dorf- und landschaftsbildprägenden Einfluß ausgeübt und üben ihn teilweise immer noch aus. Erwähnt seien die Windmühle Brink am Dorfrand von Bentorf, der sogenannte Kump oberhalb von Oerlinghausen oder aber die weithin sichtbare Windmühle oberhalb von Bavenhausen. Sie gelten, wie die Bavenhauser Windmühle, als Wahrzeichen oder haben es, wie der Oerlinghauser Kump, bis in das Gemeindewappen geschafft. 2 Dabei war etwa der Oerlinghauser Windmühlenstandort, im Vergleich zu anderen Windmühlenstandorten oder ganz zu schweigen zu einer großen Anzahl von lippischen Wassermühlen, völlig unbedeutend. Lippe war eine Region der Wassermühlen. Diese waren gewöhnlich in unspektakulären Gebäuden untergebracht, lagen in großer Zahl entlang der Bachtäler oder inmitten der Dörfer und Städte, wo sie sich in Landschaft und Siedlung unauffällig einfügten. Soweit feststellbar, ist der erste Windmühlenstandort im Jahre 1615 auf dem Windberg bei Lüdenhausen gegründet worden. Die letzten Neugründungen, die Windmühle Brink in Bentorf und die Windmühle in Oberwüsten, geschahen Ende des 19. Jh. 3 Betrachten wir die Verteilung der Standortgründungen über diesen Zeitraum von etwa 280 Jahren zwischen 1615 und Ende des 19. Jh., dann stellen wir fest, dass erst in der zweite Hälfte des 19. Jh. das Gros an Standortneugründungen erfolgte. Aber auch diese Zahl ist unbedeutend gegenüber der Anzahl der zeitgleich erfolgten Standortneugründungen von Wassermühlen. Natürliche Standortbedingungen Windmühlen benötigen, um wirtschaftlich betrieben werden zu können, einen gleichmäßig wehenden, möglichst wenig die Richtung wechselnden Wind. Diese natürlichen Voraussetzungen finden sich besonders in Ebenen und in der Nähe großer Gewässer. Die Morphologie der lippischen Naturräume, die durch den raschen Wechsel von Anhöhen, Bergen und Tälern, mit einer zuweilen hohen Reliefenergie, gekennzeichnet ist, bietet nur wenige geeignete Standorte zum Betrieb von Windmühlen. Einigermaßen günstige natürliche Bedingungen bietet lediglich das Flachhügelland westlich des Lipper Berglandes. Hier finden sich vier Windmühlenstandorte (A 7/ A 9/ A 10/ A 11) 4, die aber erst im 19. Jh. zwischen den Jahren 1851 bis 1870 gegründet worden sind. Günstige naturräumliche Standortbedingungen scheiden deshalb weitgehend als Anreiz zum Betrieb von Windmühlen in Lippe aus. Die weiteren Windmühlenstandorte, insbesondere auch die älteste Bestandschicht (A 1/ A 2/ A 3), verteilen sich auf die ungünstigeren Naturräume westliches Lipper Bergland (A 1/ A 8/ A 12/ A 13), östliches Lipper Bergland (A 3/ A 4), südliches Lipper Bergland (A 6) und Osning (A 2/ A 5). Exemplarisch verdeutlicht die Geschichte der Windmühle Lüdenhausen wie negativ sich ein ungünstiger Standort auswirken konnte. Zwischen den Jahren von 1615 bis 1838 sind auf dem Windberg fünf Windmühlenneugründungen erforderlich 1 Ernst Heil 1993a, ohne Seite. 3 Heil 1993b, Seite Die Signaturen beziehen sich auf die weiter unten im Text befindliche Bestandsaufnahme der lippischen Windkraftanlagen.
2 gewesen. Im Jahre 1822 schrieb der zeitige Pächter Johan Christian Keßler, auf dem Windberg herrschten mangelnde Winde, die zudem häufig die Richtung wechselten. 5 Diese Windverhältnisse auf dem 250 m hohen, exponiert liegenden Windberg verhinderten einen kontinuierlichen Betrieb der Mühle und somit eine wirtschaftliche Betriebsführung. Während der langen Betriebszeit des Windmühlenstandortes vom Jahr 1615 bis zum Jahr 1909 erfahren wir häufig von Sturmschäden, die bis zu Totalschäden führten und immer wieder von ruinierten Pächtern, von denen einige sich in ihrer ökonomischen Not heimlich bei Nacht davonmachen mußten. Insgesamt 36 Pächter versuchten, beinahe durchweg erfolglos, auf dem Windberg ihr Auskommen zu finden. 6 Zeit ihres Bestehens wurden Pläne erwogen die Lüdenhauser Windmühle durch eine Wassermühle zu ersetzen. Im Jahre 1909 wurde sie schließlich nach einem Brand durch eine im Dorf Lüdenhausen angelegte Motormühle ersetzt. Eine andere natürliche Gegebenheit erzwang dagegen den Betrieb von Windmühlen, nämlich der Mangel an Betriebswasser oder gar dessen gänzliches Fehlen zum Antrieb von Wassermühlen. Diesem Umstand verdankte die Lüdenhauser Windmühle ihre Existenz. Ihre Gründung war Folge der Aufgabe des Wassermühlenstandortes Hüttenhau, der wegen chronischen Wassermangels erfolgte. 7 Die neue Windmühle ersparte den Mahlgenossen den weiten Mühlenweg nach Göstrup oder Hillentrup. Nach dem Totalverlust der ersten Lüdenhauser Windmühle durch einen Brand ist diese nicht sofort wieder aufgebaut worden, sondern als Substitut in Lüdenhausen in den Jahren 1666/1667 eine Wassermühle an der Osterkalle erbaut worden musste auch sie ihren Betrieb wegen chronischen Wassermangels wieder einstellen. 8 Erst nach dem Scheitern dieses Versuches ist auf dem Windberg notgedrungen die zweite Windmühle errichtet worden. Die Windmühlen Dahlhausen (A 9), Saalberg (A 3) und Ahmsen (A 10) waren sogenannte Ausgleichsmühlen, die bei akuten oder chronischen Wassermangel ihnen zugehörige Wassermühlen unterstützten. Die Windmühle Dahlhausen ergänzte die herrschaftliche Dahlhauser Wassermühle, die unter Wassermangel litt 9. Gleiches gilt für die Ahmser Windmühle, die die wasserarme Ahmser Wassermühle unterstützte. 10 Die herrschaftliche Windmühle auf dem Saalberg diente vermutlich von Beginn an als Ausgleichsmühle für die herrschaftliche Deichmühle bei Barntrup. Nach ihrem Verkauf 1731 an die von Kerßenbruch in Barntrup diente sie offensichtlich der Kerssenbruchschen Wassermühle Wierborn als Ausgleichsmühle. 11 Die Gründung der Oerlinghauser Windmühle diente, so ist zu vermuten, der Unterstützung der herrschaftlichen Menkhauser Wassermühle. Eine weitere Möglichkeit Wassermühlen mit Windkraft zu unterstützen bildeten sogenannte Windfänge. Unter Windfänge haben wir uns Steintürme vorzustellen, die wie Windmühlen eine drehbare Kappe mit Flügeln trugen. Die nur wenige Meter Durchmesser aufweisenden Türme beherbergten jedoch kein Mahlwerk. Mittelst Getriebe und Gestänge ist die mit den Flügeln aufgefangene Energie den benachbarten Wassermühlen zugeführt worden. Erstmalig wird um 1850 ein zur Neuen Mühle in Wüsten gehöriger Windfang erwähnt (B 1). 12 Weitere Windfänge befanden sich auf der 5 StA Detmold L 92 C Tit. 12 Nr Zur Geschichte der Windmühle Lüdenhausen: Heil 1994 und Die Wassermühle Hüttenhau lag an einem Quellauf der Alme im Hüttenhau. Sie ist zu einem unbekanntem Datum auf Veranlassung des Landesherrn Simon VI. erbaut worden, ist jedoch vor 1614 infolge chronischen Wassermangels wieder aufgegeben worden. Die dieser herrschaftlichen Mühle zugeordneten Lüdenhauser Mahlgenossen beschwerten sich 1614 über den dadurch erzwungenen Mühlenweg nach Göstrup. Dieser sei weit und beschwerlich, sie müßten das Korn mitt großer Arbeit auf den Achsell nach der Muhlen dragen. StA Detmold C 92 N Nr Heil StA Detmold L 92 R Nr Heil StA Detmold L 92 C Tit. 1 Nr StA Detmold L 92 C Tit. 1 Nr. 1a.
3 Stockschen Mühle in Matorf (B 3) und auf der Schröderschen Sägemühle in Hohenhausen (B 2). 13 Technik I Die hohen Bau- und Unterhaltskosten machten die Windmühle für den Bauherren in spe nicht gerade attraktiv. Der älteste Windmühlenbestand in Lippe (A 1/ A 2/ A 3) bestand deshalb ausschließlich aus herrschaftlichen Mühlen, deren Bau und Unterhalt der Landesherr finanzierte. 14 Neben seinen besonderen finanziellen Möglichkeiten konnte der Landesherr im Rahmen der Mühlendienste unendgeldlich die Hand- und Spanndienste der Zwangsmahlgenossen bei Mühlenbau und Mühlenreparatur nutzen. Mühlsteine bezog er im Gegensatz zum normalen Bauherrn zollfrei aus dem Ausland. Für den kostspieligen Transport der Mühlsteine nutzte er ebenfalls die mühlendienstpflichtigen Untertanen. Nicht nur die Baukosten und die ungünstigen Standortbedingungen in Lippe sprachen gegen die Windmühle, auch Bedienung und Unterhalt gestalteten sich komplizierter und aufwendiger und damit teurer als der einer Wassermühle. Mit der simplen, über Jahrhunderte kaum Innovationen unterworfenen Wassermühlentechnik kamen die dörflichen Handwerker und Müller zurecht. Mit der Windmühlentechnik, die ständig technischen Innovationen unterworfen war, kamen sie dagegen ungleich schwerer zurecht. Die lippischen Windmühlen waren deshalb häufig fehlerhaft konstruiert und schlecht gewartet. Die daraus resultierenden Reparaturkosten und Betriebsstillstände verhinderten eine wirtschaftliche Betriebsführung. Nur herrschaftliche Windmühlen, denen Zwangsmahlgenossen zugeordnet werden konnten, waren deshalb halbwegs wirtschaftlich zu führen. Oft aber auch diese nicht, wie die vielen Konkurse der Pächter zeigen. Technische Innovationen konnten nur verspätet aufgenommen werden. Häufig sind diese durch wandernde Müllergesellen verbreitet worden. Sie mußten aber die Grafschaft bzw. das Fürstentum Lippe umgehen, da die lippische Müllerei nicht zünftig war schrieb der Archivrat Koch: Erfahrne und gelernte Müller und Knechte komen nicht ins Land weil keiner bey den unzünftigen arbeiten darf; ja mithin können die Inländer auch von diesen nichts lernen. Und die Inländer können eben deswegen nicht außerhalb Landes kommen. Niemand kann sagen ob auch ein Müller seine Profession verstehet klagte der Pächter der Lüdenhauser Windmühle Krüger: Da sich "in hiesiger Gegend kein Sachkundiger fand, welcher die Windmühle wieder herstellen und nach Holländischer Bauart errichten konnte, mußte ich einen Meister aus Minden kommen lassen." 16 Der älteste überlieferte Vertrag über den Bau einer lippischen Windmühle, der Windmühle Horn (A 2), mußte von der Landesherrschaft mit einem auswärtigen Mühlenbauer aus Rinteln abgeschlossen werden (Abdruck im Anhang). Im Jahre 1788 war in der Grafschaft Lippe der Beruf des Mühlenbauers noch nicht vertreten. 17 Der auf der Saline in Salzuflen beschäftigte Kunstmeister Culemann, der in 13 Heil Die Windmühle Lüdenhausen ist allerdings 1615/1616 von Hermannus Cato, Vogt im Amt Sternberg und Besitzer einer Kleinkötterstätte und eines Kruges in Lüdenhausen, nach erfolgter Konzessionserteilung am erbaut worden. Wenig nach Fertigstellung der Mühle hat er am die Mühle für die stolze Summe von 320 Tlr. an den Landesherrn verkauft. Heil 1994 und StA Detmold L 92 C Tit.1 Nr.4, Der erste Zusammenschluß lippischer Müller erfolgte im Jahre 1892 mit der Gründung des Lippischen Müllerverbandes. Er benannte sich später in Lippische Müller-Innung um. StA Detmold L 92 C Tit.1 Nr StA Detmold L 92 C Tit. 12 Nr.10 Vol.I. 17 StA Detmold D 72 Clausing Nr.3. Für das Jahr 1861 verzeichnet der Fürstlich lippische Kalender Jahrgang heimische Mühlenbauer finden sich 11 Mühlenbauer bzw. Mühlenbaufirmen im Fürstentum Lippe (Statistik des deutschen Reiches, N.F. 114, 1898). Zu einem erfolgreichen Mühlenbaubetrieb entwickelte sich die in Heiligenkirchen ansässige Firma Wendiggensen, die ursprünglich auf landwirtschaftliche Maschinen spezialisiert war
4 der Lage war moderne Windmühlen zu konstruieren, schrieb im Jahre 1829, dass nach seinem Empfinden die meisten lippischen Müller Befangenheit und Vorurteile gegen wissenschaftliche Rathschläge zeigten und voller Unwissenheit seien. 18 Die Übernahme technischer Innovationen in der Müllerei kam im Fürstentum Lippe erst langsam im Verlauf des 19. Jh. in Gang. Den Anfang machten die Wassermühlen, deren Wasserräder verbessert wurden, um einen günstigeren Wirkungsgrad zu erreichen. Weil sich die Ernährungsgewohnheiten zu ändern begannen, wurden neuartige Weizenmahlgänge angeschafft. Die hölzernen Getriebe wurden durch eiserne Getriebe ersetzt und die bis dahin gebräuchliche Triebstockverzahnung von neuartigen Zahnformen, Verzahnungsarten und der Rädertransmission abgelöst. Moderne Walzenstühle ersetzten die Steinmahlgänge. Die folgenreichste Innovation bildete aber die Einführung neuer Antriebstechniken, die im Fürstentum Lippe besonders im letzten Viertel des 19. Jh. zu beobachten ist. Zu nennen sind die Dampfmaschine, Benzol-, Rohöl- und andere Verbrennungsmaschinen und schließlich der Elektromotor. Diese Maschinen beendeten auch die Abhängigkeit der Windmühlen von den Windverhältnissen und ermöglichten einen kontinuierlichen Betrieb und damit eine wirtschaftlich erfolgreichere Führung der Betriebe. Die Energiekosten für den Motoreneinsatz belasteten die Windmühlenbetriebe nicht so schwer, da sie nach Möglichkeit den Windantrieb nutzten. Als Beispiel sei die Windmühle Brink in Bentorf genannt. Bereits 1892 wird eine zur Mühle gehörige Dampfmaschine erwähnt. Diese ist zu einem nicht bekannten Zeitpunkt durch eine Lokomobile ersetzt worden, die neben der Mühle auch eine Dreschmaschine antrieb. Die Lokomobile ist dann vor 1930 durch einen Dieselmotor ersetzt worden. Seit dem Jahre 1943 verfügte die Mühle über einen Elektromotor. 19 Weiter konnten mit den Motoren Maschinen wie Dreschmaschinen, Häckselmaschinen, Kreissägen usw. angetrieben werden, die den Windmühlenbetrieben beim wirtschaftlichen Überlebenskampf halfen. Die Lage der Windmühle auf Anhöhen abseits der Siedlungen stellte einen signifikanten Nachteil gegenüber der Wassermühle dar. Den Mahlgenossen wurden häufig weite und beschwerliche Mühlenwege zugemutet. Auch hier führte oft nur der Mahlzwang den Windmühlen ausreichend Mahlgäste zu. Die Belastung der Landbevölkerung durch die weiten Mühlenwege darf nicht unterschätzt werden. Da Mehl nicht konserviert werden konnte, mussten die Mühlen regelmäßig im Abstand weniger Tage aufgesucht werden. Die herrschaftliche Windmühlen, die den älteste Windmühlenbestand in Lippe repräsentierten (A 1/ A 3/ A 5), lagen abseits der Siedlungen auf Anhöhen. 20 Trotz des Mahlzwanges, der ihm Mahlgäste garantierte, ist der Standort Tönsberg dennoch endgültig 1851, nachdem die Mühle 1815 verkauft worden war, aufgegeben worden. Die herrschaftliche Windmühle Saalberg war bereits 1731 verkauft worden. Ein probates Mittel, Mühlenstandorte attraktiver zu gestalten, war ihre Ausstattung mit Privilegien zum Branntweinbrennen und Branntweinausschank, so 1731 beim Verkauf der Windmühle Saalberg geschehen. Mühlenrecht Einfluss auf den Windmühlenbestand übte weiter die Handhabung des Mühlenregals durch die dafür zuständige Rentkammer aus. 21 Die lange Zeit äußerst restriktive Vergabe von Mühlenkonzessionen durch die Rentkammer sollte insbesondere dem Schutz der (Wendiggensen 1931, S ). In diesem Zusammenhang ist auch die Mühlenbaufirma Falk aus Lemgo-Brake zu nennen. 18 StA L 92 C Tit. 1 Nr.27, Culemann hat 1838 eine moderne Windmühle nach Art der Holländischen in Lüdenhausen (A 1) erbaut und war maßgeblich an der Modernisierung von lippischen Ölmühlen beteiligt (StA Detmold L 92 C Tit. 1 Nr.13). Zu den Begriffen Mühlenbauer, Mühlenarzt und Kunstmeister siehe: Mager 1990, S Brink 1993, S Der Standort der herrschaftlichen Windmühle Horn ist unbekannt. 21 Zur Gewerbepolitik der Lippischen Rentkammer: Bartelt, Brunsiek, Klocke-Daffa 1991, S
5 herrschaftlichen Mühlen vor Konkurrenz dienen, denn mit den herrschaftlichen Mühlen erzielte die Rentkammer beträchtliche Pachteinnahmen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass von jedem Roggenbrot, das von einem lippischen Untertan gegessen wurde, der Landesherr partizipierte, da er zwischen 1/16 und 1/24 vom Brotgetreide seiner Untertanen auf den Herrschaftlichen Mühlen abschöpfte. 22 Etwa ab Mitte des 19. Jh. wich diese fortschrittsfeindliche Haltung, sie verhinderte ja Mühlenneubauten und die Motivation zu Investitionen in technische Innovationen und die Konkurrenz unter den Mühlenbetrieben, allmählich auf. Diese Entwicklung ist deutlich an der nun zunehmenden Zahl der Mühlenneugründungen, die allesamt auf Privatinitiative erfolgten, abzulesen. Im benachbarten Königreich Preußen war mit Einführung der Gewerbefreiheit im Jahre 1810 das Mühlenzwangsrecht beseitigt worden. Die dann folgende positive wirtschaftliche Entwicklung wird im benachbarten Fürstentum Lippe nicht ohne Resonanz geblieben sein. Aber erst der lippische Beitritt zum Norddeutschen Bund 1867 beendete entgültig die unhaltbare Gewerbepolitik der Rentkammer, denn durch den Beitritt war Lippe gezwungen, die Gewerbefreiheit einzuführen, was zum erfolgte. Während anschließend ein wahrer Bau-, Ausbau- und Modernisierungsboom auf den lippischen Wassermühlen zu beobachten ist, wurden lediglich zwei Windmühlenstandorte in Bentorf und Oberwüsten neu gegründet. Allerdings sind die Windmühlen modernisiert worden. Zu denken ist insbesondere an die neuen Jalousieflügel, die alten mit Laken besegelten Flügel ablösten und später die Windrose, die den Müllern das mühselige Drehen der Mühlenkappe ersparte. Mühlensterben Bald nach der Welle von Mühlenneugründungen setzte allerdings eine Entwicklung ein, die letztendlich zum Ende fast aller lippischen Mühlenbetriebe führen sollte. Gegen Ende des 19. Jh. begannen die Umwälzungen, die den Beginn des sogenannten Mühlensterbens markieren, das in den 50er und 60er Jahren des 20. Jh. seinen Höhepunkt und Abschluß fand. Das Mühlengesetz von 1957 und 1961, sowie das Mühlenstrukturgesetz von 1971 beschleunigten die Stillegungen, da sie denen Prämien ausschrieben, die ihren Betrieb einstellten. So wurden wenigstens die härtesten wirtschaftlichen Folgen abgemildert, denn es waren ja Familienbetriebe, die ihre Existenz verloren. Das bis dahin dezentrale, kleinräumige System der Mehl-, Schrot- und Futtermittelversorgung, in dem auch die lippischen Windmühlen ihren Platz hatten, löste sich auf. Ebenso die enge Nachbarschaft und Zusammenarbeit von Getreideproduzent, Müller und Konsument. Die neuen Antriebstechniken machten die Müllerei unabhängig von Wasser- oder Windenergie, so dass verkehrsgünstig gelegene Großmühlen, die bis dahin unvorstellbare Getreidemengen aus Übersee und Osteuropa bezogen und über große Absatzmärkte verfügten, errichtet werden konnten. Immer mehr der gewerblich geführten kleinen Mühlen wurden überflüssig und mußten ihren Betrieb einstellen. Die verbleibenden Betriebe versuchten die Handelsmüllerei auszubauen, kauften selber Getreide auf und versuchten Absatzmärkte für ihre Produkte zu finden, was in der Regel Backbetriebe in der Region waren. Die traditionelle, althergebrachte Kundenmüllerei, auch Lohnmüllerei genannt, bei der der Kunde sein Getreide auf die Mühle brachte und gegen Bezahlung schroten oder vermahlen ließ, blieb jedoch das Hauptgeschäft. Als weitere Einkommensquelle diente der Verkauf von Waren für den Haushalt und die Nutztierhaltung, wie Hühnerfutter, Taubenfutter, Bollmehl, Weizenkleie, Roggenkleie und Zuckerrübenschnitzel. Häufig sind die Kunden mit einem LKW beliefert worden. Geschmälert wurde die Lohnmüllerei durch die Anschaffung von Schrotmühlen auf den Höfen, was ja seit Einführung der Gewerbefreiheit nicht mehr verboten war und der tiefgreifenden Änderung der ländlichen Subsistenzwirtschaft. Die bisherigen Mahlgäste produzierten nun also ihr Schweinefutter selber und kauften Mehl im 22 Dem Mahlzwang unterlag in Lippe nur der Roggen. Ihm unterlagen alle Untertanen in den Städten und den Dörfern. Ausnahmen bildeten der Adel, Examinierte und Teile des Klerus. Eine Sonderstellung nahmen allerdings die Bürger der Stadt Salzuflen ein, die nicht dem Mahlzwang unterlagen. Zum Salzufler Sonderfall siehe: Heil 2002 und Stadtmühle Bad Salzuflen.
6 Lebensmittelgeschäft oder Brot beim Bäcker. Bäcker haben sich auf den lippischen Dörfern erst in der 2. Hälfte des 19. Jh. in nennenswerter Anzahl angesiedelt. Die Obrigkeit sah es nicht gerne, wenn auf dem Lande Backprodukte verkauft wurden. Im Jahre 1807 verbot sie das Hausieren mit Stuten, Kloben, Zwieback, Krengeln und anderen Gebäck mit dem Argument, es würde den armen Untertanen schaden: "Das Bedürfnis des Gaumens ist täglich mehrmals rege und wenn auch die zu Hause befindliche Frau die Kraft hätte, selbst der Einladung des ihr lieblich entgegenduftenden Gebaks zu widerstehen, so wird sie doch selten die Bitten ihrer andringenden Kinder abschlagen können." Wenn kein Geld im Hause wäre, würde die Hausfrau den Kuchen gegen Eier, Garn, Flachs und andere nützliche Dinge eintauschen. "Ein Aufwand führt zu dem anderen, denn da das Gebak herrlich zum Eintunken schmeckt, so muß das Product der Giftbohne, der Kaffee, zum Feuer gesetzt werden und Holz und Zeit geht verloren." 23 Modernisierung und Vergrößerung der Mühlenbetriebe waren enge Grenzen gesetzt, die gekennzeichnet waren durch fehlende Investitionsmittel, insbesondere aber der Beschränkung durch die zur Verfügung stehende Wasser- bzw. Windenergie. Was blieb war eine ständig sich verschmälernde Kundenmüllerei und ein unerheblicher Anteil an der Handelsmüllerei. Dieser Entwicklung konnten sich die lippischen Windmühlenbetriebe doch erstaunlich lange widersetzen. Mit Ausnahme der Lüdenhauser Windmühle (A 1), die nach einem Brand im Jahre 1909 durch eine Motormühle ersetzt wurde und der Fissenknicker Mühle (A 6), die um das Jahr 1906 abbrannte und nicht wieder Instand gesetzt wurde, konnten sich fünf Windmühlenstandorte noch länger halten. Sie gingen erst in der Zeit um dem Zweiten Weltkrieg herum ein. Die Bentorfer Windmühle stellte sogar erst in den 70er Jahren des 20. Jh. ihren Betrieb endgültig ein. Die verbliebenen Bausubstanz und Mühleneinrichtungen sind in Lippe lange Zeit kaum beachtet worden, auch nicht vom Denkmalschutz. So konnte es geschehen, das noch 1989 die Restkorpusse der Lockhauser Windmühle (A 11) und der Ahmser Windmühle (A 10) abgebrochen werden konnten. In einem unwürdigen Zustand befinden sich gegenwärtig die erhaltenen Korpusse der Windmühlen Fissenknick (A 6), Saalberg (A 3) und Dahlhausen (A 9). 24 Lediglich die Windmühle Bavenhausen zeigt sich in einem äußerlich befriedigenden Zustand. Einzig mit der Windmühle Bentorf hat es das Schicksal gut gemeint. Der Initiative und dem Einsatz der Familie Brink und vieler Kalletaler Bürger ist es zu verdanken, daß das Technische Denkmal Windmühle Brink uns heute an die Zeit traditioneller, handwerklicher lippischer Windmüllerei erinnert. Technik II Wenden wir uns noch einmal der Windmühlentechnik zu. Die lippischenwindmühlen dienten nur der Getreidevermahlung und der Produktion von Graupen. Singulär steht in Lippe die Windsägemühle Kleinenmarpe da, die bezeichnenderweise auch nie richtig in Betrieb gegangen ist. 25 Das Maximum an Gehenden Werk stellten auf unseren lippischen Windmühlen zwei Mahlgänge dar, ein Schrotmahlgang und ein mit einer Sichtemaschine versehener Roggenmahlgang, auf dem auch ein wenig Weizen vermahlen wurde. Ab und an kam noch ein Graupenmahlgang hinzu. 26 Die so ausgestatteten Mühlen konnten sowohl grobes Schrot als auch feines Roggenmehl produzieren. Weizenmahlgänge auf lippischen Windmühlen, die spezielle Mahlsteine erforderten, kamen äußerst selten vor. Um das Jahr 1855 erhielt die Windmühle Saalberg (A 3) einen solchen Mahlgang, die 23 StA Detmold L 92 N Nr Den Korpus der Windmühle auf dem Saalberg betreffend, gab es 1905 Pläne diesen zu einem Aussichtsturm in Verbindung mit einem Denkmal für den 1904 verstorbenen Grafregenten Ernst Graf zur Lippe-Biesterfeld umzubauen. Dieser Plan scheiterte allerdings am Einspruch der fürstlichen Familie, der der Standort für ein Denkmal nicht würdig genug erschien. StA Detmold L Nr.88. Auf dieses interessante Projekt hat mich freundlicherweise Herr Gahde vom NW Staatsarchiv Detmold hingewiesen. Heute ist der sehenswerte Korpus leider mit lächerlichen Burgzinnen versehen. 25 StA Detmold L 92 N Nr Eine Ausnahme bildet der Lüdenhauser Galerieholländer von 1703/1705, der im folgenden noch besprochen wird.
7 Bavenhauser Windmühle (A 8) im Jahre Der lippischen Obrigkeit gefiel die Verbreitung der Weizenmahlgänge auf dem Lande nicht, weshalb die Rentkammer sie auch nur selten konzessionierte. Nach ihrer Überzeugung brachten sie nur Nachteile mit sich, indem sie den Aufenthalt der Mahlgäste in den Mühlen verlängerten und weit entfernt wohnende Mahlgäste anlocken würden, die dann weite Wege hinter sich zu bringen hätten. Auch gewöhnten sie die Mahlgäste an feineres Mehl, bei dessen Bereitung jedoch durch Verstaubung zu viel Mehl verloren ginge. Für die Verarbeitung des Weizens sei zudem mehr zu bezahlen. 27 Die in Lippe einst zahlreichen Perlgraupenmühlen wurden spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jh. abgeworfen. 28 Auf die erst spät einsetzende Verwendung von Eisen bei der Konstruktion des Gehenden Werkes bin ich oben bereits eingegangen. Die Korpusse der ältesten Bestandschicht der lippischen Windmühlen (A 1/ A 2/ A 3/ A 4) waren aus Holz konstruiert. Der erste Steinkorpus einer lippischen Windmühle ist im Jahre 1751 auf dem Tönsberg errichtet worden. Alle dann folgenden Standortneugründungen erhielten ebenfalls von Beginn an Steinkorpusse. Eine Ausnahme bildet die 1860 errichtete Windmühle Ahmsen (A 10), die über einen Holzkorpus verfügte. Korpus und das aus einem Schrotgang und einem Mahlgang mit einer Sichtemaschine ( Beutelmahlgang ) bestehende Gehende Werk wurden jedoch nicht neu errichtet, sondern gebraucht aus dem Preußischen nach Ahmsen transloziert. 29 Windmühlen werden auf Grund ihrer äußeren Erscheinungsformen typologisiert, wobei sich für unsere Zwecke eine grobe Typologie in Form von Hauptklassen, Klassen und eventuell Typen anbietet. 30 Die lippischen Windmühlen gehören alle zur Hauptklasse der vertikalen Windmühle. 31 An Klassen finden wir in Lippe die Mühle mit drehbarem Gehäuse und die Mühle mit drehbarer Haube. 32 Die Mühle mit drehbarem Gehäuse ist in Lippe zwischen 1615 (A 1) und 1801 (A 3) gebaut worden. Allgemein als Bockwindmühle bezeichnet, wurde sie in Lippe gewöhnlich als Pfahlwindmühle bezeichnet. 33 Die letzten ihrer Art haben in Lippe von 1737 bis 1836 in Lüdenhausen (A 1) und von 1801 bis 1862 auf dem Saalberg (A 3) gestanden. Moderner und technisch aufwendiger war die Mühle mit drehbarer Haube, die in der frühen Neuzeit im niederländischen Raum entwickelt worden war und deshalb allenthalben, auch in Lippe, als Holländer bezeichnet wurde. 34 Verfügte sie über einen Steinkorpus, wurde sie in Lippe auch als massive holländische Windmühle bezeichnet. Die erste dieser modernen Maschinen wurde bereits vor 1698 in Lüdenhausen (A 1) errichtet. Da ihre Kappe vom Erdboden aus gedreht werden 27 StA Detmold L 77 A Nr Die Graupenmühlen dienten der Verarbeitung von Gerste, Hafer und Buchweizen. Graupensuppe, Gersten- und Hafergrütze und Haferbrei waren einst wichtige Volksnahrungsmittel. Die Graupenmühle verbreitete sich nennswert erst seit 1770 in Lippe, nachdem der Hohenhauser Mühlenbesitzer und Erfinder Jacobi eine neuartige Perlgraupenmühle konstruiert hatte. Vorher wurden Graupen auf den normalen Mahlgängen produziert.sta Detmold L 77 A Nr. 4501/ L 92 N Nr Bei der Herstellung der Graupen, besonders der feinen Perlgraupen, fiel als Abfall sogenanntes "Schlammehl" an, wobei man zwischen "groben und feinem Schlammehl" unterschied. Das feine Schlammehl wurde wohl seit der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts als Viehfutter, aber von den armen ländlichen Unterschichten auch zur menschlichen Ernährung genutzt, da es noch billiger als Bohnen- und Gerstenschrot war. Das zur menschlichen Ernährung genutzte Schlammehl, auch "Kehlmehl" genannt, wurde zur Bereitung von Mehlsuppen und Pfannkuchen genutzt. 29 StA Detmold L 92 N, Nr Notebaart Die zweite Hauptklasse bilden Windmühlen mit horizontalen Flügeln. 32 Die dritte Klasse bilden die nicht drehbaren Windmühlen. 33 Zur Konstruktion, Arbeitsweise und Entwicklung der Bockwindmühle siehe: Großmann/ Schulte Zur Konstruktion, Arbeitsweise und Entwicklung des Holländer siehe: Großmann/ Schulte 1980.
8 konnte, kann sie dem Typ Bodensegler oder Erdholländer zugeordnet werden 35. Ist es bereits recht ungewöhnlich in der zweiten Hälfte des 17. Jh. in der Grafschaft Lippe eine Holländerwindmühle zu finden, so ist der folgende Lüdenhauser Windmühlenneubau nur als außergewöhnlich zu bezeichnen. Zwischen dem und dem (23 Monate Bauzeit!) wurde in Lüdenhausen der damals in Nordeuropa modernste Windmühlentyp errichtet. Die Kappe wurde nicht wie beim Vorgänger vom Erdboden aus, sondern von einer Galerie (in Lippe Zwickstellung genannt) aus gedreht. 36 Diese Windmühlen werden gewöhnlich als Galerieholländer oder Laufstegmühle bezeichnet. Errichtet wurde die Mühle von dem aus dem Amt Vlotho stammenden Hans Henrich Piper, der bis 1713 auch die Mühle gepachtet hatte. Piper, so ist anzunehmen, hat wahrscheinlich von niederländischen Mühlenbauern oder gar in den Niederlanden das Mühlenbauhandwerk erlernt. Diese mit großem Aufwand errichtete Mühle war bereits 1734 eine nicht mehr nutzbare Ruine hat ein Sturm die Mühle dann endgültig zerstört. Die kläglichen Reste der mit einem Kostenaufwand von 1100 Tlr. errichtete Mühle wurden 1738 für 16 ½ Tlr. verkauft. Der verbliebene Steinsockel erhielt in der Folge ein primitives Dach und diente als Pferdestall. Bereits mit dem ersten Tag der Inbetriebnahme hatte es sich gezeigt, dass es offensichtlich ein Fehler gewesen war, eine Mühle nach dem neuesten Stand der Technik zu errichten. Sie war noch nicht genügend ausgereift. Sie war auf dem Windberg dem Wetter zu exponiert ausgesetzt, was die vielen Schäden und Reparaturen zeigen. Auch scheinen viele Pächter (8 Pächter zwischen 1705 und 1734!) Probleme mit der Handhabung der Technik gehabt zu haben. Sie war so kompliziert und aufwendig, dass sie der Windmüller nur mit Hilfe eines Mühlenknechts bedienen konnte. Gleichgültig aus welcher Perspektive dieser Mühlenbau betrachtet wird, er bleibt aus heutiger Sicht unverständlich. Da sind zum einen die exorbitanten Baukosten, die so gar nicht in die Epoche des Lippischen Absolutismus passen, als auch die Zahl von etwa 660 Mahlgenossen, für die dieser Mühlenbau völlig überdimensioniert war. Man zog allerdings Lehren aus diesem Desaster. Als Nachfolgebau wurde von dem von außerhalb Lippes stammenden Mühlenbaumeister Christian Pohlman und dem aus Escher, Kreis Schaumburg Lippe stammenden Windmüller Cord Harcke, der im folgenden die Mühle pachtete, vom bis zum (4 Monate Bauzeit!) eine Pfahlwindmühle errichtet. Die Baukosten, die Harcke aufbrachte, betrugen ganze 287 Tlr. 37 Diese Mühle war den Verhältnissen wesentlich besser angepaßt und wurde bis 1819 in vier Generationen von der Familie Harcke betrieben. In der Nacht zum zerstörte ein Sturm die Mühle vollständig. Beim Rettungsversuch verletzte der zerbrechende Mühlenschwanz den Müllergesellen Petig schwer. In der Folge wurde von dem Kunstmeister Kuhlemann aus Salzuflen ein Bodensegler mit einem steinernen Korpus errichtet. Die erste Holländerwindmühle mit Steinkorpus ist in Lippe bereits 1751 auf dem Tönsberg errichtet worden. Während dieser Korpus dem Typ der leicht konischen Turmmühle zuzuordnen ist, können alle weiteren ab 1847 errichteten Steinkorpusse dem Typ konische Turmwindmühle zugeordnet werden. Kommen die älteren Korpusse noch breit und gedrungen daher, werden die jüngeren Holländerwindmühlen immer schlanker und eleganter. Als besonders elegant zeigten sich die Windmühlen Lockhausen und Oberwüsten. Wichtiger als diese Typisierung ist 35 Diese zweite Lüdenhauser Windmühle war eine Mühle mit drehbarer Kappe, die mittelst eines bis zum Erdboden herabreichenden Hebelbalkens gegen den Wind gedreht werden konnte ( der Schwantz, womit das Tach herum gedrehet wird ). Der Korpus war eine mit Stroh gedeckte dreistöckige Holzkonstruktion, die auf einen Steinsockel aufgesetzt war. Im ersten Stock befand sich ein Mahlgang zur Schrot- und Mehlproduktion und ein Pellgang zur Graupenproduktion. Im Erdgeschoß befand sich eine Sichtemaschine zur Mehlproduktion. 36 Der Korpus war eine mit Holzschindeln bedeckte Holzkonstruktion, die auf einen Steinsockel aufgelegt war. Die Kappe wurde mittelst eines bis zur Galerie herabreichenden Hebelbalkens (in Lippe Schwantz genannt) gedreht. Sie verfügte über zwei Mahlgänge und einen Perlgraupengang. Beide Mahlgänge waren mit Sichtemaschinen ausgestattet. 37 Die Mühle verfügte über zwei Stockwerke ( Böden ). Anders als der Vorgängerbau hatte sie ursprünglich lediglich einen Mahlgang mit einer Sichtemaschine.
9 allerdings die Beobachtung, daß sowohl die ersten hölzernen Windmühlen, von der ersten Lüdenhauser Windmühle einmal abgesehen, als auch die erste Windmühle mit Steinkorpus von der Landesherrschaft errichtet worden sind, die damit mehrfach innovative Initiativen im Windmühlenbau gezeigt hatte. Anhang Contract wegen der Windtmuhlen zu Horn 1617 Heutt dato ist mitt M. Friederichen Cor... / vonn Hamburgk geschlossen, das er dem/ Hoichwolgeb. M.G. Herrn Graffen/ unndt Edlen Herrn zur Lippe, eine/ Windtmuhlen für Korn bauwen soll,/ dazu Ihme s. G. Alle Notturfft an Holtze/ willen verschaffen unndt bei die Stette/ führen lassen, unndt Ihme eins für all/ einhundertt zwanzigk Thl. zu / geben, dagegen soll er der Meister denn/ Knechten lohnen, unndt die Muhlen gantz ver=/ fertigen, unndt in schwangh ahn seiner/ I. G. Unnkosten stellen, das gerathe unndt/ werckzeugh soll ihme von Rinteln nach Horn/ unndt wieder zurucke ohn sein Kosten geführ.../ werden, Item drei Thl. Weinkauff sollen/ Ihme hirüber auch gegeben unndt wen die/ Muhlen uffgerichtet Notturfft an Volcke/ dazu verordnet werden, Actum Dettmoldt/ am 10. Feb M Friederich Cordt (StA Detmold L 92 N Nr. 1152) Literaturverzeichnis Bartelt, Fritz und Brunsiek, Sigrun und Klocke-Daffa, Sabine: Landleben in Lippe Band 2. Detmold 1991, S Brink, Monika: Die Geschichte der Windmühle Brink in Kalletal Bentorf. In: Windkraftanlagen in Westfalen-Lippe Die Windmühle Brink in Kalletal-Bentorf Ein Mühlenführer. Kalletal, Münster 1993, S Ernst, Heinrich: Anweisung zum praktischen Mühlenbau für Müller und Zimmerleute Großmann, G. Ulrich und Schulte, Ingrid: Die Kappenwindmühle. Detmold Großmann, G. Ulrich und Schulte, Ingrid: Die Bockwindmühle im Westfälischen Freilichtmuseum Detmold. Detmold Heil, Georg: Das Brausen des Wassers ist nicht lauter als das einer Kanne Bier. In: Kalletaler Zeitung, Heil, Georg: Bavenhausens Wahrzeichen 140 Jahre alt. In: 650 Jahre Bavenhausen Ein Streifzug durch die Geschichte. Bavenhausen 1993 a. Heil, Georg: Geschichtliche Einführung. In: Museumsverein Kalletal e.v. und Landschaftsverband Westfalen-Lippe Westfälisches Amt für Denkmalpflege Referat TKD (Hg.): Windkraftanlagen in Westfalen-Lippe Die Windmühle Brink in Kalletal-Bentorf Ein Mühlenführer. Kalletal, Münster 1993 b, S Heil, Georg: Die Geschichte der Mühlen auf dem Gebiet des ehemals lippischen Amtes Varenholz. Unveröffentlichtes Manuskript. Lemgo Heil, Georg: Die Lüdenhauser Windmühle. Unveröffentliches Manuskript. Lemgo Heil, Georg: Zur Geschichte der Wassermühle Ahmsen. In: Franz Meyer und Stefan Wiesekopsieker (Hg.): Bad Salzuflen 2001 Jahrbuch für Geschichte und Zeitgeschehen. Bielefeld 2001, S
10 Heil, Georg: Die Geschichte der Salzufler Stadtmühle ( ). In: Franz Meyer und Stefan Wiesekopsieker (Hg.): Bad Salzuflen 2002 Jahrbuch für Geschichte und Zeitgeschehen. Bielefeld 2002, S Lippische Landeszeitung: Alte Windmühlen im Lipperland Mager, Johannes: Mühlenflügel und Wasserrad. Leipzig Notebaart, J.C.: Windmühlen der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung. Den Haag, Paris Pölert, Otto: Wüsten Eine Höfe- und Siedlungsgeschichte. Wüsten o.j. Wendiggensen, Paul: Beiträge zur Wirtschaftsgeographie des Landes Lippe. Hannover 1931.
Kalletalsmühle. A) Lage: Ort:... Hohenhausen-Dalbke/Gemeinde Kalletal Gewässer:... Westerkalle
 228 A) Lage: Kalletalsmühle Ort:... Hohenhausen-Dalbke/Gemeinde Kalletal Gewässer:... Westerkalle B) Mühlenrechtliche Stellung:... 1872 bis 1960 Gewerbebetrieb D) Produkte und Dienstleistungen:... Mehl
228 A) Lage: Kalletalsmühle Ort:... Hohenhausen-Dalbke/Gemeinde Kalletal Gewässer:... Westerkalle B) Mühlenrechtliche Stellung:... 1872 bis 1960 Gewerbebetrieb D) Produkte und Dienstleistungen:... Mehl
 Einführung In Lippe 1 lassen sich Mühlen seit dem 12 Jahrhundert nachweisen. Die erste, schriftlich dokumentierte Mühle hatte ihren Standort in Belle 2. Eine mittelalterliche Mühle, vielleicht eine getriebelose
Einführung In Lippe 1 lassen sich Mühlen seit dem 12 Jahrhundert nachweisen. Die erste, schriftlich dokumentierte Mühle hatte ihren Standort in Belle 2. Eine mittelalterliche Mühle, vielleicht eine getriebelose
und + der Verwendung einer seit der Antike genutzten regenerativen Energiequelle zum Antrieb der Generatoren und Dynamos, der Wasserkraft.
 Weiße Kohle Die Blütezeit der Elektrizität begann mit der Erfindung von Generatoren und Dynamos zur Produktion großer Mengen Strom und mit dem Aufbau eines Versorgungsnetzes. Die wichtigsten Anstöße waren
Weiße Kohle Die Blütezeit der Elektrizität begann mit der Erfindung von Generatoren und Dynamos zur Produktion großer Mengen Strom und mit dem Aufbau eines Versorgungsnetzes. Die wichtigsten Anstöße waren
Aus dem bäuerlichen Leben
 Dr. Stefan Brüdermann Aus dem bäuerlichen Leben Während in den mittelalterlichen Urkunden nur vom Land und seinen Besitzern die Rede ist, das sind nicht die Bauern, erfahren wir im 16. Jahrhundert nun
Dr. Stefan Brüdermann Aus dem bäuerlichen Leben Während in den mittelalterlichen Urkunden nur vom Land und seinen Besitzern die Rede ist, das sind nicht die Bauern, erfahren wir im 16. Jahrhundert nun
Bericht. Sprache der Mühlenflügel. Holländer Windmühlen Beispiele: Holländer Windmühle Mitling Mark Holländer Windmühle Nenndorf
 Bericht Sprache der Mühlenflügel Datum: 14. Januar 2012 Verfasser: Erich Böhm, Nenndorf Quellen: Ausbildungsunterlagen Fotos: Erich Böhm, Nenndorf Allgemeines: Holländer Windmühlen Beispiele: Holländer
Bericht Sprache der Mühlenflügel Datum: 14. Januar 2012 Verfasser: Erich Böhm, Nenndorf Quellen: Ausbildungsunterlagen Fotos: Erich Böhm, Nenndorf Allgemeines: Holländer Windmühlen Beispiele: Holländer
Koselauer Mühle, in S-H, Riepsdorf
 Koselauer Mühle, in S-H, 23738 Riepsdorf (Eigentümer bis 1956: Erbgroßherzogliche Oldenburgische Güterverwaltung) (Hartwig Berner, Koselauer Mühle, 23738 Riepsdorf) 1622 Wasserkornmühle, im Inventarium
Koselauer Mühle, in S-H, 23738 Riepsdorf (Eigentümer bis 1956: Erbgroßherzogliche Oldenburgische Güterverwaltung) (Hartwig Berner, Koselauer Mühle, 23738 Riepsdorf) 1622 Wasserkornmühle, im Inventarium
Mühlen in Düsseldorf ein Projekt des Stadtarchivs Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Alfred-Herrhausen-Förderschule
 Mühlen in Düsseldorf ein Projekt des Stadtarchivs Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Alfred-Herrhausen-Förderschule Klaudia Wehofen Alfred-Herrhausen-Schule Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen
Mühlen in Düsseldorf ein Projekt des Stadtarchivs Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Alfred-Herrhausen-Förderschule Klaudia Wehofen Alfred-Herrhausen-Schule Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen
Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann 200 Jahre Klubgesellschaft Hamm 25. Juni, 11 Uhr, Kurhaus
 Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann 200 Jahre Klubgesellschaft Hamm 25. Juni, 11 Uhr, Kurhaus Sehr geehrte Damen und Herren! Die vergangenen 200 Jahre der Klubgesellschaft in Hamm haben zahlreiche Geschichten
Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann 200 Jahre Klubgesellschaft Hamm 25. Juni, 11 Uhr, Kurhaus Sehr geehrte Damen und Herren! Die vergangenen 200 Jahre der Klubgesellschaft in Hamm haben zahlreiche Geschichten
Getreideanbau früher (vor 100 Jahren)
 Essen verändert die Welt Ernährung früher, heute und morgen Getreide immer noch ein wichtiges Lebensmittel? anhand eines Mühlenbesuchs klären. Getreideanbau früher (vor 100 Jahren) Die Körner werden in
Essen verändert die Welt Ernährung früher, heute und morgen Getreide immer noch ein wichtiges Lebensmittel? anhand eines Mühlenbesuchs klären. Getreideanbau früher (vor 100 Jahren) Die Körner werden in
Grundsätzlicher Aufbau einer Holländerwindmühle
 Bericht Grundsätzlicher Aufbau einer Holländerwindmühle Datum: 30.04.2011 Verfasser: Erich Böhm, Nenndorf Literatur Norzel, Weßling: Ostfriesisches Mühlenbuch Fotos: Erich Böhm, Nenndorf Allgemeines: Nenndorfer
Bericht Grundsätzlicher Aufbau einer Holländerwindmühle Datum: 30.04.2011 Verfasser: Erich Böhm, Nenndorf Literatur Norzel, Weßling: Ostfriesisches Mühlenbuch Fotos: Erich Böhm, Nenndorf Allgemeines: Nenndorfer
Achimer Windmühle Wahrzeichen der Stadt an der Weser
 Achimer Windmühle Wahrzeichen der Stadt an der Weser Die Achimer Windmühle - einst errichtet, um Getreide zu mahlen und Mehl und Schrot herzustellen, ist die Windmühle heute als Baudenkmal und Wahrzeichen
Achimer Windmühle Wahrzeichen der Stadt an der Weser Die Achimer Windmühle - einst errichtet, um Getreide zu mahlen und Mehl und Schrot herzustellen, ist die Windmühle heute als Baudenkmal und Wahrzeichen
Mühle Benkelberg A) Lage: Ort:... Langenholzhausen/ Gemeinde Kalletal Gewässer:... Osterkalle
 462 Mühle Benkelberg A) Lage: Ort:... Langenholzhausen/ Gemeinde Kalletal Gewässer:... Osterkalle B) Mühlenrechtliche Stellung:... konzessionierter Mühlenbetrieb C) Abgaben und Belastungen: 1701... Wasserfall
462 Mühle Benkelberg A) Lage: Ort:... Langenholzhausen/ Gemeinde Kalletal Gewässer:... Osterkalle B) Mühlenrechtliche Stellung:... konzessionierter Mühlenbetrieb C) Abgaben und Belastungen: 1701... Wasserfall
JAHRESBLICK Bezirksregierung Münster
 JAHRESBLICK 2008 Bezirksregierung Münster Bezirksregierung Münster Impressum Der Jahresblick 2008 ist eine Veröffentlichung der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster. Telefon: 0251/411-1066,
JAHRESBLICK 2008 Bezirksregierung Münster Bezirksregierung Münster Impressum Der Jahresblick 2008 ist eine Veröffentlichung der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster. Telefon: 0251/411-1066,
Die Coll'sche Wassermühle in Eindhoven
 Die Coll'sche Wassermühle in Eindhoven Ansicht aus dem Norden, vor erneuter Aufstellung des zweiten Wasserrades. Einleitung Die Collse Wassermühle ist Eigentum der Gemeinde Eindhoven. Im letzten Jahr des
Die Coll'sche Wassermühle in Eindhoven Ansicht aus dem Norden, vor erneuter Aufstellung des zweiten Wasserrades. Einleitung Die Collse Wassermühle ist Eigentum der Gemeinde Eindhoven. Im letzten Jahr des
- 2 - Und die Flügel, die setzen ihrerseits dann die Kraft des Windes um, Pfingstsmontag
 Pfingstsmontag Ein Kollege erzählte mir vor einigen Jahren von einer Konferenz in einer norddeutschen Stadt. Er war mit dem Zug dorthin gefahren. Und als er in den Abendstunden ankam, fiel ihm am Stadtrand
Pfingstsmontag Ein Kollege erzählte mir vor einigen Jahren von einer Konferenz in einer norddeutschen Stadt. Er war mit dem Zug dorthin gefahren. Und als er in den Abendstunden ankam, fiel ihm am Stadtrand
Unterwegs betrachtete er das Brot: Vollkornbrot, dachte er, wo wächst das wohl?
 Das Brot. Eine Geschichte zum Erntedankfest im Jahr2000. Geschrieben von Anna Siebels / Willmsfeld. Diese Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen der heißt Hans. Er ist sieben Jahre alt und wird im
Das Brot. Eine Geschichte zum Erntedankfest im Jahr2000. Geschrieben von Anna Siebels / Willmsfeld. Diese Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen der heißt Hans. Er ist sieben Jahre alt und wird im
LWL-Gräftenhof :46 Uhr Seite 1. Gräftenhof. Arbeitsbogen Museumspädagogik
 LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 1 Gräftenhof 1 Arbeitsbogen Museumspädagogik LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 2 Text & Idee: Zeichnungen: Layout: Fotonachweis: LWL-Freilichtmuseum
LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 1 Gräftenhof 1 Arbeitsbogen Museumspädagogik LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 2 Text & Idee: Zeichnungen: Layout: Fotonachweis: LWL-Freilichtmuseum
D 73 Karten v. Kerssenbrock Nr.154: Mühlenzeichnungen für die Güter Barntrup und Wierborn, um 1810.
 Quellenverzeichnis 1 1.Ungedruckte Quellen 1.1 Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Detmold D 71 Handschriften Nr.14: Copialbuch Wendischer Verträge und Burglehen des Schlosses Varenholz, 1313-1550. Nr.51:
Quellenverzeichnis 1 1.Ungedruckte Quellen 1.1 Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Detmold D 71 Handschriften Nr.14: Copialbuch Wendischer Verträge und Burglehen des Schlosses Varenholz, 1313-1550. Nr.51:
Station 3 Großmühle Gunz
 1 Richard Eberle Station 3 Großmühle Gunz 2 Richard Eberle Wir stehen nun vor der Villa Gunz, dem einzig verbliebenen Gebäude der Kunstmühle Gunz Wolfurt. Ausgangspunkt dieses ehemaligen Betriebs war wieder
1 Richard Eberle Station 3 Großmühle Gunz 2 Richard Eberle Wir stehen nun vor der Villa Gunz, dem einzig verbliebenen Gebäude der Kunstmühle Gunz Wolfurt. Ausgangspunkt dieses ehemaligen Betriebs war wieder
Video-Thema Begleitmaterialien
 BÄCKEREIEN IN DEUTSCHLAND 1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche der folgenden Wörter haben etwas mit dem Thema backen zu tun? Verwendet auch ein Wörterbuch. a) kneten
BÄCKEREIEN IN DEUTSCHLAND 1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche der folgenden Wörter haben etwas mit dem Thema backen zu tun? Verwendet auch ein Wörterbuch. a) kneten
Ehemalige Münzprägestätte Berlin - Vergangenheit
 Ehemalige Münzprägestätte Berlin - Vergangenheit 1 2 Die Alte Münze - Geschichte erlebbar im Zentrum der Stadt Erstmalig wurde die Münze Berlin im Jahr 1280 urkundlich erwähnt. 1701 beauftragte der preußische
Ehemalige Münzprägestätte Berlin - Vergangenheit 1 2 Die Alte Münze - Geschichte erlebbar im Zentrum der Stadt Erstmalig wurde die Münze Berlin im Jahr 1280 urkundlich erwähnt. 1701 beauftragte der preußische
Ein Haus erzählt Geschichten. Das Buddenbrookhaus
 Ein Haus erzählt Geschichten Das Buddenbrookhaus Herzlich willkommen im Buddenbrookhaus! as Buddenbrookhaus ist das vielleicht bekannteste Haus Lübecks. Warum? Hier spielt eine weltberühmte Geschichte.
Ein Haus erzählt Geschichten Das Buddenbrookhaus Herzlich willkommen im Buddenbrookhaus! as Buddenbrookhaus ist das vielleicht bekannteste Haus Lübecks. Warum? Hier spielt eine weltberühmte Geschichte.
Geocache durch das LVR-Freilichtmuseum Kommern
 Geocache durch das LVR-Freilichtmuseum Kommern Gehe zu folgenden Koordinate: N 50 36.777 E 006 37.874 Aufgabe 1 In dem Haus bei der Koordinate findest du das Objekt, das auf dem Foto zu sehen ist. Was
Geocache durch das LVR-Freilichtmuseum Kommern Gehe zu folgenden Koordinate: N 50 36.777 E 006 37.874 Aufgabe 1 In dem Haus bei der Koordinate findest du das Objekt, das auf dem Foto zu sehen ist. Was
Abschlussarbeit Roboter Carlo Kirchmeier AB3B
 Abschlussarbeit Roboter AB3B 15.05.2012 Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung 1.1 Meine Motivation Seite 3 1.2 Ziele Seite 4 2.Hauptteil 2.1 Planung Seite 5 2.2 Umsetzung Seite 6 2.3 Fotos Seite 7 3.Schlussteil
Abschlussarbeit Roboter AB3B 15.05.2012 Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung 1.1 Meine Motivation Seite 3 1.2 Ziele Seite 4 2.Hauptteil 2.1 Planung Seite 5 2.2 Umsetzung Seite 6 2.3 Fotos Seite 7 3.Schlussteil
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung Wohnhaus
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174380989511/ ID: 174380989511 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 33 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174380989511/ ID: 174380989511 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 33 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
 Mühlenrecht 1.1 Das landesherrliche Mühlenregal "In der Grafschaft Lippe ist von unvordenklichen Zeiten bis auf den heutigen Tag niemand, mithin weder ein Edelmann, noch eine Stadt, auch kein geistl. Stift,
Mühlenrecht 1.1 Das landesherrliche Mühlenregal "In der Grafschaft Lippe ist von unvordenklichen Zeiten bis auf den heutigen Tag niemand, mithin weder ein Edelmann, noch eine Stadt, auch kein geistl. Stift,
newsletter Arbeitskreis für Agrargeschichte Nr. 26, September 2009 Die Weberkarde Eine unentbehrliche Pflanze der Tuchmacher (Renate Bärnthol) S.
 Impressum Arbeitskreis für Agrargeschichte Vorsitz: Prof. Dr. Stefan Brakensiek Universität Duisburg-Essen Historisches Seminar Universitätsstr. 12 - Gebäude R12 D-45117 Essen stefan.brakensiek@uni-duisburg-essen.de
Impressum Arbeitskreis für Agrargeschichte Vorsitz: Prof. Dr. Stefan Brakensiek Universität Duisburg-Essen Historisches Seminar Universitätsstr. 12 - Gebäude R12 D-45117 Essen stefan.brakensiek@uni-duisburg-essen.de
Das grosse Mühlrad dreht sich
 Das grosse Mühlrad dreht sich Andelfingen (uok) Das 4,8 Meter grosse, rund drei Tonnen schwere Mühlrad der Andelfinger «Lindenmühle» dreht sich wieder. Es wurde in Lauenen bei Gstaad (BE) neu gebaut. Von
Das grosse Mühlrad dreht sich Andelfingen (uok) Das 4,8 Meter grosse, rund drei Tonnen schwere Mühlrad der Andelfinger «Lindenmühle» dreht sich wieder. Es wurde in Lauenen bei Gstaad (BE) neu gebaut. Von
Bezeichnung des Objektes. Eigentümer/ Besitzer, heute: Gemeinde Erlau Hauptstraße Erlau / OT Gepülzig. 1.1 heute: Gepülziger Mühle bis 1961
 1. Bezeichnung des Objektes 1.1 heute: Gepülziger Mühle bis 1961 1.2 früher: Gepülziger Mühle 1.3 Kartierungsnummer: K 1/47 2. Lage 2.1 Gemeinde Erlau /OT Gepülzig 2.2 Hauptstraße 2.3 Gewässer: Schönfelder
1. Bezeichnung des Objektes 1.1 heute: Gepülziger Mühle bis 1961 1.2 früher: Gepülziger Mühle 1.3 Kartierungsnummer: K 1/47 2. Lage 2.1 Gemeinde Erlau /OT Gepülzig 2.2 Hauptstraße 2.3 Gewässer: Schönfelder
Jahre. Internationale Spedition
 1919 1969 50 Jahre Internationale Spedition 50 Jahre Internationale Spedition 1919 1969 Hamburg, im Oktober 1969 So fing es damals an - 1919 Der Gründer der Firma Herr Paul Weidlich m 1. Nachkriegsjahr
1919 1969 50 Jahre Internationale Spedition 50 Jahre Internationale Spedition 1919 1969 Hamburg, im Oktober 1969 So fing es damals an - 1919 Der Gründer der Firma Herr Paul Weidlich m 1. Nachkriegsjahr
Die Ägypter stellten schon vor über 5.000 Jahren Brot her, es war ihr Hauptnahrungsmittel. So gab man den Ägyptern in der Antike auch den Beinamen
 Einst haben auch in Bremerhaven und umzu viele Windmühlen gestanden. Einige haben als Museum den Sprung in die Gegenwart geschafft, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Nur noch die Namen von Straßen
Einst haben auch in Bremerhaven und umzu viele Windmühlen gestanden. Einige haben als Museum den Sprung in die Gegenwart geschafft, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Nur noch die Namen von Straßen
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung Wohnhaus
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166059314120/ ID: 166059314120 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 63 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166059314120/ ID: 166059314120 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 63 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
Achimer Windmühle Wahrzeichen der Stadt an der Weser
 Achimer Windmühle Wahrzeichen der Stadt an der Weser Die Achimer Windmühle - einst errichtet, um Getreide zu mahlen und Mehl und Schrot herzustellen, ist die Windmühle heute als Baudenkmal und Wahrzeichen
Achimer Windmühle Wahrzeichen der Stadt an der Weser Die Achimer Windmühle - einst errichtet, um Getreide zu mahlen und Mehl und Schrot herzustellen, ist die Windmühle heute als Baudenkmal und Wahrzeichen
Gutsanlage Bendeleben, Familie von Arnim
 Gutsanlage Bendeleben, Familie von Arnim Die Gutsanlage Bendeleben ist als Kulturdenkmal gem. 2 Abs. 1 ThürDSchG als bauliche Gesamtanlage aus geschichtlichen, architekturgeschichtlichen, volkskundlichen
Gutsanlage Bendeleben, Familie von Arnim Die Gutsanlage Bendeleben ist als Kulturdenkmal gem. 2 Abs. 1 ThürDSchG als bauliche Gesamtanlage aus geschichtlichen, architekturgeschichtlichen, volkskundlichen
In den Naturpark Südheide
 Länge: 55.00 Steigung: + 64 m / - 79 m Start: Verlauf:, Oberohe, Hermannsburg Ziel: Überblick Kulturell und geschichtlich interessante Rundtour durch die Südheide tour900000212_8000_1.jpg Tourbeschreibung
Länge: 55.00 Steigung: + 64 m / - 79 m Start: Verlauf:, Oberohe, Hermannsburg Ziel: Überblick Kulturell und geschichtlich interessante Rundtour durch die Südheide tour900000212_8000_1.jpg Tourbeschreibung
Arbeitsblattsammlung Getreide
 Arbeitsblattsammlung Getreide Klasse 3 4 Angeboten wird eine Arbeitsblattsammlung für den Sachunterricht zum Lernbereich vom Korn zum Brot für die Klassen 3-4. Die Dateien müssen nur noch ausgedruckt werden.
Arbeitsblattsammlung Getreide Klasse 3 4 Angeboten wird eine Arbeitsblattsammlung für den Sachunterricht zum Lernbereich vom Korn zum Brot für die Klassen 3-4. Die Dateien müssen nur noch ausgedruckt werden.
Brackwedes "Glasmacherhäuser"
 Brackwedes "Glasmacherhäuser" Fast vergessen (8): An der Hauptstraße gab es eine Glashütte - und für ihre 50 bis 60 Mitarbeiter sowie deren Familien neu gebauten Wohnraum für Glasmacher Neue Westfälische
Brackwedes "Glasmacherhäuser" Fast vergessen (8): An der Hauptstraße gab es eine Glashütte - und für ihre 50 bis 60 Mitarbeiter sowie deren Familien neu gebauten Wohnraum für Glasmacher Neue Westfälische
Das Ende des Dreißigjährigen Krieges
 I Das Ende des Dreißigjährigen Krieges 1660 In Marxheim Marxheim gehörte in diesen Zeiten zu dem Gebiet, das im Jahre 1581 von Kaiser Rudolph dem Erzstift Mainz übertragen worden war. Nach Beendigung des
I Das Ende des Dreißigjährigen Krieges 1660 In Marxheim Marxheim gehörte in diesen Zeiten zu dem Gebiet, das im Jahre 1581 von Kaiser Rudolph dem Erzstift Mainz übertragen worden war. Nach Beendigung des
Ihre grüne Oase im Herzen von Lippe!
 Ihre grüne Oase im Herzen von Lippe! Objektbeschreibung Bei diesem Objekt handelt es sich um ein großzügiges Zweihaus in ruhiger Lage in Dörentrup. Die insgesamt 230 m² Wohnfläche teilen sich in drei Wohnungen
Ihre grüne Oase im Herzen von Lippe! Objektbeschreibung Bei diesem Objekt handelt es sich um ein großzügiges Zweihaus in ruhiger Lage in Dörentrup. Die insgesamt 230 m² Wohnfläche teilen sich in drei Wohnungen
Schulauer Fährhaus
 Schulauer Fährhaus Das Schulauer Fährhaus wurde 1864 erbaut. 1875 eröffnete hier die Gastwirtschaft Fährhaus zur schönen Elbaussicht. 1887 wurde ein Tanzsaal angebaut und 1952 die Schiffsbegrüßungsanlage
Schulauer Fährhaus Das Schulauer Fährhaus wurde 1864 erbaut. 1875 eröffnete hier die Gastwirtschaft Fährhaus zur schönen Elbaussicht. 1887 wurde ein Tanzsaal angebaut und 1952 die Schiffsbegrüßungsanlage
WITTMUND. St-Nicolai-Kirche Gottesdienste. Pastorin. Pastor. sonntags 10:00 Uhr. Jeden 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl
 WITTMUND St-Nicolai-Kirche Gottesdienste sonntags 10:00 Uhr Jeden 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl freitags 10:00 Uhr im Altenheim Johanneshaus" am Schützenplatz St.-Nicolai-Kirche (Wittmund) Die Kirche
WITTMUND St-Nicolai-Kirche Gottesdienste sonntags 10:00 Uhr Jeden 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl freitags 10:00 Uhr im Altenheim Johanneshaus" am Schützenplatz St.-Nicolai-Kirche (Wittmund) Die Kirche
02a / Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Historischer Hintergrund der Landwirtschaft
 Historischer Hintergrund der Landwirtschaft INHALT 1) Vom Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht 2) Die Anfänge der Landwirtschaft: Ackerbau und Viehzucht 3) Der Wandel der Landwirtschaft seit der
Historischer Hintergrund der Landwirtschaft INHALT 1) Vom Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht 2) Die Anfänge der Landwirtschaft: Ackerbau und Viehzucht 3) Der Wandel der Landwirtschaft seit der
Erneuerbare Energien unverzichtbar für
 Erneuerbare Energien unverzichtbar für regionale Energiekonzepte Lehrte-Ahlten 19. August 2011 Dr. Detlef Koenemann Fukushima Flutwelle Am 11.03.2011 überflutet ein Tsunami das Gelände des Kernkraftwerk
Erneuerbare Energien unverzichtbar für regionale Energiekonzepte Lehrte-Ahlten 19. August 2011 Dr. Detlef Koenemann Fukushima Flutwelle Am 11.03.2011 überflutet ein Tsunami das Gelände des Kernkraftwerk
Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist
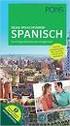 Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal
 Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal 1. Zur Geschichte der Burg und Siedlung Freusburg Im Früh- und Hochmittelalter gehörten die Wälder entweder dem König oder den hohen weltlichen und geistlichen
Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal 1. Zur Geschichte der Burg und Siedlung Freusburg Im Früh- und Hochmittelalter gehörten die Wälder entweder dem König oder den hohen weltlichen und geistlichen
Prüm früher heute. 28. Die verspätete Fertiggestellung des Prümer Abteigebäudes vor 100 Jahren. Von Erich Reichertz
 Prüm früher heute 28. Die verspätete Fertiggestellung des Prümer Abteigebäudes vor 100 Jahren Von Erich Reichertz In diesem Jahr kann im Prümer früheren Abteigebäude gleich zweimal Jubiläum gefeiert werden.
Prüm früher heute 28. Die verspätete Fertiggestellung des Prümer Abteigebäudes vor 100 Jahren Von Erich Reichertz In diesem Jahr kann im Prümer früheren Abteigebäude gleich zweimal Jubiläum gefeiert werden.
Kohle, Sonne, Wind und Wasser: Denkmale der Energietechnik in Brandenburg Last oder Chance?
 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum Kohle, Sonne, Wind und Wasser: Denkmale der Energietechnik in Brandenburg Last oder Chance? Dr. Matthias Baxmann Brandenburgisches
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum Kohle, Sonne, Wind und Wasser: Denkmale der Energietechnik in Brandenburg Last oder Chance? Dr. Matthias Baxmann Brandenburgisches
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burg Wart- Eine Wanderung von Burg zu Bergwerk Von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Spiegelberg Burg Wart- Eine Wanderung von Burg zu Bergwerk Von Frank Buchali Folgt man der Landstraße
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Spiegelberg Burg Wart- Eine Wanderung von Burg zu Bergwerk Von Frank Buchali Folgt man der Landstraße
THEMA. Bodenanalysen und Ovomaltine
 Der ursprüngliche Bau am Holzikofenweg 36 (1900). THEMA Holzikofenweg 36 Ein Gebäude mit Geschichte Autoren: Marie Avet und Isabel Herkommer, DBKO Fotos: Archiv Wander AG Nach rund drei Jahren ist die
Der ursprüngliche Bau am Holzikofenweg 36 (1900). THEMA Holzikofenweg 36 Ein Gebäude mit Geschichte Autoren: Marie Avet und Isabel Herkommer, DBKO Fotos: Archiv Wander AG Nach rund drei Jahren ist die
Doppelte Mühlenbücher der MVNB
 Doppelte Mühlenbücher der MVNB 1.4.19 1 Mühlen und Müller in Berlin Herzberg-Riseberg 305 Seiten 2 Mühlen in Berlin 1983 117 Seiten Genaue Beschreibung der Mühlentechnik, der verschiedenen Mühlentypen
Doppelte Mühlenbücher der MVNB 1.4.19 1 Mühlen und Müller in Berlin Herzberg-Riseberg 305 Seiten 2 Mühlen in Berlin 1983 117 Seiten Genaue Beschreibung der Mühlentechnik, der verschiedenen Mühlentypen
Ehem. Burg Oberstaad, Wohnturm
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210810819715/ ID: 210810819715 Datum: 21.02.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 1 In Oberstaad Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210810819715/ ID: 210810819715 Datum: 21.02.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 1 In Oberstaad Lage des Wohnplatzes
B2: Geschichte von Korn und Brot Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/6 Aufgabe Die SuS lesen die Geschichte und können die Bilder den einzelnen Textabschnitten zuordnen und einkleben. Ziel Die SuS kennen die Geschichte des Brotes: vom Anbau des Korns,
Lehrerinformation 1/6 Aufgabe Die SuS lesen die Geschichte und können die Bilder den einzelnen Textabschnitten zuordnen und einkleben. Ziel Die SuS kennen die Geschichte des Brotes: vom Anbau des Korns,
Video-Thema Begleitmaterialien
 Saubere Energie aus Norddeutschland Deutschland will seine Energie in Zukunft nicht mehr so produzieren, dass es der Umwelt schadet. Strom, der aus Wind produziert wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Saubere Energie aus Norddeutschland Deutschland will seine Energie in Zukunft nicht mehr so produzieren, dass es der Umwelt schadet. Strom, der aus Wind produziert wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.
1.Spiel um 16:45 Uhr Rot-Weiß Rehme TSV Bückeberge
 Hallenturnier am 18.02.2017 in Bad Oeynhausen um den Rehme-Cup 2017 Wir waren heute zu Gast Rot-Weiß Rehme in Bad Oeynhausen und starteten als B-Juniorinnen beim Damenturnier. Das reizvolle für uns dabei
Hallenturnier am 18.02.2017 in Bad Oeynhausen um den Rehme-Cup 2017 Wir waren heute zu Gast Rot-Weiß Rehme in Bad Oeynhausen und starteten als B-Juniorinnen beim Damenturnier. Das reizvolle für uns dabei
1. Ein kurzer Blick zurück: Die Zeche Hansa
 1. Ein kurzer Blick zurück: Die Zeche Hansa Die Geschichte der Kokerei Hansa ist eng mit der Historie der Zeche Hansa verbunden, weil hier bereits 1895 eine kleine Zechenkokerei in Betrieb genommen wurde,
1. Ein kurzer Blick zurück: Die Zeche Hansa Die Geschichte der Kokerei Hansa ist eng mit der Historie der Zeche Hansa verbunden, weil hier bereits 1895 eine kleine Zechenkokerei in Betrieb genommen wurde,
Um die Jacobskirche in Weimar
 Um die Jacobskirche in Weimar Eine Vorläuferkirche der Jacobskirche ist bereits in der Mitte des 12. Jhs. geweiht worden, als Pilgerkirche und als Kirche für die dörfliche Siedlung Weimar oder Wimare.
Um die Jacobskirche in Weimar Eine Vorläuferkirche der Jacobskirche ist bereits in der Mitte des 12. Jhs. geweiht worden, als Pilgerkirche und als Kirche für die dörfliche Siedlung Weimar oder Wimare.
AMERICAN FIRE FIGHTERS Rolf Stratemeyer 2005
 AUTO-MODELL-REPORT AMERICAN FIRE FIGHTERS Rolf Stratemeyer 2005 AMERICAN FIRE FIGHTERS Seit der Mensch das Feuer zu bändigen sucht, gibt es immer wieder unerwünschte Brände. In vergangenen Jahrhunderten
AUTO-MODELL-REPORT AMERICAN FIRE FIGHTERS Rolf Stratemeyer 2005 AMERICAN FIRE FIGHTERS Seit der Mensch das Feuer zu bändigen sucht, gibt es immer wieder unerwünschte Brände. In vergangenen Jahrhunderten
Die Leverkusen-Kennenlerntour
 Die Leverkusen-Kennenlerntour Am 01. Mai 2010 trafen sich 6 Paare der Tandemgruppe des ADFC Köln in Leverkusen vor dem Restaurant Wacht am Rhein zu einer vierstündigen Tour von rund 43 km innerhalb des
Die Leverkusen-Kennenlerntour Am 01. Mai 2010 trafen sich 6 Paare der Tandemgruppe des ADFC Köln in Leverkusen vor dem Restaurant Wacht am Rhein zu einer vierstündigen Tour von rund 43 km innerhalb des
Jahre Ortsverein Grassau
 Jahre Ortsverein Grassau ! Mitte der 50er Jahre, überall im Land blühte der wirtschaftliche Aufschwung und die sichtbaren Zeichen des langen, grausamen Krieges in den zerbombten deutschen Städten verschwanden
Jahre Ortsverein Grassau ! Mitte der 50er Jahre, überall im Land blühte der wirtschaftliche Aufschwung und die sichtbaren Zeichen des langen, grausamen Krieges in den zerbombten deutschen Städten verschwanden
Beunruhigt stellte Elvert fest, dass sich das Repertoire seiner Deeskalationsstrategien unaufhaltsam dem Ende zuneigte, während sein Gegenüber
 Beunruhigt stellte Elvert fest, dass sich das Repertoire seiner Deeskalationsstrategien unaufhaltsam dem Ende zuneigte, während sein Gegenüber zusehends lauter wurde. Er versuchte, sich daran zu erinnern,
Beunruhigt stellte Elvert fest, dass sich das Repertoire seiner Deeskalationsstrategien unaufhaltsam dem Ende zuneigte, während sein Gegenüber zusehends lauter wurde. Er versuchte, sich daran zu erinnern,
1.1 Geschichte: Die Standorte
 1.1 Geschichte: Die Standorte [?] = Die Daten sind nicht nachweisbar bzw. es handelt sich um Vermutungen. 1. Lambertikirchplatz 4, (21a) Coesfeld (Westf.) 4. April 1943 [März 1945?] Vor 1900»Colonialwaren
1.1 Geschichte: Die Standorte [?] = Die Daten sind nicht nachweisbar bzw. es handelt sich um Vermutungen. 1. Lambertikirchplatz 4, (21a) Coesfeld (Westf.) 4. April 1943 [März 1945?] Vor 1900»Colonialwaren
Deutsch Aktuell. Video-Thema Manuskript POTSDAM IN DER WEIHNACHTSSZEIT
 POTSDAM IN DER WEIHNACHTSSZEIT In Potsdam, der kleinen Nachbarstadt Berlins und der Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg, lebten früher viele preußische Herrscher und Könige. Im Advent, der Zeit vor
POTSDAM IN DER WEIHNACHTSSZEIT In Potsdam, der kleinen Nachbarstadt Berlins und der Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg, lebten früher viele preußische Herrscher und Könige. Im Advent, der Zeit vor
Die Jungsteinzeit begann vor etwa Jahren. Früher gab es noch keine Technologie, doch die Neandertaler, so hießen die Menschen früher, waren
 Jungsteinzeit Die Jungsteinzeit begann vor etwa 10 000 Jahren. Früher gab es noch keine Technologie, doch die Neandertaler, so hießen die Menschen früher, waren sehr einfallsreich! Sie bildeten damals
Jungsteinzeit Die Jungsteinzeit begann vor etwa 10 000 Jahren. Früher gab es noch keine Technologie, doch die Neandertaler, so hießen die Menschen früher, waren sehr einfallsreich! Sie bildeten damals
Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit?
 Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit? Plan der Stadt Gernsbach aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deutlich kann man die Murg und den ummauerten Stadtkern
Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit? Plan der Stadt Gernsbach aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deutlich kann man die Murg und den ummauerten Stadtkern
1 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz. Witterungsberichte Schweiz
 1 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz Witterungsberichte Schweiz 1870 1872 Witterungsberichte Schweiz 1870 1872 Herausgeber Bundesamt für
1 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz Witterungsberichte Schweiz 1870 1872 Witterungsberichte Schweiz 1870 1872 Herausgeber Bundesamt für
Archäologische Untersuchungen auf Burg Wölpe bei Erichshagen
 Archäologische Untersuchungen auf Burg Wölpe bei Erichshagen Wissenschaftliche Leitung: Dr. Tobias Gärtner Kooperationspartner: Museum Nienburg (Dr. des. Kristina Nowak-Klimscha), Kommunalarchäologie Schaumburger
Archäologische Untersuchungen auf Burg Wölpe bei Erichshagen Wissenschaftliche Leitung: Dr. Tobias Gärtner Kooperationspartner: Museum Nienburg (Dr. des. Kristina Nowak-Klimscha), Kommunalarchäologie Schaumburger
Emil Schütz baute den ehemaligen Güterbahnhof zu einer Großrösterei um und schloss in den nächsten Jahren nach und nach seine Filialen.
 Am 14. Juli 1914 erschien der am 15. April 1891 in Westfalen geborene Emil Schütz auf dem Gewerbeamt der Stadt Lehe und meldete an, dass er in der Hafenstraße 220 ein Fachgeschäft für Kaffee, Tee und Konfitüren
Am 14. Juli 1914 erschien der am 15. April 1891 in Westfalen geborene Emil Schütz auf dem Gewerbeamt der Stadt Lehe und meldete an, dass er in der Hafenstraße 220 ein Fachgeschäft für Kaffee, Tee und Konfitüren
Erfindungsreichtums, den diese Zeit hervorbrachte. Es gab wenig Kohle, um zu heizen, nichts zu essen und keine Kleidung für uns Kinder.
 Erfindungsreichtums, den diese Zeit hervorbrachte. Es gab wenig Kohle, um zu heizen, nichts zu essen und keine Kleidung für uns Kinder. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an eine kratzige Hose,
Erfindungsreichtums, den diese Zeit hervorbrachte. Es gab wenig Kohle, um zu heizen, nichts zu essen und keine Kleidung für uns Kinder. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an eine kratzige Hose,
BRÜDER GRIMM-PLATZ. Aufgabe: Wie hättet ihr ein solches Denkmal gestaltet? Stellt ein Denkmal nach und fotografiert euch dabei!
 1 BRÜDER GRIMM-PLATZ Die Brüder Grimm haben rund 30 Jahre ihres Lebens in Kassel verbracht. Am heutigen Brüder Grimm-Platz lebten sie von 1814 bis 1822 in der nördlichen Torwache. Zu jener Zeit hieß der
1 BRÜDER GRIMM-PLATZ Die Brüder Grimm haben rund 30 Jahre ihres Lebens in Kassel verbracht. Am heutigen Brüder Grimm-Platz lebten sie von 1814 bis 1822 in der nördlichen Torwache. Zu jener Zeit hieß der
61. Jahrgang. Der kleine hinkende. Hunsrücker Bote. Für die Rheinprovinz Auf das Jahr nach Chri` Geburt
 61. Jahrgang Der kleine hinkende Hunsrücker Bote Für die Rheinprovinz Auf das Jahr nach Chri` Geburt 1900 Welches ein Gemeinjahr von 365 Tagen i` (Meridian von Köln) Nach den Materialien des königl. Preußi
61. Jahrgang Der kleine hinkende Hunsrücker Bote Für die Rheinprovinz Auf das Jahr nach Chri` Geburt 1900 Welches ein Gemeinjahr von 365 Tagen i` (Meridian von Köln) Nach den Materialien des königl. Preußi
Industrialisierung / Industrielle Revolution (ab 1750 bis 1900)
 Industrialisierung / Industrielle Revolution (ab 1750 bis 1900) 1 Industrielle Herstellung von Gütern Der Einsatz von Maschinen löst Muskel-, Wind- und Wasserkraft ab Massenproduktion in Fabriken Energie
Industrialisierung / Industrielle Revolution (ab 1750 bis 1900) 1 Industrielle Herstellung von Gütern Der Einsatz von Maschinen löst Muskel-, Wind- und Wasserkraft ab Massenproduktion in Fabriken Energie
Beschreibung Routenverlauf: Reeser Rhein- und Meer-Tour (40 km, ca. 2,5 Stunden reine Fahrtzeit bei 15 km/h)
 Beschreibung Routenverlauf: Reeser Rhein- und Meer-Tour (40 km, ca. 2,5 Stunden reine Fahrtzeit bei 15 km/h) Für Liebhaber flacher Radwege entlang idyllischer Ufer ist die Reeser Rhein- und Meer-Tour genau
Beschreibung Routenverlauf: Reeser Rhein- und Meer-Tour (40 km, ca. 2,5 Stunden reine Fahrtzeit bei 15 km/h) Für Liebhaber flacher Radwege entlang idyllischer Ufer ist die Reeser Rhein- und Meer-Tour genau
Die Tricks der Pyramidenbauer
 Eckart Unterberger Die Tricks der Pyramidenbauer Vermessung und Bau der ägyptischen Pyramiden O N W Eckart Unterberger Die Tricks der Pyramidenbauer Vermessung und Bau der ägyptischen Pyramiden Herausgegeben
Eckart Unterberger Die Tricks der Pyramidenbauer Vermessung und Bau der ägyptischen Pyramiden O N W Eckart Unterberger Die Tricks der Pyramidenbauer Vermessung und Bau der ägyptischen Pyramiden Herausgegeben
Erläuterung zur Klassifizierung der Taschenuhren der. Deutschen Präzisionsuhren-Fabrik Glashütte (Sa.) e.g.m.b.h.
 Erläuterung zur Klassifizierung der Taschenuhren der Deutschen Präzisionsuhren-Fabrik Glashütte (Sa.) e.g.m.b.h. nach Kalibern, Typen und Werkqualitäten Die Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.)
Erläuterung zur Klassifizierung der Taschenuhren der Deutschen Präzisionsuhren-Fabrik Glashütte (Sa.) e.g.m.b.h. nach Kalibern, Typen und Werkqualitäten Die Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.)
Ernst-Ulrich Hahmann. Die. Ritterburgen. im Salzunger Land
 Ernst-Ulrich Hahmann Die Ritterburgen im Salzunger Land Obwohl das Schreiben eines Buches häufig ein einsames Unterfangen darstellt, kommt dennoch kein Autor ohne Hilfe aus. Ich habe mich mit vielen Menschen
Ernst-Ulrich Hahmann Die Ritterburgen im Salzunger Land Obwohl das Schreiben eines Buches häufig ein einsames Unterfangen darstellt, kommt dennoch kein Autor ohne Hilfe aus. Ich habe mich mit vielen Menschen
Vergessene Zeit Ein Wiederbelebungsversuch. Fotografien von Kirsten Mengewein 2007
 Vergessene Zeit Ein Wiederbelebungsversuch Fotografien von Kirsten Mengewein 2007 Magdeburg eine Stadt der Industrie, der Lebensmittelherstellung und des Schwermaschinenbaus. Eine Stadt, deren Silhouette
Vergessene Zeit Ein Wiederbelebungsversuch Fotografien von Kirsten Mengewein 2007 Magdeburg eine Stadt der Industrie, der Lebensmittelherstellung und des Schwermaschinenbaus. Eine Stadt, deren Silhouette
Haus der Wissenschaften, Düsseldorf Hans Schwippert
 Haus der Wissenschaften, Düsseldorf Hans Schwippert Das nach dem damaligen Ministerpräsidenten benannte Karl Arnold Haus, oder auch Haus der Wissenschaften, ist ein Auditoriengebäude in Düsseldorf. Die
Haus der Wissenschaften, Düsseldorf Hans Schwippert Das nach dem damaligen Ministerpräsidenten benannte Karl Arnold Haus, oder auch Haus der Wissenschaften, ist ein Auditoriengebäude in Düsseldorf. Die
VON DER KAPELLE INS RESTAURANT, VON DER KRIEGSRUINE IN FUGGERSCHE VERANTWORTUNG.
 VON DER KAPELLE INS RESTAURANT, VON DER KRIEGSRUINE IN FUGGERSCHE VERANTWORTUNG. DIE GESCHICHTE EINER GOTISCHEN GEWÖLBERIPPE.»Fugger im Archiv. Die Fundstücke-Geschichten.«ist eine jährliche Veranstaltung
VON DER KAPELLE INS RESTAURANT, VON DER KRIEGSRUINE IN FUGGERSCHE VERANTWORTUNG. DIE GESCHICHTE EINER GOTISCHEN GEWÖLBERIPPE.»Fugger im Archiv. Die Fundstücke-Geschichten.«ist eine jährliche Veranstaltung
Schloss Maiwaldau/Maciejowa
 Mai 2004 Maiwaldau Schloss Maiwaldau/Maciejowa Eines der schönsten Barock-Schlösser des Hirschberger Tales wurde 1686 von Graf Johann Ferdinand von Karwath zu einem repräsentativen Schloss ausgebaut. Das
Mai 2004 Maiwaldau Schloss Maiwaldau/Maciejowa Eines der schönsten Barock-Schlösser des Hirschberger Tales wurde 1686 von Graf Johann Ferdinand von Karwath zu einem repräsentativen Schloss ausgebaut. Das
gefördert durch: Titel Das Freilicht-Museum am Kiekeberg Freier Eintritt Mit Lage-Plan für alle unter 18 Jahren
 gefördert durch: Titel Das Freilicht-Museum am Kiekeberg Mit Lage-Plan Freier Eintritt für alle unter 18 Jahren Das Agrarium Haus 1 Das Agrarium ist eine große Ausstellungs-Halle im Museum. Agrar bedeutet:
gefördert durch: Titel Das Freilicht-Museum am Kiekeberg Mit Lage-Plan Freier Eintritt für alle unter 18 Jahren Das Agrarium Haus 1 Das Agrarium ist eine große Ausstellungs-Halle im Museum. Agrar bedeutet:
B1/B2 + Beruf: Vergleich von zwei Berufen Bäcker/in vs. Bäckerei-Fachverkäufer/in
 1 Vergleich Berufsbilder, geeignet für B1/B2 + Beruf Prüfungsvorbereitung B1/B2 + Beruf: Vergleich von zwei Berufen Bäcker/in vs. Bäckerei-Fachverkäufer/in Bäckereien sind in Deutschland sehr wichtige
1 Vergleich Berufsbilder, geeignet für B1/B2 + Beruf Prüfungsvorbereitung B1/B2 + Beruf: Vergleich von zwei Berufen Bäcker/in vs. Bäckerei-Fachverkäufer/in Bäckereien sind in Deutschland sehr wichtige
Die Tante mit der Synagoge im Hof Aus dem Leben rheinischer Landjuden.
 WDR 5 Diesseits von Eden Die Welt der Religionen Sendedatum: 27.07. und 29.07.2003 Beitrag Aus dem Leben rheinischer Landjuden. Manuskript: Kirsten Serup-Bilfeldt O-Ton: Ellen Eliel-Wallach Professor Stefan
WDR 5 Diesseits von Eden Die Welt der Religionen Sendedatum: 27.07. und 29.07.2003 Beitrag Aus dem Leben rheinischer Landjuden. Manuskript: Kirsten Serup-Bilfeldt O-Ton: Ellen Eliel-Wallach Professor Stefan
Video-Thema Begleitmaterialien
 KARLSRUHE: EINE STADT FEIERT GEBURTSTAG Karlsruhe, das in der Barockzeit um 1715 gegründet wurde, ist heute mit 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg. Charakteristisch für
KARLSRUHE: EINE STADT FEIERT GEBURTSTAG Karlsruhe, das in der Barockzeit um 1715 gegründet wurde, ist heute mit 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg. Charakteristisch für
Eine weltweit einzigartige kulturgeschichtliche Dokumentation über 2000 Jahre Mühlentechnik.
 Eine weltweit einzigartige kulturgeschichtliche Dokumentation über 2000 Jahre Mühlentechnik. Das Freilichtmuseum... 2 Das Mühlenmuseum... 3 Das historische Gewerbegebiet... 4 Chronik von Stoffels Säge-Mühle...5
Eine weltweit einzigartige kulturgeschichtliche Dokumentation über 2000 Jahre Mühlentechnik. Das Freilichtmuseum... 2 Das Mühlenmuseum... 3 Das historische Gewerbegebiet... 4 Chronik von Stoffels Säge-Mühle...5
Stadt Drensteinfurt. Mühlen- und Gerätemuseum Eickenbeck 44, Drensteinfurt
 Stadt Drensteinfurt Mühlen- und Gerätemuseum Eickenbeck 44, Drensteinfurt Die Alte Mühle in Rinkerode wurde 1810 durch Graf von Galen als Windmühle erbaut. Doch ganz so einfach ging das damals nicht: Dr.
Stadt Drensteinfurt Mühlen- und Gerätemuseum Eickenbeck 44, Drensteinfurt Die Alte Mühle in Rinkerode wurde 1810 durch Graf von Galen als Windmühle erbaut. Doch ganz so einfach ging das damals nicht: Dr.
Wandertag am 04. Juli 2015
 Traditionsgemeinschaft Pionierbataillon 320 e.v. 56112 Lahnstein, im Juli 2015 TG-320t-online.de www.tg-pibtl320.de Wandertag am 04. Juli 2015 Mit Schreiben vom 03.06.2015 wurde die Einladung zum diesjährigen
Traditionsgemeinschaft Pionierbataillon 320 e.v. 56112 Lahnstein, im Juli 2015 TG-320t-online.de www.tg-pibtl320.de Wandertag am 04. Juli 2015 Mit Schreiben vom 03.06.2015 wurde die Einladung zum diesjährigen
1.4 Aufgaben. 2002/2003
 .4 Aufgaben. 00/003 Aufgabe. Eine Firma stellt zwei Sorten A und B einer Meterware her. Pro Meter entstehen folgende Kosten und Erlöse in Euro: Rohstoffkosten Bearbeitungskosten Verkaufserlös A 6 3 5 B
.4 Aufgaben. 00/003 Aufgabe. Eine Firma stellt zwei Sorten A und B einer Meterware her. Pro Meter entstehen folgende Kosten und Erlöse in Euro: Rohstoffkosten Bearbeitungskosten Verkaufserlös A 6 3 5 B
VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES HÖRTEXTES
 VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES HÖRTEXTES Die Betriebswirtschaftslehre als Entscheidungslehre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Die Betriebswirtschaftslehre ist in Deutschland ein sehr beliebtes Studienfach.
VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES HÖRTEXTES Die Betriebswirtschaftslehre als Entscheidungslehre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Die Betriebswirtschaftslehre ist in Deutschland ein sehr beliebtes Studienfach.
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung Gasthaus Zum Bären
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185452828713/ ID: 185452828713 Datum: 28.11.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 18 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185452828713/ ID: 185452828713 Datum: 28.11.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 18 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
LWL-Gräftenhof :50 Uhr Seite 1. Gräftenhof. Arbeitsbogen Museumspädagogik
 LWL-Gräftenhof 3 21.09.2009 10:50 Uhr Seite 1 Gräftenhof 3 Arbeitsbogen Museumspädagogik LWL-Gräftenhof 3 21.09.2009 10:50 Uhr Seite 2 Text & Idee: Zeichnungen: Layout: Fotonachweis: LWL-Freilichtmuseum
LWL-Gräftenhof 3 21.09.2009 10:50 Uhr Seite 1 Gräftenhof 3 Arbeitsbogen Museumspädagogik LWL-Gräftenhof 3 21.09.2009 10:50 Uhr Seite 2 Text & Idee: Zeichnungen: Layout: Fotonachweis: LWL-Freilichtmuseum
Der Bordesholmer Damen-Kaffee-Club
 Barbara Rocca Der Bordesholmer Damen-Kaffee-Club Etwa in den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trafen sich diese Damen der Bordesholmer Gesellschaft einmal wöchentlich zum Kaffeeklatsch: 1 Obere
Barbara Rocca Der Bordesholmer Damen-Kaffee-Club Etwa in den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trafen sich diese Damen der Bordesholmer Gesellschaft einmal wöchentlich zum Kaffeeklatsch: 1 Obere
Das Kreis-Wahl-Programm der SPD
 Das Kreis-Wahl-Programm der SPD SPD ist eine Abkürzung. SPD bedeutet sozial-demokratische Partei Deutschlands. Das möchte die SPD im Land-Kreis Lüneburg In diesem Text stehen wichtige Informationen über
Das Kreis-Wahl-Programm der SPD SPD ist eine Abkürzung. SPD bedeutet sozial-demokratische Partei Deutschlands. Das möchte die SPD im Land-Kreis Lüneburg In diesem Text stehen wichtige Informationen über
Tag des offenen Denkmals am 13. September 2015 unter dem Mo o. "Handwerk, Technik, Industrie
 Tag des offenen Denkmals am 13. September 2015 unter dem Mo o "Handwerk, Technik, Industrie Liebe Bürgerinnen und Bürger, seit mehr als zwanzig Jahren führt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jeweils
Tag des offenen Denkmals am 13. September 2015 unter dem Mo o "Handwerk, Technik, Industrie Liebe Bürgerinnen und Bürger, seit mehr als zwanzig Jahren führt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jeweils
Lernvorgang am Beispiel eines Pferdes PROTOKOLL ZU DEN ERGEBNISSEN DER EXKURSION ZUM KINDERBAUERNHOF GROßZIEHTEN AM
 Lernvorgang am Beispiel eines Pferdes PROTOKOLL ZU DEN ERGEBNISSEN DER EXKURSION ZUM KINDERBAUERNHOF GROßZIEHTEN AM 10.12.14 Pascal A., Nils D., Jonas K., Fabiola S., Vanessa Z., Cally Biologie Leistungskurs
Lernvorgang am Beispiel eines Pferdes PROTOKOLL ZU DEN ERGEBNISSEN DER EXKURSION ZUM KINDERBAUERNHOF GROßZIEHTEN AM 10.12.14 Pascal A., Nils D., Jonas K., Fabiola S., Vanessa Z., Cally Biologie Leistungskurs
Der Stanser Dorfplatz Das Denkmal im öffentlichen Raum. Bild: Verlag Karl Engelberger, Stansstad
 Eine Zusammenarbeit des Nidwaldner Museums Aufgabe A.5. MS 2 und Sek Bild: Verlag Karl Engelberger, Stansstad Der Stanser Dorfplatz Das Denkmal im öffentlichen Raum Hier erfährst du, wie Stans und der
Eine Zusammenarbeit des Nidwaldner Museums Aufgabe A.5. MS 2 und Sek Bild: Verlag Karl Engelberger, Stansstad Der Stanser Dorfplatz Das Denkmal im öffentlichen Raum Hier erfährst du, wie Stans und der
Das kleine Dörfchen Buggow liegt an der Straße von Anklam nach Wolgast und hat seinen Ursprung in der Slawenzeit. Ein kleiner Bach (Libnower
 Das kleine Dörfchen Buggow liegt an der Straße von Anklam nach Wolgast und hat seinen Ursprung in der Slawenzeit. Ein kleiner Bach (Libnower Mühlenbach) durchzieht die Landschaft. 1 Buggow gehörte früher
Das kleine Dörfchen Buggow liegt an der Straße von Anklam nach Wolgast und hat seinen Ursprung in der Slawenzeit. Ein kleiner Bach (Libnower Mühlenbach) durchzieht die Landschaft. 1 Buggow gehörte früher
Geld verderbe den Charakter, heißt es allgemein gültig. Doch, lieber Herr Bock, diese oft verwendete Redewendung trifft auf Sie persönlich, wie
 Rede von Bürgermeister Werner Breuer anl. der Verabschiedung von Stadtkämmerer Klaus Bock am Montag, dem 19. Nov. 2001, 12.00 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses Geld verderbe den Charakter, heißt
Rede von Bürgermeister Werner Breuer anl. der Verabschiedung von Stadtkämmerer Klaus Bock am Montag, dem 19. Nov. 2001, 12.00 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses Geld verderbe den Charakter, heißt
