Das Weltgericht kann nicht entsetzlicher sein Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili
|
|
|
- Emil Schwarz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Seite 6 Problemhorizont 1. Notieren Sie, was Sie über Novellen, ihre Themen und ihren Aufbau wissen. Vgl. Sie zur Novelle die Definitionen auf S. 19 und Informieren Sie sich über die Ursachen und die allgemeinen Folgen von Erdbeben. Notieren Sie stichwortartig die Ergebnisse Ihrer Recherche. Hier wie in der nachfolgenden Aufgabe auf S. 7 kommt es darauf an, dass Sie sich gedanklich auf die Situation Erdbeben einlassen. Wesentliche Informationen zu Erdbeben, ihren Ursachen und Folgen finden Sie unter dem entsprechenden Stichwort bei wikipedia.org. Seite 7 1. Präzisieren Sie ausgehend von den Fotos die konkreten Auswirkungen, welche Naturkatastrophen auf den einzelnen Menschen, auf eine dörfliche oder städtische Gemeinschaft und auf eine ganze Gesellschaft haben können. Der Fokus sollte hier nicht nur auf dem menschlichen Elend, sondern auch auf positiven Begleiterscheinungen wie Hilfsaktionen liegen. 2. Beziehen Sie den Zeitungstext mit ein. Wie wird ein Erdbeben häufig von den Betroffenen interpretiert? Gemeint ist hier der Gedanke an ein göttliches Strafgericht (Z. 13 f.). 1 Der Boden wankte unter seinen Füßen einen epischen Text erschließen Seite Fassen Sie einer Mitschülerin/einem Mitschüler gegenüber den Inhalt der Geschichte zusammen und teilen Sie sich wechselseitig Ihre ersten Leseeindrücke mit. Halten Sie Ihre Wahrnehmungen und Erkenntnisse schriftlich fest. Formulieren Sie anschließend das Thema der Geschichte in einem Satz. Im Zentrum der Erzählung stehen zwischenmenschliche Beziehungen und ganz besonders die Liebesbeziehung zwischen Jeronimo und Josephe, die sich über die gesellschaftlichen und religiösen Konventionen hinwegsetzen. Ihre Beziehung setzt eine Spirale der Gewalt in Bewegung. Der Text wirft in besonderem Maße die Frage von Schuld und Strafe auf. 1. Untersuchen Sie den Anfang von Kleists Erzählung Das Erdbeben in Chili (Z. 1 45). Benennen Sie die wesentlichen inhaltlichen, strukturellen und thematischen Merkmale. Inhalt: Ausgangspunkt (erzählte Gegenwart) der Novelle sind das historische Erdbeben im Jahre 1647 in Chili und die Fokussierung der Geschichte auf das Schicksal des Hauslehrers Jeronimo Rugera. In einem Rückblick (erzählte Vergangenheit) wird die verbotene, da unstandesgemäße Liebesbeziehung des Hauslehrers mit seiner Schülerin Donna Josephe geschildert; als Josephe schwanger wird, schaltet ihr Vater die kirchlichen und weltlichen Strafinstanzen ein; Josephe soll öffentlich hingerichtet werden. In einer dramatischen Zuspitzung erfolgt der Rückbezug zur erzählten Gegenwart: die durch das Erdbeben verursachten Zerstörungen befreien Jeronimo aus dem Gefängnis. Struktur: Die Dreigliedrigkeit ergibt sich zum Teil aus dem erzählerischen Aufbau mit der Rückblende: privates Unglück (Verrat einer verbotenen Liebe; Unterbringung der Geliebten in einem Kloster; Bestrafung der Schwangerschaft der jungen Frau und Geburt eines Kindes durch Todesurteil; Selbstmordabsichten des verhafteten Kindsvaters am Tag der beabsichtigten Hinrichtung seiner Geliebten) kollektives Unglück (Naturkatastrophe: Zerstörung der Stadt durch ein Erdbeben) individuelle Rettung (Befreiung des Protagonisten aus dem Gefängnis, weil ein Gebäude einstürzt) 1
2 Thema: Im Zentrum des Erzählanfangs stehen zwischenmenschliche Beziehungen und ganz besonders die (sexuelle) Beziehung zwischen Mann und Frau. Auslöser der Konflikthandlung ist die Geburt eines Kindes außerhalb der gesellschaftlichen Konventionen des 18. Jahrhunderts. Jeronimo wird paradoxerweise gerettet durch eine Naturkatastrophe, die vielen Menschen den Tod bringt. Seite Analysieren Sie den Textabschnitt Z unter besonderer Berücksichtigung des Gottesbildes. Beziehen Sie in Ihre Deutung auch vorausgegangene und später folgende Ereignisse mit ein. Das Gottesbild ist im Ausschnitt überwiegend positiv (vgl. z. B. Er senkte sich so tief, dass seine Stirn den Boden berührte, Gott für seine wunderbare Errettung zu danken [ ]., Z. 63 f.; Mit welcher Seligkeit umarmten sie sich, die Unglücklichen, die ein Wunder des Himmels gerettet hatte!, Z. 90 f.), ist aber zumindest bei Jeronimo nicht frei von innerem Widerspruch (vgl. [ ] sein Gebet fing ihn zu reuen an, und fürchterlich schien ihm das Wesen, das über den Wolken waltet., Z. 69 f.). Die Deutung des Erdbebens als einer Strafe Gottes für die Sittenverderbnis der Stadtbewohner steht in einem direkten Gegensatz zur gleichfalls religiösen Interpretation der individuellen Rettung vor Gefängnisund Todesstrafe als einem göttlichen Gnadenakt. Es wird klar, dass zufällige Ereignisse von den Menschen je nach persönlicher Lage in beliebiger Weise als Ausdruck eines göttlichen Willens interpretiert werden als Hilfe in äußerster Bedrängnis (Jeronimo und Josephe) oder als grausame Bestrafung für die Verletzung göttlicher Gebote (Meister Pedrillo). 1. Der Textabschnitt Z enthält eine Fülle von religiösen bzw. biblischen Begriffen und Motiven. Ermitteln Sie entsprechende Textstellen, und untersuchen Sie ihre mögliche Funktion im Rahmen des Erzählten. Z : In Zeile 120 wird schon der Paradies-Garten ( Tal von Eden ) heraufbeschworen, der in diesem Abschnitt vom Erzähler ausgestaltet wird. Der Granatapfelbaum, unter dem das Paar sich lagert, erinnert an den Baum der Erkenntnis aus dem Paradiesgarten. Z : Das Zusammentreffen mit Don Fernando und seinen Angehörigen, der Wegfall aller sozialen Konventionen und Schranken, das vorbehaltlose Teilen weckt Erinnerungen an das biblische Gebot der nächsten- und Menschenliebe. Erinnert auch an die heidnischen Erzählungen vom Goldenen Zeitalter, in dem alle unbeschwert miteinander lebten. Z : Die Erzählungen von Augenzeugen aus der vom Erdbeben zerstörten Stadt erinnern an die biblischen Apokalypse-Erzählungen. Seite Im Übergangsteil zum Aufenthalt der Liebenden in einem Tal abseits der zerstörten Stadt heißt es: Josephe ging [ ] in ein dunkles, von Pinien beschattetes Tal [ } und fand ihn hier, diesen Geliebten, im Tale, und Seligkeit, als ob es das Tal von Eden gewesen wäre. Die Konjunktion als ob deutet bereits auf die Scheinhaftigkeit des Liebesglücks hin. Weisen Sie in der sogenannten Tal von Eden-Szene (Z ) durch unterschiedlich farbige Textmarkierungen sowohl Momente vollkommener Harmonie als auch Hinweise auf die Fragwürdigkeit dieser Harmonie nach. Der Anfang ihrer Bearbeitung könnte wie folgt aussehen: Dies alles erzählte sie jetzt voll Rührung dem Jeronimo, und reichte ihm, da sie vollendet hatte, den Knaben zum Küssen dar. Jeronimo nahm ihn, hätschelte ihn in unsäglicher Vaterfreude, und verschloss ihm, da er das fremde Antlitz anweinte, mit Liebkosungen ohne Ende den Mund. Indessen war die schönste Nacht herabgestiegen, voll wundermilden Duftes, so silberglänzend und still, wie nur ein Dichter davon träumen mag. Überall, längs der Talquelle, hatten sich, im Schimmer des Mondscheins, Menschen niedergelassen, und Nach der unvermuteten Befreiung aus Lebensgefahr und nach der glücklichen Wiedervereinigung der Liebenden bestimmen ausschließlich Emotionen das Handeln: ein Überschwang der Gefühle (Rührung, Freude, Weinen) äußert sich in Formen der unmittelbaren sinnlichen Zuwendung (Küsse, Liebkosungen). Das Berichtete erscheint als poetische Konstruktion / als bloße naturromantische Fiktion. 2
3 bereiteten sich sanfte Lager von Moos und Laub, um von einem so qualvollen Tage auszuruhen. Und weil die Armen immer noch jammerten; dieser, dass er sein Haus, jener, dass er Weib und Kind, und der dritte, dass er alles verloren habe: so schlichen Jeronimo und Josephe in ein dichtes Gebüsch, um durch das heimliche Gejauchz ihrer Seelen niemand zu betrüben. Sie fanden einen prachtvollen Granatapfelbaum, der seine Zweige, voll duftender Früchte, weit ausbreitete; und die Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges Lied. Hier ließ sich Jeronimo am Stamme nieder, und Josephe in seinem, Philipp in Josephens Schoß, saßen sie, von seinem Mantel bedeckt, und ruhten. Der Baumschatten zog, mit seinen verstreuten Lichtern, über sie hinweg, und der Mond erblasste schon wieder vor der Morgenröte, ehe sie einschliefen. Denn Unendliches hatten sie zu schwatzen vom Klostergarten und den Gefängnissen, und was sie um einander gelitten hätten; und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden! Dem individuellen Glück entspricht das kollektive einer Gesellschaft im Naturzustand. Das Bildrepertoire des Tal[s] von Eden enthält Elemente der alttestamentarischen Darstellung des Paradieses: Wie Adam und Eva halten sich Jeronimo und Josephe in einer vollkommen schönen Landschaft auf, die durch optische ( prachtvoll ), olfaktorische ( duftende Früchte ) und akustische Signale ( die Nachtigall flötete ihr wollüstiges Lied ) sinnlich erfahrbar ist. Für das absolute Liebesglück des Paares ( das heimliche Gejauchz ihrer Seelen ) bietet die Natur einen von der Seite ( Gebüsch ) und von oben geschützten Raum (ausgebreitete Zweige), der die intime Gemeinschaft von Mann, Frau und Kind hermetisch gegen die Außenwelt abschirmt. Zugleich verweist der Granatapfelbaum bereits auf das biblische Motiv der Verführung und des Sündenfalls. 1. Sprache und Stil von Kleists Erzählungen sind durch eine ganz persönliche Handschrift des Schriftstellers bestimmt. Beschreiben Sie anhand des Textabschnitts Z die typischen Merkmale der Erzähltechnik. Nutzen Sie die Checkliste zur Analyse epischer Texte auf S. 15/16. Analyse der Erzähltechnik Jeronimo nahm Josephen, nachdem sich beide in diesen Betrachtungen stillschweigend erschöpft hatten, beim Arm, und führte sie mit unaussprechlicher Heiterkeit unter den schattigen Lauben des Granatwaldes auf und nieder. Er sagte ihr, dass er, bei dieser Stimmung der Gemüter und dem Umsturz aller Verhältnisse, seinen Entschluss, sich nach Europa einzuschiffen, aufgebe; dass er vor dem Vizekönig, der sich seiner Sache immer günstig gezeigt, falls er noch am Leben sei, einen Fußfall wagen würde; und dass er Hoffnung habe (wobei er ihr einen Kuss aufdrückte), mit ihr in Chili zurückzubleiben. Josephe antwortete, dass ähnliche Gedanken in ihr aufgestiegen wären; dass auch sie nicht mehr, falls ihr Vater nur noch am Leben sei, ihn zu versöhnen zweifle; dass sie aber statt des Fußfalls lieber nach La Conception zu gehen, und von dort aus schriftlich das Versöhnungsgeschäft mit dem Vizekönig zu betreiben rate, wo man auf jeden Fall in der Nähe des Hafens wäre, und für den besten, wenn das Geschäft die erwünschte Wendung Feststellungen zu Zeitgestaltung, Erzählsituation, Redegestaltung, Bewusstseinswiedergabe Innerhalb des vorliegenden Textauszugs folgt die Erzählung der Chronologie der Handlung, bei der die Wiedergabe von Gesprächsinhalten in der indirekten Rede überwiegt. Im Dialog teilen die Sprechenden ihre Gedanken (Überlegungen, Pläne) und Gefühle (Hoffnungen, Ängste) mit. 3
4 nähme, ja leicht wieder nach St. Jago zurückkehren könnte. Nach einer kurzen Überlegung gab Jeronimo der Klugheit dieser Maßregel seinen Beifall, führte sie noch ein wenig, die heitern Momente der Zukunft überfliegend, in den Gängen umher, und kehrte mit ihr zur Gesellschaft zurück. Inzwischen war der Nachmittag herangekommen, und die Gemüter der herumschwärmenden Flüchtlinge hatten sich, da die Erdstöße nachließen, nur kaum wieder ein wenig beruhigt, als sich schon die Nachricht verbreitete, dass in der Dominikanerkirche, der einzigen, welche das Erdbeben verschont hatte, eine feierliche Messe von dem Prälaten des Klosters selbst gelesen werden würde, den Himmel um Verhütung ferneren Unglücks anzuflehen. Knappe Informationen reduzieren den Tagesablauf auf wesentliche Ereignisse. Der Erzähler verzichtet auf ausführliche Beschreibungen der Personen und / oder der Außen- und Innenwelt. Der Innenraum der Dominikanerkirche als dem einzig intakten Gebäude der vom Erdbeben zerstörten Stadt bietet den Bürgern ein sicheres Refugium. Das Kirchengebäude ist sowohl ein physischer als auch metaphysischer Schutzraum. Seite Der Schlussteil (Z ) erzählt von einer Spirale der Gewalt. Erstellen Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle eine Übersicht über den Ablauf der Ereignisse. Bewerten Sie Ihr Ergebnis vor dem Hintergrund der Frage nach der Eskalation des Bösen. Schlussteil Ablauf der Ereignisse Ort und Zeit Personen Handlung Dominikanerdom zu St. Jago einbrechende[ ] Dämmerung unermessliche Menschenmenge Jeronimo, Josephe Orgelmusik, Stille der Anwesenden Niemals schlug aus einem christlichen Dom eine solche Flamme der Inbrunst gen Himmel, wie heute aus dem Dominikanerdom zu St. Jago; und keine menschliche Brust gab wärmere Glut dazu her, als Jeronimos und Josephens! Innenraum der Kirche Kanzel: erhöhter Standort für Prediger innerhalb einer Kirche Kanzel Kirchenschiff ältester Chorherr Versammlung der Anwesenden Prediger Jeronimo und Josephe Donna Constanze Don Fernando Ormez Predigt in 4 Teilen: 1. Lob, Preis und Dank 2. Darstellung des Erdbebens als Vorboten des Weltgerichts 3. Verdammung der Sittenverderbnis der Stadt 4. Hinweis auf Gottes Güte als Ursache dafür, dass das Strafgericht noch nicht endgültig erfolgte Erwähnung des Frevels [ ] in dem Klostergarten der Karmeliterinnen Verdammung der Gottlosigkeit der Täter, deren Seelen der Geistliche allen Fürsten der Hölle übergibt Vergebliche Planung eines Fluchtversuchs 4
5 Vorplatz der Kirche Prediger Bürger von St. Jago eine Stimme eine andere Stimme ein Dritter Josephe mit Don Juan, dem Sohn Don Fernandos Schuhflicker / Schuster Meister Pedrillo Jeronimo Rugera mehrere der Umstehenden eine Stimme eine andere [Stimme] eine dritte[stimme] der wütende Haufen Don Fernando Ormez Don Alonzo Onoreja, ein Marine-Offizier von bedeutendem Range Jeronimo Rugera mit seinem Sohn Philipp Schuster Meister Pedrillo mehrere Stimmen Menschenmenge Vater Jeronimo Rugeras ( eine Stimme aus dem rasenden Haufen ) ein Unbekannter Don Fernando Ormez Donna Constanze Xares Jeronimo Rugera Josephe Identifizierung der gottlosen Menschen durch eine anonyme Person Kreisförmige Ausbreitung des Entsetzens angesichts der vermeintlichen Verursacher der Naturkatastrophe Tätlicher Angriff auf Josephe und das Kind in ihren Armen Schutzreaktion Don Fernandos Frage nach dem Vater des Kindes Josephe erklärt, dass es sich nicht um ihr leibliches Kinde, sondern um dasjenige Don Fernandos handle Die Anwesenden halten Don Fernando für Jeronimo Rugera Aufruf der Anwesenden zur Lynchjustiz an Don Fernando und an Josephe mit dem Kind: steinigt sie! steinigt sie! Jeronimo gibt sich zu erkennen Der Marineoffizier stellt sich dem bedrohten Stadtkommandanten Don Fernando zur Seite Josephe, die der wütenden Menschenmenge ausgeliefert ist, versucht durch ein Täuschungsmanöver ihren Sohn Philipp vor dem Tod zu retten Don Fernando verlässt mit Donna Constanze, Josephe und Jeronimo sowie den beiden Kindern den Innenraum der Kirche Der Vater von Jeronimo Rugera tötet seinen Sohn mit einem ungeheuren Keulenschlage Ermordung von Donna Constanze Xares Don Fernando versucht vergeblich, den fanatischen Mordknecht Pedrillo zu töten Meister Pedrillo erschlägt Josephe, die sich zu erkennen gibt. Don Fernando verteidigt vergeblich das Leben der beiden Kinder: sein Sohn Juan wird von Meister Pedrillo getötet 5
6 Finsternis der einbrechenden Nacht Wohnung Don Alonzos Seite 18 Marine-Offizier Don Alonzo Onojera Don Fernando Ormez seine Gemahlin Donna Elvire Aufbahrung der Toten in der Wohnung Don Alonzos Trauer Don Fernandos über den Tod seines Sohnes Juan Don Fernando verheimlicht den Tod des Sohnes gegenüber seiner Frau, teilt ihr aber schließlich doch die Nachricht mit Don Fernando und seine Frau Donna Elvire nehmen Philipp, den leiblichen Sohn der getöteten Eltern Jeronimo und Josephe, als Pflegekind an. 1. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Kayser hielt Don Fernando lediglich für eine Nebenfigur. Setzen Sie sich mit dieser Auffassung auseinander, indem Sie ein Personenporträt Fernandos erstellen. In Ihrem Personenporträt sollten Sie zunächst Don Fernandos Rolle für die Handlungsentwicklung deutlich machen (obwohl er von Josephes Schuld gewusst haben muss, bittet er sie um Milch; er ist es, der zum Besuch des Dankgottesdienstes aufruft; ), dann sein Verhalten bzw. seinen Charakter verdeutlichen (z. B. setzt er sich selbstlos für seine Familie ein). Beachten Sie dabei, dass es die Figur des Don Fernandos ist, durch die der Ausgang der Novelle eine versöhnliche Dimension bekommt. 1. Im ersten Satz seiner Analyse von Kleists Erdbeben in Chili schreibt der Literaturwissenschaftler Norbert Oellers 1998: Dies ist die Geschichte Begründen Sie diese Aussage auf der Basis Ihrer bisherigen Textanalyse. Dieser Aussage kann vorbehaltlos zugestimmt werden. Der Text weist eine klare Dreiteilung auf. Vor dem Hintergrund des Mittelteils, der Tal von Eden-Szene und der dort dargestellten idealen Welt (vgl. im Text vor allem Z ) erscheinen die Ereignisse des ersten und des dritten Teils in der Tat als Geschichte der Hoffnungslosigkeit. Was dort an Hoffnung aufkeimt, wird im dritten Abschnitt gänzlich zunichtegemacht. 2. Erörtern Sie die Gültigkeit der Aussage im Hinblick auf den Schlusssatz der Erzählung: Don Fernando und Donna Elvire nahmen hierauf den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an; und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich, und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsst er sich freuen. Die Aussage des Schlusssatzes ist doppeldeutig und nicht leicht chiffrierbar. Don Fernando hat sich Philipp durch eine heldenhafte Tat erworben, indem er sich als guter, nach ethischen Prinzipien handelnder Mensch gezeigt hat. Aber er hat auch einen hohen Preis dafür gezahlt, nämlich seinen eigenen Sohn. Und kann man sich am eigenen Gutsein wirklich freuen, wenn man diesen Preis gezahlt hat? Seite Norbert Oellers begründet die Titeländerung von Kleists Text folgendermaßen: Zum Inhalt gehört auch Erörtern Sie auf der Basis Ihrer Textanalysen diese Aussage. Es geht Kleist nicht um die Geschichte von Jerome und Josephe, nicht darum, das tragische Schicksal zweier Liebenden zu erzählen. Ihn interessieren an der Geschichte andere Themen: Wie entsteht Gewalt? Wie ist der Zusammenhang von Religion und Fanatismus? Wie sehen ideale menschliche Beziehungen aus? Und vor dem Hintergrund des Erdbebens von Lissabon steht natürlich die Frage im Mittelpunkt: Wie lassen sich Naturkatastrophen von Menschen interpretieren? Und welche Auswirkungen haben sie auf das herrschende Gottesbild? 6
7 Seite Begründen Sie ausgehend von diesen Definitionen, ob es sich bei Heinrich von Kleists Erdbeben in Chili eher um eine Erzählung oder um eine Novelle handelt. Wenn man für eine Erzählung im engeren Sinne als charakteristisches (weil nicht gleichsam in Abgrenzung zu anderen Textformen negativ formuliertes) Merkmal das dezentrierte, lockere, gelegentlich verweilende und entspannendes Entfalten des Erzählstoffes akzeptiert, ist das Erdbeben in Chili eher eine Novelle, wenn auch der Text nicht alle typischen Merkmale erfüllt. Seite Bestimmen Sie die zentrale These des Verfassers. Markieren Sie Textstellen, die der Begründung der These dienen. Klaus Müller-Salget vertritt die These, die Novelle habe eine durchgängig paradoxe Struktur (Z. 14). Die Mehrzahl dieser Paradoxa bezögen sich auf die Kritik an der vom Klerus beherrschten Gesellschaft (Z ) bzw. an den Institutionen überhaupt (Z ). Die Paradoxa umspielten darüber hinaus das Grundthema von Rettung und Vernichtung, das Müller-Salget für Kleist als nicht auflösbar ansieht (Z ). 2. Vergleichen Sie Ihre Arbeitsergebnisse mit denjenigen anderer Kursteilnehmer, und fassen Sie die Kernaussagen des Verfassers mit eigenen Worten zusammen. Die Aufgabe dient der Verständnissicherung, wobei die Schüler die Ausführungen Müller-Salgets auch im Einzelnen besprechen sollten. 3. Erläutern Sie, durch welche Kriterien die Wissenschaftlichkeit des Aufsatzes gewährleistet ist. Wichtige Kriterien sind: Bezug auf den Forschungsstand bzw. Vorarbeiten (vgl. die Hinweise auf Ellis und Wittkowski) argumentativ-belegende Textstruktur: der Autor entfaltet seine These und belegt sie mit Textverweisen textüberschreitender Fokus (insbesondere durch Hinweise auf die Biografie und das Werk Kleists, die Symbolik des Granatapfels in unterschiedlichen Kontexten) 2 Das Erdbeben von Lissabon und die Folgen textüberschreitende Aspekte einbeziehen Seite Bestimmen Sie beim Lesen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den historischen Fakten und der literarischen Darstellung des Erdbebens durch Heinrich von Kleist, der wahrscheinlich Kenntnis von den Augenzeugenberichten hatte. Es dominieren die Unterscheide: Kleist verändert Details und verzichtet außerdem auf die Darstellung von übernatürlichen und wundersamen Begleiterscheinungen (vgl. im Text die Z ). Während beim realen Erdbeben von Chili der Bischof überlebt und in seiner anschließenden Predigt die Vorstellung vom göttlichen Strafgericht energisch zurückweist, stellt Kleist gerade dieses Problem ins Zentrum seiner Novelle. Seite Informieren Sie sich über das Erdbeben von 1755 und die intellektuelle Debatte, die es nach sich zog. Die Aufgabe kann textbezogen bearbeitet werden und soll im Wesentlichen die Lektüre der nachfolgenden Texte vorbereiten: 7
8 philosophisch war zu klären, wie weit das aufklärerische Konzept einer in sich vernünftig organisierte Natur der Erforschung wie der Nachahmung der Natur weiterhin zugrunde gelegt werden konnte (Z. 5 ff.) theologisch war das Konzept der Theodizee ins Schwanken geraten (vgl. Z. 7 f.) Seite Erläutern Sie die Darstellung des Erdbebens durch Goethe, und erschließen Sie die existenzielle Wirkung, welche die Berichte der Katastrophe auf den Dichter hatten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kleine Goethe sein Gottvertrauen erschüttert sah ( Gott [ ] hatte sich [ ] keineswegs väterlich bewiesen, Z ). Seite Untersuchen und vergleichen Sie die Texte von Gleim, Voltaire und Kant im Hinblick auf die Sicht des Erdbebens. Gleim: Der Sprecher im Gedicht zeigt sich im Glauben an die Güte und Weisheit Gottes unerschüttert. Voltaire: Deutlich wird, dass Voltaire die Vorstellung von einem Strafgericht Gottes nicht teilt, sondern in erster Linie die Gelegenheit nutzt, Leibniz Aufklärungsoptimismus zu verspotten. Kant: Sieht die Vorstellung an ein Strafgericht Gottes als sträflichen Vorwitz (Z. 18) man beachte im Übrigen die Modernität der praktischen Aussagen (insbesondere Z. 4 10). 2. Vergleichen Sie damit Kleists Deutung des Erdbebens in Das Erdbeben von Chili. Bei Kleist ist das Erdbeben kein Indiz für göttliches Wirken, sondern ganz Naturereignis. (Auch für Jeronimo und Josephe, für die das Beben zunächst wie eine durch Gott bzw. die Jungfrau Maria bewirkte Fügung erscheinen mag, bringt es letztlich keine Rettung). 3 Unterdessen wurde die Stadt Lissabon epische Texte vergleichen Seite Analysieren Sie Johann Peter Hebels Unverhofftes Wiedersehen (1812). Achten Sie besonders auf die Zeitgestaltung. Das Unverhoffte Wiedersehen weist ein klassisches Erzählsetting auf (Ort, Zeit, Personen und Thema werden in einem Satz genannt), die eigentliche Handlung wird rasch entfaltet, wobei durch das möchte ich lieber im Grab sein eine erste Vorausdeutung gemacht wird. Nach dem Tod des Jünglings wird in extremer Zeitraffung der Zeitraum von 50 Jahren überbrückt. Am Johannistag, dem längsten Tag des Jahres) wird der ehemalige Verlobte zu Tage gefördert und anschließend begraben. Die Braut, die zuvor in einer kurzen Rückblende den Anwesenden ihre Beziehung zum Bergmann erklärt hatte, trägt zu seiner Beerdigung ihr Hochzeitsgewand und jenes schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen (Symbol hier für die Liebe, die den Tod umrahmt und mithin aufhebt). Sie äußert ihre Gewissheit, dass Gott sie mit ihrem Bräutigam am Jüngsten Tag zusammenführen wird ( Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie auch zum zweitenmal nicht behalten. ). 2. Vergleichen Sie Hebels Unverhofftes Wiedersehen (1812) und Kleists Das Erdbeben in Chili (1810) im Hinblick auf Unterschiede in der Darstellung und Deutung der menschlichen Existenz. Tragen Sie Ergebnisse in die Tabelle auf S. 30 ein. 8
9 Gemeinsamkeiten: Erdbeben als historischer Bezugspunkt der erzählten Geschichte Allgegenwart des Todes Darstellung einer tiefen Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau Überwindung der Todesmacht durch die menschliche Liebe Bestimmung des menschlichen Lebens durch religiösen Glauben: Vertrauen der Protagonisten in das Heilswirken Gottes Dreiteiligkeit der Handlung (Kleist: Naturkatastrophe soziale Idylle der Solidarität in der Tal-von-Eden-Szene Gewaltexzesse; Hebel: Tod des Geliebten Weltgeschichte Wiedersehen und Glück) Übereinstimmende Erzählform: auktoriale Erzählsituation, bildhaft-anschauliche Darstellungsweise Unterschiede: Kleist: Erdbeben in Chili (1807/1810) Hebel: Unverhofftes Wiedersehen (1812) Erzählte Zeit umfasst anderthalb Tage; Erzählte Zeit umfasst 50 Jahre; linearer linearer Erzählstrang ohne Erzählstrang mit Vorausdeutungen. Vorausdeutungen. Christliche Motivik verweist auf den Christliche Motivik verweist auf den Jüngsten Paradiesgarten Eden und den Sündenfall. Tag und die Auferstehung. Kurzzeitige Erneuerung des Liebesglücks; die Hoffnungen, die sich die Liebenden in der Tal-von-Eden-Szene machen, erfüllen sich nicht: das gemeinsame Kind Philipp als Symbol für eine bessere Zukunft? Zufall als Erzählprinzip (die glückliche Rettung Jeronimos und Josephes, ihr zufälliges Wiedersehen, die Begegnung mit Don Fernando, ) Erschütterung des Glaubens an die göttliche Gerechtigkeit (thematisch); eine göttliche Ordnung wird nicht behauptet. Erneuerung des Liebesglücks und metaphysische Heilszuversicht: Wiedererkennung des toten Geliebten und Vertrauen in eine seelische Wiedervereinigung nach dem Tod der Braut. Rationalität des Erzählten, Logik und Plausibilität des Handlungsverlaufs, z. B. Mumifizierung des verunglückten Bergmanns durch Eisenvitriol usw. Erzählung als Ausdruck eines Vertrauens in eine gottgewollte Ordnung der Welt. Seite Hebels Geschichte gehört zum literarischen Genre der Kalendergeschichte. Weisen Sie die Merkmale am Text Unverhofftes Wiedersehen nach. Hebels Geschichte ist kurz, unterhaltend (durch das versöhnliche Ende) und hat einen starken didaktischen Duktus (zum einen durch die Zusammenfassung der geschichtlichen Ereignisse der vergangenen 50 Jahre, zum anderen durch die theologische Ermahnung, an das Jüngste Gericht und die Auferstehung zu glauben). 9
10 Die kurze, überraschende Wendung Heinrich von Kleist: Anekdoten Seite 32 Problemhorizont 1. Rufen Sie sich zwei Anekdoten, die Sie kennen, in Erinnerung und erläutern Sie, welche Funktion Anekdoten auch in Alltagsgesprächen haben. Eine wichtige Funktion der Anekdote ist die Unterhaltung. 2. Beschreiben Sie stichwortartig aufgrund Ihrer Vorkenntnisse die Unterschiede zwischen Witz, Aphorismus und Anekdote. Aphorismus: kurzer, schlagkräftig und prägnant formulierter einzelner Prosasatz, mit dem ein überraschendes persönliches Urteil formuliert wird; ein Aphorismus kann, muss aber nicht pointenartig sein. Witz: meist dialogische Kürzestgeschichte, deren Spannung sich durch ein unerwartetes Umschlagen des Deutungshorizontes ins Komische entlädt. Im Unterschied zum Witz wird in der Anekdote ein charakteristischer menschlicher (oder persönlicher) Charakterzug verdeutlicht; vgl. zur Anekdote weiter S Ein merkwürdiger Vorfall Textsorte Anekdote bestimmen Seite Fassen Sie zusammen, welchen Stellenwert Fontane der Anekdote beimisst. Fontane schildert anschaulich die anekdotischen Unterrichtsstunden seines Vaters, dass er ihnen alles Beste, jedenfalls alles Brauchbarste, was ich weiß (Z. 57) verdanke. 1. Leiten Sie aus den drei Anekdoten eine vorläufige Definition der Textsorte ab. Deutlich werden sollte, dass eine Anekdote eine epische Kleinform ist, die ein Geschehen, das einen überraschenden Ausgang hat, komprimiert. 2 Da ist gutes Trinkgeld zu verdienen Kleists Anekdoten in den historischen Kontext einordnen Seite Halten Sie die Aussage der Anekdote in einem Satz fest. Informieren Sie sich über den historischen Hintergrund. Beziehen Sie die Abbildungen und die Zeittafel auf S. 36/37 mit ein. Unruhe, aber auch Wertschätzung übersteigt bei Außenstehenden oft die der Betroffenen. Historisch könnte sich die Anekdote auf die Schlacht bei Jena und Auerstedt (14. Oktober 1806) beziehen, bei der die preußische Armee vernichtend geschlagen wurde. 2. Erläutern Sie, welche Wirkung Kleist mit dieser Geschichte erzielen will. Neben dem Aspekt der Unterhaltung sowie der allgemeinen Lehre (vgl. Aufgabe 1) lobt Kleist mit seinem Text auch soldatisches (preußisches) Heldentum. Seite Vergleichen Sie die beiden Anekdoten im Hinblick auf inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Den beiden Anekdoten liegt dieselbe Begebenheit zugrunde, wobei diese bei Hebel sehr anschaulich, mit vielen Attributen, aber auch relativ breit erzählt wird. Gemeinsam ist beiden Anekdoten außerdem, dass ihre Erzähler sie direkt bewerten ( wert in Erz gegossen zu werden bei Kleist, der Schlusssatz als Erzählerkommentar bei Hebel). 10
11 Die kurze, überraschende Wendung Heinrich von Kleist: Anekdoten 2. Analysieren Sie beide Texte im Hinblick auf die Bedeutung der erzählten Geschichte und ihrer Pointen. Aufgrund der strafferen Erzählweise tritt die Pointe bei Kleist schärfer hervor. 3. Wie gibt sich Kleist als preußischer Patriot zu erkennen? Durch die vorgenommene Bewertung unter der Überschrift, dann aber auch durch die Tatsache, dass der die Begebenheit überhaupt erzählt. 4. Arbeiten Sie an den beiden Texten die den Definitionen (vgl. S. 38/39) nach typischen Gattungsmerkmale der Anekdote heraus. Vgl. S Weisen Sie nach, in welcher Weise auch Kleists Das Erdbeben in Chili Merkmale des Anekdotischen aufweist. Betont man bei der Anekdote vor allem die Merkmale der Überraschung und der Pointe, dann lassen sich im Erdbeben viele Stellen als anekdotisch deuten, z. B. die Niederkunft Josephes auf den Stufen der Kathedrale, die Entrüstung der Matronen wegen Josephes Enthauptung (statt sie zu verbrennen), das Klammern Jeronimos an den Pfeiler (an dem er sich gerade hatte aufhängen wollen). Seite Lesen Sie die Kleist-Texte. Fassen Sie Kleists politische Überzeugungen in zwei, drei Sätzen zusammen. Erörtern Sie, ob sich vor diesem Hintergrund Kleists Anekdote Mutterliebe als Allegorie auf die Vaterlandsverteidigung interpretieren lässt. Kleist zeigt sich hier als Patriot, der dem Korsenkaiser mit großer Abneigung gegenübersteht und sich für die deutsche Sache stark macht: Insbesondere zweifelt er an dem von Napoleon genannten Kriegsgrund und strebt nach der Wiederherstellung Deutschlands. Die Anekdote Mutterliebe als Allegorie auf die Vaterlandsverteidigung gelesen ergäbe folgendes Bild: Die Liebe zum Vaterland erklärt und rechtfertigt (?) den Kampfeseinsatz bis zum Tode für dieses Vaterland gegen seine Bedroher. Für eine solche Deutung liefert der bloße Text allerdings keine Anhaltspunkte: Weder ist die Sprache der Situation unangemessen kriegerisch noch verweisen Ort und Zeit der Handlung auf ein Kriegsgeschehen. 11
12 Glücklich, glücklich, möchte ich gern werden Heinrich von Kleist: Briefe Seite 44 Problemhorizont 1. Verfassen Sie einen fiktiven Brief an eine Ihnen sehr vertraute Person, in dem Sie ein persönliches Versagen (z. B. eine Lüge) erklären. Beschreiben Sie anschließend Ihre Selbstdarstellung. Durch diese Schreibaufgabe soll Ihnen bewusst werden, dass man als Schreiber geneigt ist, sich selbst in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen. 2. Halten Sie stichwortartig fest, was Sie über Heinrich von Kleist bereits wissen (seine Werke, seine Familie, sein Freundeskreis, seine Überzeugungen, ) bzw. bereits gelernt haben. Hier wird keine Lösung im eigentlichen Sinne angestrebt: Wichtig ist, dass Sie Ihr Vorwissen zu Kleist aktivieren und gedanklich ordnen. 3. Recherchieren Sie, was eine adlige Herkunft zu der Zeit um 1800 bedeutet. Eine adlige Abkunft eröffnete zwar große Lebenschancen, bedeutete aber oftmals auch vorgezeichnete Lebens- und Karrierewege. Für Söhne aus verarmten adligen Häusern wie Kleist war eine Offizierslaufbahn meist obligatorisch. 1 Kleist in seinen Briefen autobiografische Zeugnisse auswerten 1.1 Aufbruch ins Ungewisse Seite Charakterisieren Sie anhand der vorliegenden Briefe Heinrich von Kleist. Kleist fehlt es an der Fähigkeit, sich ein- und unterzuordnen, was auch der Grund für den Abbruch der Militärlaufbahn darstellt ( verzieh, wo ich hätte strafen sollen, S. 45, Z. 8). Die Briefe zeigen Kleist darüber hinaus als einen suchenden, schwankenden Menschen (vgl. etwa den Brief an Ulrike im Mai 1799), der seine Ziellosigkeit offen und ehrlich eingesteht. Von sich selbst behauptet Kleist, Bildung sei ihm das einzige Ziel, Wahrheit der einzige Reichtum (vgl. im Brief an Wilhelmine vom 22. März 1801 Z. 7 ff.). 2. Bestimmen Sie den Einfluss der Aufklärung auf sein Handeln und Denken. Der Brief vom 22. März 1801 ist beredtes Zeugnis von Heinrich von Kleists sogenannter Kant-Krise: Die durch die Kant-Lektüre gewonnene Erkenntnis, dass ein objektives Erkennen von Wahrheit nicht möglich ist, erschüttert den nach Wahrheit Strebenden Kleist so sehr, dass er zeitweilig unfähig zur Arbeit ist. Seite Beschreiben Sie anhand des Briefes die Lebenssituation und die existenzielle Problematik, in der sich Heinrich von Kleist befindet. Benutzen Sie die Tabelle auf S. 52. Ulrike: Nie denke ich anders an Dich, als mit Stolz und Freude, denn Du bist die einzige, oder überhaupt der einzige Mensch, von dem ich sagen kann, dass er mich ganz ohne ein eignes Interesse, ganz ohne eigne Absichten, kurz, dass er nur mich selbst liebt. (Z. 7 ff.) Vgl. zu den übrigen Punkten Aufgabe 1 auf S. 56. Seite Erschließen Sie die thematischen Schwerpunkte des Briefes an Wilhelmine von Zenge. Tragen Sie sie in das Arbeitsblatt ein. Vgl. dazu Aufgabe 1 auf S
13 Glücklich, glücklich, möchte ich gern werden Heinrich von Kleist: Briefe Seite Vergleichen Sie die Briefe Heinrich von Kleists an seine Schwester und an seine Verlobte im Hinblick auf thematische, inhaltliche und sprachlich-formale Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Brief aus Berlin 5. Februar 1801 an Halbschwester Ulrike von Kleist Berlin: negative Darstellung der volkreichen Königsstadt, die er als traurigen Ort bezeichnet. Ich und Gesellschaft: Problematik der Anpassung des Individuums an die sozialen Normen und Konventionen: ich passe mich nicht unter die Menschen [ ]; sie gefallen mir nicht. Indessen wenn ich mich in Gesellschaften nicht wohl befinde, so geschieht dies weniger, weil andere, als vielmehr weil ich mich selbst nicht zeige, wie ich es wünsche. Die Notwendigkeit, eine Rolle zu spielen, und ein innerer Widerwillen dagegen machen mir jede Gesellschaft lästig, und froh kann ich nur in meiner eignen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das darf man unter Menschen nicht sein und keiner ist es [ ]. Geld: Hinweise auf Probleme bei der Finanzierung des Lebensunterhalts; existenzielle Not des Verfassers. Berufstätigkeit: berufliche Unentschlossenheit: Noch immer habe ich mich nicht für ein Amt entscheiden können. Indessen sehe ich [ ], dass ich ganz unfähig bin, ein Amt zu führen. Studium der Wissenschaft: Forschung erscheint als parasitärer Akt und als Verlust einer ganzheitlichen Sicht auf die Welt: Diese Menschen sitzen sämtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt seines sei das beste, und um den Baum bekümmern sie sich nicht. Brief aus Paris 10. Oktober 1801 an Verlobte Wilhelmine von Zenge Paris: Paris wird von Heinrich von Kleist ebenfalls als traurige Stadt bezeichnet Ich und Gesellschaft: Eine Reihe von Jahren, in welchen ich über die Welt im großen frei denken konnte, hat mich dem, was die Menschen Welt nennen, sehr unähnlich gemacht. Manches, was die Menschen ehrwürdig nennen, ist es mir nicht, vieles, was ihnen verächtlich scheint, ist es mir nicht. Ich trage eine innere Vorschrift in meiner Brust, gegen welche alle äußern, und wenn sie ein König unterschrieben hätte, nichtswürdig sind. Daher fühle ich mich ganz unfähig, mich in irgendein konventionelles Verhältnis der Welt zu passen. Geld: [ ] ich habe noch etwas von meinem Vermögen, wenig zwar, doch wird es hinreichen mir etwa in der Schweiz einen Bauerhof zu kaufen, der mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite [sic!]. Zukunftspläne: Unter den persischen Magiern gab es ein religiöses Gesetz: ein Mensch könne nichts der Gottheit Wohlgefälligeres tun, als dieses, ein Feld zu bebauen, einen Baum zu pflanzen, und ein Kind zu zeugen. Das nenne ich Weisheit, und keine Wahrheit hat noch so tief in meine Seele gegriffen, als diese. Das soll ich tun, das weiß ich bestimmt. Wissenschaft: Die Wissenschaften habe ich ganz aufgegeben. Ich kann Dir nicht beschreiben, wie ekelhaft mir ein wissender Mensch ist, wenn ich ihn mit einem handelnden vergleiche. [ ] 13
14 Glücklich, glücklich, möchte ich gern werden Heinrich von Kleist: Briefe Sprache und Kommunikation: wiederholt negative Darstellung der Möglichkeitsbedingungen von Kommunikation: Und gerne möchte ich Dir alles mitteilen, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich, und wenn es auch kein weiteres Hindernis gäbe, als dieses, dass es uns an einem Mittel der Mitteilung fehlt. Selbst das einzige, das wir besitzen, die Sprache taugt nicht dazu, sie kann die Seele nicht malen, und was sie uns gibt sind nur zerrissene Bruchstücke. Stilmerkmale: anspruchsvolle Syntax häufiger Gebrauch des Klagerufs ach Einbau eines fingierten Dialogs: Ach, Du weißt nicht, wie es in meinem Innersten aussieht. Aber es interessiert Dich doch? O gewiss! Und gern möchte ich Dir alles mitteilen [ ]. Sprache und Kommunikation: Sprache als Mittel der Kommunikation ist intakt Stilmerkmale: anspruchsvolle Syntax häufiger Gebrauch des Klagerufs ach und der Interjektion o Binnengliederung durch Fragen, die anschließend beantwortet werden (als scheinbar dialogische Element) direkte Ansprache und Anrufe ( Wilhelmine! ) 1.2 Anfänge als Dichter Seite Informieren Sie sich über Kleists literarische Anfänge. Nach seinem Abschied vom Militär begann Kleist zunächst 1799 in seiner Heimatstadt Frankfurt ein Studium (Naturwissenschaften, Latein). Anfang 1800 folgte die Verlobung mit Wilhelmine von Zenge. Im Sommer desselben Jahres führte Kleist eine Reise über Dresden nach Würzburg, wo er sich für das schriftstellerische Fach entschied. Der Aufenthalt in Thun 1802 führte zu wichtigen Freundschaften (u. a. mit dem Dichter H. Zschokke) und erhärtete seinen Wunsch, Schriftsteller zu werden. Seite Informieren Sie sich über das Leben Heinrich von Kleists zwischen 1802 und Halten Sie wichtige Lebensstationen stichwortartig fest. Hier können Sie die folgende Tabelle fortsetzen. Sie können den über Online-Link abrufbaren Lexikonartikel heranziehen. (Vgl. S. 79) Jahr Ort Ereignisse 1802 Schweiz Auflösung der Verlobung mit Wilhelmine von Zenge 1803 Dresden Paris Verbindung mit Henriette von Schlieben körperlicher und seelischer Zusammenbruch 1804 Paris Berlin Uraufführung der Familie Schroffenstein in Graz Eintritt in den preußischen Staatsdienst 1805 Königsberg Angestellter der Domänenkammer 1806 Königsberg Beendigung der Beamtenlaufbahn 2. Ordnen Sie jeder Lebensstation einen charakteristischen Brief bzw. Briefausschnitt zu. Briefe finden Sie in einer Gesamtausgabe der Werke Kleists (z. B. von Helmut Sembdner oder Siegfried Streller) oder unter Unter der angegebenen Adresse finden sich die wichtigsten Briefe, sortiert nach Entstehungsdatum, im Volltext, sodass eine entsprechende Zusammenstellung keine Schwierigkeiten bereiten dürfte. Es empfiehlt sich dabei eine Gruppenarbeit (jeweils eine Gruppe könnte sich die Briefe von zwei Jahren durchsehen und entsprechende Ausschnitte herauskopieren). 14
15 Glücklich, glücklich, möchte ich gern werden Heinrich von Kleist: Briefe 2 Kleists Leben aus der Distanz von heute autobiografische Zeugnisse bewerten Seite Erläutern Sie, wie der Verfasser die Lebensstationen Kleists deutet. Rüdiger Safranski folgt (vgl. dazu auch Aufgabe 2 auf S. 65) der Selbstdarstellung Kleists (die Schulz im nachfolgenden Text als Autosuggestion bezeichnet), wodurch die Abfolge der einzelnen Lebensstation und Lebenspläne natürlich (organisch) erscheinen. Seite Vergleichen Sie die beiden Textauszüge mit Blick auf die Bewertung von Kleists Leben: Welche charakterlichen Eigenschaften werden ihm jeweils zugesprochen? Safranski: Zentrale Charaktereigenschaft Kleists ist nach Safranski dessen Selbstzweifel (Z. 8, 25). Dieser führt entweder zur emphatischen Selbstidentifikation (Z. 32), zu der auch der Ehrgeiz zu zählen ist, oder zum Selbstekel (Z. 32), der in schlimmster Form wiederum zum Selbstvernichtungswunsch (vgl. sein Versuch, in der französischen Armee aufgenommen zu werden) werden kann. Schulz: Schulz betont vor allem Kleists existenziell bedingte[s] Krisenbewusstsein (Z. 81), das Kleist immer wieder zum Rettungsring der Selbsttäuschung (Z. 65) ergreifen ließ. 2. Prüfen Sie, welchen Stellenwert die beiden Autoren den Briefen von Kleist als Selbstzeugnissen beimessen. Bei Safranski wird nicht deutlich, dass er den Briefen Kleists in der Form skeptisch entgegentritt, wie dies Schulz formuliert: Die Briefe sind Produkte bestimmter Situationen und nicht nur Selbstausdruck, sie sind an andere Menschen gerichtete Dokumente und damit zugleich auf die Eigenheiten der Adressaten bezogen, auf die sie wirken sollen. Kleist aber war in seinen Briefen ein Meister der Suggestion und der versuchten Manipulation, nicht selten auch der Autosuggestion hinsichtlich bevorstehenden eigenen Glückes und Gelingens. (Z ) 15
16 Seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater Seite 66 Problemhorizont 1. Notieren Sie, was Sie über die Kunstauffassung der Weimarer Klassik und der Frühromantiker wissen. Hier sollten Sie Ihr Vorwissen aktivieren (ggf. können sie auch in Literaturlexika nachschlagen); folgende Aspekte sollten sie im Bewusstsein haben: Weimarer Klassik: zielt auf eine Humanisierung der Gesellschaft, was die Humanität des Einzelnen, die durch eine ästhetische Erziehung erreicht werden sollte, voraussetzt. Frühromantik: Konzept der progressiven Universaltheorie, die eine poetische Wahrnehmung der Welt propagiert; diskutiert werden unter anderem alternative Lebensformen zur bürgerlichen Gesellschaft. 2. Ordnen Sie die Novelle Das Erdbeben in Chili literaturgeschichtlich ein. Halten Sie fest, welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben. Die Einordnung erweist sich deshalb als schwierig, weil Heinrich von Kleists Werke nicht mit den gängigen Epochenbegriffen zu fassen sind. Das Erdbeben in Chili ist also weder ein klassisches noch ein romantisches Werk. 3. Was bedeuten die Begriffe Anmut und Grazie für Sie? Wie könnten sich Anmut und Grazie bei einer Marionette zeigen, wer wäre dafür verantwortlich? Halten Sie ihre Gedanken stichwortartig fest. Die Aufgabe zielt nicht auf eine Lösung im eigentlichen Sinne; vielmehr sollten Sie sich als Vorbereitung für die Lektüre des Textes Über das Marionettentheater gedanklich auf diese Begriffe bzw. die Situation Marionettentheater einlassen. 1 Welche Unordnung das Bewusstsein anrichtet einen poetologischen Text erschließen Seite Bestimmen Sie die Textsorte des ersten Textes. Es handelt sich um eine Beispielerzählung (also eine didaktischen Erzählform, die anders als das Gleichnis oder die Parabel einen Sachverhalt unmittelbar zu veranschaulichen sucht). 2. Fassen Sie die wesentlichen Aussagen der beiden Texte zusammen und vergleichen Sie die Positionen. Französisches Exerzitium : Man wird (in einer scheinbar ausweglosen Situation) nur dann erfolgreich kämpfen, wenn einem die negativen Konsequenzen seines möglichen Scheiterns klar vor Augen geführt werden. Erst klare Überlegung macht erfolgreiches Handeln möglich. Von der Überlegung : Im Kampfe (im Gespräch) ist die Überlegung (die Reflexion des aktuellen Tuns) hinderlich. Vielmehr solle man erst anschließend rekapitulieren, wie man sich verhalten hat, um daraus für die Zukunft zu lernen. 3. Erörtern/Diskutieren Sie die Aussagen. Die Aufgabe kann mündlich bearbeitet werden; wie die Schüler zu den Aussagen stehen, sollten sie, wenn möglich, durch weitere Beispiele begründen bzw. veranschaulichen. Seite Gliedern Sie den Text. Fassen Sie die zentralen Aussagen der einzelnen Abschnitte zusammen. 2. Beziehen Sie bei der Untersuchung die Bibeltexte auf S. 72/73 sowie die Abbildung des Dornausziehers ein. Der Text lässt sich zunächst in zwei Großabschnitte unterteilen: I. Das Gespräch mit Herrn C. über Marionetten (Z ); II. die Berichte des Erzählers und von Herrn C. (Z ). Diese beiden Großabschnitte lassen sich wieder unterteilen: 16
17 Seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater I. a) die maschinelle Wirkungsweise von Marionetten (Z. 1 53: die tanzenden Gliedmaßen der Marionetten sind nichts weiter als die zufälligen Bewegungen freier Glieder um den vom Marionettenspieler gesteuerten Schwerpunkt der Puppen); I. b) die ideale Marionette (Z : die Vorteile der Marionetten gegenüber den Menschen liege in deren fehlender Ziererei und in der Tatsache, dass diese antigrav seien, was ihnen Anmut und Grazie verleihe); II. a) die Dornauszieher -Geschichte (Z : Reflexion zerstört Anmut und Grazie) II. b) die Geschichte vom fechtenden Bären (Z : bewusstseinsfreies, naturgemäßes Tun siegt über die Technik (die Reflexion) Eingebettet in den Dialog sind dabei drei Stellen (Z , , ), die gesprächsreflexiv sind und sich jeweils auf die Geschichte des Sündenfalls beziehen: Wie das Essen vom Baum der Erkenntnis den Menschen schuldhaft werden lässt, zerstört das Bewusstsein bzw. die Reflexion Anmut und Grazie. 3. Nennen Sie die Stadien, in die Kleist die Entwicklungsgeschichte der Menschen fasst. 4. Beziehen Sie bei der Analyse des letzten Abschnittes Jesaja 11 sowie die Abbildungen auf S. 73 ff. mit ein. Kleist sieht die Entwicklungsgeschichte als einen Dreischritt: Sündenfall (bzw. Paradies), das Leben in Sünde und die Wiederherstellung des Paradieses (vgl. Z ). Die Wiederherstellung des Paradieses sei gegeben, wenn Die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist (Z. 157), d. h. bei demjenigen, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewusstsein hat, d. h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott (Z. 158 f.). 5. Vergleichen Sie die letzten Abschnitte mit Kleists Erdbeben in Chili. Im Erdbeben zeigt sich die Welt (und die Menschen auf ihr) gerade nicht auf ihrem Weg zur Erlösung bzw. zur Wiederherstellung des Paradieses: Was sich in der Tal-von-Eden-Szene andeutet, setzt die Außerkraftsetzung der herrschenden Ordnung voraus, die im Erdbeben zwar als kurzfristig erschüttert erscheint, sich aber wieder mit voller Kraft wiederherstellt. 2 Er blieb sich ganz ein Rätsel biografische Aspekte einbeziehen Seite Arbeiten Sie die Zusammenhänge von Kleists Über das Marionettentheater mit seinem Leben und seinen Werken heraus. Carrière: Kleist sei von der Grazie besessen, weil sie ihm selbst in seinem Leben mangelte. Hohoff: Kleists Leben bestehe zum großen Teil in Versuchen, über sich selbst Klarheit zu gewinnen (Z. 17); die Klarheit habe er im Aufsatz Über das Marionettentheater (vgl. Z ) erreicht. 3 Befreit von der Schwere des Leibes kunsttheoretische Texte vergleichen Seite Vergleichen Sie die Auffassungen von Grazie in Über das Marionettentheater und den beiden Schiller- Texten. Der entscheidende Unterschied zur Kleist schen Auffassung liegt in der Annahme Schillers, die schöne Seele und mithin die Grazie sei von der bloßen Schönheit dadurch geschieden, dass in der schönen Seele Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und Neigung harmonieren ( Über Anmut und Würde, Z. 16). Mit anderen Worten: Bei Schiller geht es gerade um die Verbindung mit der Vernunft, die nach Kleist lediglich zur Ziererei führe. 17
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 1/14 Gott will durch dich wirken Gott möchte dich mit deinen Talenten und Gaben gebrauchen und segnen. Er hat einen Auftrag und einen einzigartigen Plan für dich
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 1/14 Gott will durch dich wirken Gott möchte dich mit deinen Talenten und Gaben gebrauchen und segnen. Er hat einen Auftrag und einen einzigartigen Plan für dich
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Sprüche für die Parte und das Andenkenbild
 (1) Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, nur fern! Tot ist nur, wer vergessen wird. (7) Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh`, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
(1) Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, nur fern! Tot ist nur, wer vergessen wird. (7) Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh`, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Thema 2: Gottes Plan für dein Leben
 Thema 2: für dein Leben Einleitung Viele Menschen blicken am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurück und fragen sich ernüchtert: Und das war s? Eine solche Lebensbilanz ziehen zu müssen ist eine große Tragik!
Thema 2: für dein Leben Einleitung Viele Menschen blicken am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurück und fragen sich ernüchtert: Und das war s? Eine solche Lebensbilanz ziehen zu müssen ist eine große Tragik!
Matthäus 28, Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten.
 Matthäus 28, 16-20 Liebe Gemeinde, Ich lese den Predigttext aus Matthäus 28, 16-20 16Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17Und als sie ihn sahen, fielen
Matthäus 28, 16-20 Liebe Gemeinde, Ich lese den Predigttext aus Matthäus 28, 16-20 16Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17Und als sie ihn sahen, fielen
Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
26. November 2014 Universität Zürich. Dr.med. Timo Rimner Christen an den Hochschulen
 26. November 2014 Universität Zürich Dr.med. Timo Rimner Christen an den Hochschulen Aktuelle Lage und Hintergrund Gott eine Person oder eine Energie? Gottes Weg zum Menschen Der Weg des Menschen zu Gott
26. November 2014 Universität Zürich Dr.med. Timo Rimner Christen an den Hochschulen Aktuelle Lage und Hintergrund Gott eine Person oder eine Energie? Gottes Weg zum Menschen Der Weg des Menschen zu Gott
1 Ist Religion an Worte und Orte gebunden? 10
 1 Ist Religion an Worte und Orte gebunden? 10 Wo findet man Religion? 12 Religion als Suche? 14 Was ist Religion? 16 Was sind religiöse Erfahrungen? 18 Klingt in allen Menschen eine religiöse Saite? 20
1 Ist Religion an Worte und Orte gebunden? 10 Wo findet man Religion? 12 Religion als Suche? 14 Was ist Religion? 16 Was sind religiöse Erfahrungen? 18 Klingt in allen Menschen eine religiöse Saite? 20
Johann Wolfgang von Goethe - An den Mond - Interpretation
 Germanistik Tom Schnee Johann Wolfgang von Goethe - An den Mond - Interpretation Schüleranalyse / Interpretation des Gedichts an den Mond von Goethe aus dem Jahre 1777 Referat / Aufsatz (Schule) Analyse
Germanistik Tom Schnee Johann Wolfgang von Goethe - An den Mond - Interpretation Schüleranalyse / Interpretation des Gedichts an den Mond von Goethe aus dem Jahre 1777 Referat / Aufsatz (Schule) Analyse
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF. Jahrgangsstufe: EF Jahresthema:
 Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF Jahrgangsstufe: EF Jahresthema: Unterrichtsvorhaben I: Philosophie: Was ist das? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF Jahrgangsstufe: EF Jahresthema: Unterrichtsvorhaben I: Philosophie: Was ist das? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Gott, ich will von dir erzählen in der Gemeinde singen und beten. Du kümmerst dich um Arme und Kranke, Gesunde, Alte und Kinder.
 Nach Psalm 22 Gott, wo bist du? Gott, ich fühle mich leer, ich fühle mich allein. Ich rufe laut nach dir wo bist du? Ich wünsche mir Hilfe von dir. Die Nacht ist dunkel. Ich bin unruhig. Du bist für mich
Nach Psalm 22 Gott, wo bist du? Gott, ich fühle mich leer, ich fühle mich allein. Ich rufe laut nach dir wo bist du? Ich wünsche mir Hilfe von dir. Die Nacht ist dunkel. Ich bin unruhig. Du bist für mich
Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan Variante Schuljahr
 Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan 2016 Variante 1 1. Schuljahr Prozessbezogene Kompetenzen Ich bin ich und du bist du Wir gehören zusammen 1 (5 Wochen) 2.2.4
Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan 2016 Variante 1 1. Schuljahr Prozessbezogene Kompetenzen Ich bin ich und du bist du Wir gehören zusammen 1 (5 Wochen) 2.2.4
Schleifen. Prägedruck Druckfarben: Gold, Silber, Schwarz, vor allem für dunkle Schleifen K 23 K 24
 Schleifen Prägedruck Druckfarben: Gold, Silber, Schwarz, vor allem für dunkle Schleifen K 23 K 24-41 - Schleifen Computerdruck Druckfarben: Gold- Imitat, alle Farben, nur für helle Schleifen, auch Fotos
Schleifen Prägedruck Druckfarben: Gold, Silber, Schwarz, vor allem für dunkle Schleifen K 23 K 24-41 - Schleifen Computerdruck Druckfarben: Gold- Imitat, alle Farben, nur für helle Schleifen, auch Fotos
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
6 SHALOM 7 LASST UNS FEIERN. Viel gerufenes Wort. Laßt uns das lebendige Leben feiern, INTROITUS - KEIN ANFANG DER ANGST MACHT
 VORWORT Manchmal, wenn ich in den fünf Jahren als Gemeindepfarrerin am Sonntagmorgen nach vorn an den Altar ging oder die Stufen z:ur Kanzel hochstieg, hatte ich ganz.deutlich das Gefühl, daß etwas fehlte.
VORWORT Manchmal, wenn ich in den fünf Jahren als Gemeindepfarrerin am Sonntagmorgen nach vorn an den Altar ging oder die Stufen z:ur Kanzel hochstieg, hatte ich ganz.deutlich das Gefühl, daß etwas fehlte.
Unterrichtsvorhaben I
 Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Schulinternes Curriculum Kath. Religion Klasse 3 Anlage 12 erstellt für die Grundschule Kuhstraße
 Schulinternes Curriculum Kath. Religion Klasse 3 Anlage 12 erstellt für die Grundschule Kuhstraße Zeit Kompetenz Thema/Reihe Medien/Lernorte Schulanfang bis zu den Herbstferien wissen, dass wir von Gott
Schulinternes Curriculum Kath. Religion Klasse 3 Anlage 12 erstellt für die Grundschule Kuhstraße Zeit Kompetenz Thema/Reihe Medien/Lernorte Schulanfang bis zu den Herbstferien wissen, dass wir von Gott
Gott persönlich kennen lernen
 Gott persönlich kennen lernen Zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott gibt es nur einen Weg. Aber jeder Mensch wird auf diesem Weg anders geführt. Dabei haben sich die vier Schritte, die im Folgenden
Gott persönlich kennen lernen Zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott gibt es nur einen Weg. Aber jeder Mensch wird auf diesem Weg anders geführt. Dabei haben sich die vier Schritte, die im Folgenden
ZUR HOFFNUNG ERZIEHEN
 Regine Schindler ZUR HOFFNUNG ERZIEHEN Gott im Kinderalltag VERLAG ERNST KAUFMANN THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH INHALT Vorwort 13 Religion oder Religionen für Kinder? Eine persönliche Hinführung 16 I. ZUR
Regine Schindler ZUR HOFFNUNG ERZIEHEN Gott im Kinderalltag VERLAG ERNST KAUFMANN THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH INHALT Vorwort 13 Religion oder Religionen für Kinder? Eine persönliche Hinführung 16 I. ZUR
Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase März 2015
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
wunderbarste Liebesbrief
 Der wunderbarste Liebesbrief Brief der Freude und des Lebens! Wer kann sie zählen, die Liebesbriefe, die schon weltweit geschrieben worden sind? Angefangen bei bekritzelten Schnipseln von Schulhefträndern,
Der wunderbarste Liebesbrief Brief der Freude und des Lebens! Wer kann sie zählen, die Liebesbriefe, die schon weltweit geschrieben worden sind? Angefangen bei bekritzelten Schnipseln von Schulhefträndern,
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive
 Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Unsere christliche Identität: Erinnern und bekennen, danken und barmherzig sein
 Unsere christliche Identität: Erinnern und bekennen, danken und barmherzig sein Hirtenwort zum 14. Februar 2016 + Felix Gmür Bischof von Basel 1. Fastensonntag, Lesejahr C 14. Februar 2016 1. Lesung: Dtn
Unsere christliche Identität: Erinnern und bekennen, danken und barmherzig sein Hirtenwort zum 14. Februar 2016 + Felix Gmür Bischof von Basel 1. Fastensonntag, Lesejahr C 14. Februar 2016 1. Lesung: Dtn
HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest
 15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
Gottesdienst zum Jahresthema am 1. Advent 2010
 Gottesdienst zum Jahresthema am 1. Advent 2010 Einführung zum Gottesdienst Heute zünden wir die erste Kerze auf dem Adventskranz. Denn heute beginnen wir unsere religiöse Vorbereitung auf Weihnachten,
Gottesdienst zum Jahresthema am 1. Advent 2010 Einführung zum Gottesdienst Heute zünden wir die erste Kerze auf dem Adventskranz. Denn heute beginnen wir unsere religiöse Vorbereitung auf Weihnachten,
jemand segnet? Wie werde ich für andere zum Segen? 1- Mein erster Gedanke: Die verfehlte Wahrheit,
 Der Segen Heute geht es um das Thema Segen. Und aus diesem Grund möchte ich mit ihnen, die bekannteste Segnung der Bibel lesen, die Segnung Abrahams in 1 Mose 12, 1-2 Und der HERR sprach zu Abraham: Geh
Der Segen Heute geht es um das Thema Segen. Und aus diesem Grund möchte ich mit ihnen, die bekannteste Segnung der Bibel lesen, die Segnung Abrahams in 1 Mose 12, 1-2 Und der HERR sprach zu Abraham: Geh
Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan Variante Schuljahr
 Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan 2016 Variante 1 1. Schuljahr Prozessbezogene Kompetenzen Ich bin ich und du bist du Wir gehören zusammen 1 (5 Wochen) 2.2.4
Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan 2016 Variante 1 1. Schuljahr Prozessbezogene Kompetenzen Ich bin ich und du bist du Wir gehören zusammen 1 (5 Wochen) 2.2.4
Adventliche Verheißungen 2011. 1. Ursprung der Verheißungen zu Gen 3,15
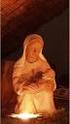 Adventliche Verheißungen 2011 1. Ursprung der Verheißungen zu Gen 3,15 1. Advent als Ankunft und Erwartung Wenn wir heute über den Advent sprechen, dann meinen wir die vier Wochen vor Weihnachten, in denen
Adventliche Verheißungen 2011 1. Ursprung der Verheißungen zu Gen 3,15 1. Advent als Ankunft und Erwartung Wenn wir heute über den Advent sprechen, dann meinen wir die vier Wochen vor Weihnachten, in denen
Bibel als "Ur- Kunde" des Glaubens an Gott (IF 3) Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler. erläutern den Aufbau der Bibel
 Unterrichtsvorhaben A: Die Bibel - mehr als nur ein Buch Bibel als "Ur- Kunde" des Glaubens an Gott (IF 3) identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser Sprache an Beispielen. finden selbstständig
Unterrichtsvorhaben A: Die Bibel - mehr als nur ein Buch Bibel als "Ur- Kunde" des Glaubens an Gott (IF 3) identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser Sprache an Beispielen. finden selbstständig
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich.
Der erste Akt: Robespierre und Danton. I,1 Die Exposition. Ort: Figuren: Inhalte der Gespräche? Wie erscheint Danton in dieser Szene?
 Der erste Akt: Robespierre und Danton I,1 Die Exposition Ort: Figuren: Inhalte der Gespräche? Wie erscheint Danton in dieser Szene? Wie ist das Verhältnis zu Julie, seiner Frau? (S. 5f.) Fasse das Programm
Der erste Akt: Robespierre und Danton I,1 Die Exposition Ort: Figuren: Inhalte der Gespräche? Wie erscheint Danton in dieser Szene? Wie ist das Verhältnis zu Julie, seiner Frau? (S. 5f.) Fasse das Programm
Abschied in Dankbarkeit Abschied nur für kurze Zeit Alles hat seine Zeit Als Freund unvergessen Am Ende steht ein Anfang An jedem Ende steht ein
 Abschied in Dankbarkeit Abschied nur für kurze Zeit Alles hat seine Zeit Als Freund unvergessen Am Ende steht ein Anfang An jedem Ende steht ein Anfang Aufrichtige Anteilnahme Auf ein Wiedersehen Auf Erden
Abschied in Dankbarkeit Abschied nur für kurze Zeit Alles hat seine Zeit Als Freund unvergessen Am Ende steht ein Anfang An jedem Ende steht ein Anfang Aufrichtige Anteilnahme Auf ein Wiedersehen Auf Erden
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben: Sakramente Lebenszeichen
 Unterrichtsvorhaben: Sakramente Lebenszeichen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IHF5), Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IHF1) Lebensweltliche Relevanz:
Unterrichtsvorhaben: Sakramente Lebenszeichen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IHF5), Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IHF1) Lebensweltliche Relevanz:
Hinweise zur Nutzung und zu den Kopierrechten dieser Materialien
 Hinweise zur Nutzung und zu den Kopierrechten dieser Materialien --------------------------------------------------------------------- 1. Didaktische Hinweise 2. Nutzung und Kopierrechte 3. Bitte um Unterstützung
Hinweise zur Nutzung und zu den Kopierrechten dieser Materialien --------------------------------------------------------------------- 1. Didaktische Hinweise 2. Nutzung und Kopierrechte 3. Bitte um Unterstützung
Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Pontifikalgottesdienst zum Weihnachtsfest 2007
 1 Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Pontifikalgottesdienst zum Weihnachtsfest 2007 Das Evangelium der Hl. Nacht hat uns nach Betlehem geführt zum Kind in der Krippe. Das Evangelium
1 Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Pontifikalgottesdienst zum Weihnachtsfest 2007 Das Evangelium der Hl. Nacht hat uns nach Betlehem geführt zum Kind in der Krippe. Das Evangelium
Was meint Glaube? Vortrag
 1 Vortrag Vortrag Einleitung Stellt man in einem Interview auf Straße die Frage:, so würde die häufigste und typische Antwort lauten: Glaube heißt, ich weiß nicht so recht. Glaube heutzutage meint NichtWissen-Können.
1 Vortrag Vortrag Einleitung Stellt man in einem Interview auf Straße die Frage:, so würde die häufigste und typische Antwort lauten: Glaube heißt, ich weiß nicht so recht. Glaube heutzutage meint NichtWissen-Können.
Leibniz. (G.W.F. Hegel)
 Leibniz 3. Der einzige Gedanke den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
Leibniz 3. Der einzige Gedanke den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
SCHAUEN BETEN DANKEN. Ein kleines Gebetbuch. Unser Leben hat ein Ende. Gott, wir möchten verstehen: Unser Leben hat ein Ende.
 Unser Leben hat ein Ende Gott, wir möchten verstehen: Unser Leben hat ein Ende. Wenn wir nachdenken über den Tod: Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Alles gut? Alles schlecht? Halb gut? Halb schlecht?
Unser Leben hat ein Ende Gott, wir möchten verstehen: Unser Leben hat ein Ende. Wenn wir nachdenken über den Tod: Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Alles gut? Alles schlecht? Halb gut? Halb schlecht?
Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan Variante Schuljahr
 Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan 2016 Variante 2 1. Schuljahr Prozessbezogene Kompetenzen Ist heute Reli? Ich-du-wir im Religionsunterricht (5 Wochen) Ausdrucksformen
Zweijahresplan mit inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zum Bildungsplan 2016 Variante 2 1. Schuljahr Prozessbezogene Kompetenzen Ist heute Reli? Ich-du-wir im Religionsunterricht (5 Wochen) Ausdrucksformen
Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie. Fach / Jahrgangsstufe Praktische Philosophie 5/6
 Fach / Jahrgangsstufe 5/6 Nr. des Unterrichtsvorhabens im Doppeljahrgang: 1 Fragekreis 1 Die Frage nach dem Selbst Personale Kompetenz beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen
Fach / Jahrgangsstufe 5/6 Nr. des Unterrichtsvorhabens im Doppeljahrgang: 1 Fragekreis 1 Die Frage nach dem Selbst Personale Kompetenz beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen
Internes Curriculum Praktische Philosophie
 Internes Curriculum Praktische Philosophie Klassenstufen 5 und 6 (Insgesamt 9 Fragekreise) Fragenkreis 1: Folgende Themen sind obligatorisch: Klassenstufen 7 und 8 (Insgesamt 7 Fragekreise) Fragenkreis
Internes Curriculum Praktische Philosophie Klassenstufen 5 und 6 (Insgesamt 9 Fragekreise) Fragenkreis 1: Folgende Themen sind obligatorisch: Klassenstufen 7 und 8 (Insgesamt 7 Fragekreise) Fragenkreis
Das Wunderbare am Tod ist, dass Sie ganz alleine sterben dürfen. Endlich dürfen Sie etwas ganz alleine tun!
 unseren Vorstellungen Angst. Ich liebe, was ist: Ich liebe Krankheit und Gesundheit, Kommen und Gehen, Leben und Tod. Für mich sind Leben und Tod gleich. Die Wirklichkeit ist gut. Deshalb muss auch der
unseren Vorstellungen Angst. Ich liebe, was ist: Ich liebe Krankheit und Gesundheit, Kommen und Gehen, Leben und Tod. Für mich sind Leben und Tod gleich. Die Wirklichkeit ist gut. Deshalb muss auch der
Inhaltsverzeichnis.
 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung 9 2. Die didaktische Struktur der Rahmenrichtlinien 12 2.1 Didaktische Konzeption Fünf Lernschwerpunkte als Strukturelemente 13 2.2 Beschreibung
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung 9 2. Die didaktische Struktur der Rahmenrichtlinien 12 2.1 Didaktische Konzeption Fünf Lernschwerpunkte als Strukturelemente 13 2.2 Beschreibung
Predigt zu Psalm 145, 14 / Ewigkeitssonntag 20. November 2011 / Stephanus-Kirche Borchen
 Predigt zu Psalm 145, 14 / Ewigkeitssonntag 20. November 2011 / Stephanus-Kirche Borchen Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt! Aus Psalm 145 hören wir diese Vers, der
Predigt zu Psalm 145, 14 / Ewigkeitssonntag 20. November 2011 / Stephanus-Kirche Borchen Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt! Aus Psalm 145 hören wir diese Vers, der
Weihnachten. Weihnachten ist Geburt. Geburt ist Licht. Licht ist Liebe. Liebe ist Vertrauen. Vertrauen ist Geborgenheit. Geborgenheit ist Zärtlichkeit
 Wenn die Weihnachtsglocken läuten In das Herz den Frieden ein, wollen wir die Hand uns reichen, alle Menschen groß und klein. Leget ab die Last des Alltags! Seht den hellen Kerzenschein! Alle Menschen
Wenn die Weihnachtsglocken läuten In das Herz den Frieden ein, wollen wir die Hand uns reichen, alle Menschen groß und klein. Leget ab die Last des Alltags! Seht den hellen Kerzenschein! Alle Menschen
Ablauf und Gebete der Messfeier
 Ablauf und Gebete der Messfeier Text: Pfarrer Martin Piller Gestaltung: Marianne Reiser Bilder: Aus dem Kinderbuch Mein Ausmal-Messbuch ; Bilder von Stefan Lohr; Herder Verlag www.pfarrei-maria-lourdes.ch
Ablauf und Gebete der Messfeier Text: Pfarrer Martin Piller Gestaltung: Marianne Reiser Bilder: Aus dem Kinderbuch Mein Ausmal-Messbuch ; Bilder von Stefan Lohr; Herder Verlag www.pfarrei-maria-lourdes.ch
Er hat Sie geschaffen, um mit ihm, in Gemeinschaft zu leben. Der heilige Gott ist der Schöpfer der Welt. Wie groß ist die Liebe Gottes?
 Zu einem Leben in die Gemeinschaft mit Gott gibt es nur einen Weg. Aber jeder Mensch wird auf diesem Weg anders geführt. Dabei haben sich die fünf Schritte, die im folgenden geschildert werden, als eine
Zu einem Leben in die Gemeinschaft mit Gott gibt es nur einen Weg. Aber jeder Mensch wird auf diesem Weg anders geführt. Dabei haben sich die fünf Schritte, die im folgenden geschildert werden, als eine
Übertragung mit Russland, einschließlich der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Litauen und Estland am 3. Januar 2009
 Übertragung mit Russland, einschließlich der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Litauen und Estland am 3. Januar 2009 Bhagavan: Namaste zu euch allen! Ich wünsche euch allen ein sehr sehr glückliches neues
Übertragung mit Russland, einschließlich der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Litauen und Estland am 3. Januar 2009 Bhagavan: Namaste zu euch allen! Ich wünsche euch allen ein sehr sehr glückliches neues
1. Teilt auf, wer von euch welchen Psalm-Ausschnitt lesen übt.
 AB 2 PSALMEN Psalmen sind Gebete und Lieder, die schon vor 2500 Jahren entstanden sind. In der Bibel im Alten Testament stehen 150 Psalmen. Aufgaben für die Gruppenarbeit: 1. Teilt auf, wer von euch welchen
AB 2 PSALMEN Psalmen sind Gebete und Lieder, die schon vor 2500 Jahren entstanden sind. In der Bibel im Alten Testament stehen 150 Psalmen. Aufgaben für die Gruppenarbeit: 1. Teilt auf, wer von euch welchen
Believe and Pray. 11. Januar Der du bist im Himmel... was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I. Bischof Stefan Oster
 Believe and Pray 11. Januar 2015 Der du bist im Himmel... was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I Bischof Stefan Oster Der du bist im Himmel... Was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I So sollt
Believe and Pray 11. Januar 2015 Der du bist im Himmel... was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I Bischof Stefan Oster Der du bist im Himmel... Was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I So sollt
Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman (S II) Reihe 11 S 1. Verlauf Material LEK Glossar Literatur
 Reihe 11 S 1 Verlauf Material Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman Erschließung durch analytische und produktionsorientierte Verfahren Judith Kurz-Bieligk, Koblenz Peter Stamms Roman Agnes
Reihe 11 S 1 Verlauf Material Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman Erschließung durch analytische und produktionsorientierte Verfahren Judith Kurz-Bieligk, Koblenz Peter Stamms Roman Agnes
Rosenkranzandacht. Gestaltet für Kinder. Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach
 Rosenkranzandacht Gestaltet für Kinder Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach Die Geschichte vom Rosenkranz Vor langer Zeit, im 15. Jahrhundert, also vor ungefähr
Rosenkranzandacht Gestaltet für Kinder Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach Die Geschichte vom Rosenkranz Vor langer Zeit, im 15. Jahrhundert, also vor ungefähr
Christliches Symbol -> Brot
 Christliches Symbol -> Brot In vielen Kulturen ist es das wichtigste Nahrungsmittel. Es ist ein Symbol für das Leben und ein Symbol für die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus hat kurz vor seinem Tod
Christliches Symbol -> Brot In vielen Kulturen ist es das wichtigste Nahrungsmittel. Es ist ein Symbol für das Leben und ein Symbol für die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus hat kurz vor seinem Tod
Als meine Tochter sehr klein war, hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis mit ihr.
 1 Predigt Du bist gut (4. und letzter Gottesdienst in der Predigtreihe Aufatmen ) am 28. April 2013 nur im AGD Als meine Tochter sehr klein war, hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis mit ihr. Ich war
1 Predigt Du bist gut (4. und letzter Gottesdienst in der Predigtreihe Aufatmen ) am 28. April 2013 nur im AGD Als meine Tochter sehr klein war, hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis mit ihr. Ich war
als Fragestellungen grundlegende Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Verständnis Gottes in Judentum, Christentum und Islam erläutern (IF 5),
 Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben 1, Der Glaube an den einen Gott in Judentum, Christentum und Islam Der Glaube Religionen und Der Glaube an Gott in den an den einen Gott in Weltanschauungen im Dialog
Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben 1, Der Glaube an den einen Gott in Judentum, Christentum und Islam Der Glaube Religionen und Der Glaube an Gott in den an den einen Gott in Weltanschauungen im Dialog
Afrikanische Märchen Weisheiten zu Moral und Nachhaltigkeit in traditionellen Kulturen. Prof. Dr. Hildegard Simon-Hohm
 Afrikanische Märchen Weisheiten zu Moral und Nachhaltigkeit in traditionellen Kulturen Prof. Dr. Hildegard Simon-Hohm Gliederung 1. Zum Verständnis afrikanischer Märchen 2. Zur kulturellen und gesellschaftlichen
Afrikanische Märchen Weisheiten zu Moral und Nachhaltigkeit in traditionellen Kulturen Prof. Dr. Hildegard Simon-Hohm Gliederung 1. Zum Verständnis afrikanischer Märchen 2. Zur kulturellen und gesellschaftlichen
Sieben Bekenntnisse, die unser Leben unerschütterlich machen.
 Sieben Bekenntnisse, die unser Leben unerschütterlich machen. Das eine was sicher ist in unserem Leben ist ständige Unsicherheit. Das Leben verändert sich um uns herum und manche Veränderungen können unsere
Sieben Bekenntnisse, die unser Leben unerschütterlich machen. Das eine was sicher ist in unserem Leben ist ständige Unsicherheit. Das Leben verändert sich um uns herum und manche Veränderungen können unsere
Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; Er lässt dich nicht fallen.
 Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; Er lässt dich nicht fallen. (Deuteronomium 4,31) Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. (Matthäus 5,9)
Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; Er lässt dich nicht fallen. (Deuteronomium 4,31) Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. (Matthäus 5,9)
BLITZLICHT ANTWORTEN AUF AKTUELLE LEBENSFRAGEN Erdbeben +++ Tsunami +++ AKW-Explosion +++ Ist unsere Welt noch zu retten?
 BLITZLICHT ANTWORTEN AUF AKTUELLE LEBENSFRAGEN 11 06 +++ Erdbeben +++ Tsunami +++ AKW-Explosion +++ Ist unsere Welt noch zu retten? Foto: U.S. Air Force +++ Japan 11. 03. 2011 +++ Das Erdbeben der Stärke
BLITZLICHT ANTWORTEN AUF AKTUELLE LEBENSFRAGEN 11 06 +++ Erdbeben +++ Tsunami +++ AKW-Explosion +++ Ist unsere Welt noch zu retten? Foto: U.S. Air Force +++ Japan 11. 03. 2011 +++ Das Erdbeben der Stärke
Fabeln verstehen und gestalten
 Ziel: Ich lerne - verschiedene Fabeln und ihre typischen Merkmale kennen. - wie Fabeln aufgebaut sind. - eine eigene Fabel zu schreiben. Lernschritt 1: Das Ziel klären Einstieg Die Menschen haben Tieren
Ziel: Ich lerne - verschiedene Fabeln und ihre typischen Merkmale kennen. - wie Fabeln aufgebaut sind. - eine eigene Fabel zu schreiben. Lernschritt 1: Das Ziel klären Einstieg Die Menschen haben Tieren
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Morgengebete. 1. Gottes Segen. Ein neuer Morgen, Herr! Ein neuer Tag, dein Lob zu singen! Lass ihn in deiner Güte und Wahrheit gelingen!
 Morgengebete 1. Gottes Segen Ein neuer Morgen, Herr! Ein neuer Tag, dein Lob zu singen! Lass ihn in deiner Güte und Wahrheit gelingen! Segne meine Augen, damit sie dich im Alltag schauen damit ich nicht
Morgengebete 1. Gottes Segen Ein neuer Morgen, Herr! Ein neuer Tag, dein Lob zu singen! Lass ihn in deiner Güte und Wahrheit gelingen! Segne meine Augen, damit sie dich im Alltag schauen damit ich nicht
FRANKFURTER GOETHE-HAUS FREIES DEUTSCHES HOCHSTIFT Textsammlung Jean Paul und Goethe zwei Leben
 1 Die Geburt in Frankfurt Die Geburt in Wunsiedel Die Geburt in Bethlehem Seite 5-7 Geburtsmythen Vergleichen Sie die drei Geburtsmythen: Unter welchem Stern wird das Kind geboren? Welche Rolle soll es
1 Die Geburt in Frankfurt Die Geburt in Wunsiedel Die Geburt in Bethlehem Seite 5-7 Geburtsmythen Vergleichen Sie die drei Geburtsmythen: Unter welchem Stern wird das Kind geboren? Welche Rolle soll es
irdischen Pilgerschaft in die Herrlichkeit der Auferstehung folgen, wo sie nun mit ihm am Herzen des Vaters ruht.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest am 25. Dezember 2011 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Unser heutiges Weihnachtsevangelium beginnt mit
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest am 25. Dezember 2011 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Unser heutiges Weihnachtsevangelium beginnt mit
Sünde WAS IST DAS? UND WIE KANN MAN DARÜBER REDEN? DAS WESEN DER SÜNDE PERSPEKTIVEN DES DIALOGS
 Sünde WAS IST DAS? UND WIE KANN MAN DARÜBER REDEN? DAS WESEN DER SÜNDE PERSPEKTIVEN DES DIALOGS Die vier Punkte Sündenerkenntnis nur im Glauben Röm.1,16: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und
Sünde WAS IST DAS? UND WIE KANN MAN DARÜBER REDEN? DAS WESEN DER SÜNDE PERSPEKTIVEN DES DIALOGS Die vier Punkte Sündenerkenntnis nur im Glauben Röm.1,16: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Kleist-Archiv Sembdner, Internet-Editionen
 Kleist-Archiv Sembdner, Internet-Editionen Heinrich von Kleist Das Erdbeben in Chili Vorliegende Ausgabe erhalten Sie ausschließlich auf dem Webserver des Kleist-Archivs Sembdner, Heilbronn. Sollten Sie
Kleist-Archiv Sembdner, Internet-Editionen Heinrich von Kleist Das Erdbeben in Chili Vorliegende Ausgabe erhalten Sie ausschließlich auf dem Webserver des Kleist-Archivs Sembdner, Heilbronn. Sollten Sie
Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse Sek II
 Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse 5-10 + Sek II Legende: prozessbezogene Kompetenzbereiche inhaltsbezogene Kompetenzbereiche Hinweise: Zur nachhaltigen Förderung
Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse 5-10 + Sek II Legende: prozessbezogene Kompetenzbereiche inhaltsbezogene Kompetenzbereiche Hinweise: Zur nachhaltigen Förderung
(Pfarrer Dr. Kurt Reuber, 1943) für ein gutes Leben mit Gott. Tipps und Texte für Erwachsene Zusammengestellt von Helge Korell
 (Pfarrer Dr. Kurt Reuber, 1943) B e t e n für ein gutes Leben mit Gott Tipps und Texte für Erwachsene Zusammengestellt von Helge Korell Lützenkirchen 2010 1 Warum beten? Fünf Gründe: 1. Ich bete zu Gott,
(Pfarrer Dr. Kurt Reuber, 1943) B e t e n für ein gutes Leben mit Gott Tipps und Texte für Erwachsene Zusammengestellt von Helge Korell Lützenkirchen 2010 1 Warum beten? Fünf Gründe: 1. Ich bete zu Gott,
Kursbuch Religion Elementar 5/6 Stoffverteilungsplan für Realschule Baden-Württemberg. Calwer Verlag Stuttgart Anzahl der Schulstunden
 Wochen Anzahl der Schulstunden Dimensionen Themenfelder Thema in Kursbuch Religion Elementar 5/6 Methoden (in Auswahl) Mensch kennen das christliche Verständnis, dass sie als Geschöpfe Gottes einzigartig
Wochen Anzahl der Schulstunden Dimensionen Themenfelder Thema in Kursbuch Religion Elementar 5/6 Methoden (in Auswahl) Mensch kennen das christliche Verständnis, dass sie als Geschöpfe Gottes einzigartig
Maria Mutter der Menschen
 Maiandacht mit eigenen Texten und Texten aus dem Gotteslob Maria Mutter der Menschen (Hinweis zur Durchführung: Die Maiandacht kann auch gekürzt werden, in dem das Rosenkranzgebet entfällt. Außerdem können
Maiandacht mit eigenen Texten und Texten aus dem Gotteslob Maria Mutter der Menschen (Hinweis zur Durchführung: Die Maiandacht kann auch gekürzt werden, in dem das Rosenkranzgebet entfällt. Außerdem können
OSTERNACHT A ERSTE LESUNG. DIE ERSCHAFFUNG DER WELT (Genesis 1,1-2,2)
 OSTERNACHT A ERSTE LESUNG DIE ERSCHAFFUNG DER WELT (Genesis 1,1-2,2) Am Anfang hat Gott Himmel und Erde gemacht. Die Erde war wie eine Wüste und wie ein Sumpf. Alles war trübes Wasser vermischt mit Land.
OSTERNACHT A ERSTE LESUNG DIE ERSCHAFFUNG DER WELT (Genesis 1,1-2,2) Am Anfang hat Gott Himmel und Erde gemacht. Die Erde war wie eine Wüste und wie ein Sumpf. Alles war trübes Wasser vermischt mit Land.
Predigttext: 1 Johannes 5,11-13 (Predigtreihe IV, Erneuerte Perikopenordnung)
 2. Sonntag nach Weihnachten, 4. Januar 2015, 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Predigt: Pfarrerin Dr. Cornelia Kulawik Predigttext: 1 Johannes 5,11-13 (Predigtreihe IV, Erneuerte
2. Sonntag nach Weihnachten, 4. Januar 2015, 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Predigt: Pfarrerin Dr. Cornelia Kulawik Predigttext: 1 Johannes 5,11-13 (Predigtreihe IV, Erneuerte
Evangelische Messe anlässlich der Segnung von N.N. und N.N. am. Zu den mit * gekennzeichneten Teilen des Gottesdienstes steht die Gemeinde
 Evangelische Messe anlässlich der Segnung von N.N. und N.N. am Zu den mit * gekennzeichneten Teilen des Gottesdienstes steht die Gemeinde Vorspiel Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
Evangelische Messe anlässlich der Segnung von N.N. und N.N. am Zu den mit * gekennzeichneten Teilen des Gottesdienstes steht die Gemeinde Vorspiel Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
Entwicklung von Fähigkeiten mittels einfacher Fragen und Geschichten. Gebrauchsanleitung :
 Entwicklung von Fähigkeiten mittels einfacher Fragen und Geschichten. Gebrauchsanleitung : 1. Der einzige Mensch über den ich etwas weiß,- und davon oft nicht allzu viel -, bin ich selbst, 2. Für andere
Entwicklung von Fähigkeiten mittels einfacher Fragen und Geschichten. Gebrauchsanleitung : 1. Der einzige Mensch über den ich etwas weiß,- und davon oft nicht allzu viel -, bin ich selbst, 2. Für andere
WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES
 WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 1 Einleitung Der christliche Glaube bekennt sich zum Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit, nämlich»gott-heiliger Geist«. Der Heilige Geist ist wesensgleich
WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 1 Einleitung Der christliche Glaube bekennt sich zum Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit, nämlich»gott-heiliger Geist«. Der Heilige Geist ist wesensgleich
ihrer Hingabe: Mir geschehe nach deinem Wort, ließ sie sich von Gott bis zum Rand füllen und wurde voll der Gnade.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum 15. Jahrestag des Todes von Mutter Teresa am 5. September 2012 in München St. Margret Mutter Teresa ist weltweit bekannt als
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum 15. Jahrestag des Todes von Mutter Teresa am 5. September 2012 in München St. Margret Mutter Teresa ist weltweit bekannt als
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Gottes- und Nächstenliebe
 Gottes- und Nächstenliebe Das Vermächtnis Jesu für die Kirche und die Welt Geistliches Wort am 26. 10. 2008 WDR 5, 8. 05 Jesus hat Gottes- und Nächstenliebe ganz eng zusammengerückt. Er wird gefragt, welches
Gottes- und Nächstenliebe Das Vermächtnis Jesu für die Kirche und die Welt Geistliches Wort am 26. 10. 2008 WDR 5, 8. 05 Jesus hat Gottes- und Nächstenliebe ganz eng zusammengerückt. Er wird gefragt, welches
Verlauf Material LEK Glossar Literatur. Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman (S II)
 Reihe 11 S 5 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman Erschließung durch analytische und produktions - orientierte Verfahren Stunde 1 Agnes ist
Reihe 11 S 5 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Peter Stamm: Agnes ein postmoderner Beziehungsroman Erschließung durch analytische und produktions - orientierte Verfahren Stunde 1 Agnes ist
dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen stehen:
 Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Thema 6: Loben und Danken
 Einleitung 2. Chronik 20,1-30 Thema 6: Loben und Danken Gott freut sich, wenn wir mit unseren Bitten zu ihm kommen. Er ist unser himmlischer Vater, der sich danach sehnt, uns zu geben, was gut für uns
Einleitung 2. Chronik 20,1-30 Thema 6: Loben und Danken Gott freut sich, wenn wir mit unseren Bitten zu ihm kommen. Er ist unser himmlischer Vater, der sich danach sehnt, uns zu geben, was gut für uns
1 Lazarus aus Betanien war krank geworden aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Marta wohnten.
 1 Lazarus aus Betanien war krank geworden aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Marta wohnten. 1 Lazarus aus Betanien war krank geworden aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Marta wohnten.
1 Lazarus aus Betanien war krank geworden aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Marta wohnten. 1 Lazarus aus Betanien war krank geworden aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Marta wohnten.
Realgymnasium Schlanders
 Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Wirkungsvoll schreiben : Tipps zu schwierigen Kundensituationen
 Wirkungsvoll schreiben : Tipps zu schwierigen Kundensituationen Schwierige Kundensituationen Strategie 1 Strategie Manche Briefe an Kunden sind besonders schwierig. Zum Beispiel, weil: Sie keine für den
Wirkungsvoll schreiben : Tipps zu schwierigen Kundensituationen Schwierige Kundensituationen Strategie 1 Strategie Manche Briefe an Kunden sind besonders schwierig. Zum Beispiel, weil: Sie keine für den
Schleifentexte. An jedem Ende steht ein Anfang. As Time Goes By. Aufrichtige Anteilnahme. Auf Deinem Stern gibt es keinen Schmerz
 Erfurter Landstraße 42 99867 Gotha Telefon: 03621-406141 info@bestattungen-gotha.de Schleifentexte An jedem Ende steht ein Anfang As Time Goes By Aufrichtige Anteilnahme Auf Deinem Stern gibt es keinen
Erfurter Landstraße 42 99867 Gotha Telefon: 03621-406141 info@bestattungen-gotha.de Schleifentexte An jedem Ende steht ein Anfang As Time Goes By Aufrichtige Anteilnahme Auf Deinem Stern gibt es keinen
VERHEISSUNGEN BLANKOSCHECKS GOTTES 01
 Auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das Ja; darum sprechen wir auch durch Jesus Christus das Amen, Gott zum Lobe - 2. Korinther 1,20. VERHEISSUNGEN BLANKOSCHECKS GOTTES 01 Verheißungen sind
Auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das Ja; darum sprechen wir auch durch Jesus Christus das Amen, Gott zum Lobe - 2. Korinther 1,20. VERHEISSUNGEN BLANKOSCHECKS GOTTES 01 Verheißungen sind
Interpretationen: Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar und die Dame in Rosa 13
 Inhaltsverzeichnis Interpretationen: Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar und die Dame in Rosa 13 1 Die Lektüre einer Ganzschrift im Religionsunterricht 13 1.1 Didaktische Vorüberlegungen 13 1.2 Lernchancen 15
Inhaltsverzeichnis Interpretationen: Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar und die Dame in Rosa 13 1 Die Lektüre einer Ganzschrift im Religionsunterricht 13 1.1 Didaktische Vorüberlegungen 13 1.2 Lernchancen 15
Ich und mein Leben. Die Frage nach dem Selbst. Fragenkreis 1: (1.HJ) Städtische Gesamtschule Neukirchen-Vluyn
 Fragenkreis 1: (1.HJ) Die Frage nach dem Selbst 5. Jahrgang Schulinterner Lehrplan: Praktische Philosophie Seite 1 von 5 beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten
Fragenkreis 1: (1.HJ) Die Frage nach dem Selbst 5. Jahrgang Schulinterner Lehrplan: Praktische Philosophie Seite 1 von 5 beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten
