LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Verordnungsnummer: 3057/0008-AP/2013
|
|
|
- Wilfried Koenig
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Verordnungsnummer: 3057/0008-AP/2013 Lehrplan für den Modullehrberuf ELEKTROTECHNIK in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September Klasse ab 1. September Klasse ab 1. September Klasse ab 1. September 2013 Dieser Lehrplan besteht aus 40 Seiten und gliedert sich in folgende Bereiche: Seitenanzahl 1 Deckblatt mit Inkraftsetzungsdatum Rechtsgrundlagen und Förderunterricht Stundentafel Allgemeine Bestimmungen, allgemeines Bildungsziel, Didaktische Grundsätze, Unterrichtsprinzipien und Umsetzungsbestimmungen Lehrstoffbereiche 5.1 Politische Bildung Deutsch und Kommunikation Berufsbezogene Fremdsprache Angewandte Wirtschaftslehre Fachunterricht Freigegenstände, unverbindliche Übungen und Förderunterricht... siehe Teil 2 Bereich 1 Seite 1
2 Lehrplan für den Modullehrberuf Elektrotechnik (ersetzt den Schulversuchslehrplan aus dem Jahr 2011) beginnend mit der 1. Klasse ab 1. September 2010 im Bundesland Salzburg Rahmenlehrplan: A/4/1 BGBL. Nr.: 272/2013 Einrichtung von Leistungsgruppen gemäß 46 Abs. 2 und 47 Abs. 3 des SCHOG: In den Pflichtgegenständen Angewandte Wirtschaftslehre bis 3. Klasse Angewandte Mathematik bis 4. Klasse Spezielle Technologie bis 4. Klasse ist ein vertieftes Bildungsangebot zu führen. Eine Leistungsgruppe hat die zur Erfüllung der Aufgabe der Berufsschule notwendigen Erfordernisse und die andere ein vertieftes Bildungsangebot zu vermitteln. Der Beobachtungszeitraum für die Einstufung in die Leistungsgruppen hat an lehrgangsmäßigen Berufsschulen sechs bis neun Unterrichtstage und an ganzjährigen Berufsschulen sechs bis zwölf Wochen zu umfassen. Schüler, die den entsprechenden Fachbereich in einer anderen berufsbildenden Schule oder in der Polytechnischen Schule erfolgreich abgeschlossen haben, sind in die höhere Leistungsgruppe einzustufen, in welcher der Unterricht auf dem bisher erlernten Lehrstoff aufzubauen ist. Für diese Schüler entfällt der Beobachtungszeitraum für die Leistungsgruppen im betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterricht. Für die Umstufung in eine höhere oder niedrigere Leistungsgruppe besteht ein Termin während des Unterrichtsjahres und ein weiterer Termin am Ende des Unterrichtsjahres für die nächste Klasse, sofern der betreffende Pflichtgegenstand in dieser geführt wird. In Klassen, die einem halben Lehrjahr entsprechen, besteht kein Umstufungstermin. Förderunterricht kann gemäß SCHOG 8 lit. f sublit. aa und cc erfolgen. Unterrichtsveranstaltungen im Zuge des Förderunterrichtes sind nicht zu beurteilen. Bereich 2 Seite 2
3 Der Förderunterricht für Schüler, die in Pflichtgegenständen eines zusätzlichen Lernangebotes bedürfen, weil sie die Anforderungen in wesentlichen Bereichen nur mangelhaft erfüllen oder wegen eines Schulwechsels Umstellungsschwierigkeiten haben, ist in den Pflichtgegenständen des sprachlichen, betriebswirtschaftlichen und des fachtheoretischen Unterrichtes, ausgenommen Laboratoriumsübungen, für eine Kursdauer von höchstens 18 Unterrichtsstunden je Unterrichtsgegenstand einzurichten, wobei die Dauer eines Kurses sechs Unterrichtsstunden nicht unterschreiten darf. Der Schüler darf diesen Förderunterricht insgesamt im Ausmaß von höchstens 18 Unterrichtsstunden je Klasse besuchen. Der Förderunterricht für Schüler, die auf den Übertritt in eine höhere Leistungsgruppe vorbereitet werden sollen, und für Schüler, deren Übertritt in eine niedrigere Leistungsgruppe verhindert werden soll, ist für eine Kursdauer von höchstens 18 Unterrichtsstunden je Unterrichtsgegenstand einzurichten, wobei die Dauer eines Kurses sechs Unterrichtsstunden nicht unterschreiten darf. Der Schüler hat bei Bedarf diesen Förderunterricht insgesamt im Ausmaß von höchstens 18 Unterrichtsstunden je Klasse zu besuchen. Ein Schüler darf beide Arten des Förderunterrichtes in einer Klasse im Ausmaß von insgesamt höchstens 24 Unterrichtsstunden besuchen. Bereich 2 Seite 3
4 Stundentafel für den Lehrberuf Elektrotechnik Stundentafel 1: Lehrzeit 3 ½ Jahre Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten bis dritten Klasse mindestens je 360 Unterrichtsstunden und in der vierten Klasse mindestens 180 Unterrichtsstunden. Unterrichtsausmaß an lehrgangsmäßigen Berufsschulen: 1. bis 3. Klasse /3 Wochen 4. Klasse /3 Wochen Wöchentliche Unterrichtsstunden in den einzelnen Klassen: Pflichtgegenstände Lehrgang Klasse Politische Bildung Deutsch und Kommunikation Berufsbezogene Fremdsprache Angewandte Wirtschaftslehre Fachunterricht Elektrotechnik Angewandte Mathematik Technologie KB Werk- und Hilfsstoffe* KB Grundlegendes über Maschinen und Geräte* KB Grundlagen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik* KB Installationstechnik* KB Grundlagen der Energietechnik* Spezielle Technologie KB Maschinen und Geräte* KB Mess-, Steuer- und Regeltechnik* KB Projektmanagement* KB Elektro- und Gebäudetechnik* KB Energietechnik* KB Anlagen- und Betriebstechnik* KB Automatisierungs- und Prozessleittechnik* Elektrotechnische Kommunikation Laboratoriumsübungen KB: Installationstechniklabor* KB: Energietechniklabor* KB: Mess-, Steuer- und Regeltechniklabor* Elektrotechnisches Projektlabor* Gesamtstundenzahl pro Woche KB: Kompetenzbereich * inkl. Kompetenzbereich Sicherheit und Ergonomie diese Stundenzahlen werden je nach gewählten Hauptmodul für die Kompetenzbereiche Elektro- und Gebäudetechnik (H1), Energietechnik (H2), Anlagen und Betriebstechnik (H3) oder Automatisierungs- und Prozessleittechnik (H4) verwendet Bereich 3 Seite 4
5 Stundentafel für den Lehrberuf Elektrotechnik Stundentafel 2: Lehrzeit 4 Jahre Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1620 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten bis vierten Klasse mindestens je 360 Unterrichtsstunden.. Unterrichtsausmaß an lehrgangsmäßigen Berufsschulen: 1. bis 3. Klasse /3 Wochen 4. Klasse... 2x 4 2/3 Wochen Wöchentliche Unterrichtsstunden in den einzelnen Klassen: Pflichtgegenstände Lehrgang Klasse Politische Bildung Deutsch und Kommunikation Berufsbezogene Fremdsprache Angewandte Wirtschaftslehre Fachunterricht Elektrotechnik Angewandte Mathematik Technologie KB Werk- und Hilfsstoffe* KB Grundlegendes über Maschinen und Geräte* KB Grundlagen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik* KB Installationstechnik* KB Grundlagen der Energietechnik* Spezielle Technologie KB Maschinen und Geräte* KB Mess-, Steuer- und Regeltechnik* KB Projektmanagement* KB Elektro- und Gebäudetechnik* KB Energietechnik* KB Anlagen- und Betriebstechnik* KB Automatisierungs- und Prozessleittechnik* Elektrotechnische Kommunikation Laboratoriumsübungen KB: Installationstechniklabor* KB: Energietechniklabor* KB: Mess-, Steuer- und Regeltechniklabor* Elektrotechnisches Projektlabor* Gesamtstundenzahl pro Woche KB: Kompetenzbereich * inkl. Kompetenzbereich Sicherheit und Ergonomie diese Stundenzahlen werden je nach gewählten Hauptmodul für die Kompetenzbereiche Elektro- und Gebäudetechnik (H1), Energietechnik (H2), Anlagen und Betriebstechnik (H3) oder Automatisierungs- und Prozessleittechnik (H4), sowie für die Vertiefung im gewählten Spezialmodul verwendet Bereich 3 Seite 5
6 4. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN, ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE, UNTERRICHTSPRINZIPIEN UND UMSETZUNGSBESTIMMUNGEN A Allgemeine Bestimmungen: Begriff: Der Lehrplan der Berufsschule ist ein lernergebnisorientierter Lehrplan mit Rahmencharakter, der die Stundentafel, die Bildungs- und Lehraufgabe, den Lehrstoff, die didaktischen Grundsätze für die einzelnen Unterrichtsgegenstände enthält. Umsetzung: Der Lehrplan ermöglicht die eigenständige und verantwortliche Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrerinnen und Lehrer gemäß den Bestimmungen des 17 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes innerhalb des vorgegebenen Umfangs. Die Sicherung des Bildungsauftrages ( 46 SchOG) und die Erfüllung des Lehrplanes erfordert die Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer. Diese Kooperation umfasst insbesondere: - die Anordnung, Gliederung, Gewichtung der Lehrstoffthemen unter Einbindung der mitverantwortlichen Entscheidung der Lehrerinnen und Lehrer, schulorganisatorischer und zeitlicher Rahmenbedingungen, - den Einsatz jener Lehr- und Lernformen und Unterrichtsmittel, welche die bestmögliche Entwicklung und Förderung der individuellen Begabungen ermöglichen. Die Unterrichtsplanung (Vorbereitung) erfordert von den Lehrerinnen und Lehrern die Konkretisierung des allgemeinen Bildungszieles sowie der Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände durch Festlegung der Unterrichtsziele, die Festlegung der Methoden und Medien für den Unterricht. Die Unterrichtsplanung hat einerseits den Erfordernissen des Lehrplanes zu entsprechen und andererseits didaktisch angemessen auf die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler sowie auf aktuelle Ereignisse und Berufsnotwendigkeiten einzugehen. Lehramtspflichten im Besonderen: Gemäß 51 des Schulunterrichtsgesetzes haben Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht sorgfältig vorzubereiten und das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken. Um sowohl fachlich als auch methodisch didaktisch auf neuestem Stand zu sein, haben die Lehrerinnen und Lehrer gem. 29 (3) Landeslehrerdienstrecht um ihre berufliche Fortbildung bestrebt zu sein. Wesentlich ergänzendes Element der Lehrplanerfüllung, Qualitätssicherung und - weiterentwicklung ist die Evaluation (z.b. Selbst-, Fremdevaluation) am Schulstandort. Bereich 4 Seite 6
7 B Allgemeines Bildungsziel: Bildungsauftrag: 2 und 46 SchOG bilden die Grundlagen des Bildungsauftrages für die persönliche und berufliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Das fachbezogene Qualifikationsprofil orientiert sich in seinen berufsschulrelevanten Aspekten an dem in der Ausbildungsordnung formulierten Berufsprofil. Die im Fachunterricht festgelegten Unterrichtsgegenstände bzw. fachbezogenen Lehrinhalte in anderen Unterrichtsgegenständen unterstützen die Entwicklung und Erreichung des Berufsprofils. Im Besonderen werden folgende Kompetenzen erreicht: - sind zum selbstständigen, eigenverantwortlichen, konstruktiv kritischen und lösungsorientieren Handeln im privaten, beruflichen, gesellschaftlichen Leben motiviert und befähigt und entwickeln dadurch ihre Individualität, Kreativität und ihren Selbstwert. - verfügen über eine nachhaltige Einstellung zum lebenslangen Lernen im privaten und beruflichen Bereich. - haben Interesse und Verständnis für Entrepreneur- und Intrapreneurship. - sind fähig, soziale wirtschaftliche und gesellschaftliche Benachteiligungen zu erkennen und motiviert an deren Lösung teilzunehmen. - haben Einsicht in die politischen Prozesse auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene und sehen sich verantwortlich für die Erhaltung der Demokratie, für das friedliche Zusammenleben von Bevölkerungsgruppen und Nationen, für die Förderung von Benachteiligten in der Gesellschaft sowie für den Schutz der Umwelt und des ökologischen Gleichgewichts. - können unter Einsatz ihrer Fach-, Methoden- sozialen und personalen Kompetenz berufs- und situationsadäquat agieren. C Allgemeine didaktische Grundsätze: Bei der Erarbeitung der Lerninhalte ist vom Bildungsstand der Schülerinnen und Schüler sowie von deren Lebens- und Berufswelt auszugehen. Die Sicherung des Bildungsauftrages und der Kompetenzen wird durch einen handlungsorientierten Unterricht in besonderer Weise unterstützt. Die Interdisziplinarität der Kompetenzfelder/Kompetenzbereiche ist durch Teamabsprachen zwischen den Lehrerinnen und Lehrern sicherzustellen. Die Lernziele der Kompetenzbereiche haben die Wissens-, Erkenntnis-, Anwendungsdimension sowie die personale und soziale Dimension zu berücksichtigen. Die Unterrichtsprinzipien der Aktualität des Lehrinhalts, der Berufs- und Lebensnähe der eingesetzten Methoden und Unterrichtsmittel, der Förderung der Selbstständigkeit, Kreativität und Innovationsbereitschaft sind in besonderer Weise zu beachten. Bereich 4 Seite 7
8 Eine Vielfalt an effizienten und effektiven Lehr- und Lernmethoden, bei denen das soziale Lernen und die individuelle Förderungsmöglichkeit einen hohen Stellenwert haben, sind anzuwenden. Selbstständiges Planen, Durchführen, Überprüfen, Korrigieren und Bewerten komplexer Aufgabenstellungen fördern den Kompetenzaufbau und in der Folge die Berufs- und Beschäftigungsfähigkeit. D Unterrichtsprinzipien: Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung sind der Berufsschule auch Aufgaben gestellt, die nicht einem Unterrichtsgegenstand oder wenigen Unterrichtsgegenständen zugeordnet werden können, sondern auch fächerübergreifend im Zusammenwirken mehrerer oder aller Unterrichtsgegenstände zu bewältigen sind. Kennzeichnend für diese Bildungsaufgaben ist, dass sie in besonderer Weise die Grundsätze der Lebensnähe und Handlungsbezogenheit des Unterrichts berücksichtigen; kennzeichnend für sie ist ferner, dass sie nicht durch Lehrstoffangaben allein beschrieben werden können, sondern als Kombination stofflicher, methodischer und erzieherischer Anforderungen zu verstehen sind und schließlich, dass sie unter Wahrung ihres fächerübergreifenden Charakters jeweils in bestimmten Unterrichtsgegenständen oder Teilen von Unterrichtsgegenständen einen stofflichen Schwerpunkt haben. - Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern - Erziehung zum unternehmerischen Denken und Handeln - Gesundheitserziehung - Lese- und Sprecherziehung - Medienerziehung - Politische Bildung - Sexualerziehung - Umwelterziehung - Verkehrserziehung. Die Umsetzung der Unterrichtsprinzipien im Schulalltag erfordert eine wirksame Koordination der Unterrichtsgegenstände unter Ausnützung ihrer Querverbindungen, den Einsatz geeigneter zusätzlicher Unterrichtsmittel und allenfalls die gelegentliche Heranziehung außerschulischer Fachleute. Für diese Umsetzung bieten sich vor allem projektorientierter Unterricht und Projekte an. Die Unterrichtsprinzipien sollen jedoch nicht eine Vermehrung des Lehrstoffs bewirken, sondern zu einer besseren Durchdringung und überlegten Auswahl des im Lehrplan beschriebenen Lehrstoffes beitragen. Unterrichtsprinzipien sind auch dann zu beachten, wenn zur selben Thematik eigene Unterrichtsgegenstände oder Bereich 4 Seite 8
9 Lehrstoffinhalte vorgesehen sind. Für die Umsetzung der Unterrichtsprinzipien sind die einschlägigen Grundsatzerlässe des zuständigen Bundesministeriums zu beachten. Die Unterrichtsprinzipien umfassen im Besonderen - die Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern (Gender Mainstreaming), indem Fragen der Gleichstellung der Geschlechter verstärkt im Unterricht, in den Lehrbehelfen und sonstigen in Verwendung stehenden Unterrichtsmitteln berücksichtigt sowie die Diskussion über diese Themen gezielt geführt werden; - die Entrepreneurship Education (Erziehung zu Unternehmergeist), indem unternehmerisches Denken und Handeln durch Vermittlung entsprechender Kenntnisse und Einbeziehung von Praxisbeispiele, Fallstudien, Planspiele und Projekte in den Unterricht gefördert werden; - die Gesundheitserziehung, indem die Schule als gesundheitsförderliche Lebenswelt gestaltet, persönliche Kompetenzen und Leistungspotentiale der Schüler/innen in Hinblick auf gesundheitsbewusstes, eigenverantwortliches Handeln und Wissen gefördert und einschlägige Projekte und Veranstaltungen durchgeführt werden; - die Wirtschaftserziehung und Verbraucherinnen- und Verbraucherbildung, indem im Unterricht die Rechte, Pflichten und Möglichkeiten als Verbraucher/innen behandelt sowie die Folgen des eigenen Konsum- und Wirtschaftsverhaltens bewusst gemacht werden; - die Umwelterziehung, indem die Verflechtung ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Einflüsse thematisiert und eine Sensibilisierung für ökologische Anliegen und Erfordernisse unter Einbeziehung des Natur- und Umweltschutzes erzeugt und im Besonderen eine persönliche Betroffenheit geschaffen wird; - die politische bzw. europapolitische Bildungsarbeit, indem im Unterricht auf aktuelle insbesondere auch europäische Entwicklungen eingegangen wird und im Besonderen die europäischen Initiativen im Bildungsbereich (Bildungsprogramme, Qualifikationsrahmen, Anerkennungsrichtlinien, Qualitätssicherungsrahmen, Transparenzinstrumente) thematisiert werden; - die Medienbildung, indem z.b. Fertigkeiten im technischen Umgang mit Medien, Selektions- und Differenzierungsfähigkeiten sowie das Erkennen eigener Bedürfnisse entwickelt und eine kritische Einsicht in die Kommunikationsphänomene vermittelt werden; - die Sexualerziehung, indem in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten das Wissen um Sexualität vertieft und den Jugendlichen geholfen wird, ihre persönliche Identität und Wertvorstellungen zu entwickeln, in denen Sexualität als wichtiger, natürlicher und positiver Aspekt unseres Menschseins erfahrbar wird; - die Verkehrserziehung, in dem in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten die persönliche Verkehrsteilnahme unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und rechtlichen Aspekten begleitet wird und im Besonderen auch die Gefahren von Alkoholisierung für sich und andere Verkehrsteilnehmer thematisiert werden; - die Politische Bildung, in der die Erziehung zu einem demokratisch fundierten Österreichbewusstsein, zu einem gesamteuropäischen Denken und zu einer Weltoffenheit vermittelt wird. Insbesondere werden die Grundwerte Friede, Bereich 4 Seite 9
10 Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit als Grundwerte unserer menschlichen Gesamtordnung und Grundlage politischen Handelns thematisiert. UMSETZUNGSBESTIMMUNGEN UND ALLGEMEINE DIDAKTISCHE BEMERKUNGEN In den ersten zwei Schulstufen ist insbesondere auf die Vermittlung einer gut fundierten Basisausbildung für den Lehrberuf Elektrotechnik Bedacht zu nehmen. Der gründlichen Erarbeitung in der notwendigen Beschränkung und der nachhaltigen Festigung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse ist der Vorzug gegenüber einer oberflächlichen Vielfalt zu geben. Im Pflichtgegenstand Spezielle Technologie wird das Ziel verfolgt, dass Schülerinnen und Schüler ausgehend von den Grundlagen im Pflichtgegenstand Technologie über tiefer gehende Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen. Je nach Schülerinnen- und Schülerzahl sind in Abstimmung mit den ausstattungsgemäßen Gegebenheiten bei der Vermittlung des Lehrstoffes insbesondere ab der 3. Schulstufe wahlweise die Besonderheiten der Kompetenzbereiche, die auf Elektround Gebäudetechnik oder Energietechnik oder Anlagen- und Betriebstechnik oder Automatisierungs- und Prozessleittechnik fokussieren, zu beachten und für diese nach Möglichkeit Fachklassen bzw. Fachgruppen zu bilden. Die angeführten Kompetenzbereiche können einzeln, kombiniert oder in Form einer inneren Differenzierung geführt werden, wobei im Sinne des exemplarischen Lernens und Arbeitens möglichst praxisnahe Aufgabenstellungen zu wählen sind, durch deren Bearbeitung Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden gewonnen werden, die eigenständig auf andere berufsverwandte Aufgaben übertragen werden können. Dasselbe gilt für Pflichtgegenstände Elektrotechnische Kommunikation und Laboratoriumsübungen. Ab der 4. Schulstufe können je nach Schülerinnen- und Schülerzahl in Abstimmung mit den ausstattungsgemäßen Gegebenheiten im Pflichtgegenstand Elektrotechnisches Projektlabor wahlweise Arbeitsaufträge, die auch die Besonderheiten der Gebäudeleittechnik, Sicherheitsanlagentechnik, Erneuerbare Energien, Netzwerk- und Kommunikationstechnik bzw. Eisenbahnelektrotechnik, Eisenbahnfahrzeugtechnik, Eisenbahntransporttechnik, Eisenbahnfahrzeuginstandhaltungstechnik oder Eisenbahnbetriebstechnik berücksichtigen, gegeben werden. GEMEINSAME DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE DES FACHUNTERRICHTES Das Hauptkriterium für die Auswahl und Schwerpunktsetzung des Lehrstoffes ist die Anwendbarkeit auf Aufgaben der beruflichen Praxis. Nützlich sind Aufgaben, die Lehrinhalte verschiedener Themenbereiche oder Pflichtgegenstände kombinieren. Desgleichen sind bei jeder Gelegenheit die Zusammenhänge zwischen theoretischer Erkenntnis und praktischer Anwendung aufzuzeigen. Zwecks rechtzeitiger Bereitstellung von Vorkenntnissen und zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten ist die Abstimmung der Lehrerinnen und Lehrer untereinander wichtig. Bereich 4 Seite 10
11 In Angewandte Mathematik stehen - auch bei der Behebung allfälliger Mängel in den mathematischen Grundkenntnissen und Fertigkeiten - Aufgabenstellungen aus den fachtheoretischen Pflichtgegenständen im Vordergrund. Den Erfordernissen der Praxis entsprechend, liegt das Hauptgewicht in der Vermittlung des Verständnisses für den Rechengang und dem Schätzen der Ergebnisse. In Elektrotechnische Kommunikation sind insbesondere Aufgabenstellungen, die das Verständnis für die Zusammenhänge im Lehrberuf Elektrotechnik fördern, nützlich. Die Unterrichtsgegenstände Elektrotechnische Kommunikation und Laboratoriumsübung sollen die Vorgänge und Zusammenhänge im Lehrberuf veranschaulichen und so die betriebliche Ausbildung ergänzen. Sie sind in Verbindung zu den fachtheoretischen Unterrichtsgegenständen zu führen und den individuellen Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. In Elektrotechnisches Projektlabor ist insbesondere beim Projektieren und Durchführen von Arbeitsaufträgen auf die praxisbezogene Kundinnen- und Kundenbetreuung Wert zu legen. Schülerinnen und Schüler sind zum logischen und vernetzten Denken zu führen. Darüber hinaus ist auf die Verknüpfung von allgemein bildenden, sprachlichen, betriebswirtschaftlichen, technischen, mathematischen und zeichnerischen Sachthemen zu achten. Dabei empfiehlt sich, dass Schülerinnen und Schüler Projekte mit verschiedener Arbeitsdauer und differenten Schwierigkeitsgraden im Team planen und erarbeiten. Der Einsatz der EDV ist grundsätzlich zu empfehlen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit ist auf die geltenden Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Umwelt hinzuweisen. Bereich 4 Seite 11
12 5. LEHRPLANBEREICHE: 5.1. Politische Bildung (PB): Der Schüler soll zur aktiven, kritischen und verantwortungsbewussten Gestaltung des Lebens in der Gemeinschaft befähigt sein. Er soll sich der persönlichen Position bewusst sein, andere Standpunkte und Überzeugungen vorurteilsfrei und kritisch prüfen sowie die eigene Meinung vertreten können. Er soll zur Mitwirkung am öffentlichen Leben bereit sein, nach Objektivität streben und anderen mit Achtung und Toleranz begegnen. Er soll für humane Grundwerte eintreten, sich für die Belange Benachteiligter einsetzen und in jeder Gemeinschaftsform zwischenmenschliche Beziehungen partnerschaftlich gestalten. Er soll Vorurteile erkennen und bereit sein, sie abzubauen. Er soll die Verantwortung des einzelnen und der Gesellschaft für eine gesunde Umwelt und die sich daraus ergebenden Interessenskonflikte erkennen und umweltbewusst handeln. Er soll Konflikte gewaltfrei bewältigen können und für Frieden und Gleichberechtigung eintreten. Er soll sich der Stellung Österreichs in Europa und in der Welt und der Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit bewusst sein. Er soll mit Rechtsgrundlagen, die ihn in Beruf und Alltag betreffen, vertraut sein und die Grundzüge der staatlichen Rechtsordnung kennen. Er soll das Wirken der Kräfte in Staat und Gesellschaft im Zusammenhang mit der zeitgeschichtlichen Entwicklung verstehen und die Mitwirkungsmöglichkeiten erkennen und nützen. 1. Klasse: Lehrling und Schule: Klassen- und Schulgemeinschaft. Lehrling und Betrieb: Berufsbildung. Rechtliche Bestimmungen über die duale Berufsausbildung sowie die Beschäftigung von Jugendlichen und ihrer Vertretung im Betrieb. Berufliches Umfeld: Arbeitsrecht(Lehrling). Sozialrecht. Interessensvertretungen. Soziales Umfeld: Gesundes Leben. Jugendschutz. Der Jugendliche als Verkehrsteilnehmer. Bereich 5.1 Seite 12 Anlage A/4/1 - Schulversuchslehrplan für den Modullehrberuf Elektrotechnik Stand: Sep. 2010
13 2. Klasse: Soziales Umfeld: Gemeinschaftsformen Gemeinschaftsbeziehungen. Rechtliche Grundlagen des österreichischen Staates, politisches System Österreichs: Prinzipien der österreichischen Bundesverfassung. Grund- und Freiheitsrechte. Staatsbürgerschaft. Politische Parteien und Verbände. Sozialpartnerschaft. Wahlen. 3. Klasse: Zeitgeschichte: Werden und Entwicklung der Republik Österreich. Rechtliche Grundlagen des österreichischen Staates, politisches System Österreichs: Direkte Demokratie. Bundesgesetzgebung, Bundesverwaltung. Gerichtsbarkeit. Landesgesetzgebung, Landesverwaltung. Gemeinde. Budget. 4. Klasse: Lehrling und Betrieb: Weiterbildung. Berufliches Umfeld: Arbeitsrecht (Arbeitnehmer)Arbeitsmarkt, Personenverkehr in der EU. Soziales Umfeld: Umwelt, Medien. Österreich in der Völkergemeinschaft: Österreich in der Europäischen Union. Internationale Beziehungen. Internationale Organisationen. Rechtliche Grundlagen des österreichischen Staates, politisches System Österreichs: Österreichische Neutralität. Landesverteidigung. Didaktische Grundsätze: Der Unterricht soll auf den Erfahrungen der Schüler aufbauen, sich an ihren Bedürfnissen orientieren und die gesellschaftliche Realität einbeziehen. Das aktuelle Zeitgeschehen ist zu berücksichtigen. Zeitgeschichte ist insoweit zu behandeln, als entsprechende Kenntnisse für das Verständnis der Gegenwart notwendig sind. Gesetze sollen nur in ihren wesentlichen Bereichen dargestellt werden. Auf bestehende Diskrepanzen zwischen Gesetzesanspruch und Wirklichkeit ist einzugehen. Die politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und humanitären Leistungen Österreichs sollen bei sich bietender Gelegenheit hervorgehoben und die österreichischen Ver- Bereich 5.1 Seite 13 Anlage A/4/1 - Schulversuchslehrplan für den Modullehrberuf Elektrotechnik Stand: Sep. 2010
14 hältnisse im Vergleich zu anderen Staaten dargestellt werden. Auf die Entwicklung der Fähigkeiten der Schüler, kritisch zu denken, sich anderen mitzuteilen, kooperativ zu handeln und selbständig zu arbeiten, soll besonderer Wert gelegt werden. Dies soll durch die Auswahl entsprechender Sozialformen und Unterrichtsmethoden gefördert werden. Die Lehrer müssen sich ihrer Wirkung im Umgang mit Schülern bewusst sein. Unabhängig von ihrer eigenen Meinung haben sie auch andere Standpunkte und Wertvorstellungen darzustellen, um den Schülern eine selbständige Meinungsbildung zu ermöglichen. Bereich 5.1 Seite 14 Anlage A/4/1 - Schulversuchslehrplan für den Modullehrberuf Elektrotechnik Stand: Sep. 2010
15 5.2. Deutsch und Kommunikation (DUK): Der Schüler soll Situationen des beruflichen und privaten Alltags sprachlich bewältigen und mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden entsprechend kommunizieren können. Er soll durch aktive Erprobung von schriftlichen und vor allem mündlichen Kommunikationsformen Erfahrungen über seine Sprech- und Verhaltensweisen sammeln, seinen Kommunikationsstil sowie seine Sprechtechnik verbessern und seine Rechtschreibkenntnisse festigen und erweitern. Der Schüler soll dadurch seine Kommunikations- und Handlungsfähigkeit verbessern, seinen Wortschatz erweitern und persönliche und betriebliche Interessen sprachlich angemessen vertreten können. Der Schüler, der sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereitet, soll unter Berücksichtigung der Schreibrichtigkeit über zusätzliche Qualifikationen im kreativen Schreiben verfügen. 1. Klasse: Kommunikation: Elemente und Aufgaben der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Schriftliche Kommunikation: Sammeln und Sichten von Informationen. Erstellen von Berichten, Inhaltsangaben und Kurzfassungen. Mündliche Kommunikation: Darstellung von Sachverhalten. Einfache Reden und Einzelgespräche. Kommunikationsnormen beim Telefonieren. Gespräche mit Vorgesetzten und Kollegen: Höflichkeitsnormen. Mitteilungs- und Fragetechniken. Gespräche mit Kunden: Höflichkeitsnormen. Kontaktaufnahme. Bedarfsermittlung. Auftragsannahme. Rechtschreibung: Erweiterung des Grundwortschatzes. Festigung des Fachwortschatzes. Übungen zum Erheben und Beheben gravierender Rechtschreibfehler. Gebrauch von Wörterbüchern und Nachschlagewerken. Lehrstoff für Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten: Kreatives Schreiben: Behandlung von gesellschaftsrelevanten Themen (Quellenstudium, Konzeption und Ausarbeitung). Bereich 5.2 Seite 15 Für alle Lehrberufe an der Landesberufsschule 4 in SalzburgStand: Sep. 2001
16 Didaktische Grundsätze: Hauptkriterium für die Lehrstoffauswahl ist der Beitrag zur Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit des Schülers, wobei das zur Verfügung stehende Stundenausmaß zu beachten ist. Texte, Medienbeispiele und Problemstellungen sollen sich vor allem an der beruflichen und privaten Erfahrungswelt orientieren und auf den erworbenen Kenntnissen aus der Pflichtschule aufbauen. Das selbständige Beschaffen von Informationsmaterial soll gefördert werden. Im Bereich der mündlichen Kommunikation sind Übungen individueller Aufgabenstellung bzw. Übungen in Kleingruppen empfehlenswert. Situationsgerechte Gesprächs- und Sozialformen motivieren den Schüler zu aktiver Mitarbeit, wodurch eine Vielzahl kommunikativer Selbst- und Fremderfahrungen ermöglicht und ein wichtiger Beitrag zur Sprechtechnik und Persönlichkeitsbildung geleistet werden kann. Es empfehlen sich Methoden, die die Sprechfertigkeit und die Mitteilungsleistung der Schüler fördern (z.b. Rollenspiele, Dialoge). Der gezielte Einsatz audiovisueller Medien ermöglicht Übungen zu angemessenem Verhalten durch Rückmeldungen sowie Selbst- und Fremdkritik. Bei jeder Gelegenheit ist auf die Verbesserung des Ausdrucks, des Stils und der grammatikalischen Richtigkeit Wert zu legen. Der Lehrstoff,,Rechtschreibung" soll sich an den individuellen Vorkenntnissen der Schüler und konkreten Schreibanlässen orientieren und zeitlich höchstens ein Viertel der Gesamtstundenzahl abdecken. Absprachen mit den Lehrern der anderen Unterrichtsgegenstände, insbesondere,,politische Bildung" hinsichtlich des Übens der Sprechfertigkeit sowie,,wirtschaftskunde mit Schriftverkehr" betreffend Festigung der Rechtschreibkenntnisse sollen einen optimalen Lernertrag sichern. Das Thema,,Gespräch mit Kunden" hat berufseinschlägig zu erfolgen, weshalb die Zusammenarbeit mit den Lehrern des Fachunterrichtes wichtig ist. Bereich 5.2 Seite 16 Für alle Lehrberufe an der Landesberufsschule 4 in SalzburgStand: Sep. 2001
17 5.3. Berufsbezogene Fremdsprache (BFE): sollen Situationen des beruflichen und privaten Alltags in der Fremdsprache bewältigen können. Sie sollen - erforderlichenfalls unter Verwendung eines zweisprachigen Wörterbuches - Gehörtes und Gelesenes verstehen und sich mündlich und schriftlich angemessen ausdrücken sowie die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten selbständig anwenden und weiterentwickeln können. Sie sollen Menschen anderer Sprachgemeinschaften und deren Lebensweise achten., die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, sollen ihren mündlichen und schriftlichen Ausdruck bei der Behandlung und Präsentation von gesellschaftsrelevanten und berufsspezifischen Themen vertiefen können. In den einzelnen Klassen soll die Schülerin, der Schüler: 1. Klasse: Das Wesentliche des Klassengespräches und das Wesentliche einfacher themenbezogener Hörtexte verstehen und Einzelheiten heraushören können; das Wesentliche einfacher themenbezogener Lesetexte verstehen und Einzelheiten mit Übersetzungshilfen hervorheben können; sich themenbezogen mit einfachen Worten und Redewendungen verständlich machen und Rückfragen stellen können; Stichworte und Redewendungen notieren, Formulare ausfüllen und einfache Texte umgestalten können. Lehrstoff für Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten: Mündlicher und schriftlicher Ausdruck: Behandlung von gesellschaftsrelevanten und berufsspezifischen Themen (Quellenstudium, Konzeption und Ausarbeitung einfacher Texte) 2. Klasse: Das Klassengespräch und das Wesentliche authentischer Hörtexte verstehen und wichtige Details heraushören und bearbeiten können; das Wesentliche authentischer Lesetexte nach gelegentlichen Rückfragen verstehen und mit Hilfe von Wörterbüchern weiterbearbeiten können; sich themenbezogen einfach und im Wesentlichen richtig ausdrücken und an Klassengesprächen teilnehmen können; Hör- und Lesetexte zusammenfassen, Konzepte als Hilfe für mündliche Äußerungen und einfache Mitteilungen verfassen können. Bereich 5.3 Seite 17
18 Lehrstoff für Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten: Mündlicher und schriftlicher Ausdruck: Behandlung von gesellschaftsrelevanten und berufsspezifischen Themen (Quellenstudium, Konzeption und Ausarbeitung von komplexen Texten). 3. Klasse: Dem Klassengespräch und authentischen Hörtexten folgen und wichtige Details verstehen und bearbeiten können (einfach); längere Lesetexte im Wesentlichen verstehen, selektiv lesen und wichtige Informationen selbständig erschließen und bearbeiten können; sich themenbezogen, insbesondere in berufsspezifischen Gesprächen, im normalen Sprechtempo äußern und an Klassengesprächen initiativ teilnehmen können; Notizen und Konzepte für das freie Sprechen erstellen, einfache Briefe nach Mustern verfassen können sowie Hör- und Lesetexte einfach zusammenfassen können. Lehrstoff für Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten: Mündlicher und schriftlicher Ausdruck: Behandlung und Präsentation von gesellschaftsrelevanten und berufsspezifischen Themen (Quellenstudium, Konzeption und Ausarbeitung von komplexen Texten). 4. Klasse: Dem Klassengespräch und authentischen Hörtexten folgen und wichtige Details verstehen und bearbeiten können (umfangreich); längere Lesetexte im Wesentlichen verstehen, selektiv lesen und wichtige Informationen selbständig erschließen und bearbeiten können; sich themenbezogen, insbesondere in berufsspezifischen Gesprächen, im normalen Sprechtempo äußern und an Klassengesprächen initiativ/aktiv teilnehmen können; Notizen und Konzepte für das freie Sprechen erstellen, einfache Briefe nach Mustern verfassen können. Lehrstoff für Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten: Mündlicher und schriftlicher Ausdruck: Behandlung und Präsentation von gesellschaftsrelevanten und berufsspezifischen Themen (Quellenstudium, Konzeption und Ausarbeitung von komplexen Texten). Die folgenden Themen sind in jeder der Klassen im Sinne der angeführten Bildungsund Lehraufgabe mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu behandeln. Wirtschaft und Arbeitswelt: Beruf, Arbeitsplatz, Ausbildung. Berufsspezifischer Schriftverkehr und Stellenbewerbung. Sicherheit und Umweltschutz. Alltag und Aktuelles: Bereich 5.3 Seite 18
19 Selbstdarstellung. Familie und Freunde. Wohnen. Gesundheit und Sozialdienste. Essen und Trinken. Ortsangaben. Freizeit. Reise und Tourismus. Einkaufen. Nationales und internationales Zeitgeschehen. Beruf (Elektrotechnik): Grundbegriffe der Elektrotechnik und Elektronik. Werk- und Hilfsstoffe. Werkzeuge, Maschinen, Geräte und Anlagen. Mess- und Prüfinstrumente. EDV- und Kommunikationssysteme. Technische Zeichnungen. Arbeitsverfahren und -techniken. Didaktische Grundsätze: Hauptkriterien für die Lehrstoffauswahl sind die Anwendbarkeit auf Situationen des beruflichen und privaten Alltags der Schülerinnen und Schüler, insbesondere die Erfordernisse des Lehrberufes. Hiebei ist auf das zur Verfügung stehende Stundenausmaß Bedacht zu nehmen. Um die Erreichung der Bildungs- und Lehraufgabe zu gewährleisten, empfiehlt es sich, von den Vorkenntnissen und dem Erlebnisbereich der Schülerinnen und Schüler auszugehen. Zur Verbesserung der Chancen von Schülerinnen und Schüler, die keine oder nur geringe Vorbildung in der Fremdsprache haben, tritt bei der Vermittlung des Lehrstoffes die Leistungsbeurteilung in den Hintergrund. Das Schwergewicht des Unterrichtes für diese Schüler liegt auf der Vermittlung der sprachlichen Grundfertigkeiten. Die Behandlung der Themen soll die Schülerinnen und Schüler auf Begegnungen mit Ausländern und mit fremdsprachlichen Texten vorbereiten und Vergnügen bereiten. Auf die Inhalte des Fachunterrichtes wäre Bezug zu nehmen. Die kommunikativen Fertigkeiten werden durch weitgehende Verwendung der Fremdsprache als Unterrichtssprache sowie durch Einsatz von Hörtexten auf Tonträgern und Filmen, z.b. von Telefon- und Verkaufsgesprächen, Radio- und Fernsehberichten, gefördert. Die Verwendung fachspezifischer Originaltexte, z.b. Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen, Anzeigen, Produkt- und Gebrauchsinformationen, Geschäftsbriefe, Fachzeitschriften, fördern nicht nur das Leseverständnis, sondern verstärkt auch den Praxisbezug. Für die Schulung der Sprechfertigkeit eignen sich besonders Partnerübungen, Rollenspiele und Diskussionen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Freude an der Mitteilungsleistung Vorrang vor der Sprachrichtigkeit genießt. Einsichten in die Grammatik der Fremdsprache und das Erlernen des Wortschatzes ergeben sich am wirkungsvollsten aus der Bearbeitung authentischer Texte und kommunikativer Situationen. Bereich 5.3 Seite 19
20 5.4 Angewandte Wirtschaftslehre (AWL) können selbstständig wirtschaftliche Entscheidungen treffen und verantwortungsbewusst handeln sowie Verständnis für die gesamtwirtschaftlichen Vorgänge zeigen, können mit Dokumenten und Urkunden korrekt umgehen und wissen über deren Handhabung Bescheid, können Verträge aus dem privaten und beruflichen Umfeld abschließen und sind sich der rechtlichen Konsequenzen bewusst, können erforderliche Schriftstücke computergestützt erstellen und diese formal richtig ausfertigen, können die für einzelne Teilbereiche beschriebenen Berechnungen durchführen und schätzen dabei die Ergebnisse vor der Rechenausführung, setzen technische Hilfsmittel sinnvoll ein und lösen die Rechenaufgaben formal richtig, können die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit von Investition kritisch analysieren, können sich einen Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Zahlungsund Sparformen sowie Finanzierungsmöglichkeiten erwerben, können die Risiken bei Fremdfinanzierungen erkennen und vergleichen durch Berechnungen die mit der Investition zusammenhängenden Kosten und Belastungen. können die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens erkennen und erfassen wesentliche Abläufe rechnerisch, kennen Grundlagen der Volkswirtschaft und setzen sich mit ausgewählten Kapiteln der Wirtschaftspolitik und den Herausforderungen der Globalisierung auseinander, kennen Mechanismen des Zustandekommens, des Abschlusses und der Beendigung eines Dienstverhältnisses, können das Entgelt für die Arbeitsleistung und die Lohnnebenkosten berechnen, der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. Bereich 5.4 Seite 20
21 1.Klasse: Dokumente und Urkunden: Arten. Beschaffung. Beglaubigung. Aufbewahrung. Verlust. Finanzierung: Lehrlingsentschädigung. Private Haushaltsplanung. Erfassung der Einnahmen und Ausgaben. Sparen und Geldanlage. Zahlungsverkehr: Geldinstitute. Kontoführung. Zahlungsformen (einfach). Formulare. Datensicherheit. Währungen. Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Finanzierung. Zahlungsverkehr. 2.Klasse: Verträge: Rechtliche Grundlagen. Arten aus dem privaten und beruflichen Umfeld. Regelmäßiger und unregelmäßiger Ablauf des Kaufvertrages. Konsumentenschutz. Einkauf. Preisvergleich. Umsatzsteuer. Ab- und Zuschläge. Wertsicherung. Produkthaftung. Finanzierung: Fremdfinanzierung. Überschuldung Zahlungsverkehr: Zahlungsformen (erweitert) Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Verträge. Finanzierung. Zahlungsverkehr. 3. Klasse: Betrieb und Unternehmen: Gründung. Rechtliche und betriebliche Organisation. Zusammenschlüsse. Auflösung. Grundbegriffe der Buchführung. Erfassung der betrieblichen Abläufe. Jahresabschluss. Preisbildung: Kostenrechnung. Kalkulation. Personalwesen: Stellenbewerbung. Europäischer Arbeitsmarkt. Dienstvertrag Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Betrieb und Unternehmen. Bereich 5.4 Seite 21
22 4. Klasse: Wirtschaft: Grundlagen der Volkswirtschaft und der Wirtschaftspolitik. EU-Binnenmarkt. Globalisierung. Personalwesen: Lohn- und Gehaltsverrechnung. Arbeitnehmerveranlagung. Didaktische Grundsätze: Bei der Vermittlung des Lehrstoffes sind das logische, kreative und vernetzte Denken und Handeln zu fördern. Die einzelnen Themenbereiche sind ganzheitlich zu vermitteln. Hauptkriterium für die Auswahl des Lehrstoffes ist der Beitrag zum Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Hinführung zum unternehmerischen Denken sowie die Bildung der Schülerinnen und Schüler als Konsumentin bzw. Konsument und Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer. Der Unterricht soll von den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler und von aktuellen Anlässen ausgehen, wobei entsprechend den Besonderheiten des Lehrberufes und den regionalen Gegebenheiten Schwerpunkte zu setzen sind. Bei der Auswahl der Lehrstoffe ist auf das fachübergreifende Prinzip Bedacht zu nehmen. Bei der Vermittlung der jeweiligen Lehrstoffinhalte sind die modernen Informationsund Kommunikationstechniken einzusetzen. Die für den privaten und beruflichen Alltag notwendigen Schriftstücke und Berechnungen sind computergestützt auszufertigen. Die Möglichkeiten von E-Government sind zu nutzen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Buchführung nur in dem Ausmaß zu vermitteln ist, wie es für das Verständnis des betriebswirtschaftlichen Grundwissens erforderlich ist. Den weltwirtschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen ist besonderes Augenmerk zu schenken und dabei die Rolle Österreichs und der Europäischen Union herauszuarbeiten. Schularbeiten: zwei bzw. eine in jeder Schulstufe, sofern das Stundenausmaß auf der betreffenden Schulstufe mindestens 40 bzw. 20 Unterrichtsstunden beträgt. Bereich 5.4 Seite 22
23 5.5. Fachunterricht: Elektrotechnik (ELT) Kompetenzbereich Sicherheit und Ergonomie wissen über die berufseinschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie über Umweltund Qualitätsstandards in Bezug auf die einzelnen Kompetenzbereiche Bescheid und können diese auch anwenden. kennen die optimale Gestaltung von Arbeitssystemen in Bezug auf die Abstimmung zwischen Mensch, Maschine und Arbeitswelt und können die Arbeiten in ergonomisch richtiger Haltung ausführen. Berufseinschlägige Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften. Umwelt- und Qualitätsstandards. Ergonomie. In Verbund mit dem Lehrstoffinhalt aus dem Kompetenzbereich Elektrotechnik. Kompetenzbereich Elektrotechnik kennen eingehend die Grundgesetze der Elektrotechnik als Voraussetzung für das Verständnis von Zusammenhängen und für die weitere fachliche Ausbildung. der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot bzw. jene, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 1. Klasse: Begriffe: Größen und Einheiten. Stromarten. Stromkreis: Stromleitung. Widerstände. Ohmsches Gesetz, Kirchhoffsche Regeln. Widerstandsschaltungen. Elektrische Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad. Elektrowärme. Wirkungen des elektrischen Stromes: Wärmewirkung. Magnetische Wirkung. Chemische Wirkung. Lichtwirkung. Physiologische Wirkung. Elektromagnetische Verträglichkeit. Elektrisches Feld: Grundbegriffe. Größen und Gesetze. Ursachen und Wirkungen. Kapazität. Magnetisches Feld und Elektromagnetismus: Bereich 5.5 Seite 23
24 Grundbegriffe. Größen und Gesetze. Elektromagnetische Induktion. Induktivität. Energie und Kraftwirkung. Transformator- und Generatorprinzip. 2. Klasse: Wechselstromtechnik: Wechselstromgrößen. Wechselstromwiderstände. Widerstandsschaltungen. Leistung. Kompensation. Schwingkreise. Dreiphasenwechselstromtechnik: Entstehung. Verkettung. Schaltungen. Belastung. Drehstromleistungen. Kompensation. Bereich 5.5 Seite 24
25 Angewandte Mathematik (AM) Kompetenzbereich grundlegende mathematische Berechnungen können einfache mathematische Aufgaben aus dem Bereich ihres Lehrberufes logisch und ökonomisch planen und lösen. bedienen sich der mathematischen Symbolik sowie benutzen Rechner, Tabellen und Formelsammlungen zweckentsprechend. der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot bzw. jene, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 1. Klasse: Mathematische Grundlagen: Rechengesetze. Gleichungen. Rechnen mit Formeln. Rechtwinkeliges Dreieck. Rechnungen aus dem Gebiet der Gleichstromtechnik, Rechenbeispiele aus dem Fachgegenstand Elektrotechnik Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Rechnungen aus dem Gebiet der Gleichstromtechnik. 2. Klasse: Mathematische Grundlagen: Winkelfunktionen. Vektorielle Darstellung. Rechnungen aus dem Gebiet der Wechsel- und Dreiphasenwechselstromtechnik, Rechenbeispiele aus dem Fachgegenstand Elektrotechnik Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Rechnungen aus dem Gebiet der Gleich-, Wechsel- und Dreiphasenwechselstromtechnik. 3. Klasse: Rechnungen aus dem Gebiet der Gleich, Wechsel und Dreiphasenwechselstromtechnik, Dimensionierungen und Berechnungen zu Wechsel- und Drehstromleitungen, Kompensation in Wechsel- und Drehstromsystemen, Berechnungen zu elektrischen Maschinen und Antrieben, Rechenbeispiele zum Fachgegenstand Spezielle Technologie Bereich 5.5 Seite 25
26 Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Rechnungen aus dem Gebiet der Wechsel- und Dreiphasenwechselstromtechnik. 4. Klasse: Rechnungen aus dem Gebiet der Gleich, Wechsel und Dreiphasenwechselstromtechnik, Rechenbeispiele aus dem Fachgegenstand Spezielle Technologie Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Rechnungen aus dem Gebiet der Gleich-, Wechsel- und Dreiphasenwechselstromtechnik. Ergänzende Fertigkeiten: Gebrauch der in der Praxis üblichen Rechner, Tabellen und Formelsammlungen. Kompetenzbereich berufsspezifische Berechnungen können einfache mathematische Aufgaben aus dem Bereich ihres Lehrberufes logisch und ökonomisch planen und lösen. bedienen sich der mathematischen Symbolik sowie benutzen Rechner, Tabellen und Formelsammlungen zweckentsprechend. der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot bzw. jene, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 2. Klasse: Berechnungen zur Elektrotechnik: Schutzmaßnahmen. Dreiphasenwechselstromtechnik, Berechnungen zur gleichmäßigen Belastung. Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Berechnungen zur Elektrotechnik. 3. Klasse: Berechnungen zur Elektrotechnik: Leitungen und Anlagen. Kompensation. Dreiphasenwechselstromtechnik, Berechnungen zu gleichmäßigen belasteten Systemen inkl. Störungen. Bereich 5.5 Seite 26
27 Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Berechnungen zur Elektrotechnik. 4. Klasse: Berechnungen zur Elektrotechnik: Überstromschutz. Licht- und Wärmetechnik. Lehrstoff der Vertiefung: Komplexe Aufgaben: Berechnungen zur Elektrotechnik. Ergänzende Fertigkeiten: Gebrauch der in der Praxis üblichen Rechner, Tabellen und Formelsammlungen. Schularbeiten in Angewandte Mathematik : zwei bzw. eine in jeder Schulstufe, sofern das Stundenausmaß auf der betreffenden Schulstufe mindestens 40 bzw. 20 Unterrichtsstunden beträgt. Bereich 5.5 Seite 27
28 Technologie (TE) Kompetenzbereich Sicherheit und Ergonomie (SE) wissen über die berufseinschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie über Umweltund Qualitätsstandards in Bezug auf die einzelnen Kompetenzbereiche Bescheid und können diese auch anwenden. kennen die optimale Gestaltung von Arbeitssystemen in Bezug auf die Abstimmung zwischen Mensch, Maschine und Arbeitswelt und können die Arbeiten in ergonomisch richtiger Haltung ausführen. 1. Klasse: Berufseinschlägige Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften. Umwelt- und Qualitätsstandards. Ergonomie. In Verbund mit Lehrstoffinhalten in den einzelnen Kompetenzbereichen. 2. Klasse: Berufseinschlägige Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften. Umwelt- und Qualitätsstandards. Ergonomie. In Verbund mit Lehrstoffinhalten in den einzelnen Kompetenzbereichen. Kompetenzbereich Werk- und Hilfsstoffe (WH) können Werk- und Hilfsstoffe fachgerecht auswählen und verwenden. wissen über deren vorschriftsmäßige Entsorgung Bescheid. 1. Klasse: Werk- und Hilfsstoffe: Arten. Eigenschaften. Verwendung. Normung. Entsorgung. Bereich 5.5 Seite 28
29 Kompetenzbereich Grundlegendes über Maschinen und Geräte (EMG) kennen den Aufbau, den Einsatz und die Wirkungsweise der Maschinen und Geräte. können diese handhaben und anwenden. 2. Klasse: Maschinen und Geräte: Arten. Aufbau. Einsatz. Wirkungsweise. Kompetenzbereich Grundlagen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik (SRG) können Steuerungen und Regelungen aufbauen sowie Fehler suchen und beheben. 2. Klasse: Mess-, Steuer- und Regeltechnik: Bauteile und Baugruppen. Arten und Aufbau von Steuerungen und Regelungen. Leistungselektronik. Überprüfung und Fehlersuche. Kompetenzbereich Installationstechnik (IT) kennen die zeitgemäßen Arbeiten und Arbeitsverfahren aus dem Bereich der Installationstechnik. können sie in Projekten umsetzen oder anwenden. 1. Klasse: Handelsübliches Elektromaterial: Arten. Verwendung. Entsorgung. Unfallschutz: Unfallursachen. Elektrounfall. Vorschriften. Bereich 5.5 Seite 29
30 Leitungsschutz: Einrichtungen. Zuordnung. Leitungen und Kabeln: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung. Installation in Gebäuden und im Freien: Anforderung. Installationen in Räumen besonderer Art. Anlagen im Freien. 2. Klasse: Schutzmaßnahmen: Schutzarten elektrischer Betriebsmittel. Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung und deren Überprüfung. Erdungsanlagen. Überspannungsschutz. Installationen in Gebäuden und im Freien: Hausanschluss und Verteilung. Überprüfung elektrischer Anlagen und Dokumentation. Kompetenzbereich Grundlagen der Energietechnik (ETG) kennen die zeitgemäßen Arbeiten und Arbeitsverfahren aus dem Bereich der Energietechnik. können sie in Projekten umsetzen oder anwenden. 1. Klasse: Energie: Gewinnung. Übertragung. Versorgung. Verteilung. Wärmetechnik: Physikalische Grundlagen. Größen und Einheiten. 2. Klasse: Beleuchtungstechnik: Physikalische Grundlagen. Größen und Einheiten. Lichterzeugung. Wärmetechnik: Wärmequellen. Bereich 5.5 Seite 30
C 1 FACHUNTERRICHT E L E K T R O T E C H N I K U N D AN G E W AN D T E M AT H E M AT I K
 C 1 FACHUNTERRICHT E L E K T R O T E C H N I K U N D AN G E W AN D T E M AT H E M AT I K ELEKTROTECHNIK Kompetenzbereich Sicherheit und Ergonomie - wissen über die berufseinschlägigen Sicherheitsvorschriften
C 1 FACHUNTERRICHT E L E K T R O T E C H N I K U N D AN G E W AN D T E M AT H E M AT I K ELEKTROTECHNIK Kompetenzbereich Sicherheit und Ergonomie - wissen über die berufseinschlägigen Sicherheitsvorschriften
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE SPENGLER, KUPFERSCHMIED I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE SPENGLER, KUPFERSCHMIED I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE SPENGLER, KUPFERSCHMIED I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER, MASCHINSTICKER I. STUNDENTAFEL A. GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER, MASCHINSTICKER I. STUNDENTAFEL A. GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER Anlage A/2/3 Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 200 Unterrichtsstunden
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER, MASCHINSTICKER I. STUNDENTAFEL A. GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER Anlage A/2/3 Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 200 Unterrichtsstunden
F A C H U N T E R R I C H T
 C 1 F A C H U N T E R R I C H T Allgemeine didaktische Bemerkungen: In den einzelnen Unterrichtsgegenständen sind bei der Vermittlung des Lehrstoffes die Besonderheiten der einzelnen Lehrberufe zu berücksichtigen
C 1 F A C H U N T E R R I C H T Allgemeine didaktische Bemerkungen: In den einzelnen Unterrichtsgegenständen sind bei der Vermittlung des Lehrstoffes die Besonderheiten der einzelnen Lehrberufe zu berücksichtigen
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SONNENSCHUTZTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/17/11 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SONNENSCHUTZTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der 1., 2.
Anlage A/17/11 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SONNENSCHUTZTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der 1., 2.
Unterrichtsausmaß. Stundenausmaß. Gesamtstundenzahl aller Schulstufen im Pflichtgegenstände Jahres- Lehrgangsunterricht. Politische Bildung - 80
 Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich gemäß Rahmenlehrplan BGBl. 2003, 3. Oktober 2003, 461. VO in der geltenden Fassung Lehrberuf: Dachdecker Unterrichtsausmaß
Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich gemäß Rahmenlehrplan BGBl. 2003, 3. Oktober 2003, 461. VO in der geltenden Fassung Lehrberuf: Dachdecker Unterrichtsausmaß
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TECHNISCHER ZEICHNER/TECHNISCHE ZEICHNERIN I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TECHNISCHER ZEICHNER/TECHNISCHE ZEICHNERIN Anlage A/18/2 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 500 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TECHNISCHER ZEICHNER/TECHNISCHE ZEICHNERIN Anlage A/18/2 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 500 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BILDHAUEREI I. STUNDENTAFEL
 BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 1 von 5 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BILDHAUEREI Anlage A/10/8 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden
BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 1 von 5 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BILDHAUEREI Anlage A/10/8 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE AUGENOPTIK, FEINOPTIK I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE AUGENOPTIK, FEINOPTIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE AUGENOPTIK, FEINOPTIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF DRECHSLER/DRECHSLERIN I. STUNDENTAFEL
 BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 1 von 5 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF DRECHSLER/DRECHSLERIN Anlage A/10/4 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden
BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 1 von 5 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF DRECHSLER/DRECHSLERIN Anlage A/10/4 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden
- 1 - RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE MAURER, SCHALUNGSBAUER I. STUNDENTAFEL
 - 1 - RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE MAURER, SCHALUNGSBAUER Anlage A/1/1 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
- 1 - RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE MAURER, SCHALUNGSBAUER Anlage A/1/1 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
A/4/2-AM KOMMUNIKATIONSTECHNIKER- ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION. gültig aufsteigend ab 09/04 VO 09/03
 A/4/2-AM KOMMUNIKATIONSTECHNIKER- ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION 2004 gültig aufsteigend ab 09/04 VO 09/03 Anlage A/4/2-AM Seite 2 B. Kommunikationstechniker Elektronische Datenverarbeitung
A/4/2-AM KOMMUNIKATIONSTECHNIKER- ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION 2004 gültig aufsteigend ab 09/04 VO 09/03 Anlage A/4/2-AM Seite 2 B. Kommunikationstechniker Elektronische Datenverarbeitung
Lehrplan für Berufsschulen. für den Lehrberuf
 Landesschulrat für Steiermark Lehrplan für Berufsschulen für den Lehrberuf Elektroenergietechniker Gemäß Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 1.Dezember.2008 Nr.339
Landesschulrat für Steiermark Lehrplan für Berufsschulen für den Lehrberuf Elektroenergietechniker Gemäß Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 1.Dezember.2008 Nr.339
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TECHNISCHER ZEICHNER I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TECHNISCHER ZEICHNER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 500 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TECHNISCHER ZEICHNER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 500 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BLECHBLASINSTRUMENTENERZEUGUNG I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/20/3 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BLECHBLASINSTRUMENTENERZEUGUNG I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 200 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in
Anlage A/20/3 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BLECHBLASINSTRUMENTENERZEUGUNG I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 200 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SEILBAHNFACHMANN/SEILBAHNFACHFRAU I. STUNDENTAFEL
 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SEILBAHNFACHMANN/SEILBAHNFACHFRAU I. STUNDENTAFEL GZ BMUKK-17.021/0041-II/1a/2007 Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SEILBAHNFACHMANN/SEILBAHNFACHFRAU I. STUNDENTAFEL GZ BMUKK-17.021/0041-II/1a/2007 Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
B 13/II. 3 1/2- und 4jährige Lehrberufe (mit 10-10 -10-5 Unterrichtswochen) D. B E T R I E B S W I R T S C H A F T L I C H E R U N T E R R I C H T
 B 13/II 3 1/2- und 4jährige Lehrberufe (mit 10-10 -10-5 Unterrichtswochen) D. B E T R I E B S W I R T S C H A F T L I C H E R U N T E R R I C H T a ) W i r t s c h a f t s k u n d e m i t S c h r i f t
B 13/II 3 1/2- und 4jährige Lehrberufe (mit 10-10 -10-5 Unterrichtswochen) D. B E T R I E B S W I R T S C H A F T L I C H E R U N T E R R I C H T a ) W i r t s c h a f t s k u n d e m i t S c h r i f t
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF METALLBEARBEITUNG I. STUNDENTAFEL
 1 von 7 Anlage A/17/7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF METALLBEARBEITUNG I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
1 von 7 Anlage A/17/7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF METALLBEARBEITUNG I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-TECHNIKER I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-TECHNIKER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-TECHNIKER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF KUNSTSTOFFTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF KUNSTSTOFFTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1 620 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten,
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF KUNSTSTOFFTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1 620 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten,
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF PRODUKTIONSTECHNIKER I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/15/15 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF PRODUKTIONSTECHNIKER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
Anlage A/15/15 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF PRODUKTIONSTECHNIKER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF STEMPELERZEUGER UND FLEXOGRAPH I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF STEMPELERZEUGER UND FLEXOGRAPH I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenanzahl: 2 Schulstufen zu insgesamt 800 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten und
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF STEMPELERZEUGER UND FLEXOGRAPH I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenanzahl: 2 Schulstufen zu insgesamt 800 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten und
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SKIERZEUGER
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SKIERZEUGER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten Klasse
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF SKIERZEUGER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten Klasse
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TRANSPORTBETONTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/1/18 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TRANSPORTBETONTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
Anlage A/1/18 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TRANSPORTBETONTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG
 LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN Lehrberuf: ELETROTECHNIK - Elektro- und Gebäudetechnik (H1) - Anlagen- und Betriebstechnik (H 3) SCHULVERSUCH bmukk-17.021/0042-ii/1a/2010
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN Lehrberuf: ELETROTECHNIK - Elektro- und Gebäudetechnik (H1) - Anlagen- und Betriebstechnik (H 3) SCHULVERSUCH bmukk-17.021/0042-ii/1a/2010
INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG
 BILDUNGSSTANDARDS FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG 309 INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG 310 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG I. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
BILDUNGSSTANDARDS FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG 309 INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG 310 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG I. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF KÄLTEANLAGENTECHNIKER I. STUNDENTAFEL. Religion 1)... 2)
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF KÄLTEANLAGENTECHNIKER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF KÄLTEANLAGENTECHNIKER I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF VERANSTALTUNGSTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 1 von 7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF VERANSTALTUNGSTECHNIK Anlage A/4/11 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden
BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 1 von 7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF VERANSTALTUNGSTECHNIK Anlage A/4/11 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden
Schulversuchs-Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich
 Schulversuchs-Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich Lehrberuf: (3,5 Jahre) Unterrichtsausmaß Lehrgangsunterricht 3 Lehrgänge zu je 10 Wochen mit je 41 Wochenstunden
Schulversuchs-Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich Lehrberuf: (3,5 Jahre) Unterrichtsausmaß Lehrgangsunterricht 3 Lehrgänge zu je 10 Wochen mit je 41 Wochenstunden
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 1 von 15 Anlage A/4/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK (Hauptmodule: Elektro- und Gebäudetechnik oder Energietechnik oder Anlagen- und Betriebstechnik oder Automatisierungs- und Prozessleittechnik
1 von 15 Anlage A/4/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK (Hauptmodule: Elektro- und Gebäudetechnik oder Energietechnik oder Anlagen- und Betriebstechnik oder Automatisierungs- und Prozessleittechnik
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-SYSTEMTECHNIK *) I. STUNDENTAFEL
 GZ BMBWK-17.021/0027-II/1/2003 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-SYSTEMTECHNIK *) I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
GZ BMBWK-17.021/0027-II/1/2003 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-SYSTEMTECHNIK *) I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TEXTILTECHNOLOGIE I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/2/7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TEXTILTECHNOLOGIE I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
Anlage A/2/7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF TEXTILTECHNOLOGIE I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
Englisch. Berufskolleg Gesundheit und Pflege I. Schuljahr 1. Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Abteilung III
 Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
2001 Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich
 2001 Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich Anlage A / 4 / 3 Lehrberuf: E l e k t r o m a s c h i n e n t e c h n i k (EMT) Unterrichtsausmaß Jahresunterricht:
2001 Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich Anlage A / 4 / 3 Lehrberuf: E l e k t r o m a s c h i n e n t e c h n i k (EMT) Unterrichtsausmaß Jahresunterricht:
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 Stand: Sep. 007/LSR Anlage A/9/ LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Rahmenlehrplan für die Lehrberufe BÜROKAUFMANN/BÜROKAUFFRAU, INDUSTRIEKAUFMANN/INDUSTRIEKAUFFRAU VERWALTUNGSASSITENT/VERWALTUNGSASSISTENTIN;
Stand: Sep. 007/LSR Anlage A/9/ LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Rahmenlehrplan für die Lehrberufe BÜROKAUFMANN/BÜROKAUFFRAU, INDUSTRIEKAUFMANN/INDUSTRIEKAUFFRAU VERWALTUNGSASSITENT/VERWALTUNGSASSISTENTIN;
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG
 LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN Lehrberuf: ELEKTRONIK SCHULVERSUCH bmukk-17.021/0017-ii1a/2011... HR Karl Hermann Benzer, e.h. (Landesschulinspektor) I N H A L T S V E R
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN Lehrberuf: ELEKTRONIK SCHULVERSUCH bmukk-17.021/0017-ii1a/2011... HR Karl Hermann Benzer, e.h. (Landesschulinspektor) I N H A L T S V E R
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde. Schuljahr 1
 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Schuljahr 1 2 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Vorbemerkungen Ziel des Unterrichts in Gemeinschafts-
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Schuljahr 1 2 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Vorbemerkungen Ziel des Unterrichts in Gemeinschafts-
Lehrplan für Berufsschulen
 Landesschulrat für Steiermark Lehrplan für Berufsschulen für die Lehrberufe Metallbearbeitungstechnik, Schlosser Betriebsschlosser, Blechtechnik, Maschinenbautechnik Gemäß Verordnung des Bundesministerium
Landesschulrat für Steiermark Lehrplan für Berufsschulen für die Lehrberufe Metallbearbeitungstechnik, Schlosser Betriebsschlosser, Blechtechnik, Maschinenbautechnik Gemäß Verordnung des Bundesministerium
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MASCHINENMECHANIK I. STUNDENTAFEL
 BGBl. II - Ausgegeben am 28. Juli 2004 - Nr. 313 1 von 6 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MASCHINENMECHANIK Anlage A/15/13 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1 620 Unterrichtsstunden
BGBl. II - Ausgegeben am 28. Juli 2004 - Nr. 313 1 von 6 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MASCHINENMECHANIK Anlage A/15/13 I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1 620 Unterrichtsstunden
Allgemeine Lehrplanbezüge Hauptschule ERSTER TEIL ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL
 Allgemeine Lehrplanbezüge Hauptschule In diesem Dokument sind die Bezüge zum Thema Berufsorientierung grau hervorgehoben. ERSTER TEIL ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 1. Funktion und Gliederung des Lehrplans Der
Allgemeine Lehrplanbezüge Hauptschule In diesem Dokument sind die Bezüge zum Thema Berufsorientierung grau hervorgehoben. ERSTER TEIL ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 1. Funktion und Gliederung des Lehrplans Der
schule Bregenz 1 UNTERRICHTSPROJEKT
 schule Bregenz 1 UNTERRICHTSPROJEKT PRO JEKTZIEL KONSTRUKTION EWES GANGHEBELS CNC - FERTIGUNG EINES GANGHEBELS ZUSAMMENBAU - INBETRIEBNAHME DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen
schule Bregenz 1 UNTERRICHTSPROJEKT PRO JEKTZIEL KONSTRUKTION EWES GANGHEBELS CNC - FERTIGUNG EINES GANGHEBELS ZUSAMMENBAU - INBETRIEBNAHME DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen
Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik für Hörbehinderte BGBl. Nr. 664/1995, II/374/ Lehrplan\FMBH doc
 Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik für Hörbehinderte BGBl. Nr. 664/1995, II/374/1999 1 Anlage 1B.5.7 FACHSCHULE FÜR MODE UND BEKLEIDUNGSTECHNIK FÜR HÖRBEHINDERTE I. Stundentafel (Gesamtstundenzahl
Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik für Hörbehinderte BGBl. Nr. 664/1995, II/374/1999 1 Anlage 1B.5.7 FACHSCHULE FÜR MODE UND BEKLEIDUNGSTECHNIK FÜR HÖRBEHINDERTE I. Stundentafel (Gesamtstundenzahl
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 LSR-Zahl 3057/0028-AP/2015 BMBF-17.021/0017-II/1/2015 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Schulversuchslehrplan für den Lehrberuf HOTELKAUFFRAU HOTELKAUFMANN in Kraft gesetzt ab 1. September 2015 1 STUNDENTAFEL
LSR-Zahl 3057/0028-AP/2015 BMBF-17.021/0017-II/1/2015 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Schulversuchslehrplan für den Lehrberuf HOTELKAUFFRAU HOTELKAUFMANN in Kraft gesetzt ab 1. September 2015 1 STUNDENTAFEL
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF GLASBAUTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 1 von 13 Anlage A/7/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF GLASBAUTECHNIK (Hauptmodule: Glasbau oder Glaskonstruktionen Spezialmodul: Planung und Konstruktion) I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen
1 von 13 Anlage A/7/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF GLASBAUTECHNIK (Hauptmodule: Glasbau oder Glaskonstruktionen Spezialmodul: Planung und Konstruktion) I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen
LEHRPLAN DES KOLLEGS AN HANDELSAKADEMIEN FÜR BERUFSTÄTIGE
 Kurztitel Lehrpläne - Handelsakademie und Handelsschule Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 895/1994 /Artikel/Anlage Anl. 1/4 Inkrafttretensdatum 01.09.1995 Außerkrafttretensdatum 03.10.2000 Beachte weise gestaffeltes
Kurztitel Lehrpläne - Handelsakademie und Handelsschule Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 895/1994 /Artikel/Anlage Anl. 1/4 Inkrafttretensdatum 01.09.1995 Außerkrafttretensdatum 03.10.2000 Beachte weise gestaffeltes
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 GZ BMUKK-17.021/0042-II/1a/2010 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
GZ BMUKK-17.021/0042-II/1a/2010 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
Landesschulrat für Tirol
 Landesschulrat für Tirol Abteilung CVI - Berufsbildende Pflichtschulen Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen für den Lehrberuf Fußpfleger Anlage A/23/2 Tiroler Fachberufsschule für Schönheitsberufe
Landesschulrat für Tirol Abteilung CVI - Berufsbildende Pflichtschulen Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen für den Lehrberuf Fußpfleger Anlage A/23/2 Tiroler Fachberufsschule für Schönheitsberufe
Schulversuchs-Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich
 Schulversuchs-Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich Lehrberuf: Elektrotechnik (3,5 Jahre) Unterrichtsausmaß Jahresunterricht 1. Kl.: 20 Schultage zu je 8
Schulversuchs-Lehrplan für die Berufsschulen im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich Lehrberuf: Elektrotechnik (3,5 Jahre) Unterrichtsausmaß Jahresunterricht 1. Kl.: 20 Schultage zu je 8
Standards für die Berufsoberschule in den Fächern Deutsch, fortgeführte Pflichtfremdsprache, Mathematik
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland BESCHLUSSSAMMLUNG DER KMK, BESCHLUSS-NR. 471 R:\B1\KMK-BESCHLUSS\RVBOS-DPM98-06-26.DOC Standards für
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland BESCHLUSSSAMMLUNG DER KMK, BESCHLUSS-NR. 471 R:\B1\KMK-BESCHLUSS\RVBOS-DPM98-06-26.DOC Standards für
Landesschulrat für Tirol
 Landesschulrat für Tirol Abteilung CVI - Berufsbildende Pflichtschulen Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen für den Lehrberuf Hohlglasveredler-Glasmalerei Anlage A/7/5 Tiroler Fachberufsschule
Landesschulrat für Tirol Abteilung CVI - Berufsbildende Pflichtschulen Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen für den Lehrberuf Hohlglasveredler-Glasmalerei Anlage A/7/5 Tiroler Fachberufsschule
C Kälteanlagentechniker
 - 1 - Kälteanlagentechniker Anlage A/15/12 Kälteanlagentechniker C - 2 - I. Stundentafel Seite 2 Gesamtstundenzahl: 4 Klassen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (Pflichtgegenstände) Lehrgangsmäßige
- 1 - Kälteanlagentechniker Anlage A/15/12 Kälteanlagentechniker C - 2 - I. Stundentafel Seite 2 Gesamtstundenzahl: 4 Klassen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (Pflichtgegenstände) Lehrgangsmäßige
Landesschulrat für Tirol
 Landesschulrat für Tirol Abteilung CVI - Berufsbildende Pflichtschulen Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen für den Lehrberuf Kraftfahrzeugtechniker u. -elektriker Anlage A/15/3/3 Tiroler Fachberufsschule
Landesschulrat für Tirol Abteilung CVI - Berufsbildende Pflichtschulen Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen für den Lehrberuf Kraftfahrzeugtechniker u. -elektriker Anlage A/15/3/3 Tiroler Fachberufsschule
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG
 LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN Lehrberuf: METALLTECHNIK - Maschinenbautechnik (H1) + Automatisierungstechnik (S1) - Werkzeugbautechnik (H6) + Prozess- und Fertigungstechnik
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN Lehrberuf: METALLTECHNIK - Maschinenbautechnik (H1) + Automatisierungstechnik (S1) - Werkzeugbautechnik (H6) + Prozess- und Fertigungstechnik
Volksschulen Änderungen Im Lehrplan 1
 Volksschulen Änderungen Im Lehrplan 1 Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ab September 2003 ergeben sich durch die Verordnung des BM:BWK wichtige Änderungen im Lehrplan der Volksschule, daher erlaube
Volksschulen Änderungen Im Lehrplan 1 Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ab September 2003 ergeben sich durch die Verordnung des BM:BWK wichtige Änderungen im Lehrplan der Volksschule, daher erlaube
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FINANZ- UND RECHNUNGSWESENASSISTENZ
 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FINANZ- UND RECHNUNGSWESENASSISTENZ I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FINANZ- UND RECHNUNGSWESENASSISTENZ I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in
 Legende: Hinweis: (Klammer) durch die RRL der zweijährigen BFS bzw. der HH abgedeckt nicht in dem im Ausbildungsrahmenplan (Ausbildungsordnung) und Rahmenlehrplan vorgesehenen Anspruchsniveau (Verben der
Legende: Hinweis: (Klammer) durch die RRL der zweijährigen BFS bzw. der HH abgedeckt nicht in dem im Ausbildungsrahmenplan (Ausbildungsordnung) und Rahmenlehrplan vorgesehenen Anspruchsniveau (Verben der
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-SYSTEMTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 1 von 7 Anlage A/4/7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-SYSTEMTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
1 von 7 Anlage A/4/7 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF EDV-SYSTEMTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der
Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE STOFFDRUCKER, TEXTILCHEMIE I. STUNDENTAFEL A. STOFFDRUCKER
 BGBl. II Nr. 334/2001 Anlage A/19/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE STOFFDRUCKER, TEXTILCHEMIE I. STUNDENTAFEL A. STOFFDRUCKER Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne
BGBl. II Nr. 334/2001 Anlage A/19/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE STOFFDRUCKER, TEXTILCHEMIE I. STUNDENTAFEL A. STOFFDRUCKER Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 Anlage A/4/9 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für die Lehrberufe A) INFORMATIONSTECHNOLOGIE-INFORMATIK (ITI) B) INFORMATIONSTECHNOLOGIE-TECHNIK (ITT) in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September
Anlage A/4/9 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für die Lehrberufe A) INFORMATIONSTECHNOLOGIE-INFORMATIK (ITI) B) INFORMATIONSTECHNOLOGIE-TECHNIK (ITT) in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September
T.FBS für TOURISMUS und HANDEL LANDECK T.FBS für TOURISMUS ABSAM
 Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen LSR für Tirol Abteilung C VI Berufsbildende Pflichtschulen T.FBS für TOURISMUS und HANDEL LANDECK T.FBS für TOURISMUS ABSAM Lehrberufe: KOCH A/6/4 KÖCHIN A/6/4
Landeslehrplan der Tiroler Fachberufsschulen LSR für Tirol Abteilung C VI Berufsbildende Pflichtschulen T.FBS für TOURISMUS und HANDEL LANDECK T.FBS für TOURISMUS ABSAM Lehrberufe: KOCH A/6/4 KÖCHIN A/6/4
Berufsfachliche Kompetenz Bereich Industrie/Elektro 1. Schuljahr 1
 Berufsfachliche Kompetenz Bereich Industrie/Elektro 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Teilqualifikation Berufsfachliche Kompetenz Schuljahr 1 Bereich Industrie/Elektro 2 Berufsfachliche Kompetenz
Berufsfachliche Kompetenz Bereich Industrie/Elektro 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Teilqualifikation Berufsfachliche Kompetenz Schuljahr 1 Bereich Industrie/Elektro 2 Berufsfachliche Kompetenz
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BERUFSFOTOGRAF/BERUFSFOTOGRAFIN I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/21/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BERUFSFOTOGRAF/BERUFSFOTOGRAFIN I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon
Anlage A/21/1 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BERUFSFOTOGRAF/BERUFSFOTOGRAFIN I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon
Institut für Berufspädagogik Studiengang BSP/TGP
 Institut für Berufspädagogik Studiengang BSP/TGP Thema: Eingereicht von: Kompetenzraster für Flächenberechnungen Ergün Damar Matrikelnummer: 1283034 Datum: 20.04.2015 Modulnummer: 724 BT 01 Modulbezeichnung:
Institut für Berufspädagogik Studiengang BSP/TGP Thema: Eingereicht von: Kompetenzraster für Flächenberechnungen Ergün Damar Matrikelnummer: 1283034 Datum: 20.04.2015 Modulnummer: 724 BT 01 Modulbezeichnung:
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WERKZEUGMECHANIK I. STUNDENTAFEL
 BGBl. II Nr. 313/2004 Anlage A/15/14 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WERKZEUGMECHANIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1 620 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
BGBl. II Nr. 313/2004 Anlage A/15/14 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WERKZEUGMECHANIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 4 Schulstufen zu insgesamt 1 620 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
LANDESLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE BLUMENBINDER UND -HÄNDLER (FLORIST) I. S T U N D E N T A F E L
 LANDESLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE BLUMENBINDER UND -HÄNDLER (FLORIST) Anlage A/5/2 I. S T U N D E N T A F E L Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1200 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
LANDESLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE BLUMENBINDER UND -HÄNDLER (FLORIST) Anlage A/5/2 I. S T U N D E N T A F E L Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1200 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht),
WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVE LEHRE
 WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVE LEHRE Lehrausbildung hat Zukunft! Die Berufswahl ist eine der wichtigsten und dauerhaftesten Entscheidungen im Leben! Was erwartet dich bei der mbs? Top-Ausbildung in einem breitgefächerten,
WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVE LEHRE Lehrausbildung hat Zukunft! Die Berufswahl ist eine der wichtigsten und dauerhaftesten Entscheidungen im Leben! Was erwartet dich bei der mbs? Top-Ausbildung in einem breitgefächerten,
(Termine, Daten, Inhalte)
 IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WÄRMEBEHANDLUNGSTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WÄRMEBEHANDLUNGSTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
SCHULVERSUCHSLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF WÄRMEBEHANDLUNGSTECHNIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 440 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
Ernährung und Haushalt in der NMS
 Ernährung und Haushalt in der NMS Aktuelle Entwicklungen Ernährung und Haushalt ist in der NMS ein Pflichtfach 1-4 Stunden sind in der NMS Stundentafel ausgewiesen 1 Stunde EH muss in der NMS angeboten
Ernährung und Haushalt in der NMS Aktuelle Entwicklungen Ernährung und Haushalt ist in der NMS ein Pflichtfach 1-4 Stunden sind in der NMS Stundentafel ausgewiesen 1 Stunde EH muss in der NMS angeboten
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 A/12/3 Karosseriebautechnik LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf Karosseriebautechnik in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2006 2. Klasse ab 1. September 2007 3. Klasse
A/12/3 Karosseriebautechnik LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf Karosseriebautechnik in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2006 2. Klasse ab 1. September 2007 3. Klasse
EXTERNISTENPRÜFUNGEN ITALIENISCH
 EXTERNISTENPRÜFUNGEN ITALIENISCH Inhaltsübersicht I. Zulassungsprüfungen 1) Italienisch als Erste lebende Fremdsprache (8 jährig) 2) Italienisch als Zweite lebende Fremdsprache (6 jährig) 3) Italienisch
EXTERNISTENPRÜFUNGEN ITALIENISCH Inhaltsübersicht I. Zulassungsprüfungen 1) Italienisch als Erste lebende Fremdsprache (8 jährig) 2) Italienisch als Zweite lebende Fremdsprache (6 jährig) 3) Italienisch
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG
 LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN DOPPEL-Lehrberuf: KOSMETIKER/FUSSPFLEGER Anlage: A/23/2 Rahmenlehrplan: Verordnung BGBl.Nr. 352/1998 und Verordnung BGBl.Nr. 389/1999 und
LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG LANDESLEHRPLAN FÜR BERUFSSCHULEN DOPPEL-Lehrberuf: KOSMETIKER/FUSSPFLEGER Anlage: A/23/2 Rahmenlehrplan: Verordnung BGBl.Nr. 352/1998 und Verordnung BGBl.Nr. 389/1999 und
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FOTOGRAF I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FOTOGRAF I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 380 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FOTOGRAF I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 1/2 Schulstufen zu insgesamt 1 380 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten
GEGENSTÄNDE 1. *) 2. *) 3. *) stundenzahl
 LANDESLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FRIEDHOFS- UND ZIERGÄRTNER I. S T U N D E N T A F E L Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen mit 1200 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
LANDESLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF FRIEDHOFS- UND ZIERGÄRTNER I. S T U N D E N T A F E L Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen mit 1200 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten
Lehrplan für den schulautonomen Pflichtgegenstand Planen - Organisieren - Präsentieren (5. Klasse)
 Sigmund Freud-Gymnasium Gymnasium und Realgymnasium des Bundes Wohlmutstraße 3, 1020 Wien (01) 728 01 92 (Fax) (01) 728 01 92 22 www.freudgymnasium.at grg2wohl@902026.ssr-wien.gv.at Lehrplan für den schulautonomen
Sigmund Freud-Gymnasium Gymnasium und Realgymnasium des Bundes Wohlmutstraße 3, 1020 Wien (01) 728 01 92 (Fax) (01) 728 01 92 22 www.freudgymnasium.at grg2wohl@902026.ssr-wien.gv.at Lehrplan für den schulautonomen
Qualität und Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung
 Qualität und Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung Warum ist Qualität so wichtig? Bewerbersituation - demographische Entwicklung Attraktivität der Berufsausbildung sichern Sicherung der Fachkräfte
Qualität und Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung Warum ist Qualität so wichtig? Bewerbersituation - demographische Entwicklung Attraktivität der Berufsausbildung sichern Sicherung der Fachkräfte
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK I. STUNDENTAFEL
 BGBl. II - Ausgegeben am 4. August 2016 - Nr. 211 1 von 31 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK (Hauptmodule: Elektro- und Gebäudetechnik oder Energietechnik oder Anlagen- und Betriebstechnik
BGBl. II - Ausgegeben am 4. August 2016 - Nr. 211 1 von 31 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF ELEKTROTECHNIK (Hauptmodule: Elektro- und Gebäudetechnik oder Energietechnik oder Anlagen- und Betriebstechnik
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MASSEUR I. STUNDENTAFEL
 BGBl. Nr. 148/1984 i.d.f. 268/1989, 555/1990, BGBl. II Nr. 352/1998 Anlage A/23/3 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MASSEUR I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 2 Schulstufen zu insgesamt 800 Unterrichtsstunden
BGBl. Nr. 148/1984 i.d.f. 268/1989, 555/1990, BGBl. II Nr. 352/1998 Anlage A/23/3 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MASSEUR I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 2 Schulstufen zu insgesamt 800 Unterrichtsstunden
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 Anlage A/2/1 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf Damenkleidermacher, Herrenkleidermacher in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2007 2. Klasse ab 1. September 2008 3. Klasse
Anlage A/2/1 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf Damenkleidermacher, Herrenkleidermacher in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2007 2. Klasse ab 1. September 2008 3. Klasse
Liebe Kollegin! Lieber Kollege! Inhaltsverzeichnis
 Liebe Kollegin! Lieber Kollege! Mit diesem Informationsweb wollen wir im Jubiläumsjahr 2005 einen Beitrag zur Politischen Bildung unserer Schüler leisten. Inhaltsverzeichnis 1. Lehrplanbezug 2 2. Lernziele
Liebe Kollegin! Lieber Kollege! Mit diesem Informationsweb wollen wir im Jubiläumsjahr 2005 einen Beitrag zur Politischen Bildung unserer Schüler leisten. Inhaltsverzeichnis 1. Lehrplanbezug 2 2. Lernziele
L A N D E S S C H U L R A T F Ü R B U R G E N L A N D L E H R P L A N F Ü R B E R U F S S C H U L E N F Ü R D E N L E H R B E R U F
 A n l a g e A / 10 / 1 L A N D E S S C H U L R A T F Ü R B U R G E N L A N D L E H R P L A N F Ü R B E R U F S S C H U L E N F Ü R D E N L E H R B E R U F T I S C H L E R E I A L L G E M E I N E B E S
A n l a g e A / 10 / 1 L A N D E S S C H U L R A T F Ü R B U R G E N L A N D L E H R P L A N F Ü R B E R U F S S C H U L E N F Ü R D E N L E H R B E R U F T I S C H L E R E I A L L G E M E I N E B E S
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom
 Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
FRANZÖSISCH ZWEITE LANDESSPRACHE
 FRANZÖSISCH ZWEITE LANDESSPRACHE 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Grundlagenfach 4 4 4 3 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach GER A2 A2+ B1 B1+ DELF B1 2 Didaktische Hinweise
FRANZÖSISCH ZWEITE LANDESSPRACHE 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Grundlagenfach 4 4 4 3 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach GER A2 A2+ B1 B1+ DELF B1 2 Didaktische Hinweise
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Zahl: /3, 30. März 2004 BANKKAUFMANN
 A/9/4 Bankkaufmann LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Zahl: 3.3057/3, 30. März 2004 Lehrplan für den Lehrberuf BANKKAUFMANN in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2004 2. Klasse ab 1. September 2005
A/9/4 Bankkaufmann LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Zahl: 3.3057/3, 30. März 2004 Lehrplan für den Lehrberuf BANKKAUFMANN in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2004 2. Klasse ab 1. September 2005
6.3 Italienisch oder Spanisch
 6.3 Italienisch oder Spanisch 6.3.1 Richtziele Kenntnisse Die Lernenden verfügen über die sprachlichen und metasprachlichen Instrumente, welche das Erreichen von Niveau A1 und A2 des Europäischen Sprachenportfolios
6.3 Italienisch oder Spanisch 6.3.1 Richtziele Kenntnisse Die Lernenden verfügen über die sprachlichen und metasprachlichen Instrumente, welche das Erreichen von Niveau A1 und A2 des Europäischen Sprachenportfolios
Synopse für Let s go Band 3 und 4
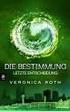 Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 A/23/2 Zahl 3057/0016-AP/2105 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf Kosmetik in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2015 2. Klasse ab 1. September 2015 Dieser Lehrplan besteht
A/23/2 Zahl 3057/0016-AP/2105 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf Kosmetik in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2015 2. Klasse ab 1. September 2015 Dieser Lehrplan besteht
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BETRIEBSDIENSTLEISTUNG I. STUNDENTAFEL
 Anlage A/9/19 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BETRIEBSDIENSTLEISTUNG I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
Anlage A/9/19 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF BETRIEBSDIENSTLEISTUNG I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten,
Verordnung über die Berufsausbildung zum Automobilkaufmann/zur Automobilkauffrau
 Verordnung über die Berufsausbildung zum Automobilkaufmann/zur Automobilkauffrau Vom 26. Mai 1998 (abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1145 vom 29. Mai 1998) Auf Grund des 25 Abs. 1 in Verbindung
Verordnung über die Berufsausbildung zum Automobilkaufmann/zur Automobilkauffrau Vom 26. Mai 1998 (abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1145 vom 29. Mai 1998) Auf Grund des 25 Abs. 1 in Verbindung
Synopse für Let s go Band 1 und 2
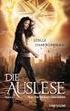 Synopse für Let s go Band 1 und 2 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 1 und 2 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MECHATRONIK I. STUNDENTAFEL
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MECHATRONIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten
RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF MECHATRONIK I. STUNDENTAFEL Gesamtstundenzahl: 3 ½ Schulstufen zu insgesamt 1 560 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), davon in der ersten, zweiten und dritten
TranzparenzKompetenzKooperation am Übergang Schule-Beruf. 21. Februar 2013 IHK-Akademie München
 TranzparenzKompetenzKooperation am Übergang Schule-Beruf 21. Februar 2013 IHK-Akademie München In Deutschland gibt es rund 350 Ausbildungsberufe und mit ihnen eine breite Variation von Inhalten und Anforderungen.
TranzparenzKompetenzKooperation am Übergang Schule-Beruf 21. Februar 2013 IHK-Akademie München In Deutschland gibt es rund 350 Ausbildungsberufe und mit ihnen eine breite Variation von Inhalten und Anforderungen.
Lehrplan für Berufsschulen
 Landesschulrat für Steiermark Lehrplan für Berufsschulen für den (die) Lehrberuf(e) Elektronik Gemäß Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst BGBl. II vom 14.Dezember 2006 Nr. 480 bzw.
Landesschulrat für Steiermark Lehrplan für Berufsschulen für den (die) Lehrberuf(e) Elektronik Gemäß Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst BGBl. II vom 14.Dezember 2006 Nr. 480 bzw.
Hermann Hesse-Gymnasium Calw. Schulcurriculum Englisch. Zielsetzung - 1
 Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Die Neue Mittelschule
 Gesetzestextauszüge SchOG und SchUG Quelle: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 36. Bundesgesetz ausgegeben am 24.04.2012; BGBl. II Nr. 185/2012 v. 30.5.2012 (Umsetzungspaket NMS) (in Kraft seit
Gesetzestextauszüge SchOG und SchUG Quelle: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 36. Bundesgesetz ausgegeben am 24.04.2012; BGBl. II Nr. 185/2012 v. 30.5.2012 (Umsetzungspaket NMS) (in Kraft seit
Entscheidungshilfen. Für den Wahlpflichtbereich. ab Klasse 7 an der Leintal-Realschule
 Entscheidungshilfen Für den Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 an der Leintal-Realschule Stellung des neuen Faches Fünftes KERNFACH - genau so wichtig wie D, E, M & NWA - hohe Versetzungsbedeutung Prinzipien,
Entscheidungshilfen Für den Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 an der Leintal-Realschule Stellung des neuen Faches Fünftes KERNFACH - genau so wichtig wie D, E, M & NWA - hohe Versetzungsbedeutung Prinzipien,
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG
 LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf EDV-TECHNIKER in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2001 2. Klasse ab 1. September 2002 3. Klasse ab 1. September 2003 4. Klasse ab 1.
LANDESSCHULRAT FÜR SALZBURG Lehrplan für den Lehrberuf EDV-TECHNIKER in Kraft gesetzt für die 1. Klasse ab 1. September 2001 2. Klasse ab 1. September 2002 3. Klasse ab 1. September 2003 4. Klasse ab 1.
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit
 Die Entwicklung der Schulsozialarbeit aus Sicht der Bildungsadministration Ulrich Thünken Ministerium für Schule und Weiterbildung Referat 524 Gliederung 1. Schule heute: Ein Bild voller Widersprüche 2.
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit aus Sicht der Bildungsadministration Ulrich Thünken Ministerium für Schule und Weiterbildung Referat 524 Gliederung 1. Schule heute: Ein Bild voller Widersprüche 2.
