Räumliche Energieplanung
|
|
|
- Johannes Fiedler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Information für kommunale Behörden und Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärme- und Kälteversorgung Dezember 2017 Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 6 in Kürze Modul 4: Energiepotenziale Die räumliche Energieplanung ist eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung von thermischen Netzen (wie Wärmeverbunde oder Anergienetze). Diese eignen sich für die Versorgung von Siedlungsgebieten mit Wärme im Hoch- und im Niedertemperaturbereich bzw. mit Kälte aus Abwärme und ortsgebundenen erneuerbaren Energien. Modul 5: Wärmeerzeugung Wirtschaftlicher Betrieb Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 6: Thermische Netze Eignung und Realisierung Modul 7: Umsetzung, Energievorschriften Modul 8: Erfolgskontrolle Modul 9: Konzession EDL Um den wirtschaftlichen Betrieb eines thermischen Netzes zu prüfen, sind Abklärungen zu den Gestehungskosten bei der Energieerzeugung, zur Wärme- und Kältebedarfsdichte, zu den Anforderungen des Gebäudebestandes sowie den Kosten für die Energieverteilung im Versorgungsgebiet erforderlich. Zwingend ist auch die Koordination mit einer allfällig bestehenden Erdgasversorgung. Contracting Der Aufbau eines Energieverbundes kann an einen Contractor (Energiedienstleister EDL) vergeben werden. Damit können Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung ausgelagert werden. Weiterführende Informationen und Links Contracting, Konzessionen EDL, Modul 9 Separates Beiblatt zu den Modulen 1 bis 9
2 Eignung und Abklärungsbedarf für thermische Netze Wo ist der Aufbau von thermischen Netzen zweckmässig? Welche Faktorenbeeinflussen die Eignung für eine thermische Vernetzung? Neben den technischen und räumlichen Voraussetzungen sind dafür auch die Wirtschaftlichkeit und die Koordination mit bereits bestehenden Versorgungsnetzen zu beachten. WAS VERSTEHEN WIR UNTER EINER THERMISCHEN VERNETZUNG? Als thermische Vernetzung wird die leitungsgebundene Verteilung von Wärme und Kälte verstanden. Folgende Begriffe werden in diesem Modul verwendet: F ernwärmeverbund: Transport von thermischer Energie über grössere Distanzen durch öffentlichen Grund zur Versorgung von Gebäuden mit Komfortwärme (Heizung und Brauchwarmwasser) mit > 5 GWh / a. Nahwärmeverbund: Im Gegensatz zum Fernwärmeverbund sind die Wärmequelle und die Verbraucher räumlich nahe beieinander gelegen und die Jahresleistung beträgt < 5 GWh / a. Thermisches Netz: Leitungsgebundene Versorgung von Gebäuden mit thermischer Energie zu Heiz- und Kühlzwecken aus einer gemeinsamen Energiequelle. Anergienetz: Netz zur Nutzung von Abwärme und / oder Umweltwärme auf einem Temperaturniveau nahe der Umgebungstemperatur mit dezentralem Temperaturhub zur Versorgung der Verbraucher mit Wärme und Kälte. WÄRME- UND KÄLTEVERSORGUNG Thermische Netze ermöglichen, die Wärme- und Kälteversorgung übergeordnet zu organisieren. Die Planung der thermischen Netze hat jedoch umsichtig zu erfolgen, weil der Aufbau und Betrieb durch hohe Investitionen und lange Nutzungs- und Amortisationszeiten bestimmt sind. Thermische Netze werden mit folgenden Zwecken erstellt: N utzung standortgebundener Abwärme aus KVA, Industrie, ARA, WKK-Anlagen Nutzung von ortsgebundenen, erneuerbaren Wärme- und Kältequellen Versorgung mit Wärme und gleichzeitige Nutzung der Abwärme aus Kälteanlagen Betrieb von (kombinierten) Energieerzeugungstechnologien wie Holzschnitzelfeuerungen, Geothermie und WKK-Anlagen (z. B. mit nicht aufbereitetem Biogas oder Altholzfeuerungen) 2 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze EIGNUNGSBEURTEILUNG Zur Bestimmung einer zweckmässigen Energieversorgung sind diverse planerische Aspekte zu berücksichtigen (Abb. 1). Damit ein Gebiet sich für die thermische Vernetzung eignet, muss es mindestens einen auch zukünftig hohen Wärmebedarf, einen erheblichen Kältebedarf oder günstige bauliche Voraussetzungen aufweisen. Ist dies nicht der Fall, ist eine dezentrale Nutzung von Abwärme und erneuerbaren Energien anzustreben. Wenn sich ein Gebiet für die thermische Vernetzung eignet, ist im Weiteren abzuklären, ob und welche Abwärmequellen vorhanden sind. Beim Vorhandensein von hochwertiger Abwärme (z. B. Abwärme KVA) mit einem direkt nutzbaren Temperaturniveau, kann ein Verbund mit hoher Vorlauftemperatur angestrebt werden. Bei niederwertiger Ab- oder Umweltwärme, welche nicht direkt nutzbar ist, kann ein Verbund mit niedriger Vorlauftemperatur als Versorgungsart anvisiert werden.
3 KÜNFTIGER WÄRME- UND KÄLTEBEDARF Das wichtigste Kriterium für ein thermisches Netz ist der künftige Wärme- und Kältebedarf im Versorgungsgebiet. Nur bei entsprechender Wärme- und Kältebedarfsdichte ist die Voraussetzung für eine Versorgung durch thermische Netze gegeben. Folgende weitere Voraussetzungen begünstigen den Aufbau eines thermischen Netzes: G rossverbraucher mit ganzjährigem Wärmebedarf (Schlüsselkunden wie z. B. Spitäler, Altersheime, Wäschereien) Wohngebiete: Eine hohe Wärmebedarfsdichte weisen ältere, dicht bebaute Wohngebiete auf; Transformations- und Neubaugebiete mit geringerer Wärmedichte lassen sich oft auch mit hohe Wärmebedarfsdichte? NEIN JA erheblicher Kältebedarf? NEIN Niedertemperaturnetzen versorgen, bei denen die Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen dezentral in den Gebäuden erfolgt. Betriebsdauer: Bei der Eignungsabklärung von Gebieten ist auf den künftigen Wärmebedarf (unter Beachtung von Gebäudesanierungen, Ersatzbauten) sowie die zeitliche Verfügbarkeit der Energiequellen zu achten. Zonen mit einem hohen Anteil an Gewerbe und Dienstleistungen: Die Erschliessung von Industriegebieten mit Wärme- oder kombinierten Kältenetzen ist detailliert und im Einzelfall zu prüfen. günstige bauliche Voraussetzungen? JA JA keine Eignung für thermische Vernetzung Eignung für thermische Vernetzung hochwertige Abwärme 1 vorhanden? NEIN niederwertige Ab- und Umweltwärme 2 vorhanden? NEIN JA JA Fernwärme mit hoher Vorlauftemperatur Wärmeverbund mit niedriger Vorlauftemperatur oder Energieverbund (Wärme/Kälte) direkt nutzbares Temperaturniveau, i. d. R. > 50 C zur Nutzung dieser Abwärme oder (ortsgebundenen) Umweltwärme muss das Temperaturniveau mit einer Wärmepumpe erhöht werden 1 2 Abbildung 1: Entscheidungsschema Versorgungsart in Abhängigkeit von Energienachfrage und Energieangebot (PLANAR 2017) 3 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze NEIN dezentrale Nutzung von Abwärme und erneubare Energie in Einzelanlagen
4 BESONDERE BEDEUTUNG KÄLTEBEDARF Die Nachfrage nach Kälte zur Klimatisierung von Dienstleistungsgebäuden, Serveranlagen und Rechenzentren nimmt deutlich zu (Klimaerwärmung, Hitzeinseln in Innen städten, Abwärme EDV sowie steigende Komfortansprüche). Die konventionelle Kälteproduktion mit Strom angetrie bene Kältemaschinen verursacht Abwärme, die in Hitze perioden das Mikroklima in Innenstädten zusätzlich aufheizt. Die Versorgung mit Wärme und Kälte kann in thermischen Netzen sinnvoll kombiniert werden: D irekte Rückkühlung in Niedertemperaturnetzen (hohe Energieeffizienz) Thermische Netze mit gleichzeitigem Angebot an Wärme und Kälte; mit einer zentralen Kältemaschine werden gleichzeitig Wärme und Kälte erzeugt, welche in je einem separaten Netz zur Verfügung gestellt werden können. Bei einem Fernwärmeverbund mit hohen Vorlauftemperaturen (z. B. mit KVA-Abwärme) kann Kälte mit Absorptionskältemaschinen vor Ort erzeugt werden (oft relativ geringe Energieeffizienz) Koordination mit der Gasversorgung Die Koordination der Gasversorgung mit bestehenden und geplanten thermischen Netzen ist eine wesentliche Aufgabe der räumlichen Energieplanung. Entsprechende Erwägungen, Planungsgrundsätze und Massnahmen werden in Modul 10 «Gasstrategie» (Herausgabe geplant) beschrieben. In Gebieten mit bestehenden oder geplanten thermischen Netzen in bereits mit Erdgas versorgten Gebieten ist für die beteiligten Werkträger das Vorgehen bei Interessenkonflikten festzulegen. Sind keine thermischen Netze vorhanden, können die für das jeweilige Gebiet am besten en Energieträger festgelegt werden (erneuerbare Wärmequellen und Erdgas / Biogas). 4 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze
5 Wirtschaftlichkeit thermischer Netze Die Wärmegestehungskosten und die Verteilkosten bestimmen, ob eine thermische Vernetzung gegenüber den individuellen Heizungslösungen konkurrenzfähig ist. Die Wirtschaftlichkeit eines Verbundes ist auf jeden Fall zu prüfen. Um die Eignung von Gebieten für eine thermische Vernetzung zu beurteilen, ist die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die Versorgung in thermischen Netzen erfolgt wirtschaftlich, wenn über den ganzen Lebenszyklus die Aufwendungen inkl. externer Kosten nicht höher sind als eine dezentrale Versorgung mit Wärme und Kälte (SIA 480). Bei der Beur teilung der Wirtschaftlichkeit sind dabei zu beachten: Ein Variantenvergleich ist mit gleichen Voraus setzungen zu rechnen: z. B. Anteil erneuerbarer Energieträger, Anforderungen an Wärme dämmung, Vollkostenrechnung für Wärme- und Kälteversorgung (Erstellung und Betrieb, monetäre Berücksichtigung der Umweltbelastung), Risiken bezüglich Preisentwicklung. Gestehungs-kosten für Wärme und Kälte Verteilkosten für Wärme und Kälte Risiken bezüglich Veränderungen beim Wärme- und Kältebedarf sowie der Kosten für die Endenergie Wirtschaftlichkeit von Realisierungsetappen Wärmedichte in Neubaugebieten: In Neubaugebieten ist aufgrund erhöhter Wärmedämmungsanforderungen mit einem geringeren Heizwärmebedarf zu rechnen; der Wärmebedarf für Brauchwarmwasser bleibt etwa konstant. Die Gebäude können auf niedrigem Temperaturniveau bei rund 30 C beheizt werden. Dies begünstigt die dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energiequellen (z. B. Erdwärme und Solarthermie). Somit beschränkt sich die Eignung für thermische Netze auf Neubaugebiete mit sehr hoher baulicher Dichte, mit verfügbarer lokaler Abwärme, mit erheblichem Bedarf an Kühlung oder mit besonderen baulichen Voraussetzungen. Insbesondere zur Deckung eines kombinierten Bedarfes von Wärme und Kälte können Anergienetze eine interessante Option darstellen. Bestehende Bauten Neubauten Ausnützungsziffer HT-Netze (> = 60 C) NT-Netze (< 60 C) HT-Netze (> 60 C, fossil max. 20 %) NT-Netze (Abwärme oder erneuerbar) wenig wenig wenig wenig < 0,5 bedingt bedingt wenig bedingt < 0,5 bis 0,80 bedingt bedingt 0,80 bis 1,10 > 1,10 Tabelle 1: Nutzerseitige Eignung von Wohngebieten bzw. Zonen mit mehrheitlich Wohnbauten für Hoch- und Niedertemperatur-Netze. Annahmen: Anschlussdichte ca. 0,8 kw / Tm (ca. 1,6 MWh / a Tm). Verteilkosten bei Neubauten: 800 Fr. / Tm; bestehende Gebäude: 1200 Fr. / Tm; Wirtschaftlichkeitsgrenze bei Verteilkosten von 40 Fr. / MWh) 5 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze
6 BESONDERE BEDEUTUNG KÄLTEBEDARF Grundsätzlich gilt: Je geringer die Wärmegestehungskosten ausfallen, umso mehr Aufwand darf für die Verteilung im Verbund eingesetzt werden. Wird die Wärme mit Wärmepumpen oder Holzschnitzelfeuerung erzeugt, sollten die Verteilkosten nicht mehr als 40 Fr. / MWh betragen. Die Verteilkosten werden entscheidend von der Wärmeabgabe (MWh / a) pro Trassemeter (Tm) beeinflusst (Tabelle 1). Als Faustregel gilt: Die Anschlussdichte bei thermischen Netzen übersteigt bei Ganzjahresbetrieb 1 kw / Tm (ca. 2 MWh / a Tm) Wärmenetz; bei Betrieb nur während der Heizperiode übersteigt sie 0,6 kw / Tm (ca.1,3 MWh / a Tm) Wärmenetz. Bei Inbetriebnahme des Netzes sollten 70 % des Wärmeabsatzes im Endausbau gesichert sein. LEITUNGSKOSTEN Die Leitungskosten in einem thermischen Netz betragen zwischen 600 und 1500 Fr. / Tm. Nachfolgend einige Variablen zur Abschätzung der Leitungskosten: Temperaturniveau, Wärmemedium (Dampf, Warmwasser) und Druck der Wärmeverteilung; Rohrtyp und Leitungsdurchmesser Verlegungsort und Wiederinstandstellung: Leitungsbau durch Wiesen und Vorgärten ist günstiger (600 Fr. / Tm) als bei Strassen und Trottoirs (900 bis 1200 Fr. / Tm) oder bei Kopfsteinpflaster (mehr als 1500 Fr. / Tm). Erfolgt die Erschliessung eines Neubaugebietes gleichzeitig mit den übrigen Werkleitungen und Strassen, kann mit tieferen Kosten gerechnet werden (weitere Informationen im Planungshandbuch QM Holzheizwerke). Höhendifferenz: Höhenunterschiede von über 30 bis 50 Meter führen zu erhöhtem Druck und Mehrkosten. NT-Netze ohne Isolation sind oft günstiger als HT-Netze. Leitungsbedarf für Erschliessung: ca. 200 bis 300 Tm Wärmenetz pro Hektare Siedlungsfläche. Wärmedichte: Geeignete Gebiete weisen einen Wärmebedarf von mindestens 350 bis 400 MWh / (a ha) auf. (Energiekennzahlen nach Alterskategorie siehe Modul 3 «Energienachfrage», Abb. 2) Amortisationsdauer: Für ein thermisches Netz wird mit Amortisationszeiten von rund 40 Jahren gerechnet, für die Wärmeerzeugung mit 15 bis 20 Jahren. Glossar Ausbaugrad: Verhältnis gebauter zur im Zonenplan erlaubten Gebäudesubstanz (Tab. 1: Annahme 100 %). Anschlussgrad: Verhältnis angeschlossener zu potenziell bezogener Wärmemenge (Tab. 1: Annahme 75 %). Ausnützungsziffer: Verhältnis zwischen der anrechenbaren Brutto geschossfläche der Gebäude und der anrechenbaren Landfläche 6 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze
7 AUSNÜTZUNGSZIFFER UND ANSCHLUSSGRAD Abbildung 2 eignet sich zur Grobabschätzung der Wirtschaftlichkeit eines thermischen Netzes bezogen auf Zonen mit unterschiedlicher Bebauungsdichte. Graue Pfeile (Grafik links und rechts): Ausgehend von der Ausnützungsziffer lassen sich die Verteilkosten bestimmen. Bei korrigierter Ausnützungsziffer von 1,1 was einer Ausnützungsziffer von etwa 1,6 bei einem Anschlussgrad von 70 % und dem Ausbaugrad von 1 entspricht resultiert eine spezifische Anschlussleistung von 0,8 kw / Tm (ca. 1,6 MWh / (a Tm) bei Minergie-Neubauten. Daraus resultieren Wärmeverteilkosten von rund 60 Fr. / MWh bei Leitungskosten von 1200 Fr. / Tm. Schwarze Pfeile (Grafik links und rechts): Aus gehend von den für einen wirtschaftlichen Betrieb zulässigen durchschnittlichen Verteil kosten lässt sich die minimale Wärmedichte des zu versorgenden Gebietes bestimmen. Bei zulässigen Verteilkosten von 40 Fr. / MWh und Leitungskosten von 1200 Fr. / Tm ergibt sich eine minimale spezifische Anschlussdichte von 1,2 kw / Tm (ca. 2,4 MWh / (a Tm). Daraus folgt eine minimale korrigierte Ausnützungsziffer von rund 0,55 bei vollständig sanierten Gebäuden. Bei einem Anschlussgrad von 70 % und einem Ausbaugrad von 1 entspricht dies einem überbauten Siedlungsgebiet mit minimaler Ausnützungsziffer von knapp 0,8. Mit Wärmenetzen versorgbare Zonentypen Spezifiesche Anschlussleistung pro Trasseemeter und Verteilkosten 3,0 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 Spez. Anschlussleistung in kw/tm Spez. Anschlussleistung in kw/tm Unterschiedlich bebaute Zonen und die Wirtschaftlichkeit eines thermisches Netzes 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Minimal nötige korrigierte Ausnützungsziffer (Ausnützungsziffer x Ausbaugrad x Anschlussgrad) Neubauten Minergie Neubauten MuKEn Vollständig sanierte Bauten Teilsanierte Bauten Unsanierte Bauten Abbildung 2: Wirtschaftlichkeit von thermischen Netzen (econcept) 7 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, Verteilkosten in Fr./MWh 600 Fr./Tm 1200 Fr./Tm 9000 Fr./Tm 1500 Fr./Tm
8 Realisierung thermischer Netze Wie soll ein neues thermisches Netz realisiert werden? Vor der Realisierung eines Energieverbundes hat die Gemeinde das Angebot und die Nachfrage von Wärme und Kälte zu analysieren sowie Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit thermischer Netze grob abzuschätzen. Die Festlegung entsprechender Verbundgebiete in der Energieplanung ist Basis für deren Realisierung. Um die Voraussetzungen für die Realisierung thermischer Netze beurteilen zu können, sind die Potenziale sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite zu analysieren sowie Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit abzuklären (siehe Seiten 2 bis 5). Der zweite Schritt zur Realisierung eines thermischen Netzes umfasst die planerische Sicherung mit folgenden Mitteln: Prioritätsgebiete für thermische Netze und erneuerbare Energieträger in der Energieplanung festlegen Entsprechende Vorgaben in der Nutzungs- und Sondernutzungsplanung (Anteile erneuerbare Energien, Anschlussverpflichtung); vgl. Modul 7 Als dritter Schritt ist die Trägerschaft der vorgesehenen thermischen Netze zu bestimmen. OPTIONEN FÜR DIE REALISIERUNG Für die Trägerschaft vorgesehener Energieverbunde bestehen verschiedene Möglichkeiten: Die Gemeinde (oder ein gemeindeeigenes Werk) wird Eigentümerin und Betreiberin des Energieverbundes. Planung, Bau und Finanzierung sowie Betrieb des Energieverbundes werden einem Energiedienstleister als Contractor übertragen. Dazwischen bestehen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten: z. B. Planung und Erstellung der Energiezentrale und der Vernetzung durch Energiedienstleister; Finanzierung, Betrieb und Kundenkontakte durch Gemeinde (oder Gemeindewerk). 8 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze ZUSAMMENARBEIT MIT CONTRACTOR Will eine Gemeinde oder öffentliche Trägerschaft den Energieverbund nicht selber betreiben, ist die Zusammenarbeit mit einem professionellen Contractor möglich. Ein solches Energiecontracting umfasst das Auslagern von Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung der Energieversorgungsanlage an eine Firma, den Contractor. Als Contractor sind häufig lokale oder regionale Energieversorger tätig. AUSWAHL ENERGIEDIENSTLEISTER Der Handlungsspielraum einer Gemeinde unterscheidet sich je nach Ausgangslage: Die Gemeinde ist selbst Wärmebezügerin und prüft, ob weitere Bezüger in das Projekt einge bunden werden können. Gemäss den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens kann sie ein Projekt ausschreiben und einen Wärme bezugsvertrag mit dem Contractor abschliessen. Die Gemeinde ist Initiantin eines Energiecontracting-Projektes, wird aber selber keine oder nur einen untergeordneten Anteil Wärme beziehen. Sie kann das Projekt unterstützen und zur Realisierung beitragen. Die Vergabe einer gebietsspezifischen Konzession wird empfohlen. Die Regelung der Rechte und Pflichten zwischen der Gemeinde und dem Energiedienstleister wird im Modul 9 detailliert behandelt.
9 Gemeindeeigener Energieverbund Das empfohlene Vorgehen beim Aufbau eines gemein deeigenen Energieverbundes (bzw. bei namhafter öffentlicher finanzieller Beteiligung) umfasst folgenden Ablauf: Vorprojekt inkl. technischen Lösungsvarianten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Tarifmodelle, Indexierung (u. a. Anpassung an Ölpreis) Sicherung von Schlüsselkunden; Prüfen einer Anschlussverpflichtung Investitionsentscheid Detailprojekt und Ausführung Zweck/Tätigkeit der Gemeinde Auswahl des EDLs durch: Anteil Wärmeversorgung von öffentlichen Gebäuden > 50 % der Wärmeleistung Umsetzung der kommunalen Energieplanung Anteil öffentliche Gebäude < 50 % der Wärmeleistung Blosse Erteilung von Durchleitungsrechten auf öffentlichem Grund; Gewährleistung der Übereinstimmung mit kommunaler Energiepolitik öffentliches Beschaffungswesen Transparentes, diskriminierungsfreies Verfahren. Begründete Wahl EDL mit anfechtbarem Entscheid Kein Auswahlverfahren notwendig Abbildung 3: Unverbindliche Entscheidungshilfe zur Gestaltung des Auswahlverfahrens beim Aufbau eines thermischen Netzes (PLANAR 2016) 9 Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze
10 Vergabe eines Energiecontracting-Projekts Die Durchführung eines Auswahlverfahrens wird auch ohne eigene Wärmeabnahme empfohlen, damit das Projekt ein möglichst gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis ausweist. Die Auswahl des Contractors kann erfolgen nach den Kriterien: wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit, Preise und qualitative Vorgaben (siehe Tabelle 2). Contracting: die einzelnen Variante 1: Gemeinde Realisierungsschritte als Wärmeabnehmerin Variante 2: Gemeinde als Initiantin, ohne eigenen Wärmebezug 1. Idee und Vorstudie Konkreter Bedarf für Versorgung eines Gebäudes Räumliche Energieplanung Projektidee aus räumlicher Energieplanung 2. Rechtliche Grundlagen (vgl. Abb. 3) Submissionsrichtlinien beachten Transparentes, diskriminierungsfreies Verfahren 3. Fachliche Grundlagen Vorstudie durch Gemeinde ausarbeiten lassen Wichtigste Eckdaten beschaffen (Wärme- und Kältebedarf) Interesse weiterer möglicher Schlüsselkunden abklären 4. Ausschreibungsunterlagen und -verfahren Einladungsverfahren oder öffentliche Ausschreibung, abhängig vom erwarteten Submissionsumfang 5. Informations veranstaltung Angeschriebene / interessierte Unternehmen werden zum Augenschein vor Ort eingeladen. Fragen werden beantwortet. Die Ausschreibungsunterlagen werden abgegeben und die Termine festgelegt 6. Rückmeldung Bestätigung der Teilnahme am Ausschreibeverfahren einholen, um bei Bedarf den Kreis der angeschriebenen Contractingunternehmen zu erweiteren 7. Eingabe und Beurteilung des Projekt vorschlages Kostenwettbewerb: Beurteilungskriterien sind qualitätsund kostenorientiert Ideenwettbewerb mit Kostenofferte: Beurteilungskriterien stärker nach konzeptionellen und qualitativen Aspekten definieren 8. Vergabe Wärmeabnahmevertrag Unterstützung des ausgewählten Contractors für die Realisierung des Projektes Gemeinde prüft die Vergabe einer Konzession für den Betrieb des Energieverbundes Empfehlung: Einladungsverfahren mit mindestens drei en Energiedienstleistern Die Gemeinde regelt Rechte und Pflichten mit dem Contractor (vgl. Modul 9) 9. Umsetzung Contractor realisiert und betreibt Energieverbund Tabelle 2: Vorgehen zur Realisierung eines Contracting-Projektes 10Räumliche Energieplanung Modul 6 Thermische Netze Gemeinde entwickelt zusammen mit dem ausgewählten Contractor das Projekt weiter Contractor holt Interessenbekundungen möglicher Kunden ein (Vorverträge) Contractor realisiert den Verbund und schliesst Verträge mit Kunden ab
11 Impressum Herausgeber: EnergieSchweiz für Gemeinden, c / o Nova Energie GmbH, 8370 Sirnach Erstdruck: Februar 2011; Revision Dezember 2017 Auftragnehmer: PLANAR AG für Raumentwicklung Begleitgruppe Revision: Brandes Energie AG, econcept AG, Hochschule Luzern HSLU Unterstützung: Kantone Aargau, Bern, Luzern, Schaffhausen, St.Gallen, Thurgau und Zürich, Amt für Raumentwicklung ARE, Bundesamt für Energie BFE
Räumliche Energieplanung
 Information für Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 4: Energiepotenziale
Information für Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 4: Energiepotenziale
Kommunale Energieplanung
 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Energiepolitik in der Gemeinde _ Handlungsspielraum nutzen! Olten, 27. Oktober 2009 Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung
Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Energiepolitik in der Gemeinde _ Handlungsspielraum nutzen! Olten, 27. Oktober 2009 Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung
2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
 Energie-Apéro Luzern Beat Marty, Leiter Abt. Energie, Luft und Strahlen 11. März 2013 2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
Energie-Apéro Luzern Beat Marty, Leiter Abt. Energie, Luft und Strahlen 11. März 2013 2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050
 Raumplanungsgruppe Nordostschweiz des VLP-ASAN Frauenfeld, 18. September 2012 Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050 Reto Dettli Managing Partner Inhalt Die neue Energiestrategie:
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz des VLP-ASAN Frauenfeld, 18. September 2012 Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050 Reto Dettli Managing Partner Inhalt Die neue Energiestrategie:
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung. 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014
 Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014 Ver- und Entsorgung - Inhalte Übergeordnete Themeneinbindung Kapitel 5.2
Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014 Ver- und Entsorgung - Inhalte Übergeordnete Themeneinbindung Kapitel 5.2
Exergetisch und wirtschaftlich optimierte Nahenergiesysteme. Chancen für innovative Betreiber
 Exergetisch und wirtschaftlich optimierte Nahenergiesysteme Quelle: Stadtwerke Bruneck Chancen für innovative Betreiber Christian Erb, Halter Entwicklungen, Zürich Energieapéro Bern, 27. März 2014 Frühere
Exergetisch und wirtschaftlich optimierte Nahenergiesysteme Quelle: Stadtwerke Bruneck Chancen für innovative Betreiber Christian Erb, Halter Entwicklungen, Zürich Energieapéro Bern, 27. März 2014 Frühere
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis. Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen
 Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen Netzwerktreffen Kälteenergie, 4. September 2013 Dr. Friederike Mechel,
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen Netzwerktreffen Kälteenergie, 4. September 2013 Dr. Friederike Mechel,
Planung und Realisierung des Energiemanagements am Beispiel des Inselspitals Bern
 Seite 1 Planung und Realisierung des Energiemanagements am Beispiel des Inselspitals Bern Dieter Többen, CEO Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Energiemanagement Masterplan/ Strategie Messen / Optimieren Projekte
Seite 1 Planung und Realisierung des Energiemanagements am Beispiel des Inselspitals Bern Dieter Többen, CEO Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Energiemanagement Masterplan/ Strategie Messen / Optimieren Projekte
Stark unterschätzte erneuerbare Energievorkommen mit Wärme- und Kältenetzen wirtschaftlich nutzen. Hanspeter Eicher VR Präsident eicher+pauli
 Stark unterschätzte erneuerbare Energievorkommen mit Wärme- und Kältenetzen wirtschaftlich nutzen Hanspeter Eicher VR Präsident eicher+pauli 1 Wärmebedarf Schweiz 2010 wurden 85 TWh/a Endenergie für Raumwärme
Stark unterschätzte erneuerbare Energievorkommen mit Wärme- und Kältenetzen wirtschaftlich nutzen Hanspeter Eicher VR Präsident eicher+pauli 1 Wärmebedarf Schweiz 2010 wurden 85 TWh/a Endenergie für Raumwärme
Sauber in die Zukunft mit Energie aus Wärmeverbunden
 Alenii Event - 12. September 2013 Sauber in die Zukunft mit Energie aus Wärmeverbunden Bruno Liesch, Geschäftsleiter Wärmeverbund Marzili Bern AG Warum Wärmeverbunde? Energiequellen: Abwärme Grundwasser
Alenii Event - 12. September 2013 Sauber in die Zukunft mit Energie aus Wärmeverbunden Bruno Liesch, Geschäftsleiter Wärmeverbund Marzili Bern AG Warum Wärmeverbunde? Energiequellen: Abwärme Grundwasser
FW KWK: Potenzialbewertung hocheffizienter Kraft Wärme Kopplung und effizienter Fernwärmeund Fernkälteversorgung
 FW KWK: Potenzialbewertung hocheffizienter Kraft Wärme Kopplung und effizienter Fernwärmeund Fernkälteversorgung Lukas Kranzl, Richard Büchele, Karl Ponweiser, Michael Hartner, Reinhard Haas, Marcus Hummel,
FW KWK: Potenzialbewertung hocheffizienter Kraft Wärme Kopplung und effizienter Fernwärmeund Fernkälteversorgung Lukas Kranzl, Richard Büchele, Karl Ponweiser, Michael Hartner, Reinhard Haas, Marcus Hummel,
Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons
 Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler
Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler
ENERGETISCHES QUARTIERSKONZEPT für die Siedlungen Eichkamp und Heerstraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
 ENERGETISCHES QUARTIERSKONZEPT für die Siedlungen Eichkamp und Heerstraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Runder Tisch Wärmeversorgung im Quartier 07. April 2016 TOP / was haben wir vor? 1. Begrüßung
ENERGETISCHES QUARTIERSKONZEPT für die Siedlungen Eichkamp und Heerstraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Runder Tisch Wärmeversorgung im Quartier 07. April 2016 TOP / was haben wir vor? 1. Begrüßung
Creating Energy Solutions
 Creating Energy Solutions VBSA-Fachtagung Thomas Peyer, Leiter Energiedienstleistungen Abwärme Eine verkannte Energieform in der Sackgasse? Swisspower Aktionäre. Swisspower und ihre Aktionäre in Zahlen
Creating Energy Solutions VBSA-Fachtagung Thomas Peyer, Leiter Energiedienstleistungen Abwärme Eine verkannte Energieform in der Sackgasse? Swisspower Aktionäre. Swisspower und ihre Aktionäre in Zahlen
Wasser statt Öl Eine Wohnkolonie stellt um.
 Wasser statt Öl Eine Wohnkolonie stellt um www.fws.ch Wasser statt Öl Eine Wohnkolonie stellt von fossile Wenn die alten Heizkessel ersetzt werden müssen, ist das der Moment, über neue Lösungen nachzudenken.
Wasser statt Öl Eine Wohnkolonie stellt um www.fws.ch Wasser statt Öl Eine Wohnkolonie stellt von fossile Wenn die alten Heizkessel ersetzt werden müssen, ist das der Moment, über neue Lösungen nachzudenken.
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
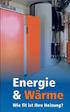 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Nahwärmeversorgung Steinbach. Nahwärmeversorgung Steinbach. Energie Belp AG l Ma l l Seite 1
 Nahwärmeversorgung Steinbach Nahwärmeversorgung Steinbach Energie Belp AG l Ma l29.08.2013l Seite 1 Standort der Heizzentrale Standort der Heizzentrale Die Heizzentrale ist unter der Zufahrtsrampe zur
Nahwärmeversorgung Steinbach Nahwärmeversorgung Steinbach Energie Belp AG l Ma l29.08.2013l Seite 1 Standort der Heizzentrale Standort der Heizzentrale Die Heizzentrale ist unter der Zufahrtsrampe zur
Analyse Nahwärmenetz Innenstadt Stand 2.Juli Folie 1
 Analyse Nahwärmenetz Innenstadt Stand 2.Juli 2014 Folie 1 Wärmebedarf im historischen Stadtkern Darstellung der Wärmedichte [kwh/m*a] Wärmedichte [kwh/m] von Wärmedichte [kwh/m] bis Anzahl Straßenabschnitte
Analyse Nahwärmenetz Innenstadt Stand 2.Juli 2014 Folie 1 Wärmebedarf im historischen Stadtkern Darstellung der Wärmedichte [kwh/m*a] Wärmedichte [kwh/m] von Wärmedichte [kwh/m] bis Anzahl Straßenabschnitte
Plusenergie-Gebäude / Plusenergie-Areale
 Plusenergie-Gebäude / Plusenergie-Areale Entwurf Definition - energie-cluster.ch Oktober 2015 Dr. Ruedi Meier, Präsident energie-cluster.ch Dr. Frank Kalvelage, Geschäftsleiter energie-cluster.ch Monbijoustrasse
Plusenergie-Gebäude / Plusenergie-Areale Entwurf Definition - energie-cluster.ch Oktober 2015 Dr. Ruedi Meier, Präsident energie-cluster.ch Dr. Frank Kalvelage, Geschäftsleiter energie-cluster.ch Monbijoustrasse
Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG)
 Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten,
Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten,
Energieplanung Rheinfelden
 Energieplanung Rheinfelden Kurs Energiestadt-Koordinatoren vom 08.11.2013 in Baden Inhalt Energiestadt Rheinfelden Übersicht Entwicklungsplanung, Raumordnung Ausgangslage Ziel(e) und Handlungsanweisungen
Energieplanung Rheinfelden Kurs Energiestadt-Koordinatoren vom 08.11.2013 in Baden Inhalt Energiestadt Rheinfelden Übersicht Entwicklungsplanung, Raumordnung Ausgangslage Ziel(e) und Handlungsanweisungen
Zukunft der Fernwärme in der 2000- Watt-Gesellschaft
 VBSA-Fachtagung, Olten, 7. Dezember 2011 Zukunft der Fernwärme in der 2000- Watt-Gesellschaft Walter Ott, Ausgangslage und Fragestellungen Forderung Klima- und Energiepolitik: 1 Tonne CO 2 pro Kopf und
VBSA-Fachtagung, Olten, 7. Dezember 2011 Zukunft der Fernwärme in der 2000- Watt-Gesellschaft Walter Ott, Ausgangslage und Fragestellungen Forderung Klima- und Energiepolitik: 1 Tonne CO 2 pro Kopf und
Räumliche Energieplanung
 Information für Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 4: Energiepotenziale
Information für Fachpersonen Räumliche Energieplanung Werkzeuge für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung Modul 1: Zweck und Bedeutung Modul 2: Vorgehen Modul 3: Energienachfrage Modul 4: Energiepotenziale
ENERGIERAUMPLANUNG IM KANTON ZÜRICH
 ENERGIERAUMPLANUNG IM KANTON ZÜRICH Roland Kloss, Michael Cerveny (beide Energy Center Wien; TINA Vienna), September 2015 1. INSTRUMENTE UND PLANUNGSEBENEN In der Schweiz hat die Verknüpfung von Raumplanung
ENERGIERAUMPLANUNG IM KANTON ZÜRICH Roland Kloss, Michael Cerveny (beide Energy Center Wien; TINA Vienna), September 2015 1. INSTRUMENTE UND PLANUNGSEBENEN In der Schweiz hat die Verknüpfung von Raumplanung
Energiewende für die Politik? Kanton Luzern konkret!
 Energiewende für die Politik? Kanton Luzern konkret! Agenda: Grosswetterlag Kanton Luzern: Ausgangslage Kanton Luzern: Perspektiven Politische Beurteilung 2 www.renggli-haus.ch 1 Stand heute 2016 Klimaerwärmung
Energiewende für die Politik? Kanton Luzern konkret! Agenda: Grosswetterlag Kanton Luzern: Ausgangslage Kanton Luzern: Perspektiven Politische Beurteilung 2 www.renggli-haus.ch 1 Stand heute 2016 Klimaerwärmung
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien
 Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Energieplanung Teufen Zweck einer Energieplanung und Stand der Arbeiten
 Energieplanung Teufen Zweck einer Energieplanung und Stand der Arbeiten Informationsveranstaltung vom 6.12.2011 Überblick Ausgangslage Zweck einer kommunalen Energieplanung Stand der Arbeiten / Potenziale
Energieplanung Teufen Zweck einer Energieplanung und Stand der Arbeiten Informationsveranstaltung vom 6.12.2011 Überblick Ausgangslage Zweck einer kommunalen Energieplanung Stand der Arbeiten / Potenziale
swb Services CONTRACTING UND TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN Ihr Mehr an Effizienz
 swb Services CONTRACTING UND TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN Ihr Mehr an Effizienz Full Service Contracting Zusammenarbeit ist Vertrauenssache Ihre Ziele sind das Maß der Dinge individuell zugeschnittene Energie-Dienstleistungen
swb Services CONTRACTING UND TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN Ihr Mehr an Effizienz Full Service Contracting Zusammenarbeit ist Vertrauenssache Ihre Ziele sind das Maß der Dinge individuell zugeschnittene Energie-Dienstleistungen
Mehr Sonnenenergie in Graubünden. Fördermöglichkeiten. Energie-Apéro
 Mehr Sonnenenergie in Graubünden Fördermöglichkeiten Energie-Apéro 20.06.2007 Andrea Lötscher, Gliederung Energie heute Energie morgen Schwerpunkte der Energiepolitik in Graubünden Fördermöglichkeiten
Mehr Sonnenenergie in Graubünden Fördermöglichkeiten Energie-Apéro 20.06.2007 Andrea Lötscher, Gliederung Energie heute Energie morgen Schwerpunkte der Energiepolitik in Graubünden Fördermöglichkeiten
Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz
 Der Wärmemarkt und das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Dr. jur. Volker Hoppenbrock, M.A. Ecologic-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Überblick Situation
Der Wärmemarkt und das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Dr. jur. Volker Hoppenbrock, M.A. Ecologic-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Überblick Situation
Information zum geplanten Wärmeverbund in der Einwohnergemeinde Cham. Markus Baumann, Gemeinderat Cham 5. März 2015
 Information zum geplanten Wärmeverbund in der Einwohnergemeinde Cham. Markus Baumann, Gemeinderat Cham 5. März 2015 Information zum geplanten Wärmeverbund in der Einwohnergemeinde Cham. Christoph Deiss,
Information zum geplanten Wärmeverbund in der Einwohnergemeinde Cham. Markus Baumann, Gemeinderat Cham 5. März 2015 Information zum geplanten Wärmeverbund in der Einwohnergemeinde Cham. Christoph Deiss,
Ansätze zur dezentralen Erschließung von Baugebieten
 Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau Ansätze zur dezentralen Erschließung von Baugebieten DIPLOMARBEIT Dresden, 03.12.2012 Ansätze zur Energieversorgung Primärenergieausnutzung
Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau Ansätze zur dezentralen Erschließung von Baugebieten DIPLOMARBEIT Dresden, 03.12.2012 Ansätze zur Energieversorgung Primärenergieausnutzung
Energiekonzept. Energieeffizienz in der Versorgung Grundlagen am Beispiel Nürnberg Vergleich von Versorgungsvarianten Kosten
 Energiekonzept. Energieeffizienz in der Versorgung Grundlagen am Beispiel Nürnberg Vergleich von Versorgungsvarianten Kosten Warum ein Energiekonzept? Ziel: kostengünstige und ressourcen-schonende Energieversorgung
Energiekonzept. Energieeffizienz in der Versorgung Grundlagen am Beispiel Nürnberg Vergleich von Versorgungsvarianten Kosten Warum ein Energiekonzept? Ziel: kostengünstige und ressourcen-schonende Energieversorgung
SCOP versus COP und JAZ
 SCOP versus COP und JAZ Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsrechnung Harry Grünenwald Geschäftsführer Grünenwald AG Grünenwald AG stellt sich vor Rechtsform Aktiengesellschaft Gründungsjahr 1989 Anzahl
SCOP versus COP und JAZ Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsrechnung Harry Grünenwald Geschäftsführer Grünenwald AG Grünenwald AG stellt sich vor Rechtsform Aktiengesellschaft Gründungsjahr 1989 Anzahl
Energiestrategie des Bundes Umsetzung im Kanton Schwyz
 Energiestrategie des Bundes Umsetzung im Kanton Schwyz Medienkonferenz 25.10.2012 Traktanden 1. Ausgangslage Bund 2. Ziele des Bundes, Energiestrategie 2050 4. Ziele des s für die kantonale Energiestrategie
Energiestrategie des Bundes Umsetzung im Kanton Schwyz Medienkonferenz 25.10.2012 Traktanden 1. Ausgangslage Bund 2. Ziele des Bundes, Energiestrategie 2050 4. Ziele des s für die kantonale Energiestrategie
Überblick: Speziell für Kunden mit Bedarf an neuer Wärme-, Kälte- bzw. Strominfrastruktur, die keine eigenen Investitionsmittel einsetzen wollen
 Energieliefer-Contracting Das Energieliefer-Contracting ist ein Dienstleistungsprodukt zur Deckung Ihres Wärme-, Kälte- und Strombedarfes. Innerhalb des Energieliefer-Contractings plant, errichtet und
Energieliefer-Contracting Das Energieliefer-Contracting ist ein Dienstleistungsprodukt zur Deckung Ihres Wärme-, Kälte- und Strombedarfes. Innerhalb des Energieliefer-Contractings plant, errichtet und
Energiemix und Selbstversorgung. Stadtwerke als dezentraler Versorger
 Unternehmensgruppe Stadtwerke Meiningen Städtische Abwasserentsorgung Meiningen Eigenbetrieb der Stadt Meiningen SWM Erneuerbare Energien GmbH konzernfrei regional mittelständisch Energiemix und Selbstversorgung
Unternehmensgruppe Stadtwerke Meiningen Städtische Abwasserentsorgung Meiningen Eigenbetrieb der Stadt Meiningen SWM Erneuerbare Energien GmbH konzernfrei regional mittelständisch Energiemix und Selbstversorgung
Änderung des Energiegesetzes
 Service de l'énergie SdE Informationssitzung Änderung des Energiegesetzes Suissetec Sektion Freiburg Donnerstag, 30 Januar 2014 Serge Boschung Dienstchef des Amts für Energie Direction de l'économie et
Service de l'énergie SdE Informationssitzung Änderung des Energiegesetzes Suissetec Sektion Freiburg Donnerstag, 30 Januar 2014 Serge Boschung Dienstchef des Amts für Energie Direction de l'économie et
Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG. Ersatzmaßnahmen
 Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisführung und ist der unteren Bauaufsicht
Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisführung und ist der unteren Bauaufsicht
Energieverbund Schlieren Abwärme als Energiequelle
 Energieverbund Schlieren Abwärme als Energiequelle 3,4 Mio. Liter Heizöl werden jährlich gespart, das entspricht einer CO 2 - Reduktion von 8 310 Tonnen. Synergien zwischen Wärme und Kälte nutzen In Zusammenarbeit
Energieverbund Schlieren Abwärme als Energiequelle 3,4 Mio. Liter Heizöl werden jährlich gespart, das entspricht einer CO 2 - Reduktion von 8 310 Tonnen. Synergien zwischen Wärme und Kälte nutzen In Zusammenarbeit
Die neue Stadt. Christian Erb, Halter Unternehmungen Blue-Tech 2011
 Die neue Stadt Chancen für die Immobilienbranche Christian Erb, Blue-Tech 2011 Die neue Stadt: Wo liegt die Herausforderung für die Immobilienbranche? Gebäude Mobilität 2 Gebäude: Gesamtbetrachtung ist
Die neue Stadt Chancen für die Immobilienbranche Christian Erb, Blue-Tech 2011 Die neue Stadt: Wo liegt die Herausforderung für die Immobilienbranche? Gebäude Mobilität 2 Gebäude: Gesamtbetrachtung ist
Wärmeversorgung Neuwerk-West / Eiderkaserne
 29.02.2016 Wärmeversorgung Neuwerk-West / Eiderkaserne 2 Agenda Kommunale Wärmeversorgung Wärmenetz Das Versorgungsgebiet Grundlagen Versorgungsvarianten und Eckdaten Zusammenfassung/CO 2 -Bilanzen 3 Das
29.02.2016 Wärmeversorgung Neuwerk-West / Eiderkaserne 2 Agenda Kommunale Wärmeversorgung Wärmenetz Das Versorgungsgebiet Grundlagen Versorgungsvarianten und Eckdaten Zusammenfassung/CO 2 -Bilanzen 3 Das
Fernwärme in Utting? Anlass diese Vortags: Die aktuelle Informationspolitik lenkt vom eigentlichen Thema ab. Ist Fernwärme für den Bürger günstiger?
 Fernwärme in Utting? Anlass diese Vortags: Die aktuelle Informationspolitik lenkt vom eigentlichen Thema ab. Ist Fernwärme für den Bürger günstiger? Was ist Fernwärme? Fernwärme (Definition) ist die Bezeichnung
Fernwärme in Utting? Anlass diese Vortags: Die aktuelle Informationspolitik lenkt vom eigentlichen Thema ab. Ist Fernwärme für den Bürger günstiger? Was ist Fernwärme? Fernwärme (Definition) ist die Bezeichnung
Fernwärme. Nah und Fernwärme Schweiz 12. Tagung vom 24. Januar 2013 in Biel-Bienne
 Fernwärme DIE KOMFORT-ENERGIE Zukunftsstrategie Fernwärme Schweiz Prof. Dr. Hanspeter Eicher VR Präsident Dr. Eicher + Pauli AG Erneuerbare und energieeffiziente Fernwärme als Teil der Energiestrategie
Fernwärme DIE KOMFORT-ENERGIE Zukunftsstrategie Fernwärme Schweiz Prof. Dr. Hanspeter Eicher VR Präsident Dr. Eicher + Pauli AG Erneuerbare und energieeffiziente Fernwärme als Teil der Energiestrategie
Trends in der Energie- und Gebäudetechnik
 Seite 1 Trends in der Energie- und Gebäudetechnik Dieter Többen, Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Eicher+Pauli Geschäftsstellen t in Bern, Liestal, Ki Kriens und dzüi Zürich Tochtergesellschaft Ingenieurbüro
Seite 1 Trends in der Energie- und Gebäudetechnik Dieter Többen, Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Eicher+Pauli Geschäftsstellen t in Bern, Liestal, Ki Kriens und dzüi Zürich Tochtergesellschaft Ingenieurbüro
ERFA Vorgehensberatung «Energieeinsparung bei der Gebäudemodernisierung»
 ERFA Vorgehensberatung «Energieeinsparung bei der Gebäudemodernisierung» Juni 2013, Silvia Gemperle, Leiterin Energie und Bauen Informationen Kanton St.Gallen 2 «Energiewende - St.Gallen kann es!» Initiative
ERFA Vorgehensberatung «Energieeinsparung bei der Gebäudemodernisierung» Juni 2013, Silvia Gemperle, Leiterin Energie und Bauen Informationen Kanton St.Gallen 2 «Energiewende - St.Gallen kann es!» Initiative
Versorgungsstrategie eines Energieversorgers. Stefan Meyre, Geschäftsleitung EKZ Marketing und Verkauf
 Versorgungsstrategie eines Energieversorgers Stefan Meyre, Geschäftsleitung EKZ Marketing und Verkauf Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) Eines der grössten Energieversorgungsunternehmen der
Versorgungsstrategie eines Energieversorgers Stefan Meyre, Geschäftsleitung EKZ Marketing und Verkauf Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) Eines der grössten Energieversorgungsunternehmen der
Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Informationen
 Klimaschutz und Energie Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Informationen Solarthermie Gasförmige Biomasse Die Bestimmungen in Kurzform Bei Neubauten besteht für die Bauherren eine Pflicht zur (zumindest
Klimaschutz und Energie Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Informationen Solarthermie Gasförmige Biomasse Die Bestimmungen in Kurzform Bei Neubauten besteht für die Bauherren eine Pflicht zur (zumindest
Änderungsentwurf des Energiegesetzes vom 9. Juni 2000 Februar 2011
 Änderungsentwurf des Energiegesetzes vom 9. Juni 000 Februar 0 Aktuelle Version Neue Version Art. Pflichten des Kantons und der Gemeinden Kanton und Gemeinden berücksichtigen überall bei ihrer gesetzgeberischen
Änderungsentwurf des Energiegesetzes vom 9. Juni 000 Februar 0 Aktuelle Version Neue Version Art. Pflichten des Kantons und der Gemeinden Kanton und Gemeinden berücksichtigen überall bei ihrer gesetzgeberischen
Individuell aus einer Hand
 Energiedienst- leistungen Individuell aus einer Hand Ihr Partner für umfassende Energiedienstleistungen Als national tätiger Anbieter von ökologisch sinnvollen Energielösungen streben wir eine nachhaltige
Energiedienst- leistungen Individuell aus einer Hand Ihr Partner für umfassende Energiedienstleistungen Als national tätiger Anbieter von ökologisch sinnvollen Energielösungen streben wir eine nachhaltige
Abwärmenutzung: Erfahrungsbericht aus einem Unternehmen. 16. August 2016, Schladen-Werda
 Abwärmenutzung: Erfahrungsbericht aus einem Unternehmen 16. August 2016, Schladen-Werda BS ENERGY Abwärme: Quellen, Nutzungsmöglichkeiten und Knackpunkte Abwärme im Braunschweiger Fernwärmenetz Konzept
Abwärmenutzung: Erfahrungsbericht aus einem Unternehmen 16. August 2016, Schladen-Werda BS ENERGY Abwärme: Quellen, Nutzungsmöglichkeiten und Knackpunkte Abwärme im Braunschweiger Fernwärmenetz Konzept
Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall
 FORTSCHREIBUNG Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Installierte Leistung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall Im Jahr betrugen die installierten Leistungen aus erneuerbaren
FORTSCHREIBUNG Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Installierte Leistung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall Im Jahr betrugen die installierten Leistungen aus erneuerbaren
Fernwärme Holzschnitzelfeuerung Fiesch. Informationsveranstaltung: Fiesch, Rondo
 Fernwärme Holzschnitzelfeuerung Fiesch Informationsveranstaltung: 12.12.2012 Fiesch, Rondo Funktionsweise eines Fernwärmenetzes.. Anschliesser (Privater, Gemeinde.) Anschliesser (Privater, Gemeinde.) Fernwärmezentrale
Fernwärme Holzschnitzelfeuerung Fiesch Informationsveranstaltung: 12.12.2012 Fiesch, Rondo Funktionsweise eines Fernwärmenetzes.. Anschliesser (Privater, Gemeinde.) Anschliesser (Privater, Gemeinde.) Fernwärmezentrale
Weissbuch VFS. Nah- und Fernwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien eine GIS Analyse. Hanspeter Eicher VR-Präsident Dr. Eicher+Pauli AG.
 Seite 1 Weissbuch VFS Nah- und Fernwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien eine GIS Analyse Hanspeter Eicher VR-Präsident Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Zielsetzungen Weissbuch VFS Lokalisierung von überbauten
Seite 1 Weissbuch VFS Nah- und Fernwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien eine GIS Analyse Hanspeter Eicher VR-Präsident Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Zielsetzungen Weissbuch VFS Lokalisierung von überbauten
Solarthermie - Gesetzliche Vorgaben
 Die Sonne nutzen Solarthermie für Heizung und Warmwasser" Solarthermie - Gesetzliche Vorgaben Dipl. Ing. Britta Neumann Stadt Freiburg Seite 1 Baurechtliche Aspekte Anlagen zur photovoltaischen und thermischen
Die Sonne nutzen Solarthermie für Heizung und Warmwasser" Solarthermie - Gesetzliche Vorgaben Dipl. Ing. Britta Neumann Stadt Freiburg Seite 1 Baurechtliche Aspekte Anlagen zur photovoltaischen und thermischen
Stromerzeugen mit BHKW. Heizen und Kühlen mit der Kraft der Sonne. Projektpräsentation der technischen Lösung
 Stromerzeugen mit BHKW. Heizen und Kühlen mit der Kraft der Sonne. Energie sparen. Kosten senken. Ertrag steigern. Das patentierte aeteba SolarCooling System Projektpräsentation der technischen Lösung
Stromerzeugen mit BHKW. Heizen und Kühlen mit der Kraft der Sonne. Energie sparen. Kosten senken. Ertrag steigern. Das patentierte aeteba SolarCooling System Projektpräsentation der technischen Lösung
Emissionsreduktion durch smarte kommunale Wärmeversorgung Uwe Mietrasch Stadtwerke Zehdenick GmbH
 Jahresveranstaltung des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) Neue Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung innovative Ansätze zur Zukunftsgestaltung aus Brandenburg Emissionsreduktion
Jahresveranstaltung des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) Neue Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung innovative Ansätze zur Zukunftsgestaltung aus Brandenburg Emissionsreduktion
FKT Fachtagung Lünen EnEV 2007 und Energieausweise in Nichtwohngebäuden. Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf Öko-Zentrum NRW
 FKT Fachtagung Lünen - 28.2.2008 EnEV 2007 und Energieausweise in Nichtwohngebäuden Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf Öko-Zentrum NRW Einführung Leistungsprofil Weiterbildungen - Gebäudeenergieberatung
FKT Fachtagung Lünen - 28.2.2008 EnEV 2007 und Energieausweise in Nichtwohngebäuden Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf Öko-Zentrum NRW Einführung Leistungsprofil Weiterbildungen - Gebäudeenergieberatung
Der Regierungsrat legt die Einzelheiten und bei kleineren Eingriffen die Anforderungen für die neu zu erstellenden Bauteile in der Verordnung fest.
 7. Gesetz über die Energienutzung vom 0. März 004 (Stand. Januar 0). Allgemeine Bestimmungen Zweck Dieses Gesetz bezweckt:. Förderung einer sparsamen und rationellen Energienutzung;. Förderung der Nutzung
7. Gesetz über die Energienutzung vom 0. März 004 (Stand. Januar 0). Allgemeine Bestimmungen Zweck Dieses Gesetz bezweckt:. Förderung einer sparsamen und rationellen Energienutzung;. Förderung der Nutzung
Anergienetze und Wärmepumpen. Marco Nani
 Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
Florian Buchter Leiter Energieeffizienz Groupe E AG. Energy Forum Valais/Wallis 2014 17.06.2014 HES-SO Valais-Wallis Siders
 DIE ENERGIEEFFIZIENZ IM DIENSTE DER UNTERNEHMEN KONKRETE BEISPIELE Florian Buchter Leiter Energieeffizienz AG Energy Forum Valais/Wallis 2014 17.06.2014 HES-SO Valais-Wallis Siders GROUPE E Energie- und
DIE ENERGIEEFFIZIENZ IM DIENSTE DER UNTERNEHMEN KONKRETE BEISPIELE Florian Buchter Leiter Energieeffizienz AG Energy Forum Valais/Wallis 2014 17.06.2014 HES-SO Valais-Wallis Siders GROUPE E Energie- und
Ulrich Ahlke Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Inhalte des Vortrages Der Zukunftskreis Netzwerke energieland 2050: der strategische Ansatz Masterplan 100 % Klimaschutz Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten Fazit Der Zukunftskreis Gesamtfläche: 1.793
Inhalte des Vortrages Der Zukunftskreis Netzwerke energieland 2050: der strategische Ansatz Masterplan 100 % Klimaschutz Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten Fazit Der Zukunftskreis Gesamtfläche: 1.793
Oberflächennahe Geothermie/thermische Nutzung des Untergrundes in der Hansestadt Rostock
 Oberflächennahe Geothermie/thermische Nutzung des Untergrundes in der Hansestadt Rostock Technik/Philosophie CO 2 -Einsparung mit erdgekoppelter WP? Wirtschaftliches Potenzial Anlagenbeispiele Gründung:
Oberflächennahe Geothermie/thermische Nutzung des Untergrundes in der Hansestadt Rostock Technik/Philosophie CO 2 -Einsparung mit erdgekoppelter WP? Wirtschaftliches Potenzial Anlagenbeispiele Gründung:
Kühlung durch Wärme? Doch, das geht!
 Kühlung durch Wärme? Doch, das geht! (Ein)blick ins Rechenzentrum der SW Schönebeck. Kälte aus Kraft-Wärme-Kopplung für die IT-Infrastruktur DRZP in Darmstadt, 19./20.04.2016 Schönebeck an der Elbe, im
Kühlung durch Wärme? Doch, das geht! (Ein)blick ins Rechenzentrum der SW Schönebeck. Kälte aus Kraft-Wärme-Kopplung für die IT-Infrastruktur DRZP in Darmstadt, 19./20.04.2016 Schönebeck an der Elbe, im
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach. Ziele und Aktivitätenprogramm. Energieteamsitzung am
 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach Energieteamsitzung am 06.11.2012 Ziele und Aktivitätenprogramm 1 Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1. 2. Arbeitsschritte bei der Konzepterstellung
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach Energieteamsitzung am 06.11.2012 Ziele und Aktivitätenprogramm 1 Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1. 2. Arbeitsschritte bei der Konzepterstellung
In diesem Zusammenhang werden folgende Fragen an den Stadtrat gestellt:
 Schriftliche Anfrage vom 10. Juli 2008 08.08 der GP-Fraktion betreffend Energiebuchhaltung von öffentlichen Gebäuden Wortlaut der Anfrage Die Liegenschaftsabteilung führt eine Energiebuchhaltung der öffentlichen
Schriftliche Anfrage vom 10. Juli 2008 08.08 der GP-Fraktion betreffend Energiebuchhaltung von öffentlichen Gebäuden Wortlaut der Anfrage Die Liegenschaftsabteilung führt eine Energiebuchhaltung der öffentlichen
Nachweisführung nach 10 EEWärmeG / Ersatzmaßnahmen
 Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG / Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG / Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der
Wärmeversorgung Graz 2020/30
 Wärmeversorgung Graz 2020/30 6. Juni 2016 Dipl.-Ing. Boris Papousek Anforderungen an die Fernwärme Versorgungs sicherheit Leistbarkeit Verträglichkeit für Umwelt & Klima Übersicht Fernwärme-Einspeisestellen
Wärmeversorgung Graz 2020/30 6. Juni 2016 Dipl.-Ing. Boris Papousek Anforderungen an die Fernwärme Versorgungs sicherheit Leistbarkeit Verträglichkeit für Umwelt & Klima Übersicht Fernwärme-Einspeisestellen
Wärme und Strom von der Sonne Messe Bauen-Modernisieren, Zürich 4./5. September 2015
 Wärme und Strom von der Sonne Messe Bauen-Modernisieren, Zürich 4./5. September 2015 Adrian Kottmann BE Netz AG Ebikon Luzern 1 Vorstellung Aufgaben: Interessenvertretung der schweizerischen Solarbranche
Wärme und Strom von der Sonne Messe Bauen-Modernisieren, Zürich 4./5. September 2015 Adrian Kottmann BE Netz AG Ebikon Luzern 1 Vorstellung Aufgaben: Interessenvertretung der schweizerischen Solarbranche
Tücken der MuKEn 2014 & weitere Herausforderungen. Beat Gasser Leiter Technik
 Tücken der MuKEn 2014 & weitere Herausforderungen Beat Gasser Leiter Technik Gebäudebestand bis 1975 740 MJ/m2a 100% um 2005 370 MJ/m2a 50% Minergie100 MJ/m2a 20% Quelle: AWEL Kt. Zürich Begriffe MuKEn
Tücken der MuKEn 2014 & weitere Herausforderungen Beat Gasser Leiter Technik Gebäudebestand bis 1975 740 MJ/m2a 100% um 2005 370 MJ/m2a 50% Minergie100 MJ/m2a 20% Quelle: AWEL Kt. Zürich Begriffe MuKEn
Dorfkorporation Bazenheid FERNWÄRME BAZENHEID REGIONAL ERNEUERBAR NACHHALTIG
 Dorfkorporation Bazenheid FERNWÄRME BAZENHEID REGIONAL ERNEUERBAR NACHHALTIG CHANCE FÜR DIE REGION EIN NACHHALTIGES KONZEPT JA, DAS ANGEBOT INTERESSIERT MICH Die Interessengemeinschaft Fernwärme Kirchberg-Wil
Dorfkorporation Bazenheid FERNWÄRME BAZENHEID REGIONAL ERNEUERBAR NACHHALTIG CHANCE FÜR DIE REGION EIN NACHHALTIGES KONZEPT JA, DAS ANGEBOT INTERESSIERT MICH Die Interessengemeinschaft Fernwärme Kirchberg-Wil
Kaminfegertagung 2013 Aus- und Weiterbildungskurs Energiestadt Energiegesetzgebung Kant. Energiepolitik und Förderprogramm
 Kaminfegertagung 2013 Aus- und Weiterbildungskurs Energiestadt Energiegesetzgebung Kant. Energiepolitik und Förderprogramm 7. August 2013 Andrea Eberhard, StV. Leiterin Sektion Energieeffizienz Wir haben
Kaminfegertagung 2013 Aus- und Weiterbildungskurs Energiestadt Energiegesetzgebung Kant. Energiepolitik und Förderprogramm 7. August 2013 Andrea Eberhard, StV. Leiterin Sektion Energieeffizienz Wir haben
WKK Schweiz - Potenzial und Wirtschaftlichkeit
 WKK Schweiz - Potenzial und Wirtschaftlichkeit Inhalt Ausgangslage Ziele / Vorgehen Resultate Schlussfolgerungen Seite 2 Ausgangslage Bundesrat und Parlament haben beschlossen, bis 25 aus der Atomenergie
WKK Schweiz - Potenzial und Wirtschaftlichkeit Inhalt Ausgangslage Ziele / Vorgehen Resultate Schlussfolgerungen Seite 2 Ausgangslage Bundesrat und Parlament haben beschlossen, bis 25 aus der Atomenergie
Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen
 1 741.111-A1 Anhang 1 zu Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 (Stand 01.09.2016) Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen Grenzwerte U li in W/(m 2 K) Bauteil Bauteil gegen opake Bauteile
1 741.111-A1 Anhang 1 zu Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 (Stand 01.09.2016) Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen Grenzwerte U li in W/(m 2 K) Bauteil Bauteil gegen opake Bauteile
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung
 Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Ökobilanzdaten 2015 der Fernwärme aus der Energiezentrale
 12.02.2016 Ökobilanzdaten 2015 der Fernwärme aus der Energiezentrale Forsthaus 1. Geltungsbereich In den Ökobilanzdaten 2015 ist die in der Energiezentrale Forsthaus produzierte Wärme in Bezug auf die
12.02.2016 Ökobilanzdaten 2015 der Fernwärme aus der Energiezentrale Forsthaus 1. Geltungsbereich In den Ökobilanzdaten 2015 ist die in der Energiezentrale Forsthaus produzierte Wärme in Bezug auf die
Wärmenutzung aus Biogasanlagen und Bioenergiedörfer eine Bestandsaufnahme für Baden-Württemberg
 Wärmenutzung aus Biogasanlagen und Bioenergiedörfer eine Bestandsaufnahme für Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien
Wärmenutzung aus Biogasanlagen und Bioenergiedörfer eine Bestandsaufnahme für Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien
Gesetze und Verordnungen
 Gesetze und Verordnungen Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt großen Wert auf Klimaschutz und Energieeinsparung. Deshalb ist der Einsatz von Erneuerbaren Energien im Bestand und im Neubau
Gesetze und Verordnungen Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt großen Wert auf Klimaschutz und Energieeinsparung. Deshalb ist der Einsatz von Erneuerbaren Energien im Bestand und im Neubau
Energiegesetz Art. 18a Grossverbraucher Die drei Vollzugsvarianten: Beschrieb und Entscheidungshilfe
 Service de l'énergie SdE Amt für Energie AfE Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg T +41 26 305 28 41, F +41 26 305 28 48 www.fr.ch/sde Energiegesetz Art. 18a Grossverbraucher Die drei Vollzugsvarianten:
Service de l'énergie SdE Amt für Energie AfE Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg T +41 26 305 28 41, F +41 26 305 28 48 www.fr.ch/sde Energiegesetz Art. 18a Grossverbraucher Die drei Vollzugsvarianten:
Verfahren bei der Konzessionierung von Kleinwasserkraftwerken (KWKW)
 Baudepartement Verfahren bei der Konzessionierung von Kleinwasserkraftwerken (KWKW) Vorgehensweise und gesetzliche Rahmenbedingungen bei der Verwirklichung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien
Baudepartement Verfahren bei der Konzessionierung von Kleinwasserkraftwerken (KWKW) Vorgehensweise und gesetzliche Rahmenbedingungen bei der Verwirklichung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien
VERTEILERSCHLÜSSEL RICHTIG ANWENDEN
 VERTEILERSCHLÜSSEL RICHTIG ANWENDEN Kriterien und fachliche Empfehlungen Grund- und Verbrauchskosten Typische Verteilung in der Heizkostenabrechnung 2 Sonderfall mit 30:70-Pflicht 7 Abs.1 der Heizkostenverordnung
VERTEILERSCHLÜSSEL RICHTIG ANWENDEN Kriterien und fachliche Empfehlungen Grund- und Verbrauchskosten Typische Verteilung in der Heizkostenabrechnung 2 Sonderfall mit 30:70-Pflicht 7 Abs.1 der Heizkostenverordnung
Kurzvorstellung durch. EOR-Forum 2009. EOR-Forum 2009 Vergleich zentrale u. dezentrale Wärmeversorgung für ein Neubaugebiet
 Vergleich von zentraler und dezentraler Wärmeversorgung in einem Neubaugebiet Beispiel Neubaugebiet Rosenstraße in Haßloch im Auftrag des Ministeriums für Finanzen Rheinland-Pfalz Kurzvorstellung durch
Vergleich von zentraler und dezentraler Wärmeversorgung in einem Neubaugebiet Beispiel Neubaugebiet Rosenstraße in Haßloch im Auftrag des Ministeriums für Finanzen Rheinland-Pfalz Kurzvorstellung durch
Energiecontracting als Geschäftsmodell
 Energiecontracting als Geschäftsmodell enercity Contracting GmbH Glockseestraße 33 30169 Hannover Corinna Kleimann Geschäftsführerin Tel.: 0511/430-2372 E-Mail: corinna.kleimann@enercitycontracting.de
Energiecontracting als Geschäftsmodell enercity Contracting GmbH Glockseestraße 33 30169 Hannover Corinna Kleimann Geschäftsführerin Tel.: 0511/430-2372 E-Mail: corinna.kleimann@enercitycontracting.de
Die öffentliche Energieberatung
 Infoabend Dienstag 13. September 2011 Energieeffizienz in kirchlichen Gebäuden Die öffentliche Energieberatung Referat I Rolf Leuenberger I öffentliche regionale Energieberatungsstelle des Kantons Bern
Infoabend Dienstag 13. September 2011 Energieeffizienz in kirchlichen Gebäuden Die öffentliche Energieberatung Referat I Rolf Leuenberger I öffentliche regionale Energieberatungsstelle des Kantons Bern
WEITSICHTIGE LÖSUNGEN. Nachhaltiges Bauen. Bild: Umnutzung eines Öltanks in Helsinki Pöyry Finnland
 WEITSICHTIGE LÖSUNGEN Nachhaltiges Bauen Bild: Umnutzung eines Öltanks in Helsinki Pöyry Finnland Wir betrachten das Gebäude als Gesamtsystem und stellen die Weichen für ein gesundes Leben. Bei der Konzipierung
WEITSICHTIGE LÖSUNGEN Nachhaltiges Bauen Bild: Umnutzung eines Öltanks in Helsinki Pöyry Finnland Wir betrachten das Gebäude als Gesamtsystem und stellen die Weichen für ein gesundes Leben. Bei der Konzipierung
Der Weg zur Nahwärmeversorgung 5 Schritte zum eigenen Nahwärmenetz
 8. Bayerisches Energieforum Garching Der Weg zur Nahwärmeversorgung 5 Schritte zum eigenen Nahwärmenetz Knecht Ingenieure GmbH Dipl. Ing. Thomas Knecht Im Öschle 10 87499 Wildpoldsried Tel.: 08304/929305-0
8. Bayerisches Energieforum Garching Der Weg zur Nahwärmeversorgung 5 Schritte zum eigenen Nahwärmenetz Knecht Ingenieure GmbH Dipl. Ing. Thomas Knecht Im Öschle 10 87499 Wildpoldsried Tel.: 08304/929305-0
Oliver Zadow. Kurzvita
 Kurzvita Oliver Zadow Beruflicher Werdegang seit 2010 Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen wissenschaftlicher Mitarbeiter seit 2010 Hochschule München Fakultät
Kurzvita Oliver Zadow Beruflicher Werdegang seit 2010 Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen wissenschaftlicher Mitarbeiter seit 2010 Hochschule München Fakultät
Was hat das Thema Heizung in der Raumplanung verloren?
 Was hat das Thema Heizung in der Raumplanung verloren? Markus Dittli 22. September 2010 Referent Markus Dittli, 46 Jahre, Altdorf Dipl. Ing. FH, Eidg. Dipl. Energieberater Master of Business Studies FH
Was hat das Thema Heizung in der Raumplanung verloren? Markus Dittli 22. September 2010 Referent Markus Dittli, 46 Jahre, Altdorf Dipl. Ing. FH, Eidg. Dipl. Energieberater Master of Business Studies FH
Daniel Tschopp. Stadt:Werk:Lehen - Wärmebereitstellung für Niedertemperaturnetz mit Solaranlage und speicherintegrierter Wärmepumpe
 Stadt:Werk:Lehen - Wärmebereitstellung für Niedertemperaturnetz mit Solaranlage und speicherintegrierter Wärmepumpe qm heizwerke Fachtagung Wärmenetze der Zukunft 03.06.2016 Daniel Tschopp AEE Institut
Stadt:Werk:Lehen - Wärmebereitstellung für Niedertemperaturnetz mit Solaranlage und speicherintegrierter Wärmepumpe qm heizwerke Fachtagung Wärmenetze der Zukunft 03.06.2016 Daniel Tschopp AEE Institut
Produkte und Services
 Produkte und Services meinstrom Wir brauchen Energie. Jeden Tag. Und jeder ein wenig anders. Daher stehen Ihnen für verschiedenste Lebensbedürfnisse drei hochwertige Stromprodukte zur Auswahl, die alle
Produkte und Services meinstrom Wir brauchen Energie. Jeden Tag. Und jeder ein wenig anders. Daher stehen Ihnen für verschiedenste Lebensbedürfnisse drei hochwertige Stromprodukte zur Auswahl, die alle
BayWa. Wärmelieferung. Komplettlösungen aus einer Hand. Ein Unternehmen der BayWa AG, München
 BayWa Contracting & Wärmelieferung Komplettlösungen aus einer Hand BayWa Energie Dienstleistungs GmbH Ein Unternehmen der BayWa AG, München Contracting - der Ursprung James Watt, 1736 1819: Die für die
BayWa Contracting & Wärmelieferung Komplettlösungen aus einer Hand BayWa Energie Dienstleistungs GmbH Ein Unternehmen der BayWa AG, München Contracting - der Ursprung James Watt, 1736 1819: Die für die
Interpellation Susanne Hochuli, Reitnau, vom 20. Mai 2008 betreffend unnötige Ausgaben für das Heizen von kantonalen Gebäuden, Beantwortung
 Regierungsrat Interpellation Susanne Hochuli, Reitnau, vom 20. Mai 2008 betreffend unnötige Ausgaben für das Heizen von kantonalen Gebäuden, Beantwortung Aarau, 13. August 2008 08.135 I. Text und Begründung
Regierungsrat Interpellation Susanne Hochuli, Reitnau, vom 20. Mai 2008 betreffend unnötige Ausgaben für das Heizen von kantonalen Gebäuden, Beantwortung Aarau, 13. August 2008 08.135 I. Text und Begründung
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen Technische Universität München Dipl.-Ing. Oliver Zadow
 Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen Technische Universität München Dipl.-Ing. Oliver Zadow Gemeindewerke Neues Gewerbegebiet Kommunale Liegenschaften Nahwärmenetz Biogasanlage Nachverdichtung Sanierung
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen Technische Universität München Dipl.-Ing. Oliver Zadow Gemeindewerke Neues Gewerbegebiet Kommunale Liegenschaften Nahwärmenetz Biogasanlage Nachverdichtung Sanierung
Die Blumensiedlung. Vogelperspektive: Teil der Blumensiedlung, bing.com, Luftbild vor 2012
 Die Blumensiedlung 1 Vogelperspektive: Teil der Blumensiedlung, bing.com, Luftbild vor 2012 Zusammenfassung Gebäude BEDARF - 1.000 Gebäude bzw. 1.600 Wohneinheiten, 3.800 Einwohner - Wohnviertel mit einzelnen
Die Blumensiedlung 1 Vogelperspektive: Teil der Blumensiedlung, bing.com, Luftbild vor 2012 Zusammenfassung Gebäude BEDARF - 1.000 Gebäude bzw. 1.600 Wohneinheiten, 3.800 Einwohner - Wohnviertel mit einzelnen
Technischer Masterplan Universitätsspital Bern
 Seite 1 Technischer Masterplan Universitätsspital Bern Dieter Többen, CEO Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Dr. Eicher+Pauli AG Kernkompetenzen Strategische Planung Energietechnik Gebäudetechnik Fakten Planer
Seite 1 Technischer Masterplan Universitätsspital Bern Dieter Többen, CEO Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Dr. Eicher+Pauli AG Kernkompetenzen Strategische Planung Energietechnik Gebäudetechnik Fakten Planer
Erfahrungen mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg
 Berliner Energietage 2009 Fachgespräch EEWärmeG: Spielräume für Landesgesetze zum Klimaschutz Erfahrungen mit dem Baden-Württemberg Gregor Stephani Umweltministerium Baden-Württemberg Referatsleiter Grundsatzfragen
Berliner Energietage 2009 Fachgespräch EEWärmeG: Spielräume für Landesgesetze zum Klimaschutz Erfahrungen mit dem Baden-Württemberg Gregor Stephani Umweltministerium Baden-Württemberg Referatsleiter Grundsatzfragen
Heizungs- und Sanitäranlagen. Industrie- und Werkleitungsbau.
 Heizungs- und Sanitäranlagen. Industrie- und Werkleitungsbau. Wärme und Wasser sind Grundbedürfnisse des Menschen, die wir durch Fachkompetenz und Erfahrung in hoher Qualität ins Haus bringen. Wir entwickeln
Heizungs- und Sanitäranlagen. Industrie- und Werkleitungsbau. Wärme und Wasser sind Grundbedürfnisse des Menschen, die wir durch Fachkompetenz und Erfahrung in hoher Qualität ins Haus bringen. Wir entwickeln
Klimaschutzkonzept Energie- & CO 2 -Bilanz Potenzialanalyse
 Klimaschutzkonzept Energie- & CO 2 -Bilanz Potenzialanalyse Planungs- & Umweltausschuss 22. April 2015 Prof. Dr.-Ing. Isabel Kuperjans FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUT NOWUM-ENERGY FACHBEREICH
Klimaschutzkonzept Energie- & CO 2 -Bilanz Potenzialanalyse Planungs- & Umweltausschuss 22. April 2015 Prof. Dr.-Ing. Isabel Kuperjans FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUT NOWUM-ENERGY FACHBEREICH
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) in der Wurstwarenindustrie. Limón Case Study Lebensmittelverarbeitung Rack und Rüther GmbH
 Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) in der Wurstwarenindustrie Limón GmbH 09.12.2014 1 Unternehmen Standort Branche Produkte Rack & Rüther GmbH Fuldabrück, Deutschland Fleischverarbeitung Hessische Wurstspezialitäten
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) in der Wurstwarenindustrie Limón GmbH 09.12.2014 1 Unternehmen Standort Branche Produkte Rack & Rüther GmbH Fuldabrück, Deutschland Fleischverarbeitung Hessische Wurstspezialitäten
