Eccremocactus bradei Britton et Rose
|
|
|
- Jan Huber
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Eccremocactus bradei Britton et Rose bradei, nach Brade, dem Entdecker der Art Literatur Eccremocactus bradei Britton N. L. & Rose J. N. in Contr. U. S. Nat. Herb. XVI/9 1913, S. 262 u. Abb. Taf. 83. Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIII 1913, S Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 204 u. Abb. Taf. XX. Haselton S. E. Epiphyllum Handbook 1946, S. 125 u. Abb. S Kimnach M. and Hutchison P. C. in Cact. Succ. Journ. Am. XXVIII, 1956, S u. Abb. Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 756 u. Abb. Phyllocactus bradei (Br. & R.) Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIII 1913, S Berger A. Kakteen 1929, S Diagnose nach N. L. Britton und J, N. Rose l. c.: Joints 15 to 30 cm long, 5 to 10 cm broad, light dull green, fiat, but the central axis somewhat elevated on both sides, the margins shallowly crenate, with small spine bearing areoles in the sinuses; spines solitary or in twos or threes, dark brown, 6 mm long or less; flowers about 5 cm long; outer perianth segments pale yellow, the inner white, the tube nearly as long as the limb; fruit juicy, 2,5 to 4 cm long, somewhat 5 ribbed, the ribs undulate; seeds 1,5 mm long. Beschreibung K ö r p e r epiphytisch auf Bäumen wachsend, hängend, in Kultur aufrecht oder aufsteigend, gegliedert, vieltriebig; Triebe flach und dicklich, cm lang, 5 10 cm breit, hell Krainz, Die Kakteen, 1. VI C II b
2 matt grün, flach, mit beidseitig etwas hervortretender Zentralachse; Ränder flach gekerbt, mit klei nen, stacheltragenden Areolen in den Einbuchtungen. S t a c h e l n einzeln, zu zweit oder zu dritt, dunkelbraun, 6 mm lang oder kürzer, in der Kultur meistens verschwindend. B l ü t e n sich sehr langsam aus den oberen Areolen der Triebe entwickelnd; einzeln, trich terförmig, etwas asymmetrisch, 5 7 cm lang. P e r i c a r p e l l durch die verlängerten Höcker gekantet, deren Areolen dicke, eiförmige, purpurrote Schuppen und kurze Haare tragen. R e c e p t a c u l u m kurz, 1 cm lang, fast zylindrisch, mit kleinen, etwas abstehenden Schuppen und ohne Stacheln. Äußerste H ü l l b l ä t t e r dick, leuchtend rosa; äußere dünner, länglich, abgestumpft, gerundet, rosaweiß bis fahlgelb; innere länglich, stumpf; die innersten spitzlich, weiß; 3 3,5 cm lang. Schlund kurz und breit, von den Staubblättern ausgefüllt; diese wie der Griffel eingeschlossen. S t a u b f ä d e n sehr dünn, zart, weiß, stark gekrümmt. S t a u b b e u t e l weiß. G r i f f e l schlank, fast weiß, oben etwas rosarötlich, kahl, verlängert. N a r b e n 8. F r u c h t saftig, karminrot, länglich, mit wenigen, stachellosen Areolen; 2,5 4 cm lang, schwach 5 rippig, mit gewellten Rippen. S a m e n zahlreich, klein, 1,5 mm lang, 1 mm breit, länglich bis mützenförmig mit basalem, schmalem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa schwarz, flachwarzig mit Zwischengrübchen. Heimat Typstandort: Cerro Turruvares, bei Orotina (ehemaliges Santo Domingo de San Mateo), auf 200 m ü. M. Allgemeine Verbreitung: in den dichten Niederungswäldern von Costa Rica. Kultur wie Epiphyllum, in feuchtwarmem Klima bei Halbschatten in recht humosem, durchlässigem Substrat. Im Winter nicht unter 16 C. Bemerkungen Meist nur in Botanischen Gärten anzutreffende Pflanze. Die Blüten öffnen sich selten ganz und schließen sich am folgenden Morgen wieder; sie dauern also nur eine Nacht. Aus den gleichen Areolen können sich mehrmals Blüten entwickeln. Photo: P. C. Hutchison, U.C.B.G Abb. etwa 1 : 1. C II b Krainz, Die Kakteen, 1. VI. 1964
3 Gattung Echinocactus Link et Otto 1827, in Verh. Ver. Beförd. Gartenb. K. Preuss. 3, S gr. echinos = Igel, also Igelkaktus U. Fam. C. Cereoideae, Tribus VIII Echinocacteae, Subtrib. a. Echinocactinae Echinocactus gusonii, im Vordergrund Polster von Ferocactus robustus im Jardin Exotique (Monaco). Diagnose nach Link et Otto l. c.: Caulis aphyllus, simplex, globosus, ovalis, aut oblongus, sulcis profundis et costis alternantibus. Costae e tuberculis (ramis) confluentibus, in apice spinarum fasciculo insignitae, saepe lanugine cinctae. Cephalium nullum. Flores e vertice caulis. Involucrum tubulosum, e bracteis imbricatis concretum, cum germine et calyce connatum. Calyx superus, interiorem paginam involucri sistens. Corolla polypetala, calyci inserta. Stamina numerosa, calyci inserta. Stylus 1. Stigma 10 et multipartitum. Fructus ignotus. Leitart: Echinocactus platyacanthus Link et Otto *) * LINK und OTTO haben eine Leitart nicht angegeben; da sie aber nur von E. tenuispinus und E. platyacanthus die Blüte gekannt haben, im letzten Absatz ihrer Abhandlung aber erklären, daß E. tenuispinus wahrscheinlich zu Cereus zu überstellen sein würde und daher nur E. platyacanthus und 7 andere Arten, die sie nicht genauer kannten, bei Echinocactus bleiben würden, erwählen BRITTON und ROSE Echinocactus platyacanthus als Leit art. Seither wird die Gattung in diesem Sinne gebraucht. Es erscheint aber darum notwendig, auch die BRITTON ROSE sche Beschreibung anzuführen, die die Grundlage für den Gebrauch des Gattungsnamen ist. Krainz, Die Kakteen, 1. VIII C VIII a
4 nach Britton und Rose 1922 in The Cactaceae Bd. III, S. 166: Plants very large, thick, cylindric and many ribbed, or low and several ribbed, the top clothed with a dense mass of wool or nearly naked; areoles very spiny, large, those on the upper part of old plants sometimes united; flowers from the crown of the plant, often partly hidden by the dense wool at the top, these usually yellow, rarely pink, of medium size; outer perianth segments narrow, sometimes terminating in pungent tips; inner perianth segments, oblong, thinner than the outer, the inner ones obtuse; scales on the ovary small, often linear, their axils filled with matted wool; fruit densely covered with white wool, thin walled, oblong; seeds blackish, smooth, shining, or rarely papilose, with a small subbasal hilum. Beschreibung K ö r p e r: Meist sehr große, aus faserigem W u r z e l system entspringende, einfache, bei E. polycephalus aber bis zu 30 Köpfen vom Grund aus verzweigte Kurzsäulen oder Kugel formen oder (UG. Homalocephala) flach scheibenförmige oder flachkugelige Körper (Vgl. Mor phologie Abb. 20, S. 13) von bis zu 30 cm Durchmesser, meist mit sehr zahlreichen, durch tiefe Rinnen getrennten, mitunter gehöckerten R i p p e n. Die in der Jugend sehr reich wollhaarigen A r e o l e n sind bei den meisten Arten über den Areolenvegetationspunkt hinaus nach oben in eine Grube verlängert, so daß sie bei alten Exemplaren oft ineinander übergehen und der Wollfilz den ganzen Scheitel erfüllt (Vgl. Morphologie S. 6 Abb. 7 und S. 12 Abb. 18). Seltener fehlt diese Wollbedeckung des Scheitels. Die B e s t a c h e l u n g ist außerordentlich stark, entwickelt sich in vielen Fällen aber erst in einigem Abstand von der Scheitelgrube. Die Dornen sind oft etwas abgeplattet, gewöhnlich quergestreift, oft sehr bunt. Die B l ü t e n entspringen in der Nähe der Scheitelgrube, wo eine solche ausgebildet ist, aus der Wollkappe des Scheitels, in der sie tief versenkt stehen. Äußerlich sind die meist gel ben, in der UG. Homalocephala rosenfarbenen Blüten glockig bis glockig trichterig. P e r i c a r p e l l und R e c e p t a c u l u m bilden eine ineinander übergehende Einheit, die ent weder ein sehr dickwandiges Receptaculum bildet oder zusammen mit dem Pericarpell einen kreiselförmigen, nur in der Nektarrinne vertieften Körper darstellt, in dessen schmalem unterem Ende die Fruchtknotenbildung liegt.*) Pericarpell und Receptaculum sind dicht mit länglichen, in einen stechend trockenhäutigen Abschnitt auslaufenden Schuppen bedeckt, die vom Pericarpell, an dem fast nur der trockene Abschnitt ausgebildet ist bis zu den großen, doch immer noch stechend trockenspitzigen äußeren Blütenhüllblättern allmählich an Größe zunehmen. Aus den Achseln der Schuppen entspringen dichte und lange Wollmassen, die oft die Schuppen vollkommen verdecken. Auch die weiteren, am vorderen Rand oft gezähnelten oder tief gefransten B l ü t e n h ü l l blätter tragen noch ein Stachelspitzchen, nur das Spitzchen der innersten ist nicht mehr trocken. Die Innenseite des R e c e p t a c u l u m bzw. die Oberseite des von diesem gebildeten kreiselförmigen Körpers ist von einer mehr oder weniger tiefen N e k t a r r i n n e an bis zum Ansatz der innersten Blütenhüllblätter gleichmäßig und dicht mit annähernd gleich langen S t a u b b l ä t t e r n besetzt. Der diese überragende, stabförmige, dicke G r i f f e l nimmt gegen die Narbe an Dicke noch zu und zeigt eine von den Narbenästen bis fast an die Basis reichende, die einzelnen Carpelle begrenzende Rillenstruktur. Die 10 bis mehr linealen N a r b e n äste stehen ± aufrecht bis etwas zusammengeneigt oder spreizen. Die S a m e n a n l a g e n stehen gewöhnlich auf gebüschelten einfachen kurzen Samensträngen, doch kommen dazwischen auch echt verzweigte Samenstränge vor. Die F r ü c h t e sind dicht wollig, dünn- und trockenwandig und durch Abbrechen an der Basis offen, nur bei E. (UG. Homalocephala) texensis verkahlen sie, werden fleischig und platzen oft unregelmäßig auf. *) SCHUMANN s Ausdruck (für E. grusonii auf S. 314 und für E. ingens auf S. 316 seiner Gesamtbeschreibung ) Fruchtknoten kreiselförmig ist also, abgesehen von dem damals gebräuchlichen Ausdruck Fruchtknoten für den morphologisch korrekten Pericarpell, falsch, da das kreiselförmige Gebilde auch das Receptaculum umfaßt. C VIII a Krainz, Die Kakteen, 1. VIII. 1962
5 Gattung Echinocactus Abb. 1. Echinocactus platyacanthus ( grandis ) Gesamtansicht der Blüte. Abb. 2. Echinocactus platyacanthus, Blütenlängsschnitt Abb. 3. Echinocactus grusonii Knospe kurz vor dem Aufblühen. Abb. 4. Echinocactus grusonii, Schnitt durch den unteren Teil einer Knospe mit (links) eingetragenem Gefäßbündelverlauf. Abb. 5. Echinocactus (UG. Homalocephala) texensis, Blüte. Abb. 7. Vereinzelt vorkommende echte Verzweigung des Samenstranges bei Echinocactus grusonii. Abb. 6. Echinocactus (UG. Homalocephala) texensis, Blütenschnitt Krainz, Die Kakteen, 1. VIII C VIII a
6 A B Abb. 8. (oben) Samen von Echinocactus (UG. Homalocephala) horizonthalonius (Hilumansicht siehe Morphologie Abb. 190) Abb. 9. Samen von Echinocactus (UG. Homalocephala) texensis. A. Seitenansicht eines extrem gekrümmten Exemplares, B. Hilumansicht, C. Lage des Embryo und Perisperms (P) im Samen, Mi das Mikropylarloch. D. freigelegter Embryo. C D Die S a m e n sind meist leicht gekrümmt eirund mit subbasalem kleinem H i l u m und vor diesem isoliert stehendem ansehnlichem M i k r o p y l a r l o c h (Vgl. Morphologie Abb. 187 A, B), nur in der UG. Homalocephala sind sie stärker, bei E. texensis sogar bis fast kreisförmig, gekrümmt und haben seitliches Hilum. Die T e s t a ist gewöhnlich glatt, mattglänzend schwarz bis bräunlich, nur bei E. polycephalus und E. horizonthalonius (Vgl. auch Morphologie Abb. 190) fein warzig, bei letzterem überdies faltig. Der gekrümmte E m b r y o hat rundliche deut liche parallel zur Sagittalebene stehende Keimblätter und legt sich an ein ansehnliches, nur bei UG. Homalocephala kleineres P e r i s p e r m an. Die länglichen K e i m p f l a n z e n zeigen große spitze Keimblätter. kreisfömig corrected in kreisförmig Heimat Die Gattung reicht von Puebla (Mexico) über das östliche und nördliche Mexico, Sonora, Niedercalifornien und Süd Californien, weiter über Texas, New Mexico, Arizona bis Utah und Nevada. Bemerkungen 1. N. H. Boke stellte auf Grund eingehender histogenetischer Untersuchungen fest, daß E. horizonthalonius dieselbe, von den anderen Echinocactus Arten abweichende Entwicklung der Areolen zeigt, wie Homalocephala texensis, also in deren engste Verwandtschaft gehört. Durch C VIII a Krainz, Die Kakteen, 1. VIII. 1962
7 Gattung Echinocactus Zusammenschluß dieser beiden Arten, die auch in der Blütenfarbe und im Wuchs sich als eng verwandt zeigen, wird aber, da E. horizonthalonius keine fleischige Frucht hat, dieses Merkmal von H. texensis als Gattungsmerkmal unbrauchbar, was sich ja auch in der nahe verwandten Gattung Ferocactus erwiesen hatte. Daher wird Echinocactus horizonthalonius zu Homalo cephala überstellt, Homalocephala aber nur mit dem Rang einer Untergattung zu Echinocactus einbezogen. W. T. Marshall hat festgestellt, daß E. ingens Zucc., E. grandis Rose, E. palmeri Rose und E. visnaga Hook. nur Standortformen desselben E. platyacanthus sind, die unter gleichartigen Standort und Kulturbedingungen (in den Huntington Botanical Gardens, San Marino, Calif.) ununterscheidbar werden. Anderseits findet man unter Sämlingen, gleich welcher Herkunft, 2. Fruchtender Echinocactus grusonii (vorne rechts), dahinter Neobuxbaumia tetetzo; links außen (vor Opuntia leucotricha) Cephalocereus hoppenstedtii mit Cephaliumbildung in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich (1941). Photo: H. Krainz. Tetozo corrected in tetezo Krainz, Die Kakteen, 1. VIII C VIII a
8 die an Wildpflanzen gesammelt wurden, alle Formen, die als artcharakteristisch angesprochen worden waren, mit 5 15 oder 20 Rippen, vielen oder wenigen, langen oder kurzen, starren oder zarten Dornen, alle aber mit der für die Art charakteristischen roten Streifung, die diese Sämlinge so anziehend macht. Daher sind diese früheren Arten alle als Synonyme zum ältesten Namen, Echinocactus platyacanthus Link et Otto zu stellen, nur E. visnaga, der konstant längere Früchte hat, kann als var. dieser Art geführt werden. Marshall hält auch den E. xeranthemoides nur für eine Varietät von E. polycephalus. Da jedoch E. polycephalus feinwarzige Samen hat, E. xeranthemoides glatte, sind in dieser Frage noch weitere Untersuchungen notwendig. (B.) Wichtige Literatur Baxter, F. M. California Cacti. Echinocactus polycephalus. Cact. & Succ. Journ. America III, 1933, S Boke, N. H. Comparative Histogenesis of the Areoles in Homalocephala and Echinocactus. Amerc corrcted in Americ Americ. Journ. of Botany 44, Nr. 4, 1957, S Buxbaum, F. Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen, Österr. Bot. Zeitschr. 98, 1951, S Marshall, W. T. und Bock T. M. Cactaceae. Pasadena, Calif C VIII a Krainz, Die Kakteen, 1. VIII. 1962
9 Echinocactus grusonii Hildm. grusonii, nach H. Gruson, dem Begründer der früher berühmten Kakteensammlung in Magdeburg Literatur Echinocactus grusonii Hildmann, H. in Monatsschrift Kakteenk. I 1891, S. 4 mit Taf. u. Holzschnitt. Schumann, K. Gesamtbeschr. Kakteen, 1898, S Britton, N. L. & Rose J. N. Cactaceae III, 1923, p. 167, 168 u. Abb. Schelle, E. Kakteen, Tübingen 1926, S. 188, 189 u. Abb. Kupper, W. Kakteen, Berlin 1928, S. 86, 87 u. Abb. Berger, A. Kakteen, Stuttgart 1929, S. 228, 229. Bravo, Helia H. Cactaceaeas Me xico, 1937, p. 448, 449 u. Abb. Bertrand A./Guillaumin A. Cactées, Ed. II. Paris 1955, p. 21 (Farbtaf.). Diagnose nach Hildmann, H. l. c. Planta globosa; simplex, rare biceps aut multiceps. Costis 20, inter areolas concavis, obtusis. Areolus ovatis, fulvolanatis, aculeis radialibus 9 10 erectis, superioribus brevioribus; aculeis centralibus 4, paulo curvatis, lateralibus quadratis, superiore latiore, inferiore plano, quadrangulato, longissimo, arciforme, omnibus sulfureis, distincte annulatis. C VIII a
10 Beschreibung K ö r p e r einfach, gedrückt, kugelig, im Alter bis 1.30 m hoch und cm breit, selten sprossend; S c h e i t e l in der Jugend etwas vertieft, gelbweißwollig, von Stacheln überragt; Epidermis lebhaft laubgrün. R i p p e n zahlreich (20 37), an jungen Pflanzen gehöckert, an alten gerade, durch scharfe Längsfurchen getrennt, ziemlich eng, scharfkantig, etwas buchtig gegliedert. A r e o l e n 1 2 cm entfernt, kreisrund oder elliptisch, bis 1 cm lang, mit dichtem gelben Wollfilz, später verkahlend. R a n d s t a c h e l n 8 10, schräg abstehend, die seitlichen die längsten, bis 3 cm lang, pfriemlich, steif, gerade, stark stechend, fein geringelt, anfangs goldgelb, später blasser; M i t t e l s t a c h e l n meist 4, kreuzförmig gestellt, gekrümmt, breiter, der untere abwärts gerichtete bis 5 cm lang. B l ü t e n aus dem Wollfilz des Scheitels, 4 6 cm lang, bis 5 cm breit, trichterig, nur beim vollen Sonnenlichte öffnend; R e c e p t a c u l u m kreiselförmig mit pfriemlichen, langgespitzten Schuppen bedeckt; ä u ß e r e Hüllblätter lang zugespitzt, außen bräunlich, innen gelb; i n n e r e kürzer, schmallanzettlich, spitz, seidiggelb glänzend; S t a u b f ä d e n zahlreich, kaum die Hälfte der Blütenhülle erreichend, zusammengeneigt, und in der Mitte der Blüten hülle einen dicken Zylinder bildend, kanariengelb; S t a u b b e u t e l hellgelb; G r i f f e l gelb mit 12 Narben, die Staubbeutel kaum überragend. F r u c h t eine längliche bis kugelige, dünnhäutige Beere, mm lang, wollig, unten nackt, mit den Blütenresten in der Wolle sitzend. S a m e n 1,5 mm lang, glatt, dunkelkastanienbraun. Hiervon eine weißstachelige Form: fa. albispina Hort. und eine Hahnenkammform: fa. cristata Hort. in Kultur. Heimat Zentral Mexiko, von San Luis Potosi bis Hidalgo. Kultur Anspruchslose, wüchsige Art. Im Frühjahr sonnenempfindlich; sonst sonnig und genügend feucht zu halten. Im Winter möglichst über 10 C. Bei Zimmerkultur auch im Winter nicht staubtrocken halten. Im sonnigen Gewächshaus ausgepflanzt entwickeln sie sich zu Riesenexemplaren. Aus Samen leicht anzuziehen. Größere Importpflanzen lassen sich leicht bewurzeln. Bis etwa zum 4. Jahre sind die Rippen der Sämlinge in Höcker zerlegt. Bemerkungen Eine der schönsten Kakteen Schaupflanzen, blüht jedoch erst im höheren Alter, d. h. nach Erreichung einer beträchtlichen Größe, was Jahrzehnte dauert. Die Blüten sind so lichtemp findlich, daß sie sich wegen eines vorüberziehenden Wolkenschattens schließen. Bei blühfähigen Pflanzen ist der Wollfilz am Scheitel zu einer großen Scheibe erweitert. C VIII a
11 Echinocactus horizonthalonius Lemaire gr.: horizonthalonius = mit horizontalen Areolen. Einheimische Namen: manca mula, biznaga de dulce, biznaga meloncillo (Durango), manca caballo (Zacatecas). Period. corrected in Périod. subelliptcis corrected to subellipticis Literatur Echinocactus horizonthalonius Lemaire, Cact. Gen. Nov. Sp. 19, 1839; Iconogr. tab. 3. Först. Handb. 1846, S. 327; 2. Aufl. 1886, S Labour. Monogr. 1858, S Weber in Bois Dict. Hort , p Coulter in Contrib. U. S. Nat. Herb. III, 1896, S Schumann., Gesamtbeschr. 1898, S Gürke M. Blühend. Kakt., Neudamm 1910, Taf Britton N. L. u. Rose J. N. Cactaceae III, 1922, p. 175 u. Taf. XX (Abb.). Schelle E. Kakteen 1926, S. 186 u. Taf. 27 (Abb.) Kupper W. Kakteenbuch 1928, S. 87 u. Abb. Berger A. Kakteen 1929, S Cactus Rev. Périod. Paris 1946, S. 12 u. Abb. Marshall W. T. Arizona Cact. II, 1953, S. 74 u. Abb. Echinocactus equitans Scheidw. in Bull. Acad. Brux. VI, 1839, S. 88. Echinocactus horizonthalonius curvispinus Salm Dyck, Cact. Hort Dyck. 1849, p. 26, 146 (1850). Echinocactus horizonthalonius centrispinus Engelm. Syn. Cact. in Proc. Amer. Acad. III, 1856, S. 276, Taf..31, 32, Fig Echinocactus laticostatus Engelm. et Big. in Pacif. Rail. Rep. IV, 1856, S. 32. Echinocactus horizonthalonius obscurispinus R. Mayer in Monatsschr. Kakteenk. 1911, S Echinocactus moelleri Haage jr. cat Diagnose aus Salm Dyck l. c. E. horizontalonius Lem. caule depresso hemisphaerico cinereolta eteviridi vertice lanato 8 10 costato, costis latis crassis convexis, pulvillis convertis transversim subellipticis mox Mashall corrected in Marshall Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VIII a
12 nudis, aculeis 7 omnibus exterioribus subaequalibus subulatis annulatis rectis fulvobrunneis, summis duobus erectis, caeteris radianter patentibus, infimo longiore ultra pulvillum inferiorem porrecto. Floribus alboroseis, laciniis lanceolato linearibus acutissimis recurvato expan sis. (Nob.) Caulis plano convexus, diametro 6 pollicari vertice umbilicatim impresso, tomento albido tecto. Costae glaucescenti laetevirides, laevissimae, plerumque 8, crassae superne convexae, inferne parum applanate, sesquipollicem latae, sinu fere obliterato. Pulvilli 6 lin. distantes, transversim latiores mox omnino nudi. Aculei rigidissimi, annulati, basi noduloso incrassati, binis superioribus parallelo erectis, et 4 lateralibus radianter expansis 7 8 lin. longis infimo subpollicari, inter duos superos pulvilli inferioris, deflexo. Stylus purpureus. Beschreibung K ö r p e r einfach, in der Kultur nicht freiwillig sprossend, kugelig oder mehr niederge drückt, oder mehr kegelförmig, oben gerundet. S c h e i t e l eingedrückt, mit spärlichem, grauem oder gelblich weißem Wollfilz, von den zusammengeneigten Stacheln überragt. E p i d e r m i s blaugrün. R i p p e n an jüngeren Exemplaren häufig 8, später mehr (bis 10), gerade oder etwas spiralig gedreht, sehr breit, bisweilen scharf, kaum 1,5 cm hoch, durch scharfe Längs furchen getrennt, durch Querbuchten kaum gegliedert. A r e o l e n 1,5 2 cm voneinander ent fernt, kreisrund, quer elliptisch oder fast herzförmig, mit dichtem, gelblichem, bald vergrauen dem und schließlich schwindendem Wollfilz. R a n d s t a c h e l n 7 8, die beiden obersten und der unterste am stärksten, bis 3 cm lang, sehr dick, pfriemlich, stielrund, gerade oder schwach gebogen, geringelt, die schwächsten wenig kürzer. Alle S t a c h e l n dunkelbernstein gelb, an der Spitze besonders braun, später vergrauend, verkalkend und werden bestoßen. B l ü t e n aus der Nähe des Scheitels, hinter dem Stachelbündel; trichterförmig, 55 mm lang, 6 cm im. Die äußersten B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r pfriemlich bis lanzettlich, 8 mm lang, 1/2 mm breit oder 12 mm lang und 3 mm breit, am Grunde rosarot, nach oben zu braun, in eine lange haarartige, dunkelbraune Spitze auslaufend; unter und neben diesen äußeren Hüllblättern sehr zahlreiche, dicht stehende, feine, weiße Wollhaare. Die i n n e r e n H ü l l b l ä t t e r lanzettlich bis spatelförmig, bis 2 cm lang und 6 mm breit, rosa, mit bräunlichem Mittelstreif, nach der braunen Spitze zu meist regelmäßig gezähnelt. Die i n n e r s t e n H ü l l b l ä t t e r lanzettlich spatelförmig, bis 3 cm lang und 9 mm breit, hellrosa, seiden glänzend mit undeutlichem Mittelstreifen, 1 mm langer, haarartiger Spitze. S t a u b g e f ä ß e zahlreich, erreichen kaum die halbe Blütenlänge. S t a u b f ä d e n hellrosa, mm lang. Staubbeutel leuchtend chromgelb. G r i f f e l (ohne Narben) 24 mm lang, ziemlich dick, rosa, am Grunde etwas dunkler. N a r b e n 6 8, 8 mm lang, rosa mit einem Schein ins Gelbrote. F r u c h t k n o t e n und Frucht von länglichen Schuppen besetzt, deren Achseln sehr wollig sind. F r u c h t 3 cm lang, eine rote, zylindrische bis ellipsoidische, von weißer Wolle um hüllte, saftige Beere, bald eintrocknend und am Grunde mit einem Ringspalt abbrechend. S a m e n 2 2,5 mm lang, ± kantig, umgekehrt eiförmig. Testa braun schwarz, papillös, mit großem Hilum, seitlich unterhalb der Mitte. Heimat Westl. Texas, südl. Neu Mexiko (auf steinigen Plätzen zwischen Doña Ana, dem Pecos River und El Paso) bis Arizona und nördl. Mexiko (Coahuila und Durango). Kultur Verlangt etwas alkalischen, kiesigen Boden (Lehm und Lauberde je zur Hälfte mit Kalkzusatz und Kies); im Sommer heißen Stand bei voller Sonne, im Winter völlig trocken, möglichst geringe Luftfeuchtigkeit bei 8 12 C. Für Zimmerkultur ungeeignet. Bemerkungen Die Blüten erscheinen von April bis Juni, haben einen feinen Duft und dauern mehrere Tage. Die Bestachelung ist fast von Pflanze zu Pflanze in Färbung, Länge, Form und Zahl wechselnd. Die von einigen Autoren aufgestellten Varietäten sind nur auf solche Formen begrün det, lassen sich aber kaum aufrecht erhalten. Die abgebildete Pflanze ist eine Importpflanze aus den Kulturen der Firma De Laet (Contiche). Etwas verkleinert, Photo Fr. De Laet. C VIII a Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1956
13 Gattung Echinocereus Engelmann in Wislizenus, Mein. Tour. North Mex Synonyme: Cereus Mill. Subgen. Echinocereus (Eng.) A. Berger in Rep. Missouri Bot. Garden , S. 79 Wilcoxia Britt. et Rose (Echinocereus tuberosus Rümpl. = Wilcoxia poselgeriana Br. et Rose) Echinos = Stachel; Echinocereus wegen des bestachelten Pericarpells und Receptaculums. U. Fam. C. Cactoideae (Cereoideae) Trib. VII Echinocereae. Diagnose nach Engelmann l. c.: Perigonii tubus ultra germen productus, abbreviatus. Sepala exteriora s. tubi subulata, in axillis tomentosis setas s. aculeos gerentes. Sepala interiora subpetaloidea et petala longiora pluriserialia corollani breviter infundibuliformem ms. sub campanulatam aemulantia. Stamina numerosissima tubo adnata, limbo breviora s. eum subaequantia. Stylus stamina vix superans. Stigma multiradiatum. Bacca pulvilligera setosa s. aculeata, perigonio coronata. Seminum testa dura tuberculata nigra. Embryo vix curvatus cotyledonibus brevibus contrariis. Leitart: Echinocereus viridiflorus Engelm. Beschreibung Niedrige, auffallend weichfleischige S ä u l e n k a k t e e n, kugelförmig, kurzsäulig, aufrecht, aufgerichtet oder niederliegend bis über Felsen überhängend, verlängert, einfach, oder häufiger vom Grunde meist nur nach Verletzung auch weiter oben bis sehr reich verzweigt und R a s e n oder K l u m p e n von bis zu 500 Köpfen (Benson) und cm oder bis zu 90 cm Durchmesser, aber selten mehr als 30 cm Höhe (Maximum nach Benson 60 cm) bildend. Einzelne Arten (E. stoloniferus und E. tayopensis, beide Sonora Mex.) aus ausläuferartig unter der Oberfläche verlaufenden Wurzeln sprossend. Die einzelnen Sprosse zylindrisch, 4 b i s v i e l r i p p i g, cm lang und 2,5 7 ( 10) cm im Durchmesser (Benson). R i p p e n nicht sehr hoch, aber nicht selten tief warzig gegliedert, wobei (nach Mieg) die Warzenbildung oder Ausgleichung vom Wassergehalt der Pflanze abhängt, indem sich die Warzen bei genügend Wasseraufnahme glätten, die Rippen zwischen den Areolen bei Wassermangel einsinken. A r e o l e n entweder einander sehr genähert, so daß dann zahlreiche kammförmig gestellte Stacheln den Körper dicht umflechten, oder aber vonein ander entfernt. B e s t a c h e l u n g weich, sehr verschieden standortabhängig weiß, grau gelbbraun, gelb, rosenfarbig, rotbraun oder schwarz, mitunter periodisch verschieden ( Re genbogenkaktus ) gefärbt; Mittelstachel gerade oder gebogen nadelförmig 1 10 cm lang, oder fehlend, Randstacheln na delförmig meist ± gerade oder gebogen; bei Echinocereus delaetii sind alle Stacheln weiß, lang borstig wie bei Ce phalocereus senilis. Abb. 1. Blüte von Echinocereus subinermis, Außenansicht (Perianth etwas verkürzt) Blütenlänge sehr variabel 5,5 8 cm. Auf den Podarien am Receptaculum und Pericarpell verschiedene Übergangsstadien zu Tragblattdornen deutlich erkennbar. Krainz, Die Kakteen, 1. I C VII c
14 Abb. 8. Schnitt durch die Blüte von Echinocereus subinermis, rechts mit eingetragenem Gefäßbündelverlauf. Die Tragblattdornen dunkel ausgeführt. scheerii -> scheerii Abb. 2. Echinocereus subinermis. Areolen aus dem mittleren Teil (A), dem unteren Teil (B im Schnitt) des Receptaculums und dem Pericarpell (C). Ub Unterblatt (Podarium), TD Tragblattdorn; in B.: Gefäßbündel des Tragblattes, GA Gefäßbündel der Areole. B l ü t e n nahe dem Scheitel, seltener weiter unterhalb, über einer Areole, doch nicht deutlich mit ihr verbunden aus einer etwas umwallten Anlage durch die Epidermis brechend, so daß nach Fruchtreife eine Abbruchsnarbe mehrere Jahre erhalten bleibt: teils mehrere Tage lang Tag und Nacht offenbleibend (Mieg 1952), einzelne Arten nächtlich offen, bei Tage geschlossen (E. scheerii, E. cucumis, Werdermann 1949); sehr ansehnlich, regelmäßig, kurz, Abb. 4. Blüte von Echinocereus reichenbachii (Länge 6,5 cm) A. Außen, B. Längsschnitt. Tragblätter auch am Receptaculum nicht zu Dornen umgewandelt, sondern reduziert. Im Längsschnitt deutlich die Grenzlinie von Achsengewebe (Rinde) und Carpellgewebe. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1975
15 Gattung Echinocereus Abb. 5. Längsschnitt durch die glockige Blüte von Echinocereus baileyi. Größe äußerst variabel. Auf die Übergangsblätter zu innerem Perianth verlagerte Areolen! TD Tragblattdornen, meist nicht deutlich als solche erkennbar. Abb. 6. Die langtrichterige (10 cm lange) Blüte von Echinocereus salm dyckianus. dayckianus corrected to dyckianus Abb. 7. Blüte von Echinocereus pulchellus. A außen (Länge 3 cm). Tragschuppen der Areolen nicht dornförmig. B. Längsschnitt. Receptaculum glockig, Abschluß der Fruchtknotenhöhle nur durch die verbreiterte Griffelbasis. C. Schnitt durch den Grund des Receptaculums mit den untersten Staubblättern. Keine Nektarrinne. Basalteil der Staubfäden von Chromophilen Epidermiszellen (dunkel ausgeführt) bedeckt wie bei Wilcoxia. seltener lang trichterförmig, oder schmal bis breit glockig, rosa, hell bis lebhaft rot, scharlach bis purpurviolett oder gelb bis grünlich weiß. P e r i c a r p e l l und R e c e p t a c u l u m ± dicht mit S c h u p p e n bedeckt, deren Podarien besonders im oberen Teil des Receptaculums manchmal als ± lange W a r z e n abstehen, auf deren Spitzen die Areole steht, mindestens aber das Receptaculum deutlich skulpturieren, deren Oberblatt (Spitze) am Pericarpell zwar meist ganz fehlt, am Receptaculum aber oft deutlich in einen T r a g b l a t t d o r n umgewandelt ist, wobei überginge auftreten können. Mitunter treten Areolen noch auf den Übergangsschuppen der äußeren Blütenhülle, auf deren Oberseite verlagert auf (Abb. 5). Alle A r e o l e n d e r B l ü t e tragen nadelförmige oder borstige, gerade, abstehende oder etwas anliegende Stacheln, Haare und Wollfilz. Ein Stachelspitzchen oft auch an den sonst oblongen bis breit lanzettlichen Perianthblättern. S t a u b b l ä t t e r stets sehr zahlreich in dichten Reihen vom Grund oder über einer kurzen Rinne über dem Grund des Receptaculums bis an die inner Krainz, Die Kakteen, 1. I C VII c
16 A B C D E G F Abb. 8. Echinocereen Samen. A. E. procumbens. Fast kugelig. Testasaum bis zum Rand deutlich warzig (vergl. Morphologie S. E. procumbens italicisized 85, Abb. 191 C); B Hilum desselben. C. E. stramineus, stark gekrümmter Samen, Hilum sublateral. D. E. delaetii, Warzen stark, bis zu rauher Oberflächenstruktur mit großen Zwischengruben ab geflacht. E G. E. engelmannii. E., F. Seiten und Vorderansicht nach Entfernen der harten Testa, G Embryo. sten Blütenblätter ohne Bildung eines eigentlichen Schlundkranzes inseriert, von den meist smaragd grünen N a r b e n strahlen des stabförmigen G r i f f e l s etwas überragt. Den Abschluß der Fruchtknotenhöhlung gegen den Receptaculumraum bildet meist nur das C a r p e l l g e w e b e (Griffelbasis), seltener ist diese Trennwand noch von Achsengewebe verstärkt. An der Wand der Nektarrinne ein sehr geringes rudimentäres Drüsengewebe (?). Die S a m e n a n l a g e n stehen an gebüschelten kurzen, etwas verzweigten Samensträngen. F r u c h t kugelig bis eiförmig mit Blütenrest, meist purpurrot oder grün, beerenartig, saftig, eßbar mit dünner Fruchtwand und nach Reife leicht abfälligen Stachelbüscheln, unregelmäßig aufspringend. S a m e n seitlich ± zusammengedrückt, schief eiförmig bis fast kugelig, mit sublateralem bzw. subbasalem, vertieft ovalem, das Mikropylarloch einbeziehendem H i l u m. T e s t a schwarz ausgeprägt k u g e l w a r z i g, Hilumsaum manchmal sehr feinwarzig, sonst ebenfalls kugelig warzig; selten (Echinocereus delaetii) die Warzen fast ganz abgeflacht, die Testa daher runzelig mit ansehnlichen Z w i s c h e n g r u b e n. P e r i s p e r m fehlt. E m b r y o im Bereich der transversal gestellten, ziemlich fleischigen K e i m b l ä t t e r etwas hakenförmig gekrümmt. Heimat Von Central Mexico mit Tehuacan im Süden über Californien bis in die südlichen Berge von Wyoming (nördlichste Art: E. viridiflorus), westlich begrenzt in Colorado. Keine Art überschreitet den Rio Pecos. Im Osten mit E. pectinatus bis nach dem Canadian River und Arcansas River. Im Norden nicht selten sogar im Föhrenwald, im Süden in Wüstengebieten. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1975
17 Gattung Echinocereus Gliederung der Gattung nach K. Schumann Schumann hat die Gattung schlüsselartig in Reihen und Unterreihen gegliedert. Diese Gliederung wurde auch von A. Berger übernommen, doch mußte Schumanns 1. Reihe Graciles Engelm. mit Leitart E. tuberosus Rümpl. herausgenommen werden, da sie heute als eigene Gattung Wilcoxia geführt wird. Im Folgenden wird diese Gliederung wiedergegeben, jedoch für jedes Taxon nur eine (die erstgeführte) Art angegeben. Reihe to be italicisized? See below!!! Reihe Subinermes K. Sch.: Aufrechte, mäßig sprossende oder reichlicher verästelte, dann rasenförmig wachsende, saftige Pflanzen mit wenig vorspringenden, geraden Rippen. Stacheln fehlend oder nur wenige, dünn und schwach. Leitart: E. subinermis S. D. S-D corrected to S-D Reihe Prostrati K. Sch.: Achsen vom Grunde aus sehr reichlich sprossend, daher Wuchs rasen förmig; Äste endlich niederliegend oder bogenförmig aufstrebend, mit stark stechenden Sta cheln bewehrt. cheeri -> scheerii Unterreihe Melanochlori K. Sch.: Rippen gleichmäßig fortlaufend, nicht tief gegliedert, zuweilen spiralig gedreht; Areolen einander genähert; Körper nach dem Neutrieb gesättigt oder dunkelgrün. Leitart: E. scheerii Lem. Unterreihe Nigricantes K. Sch.: Rippen tiefer gegliedert, bisweilen in Höcker aufgelöst oder Höcker fast spiralig angereiht. Leitart: E. berlandieri Lem. Unterreihe Pentalophi S. D.: Zweige heller oder meist gesättigt grün, verhältnismäßig sehr dünn (bis 1,5 cm im Durchmesser); Rippen sehr niedrig, daher Zweige oft nur gekantet, häufig spiralig gedreht, unten verschwinden die Rippen oft ganz, an ihrer Stelle erscheinen spiralig angereihte niedrige Warzen. Leitart: E. procumbens Lem. Unterreihe Oleosi K. Sch. Zweige lauchgrün, durchscheinend, Rippen tief gebuchtet. Leitart: E. glycimorphus Först. Unterreihe Leucacanthi K. Sch.: Zweige hell, oft saftig grün, kräftig; Stacheln im Neutrieb rein weiß. Leitart: E. ehrenbergii Rümpl. Reihe Erecti K. Sch. Wuchs durch gewöhnlich reichliche Sprossung aus dem Grunde rasenbildend; Zweige mindestens zuerst, in der Kultur bei uns stets aufrecht (später in der Heimat bisweilen am Boden liegend), immer viel kräftiger als in Reihe II (vergl. E. maritimus K. Sch.), immer reich bestachelt (mit Ausnahme von E. phoeniceus Lem. var. inermis K. Sch.) Unterreihe Pectinati S. D.: Rippen zahlreich; Areolen dicht gedrängt, meist oblong oder lanzettlich, daher die Stacheln in der Regel kammförmig, meist durcheinandergeflochten und den Körper umhüllend. Leitart: E. longisetus Lem. Krainz, Die Kakteen, 1. I C VII c
18 S-D corrected to S-D idem for Lem Triglochidiatus italicisized Unterreihe Decalophi S. D.: Rippen höchstens 12 (nur bei E. leeanus Lem. manchmal bis 14) Areolen lockerer gestellt, kreisrund; Stacheln nicht kammförmig. Leitart: E. maritimus K. Sch. Helia Bravo Hollis stellt neuerdings (1973) für die Artengruppen um Echinocereus triglochidiatus eine eigene Section Triglochidiata auf. Bemerkungen 1. Echinocereus ist innerhalb der einzelnen Entwicklungslinien außergewöhnlich variabel in Habitus und Bestachelung, und zwar nicht nur im arealgeographischen Sinne, sondern auch infolge ökologischer Um stände (adaptive Variabilität). Exemplare von E. baileyi aus dem Gebiet des Big Bent (Texas), die in der Stachelfarbe von weiß über gelb, rotbraun bis fast schwarz variierten, wurden in Kultur unter gleichen Be dingungen alle einheitlich weißlich. Mieg (1952) stellte auf eigens hiefür unternommenen Expeditionen fest, daß z. B. E. fendleri, E. bonkerae von Florence Junction Ariz. nordwärts die S Zentralstacheln auf 2, dann auf 1, und diesen mit zuneh mender Seehöhe bis 2000 m von 2 3 inch. Länge bis 1/16 inch. reduziert wird. Die Extreme auf einem Gebiet von 60 Meilen und einem Höhenunterschied von ca m, sind einander ganz unähnlich. Auf einer Exkursion über 2000 Meilen durch Arizona, Süd Utah und Colorado, auf der er Tausende Individuen der Triglochidiatus Gruppe untersuchte, fand er unter den schon von Marshall und Benson vereinigten Arten keine Unterschiede in Blüte, Frucht oder Samen. Ungeeignet zur Artentrennung fand Mieg auch den Unterschied: Rippen Warzen. Bei Trockenheit fallen die Rippen zwischen den Areolen ein, strecken sich aber bei Zunahme des Wassergehaltes sehr schnell wieder, so daß jede der Arten Rippen und ebenso Warzen haben kann. Da die Blüten der Arten einer Linie in Form und Farbe gar nicht variieren, nahmen Marshall und Bock (1941) eine Gruppierung nach Blütenfarben vor. Die schrittweisen Übergänge innerhalb einer Linie nach Standorten lassen vermuten, daß es sich bei die sen Arten um vikariierende Formen handeln dürfte. Sicherheit darüber kann da aber nur Kultur unter einheitlichen Bedingungen bringen. Um Vikariismus dürfte es sich vor allem auch bei den beiden Ausläufer bildenden Arten Echinocereus stoloniferus (Guiracoba, Bacachac, Sonora) und E. tayopensis (nördlich anschließend Bacadéhauchi, Rancho Saucito, El Capulin, La Huerta) handeln. 2. Blütenbiologisch ist die Echinocereus Blüte gewöhnlich offenbar als Pollenblume anzusprechen. Einer seits produziert sie aus den sehr zahlreichen Staubblättern überaus viel Pollen, andererseits aber ist im Grund des Receptaculums im Bereich der Umbiegung der Gefäßbündel der Primärstaubblätter zwar (meist) ein sehr dichtes, kleinzelliges Gewebe ausgebildet, das z. T. bis an die Griffelbasis reicht, aber kein typisches Drüsengewebe ist. Nektarausscheidung konnte aber mindestens bei einzelnen Arten nachgewiesen werden. Einige Arten haben starken Duft. cheeri -> scheerii; twice cheeri -> scheerii; twice 3. Anderseits stellte Werdermann (1949) ausgeprägte Nachtblütigkeit von Echinocereus scheerii und E. cucumis fest. E. scheerii ist um 7 Uhr morgens noch offen, in voller Sonne um 9 Uhr geschlossen; im Schatten beginnt er sich um 4 Uhr nachmittags zu öffnen und bleibt bis 7 Uhr morgens offen, im kühlen Innenraum im Schatten bis nachmittags. Denselben Blütenrhythmus zeigt E. cucumis Werd. und von E. salm dyckianus berichtet schon Schumann, daß er tagsüber nur halb geöffnet, wie E. s c h e e r i i erst am Abend aufgeht. Es ist bezeichnend, daß es gerade drei Arten sind, die eine besonders lange Receptaculumröhre haben. Leider liegen keinerlei Beobachtungen über den Blütenbesuch vor. Auch der Blütenrhythmus anderer Arten ist nicht genau untersucht. Viele Arten blühen mehrere Tage hindurch Tag und Nacht, einige nach unzureichenden Angaben anscheinend nur bei Tage. 4. Schumann stellte die heutige Gattung Wilcoxia als 1. Reihe Graciles Engelm. (Echinocereus tuberosus Rümpl. = Wilcoxia Poselgeriana) zu Echinocereus, Berger sowohl Wilcoxia als auch Echinocereus in seine Sippe Nyctocerei, zusammen mit Bergerocactus als tagblühenden, mehrrippigen Stammbaumast. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1975
19 Gattung Echinocereus Diese enge Beziehung zu Wilcoxia wird nun durch Echinocereus cucumis mit seiner auffallend langen Blütenröhre und rosenfarbiger, mit einem dunkleren Mittelstreifen (wie Wilcoxia!) gezeichneten Blüte noch bekräftigt. Neuerdings kommt aber noch ein wesentlich beweiskräftigeres Merkmal hinzu. Bei Wilcoxia konnte eine bis dahin noch unbekannte Charakteristik, die Ausbildung c h r o m o p h i l e r Epidermiszellen im Blütengrund, die auch den unteren Teil der Staubfäden überziehen, fest gestllt werden. Solche c h r o m a p h i l e Zellen konnten nun auch, zumindest bei einzelnen Arten (Echinocereus pulchellus), wenn auch nicht so ausgebreitet, sondern nur an den Staubfäden, festgestellt wer den. Es handelt sich hier also um ein typisches Tendenzmerkmal (Buxbaum 1951), das auf eine enge Verwandtschaft hinweist. Die Frage ist nun, ob man zufolge dieser Tatsachen Wilcoxia in die Tribus Echinocereae überstellen, oder sie zufolge der offenbaren Verwandtschaft zu Peniocereus, bei den Hylocereae Nyctocereinae belassen soll. Diese Frage ist jedoch erst dann zu klären, bis auch Nyctocereen vollkommen durchanalysiert sein werden. Die bei allem Formenreichtum doch in sich außergewöhnliche Einheitlichkeit erlaubt es jedenfalls zumindest vorerst, die Tribus Echinocereae aufrechtzuerhalten. Literatur Backeberg, C. Wertvolle Echinocereae aus Oklahoma. Kaktkde S Benson, L. The Cacti of Arizona. Tucson Benson, L. The complexity of species and the varieties of Echinocereus pectinatus. Cact. Succ. Journ. America S Benson L. The Native Cacti of California. Stanford Calif Berger A. A systematic revision of the Genus Cereus Mill. Rep. Missouri Bot. Garden , St. Louis Mo. Berger A. Die Entwicklungslinien d. Kakteen. Jena Berger A. Kakteen, Stuttgart Boyer C. F. Les Cactées dans leur Pays. Les Echinoceréés. Cact. France 1951 S , , S , Boke N. H. Histogenesis of the vegetative shoot in Echinocereus Americ. Journ. Bot. 38, 1951, S Bravo Hollis H. Triglochidiata, una Nueva Section del Genero Echinocereus. Cactaceas y Succulentas Mexicanas XVIII/ S Buxbaum F. Grundlagen u. Methoden einer Erneuerung der Systematik der höheren Pflanzen. Wien, Springer, Buxbaum F. The Phylogenetic Division of the Subfamily Cereoideae, Cactaceae. Madroño , S Buxbaum F. Gattung Wilcoxia. Krainz, Die Kakteen Forbe Weinböhla F. Leicht blühende Echinocereen. Kaktkde S Frank G. Die winterharten Pectinaten. Kakt. u. a. Sukk. 12, 1961 S Gates H. C. Lower California Echinocereus. Cact. Succ. Journ. America , S Hester J. P. New Echinocereus or an Alpine type of E. fendleri (?) Cact. Succ. Journ. America , S Dahmann M. Sherwood, Notes on Oklahoma Cacti IV, The Echinocereus. Cact. Succ. Journ , S Leding A. R. A new spine character in Cactus. Echinocactus from Texas shows woolly character in juvenile stage. Cact. Succ. Journ. America, , S Lindsay G. Echinocereus subinermis. Cact. Succ. Journ. America 16. S Lindsay G. Los Echinocereus de Baja California. Cact. Succ. Mexic , S Marshall W. T. Echinocereus chizoensis sp. nov. Cact. Succ. Journ. America , S. 15. Marshall W. T. and Bock Th. M., Cactaceae. Pasadena Mieg C. E. On Species and Genera. National Cact. & Succ. Journ , Parrish Ch. Echinocereus tayopensis. Cact. Succ. Journ. America , S Peebles R. H. A New Echinocereus from Arizona. Cact. Succ. Journ. America , S. 35. Schumann K. Gesamtbeschreibung d. Kakteen, Neudamm 1898 u Echinocerees corrected in Echinoceréés Same set of pages : ERROR? Krainz, Die Kakteen, 1. I C VII c
20 Wisliceni corrected in Wislizeni; quote deleted Seela S. P. Echinocereus reichenbachii. The most versatile Cactus in Oklahoma, Cact. Succ. Journ. America , S Soulaire J. Fam. des Cact. Genre 64, Echinocereus Engelmann Wislizeni Cact. France , S , , S Werdermann E. Nightflowering Echinocerei. National Cact. & Succ. Journ , S (B.) C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1975
21 Echinocereus acifer (Otto) Lemaire lat. acifer = nadeltragend Literatur Cereus acifer Otto in Salm Dyck, Cact. Hort. Dyck. Cult. 1849, 1850, S Echinocereus acifer (Otto) Lemaire in Förster Handb. Cact. II 1886, S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt S. 286, 287. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 12. Berger A. Kakteen 1929, S Backeberg C. Cactaceae IV 1960, S. 2065, 2066; Kakt. Lex. 1966, S Echinocereus acifer tenuispinus Jacobi in Förster Handb. Cact. II 1886, S Echinocereus acifer brevispinulus Jacobi in Förster Handb. Cact. II 1886, S Diagnose nach Otto l. c. C. caule spithameo prolifero nitide viridi 10 costato, costis repando tuberculatis, pulvillis confertis prominulis gilvo tomentosis, aculeis acicularibus rigidis, exterioribus 8 10 radianter patentibus inferne sensim longioribus pallide fuscis, centralibus 4 validioribus purpureo brunneis, tribus superioribus erectis infimoque validissimo subdeflexo. (Nob.) Caulis poll. 5 altus et diametro bipollicari, nitide perviridis, basi aut superne prolifer. Costae inter pulvillos (lin. 4 distantes) valde repando excavatae. Pulvilli elevati, tomento gilvo dein griseo instructi. Aculei exteriores lin longi; summis brevioribus, pallide fulvidi, basi nodulosi purpurascentes, centraliumque infimus fere sesquipollicaris. Hucusque non floruit. Krainz, Die Kakteen, 1. X C VII c
22 Beschreibung Pflanze gruppenbildend; Triebe glänzendgrün, aufrecht, cm hoch, 4 5 cm im, Scheitel von Stacheln überragt. R i p p e n 10 (9 11), durch scharfe Furchen getrennt, 6 7 mm hoch, etwas quergefurcht. A r e o l e n 6 8 mm voneinander entfernt, rund, 3 mm im, mit wenig Wollfilz, bald kahl. R a n d s t a c h e l n 5 10, mm lang, blaßbraun, unten zwiebelig verdickt. M i t t e l s t a c h e l n (1 ) 4, purpurbraun, die 3 oberen aufgerichtet, der unterste ± herabgebogen, bis 2,5 cm lang. B l ü t e n trichterförmig, bis 7 cm lang, 5 cm im. P e r i k a r p e l l kreiselförmig, etwa 10 mm im, dunkelgrün, glatt. R e c e p t a c u l u m gestreift, mit rötlichen bis bräunlichen Schuppen, deren Achseln weißwollig und mit weißen, an den Spitzen rotbraunen oder roten Stacheln. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r breit linealisch, dunkelscharlachrot; i n n e r e scharlachrot, manchmal nach unten hin gelb, am Rande bisweilen karminrot. S t a u b f ä d e n weiß oder oben karmin; Staubbeutel gelblich; G r i f f e l die Beutel mit 10 grünlichen Narbenästen überragend. F r u c h t kugelig, grün, mit leicht abfallenden, kleinen Stachelbündeln. S a m e n fast kugelig, mit vertieftem, ovalem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa schwarz, flachwarzig, mit Zwischengrübchen. Heimat Mexiko, in den Staaten Durango und Coahuila. wie bei Echinocereus papillosus angegeben. Kultur Bemerkungen Schöne, reichblühende und ziemlich harte Pflanze für sonnige Lagen. Farbbild: W. Täuber. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. X. 1974
23 Echinocereus baileyi Rose baileyi, nach Vernon Bailey, Entdecker der Art Literatur Echinocereus baileyi Rose J. N. in Contr. U. S. Nat. Herb. XII, 1909, S. 403 u. Abb. 56, 57. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III, 1922, S. 26, 27 u. Abb. Berger A. Kakteen 1929, S Diagnose nach Rose J. N. l. c.: Separed ->. separated Plant body cylindrical, 10 cm, or so high; ribs 15, straight or perhaps sometimes spiral; areoles elongated, separated from the adjacent ones by a space of about their own length; spines at first white, when mature brownish or yellowish, about 16, somewhat spreading, those at the top and base of the areole smaller; central spines none; areoles when young clothed with dense white wool, this nearly or quite wanting in age; flowers from the youngest growth appearing ter minal; corolla widely spreading, 6 cm or more broad; petals light purple, oblong to spatulate-oblong, the broad apex toothed or jagged, the terminal tooth tapering into a slender awn; fila ments short, yellow; style stout, longer than the filaments: stigmas 10, obtuse, green; areoles of the ovary bearing 10 or 12 slender spines intermixed with cobwebby wool, the spines whitish, or the central ones brownish; areoles of the tube crowning an elongated tubercle, not so closely set, bearing spines subtended by minute leaves. Beschreibung K ö r p e r zylindrisch, einfach, später sprossend, etwa 10 cm hoch. R i p p e n 15, gerade oder oft spiralig. A r e o l e n in der Jugend mit dichter, weißer Wolle, im Alter ganz oder bei Krainz, Die Kakteen, 15. III C VII
24 nahe ganz verkahlend, vorstehend, von den benachbarten durch einen Zwischenraum getrennt, der ihrer Länge entspricht. R a n d s t a c h e l n etwa 16, zuerst weiß, später bräunlich oder gelblich, oft spreizend, diese am Grunde und an der Spitze der Areole die kleineren. M i t telstacheln keine. B l ü t e n in der Nähe des Scheitels, sich weit öffnend, 6 cm breit oder breiter. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) mit schlanken, weißlichen oder bräunlichen (der Mittlere) Stacheln und spinnwebartiger Wolle an den Areolen. R e c e p t a c u l u m (Röhre) mit zerstreuten, hökkerigen Areolen und kleinen Schuppen, deren Achseln Stacheln tragen. H ü l l b l ä t t e r hell purpurn, länglich bis spatelförmig länglich, an ihren breiten Scheitel gezahnt oder gezackt, die Spitze zu einem schlanken Anhängsel ausgezogen. S t a u b b l ä t t e r kurz, gelb. G r i f f e l dick, länger als die Staubblätter. N a r b e n 10, stumpf, grün. F r u c h t (nach Krainz) eiförmig, etwa 1 cm breit, stark bestachelt, anfangs grün, später bräunlich. S a m e n (nach Krainz) ku gelig mützenförmig, etwa 1 mm im Durchmesser, mit basalem, etwas vertieften Hilum und breitem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, ziemlich großwarzig. Heimat Verbreitung: U.S.A., im Gebirge von Oklahoma. Typ Standort: Wichita Mountains. Kultur wurzelechter Pflanzen in lehmig sandiger Erde von leicht saurer Reaktion. Guter Wasserabzug erforderlich, verlangt sehr sonnigen, warmen Standort; Überwinterung möglichst hell, bei 5 8 C und fast ganz trocken; viel Lüften, da spinnmilbenanfällig. Für die Kultur am Fensterbrett ist Pfropfen auf C. jusbertii oder C. spachianus angezeigt. Auf C. spachianus ge pfropfte Pflanzen neigen später leicht zu Sprossenbildung. Bemerkungen Sehr schöne und blühwillige Art, die im Alter bis zu 30 cm breite Gruppen mit bis zu 25 Sprossen bilden kann. Blütezeit Juli bis August. Die im Bilde dargestellte Pflanze ist eine aus Samen aufgezogene Importpflanze aus der Städt. Sukkulentensammlung Zürich. Photo: H. Krainz. Abbildung etwas verkleinert. C VII Krainz, Die Kakteen, 15. III. 1958
25 Echinocereus berlandieri (Engelmann) Palmer berlandieri, nach Dr. J L. Berlandier, Pflanzenkenner des unteren Rio Grande Literatur Cereus berlandieri Engelmann G. Cact. Boundary 1856, S. 38 u. Abb. Taf. LVIII. Weber in Dict. Hort. Bois 1894, S Coulter in Wash. Contr. III 1896, S Echinocereus berlandieri (Engelmann) Palmer in Rev. Hort. 1865, S. 92. Lemaire Cact. 1868, S. 56. Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S u. Abb. S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 256, 257. Gürke M. Blühende Kakt. 1903, Taf. 37. Schelle E. Kakteen 1926, S Berger A. Kakteen 1929, S Diagnose nach G. Engelmann l. c.: humilis, perviridis; caule suberecti articulato-ramosissimo; tuberculis conicis distinctis 5 6 fariis; areolis parvis orbiculatis; aculeis tenuibus subsetaceis, 6 8 brevibus radiantibus albidis, 1 centrali plerumque multo longiore fuscato; floribus lateralibus magnis purpureis; ovarii pulvillis sub 20 breviter albo tomentosis aculeolos capillaceos basi bulbosos 8 10 longiores albidos et 1 2 robustiores fuscos gerentibus; sepalis tubi exterioribus 8 10 aculeoliferis, superioribus oblongo linearibus acuminatis seu cuspidatis; petalis late linearibus seu, lineari oblanceolatis elongatis fere loricatis mucronatis apice denticulatis patulis demum reflexis; stigmatibus 7 10 viridibus; bacca ovata viridi subsicca: seminibus parvis obovato-subglobosis tuberculalis, hilo circulari. inearibus corrected to linearibus Beschreibung K ö r p e r niederliegend, sehr reich verästelt; Äste am Grunde zusammengezogen, gegliedert, aufstrebend oder aufrecht, meist 6 10 cm lang und 13 0 mm dick, hell- bis dunk Krainz, Die Kakteen, 1. IV C VII
26 ler grün, entweder stielrund mit in Schrägzeilen angeordneten Warzen, oder diese zu 5 6 Rippen zu sammenfließend, die gerade oder spiralig gedreht sind; W a r z e n flach kegelförmig, spitz, ca. 4 mm hoch. A r e o l e n mm voneinander entfernt, rund, etwa 2 mm im Durch messer, mit kurzem, krausem, weißem, spärlichem Wollfilz, später verkahlend. R a n d s t a c h e l n 6 8, borstenförmig, steif, dünn, horizontal strahlend oder wenig schräg aufrecht, weiß, durchscheinend, 8 10 mm lang, ein oberer bisweilen hellbraun und etwas stärker. M i t t e l s t a c h e l n einzeln, gelbbraun, an den Zweigenden länger, oft bis 20 mm lang, unten kürzer. B l ü t e n seitlich aus den oberen Areolen, breit trichterförmig, 6 8 cm lang. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) eiförmig, gehöckert, dunkelgrün, von wenigen kurzen, dreiseitigen, braunoder dunkelroten Schuppen bedeckt, aus deren Achseln kurzer, weißer Wollfilz und Büschel von 5 10 weißen und 2 größeren, wenigstens an der Spitze braunen, bis 12 mm langen Borsten hervortreten. R e c e p t a c u l u m (Röhre) ebenfalls beschuppt und beborstet. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r etwas länglich lanzettlich, lang zugespitzt bis stachelspitzig, braun, ins Grüne bis Schwarze. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r locker gestellt, ausgebreitet und zurückgebogen, schmal spatelförmig, karminrosa bis rot, oben heller mit dunklerer Stachelspitze, oben gezähnelt, später zurückgekrümmt. S t a u b b l ä t t e r 1/3 lang wie die Blütenhülle. S t a u b f ä d e n blaßweinrot oder dunkler, oben grünlich. S t a u b b e u t e l chromgelb. G r i f f e l glatt oder gefurcht, unten weiß, oben rosarot, die Staubgefäße mit 7 10 smaragdgrünen N a r b e n über ragend. F r u c h t eine eiförmige, grüne Beere von etwa mm Länge und etwa 15 mm im Durchmesser mit anhaftendem Blütenrest und etwa 17 kleinen rotbraunen oder roten drei seitigen Schüppchen, kurzwolligen Areolen mit je 7 13 pfriemlichen, stechenden, 4 20 mm langen, gelblichweißen Borstenstacheln. S a m e n rundlich mützenförmig, etwa 1 mm im Durch messer mit basalem Hilum und eingeschlossenem, kleinem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, warzig. (Frucht und Samen nach Krainz). Heimat Standorte: am Nueces Flusse im südlichen Texas und bei Aguas Calientes, Mexiko. Allgemeine Verbreitung: Texas, Mexiko. Kultur Im Sommer möglichst im Freien an voller Sonne, nach der Blüte ohne Glasbedeckung, in nahrhafter, gut durchlässiger, leicht saurer Erde, diese zur Hälfte Rasenerde. Größere Exemplare werden am besten in breite Schalen gepflanzt. Verlangt im Sommer genügend Feuchtigkeit, im Winter fast trocken und möglichst sonnig halten bei 3 8 Grad Celsius. Bei Überwinterung im Zimmer ist regelmäßig Kontrolle auf Befall durch Rote Spinne erforderlich. Bemerkungen Helia Bravo H. führt unsere Art in Cactaceas de Mexico 1937, S. 341 als Synonym zu E. blanckii (Pos.) Palm. Körper, Stachelstellung und Blütenform beider Arten weichen jedoch voneinander so stark ab, daß ich die beiden Pflanzen als selbständige Arten führen möchte. Wir besitzen von beiden Arten über 40jährige Exemplare zuverlässiger Herkunft. Die Pflanze blüht im Juni, oft schon Ende Mai während 10 Tagen. Bei zweckmäßiger Kultur erscheinen alljährlich 5 6 Blüten an einem einzigen Trieb. Da blühfähige Pflanzen ziemlich viel Platz beanspruchen ist die Art, wie auch ihre näheren Verwandten, für kleine Verhält nisse ungeeignet. Vermehrung durch Stecklinge. Anzucht aus Samen. Die Abbildung zeigt ein kleines Exemplar aus der Städt. Sukkulentensammlung Zürich, das, wie alle unsere Echinocereen der Prostrati Gruppe mit den Rebutien und Lobivien im temperierten Kasten bei 1 8 Grad C. überwintert. Abb. 1 : 2. Photo: H. Krainz. C VII Krainz, Die Kakteen, 15. IV. 1960
27 Echinocereus blanckii (Poselger) Palmer blanckii, nach dem Apotheker P. A. Blanck in Berlin, Freund Poselgers Einheimischer Name: Alicoche (in Tamaulipas) Literatur blankii -> blanckii Cereus blanckii Poselger H. in Allg. Gartenzeitg. Jahrg. XXI Nr. 17, 1853, S Echinocereus blanckii (Poselg.) Palmer in Rev. hort. 1865, S. 92. Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S. 779 u. Abb. S Gürke M. Blühende Kakt. 1905, Taf. 70. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 20, 21 u. Abb. S. 21 u. Taf. III Fig. 4. Berger A. Kakteen 1929, S Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Echinocereus blanckii (Poselg.) Palmer Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S Schelle E. Kakteen 1926, S. 163, 164. Diagnose nach H. Poselger l. c.: C. e viridi nigricans 5 6 poll. altus diametro sesquipollicari apice attenuatus, costis 8 10 verticaliter decurrentibus, areolis gibbis mammaeformibus insertis nudis, aculeis exterioribus 8 10 semipollicaribus fuscis, summis minimis, centrali uno pollicari. Prope Camargo. Beschreibung K ö r p e r rasenförmig wachsend durch Sprossen am Grunde, säulig, oben verjüngt, kaum über 15 cm lang und 2,5 cm im Durchmesser, dunkelgrün. S c h e i t e l von Warzen geschlossen und von spreizenden Stacheln überragt. R i p p e n 5 6 (sehr selten 7), gerade, bis 6 mm hoch, sehr tief gebuchtet und fast in Höcker zerlegt. A r e o l e n mm voneinander ent Krainz, Die Kakteen, 1. IV C VII
28 fernt, rund, etwa 2 mm im Durchmesser, mit spärlichem weißem, etwas gekräuseltem Wollfilz, im Alter verkahlend. R a n d s t a c h e l n meist 8, bis 1 cm lang, horizontal strahlend, das unterste Paar am längsten, alle steif, gerade, dünn, pfriemlich, weiß, nur der oberste oder noch ein be nachbarter rötlich braun, jung karminrot. M i t t e l s t a c h e l n 1 (gelegentlich 2), ca. 3 cm lang, gerade vorgestreckt, später nach unten gebogen, weiß oder häufiger braun, in der Jugend fast schwarz. B l ü t e n aus der Nähe des Scheitels, 6,5 7 cm lang bis 7 cm breit, P e r i c a r p e l l (Frucht knoten) schlank eiförmig oder ellipsoidisch, dunkelgrün, mit dunkelbraunen Schuppen, aus deren Achseln spärliche weiße Wolle und etwa 8, bis 30 mm lange, gelblich oder reinweiße, biswei len dunkel rosarote bis bräunlich gespitzte Stacheln hervortreten. H ü l l b l ä t t e r flatterig, kurz trichterförmig; ä u ß e r e länglich, spitz, bräunlich; i n n e r e purpurrot ins Violette, lanzettlich, spitz, gezähnelt, zurückgekrümmt. S t a u b g e f ä ß e erreichen kaum ein Drittel der Blütenlänge. F ä d e n karminrot; B e u t e l chromgelb. Der G r i f f e l überragt sie weit mit 9 11 smaragdgrünen, spreizenden N a r b e n. F r u c h t (Beere) etwa 2,5 mm lang, bis 15 mm breit, oval bis eiförmig, dunkelgrün, mit dreiseitigen, spitzen, etwa 3 mm langen rötlichen Schüppchen und etwa kurzwolligen Stachelareolen mit je 9 13 pfriemlichen, 3 20 mm langen Borstenstacheln. S a m e n rundlich mützenförmig, fast kugelig, etwa 1 mm im Durch messer mit basalem, etwas schief angelegtem, weißem Hilum und eingeschlossenem, kleinem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, flachwarzig, diese oft in Linien angeordnet. (Frucht und Samen nach Krainz). Standort: Camargo Verbreitung: Staat Tamaulipas in Mexiko. Heimat wie Echinocereus berlandieri (Eng,) Palm, Kultur Bemerkungen Siehe Bemerkungen zu Echinocereus berlandieri (Eng.) Palm. Unsere Art blüht Ende Mai oder Anfang Juni. Vermehrung durch Stecklinge. Anzucht aus Samen. Die Abbildung zeigt ein kleineres blühendes Exemplar der Stadt. Sukkulentensammlung Zürich. Abb. etwa 1 : 2. Photo: H. Krainz. C VII Krainz, Die Kakteen, 1. IV. 1960
29 Echinocereus cucumis Werdermann lat. cucumis = gurkenartig Literatur Echinocereus cucumis Werdermann E. in Nat. Cact. Succ. Journ. Vol. IV Nr. 1, 1949, S. 4 u. Abb. S. 3. Diagnose nach E. Werdermann l. c.: Prostratus, ut videtur, subramosus, articulis primum 4 5 costatis, costis, humilibus demum omnino fere planis, subserpentinis vel cucumiformibus. Areolae parvulae, ca. 4 6 mm. distantes, sublanuginosae mox glabrescentes. Aculei radiales ad io, setiformes, breves, ad 1 2 mm. longi, albidi; centrales 3 6, vix crassiores atque longiores, basi leviter incrassati, fuscescentes. Flores ad 9 cm. longi, elongato infundibuliformes, ovario atque tubo extus subcostatis, squamis minutis deciduis lana brevi setisque praeditis. Perigonii phylla oblongolanceolata, rosea. Stylus stigmatibus 11, pallide viridibus stamina breviter superans. Beschreibung K ö r p e r niederliegend, Stämmchen (in Kultur) über 20 cm. lang, 1,5 3 cm im Durchmesser, im Neutrieb matt laubgrün, später vergrauend oder etwas rötlich. R i p p e n 4 5, im Krainz, Die Kakteen, 1. XII CII corrected to C VII C VII
30 Neutrieb ansehnlich, wenn 4 6 mm hoch, über den Areolen sehr leicht gekerbt, bald meist ganz abge flacht, so daß die Kanten nur als senkrechte, kaum überhöhte Linien sichtbar sind und als solche nur erkennbar durch die Areolen oder deren Überbleibsel; die Stämmchen nehmen die Gestalt einer leicht gekanteten Gurke an. Wenn 4 rippig sind die Rippen gewöhnlich gerade, wenn 5 rippig meist etwas gedreht. A r e o l e n klein, ca. 1 mm im Durchmesser, 4 6 mm von einander entfernt, in der Jugend mit wenig, kurzer, flockiger Wolle, bald verkahlend. R a n d s t a c h e l n 6 10 (an voll entwickelten Areolen); M i t t e l s t a c h e l n 1 4, meist 2 3. Alle Stacheln klein, borstig, gerade, in der Jugend bräunlich, diese in der Mitte ein wenig dunkler braun und mehr pfriemlich, am Grunde leicht verdickt. Später werden alle Stacheln weißlich und fallen meist ab. B l ü t e n schlank trichterförmig, ca. 9 cm lang, am Grunde der Röhre mit Nektar, duftlos, öffnen sich am Abend und schließen sich am Morgen während mehreren Tagen. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) matt saftgrün, etwas längsgerippt, mit rundlichen, 1 1,5 mm großen, leicht abfallenden Areolen, mit kurzen, wolligen Haaren und bis zu 16 borstenartigen, ca. 1 bis 2 mm langen Stacheln, die schräg vorwärts abstehen, 3 davon sind mehr in die Mitte gestellt, etwas mehr pfriemlich und dunkler braun, etwas länglich, ca. 5 7 mm lang. R e c e p t a c u l u m (Röhre) sehr schlank, trichterig, ca. 4,5 cm lang, 7 8 mm im Durchmesser über dem Fruchtknoten und ca. 12 mm beim Schlund, stumpf olivgrün, etwas längsgerippt infolge der an haftenden Schuppen. Areolen klein, ähnlich denen des Fruchtknotens, ebenso die weißlichen Stacheln, die jedoch nur wenige, meist 2 5, am Oberteil der Röhre bis zu 1 cm lang werden. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r bis 3 cm lang und etwa 3 mm breit, lanzettlich bis länglich, zuge spitzt, blaßrosa mit olivgrünen Mittelstreifen. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r wenige mm länger als die äußeren und etwas breiter, länglich oval, stachelspitzig, blaßrosa, tiefer rot gegen die Mittellinie, etwas zurückgebogen. S t a u b b l ä t t e r ca. 2,5 cm über dem Grunde der Röhre frei werdend; S t a u b f ä d e n ca. 4,5 cm lang, am Grunde blaßgelb, stark rosafarben im obe ren Teil; S t a u b b e u t e l klein, dunkel rosarot; Pollen gelblich. G r i f f e l etwa 6,5 cm lang, mit blaß smaragdgrünen N a r b e n, die Länge der Staubblätter erreichend, die ein geschlosse nes Bündel bilden. F r u c h t (und Samen nach Krainz) oval, 1,8 cm lang, etwa 1 cm im Durch messer, olivgrün, mit etwa 4 5 cm langem Blütenrest, mit etwa 20 runden, am Grunde kurz wolligen Areolen, 12 20, bis 3 mm langen, gelbgrauen, nach allen Richtungen spreizenden, stark stechenden Stacheln. Stachelpolster leicht abfallend. S a m e n rundlich, etwa 1 mm im Durchmesser, mit basalem, kleinem Hilum und eingeschlossenem, trichterigem Mikropylarloch; Testa glänzend schwarz, grobwarzig. unbekannt. Heimat Kultur in halbschwerer Erde in voller Sonne (wie Echinocereus blanckii). Bemerkungen Sehr charakteristische Art, deren fast stachellosen Triebe an kleine Gurken erinnern. Bei der von Gates (Calif.) unter dem Namen Echinocereus noctiflorus nom. nud. verbreiteten Pflanze handelt es sich um die oben beschriebene Art. Die seit einigen Jahren in der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich kultivierte Pflanze zeigte ihre hellrosa gefärbten Blüten erstmals im vorigen Jahr Ende Mai. Die Blüten waren während vier Tagen geöffnet. Photo: H. Krainz. Abb. 2 : 1. CII corrected to C VII C VII Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1959
31 Echinocereus engelmannii (Parry) Rümpler engelmannii, nach dem Kakteenforscher Dr. Georg Engelmann, Arzt und Botaniker in St. Louis (Missouri) Einheimische Namen: Hedgehog Cactus (Igelkaktus) und Strawberry Cactus (Erdbeerkaktus) Literatur Cereus engelmannii Parry in Engelmann Amer. Journ. Sci. II , S Engelmann G. in Cactaceae Boundary 1858, S. 36, 37 u. Abb. Taf. 57 u. 75 Fig Regel in Gartenfl. 1884, S. 353 u. Taf Coult. in Wash. Contr. III. S Cereus engelmannii chrysocentrus Eng. u. Big. Proc. Am. Acad , S Cereus engelmannii variegatus Eng. u. Big. Proc. Amer. Acad , S Echinocereus engelmannii chrysocentrus Rümpler in Först. Handb. Kakt , S Echinocereus engelmannii variegatus Rümpler in Först. Handb. Kakt , S Echinocereus engelmannii (Parry) Rümpler in Först. Handb. Kakt , S Schumann K. Gesamtbeschr. 1898, S. 275, 276. Gürke M. in Monatsschr. Kaktk. 1906, S u. Abb. Schelle E. Handb. Kaktk. 1907, S. 134 u. Abb. Nr. 135; in Kak teen 1926, S. 176, 177. Britton N. L. & Rose J. N., Cactaceae III. 1922, S. 38 u. Taf. V. Berger A. Entwicklungslinien Kakt. 1926, Abb. S. 47; Kakteen 1929, S. 180, 181. Kupper W. Kakteenbuch 1927, S Baxter E. M. Calif. Cact. 1935, S. 67 u. Abb. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Benson L. Cacti Ariz , S. 83, 85 u. Abb. II. Taf. 24. Borg J. Cacti, 1951, S Backeb. C. Cactaceae IV. 1960, S u. Abb. S. 2048; Kakt. Lexikon 1966, S Diagnose nach Parry l. c. C. engelmannii, Parry in litt.; caulis pluribus pedalibus; costis 13 tuberculatis; aculeis 4 centralibus inaequalibus radiales tenuiores superantibus; bacca ovali aculeata pulposa. Ge birge um San Felipe, auf dem Ostabhang der Cordillieras. Krainz, Die Kakteen, 1. XII C VII c
32 C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1969
33 Echinocereus engelmannii nach Engelmann G. l. c. C. engelmannii: ovato cylindricus, e basi parce ramosus; costis interruptis; areolis orbiculatis subconfertis junioribus villosis; aculeis radialibus 13 sub angulatis albidis apice adustis rectis seu paullo curvatis, lateralibus 6 longioribus, inferioribus 3 vix brevioribus, superioribus sub 4 parvis; aculeis centralibus 4 angulatis gracilibus rectis multo longioribus, inferiore longiore albido porrecto seu deflexo, superioribus fulvis arrectis; floribus sub apice lateralibus; ovarii pulvillis sub 30 aculeolos rigidos 8 14 gerentibus; sepalis tubi inferioribus ovatolanceolatis ad axillam villosam aculeiferis; petalis purpureis; stigmatibus 12 erectis viridibus; bacca ovata; seminibus oblique obovatis tuberculato foveolatis, hilo subbasilari oblongo. Beschreibung W u c h s durch Sprossung aus dem Grunde des Körpers, lockere Polster oder Rasen bildend; 4 8, manchmal 100 Stämmchen nebeneinander, diese aufrecht oder aufsteigend. K ö r p e r zylindrisch oder ins Eiförmige, oben gerundet; Scheitel eingesenkt, mit weißem, kurzem Woll filz bedeckt und von den langen, zusammengeneigten Stacheln überragt, 30 ( 45) cm lang, 4 6 cm oder mehr, hellgrün; R i p p e n ( 14), undeutlich gehöckert und durch scharfe Längsbuchten voneinander getrennt. A r e o l e n 7 12 ( 14) mm voneinander ent fernt, fast rund, 2 3 mm, mit weißem, kurzem, gekräuseltem Wollfilz, bald verkahlend; R a n d s t a c h e l n 10 ( 13), pfriemlich, etwas kantig, steif, streckend, gerade oder etwas gekrümmt, horizontal strahlend, die untersten oder seitlich untersten die längsten (bis 15 mm), die obersten die kürzesten (manchmal kaum 3 mm, weißlich, an der Spitze gebräunt. M i t t e l s t a c h e l n 2 6, steif, zum Teil gedreht oder gebogen, kantig, stärker, der unterste nach unten gedrückt. weißgelb, orange bis braun, dunkelblutrot (!!) oder bunt, der längste bis 6,5 cm lang, die oberen fast nur halb so lang, spreizend, braun. B l ü t e n seitlich, in der Nähe des Scheitels, trichterförmig, unterschiedlich 5 8 cm lang, bis 12 cm; P e r i c a r p e l l dunkelbräunlich grün, gehöckert, mit zahlreichen bräunlichgrünen Schuppen, aus deren Achseln weiße Wolle und 3 12 weiße, braun bespitzte, bis 4 mm lange Stacheln treten. Receptaculum etwa 1,3 cm (über dem Ovarium gemessen). Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r braun, fast lanzettlich dreieckig, mit 15 mm langen, weißen Stacheln in den Achseln; i n n e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich, spitz oder stachelspitzig, bis dunkelkarminrot, innerste spatelförmig, spitz oder stumpf, mit Stachelspitze, oben gezähnelt, purpurrot, ins Violette oder magenta; S t a u b b l ä t t e r äußerst zahlreich, die Hälfte der Blütenhülle erreichend; Staubfäden karminrot; Staubgefäße chromgelb. Der weiße G r i f f e l überragt mit den schräg aufrechten, smaragdgrünen N a r b e n die Staubgefäße. F r u c h t eine bestachelte Beere, nahezu rund bis ovoid, grünlich bis purpurrot, 2 3 cm lang, nach der Reife die Stacheln verlierend. S a m e n ca. 1,5 mm lang, schief umgekehrt eiförmig oder rundlich mützenförmig, etwas gekrümmt, scharf gekielt und mit basalem, kraterförmigen Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa grobwarzig mit größeren Zwischengrübchen, am breiten Hilumsaum feinwarzig, matt schwarz. var. nicholii L. Benson nicholii, nach dem Entdecker der Varietät, Nichol (USA). Literatur Echinocereus engelmannii var. nicholii L. Benson in Proc. Calif. Acad. sci. XXV/10, Taf. 25, Fig. 1944, S. 258; Cacti of Arizona 1948, S. 85 u. Fig. 23, S. 95. Backeberg C., Cactaceae IV. 1960, S. 2050; Kakt. Lex. 1966, S Krainz, Die Kakteen, 1. XII C VII c
34 Beschreibung Große Gruppen bildend, bis zu 30 Stämmen, aufrechtstehend, cm lang, ca. 5 cm ; Stacheln alle gelb. Heimat Typstandort: Berge über San Felipe, östliche Abhänge der kalifornischen Cordilliere. Cordilliere -> Cordillere Allgemeine Verbreitung: USA (Arizona: Silver Bell Mine, W. Pima County bis zu den Silver Bell Mountains, meistens in der Papago Indian Reservation. Gewöhnlich auf felsigen Hügeln der Wüste auf m Höhe, jedoch nicht auf der Ebene zwischen diesen Erhebungen (Benson). Kultur In mineralreicher, durchlässiger Erde in sehr sonniger, im Sommer warmer Lage, jedoch kalt und trocken überwintern, bei vollständiger Trockenheit auch Fröste ertragend. Blüht nur unter harten Bedingungen im April oder Juni, je nach Verhältnissen. Für Anfänger ungeeignet. Bemerkungen Blüten und Stachelfarben, insbesondere auch Dichte der Bestachelung sind sehr variabel. Baxter l. c. berichtet, daß die Stachelfarbe von einem dunklen blutrot über rot, orange, lohfarben, gelb bis weiß oder gemischt mit einer anderen Farbe variiere; die ganze Pflanze zeige dieselbe Farbe, aber schon einige Zentimeter daneben fänden sich Pflanzen mit anderen Farben. Die Farbe verliere sich, sobald die Pflanzen von der Wüste in die Küstengärten ge bracht werden. Die roten Früchte sind eßbar, und da sie häufig vorkommen, bilden sie eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Insekten. Das Ovarium ist stark zuckerhaltig; die Samen enthalten viel Fett. Die Pima Indianer in Sacaton betrachten die Früchte als eine Delikatesse (Benson l. c.). Farbbild (Standortsaufnahme) von Dr. E. Lindsay USA Wiedergabe der Tafel.57 aus Engelmann Cact. Boundary: Fig. 1) Kopfstück, 2) junge Stachelareole, 3) und 4) ältere Stachelareolen, 5) Frucht, 6) Samen, alles von derselben Pflanze aus Sonora, leg. A. Schott. Fig. 7) Sa men vom Holotypus, leg. Dr. Parry. SW Standortsaufnahme von var. nicholii L. Bens. Photo: W. H. Earle. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1969
35 Echinocereus enneacanthus Engelmann gr. enneacanthus = neunstachelig; Erdbeerkaktus (strawberry cactus [Texas]). Literatur Echinocereus enneacanthus Engelmann G. in Wislizenus Mein. Tour. North. Mex. 1948, S Schumann K. in Engl. & Prantl. Pflanzenfam. III/6a 1894, S Schumann K. Ge samtbeschr. Kakt , S. 264, 265. Schelle E. Kakteen 1926, S. 169, 170. Berger A. Kakteen 1929, S Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 36, 37. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 345, 346. Borg J. Cacti 1951, S Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S. 2005, Cereus enneacanthus Engelmann G. in Plant. Fendl. 1849, S. 50. Engelmann G. in Cact. Boundary 1858, S. 34, 35 u. Abb. Taf. XLVIII Fig. 2 4 u. Taf. XLIX. Salm Dyck Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 42 u Labouret Monogr. Cact. 1853, S Rümpler Th. Förster Handb. Cact. II 1886, S u. Abb. S Weber in Bois D. Dict. Hort , S Coulter in Contr. U. S. Nat. Herb. III 1896, S Echinocereus carnosus Rümpler Th. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 796, 797. Echinocereus enneacanthus carnosus Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S Quehl L. in Monatsschr. Kakteenkde. XVIII 1908, S Schelle E. Kakteen 1926, S Borg J. Cacti 1951, S Echinocereus enneacanthus major Hildmann in Schelle E. Kakteen 1926, S Borg J. Cacti 1951, S Echinocereus enneacanthus cristatus Hort. Schelle E. Kakteen 1926, S Diagnose nach G. Engelmann (1858) l. c.: Ovato cylindricus, obtusus, laete viridis, simplex seu plerumque dense caespitosus; costis 7 10 obtusis infra dilatatis sursum compressis tuberculatis sulco transverso saepe interruptis, sinibus profundis acutis; areolis orbiculatis remotis; aculeis rectis, radialibus 7 12 (plerumque Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VII c
36 8) albis subpellucidis, inferioribus longioribus, centrali singulo (raro 2 superioribus tenui oribus additis) basi bulboso teretiusculo seu plerumque plus minus compresso triangulatoque albido stramineo seu obscuriore radialibus longiore; floribus subterminalibus seu lateralibus; ovarii pulvillis in squamae triangularis axillis villosis aculeolos 6 12 albidos seu fuscatos gerentibus; sepalis tubi inferioribus cum aculeolis longioribus paucioribus, superioribus oblanceolatis acutis; petalis oblongo obovatis erosis obtusis acu tisve; stigmatibus 8 10 viridibus elongatis erectiusculis; bacca subglobosa e purpureo vires cente; seminibus minutis obovatis subobliquis tuberculatis, hilo oblongo. Beschreibung K ö r p e r durch Sprossung am Grunde dicht und unregelmäßig rasig; Triebe aufstrebend, oft gekrümmt, säulenförmig, oben gerundet, am Scheitel eingesenkt, und dort von kurzem, weißem Wollfilz verdeckt, die obersten Stacheln mäßig dicht darüber geneigt; Sprosse 7 13 cm hoch, bei mastiger Kultur um das doppelte höher, 3,5 5 cm im Durchmesser, bisweilen dicker, lebhaft grün, im Winter oft rot, häufig schlaff und geschrumpft, bei üppiger Kultur dunkel grün. R i p p e n 8 10, gerade, durch breite Querfurchen oft deutlich in Höcker zerlegt, oben zusammengedrückt, stumpf, durch scharfe Buchten gesondert. A r e o l e n 8 15 mm voneinan der entfernt, rund, 2 3 mm breit, mit weißem, kurzem, krausem Wollfilz, bald verkahlend. R a n d s t a c h e l n 7 12 (meist 8), horizontal strahlend, pfriemlich, gerade, stechend, steif, durchscheinend weiß, am Grunde zwiebelig verdickt; die unteren die längsten, aber selten über 15 mm lang; die oberen die kürzesten, bisweilen kaum 2 mm lang. M i t t e l s t a c h e l n meist einzeln, selten noch zwei obere, spreizende Beistacheln; ersterer gerade vorgestreckt oder etwas nach unten gedrückt, rund oder kantig, weißlich, strohgelb oder dunkler, 1,7 4 cm lang. Im Alter vergrauen alle Stacheln. B l ü t e n seitlich, entweder in der Nähe des Scheitels, oder tiefer unten; breit trichterförmig, 4,5 6 cm lang. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) grün, mit zahlreichen, dreiseitigen Schuppen, deren Achseln weiße Wolle und 6 12 weiße oder braune, bis 5 mm lange Borsten tragen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich spitz, etwas bräunlich, mit längeren Borsten. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r spatelförmig, spitz oder stumpf, mit Stachelspitze, oben gezähnelt, rot oder purpurn. S t a u b b l ä t t e r halb so lang wie die Blütenhülle. N a r b e n 8 10, verlängert, schief aufrecht, grün. F r u c h t eine Beere, kugelförmig, grün, etwas rötlich, saftig, bestachelt, 2 2,2 cm lang, wohlschmeckend. S a m e n klein, kaum 1 mm lang, etwas schief, umgekehrt eiförmig, mit länglichem Hilum; Testa mit hervorragenden, leicht unterscheidbaren Warzen. Heimat Standorte: dem Rio Grande entlang, von El Paso bis zum Eagle Paß; bei Laredo; bei El Pablo, Chihuahua; Coahuila. Allgemeine Verbreitung: Texas, Neu Mexiko, U.S.A.; Chihuahua, Coahuila in Mexiko. Kultur wie bei Echinocereus berlandieri angegeben. Bemerkungen Im Alter große Rasen bildende altbekannte Art, die an heißen Standorten im Juni reich blüht. Nur für größere Sammlungen geeignet. Die süßen Früchte schmecken nach Erdbeeren. Die Abbildung zeigt ein etwa 35jähriges Exemplar von etwa 40 cm aus der Städt. Sukkulen tensammlung Zürich. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1964
37 Echinocereus papillosus Linke lat. papillosus = mit Papillen (oder Warzen) versehen Literatur Abb -> Abb. Echinocereus papillosus Linke A. in Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 258, 259; Nachtr. 1903, S. 81 Schelle E. Handb. Kaktk. 1907, S Gürke M. Blühende Kakteen 1909, Taf Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 19, 20. Schelle E. Kakteen 1926, S. 164, 165. Berger A. Kakteen 1929, S Echinocereus texensis Runge in Monatsschr. Kakteenk. IV 1894, S. 61, 62. Mathsson in Monatsschr. Kakteenk. IV 1894, S Echinocereus rungei K. Sch. in Monatsschr. Kakteenk. V 1895, S Cereus papillosus Berger in Rep. Mo. Bot. Gard. XVI 1905, S. 80. Echinocereus angusticeps Clover E. U. nom. nud. in Rhodora Vol. 37, 1935; in Cact. and Succ. Journ. of Amer. VII 1936, S u. Abb. S Echinocereus papillosus var. angusticeps (Clover nom. nud.) Marshall W. T. & Bock T. M. Cactaceae 1941, S Diagnose nach A. Linke l. c.: Vaterland unbekannt. Stamm kriechend, stark verästelt, matt graugrün, in der Jugend bisweilen bräunlich angelaufen. Rippen meistens 6, sehr flach und weitläufig gestellt, durch Höcker unterbrochen. Stachelpolster durchschnittlich 15 mm voneinander entfernt, auf den 3 5 mm hohen Höckern sitzend, rund, gewölbt, in der Jugend mit grauem, bräunlich schimmerndem Filz besetzt, später nackt. Randstacheln 8 10, strahlig, gerade, ziemlich fein, dem Körper fast an liegend, mm lang, in der Jugend braungelb, später grau, mit Ausnahme der 2 nach der Mitte des Polsters gerichteten, welche die Jugendfarbe behalten. Mittelstacheln 3, der längste (25 mm) nach unten gerichtet, die beiden anderen, kürzeren (20 25 mm) seitwärts horizontal gestreckt, alle von derselben Färbung. Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VII c
38 Beschreibung K ö r p e r am Grunde rasenförmig sprossend. Äste ca. 20 cm lang, 3 4 cm dick, niederliegend, laubgrün. S c h e i t e l durch Höcker und schwach gelblich weißen Wollfilz geschlossen und von Stacheln überragt. R i p p e n 7 8, durch sehr tiefe Buchten völlig in kegelförmige Warzen von 1 cm Höhe aufgelöst. A r e o l e n kreisrund, mm voneinander entfernt, 2 2,5 mm im Durchmesser, mit gelblich weißem Wollfilz, bald verkahlend. R a n d s t a c h e l n meist 7, spreizend, das untere Paar am längsten, bis 1 cm lang; im Neutrieb weiß, später die stärkeren oben blaßgelb, pfriemlich. M i t t e l s t a c h e l n einzeln, aufgerichtet, etwas länger und stärker, bernsteingelb, am Grunde bräunlich. B l ü t e n aus den seitlichen Areolen, 6 cm lang, 8 12 cm breit. Pericarpell (Frucht knoten) beschuppt und mit zahlreichen, weißen Stacheln. R e c e p t a c u l u m (Röhre) zylin drisch, mm lang, gehöckert, mit Schuppen auf den Höckern. Schuppen lineal lanzettlich, 2 5 mm lang, 1/2 mm breit, grünlich violett mit helleren Spitzen, bald vertrocknend und sich krümmend, ihre Achseln mit ganz kurzem, feinem, weißem Wollfilz und 2 4 rein weißen, wenig stechenden, 8 12 mm langen Stacheln. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r kürzer, schmaler, dunkler olivgrün, allmählich in ihrer Form in die Schuppen der Röhre und des Fruchtknotens übergehend. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich bis spatelig, ziemlich lang zugespitzt, gegen die Spitze zu mit unregelmäßig gezähneltem Rande, oft auch zerschlitzt, blaß grüngelb, seiden glänzend, etwas durchscheinend, außen mit einem olivgrünen, unten verbreiterten, oben schar lachroten Mittelstreifen, auch innen am Grunde mit scharlachroten Streifen, 5 6 cm lang, 10 bis 18 mm breit. S t a u b f ä d e n 8 mm lang, hellgelb, am Grunde scharlachrot. S t a u b b e u t e l länglich, 1,5 2 mm lang, hellgelb. G r i f f e l weiß, nach oben zu ein wenig grünlich, mit 9 grünen N a r b e n. F r u c h t fast kugelig, etwa 15 mm im Durchmesser, olivgrün, mit leicht abfallenden, gelblich bestachelten Areolen. S a m e n rundlich mützenförmig mit basalem, rundlichem, nur wenig versenktem Hilum mit seitlich eingeschlossenem kleinem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, um das Hilum fein, sonst grobwarzig (Frucht und Samen nach Krainz). Heimat Allgemeine Verbreitung: Texas, nach Clover l. c. in offenen Mesquitewäldern. Kultur wurzelechter Pflanzen in durchlässiger, nahrhafter Erde von leicht saurer Reaktion (z. B. 1/3 Rasenerde, 1/3 Heideerde, 1/6 Mistbeeterde, 1/6 Bimskies). Im Sommer wie im Winter, wenn immer möglich, an voller Sonne; im Winter ziemlich trocken bei 6 10 Grad C. Einfacher ist die Pflege gepfropfter Pflanzen. Hierzu eignen sich sowohl C. spachianus wie C. jusbertii, sie blü hen auf beiden Unterlagen gleich willig, wenn sie sonnig und warm stehen. Vermehrung durch Stecklinge. Anzucht aus Samen. Bemerkungen Wurzelecht gezogene Pflanzen bleiben meist kleiner im Körper und färben sich im Hochsommer etwas rötlich. Die von Clover l. c. abgetrennte Form ist ein nom. nud. und von unseren wurzelecht gezogenen Pflanzen kaum verschieden. Auffällige, durch ihre rotschlundigen gelben Blüten besonders schöne Art. Kommt in sonnigen Lagen auch noch vor dem Fenster zum Blühen. Die Abbildung zeigt ein gepfropftes Exemplar aus der Städt. Sukkulentensammlung Zürich, das alljährlich im Mai blüht. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 1 : 2. C VII c Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1960
39 Echinocereus pentalophus (De Candolle) Lemaire gr. pentalophus = fünfrippig Literatur Cereus pentalophus De Candolle P. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris XVII 1828, S Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S Salm Dyck in Cact. Hort. Dyck. 1850, S. 41 u Labour. Monogr. 1858, S Cereus pentalophus simplex De Candolle P. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris XVII 1828, S Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S Cereus pentalophus subarticulatus De Candolle P. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris XVII 1828, S Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S Curtis Botanical Mag. 1839, Taf Cereus pentalophus radicans De Candolle P. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris XVII 1828, S Cereus propinquus De Candolle P. in Salm Dyck in Allg. Gartenztg. I 1833, S Cereus leptacanthus De Candolle P. in Salm Dyck in Allg. Gartenztg. I 1833, S Salm Dyck Cact. Hort. Dyck. 1843, S. 23. Palmer in Rev. Hort. 1864, S Palmer in Rev. Hort. 1865, S. 171 u. Abb. Cereus pentalophus leptacanthus Salm Dyck Cact. Hort. Dyck. 1850, S. 42. Echinocereus pentalophus Lemaire Cact. 1868, S. 56. Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S. 774, 775 u. Abb. S. 785 als Echinocereus leptacanthus. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 21, 22 u. Abb. S. 20, Taf. III Fig. 1. Berger A. Kakteen 1929, S Werdermann E. Blühende Kakt. u. a. sukk. Pfl. XVI 1933 Taf. 61. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 343, 344. Echinocereus pentalophus leptacanthus (S. D.) Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S Echinocereus leptacanthus (DC.) Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 260, 261. Gürke M. Blühende Kakteen 1901, Taf. 15. Schelle E. Kakteen 1926, S. 165, 166. Krainz, Die Kakteen, 15. VII C VII
40 Diagnose nach P. De Candolle l. c.: C. PENTALOPHUS, erectus cinereo viridis obtusus, costis 5 verticalibus obtusis, fasciculis approximatis, areolâ juniore velutinâ, aculeis 5 7 setaceis divergentibus junioribus albido flavidis, adultis griseis. ђ in Mexico. Cl. Coulter hìc conjungit tres varietates in posterum forsan separandas, nempè: a. simplex, caule simplici non radicante, sinubus latis obtusis, costis parum prominulis, aculeis albidis. b. subarticulatus, caule ramoso subarticulato non radicante, costis irregularibus subrepandis, sinubus angustis, aculeis junioribus flavescentibus. g. radicans, caule radicante, costis latis brevibus, aculeis junioribus flavescentibus. Beschreibung K ö r p e r halb niederliegend, am Grunde reichlich verzweigt, rasenförmig, etwas glänzend, sattgrün, bisweilen rötlich überhaucht. Glieder etwa fingerdick, bis ca. 15 cm lang; S c h e i t e l mit wolligen Areolen und von bräunlichen Stacheln überragt. R i p p e n meist 5, gerade oder etwas spiralig herablaufend, oben scharf getrennt, nach unten zu verflachend, etwas über 5 mm hoch, besonders um den Scheitel stark gehöckert. A r e o l e n meist etwas über 1 cm voneinander entfernt, klein, mit kurzem, spärlichem, weißem Wollfilz, bald kahl. R a n d s t a c h e l n meist 4 6, strahlenförmig angeordnet, bis 7 mm lang, nadelförmig, etwas stechend, zuerst bräunlich, dann weißlich, mit dunklerer Spitze. M i t t e l s t a c h e l 1 oder fehlend, etwas dunkler und kräftiger, aber selten mehr als 1 cm lang. B l ü t e n etwas von der Spitze entfernt stehend, fast 10 cm lang und bis 8 cm breit. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) grün, ebenso wie das R e c e p t a c u l u m (Röhre) außen mit kleinen roten Schüppchen bedeckt, aus deren Achseln weiße oder etwas hellbräunliche Wolle und mehrere gelbe bis braune, steife Borsten entspringen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich, zuge spitzt, olivfarben bis rötlich; i n n e r e mehr spatelförmig, oben stumpf oder mit kurzem Spitzchen und etwas gezähnelt, karmin bis rosenrot, mit violettlichen Tönen, am Grunde viel heller, fast cremefarbig. S t a u b f ä d e n grünlichweiß. S t a u b b e u t e l chromgelb. G r i f f e l etwas gerieft, weiß mit ca tiefgrünen N a r b e n, die die Staubgefäße überragen. F r u c h t oval, 1 1,5 cm lang, grün, unregelmäßig aufreißend, stark bestachelt, einzelne Areolen mit bis 10 Stacheln von 4 10 mm Länge und grauer bis gelber Farbe. S a m e n ca. 1 mm groß, klein, linsenförmig, zusammengedrückt, am Grunde mit einem engen, länglichen, abgestumpften Hilum und warziger matt schwarzer Testa. Heimat Allgemeine Verbreitung: Östliches Mexiko und südliches Texas. wie Echinocereus berlandieri (Eng.) Palm. Kultur Bemerkungen Ziemlich sparrig wachsende, Ende Mai blühende Art, die besonders im Alter viel Platz beansprucht. Nur für größere Sammlungen. Die Abbildung zeigt ein in der Städt. Sukkulentensammlung seit dreißig Jahren kultiviertes Exemplar, das inzwischen allerdings schon mehrmals geteilt wurde. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 1 : 2. C VII Krainz, Die Kakteen, 15. VI. 1960
41 var. procumbens (Engelmann) Krainz comb. nov. gr. procumbens = niederliegend var set back to regular Literatur Cereus procumbens Engelmann G. in Pl. Fendl. 1849, S. 50; in Pl. Lindh. 1850; Cact. Boundary 1856, S. 38, 39 u. Abb. Taf. LXIX Fig Echinocereus procumbens Lemaire Cact. 1868, S. 56. Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S u. Abb. S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 259, 260. Schelle E. Kakteen 1926, S. 165 u. Abb. Nr. 55. before Schelle Echinocereus procumbens gracilior Dautw. in Schelle E. Kakteen 1926, S Echinocereus procumbens longispinus Hort. in Schelle E. Kakteen 126, S Diagnose nach G. Engelmann 1850 l. c.: CEREUS PROCUMBENS (sp. nov.): humilis perviridis; caule subtereti seu 4 5 angulato articulato ramosissimo; tuberculis distinctis spiralibus seu 4 5 fariis; areolis parvis orbiculatis; aculeis rigidis brevibus albidis apice fuscis, 4 6 radiantibus, centrali nullo seu singulo paullo longiore obscuriore; floribus sub apice ramorum lateralibus magnis; ovarii pulvillis sub 25 albidovillosis aculeolos rigidos 6 9 breves variegatos gerentibus; sepalis tubi exterioribus aculeoliferis, superioribus sub 15 linearilanceolatis acumunatis; petalis linearispathulatis acutis seu obtusis; integris seu plerumque eroso dentatis patulis demum recurvis violaceis basi flavidis; stigmatibus stamina flavicantia superantibus; bacca ovata viridi irregulariter dehiscente; seminibus parvulis lanticularibus basi hilo oblongo truncatis verri culosis. Beschreibung K ö r p e r und Blüten wie bei der Art; R a n d und M i t t e l s t a c h e l n länger und stärker, bräunlich gespitzt. Heimat Standort: an der Mündung des Rio Grande unterhalb Matamoros. Allgemeine Verbreitung: Staat Tamaulipas, Mexiko. wie die Art. Kultur Krainz, Die Kakteen, 15. VII C VII
42
43 Echinocereus salm dyckianus Scheer salm dyckianus, nach dem Fürsten Jos. von Salm Reifferscheid Dyck, hervorragender Kenner und Autor von sukkulenten Pflanzen, besaß eine große, weithin berühmte Sammlung Echinocerneus corrected in Echinocereus Literatur Echinocereus salm dyckianus Scheer F. in Seeman, Voyage of the Herald , S Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S. 808, 809. Schumann K. in Monatsschr. Kakteenk. 1893, S u. Abb. S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 255, 256. Gürke M. Blühende Kakteen 1903, Taf. 29. Britton N. L. & Rose J. N. Cacta ceae III 1922, S. 7 u. Abb. Schelle E. Kakteen 1926, S. 162, 163 u. Abb. Taf. 54. Berger A. Kakteen 1929, S. 171 u. Abb. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Cereus salm dyckianus Hemsley in Biol. Centr. Amer. Bot. I 1880, S Weber in Dict. Hort. Bois. 1894, S Echinocereus salmianus Hort. Rümpler T. Först. Handb. II 1886, S. 809, Schelle E. Kakteen 1926, S Cereus salmianus Weber in Dict. Hort. Bois. 1894, S Echinocereus salm dyckianus gracilior Hort. Schelle E. Kakteen 1926, S Diagnose nach F. Scheer l. c.: Species praesingularis, Cereis flagriformibus similis bipedalis plusve et diametro vix pollicari; caule cylindraceo ad basin et superne valde prolifero, decumbente, carnoso, submolli, 7 8 sulcato; costis repandis, subtuberculatis; pulvillis approximatis, junioribus gilvo tomentosis, aculeis gracilibus rectis, exterioribus 8 10 radiantibus, interiore 1 (interdum 2 vel 3) duplo longiore plusve et paullo validiore, ad basin subnoduloso porrecto, omnibus griseis. Received Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VII
44 Beschreibung K ö r p e r am Grunde sprossend und Rasen bildend. Einzeltriebe 5 10 cm lang, 2 2,5 ( 3) cm dick, zylindrisch, oben gerundet, am Scheitel eingesenkt, nicht mit Wollfilz bedeckt, dunkelgrün, später ins Graue. R i p p e n 7 9, mit gegen den Scheitel zu scharfen Furchen, die gegen den Grund zu verflachen; gerade oder etwas spiralig gedreht, gerundet, nur wenig buchtig gegliedert. A r e o l e n rund, 3 5 mm im Durchmesser, 5 8 mm voneinander entfernt, jung mit gelbem, kurzem Wollfilz, im Alter verkahlend. R a n d s t a c h e l n 8 9, gelblich, an der Spitze zuweilen rosenrot, der oberste und unterste die längsten (bis 7 mm). M i t t e l s t a c h e l n einzeln, bis 1,5 cm lang, pfriemlich, stark stechend, hellhornfarben oder rot. Im Alter vergrauen alle Stacheln und fasern an der Spitze auf. B l ü t e n seitlich, einzeln oder zu mehreren, cm lang, 5 6 cm breit, verlängert trichterig. F r u c h t k n o t e n (Pericarpell) frischgrün, gehöckert, mit kurzen Schuppen bedeckt, deren Achsen zottige, weiße Wolle und 9 11 weiße, borstige, leicht abfallende Stacheln tragen. R ö h r e (Receptaculum) grün bis bräunlich, innen am Grunde gelb, außen höckerig beschuppt und bestachelt, mit weißen, bis 1,5 cm langen Stacheln. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich, spatelförmig, spitz, mohrrübenfarbig; i n n e r e etwas blasser. S t a u b f ä d e n unten weiß, oben rosenrot bis purpurfarbig; B e u t e l gelbrot. Der weiße G r i f f e l überragt sie mit smaragdgrünen N a r b e n. F r u c h t eine fast kugelige, 2 cm große, grüne Beere. S a m e n (nach Krainz) etwa 15 mm im Durchmesser, rundlich mützenförmig mit etwas schief angelegtem Hilum und eingeschlossenem trichterigem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, grobwarzig. Heimat Allgemeine Verbreitung: Staaten Chihuahua und Durango, Mexiko. Kultur einfach in mineralreicher, sandiger Erde (Rasenerde) bei voller Sonne und genügend Feuchtigkeit im Sommer. Im Winter trocken bei 2 8 Grad C. Blüht an sonnigen Standorten auch noch gerne vor dem Fenster. Im Winter im Zimmer Spinnmilben anfällig. Alte Körper verkorken mit der Zeit, daher ist gelegentliches Verjüngen durch Stecklinge ratsam. Anzucht aus Samen. Bemerkungen Diese Pflanze wurde um 1850 herum an den im Bot. Garten Kew tätigen Gärtner Scheer gesandt und von diesem darauf zur Bestimmung an Salm-Dyck weitergeschickt. Während der Blütezeit (Ende Mai) durch die rübenfarbenen Blüten aus frischgrünen Körpern sehr auffällige, schöne Art. Die Abbildung zeigt einen Teil eines älteren Exemplares der Städt. Sukkulentensammlung Zürich. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 1 : 2. C VII Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1960
45 Echinocereus stramineus (Engelmann) Rümpler lat. stramineus = strohgelb Literatur Cereus stramineus Engelmann G. in Proc. Amer. Acad. III 1856, S Engelmann G. Cact. Bound. 1858, S. 35 u. Abb. Taf. 46, 47, 48/1. Coulter in Wash. Contr. III 1896, S Weber A. in Bois Dict. d Hort , S Echinocereus stramineus (Engelmann) Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 797, 798. Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 278, 279. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 40, 41 u. Abb. S. 41. Schelle E. Kakteen 1926, S. 166, 167. Berger A. Kakteen 1929, S. 182, 183. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 369 u. Abb. Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S. 2053, 2054 u. Abb. S Echinocereus stramineus major Hort. Schelle E. Kakteen 1926, S. 167 u. Abb. 57. Diagnose nach G. Engelmann 1858 l. c.: C. stramineus, (sp. nov.): ovato cylindricus, versus apicem attenuatus, laete viridis, caespitosus densissimeque agglomeratus; costis sursum compressis obtusis tuberculatis transverse sulcatis; areolis orbiculatis remotis; aculeis radialibus 7 10 (plerumque 8) rectis seu paullo curvatis basi bulbosis teretibus seu inferioribus subinde angulatis albis sub pellucidis subaequalibus; aculeis centralibus subquaternis basi bulbosis angulatis elongatis radiale longe excedentibus saepe flexuosis stramineis fuscatis, nascentibus saepe roseis seu purpureis, superioribus sursum divergentibus, inferiore latiore porrecto seu paullo deflexo; floribus lateralibus grandibus; ovarii squamis triangularibus et sepalis tubi late campanulati inferioribus oblongis abrupte cuspidatis in axilla villosa aculeolos paucos flexuosus elongatos Krainz, Die Kakteen, 1. XII C VII
46 gerentibus; sepalis superioribus oblongo obovatis obtusis seu cuspidatis; petalis late obovatis obtusis eroso denticulatis; stigmatibus elongatis erecto patulis; bacca ovatosubglobosa magna purpurascente aculeolis elongatis numerosis deciduis armata; seminibus obovatis obliquis tuberculatis; hilo oblongo parvo; cotyledonibus subcurvatis. Beschreibung K ö r p e r durch sehr reichliches Sprossen am Grunde rasenförmig, oft äußerst dichte, um fangreiche, bis mehrere Hunderte von Köpfen zählende, halbkugelige, oft mehr als 2 m breite Klumpen bildend. Einzelsprosse eiförmig bis zylindrisch, cm lang, 4 6 cm dick. S c h e i t e l mäßig eingesenkt, mit kurzer, weißer Wolle verdeckt und von den langen, zusammenge neigten Stacheln überragt. R i p p e n 11 13, stumpf, oben zusammengedrückt, durch scharfe Furchen gesondert und Buchten in Höcker gegliedert, frisch grün. A r e o l e n rund, etwa 5 mm im Durchmesser, 25 mm voneinander entfernt, erst von weißem, kurzem, gekräuseltem Woll filz bedeckt, später verkahlend. R a n d s t a c h e l n 7 10, meist 8, horizontal strahlend oder etwas schräg aufrecht, gerade oder wenig gebogen, pfriemlich, stechend, stielrund oder die unterer längeren kantig, weiß, durchscheinend, fast gleich lang, mm, manchmal bis 40 mm lang. M i t t e l s t a c h e l n 3 4, viel länger, bisweilen bis zu 9 cm lang, stärker, gekrümmt und manchmal gewunden, kantig, strohgelb oder bräunlich; im Neutrieb rosarot oder rubinfarbig, durchscheinend, die oberen kürzeren spreizend, nach oben gewendet, der un tere gerade vorgestreckt oder nach unten gedrückt. B l ü t e n seitlich, 6,5 9 cm lang, weit trichterförmig. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) grün, mit vielen grünen, dreiseitigen Schuppen, deren Achseln Wolle und wenige (4 5) kurze, 3 bis 5 mm lange, weiße, gekrümmte Stacheln tragen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r länglich, plötz lich in eine Spitze zusammengezogen, bräunlichgrün, mit zahlreicheren, doppelt so langen Bor sten in den Achseln; i n n e r e länglich, verkehrt eiförmig, stumpf, stachelspitzig, ins Bräun liche gehend; i n n e r s t e breit spatelförmig, stumpf, kurz zugespitzt, gezähnelt, glänzend purpurrot oder tief dunkelrot bis gegen scharlachrot. S t a u b b l ä t t e r die halbe Länge der Blütenhülle nicht erreichend. G r i f f e l mit schräg aufrechten, smaragdgrünen N a r b e n die Staubblätter weit überragend. F r u c h t eine ellipsoidische, purpurrote Beere, mit vielen, später abfallenden Stacheln, eßbar, im Geschmacke zwischen Stachelbeeren und Erd beeren stehend. S a m e n etwa 1 mm lang, schief umgekehrt eiförmig, mit kleinem, länglichem Hilum und verhältnismäßig großwarzig punktierter Testa. Heimat Standorte: trockene Berghänge und geröllreiche Hochländer; vom Pecos Flusse bis El Paso Aguascalientes -> Aguas und zum Rio Gila, bis Aguas Calientes. Calientes Allgemeine Verbreitung: Südliches Neu Mexiko, Arizona, West und Südtexas (U. S. A.) bis Nord Chihuahua, Coahuila und San Luis Potosi (Mexiko). Kultur wie bei Echinocereus berlandieri. Verlangt im Sommer den sonnigsten und wärmsten Standort, möglichst ohne Glasbedeckung. Vermehrung durch Trieb Stecklinge. Bemerkungen Auffällige, für Anfänger jedoch ungeeignete Art, die in unseren Klimaverhältnissen nicht reich blüht. Das abgebildete, über dreißigjährige Exemplar der Städt. Sukkulentensammlung Zürich blüht jeweils im Juli. Photo: H. Krainz. Abb. 1 : 2. C VII Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1962
47 Echinocereus subinermis Salm Dyck lat. subinermis = fast unbewehrt Literatur Echinocereus subinermis Salm Dyck in Seem. Voyage Herald , S Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S Schumann K. in Engler & Prantl Pflanzenfam. III/6a 1894, S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 250, 251. Gürke M. Blühende Kakt. I 1900 Taf. 3. Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXVI 1916, S. 98 u. Abb. S Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 16 u. Abb. Schelle E. Kakteen 1926, S. 161 u. Abb. Nr. 52. Berger A. Kakteen 1929, S. 169, 170. König G. in Zeitschr. Sukkulentenkunde 1927/28, Heft 10, S. 218, 219 u. Abb. Taf. 5. Werdermann E. Blühende Kakt. u. a. sukk. Pflanz. II Taf. 8, Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S U. Abb. Gräser R. in Kakt. u. a. Sukk. XI/1, 1960, S. 1, 2. Cereus subinermis Hemsley Biol. Centr. Amer. Bot. I 1880, S Weber A. in Bois D. Dict. Hort , S Echinocereus luteus Britton N. L. & Rose J. N. in Contr. U.S. Nat. Herb. XVI 1913, S. 239 u. Abb. Taf. 67. Vaupel F. in Kakteenkde. XXIII 1913, S Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 16 u. Abb. S. 17. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Backeberg C. in Beitr. Sukkulentenkde. u. pflege 1938, S. 73, 74 u. Abb. Echinocereus subinermis S. D. var. luteus (Britton & Rose) Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S u. Abb. S. 1993, Diagnose nach Salm Dyck l. c.: Echinocereus subinermis, S. D. in literis. Planta distinctissima, clavata vel sub globosa, aeruginosa, 5 vel 6 costata, subnuda quasi inermis, costis acutis repandis; areolis 6''' distantibus minutis; aculeis 3 4 minutissimis, sub lente subulatis. Flos magnus, speciosissimus, luteus. Tubus abbreviatus, subpollicaris. Petala pallide lutea, spathulato lanceolata ad margines superne erosa, apice acuta. Stamina collecta stylo adpressa, filamentis flavidis antherisque croceis. Stylus staminibus longior, stigmata 8 viridia. Planta emortua. Received 1845 and afterwards. Krainz, Die Kakteen, 1. IV C VII
48 Beschreibung K ö r p e r meist einfach, selten sprossend, erst fast kugelförmig, später säulig, meist 10 15, seltener auch bis 20 cm hoch und am Grunde 7 9 cm breit; im Neutrieb lebhaft grün, an älteren Teilen mehr in graue, bräunliche oder bläuliche Töne übergehend, oft stellenweise fast rötlich überhaucht. Scheitel etwas eingesenkt, ohne Wollfilz. R i p p e n 5 8, meist 6 7, oben durch schwache Furchen gesondert, am Grunde des Körpers sich allmählich verflachend, oft etwas querrunzelig. A r e o l e n klein, rundlich, in der Jugend etwas weißwollig, später verkahlend, ca. 1 cm voneinander entfernt. Stacheln an jungen Pflanzen noch verhältnismäßig deutlich; R a n d s t a c h e l n 6 8, M i t t e l s t a c h e l einer; alle dünn, gelblich, bis 5 mm lang. Ältere Pflanzen tragen nur etwa 4 kurz kegelförmige Stacheln von kaum über 1 mm Länge. B l ü t e n aus dem oberen Teile des Körpers, meist zu mehreren, 7 cm lang und geöffnet ebenso breit, hellgelb, leicht süß duftend; Blütenknospen spitz, rötlich, mit langen, bräunlichen Stacheln. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) dunkelgrün, mit zahlreichen Areolen, die in den Achseln kleiner Schuppen stehen und kurzen, weißen Wollfilz, sowie 7, oder mehr, borsten förmige, bis 5 mm lange, weiße, bisweilen kurz braun gespitzte Stacheln tragen. R e c e p t a c u l u m (Röhre) außen olivgrün, schwach gerieft, wie das Pericarpell bekleidet, jedoch mit bis zu 1 cm langen Borstenstacheln. H ü l l b l ä t t e r: äußere olivgrün bis bräunlich, innere hellgelb, mit blaßrötlichem oder bräunlichem Mittelstreifen auf dem Rücken, innerste rein gelb; umgekehrt lanzettlich, mm lang, fast 1 cm breit, zugespitzt, am Rande meist etwas gezähnelt. Staubblätter wenig länger als die Hälfte der Blütenhülle, dicht um den Griffel angeordnet. S t a u b f ä d e n blaßgelb bis gelb. S t a u b b e u t e l leuchtend chromgelb. G r i f f e l grünlichgelb, etwas längsgestreift, die Staubblätter mit 8 10 dunkel smaragd grünen, nur wenig spreizenden Narben überragend. F r u c h t dunkelgrün, in der Form einer Olive ähnlich, 2 cm lang, 13 mm breit, mit leicht abfallenden Stachelbündeln, die einen gelb lichen Fleck auf der Fruchthaut hinterlassen. Im Fruchtinnern findet sich ein saftiges, weiches Fruchtfleisch mit zahlreichen S a m e n, ca. 0,8 mm lang, eiförmig, mit grundständigem Hilum und dunkelbrauner, körnig punktierter, z. T. grobwarziger Testa. Heimat Standorte: auf den hohen Bergen über Alamos in der Sonora; bei Noria und Bajada (Sinaloa). Allgemeine Verbreitung: Staaten Chihuahua, Coahuila, nordöstliches Durango bis zur Grenze mit Zacatecas; Sinaloa; Sonora, Mexiko. Kultur wurzelechter Pflanzen in gut durchlässiger Erde von saurer Reaktion. Im Sommer warmer, sonniger Standort bei genügender Feuchtigkeit, im Winter nicht allzu trocken bei C. Am besten wird gepfropft auf Erioc. jusbertii oder Trichoc. spachianus. Anzucht aus Samen, die sehr langsam keimen. Bemerkungen Mitte des vorigen Jahrhunderts in Europa eingeführte Art. Ältestes Exemplar wurde um 1902 im Bot. Garten Berlin vegetativ vermehrt und von dort hauptsächlich verbreitet. Ihre Blü ten sind selbststeril, erscheinen im Mai oder Juni, öffnen sich bei Sonnenschein und halten mehrere Tage. Bestachelung und Blütengröße sind variabel. Eine etwas schwächer bestachelte Form mit etwas kleineren, manchmal auch schlankeren Blüten wurde von Br. & R. als Echcer. luteus beschrieben. Aus Sonora stammende Echcer. luteus Br. & R., die in Zürich untersucht wurden, rechtfertigen eine Abtrennung von unserer Art nicht, auch nicht als Varietät. Es gibt auch Pflanzen mit gefransten Bl. Hüllblättern. Samen und Früchte sind aber nicht unterscheidbar. Im Gegensatz zu seiner Überzeugung vom Jahre 1938 führt Backeberg * den Echcer. luteus Br. & R. heute wieder als Varietät zu unserer Art. Für die Kultur ohne Glas sind nur gepfropfte Exemplare zu empfehlen. Die Abbildung zeigt ein sehr kurzstacheliges Exemplar aus der Städt. Sukkulentensammlung Zürich. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 1 : 1,2. * Backeberg schreibt 1938, S. 74 l. c.: Vor kurzem habe ich nun von einem amerikanischen Sammler ein Stück erhalten. Es zeigt ganz eindeutig, daß es sich um die gleichen Pflanzen handelt, wie unsere Echinocereus subinermis. Echinocereus luteus Br. & R. ist daher nur als ein Synonym von Echinocereus subinermis anzusehen. C VII Krainz, Die Kakteen, 1. IV. 1962
49 Echinofossulocactus hastatus (Hopffer) Britton et Rose lat. hastatus = speerartig Literatur Echinocactus hastatus Hopffer in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt S Gürke M. in Monatsschr. Kakteenkde. XVII 1907, S. 85, 86. Schelle E. Kakteen 1926, S Echinofossulocactus hastatus (Hopffer) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S Tiegel E. & Oehme H. in Beitr. Sukkulentenkde. u. pflege 1938, S. 80 u. Abb. Nr. 11. Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2763, 2764 u. Abb. S Nr Fig. 11. Brittonrosea hastata (Hopffer) Spegazzini C. Brev. Not. Cact. 1923, S 11. Stenocactus (Echinocactus) hastatus (Hopffer) Berger A. Kakteen 1929, S Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Borg J. Cacti 1951, S Diagnose nach Hopffer in K. Schumann l. c.: Simplex depresso globosus, costis c. 35 pro rate crassioribus acutis crenatis laete viridibus; aculeis radialibus 5 6 validis, superioribus foliaceis flavis, centralibus solitariis validioribus; floribus albis. Bemerkungen K ö r p e r einfach, später an der Basis sprossend, niedergedrückt kugelig, am S c h e i t e l eingesenkt, mit weißem Wollfilz, von den gelben, starken Stacheln überragt; hell bis dunkel Krainz, Die Kakteen, 1. IV C VIII c
50 grün, 10 cm hoch und 8 12 cm breit. R i p p e n 27 35, etwa 1 cm hoch, oben kaum gewellt, gekerbt, nach dem Grunde zu verbreitert, ziemlich dick und meist nicht sehr scharfkantig; durch scharfe Furchen voneinander getrennt. A r e o l e n eiförmig bis abgestumpft dreieckig, über die Stachelpolster hinaus verlängert, 5 8 mm lang, 2 3 cm voneinander entfernt, mit gelb lichweißem Wollfilz, später verkahlend. R a n d s t a c h e l n 5 7, der oberste mm lang, flach, blattartig, am Grunde 1,5 mm breit, gerade; die beiden benachbarten schräg nach oben gerichtet, ebenso flach und breit, mm lang; die 4 unteren, von denen das eine Paar waagrecht steht und das andere schräg nach unten gerichtet ist, bis 10 mm lang, pfriemlich; zu weilen fehlen von den 7 Stacheln der obere, oder ein Paar der unteren; alle sehr steif. M i t t e l s t a c h e l bis 4 cm lang, von oben nach unten etwas zusammengedrückt, aber nicht blattartig, gerade vorgestreckt oder ein wenig nach oben gebogen, sehr starr, stechend. Alle Stacheln hell bernsteingelb, mit etwas dunklerer Spitze, später vergrauend und leicht bestoßen. B l ü t e n mehrere, in Scheitelnähe, 32 mm lang, flach ausgebreitet, kurz trichter bis fast radförmig. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) rundlich, 2 3 mm lang, 3 4 mm breit, rötlichbraun. P e r i c a r p e l l (Röhre) mm lang, 6 mm breit, dicht beschuppt; Schuppen rötlichbraun, mit sehr breiten, hellgrünen, fast weißen Rändern und kurzer Spitze, die untersten breit dreieckig, 3 mm lang und ebenso breit, die oberen bis 5 mm lang und 4 mm breit. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r eiförmig, mit breiten, weißen, durchscheinenden, fein ge zähnten Rändern; deutlich zugespitzt, 7 mm breit, bis 10 mm lang; dunkelviolett. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich, bis 17 mm lang, 3 mm breit, spitz, rotviolett, gegen die Spitze dunkler, heller gerandet. S t a u b b l ä t t e r zahlreich. S t a u b f ä d e n weiß, 7 9 mm lang. S t a u b b e u t e l fast kugelig, schwefelgelb. G r i f f e l 24 mm lang, ganz hell rosafarben. N a r b e n 9, zitronengelb, 3 4 mm lang. Frucht eine schließlich trockene, sich am Grunde ablösende, nur mit wenigen dünnen Schüppchen besetzte Beere. S a m e n ver kehrt eiförmig, 1,5 mm lang, mit basalem, stark vertieftem Hilum und eingeschlossenem Mikro pylarloch; Testa bräunlichgrau bis grünlich, schwach glänzend und netzig gezeichnet. Pericarpell (Röhre) instead of Receptaculum (Röhre)? Not corrected Heimat Standort: Nördlich Pachuca, bei Meztitlan (Mathsson). Allgemeine Verbreitung: Staat Hidalgo, Mexiko. Kultur wurzelechter Pflanzen nur erfolgreich in sonnigster, warmer Lage oder nahe unter Glas bei guter Lüftung; nahrhafte Erde von saurer Reaktion und genügende Bewässerung im Sommer sind Bedingung. Im Winter 8 12 C und fast trocken zu halten. Gepfropfte Pflanzen verlieren meist ihren natürlichen Wuchs und Stachelcharakter. Anzucht au Samen, dann Sämlinge pfropfen und später wurzelecht weiterpflegen. Bemerkungen Eine der bekanntesten Arten, blüht je nach Gegend schon im Februar oder März, leider oft (wie viele in den Sammlungen befindliche Pflanzen dieser Gattung) verbastardiert. Die Abbildung zeigt eine Wildpflanze bei F. Schmoll in Mexiko. Photo: I. Groth. Abb. 1 : 1. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 1. IV. 1962
51 Echinofossulocactus violaciflorus (Quehl) Britton et Rose lat. violaciflorus = violettblütig Literatur Echinocactus violaciflorus Quehl L. in Monatsschr. Kakteenkde. XX 1912, S u. Abb. S Schelle E. Kakteen 1926, S. 211, 212 u. Abb. 96. Echinofossulocactus violaciflorus (Quehl) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 114, 115 u. Abb. S Bertrand A. in Cactus Nr. 31, 1952, S. 18 u. Abb. Cull mann W. in Kakt. u. a. Sukk. 1958, S. 53, 54 u. Abb. S. 53. Backeberg C. Die Cacta ceae V 1961, S. 2777, Brittonrosea violaciflora (Quehl) Spegazzini Brev. Not. Cact. 1923, S. 12. Stenocactus violaciflorus (Quehl) Berger A. Kakteen 1929, S Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 407, corercted in 407 Diagnose nach L. Quehl l. c.: Simplex globosus dein breviter columnaris, costis ad 35 compressis laxius dispositis alte crenatis; aculeis retroflexis 7 interdum 8:3 foliaceis flavis apice brunneis, 4 aut 5 circinatis albis; floribus albis violaceo striatis; staminibus et stylo violaceis. Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VIII c
52 Beschreibung K ö r p e r einfach, flachkugelig, später etwas säulig, oben gerundet, am S c h e i t e l leicht ver tieft, mit wenig weißem Wollfilz geschlossen und von hoch aufgerichteten, kräftigen Stacheln weit überragt; matt bläulichgrün; 5 cm hoch, 7 cm breit. R i p p e n ca. 35, durch oben enge, unten bis 5 mm weite und ebenso tiefe Längsfurchen getrennt; zusammengedrückt, wellig, um die Areolen verbreitert. A r e o l e n etwa 2 cm voneinander entfernt, tief eingesenkt, rund, erst mit wenig grauer, kurzer Wolle bekleidet, bald verkahlend. S t a c h e l n meist 7; der oberste 3 cm lang und am Grunde 5 mm breit, lineal lanzettlich, pfriemlich, scharf gespitzt, blatt bis spanförmig, im Neutrieb honiggelb, brandig gespitzt, gekielt oder geringelt. Die beiden folgenden sind ebenso lang, oft auch länger und dicker, jedoch weniger breit, sonst wie der oberste. Das nächstfolgende Paar mißt 7 9 mm, das unterste etwa 12 mm. Die vier untersten, sowie ein nur hie und da hinter de obersten Stachel hervortretender, der 3 5 mm lang sein kann, sind im Neutriebe glasig weiß, stielrund, pfriemlich, dem Körper angepreßt. Alle Stacheln an der Basis zwiebelig verdickt, bald vergrauend und im Alter einschrumpfend. B l ü t e aus dem Scheitel, zwischen den Stacheln hervortretend, 2,5 cm lang, geöffnet 3 cm breit, trichterförmig. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) kurz, weißgrünlich, wie das R e c e p t a c u l u m (Röhre) mit dreiseitigen bis ovalen, kurz gespitzten Schuppen bedeckt, deren Rand weißhäutig und etwas gekraust ist; die unteren mit grünem, die oberen mit braun aus laufendem Mittelstreifen. H ü l l b l ä t t e r zweireihig, lineal lanzettlich, 4 mm breit, kurz ge spitzt, weiß, mit violettem Mittelstreifen. S t a u b b l ä t t e r bis zur Hälfte der Blüten hülle reichend, F ä d e n violett, gerade, B e u t e l lehmgelb. G r i f f e l die Staubblätter weit überragend, violett. N a r b e n 9, lehmgelb. F r u c h t (nach Krainz) eirunde Beere, etwa 10 mm lang, 8 mm im Durchmesser, mit ganz kurzem Stielchen und dreiseitigen, bis 2 mm breiten, weißen Schuppen; Samen kugelig bis kugelig mützenförmig, etwa 1,5 mm im Durchmesser mit basalem, schwach eingesenktem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa netzig grubig, schwarz, die Flächen innerhalb der Netzmaschen glänzend lederfarben (s. Morpho logie (85). Pericarpell formatted in extended style Heimat Allgemeine Verbreitung: Provinz Zacatecas, Mexiko. Kultur am zweckmäßigsten wurzelecht, in halbschwerer, doch nährstoffreicher Erde von leicht saurer Reaktion; an sehr warmem, sonnigem Standort bei genügend Feuchtigkeit, möglichst ohne Glas, vor allem auch luftig. Im Winter bei etwa 8 12 Grad C, möglichst hell. Gepfropfte Pflanzen erreichen meist nur eine kümmerliche Bestachelung. Anzucht aus Samen nicht schwierig. Bemerkungen Altbekannte, leichtblühende Art, deren Blüten bei Gewächshausüberwinterung schon Mitte März, im Tessin (Schweiz) Anfang Februar erscheinen. Foto: W. Cullmann. Abb. etwa 1 : 1. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1963
53 Echinomastus erectocentrus (Coulter) Britton et Rose lat. erectocentrus mit aufrechtem Stachel. Foto: Oliver Young Bridgton, aus Marshall und Bock (1941) l. c. Literatur Echinocactus erectocentrus Coulter, Contr. U. S. Nat. Herb. III 1896, S Berger A. Kakteen 1929, S Benson L. Cacti Arizona 1950, S Echinomastus erectocentrus (Coult.) Britton N. L. & Rose. J. N. Cactaceae III 1922, S. 148 u. Abb. Marshall W. T. & Bock T. M. Cactaceae 1941 S u. Abb. Marshall W. T. in Saguaroland Bull. Ariz. 1957, S. 45 u. Abb. S. 43. Borg J. Cacti 1945, S Backeberg C. Cactaceae V 1961, S. 2826; Kakteen Lex. 1965, S Neolloydia erectocentra (Coult.) Benson L. in Cacti Arizona 1969, S. 24, appressed -> appressed Diagnose nach Coulter l. c. Broadly ovate and small, with very fiat base, 8 cm high; ribs 21, oblique, tuberculateinterrupted; spines terete, rigid, interwoven; radials 14, pectinate appressed below, spreading above, bulbous at base, 10 to 12 mm long, the 4 or 5 lower ones shorter, with white base and pink tips; the solitary central from the upper part of the areola, longer (20 mm), erect and slightly curved, darker; flowers yellow (?); fruit unknown. Type in Nat. Herb. and Herb. Coulter. Near Benson, Arizona, and also near Saltillo, Coahuila. Specimens examined: Arizona (Evans of 1891); Coahuila (Weber of 1869). Krainz, Die Kakteen, 16. IV C VIII b
54 Foto: R. C. Proctor (Repr.) Beschreibung K ö r p e r kurz zylindrisch, 7 20 cm lang, bis 10 cm im, blaß bläulichgrün. Rippen 15 20, niedrig, gehöckert, dorsal mit ± langer Furche, die an blühfähigen Pflanzen den Blütenvegetationspunkt bildet und sich den A r e o l e n anschließt; diese elliptisch. R a n d s t a c h e l n 13 15, ca. 13 mm lang, spreizend, nadelförmig, gerade, weiß. M i t t e l s t a c h e l n 1 2, bis 25 mm lang, aufwärts gerichtet und im Scheitel nach oben abstehend, nadelförmig, biegsam, am Grunde etwas verdickt, rötlich bis purpurn. Alle Stacheln den Körper fast ganz verhüllend. B l ü t e n einzeln, aus den Blütenvegetationspunkten, meist zu mehreren um den Scheitel, mm lang, offen 40 mm, halbgeschlossen 32 mm im, breit trichterig. P e r i c a r p e l l ± kurz zylindrisch, fleischig, 7 8 mm lang, oben 10 mm im, dickwandig (ca. 3,5 mm), vom Grunde aus mit dreieckigen oder herzförmigen, 4 6 mm langen, gelblichweiß und zart gerandeten, unregelmäßig gezähnten, gefransten, oder z. T. gewimperten, oft in eine kleine, fleischige Spitze auslaufenden Schüppchen mit fleischiger, rötlichbrauner Mittelrippe und Blattbasen, die in ± kurze Kanten auslaufen, sofern die Blättchen nicht imbrikat stehen. Pedicellarzone des Pericarpells etwas ins Achsengewebe eingesenkt. Fruchthöhle kugelig, 3 mm im, am Grunde durch Abriß offen und ganz von den einzelnen, unverzweigten, langen Funiculi mit den breit angesetzten, ovoiden Samenanlagen ausgefüllt, deren inneres Integument weit heraus ragt. R e c e p t a c u l u m ca. 11 mm lang, oben ca. 18 mm im, in der Höhe der Primärstaubblätter ca. 5 mm dick, mit lanzettlichen oder eilanzettlichen, weich und schmal gespitzten, unregelmäßig gezähnten bis gekerbten, erst mm, dann mm langen, ± breit ge randeten Schuppen mit fleischiger Mittelspreite und quaddelartigen, verschieden großen, von Flüssigkeit erfüllten Vakuolen. Nektarkammer schmal, tief rinnenförmig, von der Griffelbasis bis zur Insertion der Primärstaubblätter reichend. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r mm lang, breit lineal lanzettlich, in eine weiche Spitze auslaufend, unregelmäßig kurz gezähnt bis ge kerbt, zart, blaßrosa, gegen die Blattbasis etwas dunkler. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r ca. 25 mm lang, schmal lanzettlich, zart, fein bespitzt, blaßrosa, am Grunde schmaler und dunkler, unregel mäßig gewellt oder kurz und breit gezähnt, mit einzelnen, kleinen quaddelförmigen Vakuolen. Primärs t a u b b l ä t t e r über der Griffelbasis, am unteren Receptaculumteil inse C VIII b Krainz, Die Kakteen, 16. IV. 1973
55 Echinomastus erectocentrus riert. Ihre F i l a m e n t e 9 mm lang, grünlichgelb, mit den ca. 1,2 mm langen, schlanken, gelben A n t h e r e n die Griffelmitte kaum erreichend. Die folgenden Staubblätter länger, die obersten etwa 13 mm lang, mit ca. 1 mm langen, schmalen Staubbeuteln, die bis knapp unterhalb der Narbe reichen. G r i f f e l ca. 23 mm lang, unten 2,5 mm, in der Mitte 2 mm und zuoberst 3 mm dick, blaßgrün, gerade. N a r b e n 7 8, ca. 3,5 mm lang, kopfig oder wenig gespreizt, purpurn, schmalzipfelig, innen und am Rande völlig mit kurzen, breiten, zottigen Papillen be deckt; bis etwa 8 mm unterhalb der Blütenhülle reichend. F r u c h t tonnenförmig, kurz zylindrisch bis fast kugelig, mm lang, oben 9 11 mm im, dickwandig, Wände oben 5 mm und am Grunde 2,5 3 mm dick. Pericarpium wenn trocken derb, strohfarben, basal oder im unteren Teil seitlich aufreißend, überall mit einzelnen Schuppenblättchen, deren Blattbasen in Kanten auslaufen. Der vertrocknete, 2 cm lange Perianth rest reicht in der Mitte nabelartig tiefer in das Pericarpium hinein und ist von diesem durch eine 2 mm dicke, gelbliche bis hellbraune Gewebeschicht getrennt; ziemlich lange anhaftend und wenn abfallend, den Nabel radial einreißend. Fruchtinneres dicht mit Samen, Pulpa und Funiculi aus gefüllt. Die abgefallene Frucht hinterläßt eine ± tiefe, von kurzen Filzhaaren umgebene Narbe. S a m e n ovoid, je nach Standort verschieden groß, in derselben Frucht 1,8 2,2 mm lang, von der Vorder zur Hinterkante 1,4 1,5 (2) mm und von einer Abb. 1a. Echinomastus erectocentrus. Abb. 1b. Blütenlängsschnitt: rechts mit Gefäßbündelverlauf. Narben etwas vergrößert, mit 7 Ästen. Abb. 1c. Perianth: a e = derbfleischige Schuppen, c e mit Flüssigkeit gefüllte Blasen enthaltend. Abb. 1d. Samenanlagen: links im auffallenden, rechts im durchfallenden Licht. Krainz, Die Kakteen, 16. IV C VIII b
56 Abb. 3a. Samen von der Seite, mit äußerer Testa. Abb. 3b. Embryo mit innerer Testa, von der Seite. Psp = Perisperm, W = Wurzelpol, Psp = Restperisperm, Co = Kotyledonenregion. Abb. 3d. Hilumansicht: Hi = Hilum, HiS = Hilum saum, Mi = Mikropyle. Abb. 2. Längsschnitt durch die Frucht: rechts mit Gefäßbündelverlauf. Rp = Receptaculum, Pc = Pericarpium Abb. 3c. Längsschnitt durch den Em bryo: E = Embryo, it = innere Testa, Psp = Restperisperm (schraffiert). Seite zur anderen 1,1 1,2 mm; an der Vorderkante mit einem niedrigen Kamm, der über dem Hilum einen nasenförmigen Vorsprung bildet, unter dem, jedoch außerhalb des Hilums ein ziemlich großes, querovales Mikropylarloch liegt. Hilum von einem schmalen Saum umgeben, ventral, breit oval, kraterförmig, von einem dünnen, gelblichen Gewebe verschlossen. Äußere Testa ziemlich dick, hart, brüchig, glänzend schwarz, mit ziemlich kleinen regelmäßigen, halbkugelig vorgewölbten Warzen ohne Zwischen räume. E m b r y o weiß, gekrümmt, gegliedert, mit gegenüber den Cotyledonen stärker entwickel tem Hypocotyl, von einer gelblichen, chalazal braunen, inneren Testa und einem schmalen Rest perisperm umgeben. Heimat Standorte: im östlichen Teil von Arizona, in den Pinal, Pima und Cochise County, im Desert Grasland, bei m ü. M. Allgemeine Verbreitung: Arizona, USA Kultur in durchlässigem Boden von leicht saurer Reaktion mit viel grobem Sand. Diese typische Wüsten art verlangt sehr wenig Wasser und sonnigen Stand. Am besten wird sie gepfropft und nahe unter Glas gehalten. Für Anfänger wenig geeignet. Bemerkungen Echinomastus erectocentrus ist die Leitart der Gattung, die sich trotz Konvergenzen von Sclerocactus, Pediocactus und Thelocactus unterscheidet. Das untersuchte Material stammt zum grüßten Teil vorn Typstandort und wurde auf Veranlassung von Herrn Charles Glass durch das Ehepaar Kirkpatrick in Kalifornien zur Ver fügung gestellt. Nach Cutak blüht die Pflanze in USA im April während 4 Tagen. Die Blüten öffnen sich vormittags und sind nachts geschlossen. Zeichnungen (Originale) Kladiwa. Foto: Oliver Young Bridgton (aus Marshall und Bock 1941 l. c.; Blütenfoto: R. C. Proctor (Repr.). (Kla.) C VIII b Krainz, Die Kakteen, 16. IV. 1973
57 Echinomastus intertextus (Engelmann) Britton et Rose lat. intertextus = verstrickt oder verwebt Literatur Echinocactus intertextus Engelmann G. in Proc. Amer. Acad. III 1856, S Engel mann G. Cact. Mex. Boundary 1858, S. 27, 28 u. Abb. Taf. XXXIV. Rümpler Förster Handb. Cact. II 1886, S u. Abb. S Weber in Bois Dict. d Hort , S Coulter in Contr. U. S. Nat. Herb. III 1896, S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S. 445, 446. Schelle E. Kakteen 1926, S Berger A. Kakteen 1929, S Cereus pectinatus centralis Coulter in Contr. U. S. Nat. Herb. III 1896, S. 386 u. Abb. Echinocereus pectinatus centralis (Coulter) Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S.271. Echinocereus centralis Rose in Contr. U. S. Nat. Herb. XII 1909, S Echinomastus intertextus (Engelmann) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 149, 150 u. Abb. S Helia Bravo H. Cact. Mex. S Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S u. Abb. S. 2831, ( before Coulter deleted Diagnose nach G. Engelmann Cact. Mex l. c.: E. INTERTEXTUS, (sp. nov.): minor, ovato globosus; costis 13 acutis interruptis, subobliquis; tuberculis supra breviter tomentososulcatis; areolis ovatis (in planta juniore angustio ribus) approximatis; aculeis brevibus rigidis e basi albida rubellis apice fuscatis, radialibus arcte adpressis intertextis superioribus 5 9 setaceis albidis rectis, lateralibus rigidoribus paullo longioribus infimoque robusto brevi saepe paullo recurvatis; aculeis centralibus 4, superioribus radiales excedentibus sursum versis, inferiore brevissimo porrecto robusto; floribus parvis in vertice dense lanato congestis purpurascentibus; ovario brevissimo 5 6 squamato; sepalis tubi 20 late ovatis cuspidatis albo marginatis; petalis oblongis mucronatis; stylo stamina numerosissima vix superante; stigmatibus 7 8 purpureis erectis; bacca globosa sicca squamis evanescentibus subnuda basi subpersistente circumscissa; seminibus reniformibus circa hilum magnum orbiculare ventrale curvatis tenuiter verruculosis lucidis; albumine parco; embryone curvato; cotyledonibus foliaceis brevibus. Beschreibung K ö r p e r einfach, fast kugelig bis eiförmig, frisch grün, oben gerundet, bis 10 cm hoch und 7 cm dick; S c h e i t e l eingesenkt, mit kurzem, dichtem Wollfilz, von schrägen Stacheln über Krainz, Die Kakteen, 1. XII C VIII b
58 deckt. R i p p e n 13, durch horizontale Furchen gegliedert und durch scharfe Längsbuchten voneinander getrennt; gerade oder etwas schief, scharf. A r e o l e n einwenig elliptisch, 3 6 mm lang, 8 11 mm voneinander entfernt, mit reichlichem, weißem, kurzem Wollfilz, bald verkahlend. R a n d s t a c h e l n 16 25, horizontal strahlend und ineinander geflochten; die mittleren die längsten, 9 15 mm lang, gerade oder gekrümmt, aus weißlichem Grunde rötlich, oben braun, steif, pfriemlich, stechend; die unteren ähnlich, aber kürzer, 4 9 mm lang; die obersten 5 9 borstenförmig, gerade, weiß. M i t t e l s t a c h e l n 4, die 3 obersten auf recht, spreizend, mm, manchmal bis 20 mm lang, den Seitenstacheln ähnlich, der vierte viel kürzer, 2 4 mm lang und stärker, gerade vorgestreckt; an jüngeren Pflanzen fehlt von den Mittelstacheln der eine oder andere, manchmal ist auch keiner vorhanden. Hinter der Areole ist eine kurze, wollig bekleidete Furche. B l ü t e n nahe am Scheitel zusammengedrängt; breit, kurz trichterförmig, 2 2,5 cm lang und breit. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) hellgrünlich, mit wenigen Schuppen. R e c e p t a c u l u m (Röhre) mit breit eiförmigen, zugespitzten, roten, weiß gerandeten Schuppen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r ca. 20, lanzettlich, zugespitzt, dunkelrot, mit weißen Rändern. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r 20 25, länglich, stachelspitzig, purpurrot, die innersten heller. S t a u b b l ä t t e r die Hälfte der Blütenhülle nicht erreichend. G r i f f e l rot. N a r b e n 7 8, aufrecht, purpurrot, die Staubblätter überragend. F r u c h t eine kugelförmige, trockene, mit wenigen Schuppen bekleidete Beere, fast ganz kahl, nahe am Grunde unregelmäßig um schnitten aufspringend, 8 10 mm im Durchmesser, grün. S a m e n nierenförmig, 2 mm lang, mit großem, rundlichem, ventralem Hilum und schwarzer, glänzender, sehr feinwarzig punk tierter Testa. Heimat Standorte: von Limpia bis El Paso (Texas) nach Chihuahua. Allgemeine Verbreitung: Südwesttexas bis Südostarizona und Nordmexiko. var. dasyacanthus (Engelmann) Backeberg gr. dasyacanthus = dichtstachelig var set back to regular Literatur Echinocactus intertextus var. dasyacanthus Engelmann G. in Proc. Amer. Acad. III 1856, S. 277; Cact. Mex. Boundary 1958, S. 28 u. Abb. Taf. 35, Fig Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , S Echinomastus dasyacanthus (Eng.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Echinocactus dasyacanthus (Eng.) Berger A. Kakteen 1929, S Echinomastus intertextus var. dasyacanthus (Eng.) Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2832, Diagnose nach G. Engelmann 1858 l. c.:... ovatus seu conoideus; aculeis gracilibus longioribus e purpurascente caesiis, radialibus setaceis pluriserialibus, superioribus 7 9 gracilioribus brevioribus albidis fasciculatis, centralibus 4 vix robustioribus, superioribus 3 sursum versis reliquos excedentibus, inferiore porrecto paullo breviore. Beschreibung K ö r p e r größer, mit längeren und schlankeren S t a c h e l n, die am Scheitel einen Schopf bilden und locker ausgebreitet sind. Der untere Mittelstachel ist mindestens so lang wie die anderen. Standorte: gemein bei El Paso. Allgemeine Verbreitung: Texas. Heimat C VIII b Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1962
59 Echinomastus mapimiensis Backeberg mapimiensis, nach der Sierra Mapimi, dem Fundort der Art. Abb. 1. Foto (Reprodukt.) des Typus aus Backeberg l. c. (1953). Literatur Echinomastus mapimiensis Backeberg C. in Cact. & Succ. Journ. GB XV/3, 1953, S. 67, 68 u. Abb. S. 60; Cactaceae 1961 V, S u. Abb.; Kakt. Lex. 1966, S Diagnose nach C. Backeberg l. c. Singularis, ad 10 cm altus, 8 cm crassus; costis 13, tuberculatis; areolibus 13 mm distantibus; aculeis radialibus ca. 22, ad 22 mm longis, albidis, ± curvatis, radiantibus, implicatis, 4 centralibus, ad 30 mm longis, inferiore semifuscato; floribus ad 3 cm longis, 2 cm latis; phyllis perigonii albidis, in media parte brunnescentibus; ovario squamoso. Patria: Mexico, Sierra de Mapimi (F. Schwarz). Beschreibung K ö r p e r mit Faserwurzeln, einzeln, bis 10 cm hoch, 8 cm im ; Scheitel eingesenkt. R i p p e n ca. 13, in Höcker aufgelöst, graugrün. A r e o l e n rund, wollfilzig. Höcker dorsal mit einer ± lan gen Furche (Blütenvegetationspunkt), die kurze, weiße Haare trägt. R a n d s t a c h e l n 22, mm lang, glasigweiß, gegen den Scheitel zu etwas aufwärts gebogen, sonst anliegend und miteinander verflochten. M i t t e l s t a c h e l n meist 4, bis 3 cm lang, 3 davon aufwärts ge richtet, weiß, braun gespitzt, leicht gebogen; einer abwärts gerichtet, halb so lang wie die anderen, braun, ± hakig gekrümmt. B l ü t e n aus den behaarten Furchen um den Scheitel, einzeln oder zu mehreren, mm Krainz, Die Kakteen, 15. I C VIII b
60 Abb. 2a. Blüte von außen mit Schuppen am Pericarpell und Receptaculum. Abb. 2b. Blütenlängsschnitt, rechts mit Gefäßbündelverlauf (punktiert). Abb. 2d. Samenanlagen: links im Auflicht, rechts im Durchlicht. Abb. 2c. Blütenblätter: a d = Schuppen, a = mit Nervatur, d = mit Flüssigkeitsvakuolen, e = äußeres Hüllblatt, f = inneres Hüllblatt. lang, offen 20 mm im, halbgeschlossen 12 mm; trichterig bis leicht glockig. P e r i c a r p e l l hellgrün, ca. 5 mm lang, am Grunde 5 mm breit, darüber 7 mm im, fleischig (Wand ca. 3 mm dick), mit herzförmigen, steifen, 3 4 mm langen, 4 5 mm breiten, in der Mitte fleischigen, sonst zarten, grünen, weiß gerandeten, gezähnten bis gekerbten, oft spärlich bewimperten Schuppenblättchen locker besetzt. Fruchthöhle kugelig, von kugeligen Samenanlagen mit hervor stehendem, innerem Integument dicht gefüllt, welche an ziemlich langen, breit angesetzten, un verzweigten, dicht nebeneinander inserierten Funiculi hängen. Nektarkammer schmal, tief rinnenförmig, von der Griffelbasis bis zur Insertion der Primärstaubblätter reichend. R e c e p t a c u l u m ca. 8 mm lang, am Grunde 3 mm, an der Spitze 12 mm im ; mit 6 8 mm langen, ca. 5 mm breiten, spateligen, erst hellgrünen, dann hell braunkarminen, unregelmäßig gezähnten, eingeschnittenen Schuppen, deren grünoliver, fleischiger Mittelstreifen kleine, mit Flüssigkeit erfüllte Vakuolen in Quaddelform enthält. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r ca. 19 mm lang, 5 mm breit, spatelförmig, unregelmäßig gezähnt oder gewellt, oben leicht eingebuchtet und kurz, zart gespitzt, gegen die Basis zu sich verschmälernd, hell rosalila, mit ± breitem, braunlila Mittelstreifen. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r ca. 15 mm lang, 3,5 mm breit, spatelförmig, oben etwas eingebuchtet, mit kurzer, zarter Spitze, nach unten schmaler, glatt oder schwach gewellt, rosafarben, mit ± breitem, rotlila Mittelstreifen. Primärs t a u b b l ä t t e r über der Griffelbasis inseriert, mit ca. 8 mm langen S t a u b f ä d e n und schlanken, gelben S t a u b b e u t e l n etwas über die Griffelmitte hinausreichend; folgende Staubblätter kürzer, ca. 6 mm lang, mit ihren Antheren bis etwa 3 mm unter die Narben reichend. Griffel C VIII b Krainz, Die Kakteen, 15. I. 1973
61 Echinomastus mapimiensis ca. 16 mm lang, unten 1,9 mm, in der Mitte 1,5 mm und an der Spitze ca. 1,8 mm dick, in den beiden unteren Dritteln rosa. N a r b e n 10, lineal, gelblichweiß, ca. 4 mm lang, spreizend, bei halbgeschlossener Blüte die Hüllblätter fast erreichend; auf der Oberfläche mit dünnen Papillen. F r u c h t eine Trockenfrucht, ca. 9 mm lang, 8 mm breit, tonnenförmig bis kugelig, strohfarben, mit kurzem, behaartem, ca. 4 mm langem Stielchen und ganz mit vertrockneten, gelblich braunen Schuppen bedeckt. Pericarp dünn, spröde, am Grunde längs, und nach dem Abfallen des Perianthrests oben radial aufreißend. Samen das Fruchtinnere völlig ausfüllend und das trockene Perikarp bucklig nach außen vorwölbend, das mit den trockenen Schuppen zusammen wie zer klüftet aussieht. S a m e n ovoid bis fast kugelig, 1,7 1,9 (meist 1,8) mm lang, von der Vorder zur Hinterkante 1,4 1,5 mm lang und von einer Seite zur anderen 1,1 1,2 mm dick; an der Vorderseite mit einem ± hohen, scharfen Kamm (Crista), der in einen nasenförmigen Vorsprung ausläuft, unter dem das ziemlich große, kraterförmige, ovale, ventrale Hilum liegt. Äußere Testa reduziert, spröde, glänzend dunkelbraun bis braunschwarz, mit kleinen, regelmäßigen Zellen und halbkugelig vorgewölbten Zellaußenwänden, dünnen Radialwänden und keinen Zwischenräumen. Mikropylarloch groß, zwischen dem nasenförmigen Vorsprung und dem Hilum liegend. Embryo gekrümmt, mit breitem Hypocotyl und schmalerem Cotyledonenteil, chalazal mit Restperisperm, von einer gelblichen, inneren Testa umhüllt. Abb. 3a. Trockenfrucht von außen. Sch = Schuppenblättchen. Abb. 3b. Trockenfrucht im Längsschnitt (Perianthrest abgefallen). Samen mit Testastruktur von der Seite. Abb. 4a. Hilumansicht: Mi = Mikropyle, Hi = Hilum. Abb. 4b. Embryo: c = mit innerer Tests, d = im Längsschnitt, e = ohne innere Testa. E = Embryo, it = innere Testa, Psp = Perisperm, Co = Kotyledonen. Krainz, Die Kakteen, 15. I C VIII b
62 Heimat Standorte: in der Sierra Mapimi, im Halbschatten, auf nahrhaftem Boden, in flachen Lagen am Fuße von Hügeln. Allgemeine Verbreitung: Mexiko. (Kla.) Kultur wurzelechter Pflanzen in krümeligem Boden von leicht saurer Reaktion; sehr empfindlich gegen kühle Feuchtigkeit, auch im Sommer. Wächst besser gepfropft. Verlangt im Sommer leichten Halbschatten, doch viel Warme! Bemerkungen Dichtbestachelte, in den Sammlungen wenig verbreitete, selbststerile Art, die hier im April/Mai blüht. Unsere Art steht E. unguispinus (Eng.) Br. et R. wohl nahe, doch sind Stachelcharakter und Samen wesentlich verschieden. Für Anfänger wenig geeignet. Alle Zeichnungen (Originale) L. Kladiwa. Foto (Reproduktion) aus Backeberg l. c. (1953). (Kz.) C VIII b Krainz, Die Kakteen, 15. I. 1973
63 Echinopsis eyriesii (Turpin) Zuccarini eyriesii, nach dem Kakteensammler A. Eyries, aus Le Havre benannt Literatur Echinocactus eyriesii Turpin in Ann. Inst. Roy. Hort. Fromont II 1830, S. 158 (Obs. Fam. Cact.) U. Abb. Taf. 2. Bot. Reg. XX, Taf Bot. Mag. 62, Taf Cereus eyriesii Otto in Allg. Gartenzeitg. II 1834, S Otto in Allg. Gartenzeitg. III 1835, S. 59 u Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S. 72. Echinonyctanthus eyriesii Lemaire Cact. Gen. Nov. Sp. 1839, S. 84. Echinopsis eyriesii (Turpin) Zuccarini in Pfeiffer & Otto Abbild. Beschr. Cact. I 1839, Taf. 4. Zuccarini in Abhandl. Bayr. Akad. II, S Förster Handb. Cact. I 1846, S Salm Dyck Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 38. Labouret Monogr. Cact. 1853, S Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S u. Abb. S Schumann K. in Martius Flor. Bras. IV/2 1890, S. 230 u. Abb. Taf. XLVII. Weber in Bois Dict. d Hort , S Schumann K. in Engler & Prantl Pflanzenfam. III/6a 1894, S Meyer in Monatsschr. Kakteenkde. IV 1894, S. 54. Schumann K. Ge samtbeschr. Kakt , S. 230, 231. Arechavaleta J. in Anal. Mus. Nac. Mon tevideo V 1905, S u. Abb. S Gürke M. Blühende Kakt. II 1905, Taf. 72. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 65, 66. Schelle E. Kakteen 1926, S Berger A. Kakteen 1929, S Backeberg C. Die Cactaceae III 1959, S Diagnose nach L. Pfeiffer Enumer. Cact. l. c.: Pa: Buenos Ayres. C. globosus vel depresso globosus pallide virens; vertice impresso; sinubus latis; costis verticalibus, subacutis, undulatis; areolis remotis flavido, serius griseo tomentosis; aculeis brevissimis brunneis pungentibus rectis, exterioribus 11, centralibus 4. Echinonyctanthes corrected in Echinonyctanthus, S. 84 in S. 85 Krainz, Die Kakteen, 1. XII C V a
64 Specimina in horto Breiteriano pedem alta et diam., areolis 6 8 lin. distantibus, aculeis linearibus. Plantae juniores a sequente vix distingui possunt ob areolas confertas et aculeos exteriores longiores setaceos albos. Flores per totam aestatem ex areolis inferioribus plantae, vespere aperti, per horas expansi, albi, 3 31/2 poll. diam., odorem exhalantes fortem narcoticum. Receptaculum viride, dense squamatum et pilosum. Tubus 8 10 poll. longus, basi 5 lin. diam., inde a medio incrassatus, infra corollam 11/2 poll. diam., viridis, parce squa. mulatus. Sepala linearia, fuscescenti viridia, reflexa. Petala biserialia, nivea, exteriora apice viridia, longe mucronata, 11/2 poll. longa, 10 lin. lata. Stamina numerosissima, partim corollae orificio, partim tubi inferioribus partibus affixa, alba, antheris flavis. Stylus brevior, stigmatibus 8 10 albidis. Beschreibung K ö r p e r einfach oder mäßig sprossend, erst etwas niedergedrückt, später kugelig bis zylindrisch, oben gerundet, bis 30 cm hoch und cm breit, erst rein, später dunkelgrün. S c h e i t e l eingedrückt, mit Wollfilz. R i p p e n 11 18, durch scharfe Furchen voneinander getrennt, buchtig gegliedert, gerade, scharf, kräftig, bis 2 cm hoch, im Querschnitt dreiseitig, mit etwas gewölbten Seiten. A r e o l e n rund, bis 8 mm breit, mit grauem Wollfilz, 1,5 3,5 cm voneinander entfernt. R a n d s t a c h e l n 7 14, kaum über 5 mm lang, gerade, spitz, dünn bis kegelig, weiß oder dunkelbraun, z. T. horizontal strahlend. M i t t e l s t a c h e l n 4 8, ca. 5 mm lang, schwarzbraun, von den Randstacheln ihrer Gestalt nach kaum verschieden. B l ü t e n seitenständig, einzeln, cm lang, 8 12 cm breit, wie Jasmin duftend, trichterförmig. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) grünlich, kugelig, schwach gehöckert und wie das R e c e p t a c u l u m (Röhre) mit dunkelbraunen, linealen, spitzen Schuppen, deren Achseln schmutzig weiße Wolle und braune bis rote Borsten tragen. Das grüne, gehöckerte Receptaculum erweitert sich allmählich beträchtlich und ist mit lineal lanzettlichen, dunkler grünen Schuppen besetzt, aus deren Achseln schmutzig weiße bis schwarze, längere Wolle, außer den längeren Borsten hervortritt. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r schmal linealisch bis länglich eiförmig, lang zugespitzt, grün, in der Mitte und nach oben braun. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r spatelförmig, länglich bis lanzettlich, oben fein gezähnelt, zugespitzt, weiß, schwach grünlich oder violettlich angehaucht. S t a u b b l ä t t e r vom Grunde aus der Röhrenwand entlang angeheftet, ein Kranz am Grunde der Hüllblätter bzw. an der Mündung der Röhre angeheftet. S t a u b f ä d e n weißlich bis grünlich oder grün. S t a u b b e u t e l weißlich oder hellgelb. G r i f f e l die Blütenhülle fast erreichend, grün, weißlich oder zuweilen gelblichrot. N a r b e n 12 13, strahlend, weißlich. F r u c h t eine schmal eiförmige, oben gestutzte Beere, ca. 3 cm lang, beschuppt, wenig filzig und der Länge nach einseitig aufspringend. S a m e n (nach Krainz) etwa 1 mm im Durchmesser, rundlich mützenförmig mit großem, basalem, rundem und tiefem Hilum mit eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa großwarzig, braunschwarz, eine schmale Zone um das Hilum schwarz, sehr feinwarzig punktiert. Heimat Standorte: Mercedes, Tacuarembó (Uruguay); Buenos Aires und Prov. Entre Rios (Argentinien). Allgemeine Verbreitung: Südbrasilien, Uruguay, Argentinien. Kultur in nährstoffreicher, sandiger Erde von leicht saurer Reaktion. Im Sommer leichter Schutz vor Prallsonne; mäßige Gaben stickstoffarmer Dünger zu dieser Zeit für ältere Pflanzen angebracht. Überwinterung kann im Keller erfolgen, sofern der Raum trocken und kühl ist (6 bis 10 C). Aufstellung im Sommer möglichst im Freien. Bemerkungen Die Art wurde im Jahre 1830 von Eyries aus Uruguay erstmals eingeführt und gehörte bald darauf zu den am häufigsten kultivierten Kakteen. Mit anderen Arten gekreuzt, entstanden unzählige Bastarde, die z. T. mit botanischen Namen belegt und beschrieben wurden. Einige weitere als selbständige Arten geführte Pflanzen sind lediglich Varietäten oder Formen un serer Art. Blüht in den Monaten Juni/Juli je nach Klimaverhältnissen. Bildarchiv H. Krainz. Abb. stark verkleinert. C V a Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1962
65 Echinopsis kermesina (Krainz) Krainz comb. nov. (U. G. Pseudolobivia Backeberg) lat. kermesina = kermesinrot Literatur Pseudolobivia kermesina Krainz H. in Beitr. z. Sukkulentenkde. u. pflege 1942, S. 61, 64 u. Abb. S. 62, 63. Krainz H. in Neue u. selt. Sukk. 1946, S. 14 u. Abb. Proctor R. C. in Cact. Succ. Journ. Amer. XXVII/6, 1955, Abb. S Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 1354, 1355 u. Abb. S Echinopsis kermesina Krainz Buxbaum F. in Sukkulentenkunde VI, Jahrb. Schweiz. Kakt. Ges. 1957, S. 9, 10 u. Abb. Echinopsis kermesina (Krainz) Krainz in Pareys Blumengärtnerei II (2. Aufl.) 1960, S. 124 u. Abb. Diagnose nach H. Krainz l. c.: Depresso globosa, plano radicans, solitaria, ca. 8 cm lata et 5,5 cm alta; vertex paullum depressum; epidermis intense obscure viridis; costae 15 23, prorsum oblique plus vel minus gibbosae, basin versus saepe paullum crenatae; areolae griseo tomentosae, postea glabrescentes, ca mm remotae; aculei radiales 11 16, ca mm longi, juventute rufo flavi, acumen versus obscure brunnei, vetustiores grisei, tenuiter subulati, asperi, rigidi, pungentes, recti vel arcuati, paullum adversi, saepe promiscui; aculei centrales 4 ( 6), valde patentes, recti vel leviter curvati, ad 25 mm longi, paullum aculeis radialibus crassiores, aciculares, basi nodose incrassati, prope an vertex obscuriores, praeterea sicut aculei radiales. Flores ca. 17,5 cm longi, aperti ca. 9 cm lati (diam.), etiam nocte aperti, sine odore. Tubus ca. 12 cm longus, gracilis, intus obscure kermesinus roseus. Folia involucralia exteriora ca. 4 5 cm longa, 5 mm lata, kermesine marginata, media parte brunnescenti, quasi nervum opicem mucronuli modo superantem formante. Petala ca.4 5 cm 2 cm, late acuta kermesina, stria media angusta brunnescenti in mucronulum prominentem transeunte ornata. Filamenta ca. 6 cm longa, Krainz, Die Kakteen, 15. II C V a
66 punicea; antherae flavae; stylus 15 cm longus kermesine roseus, basin versus viridis; ovarium ca. 10 mm longum, ca. 10 mm crassum, viride; stigmata 8, flava. Fructus seminaque nondum observata. Patria Argentinia. Beschreibung K ö r p e r flachwurzelnd, flachkugelig, einzeln, etwa 8 cm breit und 5,5 cm hoch, saftig dunkelgrün. S c h e i t e l etwas eingesenkt und mit Wollflöckchen. R i p p e n 15 23, etwa 8 mm hoch, 9 15 mm breit, ± beilhöckerig, besonders im Scheitel, gegen den Grund oft etwas ge kerbt. A r e o l e n rundlich, graufilzig, nur die jüngeren gelbwollig, später verkahlend, etwa mm voneinander entfernt, 3 5 mm breit. R a n d s t a c h e l n 11 16, ungleich lang (etwa 6 12 mm), in der Jugend fuchsiggelb, gegen die Spitze dunkelbraun, später grau, dünn pfriemlich, rauh, steif, stechend, strahlenförmig von der Areolenmitte, gerade oder etwas verbogen, vorspreizend, in der Nähe des Scheitels oft ineinander greifend. M i t t e l s t a c h e l n 4 ( 6), stark vorspreizend, gerade oder etwas dem Körper zu gebogen, bis 25 mm lang, etwas dicker als die Randstacheln, nadelförmig, am Grunde knotig verdickt, in Nähe des Scheitels etwas dunkler gefärbt, sonst gleichfarbig wie die Randstacheln. B l ü t e n meist in Scheitelnähe erscheinend, duftlos, auch nachts geöffnet (etwa 3 Tage dauernd), 17,5 cm lang, geöffnet 9 cm breit. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) 10 mm lang und dick, grün. R e c e p t a c u l u m (Röhre) etwa 12 cm lang (vom Nektarboden gemessen), innen dunkel karminrosa, außen mit schlanken und scharf zugespitzten, am unteren Teil der Röhre kaum sichtbaren, später bis 10 mm langen und bis 3 mm breiten, grünlichen Schuppen, aus deren Areolen graue Wollhaare entspringen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r 4 5 cm lang, 5 mm breit, karmin gerändert, mit grünlichbrauner Mitte und erhöhter Mittelnarbe, zugespitzt. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r 4 6 cm lang, 2 cm breit, karminrot, mit schmalem, braunem Mittelstreifen. S t a u b f ä d e n etwa 6 cm lang, die obersten aus einem schwachen Hymen, karminfarbig. S t a u b b e u t e l gelb. G r i f f e l 15 cm lang (mit geschlossener Narbe), karminrosa, von der Mitte ab bis zum Grunde grün. N a r b e n 8, etwa 15 mm lang, gelb. F r u c h t faßförmig bis kugelig, etwa mm lang und dick, mit wenigen, kaum 2 mm langen, scharf zugespitzten, grünlichen Schuppen mit grauweißen und braunen Wollhaaren aus deren Achseln, bei der Reife vertrocknend und seitlich aufreißend. S a m e n länglich mützenförmig, etwa 1 mm lang, etwas weniger dick, mit basalem, ovalem bis rundlichem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, feinwarzig punktiert. Heimat Allgemeine Verbreitung: Argentinien, näherer Standort nicht bekannt. Kultur Als Bergpflanze liebt die Art luftigen, sonnigen Standort, wenn möglich mit Morgensonne, dann ist Schattieren über Mittag im Sommer nicht erforderlich, sonst aber angebracht, beson ders bei Kultur unter Glas. Überwinterung möglichst luftig bei 8 12 C, bei höheren Tem peraturen muß von Zeit zu Zeit gegossen werden. Wächst in nahrhafter, durchlässiger, leicht saurer Erde ziemlich rasch. Verlangt im Sommer genügend Feuchtigkeit. 3 4jährige Sämlinge können bei zweckmäßiger Pflege bereits blühen. Bemerkungen Diese schöne, auch für Anfänger geeignete Art wurde 1938 zuerst von H. Blossfeld jun. gefunden und im gleichen Jahre von Sao Paulo (Brasilien) aus an den Besitzer der Firma Kaktus AG. in Reinach BL, Herrn J. Maute, gesandt. Die Pflanzen blühten erstmals an der Kakteenschau der Schweizerischen Landesausstellung 1939 in Zürich, wo ich sie zur Beschreibung für unsere Züricher Sammlung übernahm. Die ersten Vermehrungen gelangten von hier aus an die Bot. Gärten in Dahlem und Darmstadt. Die Blütezeit dauert hier von Juni bis Ende Juli. Bei den Blütenfarben gibt es Abstufungen von dunkelkarminrot bis zu karminrosa. Die Blüten öffnen sich manchmal auch erst am Abend. Photo: H. Krainz. Abbildung etwa 1 : 2. C V a Krainz, Die Kakteen, 15. II. 1961
67 Gattung Encephalocarpus Berger in Kakteen 1929, S. 331, 332 Einzige Art: Encephalocarpus strobiliformis (Werderm.) Berg. (Ariocarpus strobiliformis Werdermann in Zeitschr. f. Sukkulentenkunde III., 1927, S. 126) (En kephalos = gr. im Kopfe, karpos = gr. Frucht, d. h. die Frucht bleibt in der Scheitelwolle verborgen; strobiliformis = lat. zapfenförmig, wegen der Ähnlichkeit der Pflanze mit einem Koniferenzapfen) U. Fam. C. Cereoideae, Tribus VIII. Euechinocactideae (Echinocacteae) Subtrib. b. Thelocactinae, Linea Strombocacti. Diagnosen 1. der Gattung nach A. Berger l. c. S. 331 Körper ± kugelig mit Rübenwurzel und weißwolligem und bestacheltem Scheitel. Warzen sehr zahlreich, dicht dachziegelig und ± einwärts gekrümmt, ziemlich dünn, fast blatt oder schuppenartig, am Rücken gekielt; die jüngeren an der Spitze am Rücken mit kleiner, länglicher Areole und Stacheln, die älteren kahl, die vertiefte Ansatzstelle der Stacheln zeigend. Stacheln etwas kammförmig gestellt, die oberen länger, den Scheitel überragend. Blüten aus dem Scheitel, aus den ganzen jungen Axillen, 3 3,5 cm breit, mit kurzer, enger Röhre; äußerste Krainz, Die Kakteen, 1. VIII C VIII b
68 Hüllblätter 5 6, sehr schmal, grün, gefranst, die folgenden ebenso, aber etwas breiter und länger; innere Blumenblätter schön violettrosa, nach dem Grund dunkler, länglich spatelig, kurz gespitzt, ganz randig oder fein gezähnelt, die äußeren blasser. Staubfäden nicht sehr zahlreich, halbsolang, gelb, Beutel goldgelb; Griffel schlank, etwas länger, mit 2 3 ganz kurzen, wenig abstehenden gelblichweißen Narben. Früchte im Scheitelgrunde versteckt, zwischen der Wolle reifend und vertrocknend. Samen klein, braun. der Art nach Werdermann l. c. Vor einigen Monaten überwies Herr Klissing dem Botanischen Garten zu Dahlem drei Exemplare einer schönen mexikanischen Importe, welche ich Ariocarpus strobiliformis Werd. n. sp. nennen und im Folgenden kurz beschrieben will. Die Pflanze erinnert, wie auch die Abbildung zeigt, in ihrem Habitus an einen gedrungenen Koniferenzapfen. Der Körper des größten hier vorhandenen Exemplares erreicht die Höhe von 3,5 cm bei einem Durchmesser von 6 cm und ruht auf einer gedrungenen Pfahlwurzel. Die Kör perform könnte man als gestaucht kugelige bezeichnen. Der obere Teil erscheint ein wenig abgeplattet, der Scheitel ist schwach eingesenkt. Die Scheitelmitte wird bedeckt von spärlicher, nur wenige mm langer grauer Wolle. Die schuppenartigen Warzen sind in ungefähr 16 Schrägzeilen angeordnet, flach dreiseitig, an der Grundfläche 0,7 1 cm breit, 0,6 0,7 cm hoch, dem Körper angepreßt und diesem in der Form der Rundung folgend, also nach außen konvex. Von der Spitze zur Mitte der Grundfläche läuft eine schwach erhabene Rippe die dritte Kante der Warzen anderer Ariocarpusarten. Die Spitze der Schuppen (Warzen) erscheint nur ganz schwach vorgezogen und trägt bei den scheitelnahen eine etwas längliche kahle Areole von knapp 1 mm Durchmesser. Bei scheitelferneren Warzen sind diese nicht mehr zu erkennen, die Spitze zeigt sich verkorkt. Die nur in nächster Nähen des Scheitels gut erhaltenen Areolen werden von Stacheln umkränzt Mittelstacheln sind nicht ausgeprägt welche zart borstig erscheinen und eine Länge bis zu 5 mm erreichen. Der einzelne Stachel setzt sich zusammen aus einer ca 0,5 mm langen Ansatzstelle von graugelber Farbe und der Borste, welche dieser scheidenartig aufgewachsen ist. Fast stets sind die Borstenstacheln mehr oder weniger in Richtung des Scheitelpunktes angeordnet, zumeist auch nur die von vornherein so orientierten erhalten, während von den mehr nach außen gerichteten allein die Ansetzstellen übrig geblieben sind. Zusammen mit dem spärlichen Wollfilz bilden die Stachelborsten ein Schutzgeflecht über der empfindlichsten Stelle der Pflanze, dem Vegetationspunkt in der Scheitelmitte. Die vom Scheitel entfernter liegenden Schuppenwarzen tragen zunächst noch die Ansatzstellen der Stacheln, die später samt den Areolen ganz verschwinden. Den Axillen entsprießt spärlich am unteren Teil des Körpers ganz fehlend grauweiße Wolle von wenigen mm Länge. Die ganze Pflanze erscheint blaugrün, nur die Warzen in der Nähe des Scheitels zeigen noch Stellen von dunkelgrüner Farbe. Der bläuliche Ton rührt nicht von Wachsausscheidungen her, sondern wird durch Reste abgeschilferter Epidermis hervorgerufen, die oft in mehreren Schichten der Außenseite der Warzen aufsitzt. Die anscheinend sehr kleinen Blüten entspringen den Axillen in der Nähe des Scheitels. Leider habe ich die Exemplare nicht blühend gesehen. Die Art scheint aber wenigstens in der Heimat reichen Blütenschmuck anzulegen. Bei genauer Nach prüfung fanden sich in zahlreichen Axillen Reste, deren Untersuchung vertrocknete Blüten er kennen ließen. Die neue Art ist eine interessante Bereicherung des Formenkreises, den wir in der Gattung Ariocarpus zusammenfassen. Beschreibung der Gattung Meist einfach, aus einer dicken R ü b e n w u r z e l etwa kugelig oder, seltener, verlängert. Der Scheitel ist weißlich wollig und wird von verlängerten Stacheln überragt. Die sehr zahlreichen P o d a r i e n sind als ziemlich dünne und schmale, in der Gestalt und Stellung an die Schuppen eines Koniferenzapfens erinnernde W a r z e n ausgebildet, die nach oben und innen gekrümmt, einander dachziegelig überdecken. Am Rücken sind die Warzen gekielt und am freien Teil verhärtet. Etwas unter der Spitze befindet sich auf der Rückseite eine kleine, längliche A r e o l e, die nur in der Jugend noch Stacheln trägt. Die obersten der etwas kammförmig gestellten S t a c h e l n sind sehr verlängert und zu sehr eigenartigen, durch einen vertrockneten Sekrettropfen an der Spitze keulenförmigen Drüsendornen umgebildet, deren Sekret wasser löslich ist (vgl. Morphologie Abb. 9). Die Drüsendornen verstoßen zuerst, später fallen Axilen corrected in Axillen C VIII b Krainz, Die Kakteen, 1. VIII. 1958
69 Gattung Encephalocarpus Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Encephalocarpus strobiliformis, Blüte Encephalocarpus strobiliformis, Encephalocarpus strobiliformis, Außenansicht Blüte Längsschnitt Samen Außenansicht Längschnitt -> Längsschnitt Abb. 4 Encephalocarpus strobiliformis, Lage des Embryo (E) und des Perisperms (Psp) in der inneren Samenschale, (is). Mi Micropylare Zellgruppe der inneren Samenschale, vg verstärkter Gewebsstreifen zwischen Micropyle und Perisperm. Abb. 5 Encephalocarpus strobiliformis, Unterseite der Spitze des Samens mit Hilum (Hi) und Micropylarloch (Mi) auch die anderen kurzen und stumpfen Stacheln ab, so daß nur eine kleine Vertiefung bleibt. Die Axillen tragen Wolle. Die B l ü t e n entspringen aus den Axillen sehr junger Warzen im Scheitel. Das P e r i c a r p e l l ist tief in der Scheitelwolle verborgen, nackt. Das ebenfalls nackte und kahle R e c e p t a c u l u m ist sehr dünn zylindrisch, gegen das Ende zu plötzlich auf eine kurze Strecke trichterig erweitert. Der zylindrische Teil ist ganz zwischen den Warzen des Scheitels verborgen, nur der erweiterte Teil ragt heraus. Dieser trägt außen, etwas herablaufend, die schmalen, sepaloiden (kelchähnlichen) stark grob gewimperten äußeren Blütenhüllblätter, die rasch in die etwas breiteren mittleren und in die petaloiden (blumenblattfarbigen) inneren Blütenhüll blätter überleiten. Diese sind breit spatelförmig, ganzrandig oder etwas gezähnelt. Die S t a u b b l ä t t e r sind im Receptaculum vom Grund des zylindrischen Teiles an bis zum Schlund an geheftet, die Staubfäden ungleich lang, so daß die Antheren annähernd in gleiche Höhe zu stehen kommen. Sie werden vom schlanken G r i f f e l, der ca. 5 krallenartig spreizende N a r b e n trägt, erheblich überragt. Die F r u c h t bleibt in der Scheitelwolle verborgen und ver trocknet und verwittert schließlich, so daß die sehr lange keimfähig bleibenden Samen erst allmählich frei werden. Der S a m e n ist ziemlich variabel in der Gestalt und hat etwa die Form einer stark gekrümmten Birne, die seitlich etwas abgeflacht ist. Der spitze Teil trägt an der Innenseite der Krümmung das Hilum und das eigenartige, verschieden geformte Mikropylarloch. Die Spitze ist oft verschiedenartig zerklüftet. Die Testa ist bräunlich schwarz, freigelegt, bzw. in Durchsicht, Krainz, Die Kakteen, 1. VIII C VIII b
70 braun und besteht aus in der Richtung der Längsachse des Samens auffallend langgestreck ten Zellen mit dicken Radialwänden, wodurch der Samen in sehr charakteristischer Weise längs gerunzelt erscheint. Die innere Samenschale trägt an der Micropyle eine Gruppe von verhärteten Zellen (die in der Samenanlage aus dem äußeren Integument vorragende Micropyle des inne ren Integuments) von der aus ein ebenfalls verhärteter Gewebsstreifen zu dem kleinen im Bauche der Krümmung liegenden stärkehaltigen P e r i s p e r m verläuft. Der E m b r y o ist un geliedert, leicht gekrümmt und hochsukkulent. Er enthält als Reservestoff Öl. Beschreibung der Art Meist flachkugelig, alte Exemplare auch verlängert, bis ca. 5 cm im Durchmesser. Von den ca. 9, etwas kammförmig gestellten Stacheln der jungen Areolen sind die oberen (ca. 3) zu den beschriebenen Drüsendornen umgewandelt, die anderen sehr kurz und stumpf, leicht unregelmäßig gekrümmt. Die B l ü t e n sind sehr auffällig, bei voller Sonne weit offen und dann 3 3,5 cm im Durchmesser. Die 5 6 äußersten Blütenblätter sind grün, schmal lanzettlich, ge franst, die folgenden grünlichweiß bis gelblich, wesentlich größer und in der Gestalt bereits den spateligen innersten Blütenblättern angenähert, die innersten sind hell rotviolett im Grunde dunkler, länglich spatelförmig. Die Staubfäden sind gelb, die Antheren goldgelb, die Narben gelblich weiß. Mexico: Tamaulipas und Jaumave. Heimat Kultur Verlangt im Sommer den heißesten und sonnigsten Platz, den man zur Verfügung hat. Die nur einen Tag dauernden Blüten öffnen sich nur in voller Sonne. Wenn die Pflanze im Wachstum ist, soll nicht zu spärlich bewässert werden, doch darf keine stehende Nässe bleiben. Der Boden muß also, z. B. durch Ziegelbrocken, gut durchlässig gemacht sein, der Wurzelhals wird zweckmäßig zwischen Steine oder Ziegelbrocken eingebaut, so daß dort keine Nässe bleiben kann. Die Erde soll nahrhaft sein, am besten eine lehmig sandige Mischung mit etwas Gipszusatz. Beim Gießen darf der Scheitel ebenfalls nicht naß werden. Im Winter kühler, aber frostfreier Stand und absolut trocken, auch junge Exemplare. Wächst äußerst langsam, Sämlingsaufzucht daher sehr langwierig. Bemerkungen Die Art wurde von A. Viereck entdeckt und 1927 erstmalig durch Klissing & Sohn, Barth in Pommern eingeführt. In ihren Merkmalen vereinigt die Pflanze Merkmale verschiedener Gattungen der Linea Strombocacti, der sie unstreitig angehört. In der Warzenform steht sie nahe Ariocarpus bzw. Obregonia, die Verhärtung der Warzenspitzen aber hat sie mit Strombocactus gemeinsam. Die Drüsendornen besitzt außer ihr nur Epithelantha, der sie daher am nächsten verwandt ist. Die Blütenröhre gleicht der von Aztekium, das aber nur im erweiterten Teil Staubblätter trägt. In der Blütenfarbe ist sie Pelecyphora aselliformis ähnlich, der die Art auch in der sehr eigen artigen Samenform nahe steht. Weitere Literatur Buxbaum, F. Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen. Österr. Bot. Zeitschr. 98, 1951, S Buxbaum, F. Entwicklungslinien und Entwicklungsstufen der Tribus Euechinocactineae. Kakt. u. a. Sukk., Veröffentl. d. Deutsch. Kakt. Ges, 2, 1951, S Buxbaum, F. Stages und Lines of Evolution of the Tribe Euechinocactineae. Cact. and Succ. Journ of America XXIII, 1951, Nr. 6. Buxbaum, F. Morphologie of Cacti. Vol. I. S , C VIII b Krainz, Die Kakteen, 1. VIII. 1958
71 Gattung Epiphyllum Haworth, 1812, Synopsis plantarum succulentarum S. 197 *) Synonyme: Phyllocactus Link 1831 in Handbuch zum Erkennen der Gewächse 2, S. 10, Phyllocereus Miquel, 1839 in Bull. Sci. Phys. Nat. Néerl. S. 112 (kam nicht in Gebrauch), Marniera Backeberg 1950, in Cact. & Succ. Journ. America 22, S Gr. epi = über, phyllos = Blatt; wörtlich also Überblatt, da man damals die Flachsprosse für Blätter hielt und meinte, die Blüten entspringen den Blättern. U. Fam. C. Cereoideae, Tribus II. Hylocereae, Subtribus 3 Epiphyllinae **) Diagnose nach Haworth l. c.: Corolla supera, polypetaloidea, rosacea, tubo longissimo fere pedali, flexuoso, parum squamato. Stamina ore tubo affixa, vel in tubum connata. Stylus longissimus. Stigmata Character ex Dillenii descriptione. Flores perfectos non vidi. Leitart: Epiphyllum phyllanthus (Linnaeus) Haworth (Cactus phyllanthus Linnaeus 1753 in Species Plantarum S. 469) Beschreibung Gewöhnlich epiphytische gelegentlich in humösen Ansammlungen wachsende reich ver zweigte, aufrechte bis herabhängende oder mit Luftwurzeln kletternde S t r ä u c h e r von ver schiedenen Gesamthabitus. Basalteile der Sprosse stets stielrund oder fast stielrund, rings mit Areolen versehen und in dreikantige, schließlich in Flachsprosse übergehend, seltener (z. B. E. lepidocarpum) dreiflügelig bleibend, oder mehrere Meter lange stielrunde, wurzelkletternde L a n g s p r o s s e, die manchmal am Ende selbst 3 flügelig werden und Flachsprosse als seit liche Kurztriebe ausbilden, (vgl. Morphologie Abb. 12) oder bandförmige Langtriebe mit zwi schengeschalteten ± stielrunden Abschnitten, aus denen Luftwurzeln und Seitensprosse entsprin gen. Die stielrunden Teile verholzen schließlich und bilden später eine Borke aus, ebenso ver borkt der Bereich der Mittelrippe an alten, flachen Langtrieben. Die Seitentriebe (Kurztriebe) manchmal aus stielrundem Basalteil breitlanzettlich und spitz auslaufend und so tatsächlich Blättern ähnlich (z. B. E. oxypetalum BGUC Nr ). Die F l a c h s p r o s s e werden bis 10 cm (E. macropterum) ***) bei E. chrysocardium bis 30 cm breit, sind am Rande fast glatt (eine Form v. E. macropterum) oder groß gekerbt, bei E. darrahii grob sägeartig, bei E. chryso cardium bis an die Rhachis ( Mittelrippe ) eingeschnitten und in leicht sichelartige Abschnitte zerlegt, solcherart wie ein Cycadeenwedel aussehend. (Vgl. Morphologie Abb. 15). Die A r e o l e n stehen nur am Rande der Flügel in den Kerben oder Einschnitten, getragen *) HAWORTH gibt in Klammer HERMANN als Namensautor an. HERMANN führt jedoch (in Psr. Botavus Prodr. Add. 2, 1689) den Namen Epiphyllum americanum ohne jede Beschreibung an. **) Nach BUXBAUM, The Phylogenetic Division of the Subfamily Cereoideae, Cactaceae. Madroño 14, 1958, S. 177 ff.; in der alten Einteilung: C II b. Die damalige Subtribus Epiphyllineae nom. prov. mußte wegen des nachgewiesenen biphyletischen Ursprunges geteilt werden, wobei in der Subtribus Epiphyllinae F. Buxb. nur die Gattung Epiphyllum verblieb, während die anderen Gattungen als eigene Subtribus 4. Disocactinae F. Buxb. zu führen sind. ***) Siehe Bemerkungen 2 Krainz, Die Kakteen, 1. I C II b
72 von einem ± deutlichen Schüppchen, aus dem in einigen Fällen Nektarausscheidung festgestellt wurde *). Der Rand zwischen den Areolen ist in manchen Fällen hornartig. Die Areolen tragen nur etwas Wolle, seltener einige Borstenstachelchen. Nur an Sämlingen, mitunter auch aus den Areolen der stielrunden Teile, treten Borstenstacheln regelmäßiger auf. Die B l ü t e n entspringen aus den Flachsprossen oder flachsprossigen Kurztrieben, seltener auch aus den stielrunden Teilen **). Sie sind nächtlich, manchmal noch am folgenden Tag geöffnet und haben einen starken Duft. In geöffnetem Zustand sind sie trichterförmig bis stieltellerförmig mit einem sehr langen röhrenförmigen Receptaculum, das die Blumenkrone wesentlich (3 bis 6fach) an Länge übertrifft. Das langgestreckte schmal eiförmige bis cylindrische P e r i c a r p e l l geht allmählich in das R e c e p t a c u l u m über. Es trägt eine größere bis sehr geringe Anzahl von lineal lanzettlichen abstehenden bis schmal dreieckigen meist anliegenden S c h u p p e n mit lang herablaufenden Podarien. Unter der Spitze der Schuppen wird an der Außenseite Nektar ausgeschieden, der in einigen Fällen außerordentlich stark duftet und schon im Knospenzustand auftritt. Die Schuppenachseln sind gewöhnlich kahl, in einigen Fällen (E. macropterum und E. chrysocardium) treten einige feine Borsten auf. Das oft außerordentlich lange R e c e p t a c u l u m ist cylindrisch, in der oberen Hälfte kaum merklich erweitert, zur Einstellung der Blü tenlage gewöhnlich ± gekrümmt und trägt nur mehr wenige Schuppen desselben Charakters, wie jene des Pericarpells, die in der erweiterten Schlundregion ziemlich unvermittelt in die äußeren Blütenhüllblätter übergehen. Die äußeren B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r sind bei man chen Arten von den inneren wesentlich verschieden, indem sie schmal lanzettlich bis fast lineal und anders gefärbt sind und beim Blühen strahlig abstehen. Auch sie produzieren reichlich Nektar. Die inneren Blütenhüllblätter sind stets viel zarter, breiter und weiß und neigen beim Erblühen oft mehr glockig zusammen. Die Stellung der Staubblätter ist bei den verschiedenen Arten unterschiedlich. Stets ist mindestens die untere Hälfte des Receptaculum staubblattfrei und bildet so eine enge aber lange Nektarkammer, die von den untersten Staubblättern diffus abgeschlossen ist. Es folgt sodann meist eine ± lange Zone von dicht stehenden Staubblättern und dann abermals ein staubblattfreier Zwischenraum, der mit einem Schlundkranz endet. Bei E. cartagense sind nur im Schlund einige Reihen von Staubblättern ausgebildet, bei der Leitart, E. phyllanthus praktisch nur der Schlundkranz. Die ansehnliche, langgestreckte Fruchtknotenhöhle enthält sehr zahlreiche S a m e n a n l a g e n auf gebüschelt angeordneten und echt verzweigten Samensträngen, die an der Innenseite der Krümmung sehr charakteristische steife Haarzellen tragen (vgl. Morphologie Abb. 53 A). Der dünne Griffel überragt die etwas aus dem Schlund ragenden Staubblätter mit der aus 9 bis mehr schlanken, spitz zulaufenden und mit Ausnahme eines schmalen Rückenstreifens ringsum langzottig papillösen Ästen bestehenden N a r b e. Die F r u c h t ist beerenartig, sehr saftig, meist rot, mitunter grünlich, eirund oder länglich ellipsoidisch, gegen die Abbruchsnarbe des Receptaculum meist zugespitzt. In ein zelnen Fällen verbleibt der vertrocknete Blütenrest an der Frucht. Von den herablaufenden Podarien oder Schuppen, die erhalten bleiben oder abfallen können, ist die Frucht etwas kantig. Sie platzt nicht auf, sondern vertrocknet und verrottet schließlich. Der S a m e n hat die Ge stalt einer Schirmmütze, ist aber seitlich abgeflacht. Am schlanken Teil befindet sich seitlich das schmale langgestreckte H i l u m, das das undeutliche M i k r o p y l a r l o c h einschließt. Die bräunlich schwarze T e s t a ist entweder glatt, indem die Außenwände der Testazellen kaum vorgewölbt sind, oder die Außenwände sinken am trockenen Samen ein und bilden so eine echte grubige Punktierung. In beiden Fällen sind die Radialwände der Testazellen relativ dick und es können zwischen den gerundeten Ecken der Testazellen vereinzelt ziemlich ansehn liche Zwischengrübchen auftreten. Das Hilum steht etwas vor und ist weiß bis hellockergelb. Der Samen enthält kein P e r i s p e r m. Der E m b r y o ist stark hakenförmig eingekrümmt, wobei die Krümmung im Bereiche der sehr großen Keimblätter liegt. *) Festgestellt bei E. grandilobum BGUC Nr und bei E. chrysocardium BGUC Nr / Clonotype /. Wahrscheinlich ist dies jedoch eine bei allen Arten zutreffende Erscheinung. **) Bei einer vielkultivierten Form (Hybride?) von E. macropterum, erscheinen die Blüten fast immer aus den Basalteilen der Flachsprosse, was beim Rückschnitt beachtet werden muß! C II b Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1962
73 Gattung Epiphyllum Abb. 1. Reduktionsstufen im Blütenbau von Epiphyllum. A. Blüte einer E. macropterum Form. Pericarpellschuppen zahlreich, mit behaarten Areolen; äußere Blütenhüllblätter von den inneren deutlich verschieden ( sepaloid ). B. Un tere Hälfte der Blüte von E. guatemalense (BGUC Nr. 40,414). Schuppen am Pericarpell noch zahlreich und abstehend, doch keine Areolen mehr. C. Blüte von E. anguliger (BGUC Nr. 41,398). Schuppenzahl bereits vermindert, Schup pen nicht mehr abstehend; oberste Re ceptaculum Schuppen dem Schlund sehr genähert (Akrotonie) und petaloid ge färbt, äußere Blütenhüllblätter hingegen bereits den inneren ähnlich. Vergleiche hierzu noch E. phyllanthus in Mor phologie Abb. 75. In B. sind die Nektartropfen an den Schuppenspitzen eingezeichnet. In C deutet der Pfeil den Bereich der Staubblattinsertion an, die von da bis zum Schlund reicht. Abb. 2. Unterste Pericarpellschuppe von Epiphyllum lepidocarpum mit punktförmigen Areolen, deren unterste noch kleine Borstenstachelchen trägt. Abb. 3. Schnitt durch die Blüte einer Epiphyllum lepidocarpum Form. Griffel beiseite gelegt. Die Pfeile verdeutlichen die Staubblätter tragende Zone und den Schlundkranz. Abb. 5. Frucht von Epiphyllum phyllanthus Abb. 4. Die charakteristischen steifen Haarzellen des Funiculus von Epiphyllum. A Gruppe von Haarzellen am Funiculus, B einzelne, ausgestoßene Zellen. (Vergl. dazu Morphologie Abb. 53 A) Krainz, Die Kakteen, 1. I C II b
74 Abb. 6. Samen von Epiphyllum phyllanthus (leg. F. Ritter FR Nr. 311 b). A Außenansicht von der Seite. Hi Hilumgewebe. Mi zeigt die Lage des Mikropylarloches an. B Hilum. Mi Mikropylarloch, Fu Ansatz des Samenstranges. C Detail aus der Testa. Radialwände der Testazellen auffallend dick, Außenwände zu einer (echten) grubigen Punktierung eingesunken (G); zwischen manchen Zellen vereinzelte Zwischengrübchen (Z). Diese der Deutlichkeit wegen weiß gelassen, tatsächlich aber dunkel. D Samen nach Entfernen der äuße Samenschale; kein Perisperm! E Embryo, ->. Die S ä m l i n g e haben nur ein dünnes Hypocotyl und relativ dünne schmale Keimblätter (vgl. Morphologie Abb. 54a). Auffallend ist, daß schon der Epicotylsproß ein Flachsproß ist, der meist noch Borstenstacheln trägt. Heimat Als Bewohner des tropischen Regenwaldes ist die Gattung besonders in Zentralamerika (Costa Rica, Guatemala, Honduras bis Panama), ferner im nördlichen Südamerika und in den Mexicanischen Staaten Oaxaca (E. caudatum, E. stenopetalum) und im nördlichen Chiapas (E. chrysocardium) beheimatet. E. hookeri reicht von Venezuela nach Trinidad. Am weitesten nach Norden reicht E. anguliger ( Jalisco, zentrales und südliches Mexico) und E. darrahii. E. oxypetalum reicht von Mexico über Guatemala und Venezuela bis Brasilien, E. phyllanthus in Varietäten von Panama nach Britisch Guyana und weiter bis in die Chaco Region von Bolivien, Peru, Brasilien und die argentinischen Provinzen Chaco und Missiones. Bemerkungen 1. Die Gattung Epiphyllum wurde von HAWORTH 1812 auf Cactus phyllanthus L. aufgestellt. Als Bemerkung fügt HAWORTH noch hinzu, daß auch Cactus alatus Swartz, auf den später BRITTON & ROSE die Gattung Pseudorhipsalis aufstellten, zu dieser Gattung gehöre. Später (HAWORTH, Suppl. Pl. Succ. S. 55, 1519) fügt HAWORTH noch Epiphyllum truncatum Haw. hinzu. DE CANDOLLE (1828, Prodromus 3, S ) zieht Epiphyllum Haw. zu Cereus ein, und stellt dafür die Cerei 3 Alati auf, zu denen er C. phyllanthus, C. phyllanthoides, C. oxypetalus, C. alatus und C. truncatus stellt. Phyllanthus corrected in phyllanthus as stated in Korrekturen 3 XII C II b Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1962
75 Gattung Epiphyllum Die Einbeziehung von Epiphyllum truncatum erst zu Epiphyllum und dann zu der betreffenden Gruppe von Cereus führte dann zu einer nomenklatorischen Wirrnis. Auf die gleiche Leitart wie HAWORTH stellt nämlich 1831 LINK im Handbuch zum Erkennen der Gewächse 2. S. 10, die Gattung Phyllocactus auf, zu der er auch Phyllocactus phyllanthoides stellt. Nach den Regeln der nomenklatorischen Priorität ist dieser Gattungsnamen von vorneherein ungültig erklärt aber PFEIFFER in Enumeratio diagnostica Cactacearum Haworth s Gattung Epiphyllum für eigent lich unberechtigt, da sie ohne Rücksicht auf Blütenmerkmale lediglich auf vegetative Merkmale aufgebaut sei. Er stellt alle Epiphyllen mit röhrigen Blüten zu Cereus, jene mit radförmigen zu Rhipsalis und läßt lediglich Epiphyl lum truncatum bestehen. Die Begründung PFEIFFERS ist ausgesprochen falsch. Denn HAWORTH führte in seiner Gattungsdiagnose ausschließlich Blütenmerkmale an, die sogar eine sehr gute Beschreibung des E. phyllanthus darstellen, aber keineswegs auf Epiphyllum truncatum passen. Erst in der Beschreibung der Art Epiphyllum phyllan thus gibt HAWORTH vegetative Merkmale an: E. (spleenwort leav d) proliferum laeve ramosum ensiformicompressum, serrato repandum, costa centrali lignea. Dieser Irrtum PFEIFFERS führte aber zu einer fast hundertjährigen Namensverwechslung, denn SALM DYCK (Cactaceae in Horto Dyckense cultae anno 1849, S ) greift Phyllocactus LINK wieder auf und von da an wird Phyllocactus im LINK schen Sinne und Epiphyllum im PFEIFFER schen Sinne gebraucht. SCHUMANN befolgt bei der Bearbeitung der Cactaceae in MARTIUS, Flora Brasiliensis Bd. 4, 2, 1890 die Prioritätsgesetze und gebraucht dort Epiphyllum im Sinne HAWORTH s, weshalb er für Epiphyllum truncatum Haw. die Gattung Zygocactus aufstellt. In seiner Gesamtbeschreibung der Kakteen 1898, S. 203 greift er aber wieder auf die Benennung im PFEIFFER schen Sinne zurück, weil er sich in der häufigen Berührung mit Praktikern von der Unzuträglichkeit, die Priorität bei bekannten, viel genannten und kultivierten Pflanzen durchzuführen überzeugt habe. Erst BRITTON & ROSE stellten 1923 (The Cactaceae Bd. 4) die Priorität für Schumann s Sect. I. Euphyllocactus wieder her, wobei sie aber gleichzeitig erkennen, daß die anderen Phyllocactus Sectionen von Epiphyllum ab getrennt und zu eigenen Gattungen erhoben werden müssen. Die Tatsache, daß auch die LINK sche Gattung Phyllocactus in sich uneinheitlich war, mag vielleicht mitbestimmend gewesen sein, daß WERDERMANNS Antrag (1937), den eingebürgerten Namen Phyllocactus gemäß 21 der Internationalen Regeln zu schützen, von der Internationalen Nomenklaturkommission verworfen wurde. Damit hat der LINK sche Gattungsname Phyllocactus endlich seine Berechtigung verloren und Epiphyllum muß im HAWORTH schen Sinne gebraucht werden. Diese Tatsache schließt aber m. E. einen ganz anderen Gebrauch des LINK schen Namens keineswegs aus. Im Plural der verdeutschten Schreibweise P h y l l o k a k t e e n (was wörtlich Blattkakteen heißen würde, aber doch nicht mit belaubte Kakteen verwechselt werden kann) ist er nämlich ein sehr brauchbarer Sammelbegriff für alle Kakteen mit blattähnlichen Sprossen, ohne Rücksicht auf ihre Gattungszugehörigkeit, einschließlich der ge züchteten Hybriden, die, ihrer epiphytischen Lebensweise nach, eine andere Behandlung erfordern, als die anderen Kakteen. 2. Über die Benennung von Epiphyllum macropterum besteht ich möchte sagen merkwürdigerweise Unklarheit, seit SCHUMANN sie für identisch mit Phyllocactus thomasianus Schum. aufgefaßt hatte; gerade diese Tatsache aber ist von Bedeutung, da sie die Zusammengehörigkeit jener Arten, die am Pericarpell noch Haardornen tragen, mit jenen, denen diese bereits fehlen, aufzeigt. Es muß daher hier näher auf diese Frage eingegangen werden. SCHUMANN stellte Phyllocactus macropterus LEMAIRE als Synonym zu seinem Phyllocactus thomasianus, weil die ungenügende Beschreibung LEMAIRE s nach der sterilen Pflanze keineswegs genügend sein kann, um sie zu erkennen. BRITTON und ROSE hingegen, die ihr Material aus San José, Costa Rica, erhalten hatten, stellen P. thomasianus als Synonym zu Epiphyllum macropterum (Lem.) Britt. et Rose, entsprechend der Priorität des LEMAIRE schen Namens. Ein sorgfältiger Vergleich der Beschreibung SCHUMANNS für Ph. thomasianus mit jener, die BRITTON und ROSE nach dem Material vom Standort in Costa Rica für E. macropterum geben, läßt aber bereits erkennen, daß die beiden nicht identisch sein können und nur in der, für die Gattung auffallenden Größe, sowie der Gestalt der Blüte übereinstimmen. BRITTON und ROSE betonen die Behaarung der Schuppenachseln am Pericarpell. SCHUMANN erwähnt mit keinem Wort eine Behaarung, die seiner Sorgfalt bei Beschreibungen sicher nicht entgangen wäre. Den Wuchs schildert SCHUMANN (allerdings nur in der ergänzenden deutschen Beschreibung, nicht in der lateinischen Diagnose!): Glieder zweigestaltig, indem bis fast 2 m lange, drehrunde oder wenig zusammengedrückte Langtriebe in Blattartige ausgehen... diese sind oblong oder breit lanzettlich, meist stumpf oder selbst ausgerandet, seltener spitz, am Grunde in die Langtriebe oder wie in einen Stiel verschmälert, bis 40 cm lang und 5 8 cm breit... BRITTON und ROSE erwähnen keinen anders gearteten Langtrieb, sondern schreiben nur: Plants up to 2 m long, the joints weak, sometimes 10 cm broad, thin... Thomasianus corrected in thomasianus 4 times as stated in Korrekturen 3 XII 1973 Krainz, Die Kakteen, 1. I C II b
76 ancheinend -> anscheinend MORAN (1953) sind diese Differenzen anscheinend entgangen und er hält SCHUMANN s und BRITTON Differnzen -> Differenzen und ROSE s Pflanze für identisch. Auch er meint, daß Phyllocactus macropterus Lem. nach der Beschreibung kaum identifizierbar sei und tritt für den Namen Epiphyllum thomasianum ein. KIMNACH (1958, Fußnote S. 24), der sich mit der Gattung sehr eingehend befaßt hat, hält die beiden Arten für verschieden, eine Ansicht, der ich mich anschließe. Epiphyllum thomasianum scheint mir sogar ein wichtiges Bindeglied zwischen den großblütigen Arten mit Behaarung des Pericarpells (E. macropterum und E. chrysocardium) und längerer Blühdauer und den kleinblütigen ohne Behaarung mit kurzlebigen Blüten zu sein, da es die Blütencharaktere der ersteren mit den kahlen Pericarpell der letzteren vereint. Damit beweist es die Einheit der Gattung. Die hier angeführte und abgebildete Kulturform vom Epiphyllum macropterum stimmt jedenfalls sehr gut mit der Blütenabbildung und der Beschreibung der Art bei BRITTON und ROSE überein. In guter Kultur werden die Flachsprosse, die aus nur kurzen verholzten drehrunden Basalteilen ausgehen, ebenfalls 10 cm breit und sehr lang. 3. Stammesgeschichtlich schließt sich die Gattung Epiphyllum als eigene Subtribus Epiphyllinae F. Buxb. an der Art B der Subtribus Hylocereinae F. Buxb. an, wobei die Gattung Mediocactus mit Mediocactus coccineus im Blütenbau ein klares Bindeglied zu den primitivsten, noch einige Haarstacheln am Pericarpell tragenden Epiphyl lumarten bildet (Vergl. Bild Tafel 23 in CASTELLANOS & LELONG, Cactaceae in DESCOLE, Genera et Species Plantarum Argentinarum Bd. I. 1943). Auf diese Arten, d. h. auf Phyllocactus macropterus Lemaire, hat BACKEBERG (mit ganzen 6 Worten!!) die Gattung Marniera Backeb. aufgestellt (Cact. & Succ. Journ. Amer. 22, S. 153, 1950). Diese Abtrennung entbehrt jedoch jeder Berechtigung, da die Unterschiede, Haare am Pericarpell und Tagblütigkeit d. h. längeres Offenbleiben der sich ebenfalls nachts öffnenden Blüten, keine Gattungscharaktere sein können. Außer den in Zusammenhang mit Epiphyllum macropterum und E. thomasianum oben gemachten Feststellungen, sei darauf hingewiesen, daß auch an den untersten Pericarpellschuppen von Epiphyllum lepidocarpum winzige, punktförmige Areolen und selbst einzelne Haarstacheln auftreten können! Die Gattung Marniera Backeb. ist daher in die S y n o n y m i k zu ver weisen. Weitere wichtige Literatur Alexander, E. J., Epiphyllum chrysocardium, a new species. Cact. & Succ. Journ. Amer. XXVIII, 1956, 3 6. Britton, N. L. and Rose J. N., The Genus Epiphyllum and its allies. Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI, Cactus Pete, Mrs., The Orchid. Cactus. Cact. & Succ. Journ. Amer. XIX, 1947, S Cutak, L., Night blooming Cereus and its allies. Miss. Bot. Gard. Bull. 33, 1945, S. 5. Hall, H., Fruiting two Epiphyllum Species. Cact. & Succ. Journ. Amer. XIX, 1947, S. 54. Haselton, S. E., Epiphyllum Handbook, Pasadena. Kimnach, M., Icones Plantarum Succulentarum, 11. Epiphyllum cartagense (Web.) Britt. et Rose. Cact. & Succ. Journ. Amer. XXX., 1958, S Knebel, K., Phyllokakteen. Potsdam Moran, R., Taxonomic Studies in the Cactaceae. I. Problems in Classification and Nomenclature. Epiphyllum Haw., Phyllocactus Link and Zygocactus Schum. Epiphyllum Thomasianum (Schum.) Britt. et Rose. Gentes Herbarum VIII/IV. 1953, S Schumann, K., Die Gliederung der Gattungen Phyllocactus Lk. und Epiphyllum Haw. (Pfeiff. emend.). Englers Bot. Jahrb. XXIV, 1897 a, S Vöchting, H., Über die Bedeutung des Lichtes für die Gestaltung der blattförmigen Kakteen. Berlin Weber, A., Phyllocactus, in Bois, Dictionnaire d Horticulture, Paris 1898, S Werdermann, E., Beiträge zur Nomenklatur. II/7. Epiphyllum Haworth, Phyllocactus Link und Zygocactus K. Schumann. Kakteenkunde 1937, S Epyphyllum corrected in Epiphyllum Dicctionnaire corrected in Dictionnaire S corrected in S. C II b Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1962
77 Gattung Epithelantha Weber ex Britton et Rose, 1922, in The Cactaceae III, S. 92.* Griech. epi = über, auf; thele = Warze; anthos = Blüte. Epithelantha heißt also Die auf der Warze Blühende. U. Fam. C. Cereoideae, Tribus VIII. Echinocacteae, Subtrib. Thelocactinae, Linea Strombocacti. Diagnose nach Britton und Rose l. c.: Plant globular, very small, the surface divided into numerous tubercles arranged in spiraled rows, mostly hidden by the numerous small spines; flowers very small, from near the center of the plant, arising from upper part of the spine areole on the young tubercles; outer perianthsegments 3 5; inner perianth segments few, often only 5; stamens few, usually 10, included; fruit small, clavate, red, few seeded; seeds black, shining, rather large depressed hilum. ** hilium -> hilum Leitart: Epithelantha micromeris (Engelm.) Web. et Britton et Rose (Mammillaria micromeris Engelmann in Proceed. Amer. Acad. 3, 1856, S. 260.) hilium -> hilum Beschreibung Zwergige Kugelkakteen von Mammillaria ähnlichem Habitus, die aus einem schlanken Wurzelstuhl faserige, in einem Falle (E. pachyrhiza) dickfleischige W u r z e l n ausbilden. Die einfachen oder mäßig sprossenden, nur selten rasenförmig wachsenden K ö r p e r sind flachkugelig oder kugelförmig, am Scheitel abgeplattet oder selbst eingedrückt, später ± zylindrisch und tragen sehr zahlreiche aber kleine W a r z e n in sehr regelmäßiger Anordnung. Die in mehreren Reihen stehenden ± flach ausgebreiteten R a n d s t a c h e l n sind oft so in einander verflochten, daß der Körper gänzlich verdeckt ist; M i t t e l s t a c h e l n werden meist nicht ausgebildet bzw. sind nur undeutlich als solche zu unterscheiden. An blühfähigen Exemplaren sind die obersten Randstacheln sehr verlängert, gebogen und infolge einer Sekretabscheidung nahe der Spitze keulenförmig *** und überdecken die Scheitelgrube; später wird die obere Hälfte dieser Stacheln verstoßen. Die kleinen, trichterförmigen, meist rosenroten B l ü t e n entspringen vereinzelt in unmittelbarer Nähe des Scheitels. Sie entstehen aus einer unmittelbar, an die bestachelte Areole anschließenden Anlage, die zunächst ein dichtes Wollbüschel hervorbringt. Das kahle und nackte P e r i c a r p e l l verlängert sich in das schuppenlose, völlig blumenkronartig gefärbte R e c e p t a c u l u m, das sich aus einem ± zylindrischen unteren Teil allmählich trichterig erwei tert. Dem oberen Teil des Receptaculum entspringen die wenigen äußeren B l ü t e n h ü l l blätter, die, im Gegensatz zu den inneren, einen grünlichen Mittelstreifen aufweisen und am Rande gefranst sind; ihr Rand, und insbesondere der der Fransen zeigt papillenförmige Rand zellen. Der Rand des Receptaculum geht ohne deutliche Grenze in die wenigen, bis zum Pericarpell herablaufenden zarten inneren Blütenhüllblätter über, die an der Spitze meist stumpf bis gerundet, mitunter etwas fransig gezähnt sind. Innen trägt das Receptaculum vom Beginn der Erweiterung bis zum Schlund die wenig zahlreichen relativ kurzen S t a u b b l ä t t e r in mehreren Spiralgängen. Der dünne G r i f f e l trägt drei kurze, stank papillöse N a r b e n äste. * WEBER, der als Erster erkannt hatte, daß die Blüten nicht aus den Axillen, sondern aus der Spitze junge Warzen entspringen, hat zwar den Namen Epithelantha geprägt und in Dict. Hort. Boiss. 1898, S. 804 veröffentlicht, jedoch nur in der Synonymik zu Mammillaria micromeris Engelm. bzw. an anderer Seile als Synonym unter Echinocactus micromeris. Daher wurde die Gattung Epithelantha erst durch die Veröffent lichung durch BRITTON und ROSE gültig. ** Wiedergegeben einschließlich des offensichtlichen Druckfehlers hilum. mehrerne corrected in mehreren *** Siehe unter Bemerkungen 1. Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VIII
78 Abb. 1. Areole von Epithelantha micromeris. (Die längsten Dornen nicht ausgezeichnet). Die in Anlage ovale Form der Areole ist an der erwachsenen nicht mehr erkennbar. A papillenfözmige corrected in papillenförmige lantha fungifera. P papillenförmige Rand Abb. 3. Äußeres Blütenblatt von Epithezellen. B C D Abb. 2. Außenansicht der Blute von Epithelantha fungifera hort. Abb. 4. Schnitt durch die Blüte von Epithelantha fungifera. Abb. 5. Samen von Epithelantha micromeris. A. Seitenansicht ohne Berücksichtigung der Testastruktur. Testastruktur und Hilumansicht siehe Morphologie S. 93, Abb. 215 C. B. Schnitt durch den Samen nach Entfernen der äußeren Testa. it innere Testa mit vorgezogenem Mikropylarteil (Mi), vg verstärkter Gewebestreifen. C. Samen ohne äußere Testa, Ventralansicht. A Gewebskomplex mit geringem Stärkegehalt, Bezeichnung sonst wie bei B. D. Embryo. C VIII Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1964
79 Gattung Epithelantha A B Abb. 6. A. und B. Samen von Epithelantha micromeris v. tuberosa hort., reine Seitenansicht und mit Sicht auf die Hilumseite. Die warzige Testastruktur vernachlässigt, um die Gestalt des Samens deutlicher zu machen. Man beachte die Aufspaltung der Testa an der Spitze und die für die Gattung starke Einkrümmung auch der äußeren Testa. pachyrrhiza -> pachyrhiza Die F r ü c h t e sind nackte, langgestreckte keulenförmige rote Beeren ohne Blütenrest, die nur wenige Samen enthalten. Die ansehnlichen schwarzen S a m e n sind bei der typischen E. micromeris (Leitart!) etwa mützenförmig *, mit einem die ganze Längsseite einnehmenden, vertieften H i l u m. Das vor dere (mikropylare) Ende ist, von oben gesehen, verschmälert, das rückwärtige gerundet. Bei der var. greggii sind sie etwas schiefer (Vergl. Morphologie S. 93. Abb. 215 C), bei der var. tuberosa (die Backeberg mit? für identisch mit seiner E. pachyrhiza hält) ist die micro pylare Region des leicht gekrümmten Samen spitz vorgezogen und die Testa hier aufgespalten, was sehr an die Verhältnisse bei Encephalocarpus anklingt. Die T e s t a ist bis auf den Hilum rand sehr gleichmäßig warzig. Nach Entfernen der äußeren Testa zeigt es sich, daß der Samen im i n n e r e n B a u eine leichte Krümmung und ventrale Abplattung zeigt und die Mikropyle der inneren Testa bis an den Hilumsaum lang vorgezogen und verhärtet ist, wobei sich ein verstärkter Gewebestreifen noch über die Ventralseite erstreckt. An dieser ist zwar kein ausgesprochenes P e r i s p e r m zu erkennen, aber doch etwas Stärke führendes Gewebe. Auch der E m b r y o, der nur kurze Keimblatthöcker aufweist ist leicht gekrümmt. Verbreitung Westliches Texas, südliches Neumexiko und anschließende Gebiete von Nord Mexiko. Bemerkungen 1. Wenn Boke (1955) erklärt, daß er weder bei Epithelantha noch bei Encephalocarpus die von mir festgestellten Drüsendornen finden konnte, so dürfte dies auf ein Mißverständnis zurück zuführen sein, da seine Habitus Photographie der E. micromeris unverkennbar diese keulen förmigen Stacheln erkennen läßt. Diese Dornen lassen im anatomischen Bau nämlich tatsäch lich in keiner Weise erkennen, daß sie zu sezernieren imstande sind und überdies ist das aus geschiedene Sekret sehr leicht in Wasser löslich, Eben darin stellen diese Sekretdornen aber einen ganz besonderen, bisher nur bei diesen beiden Gattungen festgestellten Typus dar. (Vergl. auch die Bemerkungen bei Gattung Encephalocarpus sowie Morphologie S. 7, Abb. 9). Nur das ausgeschiedene Sekret erweckt den Eindruck einer verdickten Dornenspitze. 2. Die Blüte von Epithelantha gleicht infolge der ebenfalls fransigen äußeren Blütenblätter völlig einer stark reduzierten Encephalocarpus Blüte. Der Samen der Epithelantha micromeris * K. SCHUMANN bezeichnet sie als schiffchenförmig. Vielleicht meinte er dabei aber das Schiffchen, d. i. die Lagermütze der deutschen Soldaten, was tatsächlich gut passen würde. Krainz, Die Kakteen, 1. XI C VIII
80 var. tuberosa *, aber auch der innere Bau des Samens der typischen Leitart, zeigen bereits eine gewisse bei der var. tuberosa sogar starke Annäherung an die Einkrümmung und Gestalt des Samens von Encephalocarpus und Pelecyphora, die im inneren Bau noch besonders zum Ausdruck kommt. Epithelantha, Encephalocarpus und Pelecyphora (aus der jedoch Pelecyphora valdeziana und Pelecyphora pseudopectinata auszuscheiden sind) bilden damit einen eigenen Entwicklungszweig der Linea Strombocacti, wobei alle drei Gattungen als Endglieder der Entwicklung anzusprechen sind, indem sie alle drei wie dies ja meist der Fall zu sein pflegt primitive und hochabgeleitete Eigenschaften vereinen. Pelecyphora ist in der Blüte am primitivsten, Epithelantha am höchsten abgeleitet. Im Samen ist umgekehrt Epithelantha am ursprünglichsten, Encephalocarpus und Pelecyphora stark abgeleitet. Da die starke Reduktion in der Blüte Enceyphalocarpus corrected in Encephalocarpus von Epithelantha mit deren Zwergwuchs in Zusammenhang gebracht werden kann, im Samen aber erst Andeutungen der Entwicklung zur Samenform von Pelecyphora feststellbar sind, muß Epithelantha doch trotz der Reduktion der Blüte als die, der Stammform am ähnlichsten gebliebene Gattung angesprochen werden. 3. Der mitunter recht lange Hals zwischen Wurzelstuhl und dem kugeligen Körper erweist sich durch die deutliche Erkennbarkeit von Warzen unverkennbar als ein in die Tiefe geratener Teil des Epikotylsprosses; offenbar sind solche Exemplare als Jungpflanzen immer wieder vom lockeren Boden verschüttet worden und erst nachdem sie endgültig die Oberfläche erreich ten, konnten sie den Kopf ausbilden. Es handelt sich also bei diesem Merkmal offensicht lich taxonimischen -> taxono umischen eine standortbedingte Wuchsform ohne jeden taxonomischen Wert. 4. Innerhalb der in sich sehr gut abgeschlossenen Gattung besteht wie bei Pflanzen sehr extremer Standorte gewöhnlich eine sehr große Variabilität im Habitus. Backebergs Monographie du Genre Epithelantha (1954) ist aber lediglich eine Zusammenfassung von Literaturangaben mit Wiedergabe der betreffenden Originalabbildungen der betreffenden Autoren, die keinerlei weitere Untersuchungen außer einiger rein habitueller Merkmale enthält. Sie bringt daher auch keine Angaben über die Blüten und die innerhalb dieser Gattung sicher sehr maßgeblichen Samen. Daher kann diese Publikation keinesfalls als Monographie im wissenschaftlich botanischen Sinne bezeichnet werden. Es ist klar, daß unter diesen Umständen auch Backebergs Neukombinationen (Arten anderer Autoren als Varietät Backeberg und umgekehrt Varietäten anderer Autoren als Species Backeberg!) als zweifelhaft bezeichnet werden müssen. Bis eine wirkliche Klärung der Arten und Varietäten durch genaue Untersuchungen aller Pflanzenteile und Studium der individuellen Variabilität erfolgt sein wird, ist es zweifellos besser, sie zu ignorieren. 5. Epithelantha wird von den Indios ähnlich wie Lophophora als Rauschdroge verwendet. pachyrrhiza -> pachyrhiza Literatur Backeberg, C. Monographie du genre Epithelantha. Cactus France 1954 Nr. 39 und 40. Boke, N. H. Dimorphic areoles of Epithelantha. Americ. Journ. Bot. 42, Bravo Hollis, H. Nuevas especies del genero Epithelantha. Ann. Inst. de Biol. Mexico XXII, Buxbaum, F. Die Phylogenie der nordamerik. Echinocacteen. Österr. Bot. Zeitschr. 98, 1951., Once more... Phylogeny of Pelecyphora, Solisia, Encephalocarpus and Epithelantha. Nation. Cact. and Succ. Journ. 15, Marshall, W. T. A. New variety of Cactus (Epithelantha micromeris var. pachyrhiza) Cact. Succ. Journ. America XVI, * Da die Synonymik der Arten der Gattung noch keineswegs als geklärt betrachtet werden kann, wende ich hier die Namen an, unter denen das mir zur Verfügung stehende Material geführt wurde, ohne damit ein Urteil über Gültigkeit oder Ungültigkeit des betr. Namens ein Urteil fällen zu wollen. C VIII Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1964
81 Gattung Eriocereus (A. Berger pro subgen. in Rep. Missouri Bot. Gard. 16, 1905, S. 74) Riccobono V. in Bull. R. Orto Bot. Palermo 8, 1909, S Synonyme: Harrisia Britton subgen. Eriocereus Britt. et Rose in The Cactaceae II, 1920, S NON Harrisia Britt. subgen. Euharrisia Britt. et Rose l. c. Nach gr. erion = Wolle, also wolliger Cereus. U. Fam. C, Cactoideae (Cereoideae), Trib. II Hylocereae, Subtr. a Nyctocereae. Britt. corrected in Britt. Diagnosen I. nach A. Berger l. c. als Subgenus zu Cereus Ovary roundish with deltoid acute scales; tube with similar but larger and more remote scales, in their axils with more or less copious white wool, on the ovary sometimes with a few spines; sepaloid perianth leaves acute greenish brown; petaloid ones white; stamens numerous, in two groups. Fruit roundish, with the dried remains of the flower more or less persistent, red, with the pulvilli more or less raised, scales often a little increased, with wool and often spines in their axils; pulp white, seeds numerous, black, opaque, compressed, strongly papillous along the crest. II. nach Riccobono l. c. pro genere: Fiori grandi, imbotiformi, notturni, bianchi al centro; ovario rotondo, con squame deltoidee, acute; tubo con squame somiglianti, ma più larghe e più remote portanti alla loro ascella più o meno copiosa lana, ed in alcune specie setole o spine; lacinie interne bianche, esterne verde rosee; stami numerosi declinati; frutti rotondi, con il perigonia più o meno persistente, rossi, apulvilli prominenti, squame un poco accresciute, con lana e sovente spine alla loro ascella; polpa bianca. III. Ergänzung durch Buxbaum: Cactaceae cereoideae fruticosae primum solum erectae, deinde vel arcuatae usque ad prostratae vel scandentes, ramosae usque ad ramosissimae, ramis tenuibus 2 8 cm crassis, costis , rarius 3, interdum gibbosis. Seminibus galeaeformibus distincte carinatis, carinae cellulis permagnis, ceterum minute verrucosis; perispermio absente, embryone crasso, cotyledonibus magnis transversaliter positis. Leitart: Cereus tortuosus Forb. in Allg. Gartenzeitg , S. 35. Beschreibung S t r a u c h i g e, ± reich verzweigte S ä u l e n k a k t e e n mit schlanken Zweigen. Nur anfangs aufrecht, bald bogenförmig bis niederliegend, buschig verzweigt oder spreizend ästig, oder anlehnend kletternd, E. guelichii dann bis 25 m lang auf Bäume kletternd. Äste (4) 6 bis 10 rippig oder 3 4 kantig, später manchmal fast drehrund. Areolen manchmal auf Höckern der Rippen stehend mit meist 5 10 acicularen (bei E. platygonus bis 15 borstigen) R a n d s t a c h e l n und meist 1 kräftigeren M i t t e l s t a c h e l. B l ü t e n einzeln aus Areolen in der Nähe der Sproßenden, nächtlich, trichterig, sehr ansehnlich (12 22 cm lang). Das gegen das Receptaculum etwas verdickte P e r i c a r p e l l ist dicht von den ± stark vortretenden Podarien der kleinen bis sehr ansehnlichen, drei eckigen bis spitz eiförmigen, mit Spitzchen versehenen S c h u p p e n, die ± starke Wolle, nach Berger manchmal auch einzelne S t a c h e l n in den Achseln tragen. R e c e p t a c u l u m lang zylindrisch röhrenförmig, gegen den Schlund hin trichterig erweitert, mit größeren, abstehenden, bei E. guelichii sehr groß laubartigen, grünen Schuppen und unterschiedlich starker Wollbildung in den Achseln. Am erweiterten Teil rascher Übergang zu den ± lanzettlichen grün bräunlichen äußeren P e r i a n t h b l ä t t e r n. Die inneren sind breiter lanzettlich, weiß. Krainz, Die Kakteen, 1. I C II a
82 Abb. 1. A. Blüte von Eriocereus platygonus, halboffen, B. von Eriocereus bonplandii, Knospe. Abb. 2. Eriocereus platygonus, Blütendetails. A. Längsschnitt. (Beachtlich die sehr starke Lagekrümmung der ra diär gebauten Blüte!) B. Narbe, ebenfalls durch die Lagekrümmung schief. C. verzweigter Samenstrang, D. Samenanlage. Abb. 13. Eriocereus guelichii, unterer Teil der Blüte mit den laubartig großen Schuppenblättern. Abb. 4. Schnitt durch halbreife Frucht von Eriocereus bonplandii, schematisiert. Blütenrest nicht ausgezeichnet. Durch Lagekrümmung der Blüte auch die Frucht asymmetrisch. St. Stielzone. Areolen in den Schuppenachseln hier verkümmert. Pulpa noch nicht verquollen, obwohl die Samen bereits keimfähig sind. Die untersten S t a u b b l ä t t e r entspringen über einer engen, aber ziemlich langen Nektarkammer in fast gleicher Höhe, die zahlreichen weiteren in dichten Reihen bis an den Beginn der Erweiterung; nach einer staubblattfreien Zone ein S c h l u n d r i n g. Die Antheren liegen etwa in halber Höhe der Blumenkrone. G r i f f e l sehr dünn mit ± zahlreichen line alen, am Rücken z. T. papillenfreien Narbenästen die Staubblätter überra gend. S a m e n a n l a g e n an mehr fach gabelig verzweigten langen Sa mensträngen. Die ± kugelige F r u c h t trägt den Blütenrest, der aber später abbrechen kann. Die Po darien der Schuppen der Blüte wachsen zu oft sehr ansehnlichen Höckern heran, ebenso ver größern sich etwas die Schuppen selbst, in deren Achseln bei manchen Arten neben etwas Wolle einige feine Stacheln stehen können, bei anderen aber auch die Areolenwolle verschwindet. Das P e r i k a r p ( F r u c h t w a n d ) ist bis zur Reife meist auffallend dick, unter den Podarienhöckern bis 12 mm. Erst bei Vollreife springt die Frucht mit Längsriß auf, die weiße Pulpa tritt aus (Siehe Bemerkung 1). Der S a m e n ist sehr charakteristisch helmförmig mit einem sehr ausgeprägten Kiel von auffallend großen Zellen, die Seitenwände sind mattglänzend schwarz, feinwandig, mit sehr kleinen Zwischengrübchen, am Hilumsaum fast glatt, nur feinkörnig. Das basale Hilum ist C II a Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1975
83 Gattung Eriocereus Echinocereus corrected in Eriocereus!!! B C D A Abb. 5. Samen von Eriocereus guelichii. A. Außenansicht, B. Hilum, C. nach Entfernen der sehr harten Außentesta. D. Embryo. Die Keim blätter liegen transversal zur Medianebene! Abb. 6. Sämling von Eriocereus jusbertii. Abb. 7. Areal von Eriocereus. Südgrenze nach Castellanos und Lelong, Nordgrenze noch nicht ermittelt. Eriocereus adscendens tritt aber nach Werdermann noch häufig und verbreitet in NO Brasilien in der Caatinga von Pernambuco und Bahia auf. etwas oval mit einer Verengung. Ein P e r i s p e r m fehlt, der E m b r y o hat große K e i m b l ä t t e r, die quer zur Medianebene stehen. Am Sämling bilden sie seitliche Spitzen. Heimat Südamerika: Argentinien im NW bis Catamarca (E. pomanensis), Chaco, Paraguay, nordöstlich bis Bahia und Recife (Pernambuco), in NO Brasilien mit E. adscendens in der Caatinga. Nördliche Arealabgrenzung nicht bekannt. Bemerkungen 1. Obwohl Eriocereus sehr häufig in Kultur ist und leicht blüht, sind die Angaben über die Frucht in der Literatur äußerst spärlich und ungenau. Meist ist nur eine Angabe über die Frucht in einem Frühzustand gegeben, wobei beachtet werden muß, daß ein Ausgleich der Höcker oft erst im letzten Stadium der Reife Krainz, Die Kakteen, 1. I C II a
84 eintritt. Eine Frucht, die ich als Harrisia tortuosa seinerzeit erhielt und abbildete, ist vollkommen glatt, ohne Höcker und mit nur 3 mm dicker Fruchtwand und glasiger Pulpa, während die Früchte dieser Art bei Britton und Rose stark gehöckert sind und die Pulpa als Weiß (white) angegeben wird. Nur die lebhaft rote Farbe dieser Frucht zeigte, daß es (wahrscheinlich!) keine Harrisia Frucht sein kann, der sie in der glatten Oberfläche und dem abgefallenen Blütenrest vollkommen gleicht! Da dieselben Mängel bei Harrisia festgestellt werden, muß hier noch viel Feldarbeit geleistet werden! 2. Berger hat bei seiner Aufgliederung der alten Sammelgattung Cereus (1905) die Untergattung Eriocereus aufgestellt, die 1909 von Riccobono zur Gattung erhoben wurde. Sowohl Berger s Untergattungsdiagnose als die Gattungsdiagnose Riccobono s, die fast nur eine Übersetzung der Berger schen ist, beruhen aber ausschließlich auf Blüte und Frucht. Sie waren daher von der 1908 von Britton gegebenen Diagnose seiner Gattung Harrisia die allerdings auch vegetative Merkmale anführt infolge der biologischen Konvergenz der beiden ausgeprägten Sphingiden- Blumen der beiden Gattungen aus der Diagnose nicht unterscheidbar. Daher wurde von allen späteren Autoren, mit Ausnahme von W. T. Marshall und T. M. Bock, Eriocereus als Synonym zu Harrisia gestellt und als Untergattung geführt, trotz der so auffälligen Disjunktion der beiden Areale. Meine vollständigen morphologischen Analysen beider Gattungen haben nun gezeigt, daß Eriocereus und Harrisia doch auch außer der Arealdisjunktion und der etwas fragwürdigen Trennung durch Aufspringen und Nicht Aufspringen der roten bzw. gelben Früchte, in so entscheidend wichtigen Merkmalen unterschie den sind, daß, trotz zweifellos gegebener Verwandtschaft, eine Zusammenlegung der beiden Gattungen nicht berechtigt ist. Die Differenzialdiagnose wird in der Bearbeitung der Gattung Harrisia gegeben werden. 3. Berger betont, daß Abbé Béguin ihm wiederholt versichert habe, daß Cereus jusbertii Rebut eine Hy bride Beguin corrected in zwischen Cereus und Echinopsis sei, die er gezüchtet hätte. Diese Ansicht wird von der Literatur unkritisch weitergeschleppt. Erst W. T. Marshall berichtet, daß Erioc. jusbertii im Desert Botanical Gar den von Arizona in Béguin vielen Exemplaren aus Samen aufgezogen worden sei, die alle dem Typus entspra chen; es könne sich also nicht um eine Hybride handeln. Dieselbe Erfahrung machte auch H. Krainz mit Aussaaten von E. jusbertii in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich. escolles corrected in escole Literatur Berger A. Revision of the Genus Cereus Mill. Rep. Missouri Bot. Gardens 16, 1905, S. 57 ff. Buxbaum F. Allgem. Morphologie der Kakteen. Die Frucht. Cactaceae, Jb. Deutsch. Kakt. Ges. 1941, Blatt Castellanos A. und Lelong H. V. Los Géneros de los Cactáceas Argentinas. Ann. Mus. Argent. Scienc. Nat. Bernardino Rivadivio, Buenos Aires, 39, S , Castellanos A. Cactaceae in Descole H. R. Genera et Species Plantarum Argentinarum I. Buenos Aires Marshall W. T. und Bock T. M. Cactaceae. Pasadena Riccobono V. Studi sulle Cattee del R. Orto Botanico di Palermo; Bull. R. Orto, Bot. di Palermo 8 / 4, 1909, S Weingart W. Cereus repandus und Verwandte. Monatsschr. f. Kakt. 29, 1919, S Werdermann E. Brasilien und seine Säulenkakteen, Neumann, Neudamm (B.) Studi instead of Studii : is that right??? die corrected in di. C II a Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1975
85 guelichi corrected in guelichii: twice Eriocereus guelichii (Spegazzini) Berger guelichii, nach Karl von Gülich, einem Freunde von Spegazzini und Pflanzenliebhaber benannt guelichi corrected in guelichii: 4 times Literatur Cereus guelichii Spegazzini C. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires III, Bd. IV 1905, S. 482, 483. Weingart, W. in Monatsschr. Kakteenkde. XIX 1909, S u. Abb. S. 19. Schelle E. Kakteen 1926, S Harrisia guelichii (Speg.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 158 u. Abb. Eriocereus (Cereus) guelichii (Speg.) Berger A. Kakteen 1929, S Eriocereus guelichii (Speg.) Berger. Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S Diagnose nach C. Spegazzini l. c.: Diag. Tortuosus, scandens, parce ramosus, herbaceo viridis; costis saepius 3 acutis undu latis; aculeis marginalibus 4 5, inferis minimis saepe evanidis, superis centralem omnium validioriem subaequantibus; floribus maximis extus viridibus dense squamosis glabris, petalis albis; fructu subgloboso rubro violascente grosse squamoso subglaberrimo inermi. Beschreibung K ö r p e r gewunden, kletternd, in Bäumen bis 25 m hoch steigend, kaum verzweigt, ohne eigentliche Luftwurzeln. Zweige im Querschnitt dreiseitig, mit kaum, oder nicht hohlen Flä chen, seltener vierseitig, 3 5 cm dick. E p i d e r m i s dunkelgrün, im Neutrieb heller, Krainz, Die Kakteen, 1. XII C II a
86 glatt. S c h e i t e l gerundet, von Stacheln überragt. R i p p e n meist 3, gewellt, scharfkantig. A r e o l e n fast kreisförmig, (2 ) 4 5 mm im Durchmesser, mit kurzem, weißem Filz, im Alter ver grauend; 2 6 cm voneinander entfernt. R a n d s t a c h e l n 4 5, die unteren die kleineren, 4 5 mm lang, oft verschwindend, nach unten und den Seiten abstehend; die beiden oberen länger, mm lang, waagrecht gestellt. M i t t e l s t a c h e l 1, stärker als die Randstacheln, mm lang. Alle Stacheln anfangs schwarzrot, später aschfarbig, grau, mehr oder weniger schwarz bis schwärzlich gespitzt. B l ü t e n cm lang, innere Hüllblätter einen Kreis von 14 cm Durchmesser bildend; glatt, dicht beschuppt, mit leichtem Rosengeruch. R e c e p t a c u l u m (Röhre) 7 cm lang, dicht mit fleischigen, grünen, oben braunroten Schuppen bedeckt, deren Achseln weiße, oben bräun liche Wollhaare tragen. Schuppen unten kurz, spitz zulaufend, nach oben länger werdend, braun, stachelspitzig, in die Hüllblätter übergehend. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r grün, sehr schmal lineal, von 5 bis zu cm lang, bis 1 cm breit, zugespitzt. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r weiß, bis 10 cm lang, ca. 2,5 cm breit, etwas gerandet, ausgefressen, mit einem Spitzchen. S t a u b b l ä t t e r zahlreich, 3/4 so lang als die inneren Hüllblätter. S t a u b b e u t e l ziemlich groß. G r i f f e l so lang wie die Staubblätter, mit ca. 15 kräftigen, spreizenden N a r b e n. F r u c h t groß, 4 4,5 cm im Durchmesser, fast kugelig, ziemlich glatt, stachellos, derb schuppig, rot violett, mit weißem, sehr süßem Fleisch; eßbar. S a m e n 1 mm dick, 2 mm lang, 1,5 mm breit, mützenförmig (in Form einer hohen Schottenmütze), vorn gerade aufsteigend, nicht überhängend, mit raupenartig hervortretendem Rande, nach hinten und unten recht winklig umgebogen und mit leicht gekerbtem Hilum; Testa schwarz, glänzend, am Rande stark geperlt, im übrigen fein punktiert. Heimat Allgemeine Verbreitung: nicht selten in den Wäldern des nördlichen und südlichen Chaco, Argentinien. Kultur im Gewächshaus (im Sommer im Freien) in mittelschwerer, nahrhafter Erde. Nicht anspruchs voll. Triebe von 1 m Länge können bereits blühen. Anzucht aus Samen. Vermehrung durch Stecklinge, die leicht wurzeln. Bemerkungen Die Art wurde um die Jahrhundertwende entdeckt und durch eingeführte Samen in Europa verbreitet. Blüht im August / September. Die Aufnahme zeigt einen blühenden Trieb einer Pflanze der Städt. Sukkulentensammlung Zürich. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 1 : 5. C II a Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1962
87 Eriocereus jusbertii (Rebut) Riccobono jusbertii, nach Mr. Jusbert, Freund des französischen Kakteengärtners P. Rebut, und Reisender, der in Argentinien und Paraguay Pflanzen sammelte Literatur Cereus jusbertii Rebut in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt , , 138 u. Abb. S Gürke M. Blühende Kakt. II 1906, Taf. 78. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S Schelle E. Kakteen 1926, S. 114, 115. Berger A. Kakteen 1929, Eriocereus jusbertii (Rebut) Riccobono in Boll. R. Ort. Bot. Palermo VIII 1909, S Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S Diagnose nach K. Schumann l. c.: Columnaris dein ramosus et in fulcra se accumbens, costis 6 humilibus nunc vix prominentibus crenatis; aculeis radialibus 7 brevibus, conicis validis, centralibus paullo mojoribus; flore infundibuliformi, ovario squamoso lanato. Beschreibung K ö r p e r stammbildend, aufrecht, von unten her, nicht sehr reichlich verzweigt, später sich anlehnend, ziemlich kräftig gegliedert, oben verjüngt und am S c h e i t e l von weißem Wollfilz bedeckt, aus dem die zahlreichen, kleinen, dunklen Stacheln hervorragen; Triebe bis 6 cm dick, fast schwarzgrün, nur an der Spitze heller grün, nach unten zu vergrauend. R i p p e n 6, Krainz, Die Kakteen, 1. I C II?
88 durch sehr flache, konkave, selbst am Scheitel nicht scharfe Furchen voneinander getrennt, etwa 5 6 mm hoch, stumpflich, an den Seiten ausgehöhlt, gekerbt, unten verlaufend. A r e o l e n 1 2 cm voneinander entfernt, fast umgekehrt herzförmig, unten gerundet, im Alter an Größe zunehmend, zuerst 5, dann 8 mm lang, und erst 4, dann 6 mm breit, mit gelblichem, später grauem, reichlichem, polsterförmigem Wollfilz. R a n d s t a c h e l n 7, von denen die beiden obersten die stärksten sind, derb kegelförmig (bis 2 mm im Durchmesser), bis 4 mm lang, dunkel kastanienbraun, jung rubinrot, wenig stechend, aufgerichtet; nach unten hin nehmen die Stacheln an Stärke ab, so daß der unterste nur pfriemlich ist, letztere strahlend. M i t t e l s t a c h e l n 1, etwas kräftiger und länger als die obersten Randstacheln, sonst gleich wie diese. B l ü t e n schlank trichterförmig, 18 cm lang. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) eiförmig, frisch grün, mit dreiseitig lanzettlichen bis oblongen, spitzen, auf vorspringenden Höckern sit zenden, braunen, schwarz gespitzten, 4 10 mm langen Schuppen, deren Achseln reichlich weiße, oben bräunliche Wolle tragen. Fruchtknotenhöhlung fast kugelig, oben gestutzt. R e c e p t a c u l u m (Röhre) mit lineal lanzettlichen Schuppen, deren Achseln Wolle tragen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r 6 8 cm lang, bräunlich grün, die inneren mehr und mehr weiß werdend. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r spatelförmig, bis 9 cm lang, oben 5 cm breit, rein weiß, ausgefranst gezähnelt und fein stachelspitzig. S t a u b b l ä t t e r fast so lang wie die Blütenhülle, nach unten geneigt. S t a u b f ä d e n grünlichweiß. S t a u b b e u t e l hell schwefelgelb. S t e m p e l wenig länger, mit strahligen, gelblich weißen N a r b e n. F r u c h t karmin rot, bis 5 cm lang und 6 cm breit. S a m e n rundlich mützenförmig, seitlich abgeflacht, etwa 2 cm im Durchmesser mit basalem stark vertieftem, rundem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa matt schwarz, ziemlich grobwarzig, um das Hilum feinwarzig punktiert. Heimat Allgemeine Verbreitung: angeblich Argentinien oder Paraguay? Kultur in nahrhafter, gut durchlässiger Erde; liebt im Sommer Wärme und genügend Feuchtigkeit. Anzucht aus Samen; Vermehrung durch Sproßstecklinge. Die Art ist selbststeril. Bemerkungen Diese Art ist bisher nie als Wildpflanze eingeführt worden, weshalb obige Heimatangaben fragwürdig sind. Rebut hat die Pflanze wohl in seinen Katalogen aufgeführt, ihr aber nie eine Beschreibung gegeben, was Schumann l. c. nachholte. Gürke l. c. berichtet, daß Dr. Weber der Ansicht war. E. jusbertii sei eine von Rebut erzeugte Hybride, welcher Ansicht aber W. Weingart, damaliger Cereen Spezialist, nicht zustimmte. Nach Abbée Béguin soll diese Pflanze ein Abbe Beguin corrected von ihm erzogener Bastard zwischen einer Echinopsis und einem Cereus sein, welche Auffas sung in Abbée Béguin ich nicht teilen möchte, da eigene Aussaaten stets typische Nachkommen hervorbrachten. Die Pflanze ist wohl die beste Pfropfunterlage selbst für großwerdende Arten aller Gattungen, sofern Sprossen in der Jugend gepfropft werden. Sie ist selbst für höhere Feuchtig keit bei niedriger Temperatur noch am unempfindlichsten von allen Unterlagen. Die Abbildung zeigt zwei Triebe eines 1,50 m hohen ausgepflanzten Strauches in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich, wo die Pflanze im September/Oktober reich blüht. Photo: H. Krainz. Abb. 1 : 0,6. C II a Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1962
89 Gattung Erythrorhipsalis Berger, 1920 in Monatsschrift f. Kakteenkunde 30, S. 4. Synonym: Rhipsalis Gaertn. pro parte Einzige Art: Erythrorhipsalis pilocarpa (Loefgren) Berger Synonyme: Rhipsalis pilocarpa Loefgren 1903 in Monatsschr. f. Kakteenkunde 13, S. 52 Pfeiffera rhipsaloides Loefgren *) Erythros (griech.) = rot, bezieht sich auf die Farbe der Beere, Rhipsalis, wegen der habituellen Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit Rhipsalis Pilocarpa (lat.) = behaartfrüchtig, bezieht sich auf die Behaarung des Fruchtknotens (richtig des Pericarpells) bzw. der Frucht U. Fam. C. Cereoideae, Tribus II. Hylocereae, Subtrib. c. Rhipsalinae, Linea B. Schlumbergerae **) Erstbeschreibung der Gattung nach Berger l. c. ***) Berger l. c. S. 3: Die Pflanze fällt durch ihre schönen Borsten auf... In der Tracht weicht sie von den überigen Rhipsalis ab. Man ist versucht, sie wegen der borstigen Stämmchen bei den Ophiorhipsalis unterzubringen. Indessen erweisen sich der Habitus, die Borsten und später die Früchte hiebei als ein ganz wesentliches Hindernis. (Als Fußnote:) Ganze Blüte etwa 2 cm im Durchmesser; die äußeren fünf bis sechs Blumenblätter dreieckig mit schwach rosafarbenen Spitzen, die inneren zehn bis elf strahlig abstehend oder etwas zurückgebogen, lanzettlich, zugespitzt, reinweiß, ca. 10 mm lang. Staubfäden zahlreich, am Grunde gerötet. Griffel etwas kürzer als die Blumenblätter mit sieben bis acht Narben. Die Blüten erscheinen im November Dezember, während noch die vorjährigen Früchte auf der Pflanze sitzen.... Bei dieser Pflanze trägt der auch in der Form mehr an Cereus erinnernde Fruchtknoten eine ganze Menge kleiner Höcker mit Schüppchen, in deren Achseln sich noch eine große Anzahl abstehender weißer Borsten befindet. Noch abweichender ist die Frucht, welche Loefgren noch nicht gekannt hatte. Sie fällt schon allein durch ihre Größe auf, etwa mm, und... ist... stark weinrot gefärbt mit zahlreichen borstentragenden, kleinen Areolen versehen, die sich am Nabel der Frucht, bei den abgefallenen Blumenkronresten im Kranze ordnen, ganz wie Cereus und besonders Opuntia, nur sind die Borsten weich und nicht stechend. Im Durchschnitt ist die Frucht gleichfalls rot, hat aber wässerigen Saft und eine große Anzahl von Samen, die in der Mitte der Frucht knäuelartig an die Placenta befestigt sind. Die Samen sind etwa doppelt so groß als bei den Rhipsales. *) Von LÖFGREN l. c. nur als eventueller Name vorgeschlagen, falls die Art zu Pfeiffera gezogen werden müßte. Der Name kam jedoch niemals in Anwendung. **) Einteilung nach BUXBAUM, 1958 in Madroño 14, 177. ***) Eine richtige Gattungsdiagnose hat BERGER nicht gegeben. Vielmehr ist die Beschreibung in dem Aufsatz Einiges über Rhipsalis im sonstigen Text, z. T. als Fußnote, eingestreut. Die beschreibenden Teile des Textes sind hier wörtlich wiedergegeben, nicht zur Beschreibung gehörender Zwischentext.... angedeutet. Krainz, Die Kakteen, 15. VI C II c
90 Beschreibung der Gattung Kleine epiphytische S t r ä u c h e r mit drehrunden gegliederten Sprossen, an denen nach Löfgren am Standort und in Kultur in Brasilien stets eine feine Rippung erkennbar ist, die an Kulturexemplaren nicht festgestellt werden kann. Die einzelnen S p r o ß g l i e d e r haben determiniertes Wachstum, doch sind längere Grund und kürzere Verzweigungssprosse zu unterscheiden. Bis kurz vor Abschluß des Längenwachstums (Abb. 1A) ist der Scheitel der Sproßglieder von langen Borsten überragt und trägt eine dichtgedrängte Gruppe von Areolen (Abb. 1B), die nach Erreichen der endgültigen Länge umwallt und dadurch versenkt werden (Abb. 1C). Die Verlängerung des Sprosses erfolgt nur aus dieser Areolengruppe mit 1 6 neuen Sproßgliedern (Abb. 1D). Auch wenn nur eine Verlängerung durch ein Sproßglied erfolgt, zeigt die exzentrische Stellung desselben den Ursprung aus einer Areole der Scheitelgruppe an (Abb. 1E). Junge Sprosse sind rings mit länglich ovalen Schüppchen besetzt, in deren Achseln Areolen stehen, die außer etwas Wolle auch mehrere lange Haarstacheln tragen (Abb. 1F). B C A D E F Abb. 1. Der Sproß von Erythrorhipsalis pilocarpa. A. Spitze eines vor Abschluß des Längenwachstums stehenden Sproßgliedes. B. Scheitelansicht desselben nach Kürzung der Haardornen. Die scheitelständige Areolengruppe ist noch nicht umwallt. C. Spitze eines Sproßgliedes nach Abschluß des Längenwachstums. Areolengruppe als Sammelareole umwallt. Junge Verzweigungssprosse (Pfeil) im Entstehen. D. Entwicklung der Verzweigungssprosse aus der Sammelareole in spiraliger, nicht echt wirteliger, Entstehungsfolge. E. Exzentrische Lage eines einzelnen (Verlängerungs ) Sproßgliedes. F. Junger Sproß mit noch deutlichen Schuppen. C II a Krainz, Die Kakteen, 15. VI. 1961
91 Gattung Erythrorhipsalis Abb. 2. Blüte von Erythrorhipsalis pilocarpa. A. Knospe, Schüppchen am Pericarpell noch erkennbar. B. Gesamtansicht (Schnittbild: Morphologie Abb. 91) A B Abb. 3. Frucht von Erythrorhipsalis pilocarpa. Abb. 4. Samen von Erythrorhipsalis pilocarpa. A. Hilum, B. freigelegter Embryo. Außenansicht siehe Morphologie Abb. 198 b A B Auch die B l ü t e n entspringen nur der scheitelständigen Areolengruppe, also pseudoterminal. Sie sind regelmäßige, radförmige offene Tagblüher. Das dick kreiselförmige P e r i c a r p e l l läßt nur im Knospenzustand zahlreiche kleine, breit dreieckige, spiralig stehende Schüppchen erkennen (Abb. 2A), die später von der Areolenwolle der in ihren Achseln stehenden Areolen verborgen werden. Außer Wolle tragen auch diese Areolen auch ein Büschel langer Haarstacheln (Abb. 2B). Von außen gesehen scheint ein R e c e p t a c u l u m zu fehlen, doch zeigt der Schnitt (vgl. Morphologie Abb. 91), daß das Pericarpell im oberen Drittel vertieft ist, dieser Teil also das kurze aber deutliche Receptaculum bildet. Der breite Rand des Receptaculum trägt außen die wenigen Reihen durchwegs blumenblattartig gefärbter B l ü t e n h ü l l blätter, die aus einigen noch schuppenartig kleinen Außenblättern schnell zur vollen Größe der lanzett lichen Innenblätter überleiten. Die innere Hälfte des Randes trägt ca. 3 Reihen von, den Blütenhüllblättern etwa gleich langen, S t a u b b l ä t t e r n, die nach innen etwas an Länge zunehmen. Der schräg ansteigende Boden des Receptaculum trägt die N e k t a r d r ü s e n. Der dicke, stabförmige G r i f f e l überragt mit seinen, meist 5, lineal lanzettlichen N a r b e n ästen etwas die Staubblätter. Die Fruchtknotenhöhle ist relativ klein und enthält an kurzen Strängen sitzende Samenanlagen. Die F r u c h t ist eine durchscheinend rote, aus Pericarpell und Receptaculum entstandene Beere, die mit Haarbüschel tragenden Areolen besetzt ist und um den Nabel die vertrockneten Reste der Blütenhülle trägt (Abb. 3); sie enthält zahlreiche Samen an saftigen Samensträngen. Der dunkelbraune S a m e n (Abb. 4 und Morphologie Abb. 198 b) ist langgestreckt, leicht gekrümmt und etwas seitlich zusammengedruckt, mit schmal ovalen basalem H i l u m, das das undeutlich begrenzte Mikropylarloch einbezieht. Die T e s t a ist leicht strukturiert, indem unregelmäßige, langgestreckte Felder (die Außenwände der Zeilen) von seichten Furchen getrennt werden. Ein Perisperm fehlt. Der etwas gekrümmte Embryo zeigt eine konische Radicula und Hypocotyl und ansehnliche Keimblätter, die etwa das obere Viertel des Embryo bilden. Krainz, Die Kakteen, 15. VI C II c
92 Heimat Brasilien im Staate Sao Paulo und Rio de Janeiro. Bemerkungen Erythrorhipsalis ist eine typische Bindeglied Gattung. Schon bei der Beschreibung der Art neigte Löfgren dazu, sie zu Pfeiffera zu stellen und später (in Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 1, 1915, S. 68) stellt er sowohl Pfeiffera ianthothele als auch Erythrorhipsalis pilocarpa als Untergattung Pfeiffera in die Gattung Rhipsalis. Tatsächlich gleicht die Beere sehr stark jener von Pfeiffera ianthothele und auch der Samen gehört dem gleichen (dem Rhipsalis )Typus an, ist aber bei Pfeiffera noch schwarz und etwas dicker. Fortschrittlich ist bei Erythrorhipsalis pilocarpa der Umstand, daß nur mehr Haardornen sowohl am Sproß als an der Blüte gebildet werden, vor allem aber das determinierte Wachstum der Sproßglieder, die mit der Bildung einer endständigen Sammelareole ihr Wachstum einstellen und sich nur von dieser aus verzweigen. Diese von Pfeiffera vollständig abweichende Wuchsform veranlaßte mich, die Gattung, trotz der klaren Verwandtschaft mit Pfeiffera, lieber in die durch determiniertes Wachstum charakterisierte Linea Schlumbergerae zu stellen, mit der sie auch arealgeographisch näher verbunden ist, als mit der west argentinisch bolivianischen Gattung Pfeiffera *) Die Verbindung von Erythrorhipsalis einerseits zu Hatiora, andererseits zu Schlumbergera und Zygocactus ist durch die Bindegliedgattung Rhipsalidopsis gegeben. Diese Erkenntnis hatte bereits A. Berger, der in seinem Stammbaum der Rhipsalideae eine geradlinige Entwicklung Erythrorhipsalis Rhipsalidopsis Schlumbergera Epiphyllanthus Zygocactus darstellt und diesen Ast, von dem an der Ursprungsstelle der Hatiora Ast abzweigt, als Erythrorhipsalideen bezeichnet und die Entwicklung in schönster Reihenfolge Schritt für Schritt von einfacherem zu komplizierterem Bau hervorhebt. (B.) Weitere Literatur Berger, A., Die Entwicklungslinien der Kakteen, Jena Buxbaum, F., Kakteen, Rhipsalidenstudien. Cactaceae Jahrb. D. Kakt. Ges. 1942, Blatt Buxbaum, F., Morphologie of Cacti I. Root and Stem, Pasadena Vaupel, F., Kakteen, Lief. 2. Berlin C II a Krainz, Die Kakteen, 15. VI. 1961
93 Erythrorhipsalis pilocarpa (Loefgren) Berger pilocarpa = mit Borsten am Fruchtknoten Literatur Rhipsalis pilocarpa Loefgren A. in Monatsschr. Kakteenkde. XIII 1903, S u. Abb. S. 55. Schelle E. Kakteen 1926, S. 276, 277 u. Abb. Nr Erythrorhipsalis pilocarpa (Loefgren) Berger A. in Monatsschr. Kakteenkde. XXX 1920, S. 4. Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 209 u. Abb. Taf. XXI Fig. 5. Berger A. Kakteen 1929, S. 97. Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 711, 712 u. Abb. S. 711, 712. Diagnose nach A. Loefgren l. c.: Caulis declinatus vel pendulus, cylindricus, articulatus. Articuli dichotomi vel 3 6 verticillati, 2 12 cm longi et 3 6 mm crassi, 8 10 costati; costae rarissime inconspicuae, opacocinereo virides, longitudinaliter et transversaliter sub lente subtiliter striati; areoli approxi mati; squamae 3 10 setas gerentes, minimae, lana carentes. Flores terminalibus, rotatis pro genere magnis; petala 16 18, oblongo linearia, albo hyalina, apice et basi plus minus roseis, 16 mm longa, exteriora minora, squamiformia et semper rosea; stamina petalis triente minora, filamentis albis hyalinis; antherae albae; stylus staminibus longior; stigma 7 radiatum, radiis reflexis, albis; disco pallide roseo; ovario obconico, 7 mm diametro, rubro squamoso et squamae axillis lanoso et pilis albis longis munito. Colores fructus maturi ignotus. Semina plura. Epiphytica in silvis ad Ytu et Ypanema in Brasiliae civitate Sancti Pauli lecta et in Horto Botanico Paulopolitano culta. Floret mense Februario. Siehe unter Beschreibung der Gattung. Beschreibung Krainz, Die Kakteen, 1. I C II c
94 Heimat Standorte: epiphytisch in den Wäldern von Ytu und Ypanema. Allgemeine Verbreitung: Staat Sao Paulo, Brasilien. Kultur in Orchideenpflanzkörbchen hängend (im Gewächshaus) oder in Töpfen mit gutem Wasserabzug (grobe Lauberde und Sand mit Torfmull, also leichtes, etwas saures Material). Im Sommer im Halbschatten oder Schatten, im Winter bei Grad C. Die Wurzelballen sollen stets leicht feucht gehalten werden. Auch für Wasserkultur geeignet. Bemerkungen Die Aufnahme zeigt eine Pflanze der Städt. Sukkulentensammlung Zürich, wo sie jeweils im Dezember bis Januar blüht. Photo: H. Krainz. Abb. 1 : 0,3. C II a Krainz, Die Kakteen, 1. I. 1962
95 Gattung Escobaria Britton et Rose, 1923, in The Cactaceae Band IV, S. 53, emend. F. Buxbaum, 1951, in Österr. Bot. Zeitschr. 98, S. 78. Synonyme: Mammillaria Haw. pro parte Coryphantha (Engelm.) Lemaire pro parte Synonyma corrected in Synonyme Escobaria benannt nach den hervorragenden mexikanischen Brüdern Rómulo und Numa Escobar U. Fam. Cereoideae, Tribus VIII. Echinocacteae, Subtrib. c. Ferocactinae, Linea Neobesseyae Diagnose nach Britton & Rose l. c.: Globose or cylindric, usually cespitose cacti, never milky; tubercles grooved above; per sisting as knobs at the base of old plants after the spines have fallen; spines both central and radial, never hooked; flowers small, regular, appearing from top of plant at bottom of groove of young tubercles; stamens and style included; fruit red, naked (or with one scale), indehiscent, globular to oblong, crowned by the withering perianth; seeds brown to black; aril basal or subventral, oval. Type species: M a m m i l l a r i a t u b e r c u l o s a Engelmann. emendierte Diagnose nach F. Buxbaum l. c.: Plantae minores vel parvae, globosae vel cylindricae, plerumque basi caespitosae, mammiliosae, non latescentes. Mammillis supra sulcatis usque ad axillam, in parte basali plantae ± persistentibus. Spinis centralibus et radialibus strictis, acicularibus, vel centralibus abortis. Floribus e basi sulci mammillarum orientibus magnis (subgen. Pseudocoryphantha) vel parvis (subgen. Euescobaria), pericarpello nudo vel squamis paucis instructo. Receptaculo campanu lato petaloideo, perianthii foliis externis ± petaloideis, ciliatis, internis apiculatis, staminibus stylo incluso brevioribus. Fructus baccatus viridis (subgen. Pseudocoryphantha) vel ruber (subgen. Euescobaria), receptaculo perianthoque siccato instructus. Semina nigra vel obscure brunnea semiorbicularia vel ovoidea, hilo subbasali, poro micropylario distincto hilo adnato, testa foveolata. Embryone curvato, perispermio magno. Differt a Coryphantha habitu seminum, testa foveolata, poro micropylario distincto hilo adnato, foliis perianthii externis ciliatis. Leitart: Escobaria tuberculosa (Engelmann) Britton & Rose (Mammillaria tuberculosa Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3, 1856, S. 268). Beschreibung Kleine bis sehr kleine, verlängert kugelförmige oder kurz zylindrische, gewöhnlich von der Basis verzweigt rasenförmig wachsende, warzenbildende Kakteen mit wässerigem Saft. W a r z e n oberseits mit einer bis zur Axille reichenden Furche versehen, weichfleischig, später an der Basis der Pflanze verkorkend. Die B l ü t e n (Abb. 1) entspringen aus dem der Axille zuge wendeten Teil der Furche jüngster Warzen im Scheitel. Sie sind in der UG. Pseudocoryphantha ansehnlich, in der UG. Escobaria (syn. Euescobaria) stark reduziert und mammillarien artig. Das P e r i c a r p e l l ist nackt oder trägt nur wenige Schuppen. Das glockenförmige R e c e p t a c u l u m ist blumenblattartig gefärbt, seine Schuppen sind gewimpert und, mindestens die obersten (sogen. äußeren Perianthblätter) gleichfalls blumenblattartig. Die weiteren B l ü t e n b l ä t t e r sind bei UG. Pseudocoryphantha zugespitzt, bei UG. Escobaria verschieden gestaltet. Krainz, Die Kakteen, 15. VII C VIII c
96 Abb. 1 A Abb. 1 B Abb. 1. Blüte von Escobaria (UG. Pseudocoryphantha) vivipara var. aggregata. A. Außenansicht. B. Schnitt. Die S t a u b b l ä t t e r überragen die Blütenhülle nicht: die untersten entspringen oberhalb einer kurzen N e k t a r r i n n e, die weiteren sind bis an den Schlund des Receptaculum gleichmäßig verteilt. Sie können, wie bei Dolichothele, spiralig um den etwas längeren G r i f f e l gewunden sein. Die N a r b e besteht aus wenigen linealen Narbenästen. Die beerenartige, kugelige bis länglich eiförmige F r u c h t ist in der UG. Pseudocoryphantha grün, in der UG. Escobaria rot und trägt den vertrockneten Blütenrest. Die S a m e n (Abb. 2 A C) sind grubig punktiert bzw. infolge des großen Durchmessers der Gruben, netzartig (vgl. Morphologie Abb. 205b und 211a), schwarz bis dunkelbraun, schief halbkugelig, mitunter am Hilum etwas verlängert oder ± eiför mig. Das basale bis subbasale H i l u m ist relativ klein, ihm schließt sich das Mikropylarloch eng an, doch kann es auch, wie bei E. deserti etwas auf die Spitze des eiförmigen Samens verschoben sein. Der Samen enthält ein ansehnliches P e r i s p e r m, der E m b r y o ist gekrümmt. Abb. 2 A Abb. 2 B Abb. 2 C Abb. 2. Samen Von Escobaria (Escobaria) roseana. A. Seitenansicht. B. Hilumansicht (Testastruktur nicht eingezeich net). C. Der innere Bau. M. Mikropylarloch, H. Hilum, P. Perisperm, E. Embryo. Leitart: Escobaria tuberculosa (Engelm.) Britt. & Rose. Gliederung der Gattung Die Gattung Escobaria gliedert sich in die ursprünglichere UG. Pseudocoryphantha F. Buxb., deren Arten früher unter Coryphantha geführt wurden, und die höher abgeleitete, d. h. stär C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. VII. 1960
97 Gattung Escobaria ker reduzierte UG. Escobaria Britt. & Rose, die die ursprünglich von Britton und Rose einbezoge nen sowie später entdeckte Arten umfaßt. UG. Pseudocoryphantha F. Buxbaum, (1951) in Österr. Bot. Zeitschr. 98, S. 78. Diagnose Plantae maiores, ad 25 cm altae, floribus maioribus 3 7,5 cm diametientibus, fructibus viri dibus. Pflanzen für die Gattung groß, bis 25 cm hoch, Blüten sehr ansehnlich (meist aber nur einen Tag andauernd), 3 bis 7,5 cm im Durchmesser. Früchte grün. Samen meist braun. Leitart: Escobaria chlorantha (Engelmann) F. Buxbaum. In diese UG. gehören folgende, früher zu Coryphantha gezählten Arten, wobei die Frage noch zu ermitteln ist, wieweit diese Arten berechtigt und wieweit nur als Varietäten zu bezeichnen sind: E. chlorantha (Engelm.) F. Buxb. E. vivipara (Nuttall) F. Buxb. E. neo mexicana (Engelm.) F. Buxb. E. arizonica (Engelm.) F. Buxb. E. deserti (Engelm.) F. Buxb. E. aggregata (Engelm.) F. Buxb. (wahrscheinlich nur var. zu E. vivipara) E. oclahomensis (Lahm.) F. Buxb. E. hesteri (Wright) F. Buxb. oclahomensis is the original orthography by Buxbaum! UG. Escobaria Britton & Rose (Syn. Euescobaria F. Buxb.) Diagnose nach F. Buxbaum (als UG. Euescobaria in Österr. Bot. Zeitschr. 98, (1951) S. 78: Plantae minores, floribus sub 20 mm diametientibus; fructibus rubris. Kleine Pflanzen mit sehr reduzierten, an Mammillarien Blüten erinnernden, 20 mm im Durchmesser kaum übersteigenden Blüten und roten Früchten. Die Samen sind meist schwarz. L e i t a r t : Die der Gattung, E. tuberculosa (Engelm.) Britt. & Rose. Geographische Verteilung der Gattung In der geographischen Verteilung der Gattung zeigt sich einerseits eine, der morphologischen Höherentwicklung korrespondierende, von Nord nach Süd fortschreitende Entwicklung, die sich dann in der Gattung Leptocladodia fortsetzt, anderseits eine Ausbildung von z. T. sehr eng begrenzten lokalen Arten. Die zweifellos ursprünglichere UG. Pseudocoryphantha hat ein nördlicheres, fast ganz im Bereiche der SW USA liegendes und mit dem Riesenareal von E. vivipara bis in das südliche Kanada reichendes Areal, von dem sich das in kleine lokale Areale aufgesplitterte Gesamtareal von UG. Escobaria in den südlichsten Teilen der USA und im Norden Mexikos anschließt. Systematische Bemerkungen Die Gattung Escobaria nimmt in doppelter Hinsicht eine interessante Bindegliedstellung ein. Die UG. Pseudocoryphantha schließt sich an die kleinen Ferocactus Arten mit gewimperten Schuppen bzw. Blütenhüllblättern an. Durch Reduktion der Vegetativen Phase erreicht sie aber im Zuge der Höherentwicklung aus den Ferocacti die Blühfähigkeit bereits, ohne zur Rippen bildung zu schreiten, d. h. nimmt Mammillarien (bzw. Coryphanthen ) Habitus an. Sie behält jedoch noch das Perisperm wie Ferocactus. Von ihr aus führt ein Entwicklungsast Krainz, Die Kakteen, 15. VII C VIII c
98 zur zentralen Gattung der Neobesseyae, Neobesseya, ein zweiter, Hochgebirgsast, zur Gattung Mamillopsis. Die Beziehungen zu Neobesseya im Samenbau sind so eng, daß Hester die nach seiner Mei nung zwischen Escobaria (im Sinne von Britton & Rose) und Neobesseya stehenden Arten (mit E. dasyacantha (Engelm.) Hest. als Leitart) zur Gattung Escobesseya erhob. Der Vergleich von Originalsamen der E. dasyacantha zeigt aber keinen Unterschied gegenüber den typischen Escobaria bzw. Pseudocoryphantha Samen insbesondere auch nicht gegenüber E. tuberculosa. Die Gattung Escobesseya ist daher als Synonym zu Escobaria zu stellen, die zweite Art, Esco besseya duncanii Hester muß heißen: Escobaria duncanii (Hester) F. Buxbaum und gehört in die UG. Escobaria. Aus der Entwicklungslinie Escobaria UG. Pseudocoryphantha Neobesseya hat sich nach Verlust des Perisperms, aber vor der Ausbildung des für Neobesseya charakteristischen Samenanhanges (Strophiola) die Gattung Mammillaria UG. Chilita abgezweigt, wahrscheinlich in mehreren Auszweigungen. So steht Mammillaria albicans der Escobaria albicolumnaris He ster sehr nahe, Mammillaria wrightii und M. wilcoxii hingegen der E. (Pseudocor.) deserti, während Mammillaria zephyranthoides bereits näher zu Neobesseya steht. Anderseits aber leitet sich aus der UG. Escobaria habituell und geographisch die Gattung Leptocladodia ab, die sich durch die völlig in die Axille gerückte Blüte und daher das Fehlen einer Warzenfurche unterscheidet. Weitere wichtige Literatur Baxter E. M., 1934, California Cacti XI, Coryphantha. Cact. and Succ. Journ. of America V., 1933/34. Benson L., 1940, The Cacti of Arizona. Tucson Britton N. and A. Brown, 1936, An illustrated Flora of the Northern United States, Canada and the British Possessions, Vol. II. New York Buxbaum F., 1951, Die Gattungen der Mammillaria Stufe I. Sukkulentenkunde, Jahrb. Schweiz. Kakt. Ges. IV, Hester J. P., 1941, Escobaria albicolumnaris sp. nov. Desert. Pl. Life Sept ,, 1941, Cacti,... by their seeds you shall know them! Desert Pl. Life Dez ,, 1945, Escobesseya gen. nov., Escobesseya duncanii sp. nov., Echinomastus mariosensis sp. nov. Desert Pl. Life Feb Lahmann M. S., 1949, A new species of Coryphantha. Cact. & Succ. Journ. of America XXI, Wright Y. 1932, Coryphantha hesteri sp. nov. Cact. & Succ. Journ. of America IV B. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. VII. 1960
99 Escobaria bella Britton et Rose (U. G.: Escobaria Britton et Rose). lat. bella = hübsch U. G added according to Korrekturen 1 VII 1966 Literatur Escobaria bella Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 56, 57 u. Abb. Taf. VII Fig. 4 u. 4 a. Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2968, Diagnose nach N. L. Britton & J. N. Rose l. c.: Cespitose, cylindric, 6 to 8 cm long; tubercles nearly terete, 1,5 to 2 cm long, the groove white hairy, with a narrow brownish gland near center; radial spines several, whitish, 1 cm long or less; central spines 3 to 5, brown unequal, the largest 2 cm long or more, ascending; flowers central, small, rotate, nearly 2 cm broad; perianth segments pinkish with pale margins, linear oblong, acute, the outer ones ciliate; filaments reddish; upper part of style and stigmalobes green. Krainz, Die Kakteen, 1. XII C VIII c
100 Beschreibung K ö r p e r mäßig sprossend; Triebe zylindrisch, 6 8 cm lang. W a r z e n fast walzenförmig, 1,5 2 cm lang, mit weißfilziger Furche und einer schmalen, bräunlichen Drüse nahezu in der Furchenmitte. R a n d s t a c h e l n mehrere (bis 15 Kz.), weißlich, bis 1 cm lang. M i t t e l s t a c h e l n 3 5, braun, ungleich, bis 2 cm oder mehr lang, aufsteigend. B l ü t e n klein, radförmig geöffnet, fast 2 cm breit. H ü l l b l ä t t e r rosarötlich, mit blassem Rand, linear oblong, oben spitzlich, die äußeren bewimpert. S t a u b f ä d e n rötlich. G r i f f e l oben grün. 5 N a r b e n grün. F r u c h t (und Samen nach Krainz) beerenartig, oval bis birnförmig, 10 mm lang, etwa 5 mm breit, kahl und glatt, karminrot, mit anhaftendem Blütenrest. S a m e n ± eiförmig, am Hilum etwas verlängert, etwa 1 mm lang mit kleinem subbasalem Hilum und eng angeschlossenem Mikropylarloch; Testa braun, netzartig grubig punktiert. Perisperm vorhanden. Die Art ist selbststeril. Typstandort: auf Hügeln am Devil s River. Allgemeine Verbreitung: Texas, U. S. A. Heimat Kultur wie Escobaria roseana. Verlangt viel Sonne und Wärme. Anzucht au Samen. Bemerkungen Schöne, seltene Art, sproßt im Alter am Grunde. Blüht im April/Mai. Die Pflanze wurde um das Jahr 1913 von J. N. Rose und Wm. R. Fitch erstmals gesammelt und blühte in Kultur des Botanischen Gartens New York erstmals Ende März Die Abbildung zeigt eine Importpflanze, die von Herrn Ing. F. Wild, Zürich, in seiner Sammlung aufgenommen wurde. Abb. etwas vergrößert. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1962
101 Escobaria muehlbaueriana (Boedeker) Knuth (U. G.: Escobaria Britton et Rose) muehlbaueriana, nach dem Kakteenliebhaber Jos. Mühlbauer, München U. G. according to Korrekturen 1 VII 1966 Mamillarien corrected in Mammillarien Literatur Coryphantha muehlbaueriana Boedeker F. in Monatsschr. Kakteenkde. 1930, S u. Abb. S. 19. Neobesseya muehlbaueriana (Boedeker) Boedeker F. Mammillarien Vergl. Schlüssel 1933, S. 15. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Escobaria muehlbaueriana (Boedeker) Knuth in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC. 1935, S Diagnose nach F. Boedeker l. c.: scrobiculata??? strobiculata??? See Boedeker description!!! Ovoidea vel subcylindrica proliferans, vertice vix umbilicata aculeisque superata; mammillae ad 5 et 8 series laxe ordinatae, conoideae vel subovoideae, sulcus ab areola ad mediam partem mammillae pertinens glaber, flocco solitario lanae terminatus; areolae orbiculares mox glabrescentes; aculei radiales 15 20, ± horizontaliter divaricati, tenues aciculares, albidi apice rubiginosi, centrales 6, crassiores, basi incrassati; axillae glaberrimae; flores solitarii ex vertice, infundibiliformes, sepalis fimbriatis, petalis integerrimis flavovirentibus, stylus stigmatibus 6 stamina superans; fructus globosus rubicundus, semina nephroidea, nitida, obscure rubiginosa, rephroidea corrected in scrobiculata. nephroidea Krainz, Die Kakteen, 15. VI C VIII c
102 Beschreibung K ö r p e r eiförmig, ins Zylindrische, am Grunde sprossend; 5 cm hoch, 3 cm breit, glänzend dunkellaubgrün. S c h e i t e l kaum eingesenkt, von aufrechten Stacheln überragt. W a r z e n nach den Spiralzeilen 5 : 8 locker geordnet, kegel bis fast eiförmig, etwa 8 mm lang und am Grunde 6 mm dick, an der Spitze wenig abgestutzt, oberseits mit kahler, in ein Wollflöckchen endigen der Furche, die nur bis gut zur halben Warzenlänge, jedoch nicht bis zur Axille verläuft. A r e o l e n rundlich, nur im Neutrieb weißwollig, bald verkahlend. A x i l l e n kahl. R a n d s t a c h e l n 15 20, die 4 6 oberen dünn haarförmig, rein weiß, etwas zurückstehend und oft etwas verbogen; alle übrigen rund herum horizontal spreizend, dünn, steif nadelförmig, weiß lich, brandbraun gespitzt, glatt, etwa 8 mm lang, die oberen wenig länger. M i t t e l s t a c h e l n meist 6, etwas vor, oder einer auch geradeaus spreizend, derber als die Randstacheln, glatt, steif, am Grunde schwach knotig verdickt; die oberen mm lang, die unteren bis 1/ kürzer und alle grauweiß, von der Mitte bis zur Spitze in dunkelrotbraune Farbe übergehend. B l ü t e n vereinzelt im Scheitel, ausgebreitet trichterig, 15 mm lang, 25 mm breit. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) kugelig, hellgrün. Ä u ß e r s t e H ü l l b l ä t t e r länglich, kurz zu gespitzt, 3 5 mm lang, 1,5 mm breit, am Rande gewimpert, dunkelgrün. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r schmal lanzettlich, schlank zugespitzt, am Rande gewimpert, bis 12 mm lang und 2 mm breit, grünlichgelb, mit breitem, rotbraunem Rückenstrei fen. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r von gleicher Form und Farbe, aber nur an der Spitze mit feinem Mittelstreifen, nicht gewim pert, bis 16 mm lang und 3 mm breit. S t a u b f ä d e n weißlich, oben rosa. Staubbeutel dottergelb. G r i f f e l grünlich. N a r b e n 6, kurz, spreizend, chromgelb, die Staubblätter ziemlich weit überragend. F r u c h t kugelig, bis 5 mm dick, rot, mit anhaftendem Blütenrest. S a m e n kurz nierenförmig, 1 mm groß, mit seitlich sitzendem Hilum und glänzend dunkelrotbrauner, sehr fein grubig punktierter Testa. Heimat Standort: bei Jaumave. Allgemeine Verbreitung: Staat Tamaulipas, Mexiko. Kultur wie Escobaria runyonii. Anzucht aus Samen, Vermehrung durch Sproßpfropfungen. Bemerkungen Die Art wurde 1929 von Herrn Viereck entdeckt und durch Garteninspektor Baum zuerst F. Bödeker, Köln und der Firma F. A. Haage jun. Erfurt zugesandt, von wo aus die Pflanze in den Handel kam. Die Art ist heute nicht mehr häufig anzutreffen. Das Bild zeigt eine von Herrn G. Ross (Bad Krozingen) der Städt. Sukkulentensammlung Zürich geschenkte Pflanze, die hier Ende März blühte. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 1 : 1. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. VI. 1961
103 Escobaria nelliae (Croizat) Backeberg nelliae, benannt nach der Gattin des Sammlers der Art, Mrs. Nellie Davis Literatur Coryphantha nelliae Croizat L. in Torreya XXXIV 1934, S. 15, 16 U. Abb. Escobaria nelliae (Croizat) Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2967, 2968 u..abb bis Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S Diagnose nach L. Croizat l. c.: Planta pusilla simplex, raro caespitosa, cylindrica, ad 4,5 cm longa, parte hypogaea 2 3 cm. Costis 8 14, tuberculis rima percursis, 2 mm longis; areolis vix lanosis; spina centrali nulla; spinis radialibus ex patentibus tenuiter adpressis, rectis, raro ad latus incurvis, basi luteis caeterumque albis, interdum roseatis; 2 4 spinis caeteris robustioribus ad 4 4,5 mm longis, breviter acuminatis; 4 6 spinis setarum adspectum fingentibus, tenuiter aciculatis, acuminiatis corrected circa 2 mm longis; flore (cum hypanthio) 1 1,5 cm longo, persistenti; perianthio ad 1 cm in acuminatis longo; sepalis e lanceolatis cuneatis, acutis vel acuminatis, viridescentibus; petalis purpureis vel purpurascentibus ex oblanceolatis spathulatis, obtusis; ovario cylindrico, nudo, fructum seminaque non vidi. Beschreibung K ö r p e r klein, einfach oder seltener (einmal in sechs Fällen) sparrig verzweigt; Triebe bis 4,5 cm lang, der unterirdische Teil des Körpers 2 3 cm lang. R i p p e n W a r z e n gefurcht, 2 mm lang. A r e o l e n mit spärlicher Wolle. R a n d s t a c h e l n 13 18, spreizend bis leicht anliegend, gerade, selten seitlich gekrümmt, am Grunde gelblich, sonst weiß, gelegentlich rosarötlich; 2, 3 oder 4 der Stacheln stärker als die übrigen und bis zu 4 4,5 mm lang, Krainz, Die Kakteen, 1. VII C VIII c
104 kurz zugespitzt; 4, 5 oder 6 der Stacheln schlanker, nadelförmig oder borstenähnlich, ca. 2 mm lang. M i t t e l s t a c h e l fehlend. B l ü t e einschließlich des Pericarpells 1 1,5 cm lang, bleibend. Blütenhülle ca. 1 cm lang. P e r i c a r p e l l zylindrisch, nackt. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich bis keilförmig, zugespitzt bis scharf zugespitzt, grünlich. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r purpurrötlich oder purpurn, umgekehrt lanzettlich bis spatelförmig, stumpf. F r u c h t (und Samen nach Krainz) eine kugelige, grüne Beere, wenn ausgereift 3 mm im Durchmesser, mit nur vereinzelten, sehr win zigen Schüppchen, die in lange, haarförmig gekrümmte Spitzchen auslaufen; mit langem Blüten hüllrest. S a m e n etwa 1 mm im Durchmesser, länglich mützenförmig, gegen das Hilum zu vor gezogen; Hilum basal, klein, gelb, mit am Rande eingesenktem Mikropylarloch; Testa glän zend schwarz, gleichmäßig grubig punktiert. Heimat Typstandort: ca. 4 Meilen südlich von Marathon, auf Kalkboden in einer Höhe von 1200 m. Allgemeine Verbreitung: Brewster County, Texas, U.S.A. Kultur am besten auf Erioc. jusbertii gepfropft. Wurzelechte Pflanzen verlangen etwas schweren, aber durchlässigen Boden von neutraler Reaktion mit Gipszusatz. Blüht nur in sonniger, warmer Lage. Bemerkungen Kleine, durch ihre dichte, gelbe oder weißgelbe Bestachelung auffällige Pflanze, deren Früchte und Samen bisher nicht beschrieben waren. Das Farbbild zeigt eine Pflanze aus der Sammlung R. Leemann (Uetikon) in etwa nat. Größe. Das zweite Bild zeigt ein sehr hell bestacheltes Exemplar. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 1. VII. 1968
105 Escobaria roseana (Boedeker) Schmoll ex F. Buxbaum (U. G.: Escobaria Britton et Rose) roseana, nach dem amerikanischen Kakteenforscher Dr. J. N. Rose, Washington U. G. according to Korrekturen 1 VII 1966 Literatur Echinocactus roseanus Boedeker F. in Sukkulentenkunde DKG. 1927/28, S. 363, 364 u. Abb. S Thelocactus (Echinocactus) roseanus (Boed.) Berger A. Kakteen 1929, S Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 479, 480. Neolloydia roseana (Boed.) Knuth in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, S Escobaria roseana (Boed.) Schmoll ex Buxbaum F. in Österr. Bot. Zeitschr. 98, H. 1/2, 1951, S. 79. Backeberg C. Nachtrag mit Korrekturen zu Some Results of Twenty Years of Cactus Research in Cact. & Succ. Journ. Amer. XXIII/5, 1951, S Diagnose nach F. Bödeker l. c.: Simplex, dein proliferans, subovoideus, vertice sublanatus aculeisque flavidulis clausus, costae in tubercula ad series 8 et 13 ordinata disjunctae, areolae flavido lanuginosae, mox glabrescentes; aculei radiales ca. 15, laeves, aciculariformes, divaricati vel paullo appressi, sulfurei vel interdum basi fusci, aculei centrales 4 6, vix distincti, verticem versus vergentes, superioribus paullo longioribus, semina brunnea, punctata, semilunata. Beschreibung K ö r p e r erst einfach, später vom Grunde sprossend, polsterbildend. Einzelköpfe eiförmig, 4 cm hoch, 3 cm dick, lebhaft mattgelblich laubgrün. S c h e i t e l kaum eingesenkt, durch Krainz, Die Kakteen, 15. VII C VIII c
106 die jüngsten Areolen etwas wollig, von hellgelben, aufrechten Stacheln verhältnismäßig hoch, je doch nicht dicht schopfförmig überragt. R i p p e n völlig in kurzkegelförmige Warzen aufgelöst, diese am Grunde etwa 3 mm breit, ebenso hoch, mit abgestutzter Spitze, nach den Spiralzeilen 8:13 angeordnet. A r e o l e n im Scheitel heller, später dunkler gelbwollig, über die Stachel bündel sehr kurz und wollig verlängert, bald verkahlend, erst 2, dann 1 mm im Durchmesser. R a n d s t a c h e l n ca. 15, glatt, dünn, nadelförmig, schwach vorspreizend und etwas dem Körper zu gebogen, die untersten etwa 10, die oberen bis 15 mm lang, auf den kahlen Areolen am Grunde eben bräunlich, sonst im allgemeinen im Scheitel heller, die älteren rein schwefel gelb, den Körper lose umstrickend. M i t t e l s t a c h e l n von den Randstacheln kaum unter scheidbar in Stärke, Form und Farbe, 4 6, stärker vorspreizend, die oberen etwas länger und alle sich schwach dem Scheitel zubiegend. B l ü t e n im Kranze in der Nähe des Scheitels aus den oberhalb des Stachelbündels verlängerten, noch wolligen Areolen, 20 mm lang, 15 mm im Durchmesser. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) 4 mm lang, 3 mm im Durchmesser, grün, eiförmig, kahl (oben nur eine Schuppe!). Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r 13 mm lang, 2 mm breit, lanzettlich, blaßkarmin, cremerosa geran det. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r cremerosa, mit breitem karminrosa Mittelstreifen, durchschei nend seidenglänzend. S t a u b b l ä t t e r sehr zahlreich, blaßgelb, gegen den Griffel zu gebo gen, die obersten die Narben eben noch erreichend. G r i f f e l blaßrosa, 11 mm lang. N a r b e n 6 7, blaßgelb, 2 mm lang. F r u c h t ca. 10 ( 15) mm lang, 3 mm breit, verkehrt eiförmig, glatt, kahl, resedagrün, mit anhaftendem Blütenrest und durchscheinenden Samen. S a m e n 1 mm groß, kugelig halbmondförmig, an der geraden Seite zusammengedrückt und hier unten mit einem kleinen, weißlichen Nabel; Testa dunkelbraun, sehr feingrubig punktiert. Heimat Typstandort: bei Saltillo, sehr selten und spärlich an Berggraten von Sandsteinen wachsend (Bödeker l. c.). Allgemeine Verbreitung: Staat Coahuila, Mexiko. Kultur in sandiger Rasenerde, im Hochsommer genügend Feuchtigkeit, im Winter dagegen fast trocken bei 6 10 Grad C. Pfropfen ist nicht erforderlich. Bemerkungen Die Art wurde 1929 von Friedrich Ritter in Saltillo gefunden und erstmals nach Europa geschickt. Obwohl sich Backeberg l. c. als Kombinationsautor aufführt, mußte ich hier korrekterweise die wirklichen Autoren für die Kombination einsetzen, da Schmoll die Art schon in seinem Katalog zu Escobaria stellte und Buxbaum l. c. erstmals die Zugehörigkeit der Art zu dieser Gattung einwandfrei nachgewiesen und kombiniert hat. Buxbaum s Arbeit erschien vor derjenigen Backeberg s. (Basionymangaben sind erst ab 1953 vorgeschrieben.) Das älteste, 17köpfige Importexemplar der Städt. Sukkulentensammlung Zürich blüht alljährlich Ende Mai. Die abgebildete Pflanze wurde von Herrn W. Andreae in seiner Sammlung aufgenommen. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. VII. 1960
107 Escobaria runyonui Britton et Rose (U. G. Escobaria Britton et Rose) runyonii, nach dem Entdecker und Sammler der Art, Robert Runyon Literatur Escobaria runyonii Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 55, 56 u. Abb. S. 56 u. Taf. VI. Berger A. Kakteen 1929, S Bödeker F. Mammillarien Vergl. Schlüssel 1933, S. 16. Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S Diagnose nach Britton et Rose l. c.: Cespitose, with numerous (sometimes 100) globose to short oblong heads, grayish green, 3 to gayish corrected in grayish. 5 cm long with fibrous roots; tubercles 5 mm long, terete in section with very narrow groove above; groove at first white woolly, not glandular; radial spines numerous, acicular, white, 4 to 5 mm long; central spines stouter than radials, 5 to 7, slightly spreading with brown or black tips, 6 to 8 mm long; flowers 1,5 cm long, pale purple; segments with a dark purple stripe down the middle and pale margins; outer perianth segments narrow oblong, with thin ciliate margins; inner perianth segments narrower than the outer, with margins entire, acute; filaments purplish; style very pale; stigma lobes 6, green; fruit scarlet, globose to short oblong, 6 to 9 mm long, juicy. Beschreibung K ö r p e r sprossend, mit zahlreichen (bisweilen bis zu 100), kugeligen bis kurz zylindrischen Köpfen; Sprosse 3 5 cm lang, gräulichgrün. W u r z e l faserig. W a r z e n 5 mm lang, durch schnitten kegelförmig, oben mit einer sehr schmalen Furche, diese zuerst weißwollig, nicht drüsig. R a n d s t a c h e l n zahlreich, nadelförmig, weiß, 4 5 mm lang. M i t t e l s t a c h e l n stärker als die Randstacheln, 5 7, leicht spreizend, mit braunen oder schwarzen Spitzen, 6 bis 8 mm lang. Krainz, Die Kakteen, 15. VI C VIII c
108 B l ü t e n 1,5 cm lang, blaßpurpurn. H ü l l b l ä t t e r mit einem dunkel purpurnen Mittelstreifen und blassem Rande; äußere länglich schmal, mit dünn gewimpertem Rande; innere schmaler als die äußeren, ganzrandig, zugespitzt. S t a u b f ä d e n purpurn. G r i f f e l sehr blaß. N a r b e n 6, grün. F r u c h t (und Samen nach Krainz) eine länglich kugelige Beere, kar minrot, mm lang, 7 mm im Durchmesser, mit anhaftendem Blütenrest. S a m e n rundlich bis länglich, kaum 1 mm im Durchmesser, mit rundem, kleinem Hilum und seitlicher, schmaler Raphe; Testa braun, glänzend oder matt, grubig punktiert. Heimat Standorte: bei Reynosa (Mexiko); ca. 75 Meilen flußaufwärts von Brownsville, am Rio Grande; im Rio Grande, Starr County, Texas. Allgemeine Verbreitung: Mexiko und Texas. Kultur wie Escobaria roseana. Verlangt viel Sonne und Wärme. Gedeiht wurzelecht gut. Anzucht aus Samen. Bemerkungen Die Pflanze wurde von dem Amerikaner R. Runyon im Jahre 1921 entdeckt. Sie bildet im Alter zierliche, dichte Rasen und blüht in Zürich Anfang April. Die Abbildung zeigt eine seit mehreren Jahren in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich kultivierte Importpflanze. Photo: H. Krainz Abb. 1 : 1. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. VI. 1961
109 Escobaria vivipara (Nuttall) var. neo mexicana (Engelmann) F. Buxbaum (U. G.: Pseudocoryphantha F. Buxbaum) neo mexicana, nach dem Bundesstaat Neu Mexiko in USA. Literatur Mammillaria vivipara ssp. radiosa var. neo mexicana Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3, 1856, S. 269; Cact. Mex. Bound. 64, Cactus radiosus neo mexicanus Coulter, Contr. U. S. Nat. Herb. 3, 1894, S Cactus neo mexicanus Small, Fl. southeast U. S. 1903, S Mammillaria radiosa var. neo mexicana (Engelm.) Förster Handb. Kakteenk. 1886, S Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898, S Mammillaria neo mexicana (Engelm.) Nelson A. in Coulter and Nelson, Man. Bot. Rocky Mount. 1909, S Coryphantha radiosa var. neo mexicana (Engelm.) Schelle E. Kakteen 1926, S Coryphantha neo mexicana (Engelm.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 43. Berger A. Kakteen 1929, S Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, S Helia Bravo H. Cactaceas Mex. 1937, S Borg J. Cacti 1951, S Coryphantha vivipara (Nutt.) var. neo mexicana (Engelm.) Backeberg C. Cactaceae V 1961, S u. Abb. Nr. 2816, 2818; Kakt. Lex. 1966, S Czorny R. in Kakt. u. a. Sukk. 5, 1970, S. 81 u. Abb. added before Schumann Krainz, Die Kakteen, 15. X C VIII c
110 Mamillaria corrected ti mammillaria Mammillaria radiosa var. neo mexicana C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. X. 1972
111 Escobaria vivipara var. neo mexicana Escobaria neo mexicana (Engelm.) Buxb. F. (comb. nud.) Österr. Bot. Zeitschr. 98, 1/2, 1951, S. 78; Kakteen Pflege 1962, S Diagnose nach G. Engelmann l. c. ovata seu ovato cylindrica, saepe e basi ramosa; aculeis radialibus albidis sub 30 (20 40), centralibus 6 9 (3 12) infra albidis sursum purpurascentibus apice atratis; floribus maioribus; seminibus maioribus ventre subconcavis. Beschreibung K ö r p e r meist einfach oder wenig sprossend, kugelig bis kurz eiförmig, 8 12 cm lang. W a r z e n in den Spiralzeilen 8 : 13, locker gestellt, zylindrisch, an der Spitze gerundet, mit schmaler, bis über die Mitte reichender Furche. A r e o l e n rund, 4 5 mm, in der Jugend weißwollig. S t a c h e l n den ganzen Körper verhüllend. R a n d s t a c h e l n oder mehr, strahlend, nadelförmig, von den Mittelstacheln kaum zu trennen, weiß. M i t t e l s t a c h e l n bis 6, kräftiger, abstehend, am Grunde blaß, braun, schwarz oder rot gespitzt. B l ü t e n trichterförmig, vereinzelt, aus Scheitelnähe, geöffnet 4 5 cm breit, von Mai bis Juni. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r lanzettlich, grünlich oder etwas purpurn, gewimpert; i n n e r e H ü l l b l ä t t e r breit lineal, lang zugespitzt und stachelspitzig, oben mehr oder weniger ge zähnelt, rosa bis dunkelkarmin. P e r i c a r p e l l kurz zylindrisch oder eiförmig, oben mit einigen grünen, gefransten, kurz dreiseitigen Schüppchen. S t a u b f ä d e n kaum die halbe Blütenhülle erreichend, um den Griffel gewunden, karminrosa, S t a u b b e u t e l chromgelb. G r i f f e l bis 11/2 cm lang, weiß, mit 7 9 weißen gespreizten, stumpfen Narben, welche die Staubbeutel überragen. F r u c h t eine 2,5 cm lange Beere, grün, saftig, fast nackt, bis auf einige wenige Schüppchen mit Haaren um den Scheitel, dieser eingesenkt, mit vertrocknetem Perianth. S a m e n länglich bis halbrundlich, 1,75 bis 2,25 mm lang, mit halbseitlichem Hilum und anschließender Micropyle; Testa bräunlich, netzig grubig punktiert. Perisperm vorhanden. Heimat Verbreitung am oberen Pecos River und im südlichen Neu Mexiko, in der Sonora und im westlichen Teil von Texas. In Neu Mexiko zwischen m ü. M. Kultur Czorni -> Czorny Verlangt viel Licht und Sonnenwärme, mineralreiche Erde mit Torfbeigabe; (nach R. Czorny) mäßige Feuchtigkeit während der Wachstumszeit mit einer hochsommerlichen Gieß pause. Im Winter, wenn ausgepflanzt, absolut trocken, um + 80 C. Bei Kultur ohne Glas ist Pfropfen angezeigt. Krainz, Die Kakteen, 15. X C VIII c
112 Bemerkungen Das von R. Czorny in seiner Sammlung aufgenommene Farbbild zeigt einen 3jährigen Sämling von 4 cm Höhe und einem von 3 cm. Die Zeichnung ist Engelmanns Darstellung von Mammillaria radiosa var. neo mexicana in United States & Mex. Boundary, Pl. 1. C VIII c Krainz, Die Kakteen, 15. X. 1972
113 Gattung Escontria Rose in Contr. U. S. Nat. Herb. 10, 1906, S emend. F. Buxbaum in Buxbaum F. Die Entwicklungslinien d. Trib. Pachycereae in Botanische Studien Heft 12, Jena Synonyme: Cereus Miller p. p. Pachycereus (Berger) Britton et Rose in Contr. U. S. Nat. Herb. 12, 1909, S. 420, p. p. (Pachycereus lepidanthus [Eichlam] Br. et. R.) Anisocereus Backeberg in Blätt. f. Kakteenf p. p. Escontria benannt zum Gedenken des 1906 verstorbenen vornehmen Mexikaners Don Blas Escontria, einem eifrigen Förderer der Wissenschaft. U. Fam. C. Cactoideae (Cereoideae) Trib. III. Pachycereae Subtrib. a. Pterocereinae. Diagnosen 1. nach Rose l. c. Flowers small, tubular, ovary globular, covered with imbricating chartaceous, translucent, persistent scales, without spines or hairs; tube of flower narrow, also bearing scales like those of the ovary; petals erect, narrow, yellow; stamens and style included; fruit globular, scaly purple, fleshy, edible; seeds black. Tree, very much branched; ribs of stems few. Leitart: Escontria chiotilla (Weber) Rose (Cereus chiotilla Weber in SCHUMANN, Gesamtbeschreibung der Kakteen, 1897, S. 83). erect. corrected in erect,, styl in style : to be checked in original! 2. Emendierung der Diagnose nach F. Buxbaum l. c. Da die Rose sche Diagnose auf die damals monotypische Gattung bezogen war, mußte nach der Erkenntnis, daß auch Cereus lepidanthus Eichlam in die Gattung Escontria gehört, die Diagnose entsprechend erweitert werden. Arbores supra truncum brevem ramosissimae vel columnae simplices vel paulum ramosae, ramis cereoideis haud crassissimis, costis paucis, areolis nonnumquam elongatis. Flores prope apicem ramorum orientes, tubulato campanulati pericarpello et receptaculo crassissimis, densissime imbricato squamosis; squamis pericarpelli receptaculoque ex basi minuta carnosa pergamensis, latis, axillis in anthesi nudis vel in pericarpello setas nonnullas gerentibus; cavo ovarii cameram nectariferam versus carpellorum tela tantummodo separatum; camera nectarifera magna, super staminarum infimarum filamentis incrassatis, pistillum versus curvatis terminata; staminibus ceteris permultis receptaculo usque ad faucem insertis; stigmate in com pluribus partibus linearibus diviso. Fructus carnosus vel ± siccus squamis pergamenis per sistentibus instructus, axillis squamarum nudis vel areolas lanatas, setosas gerentibus. Semina magna nigra vel brunescenti nigra, verrucoso rugosa vel nitida, curvata, hili parte elongata hilo testae margine angustissimo circumdato, non depresso; embryone apud cotyledones magnas curvato. Starting quote added: correspond to end quote below and to the citation! Beschreibung Reich verzweigte B ä u m e mit kurzem S t a m m und schlanken cereoiden Ästen oder ein fache bis wenig verzweigte S ä u l e n f o r m e n, mit wenigen R i p p e n und oft verlängerten Areolen. B l ü t e n nahe den Zweigenden, röhrig glockig. P e r i c a r p e l l und Krainz, Die Kakteen, 1. X C III a
114 Abb. 1. Blütentragende Areole von Escontria chiotilla. Abb. 2. Escontria chiotilla, Blüte. Material l. n. Mixtecas, Oaxaca. leg. H. Bravo Hollis. A = Außenansicht, B = Längsschnitt cz = cauline Zone. Ooxaca correctedd in Oaxaca Abb. 3. Samen von Escontria chiotilla. A = Außenansicht, B = Hilum mit Mikropylarloch, C = ohne harte Außentesta, D = Embryo. Hylum correctedd in Hilum Receptaculum dicht mit breiten pergamentartigen Schuppen dachziegelartig bedeckt, deren Achseln zur Blütezeit noch kahl sind oder einige Borsten tragen. F r u c h t k n o t e n h ö h l e oben nur mit Carpellgewebe abgeschlossen. N e k t a r k a m m e r ansehnlich, zum halboffenen Typus gehörig, durch die verdickten, gegen den Griffel gewendeten Staubfäden der unter sten S t a u b b l a t t r e i h e n abgeschlossen. Weitere Staubblätter in dichten Reihen zahlreich bis an den Schlund. N a r b e aus mehreren linealen Narbenstrahlen gebildet. F r u c h t fleischig oder mehr oder weniger trocken, mit den verbleibenden pergamentartigen Schuppen besetzt, deren Achseln kahl sind oder eine wollige und borstige Areole tragen. S a m e n groß, schwarz bis braunschwarz, rauhwarzig oder glänzend, gekrümmt mit vorgestrecktem Hilumansatz. Hilum mit sehr schmalem Saum, nicht versenkt. Perisperm fehlt. E m b r y o in der Region der Keim blätter gekrümmt. Heimat Süd Mexico (Esc. chiotilla) bzw. Guatemala (Esc. lepidantha). C VIII a Krainz, Die Kakteen, 1. X. 1970
115 Gattung Escontria Bemerkungen Cacaceae -> Cactaceae Backeberg hat für Cereus lepidanthus Eichlam (Escontria lepidantha (Eichl.) F. Buxb.) seine Gattung Anisocereus aufgestellt, ohne die Blüte zu kennen! Nach Eichlams Beschreibung hat er (Die Cactaceae II, S. 2227, Abb. S. 2125) eine Darstellung der Blüte von Anisocereus lepid anthus (Eich.) Backeb. konstruiert, die aber mit Eichlams sehr genauer Beschreibung wenig übereinstimmt. Hingegen hat er offenkundig die Zeichnung der Blüte von Pterocereus foetidus von Mac Dougal und Miranda, die er ebenda S. 2221, Abb wiedergibt, zum Vorbild genommen, da die den Angaben Eichlams geradezu widersprechende Ausführung der Receptaculum und Pericarpell Schuppen genau jenen dieser Zeichnung gleichen. Vielleicht, weil er auch den Pachycereus (?) gaumeri Britton et Rose zu Anisocereus stellte, dessen Zugehörig keit zu Pterocereus schon von Mac Dougal und Miranda erkannt worden war. Die ganze Konstruktion war aber ebenso überflüssig wie die Gattung Anisocereus, da Britton und Rose bereits 1923 (!) in The Cactaceae IV. S. 272, Abb. 245, im Nachtrag zu Pachycereus die Photographie einer Blüte von Cereus lepidanthus, die sie von Weingart erhalten hatten, in Außenansicht und Schnitt veröffentlicht hatten, was Backeberg gar nicht gewußt hat! Dabei stellten Britton und Rose auch die große Ähnlichkeit mit Escontria chiotilla fest. Nur der Umstand, daß die Frucht des Lepidanthus im Gegensatz zur eßbaren Frucht der Escontria chiotilla als trocken beschrieben wurde ein Umstand der heute nicht mehr als gattungstrennend anerkannt werden kann, hat sie veranlaßt, die Art bei Pachycereus zu belassen. Mit diesen Photographien einer Originalblute der Escontria lepidantha hat Backeberg s Kon struktion nicht die entfernteste Ähnlichkeit. Daher ist die Gattung Anisocereus Backeberg in die Synonymik zu Escontria zu verweisen. Anisocereus gaumeri Backeberg s allerdings gehört, wie erwähnt, zu Pterocereus. 2. Die gleichmäßig sehr dichte laubige Beschuppung von Pericarpell und Receptaculum sowie der noch sehr einfache innere Bau der Blüte und die Samenform zeigen, daß die Gattung Escontria zu den urtümlichsten Vertretern der Pachycereae gehört und folglich in das Primitiv-Subtribus Pterocereinae zu stellen ist. Innerhalb dieser bildet sie allerdings in der ganz ungewöhn lichen strohigen Ausbildung der Schuppenblätter eine eigene Seitenlinie, die nirgends eine Fort setzung fand. 3. Besondere Beachtung verdient bei Escontria chiotilla die eigenartige, v o m S t a c h e l b ü s c h e l abwärts gerichtete Verlängerung der Areole in einer wolligen Furche, die später auch die von Rose erwähnte eigenartig pectinate Stellung der Stacheln erklärt. Ihre Bedeutung liegt darin, daß sie ein Vorläufer der durchlaufend die Rippenkante durchziehenden Filzrinne bei Stenocereus marginatus und St. dumortieri sowie bei Pachycereus pringlei ist, womit die entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhänge besonders deutlich hervortreten. Beachtet man hierzu noch, daß die guatematelkische Art, Esc. lepidantha noch wie Pterocereus wenig oder unverzweigt ist, Esc. chiotilla in Südmexico aber die reich verzweigte Krone, der baumförmigen Pachycereengattungen, wie Heliabravoa, u. a. ausbildet, so tritt eine Ent wicklungsreihe von Süd nach Nord deutlich hervor. Krainz, Die Kakteen, 1. X C III a
116 Literatur Buxbaum F. Die Entwicklungslinien der Tribus Pachycereae F. Buxb. (Cactaceae, Cereoideae). Botanische Studien Nr. 12. Jena Buxbaum F. Die Tribus Pachycereae und ihre Entwicklungswege. Kakt. u. a. Sukk. 15, 1964, S , , , , , , und 16, 1965, S , 82 85, Eichlam F. Cereus lepidanthus Eichl. nov. spec. Monatsschr. f. Kakteenk. 19, 1909, S C VIII a Krainz, Die Kakteen, 1. X. 1970
117 Gattung Espostoa Britton et Rose emend. F. Buxbaum in Österr. Bot. Zeitschr. 106, S. 154, 1959 Espostoa Britton et Rose in Britton N. L. and Rose J. N., The Cactaceae Band II. S. 60, Facheiroa Britton et Rose, l. c. S Pseudoespostoa Backeberg in Backeberg, C., Blätter für Kakteenforschung 1934 (10) S. 1. Thrixanthocereus Backeberg in Backeberg, C., Blätter für Kakteenforschung 1937 (7) Nachtrag 15, S. 2. Vatricania Backeberg in Cact. and Succ., Journ. Am. 22, S. 154, Espostoa benannt nach dem Botaniker an der Escuela Nacional de Agricultura in Lima, Peru, Nicolas E. Esposito. U. Fam. C. Cereoideae, Tribus V. Trichocereae, Subtrib. a. Trichocereinae. Diagnosen 1. von Britton und Rose l. c. 1920: Columnar plants with numerous low ribs and when flowering developing a pseudocephalium similar to that of some species of cephalocereus; areoles strongly armed with spines, and bea ring long white hairs; flowers small, short campanulate, nearly hidden by the surrounding wool, probably opening at night; tube short; outer perianth segments pinkish, the inner ones pro bably white; stamens and style short, included; scales on ovary and flower tube small, acute, with long silky caducous hairs; fruit subglobose to broadly obovoid, smooth, its flesh pure white, slightly acid, very juicy, edible; seeds very small, black, shining. 2. Berichtigte Diagnose F. Buxbaum l. c. 1959: Cactaceae columnares basi vel supra ± ramosae usque ramosissimae, ramis erectis vel ascendentibus; areolis approximatis aculeatis interdum et setosis vel pilosis. Floribus ex cephalio vero laterali, interdum denique latissimo et apicem ± involventi orientibus; cephalio dense piloso lanato et setoso interdum et spinas aciculares gerenti. Floribus tubulato campanulatis extus squamis permultis ± lanceolatis, interdum setoso apiculatis, instructis, ex squamarum axillis longe pilosis, perianthio brevi; staminibus prémariis basi connatis cameram nectariferam occludentibus, rarissime separatis, in specie adhuc unico interdum in staminodia piliformia transformatis; secundariis tubo receptaculi variabili modo insertis, ultimis, coronam in fauce formantibus. Pistillo antheras paulum superanto, saepe ex gemma floris superante, stigmatibus lineariis ca. 10 vel plus. Fructibus squamosis umquam pilis caducis pilosis, funiculis succosis pulpam formantibus. Seminibus curvato ovatis, basi obtusis, nigris verrucoso punctatis, interdum verruculis confluentibus sublaevibus; hilo basali magno, concavo, porum micropylarium permagnum includenti. in specie unica (E. blossfeldiorum) semina brunea hilo permaximo oblongo, caeteram partem seminis superante. Perispermio absenti; embryone crasso curvato (in E. blossfeldiorum recto), cotyledonibus parvis. Leitart: Espostoa lanata (HBK) Britt. et Rose (Cactus lanatus Humboldt, Bonpland et Kunth). 3. Diagnose von Facheiroa nach Britton und Rose l. c.*): Trunk short, with numerous slender, erect or ascending branches; ribs numerous, spiny; flowers borne in a pseudocephalium, this densely brown or red felted; flowers small, the ovary and *) Infolge eines Druckfehlers lautet der Gattungsname bei BRITTON und ROSE 33. Facheiro gen. nov., beim Artnamen ist aber dann wieder Facheiroa geschrieben wie im Schlüssel der Gattungen der Cereoideae und im Inhaltsverzeichnis. Krainz, Die Kakteen, 1. XII C V a
118 flower tube covered with long silky brown or red hairs; tube proper short, smooth within; throat short, not hairy at base, bearing numerous short, included, stamens; inner perianth seg ments short, white; fruit small, globular, greenish, and gelatinous within; seeds black, tuber culate, with a large basal hilum. Leitart: Facheiroa ulei (Gürke) Werderm. (Syn. Facheiroa pubiflora Britton et Rose) Cephalocereus ulei Gürke. 4. Diagnose Pseudoespostoa Backeberg l. c. 1934: Plantae cylindricae, basi ramosae; ramis ad 2 m longis lana primo alba postea nigrescente dense lanuginosis. Aculei longi, flavi, postea nigrescentes. Cephalium ex areolis, ad 30 cm longum. Flos albus, diurnus. Fructus albus, seminibus nitidis. Leitart: Pseudoespostoa melanostele (Vaupel) Backeberg (Cereus melanostele Vaupel). 5. Diagnose Thrixanthocereus Backeberg l. c. 1937: Plantae erectae, ramis solitariis; cephalium setis albo cinereis; floribus infundibuliformibus; tubo lanato, squamis apice setosis. Leitart: Thrixanthocereus blossfeldiorum (Werderm.) Backeb. (Cephalocereus (?) blossfeldiorum Werdermann). 6. Diagnose Vatricania Backeberg in Cact. & Succ. Journ. Am. 1950: Cephalio exteriore; floribus tubuloso campanulatis, paulum apertis; tubo squamoso, dense lanato; stylo exserto. Leitart: Vatricania güntheri (Kupp.) Backeb. (Cephalocereus güntheri Kupper). Beschreibung der Gattung Säulenförmige, an der Basis oder höher oben mehr oder weniger verzweigte bis vielästige Kakteen mit aufrechten oder aufsteigenden Ästen. A r e o l e n genähert, verschieden bestachelt, mitunter auch mit Borsten und langen Haaren besetzt. Die B l ü t e n entspringen einem echten seitlichen C e p h a l i u m (Abb. 1 3), das aber mitunter auch schließlich so verbreitert wird, daß es das ganze Säulenende einhüllt. Das C e p h a l i u m ist dicht wollhaarig und mit Borsten durchsetzt und enthält mitunter auch dünne nadelförmige Stacheln. Die B l ü t e n (Abb. 4, 5) sind röhrig engglockig, außen mit sehr zahlreichen, mehr oder weniger lanzettlichen, mitunter zum Teil in eine Granne auslaufenden Schuppen bedeckt, die in den Achseln lange Haare tra gen. Die Blütenhüllblätter sind kurz. Die Primärstaubblätter (unterste Staubblätter) sind gewöhnlich an der Basis zu einem Diaphragma vereint (Abb. 6), das die Nektar kammer abschließt, selten sind sie frei und in bisher nur einer Art sind sie in haarförmige Staminodien umgewandelt. Die S e k u n d ä r s t a u b b l ä t t e r entspringen in verschiedener Anordnung der Innenwand des Receptaculum, die obersten bilden einen Schlundkranz. Der G r i f f e l, der oft schon aus der Knospe herausragt, überragt an der offenen Blüte etwas die Höhe der Staubbeutel und trägt 10 oder mehr lineare N a r b e n äste (Abb. 7). Die F r ü c h t e sind mehr oder weniger schuppig und tragen hinfällige Haare. Meist bilden die saftigen Samenstränge eine Pulpa. Nur bei E. blossfeldiorum sind die Samenstränge nur kurz, aber doch anfangs saftig; bei dieser Art platzt die Frucht mit Längsrissen auf. (Vergl. Morphologie Abb. 176). Die S a m e n (Abb. 10) sind bei den meisten Arten gekrümmt eiförmig, an der Basis abgestutzt, schwarz, warzig punktiert, mitunter durch Zusammenfließen der Warzen fast glatt; C V a Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1959
119 Gattung Espostoa Abb. 1 Längsschnitt durch ein (links) ein Cephalium tragendes Sproßende von Espostoa sericata. Die Areolen des Cephaliums tragen neben langen Haaren auch borstige Stacheln. Ober jeder Areole liegt ein (Blüten ) Vegetationskegel der aus der bereits ausgebildeten Stielzone reichlich lange Haare entwickelt. Abb. 2 Schnitt durch den Sproßscheitel in stärkerer Vergrößerung. Die vegetativen (V) und reproduktiven, d. h. Cepbalien Areolen (R) sind bereits im Scheitel deutlich verschieden. D. h. es ist ein echtes Cephalium. Abb. 3 Querschnitt durch einen ein Cephalium tragenden Sproß von Espostoa sericata. Die reproduktiven, d. h. das Cephalium bildenden Rippen bleiben niedrig. Abb. 4 Blüte von Espostoa güntheri Abb. 5 Schnitt durch die Blüte von Espostoa güntheri Abb. 6 Nektarkammer und Primärstaubblätter von Espostoa blossfeldiorum Krainz, Die Kakteen, 1. XII C V a
120 Abb. 7 Narbe von Espostoa blossfeldiorum Abb. 8 Samen von Espostoa güntheri. A. seitliche Außenansicht, B. Hilumansicht C. Embryo Abb. 9 Samen von Espostoa blossfeldiorum. A. Außenansicht halbseitlich, B. Hilumansicht, C. Embryo das basale Hilum ist groß, vertieft und schließt ein sehr großes Mikropylarloch ein. Bei einer Art, E. blossfeldiorum, sind infolge Entwicklungshemmung die Samen braun und mit einem übergroßem, an den Astrophytum Samen erinnernden Hilum versehen, das den eigentlichen Samen weit an Größe über trifft (Abb. 9). Ein Perisperm ist nicht vorhanden. Der E m b r y o ist dick, meist gekrümmt (bei E. blossfeldiorum gerade) und hat nur kleine Keimblätter. Die S ä m l i n g e bilden soweit bisher bekannt einen sehr charakteristischen Borstenkranz aus. *) Vorkommen Die noch relativ primitive Esp. (subgen. Facheiroa) ulei kommt im Chique Chique Distrikt von Bahia (Brasilien) auf felsigen Hängen der Catinga vor, Esp. (Facheiroa) güntheri im Tal des Rio Grande und Rio Oro in der Bolivianischen Provinz Chuquisaca in m Seehöhe in Catinga ähnlicher Formation, nicht weit nördlich vom südamerikanischen Hitzepol in einem Gebiet mit Höchsttemperaturen von 46 C. Esp. (Facheiroa) blossfeldiorum ist lokal begrenzt auf das Gebiet von Huancabamba in Peru, während die Arten der UG. Espostoa vom Huancabamba Distrikt aus besonders längs der Küstenkordillere (Cordillera occidental) bis Südperu reichen. Bemerkungen 1. Die Unhaltbarkeit der Gattung Pseudoespostoa habe ich bereits anläßlich meiner Untersuchungen über das Cephalium festgestellt. Auch Friedr. Ritter stellte am Standort fest, daß kein Unterschied zwischen Espostoa und Pseudoespostoa besteht. 2. Die Blüte von Esp. güntheri, für den Backeberg die Gattung Vatricania aufstellte, erwies sich entgegen Backebergs Erklärung, daß sie differs from all other South American Cephalocerei als vollkommen gleich jener von Espostoa subgen. Espostoa. ; C corrected in C *) Nach einer schriftlichen Mitteilung von P. C. HUTCHISON haben auch die im Botanischen Garten der University of California in Berkeley gezogenen Sämlinge von Espostoa ulei den Borstenkranz. RAUH s Angabe beruht also auf einer falschen Information. C V a Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1959
121 Gattung Espostoa 3. Dasselbe gilt von Esp. (subgen. Facheiroa) blossfeldiorum, für die Backeberg die Gattung Thrixanthocereus aufstellte. Die Unterschiede im Samen wie auch die hohle Frucht mit den nur kurzen Samensträngen erwies sich als die Folge einer Wachstumshemmung der Samenstränge (Abb. 10, 11), einer Erscheinung, die durch eine einzige Mutation ausgelöst worden sein könnte. Daher ist, wie schon W. T. Marshall feststellte, auch die Gattung Thrixanthocereus einzu ziehen *) Abb. 10 Einzelne Samenanlage Espostoa güntheri (A) und Espostoa blossfeldiorum (B). Die gehemmte Krümmung der Samenanlage verhindert bei E. blossfeldiorum den Zusammenschluß der Ränder des äußeren Integuments. Abb. 11 Büschel von Samenanlagen von Espostoa blossfeldiorum. Die Wachstumshemmung der Samenstränge ist die Ursache aller Abweichungen vom normalen Bau der Espostoa Samen und Früchte. 4. Es erwies sich nun auch, daß auch Facheiroa ulei im Blütenbau diesem Verwandtschaftskreis angehört, der durch Esp. güntheri und einige noch nicht gültig publizierte Neufunde Friedrich Ritters mit Espostoa subgen. Espostoa verbunden ist. 5. In Kakteen u. a. Sukkulenten 10, 1959, Nr. 11, S. 165 schreibt Backeberg, meine Abbildungen in Österr. Bot. Zeitschr. 106 seien ungenau in der Darstellung, nicht im vollen Hochstand und daher nur scheinbar einander ähnelnd. Dazu sei gesagt: 1. Meine sorgfältigen Untersuchungen und Zeichnungen sind weltbekannt. 2. Der B a u einer Blüte ändert sich nicht im Hochstand. 3. Wenn Backeberg dabei auf Rauh s Beiträge (1958) hinweist, verschleiert er die Tatsache, daß gerade Rauh s Längsschnitt Photos wichtige Ergänzungen zu meinen Schlußfolgerungen gaben und seine Textangaben von mir sorgfältig widerlegt worden sind. 4. P. C. Hutchison bestätigte (brieflich) auf Grund seiner Untersuchungen auf der Peru Expedition der University of California meine Folgerungen. 6. Daraus ergibt sich eine Unterteilung der Gattung Espostoa Britt. et Rose emend. F. Buxbaum in folgende, nur durch vegetative, aber doch recht augenfällige Merkmale unterscheidbare Untergattungen: I. Subgenus Espostoa Diagnose aus Buxbaum, l. c. S. 155: Areolis spinosis et longissime pilosis, cephalio praecipue molle lanato parce setoso. Beschreibung Areolen bestachelt und sehr langhaarig, Cephalium v o r z u g s w e i s e w e i c h w o l l i g nur mit spärlichen Grannenstacheln. Leitart: Espostoa lanata (HBK) Britton et Rose. *) Da erst die neuesten Erkenntnisse (1959) ergaben, daß auch die Gattung Facheiroa BR. et R. mit Espostoa zu vereinigen ist, ist das Blatt Facheiroa blossfeldiorum (WERDERMANN) MARSHALL aus C VI? nach C Va zu überstellen und der Kopf folgendermaßen abzuändern: Espostoa (subgen. Facheiroa) blossfeldiorum (WERDERMANN) F. BUXBAUM. Espostoa set to italics Krainz, Die Kakteen, 1. XII C V a
122 II. Subgenus Facheiroa (Britton et Rose) F. BUXBAUM Diagnose aus Buxbaum l. c. S. 155: Areolis spinosis non pilosis, cephalio lanato vel setoso vel crispato setoso, interdum et spinoso. Beschreibung A r e o l e n nur bestachelt, nicht langhaarig, Cephalium wollig oder borstig oder mit krausen Borstenstacheln, mitunter auch mit nadelförmigen Stacheln. Leitart: Espostoa ulei (Gürke) F. Buxbaum (Cephalocereus ulei Gürke). Bemerkungen Espostoa ulei ist nicht in Kultur; die Arten der UG. Espostoa gehören aber zum Schönsten, was man an Säulenkakteen halten kann, wenn sie auch erst in alten Stücken zur Blüte kommen. Von der UG. Facheiroa ist besonders Esp. blossfeldiorum auch durch die Bestachelung sehr kulturwürdig, während Esp. güntheri mit dem leuchtend fuchsroten Cephalium erst an etwa meterhohen Exemplaren, dann aber besonders schön wird. (B.) onatschr -> Monatsschr axo nimische -> taxoomische Weitere Literatur Akers, J. F. A Cactus Collector goes to Peru. Cact. & Succ. Journ. Am. XIX, 1947, S Backeberg, C. Cereus lanatus und seine Verwandtschaft in Peru. Monatsschr. Deutsch. Kakt. Ges. 111, 1931, S , Genre 45a. Thrixanthocereus Backeb. in Famille des Cactées, Cactus Rev. Assoc. Franç. des Amat. d. Cact. VIII. 1953, Nr. 38, S. 257, 258., Genre 13a, Vatricania Backeberg in Famille des Cactées, Cactus Rev. Assoc. Franç. des Amat. d. Cact. XII. 1957, Nr. 54, S Buxbaum, F. Die behaartblütigen Cephalienträger Südamerikas. Österr. Bot. Zeitschr. 106, 1959, S , Morphologie des Spaltcephaliums von Espostoa sericata. Österr. Bot. Zeitschr. 99, 1952, S. 89, 99., Morphologie du Cephalium lateral chez Espostoa sericata. Cactus Rev. Assoc. Franç. des Amat. d. Cact. 1951, Nr. 31, S Cullmann, W. Die Blüte von Thrixanthocereus blossfeldiorum. Kakt. u. a. Sukk. IV. 1955, S. 103, 104., Die Entwicklung des Cephaliums bei Thrixanthocereus blossfeldiorum. Kakt. u. a. Sukk. IV. 1953, S Gürke, M. Neue Kakteen Arten aus Brasilien. Cephalocereus ulei Gürke n. sp. Monatsschr. Kakteenkunde XVIII 1908, S. 85. Johnson, H. A Cactus Collector in the Andes. Cact. & Succ. Journ. Am. XXIV, 1952, S. 52 bis 54, 91, 92, , Kupper, W. Cephalocereus güntheri n. sp. Monatsschr. Deutsch. Kakt. Ges. III., 1931, S. 159 bis 162, Bild S Rauh, W. Beitrag zur Kenntnis der peruanischen Kakteenvegetation. Sitzber. Heidelberger Akad. Wiss. Math. Naturw. Kl. Jahrg. 1958, 1. Abh. Heidelberg Ritter, F. Die von Curt Backeberg in Descriptiones Cactacearum Novarum veröffentlichten Diagnosen neuer peruanischer Kakteen nebst grundsätzlichen Erörterungen über taxonomische und nomenklatorische Fragen. Selbstverlag Hamburg Werdermann, E. Brasilien und seine Säulenkakteen. Neudamm d Cact corrected in d. Cact, Franc in Franç twice! Franc corrected in Franç C V a Krainz, Die Kakteen, 1. XII. 1959
123 Espostoa guentheri (Kupper) F. Buxbaum (U. G. II: Facheiroa Britton et Rose) guentheri, nach Ernesto Günther, Valparaiso, einem Liebhaber der Botanik Einheimischer Name: Keweillu antoichupa Literatur Cephalocereus guentheri Kupper W. in Monatsschr. DKG. III 1931, S u. Abb. S. 160 u Marshall in Marshall W. T. & Bock T. M. Cactaceae 1941, S. 72. Vatricania guentheri (Kupper) Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. Amer. XXII/5 1950, S Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S. 2492, 2493 u. Abb. S Espostoa guentheri (Kupper) Buxbaum F. in Österr. Bot. Zeitschr. 106, H. 1/2, 1959, S Diagnose nach W. Kupper l. c.: A basi ramosus ramis erectis columnaribus, costis usque ad 27 et ultra, humilibus rotundatis leviter crenatis; areolis approximatis tomentosis, aculeis et ultra acicularibus vel seti formis, cephalio laterali denso setoso; flore campanulato infundibuliformi extus squamoso et dense lanuginoso. Krainz, Die Kakteen, 1. X C V a
124 Beschreibung K ö r p e r vom Grunde an verzweigt, säulenförmig; die einzelnen Stämme bis 2 m hoch und 10 cm dick. R i p p e n ca. 27, etwa 1 cm breit und 5 7 mm hoch, oben gerundet, schwach gehöckert, mit einer schwachen, oft undeutlichen Furche über den Areolen. A r e o l e n klein, rund bis etwas länglich, ca. 5 mm lang, mit kurzem, gelblichweißem Filz, bis 1 cm vonein ander entfernt. S t a c h e l n nicht in Rand und Mittelstacheln geschieden, wenn auch oft ein mittlerer Stachel durch seine Länge (bis 22 mm), Stärke und durch seine dunkelbraune Färbung auffällt; etwa 15, in der Nähe des Cephaliums ca. 25, 0,5 1,5 cm lang, dunkel honiggelb; die nach oben gerichteten kürzer, kräftiger, nadelförmig, die nach unten gerich teten zahlreicher, länger, dünner, bis borstenförmig. C e p h a l i u m am Sproßende einseitig entwickelt, bis 50 cm lang, meist aber kürzer, rötlichbraun bis weißlich, seidig glänzend, mit dicken Polstern gelblichweißer Wolle von 3 4 mm Länge und mit sehr zahlreichen, 4 6 cm langen, zu Borsten umgewandelten Stacheln (oft bis zu 100 pro Areole). B l ü t e n nur wenig aus dem Cephalium herausragend, 8 cm lang, 2,5 3 cm breit, röhrigglockig. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) und R e c e p t a c u l u m (Röhre) vom Grunde an mit hellgrünen, schmal dreieckigen, braun gespitzten Schuppen dicht bedeckt, deren Achseln leicht rosafarbene, schopfige Wollbüschel von 15 mm Länge tragen. Schuppen am Grunde der Blüte 5 6 mm lang, sehr schmal und spitz, nach oben hin 10 mm lang und 3 mm breit werdend und in die ca. 13 mm langen, 5 6 mm breiten, zungenförmigen H ü l l b l ä t t e r übergehend; diese innen gelblichweiß, außen rosa angelaufen. Fruchtknotenhöhle breiter als hoch, erfüllt mit Samenanlagen auf bäumchenartig verzweigten Trägern. S t a u b b l ä t t e r an der Innenwand der Blütenröhre entspringend, die obersten am Grunde der Hüllblätter sitzend und nur noch etwa 5 mm lang. S t a u b b e u t e l blaßrosa. G r i f f e l weiß, die Blütenröhre um 1,5 cm überragend, 1,5 mm dick. N a r b e n 18, gelblich, 4 5 mm lang. Blüte nur eine Nacht sich öffnend. Frucht mehr oder weniger beschuppt, mit hinfälligen Haaren und einer aus den saftigen Samensträngen gebildeten Pulpa. S a m e n etwa 1,2 mm lang und 1 mm breit, mützen oder eiförmig, in der Gestalt an einen Topfhelm erinnernd, mit großem kraterartig vertieftem, basalem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa schwarz, am Rande feinwarzig, sonst grob und flachwarzig. Kein Perisperm. Heimat Typstandort: Tal des Rio Grande, bei m ü. M., im Gebirgsland von Chuquisaca (C. Troll); ein weiterer Standort bei El Oro (Cardenas). Allgemeine Verbreitung: Bolivien. Kultur im sonnigen Gewächshaus, ausgepflanzt in gut durchlässiger, nahrhafter Erde. Im Winter bei 8 16 C; im Sommer ohne jede Schattierung. Die Pflanze stellt auch wurzelecht keine besonderen Ansprüche an die Erde. Bemerkungen Diese Pflanze wurde Ende 1927 von Prof. Dr. C. Troll entdeckt. An jungen Pflanzen sind die Stacheln meist lang und borstenförmig. Die Cephalien sind im Charakter verschieden. Die größten und schönsten blühfähigen Exemplare finden sich bei der Firma H. Stern in San Remo, von wo auch das abgebildete Exemplar stammt und das seit zwei Jahren in der Städt. Sukkulentensammlung regelmäßig im Juli blüht. Die Art ist selbststeril. Es gibt hell gelb bis rötlichbraun behaarte Cephalien. Photo: H. Krainz. Abb. stark verkleinert. C V a Krainz, Die Kakteen, 1. X. 1961
125 Espostoa melanostele (Vaupel) Borg U. G. I: Espostoa F. Buxb. gr. melanostele = schwarzsäulig Literatur Cephalocereus melanostele Vaupel F. in Engl. Bot. Jahrb. 50, Beibl. 111 H 2/3 1913, S. 12, 13. Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIV 1914, S. 154, 155. Binghamia melanostele (Vaupel) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 167, 168 u. Cactaceae repeated Abb. twice: one deleted Cereus melanostele (Vaupel) Berger A, Kakteen 1929, S Pseudoespostoa melanostele (Vaupel) Backeberg C. Blatt. f. Kakteenforschg u. Abb. Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. Amer. XXIII/5 1951, S Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S u. Abb. S , Espostoa melanostele Borg, J. Cacti 1937 u. 1951, S Marshall W. T. & Bock T. M. Cactaceae 1941, S Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math nat. Kl. I 1958, S u. Abb. S. 518, 519; S u. Abb. S. 59; S u. Abb. S. 82. Krainz, Die Kakteen, 1. III C V a
126 Diagnose nach F. Vaupel l. c.: Caulis erectus, validus, lana supertextus, apice rotundatus. Costae circiter 25 humiles, sectione transversa aequilaterali triangulares, inter areolas leviter incisae. Sinus acuti. Areolae valde approximatae, orbiculares vel subellipticae, convexae, lana multa bruneola obtectae. Aculei numerosissimi, nigri; unus validissimus erectus vel plus minus horizontaliter patens, ceteri multo minores subsetiformes, ex tota areola oriundi. Cephalium laterale, crassissimum, lineari oblongum, bruneum, aculeis egens, costas 8 obtegens. Flores pauci e cephalio erumpentes; ovarium breviter subcylindricum atque tubus cylindraceo infundibuliformis squamis parvis decurrentibus obsita; lana ex axillis squamarum ovarii et inferioris tubi oriunda spar sissima, parts corrected in oculo vix cognoscenda, sursum multo major, tubum plus minus obtegens; perigonii phylla exteriora lanceolata, interiora potius oblongo elliptica, tubo fere triplo breviora; sta mina nume partis rosa inclusa; filamenta filiformia, parieti tubi plus minus affixa; antherae parvae, dimidium superius tubi explentes; stylus antheras vix superans. Beschreibung K ö r p e r 1 2 m hoch, strauchig, vom Grunde an mehr oder weniger verzweigt, im Alter ohne hervortretenden Primärsproß. Triebe 5 25, aufrecht oder aufsteigend, 10 ( 15) cm dick, säulenförmig, graugrün, im Scheitel gerundet, hier mit reinweißem Haarfilz, der später dunkelbraun und schließlich am Grunde tiefschwarz wird, dicht umsponnen. R i p p e n (ca. 25), 1 cm hoch, flach im Querschnitt gleichseitig dreieckig, durch Einschnitte über den Areolen in seichte Höcker zerlegt, ca. 1 cm voneinander entfernt und durch scharfe Furchen getrennt. A r e o l e n sehr dicht stehend, rund bis breit elliptisch, fast 1 cm im Durchmesser, etwas gewölbt und mit dichter, flockiger, weißer oder bräunlicher, bis 1 cm langer Wolle bekleidet, die den Stamm in dünner Lage umhüllt; Sprosse im Alter vorwiegend am Grunde verkahlend. R a n d s t a c h e l n sehr zahlreich (40 50), 5 10 mm lang, der ganzen Oberfläche der Areole ent springend, regellos gestellt, bedeutend dünner als die Mittelstacheln, fast borstenförmig, erst bernsteingelb, später schwärzlich. M i t t e l s t a c h e l n 1 3, lang, durch besondere Größe und Stärke ausgezeichnet, meist schräg nach oben gerichtet, 4 10 cm lang, im Neutrieb bernsteingelb, im Alter purpurschwarzrötlich. An Trieben von ca. 1 m Höhe erfolgt die Cephalienbildung; meist ein Cephalium pro Sproß, selten Doppelcephalien aus zwei sich gegenüberstehenden Cephalien; diese an derselben Pflanze alle auf die gleiche Seite, nämlich nach der der längsten Lichteinwirkung (meist SW oder W bis WSW) gerichtet. Zu Beginn der Cephalienbildung sind die Wollbüschel der Blühareolen noch deutlich gegeneinander abgegrenzt. Letztere mit dichten Büscheln intensiv gelbbraunen, braunen bis dunkelbraunen Wollhaaren versehen, ohne Stacheln, sich vom Scheitel aus cm herabziehend und 8 Rippen breit. B l ü t e n mehrere oft gleichzeitig und unregelmäßig verteilt aus dem Cephalium erscheinend; mehr oder weniger reichlich blühend; 5 6 cm lang, 5 cm breit, mit flach ausgebreiteten Hüllblättern, weiß; öffnen sich mit einbrechender Dunkelheit (18 Uhr) und schließen sich kurz vor Sonnenaufgang (6 Uhr); von zahlreichen, kleinen Ameisen besucht, die wohl auch die Be stäubung vollziehen. P e r i c a r p e l l kurzzylindrisch, 8 mm breit, mit winzigen, kleinen Schüppchen, deren Achseln nur wenige, mit der Lupe kaum erkennbare Wollhärchen tragen; Fruchtknotenhöhle 3 mm im Durchmesser; Planzentarstränge dünn, vorwiegend am Grunde ver zweigt, behaart. R e c e p t a c u l u m mm breit, zylindrisch bis trichterförmig, erwei tert sich spitzenwärts nur wenig, flach gerieft, im unteren Teile fast kahl, weiter oben von bräunlicher Wolle durchsichtig umhüllt; mit herablaufenden, nach oben etwas größer werden den, 2 3 mm langen, scharf zugespitzten, bräunlichroten, freien Schuppen dicht bedeckt; Schup penachseln mit Wollhaaren. Nektarkammer 1,2 cm lang, sehr weit (6 10 mm im Durchmesser), nur unvollständig durch die kürzeren, inneren, meist in Doppelreihe angeordneten und am Grunde miteinander vereinigten Staubblätter verschlossen. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r unter seits grünlich, mit schwach rötlichem Mittelsreifen und rötlicher Spitze, oberseits reinweiß, etwas kürzer und schmaler als die inneren, sonst wie diese lanzettlich bis länglich elliptisch. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r bis 15 mm lang und 4 7 mm breit, reinweiß, C V a Krainz, Die Kakteen, 1. III. 1964
127 Espostoa melanostele an der Spitze ausgefranst bis gezähnt. Staubblätter sehr zahlreich, von der Blütenhülle eingeschlossen, an der oberen Hälfte der Röhre entspringend; häufig fällt einer der beiden inneren Staubblattkreise aus, in diesem Falle treten dann am Grunde der Staubfäden haarartige, verzweigte Auswüchse auf, die wohl als Staminodialhaare zu deuten sind. S t a u b f ä d e n weiß. S t a u b b e u t e l klein, gelb. G r i f f e l kräftig, 3,5 cm lang. N a r b e n mehrere, 0,5 mm lang, die Staubblätter überragend. F r u c h t rundlich bis birnförmig, bis 5 cm lang, sich aus der Cephalienwolle herausschiebend, anfangs vom abgetrockneten Blütenrest gekrönt, erst grasgrün, reif weißlich lichgelb bis rötlich, mit sehr dünner, glänzender Fruchtschale und weißem Fruchtfleisch; angeb lich eßbar; mit winzigen, zerstreut stehenden Areolen, kleinen Schuppenblättern und kleinen Wollflöckchen. Trotz oft reichlicher Blütenbildung, setzen die Pflanzen nur relativ wenig Früchte an. S a m e n klein, zahlreich, mit schwarzer, glänzender Testa. Heimat Standorte: bei Chosica, an der Lima Oroya Bahn, auf sehr dürftig bewachsenem steinigem Boden, bei 800 m; Rimac Tal bei Lima, 1100 m; in den niederschlagsarmen Kakteenfelswüsten der Westanden, steigt bis m, ihre Grenze fällt mit derjenigen der Sommerregenzone gegen die Trockengebiete zusammen; Tal des Rio Chillon (Canta Tal), bildet hier in der Neoraimondia Ges. die obere Espostoa melanostele reiche Fazies ( m); größte Verbreitungsdichte bei m, vereinzelt bis m herab und m hinauf steigend; in der Espostoa melanostele Haageocereus acranthus Ges. ( m); im Tal des Rio Huaura (Churin Tal) in dichten Beständen ( m), auf schmalen Flußterrassen und am Fuße der von Schuttblöcken übersäten Steilhänge; bildet hier die Espostoa melanostde Ges., zusammen mit Haageocereus crassiareolatus (inkl. var. smaragdisepalus), H. achae tus, H. albisaetacea -> albisaetascens oder albisetacea dichromus (inkl. var. pallidior), H. acranthus, Opuntia tunicata, Mila albisaetacea, Neo binghamia climaxantha (inkl. var. armata), N. villigera und Schinus molle; die Espostoa Ges. steigt bis m an; lockert sich jedoch gegen ihre obere Grenze zu auf; ab m mit Deu terocohnia longipetala, einer erdbewohnenden Bromelie. Allgemeine Verbreitung: in nahezu allen Andenquertälern vom Cañete Tal im Süden bis zum Saña Tal im Norden; vertikale Ausdehnung von 800 m bis an die untere Grenze der regengrünen Zone ( m). Peru. forma inermis (Backeberg) Krainz comb. nov. lat. inermis = unbewehrt forma set back to regular Literatur Pseudoespostoa melanostele (Vaupel) Backeberg var. inermis Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. Amer. XXIII/5 1951, S Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S u. Abb. S Espostoa melanostele (Vaupel) Borg var. inermis (Backeberg) Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math nat. Kl. I 1958, S. 520; S. 59 u. Abb. S. 60. Diagnose nach C. Backeberg l. c.: Differt ab typo areolibus aculeis longioribus deficientibus. Beschreibung Mit längeren und dichteren Wollhaaren, die sich so stark miteinander verweben, daß weder die Areolen noch der Körper sichtbar sind. M i t t e l s t a c h e l n fehlend oder nur kurz. Krainz, Die Kakteen, 1. III C V a
128 Espostoa melanostele fa. inermis am natürlichen Standort. Heimat Standorte: Matucana, bei m; Rimac Tal bei Lima, bei m in der Kakteenformation. Allgemeine Verbreitung: Mittelperu. Kultur wie Espostoa lanata in lockerem, nahrhaftem Boden von leicht saurer Reaktion. Im Sommer sonnig und warm bei ausreichender Bewässerung. Im Winter bei Grad C. Pfropfen ist hier zweckmäßig. Geeignet sind Trichocer. spachianus wie auch T. macrogonus als Dauerunterlagen. Sämlingspfropfen ist angebracht. Anzucht aus Samen leicht. Die schönsten Pflanzen werden erreicht, wenn sie in einem Gewächshausbeet ausgepflanzt werden. Bemerkungen Betreffend der Zugehörigkeit der Art zur Gattung Espostoa hat Buxbaum (s. Literaturzitierung bei der Gattung) nachgewiesen, daß die für unsere Art durch Backeberg aufgestellte mo notypische Gattung Pseudoespostoa unberechtigt ist, weshalb sie sowohl von Rauh l. c. wie auch hier zur Synonymik gestellt wurde. Die farbige Abbildung zeigt einen blühenden Sproß (nach Einbruch der Dunkelheit photographiert) mit zahlreichen Ameisen als Bestäuber. RAUH bemerkt hierzu, daß trotz der Reichblütigkeit der Pflanzen relativ nur wenige Blüten Früchte ansetzen. Photos: W. Rauh. C V a Krainz, Die Kakteen, 1. III. 1964
129 Gattung Espostoopsis F. Buxbaum genus novum *) Esposto opsis (lat.) = wie eine Espostoa aussehend. U. Fam. C. Cactoideae, Tribus V. Trichocereae, Subtr. a. Trichocereinae **) Diagnose Cactaceae columnares, a basi ramosae, supra singulae, erectae, usque ad 5 m altae; costis multis humilibus lana obtextis, areolis dense positis lanuginosissimis; aculeis multis aciculari bus setaceis intertextis. Floribus ex cephalio vero (sensu Werdermann) sed interdum interrupto orientibus, tubuloso campanulatis nudis atque glabris, prope faucem solum squamis ovatis acuminatis in perianthium transeuntis instructis, interdum in parte undo squamulas nonnullas reductissimas gerentibus; perianthio brevi radiato; pericarpello minimo, in receptaculum trans eunte; receptaculi parte infima cameram nectariferam formante, quae diaphragma transversali vel subconici, filamenta crassa staminum primarium gerenti clausa est. Filamentis staminum primarium basi confertis itaque tubum formantibus parte superiore distortis; staminibus secun dariis parte superiore receptaculi usque ad faucem insertis, filamentis tenuissiinis, brevissimis prope faucem minutissimis. Pistillo tenui, stigmatis radiis linearibus. Funiculis ovulum ramosis. Fructu ovato, succoso floris residuum gerente, pericarpio carnoso, pulpa albida, hyalina, succosa. Seminibus nigris, parvis, obliquis, testa verrucosa, hilo sublaterali ovato, porum micropylarium includenti; perispermio absenti, embryone redunco, cotyledonibus conspicuis. *) Manuskript eingegangen am **) Einzureihen hinter Espostoa. Krainz, Die Kakteen, 1. VII C V a
130 Species typica, hucusque unica: Espostoopsis dybowskii (Goss.) F. Buxbaum: Cereus dybowskii Gosselin in Bull. Soc. Bot. France 55, S , (Syn.: Cephalocereus dybowskii (Goss.) Britton et Rose; Austrocephalocereus dybowskii (Goss.) Backeberg). Heimat: Bahia, Brasilien. 1908) corrected in 1908 Beschreibung Normale, nur vom Grunde verzweigte, aufrechte, mehrere Meter hohe S ä u l e n mit zahlreichen, niedrigen R i p p e n. A r e o l e n dicht gestellt, mit zahlreichen nadelförmigen S t a c h e l n und langen H a a r e n, die den Körper ganz verhüllen. B l ü t e n nächtlich geöffnet, röhrig glockig, mit kurzem, radiären P e r i a n t h, einem einseitigen, e c h t e n C e p h a l i u m im Sinne Werdermann s entspringend, das jedoch unterbrochen sein kann. *) Abb. 1. Espostoopsis dybowskii, Außenansicht der Blüte Abb. 2. Espostoopsis dybowskii Blütenlängsschnitt Abb. 3. Einzelast am Grunde zusammenhängenden Büschels der Samenanlagen von Espostoopsis dybowskii. Abb. 4. Samenanlagen, durchscheinend Abb. 5. Frucht von Espostoopsis dybowskii, nach einem Farbdia von A. F. H. BUINING. A. Außenansicht, B. Schnitt. Beachtenswert sind die Haare an der Basis des Blütenrestes und die rudimentierten kleinen Haarbüschelchen auf der oberen Kuppe der Frucht *) Eingehende Untersuchungen zeigen, daß über einem bestehenden Cephalium mehrere vegetative Podarien entwickelt werden können, über denen dann im Scheitel ein neuer Cephaliumteil angelegt wird. C V a Krainz, Die Kakteen, 1. VII. 1968
131 Gattung Espostoopsis Abb. 6. Samen von Espostoopsis dybowskii A. Außenansicht, häufigste Umrißform des Samens, B. Hilumansicht, Mi = Mikropylarloch, C. Die Lage des noch von der inneren Testa eingehüllten Embryos im Samen (seltenere Umrißform des Samens), D. Embryo. P e r i c a r p e l l kurz, nackt, unmittelbar in das R e c e p t a c u l u m übergehend. Dieses ist größtenteils nackt oder nur mit sehr reduzierten, erst nahe dem Schlund in mehreren Reihen stehenden, ovalen, bespitzten und in den Achseln kahlen Schuppen, die in die H ü l l b l ä t t e r überleiten. Im untersten Drittel des dickwandigen Receptaculums liegt eine große N e k t a r k a m m e r, deren Abschluß durch einen A c h s e n v o r s p r u n g und die an seinem Rande entspringenden Filamente der Primärstaubblätter in Form eines transversalen bis konisch aufstrebenden D i a p h r a g m a s gebildet wird. Filamente der P r i m ä r s t a u b b l ä t t e r dick, röhrig, aneinandergepreßt, den Griffel dicht umgebend, weiter oben in scharfem Bogen nach außen gewendet. S e k u n d ä r s t a u b b l ä t t e r erst wesentlich höher oben an der Receptaculumwand beginnend, mit s e h r k u r z e n, h a a r d ü n n e n F i l a m e n t e n, die bei den schlundnahen Staubblättern kürzer als die Antheren sind. G r i f f e l schlank, stabförmig. N a r b e n lineal, etwas spreizend. S a m e n a n l a g e n in der sehr flachen Pericarpellhöhle in Büscheln an verzweigten, am Grunde ± vereinigten Samensträngen. F r u c h t fleischig, glatt, verkehrt eiförmig, am Scheitel vertieft mit kurzem, vertrocknetem Blütenrest. Kleine bis winzige Haarbüschel an dessen Grund und vereinzelt auch auf der oberen Rundung der Frucht stehend. Fruchtwand fleischig und Pulpa saftig, ± farblos, hyalin. S a m e n klein, gekrümmt, mit ovalem, sublateralem H i l u m, das in einer Grube das Mikropylarloch umschließt; eine zweite Grube entsteht beim Ausbrechen des Funiculus. T e s t a mattschwarz, grobwarzig. P e r i s p e r m f e h l t. E m b r y o hakenförmig gekrümmt, mit ansehnlichen, ovalen Keimblättern. Differentialdiagnose und Stellung der Gattung Die bereits hoch reduzierte Blüte von Espostoopsis ist der ebenfalls stark reduzierten Blüte von Austrocephalocereus äußerlich sehr ähnlich, im morphologischen Typus des inneren Blütenbaus jedoch in wesentlichen Merkmalen grundsätzlich verschieden. Der A c h s e n v o r s p r u n g und die an seinem Rande entspringenden Primärstaubblätter die dadurch an der Basis verwachsen erscheinen, bilden bei Espostoopsis ein die Nektarkammer abschließendes D i a p h r a g m a. Bei Austrocephalocereus besteht der Achsenvorsprung aus einer kürzeren oder längeren, flachen, oft k a u m e r h a b e n e n V e r d i c k u n g der Receptaculumwand, die von den herablaufenden Basen der an ihrem oberen Rande entspringenden, völlig freien Primärstaubblätter gestreift ist ( kannelierte Zone ). Diese Primärstaubblätter sind bei Austrocephalocereus kaum merklich dicker als die etwas höher an der Receptaculumwand tangential entspringenden und anliegenden Sekundärstaubblätter. Im G e g e n s a t z dazu sind die Primärstaubblätter bei E s p o s t o o p s i s l a n g u n d d i c k, die Filamente der Sekundärstaubblätter h a a r d ü n n, s e h r k u r z und gegen den Schlund zu noch kürzer. Sie bilden einen ganz anders gearteten morphologischen Typus, der auch bei anderen hochabgeleiteten Gattungen vorkommt. Hingegen schließt sich die Art der Anordnung Krainz, Die Kakteen, 1. VII C V a
Beschreibung der M. sphaerica aus dem Buch von J. Pilbeam: Mammillaria (1999,
 Mammillaria sphaerica Text und Fotos von Elton Roberts, Ripon/California-USA Deutsche Übersetzung: Othmar Appenzeller Beschreibung der M. sphaerica aus dem Buch von J. Pilbeam: Mammillaria (1999, S. 277):
Mammillaria sphaerica Text und Fotos von Elton Roberts, Ripon/California-USA Deutsche Übersetzung: Othmar Appenzeller Beschreibung der M. sphaerica aus dem Buch von J. Pilbeam: Mammillaria (1999, S. 277):
Bestimmungsschlüssel Pinus. Hier die wichtigsten für uns
 Hier die wichtigsten für uns 2 nadelige Kiefern Pinus sylvestris Gewöhnliche Waldkiefer Pinus nigra Schwarzkiefer Pinus mugo Latsche oder Bergkiefer 3 nadelige Kiefern Pinus ponderosa Gelb-Kiefer Pinus
Hier die wichtigsten für uns 2 nadelige Kiefern Pinus sylvestris Gewöhnliche Waldkiefer Pinus nigra Schwarzkiefer Pinus mugo Latsche oder Bergkiefer 3 nadelige Kiefern Pinus ponderosa Gelb-Kiefer Pinus
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein
 Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia arenacea (Cardenas) Ritter
 Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia arenacea (Cardenas) Ritter - Teil 2 - Günther Fritz Berichtigung zum Teil 1 im vorigen Heft, S. 20, Mitte des vorletzten Abschnitts: "Weitere Formen bilden
Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia arenacea (Cardenas) Ritter - Teil 2 - Günther Fritz Berichtigung zum Teil 1 im vorigen Heft, S. 20, Mitte des vorletzten Abschnitts: "Weitere Formen bilden
L.; \"' 19. ISSN o Heft Juli 1993 ' Jahrgang 14
 Y L.; I. \"' 19. ISSN o-722-4923. Heft 3. 15. Juli 1993 ' Jahrgang 14 Zur Abgrenzung der Scopanae von Notocactus tabularis (Cels ex K. Schumann) Berger ex Backeberg und seinen Varietäten Wolfgang Prauser
Y L.; I. \"' 19. ISSN o-722-4923. Heft 3. 15. Juli 1993 ' Jahrgang 14 Zur Abgrenzung der Scopanae von Notocactus tabularis (Cels ex K. Schumann) Berger ex Backeberg und seinen Varietäten Wolfgang Prauser
Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und
 Ent. Arb. Mus. Frey 25, 1974 131 Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und Bolivien (Col. Melolonthidae Sericinae) Von G. Frey Astaena iridescens n. sp. (Abb. 1) Ober- und Unterseite braun bis
Ent. Arb. Mus. Frey 25, 1974 131 Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und Bolivien (Col. Melolonthidae Sericinae) Von G. Frey Astaena iridescens n. sp. (Abb. 1) Ober- und Unterseite braun bis
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen
 Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 1. Vorsitzender der Deutschen Kakteen Gesellschaft 2. Band
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 1. Vorsitzender der Deutschen Kakteen Gesellschaft 2. Band
Pflanzen in den Lebensräumen
 Arbeitsbeschrieb Arbeitsauftrag: Anhand eines Exkursionsschemas versuchen die Sch gewisse Pflanzen in unserem Wald / in unserer Landschaft zu bestimmen. Ziel: Die Sch unterscheiden und bestimmen 10 in
Arbeitsbeschrieb Arbeitsauftrag: Anhand eines Exkursionsschemas versuchen die Sch gewisse Pflanzen in unserem Wald / in unserer Landschaft zu bestimmen. Ziel: Die Sch unterscheiden und bestimmen 10 in
Laubbäume
 Laubbäume http://www.faz-mattenhof.de/ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung/unterlagen Stand: 06-11-12 Knospen gelbgrün, kreuzgegenständig Seitenknospen abstehend glatte Rinde Knospen klein, spitz, graubraun
Laubbäume http://www.faz-mattenhof.de/ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung/unterlagen Stand: 06-11-12 Knospen gelbgrün, kreuzgegenständig Seitenknospen abstehend glatte Rinde Knospen klein, spitz, graubraun
Untersuche, aus welchen Teilen eine Blüte aufgebaut ist und wie diese Teile angeordnet sind.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 1 Untersuchung von Pflanzen und Tieren (P8010000) 1.1 Untersuchung einer Blüte Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:01:04 intertess (Version
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 1 Untersuchung von Pflanzen und Tieren (P8010000) 1.1 Untersuchung einer Blüte Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:01:04 intertess (Version
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4)
 Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
1.1 Im Einzelstand mächtiger Baum, manchmal mit bogenförmigen Ästen an der Stammbasis; im Bestand gerader Stamm, Äste nur im oberen Teil (Abb.
 Populus nigra L. I. Alte Bäume am natürlichen Standort 1 Habitus 1.1 Im Einzelstand mächtiger Baum, manchmal mit bogenförmigen Ästen an der Stammbasis; im Bestand gerader Stamm, Äste nur im oberen Teil
Populus nigra L. I. Alte Bäume am natürlichen Standort 1 Habitus 1.1 Im Einzelstand mächtiger Baum, manchmal mit bogenförmigen Ästen an der Stammbasis; im Bestand gerader Stamm, Äste nur im oberen Teil
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana
 Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKEBERG
 Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKEBERG Eine Bestandsaufnahme Willi Gertel Der erste Vertreter der Gattung Sulcorebutia, der in Bolivien gefunden und nach Deutschland geschickt wurde, war Rebutia steinbachii
Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKEBERG Eine Bestandsaufnahme Willi Gertel Der erste Vertreter der Gattung Sulcorebutia, der in Bolivien gefunden und nach Deutschland geschickt wurde, war Rebutia steinbachii
Waldeidechse. Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787)
 6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen
 Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 3. Band 1934/35 Mit 32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 3. Band 1934/35 Mit 32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien
Niederlande, vor Duft: leicht
 Niederlande, vor 1700 Sie ist die größte Vertreterin der Gallica- Rosen. Die schwach duftenden Blüten sind erst becherförmig, dann flach kissenförmig. Sie erscheinen in einem intensiv leuchtenden Purpurrot
Niederlande, vor 1700 Sie ist die größte Vertreterin der Gallica- Rosen. Die schwach duftenden Blüten sind erst becherförmig, dann flach kissenförmig. Sie erscheinen in einem intensiv leuchtenden Purpurrot
 www.sempervivumgarten.de Volkmar Schara Kreuzstr. 2 / OT Neunstetten 91567 Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521 Delosperma Mittagsblume Sukkulente Gattung aus Süd-Afrika. Es gibt Arten die unserem
www.sempervivumgarten.de Volkmar Schara Kreuzstr. 2 / OT Neunstetten 91567 Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521 Delosperma Mittagsblume Sukkulente Gattung aus Süd-Afrika. Es gibt Arten die unserem
Lobivia acchaensis Scholz, Kral & Wittau, spec. nov. eine neue Lobivia aus Perú
 Lobivia acchaensis Scholz, Kral & Wittau, spec. nov. eine neue Lobivia aus Perú Eines der schönsten Kakteenländer ist zweifellos Perú, auch wenn es als Reiseland in dieser Beziehung weniger bekannt ist.
Lobivia acchaensis Scholz, Kral & Wittau, spec. nov. eine neue Lobivia aus Perú Eines der schönsten Kakteenländer ist zweifellos Perú, auch wenn es als Reiseland in dieser Beziehung weniger bekannt ist.
Die heimischen Ginsterarten
 Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Saxifraga cortusifolia. ' Das Oktoberle '
 Saxifraga cortusifolia ' Das Oktoberle ' Saxifraga cortusifolia var fortunei Dieser Herbststeinbrech aus den Waldrändern Japans erobert ganz langsam auch unsere Gärten. Die bei uns unter dem Namen ' Oktoberle
Saxifraga cortusifolia ' Das Oktoberle ' Saxifraga cortusifolia var fortunei Dieser Herbststeinbrech aus den Waldrändern Japans erobert ganz langsam auch unsere Gärten. Die bei uns unter dem Namen ' Oktoberle
Obwohl M. magnimamma in Mexiko weit verbreitet ist, hat sich die Feld-Forschung
 Mammillaria magnimamma Haworth und Mammillaria centicirrha Lemaire (Teil 1) von Helmut Rogozinski, Köln,Weiden/Deutschland Alle Fotos und Repros, sofern nicht anders vermerkt, vom Autor Taxonomie und Nomenklatur
Mammillaria magnimamma Haworth und Mammillaria centicirrha Lemaire (Teil 1) von Helmut Rogozinski, Köln,Weiden/Deutschland Alle Fotos und Repros, sofern nicht anders vermerkt, vom Autor Taxonomie und Nomenklatur
Winter-Linde 51 Tilia cordata. Robinie 29 Robinia pseudacacia. Baum: bis 40 m hoch, oft als Parkbaum
 Winter-Linde 51 Tilia cordata Baum: bis 40 m hoch, oft als Parkbaum Blatt: herzförmig, zugespitzt, steif Früchte: mehrere Nüsschen mit Flughaut Blüten: wohlriechend (Tee) Blattunterseite mit rostfarbenen
Winter-Linde 51 Tilia cordata Baum: bis 40 m hoch, oft als Parkbaum Blatt: herzförmig, zugespitzt, steif Früchte: mehrere Nüsschen mit Flughaut Blüten: wohlriechend (Tee) Blattunterseite mit rostfarbenen
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen
 Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 4. Band 1936/37 Mit 32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 4. Band 1936/37 Mit 32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen
 Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 5. Band 1938/39 Mit 32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Werdermann Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 5. Band 1938/39 Mit 32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien
Weberbauerocereus rauhii Backeberg rauhii, nach dem Botaniker und Sukkulentenautor Prof. Dr. Werner Rauh, Heidelberg.
 Weberbauerocereus rauhii Backeberg rauhii, nach dem Botaniker und Sukkulentenautor Prof. Dr. Werner Rauh, Heidelberg. Literatur Weberbauerocereus rauhii Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 27. Rauh
Weberbauerocereus rauhii Backeberg rauhii, nach dem Botaniker und Sukkulentenautor Prof. Dr. Werner Rauh, Heidelberg. Literatur Weberbauerocereus rauhii Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 27. Rauh
Abraham Darby. Typ Kategorie Klasse. Blütenfarbe. Blütenform stark gefüllt, ca Blütengrösse Duft
 Abraham Darby, Kletterrose aprikosen-gelb stark gefüllt, ca. 50-60 Petalen, becherförmig 7-9, in Büscheln/ einzeln stark, fruchtig +++ / dauerblühend sehr frosthart sehr robust rund, edel stark, buschig,
Abraham Darby, Kletterrose aprikosen-gelb stark gefüllt, ca. 50-60 Petalen, becherförmig 7-9, in Büscheln/ einzeln stark, fruchtig +++ / dauerblühend sehr frosthart sehr robust rund, edel stark, buschig,
Abraham Darby. Typ Kategorie Klasse. Blütenfarbe. Blütenform stark gefüllt, ca Blütengrösse Duft
 Abraham Darby, Kletterrose aprikosen-gelb stark gefüllt, ca. 50-60 Petalen, becherförmig 7-9, in Büscheln/ einzeln stark, fruchtig +++ / dauerblühend sehr frosthart sehr rund, edel stark, buschig, lange
Abraham Darby, Kletterrose aprikosen-gelb stark gefüllt, ca. 50-60 Petalen, becherförmig 7-9, in Büscheln/ einzeln stark, fruchtig +++ / dauerblühend sehr frosthart sehr rund, edel stark, buschig, lange
Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis
 Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 41: 98 104 (2015/2016) Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis Hans-Oluf Martensen Kurzfassung Vom häufigen Rubus plicatus sind vom Typischen
Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 41: 98 104 (2015/2016) Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis Hans-Oluf Martensen Kurzfassung Vom häufigen Rubus plicatus sind vom Typischen
Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald - was ist das denn nun wirklich?
 Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald - was ist das denn nun wirklich? Willi Gertel In den letzten Jahren habe ich in 2 Artikeln (Gertel 1985 und 1991) etwas zu Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald
Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald - was ist das denn nun wirklich? Willi Gertel In den letzten Jahren habe ich in 2 Artikeln (Gertel 1985 und 1991) etwas zu Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald
Rosa arvensis (Feld-Rose )
 Rosa arvensis (Feld-Rose ) weiss einfach, 5 Petalen, gelbe Staubgefässe 3-4 einmalblühend sehr frosthart normal bogig überhängend, kletternd / kriechend mittelgross, hellgrün, matt 200 cm 200 cm Europa
Rosa arvensis (Feld-Rose ) weiss einfach, 5 Petalen, gelbe Staubgefässe 3-4 einmalblühend sehr frosthart normal bogig überhängend, kletternd / kriechend mittelgross, hellgrün, matt 200 cm 200 cm Europa
1 Membranbasis mit nur einer langen, quer verlaufenden, dreieckigen Zelle (Abb. 11 A). 1. Unterfamilie Coreinae (Seite 85) A B
 b) Bestimmungsschlüssel: Bestimmungsschlüssel der Familie Coreidae (Leder- oder Randwanzen) aus Bayern: Der Bestimmungsschlüssel ist kombiniert nach STICHEL 1959, WAGNER 1966, MOULET 1995 und GÖLLNER-SCHEIDING
b) Bestimmungsschlüssel: Bestimmungsschlüssel der Familie Coreidae (Leder- oder Randwanzen) aus Bayern: Der Bestimmungsschlüssel ist kombiniert nach STICHEL 1959, WAGNER 1966, MOULET 1995 und GÖLLNER-SCHEIDING
Anemonella thalictroides. Rautenanemone
 Anemonella thalictroides Rautenanemone Anemonella thalictroides, Rautenanemone Diese aus den lichten Wäldern Nordamerikas stammende winterharte Staude ähnelt unser einheimischen Buschwindröschen sehr.
Anemonella thalictroides Rautenanemone Anemonella thalictroides, Rautenanemone Diese aus den lichten Wäldern Nordamerikas stammende winterharte Staude ähnelt unser einheimischen Buschwindröschen sehr.
Star. Amsel. langer, spitzer Schnabel. grün-violetter Metallglanz auf den Federn. gelber Schnabel. schwarzes G e fi e d e r. längerer.
 Star Amsel grün-violetter Metallglanz auf den Federn langer, spitzer gelber schwarzes G e fi e d e r längerer kürzerer silbrige Sprenkel im Gefieder (weniger zur Brutzeit, viel im Herbst und Winter) 19
Star Amsel grün-violetter Metallglanz auf den Federn langer, spitzer gelber schwarzes G e fi e d e r längerer kürzerer silbrige Sprenkel im Gefieder (weniger zur Brutzeit, viel im Herbst und Winter) 19
Notizen Dessau. Interessante Funde Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora,
 Notizen Dessau Nr. 4 Interessante Funde 2015 Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora, Eryngium planum L. Das Grundstück Mannheimer Straße Ecke Junkers-Straße ist bis auf
Notizen Dessau Nr. 4 Interessante Funde 2015 Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora, Eryngium planum L. Das Grundstück Mannheimer Straße Ecke Junkers-Straße ist bis auf
In diesem Jahr traf sich der ADR-Arbeitskreis erstmalig im Ostdeutschen Rosengarten in Forst.
 ADR-Rosen 2015, ein großer Erfolg der Rosenzüchtung In diesem Jahr traf sich der ADR-Arbeitskreis erstmalig im Ostdeutschen Rosengarten in Forst. Die Rosenneuheitenprüfung hat in Forst Geschichte. Bereits
ADR-Rosen 2015, ein großer Erfolg der Rosenzüchtung In diesem Jahr traf sich der ADR-Arbeitskreis erstmalig im Ostdeutschen Rosengarten in Forst. Die Rosenneuheitenprüfung hat in Forst Geschichte. Bereits
Bambus. Fargesia murielae `Jumbo. Fargesia murielae `Rufa. Wachstum pro Jahr. Lanzettförmige hellgrüne Blätter, neuer Blattaustrieb im Frühjahr
 Bambus Fargesia murielae `Jumbo Buschig, dicht Lanzettförmige hellgrüne Blätter, neuer austrieb im Frühjahr Bis 3 m Aufrechter Wuchs, auch für Halbschatten geeignet, Schnellwüchsig, winterhart, schnittverträglich
Bambus Fargesia murielae `Jumbo Buschig, dicht Lanzettförmige hellgrüne Blätter, neuer austrieb im Frühjahr Bis 3 m Aufrechter Wuchs, auch für Halbschatten geeignet, Schnellwüchsig, winterhart, schnittverträglich
Sulcorebutia azurduyensis var. sormae eine neue Varietät aus der südlichen Cordillera Mandinga, Chuquisaca, Bolivien.
 Sulcorebutia azurduyensis var. sormae eine neue Varietät aus der südlichen Cordillera Mandinga, Chuquisaca, Bolivien. Willi Gertel & Hansjörg Jucker Als Hansjörg Jucker 1993 die Cordillera Mandinga von
Sulcorebutia azurduyensis var. sormae eine neue Varietät aus der südlichen Cordillera Mandinga, Chuquisaca, Bolivien. Willi Gertel & Hansjörg Jucker Als Hansjörg Jucker 1993 die Cordillera Mandinga von
Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) Baum des Jahres 2009
 Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) Baum des Jahres 2009 Verbreitung: Der Bergahorn ist die am meisten verbreitete Ahornart in Deutschland. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Norddeutschen
Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) Baum des Jahres 2009 Verbreitung: Der Bergahorn ist die am meisten verbreitete Ahornart in Deutschland. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Norddeutschen
Schatten. Auswertung Beet- und Balkonpflanzen in Ampeln. Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau Erfurt. Bestell- Nr. Art Sorte Firma Lieferwoche
 Art Sorte Firma Lieferwoche Aussaat Datum Topfen Datum Ges. Stück Stutzen Datum Bemerkung zu Stutzen Topflor 0,08 %ig Caramba Blühbeginn in den einzelnen Anzuchtkabinen K 3.1 K 3.2 K 3.3 K 3.4 K 2.4 K
Art Sorte Firma Lieferwoche Aussaat Datum Topfen Datum Ges. Stück Stutzen Datum Bemerkung zu Stutzen Topflor 0,08 %ig Caramba Blühbeginn in den einzelnen Anzuchtkabinen K 3.1 K 3.2 K 3.3 K 3.4 K 2.4 K
Notizen zur Flora der Steiermark
 Notizen zur Flora der Steiermark Nr. 4 1978 Inhalt HAEELLNER J.: Zur Unterscheidung der steirischen Fu/naria-Arten... 1 TRACEY R.: Festuca ovina agg. im Osten Österreichs- Bestimmungsschlüssel und kritische
Notizen zur Flora der Steiermark Nr. 4 1978 Inhalt HAEELLNER J.: Zur Unterscheidung der steirischen Fu/naria-Arten... 1 TRACEY R.: Festuca ovina agg. im Osten Österreichs- Bestimmungsschlüssel und kritische
Weingartia (Sulcorebutia) insperata nom.prov. Eine aufregende, unverhoffte neue Art aus dem östlichen Chuquisaca (Bolivien)
 Weingartia (Sulcorebutia) insperata nom.prov. Eine aufregende, unverhoffte neue Art aus dem östlichen Chuquisaca (Bolivien) Roland Müller Seit Jahren hat das Bergland nördlich und südlich von Padilla,
Weingartia (Sulcorebutia) insperata nom.prov. Eine aufregende, unverhoffte neue Art aus dem östlichen Chuquisaca (Bolivien) Roland Müller Seit Jahren hat das Bergland nördlich und südlich von Padilla,
Züchter: Duft: leicht
 Mallerin 1956 W. Kordes`Söhne 1955 Höhe: 4 m Die Blüten sind tief dunkelrot und starkgefüllt. Sie duften leicht, sind klein und kommen in Büscheln vor. Einmalblühend. Sehr robust gegen Sternrußtau. Diese
Mallerin 1956 W. Kordes`Söhne 1955 Höhe: 4 m Die Blüten sind tief dunkelrot und starkgefüllt. Sie duften leicht, sind klein und kommen in Büscheln vor. Einmalblühend. Sehr robust gegen Sternrußtau. Diese
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Der Teil I endete mit der Schilderung
 Taxonomie und Nomenklatur Die Mammillarien der Reihe Rhodanthae Lüthy im Westen Mexikos, Teil II Von Helmut Rogozinski, Köln/Deutschland, und Wolfgang Plein, Düsseldorf/Deutschland Engl. Übersetzung: W.
Taxonomie und Nomenklatur Die Mammillarien der Reihe Rhodanthae Lüthy im Westen Mexikos, Teil II Von Helmut Rogozinski, Köln/Deutschland, und Wolfgang Plein, Düsseldorf/Deutschland Engl. Übersetzung: W.
Zwiebel- und Knollenpflanzen. ,!7ID8A0-biagfd! Taschenatlas. Frank M. von Berger. Tulpe, Krokus & Co.
 Frank M. von Berger In diesem Buch finden Sie 200 Pflanzen in Wort und Bild kompakt beschrieben. Sie erfahren alles über die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Pflanzen und ihre Standort ansprüche. Hinweise
Frank M. von Berger In diesem Buch finden Sie 200 Pflanzen in Wort und Bild kompakt beschrieben. Sie erfahren alles über die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Pflanzen und ihre Standort ansprüche. Hinweise
Sempervivum Hauswurz
 Sempervivum Hauswurz Sempervivum - Hauswurz Sempervivum ist eine Gattung mit etwa 40 Arten. Diese immergrünen Stauden kommen hauptsächlich in den Gebirgen Europas und Asiens vor. Die n dieser Pflanze sind
Sempervivum Hauswurz Sempervivum - Hauswurz Sempervivum ist eine Gattung mit etwa 40 Arten. Diese immergrünen Stauden kommen hauptsächlich in den Gebirgen Europas und Asiens vor. Die n dieser Pflanze sind
Abraham Darby. Typ Kategorie Klasse. Blütenfarbe. Blütenform stark gefüllt, ca. 50-60. Blütengrösse Duft
 Abraham Darby, Kletterrose aprikosen-gelb stark gefüllt, ca. 50-60 Petalen, becherförmig 7-9, in Büscheln/ einzeln stark, fruchtig +++ / dauerblühend sehr frosthart sehr robust rund, edel stark, buschig,
Abraham Darby, Kletterrose aprikosen-gelb stark gefüllt, ca. 50-60 Petalen, becherförmig 7-9, in Büscheln/ einzeln stark, fruchtig +++ / dauerblühend sehr frosthart sehr robust rund, edel stark, buschig,
Gattung Dendrocereus. Britton et Rose in The Cactaceae II: 113, 1920.
 Gattung Dendrocereus Britton et Rose in The Cactaceae II: 113, 1920. Synonym: Cereus Miller p. p. Von gr. dendron = Baum, weil diese monotypische Art im Gesamthabitus am meisten von allen Kakteen einem
Gattung Dendrocereus Britton et Rose in The Cactaceae II: 113, 1920. Synonym: Cereus Miller p. p. Von gr. dendron = Baum, weil diese monotypische Art im Gesamthabitus am meisten von allen Kakteen einem
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Kamelien. Sortenübersicht
 Kamelien Sortenübersicht 2 0 1 3 Camellia reticulata Black Lace Blütenfarbe: dunkles, samtiges Rot Blütenform: vollständig gefüllt Blütezeit: ab April Frosthärte: bis - 21 C Wuchs: Kompakter, dichter und
Kamelien Sortenübersicht 2 0 1 3 Camellia reticulata Black Lace Blütenfarbe: dunkles, samtiges Rot Blütenform: vollständig gefüllt Blütezeit: ab April Frosthärte: bis - 21 C Wuchs: Kompakter, dichter und
Mammillaria hermosana spec. nov. - ein neues Mitglied der Reihe Herrerae Lüthy Mammillaria hermosana spec. nov. - a new member of series Herrerae
 Mammillaria hermosana spec. nov. - ein neues Mitglied der Reihe Herrerae Lüthy Mammillaria hermosana spec. nov. - a new member of series Herrerae Lüthy von Thomas Linzen, Irxleben/Deutschland Alle Fotos,
Mammillaria hermosana spec. nov. - ein neues Mitglied der Reihe Herrerae Lüthy Mammillaria hermosana spec. nov. - a new member of series Herrerae Lüthy von Thomas Linzen, Irxleben/Deutschland Alle Fotos,
Vogel-Nestfarn (Asplenium nidus)
 Blätter bilden einen Trichter Blätter am Ansatz schmal, in der Mitte breit Blattrippen sind dunkelbraun Blattunterseiten z. T. mit pudrigen Streifen (Sporangien) Vogel-Nestfarn (Asplenium nidus) Stängel
Blätter bilden einen Trichter Blätter am Ansatz schmal, in der Mitte breit Blattrippen sind dunkelbraun Blattunterseiten z. T. mit pudrigen Streifen (Sporangien) Vogel-Nestfarn (Asplenium nidus) Stängel
Bestimmungshilfe Krautpflanzen
 Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Schweizerische Kakteen-Gesellschaft Association Suisse des Cactophiles
 Bücherverzeichnis Fremdsprachen A 101 Mesembs of the world Autoren Team 1998 B 101 The Cactacea Benson 1950 B 102 The Cactacea Volume l Britton and B 103 The Cactacea Volume ll Britton and 1937 Descriptions
Bücherverzeichnis Fremdsprachen A 101 Mesembs of the world Autoren Team 1998 B 101 The Cactacea Benson 1950 B 102 The Cactacea Volume l Britton and B 103 The Cactacea Volume ll Britton and 1937 Descriptions
Euonymus europaea Spindelbaumgewächse. Präsentation Markus Würsten
 Euonymus europaea Spindelbaumgewächse Präsentation Markus Würsten 2014-1 Bestimmungsmerkmale Das Pfaffenhütchen wächst als Strauch. Es kann bis zu 6 m hoch werden. Präsentation Markus Würsten 2014-2 Bestimmungsmerkmale
Euonymus europaea Spindelbaumgewächse Präsentation Markus Würsten 2014-1 Bestimmungsmerkmale Das Pfaffenhütchen wächst als Strauch. Es kann bis zu 6 m hoch werden. Präsentation Markus Würsten 2014-2 Bestimmungsmerkmale
Baumschule Freiberg GbR Münzbachtal 126, Großschirma Tel.: 03731/ Fax: 03731/ freiberg.de
 Amadeus Baikal Züchter: W. Kordes Söhne 2003 Blüten: blutrot, groß, gefüllt, leuchtend Wuchs: ca. 200 cm, Klettermaxe Laub: glänzend Besonderheit: öfterblühend, gesund Duft: Barock Züchter: Harkness 2005
Amadeus Baikal Züchter: W. Kordes Söhne 2003 Blüten: blutrot, groß, gefüllt, leuchtend Wuchs: ca. 200 cm, Klettermaxe Laub: glänzend Besonderheit: öfterblühend, gesund Duft: Barock Züchter: Harkness 2005
Züchter: Eine großartige Rose mit. David Austin 2087 Höhe: cm
 Die Rose hat einen fast lachsfarbenden Farbton, der sich mit der Zeit zu einem intensiven Rosarot hin verändert. Die duftenden Blüten sind anfangs tief schalenförmig und öffnen sich später zu flacheren
Die Rose hat einen fast lachsfarbenden Farbton, der sich mit der Zeit zu einem intensiven Rosarot hin verändert. Die duftenden Blüten sind anfangs tief schalenförmig und öffnen sich später zu flacheren
Bestimmungsschlüssel für den Lorbeerwald auf Teneriffa
 Bestimmungsschlüssel für den Lorbeerwald auf Teneriffa Erfasst sind Bäume, Sträucher und Rankengewächse. 1a Pflanze rankend oder anlehnend...2 1b Planze freistehend...5 2a Spross auffällig behaart...convolvolus
Bestimmungsschlüssel für den Lorbeerwald auf Teneriffa Erfasst sind Bäume, Sträucher und Rankengewächse. 1a Pflanze rankend oder anlehnend...2 1b Planze freistehend...5 2a Spross auffällig behaart...convolvolus
Nadelhölzer bestimmen
 Nadelhölzer bestimmen Inhaltsverzeichnis Nadelhölzer... 2 Stehende Zapfen... 2 Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) nicht giftig... 2 Balsam-Tanne (Abies balsamea) nicht giftig... 2 Edel-Tanne (Abies procera)
Nadelhölzer bestimmen Inhaltsverzeichnis Nadelhölzer... 2 Stehende Zapfen... 2 Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) nicht giftig... 2 Balsam-Tanne (Abies balsamea) nicht giftig... 2 Edel-Tanne (Abies procera)
Martin Haberer. Garten- und Zimmerpflanzen
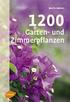 Martin Haberer 1200 Garten- und Zimmerpflanzen 15 H: 50 B: 8 L: 1 2 II III H: 10 20 B: 6 L: 0,5 B: 0,15 IX Cryptomeria japonica Sicheltanne Taxodiaceae, Sumpfzypressen gewächse Heimat: Japan, China. Wuchs:
Martin Haberer 1200 Garten- und Zimmerpflanzen 15 H: 50 B: 8 L: 1 2 II III H: 10 20 B: 6 L: 0,5 B: 0,15 IX Cryptomeria japonica Sicheltanne Taxodiaceae, Sumpfzypressen gewächse Heimat: Japan, China. Wuchs:
NRW. Merkblatt zur Artenförderung. Mehlbeere
 Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (LÖBF) NRW. Merkblatt zur Artenförderung Mehlbeere Bedrohung und Förderung der Mehlbeere - Sorbus aria
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (LÖBF) NRW. Merkblatt zur Artenförderung Mehlbeere Bedrohung und Förderung der Mehlbeere - Sorbus aria
Zoologische Ergebnisse der Mazedonienreisen Friedrich Kasys
 Zoologische Ergebnisse der Mazedonienreisen Friedrich Kasys Lepidoptera II. Teil Scythridae Von H. J. H a n n e m a n n, Berlin (Mit 4 Abbildungen) (Vorgelegt in der Sitzung am 9. November 1961) Scythris
Zoologische Ergebnisse der Mazedonienreisen Friedrich Kasys Lepidoptera II. Teil Scythridae Von H. J. H a n n e m a n n, Berlin (Mit 4 Abbildungen) (Vorgelegt in der Sitzung am 9. November 1961) Scythris
Klatschmohn. Abbildung von Martha Seitz, Zürich. Text, Konzept, Gestaltung: carabus Naturschutzbüro, Luzern
 Klatschmohn Da der Klatschmohn in der Nähe von Menschen wächst, bezeichnen wir ihn als Kulturbegleiter. Die einjährige Pflanze wächst auf offenen Flächen, oft auch auf frisch gepflügten Äckern oder an
Klatschmohn Da der Klatschmohn in der Nähe von Menschen wächst, bezeichnen wir ihn als Kulturbegleiter. Die einjährige Pflanze wächst auf offenen Flächen, oft auch auf frisch gepflügten Äckern oder an
Kunterbunter Ostertisch Über den Wolken Altes Holz, neues Leben
 Die schönen Seiten des Landlebens März/ April 2015 I 4,00 Kunterbunter Ostertisch Über den Wolken Altes Holz, neues Leben Frühling Frühe Glöckchen und Sterne Propertius hat zart duftende Blüten. An sonnigen
Die schönen Seiten des Landlebens März/ April 2015 I 4,00 Kunterbunter Ostertisch Über den Wolken Altes Holz, neues Leben Frühling Frühe Glöckchen und Sterne Propertius hat zart duftende Blüten. An sonnigen
ZWEI NEUE PENTATOMIDEN-ARTEN AUS DER SPANISCHEN SAHARA (Hem. Hei.)
 ZWEI NEUE PENTATOMIDEN-ARTEN AUS DER SPANISCHEN SAHARA (Hem. Hei.) VON EDUARD WAGNER Hamburg 1. Aethus (Stilbocydnus) laevis nov. spec. a. Stilbocydnus nov. subgen. Typus subgeneris : S. laevis nov. spec.
ZWEI NEUE PENTATOMIDEN-ARTEN AUS DER SPANISCHEN SAHARA (Hem. Hei.) VON EDUARD WAGNER Hamburg 1. Aethus (Stilbocydnus) laevis nov. spec. a. Stilbocydnus nov. subgen. Typus subgeneris : S. laevis nov. spec.
1 Einleitung Das Holz der Eberesche Eigenschaften und Aussehen des Holzes Verwendung des Holzes...
 Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Wer schneckt denn da? Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein
 Wer schneckt denn da? Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2011 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Wer schneckt denn da? Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2011 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Cantharidae. 22. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Malacodermata. Von W. Wittmer, Herrliberg-Zürich
 Ent. Arb. Mus. Frey 12, 1961 357 22. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Malacodermata (Col.) Von W. Wittmer, Herrliberg-Zürich Cantharidae Oontelus pioi n. sp. (5 Schwarzbraun, 2 bis 3 erste Fühlerglieder
Ent. Arb. Mus. Frey 12, 1961 357 22. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Malacodermata (Col.) Von W. Wittmer, Herrliberg-Zürich Cantharidae Oontelus pioi n. sp. (5 Schwarzbraun, 2 bis 3 erste Fühlerglieder
Weingartia (Cumingia) torotorensis?
 Weingartia (Cumingia) torotorensis? Teil II Rolf Oeser und Dr. Gerd Köllner Die in unseren Sammlungen beobachteten weingartia-ähnlichen Torotoro - Pflanzen zeigen nun das gleiche Verhalten wie die nördlichen
Weingartia (Cumingia) torotorensis? Teil II Rolf Oeser und Dr. Gerd Köllner Die in unseren Sammlungen beobachteten weingartia-ähnlichen Torotoro - Pflanzen zeigen nun das gleiche Verhalten wie die nördlichen
Sclerocactus polyancistrus (Engelmann et Bigelow) Britton et Rose
 Sclerocactus polyancistrus (Engelmann et Bigelow) Britton et Rose gr. polyancistrus = vielhakig. L i t e r a t u r Echinocactus polyancistrus Engelm. et Bigelow in Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3. 1856,
Sclerocactus polyancistrus (Engelmann et Bigelow) Britton et Rose gr. polyancistrus = vielhakig. L i t e r a t u r Echinocactus polyancistrus Engelm. et Bigelow in Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3. 1856,
Renate Volk Fridhelm Volk. Pilze. sicher bestimmen lecker zubereiten
 Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten Sicher bestimmen 16 Butterpilz Suillus luteus (Butterröhrling, Schälpilz, Schleimchen, Schlabberpilz, Schmalzring) Hut: 4 10 cm. Jung
Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten Sicher bestimmen 16 Butterpilz Suillus luteus (Butterröhrling, Schälpilz, Schleimchen, Schlabberpilz, Schmalzring) Hut: 4 10 cm. Jung
2018: Salzburger Rosenstreifling
 2018: Salzburger Rosenstreifling Streuobstbestände sind vielfältige und unersetzliche Lebensräume in unserer Kulturlandschaft. In den Streuobstgärten wird die traditionelle Obstsortenvielfalt erhalten
2018: Salzburger Rosenstreifling Streuobstbestände sind vielfältige und unersetzliche Lebensräume in unserer Kulturlandschaft. In den Streuobstgärten wird die traditionelle Obstsortenvielfalt erhalten
Die wichtigsten Spalierformen
 Die wichtigsten Spalierformen im Überblick Doppelte U-Form Als Pflanzmaterial dient eine einjährige Veredlung. Der Trieb wird auf eine Länge von etwa 30 cm zurückgeschnitten (Abb. 1). Wichtig ist, dass
Die wichtigsten Spalierformen im Überblick Doppelte U-Form Als Pflanzmaterial dient eine einjährige Veredlung. Der Trieb wird auf eine Länge von etwa 30 cm zurückgeschnitten (Abb. 1). Wichtig ist, dass
Argyranthemum frutescenes (Strauchmargeriten)
 Argyranthemum frutescenes (Strauchmargeriten) Steckbrief: Die Strauchmargerite eignet sich hervorragend als Kübelpflanze. Kurze Trockenperioden werden nicht übel genommen. Ihre Blüten gibt es in unterschiedlichen
Argyranthemum frutescenes (Strauchmargeriten) Steckbrief: Die Strauchmargerite eignet sich hervorragend als Kübelpflanze. Kurze Trockenperioden werden nicht übel genommen. Ihre Blüten gibt es in unterschiedlichen
Sulcorebutia crispata var. muelleri
 Sulcorebutia crispata var. muelleri eine neue Varietät aus der Umgebung von Pucara, Prov. Vallegrande, Dept. Sta. Cruz, Bolivien. Willi Gertel Als Karl Heinz Müller aus Singhofen, Deutschland im Jahr 2000
Sulcorebutia crispata var. muelleri eine neue Varietät aus der Umgebung von Pucara, Prov. Vallegrande, Dept. Sta. Cruz, Bolivien. Willi Gertel Als Karl Heinz Müller aus Singhofen, Deutschland im Jahr 2000
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
 Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale Thallus relativ fest angeheftet, 2-12 cm; Lappen 1-3 mm, zusammenschließend bis dachziegelig, im Alter manchmal randlich schwarz und im Zentrum mit Sekundärläppchen;
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale Thallus relativ fest angeheftet, 2-12 cm; Lappen 1-3 mm, zusammenschließend bis dachziegelig, im Alter manchmal randlich schwarz und im Zentrum mit Sekundärläppchen;
Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen
 Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen Bearbeitet von Bettina Rahfeld 1. Auflage 2011. Taschenbuch. x, 326 S. Paperback ISBN 978 3 8274 2781 6 Format (B x L): 16,8 x 24 cm Weitere Fachgebiete >
Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen Bearbeitet von Bettina Rahfeld 1. Auflage 2011. Taschenbuch. x, 326 S. Paperback ISBN 978 3 8274 2781 6 Format (B x L): 16,8 x 24 cm Weitere Fachgebiete >
Gattung Backebergia Bravo in Anales del Instituto de Biología, Mexico 24/2, 1953, S
 Gattung Backebergia Bravo in Anales del Instituto de Biología, Mexico 24/2, 1953, S. 215-232 Synonyme: Pilocereus Lemaire p. p. Cereus Miller p. p. Cephalocereus Pfeiffer sensu K. Schumann NON Cephalocereus
Gattung Backebergia Bravo in Anales del Instituto de Biología, Mexico 24/2, 1953, S. 215-232 Synonyme: Pilocereus Lemaire p. p. Cereus Miller p. p. Cephalocereus Pfeiffer sensu K. Schumann NON Cephalocereus
Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand
 Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand Aus der Vielzahl an neuen Sorten für den Anbau von Sommerhimbeeren stachen in den letzten Jahren Tulameen und Glen Ample als besonders anbauwürdig hervor und
Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand Aus der Vielzahl an neuen Sorten für den Anbau von Sommerhimbeeren stachen in den letzten Jahren Tulameen und Glen Ample als besonders anbauwürdig hervor und
Exkursion Bäume erkennen im Herbst am
 Exkursion Bäume erkennen im Herbst am 10.11.2018 Insgesamt 20 Personen trafen sich an der Friedhofskapelle Feldstraße im Schatten großer Hainbuchen zu dieser Exkursion, auf der unter Leitung von Dr. Agnes-M.
Exkursion Bäume erkennen im Herbst am 10.11.2018 Insgesamt 20 Personen trafen sich an der Friedhofskapelle Feldstraße im Schatten großer Hainbuchen zu dieser Exkursion, auf der unter Leitung von Dr. Agnes-M.
Zwiebel- und Knollenpflanzen
 Frank Michael von Berger Taschenatlas Zwiebel- und Knollenpflanzen 196 Zwiebel- und Knollenpflanzen 20 5 Allium moly Gold-Lauch Heimat: Südwest- und Südeuropa. Wuchsform: Aufrecht bis überhängend, horstbildend.
Frank Michael von Berger Taschenatlas Zwiebel- und Knollenpflanzen 196 Zwiebel- und Knollenpflanzen 20 5 Allium moly Gold-Lauch Heimat: Südwest- und Südeuropa. Wuchsform: Aufrecht bis überhängend, horstbildend.
Enzianbäumchen Enzianbäumchen. Sommerjasmin. Enzianbäumchen. Sommerjasmin. Solanum rantonnetii. Solanum jasminoides. Solanum rantonnetii
 Enzianbäumchen Enzianbäumchen Sommerjasmin Enzianbäumchen Sonnig bis halbschattig. Sommerjasmin Solanum jasminoides Solanum jasminoides Sonnig bis halbschattig. Blüht unermüdlich von März bis November.
Enzianbäumchen Enzianbäumchen Sommerjasmin Enzianbäumchen Sonnig bis halbschattig. Sommerjasmin Solanum jasminoides Solanum jasminoides Sonnig bis halbschattig. Blüht unermüdlich von März bis November.
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010
 Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
SALAT- UND SAUCENTOMATEN
 SALAT- UND SAUCENTOMATEN TICA Glänzend rote, sehr feste Salattomate, sehr ertragreich und gesund. HELLFRUCHT Ertragreiche rote Salattomate mit sehr gutem Geschmack. MATINA Sehr frühe rote Salattomate,
SALAT- UND SAUCENTOMATEN TICA Glänzend rote, sehr feste Salattomate, sehr ertragreich und gesund. HELLFRUCHT Ertragreiche rote Salattomate mit sehr gutem Geschmack. MATINA Sehr frühe rote Salattomate,
Biodiversity Heritage Library, Chaicidopterella *) nov. gen. Museum. Mit 1 TL'xtlif^ur. Farn. Jassidae.
 262 Chaicidopterella *) nov. gen. (Typus: Ch. chalcidipcnnis Enderl. Zool. Anz. 1905 p. 715. Bolivien). Im Vorder flügel ist nur die Costa und die Subcosta = ( sc + r) vorhanden, die jmedianader fehlt
262 Chaicidopterella *) nov. gen. (Typus: Ch. chalcidipcnnis Enderl. Zool. Anz. 1905 p. 715. Bolivien). Im Vorder flügel ist nur die Costa und die Subcosta = ( sc + r) vorhanden, die jmedianader fehlt
Online-Journal Vol. 2 Sonderheft 2014 ISSN
 Echinocereus Online-Journal Vol. 2 Sonderheft 2014 ISSN 2195-7541 Vorwort der Herausgeber Inhaltsverzeichnis Erstbeschreibung Echinocereus dasyacanthus G. Engelmann subsp. crockettianus D. Felix & H. Bauer
Echinocereus Online-Journal Vol. 2 Sonderheft 2014 ISSN 2195-7541 Vorwort der Herausgeber Inhaltsverzeichnis Erstbeschreibung Echinocereus dasyacanthus G. Engelmann subsp. crockettianus D. Felix & H. Bauer
MITTELGROSSER ANGLO-FRANZÖSISCHER LAUFHUND (Anglo-français de petite vénerie)
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 28. 04. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 325 MITTELGROSSER ANGLO-FRANZÖSISCHER LAUFHUND (Anglo-français
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 28. 04. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 325 MITTELGROSSER ANGLO-FRANZÖSISCHER LAUFHUND (Anglo-français
SORTENKATALOG. Zucchini Zucchetti und Kürbis. Saison Daniela und Thomas Glos. Schnann Pettneu am Arlberg
 SORTENKATALOG Zucchini Zucchetti und Kürbis Saison 2017 Daniela und Thomas Glos www.gartli.at Schnann 78 info@gartli.at 6574 Pettneu am Arlberg Telefon 0664 540 67 57 Hinweis zu den verwendeten Bildquellen:
SORTENKATALOG Zucchini Zucchetti und Kürbis Saison 2017 Daniela und Thomas Glos www.gartli.at Schnann 78 info@gartli.at 6574 Pettneu am Arlberg Telefon 0664 540 67 57 Hinweis zu den verwendeten Bildquellen:
Esche & Co. Zum Pollenflug im Zeitraum März bis Mai. Die Gemeine Esche. Newsletter Nr
 Newsletter Nr. 7-2008 Esche & Co Die windblütige Esche ist vielen Pollenallergiker bekannt. Doch wenn es um den Unterschied zwischen Gemeiner Esche, Manna-Esche und Eschen-Ahorn geht, sind die Begriffe
Newsletter Nr. 7-2008 Esche & Co Die windblütige Esche ist vielen Pollenallergiker bekannt. Doch wenn es um den Unterschied zwischen Gemeiner Esche, Manna-Esche und Eschen-Ahorn geht, sind die Begriffe
Prüfung Neuheiten Ampelbepflanzung 2008
 Blütenfarbe Stutzen Anzuchttemperaturen (Istwerte) TMT Stauchen Topflor 0,1 % Begonia 'Summerwings Rose' 1,0 C 16,1 C 13, C 16, C 16 C 15 C Diff+Drop rosa 10.5.0 54 'Callie Yellow 0' Syngenta sattgelb
Blütenfarbe Stutzen Anzuchttemperaturen (Istwerte) TMT Stauchen Topflor 0,1 % Begonia 'Summerwings Rose' 1,0 C 16,1 C 13, C 16, C 16 C 15 C Diff+Drop rosa 10.5.0 54 'Callie Yellow 0' Syngenta sattgelb
Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter t ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE
 Gntomohuna t ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE Band 8, Heft 15 ISSN 0250-4413 Linz, 10.Juni 1987 Nachtrag zur Revision der Untergattung Agelasta Newman s.str. * (Coleoptera, Cerambycidae) Karl-Ernst Hüdepohl
Gntomohuna t ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE Band 8, Heft 15 ISSN 0250-4413 Linz, 10.Juni 1987 Nachtrag zur Revision der Untergattung Agelasta Newman s.str. * (Coleoptera, Cerambycidae) Karl-Ernst Hüdepohl
Die beiden Verzeichnisse von 1905/1906 sind identisch. Diese Büchlein sind nur noch antiquarisch zu bekommen.
 Verschollene Kernobstsorten in Vorarlberg Für die Geschichte des Obstbaues sind die alten Verzeichnisse (Sortenempfehlungen) eine wichtige Quelle. Dort finden sich auch Sortennamen, die bei der Bestimmung
Verschollene Kernobstsorten in Vorarlberg Für die Geschichte des Obstbaues sind die alten Verzeichnisse (Sortenempfehlungen) eine wichtige Quelle. Dort finden sich auch Sortennamen, die bei der Bestimmung
DIE SCHNEEROSE. Helleborus niger
 DIE SCHNEEROSE Die Gattung Helleborus, zu deutsch Schnee- oder Christrose, mancherorts auch Lenzrose genannt, gehört mit 15 bis 25 Arten zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae), hat also nichts mit Rosen
DIE SCHNEEROSE Die Gattung Helleborus, zu deutsch Schnee- oder Christrose, mancherorts auch Lenzrose genannt, gehört mit 15 bis 25 Arten zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae), hat also nichts mit Rosen
Bäume im Zechliner Land
 Bäume im Zechliner Land Bäume sind Gedichte welche die Erde in den Himmel schreibt Kahlil Gibran XII Wegbegleiter von E.Ullrich 2013 Inhalt Der Eschenahorn Einführung Ansichten Blüte und Frucht Eschenahorn,
Bäume im Zechliner Land Bäume sind Gedichte welche die Erde in den Himmel schreibt Kahlil Gibran XII Wegbegleiter von E.Ullrich 2013 Inhalt Der Eschenahorn Einführung Ansichten Blüte und Frucht Eschenahorn,
