Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung Baden-Württemberg
|
|
|
- Christel Sachs
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung Baden-Württemberg
2 IMPRESSUM Herausgeber Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Kernerplatz 9, Stuttgart Telefon Gestaltung Grafik-Design Klaus Killenberg, Stuttgart Druck Schwäbische Druckerei GmbH, Stuttgart Das verwendete Papier ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. klimaneutral natureoffice.com DE gedruckt Bildnachweis Fotolia: Titel, Seite 2, 8 Konrad Raab, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft: Seite 7 Bruno Lorinser, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: Seite 9, 10, 12, 20 Vaillant: Seite 20 (unten rechts) August 2015
3 Die Landesregierung hat im Klimaschutzgesetz die Minderung der jährlichen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 verbindlich festgeschrieben. Um dies zu erreichen, soll bis 2050 der Energieverbrauch im Vergleich zum Jahr 2010 um 50 Prozent reduziert und der verbleibende Energiebedarf zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Dem Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Der Grund für die große Bedeutung der KWK in einem nachhaltigen Energiesystem der Zukunft ist die hohe Effizienz der gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung bei gleichzeitig sehr großer Flexibilität hinsichtlich Anlagengröße und Einsatzart. Die hohe Brennstoffeffizienz bedingt eine deutlich bessere CO2-Bilanz für die gekoppelte Erzeugung gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme. Im Zusammenhang mit der wachsenden regenerativen Stromerzeugung aus fluktuierenden Quellen gewinnt die KWK als regelbare Ergänzung des volatilen erneuerbaren Stromangebots zusätzlich an Bedeutung. Damit trägt KWK zu einer nachhaltigen Energieversorgung und zur Steigerung der Versorgungssicherheit bei. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Beitrag der KWK zur jährlichen Stromerzeugung bis 2020 auf rund 13 TWh zu steigern. Dies entspricht einer Erhöhung des derzeitigen Anteils von 12 auf 20 Prozent. Der dafür notwendige Ausbaupfad ist Kernstück einer vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Studie des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), des Instituts für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und von Dr. Joachim Nitsch, die Anfang 2015 veröffentlicht wurde. Sie ist Grundlage für das vorliegende Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung Baden- Württemberg an dem die KWK-Politik des Landes zukünftig ausgerichtet werden soll. Franz Untersteller MdL Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
4
5 3 Aktueller Stand der KWK in Baden-Württemberg Im Jahr 2013 wurden in Baden-Württemberg rund 7,3 Terawattstunden (TWh/a) KWK-Strom erzeugt. Dies entspricht einem Anteil von rund 12 % an der baden-württembergischen Bruttostromerzeugung. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der KWK-Stromerzeugung von 2003 bis Ein klarer Aufwärtstrend ist daraus nicht ableitbar. Die in den Jahren 2011 und 2012 deutlich gesunkene KWK-Erzeugung im Bereich Allgemeine Versorgung konnte teilweise durch die gesteigerte KWK-Erzeugung im industriellen Sektor sowie im fossilen und biogenen Bereich unter 1 MW ausgeglichen werden. Tendenziell ist in diesem Bereich auch für 2013 ein geringes Wachstum zu verzeichnen. Der Bestand von KWK-Anlagen in Baden- Württemberg beträgt zum Ende des Jahres 2013 rund 3 GWel. Davon entfallen auf Kohle 1,4 GWel, auf Erdgas (einschl. Heizöl) 1,1 GWel und auf Biomasse 0,5 GWel. Die Entwicklung der installierten Leistung ist in Tabelle 1 dargestellt. Abbildung 1: Entwicklung der KWK-Stromerzeugung nach Erzeugungsbereichen und des KWK-Anteils in Baden-Württemberg (2013 vorläufig/geschätzt) % KWK-Nettostromerzeugung, GWh/a % 9 % 6 % 3 % Biomasse < 1 MW Fossile Anlagen < 1 MW Industrie < 1 MW Allgemeine Versorgung Anteil an der Nettostromerzeugung Anteil an der Bruttostromerzeugung 0 0 % Anteil am Bruttostromverbrauch Quellen: StaLa, BAFA, ZSW, DLR, Dr. Nitsch Tabelle 1: Entwicklung der elektrischen Leistung von KWK-Anlagen in Baden-Württemberg (2013 vorläufig/geschätzt) MWel (1) Kohle, sonst (2) Erdgas, (3) Biomassen*) Summe *) einschließlich biogenem Abfall; Sonstige KWKG-Anlagen zu 50 % Biomasse zugeordnet Quellen: StaLa, BAFA, ZSW, DLR, Dr. Nitsch
6 4 Die Entwicklung der Wärmeerzeugung von KWK- Anlagen zeigt hinsichtlich der Gesamtmenge einen ähnlichen Verlauf wie die KWK-Stromerzeugung. Der Anteil der Industrie an der KWK-Wärmenutzung ist jedoch deutlich höher als an der KWK- Stromerzeugung. Dies ist auf den hohen Wärmenutzungsgrad und damit auf eine hohe Brennstoffausnutzung bei industriellen KWK-Anlagen zurückzuführen, die überwiegend auf der Basis des entsprechenden Prozesswärmebedarfs konzipiert wurden. Die Entwicklung der KWK-Nettowärmeerzeugung ist in Tabelle 2 und Abbildung 2 dargestellt. Das gesamte Wärmeaufkommen in 2013 aus KWK-Anlagen beträgt 19 TWh/a. Tabelle 2: Entwicklung der KWK-Wärmeerzeugung in Baden-Württemberg nach Erzeugungsbereichen (2013 vorläufig/geschätzt) [GWh/a] Allg.Versorgung Industrie >1 MW Fossil < 1 MW Biomasse < 1 MW Summe Quellen: StaLa, BAFA, ZSW, DLR, Dr. Nitsch Abbildung 2: Entwicklung der KWK-Wärmeerzeugung in Baden-Württemberg nach Erzeugungsbereichen (2013 vorläufig/geschätzt) KWK-Nettostromerzeugung, GWh/a Biomasse < 1 MW Fossile Anlagen < 1 MW Industrie < 1 MW Allgemeine Versorgung Quellen: StaLa, BAFA, ZSW, DLR, Dr. Nitsch
7 5 Ziele, Ausbaupfad und Akteure Um das im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) festgelegte Ausbauziel für die KWK-Stromerzeugung (rund 20 % der Bruttostromerzeugung) zu erreichen, ist bis Ende 2020 eine Steigerung der installierten KWK-Leistung auf rd. 4,5 GWel und der KWK- Stromerzeugung auf rd. 13 TWh/a erforderlich. Der zugrunde liegende KWK-Ausbaupfad ist ein wesentlicher Baustein zur Erfüllung des CO2-Minderungsziels im IEKK und zur Flexibilisierung der Stromversorgung. Bei der Realisierung des Ausbaupfades bestehen keine potenzialseitigen Restriktionen. Die Stromerzeugung mittels KWK verfügt über große Potenziale, die bisher bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Für Baden-Württemberg wurden diese Potenziale mehrfach untersucht. Zwei Beispiele sind in Abbildung 3 aufgeführt. Zu nennen ist einerseits eine Untersuchung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (DLR/ISI) aus dem Jahre 2002 zur zukünftigen Stromversorgung Baden-Württembergs, in der ein technischstrukturelles Gesamtpotenzial von 26 TWh/a ermittelt wurde. Andererseits ergaben die Analysen in einer Studie des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zur Weiterentwicklung der Energiewirtschaft in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2012 sogar ein Potenzial von rund 37 TWh/a, wobei insbesondere die großen Potenziale in der Industrie auffallen. Die tatsächliche KWK-Stromerzeugung im Jahr 2013 von 7,3 TWh/a ist weit von diesen Potenzialgrenzen entfernt. Die im KWK-Ausbaupfad angesetzten Werte für 2020 sind im Vergleich zu den Potenzialen daher als konservativ zu bewerten. Im Ausbaupfad wächst die KWK-Stromerzeugung auf 13,1 TWh/a in 2020 (Tabelle 3 auf Seite 6). Abbildung 3: KWK-Stromerzeugung in 2013, Potenziale der KWK-Stromerzeugung gemäß Studien des DLR/ISI 2002 und des KIT 2012 und KWK-Beitrag 2020 im Ausbaupfad KWK-Stromerzeugung, TWh/a C: Industrie B: Öffentliche/private Versorgung A: Fernwärme 0 Ist 2013 POT [DLR/ISI 2002] POT [KIT 2012] Quellen: ZSW, DLR, Dr. Nitsch
8 6 Trotz des erheblichen Potenzials ist im letzten Jahrzehnt aufgrund der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen die gesamte KWK- Stromerzeugung im Wesentlichen konstant geblieben. Einem Rückgang der KWK-Stromerzeugung aus Kohle stand ein Anwachsen der KWK- Stromerzeugung aus Gas und insbesondere aus Biomasse gegenüber. Der in Tabelle 3 dargestellte Ausbaupfad stellt daher eine erhebliche Herausforderung dar. Dies wird auch aus Abbildung 4 deutlich. Durchschnittlich muss die jährliche KWK-Stromerzeugung bis Ende 2020 um rund 830 GWh/a gegenüber 2013 zunehmen. Dies entspricht einer jährlichen Zunahme von gut 11 % der gesamten KWK-Erzeugung des Jahres Die bestehenden Ziele zum KWK-Ausbau in Baden-Württemberg wurden im Zuge der Erstellung des IEKK ausgehend von den Bundeszielsetzungen abgeleitet. Eine Änderung der KWK-Ziele auf Bundesebene würde deshalb erfordern, dass die KWK-Landesziele überprüft und ggf. angepasst werden müssen. Die Beibehaltung des 25 %-Ziels auf Bundesebene mit ziel- adäquater Novellierung der KWKG-Förderung ist zwingend erforderlich, um die Zielsetzungen des Landes zum KWK-Ausbau erreichen zu können und den KWK-Ausbau in Baden-Württemberg voranzubringen. Am skizzierten Anstieg der KWK-Stromerzeugung müssen alle Segmente der Kraft-Wärme- Kopplung beteiligt sein. Für die KWK-Erzeugung aus Kohlekraftwerken wird von einer Ausweitung der KWK-Stromerzeugung infolge der Inbetriebnahme der Neukraftwerke in Mannheim (GKM9) und Karlsruhe (RDK8) ausgegangen. GKM9 kann maximal 500 MW th Fernwärme auskoppeln, beim RDK8 sind es 200 MWth. Damit kann die KWK-Stromerzeugung aus Kohle von derzeit rund 12 % an der gesamten Kohlestromerzeugung auf rund 22 % gesteigert werden bei insgesamt leicht zurückgehender Gesamtstromerzeugung aus Kohle. Die äquivalente KWK-Leistung aus Kohle in Baden-Württemberg (ermittelt mit einer mittleren Auslastung von ~ h/a) steigt dadurch von derzeit MW auf gut MW (Tabelle 4). Tabelle 3: Ausbaupfad der KWK-Nettostromerzeugung GWh/a (1) Kohle, sonstige (2) Erdgas, Öl (3) Biomassen Gesamte KWK-Erzeugung Quellen: StaLa, BAFA, ZSW, DLR, Dr. Nitsch Tabelle 4: Wachstum der elektrischen KWK-Leistung im Ausbaupfad [MW el ] (1) Kohle, sonstige (2) Erdgas, Öl (3) Biomassen Gesamte KWK-Leistung Quellen: ZSW, DLR, Dr. Nitsch
9 7 Nach Inbetriebnahme dieser Kraftwerke wird kein weiterer Ausbau der Kohle-KWK mehr angenommen, längerfristig sinkt aus Klimaschutzgründen die gesamte Kohlestromerzeugung im Szenario und damit auch die KWK-Stromerzeugung. Aus Klimaschutz- und Flexibilitätsgründen wird im IEKK angestrebt, das weitere KWK- Wachstum auf effiziente Heizkraftwerke (HKW) und Blockheizkraftwerke (BHKW) zu verlagern, die mit Gas und Biomasse versorgt werden. Um den KWK-Ausbaupfad bis 2020 umzusetzen, müssen die gegenwärtigen Leistungen innerhalb der nächsten Jahre deutlich gesteigert werden. Die entsprechenden erforderlichen jährlichen Nettowachstumsraten belaufen sich zwischen 2013 und 2020 bei gasgefeuerten Anlagen in der Summe über alle Leistungsklassen auf durchschnittlich 105 MW/a und bei Biomasseanlagen auf durchschnittlich 28 MW/a. Bei der Ermittlung der KWK-Leistungen ist tendenziell eine Verringerung der jährlichen Auslastung angenommen, damit KWK-Anlagen den wachsenden Flexibilitätsansprüchen der zukünftigen Stromversorgung gerecht werden können. Abbildung 4: Entwicklung der KWK-Nettostromerzeugung im Ausbaupfad KWK-Nettostromerzeugung, GWh/a Biomassen (einschl. Bioabfall) Erdgas, Öl andere Gase Kohle sonstige Quellen: ZSW, DLR, Dr. Nitsch
10 8 Die Umsetzung des KWK-Ausbaupfads erfordert eine deutliche Steigerung der KWK- Stromerzeugung in allen Bereichen (Fernwärmeversorgung, öffentliche/private Versorgung, Industrie), wie aus Abbildung 5 deutlich wird. Zuwächse finden im Ausbaupfad in allen Leistungsklassen statt, kleinere KWK-Anlagen (< 10 MW) wachsen jedoch deutlich stärker. Neben dem Ausbau von Wärmenetzen sind KWK-Anlagen für die Objektversorgung sowie die industrielle KWK die zweite Säule des Ausbaupfades. Der Zubau von Gas-KWK kann unter der Voraussetzung einer generellen Anpassung des KWKG im Bereich kleinerer Anlagen (< 10 MW) durch Landesmaßnahmen erheblich unterstützt werden. Bei der Biomasse-KWK muss der Schwerpunkt auf der Ausweitung der Wärmenutzung von bestehenden Nicht-KWK-Anlagen liegen (insb. Biogasanlagen). Auch hierbei sind Landesmaßnahmen zielführend (z. B. Wärmenetzförderung). Abbildung 5: Entwicklung der KWK-Stromerzeugung nach drei Bereichen im aktualisierten Ausbaupfad KWK-Nettostromerzeugung, TWh/a Industrie Öffentliche/private Versorgung Fernwärme Quellen: StaLa, ZSW, DLR, Dr. Nitsch
11 9 KWK im Strom- und Wärmemarkt der Zukunft Der Ausbau und die Flexibilisierung der KWK sind aus Sicht der Versorgungssicherheit und des Klimaschutzes sinnvoll. Auch längerfristig bleibt die KWK ein wesentliches Standbein einer zukunftsfähigen Stromund Wärmeversorgung. Hauptaugenmerk kurzfristiger Maßnahmen soll die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der KWK sein, um den Erhalt und weiteren Ausbau von Anlagen sicherzustellen. Mit dem Ausbau dargebotsabhängiger erneuerbarer Energien steigt der Bedarf an Flexibilitäten im Stromsystem. Mittelfristig gewinnen daher die strommarktorientierte Betriebsweise der KWK und die Ausweitung der Systemdienstleistungen für die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien-Einspeisung an Bedeutung. Um die Klimaschutzziele der Landesregierung zu erreichen, muss der Anteil der KWK im Wärmemarkt, sowohl in der Objektversorgung und in der Industrie, als auch in Verbindung mit Wärmenetzen und unter Nutzung von erneuerbaren Energien, stärker wachsen. Über die Wärmegesetze des Bundes und des Landes Baden-Württemberg hinaus gibt es auf wissenschaftlicher Ebene Überlegungen, mit Hilfe des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes erneuerbare Energien besser in den Wärmemarkt einzubinden. Ein Ansatz sieht vor, verstärkt Wärme aus großflächigen Solarthermieanlagen oder geothermische Wärme in Wärmenetzen zu nutzen. Da keine Brennstoffkosten anfallen, bietet dies ein hohes Maß an langfristiger Kostensicherheit für Versorger und Verbraucher. Im Sommer, wenn der Wärmebedarf niedrig ist und ausreichend kostengünstige erneuerbare Energiequellen zur Verfügung stehen, sollte auf eine KWK-Förderung verzichtet und diese ab dem Jahr 2018 auf die Heizperiode konzentriert werden. Damit könnte der künstlich geschaffene Wettbewerb zwischen KWK-Wärme und erneuerbarer Wärme vermieden werden. Aus Sicht der Landesregierung ist die verstärkte Integration der erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung mittel- und längerfristig ein geeigneter Schritt um die Wärmewende kostengünstig, umweltfreundlich und unter Beibehaltung einer hohen Versorgungssicherheit umzusetzen. Aus diesem Grund soll bis zur nächsten Novellierung des KWKG (voraussichtlich in 2017) mit Blick auf den dargestellten Ansatz und weitere entsprechende Überlegungen geprüft werden, inwieweit mit Hilfe dieses Gesetzes erneuerbare Energien besser in den Wärmemarkt eingebunden werden können.
12
13 11 Maßnahmen zum Ausbau der KWK in Baden-Württemberg Im Folgenden werden 17 Maßnahmen beschrieben, mit deren Hilfe die Landesregierung den technologieoffenen Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung im Land voranbringen will. Sie wurden unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der beteiligten Kreise und auf Grundlage der Vorschläge der wissenschaftlichen Studie entwickelt. Für eine erfolgreiche, effiziente und effektive Umsetzung der Landesmaßnahmen ist es unverzichtbar, dass die von der Landesregierung Baden-Württemberg initiierten Maßnahmen von der Branche und den Akteuren mitgetragen und ihre Umsetzung unterstützt wird. Bereits im Zuge der Erstellung der Studie zum Landeskonzept KWK wurde ein Begleitkreis von Experten und Akteuren eingesetzt, mit dem die Maßnahmen diskutiert wurden. Diesen beteiligten Akteuren kommt im Hinblick auf die Umsetzung von Maßnahmen eine wichtige Multiplikatorenrolle zu. Alle Maßnahmen müssen zunächst unter Haushaltsvorbehalt gestellt werden und werden abhängig von der finanziellen Lage des Landes umgesetzt. Die Maßnahmen können in vier Handlungsfelder eingeordnet werden. Die Maßnahmen werden nachfolgend aufgelistet und im Anschluss detailliert beschrieben. BUNDESINITIATIVEN KWK 1: KWKG Novellierung KWK 2: Einsatz für einen funktionierenden Emissionshandel INFORMATION, BERATUNG UND QUALIFIZIERUNG KWK 3: KWK-Informationskampagne auflegen KWK 4: Akteure mobilisieren KWK 5: BHKW-Lotsen zur Unterstützung fördern KWK 6: KWK-Plattform Baden-Württemberg einrichten KWK 7: KWK Qualifizierungsangebot ausbauen KWK 8: Datenbasis für Wärmenetze und KWK-Anlagen verbessern KWK 9: Abwärmepotentiale erheben und im Energieatlas darstellen KWK 10: Wärmesenken ermitteln und im Energieatlas darstellen FÖRDERUNG KWK 11: Impulse für Energienutzungspläne geben KWK 12: Landesförderprogramme weiterentwickeln KWK 13: Landeseigenes Förderprogramm Wärmenetze entwickeln KWK 14: Wettbewerb KWK-Modellkommune durchführen KWK 15: Pilotprojekte für residuallastangepasste KWK-Konzepte fördern VORBILDFUNKTION DES LANDES KWK 16: KWK-Projekte in Landesliegenschaften umsetzen und landeseigene KWK-Maßnahmen stärker öffentlichkeitswirksam präsentieren KWK 17: Prüfung und verstärkter Einsatz von KWK in Landesliegenschaften
14
15 Beschreibung der Maßnahmen im Handlungsfeld Bundesinitiativen 13 KWKG Novellierung KWK 1 Zielgruppe: alle Akteure Bedingt durch die hohe Brennstoffeffizienz ist die KWK eine wichtige Technologie für die Energiewende und das Erreichen der Klimaschutzziele in Baden-Württemberg. Um die in Baden-Württemberg gesteckten Ausbauziele im Bereich der KWK bis 2020 erreichen zu können, ist eine am 25 %-Bundesziel orientierte Novellierung des KWKG unbedingt erforderlich. Die Landesregierung wird sich insbesondere für die folgenden Aspekte bei der KWKG Novellierung einsetzen: Beibehaltung des 25 % KWK-Ziels an der Nettostromerzeugung oder bei Bezug auf die thermischen Anlagen eine entsprechende Anpassung des Ziels Beibehaltung des Förderdesigns Verlängerung der Laufzeit des KWKG auf 2025 Ermöglichen des wirtschaftlichen Betriebs der Bestandsanlagen aller Leistungsklassen ggf. unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs Förderung von Wärmenetzen und Speichern in allen Leistungsklassen, zur weiteren Flexibilisierung des Strommarktes Sicherstellen eines zielorientierten Ausbaus der KWK, ggf. durch angemessene Anhebung des Deckels Einsatz für einen funktionierenden Emissionshandel KWK 2 Zielgruppe: am Strommarkt tätige KWK-Akteure Ein wichtiges Anliegen der Landesregierung ist es, dass die erforderliche Lenkungswirkung des EU-Emissionshandelssystems (ETS) wiederhergestellt wird. Ein funktionierender Emissionshandel (ETS) ist für die Konkurrenzfähigkeit der KWK im Strommarkt von entscheidender Bedeutung. Nur bei einem ausreichend hohen CO2-Preis kann die gasgefeuerte KWK die Effizienzvorteile gegenüber der ungekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung auch in wirtschaftliche Vorteile ummünzen und sich in der Merit- Order direkt hinter den erneuerbaren Energien einordnen. Auch nach Einführung der Marktstabilitätsreserve setzt sich die Landesregierung für entsprechend notwendige strukturelle Verbesserungen beim Emissionshandel ein.
16 14 Beschreibung der Maßnahmen im Handlungsfeld Information, Beratung und Qualifizierung KWK 3 KWK-Informationskampagne auflegen Zielgruppe und Akteure: alle KWK-Akteure Information, Beratung und Unterstützung rund um das Thema KWK ist von größter Wichtigkeit für den Ausbau der KWK in allen Anwendungsbereichen. Eine KWK-Informationskampagne soll zudem ein KWK-Portal beinhalten. Mit einem KWK-Portal sollen alle Aktivitäten, Informationen und KWKrelevante Themen gebündelt präsentiert werden. Das Portal soll als Anlaufstelle für KWK-Interessenten, Betreiber, Hersteller, sowie für die interessierte Öffentlichkeit dienen. KWK 4 Akteure mobilisieren Zielgruppe: Wohnungswirtschaft, Contractoren, Eigentümergemeinschaften Knapp 20 % am Landesbestand von Wohngebäuden sind Mehrfamilienhäuser. Obwohl KWK-Anlagen ausgereift sind und i.d.r. ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb realisiert werden kann, ist das Potenzial für KWK-Anlagen in Mehrfamilienhäusern noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Im Bereich der Mehrfamilienhäuser sind für den Betrieb der Heizungsanlage insbesondere als wichtige Akteure Wohnungsbauunternehmen, Wohnungsbaugenossenschaften, Eigentümergemeinschaften sowie Contractoren zu nennen. Die Landesregierung beabsichtigt Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten von KWK-Anlagen in Einzelobjekten bzw. auch in Kombination mit Wärmenetzen für mehrere Objekte oder Quartiere zu bündeln und dies darzustellen. Dazu bietet sich die KWK-Informationskampagne an. KWK 5 BHKW-Lotsen fördern Zielgruppe und Akteure: Wohneigentümergemeinschaften, Hauseigentümer insb. Besitzer von Mehrfamilienhäusern, EVU (insb. Stadtwerke), Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU), Gewerbe, Handel und Dienstleistung (GHD) Der Informations- und Beratungsbedarf bei der Planung und der Inbetriebnahme von KWK-Anlagen ist bei der Zielgruppe und den Akteuren erheblich. Neben der Erstberatung über die Eignung des Objekts und die Modulauswahl sind vor der Inbetriebnahme und während des ersten Betriebsjahrs spezielle rechtliche und organisatorische Schritte zu berücksichtigen. Die Landesregierung beabsichtigt bei der Realisierung von KWK-Projekten eine Unterstützung durch sogenannte BHKW-Lotsen zu fördern.
17 15 KWK-Plattform Baden-Württemberg einrichten KWK 6 Zielgruppe: Stadtwerke, Energieversorger, Kommunen, Wohnungswirtschaft, GHD, Industrie (KMU) Verbände Die Landesregierung beabsichtigt, eine KWK-Plattform einzurichten, um sowohl zielgruppenspezifisch als auch generell die in Baden-Württemberg relevanten Akteure zu vernetzen. Ein Dialog- und Kooperationsforum mit entsprechenden Workshops, Veranstaltungen, runden Tischen (einschließlich der Initiierung von Veranstaltungen auf regionaler/lokaler Ebene) etc. kann für den Ausbau der KWK einen entscheidenden Beitrag leisten. Eine Verknüpfung der KWK-Plattform mit bestehenden Strukturen soll berücksichtigt werden. KWK Qualifizierungsangebot ausbauen KWK 7 Zielgruppe und Akteure: Regionale Energieagenturen, Handwerk, Planer, Kommunen, Behörden, Akteure der Energie- und Baubranche, Kreditinstitute, Wohnungswirtschaft Für die Umsetzung von KWK-Projekten und die erforderliche Steigerung der Dynamik beim Zubau von KWK-Anlagen ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten umfassend und aktuell über das Thema KWK informiert sind und diese Informationen zielgerichtet weitergeben. Gemeinsam mit Interessenvertretern soll das Qualifizierungsangebot rund um das Thema KWK ausgebaut werden z. B. über die Qualifizierungskampagne Energie aber wie? des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Dabei sollten im Hinblick auf bestehende Angebote von Verbänden, Kammern und Handwerk Synergien genutzt bzw. Überschneidungen vermieden werden. Datenbasis zu Wärmenetzen und KWK-Anlagen verbessern KWK 8 Zielgruppe: Contracting-Unternehmen, Energiegenossenschaften, Kommunen/Stadtwerke, Entsorgungsunternehmen, Stadtwerkeverbünde/Große Energieversorger Zur Beurteilung des Stands der Markteinführung der KWK und der Prognose der zukünftigen Entwicklungen ist eine solide Datenbasis eine grundsätzliche Voraussetzung. Die Landesregierung plant, bestehende Wärmenetze sowie KWK-Anlagen voraussichtlich ab 2016 zu erfassen und im Energieatlas darzustellen. Eine Wärmenetzkarte kann Hinweise für Investoren der Wohnungswirtschaft oder der Kommunalverwaltungen im Hinblick auf die optimale Verzahnung von Gebäudeeffizienzmaßnahmen einerseits und der Art der Wärmeversorgung andererseits liefern. Ausgewählte Beispiele innovativer KWK-Objektversorgungen und industrieller KWK-Nutzungen sollen dazu dienen, die gesamte Bandbreite von KWK-Technologien abzubilden und attraktive Alternativen zu einer KWK-Wärmeversorgung ohne Netze aufzuzeigen. Die Umsetzung der Maßnahme erfordert die Unterstützung der kommunalen Wärmenetzbetreiber und der Wirtschaft.
18 16 KWK 9 Abwärmepotenziale erheben und im Energieatlas darstellen Zielgruppe und Akteure: Unternehmen Im Energieatlas Baden-Württemberg sollen die Abwärmepotenziale dargestellt werden. Es sollen dabei bisher ungenutzte Wärmepotenziale aus industrieller Abwärme systematisch erfasst und geprüft werden, ob regionale Wärmesenken vorhanden sind, die eine Nutzung der Wärme durch Dritte ermöglichen. Damit wird die Maßnahme Nr. 59 des IEKK umgesetzt und für die Maßnahme Nr. 62 des IEKK Erstellung von Wärme- und Kälteplänen eine gute Basis geschaffen, um den Bedarf an Wärme/Kälte mit dem Ort der Erzeugung (Kraftwerksstandorte, industrielle Abwärme, lokale Netze) abgleichen zu können. Die Umsetzung der Maßnahme sowie die Festlegung der wichtigsten Parameter (Mengen, Leistungen und Temperaturniveau) sind ohne die Unterstützung der Wirtschaft nicht möglich. KWK 10 Wärmesenken ermitteln und im Energieatlas darstellen Zielgruppe: Kommunen/Stadtwerke, KMU Informationen zu Wärmesenken können eine sehr wichtige Planungsgrundlage darstellen. Daher sollen Informationen zu Wärmebedarfsdichten auf Grundlage GIS-basierter Daten im Rahmen einer zeitnahen Erweiterung des Energieatlasses Baden-Württemberg (Maßnahme Nr. 62 IEKK) zur Verfügung gestellt werden.
19 Beschreibung der Maßnahmen im Handlungsfeld Förderung 17 Impulse für Energienutzungspläne geben KWK 11 Zielgruppe: Kommunen/Stadtwerke Energienutzungspläne (enthalten auch Wärmenutzungspläne) können wesentlich dazu beitragen, die politischen Akteure vor Ort für effiziente KWK und Wärmenetze, aber auch für Klimaschutz im Allgemeinen zu sensibilisieren. Die Pläne liefern günstige Voraussetzungen für eine gute Projektplanung. Viele Fragen und Probleme, die bei der Ausfertigung von entsprechenden Plänen und Konzepten anfallen, werden dabei in den verschiedenen Kommunen in ähnlicher Form auftreten. Von Seiten des Landes sollen daher Planungshilfen, z. B. in Form von Leitfäden zur Verfügung gestellt werden. Die Landesregierung prüft darüber hinaus eine Bezuschussung von Energienutzungsplänen sowie die Unterstützung von Akteuren über eine Einstiegsberatung, Betreuung und Vernetzung. Weiterentwicklung von Landesförderprogrammen KWK 12 Zielgruppe: Kommunen, KMU, GHD Das etablierte Landesförderprogramm Klimaschutz-Plus wird zeitnah evaluiert und weiterentwickelt im Hinblick auf die Ziele des IEKK insgesamt, einschließlich der KWK-Ziele dieses Landeskonzepts. Angestrebt wird mit Blick auf die KWK eine effektive Förderung, ergänzend zur bereits bestehenden KWK-Förderung durch Bund und Land. Beispielsweise fördert das Programm Klimaschutz mit System seit 2015 vor allem ambitionierte Maßnahmen des kommunalen Klimaschutzes, auf Grundlage eines Klimaschutzkonzeptes bzw. im Rahmen des European Energy Awards (eea). Gefördert werden Maßnahmen, die sich von Standardmaßnahmen unterscheiden. Vorrangig werden deshalb Maßnahmen berücksichtigt, die mit einem Zuschuss aus laufenden Förderprogrammen des Umweltministeriums nicht realisiert werden könnten. Auch Anlagen zur Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung können hier gefördert werden. Eine öffentlichkeitswirksame Präsentation und Evaluierung dieser Landesförderprogramme kann nicht nur die Programme allgemein bekannter machen, sondern darüber hinaus vorbildliche geförderte Projekte präsentieren und damit Anreize zur Nachahmung schaffen. Landeseigenes Förderprogramm für Wärmenetze entwickeln KWK 13 Zielgruppe: Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften, Contracting-Unternehmen, Landesliegenschaften/öffentliche Gebäude, Kommunen/Stadtwerke, Entsorgungsunternehmen, Energiegenossenschaften, Landwirte Das Land plant die Förderung von energieeffizienten Wärmenetzen. Es sollen von der Landesregierung nur Wärmenetze gefördert werden, bei denen grundlegende Effizienzkriterien eingehalten werden. Zusätzliche innovative und effiziente Lösungen sollen über Zuschläge angereizt werden. Dazu zählen niedrige Wärmeverluste, niedrige Rücklauftemperaturen und die Einbeziehung von Abwärme und großer Solarthermie.
20 18 KWK 14 Wettbewerb KWK-Modellkommune durchführen Zielgruppe: Kommunen, aber auch Energiegenossenschaften, Contracting-Unternehmen, Wohnungsunternehmen Ein wesentliches Hemmnis, das auf kommunaler Ebene dem KWK-Ausbau entgegensteht, ist häufig das Fehlen eines geeigneten und sachkundigen verwaltungsinternen Akteurs. Dies trifft in vielen Fällen auf Kommunen ohne eigene Stadtwerke zu. Die Landesregierung beabsichtigt daher einen Wettbewerb KWK-Modellkommunen auszuschreiben, mit dem die Kommunen animiert werden sich mit dem Thema KWK auseinanderzusetzen. Die Preisträger-Kommunen sollen eine Vorbildfunktion für ähnliche Kommunen einnehmen und damit eine wichtige Multiplikatorfunktion erfüllen. KWK 15 Pilotprojekte für residuallastangepasste KWK-Konzepte fördern Zielgruppe: alle Akteure im Bereich der Siedlungs-KWK Um den Betrieb und die Wirkungsweise flexibler, residuallastangepasster KWK-Konzepte auf das Stromsystem zu demonstrieren, will die Landesregierung innovative Pilotprojekte fördern und einem wissenschaftlichen Monitoring unterziehen. Neben virtuellen Kraftwerken mit KWK-Komponenten sind auch hybride KWK-Systeme, wie die Kombination aus BHKW, Wärmepumpe und elektrischem Durchlauferhitzer als Power-to-Heat-Option, insbesondere, wenn sie in einem Nah- oder Fernwärmenetz eingebunden sind, besonders zu betrachten.
21 Beschreibung der Maßnahmen im Handlungsfeld Vorbildfunktion des Landes 19 KWK-Projekte in Landesliegenschaften umsetzen und landeseigene KWK-Maßnahmen stärker öffentlichkeitswirksam präsentieren KWK 16 Zielgruppe: alle Akteure im Bereich der Siedlungs-KWK Im Bereich der landeseigenen Liegenschaften wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche KWK-Anlagen errichtet (von 2000 bis 2012 Zubau von rd. 20 MWel). Weitere Anlagen sind in den kommenden Jahren geplant (Steigerung auf > 80 MWel). Diese Landesaktivitäten können eine Vorbildfunktion für andere Akteure im Bereich der Siedlungs-KWK darstellen. KWK-Leuchtturmprojekte der öffentlichen Hand können darüber hinaus im Hinblick auf nicht alltägliche Anwendungsbereiche eine wichtige Signalwirkung gewährleisten. Zu nennen sind in erster Linie denkmalgeschützte Gebäude bzw. Gebäudekomplexe oder Altstadtquartiere. Die Landesregierung sieht vor, die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Landesaktivitäten im KWK-Bereich sowie KWK-Leuchtturmprojekte zu verstärken. Prüfung und verstärkter Einsatz von KWK in Landesliegenschaften KWK 17 Zielgruppe: alle Akteure im Bereich der Siedlungs-KWK Das Land nimmt seine Vorbildfunktion im Bereich Landesliegenschaften aktiv wahr. Der Einsatz von KWK-Anlagen wird bei allen Landesbaumaßnahmen geprüft. Bei großen Baumaßnahmen werden Energiekonzepte erstellt und im Rahmen der Entscheidung über das Energieversorgungskonzept der KWK-Einsatz geprüft und bei Eignung realisiert. Damit werden einerseits KWK-Anlagen in Landesliegenschaften errichtet, andererseits agiert das Land als Multiplikator. Bei Neubaumaßnahmen und im Zuge der Sanierung von Bestandsgebäuden wird weiterhin geprüft, ob der Einsatz von KWK-Anlagen in Landesliegenschaften durchführbar ist und diese ökonomisch betrieben werden können. Gebäude, die bereits mit Fernwärme oder erneuerbaren Energien versorgt werden bzw. Neubauten in Gebieten mit Fernwärmeversorgung werden dabei berücksichtigt.
22
23
Grüne Wärme für Neubrandenburg
 Grüne Wärme für Neubrandenburg AEE Regionalkonferenz Rostock, 29.06.2018 Ingo Meyer Vorsitzender der Geschäftsführung Neubrandenburger Stadtwerke GmbH CO 2 Emissionen Kyoto Protokoll: 20 Reduzierung der
Grüne Wärme für Neubrandenburg AEE Regionalkonferenz Rostock, 29.06.2018 Ingo Meyer Vorsitzender der Geschäftsführung Neubrandenburger Stadtwerke GmbH CO 2 Emissionen Kyoto Protokoll: 20 Reduzierung der
Strom 2030 Berichte aus den Arbeitsgruppen. Berlin, 20. März 2017
 Strom 2030 Berichte aus den Arbeitsgruppen Berlin, 20. März 2017 Trend 1 Fluktuierende Stromerzeugung aus Wind und Sonne prägt das System Anteil von Wind- und Sonne an Stromproduktion steigt Anteil von
Strom 2030 Berichte aus den Arbeitsgruppen Berlin, 20. März 2017 Trend 1 Fluktuierende Stromerzeugung aus Wind und Sonne prägt das System Anteil von Wind- und Sonne an Stromproduktion steigt Anteil von
Förderung Energieeffizienter Wärmenetze
 Kommunaler Klimaschutzkongress Baden-Württemberg 2017 Förderung Energieeffizienter Wärmenetze Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat 64 Referat für erneuerbare
Kommunaler Klimaschutzkongress Baden-Württemberg 2017 Förderung Energieeffizienter Wärmenetze Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat 64 Referat für erneuerbare
Perspektive Biogas für das Land Baden-Württemberg/Deutschland Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
 für das Land Baden-Württemberg/Deutschland Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Aktueller Stand Biogasanlagen Folie 2 Entwicklung
für das Land Baden-Württemberg/Deutschland Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Aktueller Stand Biogasanlagen Folie 2 Entwicklung
Stromerzeugung aus Biomasse Nachhaltige Nutzung von Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung. FVS-Workshop Systemanalyse im FVS
 FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein
 Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
UFOPLAN-Forschungsvorhaben KWK-Ausbau
 UFOPLAN-Forschungsvorhaben KWK-Ausbau Workshop Klimaschutz und KWK-Ausbau 02.04.2012 Berlin Sven Schneider Umweltbundesamt FG I 2.5 Energieversorgung und -daten Wesentliche mit KWK befasste Fachgebiete
UFOPLAN-Forschungsvorhaben KWK-Ausbau Workshop Klimaschutz und KWK-Ausbau 02.04.2012 Berlin Sven Schneider Umweltbundesamt FG I 2.5 Energieversorgung und -daten Wesentliche mit KWK befasste Fachgebiete
Aktueller Stand und Perspektiven der Energiewende in Baden-Württemberg
 Aktueller Stand und Perspektiven der Energiewende in Baden-Württemberg Veranstaltung von GLS-Bank Stuttgart, KUS Stuttgart und solarcomplex Singen 25. März 215 Dr. Ing. Joachim Nitsch, Stuttgart Aktueller
Aktueller Stand und Perspektiven der Energiewende in Baden-Württemberg Veranstaltung von GLS-Bank Stuttgart, KUS Stuttgart und solarcomplex Singen 25. März 215 Dr. Ing. Joachim Nitsch, Stuttgart Aktueller
ENERGIEPOLITIK DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG
 ENERGIEPOLITIK DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG Voller Energie 2013 Eckpunkte der Energiepolitik sichere Energieversorgung Beteiligung und Wertschöpfung angemessene Preise und Wirtschaftlichkeit Eckpunkte
ENERGIEPOLITIK DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG Voller Energie 2013 Eckpunkte der Energiepolitik sichere Energieversorgung Beteiligung und Wertschöpfung angemessene Preise und Wirtschaftlichkeit Eckpunkte
Regenerative Energien Chancen für Nordbaden
 Öffentliche Fraktionssitzung 14. Oktober 2011, Baden-Baden Regenerative Energien Chancen für Nordbaden Dipl.-Wirt.-Ing. Maike Schmidt Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Öffentliche Fraktionssitzung 14. Oktober 2011, Baden-Baden Regenerative Energien Chancen für Nordbaden Dipl.-Wirt.-Ing. Maike Schmidt Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Kißlegg
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Kißlegg Aufgestellt im Dezember 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Kißlegg Aufgestellt im Dezember 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Eine Zukunft ohne Kohle Notwendige Weichenstellungen für die Energiepolitik Deutschlands
 Eine Zukunft ohne Kohle Notwendige Weichenstellungen für die Energiepolitik Deutschlands Tagung Mit Kohle in die Zukunft? Königswinter 21. -22. Juni 213 Dr. Joachim Nitsch Energiepolitische Zielsetzungen
Eine Zukunft ohne Kohle Notwendige Weichenstellungen für die Energiepolitik Deutschlands Tagung Mit Kohle in die Zukunft? Königswinter 21. -22. Juni 213 Dr. Joachim Nitsch Energiepolitische Zielsetzungen
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Perspektiven der öffentlichen Kraft-Wärme/Kälte- Kopplung (KWKK) in Österreich. Marcus Koepp Wien 26. November 2014
 Perspektiven der öffentlichen Kraft-Wärme/Kälte- Kopplung (KWKK) in Österreich Marcus Koepp Wien 26. November 2014 Die KWK leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromund Wärmeerzeugung in Österreich
Perspektiven der öffentlichen Kraft-Wärme/Kälte- Kopplung (KWKK) in Österreich Marcus Koepp Wien 26. November 2014 Die KWK leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromund Wärmeerzeugung in Österreich
Energiewende Nordhessen
 Energiewende Nordhessen Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes Stand 12. November 2013 Dr. Thorsten Ebert, Vorstand Städtische Werke AG Energiewende Nordhessen:
Energiewende Nordhessen Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes Stand 12. November 2013 Dr. Thorsten Ebert, Vorstand Städtische Werke AG Energiewende Nordhessen:
Wärmenetze als Rückgrat einer nachhaltigen Wärmeversorgung
 Wärmenetze als Rückgrat einer nachhaltigen Wärmeversorgung Vortrag auf den Berliner Energietagen im Rahmen des Fachforums E.11 Infrastruktur der Energiewende Uwe Leprich Institut für ZukunftsEnergieSysteme
Wärmenetze als Rückgrat einer nachhaltigen Wärmeversorgung Vortrag auf den Berliner Energietagen im Rahmen des Fachforums E.11 Infrastruktur der Energiewende Uwe Leprich Institut für ZukunftsEnergieSysteme
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr Bielefeld Telefon: 0521/ Fax: 0521/
 Klimaschutzkonzept Remscheid Arbeitsgruppe Kraft-Wärme-Kopplung und Innovative Technologien 18.03.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Klimaschutzkonzept Remscheid Arbeitsgruppe Kraft-Wärme-Kopplung und Innovative Technologien 18.03.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
ENERGIEPOLITIK DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG
 ENERGIEPOLITIK DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG Voller Energie 2013 Eckpunkte der Energiepolitik sichere Energieversorgung Beteiligung und Wertschöpfung angemessene Preise und Wirtschaftlichkeit Eckpunkte
ENERGIEPOLITIK DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG Voller Energie 2013 Eckpunkte der Energiepolitik sichere Energieversorgung Beteiligung und Wertschöpfung angemessene Preise und Wirtschaftlichkeit Eckpunkte
Weiterer Ausbau der ökologischen Wärmeerzeugung im Heizwerk Grünäcker
 Pressemitteilung vom 31.03.2017 Stadtwerke Sindelfingen investieren in ein neues BHKW-Modul Weiterer Ausbau der ökologischen Wärmeerzeugung im Heizwerk Grünäcker Zum Jahresbeginn 2017 haben die Stadtwerke
Pressemitteilung vom 31.03.2017 Stadtwerke Sindelfingen investieren in ein neues BHKW-Modul Weiterer Ausbau der ökologischen Wärmeerzeugung im Heizwerk Grünäcker Zum Jahresbeginn 2017 haben die Stadtwerke
Dekarbonisierung der netzgebundenen Wärmeversorgung KWK in einem Energiesystem mit hohem EE-Anteil Zukunft und Rolle der KWK in der Wärmewende
 Dekarbonisierung der netzgebundenen Wärmeversorgung KWK in einem Energiesystem mit hohem EE-Anteil Zukunft und Rolle der KWK in der Wärmewende Marco Wünsch Würzburg, 27. November 2018 KWK-Stromerzeugung
Dekarbonisierung der netzgebundenen Wärmeversorgung KWK in einem Energiesystem mit hohem EE-Anteil Zukunft und Rolle der KWK in der Wärmewende Marco Wünsch Würzburg, 27. November 2018 KWK-Stromerzeugung
Projektskizze: Pilotprojekt Demand-Side-Management Bayern. Potenziale erkennen Märkte schaffen Energiewende gestalten Klima schützen.
 Projektskizze: Pilotprojekt Demand-Side-Management Bayern. Potenziale erkennen Märkte schaffen Energiewende gestalten Klima schützen. Deutsche Energie-Agentur (dena) Bereich Energiesysteme und Energiedienstleistungen
Projektskizze: Pilotprojekt Demand-Side-Management Bayern. Potenziale erkennen Märkte schaffen Energiewende gestalten Klima schützen. Deutsche Energie-Agentur (dena) Bereich Energiesysteme und Energiedienstleistungen
ABWÄRME IN KOMMUNALEN WÄRMENETZEN AUS SICHT KOMMUNALER UNTERNEHMEN
 ABWÄRME IN KOMMUNALEN WÄRMENETZEN AUS SICHT KOMMUNALER UNTERNEHMEN Berlin, 7. November 2017 Erkenntnis für Klimaschutz ist global vorhanden. Rahmen für Klimaschutz. Ziele: Pariser Abkommen 2015, u. a.
ABWÄRME IN KOMMUNALEN WÄRMENETZEN AUS SICHT KOMMUNALER UNTERNEHMEN Berlin, 7. November 2017 Erkenntnis für Klimaschutz ist global vorhanden. Rahmen für Klimaschutz. Ziele: Pariser Abkommen 2015, u. a.
Wir sorgen für sichere Energie.
 Wir sorgen für sichere Energie. lokal. regional. international. 1.186 MWth Anschluss-Leistung 527 MWel Anschluss-Leistung Wir sind STEAG New Energies Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral, hoch
Wir sorgen für sichere Energie. lokal. regional. international. 1.186 MWth Anschluss-Leistung 527 MWel Anschluss-Leistung Wir sind STEAG New Energies Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral, hoch
Zur Rolle des Erdgases in der Transformation der Energiesysteme Stützpfeiler oder Auslaufmodell?
 Für Mensch & Umwelt 3. VKU-GASKONFERENZ Zur Rolle des Erdgases in der Transformation der Energiesysteme Stützpfeiler oder Auslaufmodell? Prof. Dr. Uwe Leprich Leiter der Abteilung I 2 Klimaschutz und Energie
Für Mensch & Umwelt 3. VKU-GASKONFERENZ Zur Rolle des Erdgases in der Transformation der Energiesysteme Stützpfeiler oder Auslaufmodell? Prof. Dr. Uwe Leprich Leiter der Abteilung I 2 Klimaschutz und Energie
Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung KWK konkret: Die Novellierung des KWK-G. Berlin, 07. Mai 2015
 Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung KWK konkret: Die Novellierung des KWK-G Berlin, 07. Mai 2015 Aktuelle Situation der KWK Die KWK erzeugt heute rund 96 TWh Strom. Der Anteil der
Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung KWK konkret: Die Novellierung des KWK-G Berlin, 07. Mai 2015 Aktuelle Situation der KWK Die KWK erzeugt heute rund 96 TWh Strom. Der Anteil der
Bedeutung der KWK in der BMU-Leitstudie sowie im Klimaschutzkonzept des Landes Baden-Württemberg
 Bedeutung der KWK in der BMU-Leitstudie sowie im Klimaschutzkonzept des Landes Baden-Württemberg Tagung: Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung - in der zukünftigen Energieversorgung Solar Info Center Freiburg,
Bedeutung der KWK in der BMU-Leitstudie sowie im Klimaschutzkonzept des Landes Baden-Württemberg Tagung: Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung - in der zukünftigen Energieversorgung Solar Info Center Freiburg,
Auswertungstabellen zur Energiebilanz Deutschland bis 2013
 ARBEITSGEMEINSCHAFT ENERGIEBILANZEN e.v. Auswertungstabellen zur Energiebilanz Deutschland 1990 bis 2013 Stand: August 2014 Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen bearbeitet von: Energy Environment
ARBEITSGEMEINSCHAFT ENERGIEBILANZEN e.v. Auswertungstabellen zur Energiebilanz Deutschland 1990 bis 2013 Stand: August 2014 Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen bearbeitet von: Energy Environment
Wärmewende Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor.
 Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor Matthias Deutsch BERLIN, 4. MAI 2017 Wärmewende 2030 Auftragnehmer: Fraunhofer IWES
Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor Matthias Deutsch BERLIN, 4. MAI 2017 Wärmewende 2030 Auftragnehmer: Fraunhofer IWES
BEDEUTUNG DER FERNWÄRME FÜR KOMMUNALE STADTWERKE
 BEDEUTUNG DER FERNWÄRME FÜR KOMMUNALE STADTWERKE Düsseldorf, 28.04.2016 Wärmemarkt ist bedeutend. Marktvolumen im Wärmemarkt. 1.200 /a 29% 1.000 /a Gesamt 2.500 TWh 51% 500 /a 300 /a 20% Wärme Strom Verkehr
BEDEUTUNG DER FERNWÄRME FÜR KOMMUNALE STADTWERKE Düsseldorf, 28.04.2016 Wärmemarkt ist bedeutend. Marktvolumen im Wärmemarkt. 1.200 /a 29% 1.000 /a Gesamt 2.500 TWh 51% 500 /a 300 /a 20% Wärme Strom Verkehr
Einführung eines Klimazuschlages zur Erreichung der KWK-Ausbauziele und der THG-Minderungsziele
 Einführung eines Klimazuschlages zur Erreichung der KWK-Ausbauziele und der THG-Minderungsziele 06/2015 Biogasrat + e.v. - dezentrale energien Mittelstraße 55 10117 Berlin Tel. 030 206 218 100 Fax: 030
Einführung eines Klimazuschlages zur Erreichung der KWK-Ausbauziele und der THG-Minderungsziele 06/2015 Biogasrat + e.v. - dezentrale energien Mittelstraße 55 10117 Berlin Tel. 030 206 218 100 Fax: 030
Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der Energiewende
 Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der Energiewende Dr. Patrick Graichen 23. APRIL 2015 Kraft-Wärme-Kopplung und ihre Förderung Worum geht es? > Mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) lassen sich Primärenergieträger
Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der Energiewende Dr. Patrick Graichen 23. APRIL 2015 Kraft-Wärme-Kopplung und ihre Förderung Worum geht es? > Mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) lassen sich Primärenergieträger
Kraft-Wärme-Kopplung: was verbirgt sich dahinter?
 Kraft-Wärme-Kopplung: was verbirgt sich dahinter? Dr. Bernd Eikmeier 1 Das Bremer Energie Institut Unabhängiges Institut zur Forschung im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung 1990 auf Initiative
Kraft-Wärme-Kopplung: was verbirgt sich dahinter? Dr. Bernd Eikmeier 1 Das Bremer Energie Institut Unabhängiges Institut zur Forschung im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung 1990 auf Initiative
Studien auf regionale/lokaler Ebene und Zwischenbilanz
 Studien auf regionale/lokaler Ebene und Zwischenbilanz Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der zukünftigen Energieversorgung Freiburg, 21.03.2013 Dipl. Ing. Christian Neumann Energieagentur Regio Freiburg
Studien auf regionale/lokaler Ebene und Zwischenbilanz Die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung in der zukünftigen Energieversorgung Freiburg, 21.03.2013 Dipl. Ing. Christian Neumann Energieagentur Regio Freiburg
Status quo und Zukunft der Wärmeversorgung in Bautzen
 Status quo und Zukunft der Wärmeversorgung in Bautzen Inhalt 1. Umweltpolitische Ziele 2. Wärmeversorgung in Bautzen 3. Umweltrelevante Ergebnisse 4. Aussichten und Ausbau der Wärmeerzeugung 5. Zukünftige
Status quo und Zukunft der Wärmeversorgung in Bautzen Inhalt 1. Umweltpolitische Ziele 2. Wärmeversorgung in Bautzen 3. Umweltrelevante Ergebnisse 4. Aussichten und Ausbau der Wärmeerzeugung 5. Zukünftige
MIKRO- KWK- PARTNER- BONUS.
 BONUS PROGRAMME MIKRO- KWK- PARTNER- BONUS. Brennstoffzellen im Contracting. Zentraler Baustein der Energiewende: Kraft-Wärme-Kopplung. Die Bundesregierung verfolgt das Klimaziel, bis 2020 die CO 2 -Emissionen
BONUS PROGRAMME MIKRO- KWK- PARTNER- BONUS. Brennstoffzellen im Contracting. Zentraler Baustein der Energiewende: Kraft-Wärme-Kopplung. Die Bundesregierung verfolgt das Klimaziel, bis 2020 die CO 2 -Emissionen
Wärmewende Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor.
 Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor Matthias Deutsch GRAZ, 16. MAI 2017 Wärmewende 2030 Auftragnehmer: Fraunhofer IWES und
Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor Matthias Deutsch GRAZ, 16. MAI 2017 Wärmewende 2030 Auftragnehmer: Fraunhofer IWES und
Die Wohnungswirtschaft Deutschland
 7. Göttinger Tagung zu aktuellen Fragen zur Entwicklung der Energieversorgungsnetze 28. 29. April 2015 Fachforum 2: Energiekonzepte der Wohnungswirtschaft Energieversorgung außerhalb des allgemeinen Energiesystems?
7. Göttinger Tagung zu aktuellen Fragen zur Entwicklung der Energieversorgungsnetze 28. 29. April 2015 Fachforum 2: Energiekonzepte der Wohnungswirtschaft Energieversorgung außerhalb des allgemeinen Energiesystems?
Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel-und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor
 Fraunhofer IWES Energiesystemtechnik Norman Gerhardt Berlin, 15. Februar 2017 Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel-und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor Inhalt
Fraunhofer IWES Energiesystemtechnik Norman Gerhardt Berlin, 15. Februar 2017 Wärmewende 2030 Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel-und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor Inhalt
Wärmeinitiative Bad Säckingen. Richtlinie. zum Förderprogramm - Wärmeinitiative Bad Säckingen. Stand
 Wärmeinitiative Bad Säckingen Richtlinie zum Förderprogramm - Wärmeinitiative Bad Säckingen Stand 27.06.2016 gefördert durch das Umweltministerium Baden-Württemberg 2 INHALT 1 Hintergrund und Zweck der
Wärmeinitiative Bad Säckingen Richtlinie zum Förderprogramm - Wärmeinitiative Bad Säckingen Stand 27.06.2016 gefördert durch das Umweltministerium Baden-Württemberg 2 INHALT 1 Hintergrund und Zweck der
Energierahmenstrategie Wien 2030
 // Energierahmenstrategie Wien 2030 Eckpunkte der Energiestrategie der Stadt Wien (Teil 1) Herbert Pöschl 22.05.2017 Global Energy Consumption in Mtoe // Energiestrategie Umfeld Europäisches Umfeld Um
// Energierahmenstrategie Wien 2030 Eckpunkte der Energiestrategie der Stadt Wien (Teil 1) Herbert Pöschl 22.05.2017 Global Energy Consumption in Mtoe // Energiestrategie Umfeld Europäisches Umfeld Um
Förderung Energieeffizienter Wärmenetze - Inhalte und Zwischenbilanz der Förderrichtlinie
 Förderung Energieeffizienter Wärmenetze - Inhalte und Zwischenbilanz der Förderrichtlinie Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat 64 Referat für erneuerbare
Förderung Energieeffizienter Wärmenetze - Inhalte und Zwischenbilanz der Förderrichtlinie Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat 64 Referat für erneuerbare
Entwicklungen beim Wärmenetzausbau und -betrieb
 Entwicklungen beim Wärmenetzausbau und -betrieb Michael Nast, Evelyn Sperber DLR, Stuttgart Institut für Technische Thermodynamik VDI Fachkonferenz Thermische Energiespeicher in der Energieversorgung Ludwigsburg,
Entwicklungen beim Wärmenetzausbau und -betrieb Michael Nast, Evelyn Sperber DLR, Stuttgart Institut für Technische Thermodynamik VDI Fachkonferenz Thermische Energiespeicher in der Energieversorgung Ludwigsburg,
Schulungsunterlagen für Energieberaterseminare. KWK-Leitfaden für Energieberater. www.asue.de 1
 Schulungsunterlagen für Energieberaterseminare KWK-Leitfaden für Energieberater www.asue.de 1 Vorwort Auf dem Weg zu einer neuen, emissionsarmen Energieversorgung werden die konventionellen Energieträger
Schulungsunterlagen für Energieberaterseminare KWK-Leitfaden für Energieberater www.asue.de 1 Vorwort Auf dem Weg zu einer neuen, emissionsarmen Energieversorgung werden die konventionellen Energieträger
Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg
 Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Was ist ein Bioenergiedorf? Eine allgemeingültige Definition
Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Was ist ein Bioenergiedorf? Eine allgemeingültige Definition
Dezentrale Energieversorgung, aber wie? Herten, Thorsten Rattmann, GF Hertener Stadtwerke
 Dezentrale Energieversorgung, aber wie? Herten, 29.10.2015 Thorsten Rattmann, GF Hertener Stadtwerke Digitalisierung / Dezentralisierung Der nächste große Umbruch in der Energiewirtschaft Wettbewerb 1994
Dezentrale Energieversorgung, aber wie? Herten, 29.10.2015 Thorsten Rattmann, GF Hertener Stadtwerke Digitalisierung / Dezentralisierung Der nächste große Umbruch in der Energiewirtschaft Wettbewerb 1994
Kommunale Wärmeplanung Lothar Nolte 1
 Kommunale Wärmeplanung 15.08.2018 Lothar Nolte 1 Hintergrund Anteil Niedertemperaturwärme (T
Kommunale Wärmeplanung 15.08.2018 Lothar Nolte 1 Hintergrund Anteil Niedertemperaturwärme (T
Umsetzung und Finanzierung von Vorhaben aus Energie-, Quartiers- und Klimaschutzkonzepten für Kommunen
 Umsetzung und Finanzierung von Vorhaben aus Energie-, Quartiers- und Klimaschutzkonzepten für Kommunen ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Cleantech-Jahreskonferenz 2015 Dr. Uwe Mixdorf,
Umsetzung und Finanzierung von Vorhaben aus Energie-, Quartiers- und Klimaschutzkonzepten für Kommunen ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Cleantech-Jahreskonferenz 2015 Dr. Uwe Mixdorf,
Impulsvortrag. Die Energiewende im Land ist eingeläutet. Wo stehen wir bei Kraft und Wärme in der Kommune?
 Impulsvortrag Die Energiewende im Land ist eingeläutet. Wo stehen wir bei Kraft und Wärme in der Kommune? Bürgermeister Alexander Uhlig Stadt Pforzheim erneuerbare Energien Klimaschutzprofil Stadt Pforzheim
Impulsvortrag Die Energiewende im Land ist eingeläutet. Wo stehen wir bei Kraft und Wärme in der Kommune? Bürgermeister Alexander Uhlig Stadt Pforzheim erneuerbare Energien Klimaschutzprofil Stadt Pforzheim
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg Aufgestellt im Mai 2012, Stand 31.12.2010 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes, Landes
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg Aufgestellt im Mai 2012, Stand 31.12.2010 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes, Landes
ASUE-Effizienzdialog 04. März 2010 Die Strom erzeugende Heizung: Status Quo und Technologieperspektiven
 ASUE-Effizienzdialog 04. März 2010 Die Strom erzeugende Heizung: Status Quo und Technologieperspektiven Dr. Guido Bruch Geschäftsführer ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch
ASUE-Effizienzdialog 04. März 2010 Die Strom erzeugende Heizung: Status Quo und Technologieperspektiven Dr. Guido Bruch Geschäftsführer ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch
Gesamtenergiekonzept der Stadt Ludwigsburg Zwischenergebnis und mögliche Konsequenzen
 Gesamtenergiekonzept der Stadt Ludwigsburg Zwischenergebnis und mögliche Konsequenzen Anja Wenninger Referat Nachhaltige Stadtentwicklung, Stadt Ludwigsburg Informationsveranstaltung Abwasserwärmenutzung
Gesamtenergiekonzept der Stadt Ludwigsburg Zwischenergebnis und mögliche Konsequenzen Anja Wenninger Referat Nachhaltige Stadtentwicklung, Stadt Ludwigsburg Informationsveranstaltung Abwasserwärmenutzung
Die Rolle des Berliner Wärmemarkts im Kontext des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) 2030
 polidia GmbH Die Rolle des Berliner Wärmemarkts im Kontext des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) 2030 Lothar Stock, Leiter des Sonderreferats Klimaschutz und Energie der Senatsverwaltung
polidia GmbH Die Rolle des Berliner Wärmemarkts im Kontext des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) 2030 Lothar Stock, Leiter des Sonderreferats Klimaschutz und Energie der Senatsverwaltung
Energiebericht Gesamtbetrachtung der Kreisgebäude. Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 Energiebericht 2017 Gesamtbetrachtung der Kreisgebäude Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft Oktober 2017 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einführung 3 2 Gesamtentwicklung bei Verbrauch und Kosten 3
Energiebericht 2017 Gesamtbetrachtung der Kreisgebäude Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft Oktober 2017 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einführung 3 2 Gesamtentwicklung bei Verbrauch und Kosten 3
Energienutzungsplan für die Gemeinde Chieming
 Energienutzungsplan für die Gemeinde Chieming Wege zur Umsetzung der Energiewende K.GREENTECH GmbH Lindwurmstraße 122-124 80337 München Tel.: +49 (0) 89 550 5690-10 www.k-greentech.de 0 MWh 1. Zusammenfassung
Energienutzungsplan für die Gemeinde Chieming Wege zur Umsetzung der Energiewende K.GREENTECH GmbH Lindwurmstraße 122-124 80337 München Tel.: +49 (0) 89 550 5690-10 www.k-greentech.de 0 MWh 1. Zusammenfassung
Erneuerbare Energien 2017
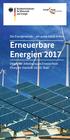 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Guter Rat zum EEWärmeG
 Vorlage 1 04/2012 Viessmann Werke Guter Rat zum EEWärmeG Handlungsbedarfe und Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Praxis Manfred Greis Vorlage 2 04/2012 Viessmann Werke Anteile Energieträger und Verbraucher
Vorlage 1 04/2012 Viessmann Werke Guter Rat zum EEWärmeG Handlungsbedarfe und Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Praxis Manfred Greis Vorlage 2 04/2012 Viessmann Werke Anteile Energieträger und Verbraucher
Wirtschaftsförderung Konstanz. Die Energieversorgung der Zukunft und was Kommunen dazu beitragen können
 Wirtschaftsförderung Konstanz Die Energieversorgung der Zukunft und was Kommunen dazu beitragen können Energieversorgung der Zukunft was bedeutet das? Ziel: weitgehende Treibhausgasneutralität in allen
Wirtschaftsförderung Konstanz Die Energieversorgung der Zukunft und was Kommunen dazu beitragen können Energieversorgung der Zukunft was bedeutet das? Ziel: weitgehende Treibhausgasneutralität in allen
Das Regionenmodell Basis detaillierter Analysen von Energieversorgungskonzepten
 Das Regionenmodell Basis detaillierter Analysen von Energieversorgungskonzepten 42. Kraftwerkstechnisches Kolloquium 12. und 13. Oktober 2010 Dipl.-Phys. Tobias Schmid Dipl.-Ing. Michael Beer 1 Forschungsstelle
Das Regionenmodell Basis detaillierter Analysen von Energieversorgungskonzepten 42. Kraftwerkstechnisches Kolloquium 12. und 13. Oktober 2010 Dipl.-Phys. Tobias Schmid Dipl.-Ing. Michael Beer 1 Forschungsstelle
Energiewende Kreis Groß Gerau. Strategische Handlungsschwerpunkte
 Energiewende Kreis Groß Gerau Strategische Handlungsschwerpunkte Fachbereich Wirtschaft und Energie III/2 Straßer März 2016 Energiewende Kreis Groß Gerau Der Kreistag des Kreises Groß Gerau hat im Frühjahr
Energiewende Kreis Groß Gerau Strategische Handlungsschwerpunkte Fachbereich Wirtschaft und Energie III/2 Straßer März 2016 Energiewende Kreis Groß Gerau Der Kreistag des Kreises Groß Gerau hat im Frühjahr
Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele?
 Hannes Seidl Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele? 9. Mai 2012, Berlin 1 Energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Senkung des Primärenergieverbrauchs
Hannes Seidl Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele? 9. Mai 2012, Berlin 1 Energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Senkung des Primärenergieverbrauchs
STADT KLIMA ENERGIE. Integrierte Stadtentwicklung in Gotha. Klaus Schmitz-Gielsdorf, Bürgermeister der Stadt Gotha
 STADT KLIMA ENERGIE Integrierte Stadtentwicklung in Gotha Klaus Schmitz-Gielsdorf, Bürgermeister der Stadt Gotha Stadtentwicklung und Klimaschutz Energetische Quartiersentwicklung Bahnhofsquartier Klimaschutz
STADT KLIMA ENERGIE Integrierte Stadtentwicklung in Gotha Klaus Schmitz-Gielsdorf, Bürgermeister der Stadt Gotha Stadtentwicklung und Klimaschutz Energetische Quartiersentwicklung Bahnhofsquartier Klimaschutz
Die grüne Brücke 2050 Gemeinsam den Weg in die neue Energiewelt gestalten.
 Die grüne Brücke 2050 Gemeinsam den Weg in die neue Energiewelt gestalten. Mitten im Leben. Klimaschutz gestalten für die Menschen in Düsseldorf. Der Weg hin zur Energieerzeugung auf Basis regenerativer
Die grüne Brücke 2050 Gemeinsam den Weg in die neue Energiewelt gestalten. Mitten im Leben. Klimaschutz gestalten für die Menschen in Düsseldorf. Der Weg hin zur Energieerzeugung auf Basis regenerativer
Initiative energie 2010 Wärme mit Zukunft
 Initiative energie 2010 Wärme mit Zukunft Klimaschutz in aller Munde Grund für die zunehmende Erderwärmung ist vor allem der hohe Ausstoß von Kohlendioxid, der zu einer Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes
Initiative energie 2010 Wärme mit Zukunft Klimaschutz in aller Munde Grund für die zunehmende Erderwärmung ist vor allem der hohe Ausstoß von Kohlendioxid, der zu einer Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes
Regionaler Dialog Energiewende
 Regionaler Dialog Energiewende Gemeinsam auf den Weg machen zur EnergieRegion Aachen 2030 21. August 2014, Energiebeirat Stadt Aachen Energiewende Ausbau EE kann zu einer deutlichen Veränderung der verschiedenen
Regionaler Dialog Energiewende Gemeinsam auf den Weg machen zur EnergieRegion Aachen 2030 21. August 2014, Energiebeirat Stadt Aachen Energiewende Ausbau EE kann zu einer deutlichen Veränderung der verschiedenen
Stadtwerke Sindelfingen erweitern das Fernwärmenetz in Maichingen
 Pressemitteilung vom 13.12.2012 Stadtwerke Sindelfingen erweitern das Fernwärmenetz in Maichingen Das erweiterte Heizkraftwerk Grünäcker liefert zukünftig noch mehr Ökowärme zum Heizen Seit August 2012
Pressemitteilung vom 13.12.2012 Stadtwerke Sindelfingen erweitern das Fernwärmenetz in Maichingen Das erweiterte Heizkraftwerk Grünäcker liefert zukünftig noch mehr Ökowärme zum Heizen Seit August 2012
ENERGIEWIRTSCHAFT der ZUKUNFT
 Die starke STIMME für die ENERGIEWIRTSCHAFT der ZUKUNFT Grußwort Liebe Leserin, lieber Leser, wir befinden uns mitten im Umbau unserer Energieversorgung: Die alten Energieträger Kohle, Öl, Gas und Uran
Die starke STIMME für die ENERGIEWIRTSCHAFT der ZUKUNFT Grußwort Liebe Leserin, lieber Leser, wir befinden uns mitten im Umbau unserer Energieversorgung: Die alten Energieträger Kohle, Öl, Gas und Uran
Braucht CO 2 seinen Preis?
 Braucht CO 2 seinen Preis? 23. März 2017, Berlin, Steigenberger Hotel Am Kanzleramt Udo Wichert Präsident des AGFW und Sprecher der Geschäftsführung der STEAG Fernwärme GmbH AGFW - Die Wärmesystemexperten
Braucht CO 2 seinen Preis? 23. März 2017, Berlin, Steigenberger Hotel Am Kanzleramt Udo Wichert Präsident des AGFW und Sprecher der Geschäftsführung der STEAG Fernwärme GmbH AGFW - Die Wärmesystemexperten
Ergebnisse des Forschungsberichtes zur Zwischenüberprüfung der KWK-G
 Michael Geißler Berliner Energieagentur GmbH Friedrich Seefeldt Prognos AG Workshop Klimaschutz und KWK-Ausbau Berlin, 16.11.2011 Als Einführung Die Ergebnisse im Überblick Das Wachstum der KWK war in
Michael Geißler Berliner Energieagentur GmbH Friedrich Seefeldt Prognos AG Workshop Klimaschutz und KWK-Ausbau Berlin, 16.11.2011 Als Einführung Die Ergebnisse im Überblick Das Wachstum der KWK war in
Mieterstrom und Solaroffensive Baden-Württemberg
 Mieterstrom und Solaroffensive Baden-Württemberg Dr. Till Jenssen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Referat 64 Erneuerbare Energien Energie Szenario BW 2050 Quelle: ZSW 2015 Quelle: IEKK
Mieterstrom und Solaroffensive Baden-Württemberg Dr. Till Jenssen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Referat 64 Erneuerbare Energien Energie Szenario BW 2050 Quelle: ZSW 2015 Quelle: IEKK
Beitrag der Energieversorgung Gera GmbH zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland
 Beitrag der Energieversorgung Gera GmbH zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland Die EGG plant, auch in Zukunft die Fernwärmeversorgung in Gera auf der Basis von dem zukünftig erwarteten Fernwärmebedarf
Beitrag der Energieversorgung Gera GmbH zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland Die EGG plant, auch in Zukunft die Fernwärmeversorgung in Gera auf der Basis von dem zukünftig erwarteten Fernwärmebedarf
Masterplan 100 % Klimaschutz Arbeitsgruppe Energieversorgung. Foto: Joachim Kläschen
 Masterplan 100 % Klimaschutz Arbeitsgruppe Energieversorgung Foto: Joachim Kläschen Agenda Arbeitsgruppe Energieversorgung 1. Rückblick auf die Konzepterstellung und die wesentlichen Ergebnisse (Impulsvortrag)
Masterplan 100 % Klimaschutz Arbeitsgruppe Energieversorgung Foto: Joachim Kläschen Agenda Arbeitsgruppe Energieversorgung 1. Rückblick auf die Konzepterstellung und die wesentlichen Ergebnisse (Impulsvortrag)
Interaktion EE-Strom, Wärme und Verkehr. Patrick Schumacher (IBP), Norman Gerhardt (IWES) KERNAUSSAGEN
 Patrick Schumacher (IBP), Norman Gerhardt (IWES) KERNAUSSAGEN 1 Kernaussagen (1) - Allgemein 1. Strom wird Hauptenergieträger im Wärmesektor Schlüsseltechnologie dezentrale und zentrale Wärmepumpe (Haushalte/Gewerbe/Fernwärme/Industrie)
Patrick Schumacher (IBP), Norman Gerhardt (IWES) KERNAUSSAGEN 1 Kernaussagen (1) - Allgemein 1. Strom wird Hauptenergieträger im Wärmesektor Schlüsseltechnologie dezentrale und zentrale Wärmepumpe (Haushalte/Gewerbe/Fernwärme/Industrie)
Zukünftige Herausforderungen für Kraft-Wärme-Kopplung
 Zukünftige Herausforderungen für Kraft-Wärme-Kopplung Das Projekt: Chancen und Risiken von KWK im Rahmen des IEKP LowEx Symposium 28. 29. Oktober 2009 in Kassel Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch Dipl.-Ing.
Zukünftige Herausforderungen für Kraft-Wärme-Kopplung Das Projekt: Chancen und Risiken von KWK im Rahmen des IEKP LowEx Symposium 28. 29. Oktober 2009 in Kassel Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch Dipl.-Ing.
ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE: AUßERBETRIEBLICHE ABWÄRMENUTZUNG ERFAHRUNG UND AUSBLICK
 Block 2B: Energieeffizienz und Lastflexibilisierung in Industriegebieten CEB 2018 in Karlsruhe ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE: AUßERBETRIEBLICHE ABWÄRMENUTZUNG ERFAHRUNG UND AUSBLICK INHALT BEDEUTUNG
Block 2B: Energieeffizienz und Lastflexibilisierung in Industriegebieten CEB 2018 in Karlsruhe ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE: AUßERBETRIEBLICHE ABWÄRMENUTZUNG ERFAHRUNG UND AUSBLICK INHALT BEDEUTUNG
Fachseminar Strom erzeugende Heizungen/Mini-BHKW. Programm Fachseminar Strom erzeugende Heizungen 1
 Fachseminar Strom erzeugende Heizungen/Mini-BHKW Programm Fachseminar Strom erzeugende Heizungen 1 Kraft-Wärme-Kopplung, BHKW Grundlagen und allgemeine Rahmenbedingungen GETEC Fachseminar Strom erzeugende
Fachseminar Strom erzeugende Heizungen/Mini-BHKW Programm Fachseminar Strom erzeugende Heizungen 1 Kraft-Wärme-Kopplung, BHKW Grundlagen und allgemeine Rahmenbedingungen GETEC Fachseminar Strom erzeugende
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung
 Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim
 Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Voerde. Arbeitskreis Erneuerbare Energie/KWK Themen
 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Voerde Arbeitskreis Erneuerbare Energie/KWK
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Voerde Arbeitskreis Erneuerbare Energie/KWK
100 Bioenergiedörfer bis 2020 wie geht das?
 100 Bioenergiedörfer bis 2020 wie geht das? Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Was ist ein Bioenergiedorf? Eine allgemeingültige
100 Bioenergiedörfer bis 2020 wie geht das? Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Was ist ein Bioenergiedorf? Eine allgemeingültige
Erneuerbare und Effiziente Wärme im Energieatlas NRW Stand und Ausblick
 Erneuerbare und Effiziente Wärme im Energieatlas NRW Stand und Ausblick Antje Kruse Fachbereichsleiterin Klimaschutz, Klimawandel Koordinierungsstelle Was hat das Landesumweltamt mit dem Thema Klimaschutz
Erneuerbare und Effiziente Wärme im Energieatlas NRW Stand und Ausblick Antje Kruse Fachbereichsleiterin Klimaschutz, Klimawandel Koordinierungsstelle Was hat das Landesumweltamt mit dem Thema Klimaschutz
Rückenwind für das Energiekonzept Baden-Württemberg. Joachim Sautter Grundsatzfragen der Energiepolitik
 Rückenwind für das Energiekonzept Baden-Württemberg Joachim Sautter Grundsatzfragen der Energiepolitik Planungsausschuss Regionalverband Neckar-Alb - 16.03.10 Joachim Sautter - Planungsausschuss Regionalverband
Rückenwind für das Energiekonzept Baden-Württemberg Joachim Sautter Grundsatzfragen der Energiepolitik Planungsausschuss Regionalverband Neckar-Alb - 16.03.10 Joachim Sautter - Planungsausschuss Regionalverband
Klimaneutrale Landesliegenschaften Wie geht das Land vor?
 Klimaneutrale Landesliegenschaften Wie geht das Land vor? 6. EKI-Fachforum: Förderung sichern mit Sanierungsfahrplänen Energie und Kosten sparen Dr. Patrick Hansen Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Klimaneutrale Landesliegenschaften Wie geht das Land vor? 6. EKI-Fachforum: Förderung sichern mit Sanierungsfahrplänen Energie und Kosten sparen Dr. Patrick Hansen Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Energiewende Nordhessen.Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes
 Technik Fraunhofer IWES. Institut dezentrale Energietechnologien IdE. Stadtwerke Union Nordhessen SUN Energiewende Nordhessen.Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes
Technik Fraunhofer IWES. Institut dezentrale Energietechnologien IdE. Stadtwerke Union Nordhessen SUN Energiewende Nordhessen.Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes
Energieeffizienz in Gebäuden. - Schlüssel zur Energiewende -
 Energieeffizienz in Gebäuden - Schlüssel zur Energiewende - Vortrag anlässlich der Veranstaltung KfW Förderprogramme für Architekten und Planer im Rahmen der Initiative Besser mit Architekten Energieeffiziente
Energieeffizienz in Gebäuden - Schlüssel zur Energiewende - Vortrag anlässlich der Veranstaltung KfW Förderprogramme für Architekten und Planer im Rahmen der Initiative Besser mit Architekten Energieeffiziente
Neue Energie durch kommunale Kompetenz
 Neue Energie durch kommunale Kompetenz Uwe Barthel Mitglied des Vorstandes 28. Februar 2009 Chemnitz Ziele von Bund und Land Bund / BMU Roadmap Senkung CO 2 -Ausstoß bis 2020 gegenüber 1990 um 40 % im
Neue Energie durch kommunale Kompetenz Uwe Barthel Mitglied des Vorstandes 28. Februar 2009 Chemnitz Ziele von Bund und Land Bund / BMU Roadmap Senkung CO 2 -Ausstoß bis 2020 gegenüber 1990 um 40 % im
Integriertes Energie-und Klimaschutzkonzept der Stadt Schopfheim
 Integriertes Energie-und Klimaschutzkonzept der Stadt Schopfheim 11.04.2016 Jan Münster Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH Das Klimaschutzkonzept Definiert ein langfristiges kommunales Entwicklungsziel
Integriertes Energie-und Klimaschutzkonzept der Stadt Schopfheim 11.04.2016 Jan Münster Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH Das Klimaschutzkonzept Definiert ein langfristiges kommunales Entwicklungsziel
Das KWK-Impulsprogramm NRW Strategie und Förderung. KWK KONKRET! Essen,
 Das KWK-Impulsprogramm NRW Strategie und Förderung KWK KONKRET! Essen, 4.11.2015 KWK-Impulsprogramm in NRW Ziel: Erhöhung des KWK-Anteils an der Stromerzeugung auf 25 % bis 2020 250 Mio. für KWK und KWK-bezogene
Das KWK-Impulsprogramm NRW Strategie und Förderung KWK KONKRET! Essen, 4.11.2015 KWK-Impulsprogramm in NRW Ziel: Erhöhung des KWK-Anteils an der Stromerzeugung auf 25 % bis 2020 250 Mio. für KWK und KWK-bezogene
Radolfzeller WERK-Erklärung für Klimaschutz und regionale Wertschöpfung
 Seite 1 Für was steht WERK? Radolfzeller WERK-Erklärung für Klimaschutz und regionale Wertschöpfung Die Initiatoren der Radolfzeller WERK-Erklärung, die Stadt Radolfzell, Radolfzeller Handwerksbetriebe,
Seite 1 Für was steht WERK? Radolfzeller WERK-Erklärung für Klimaschutz und regionale Wertschöpfung Die Initiatoren der Radolfzeller WERK-Erklärung, die Stadt Radolfzell, Radolfzeller Handwerksbetriebe,
Projekt trifft Partner
 Headline Fachtagung Klimaschonende Energieversorgung Projekt trifft Partner Herten, Donnerstag 29.10.2015 Werner R. Lutsch, Geschäftsführer AGFW, Frankfurt und Vizepräsident Euroheat & Power, Brüssel Energiewende
Headline Fachtagung Klimaschonende Energieversorgung Projekt trifft Partner Herten, Donnerstag 29.10.2015 Werner R. Lutsch, Geschäftsführer AGFW, Frankfurt und Vizepräsident Euroheat & Power, Brüssel Energiewende
Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Stromerzeugung aus Biomasse im EEG 2016
 Bundesrat Drucksache 555/15 (Beschluss) 18.12.15 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Stromerzeugung aus Biomasse im EEG 2016 Der Bundesrat hat in seiner 940. Sitzung
Bundesrat Drucksache 555/15 (Beschluss) 18.12.15 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Stromerzeugung aus Biomasse im EEG 2016 Der Bundesrat hat in seiner 940. Sitzung
Global denken lokal handeln Die Umsetzung der Energiewende in der Region Esslingen
 Global denken lokal handeln Die Umsetzung der Energiewende in der Region Esslingen Esslinger Energie-Gespräche Esslingen, 18. März 2014 Dominik Völker Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG www.swe.de
Global denken lokal handeln Die Umsetzung der Energiewende in der Region Esslingen Esslinger Energie-Gespräche Esslingen, 18. März 2014 Dominik Völker Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG www.swe.de
Energiekonzept. Ziele Projekte Visionen. Pfarrkirchen. Pure Energie.
 Energiekonzept Ziele Projekte Visionen Pfarrkirchen Pure Energie. Energiekonzept Pfarrkirchen Was ist das? Für die Umsetzung der Energiewende und von Klimaschutzzielen in Deutschland spielen die Kommunen
Energiekonzept Ziele Projekte Visionen Pfarrkirchen Pure Energie. Energiekonzept Pfarrkirchen Was ist das? Für die Umsetzung der Energiewende und von Klimaschutzzielen in Deutschland spielen die Kommunen
Integriertes Klimaschutzkonzept Rems-Murr-Kreis
 Integriertes Klimaschutzkonzept Rems-Murr-Kreis Gesche Clausen Leiterin der Geschäftsstelle Klimaschutz im Landratsamt Rems-Murr-Kreis Kommunaler Landesklimaschutzkongress am Montag, 8. Oktober 2012 in
Integriertes Klimaschutzkonzept Rems-Murr-Kreis Gesche Clausen Leiterin der Geschäftsstelle Klimaschutz im Landratsamt Rems-Murr-Kreis Kommunaler Landesklimaschutzkongress am Montag, 8. Oktober 2012 in
Fernwärme für die Hansestadt Rostock- Ein Beitrag zum Klimaschutz
 Fernwärme für die Hansestadt Rostock- Ein Beitrag zum Klimaschutz 24.02.2012 Ute Römer Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft 1 Forum Fernwärme Folie 01 Die Stadtwerke Rostock AG Fernwärme Erzeugung Wärme:
Fernwärme für die Hansestadt Rostock- Ein Beitrag zum Klimaschutz 24.02.2012 Ute Römer Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft 1 Forum Fernwärme Folie 01 Die Stadtwerke Rostock AG Fernwärme Erzeugung Wärme:
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien
 Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Ökologische und sichere Wärme für Hamburg
 Konzept Ökologische und sichere Wärme für Hamburg CO 2 minus 50% Sicher Partnerschaftlich Bezahlbar Juni 2016 Übersicht 1 Fernwärmesituation in Hamburg 2 Herausforderungen partnerschaftlich lösen CO 2
Konzept Ökologische und sichere Wärme für Hamburg CO 2 minus 50% Sicher Partnerschaftlich Bezahlbar Juni 2016 Übersicht 1 Fernwärmesituation in Hamburg 2 Herausforderungen partnerschaftlich lösen CO 2
Schriftliche Kleine Anfrage
 BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 18/6181 18. Wahlperiode 08. 05. 07 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Monika Schaal (SPD) vom 30.04.07 und Antwort des Senats Betr.:
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 18/6181 18. Wahlperiode 08. 05. 07 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Monika Schaal (SPD) vom 30.04.07 und Antwort des Senats Betr.:
