Errichtung von Grundwassermessstellen und begleitende Untersuchungen am Gesamtstandort Morgenstern - Oktober April
|
|
|
- Stefanie Esser
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Errichtung von Grundwassermessstellen und begleitende Untersuchungen am Gesamtstandort Morgenstern - Oktober April Projekt-Nr.: Auftraggeber: KreisWirtschaftsBetriebe Goslar kaör Bornhardtstraße Goslar Auftragnehmer: Partnerschaft Diesing, Kumm, Dr. Pelzer, Dr. Türk Lilly-Reich-Straße Hildesheim Tel.: / Fax: 05121/ Bearbeiter: Dipl.-Min. Joachim Peter Dipl.-Geol. Dr. Guido Pelzer Dipl.-Geoökol. Dr. Thomas Türk Dipl.-Geoökol. Andreas Müller-Lobensteiner Hildesheim, den 14. Mai 2013 digitales Exemplar
2 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 2 von 65 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Aufgabenstellung Durchgeführte Arbeiten Geologische Ergebnisse der Bohrungen Hydrogeologische Ergebnisse der Bohrungen und Pumpversuche Bohrung Hilssandstein Bohrung Sohle Zusammenfassende Interpretation der hydraulischen Situation anhand der Wasserstandsbeobachtungen während der Bohrungen Grundwasseruntersuchungen Umfang der vergleichenden Analytik Sickerwasser Deponiesickerwasser Luttenschacht Fazit Grundwasser im Festgestein außerhalb des Grubengebäudes Grundwassermessstelle GWM HI Probenahme Analysenergebnisse Fazit Grundwassermessstelle GWM FM Probenahme Analysenergebnisse Fazit Grundwasser innerhalb der Grube Morgenstern Schrägstollen Messstellenzustand Analysenergebnisse Fazit Grundwassermessstelle GWM Sohle Pumpversuch Vorbemerkungen zur Analyse... 42
3 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 3 von 65 Analysenergebnisse Grundwasser Analysenergebnisse Schwimmphase Fazit Entsorgung Radioaktivitätsmessungen Hydrochemischer Vergleich Kontaminationshypothese Schadensherd Sohle Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse Vorschläge für weitere Untersuchungen Einrichtung neuer Grundwassermessstellen Aktualisierung der Wasserbilanz Messstelleninstandsetzung Hydraulisches und hydrochemisches Monitoring Mögliche Erkundung der Altlast Florentz im Bereich der Deponie Zeitzeugen Zitate Abbildungen Abb. 2.1: Bilder der Kamerabefahrung der Bohrung Sohle 2 aus 83,9 und 84,02 m Tiefe u. GOK 10 Abb. 3.1: Bohrkern mit Ölschlieren auf der Brauchfläche (Bohrtiefe ca. 81,4m u GOK) 12 Abb. 4.1: Zeitliche Entwicklung des wasserspiegels im Bohrloch und der Bohrungstiefe bei den Bohrungen Hilssandstein und Flammenmergel 13 Abb. 4.2: Zeitliche Entwicklung der Wasserergiebigkeit der Bohrung Hilssandstein während des Kurzpumpversuchs am (Beginn des Pumpversuchs um 17:00 Uhr) 15 Abb. 4.3: Auswertung des Wiederanstiegs nach dem Kurzpumpversuch in der Bohrung Hilssandstein nach THEIS. Dargestellt sind zwei Ausgleichgeraden (schwarz, rot) mit den zugehörigen Auswerteergebnissen 16 Abb. 4.4: Zeitliche Entwicklung des Wasserspiegels im Bohrloch und der Bohrungstiefe bei der Bohrung auf die Schachtumfahrung der 2. Sohle 18 Abb. 4.5: Zeitliche Entwicklung der Wasserspiegel in der GWM Sohle 2 und den Messstellen Schrägstollen, Fortuna und GWM HI 1 während des Pumpversuchs an der GWM Sohle 2 19 Abb. 4.6: Veranschaulichung der potentiellen freien Grundwasseroberfläche im Bereich der verbrochenen Abbauräume und des Bruchfeldes 20 Abb. 4.7: Zeitliche Entwicklung der Wasserspiegel in der GWM Sohle 2 und den Messstellen Schrägstollen, Fortuna und GWM HI 1 und GWM FM 1 während der Bohrarbeiten Sohle 2 21
4 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 4 von 65 Abb. 4.8: Zeitliche Entwicklung der Wasserspiegel in der GWM Sohle 2 und den Messstellen Schrägstollen, Fortuna und GWM HI 1 während der Bohrarbeiten Sohle 2 23 Abb. 5.1: Entwicklung ausgewählter Parameter im Grundwasser der GWM Schrägstollen. 35 Abb. 5.2: Prinzipschema der Aufbereitungsanlage für den Pumpversuch Sohle Abb. 5.3: Gefördertes Grundwasser mit Schwimmphase zu Beginn und während des Pumpversuchs 40 Abb. 5.4: Verlauf der von der Synspec gemessenen Aromaten und LHKW-Konzentrationen im Ablaufcontainer. 41 Abb. 5.5: Verlauf der Vor-Ort-Parameter im Ablaufcontainer 42 Abb. 5.6: Charakteristische hydrochemische Gruppierungen innerhalb des Piper-Diagramms 47 Abb. 5.7: Hydrochemische Gruppierung unter Einbeziehung weiterer Messstellen im Diagramm der Kationen. 48 Abb. 5.8: Position der GWM Sohle 2 in der Umfahrung bzw. im Randbereich zum Stollen Sohle 2 49 Abb. 5.9: Modellvorstellung zur Verteilung der Lösemittelphase im Bereich Stollen Sohle 2 und Situation beim Pumpversuch. 51 Abb. 6.1: 3D-Modell mit den neuen Grundwassermessstellen und der Lage der geplanten Bohrung für die Messstelle GWM Verbindungsstrecke. 55 Abb. 7.1: Lage der vorgeschlagenen weiteren Messstellen. 56
5 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 5 von 65 Tabellen Tabelle 2.1: Zeitlicher Ablauf der Bohrarbeiten und der begleitenden Untersuchungen 8 Tabelle 5.1: Parameterliste Grund- und Sickerwasser 27 Tabelle 5.2: Gegenüberstellung ausgewählter Analysenergebnisse 34 Tabelle 5.3: Pumpversuchsverlauf GWM Sohle2 40 Tabelle 7.1: Übersicht über die vorgeschlagenen Bohrungen/Grundwassermessstellen 57 Tabelle 7.2: Übersicht der Mess- und Probenahmestellen für die weitere Überwachung im Monitoring erstes Jahr 60 Anlagen Anlage 1: Lageplan des engeren Untersuchungsgebietes mit den Messstellen Anlage 2.1: Bohrprofile (GeODin) Anlage 2.2: Ausbauplan GWM HI1 Anlage 2.3: Ausbauplan GWM FM1 Anlage 2.4: Ausbauplan GWM Sohle2 Anlage 3.1: Petrographische Beschreibung von Proben aus dem Stratum Hilssandstein Anlage 3.2: Fotodokumentation der Schichtenfolge GWM Sohle2 Anlage 3.3: Fotodokumentation der Schichtenfolge GWM HI1 Anlage 3.4: Ergebnisse der Feststoffuntersuchungen Anlage 4: Tabelle der Grundwasserstände Anlage 5.1: Verlauf der Vor-Ort-Parameter während der Probenahme GWM HI1 Anlage 5.2: Verlauf der Vor-Ort-Parameter während der Probenahme GWM FM1 Anlage 5.3: Ergebnisse der Wasseruntersuchungen Anlage 5.4: Ergebnisse der Untersuchung von Schwimmphase Anlage 5.5: Hydrochemische Auswertung im Piper-Diagramm Anlage 5.6: Benennung der bisherigen Messstellen aus /8/ mit den drei neu eingerichteten Grundwassermessstellen. Anlage 6.1: Erwartete Schichtenfolge für Bohrung Verbindungsstrecke
6 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 6 von 65 Anhang Anhang 1: Prüfberichte der Laboranalytik (GBA) Anhang 2: Brunnenfernsehprotokoll Bohrung Sohle 2 Anhang 3: Anhang 4: Anhang 5: Dokumentation der Bohrlochverlaufsmessung Deponie Morgenstern Goslar Bohrung Sohle 2 Schacht Morgenstern 2. Sohle Leerumfahrung Kurzbericht zu geophysikalischen Messungen Deponie Morgenstern Goslar Bohrung 2 Hilssandstein Anhang 6: Hydraulische Bohrlochversuche Testbericht Bohrung Sohle 2 Anhang 7: Anhang 8: Anhang 9: Anhang 10: Anhang 11: Anhang 12: Anhang 13: Hydraulische Bohrlochversuche Testbericht Bohrung 2 Hilssandstein Schacht Morgenstern Morgensternstrecke Brunnenfernsehprotokoll Messstelle Schrägstollen Angebot Sanierung GWM Schrägstollen Informationen zu Dämmern und Zementen Ergebnisse der begleitenden PID-Messungen Beweissicherung Straßenseitengraben K32
7 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 7 von 65 1 Aufgabenstellung Auf Grundlage des Angebots vom wurde die Partnerschaftsgesellschaft Dr. Pelzer und Partner durch die KreisWirtschaftsBetriebe Goslar kaör mit Ingenieurvertrag vom mit weiteren Untersuchungen und der Begleitung des Baus von Grundwassermessstellen im Bereich des Gesamtstandortes Morgenstern beauftragt. Ziel der Arbeiten war die Einrichtung von zwei Grundwassermessstellen und die Durchführung orientierender grundwasserchemischer und hydraulischer Untersuchungen. Im Vordergrund stand die Untersuchung der Grundwassersituation in den Deckschichten der Grube Morgenstern und die Frage, ob ein Abströmen des im Grubengebäude stehenden Wassers ins Nebengestein, insbesondere den potentiellen Aquifer des Hilssandsteins erfolgt. Desweiteren sollte durch das Einrichten einer Messstelle im Grubengebäude in der Nähe des ehem. Schachtes Morgenstern das im Grubengebäude stehende Wasser auf Verunreinigungen untersucht werden. Im Verlauf der Arbeiten wurde das Arbeitsprogramm erweitert und eine zusätzliche Grundwassermessstelle im Flammenmergel nordöstlich der ehem. Grube Morgenstern eingerichtet sowie Pumpversuche an den Bohrungen Hilssandstein und Sohle 2 durchgeführt. Die neuen Messstellen wurden beprobt und das Grundwasser chemisch untersucht. In die Bewertung wurden neben den neuen Analysenergebnissen auch die Resultate der jüngsten Untersuchungen der Messstelle Schrägstollen sowie früherer Ergebnisse anderer Messstellen einbezogen.
8 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 8 von 65 2 Durchgeführte Arbeiten Im Zeitraum Oktober 2012 bis April 2013 wurden von die H. Anger s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft insgesamt 3 Bohrungen niedergebracht und zu Grundwassermessstellen /Brunnen ausgebaut. Der zeitliche Ablauf der durchgeführten Arbeiten ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Tabelle 2.1: Zeitlicher Ablauf der Bohrarbeiten und der begleitenden Untersuchungen Zeit Gewerk Tätigkeit GWM HI 1 Vorbohren mit Schnecke und Rollenmeißel, Einbau des Standrohrs 356mm bis 11m Tiefe u. GOK GWM HI 1 Bohrung 318mm im Lufthebeverfahren bis 85m Tiefe u. GOK GWM HI 1 Kernbohrung 146mm, ,5m Tiefe u. GOK GWM HI 1 akustischer Bohrlochscan ,1m Tiefe u. GOK GWM HI 1 Wasserdruckversuche (WD-Test s) GWM HI 1 Vorbereitung Pumpversuch GWM HI 1 Pumpversuch GWM FM 1 Vorbohren mit Schnecke und Rollenmeißel bis 12,5m Tiefe u. GOK vorgebohrt, Einbau des Standrohrs 356mm bis 6m Tiefe u. GOK GWM FM 1 Bohrung 311mm im Lufthebeverfahren bis 65m Tiefe u. GOK GWM FM 1 Ausbau der Bohrung zu einer GW-Messstelle (Rohrtour DA160) GWM HI 1 Ausbau der Bohrung zu einer GW-Messstelle (Rohrtour DA90) GWM Sohle 2 Kernbohrung 146mm bis 35m Tiefe u. GOK GWM Sohle 2 Bohrlochverlaufsmessung, WD-Test GWM Sohle 2 Kernbohrung 146mm, 35-86,5m Tiefe u. GOK GWM Sohle 2 TV-Inspektion Messstelle TV-Inspektion Schrägstollen GWM Sohle 2 Packer bei 78m Tiefe u. GOK eingebaut, Schneckenbohrung und Einbau Standrohr 356mm bis 6,6m Tiefe u. GOK GWM Sohle 2 Bohrung/Aufweitung 311mm im Lufthebeverfahren bis 85m Tiefe u. GOK GWM HI1, Probenahme GWM FM1 und GWM HI 1 GWM FM GWM Sohle 2 Bohrung/Aufweitung 311mm im Direktspülverfahren bis 87m Tiefe u. GOK GWM Sohle 2 Ausbau zu einer Messstelle DA160 mit Peilrohr DN GWM Sohle 2 Pumpversuch Die Bohrprofile und Ausbaupläne der Bohrungen sind diesem Bericht in den Anlagen 2.1 bis 2.4 beigefügt. Als erste wurde die Bohrung zur Erkundung des Hilssandsteins nordöstlich der ehem. Grube Morgenstern abgeteuft. Die Bohrung wurde durch Spülungsverluste in den durchbohrten Schichten des Cenoman (Plänerkalke bis Mergelkalke) und im Flammenmergel behindert. Als Bohrspülung wurde bei allen Bohrungen nur klares Wasser eingesetzt. Kurz vor dem Erreichen der erwarteten Hangendgrenze des Hilssandsteins wurde das Bohrverfahren bei 85m Tiefe u. GOK von Lufthebebohren 311mm auf Kernbohren 146mm umgestellt. In der Folge wurde der Hilssandstein (Bezeichnung hier und im Folgenden im lithostratigraphischen Sinne benutzt) bei durchgehender Kerngewinnung durchteuft.
9 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 9 von 65 Anschließend wurden im Kernbohrloch Wasserdruckversuche mittels Einzel- und Doppelpacker durchgeführt, deren Ergebnisse auf relativ geringe hydraulische Durchlässigkeiten des Hilssandsteins hindeuteten (vergleiche Kapitel 4.1). Aufgrund dieser Ergebnisse wurde in der Projektgruppe Morgenstern beschlossen, vor einer Entscheidung über das weitere Aufbohren und/oder den Ausbau des Bohrloches einen Pumpversuch im Bohrloch durchzuführen, um weitere Informationen zur Beurteilung der Relevanz des Hilssandsteins als lokalen Aquifer zu sammeln. Nach Vorliegen der Ergebnisse des Pumpversuchs, die auf eine nicht zu vernachlässigende Transmissivität der Hilssandsteinfolge hindeuteten, wurde beschlossen, die Bohrung ohne weiteres Aufweiten und mit verringerten Ausbaudurchmesser (DA90 statt wie ursprünglich geplant DA160) zu einer Grundwassermessstelle im Hilssandstein (GWM HI 1) auszubauen. Die bei der Bohrung in den Hilssandstein beobachteten Spülungsverluste und die Ergebnisse der bohrungsbegleitenden Wasserstandsmessungen im Bohrloch Hilssandstein deuten darauf hin, dass im Flammenmergel ein Aquifer ausgebildet ist. Daher wurde in der Nachbarschaft der Bohrung Hilssandstein eine weitere Bohrung bis 65m Tiefe unter GOK niedergebracht und im Bereich des Flammenmergels zu einer Grundwassermessstelle ausgebaut (Ausbau DA160). Die bei dieser Bohrung beobachteten Spülungsverluste fielen geringer aus, als im gleichen Teufenbereich in der Bohrung Hilssandstein. Im Februar 2013 wurde schließlich mit der Zielbohrung auf die Leerumfahrung des Schachts Morgenstern auf der 2.Sohle nahe der Einmündung in den Hauptförderstollen begonnen. Der Bohransatzpunkt wurde vom Markscheider Dipl.-Ing. Peter Haake unter Berücksichtigung der beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vorliegenden Informationen über den Stollenausbau vorgeschlagen und aufgemessen. Die Bohrung wurde im ersten Schritt als Kernbohrung bis 35m Tiefe u. GOK niedergebracht. Dann wurde eine Bohrlochverlaufsmessung und ein Wasserdruckversuch (WD- Test) durchgeführt. Nach festgestellter ausreichender Lottreue der Bohrung wurde diese fortgesetzt. Nach Auswertungen des Markscheiders war das Anbohren der Stollenfirste nach ca. 81,7 Bohrmetern und eine Firsthöhe des Stollens von 2,7-2,8m, entsprechend einer Bohrtiefe bis Stollensohle von ca. 84,5m, zu erwarten. Die Bohrung traf die Stollensohle hingegen erst bei 86,5m an. Nach dem Fertigstellen der Kernbohrung wurde eine TV-Inspektion (Kamerabefahrung) des Bohrlochs unterhalb 82m Teufe durchgeführt. Die Kamerabefahrung zeigte von 82-84m Bohrtiefe stark zerbrochenes Gestein, dass aber weitgehend noch im Verband vorlag. Unterhalb von ca. 84m bis zur Endtiefe der Kamerabefahrung von ca. 84,5m war lose liegendes Gestein mit freien Zwischenräumen sichtbar (siehe Abbildung 2.1). Unterhalb 84,5m war das Bohrloch zugefallen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Schachtumfahrung Sohle 2, möglicherweise im Zuge des Rückbaus der Ausbaumaterialien, weitgehend mit Abraum/Gesteinsbruch verfüllt wurde. Das Gebirge unmittelbar über der ehemaligen Stollendecke weist zwar viele offene Risse auf, der Stollen scheint aber nicht eingestürzt zu sein. (Es ist zu prüfen, ob die Umfahrung schon vor der Stillegung der Grube verfüllt wurde.)
10 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 10 von 65 ABB. 2.1: BILDER DER KAMERABEFAHRUNG DER BOHRUNG SOHLE 2 AUS 83,9 UND 84,02 M TIEFE U. GOK Für die Aufweitung der Bohrung Sohle 2 wurde das Kernbohrloch bei ca. 78m Teufe mittels eines verlorenen Packers gegenüber dem Stollen abgedichtet. Anschließend wurde die Bohrung auf 311mm Durchmesser aufgeweitet, wobei es bereits oberhalb des Packers zu erheblichen Spülungsverlusten kam. Nach dem Durchteufen des Packers erhöhten sich die Spülungsverluste. Ab dem Erreichen einer Tiefe von 85m war trotz hoher Frischwasserzusätze (bis zu 25m³ in 10 min) kein Bohrgutaustrag im Lufthebeverfahren mehr möglich. Die Bohrung wurde mit sehr geringem Bohrfortschritt und hohen Spülungsverlusten mit dem Direktspülverfahren und dem Lufthebeverfahren im Wechsel bis auf eine Tiefe von 87m u. GOK niedergebracht und mittels DA160-Rohren zu einem Brunnen ausgebaut (GWM Sohle 2). Ein Ausbau bis auf die volle Bohrtiefe war aufgrund des ständig zusammenstürzenden Bohrloches nicht möglich. Die Unterkante des Filters wurde daher bei 85m u. GOK abgesetzt. Zusätzlich wurde bis 59,3m Tiefe u. GOK ein DN35-Peilrohr eingebaut (Messstelle GWM PS1, siehe Anlage 2.4). Die neuerrichteten Messstellen wurden mit Datenloggern zur Aufzeichnung des Wasserstandes ausgestattet. An der GWM Sohle 2 wurde im Zeitraum ein Pumpversuch durchgeführt. Der Pumpversuch musste vorzeitig abgebrochen werden, da große Mengen einer ölartigen Leichtphase gefördert wurden. (vgl. Kap ) GWM HI1 und GWM FM1 wurden am beprobt. Eine am in Verbindung mit der Untersuchung des Bohrlochs Sohle 2 durchgeführte TV-Inspektion der Messstelle Schrägstollen zeigt im Brunnenrohr flächige bis knollige Aufwachsungen von gelber, brauner und grauer Farbe, die die gesamte Rohrtour unterhalb der Wasserlinie auskleiden und die Filterschlitze des Rohres fast vollständig verschlossen haben. Die Formen und Strukturen der Beläge erinnern an organische Formen. Ähnlich geformte Beläge treten innerhalb von Trinkwasserleitungen aus Eisenwerkstoffen auf und bestehen dort aus Korrosionsprodukten. Da die Schrägstollenmessstelle mit einem Stahlrohr ausgebaut wurde, könnte es sich bei den Belägen um Korrosionsprodukte handeln. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit ergibt
11 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 11 von 65 sich aus den hydrochemischen Befunden (Kap ). Eine Ertüchtigung der Messstelle ist dringend zu empfehlen. In den nachfolgenden Kapiteln werden die geologischen, hydrogeologischen und umweltchemischen Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen dargestellt und ausgewertet. 3 Geologische Ergebnisse der Bohrungen Die in den Bohrungen angetroffenen Schichtenfolgen sind in den Bohrprofilen (Anlage 2.1) beschrieben. In Anlagen 3.1 bis 3.3 sind diesem Bericht eine Fotodokumentation der Bohrkerne und des Bohrkleins (cuttings) sowie sedimentpetrografische Beschreibungen ausgewählter Proben aus dem Bereich des Hilssandsteins beigefügt. Die erbohrten Profile stimmen gut mit den erwarteten Schichtenfolgen überein. Die Bohrung Hilssandstein (GWM HI 1) durchörterte zuerst Kalksteine und basal Mergelton- bis Tonsteine des Cenomanium, dann den Flammenmergel, die minimus- Schichten (Tonsteine) und die Hilssandsteinfolge (Sandsteine, Schluffsteine, Tonsteine) und abschließend das basale Transgressionskonglomerat ( Gault-Konglomerat ) des Albium. Die Schichtabfolge des Hilssandsteinkomplexes zeigte sich im Bohrkern relativ wenig geklüftet. Im Bohrloch der Kernbohrung unterhalb 86m u. GOK wurde ein akustischer Bohrlochscan durchgeführt und von der Dr. Lux Geophysikalische Fachberatung GbR ausgewertet (Anhang 5). In der Auswertung des Bohrlochscans werden offene Klüfte in folgenden Tiefenbereichen dargestellt: 1. 90,3 91,1m u. GOK (7 Klüfte unterschiedlicher Steilheit) 2. 91,6 93,3 m u. GOK (8 Klüfte unterschiedlicher Steilheit) 3. 93,9 94,8 m u. GOK(5 steile Klüfte) 4. 95,4-96,2 m u. GOK (6 Klüfte unterschiedlicher Steilheit) ,4 m u. GOK (1 steile Kluft) und 6. 99,4-100,7m u. GOK (13 Klüfte unterschiedlicher Steilheit) Die detektierten und als offen angesprochenen Klüfte liegen damit alle im oberen, durch Tonsteine bis Schluffsteine geprägten Teil der Hilssandsteinfolge. Im unteren Teil der Hilssandsteinfolge wurden dagegen überwiegend geschlossene Klüfte ausgewiesen. Das Schichteinfallen wird mit NNE angegeben und dargestellt. Die Bohrung auf die Schachtumfahrung der 2. Sohle duchteufte den opalinus-ton, den Posidonienschiefer und den Amaltheen-Ton des unteren Jura. Bei 83,5m Bohrtiefe (ca. 176,5mNN) sackte der Bohrer durch und es wurde bis 86,5m. u. GOK nur noch loses Gestein gefördert. Unterhalb 86,5 m u. GOK traf die Bohrung ungestörten Fels an. Da
12 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 12 von 65 der Bohrkern oberhalb 83,5m u. GOK zwar Klüfte/Brüche aber keine nennenswert verstellten Gesteinsblöcke erkennen ließ ist anzunehmen, dass die Schachtumfahrung der 2. Sohle noch während des Grubenbetriebs mit Abraum/Bergematerial verfüllt worden ist. Ursache könnte ein Rückbau der Ausbaumaterialien im Stollen gewesen sein, bei dem zur Verhinderung eines Einstürzens des schachtnah verlaufenden Stollens Gesteinsmaterial zur Abstützung des Stollens eingebracht worden war. Hierfür spricht auch die kleinstückige Beschaffenheit des erbohrten Materials. Unterhalb ca. 62m u. GOK (ca. 198mNN) wurde entlang von Klüften ölige Imprägnationen des Gesteins in Verbindung mit einem auffälligen, an Teeröl erinnernden Geruch beobachtet. Auf den Kluftflächen waren stellenweise schillernde, ölartige Filme sichtbar (siehe Abbildung 3.1). Aus dem auffälligen Material und aus dem Bohrklein vom Aufweiten der Kernbohrung wurden Proben entnommen und im Labor analysiert (siehe Anlage 3.4). ABB. 3.1: BOHRKERN MIT ÖLSCHLIEREN AUF DER BRAUCHFLÄCHE (BOHRTIEFE CA. 81,4M U GOK)
13 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 13 von 65 4 Hydrogeologische Ergebnisse der Bohrungen und Pumpversuche 4.1 Bohrung Hilssandstein Erste Informationen zu den hydraulischen Verhältnissen im Untergrund lieferte die Beobachtung der Wasserstände während der Bohrungen. In Abbildung 4.1 sind die in den Bohrungen Hilssandstein und Flammenmergel gemessenen Wasserstände dem Bohrfortschritt gegenübergestellt. Die Wasserstände wurden in der Regel am Beginn des Arbeitstages und damit ggf. vor Anhebung des Wasserstandes durch die Spülungszugabe und am Ende des Arbeitstages gemessen. Hierbei geben die morgens gemessenen Wasserstände, insbesondere nach einem Wochenende, am ehesten Hinweise auf den tatsächlichen Grundwasserstand. mnn Bohrung Hilssandstein mnn Bohrung Flammenmergel Wasserspiegel [mnn] Bohrtiefe [mnn] Wasserspiegel [mnn] Bohrtiefe [mnn] ABB. 4.1: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DES WASSERSPIEGELS IM BOHRLOCH UND DER BOHRUNGSTIEFE BEI DEN BOHRUNGEN HILSSANDSTEIN UND FLAMMENMERGEL Bei der Bohrung Hilssandstein waren bis zum (Bohrtiefe morgens ca. 226,55mNN) morgens Wasserstände um mNN zu beobachten. Danach sanken die morgendlichen Wasserstände mit zunehmender Bohrungstiefe bis auf ein Niveau von ca. 205mNN ab, welches bis zum Beginn der Kernbohrung weitgehend gleich blieb. Die ab dem gemessenen Wasserstände innerhalb der für die Kernbohrung eingebauten Verrohrung zeigten stärkere Schwankungen. Der niedrigste gemessene Wert lag mit ca. 205,67mNN etwas höher als der im Bohrloch oberhalb der Kernbohrstrecke beobachtete Wasserspiegel. In Verbindung mit den Schichtenprofilen sind die Beobachtungen dahingehend zu interpretieren, das zwischen den Kalken des
14 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 14 von 65 Cenomanium und dem unterlagernden Flammenmergel eine vertikal geringdurchlässige Gesteinsschicht ausgebildet ist. Hierbei dürfte es sich um die an der Basis des Cenomanium bei ca. 232,25-231,55mNN erbohrte Schicht aus Mergelton bis Tonstein handeln. Die Spülungsverluste und der Verlauf der beobachteten Wasserspiegel im Bohrloch deuten sowohl für die Kalksteine des Cenomanium als auch für den Flammenmergel auf relevante hydraulische Durchlässigkeiten hin. Die in der Kernbohrung beobachten Wasserstände sind hinsichtlich des Grundwasserstandes im durchbohrten Gestein nur wenig aussagekräftig, da Umläufigkeiten um die Verrohrung der Kernbohrung möglich erscheinen. Insgesamt deuteten diese Werte daraufhin, dass der Grundwasserspiegel im Hilssandstein etwas höher lag als im Flammenmergel. Bei der Bohrung Flammenmergel zeigte sich ein ähnlicher Wasserstandsverlauf über den Bohrfortschritt. Allerdings lagen die nach Erreichen der Endteufe beobachteten Wasserstände mit ca. 213mNN deutlich höher als in der Bohrung Hilssandstein. In der Bohrung Hilssandstein wurden am mehrstufige Wasserdruckversuche (WD-Tests) durchgeführt um Hinweise auf die hydraulischen Durchlässigkeiten im Bereich des Hilssandsteins zu erhalten. Die Tests wurden durch die HPC AG, Niederlassung Göttingen, ausgeführt. Die Testberichte sind diesem Bericht als Anhang 7 beigefügt. Getestet wurde das Bohrloch unterhalb 102m u. GOK (entspricht ca ,5 mnn, vorherrschend Sandsteine erbohrt) mittels Einzelpacker sowie der Bereich 89-94m u. GOK (ca mNN, Tonsteine) mittels Doppelpackeranordnung. Die Messergebnisse des Doppelpackerversuchs zeigten, dass der untere Packer undicht war und somit praktisch das gesamte Bohrloch unterhalb 89m u. GOK (entspricht ca ,5 mnn) getestet wurde. Die Tests ergaben durchschnittliche Lugeon-Werte von 0,087 l/min/m im Bereich unterhalb ,5m u. GOK und 0,056l/min/m im Bereich ,5m u. GOK. Signifikante Änderungen über die im Verlauf des Tests eingestellten Druckstufen waren nicht festzustellen. Hieraus ist zu schließen, dass der Bereich m u. GOK deutlich geringere hydraulische Durchlässigkeiten aufweist als der Bereich ,5m u. GOK. Die Bestimmung von hydraulische Durchlässigkeitsbeiwerten aus Wasserdruckversuchen ist nicht ohne weiteres möglich, da ein beeinflusstes, nicht stationäres System vorliegt. Nach PRINZ&STRAUß (2006) /9/ liefert für k f -Werte von m/s eine Auswertung unter Annahme eines homogenen Kontinuums mit radialsymetrischem und konstantem Durchfluss und einem stationären Regime brauchbare Ergebnisse: Q L Q L 1) k ln 0,3665 lg 2 L H r L hm r mit: Q = abgepresste Wassermenge [m³/s] L = freie Bohrlochstrecke [m] H = in Teststrecke wirksamer Überdruck [m Wassersäule] R = wirksamer Bohrlochradius [m] Aus den Ergebnissen des Einfachpackertests lassen sich nach 1) für den Bereich ,5m u. GOK im Mittel k f -Werte von m/s abschätzen.
15 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 15 von 65 Zur weiteren Untersuchung der hydraulischen Eigenschaften des Hilssandsteins wurden vom Kurzpumpversuche durchgeführt. Die Pumpversuche sollten als Grundlage für die Entscheidung über das Aufweiten der Kernbohrstrecke und den Ausbau der Bohrung dienen. Die für die Pumpversuche zur Verfügung stehende Zeit war aufgrund von Verzögerungen im Vorfeld eng begrenzt. Zusätzlich kam es zu technischen Problemen, unter anderem in Form eines verhängten Lichtlotes nach Beginn des Pumpversuches. In der Folge musste vom ursprünglichen Konzept abgewichen werden. Für den Pumpversuch wurde eine unten geschlitzte Kernbohrverrohrung eingebaut, gegenüber dem Flammenmergel abgedichtet und in diese eine Pumpe bei ca. 117m u. GOK (Einlauf) eingehängt. Im ersten Schritt wurde die Ergiebigkeit des Brunnens getestet indem über zwei Stunden der Wasserspiegel bis zur Pumpe (ca. 117m u. GOK, ~136mNN) abgesenkt wurde. Abbildung 4.2 zeigt die zeitliche Entwicklung der Fördermengen. Wie aufgrund der Ergebnisse der WD-Tests zu erwarten war, sind die Förderraten in Anbetracht der hohen Absenkung des Wasserspiegels (ca. 66m Absenkung gegenüber dem Ruhewasserstand) gering. Andererseits reichen die erzielten Förderraten aus, um mit vertretbaren Zeitaufwand eine Beprobung einer Messstelle im Hilssandstein durchführen zu können, was für einen Ausbau der Bohrung zu einer Grundwassermessstelle sprach. 0,5 0,45 0,4 m³/h 0,35 0,3 0,25 Förderleistung m³/h 0,2 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 ABB. 4.2: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER WASSERERGIEBIGKEIT DER BOHRUNG HILSSANDSTEIN WÄHREND DES KURZPUMPVERSUCHS AM (BEGINN DES PUMPVERSUCHS UM 17:00 UHR) Im nächsten Schritt wurde aufsetzend auf dem noch laufenden Wiederanstieg des Grundwasserspiegels (Wasserstand 60,92m u. GOK und damit ca. 11,25m unterhalb des Ruhewasserstandes) eine Grundwasserentnahme durchgeführt, die das vom Wiederanstieg erreichte Absenkniveau gerade erhielt. Diese Kompensation wurde bei einer Entnahme von ca. 0,04 m³/h erreicht. nach einer Entnahmedauer von 2h 10min wurde die Pumpe abgestellt und der weitere Anstieg des Grundwasserspiegels beobachtet. Die Ergebnisse der Wiederanstiegsmessungen wurden nach THEIS ausge-
16 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 16 von 65 wertet. Vier Stunden nach dem Ende des Pumpversuchs wurden die Pumpe ausgebaut Abbildung 4.2 zeigt die Ergebnisse der Auswertung des Wiederanstiegs nach THEIS. Die Kurve s /log(t/t )T zeigt einen unregelmäßigen Verlauf. Nachdem sie anfangs einen unregelmäßigen Verlauf. Vom rechten Rand des halblogarithmischen Diagramms kommend schwenkt die Kurve log (t/t ) zu s relativ schnell in eine Gerade ein, die ungefähr einem kf-wert von 1, m/s entspricht. Dann flacht die Kurve bei einem Absenkbetrag s von ca. 7m ab um dann in eine Gerade mit einer höheren Steigung, entsprechend einem kf-wert von m/s, einzuschwenken. Danach wurde die Wiederanstiegskurve durch den Rückbau der Pumpe gestört. Transmissivität: 2, , m²/s K-Wert: 1, , m/s ABB. 4.3: AUSWERTUNG DES WIEDERANSTIEGS NACH DEM KURZPUMPVERSUCH IN DER BOHRUNG HILSSANDSTEIN NACH THEIS. DARGESTELLT SIND ZWEI AUSGLEICHGERADEN (SCHWARZ, ROT) MIT DEN ZUGEHÖRIGEN AUSWERTEERGEBNISSEN Trotz des suboptimalen Ablaufs des Kurzpumpversuchs und des gemessen an der Geschwindigkeit des Wiederanstiegs des Grundwasserspiegels relativ kurzen Beobachtungsdauer stimmen die Ergebnisse der Auswertung gut mit den anhand der WD-Tests getroffenen Abschätzungen überein. Die mittlere Transmissivität der unmittelbar an das Bohrloch angrenzenden Gesteinsfolge des Hilssandsteins dürfte demnach mindestens in der Größenordnung von m²/s liegen. Aufgrund erheblicher, zum Teil kleinräumiger, lateraler Schwankungen der petrografischen Zusammensetzung und vermutlich auch der Klüftigkeit der Hilssandsteinfolge sind entsprechende Variationen der Transmissivität über die oben angegebene Spannweite hinaus anzunehmen.
17 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 17 von 65 Aufgrund der Ergebnisse des Kurzpumpversuches wurde beschlossen, die Bohrung im Bereich des Hilssandsteins mit einer DA90-HDPE-Rohrtour zu einer Messstelle auszubauen (vgl. Anlage 2.2). 4.2 Bohrung Sohle 2 Die Zielbohrung auf die Schachtumfahrung der 2. Sohle wurde zuerst in zwei Etappen als Kernbohrung niedergebracht und anschließend nach unten abgepackert und aufgeweitet. Beim Erreichen einer Tiefe von 35m u. GOK wurde in der Kernbohrung eine mehrstufiger WD-Test mit Einzelpackeranordnung im Teufenbereich ca. 233,5 225mNN (26,5-35m u. GOK) durchgeführt. Der Versuch wurde in vier Druckstufen gefahren (siehe Testbericht im Anhang 6). Die letzte absteigende Druckstufe war aufgrund eines sehr langsamen Druckabbaus nicht realisierbar. Die ermittelten LUGEON-Werte lagen bei 0,09-0,483 l/min/m und nahmen im Verlauf des Versuchs kontinuierlich ab. Dieser Effekt kann durch ein dauerhaftes Verschließen der Wasserwegsamkeiten durch den hohen Druck bei dem Test hervorgerufen worden sein, was insbesondere im Bereich des opalinus-tons anzunehmen ist. Da der getestete Abschnitt der Bohrung oberhalb des Grundwasserspiegels liegt ist zudem zu vermuten, dass die gemessenen Infiltrationsraten nicht dem stationären Zustand entsprechen. Die rechnerische Abschätzung der hydraulischen Durchlässigkeit aus den WD- Testergebnissen nach 1) ergibt eine Spanne für den k f -Wert des Testabschnitts von 1, , m/s. In Abbildung 4.4 sind die Wasserstandsbeobachtungen und der Bohrfortschritt bei der Zielbohrung auf die Schachtumfahrung der 2.Sohle dargestellt. Die zeitliche Entwicklung des Wasserstandes im Bohrloch weist auf Wasserwegsamkeiten in der durchbohrten Gesteinsfolge hin. Bei einer Bohrtiefe bis ca. 225mNN (35 m u. GOK) war die zuerst durchgeführte Kernbohrung trocken ( und ), das bedeutet, die gesamte eingebrachte Bohrspülung ist versickert. Dieses ist ein Indiz, dass spätestens in einer Bohrtiefe von 35m u. GOK nennenswerte hydraulische Durchlässigkeiten vorliegen. In dieser Teufe hatte die Bohrung den opalinus-ton durchörtert und war etwa 2,2m in den Posidonienschiefer eingedrungen. Die Bohrkerne aus dem Bereich des opalinus-tons sind in vielen Abschnitten stark zerbrochen, so dass das Vorhandensein wasserwegsamer Klüfte/Bruchzonen nicht auszuschließen ist. Zudem hatte sich die Bohrung auf weniger als 10m an den schräg unterhalb verlaufenden Förderstollen der 1. Sohle angenähert. Das Vorhandensein von wasserwegsamen Klüften im Bereich des Posidonienschiefers wird hingegen durch das weitere Absinken des Wasserspiegels mit zunehmenden Bohrfortschritt belegt. Hervorzuheben ist, dass der Wasserspiegel sich vom abends bis zum morgens über eine Bohrpause von fast 6 Tagen kaum veränderte und schließlich bei 209,21mNN lag. Mit dem Anbohren des Stollens fiel der Wasserspiegel noch einmal schlagartig auf rund mNN. Die Spülungsverluste während der Kernbohrung wurden von der Fa. Anger s mit 30-40m³ angegeben.
18 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 18 von 65 Bohrung Sohle Wasserspiegel [mnn] Bohrtiefe [mnn] ABB. 4.4: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DES WASSERSPIEGELS IM BOHRLOCH UND DER BOHRUNGSTIEFE BEI DER BOHRUNG AUF DIE SCHACHTUMFAHRUNG DER 2. SOHLE Vor dem Aufbohren des Kernbohrlochs wurde dieses gegenüber dem Stollen durch den Einbau eines verlorenen Packers bei ca. 182mNN (78m u. GOK) verschlossen. Trotzdem kam es zu sehr großen Spülungsverlusten (ca. 300m³), auch oberhalb des Packers. Der Wasserspiegel stellte sich vor dem Durchbohren des Packers wiederum etwas höher ein als nach dem Aufbohren der Verbindung zum Stollen. Diese Beobachtungen wurden zum Anlass genommen, dass für diese Messstelle vorgesehene zusätzliche Peilrohr im Bereich des Posidonienschiefers zu verfiltern (vgl. Anlage 2.4). Die Bohrung wurde mit einer DA160 HDPE-Rohrtour mit kurzer Filterstrecke im Bereich des Stollens ausgebaut. Anschließend wurde am ein Leistungspumpversuch durchgeführt (Förderrate 7m³/h). Zusätzlich erfolgte am im Zuge einer Probenahme kurzzeitig eine weitere Entnahme. Der Pumpversuch am musste aufgrund großer Mengen geförderter Leichtphase und dadurch bedingter Probleme mit der Trennung/Abreinigung des geförderten Wasser/Leichtphase-Gemischs nach etwa 5 Stunden (Entnahme rund 35m³) wieder eingestellt werden. Durch diese Entnahme wurde in der GWM Sohle 2, ausgehend von einem Druckspiegel von ca. 200,7mNN (bezogen auf die Dichte von Wasser), eine Absenkung von 1,02m erreicht. In der Messstelle Schrägstollen war gleichzeitig ausgehend von einem Druckspiegel von 200,81mNN eine Absenkung von 0,21m zu beobachten (siehe Abbildung 4.5). Nach dem Abschalten der Pumpe erfolgte ein schlagartiger Anstieg der Wasserspiegels in GWM Sohle 2 bis auf ein Niveau von 200,43mNN. Der weitere Anstieg des Druckspiegels erfolgte wesentlich langsamer. In der Messstelle Schrägstollen erfolgte der Wiederanstieg insgesamt langsamer. Nach 2 Tagen lag der Wasserspiegel in der Messstelle Schrägstollen noch ca. 0,03m unterhalb des Ausgangswasserspiegels.
19 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 19 von 65 In dem im Posidonienschiefer der Bohrung Sohle 2 verfilterten DN35-Peilrohr GWM PS1 wurde während des Pumpversuchs am ein Absinken des Wasserspiegels von 52,99m u. ROK auf 53,04 m u. ROK beobachtet. Am um 11:55Uhr wurde in dieser Messstelle ein Wasserstand von 53,10 m u. ROK gemessen. Der Wasserspiegel war also auch nach Beendigung des Pumpversuchs weiter abgesunken. Hier liegt möglicherweise eine Überlagerung der Wirkung des Pumpversuchs mit einem kontinuierlichen Absinken des Wasserstandes im Posidonienschiefer vor. mnn GWM HI 1 Logger Schrägstollen Logger GWM Sohle 2 Logger Fortunaschacht Logger GWM HI 1 Handmessung GWM Sohle 2 Handmessung Schrägstollen Handmessung Fortunaschacht Handmessung ABB. 4.5: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER WASSERSPIEGEL IN DER GWM SOHLE 2 UND DEN MESSSTELLEN SCHRÄGSTOLLEN, FORTUNA UND GWM HI 1 WÄHREND DES PUMPVERSUCHS AN DER GWM SOHLE 2 Die schnelle Reaktion des Druckspiegels in der Schrägstollenmessstelle auf die Entnahme in der GWM Sohle 2 deutet auf gute hydraulische Verbindung und gespannte Verhältnisse hin, wie sie bei einem weitgehend unverbrochenen Stollensystem zu erwarten wäre. In der deutlich geringeren Absenkung und dem langsameren Wiederanstieg in der Messstelle Schrägstollen könnte sich hingegen der Einfluss von Wasserzuflüssen aus hydraulisch ungespannten Bereichen äußern, wie sie in Form der verbrochenen Abbaukammern vorhanden und zumindest über ehemalige Erzrollen an das Stollensystem angeschlossen sind. Nach einer Abschätzung auf Grundlage des 3D-Modells des Grubengebäudes beträgt die Fläche der derzeit im Niveau des Grubenwasserspiegels liegenden Fläche des Grubengebäudes (im Wesentlichen die Abbauräume, ca m²) und der Bruchbereiche (Annahme Bruchwinkel 60. ca m²) insgesamt rund m² (Veranschaulichung der Fläche in Abbildung 4.6). Es ist zu vermuten, dass innerhalb der Abbauräume und Bruchbereiche relativ grobstückiges Material und damit ein hoher Hohlraumanteil vorliegt. Unter Annahme eines effektiven Hohlraumvolumens von 30% und ohne externe Zuflüsse würde eine Entnahme von 35m³ bei Verteilung auf den Bruchbereich rechnerisch zu einer Absenkung von 0,0017m führen. Im Vergleich zu der in der Messstelle Schrägstollen im Rahmen
20 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 20 von 65 des Pumpversuchs beobachteten Absenkung des Wasserspiegels von 0,21m wird deutlich, dass das Grundwasser im Stollensystem trotz der angeschlossenen Abbauräume und Bruchbereiche im Wesentlichen gespannt reagiert. Grundwasseroberfläche im Grubengebäude und Bruchbereich (Bruchwinkel 60 ) bei einem Wasserspiegel von 200mNN Fläche ~70.000m² ABB. 4.6: VERANSCHAULICHUNG DER POTENTIELLEN FREIEN GRUNDWASSEROBERFLÄCHE IM BEREICH DER VERBROCHENEN ABBAURÄUME UND DES BRUCHFELDES Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Durchlässigkeit der Verbindungen zwischen Stollensystem und verbrochenen Abbauräumen so gering ist, das kein schneller Ausgleich von hydraulischen Gradienten erfolgt. Wenn der Grundwasserstand in dem an den Bruchraum angrenzenden Gebirge höher liegt als im Verbruchbereich, wie die bisherigen Beobachtungen in den Messstellen GWM HI 1 und GWM PS 1 andeuten, fließt dem Verbruchraum Grundwasser zu. Zusätzlich kommt es im Bereich des Bruchfeldes zu einer Versickerung von Niederschlägen. Dieses Wasser muss nach bisherigem Kenntnisstand über die in ihrer Durchlässigkeit begrenzten Verbindungen zum Stollensystem abfließen. Somit können in den verbrochenen Abbaukammern unterschiedliche Wasserstände oberhalb des Druckspiels im Stollensystem auftreten.
21 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 21 von Zusammenfassende Interpretation der hydraulischen Situation anhand der Wasserstandsbeobachtungen während der Bohrungen In Abbildung 4.7 sind die Ergebnisse der Wasserstandsmessungen für den Zeitraum der Bohrung Sohle 2 und den anschließenden Pumpversuch dargestellt. Beginn Bohrung Sohle 2 Stollenfirste durchstoßen Packer eingebaut Probenahme GWM FM1 und GWM HI 1 Packer zerbohrt Einbau und Fußzementation Rohrtour Pumpversuch GWM Sohle mnn GWM FM 1 Logger GWM HI 1 Logger Schrägstollen Logger GWM Sohle 2 Logger Fortunaschacht Logger GWM FM 1 Handmessung GWM HI 1 Handmessung GWM PS 1 Handmessung GWM Sohle 2 Handmessung Schrägstollen Handmessung Fortunaschacht Handmessung ABB. 4.7: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER WASSERSPIEGEL IN DER GWM SOHLE 2 UND DEN MESSSTELLEN SCHRÄGSTOLLEN, FORTUNA UND GWM HI 1 UND GWM FM 1 WÄHREND DER BOHRARBEITEN SOHLE 2 Der in der Messstelle GWM HI 1 gemessene Druckspiegel im Hilssandstein lag während des bisherigen Beobachtungszeitraums kontinuierlich oberhalb des Wasserspiegels in der Messstelle Schrägstollen. Gleiches gilt für die im Posidonienschiefer ausgebaute GWM PS 1, für die bisher wenige Messungen vorliegen.
22 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 22 von 65 Die Ganglinie des Wasserstandes/Druckspiegels in der Schrägstollenmessstelle zeigt im Zeitraum der Bohrung Sohle 2 zwei Berge, die mit dem Bohrungsverlauf korrelieren. Nach einem kontinuierlichen, langsamen Anstieg während der Kernbohrung erfolgte nach dem Durchbohren der Stollenfirste der Schachtumfahrung Sohle 2 am ein schneller Anstieg des Druckspiegels um ca. 1m, ohne dass dem Bohrloch Spülung zugeführt worden wäre. Nach dem Einbau des verlorenen Packers am , der die Kernbohrung gegenüber dem Stollen abdichtete, fiel der Druckspiegel im Schrägstollen schnell bis auf ein Niveau etwas oberhalb des Spiegels von ab. Diese Beobachtung ist ein Indiz für einen starken Wasserzulauf über das Kernbohrloch in das Stollensystem der 2. Sohle nach dem Durchbohren der Stollenfirste. Hierbei könnte es sich um die im Rahmen der Kernbohrung verlorene Bohrspülung handeln, die wohl im durchbohrten Gesteinsabschnitt zwischengespeichert wurde. Eine entsprechende Speicherkapazität erscheint in den durchbohrten Gesteinen des Jura nur möglich, wenn ungewöhnlich viele geöffnete Störungen, Brüche oder/und Klüfte vorhanden sind. Da die Bohrung nur wenige Meter am Förderstollen der 1. Sohle vorbeiführt, könnte sich in diesem Stollen Spülung gesammelt haben, und nach Anbohren der 2. Sohle durch das Bohrloch dorthin abgelaufen sein. Eine ähnliche Situation ergab sich am beim Zerbohren des Packers im Rahmen des Aufweitens der Kernbohrung. Nach dem Zerstören des Packers wurde bis einschließlich dem mit sehr hohen Spülungsverlusten (nach Angaben der Fa. Anger s ca m³) gebohrt, was sich in einem erheblichen Anstieg des Druckspiegels im Schrägstollen äußerte. Die Anregung des Wassers im Stollensystem durch die Spülungsverluste der Bohrung Sohle 2 führte demnach zu einer unmittelbaren starken Reaktion des Druckspiegels in der Messstelle Schrägstollen, wie sie für gespannte Aquifere typisch ist. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Ganglinie an der Messstelle Fortunaschacht in abgeschwächter Form aber praktisch ohne zeitlichen Versatz den gleichen Kurvenverlauf aufweist, wie die Schrägstollenmessstelle. Ein ähnlicher, leicht verzögerter Verlauf der Ganglinie ist auch in GWM HI 1 festzustellen. Die im Flammenmergel verfilterte GWM FM1 lässt hingegen keine Reaktion auf die Bohrarbeiten Sohle 2 erkennen. In Abbildung 4.8 ist der Ganglinienverlauf in den Messstellen Schrägstollen, Fortuna, GWM Sohle 2 und GWM HI 1 den Wetterdaten von Stationen im Umfeld gegenübergestellt. Der Verlauf der mittleren Tagestemperaturen weist jeweils ca. eine Woche vor den Bergen der Ganglinien kurze Tauwetterphasen auf. Auch im vorangegangenen Zeitraum vom lag eine längere Tauwetterphase, die mit erhöhten Niederschlägen zusammenfiel. Im Zusammenhang damit wurde über mehr als zwei Wochen ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg der Wasserstände in den Messstellen Schrägstollen und Fortunaschacht beobachtet, der jedoch langsamer erfolgte, als die Anstiege in den Zeiträumen und Demnach dürften diese vergleichs-
23 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 23 von 65 weise steilen Anstiege keine Folge des Temperatur- und Niederschlagsverlaufs sondern eine Reaktion auf die Spülungsverluste während der Bohrung Sohle 2 sein Luftdruck (Tagesmittelwerte nach DWD) 1000 Braunschweig hpa Brocken Wernigerode Temperatur (Tagesmittelwerte nach DWD) Brocken Bad Harzburg C Liebenburg- Othfresen Wernigerode mm Niederschlagsmengen (Tageswerte nach DWD) Hahausen Bad Harzburg Langelsheim- Astfeld Liebenburg- Othfresen Wernigerode GWM HI 1 Logger Schrägstollen Logger mnn GWM Sohle 2 Logger Fortunaschacht Logger GWM HI 1 Handmessung Schrägstollen Handmessung Fortunaschacht Handmessung ABB. 4.8: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER WASSERSPIEGEL IN DER GWM SOHLE 2 UND DEN MESSSTELLEN SCHRÄGSTOLLEN, FORTUNA UND GWM HI 1 WÄHREND DER BOHRARBEITEN SOHLE 2
24 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 24 von 65 Die Ganglinienverläufe in den Messstellen lassen keine Korrelation mit dem Luftdruck erkennen. Im Zeitraum vom , in dem der erste Berg der Ganglinie der Schrägstollenmessstelle liegt, wurden erhöhte Niederschlagsmengen gemessen. Die Temperatur lag gleichzeitig jedoch überwiegend unter dem Gefrierpunkt, so dass keine aufgrund von Niederschlagsereignissen erhöhte Versickerung anzunehmen ist, die zu den Bergen in den Ganglinien Schrägstollen, Fortunaschacht und GWM HI 1 geführt haben könnte. Zudem fielen im Zeitraum , in dem der zweite Berg der Ganglinien liegt, keine erhöhten Niederschlagsmengen. Die voranstehenden Auswertungen weisen darauf hin, dass eine gespannte hydraulische Verbindung über den Verbindungsstollen Fortuna-Morgenstern zwischen den Stollensystem des Grubengebäudes Morgenstern und dem Fortunaschacht und damit auch dem Stollensystem der Grube Fortuna besteht. Zudem ist der Ganglinienverlauf in der im Hilssandstein verfilterten GWM HI 1 im Zeitraum der Bohrung Sohle 2 demnach nicht durch temporäre Schwankungen in der Grundwasserneubildung zu erklären, sondern eine Reaktion auf die Änderungen der Druckspiegelhöhen des Wassers im Grubengebäude Morgenstern. Hervorzuheben ist, dass der Druckspiegelanstieg infolge der Spülungsverluste bei der Bohrung Sohle 2 in der GWM HI 1 nur wenig geringer ist, als der Anstieg in der Schrägstollenmessstelle. Bei der Interpretation dieser Beobachtung sind die bereits im Abschnitt 4.2 im Zusammenhang mit dem Pumpversuch Sohle 2 angestellten Überlegungen zum effektiven Hohlraumvolumen im Bereich der verstürzten Abbauräume und des Bruchfeldes zu berücksichtigen, wonach die Spülungsverluste bei gleichmäßiger Verteilung auf das Bruchfeld (Annahme: aufgrund zu Tage durchsetzender Versturztrichter hydraulisch ungespannte Verhältnisse) höchstens für einen Wasserspiegelanstieg im unteren cm-bereich geführt haben könnten. In der starken Reaktion des Druckwasserspiegels im Hilssandstein auf die Veränderungen des Druckwasserspiegels im Stollensystem der Grube Morgenstern liegt somit ein Hinweis auf direkte, quasi gespannte hydraulische Kontakte zwischen dem Hilssandstein und dem Stollensystem Morgenstern vor, wobei der Druckspiegel im Hilssandstein leicht verzögert reagiert. Folgende Ergebnisse der hydraulischen Auswertungen sind festzuhalten: Der Wasserspiegel im Hilssandstein lag während der bisherigen Beobachtungen höher als der Druckspiegel in der Schrägstollenmessstelle. Die vorliegenden Ergebnisse sprechen dafür, dass vom Stollensystem der Grube Morgenstern eine gespannte hydraulische Verbindung über den Verbindungsstollen Fortuna-Morgenstern zum Fortunaschacht und damit zum Grubengebäude Fortuna besteht. Aufgrund des von der Schrägstollenmessstelle zur Messstelle Fortunaschacht gerichteten hydraulischen Gradienten ist davon auszugehen, dass Grubenwasser von der Grube Morgenstern in Richtung zur Grube Fortuna abfließt.
25 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 25 von 65 Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass eine quasi gespannte hydraulische Verbindung zwischen dem Stollensystem Morgenstern und dem Hilssandstein im Bereich der Messstelle GWM HI 1 mit einem auf das Stollensystem gerichteten hydraulischen Gradienten besteht. Innerhalb des ehemaligen Grubengebäudes Morgenstern sind aufgrund der hydraulisch gespannten Verhältnisse im Stollensystems und den nur begrenzt durchlässigen Verbindungen zwischen den verstürzten Abbauräumen und dem Stollensystem komplexe Strömungsverhältnisse zu erwarten. In den verstürzten Abbaukammern sind dabei zum Teil auch unterschiedliche hohe Wasserstände nicht auszuschließen. 5 Grundwasseruntersuchungen 5.1 Umfang der vergleichenden Analytik Auf der Basis der bisherigen analytischen Auffälligkeiten in Sickerwasser und Luttenschacht sowie den Erkenntnissen der letzten beiden Beprobungen der Messstelle Schrägstollen wurde ein Parameterumfang für den Vergleich der verschiedenen erwarteten Wässer zusammengestellt. Er hatte zum Ziel, eine hydrochemische Charakterisierung der verschiedenen Quellen zu erreichen. Auf diese Weise sollten hydrochemisch oder aufgrund von Schadstoffspektren charakteristische Unterschiede herausgearbeitet werden. Auf diese Weise können z.b. bei einem Pumpversuch unterschiedliche Einflüsse erkennbar werden. Parameter, die bisher im Rahmen des Monitorings unauffällig oder wenig aussagekräftig waren, wurden in dieser Parameterzusammenstellung nicht berücksichtigt. Auf folgende Parameter ist besonders hinzuweisen: Komplexbildner, wie vor allem EDTA, sind ein sehr gut geeigneter Tracer für Deponiesickerwässer ab Anfang 70er Jahre. Sie sind mobil und gut nachzuweisen. Vor allem ist aber von Bedeutung, dass es sich um eine xenobiotische also absolut künstliche Substanz handelt. Sie kann daher am und im Umfeld des Standortes eindeutig der Deponie zugeordnet werden. Die Analyse der gelösten Salze muss auch immer Hydrogenkarbonat /Säurekapazität einschließen. Dieser Parameter ist für die hydrochemische Auswertung und Ionenbilanz notwendig. Leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) sind wahrscheinlich für die Altlast Florentz typische Bestandteile, die bisher als einzige einen klaren Hinweis auf den Eintrag xenobiotischer Stoffe geben. Sie sind mobiler als BTEX-Aromaten. Ihre Konzentration sollte daher stets bestimmt werden. Verschiedene Metalle sind bisher für das Sickerwasser der Deponie und Luttenschacht auffällig. Hierzu gehören neben einigen der üblicherweise be-
26 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 26 von 65 stimmten Schwermetalle in erster Linie Wolfram, Molybdän, Niob und Rhenium. Die Untersuchung auf Bromid ermöglicht die Bestimmung des Hintergrundgehaltes, für den Fall möglicher späterer Tracerversuche (z. B. mit Kaliumbromid). Organische Säuren fungieren in der Regel als Indikator für Deponieeinfluss und wurden daher ebenfalls mit in den Untersuchungsumfang aufgenommen. Einzelne organische Säuren sind auch Anzeiger für das Vorhandensein biologischer Abbauprozesse. Tabelle 5.1: Parameterliste Grund- und Sickerwasser ph-wert elektrische Leitfähigkeit Chlorid Bromid Fluorid Sulfat Cyanid ges. Nitrat Ammonium Phosphat (PO4) Bor Hydrogencarbonat DOC Arsen Chrom ges. Nickel Zink Wolfram Niob Molybdän Rhenium Kalium Natrium Calcium Magnesium Eisen, ges. Kohlenwasserstoffe LAKW(C 6 -C 10 ) BTXE LHKW PAK Alkylphenole (Phenol / Kresole) Komplexbildner Organische Säuren (Deponieindikator) Auf die Analyse von chlororganischen Pestiziden (z.b. Lindan, DDT) wurde verzichtet, da sie in den letzten Jahren nicht nachgewiesen werden konnten. 5.2 Sickerwasser Die Ergebnisse der Sickerwasseruntersuchungen sind in der Anlage 5.1 aufgeführt und dort den Resultaten der Analyse von Grundwasser und weiteren Proben gegenübergestellt. Die Probenahme erfolgte am im Vorfeld der dortigen Sanierungsarbeiten Deponiesickerwasser Das Deponiesickerwasser wird in zwei Fassungen gesammelt, die dem ersten und zweiten Bauabschnitt der Deponie zuzuordnen sind. Das Sickerwasser von erstem und zweitem Bauabschnitt sind grundsätzlich gut miteinander vergleichbar. Es liegt im Wesentlichen eine große Übereinstimmung der Konzentrationen vor. Dies gilt vor allem für folgende Parameter: Elektrische Leitfähigkeit, Chlorid, Ammonium, Hydrogenkarbonat, Bor Kalium, DOC, Kohlenwasserstoffe, organische Säuren: Ameisensäure und Essigsäure
27 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 27 von 65 die Metalle Arsen, Chrom, Nickel, Zink, Rhenium, Eisen Naphthalin EDTA Im Deponiesickerwasser des Bauabschnittes I überwiegen gegenüber demjenigen des Bauabschnittes II die folgenden Konzentrationen bzw. Parameter: ph-wert, Sulfat, Fluorid, Bromid Natrium, Wolfram, Niob Summe PAK Im Gegenzug überwiegen im Sickerwasser des Bauabschnittes II: Calcium, Magnesium Ortho-Phosphat Molybdän Alkylphenole, BTEX-Aromaten Insgesamt ist das Sickerwasser der Deponie Morgenstern vor allem durch hohe elektrische Leitfähigkeit (um µs/cm), und einen leicht alkalischen ph-wert um ph 8 charakterisiert. Die hohe Leitfähigkeit beruht dabei vor allem auf den hohen Konzentrationen von Chlorid (1500 mg/l) und Hydrogenkarbonat (um 6200 mg/l) sowie Ammonium (um 1100 mg/l) Natrium (um 1300 mg/l) und Kalium (um 550 mg/l). Bemerkenswert ist auch der relativ hohe Gehalt an ortho-phosphat. Sulfat ist dagegen, ebenso wie Calcium und Magnesium, in auffällig geringen Konzentrationen vorhanden. Die Konzentrationen von Schwermetallen und Arsen sind im Sickerwasser der Deponie gering. Auffällig hoch sind dagegen die Konzentrationen von Wolfram (bis µg/l) sowie Molybdän, Rhenium und Niob. Bei den untersuchten organischen Schadstoffen sind die Konzentrationen von BTXE-Aromaten, Alkylphenolen oder PAK mit Konzentrationen im 10er- bis 100er-Mikrogrammbereich für ein Deponiesickerwasser nicht ungewöhnlich erhöht. LHKW oder auch leichtflüchtige aliphatische KW (LAKW) wurden nicht nachgewiesen. Der Komplexbildner EDTA bewegt sich mit Konzentrationen um 800 bis 900 µg/l in einer für Hausmülldeponien typischen Größenordnung. EDTA ist daher im vorliegenden Fall sehr gut als Indikator (Tracer) für Deponieeinfluss geeignet Luttenschacht Das Sickerwasser des Luttenschachts erfasst Wasser, das auf der alten Tagebauoberfläche migriert. Es kann sowohl aus dem alten Kippfeld der Fa. Florentz (Fässer), als auch aus dem Bereich der Deponie stammen, sofern die mineralische Sohldichtung dies zulässt. Die Position des Luttenschachts befindet sich am unteren nördlichen Rand des ehemaligen Abkippbereichs.
28 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 28 von 65 Anhand der Analysen des Deponiesickerwassers lässt sich im Vergleich mit dem Wasser des Luttenschachts ableiten, welche Parameter insbesondere für die Altlast Florentz im Bereich des Tagebaus charakteristisch sind. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die Konzentrationen der betreffenden Parameter deutlich, eventuell um ein Mehrfaches, über denjenigen im Sickerwasser liegt. Geringe Konzentrationen von Stoffen, die im Deponiesickerwasser hohe Gehalte aufweisen, deuten auf eine stärkere Verdünnung oder eben ein Fehlen des Deponieeinflusses hin. Die entsprechende Bewertung wird in der Zusammenschau möglich. Folgende Parameter bzw. Stoffe sind im Luttenschacht besonders auffällig: Sehr stark erhöhte Werte / Konzentrationen: Elektrische Leitfähigkeit, Sulfat, Nitrat, Ammonium, Cyanid, Arsen, Chrom ges., Nickel, Zink, Calcium, Eisen Ebenfalls gegenüber dem Deponiesickerwasser erhöhte Konzentrationen: Bromid Kohlenwasserstoffe, Essigsäure Gegenüber dem Deponiesickerwasser signifikant geringere Werte / Konzentrationen: ph-wert Chlorid, ortho-phosphat, Hydrogencarbonat Naphthalin, Alkylphenole EDTA Das Wasser des Luttenschachtes ist also im direkten Vergleich durch einen sehr hohen Salzgehalt geprägt, der vor allem auf Ammoniumsulfat zurückzuführen sein dürfte. Ammoniumsulfat wird beispielsweise bei der Flotation eingesetzt. - Hinzu kommt auch, dass der Cyanidgehalt gegenüber dem Deponiesickerwasser um den Faktor 10 höher ist. Ein vergleichbarer Faktor ergibt sich im Übrigen für Calcium und Eisen. Auch die erhöhten Schwermetallgehalte können für das Wasser des Luttenschachtes als prägend angesehen werden. Der vergleichsweise ebenfalls erhöhte Gehalt von Essigsäure könnte auf den Abbau organischer Substanzen hindeuten. Hier besteht möglicherweise eine Parallele zum Befund in GWM Sohle 2. Hinsichtlich des aufgrund der Altlast Florentz zu erwartenden Stoffinventars von Lösemitteln und anderen organischen Substanzen zeigen sich im Luttenschacht nur wenig Auffälligkeiten. So ist der Gehalt an Kohlenwasserstoffen mit 0,31 mg/l etwa doppelt so hoch wie im Deponiesickerwasser. Spektrum und Konzentration der BTEX-Aromaten sind mit dem des Bauabschnittes 2 zu vergleichen. LHKW wurden nicht nachgewiesen. Der Befund korreliert nur wenig mit den bisherigen Untersuchungsergebnissen, die in /4/ diskutiert sind. Demnach lagen in der Zeit nach der hydraulischen Entkoppelung der
29 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 29 von 65 beiden Schächte niedrige Schwermetallgehalte und hohe Konzentrationen von BTEX- Aromaten (bis µg/l) und Phenolen (Phenolindex bis µg/l) vor. Ein aussagekräftiger Vergleich mit früheren Daten sowie Aussagen zu möglichen Entwicklungen sind aufgrund der dünnen Datenlage nicht möglich. Besonders ungewöhnlich ist der am beobachtete hohe Natrium- und Kaliumgehalt, der in keiner Relation zu den angetroffenen Anionen steht und somit nicht nachvollziehbar erklärt werden kann. Fazit Im direkten Vergleich zeigen sich somit für das Wasser aus dem Luttenschacht deutliche Unterschiede zum Deponiesickerwasser. Der Einfluss organischer Schadstoffe aus dem Bereich des Abkippfeldes innerhalb des Tagebaus zeigt sich jedoch kaum. Dies kann durch die räumliche Lage des Luttenschachtes erklärt werden, da er, selbst unter Annahme einer stauenden Oberfläche des alten Tagebaus, nur randlich zum Kippfeld gelegen ist. Gleichwohl ist in jedem Fall für das Monitoring der Altlast Florentz im Bereich des ehemaligen Tagebaus notwendig. Insbesondere auch im Fall einer Sanierung (Deponieoberflächenabdichtung) ist der Luttenschacht für die Beobachtung der dann zu erwartenden Veränderungen und den vorher-/ nachher- Vergleich notwendig. 5.3 Grundwasser im Festgestein außerhalb des Grubengebäudes Insgesamt sind im Rahmen der Arbeiten drei Grundwassermessstellen entstanden, die das Grundwasser im Festgestein erschließen bzw. seine Beobachtung ermöglichen. Als Gütemessstellen, die auch für eine Grundwasserprobenahme nach Abpumpen geeignet sind, kommen aufgrund ihres Ausbaudurchmessers nur GWM HI1 und GWM FM1 in Betracht. Das Grundwasser dieser Messstellen wurde auf den gleichen Parameterumfang wie das Sickerwasser untersucht. Die Übersicht der Ergebnisse befindet sich in Anlage Grundwassermessstelle GWM HI 1 Die Grundwassermessstelle GWM HI1 erschließt den Hilssandstein. Sie wurde am , also gut einen Monat nach dem Ausbau und neun Tage nach dem Klarpumpen beprobt. Probenahme Aufgrund des DN80-Messstellenausbaus war während des Abpumpens für die Probenahme keine Messung der Absenkung möglich. Die Messstelle hatte zum Zeitpunkt der Probenahme ein wassererfülltes Messstellenvolumen von 290 Liter. Mit dem Ringraum ergab sich ein Wasservolumen von 399 Liter. Da die Pumpe bei einer Tiefe von 101m eingehängt wurde, entsprach das oberhalb befindliche Wasservolumen zusammen mit dem Ringraum etwa 315 Liter (Messstellenvolumen 207 Liter). Für die Pro-
30 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 30 von 65 benahme wurden insgesamt 271 Liter Grundwasser entnommen, ohne dass der Pumpenstrom abbrach. Daraus ergibt sich ein Wasseraustausch in der Größenordnung des Messstellenvolumens. Die Anlage 5.1 zeigt den Verlauf der Vor-Ort-Parameter während des Abpumpens. Nach etwa 20 Minuten bzw. einer Entnahme von 130 Litern zeichnete sich ein deutlicher Wechsel bei der elektrischen Leitfähigkeit sowie bei der Redoxspannung und dem Sauerstoffgehalt ab. Die Werte der elektrischen Leitfähigkeit stiegen von 4800 auf etwa 6000 µs/cm und nahmen danach sehr langsam wieder ab. Die Redoxspannung sank von 72 mv auf etwa -80 mv und die Sauerstoffsättigung nahm von 55 % auf 11 % ab. Das Redoxmilieu war somit bei einem rh-wert von rh 30 schwach oxidierend. - Im Vergleich zu diesen deutlichen Veränderungen blieb der sehr hohe ph-wert mit Werten zwischen 12,8 und 13 praktisch konstant. Analysenergebnisse Die in der Anlage 5.3 aufgeführten Analysenergebnisse dokumentieren ein Grundwasser mit einem ungewöhnlich hohen ph-wert. Betrachtet man die Konzentrationen der Anionen und Kationen, so fällt auf, dass der Salzgehalt verhältnismäßig gering ist, während der Gehalt an Natrium mit 440 mg/l überproportional hoch ist. Auch der Anteil von Kalium ist mit 16 mg/l auffällig hoch. Die Summe der Kationen Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium beträgt 24 mmol/l während der Anteil der Anionen 4,3 mmol/l beträgt. Die fehlende Differenz lässt sich aus dem ph-wert von 12,3 errechnen. 1 Es ergibt sich eine Hydroxidkonzentration von 20 mmol/l. Dieser Befund ist ungewöhnlich und gegenwärtig nicht zu erklären. Prinzipiell können hohe ph-werte beim Einsatz zementähnlicher Baustoffe auftreten. Es wurden Recherchen hinsichtlich der beim Messstellenbau eingesetzten Materialien durchgeführt. Wegen des möglichen Einsatzes von Natrium-Benthoniten wurde mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen (vgl. Anhang). Demnach lässt sich der Befund nicht anhand von Erfahrungen des Herstellers erklären, so dass sich über die Ursachen nur spekulieren lässt (geringe Grundwasserführung, fehlende Pufferkapazität). Eine Klärung ist letztlich nur anhand eines weiteren Monitorings möglich. Im Zusammenhang mit dem ph-wert könnte auch der deutlich erhöhte Gehalt an Molybdän stehen. Die Konzentration von 27 µg/l ist möglicherweise auf das amphotere Verhalten von Molybdän zurückzuführen. Hintergrundgehalte liegen im Grundwasser im Bereich 1-2 µg/l. Der Geringfügigkeitsschwellenwert für Molybdän (35 µg/l) wird nicht überschritten. Auffällige ist außerdem noch der Gehalt von 9 mg/l Ammonium. Er liegt deutlich oberhalb des Geringfügigkeitsschwellenwertes von 0,5 mg/l /5/. Geogene Ammoniumgehalte in Grundwasser von Jura- oder Kreide-zeitlichen Festgesteinen erreichen erfahrungsgemäß eine Größenordnung um 5 mg/l. 1 Es gilt: ph + poh = 14 Für den poh ergibt sich 14 - ph12,3 = 1,7 Die Umrechnung in molare Konzentration erfolgt durch Delogarithmierung: 10-1,7 mol/l = 0,02 mol/l = 20 mmol/l
31 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 31 von 65 Ein weiterer auffälliger Parameter ist der Gehalt gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), der mit 22 mg/l als signifikant erhöht angesehen werden kann. Der Summenparameter DOC ist nicht selektiv und erfasst nicht nur den Kohlenstoff organischer Verbindungen aus Altablagerungen, Grundwasserschäden oder Abwässern, sondern auch natürliche organische Substanzen wie z.b. Huminstoffe. Es gibt keinen Grenzwert, aber aus der Erfahrung heraus sind Werte von mehr als 10 mg/l in der Regel Anzeichen für eine mögliche Verunreinigung. Im Fall beider Parameter ist keine eindeutige Zuordnung hinsichtlich der Ursache möglich. Aufgrund der geringen Wasserführung der Messstelle ist ein Einfluss durch die eingesetzten Dämmer nicht auszuschließen. Allerdings können diese Parameter theoretisch auch auf Deponieeinfluss hindeuten. Auch in diesem Fall ist eine Klärung nur anhand eines regelmäßigen Monitorings möglich. Die für die Deponie oder Altlast typischen Schadstoffgruppen wie den organischen Lösemitteln BTXE-Aromaten, LHKW, Alkylphenolen oder PAK und Kohlenwasserstoffe, konnten nicht nachgewiesen werden. Ebenso ergaben sich bei den untersuchten Metallen und Schwermetallen keine Auffälligkeiten. Fazit Die hydrochemische Beschaffenheit des Grundwassers in der Messstelle GWM HI1 weist verschiedene Besonderheiten auf, die noch nicht abschließend beurteilt werden können. Es handelt sich um einen stark alkalischen ph-wert, der letztlich auf einen hohen Gehalt an Natriumhydroxid zurückzuführen ist. Dieser ist nicht ohne weiteres aus dem eingesetzten Dämmermaterial zu erklären, zumal die Messstelle zufriedenstellend klargepumpt war. Gleichwohl erfolgt der Abbindeprozess relativ langsam, und der Wasseraustausch der Messstelle mit dem umgebenden Gestein ist sehr begrenzt. Entsprechend gering sind die sonst üblichen Verdünnungseffekte. Vor diesem Hintergrund können auch weitere Auffälligkeiten wie die erhöhten Konzentrationen von Ammonium, DOC sowie Molybdän nicht abschließend gedeutet werden. Vor dem Hintergrund der bisherigen hydraulischen Ergebnisse ist eine Beeinflussung aus dem Bereich des Stollensystems des Grubengebäudes unwahrscheinlich. Die Konzentrationen an organischen Stoffen wie BTXE-Aromaten, LHKW, Alkylphenolen, PAK und Kohlenwasserstoffen sowie Schwermetallen und auch Cyaniden liegen unter der Bestimmungsgrenze bzw. sind unauffällig Grundwassermessstelle GWM FM1 Probenahme Die Grundwassermessstelle GWM FM1 war am fertiggestellt worden und wurde am mit dem Ziel einer Probenahme abgepumpt. Die Entnahmepumpe wurde 1m über der Messstellensohle (65m u. GOK) eingehängt. Aufgrund der raschen Absenkung bis zur Pumpe und des geringen Grundwassernachlaufs wurde nach der Entnahme von 417 Litern das Abpumpen beendet und die Probenahme durchgeführt (vgl. Anlage 5.2). Der reine Messstelleninhalt von ca. 398 Litern war durch diesen
32 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 32 von 65 Vorgang abgepumpt worden. Das Messstellenvolumen mit dem Ringraumbereich betrug bei dem angetroffenen Grundwasserstand allerdings 899 Liter. Vor diesem Hintergrund wurde vereinbart, am den Nachlauf in die Messstelle mittels Schöpfer zu beproben. Diese Probe wurde schließlich analysiert. Die Vor-Ort-Parameter zeigten während der Entnahme teilweise deutliche Veränderungen an. So stieg der ph-wert von ph 9,3 auf ph 11,6, also in einer nahezu ähnliche Größenordnung wie bei der Messstelle GWM HI1. Im Gegensatz dazu war die elektrische Leitfähigkeit mit Werten zwischen 520 und 750 µs/cm ausgesprochen gering. Der Sauerstoffgehalt zeigte einen Anstieg, der aber auf das diskontinuierliche Pumpen zurückzuführen sein kann. Die Redoxspannung reagiert träger und ist daher der verlässlichere Parameter. Sie nahm von etwa 250 mv auf etwa 100 mv ab. Das Redoxmilieu war bei einem rh-wert von rh 34 schwach oxidierend. Bis auf den sehr hohen ph-wert waren die Befunde damit unauffällig. Ein ph-wert von ph11 kann angesichts der geringen Durchlässigkeit des Grundwasserleiters ohne weiteres auf den eingesetzten Dämmer zurückgeführt werden (siehe Anhang). Analysenergebnisse Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in der Tabelle der Anlage 5.3 aufgeführt. Nahezu alle Parameter erweisen sich als unauffällig. Lediglich für Ammonium ist mit 1,2 mg/l eine Überschreitung der Geringfügigkeitsschwelle von 0,5 mg/l zu verzeichnen. Dies gilt auch für Arsen, das mit 11 µg/l den Geringfügigkeitsschwellenwert von 10 µg/l überschreitet. In beiden Fällen können in dieser Größenordnung allerdings auch geogene Ursachen vorliegen. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass die Natriumkonzentration in Relation zum Chlorid sowie den anderen Kationen etwas erhöht ist (vgl. Kap. 5.5). Möglicherweise liegt hier ebenfalls eine Beeinflussung durch Dämmer vor. Weitere Besonderheiten haben sich aus der chemischen Analyse nicht ergeben. Die Konzentrationen an organischen Stoffen wie BTXE-Aromaten, LHKW, Alkylphenolen, PAK und Kohlenwasserstoffen sowie Schwermetallen und auch Cyaniden liegen unter der Bestimmungsgrenze bzw. sind unauffällig. Fazit Die über der Geringfügigkeitsschwelle liegenden Konzentrationen von Ammonium und Arsen sowie der in Relation etwas erhöhte Natriumgehalt lassen ebenso wie der hohe ph-wert nicht ohne weiteres auf eine Beeinflussung durch Deponie oder Altlast schließen. Hier sind weitere Untersuchungen im Rahmen eines Monitorings abzuwarten, um Effekte aus dem im Messstellenbau eingesetzten Dämmer ausschließen zu können, da sich diese bei Messstellen in gering durchlässigen Schichten länger bemerkbar machen können.
33 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 33 von Grundwasser innerhalb der Grube Morgenstern Schrägstollen Im Jahr 2012 wurden insgesamt drei Grundwasserprobenahmen an der Messstelle GWM Schrägstollen durchgeführt. Im Vergleich zur bisherigen Probenahme wurde im Mai und Dezember ein anderes Vorgehen gewählt. Anlass war das Analysenergebnis einer Beprobung durch das NLWKN, die am durchgeführt wurde. Es ergab eine BTEX-Konzentration von 36,13 µg/l mit der Hauptkomponente Toluol. Es sollte daher im Mai 2012 eine Überprüfung vorgenommen werden. Bei der Beprobung im März 2012 war, wie bei früheren Pumpprobenahmen, mit einer MP1-Tauchpumpe eine Gesamtfördermenge von 180 Liter entnommen worden. Das Rohrvolumen der wassererfüllten Filterstrecke beträgt allerdings etwa 380 Liter, so dass bei den weiteren Probenahmen wenigstens ein vollständiger Austausch des Wasservolumens erzielt werden sollte. 2 Zu diesem Zweck wurden die weiteren Probenahmen im Mai und Dezember mit leistungsfähigeren Tauchpumpen durchgeführt (BPT Wöltjen GmbH). Im Mai 2012 wurden 10m³ und im Dezember m³ Grundwasser entnommen. Diese Entnahmen sind in jedem Fall als repräsentativ anzusehen. Vorgehen und Untersuchungsergebnisse sind in den Berichten vom /1/ und /2/ dargestellt. Messstellenzustand Die Messstelle GWM Schrägstollen reicht bis auf die Sohle des Schrägstollens. Im Bereich von bis zu 2m über der Sohle ist ein direkter Zustrom aus dem Schrägstollen bzw. Grubengebäude möglich. Da hier das Grundwasser frei strömen kann ist oberhalb im Verhältnis dazu praktisch kein Zustrom zu erwarten. Es wird also das im stollenbefindliche Grubenwasser beprobt. Bei der Probenahme im Dezember 2012 wurde nach etwa zweidreiviertel Stunden Pumpzeit mit 2,3 m³/h eine Absenkung von 2,31m erreicht. Sie war damit deutlich stärker als im Mai, als nach zwei Stunden Pumpzeit mit 5 m³/h eine Absenkung von 1,07 m erzielt wurde. Das Absenkverhalten lässt auf einen erhöhten brunnenwiderstand schließen. Aus diesem Grund wurde eine Kamerabefahrung der Messstelle Schrägstollen durchgeführt (Anhang 9). Die Befahrung zeigte, dass die in das Stahlrohr geschnittenen Filterschlitze kaum noch erkennbar und stark zugewachsen sind. 2 Die Untersuchungen im Rahmen des Monitorings an der Deponie Morgenstern an der Messstelle Schrägstollen, die nicht vom NLWKN durchgeführt wurden, basieren auf Grundwasserproben, die mittels Schichtmessheber (Bailer) aus dem Niveau der Filterstreckenoberkante (ca. 78m u. ROK) und über der Sohle (ca. 100 m u. ROK) entnommen wurden. Es wurden auf diese Art jeweils 12 Liter Grundwasser zu Tage gefördert.
34 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 34 von 65 Die Messstelle ist daher für die weitere Überwachung im Rahmen des Monitorings zu sanieren. Analysenergebnisse Die Ergebnisse der beiden letzten Untersuchungen ergaben zusammenfassend folgende auffällige Befunde (vgl. Tab. 5.2): BTEX-Aromaten ließen sich im Rahmen der Grundwasseruntersuchungen vom Mai und Dezember 2012 nicht nachweisen. Der singuläre Befund vom März 2012 konnte also nicht bestätigt werden. Besonders bemerkenswert war im Dezember die mit 11,6 C deutlich geringere Temperatur des geförderten Grundwassers (Mai 14 C), die einen jahreszeitlichen Einfluss nahelegt, der in dieser Tiefe und im Grubenwasser nicht ohne weiteres zu erwarten wäre. Da gleichzeitig auch das Redoxpotential anstieg, ist auf einen Einfluss durch Grundwasserneubildung zu schließen. Tabelle 5.2: Gegenüberstellung ausgewählter Analysenergebnisse Entnahmedatum m 100m 78m 100m 100m?90m? 97,5m 94m Abdampfrückstand mg/l Chlorid mg/l Cyanid gesamt mg/l 0 0 0,005 0, <0,005 <0,005 Fluorid mg/l 0 0 0,50 0, ,14 0,33 -- Sulfat mg/l Ammonium (NH4) mg/l 1,1 5,1 6,5 9,6 11 3,5 7,7 5,6 Arsen mg/l ,01 0, ,03 -- Bor mg/l 2,1 1,8 1,8 1,7 1,9 2,0 2 1,5 Calcium mg/l Eisen mg/l 0,0694 0,072 3,6 9, ,0 4,6 3,3 Kalium mg/l 7,2 8, Magnesium mg/l Natrium mg/l CSB mg/l <15 20 <15 TOC, l mg/l 3,5 5,1 3,2 3, ,8 Summe BTEX µg/l 0 0 1,0 1,0 0 36,1 <1 <1 cis-1,2-dichlorethen µg/l 0 0 0,50 0,50 2,4 -- 1,5 <1 Vinylchlorid µg/l 0 1,4 1,3 2,1 2,1 -- 1,2 <1 Summe LHKW µg/l 0 1,4 1,3 2,1 4,5 -- 2,7 <1 Methan µg/l EDTA µg/l ,2 2,6 Bromid mg/l <0,5
35 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 35 von 65 Im direkten Vergleich vom Ergebnis Dezember zum Mai 2012 ergibt sich für praktisch alle Parameter eine Verringerung der Konzentration. Dies deutet ebenfalls auf einen jahreszeitlichen Einfluss durch Grundwasserneubildung hin. Bemerkenswert ist das Fehlen der LHKW, die in der Regel immer wieder in Spuren festgestellt wurden. Es deutet ebenfalls auf die konstatierte Verdünnung (hier unter die Bestimmungsgrenze) hin Chlorid mg/l Sulfat mg/l Natrium mg/l Ammonium (NH4) mg/l Bor mg/l Calcium mg/l Kalium mg/l Magnesium mg/l Ammonium (NH4) mg/l Bor mg/l 8 6 Kalium mg/l ABB. 5.1: ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER PARAMETER IM GRUNDWASSER DER GWM SCHRÄGSTOLLEN.
36 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 36 von 65 Der Komplexbildner EDTA wurde im Mai und Dezember in signifikanter Konzentration (>1µg/l) nachgewiesen. 3 Die Konzentrationen sind mit 4,2 bzw. 2,6 µg/l ein erster Beleg für den Deponieeinfluss und zeigen gleichzeitig den erwähnten jahreszeitlichen Effekt. Ursache für den relativ direkten Einfluss der Grundwasserneubildung ist sehr wahrscheinlich der Umstand, dass der Schrägstollen nicht verfüllt wurde. Er wurde zwar an der Geländeoberfläche verschlossen, wird aber eine hydraulische Anbindung an die oberflächennahen Schichten haben und von dort Wasser sammeln. Insofern ist ein möglicher Zulauf von Tagwässern bzw. Sicker- und Kluftwässern naheliegend. Das Grundwasser im Schrägstollen wird also direkt durch Neubildung beeinflusst und es kommt zu einer Verdünnung der Konzentrationen (Im Dezember etwa 1 zu 1,3). - Gleichzeitig ist der Grundwasserstand aber gering, da es sich um den Grubenwasserstand handelt, der die hier beobachtete Neubildung in seiner Gesamtheit eher etwas gedämpfter und später erfährt. Die Abbildung 5.1 zeigt die Entwicklung ausgewählter Parameter in der Messstelle GWM Schrägstollen. Dabei fällt vor allem auf, dass bei den letzten beiden Probenahmen der Gehalt an Calcium und Sulfat deutlich höher war. Dies ist vermutlich auf die veränderte und repräsentativere Art der Probenahme zurückzuführen. Gleichzeitig kann daraus geschlossen werden, dass die Versinterung in der Messstelle wahrscheinlich auf Calciumcarbonate und -sulfate zurückzuführen ist. Ähnliches ist auch aus Deponiedrainagen bekannt.- Als Quelle für das Calciumsulfat kommt nahe liegender weise die Bauschuttdeponie in Betracht. Anhand der Aufstellung in der Tabelle 5.1 zeigt sich, dass immer wieder zumindest geringe Spuren von BTEX-Aromaten, vor allem aber LHKW, gefunden wurden. Insbesondere die LHKW sind dabei nach den früheren Untersuchungen an Proben aus dem Luttenschacht und des Deponiesickerwassers nicht auf die Deponie zurückzuführen, sondern gehen eher auf die Altlast Florentz zurück. Eine solche eindeutige Aussage lässt sich nicht für die BTEX-Aromaten konstatieren, da sie auch im Deponiesickerwasser vorkommen. Der Einfluss der Hausmülldeponie lässt sich hingegen anhand des Komplexbildners EDTA ableiten. Geht man von etwa 800 µg/l EDTA im Sickerwasser aus, so ergibt sich bei 4 µg/l EDTA im Wasser von GWM Schrägstollen ein Sickerwasseranteil in der Wasserprobe von 0,5%. Geht man zur Probe von etwa 1200 mg/l Ammonium im Sickerwasser aus (vgl. Anlage 5.3), so ergibt sich für das Grundwasser eine erwartete Konzentration von 6 mg/l. Dies stimmt sehr gut mit den beobachteten Konzentrationen überein. Die Geringfügigkeitsschwellenwerte werden im Fall der Parameter Sulfat, Ammonium, Bor und Arsen überschritten. Ursache hierfür sind die Einflüsse der Deponie. Der 3 Die Bewertung erfolgt auf der Basis von Beobachtungen aus Baden-Württemberg. Für das dortige Grundwasserüberwachungsprogramm wurde für EDTA ein Warnwert von 1 µg/l (GÜP-Warnwert) formuliert /3/. Die Bedeutung von NTA und DTPA erwies sich dagegen bei diffusen Einträgen im Vergleich zu EDTA als vernachlässigbar.
37 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 37 von 65 Einfluss der Altlast Florentz findet sich, vermutlich aufgrund der räumlichen Entfernung, nur in Spuren wieder. Fazit An der Messstelle Schrägstollen lassen sich in den Grundwasserproben sowohl Einflüsse der Deponie Morgenstern und der Bauschuttdeponie als auch der Altlast Florentz nachvollziehen. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2012 deuten außerdem darauf hin, dass das Wasser im Schrägstollen direkt von der Grundwasserneubildung beeinflusst wird, die sich über den offenen und nur an der Oberfläche verschlossenen Stollen gesammelt wird. Wahrscheinlich aufgrund der räumlichen Entfernung ist der Einfluss der Altlast Florentz deutlich geringer als derjenige der Deponie. Die Messstelle ist stark versintert, so dass der Brunnenwiderstand stark erhöht ist. Zur Instandhaltung für das weitere regelmäßige Monitoring ist eine Sanierung der Messstelle notwendig Grundwassermessstelle GWM Sohle 2 Die Grundwassermessstelle GWM Sohle 2 hatte zum Ziel, das Schadstoffpotential im Bereich des Schachtes Morgenstern zu erkunden. Dabei war die Vorstellung maßgeblich, dass das Abkippen von flüssigen Schadstoffen in den Schacht sich am ehesten im Grundwasser des Stollens der Sohle 2 widerspiegeln sollte. Dort ist hydraulisch eine unmittelbare Anbindung an den Schacht vorhanden, während das umgebende tonige Gestein weitgehend schwer durchlässig ist. Der Ausbau der Messstelle erschließt den vollständigen ehemaligen Querschnitt des Umfahrungsstollens sowie den wesentlichen Teil des darüber befindlichen, durch Nachbrechen stark geklüfteten Tonsteins. Während der Bohrung war nach dem Erreichen der ersten Hinweise hinsichtlich von Belastungen auf den Gesteinsklüften (ab ca. 62m u. GOK) eine Wasserprobe untersucht worden, die nur geringe Konzentrationen von LHKW und Alkylphenolen erkennen ließ (Probe vom in Anl. 5.3). Während der Kamerabefahrung ergaben sich keine optischen oder andere organoleptischen Hinweise (z.b. kein Geruch an der Kamera) auf eine signifikante Verunreinigung. Aus diesem Grund wurde vorgesehen, das Klarpumpen der Messstelle mit der Durchführung eines mehrtägigen Pumpversuchs zu kombinieren. Pumpversuch Zu diesem Zweck stand ein mit 2,5 Tonnen Aktivkohle bestückter Aktivkohlefilter zur Verfügung, der von vornherein für den Fall kontaminierter Wässer vorgehalten worden war.
38 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 38 von 65 Es wurde ein Pumpversuch über einen Zeitraum von acht Tagen mit einer Entnahmerate zwischen 6 und 8 m³/h vorgesehen. Ziel war es, mit einem Entnahmevolumen von bis zu 1000 m³ Grundwasser zunächst, das während der Bohrarbeiten eingebrachte Spülwasser wieder zurückzuholen. Ein weiteres Ziel war es, Wasser aus dem Abzweig des Stollens Sohle 2 im Osten heranzuziehen. - Der Stollen befindet sich quasi in einer Sackgassensituation der Schacht und die Messstelle GWM Sohle 2 liegen dabei im Bereich des Wendehammers. Wird also an der GWM-Sohle 2 gepumpt wird im Wesentlichen Grundwasser aus dem Grubengebäude heranströmen, das unter den vorherigen Gleichgewichtsbedingungen in keinem Fall in Richtung Schacht geströmt wäre.- Mit dem Pumpen einer größeren Menge Grundwasser sollte Wasser herangezogen werden, das möglicherweise Aufschluss über den Einfluss der i ehemaligen Tagebau abgekippten Chemikalien, aber auch den Einfluss der Deponie zulässt. Die Planung erfolgte unter der Prämisse, dass, wie beobachtet, nur moderate Schadstoffkonzentrationen im Bereich des Schachtes Morgenstern vorkommen. Für den Fall, dass nach einer gewissen Pumpzeit Ablaufcontainer sehr hohe Konzentrationen ABB. 5.2: PRINZIPSCHEMA DER AUFBEREITUNGSANLAGE FÜR DEN PUMPVERSUCH SOHLE oder gar Mineralöl- 2 (GEÄNDERT NACH EINEM PLAN DER BC-ENVIROTEC). oder Lösemittel in reiner Phase angezogen würden, war ein Abbruch vorgesehen. Die Tauchpumpe für den Pumpversuch wurde von der Fa. Anger so eingebaut, dass der Pumpeneinlass etwa in 84m Tiefe unter GOK liegt. 4 Bereits beim probeweisen Anpumpen (Funktionstest) in den Vorlagecontainer wurde festgestellt, dass etwa die ersten 50 Liter nahezu des gepumpten Wassers ausschließlich aus einer Art Mineralölphase bestanden. Im Container setzte sich eine aufschwimmende Leichtstoffphase ab. Zum Loten des Grundwasserstandes wurde das Lot ebenfalls durch die Ölphase benetzt. Mit Hilfe des Lots war, auch nach Reinigung der Elektrode, keine reguläre Messung des Grundwasserstands möglich. Es zeigte sich, dass die Phase sehr ausgeprägt sein muss, da sich durch Abstreifen des Lots etwa 100ml Probenmenge gewinnen ließen. Die Probe wurde der GBA zur Analyse übergeben (Auftragsnummer 4 Die Pumpe ist zum Zeitpunkt der Berichtstellung nach wie vor installiert.
39 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 39 von ). Für die Ölprobe wurde von uns eine Untersuchung auf die Parameter PAK, BTEX, LCKW, PCB, Chlorbenzole und Summe Chlor veranlasst. Außerdem soll ein GC-FID-Screening zur Ölcharakterisierung erstellt werden. - Ebenso wurden 1,5 Liter Wasserprobe, die von der Fa. Anger gezogen worden waren, dem Labor übergeben (Auftragsnummer ). Diese Probe war nach dem Auftreten der Ölphase aus dem nachfolgenden Wasser entnommen worden. Es zeigte sich, dass eine Entmischung von Emulsion erfolgt sein muss, so dass sich eine mehrere Millimeter dicke Leichtstoffphase absetzen konnte. Die Analyse ergab einen Volumenanteil der organischen Phase von 2%. Es zeigte sich, dass in der Ölphase Aromaten einen Anteil von etwa 13% ausmachten (vgl. Anl. 5.4). Aufgrund des Befundes wurde beschlossen, dem Naßaktivkohlefilter zur Aufbereitung ein Leichtflüssigkeits- und Koaleszenzabscheider vorgeschaltet werden muss, um den Fliter nicht gleich zu Beginn erheblich zu belasten. Zu diesem Zeitpunkt wurde erwartet, dass im Zuge der Verdünnung durch herangezogenes Grundwasser, die Konzentration relativ rasch wieder abnehmen könnte. Ein Container mit geeigneter Kapazität für den anvisierten Volumenstrom konnte kurzfristig von der BC-Envirotec GmbH gestellt werden. Die Abbildung 5.2 zeigt die prinzipielle Anordnung der Wasseraufbereitungsanlage. in der Anlage zu diesem Schreiben zeigt die Platzierung des Koaleszenzabscheiders im System der Wasseraufbereitungsanlage. Der Pumpversuch war von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Goslar mit dezidierten Auflagen hinsichtlich der Überwachung und Reinigungsleistung genehmigt worden. Es umfasste eine kontinuierliche Überwachung der Konzentration aromatischer und leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (BTEX und LHKW) sowie die Aufzeichnung von Vor-Ort-Parametern. Im Fall einer Überschreitung der vorgegebenen Grenzwerte für die Einleitung in den Regenwasserkanal sollte der Pumpversuch beendet werden. Folgende Ablaufwerte waren einzuhalten: Summe BTEX-Aromaten 10 µg/l Summe LHKW 10 µg/l Kohlenwasserstoffe gesamt 5 mg/l Zur Beweissicherung war außerdem vor und nach dem Pumpversuch der Straßenseitengraben der K32 beprobt worden (vgl. Anhang). Die Messungen erfolgten, anders als ursprünglich vorgesehen, nur im Ablauf hinter dem Aktivkohlefilter, da im Zulauf bei Förderung einer Emulsion aus Kohlenwasserstoffen und Wasser keine sinnvolle Messung möglich war. Insofern begannen die Messungen zeitversetzt, nach dem das Totvolumen der Behälter der Aufbereitungsanlage (Abscheider und Filter) gefüllt war. Der Pumpversuch startete am um 15:15 Uhr. Das geförderte Wasser wies einen erheblichen Anteil an Mineralöl- oder Lösemittelphase auf. Es wurde eine Emulsion aus Kohlenwasserstoffen und Wasser gefördert, die sich nur langsam im Abscheider entmischte. Die in Abbildung 5.3 zusammengestellten Fotos dokumentieren
40 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 40 von 65 den Zulauf in den Abscheidecontainer. Das Phasengemisch bzw. die Emulsion nahm im Verlauf der Zeit eine hellere Farbe an, wechselte von dunkelbraun zu grau. Im Verlauf der gut 5 Stunden des Pumpversuchs wurden die in der Tabelle 5.3 aufgeführten Proben entnommen: Tabelle 5.3: Pumpversuchsverlauf GWM Sohle2 Datum Uhrzeit Std. nach Pumpbeginn Summe gepumptes Volumen [m³] Entnahmestelle Parameterumfang Pumpversuchsstart um 15: :00 Zulauf 0,75 5 VOLLUMFANG :15 Zulauf 4 32 Ammonium /CSB :15 Ablauf 5 39 BTXE, LHKW Pumpversuchsstop um 20:30 Uhr 40 Ende der Ableitung in den RWK! Neustart um 11:30 Uhr Ableitung in bisherigen Ablaufcontainer Zulauf Leistung 1,2 40 KW, LAKW, 11:30 m³/h BTXE, LHKW Zulauf Leistung 1,2 12:25 m³/h 41 VOLLUMFANG Zulauf Volle Pumpenleistung BTXE, 42 KW, LAKW, 12:50 LHKW Versuchsende 13:00 Uhr 43 ABB. 5.3: GEFÖRDERTES GRUNDWASSER MIT SCHWIMMPHASE ZU BEGINN UND WÄHREND DES PUMPVERSUCHS
41 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 41 von 65 Der Pumpversuch wurde bereits am Abend des um 20:30 beendet. - In den 5,25 Stunden wurde bei einer durchschnittlichen Förderleistung von gut 7,5 m³/h eine Menge von 40 m³ entnommen. - Grund für Abschaltung war die Überschreitung der Ablaufwerte, die mit der kontinuierlichen Überwachung mit Hilfe einer GC-Messeinheit der Synspec GmbH festgestellt wurde. Die Abbildung 5.4 zeigt den Verlauf der Messwerte für die erfassten Einzelstoffe. Den Hauptanteil am Stoffspektrum stellten erwartungsgemäß die BTEX-Aromaten. Der gezeigte Befund stimmt gut mit dem Ergebnis der im Labor untersuchten Ablaufprobe überein, das 480,4 µg/l BTXE-Aromaten und 240 µg/l LHKW aufwies (Auftragsnummer , Anhang 1). ABB. 5.4: VERLAUF DER VON DER SYNSPEC GEMESSENEN AROMATEN UND LHKW-KONZENTRATIONEN IM ABLAUFCONTAINER. Die Vor-Ort-Parameter zeigten eine relativ konstante Redoxspannung die von 100 mv auf 140 mv anstieg, sowie eine Zunahme der elektrischen Leitfähigkeit von etwa 1250 µs/cm auf 1400 µs/cm (Abb. 5.5). Darüber hinaus sank der ph-wert (gemessen im Ablaufcontainer) von anfänglich ph 9,4 auf ph 8,9. Am folgenden Tag, dem , wurde die Entnahme zum Zweck einer Abschlussbeprobung erneut in Betrieb genommen (vgl. Tab. 5.2). Dies war möglich, da der Ablaufcontainer noch genug freies Aufnahmevolumen aufwies. Zu diesem Zweck und um mögliche Effekte bei deutlich gedrosselter Entnahme beobachten zu können, wurde zunächst für eine Stunde mit einer Pumpleistung von nur 1,2 m³ gefördert. Die Emulsion erwies sich in diesem Entnahmebetrieb als weniger stark (s. u.). Um zu sehen, wie schnell die Reaktion auf eine erneute Entnahmeerhöhung erfolgt, wurde zum Schluss nochmals für insgesamt etwa 20 Minuten mit voller Leistung gepumpt. Die Veränderung machte sich unmittelbar in der Zunahme des geförderten Phasenanteils bemerkbar.
42 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 42 von mv µs/cm : : : : : : :52 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 C ph 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8, : : : : : : :52 ABB. 5.5: VERLAUF DER VOR-ORT-PARAMETER IM ABLAUFCONTAINER Vorbemerkungen zur Analyse Bei der Betrachtung der Untersuchungsergebnisse ist zwischen der Analyse im geförderten Grundwasser und in der aufschwimmenden Mineralöl- und Lösemittelphase (Schwimmphase) zu unterscheiden. Gleichwohl ist bei der Analyse des Grundwassers stets zu berücksichtigen, dass die Entmischung ggf. nicht vollständig war und daher auch Konzentrationen oberhalb der Löslichkeitsgrenzen auftreten können. Ferner ist zu beachten, dass bei der Analyse der Schwimmphase die Konzentrationsangaben in mg/kg erfolgen. Aufgrund der starken Präsenz einer Schwimmphase konzentrierten sich die zusätzlichen Untersuchungen vor allem auf diese. Ziel war und ist es, eine möglichst weit reichende Vorstellung von dem beteiligten Stoffspektrum zu bekommen. Aus diesem
43 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 43 von 65 Grund wurden neben gezielten Analysen auf weitere Stoffgruppen (z.b. PCB, Dioxine, Chlorpestizide) auch GC/MS-Übersichtsuntersuchungen durchgeführt. Sie sollen zusätzliche Hinweise auf mögliche weitere wichtige Stoffgruppen geben. Der Analyse der Schwerphase kommt auch deshalb besondere Bedeutung zu, weil sich gezeigt hat, dass offensichtlich sehr ein großes Schadstoffpotential vorliegt. Die Untersuchung des Grundwassers ist unter diesen Umständen wenig repräsentativ, da stets eine starke Störung des durch Diffusion entstandenen Gleichgewichtszustandes erfolgt. Ergebnisse der Grundwasseranalyse sind also hinsichtlich der an der Schwimmphase beteiligten Stoffe als nicht repräsentativ anzusehen. Sie können insofern nicht verlässlich für eine Gefährdungsabschätzung des Stoffaustrags herangezogen werden. Gleichwohl lassen sich, insbesondere über die anderen untersuchten Parameter, hydrochemische Rückschlüsse ziehen. Analysenergebnisse Grundwasser Betrachtet man zunächst nur die anorganischen Parameter, so erweisen sich diese als weitgehend unauffällig. Die elektrische Leitfähigkeit des Grundwassers lag mit etwa 1700 µs/cm in der Größenordnung derjenigen in der GWM Schrägstollen. Auch der im Labor bestimmte ph-wert lag mit ph7 bis ph7,5 im vergleichbaren Niveau. Eine Überschreitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten (GFS-Wert) liegt im Fall von Ammonium und Chlorid (Analysenauftrag ) vor. Die Ammoniumkonzentration ist mit 1,4 bis 1,8 mg/l wesentlich geringer als in der GWM Schrägstollen (vgl. anl. 5.3). Beim Chlorid fällt auf, dass es im Verhältnis zum Sulfat deutlich stärker vertreten ist. Allerdings ist die molare Konzentration von Natrium auch in der Messstelle GWM Sohle 2 noch höher. Hinweis auf einen mikrobiellen Abbau können insofern nicht aus dem Chloridgehalt abgeleitet werden. Auffällig ist schließlich auch der Nachweis von Cyanid mit 0,023 mg/l (GFS-Wert 0,05 mg/l). - Hier erfolgt an Rückstellproben noch eine Prüfung auf leicht freisetzbares Cyanid, da hierfür ein GFS-Wert von 0,05 mg/l gilt. Die Konzentration von Orthophosphat ist ebenfalls im Vergleich zur GWM Schrägstollen signifikant erhöht (0,23 µg/l). Für die beiden zuletzt genannten Parameter ist ein Zusammenhang mit Abfallstoffen aus metallverarbeitenden Betrieben vorstellbar. Die Konzentrationen von Metallen und Schwermetallen sind allerdings im Grundwasser der Sohle 2 unauffällig. Bei den organischen Stoffen zeigt sich selbst an der am geringsten belasteten Probe, die am im gedrosselten Pumpbetrieb gezogen wurde, eine sehr hohe Überschreitung der Referenzwerte. Auf sie wird nur der Vollständigkeit halber eigegangen, da sie m Bereich des jetzt angebohrten Schadensherdes keine Relevanz besitzen: Konzentrationen im Grundwasser an der vergleichsweise gering belasteten Grundwasserprobe (Auftragsnummer Anl. 5.3): Kohlenwasserstoffe 90 mg/l (GFS-Wert 0,1 mg/l) Summe PAK (ohne Naphthalin) 0,53 µg/l (GFS-Wert 0,2 mg/l)
44 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 44 von 65 Naphthalin 45 µg/l (GFS-Wert 2 mg/l) Summe LHKW 6126 µg/l (GFS-Wert 20 µg/l) Summe BTEX µg/l (GFS-Wert 20 µg/l) Außerdem: Summe Alkylphenole 245 µg/l (GFS-Wert für Phenol 8 µg/l) Summe LAKW (C6-C10) 3390 µg/l Die vorangehende Gegenüberstellung zeigt, dass die Geringfügigkeitsschwellenwerte um mehrere Größenordnungen überschritten werden. Der Anlage 5.3 ist darüber hinaus zu entnehmen, die Konzentrationen bei starkem Pumpen nochmals um zwei Zehnerpotenzen anstiegen. Die Proben und zeigen, dass sich die hohe Startkonzentration am nächsten Tag bei erneuter voller Pumpleistung sehr gut reproduzieren ließ. Aus den Konzentrationen von KW, LAKW, BTXE und LHKW ergeben sich für das Gemisch in der Summe Gehalte von etwa 3 bis 5 g/l. Dies entspricht 0,3 bis 0,5 Gewichtsprozent. Berücksichtigt man auch noch den Befund vom Anpumpen, der einen Volumenanteil von 2% ergab, so lässt sich abschätzen, dass ohne weiteres 200 Liter Lösemittelphase gefördert wurden. Anhand der GC/MS-Übersichtsanalysen der Probe vom :00 Uhr wurden CKW und Toluol C2-, C3- und C4-Aromaten, Terpene, PAK und Phthalate (Weichmacher) sowie weitere Alkene nachgewiesen. Hinzu kommen im mittel- bis schwerflüchtigen Bereich alkyliertes Benzol, n-propytoluol, n-alkan>c10, Tetrahydronaphthalin und Phenylether. Das Vorhandensein von signifikanten Mengen Essigsäure (4,7 bis 6,2 mg/l) ist ein möglicher Anhaltspunkt für mikrobiologische Abbauprozesse. Die Konzentration ist teilweise höher als im Deponiesickerwasser. Das Fehlen der Ameisensäure spricht im Übrigen gegen eine Herkunft aus der Deponie. Dies könnte auch dadurch belegt werden, dass der Komplexbildner EDTA nicht nachzuweisen war. Allerdings war die Bestimmungsgrenze aufgrund der organischen Matrix auf 5 µg/l erhöht. Analysenergebnisse Schwimmphase Die organische Matrix, also das vorliegende Gemisch vieler sehr unterschiedlicher organischer Einzelsubstanzen stellt auch durchaus eine Schwierigkeit bei der Analyse dar. Die analytischen Routineverfahren sind auf reine Wasseranalytik ausgelegt und nicht ohne weiteres auf die Analyse der Schwimmphase übertragbar. Insofern müssen auch längere Analysenzeiten in Kauf genommen werden. Anhand eines FID-Screenings der Schwimmphase konnte gezeigt werden, dass es sich bei den aliphatischen Kohlenwasserstoffen vor allem um Verbindungen der Kettenlänge C6 (Hexan) bis um C20 handelt (Anlage zu Prüfbericht 2013P602195). Damit handelt es sich um relativ leichtflüchtige und mobile Kohlenwasserstoffe. Anteile von Dieselöl oder gar Schmieröle sind nicht von Bedeutung. Anhand der GC/MS-Übersichtsanalysen zeigte sich, dass die Schwimmphase neben LHKW und Toluol C2-, C3- und C4-Aromaten, Terpene, Indan (Bestandteil von Stein-
45 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 45 von 65 kohlenteer), PAK und PAK-Derivate und viele weitere Alkane und nicht näher identifizierbare Kohlenwasserstoffe umfasst (Anlagen zu Prüfbericht 2013P (vgl. Anhang 1)). Inwieweit die gefundenen Weichmacher (Phthalat) probenspezifisch ist, bleibt abzuwarten, da in fast jedem Screening die ubiquitär vorkommenden Weichmacher zu finden sind. Die Anlage 5.4 zeigt, dass allein die BTEX-Aromaten( mg/kg) bereits einen Anteil von etwa 13 Prozent an der Schwimmphase ausmachen. Der Anteil der PAK (685 mg/kg) und der LHKW bzw. LCKW (641 mg/kg) sowie der Chlorbenzole (610 mg/kg) ist demgegenüber eher gering. Sie sind aber, ebenso wie die mit 210 mg/kg nachgewiesenen PCB, als wesentliches Charakteristikum des Schadens geeignet und bei den künftigen Untersuchungen zu berücksichtigen. Im Fall der LHKW ist festzuhalten, dass es sich nahezu ausschließlich um das Abbauprodukt cis-1,2-dichlorethen handelt, das auch in den Grundwasserproben mit Abstand die dominierende LHKW-Substanz ist. Das ebenfalls immer wieder im Grundwasser angetroffene Vinylchlorid fehlt dagegen in der Schwimmphase. Dies wird bei einer künftigen Diskussion der natürlichen Abbauprozesse von Bedeutung sein. Die Prüfberichte bzw. Ergebnisse einer nachbeauftragten Analyse auf Chlorpestizide, Chlorphenole und Chlorparaffine sowie leicht freisetzbare Cyanide stehen noch aus. Mündlich wurde uns vom Labor GBA übermittelt, dass in der Probe Auftragsnummer bisher keine Chlorpestizide gefunden wurden (Lindan, DDT). Aufgrund der relativ hohen Konzentrationen chlorierter Verbindungen und des Chlor ges.-gehaltes von 0,37 Gew.% wurde auch eine Analyse auf polychlorierte Dioxine und Furane durchgeführt. Es ergab sich eine Konzentration von ng/kg TM Toxizitätsäquivalenten für die Summe PCDD/PCDF (NATO/CCMS). Dieser signifikant hohe Wert ist vor allem auf den relativ hohen Anteil des als besonders toxisch eingestuften 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxins zurückzuführen. Fazit Durch die Bohrung Sohle 2 wurde der Verdacht einer schwerwiegenden Kontamination durch ein Gemisch im Bereich des Schachtes Morgenstern nachdrücklich bestätigt. Es ist von größeren Mengen organischer Leichtstoffphase im Bereich des Stollens Sohle 2 auszugehen. Insgesamt ist das vorgefundene Stoffgemisch nicht nur aufgrund der nachgewiesenen Stoffgruppen und Einzelsubstanzen, sondern auch wegen der möglichen kombinierten toxikologischen Wirkung als kritisch einzustufen. Für künftige Arbeiten an der Messstelle Sohle 2 ist daher ein angepasstes Arbeitsschutzkonzept aufzustellen. Eine Schwarz-Weiß-Anlage und die entsprechenden Reinigungs- und Entsorgungsmöglichkeiten sind wahrscheinlich dauerhaft erforderlich. Entsorgung Die Entsorgung sämtlichen kontaminierten Wassers bzw. der Containerinhalte und die Reinigung der Behälter wurde am von der Onyx Rohr- und Kanal- Service GmbH, Braunschweig durchgeführt. Das Material wurde der Verbrennung zugeführt.
46 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 46 von 65 Radioaktivitätsmessungen Im Zuge der Arbeiten auf dem Betriebsgelände Morgenstern wurden von uns orientierende Messungen mit dem Messgerät GAMMA-SCOUT (Strahlendetektor: Endfensterzählrohr nach dem Geiger-Müller-Prinzip durchgeführt). Das Messgerät bietet ermöglicht folgende Messmodi: gamma-strahlung, beta+gamma-strahlung, alpha+beta+gamma-strahlung. Während der Probenahme Luttenschacht und Deponiesickerwasser am wurden Messungen durchgeführt. Sie ergaben: Wasser Luttenschacht: 0,17mySv/h; Sickerwasser 1.BA: 0,18mySv/h; Sickerwasser 2.BA: 0,14mySv/h. Der Hintergrundwert lag bei 0,14-0,20mySv/h. Die Messwerte beziehen sich auf die Messeinstellung alpha+beta+gamma-strahlung. Im Vergleich mit der Messeinstellung gamma-strahlung war kein Anteil an alpha- und/oder beta-strahlung feststellbar. Stichprobenartige Messungen an den Bohrkernen aus der Bohrung Sohle 2 lie- ferten ebenfalls Werte im Bereich der Hintergrundwerte. Im Zuge des Pumpversuches Sohle 2 wurden die Wasserproben im Labor der GBA (gekühltes Probenlager) von uns ebenfalls geprüft. Es ergaben sich Werte von 0,14 bis 0,16 mysv/h. Sie entsprachen damit der Hintergrundstrahlung im Raum. Aus den Ergebnissen lässt sich orientierend ableiten, dass es keinen Hinweis auf wesentliche Belastungen durch Radionuklide gibt. 5.5 Hydrochemischer Vergleich Die hydrochemische Charakterisierung von Wässern ermöglicht es Unterschiede, aber auch Mischzustände zu erkennen. Insbesondere die Beeinflussung von Grund- oder Oberflächenwasser durch Sickerwasser kann häufig nachvollzogen werden. Hinzu kommt, dass bei Grundwasser unterschiedlicher geologischer Herkunft im Bereich von Mischzonen oder auch in Oberflächengewässern dieser Prozess nachvollzogen werden kann. Voraussetzung ist dabei natürlich eine ausreichende Zahl geeigneter und repräsentativer Messstellen. Im vorliegenden Fall wird erstmals die hydrochemische Charakterisierung mit Hilfe des Piper-Diagramms und der Klassifikation nach Furtak und Langguth vorgenommen (vgl. Anl. 5.5). Die bisherigen Untersuchungen hatten darauf verzichtet, die Konzentration von Hydrogenkarbonat mit zu bestimmen, so dass eine vollständige Auswertung nur für die von uns durchgeführten Untersuchungen möglich ist. Dazu gehören auch die letzten zwei Beprobungen der GWM Schrägstollen. Für die übrigen Messstellen des bisherigen Monitorings erfolgt nur eine Diskussion anhand der Kationen. Wie die weiterführende Veranschaulichung in der Abbildung 5.6 zeigt, fallen die meisten darstellenden Punkte in die Felder e und g des Hauptdiagramms. Lediglich das Deponiesickerwasser hat eine davon noch stärker abgesetzte Zusammensetzung und fällt in das Feld f. Es ergibt sich folgende Charakterisierung:
47 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 47 von 65 Beim Deponiesickerwasser handelt es sich um ein überwiegend (hydrogen-) carbonatisches, alkalisches Wasser. Das Grundwasser aus Flammenmergel und Hilssandstein ist nach der vorliegenden Analytik als überwiegend sulfatisch/chloridisches, alkalisches Wasser einzustufen. Das Wasser aus dem Luttenschacht fällt ebenfalls in die Kategorie eines überwiegend sulfatisch/chloridisches, alkalisches Wassers. Es weist eine künftig mit besonderer Aufmerksamkeit zu beobachtende Ähnlichkeit mit dem Wasser des Hilssandsteins auf. Das Diagramm für die Anionen (rechts unten) zeigt, dass der wesentliche Unterschied auf den (ungewöhnlich) hohen Sulfatgehalt im Wasser des Luttenschachtes zurückzuführen ist. Das Grundwasser innerhalb des Grubengebäudes kann zunächst zusammenfassend der Kategorie der überwiegend sulfatisch/ chloridischen, eralkalischen Wässer mit höherem Alkaligehalt zugeordnet werden. Allerdings liegt der darstellende Bereich für die GWM Sohle 2 im Grenzbereich zum alkalischen Wasser. Luttenschacht ehem. Tagebau unterhalb Deponie GWM Schrägstollen (Grubengebäude) GWM Sohle 2 (Grubengebäude) GWM HI1 Hilssandstein GWM FM1 Flammenmergel Deponiesickerwasser ABB. 5.6: CHARAKTERISTISCHE HYDROCHEMISCHE GRUPPIERUNGEN INNERHALB DES PIPER-DIAGRAMMS
48 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 48 von 65 Grundsätzlich liegt damit eine gute Unterscheidbarkeit der verschiedenen Wässer vor, die für das weitere Monitoring eine gute Nutzbarkeit des Piper-Diagramms erwarten lässt. Gegenwärtig ist es für eine Interpretation zu früh. Im Fall des Luttenschachtes ist aber anzumerken, dass eine hydraulische Verbindung zum Hilssandstein gegenwärtig nicht wahrscheinlich ist. Das Höhenniveau des Stauwassers im Luttenschacht liegt auch deutlich über dem des Grundwassers im Hilssandstein. ABB. 5.7: HYDROCHEMISCHE GRUPPIERUNG UNTER EINBEZIEHUNG WEITERER MESSSTELLEN IM DIAGRAMM DER KATIONEN. Grube Morgenstern Deponie Morgenstern Luttenschacht Schacht Fortuna Teiche und Stollenabläufe Hilssandstein Flammenmergel Luttenschacht Betrachtet man lediglich die Verteilung der Kationen, so ist die Einbeziehung früherer Analysenergebnisse möglich. Es zeigt sich dann das in der Abbildung 5.7 gezeigte Bild (vgl. Anl. 5.5), welches einige Fragen aufwirft und gleichzeitig die Potentiale der Methode erkennen lässt:
49 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 49 von 65 Die darstellenden Punkte für das Deponiesickerwasser liegen in der von den Alkalimetallen dominierten Ecke. - Unmittelbar in diesem Bereich liegen auch die darstellenden Punkte des Schachts Fortuna sowie des Luttenschachtes unmittelbar nach der hydraulischen Entkoppelung vom Deponiesickerwasser. Es deutet sich damit ein möglicher Zusammenhang an, der durch das weitere Monitoring zu erkunden ist. Das Wasser der Messstellen im Grubengebäude Morgenstern (GWM Schrägstollen und GWM Sohle 2) unterscheidet sich hinsichtlich der Kationen deutlich von dem Wasser im Schacht Fortuna. Die darstellenden Punkte für Hilssandstein, Flammenmergel und Luttenschacht liegen dicht beieinander. Es gibt einen zusammenhängenden Bereich in dem sich Oberflächengewässer (Teiche Morgenstern und Fortuna) sowie die Abläufe von Anna-Hoffnung und Schröderstollen wiederfinden (vgl. Lageplan in Anl. 5.6).
50 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 50 von Kontaminationshypothese Schadensherd Sohle 2 Mit der Bohrung Sohle 2 ist in der Grube Morgenstern eine hochgradige Kontamination durch eine Lösemittelphase nachgewiesen. Aufgrund der Befunde während der Bohrarbeiten und der Kamerabefahrung ist dabei offen, inwieweit sich die Verunreinigung innerhalb des Stollens der Schachtumfahrung befindet. Es ist gegenwärtig anzunehmen, dass die Schachtumfahrung mehr oder weniger verfüllt wurde und sich das Gebirge darüber gesetzt hat, so dass sich die beobachteten Klüfte öffnen konnten. 5 In welchem Zustand sich der eigentlich Stollen Sohle 2 befindet, ist ungeklärt. Es ist gegenwärtig davon auszugehen, dass er offen gelassen wurde (vgl. Kap. 7.5). Flüssigabfälle dürften sich insofern vor allem im Stollen Sohle 2 befinden. Die Fa. Florentz hat bereits 1963 damit begonnen, Flüssigabfälle in den Schacht Morgenstern abzuleiten. Demnach kann ein Teil der Abfälle bis in den Stollen Sohle 2 gelangt sein, bevor das Grundwasser den Stollen flutete. 6 Damals bereits im Stollen vorhandene Mineralöl- und Lösemittelgemische schwammen dann auf dem ansteigenden Wasser auf und fingen sich schließlich im Bereich der Stollendecke. Inwieweit gleichzeitig eine Ausbreitung entlang des Stollens stattfand lässt sich nicht rekonstruieren. Soweit Klüfte ABB. 5.8: POSITION DER GWM SOHLE 2 IN DER UMFAHRUNG BZW. IM RANDBEREICH ZUM STOLLEN SOHLE 2 und Risse im Gebirge vorhanden waren oder im Verlauf der Zeit entstanden, konnten die Schadstoffe als Phase aufsteigen und in die Schichten der Juratonsteine eindringen. Aus den Ergebnissen der Bohrung Sohle 2 lässt sich schließen, dass dieser Einfluss von der Sohle 2 bis zur Basis des Posidonienschiefers reicht (Abb. 5.9). Die GWM-Sohle 2 befindet sich nur gut 2m von dem Eingang des Stollens Sohle 2 entfernt (Abb. 5.8). In dem lockeren und gut durchlässigen Material und unter gespannten Bedingungen konnte so unmittelbar Wasser bzw. Schwimmphase aus dem Stollen Sohle 2 angesaugt werden. Die Abbildung 5.9 zeigt die wahrscheinliche Situation, die sich auch während des Pumpversuchs widerspiegelte. Bereits durch das erste An- 5 Es ist denkbar, dass die Umfahrung vorzeitig aufgegeben wurde, nachdem der Verbindungsstollen zur Fortuna genutzt wurde Stilllegung der Grube Morgenstern, nach zwei Jahren hatte der Wasserstand ein Niveau von etwa 185m ü. NN erreicht.
51 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 51 von 65 pumpen nach der Pumpeninstallation (Funktionstest) hatte sich Schwimmphase in der Messstelle sammeln können. Aus dem Szenario und den geförderten Schadstoffmengen sind keine rechnerischen Rückschlüsse auf das im Untergrund, also Schacht und Stollen, vorhandene Stoffpotential zu ziehen. Dies wird angesichts der Modellvorstellung zur Kontamination auch nicht ohne weiteres durch einen Pumpversuch zu ermitteln sein, da unklar ist, wie sich die Phase im Stollensystem verteilt. Aufgrund der raschen Reaktionen beim Anpumpen der Phase ist ebenfalls zu vermuten, dass der Stollen Sohle 2 noch offen ist. Andernfalls würde sich die Phase wohl in höher liegenden Versturzbereichen gefangen haben. Letztlich kann sich die Phasenverteilung auch kleinräumig unterschiedlich darstellen, falls es auch verstürzte Stollenabschnitte geben sollte. Absenkung während des Pumpversuchs ca. 1m Schwimmphase steigt in Klüften bzw. Bruchbereich auf Schwimmphase sammelt sich in der Messstelle ABB. 5.9: MODELLVORSTELLUNG ZUR VERTEILUNG DER LÖSEMITTELPHASE IM BEREICH STOLLEN SOHLE 2 UND SITUATION BEIM PUMPVERSUCH. Die Befunde des Pumpversuchs sowie die bereits während der Bohrarbeiten beobachteten Verunreinigungen auf Klüften lassen jedenfalls darauf schließen, dass die im Kapitel 4 diskutierten gespannten Verhältnisse des Grundwassers bei der Ausbreitung der eingebrachten Lösemittel eine wesentliche Rolle spielen.
52 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 52 von 65 6 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse Ziel der Arbeiten war die Untersuchung der Grundwassersituation in den Deckschichten der Grube Morgenstern und die Frage, ob ein Abströmen des im Grubengebäude stehenden Wassers ins Nebengestein, insbesondere den potentiellen Aquifer des Hilssandsteins erfolgt. Außerdem sollte durch das Einrichten einer Messstelle im Grubengebäude in der Nähe des ehem. Schachtes Morgenstern das im Grubengebäude stehende Wasser auf Verunreinigungen untersucht werden. Die Planung der Arbeiten basierte auf dem geologischen 3D-Modell des Gesamtstandortes Morgenstern /7/. Die Arbeiten wurden Ende Oktober 2012 begonnen und bis auf den noch ausstehenden Ausbau des Messstellenabschlusses GWM Sohle 2 Ende April 2013 beendet. Die Einrichtung der drei neuen Grundwassermessstellen (GWM HI1, GWM FM1 u. GWM Sohle2) sowie eines Messpegels (GWM PS1), dargestellt in Abbildung 6.1, und die in diesem Zusammenhang durchgeführten geophysikalischen, hydraulischen und hydrochemischen Untersuchungen haben folgende Ergebnisse erbracht: Hydraulische Zusammenhänge Im Untersuchungsgebiet liegen im Grundwasser teilweise gespannte hydraulische Bedingungen vor. Sie führen dazu, dass sich hydraulische Veränderungen relativ schnell über größere Entfernung auswirken. Sowohl die Messstelle GWM Schrägstollen, und die Messstelle Fortunaschacht, aber auch die GWM HI1 reagierten unmittelbar auf die Spülwasserverluste bei den Bohrarbeiten für GWM Sohle 2. Einheitlicher Grundwasserstand im Grubengebäude Der Grundwasserstand im Grubengebäude liegt, wie bereits bei der Erstellung des Modells angenommen, bei etwa 200,5 m ü. NN. Die beiden Messstellen GWM Schrägstollen und GWM Sohle 2 zeigen zueinander nur äußerst geringe Grundwasserstandsdifferenzen von wenigen Zentimetern. Grundwasserstand Hilssandstein über Grundwasserstand Grubengebäude Der Grundwasserstand im Hilssandstein (GWM HI1) liegt im bisherigen Beobachtungszeitraum höher als der Druckspiegel im Grubengebäude. Das heißt der Gradient ist in Richtung Grube gerichtet. Es bleibt aber zunächst offen, ob sich im Jahresverlauf für einen begrenzten Zeitraum auch andere Verhältnisse einstellen können. Durch weiteres hydraulisches Monitoring ist zu klären, ob es zu einer Potentialumkehr kommen kann. Hydraulischer Gradient Richtung Schacht Fortuna Hilssandstein hydraulisch an Grubengebäude gekoppelt Die vorliegenden Ergebnisse sprechen auch dafür, dass vom Stollensystem der Grube Morgenstern eine gespannte hydraulische Verbindung über den Verbindungsstollen Fortuna-Morgenstern zum Fortunaschacht besteht. Aufgrund des von der Schrägstollenmessstelle zur Messstelle Fortunaschacht gerichteten hydraulischen Gradienten ist deshalb davon auszugehen, dass Grubenwasser von der Grube Morgenstern in Richtung zur Grube Fortuna abfließt. Durch die Reaktionen der Messstelle Hilssandstein auf die Bohrarbeiten für die GWM Sohle 2 kann prinzipiell eine hydraulische Koppelung des Hilssandsteins an das Grubengebäude belegt werden. Es besteht eine quasi gespannte hyd-
53 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 53 von 65 raulische Verbindung zwischen dem Stollensystem Morgenstern und dem Hilssandstein im Bereich der Messstelle GWM HI 1. Innerhalb des ehemaligen Grubengebäudes Morgenstern sind insbesondere aufgrund der nur begrenzt durchlässigen Verbindungen von den verstürzten Abbauräumen in das Stollensystem komplexe Strömungsverhältnisse zu erwarten. Innerhalb der verstürzten Abbaukammern sind dabei zum Teil auch unterschiedliche hohe Wasserstände oberhalb des in GWM Schrägstollen und GWM Sohle 2 gemessenen Grubenwasserstands nicht auszuschließen. Flammenmergel hydraulisch nicht an Grubengebäude gekoppelt Grundwasserstand Posidonienschiefer über Grundwasserstand Hydrochemische Zusammenhänge Charakteristik des Deponiesickerwassers EDTA als Tracer für Deponieeinfluss Bedeutung des Luttenschachts Der Grundwasserstand im Flammenmergel (GWM FM1) zeigt, dass dieser ein weitgehend eigenständiger Wasserleiter ist, der nach den bisherigen Beobachtungen hydraulisch nicht an den Hilssandstein oder die Grube Morgenstern gekoppelt ist. Am Standort der GWM Sohle 2 liegt der Grundwasserstand im Juratonstein (Posidonienschiefer) in der DN35-Messstelle GWM PS1 mehrere Meter über dem Grubenwasserstand. Der hydraulische Gradient ist also in Richtung der Grube gerichtet. In die Betrachtungen zur Hydrochemie wurde auch das Deponiesickerwasser einbezogen, dass auf einen für vergleichende Untersuchungen konzipierten Parameterumfang analysiert wurde. Beim Deponiesickerwasser handelt es sich um ein überwiegend (hydrogen-) carbonatisches, alkalisches Wasser. Die Konzentrationen von Schwermetallen und Arsen sind im Sickerwasser der Deponie gering. Auffällig hoch sind die Konzentrationen von Wolfram sowie Molybdän, Rhenium und Niob. Bei den untersuchten organischen Schadstoffen sind die Konzentrationen von BTXE-Aromaten, Alkylphenolen oder PAK mit Konzentrationen im 10er- bis 100er-Mikrogrammbereich sind für ein Deponiesickerwasser nicht ungewöhnlich hoch. LHKW oder auch leichtflüchtige aliphatische KW (LAKW) wurden nicht nachgewiesen. Der Komplexbildner EDTA bewegt sich mit Konzentrationen um 800 bis 900 µg/l in einer für Hausmülldeponien typischen Größenordnung. EDTA ist daher am Standort Morgenstern sehr gut als Indikator (Tracer) für Deponieeinfluss geeignet. Das Wasser des Luttenschachts zeigt deutliche Unterschiede zum Deponiesickerwasser. Ein Einfluss organischer Schadstoffe aus dem Bereich des ehemaligen Abkippfeldes der Fa. Florentz innerhalb des Tagebaus ist kaum erkennbar. Dies kann durch die räumliche Lage des Luttenschachtes erklärt werden, da er, selbst unter Annahme einer stauenden Oberfläche des alten Tagebaus, nur randlich zum Kippfeld gelegen ist. Gleichwohl ist in jedem Fall für das Monitoring der Altlast Florentz im Bereich des ehemaligen Tagebaus notwendig. Insbesondere auch im Fall einer Sanierung (Deponieoberflächenabdichtung) ist der Luttenschacht für die Beobachtung der dann zu erwartenden Veränderungen und den vorher-/ nachher- Vergleich notwendig.
54 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 54 von 65 Weitere hydrochemische Kontrolle von GWM HI1 und GWM FM1 Die hydrochemische Beschaffenheit des Grundwassers in der Messstelle GWM HI1 weist verschiedene Besonderheiten auf, die noch nicht abschließend beurteilt werden können. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Effekte handelt, die auf die langsamen Abbindeprozesse des beim Messstellenbau eingesetzten Dämmermaterials und den geringen Wasseraustausch der Messstelle mit dem umgebenden Gestein zurückzuführen sind. Aus diesem Grund sind auch die erhöhten Konzentrationen von Ammonium, DOC sowie Molybdän (amphotere Reaktion) durch weiteres Monitoring zu überprüfen. - Vor dem Hintergrund der bisherigen hydraulischen Ergebnisse ist eine Beeinflussung aus dem Bereich des Stollensystems des Grubengebäudes unwahrscheinlich. Die Messstelle GWM FM1 wies wie die Messstelle GWM HI1 einen hohen ph- Wert auf. Die Konzentrationen von Ammonium und Arsen liegen über der Geringfügigkeitsschwelle. Aufgrund der geologischen Verhältnisse ist eine Beeinflussung durch Deponie oder Altlast unwahrscheinlich. Auch hier sind weitere Untersuchungen im Rahmen eines Monitorings abzuwarten. Die Messstelle GWM Schrägstollen muss saniert werden An der Messstelle GWM Schrägstollen können anhand der Grundwasserproben sowohl Einflüsse der Deponie Morgenstern und der Bauschuttdeponie als auch der Altlast Florentz beobachtet werden. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2012 deuten außerdem darauf hin, dass das Wasser im Schrägstollen direkt von der Grundwasserneubildung beeinflusst wird, die sich über den offenen und nur an der Oberfläche verschlossenen Stollen gesammelt wird. Der Einfluss der Altlast Florentz erscheint deutlich geringer als derjenige der Deponie. - Die Messstelle ist stark versintert oder korrodiert, so dass der Brunnenwiderstand stark erhöht ist. Zur Instandhaltung für das weitere regelmäßige Monitoring ist eine Sanierung der Messstelle notwendig. Hochgradige Kontamination in Stollen Sohle 2 Große Mengen Lösemittelphase Durch die Bohrung Sohle 2 und vor allem den nachfolgenden Pumpversuch wurde der Verdacht einer schwerwiegenden Kontamination durch ein Gemisch im Bereich des Schachtes Morgenstern nachdrücklich bestätigt. Es ist von größeren Mengen organischer Leichtstoffphase im Bereich des Stollens Sohle 2 auszugehen. Aufgrund der Befunde ist ein Stoffeintrag von einigen hundert Kubikmetern Lösemittel oder mehr nicht unwahrscheinlich. Im geförderten Grundwasser erreichte der Anteil dieser aufschwimmenden Lösemittelphase eine Größenordnung von 0,3 bis 0,5 Gew.% (max. 2 Vol.%). Wesentlicher Bestandteil sind aromatische Kohlenwasserstoffe sowie verschiedenste chlorierte Kohlenwasserstoffe, von den LHKW über Chlorbenzole und PCB bis hin zu polychlorierten Dioxinen und Furanen. Hinzu kommen neben verschiedensten Alkanen noch PAK und andere Steinkohlenteerbestandteile aber auch Weichmacher. Insgesamt ist das vorgefundene Stoffgemisch nicht nur aufgrund der nachgewiesenen Stoffgruppen und Einzelsubstanzen, sondern auch wegen der möglichen kombinierten toxikologischen Wirkung als kritisch einzustufen. Die bisherige Einschätzung der Gefährdungssituation hat sich durch die jetzigen Erkenntnisse, die vorhandene Befürchtungen bestätigen, nicht verändert.
55 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 55 von 65 Wahrscheinlicher Austrag Richtung Schacht Fortuna ist zu prüfen Der wahrscheinlichste Austragspfad aus dem System Morgenstern ist der Verbindungsstollen (Abb. 6.1) zum Schacht Fortuna. Neben dem hydraulischen Befund, der dafür spricht, kann voraussichtlich auch die hydrochemische Charakterisierung der beteiligten Wässer zur Klärung entsprechender Zusammenhänge beitragen. Die im Untersuchungsgebiet vorhandene breite Streuung unterschiedlicher hydrochemischer Wassertypen und ihre Auswertung im Piper- Diagramm können schon in einem früheren Stadium des jetzt erforderlichen Monitorings zu weiteren Erkenntnissen führen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das ungewöhnliche Kationenverhältnis in den Proben des Schachtes Fortuna zu prüfen, das mit demjenigen des Deponiesickerwassers vergleichbar ist. GWM HI1 und GWM FM1 Geplante Bohrung auf die Verbindungs strecke GWM Sohle2 und GWM PS1 Schacht Morgenstern Ohleistrecke Verbindungsstrecke zur Fortuna ABB. 6.1: 3D-MODELL MIT DEN NEUEN GRUNDWASSERMESSSTELLEN UND DER LAGE DER GEPLANTEN BOHRUNG FÜR DIE MESSSTELLE GWM VERBINDUNGSSTRECKE.
56 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 56 von 65 7 Vorschläge für weitere Untersuchungen Die durchgeführten Untersuchungen belegen, dass erhebliche Schadstoffmengen im Grubengebäude Morgenstern vorhanden sind. Der nächste Untersuchungsschritt muss daher eine Gefährdungsabschätzung zum Ziel haben. Sie muss sich insbesondere auf den Grundwasserpfad konzentrieren. Der Ausbreitungspfad wird schließlich wesentlich die Art und Weise einer möglichen Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahme bestimmen. 7.1 Einrichtung neuer Grundwassermessstellen Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen sprechen dafür, dass die hydraulische Verbindung zwischen der Grube Morgenstern und dem Grubengebäude Fortuna weiterhin über den Verbindungsstollen Fortuna-Morgenstern besteht und über diese dem hydraulischen Gradienten folgend Grundwasser von der Grube Morgenstern zum Grubengebäude Fortuna abströmt. Diese bereits im Bericht zum 3D-Modell aufgestellte These /7/ hat sich verdichtet. Hinsichtlich der hydraulischen Verhältnisse im Nebengestein der Grube Morgenstern haben die neu eingerichteten Messstellen wesentliche Beiträge zum Systemverständnis geleistet. Eine nachvollziehbare Beurteilung der Strömungsverhältnisse im Untergrund und damit der potentiellen Schadstoffausbreitungspfade ist auf dieser Grundlage jedoch noch nicht möglich. ABB. 7.1: TABELLE 7.1) LAGE DER VORGESCHLAGENEN WEITEREN MESSSTELLEN. (NUMMERIERUNG ENTSPRECHEND
57 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 57 von 65 Für die Untersuchung des über den Verbindungsstollen aus dem Grubengebäude Morgenstern abströmenden Grundwassers und die weitere Aufklärung der hydraulischen Verhältnisse im Nebengestein der Grube ist die Einrichtung zusätzlicher Grundwassermessstellen erforderlich. Abbildung 7.1 gibt einen Überblick über die Messstellen, deren Einrichtung wir für den nächsten Untersuchungsschritt empfehlen. In Tabelle 7.1 sind Informationen zum Untersuchungsziel, die zu erwartenden Bohrtiefen und Schichtabfolgen sowie den vorgeschlagenen Messstellenausbau zusammengefasst. Die Schätzungen der zu erwartenden Bohrungstiefen sind aufgrund der lückenhaften vorliegenden Informationen zum Teil mit großen Unsicherheiten behaftet. Tabelle 7.1: Ansatzbereich Nr. Übersicht über die vorgeschlagenen Bohrungen/Grundwassermessstellen Untersuchungsziel 1 Wasserchemie/-spiegel Verbindungstollen, nach Möglichkeit hydraulischer Gradient Verbindungsstollen/Hilssandstein 3 Grundwasserspiegel/-chemie Hilssandstein, nach Möglichkeit hydraulischer Gradient Flammenmergel/Hilssandstein 4 Grundwasserspiegel/-chemie Hilssandstein, nach Möglichkeit hydraulischer Gradient Flammenmergel/Hilssandstein 5 Grundwasserspiegel/-chemie Erzlager, nach Möglichkeit hydraulischer Gradient Hilssandstein/Erzlager Ansatzhöhe [mnn] geschätzte Endtiefe [m u.gok/ mnn] erwartete Schichtfolge /58 28m minimus-schichten 35,5 m Hilssandstein 65,5 unbauwürdiges Neokom 76 Neokom, Lager + Sandbank (siehe Anlage 6.1) /160 55m Cenomanium 18,5m Flammenmergel 10,5m minimus-schichten 26m Hilssandstein 1m Aptium 265,3 140/125,3 51m Cenomanium 42m Flammenmergel 22m minimus-schichten 29m Hilssandstein 1m Aptium 262,9 145/117,9 1m Lehm 144m Neokom Ausbau (den tatsächlich angetroffenen Verhältnissen anzupassen) Ausbau DA160 HDPE Filterstrecke: m zusätzlich Peilrohr im Bereich des oberen Teils des Lagers inklusive der Sandbank, soweit ohne erhebliche Mehrkosten möglich Ausbau DA90 Filterstrecke: m (Hilssandstein) zusätzlich Peilrohr bis Basis des Flammenmergel soweit ohne erhebliche Mehrkosten möglich Ausbau DA90 Filterstrecke: m (Hilssandstein) zusätzlich Peilrohr bis Basis des Flammenmergel, soweit ohne erhebliche Mehrkosten möglich Ausbau DA90 Filterstrecke: m (Neokom Erzlager) zusätzlich Peilrohr bis Basis des HIlssandsteins, soweit ohne erhebliche Mehrkosten möglich Wir schlagen vor, die Bohrungen wie bisher mit einem Durchmesser von ca. 311mm niederzubringen, um den Ausbaudurchmesser den angetroffenen Verhältnissen anpassen zu können und eine Möglichkeit zum Einbau eines zusätzlichen Peilrohres zu erhalten. Priorität besitzt die Bohrung 1, die das Ziel hat, die Verbindungsstrecke Morgenstern- Fortuna zu erschließen. Hierfür ist eine Zielbohrung erforderlich (vgl. Anhang 8). Es besteht das Risiko, den Stollen nicht beim ersten Versuch zu treffen. Auch kann es zu
58 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 58 von 65 Komplikationen beim Anbohren des Stollens kommen. Ungünstigenfalls könnte die Stollendecke einstürzen oder das Bohrziel nicht erreicht werden. Trotz der damit verbundenen Risiken ist diese Bohrung unverzichtbar, da hieraus Informationen zur chemischen Zusammensetzung des aus dem Grubengebäude in Richtung Fortuna abfließenden Wassers und günstigenfalls auch dessen Strömungsgeschwindigkeit zu erwarten sind. Der vom Vermessungsingenieur und Markscheider Dipl.-Ing. Haacke als Bohransatzpunkt ausgesuchte Stollenbereich befindet sich noch innerhalb der Schichten des Erzlagers (Anhang 8, vgl. auch Abb. 6.1). Dieser Bereich verspricht stabilere Verhältnisse als der sich im Norden anschließende Stollenabschnitt im Dogger. Außerdem handelt es sich um eine sehr breite Stelle des Verbindungsstollens, so dass die Relation Bohrtiefe zu Stollenbreite annähernd mit derjenigen im Fall der Bohrung Sohle 2 zu vergleichen ist. Andererseits ist die Stabilität des Stollens an dieser Stelle durch die unmittelbar folgende Verengung als relativ hoch einzuschätzen. Die hydrogeologische Auswertung der bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigte, dass der Druckspiegel des Grundwassers im Hilssandstein zumindest während der bisherigen Beobachtung nur geringfügig oberhalb des Druckspiegels im Stollensystem Morgenstern lag und schnell auf Veränderungen reagierte. Dieses erhöht die Bedeutung der Frage, welche hydraulischen Gradienten im Streichen des Hilssandsteins vorliegen und ob sich der Einfluss der nächsten bekannten potentiellen Vorflut, also des Schröderstollens, bis in die Nachbarschaft des Grubengebäudes bemerkbar macht. Aufgrund der schnellen hydraulischen Reaktion der Messstelle GWM HI1 auf die Druckspiegeländerungen im Stollensystem, die auch relevante hydraulische Verbindungen innerhalb des Lagerhorizontes zur Ohleistrecke hin möglich erscheinen lassen, schlagen wir zusätzlich die Erstellung einer Messstelle im Lagerhorizont des Neokom zwischen dem Grubengebäude Morgenstern und der Ohleistrecke vor. Wie die Erfahrung mit den bisherigen Bohrungen zeigt, sind die Kosten und der Zeitbedarf für die Errichtung der Messstellen nur mit Unsicherheiten abzuschätzen. Bei der Errichtung der Messstellen GWM HI1, GWM Sohle2 und GWM FM1 ergaben sich durchschnittliche Kosten von EURO netto pro Bohrmeter. Kalkuliert man auf dieser Basis die Kosten für die Messstellen 3,4 und 5, die zwar größere Bohrtiefen aufweisen aber keine relevanten Komplikationen erwarten lassen, ergeben sich für die Bohrkosten rund 320 TEURO. Die Bohrung auf den Verbindungsstollen Fortuna-Morgenstern ist aufgrund der Anforderungen an die Zielgenauigkeit kostenintensiver. Das seinerzeit von der Fa. Anger s vorgelegte Angebot für die Durchführung der Bohrungen mit einem größeren Bohrgerät, dass den Einsatz eines vertical-drilling-systems ermöglicht hätte, wies Gesamtkosten von rund 210 TEURO netto aus, so dass die ein durchschnittlicher Komplettpreis pro Bohrmeter von rund 1000 EURO netto ergab. Durch die größere Bohrtiefe der Bohrung auf die Verbindungsstrecke, den längeren Einsatz des vertical-drilling- Systems und den aufgrund der bisherigen Erfahrungen zu knapp gewählten Kalkulationsansätze des Angebots dürften die Kosten eher höher liegen. Nach diesen Überlegungen sollte für die Bohrung auf den Verbindungsstollen ein Budget von 300 TEURO netto ausreichen, wenn der Stollen beim ersten Versuch getroffen wird. Eine günstigere Erstellung der Bohrung kann möglicherweise mittels einer Zielbohrung im Kernbohr-
59 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 59 von 65 verfahren und einem anschließenden Aufweiten der Bohrung gelingen, wie sie bei der Bohrung Sohle 2 angewandt wurde. Allerdings ist das Risiko einer kostenintensiven Fehlbohrung bei diesem Verfahren auch deutlich höher. Zusätzlich zu den eigentlichen Bohrkosten ist ein erheblicher Aufwand für die Einrichtung und erforderlichenfalls den Rückbau von Bohrplätzen und Zuwegungen zu erwarten. 7.2 Aktualisierung der Wasserbilanz Für die Abschätzung der vom Standort Morgenstern auf dem Grundwasserpfad ausgehenden Wirkungen auf die Schützgüter ist neben den Konzentrationen potentieller Schadstoffe auch die tatsächliche Fracht von Bedeutung. Daher empfehlen wir im Rahmen der Arbeiten zur Gefährdungsabschätzung auch eine Wasserbilanz für den Wasserhaushalt der Grube Morgenstern und nach Möglichkeit auch der Grube Fortuna zu erstellen. Diese Wasserbilanz kann sich im ersten Ansatz auf die vorhandenen und die aus den errichteten Messstellen erhaltenen Daten stützen. Die Aussageschärfe dieser Bilanzierung wird zwar voraussichtlich aufgrund der in Anbetracht der komplexen Verhältnisse eher geringen Datengrundlage begrenzt sein, als Grundlage für die Frachtabschätzung und die Planung von Sicherungs- /Sanierungsmaßnahmen ist sie jedoch unabdingbar. So sind insbesondere Aufschlüsse im Hinblick auf ggf. erforderliche Förderraten im Fall eines Sicherungsbetriebs vorstellbar. 7.3 Messstelleninstandsetzung Die Messstelle GWM Schrägstollen ist für das weitere Monitoring zu sanieren. Im Anhang 10 liegt ein Angebot der Fa. Anger vor, das auf den Ergebnissen der Kamerabefahrung basiert (Anhang. Das Angebot weist eine Bruttosumme von ,03 Euro aus. 7.4 Hydraulisches und hydrochemisches Monitoring Neben dem Bau weiterer Messstellen kommt dem Monitoring der hydraulischen und hydrochemischen Verhältnisse eine besondere Bedeutung zu. Angesichts der sich nunmehr abzeichnenden Größe der Kontamination ist ein fundiertes Monitoringsystem eine wesentliche Grundlage für langfristig orientiertes Handeln. Das Verständnis der hydraulischen Prozesse ist außerdem notwendig, um Auswirkungen möglicher Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen. Hierfür ist unter normalen Umständen ein Beobachtungszeitraum von drei Jahren anzusetzen, da jahreszeitlich bzw. meteorologisch bedingte Effekte sonst nur unter sehr günstigen Bedingungen zu erkennen sind. Darüber hinaus ist aber auch von einem langfristigen Monitoring auszugehen.
60 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 60 von 65 Zur Beobachtung der hydraulischen Verhältnisse und ihrer zeitlichen Dynamik hat sich der Einsatz von Drucksonden bewährt. Wir empfehlen daher auch die Messstelle GWM PS1 mit einer Drucksonde auszustatten. Entsprechendes ist für alle künftigen Messstellen vorzusehen. Die Tabelle 7.2 führt die Messstellen und Lokationen auf, die für die hydraulische Überwachung mit Datensammlern versehen sind bzw. werden sollen. Darüber hinaus soll das bisherige manuelle hydraulische Messprogramm beibehalten werden (vgl. /8/). Als Ergänzung zur Wasserspiegelbeobachtung ist ein hydrochemisches Monitoring mit Tabelle 7.2: Übersicht der Mess- und Probenahmestellen für die weitere Überwachung im Monitoring erstes Jahr Messstelle Gewässertyp Hydraulisch Hydrochemisch Fortuna Stollen Grundwasser Datenlogger Parameters. 3 GWM Schrägstollen (Grubengebäude) Grundwasser Datenlogger Parameters. 3 GWM Sohle 2 Grundwasser Datenlogger Nur nach besonderer Anforderung (Grubengebäude) GWM HI1 (Hilssandstein) Grundwasser Datenlogger Parameters. 3 GWM FM1 (Flammenmergel) Grundwasser Datenlogger Parameters. 3 GWM PS1 (Posidonienschiefer) Grundwasser Datenlogger neu -- Anna und Hoffnung Oberfläche Datenlogger Parameters. 1 u. 2 Auslauf Fortuna Teich Oberfläche Datenlogger Parameters. 1 u. 2 Auslauf unt. Morgensternteich Oberfläche Datenlogger Parameters. 1 u. 2 Auslauf Schröderstollen Oberfläche Datenlogger Parameters. 1 u. 2 Deponiesickerwasser BA1 Deponiesickerwasser BA2 Luttenschacht Niederschlagsmesser Morgenstern Deponie Morgenstern Deponie Morgenstern Deponie Morgenstern / ehem. Tagebau Parameters. 3 Parameters. 3 Parameters. 3 Wetterstation Datenlogger einer regelmäßigen Beprobung aller in der Tabelle 7 aufgeführten Messstellen sinnvoll. Dies betrifft vor allem die hydrochemische Charakterisierung der Wasserproben (Hauptanionen, Hauptkationen, Lage im PIPER-Diagramm). Parametersatz 1: ph-wert, elektrische Leitfähigkeit Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium Hydrogencarbonat, Chlorid, Sulfat
61 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 61 von 65 Zusätzlich sollten einige Schlüsselparameter analysiert werden, die als Tracer oder Anzeiger für eine beginnende Schadstoffausbreitung fungieren können. Parametersatz 2: EDTA, Ammonium, Nitrat, LHKW, BTXE, Bromid Die beiden ersten Parametersätze beziehen sich auf alle Grund- und Oberflächenwassermessstellen in der Tabelle 7.2. Die Grundwassermessstellen sollten darüber hinaus im ersten Jahr auf den jetzigen Parameterumfang untersucht werden, der aufgrund der Ergebnisse der Bohrung Sohle 2 etwas modifiziert wird. Nach einem Jahr kann eine erste Überprüfung des Untersuchungsumfanges vorgenommen werden. Parametersatz 3: ph-wert elektrische Leitfähigkeit Chlorid Bromid Fluorid Sulfat Cyanid ges. Cyanid l. freis. Nitrat Ammonium Phosphat (PO4) Bor Hydrogencarbonat DOC Arsen Chrom ges. Nickel Zink Wolfram Niob Molybdän Kalium Natrium Calcium Magnesium Eisen, ges. Mangan Kohlenwasserstoffe LAKW(C 6 -C 10 ) BTXE LHKW Chlorbenzole PAK Alkylphenole (Phenol / Kresole) Komplexbildner Organische Säuren (Deponieindikator) Die Probenahme sollte vierteljährlich erfolgen, um eine Vorstellung von jahreszeitabhängigen Prozessen gewinnen zu können. Wesentlicher Kostenaufwand ist dabei die Probenahme aus den tiefen Grundwassermessstellen. Schon allein aufgrund dieses Aufwandes macht es wenig Sinn, den Parameterumfang wesentlich zu verringern. Aus der Messstelle GWM Sohle 2 sollte nur aufgrund besonderen Anlasses eine Pumpprobe entnommen werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass in diesem hochkontaminierten Bereich repräsentative Proben mit sinnvollem Aufwand gezogen werden können. Es ist auch nicht zu erwarten, dass unter den gegebenen Umständen jahreszeitliche Einflüsse erkennbar wären. 7.5 Mögliche Erkundung der Altlast Florentz im Bereich der Deponie Eine Bohrung zur Erkundung des ehemaligen Abkippbereichs im früheren Tagebau wird nicht empfohlen. Anhand des 3D-Modells wurde geprüft, inwieweit hierfür ein verlässliches Ziel benannt werden kann. Aufgrund der Verbruchstrukturen im Untergrund ist das damalige Versickern der Schadstoffe im Untergrund des Tagebaus nicht nachvollziehbar. Vertikale Bohrungen müssten die Deponie Morgenstern und den gestörten Untergrund durchteufen. Ein in mehrfacher Hinsicht risikobehaftetes Unterfangen. Auch eine Schrägbohrung würde schließlich gestörte Bereiche erreichen, da
62 Projekt Einrichtung GWM Gesamtstandort Morgenstern, Bericht vom Seite 62 von 65 letztlich in einem verstürzten Abbauraum erkundet werden müsste. Auch in diesem Fall wären erhebliche technische Probleme zu erwarten. - Selbst wenn eine solche Bohrung gelingen würde, wäre es fraglich ob, das richtige Ziel ausgewählt wurde. Würden keine hohen Konzentrationen der für die Aktivitäten der Fa. Florentz spezifischen Schadstoffe angetroffen, würde das nicht bedeuten, dass es im Bereich des Kippfeldes oder der damals vorhandenen Ableiteinrichtung keine weitere Kontamination gibt. 7.6 Zeitzeugen Aufgrund der neuen Erkenntnisse aber auch angesichts des großen öffentlichen Interesses schlagen wir vor nochmals nach Zeitzeugen zu suchen, um insbesondere im Hinblick auf die Stilllegung der Grube Morgenstern und den damaligen Zustand Informationen zu sammeln. So ist beispielweise eine Aussage zum Zustand der Schachtumfahrung auf der Sohle 2 von Interesse. In diesem Zusammenhang könnte auch das 3D-Modell im Rahmen der Befragung eingesetzt werden. Dr. Guido Pelzer (Dipl.-Geol.) Joachim Peter (Dipl.-Min.)
Informationen zum aktuellen Sachstand
 Informationen zum aktuellen Sachstand Geplanter Ablauf 1. Begrüßung und Einleitung 2. Bisheriger Sachstand 3. Bericht über den Sachstand der Altlastenuntersuchungen 4. Bericht über die Beräumung und Erkundung
Informationen zum aktuellen Sachstand Geplanter Ablauf 1. Begrüßung und Einleitung 2. Bisheriger Sachstand 3. Bericht über den Sachstand der Altlastenuntersuchungen 4. Bericht über die Beräumung und Erkundung
Deponie Morgenstern / Altlast Florentz
 Deponie / Altlast Florentz Sanierung der Deponie Sachstand Altlast weiterer Umgang mit den Fassfunden Winterimpression vom Standort 11.04.2018 1 Deponie / Altlast Florentz Sanierung der Deponie - Bisherige
Deponie / Altlast Florentz Sanierung der Deponie Sachstand Altlast weiterer Umgang mit den Fassfunden Winterimpression vom Standort 11.04.2018 1 Deponie / Altlast Florentz Sanierung der Deponie - Bisherige
Dokumentation Durchführung eines Leistungspumpversuches im neu erbauten Brunnen TB 11, Wasserwerk Frankenthal
 Dokumentation Durchführung eines Leistungspumpversuches im neu erbauten Brunnen TB 11, Wasserwerk Frankenthal Auftraggeber: Sax + Klee GmbH Verfasser: André Voutta Datum: 5. September 12 I N H A L T S
Dokumentation Durchführung eines Leistungspumpversuches im neu erbauten Brunnen TB 11, Wasserwerk Frankenthal Auftraggeber: Sax + Klee GmbH Verfasser: André Voutta Datum: 5. September 12 I N H A L T S
Informationen zum aktuellen Sachstand
 Informationen zum aktuellen Sachstand 1. Einleitung 2. Bisheriger Sachstand Deponie (Sickerwasserfassung) 3. Aktueller Kenntnisstand Altlastenuntersuchungen 4. Vorschläge der zum weiteren Vorgehen 5. Zusammenfassung
Informationen zum aktuellen Sachstand 1. Einleitung 2. Bisheriger Sachstand Deponie (Sickerwasserfassung) 3. Aktueller Kenntnisstand Altlastenuntersuchungen 4. Vorschläge der zum weiteren Vorgehen 5. Zusammenfassung
Deponie Morgenstern / Altlast Florentz -
 Deponie / Altlast Florentz - Sachstand Altlastenerkundung Sanierung der Deponie Michael Riesen & Dr. Walter Schmotz 23.03.2017 1 Deponie / Altlast Florentz Geschichte des Standortes Stand der Altlastenerkundung
Deponie / Altlast Florentz - Sachstand Altlastenerkundung Sanierung der Deponie Michael Riesen & Dr. Walter Schmotz 23.03.2017 1 Deponie / Altlast Florentz Geschichte des Standortes Stand der Altlastenerkundung
Dr. Pelzer und Partner
 Lilly-Reich-Straße 5, 31137 Hildesheim Tel.: 05121/ 28293-30 LANDKREIS GOSLAR Fachbereich Bauen & Umwelt - Bodenschutz / Deponiemanagement Herr Dr. Schmotz Klubgartenstraße 6 38640 Goslar Projekt: Grundwassermonitoring
Lilly-Reich-Straße 5, 31137 Hildesheim Tel.: 05121/ 28293-30 LANDKREIS GOSLAR Fachbereich Bauen & Umwelt - Bodenschutz / Deponiemanagement Herr Dr. Schmotz Klubgartenstraße 6 38640 Goslar Projekt: Grundwassermonitoring
Seminar Altlastenbearbeitung in Thüringen Guthmannshausen
 Seminar Altlastenbearbeitung in Thüringen 14.06.2006 Guthmannshausen Bau, Sanierung und Rückbau von Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen Gliederung: Neubau Sanierung Rückbau Allgemeine Hinweise Überblick
Seminar Altlastenbearbeitung in Thüringen 14.06.2006 Guthmannshausen Bau, Sanierung und Rückbau von Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen Gliederung: Neubau Sanierung Rückbau Allgemeine Hinweise Überblick
Informationen zum aktuellen Sachstand
 Informationen zum aktuellen Sachstand 1. Einleitung 2. Sickerwasserfassung und Sickerwasserspeicher 3. Altlastenuntersuchungen 4. Sanierung der Deponie Variantenprüfung und Kostenschätzung 5. Bodenmanagementkonzept
Informationen zum aktuellen Sachstand 1. Einleitung 2. Sickerwasserfassung und Sickerwasserspeicher 3. Altlastenuntersuchungen 4. Sanierung der Deponie Variantenprüfung und Kostenschätzung 5. Bodenmanagementkonzept
Geologisches Büro Thomas Voß
 Geologisches Büro Thomas Voß (Dipl. Geol.) Tel.: 04121 / 4751721 Baugrunderkundungen Blücherstr. 16 Mobil: 0171 / 2814955 Gründungsgutachten 25336 Elmshorn www.baugrund-voss.de Versickerungsanlagen voss-thomas@t-online.de
Geologisches Büro Thomas Voß (Dipl. Geol.) Tel.: 04121 / 4751721 Baugrunderkundungen Blücherstr. 16 Mobil: 0171 / 2814955 Gründungsgutachten 25336 Elmshorn www.baugrund-voss.de Versickerungsanlagen voss-thomas@t-online.de
Teil 1. Brunnen des Wasserverbandes Kinzig (WVK)
 Teil 1 Brunnen des Wasserverbandes Kinzig (WVK) 1 1.1 Allgemeines Die acht Brunnen des Wasserverbandes Kinzig (WVK) sind in eine Südgruppe (I, II, III und IV, im Tal der Bracht südlich und östlich von
Teil 1 Brunnen des Wasserverbandes Kinzig (WVK) 1 1.1 Allgemeines Die acht Brunnen des Wasserverbandes Kinzig (WVK) sind in eine Südgruppe (I, II, III und IV, im Tal der Bracht südlich und östlich von
GUCH Tel / Fax /
 GUCH Geologie+Umwelt-Consulting Hamm GmbH - Am Boonekamp 5-59067 Hamm GUCH Tel. 02381 / 599548 Fax 02381 / 599560 E-mail: GUCH@gmx.de www.guch-hamm.de Schürbüscher-Artmann GbR Herrn Schürbüscher Dillweg
GUCH Geologie+Umwelt-Consulting Hamm GmbH - Am Boonekamp 5-59067 Hamm GUCH Tel. 02381 / 599548 Fax 02381 / 599560 E-mail: GUCH@gmx.de www.guch-hamm.de Schürbüscher-Artmann GbR Herrn Schürbüscher Dillweg
 Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s http://www.paulguckelsberger.de/wasserprojekte.htm
Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s http://www.paulguckelsberger.de/wasserprojekte.htm
Fachbeitrag Altlasten
 Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Stadt Diepholz. Herr Andy Blumberg B.Sc. (FH) 04441/ Rathausmarkt Diepholz. 01. April 2015
 Ingenieurgeologie Dr. Lübbe Füchteler Straße 29 49377 Vechta Stadt Diepholz Dipl.-Geow. Torsten Wagner Herr Andy Blumberg B.Sc. (FH) 04441/97975-13 Rathausmarkt 1 49356 Diepholz 01. April 2015 Füchteler
Ingenieurgeologie Dr. Lübbe Füchteler Straße 29 49377 Vechta Stadt Diepholz Dipl.-Geow. Torsten Wagner Herr Andy Blumberg B.Sc. (FH) 04441/97975-13 Rathausmarkt 1 49356 Diepholz 01. April 2015 Füchteler
GEOLOGISCHES BÜRO DR. BEHRINGER
 GEOLOGISCHES BÜRO DR. BEHRINGER UNABHÄNGIGE BAUINGENIEURE UND GEOLOGEN BAUGRUND ALTLASTEN GEBÄUDERÜCKBAU HYDROGEOLOGIE Rotebühlstr. 89/2 70178 Stuttgart 0711 / 263 43 93 Fax 0711 / 263 43 95 STUTTGART
GEOLOGISCHES BÜRO DR. BEHRINGER UNABHÄNGIGE BAUINGENIEURE UND GEOLOGEN BAUGRUND ALTLASTEN GEBÄUDERÜCKBAU HYDROGEOLOGIE Rotebühlstr. 89/2 70178 Stuttgart 0711 / 263 43 93 Fax 0711 / 263 43 95 STUTTGART
DIPLOM - GEOLOGE WERNER GRÖBLINGHOFF
 DIPLOM - GEOLOGE WERNER GRÖBLINGHOFF Altlastenuntersuchung Umweltmanagement Baugrundgeologie Hydrogeologie Michaela Roreger Dolomitstraße 4 59609 Anröchte HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNG ZUR ERMITTLUNG DES
DIPLOM - GEOLOGE WERNER GRÖBLINGHOFF Altlastenuntersuchung Umweltmanagement Baugrundgeologie Hydrogeologie Michaela Roreger Dolomitstraße 4 59609 Anröchte HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNG ZUR ERMITTLUNG DES
Neubau von Grundwassermessstellen. Planung Bau Grundwassermessstellen - R. Lorenz
 Neubau von Grundwassermessstellen Arbeitsablauf Bedarf entsprechend Planung anmelden Auftrag/Vertrag mit Ing.-Büro (Hydrogeologie) Bohrpunkt festlegen, Bauerlaubnis, Kommune informieren Bohranzeige bei
Neubau von Grundwassermessstellen Arbeitsablauf Bedarf entsprechend Planung anmelden Auftrag/Vertrag mit Ing.-Büro (Hydrogeologie) Bohrpunkt festlegen, Bauerlaubnis, Kommune informieren Bohranzeige bei
Beweissicherung und Monitoring für einen oberflächennahen Grundwasserkörper bei Tiefbohrungen mit geplantem Fracking
 Beweissicherung und Monitoring für einen oberflächennahen Grundwasserkörper bei Tiefbohrungen mit geplantem Fracking - Stand der Konzeption- Dr. Thomas Meyer-Uhlich, GEO-data GmbH Zielsetzung des Monitorings
Beweissicherung und Monitoring für einen oberflächennahen Grundwasserkörper bei Tiefbohrungen mit geplantem Fracking - Stand der Konzeption- Dr. Thomas Meyer-Uhlich, GEO-data GmbH Zielsetzung des Monitorings
Bedeutung von Messstellenausbau, Pumpversuch und Probenahme für die Frachtbetrachtung
 Bedeutung von Messstellenausbau, Pumpversuch und Probenahme für die Frachtbetrachtung HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH Europastraße 11, 35394 Gießen Dipl.-Geol. Dr. Walter Lenz 1 Bau von GWM:
Bedeutung von Messstellenausbau, Pumpversuch und Probenahme für die Frachtbetrachtung HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH Europastraße 11, 35394 Gießen Dipl.-Geol. Dr. Walter Lenz 1 Bau von GWM:
Die Grubenwassermessstellen in Oelsnitz/Erzgeb. und Gersdorf
 Die Grubenwassermessstellen in Oelsnitz/Erzgeb. und Gersdorf Bestätigen die bisherigen Ergebnisse eine hydraulische Kommunikation zwischen den Grubenteilen? Frank Horna, LfULG & Rainer Bergner, SOBA 1
Die Grubenwassermessstellen in Oelsnitz/Erzgeb. und Gersdorf Bestätigen die bisherigen Ergebnisse eine hydraulische Kommunikation zwischen den Grubenteilen? Frank Horna, LfULG & Rainer Bergner, SOBA 1
D i p l o m a r b e i t
 D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
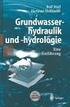 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
SL Windenergie GmbH. Windkraftanlage Neuenrade - Giebel. Hydrogeologisches Gutachten. Projekt-Nr Bonn, Dipl.-Geol.
 Windkraftanlage Neuenrade - Giebel Projekt-Nr. 2160011 Bonn, 10.02.2016 Dipl.-Geol. Beate Hörbelt Inhaltsverzeichnis: 1 Auftrag und Unterlagen... 1 2 Geologie... 1 2.1 Allgemein... 1 2.2 Tektonik... 2
Windkraftanlage Neuenrade - Giebel Projekt-Nr. 2160011 Bonn, 10.02.2016 Dipl.-Geol. Beate Hörbelt Inhaltsverzeichnis: 1 Auftrag und Unterlagen... 1 2 Geologie... 1 2.1 Allgemein... 1 2.2 Tektonik... 2
* Auswertung vorhandener Gutachten und Bohrprofile. * Durchführung von Geoelektrik und von neuen Bohrungen
 Hydrogeologisches Modell im Bereich von Regensburg-Ost bis an den Landkreis Straubing-Bogen mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der möglichen Flutpolder Eltheim-Wörthhof * Auswertung vorhandener Gutachten und
Hydrogeologisches Modell im Bereich von Regensburg-Ost bis an den Landkreis Straubing-Bogen mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der möglichen Flutpolder Eltheim-Wörthhof * Auswertung vorhandener Gutachten und
Ausbau von Grundwassermessstellen in Böden
 62. Deutsche Brunnenbauertage und BAW-Baugrundkolloquium Baugrundaufschlüsse: Planung, Ausschreibung, Durchführung, Überwachung und Interpretation 13. 15. April 2011 im Bau-ABC Rostrup / Bad Zwischenahn
62. Deutsche Brunnenbauertage und BAW-Baugrundkolloquium Baugrundaufschlüsse: Planung, Ausschreibung, Durchführung, Überwachung und Interpretation 13. 15. April 2011 im Bau-ABC Rostrup / Bad Zwischenahn
M. 1 : Flur 11. Flur 16. Flur 10. Promenadenweg 3,0 2,0 4,0 7,0 3,5. Stellplatzanlage 3,0. Rathaus. Landentwicklung LGLN 61/2.
 Geologie und Umwelttechnik Dipl.-Geologe Jochen Holst 08 BG S Sulingen, nördlich Promenadenweg Geotechnische Untersuchungen zu Versickerungsmöglichkeiten Vorgang Die Stadt Sulingen beabsichtigt die Änderung
Geologie und Umwelttechnik Dipl.-Geologe Jochen Holst 08 BG S Sulingen, nördlich Promenadenweg Geotechnische Untersuchungen zu Versickerungsmöglichkeiten Vorgang Die Stadt Sulingen beabsichtigt die Änderung
Dipl.-Geol. Michael Eckardt
 Dipl.-Geol. Michael Eckardt Büro für Ingenieur- und Hydrogeologie Boden- und Felsmechanik Umweltgeotechnik Dipl.-Geol. Michael Eckardt Johanniterstraße 23 52064 Aachen Johanniterstraße 23 52064 Aachen
Dipl.-Geol. Michael Eckardt Büro für Ingenieur- und Hydrogeologie Boden- und Felsmechanik Umweltgeotechnik Dipl.-Geol. Michael Eckardt Johanniterstraße 23 52064 Aachen Johanniterstraße 23 52064 Aachen
Temperatur des Grundwassers
 Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Ausbau von Grundwassermessstellen
 BAW-Seminar: Baugrundaufschlüsse 23. bis 25. Mai 2005 Ausbau von Grundwassermessstellen Gerd Siebenborn Bundesanstalt für Wasserbau Referat Geotechnik Nord Wedeler Landstraße 157, 22559 Hamburg AK - K1
BAW-Seminar: Baugrundaufschlüsse 23. bis 25. Mai 2005 Ausbau von Grundwassermessstellen Gerd Siebenborn Bundesanstalt für Wasserbau Referat Geotechnik Nord Wedeler Landstraße 157, 22559 Hamburg AK - K1
/ 4 9. November Ehemalige Deponie Glückskoppel in Glücksburg. Orientierende Ausgasungsmessungen mit FID
 HPC AG Am Stadtweg 8 06217 Merseburg Telefon: +49(0)3461-341-0 Telefax: +49(0)3461-341-332 Projekt-Nr. Ausfertigungs-Nr. Datum 2151964 1 / 4 9. November 2015 Ehemalige Deponie Glückskoppel in Glücksburg
HPC AG Am Stadtweg 8 06217 Merseburg Telefon: +49(0)3461-341-0 Telefax: +49(0)3461-341-332 Projekt-Nr. Ausfertigungs-Nr. Datum 2151964 1 / 4 9. November 2015 Ehemalige Deponie Glückskoppel in Glücksburg
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur
 Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien
 Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien Jochen Stark Referat Boden und Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung Workshop der MAGPlan - Begleitgruppe 28./29. Juni
Rührkesselmodell in Deutschland Konsequenzen für Untersuchungsstrategien Jochen Stark Referat Boden und Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung Workshop der MAGPlan - Begleitgruppe 28./29. Juni
Grundwassermessstellen mit Barometerfunktion
 Wolf-Peter von Pape W4 Wolf-Peter von Pape Die Wasserstände in Grundwassermessstellen haben natürliche Schwankungen, die vor allem von der jahreszeitlich veränderlichen Grundwasserneubildung aus dem Niederschlag
Wolf-Peter von Pape W4 Wolf-Peter von Pape Die Wasserstände in Grundwassermessstellen haben natürliche Schwankungen, die vor allem von der jahreszeitlich veränderlichen Grundwasserneubildung aus dem Niederschlag
11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014
 11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014 Auswirkungen der thermischen Nutzung des Grundwassers im Stadtgebiet Biberach: Brauchen wir ein thermisches Management? Dr. Rainer Klein, boden & grundwasser
11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014 Auswirkungen der thermischen Nutzung des Grundwassers im Stadtgebiet Biberach: Brauchen wir ein thermisches Management? Dr. Rainer Klein, boden & grundwasser
1. Beispiel : Arbeitsanweisung Ansprache Grundwasserverhältnisse bei Bohrungen im Lockergestein
 1. Beispiel : Arbeitsanweisung Ansprache Grundwasserverhältnisse bei Bohrungen im Lockergestein Bohrungen für Erdwärmesonden können in den verschiedensten Bohrverfahren niedergebracht werden. Die Wahl
1. Beispiel : Arbeitsanweisung Ansprache Grundwasserverhältnisse bei Bohrungen im Lockergestein Bohrungen für Erdwärmesonden können in den verschiedensten Bohrverfahren niedergebracht werden. Die Wahl
Für die Bearbeitung wurden der ingeo-consult GbR Lagepläne, Maßstab 1 : 500/1.000, zur Verfügung
 ingeo-consult GbR Am Truxhof 1 44229 Dortmund Weßlings Kamp 19 48653 Coesfeld Gesellschafter Dipl.-Ing. Rolf Funke Dipl.-Geol. Karsten Weber A m Truxhof 1 44229 Dortmund fon 0231/9678985-0 fax 0231/9678985-5
ingeo-consult GbR Am Truxhof 1 44229 Dortmund Weßlings Kamp 19 48653 Coesfeld Gesellschafter Dipl.-Ing. Rolf Funke Dipl.-Geol. Karsten Weber A m Truxhof 1 44229 Dortmund fon 0231/9678985-0 fax 0231/9678985-5
Monitoring Gesamtstandort Morgenstern Untersuchungskampagnen September und November 2014
 Projekt 23200 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern, Bericht v. 23.03.2015 Seite 1 von 34 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern Untersuchungskampagnen September und November 2014 Projekt-Nr.: 23200 Auftraggeber:
Projekt 23200 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern, Bericht v. 23.03.2015 Seite 1 von 34 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern Untersuchungskampagnen September und November 2014 Projekt-Nr.: 23200 Auftraggeber:
Hydrogeologische Voraussetzungen
 Grundwasserwärmenutzung Ihr Beitrag zur Energiewende? 3. Sept. 2015 Hydrogeologische Voraussetzungen und Erkundung Reto Murer, Dipl. Natw. ETH, Geologe CHGeol Bereichsleiter Geologie 1 Inhalt System Grundwasserleiter
Grundwasserwärmenutzung Ihr Beitrag zur Energiewende? 3. Sept. 2015 Hydrogeologische Voraussetzungen und Erkundung Reto Murer, Dipl. Natw. ETH, Geologe CHGeol Bereichsleiter Geologie 1 Inhalt System Grundwasserleiter
TECHNOLOGIEBERATUNG GRUNDWASSER UND UMWELT GMBH
 TECHNOLOGIEBERATUNG GRUNDWASSER UND UMWELT GMBH Seite 1 56070 Koblenz, 03. Juni 2004 - Pr//2003087 (HGVTO1.DOC) - Schutz der Bebauung Viernheim vor hohen Grundwasserständen hier: Bewertung der Problemursache
TECHNOLOGIEBERATUNG GRUNDWASSER UND UMWELT GMBH Seite 1 56070 Koblenz, 03. Juni 2004 - Pr//2003087 (HGVTO1.DOC) - Schutz der Bebauung Viernheim vor hohen Grundwasserständen hier: Bewertung der Problemursache
Arnsteiner Brauerei Max Bender, Arnstein
 c Arnsteiner Brauerei Max Bender, Arnstein Ergebnisbericht zur Sanierung Brunnen II Ort: Auftraggeber: Projektleiterin: GMP-Projektnr.: Datum: Würzburg Brauerei Max Bender GmbH & Co. KG Schweinfurter Straße
c Arnsteiner Brauerei Max Bender, Arnstein Ergebnisbericht zur Sanierung Brunnen II Ort: Auftraggeber: Projektleiterin: GMP-Projektnr.: Datum: Würzburg Brauerei Max Bender GmbH & Co. KG Schweinfurter Straße
Ihr Zeichen Ihre Nachricht Unser Zeichen Datum Ar/die 22. August Untersuchung zur Versickerung von Niederschlagswasser Weserberghausweg, Rinteln
 gpb-arke PappelmÄhle 6, 31840 Hess. Oldendorf Matthias Hefele Im Grund 7 31737 Rinteln Standortbewertung Altlastenerkundung Sanierungsmanagement Baugrunduntersuchung GrundwassererschlieÅung GebÇude- /
gpb-arke PappelmÄhle 6, 31840 Hess. Oldendorf Matthias Hefele Im Grund 7 31737 Rinteln Standortbewertung Altlastenerkundung Sanierungsmanagement Baugrunduntersuchung GrundwassererschlieÅung GebÇude- /
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Boden mbh. Engelhard Bauunternehmen GmbH Industriestraße Spalt
 K P Vorhabensträger: Ingenieurgesellschaft für Wasser und Boden mbh Richard-Stücklen-Straße 2 D-91710 Gunzenhausen (09831) 8860-0 (09831) 8860-29 mail@ibwabo.de www.ibwabo.de Engelhard Bauunternehmen GmbH
K P Vorhabensträger: Ingenieurgesellschaft für Wasser und Boden mbh Richard-Stücklen-Straße 2 D-91710 Gunzenhausen (09831) 8860-0 (09831) 8860-29 mail@ibwabo.de www.ibwabo.de Engelhard Bauunternehmen GmbH
Veranlassung Aufgabenstellung Wassergewinnung mit Brunnen
 Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s zum Skript SiWaWi-2 Eckhardt/Guckelsberger
Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s zum Skript SiWaWi-2 Eckhardt/Guckelsberger
Hydrogeologie Klausur vom
 Hydrogeologie Klausur vom 10.02.2009 Aufgabe 1 Sie wollen aus einer Grundwassermessstelle eine Wasserprobe (Altlasterkundung im Unterstrom eines Schwermetall-Schadensfalles) entnehmen. a) Aus welchem Material
Hydrogeologie Klausur vom 10.02.2009 Aufgabe 1 Sie wollen aus einer Grundwassermessstelle eine Wasserprobe (Altlasterkundung im Unterstrom eines Schwermetall-Schadensfalles) entnehmen. a) Aus welchem Material
Bericht. Steinbruch Kreimbach GWM 1
 Bericht Geophysikalische Bohrlochmessungen Steinbruch Kreimbach GWM 1 Land: Auftraggeber: Auftragnehmer: Inhalt: Bearbeiter: Rheinland-Pfalz Eder Brunnenbau GmbH Kreuzweg 3 84332 Hebertsfelden BLM Gesellschaft
Bericht Geophysikalische Bohrlochmessungen Steinbruch Kreimbach GWM 1 Land: Auftraggeber: Auftragnehmer: Inhalt: Bearbeiter: Rheinland-Pfalz Eder Brunnenbau GmbH Kreuzweg 3 84332 Hebertsfelden BLM Gesellschaft
Korrektion Bolligenstrasse Nord
 Oberingenieurkreis II IIe arrondissement d'ingénieur en chef Tiefbauamt des Kantons Bern Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Mitwirkungsprojekt Strassen-Nr. Strassenzug Gemeinde Projekt vom
Oberingenieurkreis II IIe arrondissement d'ingénieur en chef Tiefbauamt des Kantons Bern Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Mitwirkungsprojekt Strassen-Nr. Strassenzug Gemeinde Projekt vom
Förderrichtlinie Altlasten - Gewässerschutz
 Förderrichtlinie Altlasten - Gewässerschutz Hannover Steinweg 4 30989 Gehrden Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Chemnitz Dresden Erfurt Hamburg Heilbronn Dipl.-Ing. Christian Poggendorf Probenahme
Förderrichtlinie Altlasten - Gewässerschutz Hannover Steinweg 4 30989 Gehrden Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Chemnitz Dresden Erfurt Hamburg Heilbronn Dipl.-Ing. Christian Poggendorf Probenahme
& PARTNER. Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Ka / Be
 DR. SCHLEICHER & PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH BERATENDE INGENIEUR-GEOLOGEN FÜR BAUGRUND UND UMW ELT TECHNISCHE BODENUNTERSUCHUNGEN INGENIEUR-GEOLOGISCHE GUTACHTEN Dr. Schleicher & Partner, Düppelstr.
DR. SCHLEICHER & PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH BERATENDE INGENIEUR-GEOLOGEN FÜR BAUGRUND UND UMW ELT TECHNISCHE BODENUNTERSUCHUNGEN INGENIEUR-GEOLOGISCHE GUTACHTEN Dr. Schleicher & Partner, Düppelstr.
1. Auswirkungen der Sohlrampe auf den Wasserstand der Amper
 Wiedervernässung des Ampermooses Auswertungen von April 2015 bis März 2016 1. Auswirkungen der Sohlrampe auf den Wasserstand der Amper Das Ziel der Wiedervernässung des Ampermooses soll durch eine Anhebung
Wiedervernässung des Ampermooses Auswertungen von April 2015 bis März 2016 1. Auswirkungen der Sohlrampe auf den Wasserstand der Amper Das Ziel der Wiedervernässung des Ampermooses soll durch eine Anhebung
WV Stadtwerke Wiesloch
 WV Stadtwerke Wiesloch Überarbeitung Wasserschutzgebiet WW Hungerbühl - Untersuchungsprogramm - TU-Sitzung, 02.12.2015 Projektleiter: Dr. Stefan Ludwig, Dipl.-Geologe Kontaktdaten: Tel: 0721/94337-0, Mail:
WV Stadtwerke Wiesloch Überarbeitung Wasserschutzgebiet WW Hungerbühl - Untersuchungsprogramm - TU-Sitzung, 02.12.2015 Projektleiter: Dr. Stefan Ludwig, Dipl.-Geologe Kontaktdaten: Tel: 0721/94337-0, Mail:
Praxiserfahrungen mit tiefenorientierter Grundwasserbeprobung
 Praxiserfahrungen mit tiefenorientierter Grundwasserbeprobung HLUG-Seminar Altlasten und Schadensfälle Neue Entwicklungen 20.-21.05.2014 Rüsselsheim Dr. Peter Martus Gliederung 1. Untersuchungsstrategien
Praxiserfahrungen mit tiefenorientierter Grundwasserbeprobung HLUG-Seminar Altlasten und Schadensfälle Neue Entwicklungen 20.-21.05.2014 Rüsselsheim Dr. Peter Martus Gliederung 1. Untersuchungsstrategien
Vergleich IPV-Tool und C-SET
 Auswertung von Immissionspumpversuchen an zwei Beispielen aus dem Berner Oberland Aus Sicht des Praktikers Gliederung: Übersicht Annahmen / Grundvoraussetzungen Fallbeispiel Meiringen Fallbeispiel Thun
Auswertung von Immissionspumpversuchen an zwei Beispielen aus dem Berner Oberland Aus Sicht des Praktikers Gliederung: Übersicht Annahmen / Grundvoraussetzungen Fallbeispiel Meiringen Fallbeispiel Thun
Stadt Norderstedt Erschließung des B - Plans 176, Norderstedt-Mitte. Erstellung von Grundwassermeßstellen
 Geotechnik, Umweltgeotechnik, Bodenmanagement Institut für Erd- und Grundbau Bauüberwachung Verkehrsanlagen Bahnanlagen, Leit- und Sicherungstechnik Projektmanagement GTU Ingenieurgesellschaft mbh Münzkamp
Geotechnik, Umweltgeotechnik, Bodenmanagement Institut für Erd- und Grundbau Bauüberwachung Verkehrsanlagen Bahnanlagen, Leit- und Sicherungstechnik Projektmanagement GTU Ingenieurgesellschaft mbh Münzkamp
Merkblatt Maschinengetriebene Bohrungen in Nordrhein-Westfalen Anzeige und Ergebnisübermittlung
 Merkblatt Maschinengetriebene Bohrungen in Nordrhein-Westfalen Anzeige und Ergebnisübermittlung Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) unterhält für das Land Nordrhein-Westfalen eine zentrale Bohrungsdatenbank,
Merkblatt Maschinengetriebene Bohrungen in Nordrhein-Westfalen Anzeige und Ergebnisübermittlung Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) unterhält für das Land Nordrhein-Westfalen eine zentrale Bohrungsdatenbank,
Einsatz des Großlochbohrverfahrens. am Beispiel einer Sanierung in Hoya
 Einsatz des Großlochbohrverfahrens am Beispiel einer Sanierung in Hoya Paul Jelen M&P Ingenieurgesellschaft mbh UMWELTBERATUNG PLANUNG BAULEITUNG Erfahrungsaustausch zur Förderrichtlinie Altlasten - Gewässerschutz
Einsatz des Großlochbohrverfahrens am Beispiel einer Sanierung in Hoya Paul Jelen M&P Ingenieurgesellschaft mbh UMWELTBERATUNG PLANUNG BAULEITUNG Erfahrungsaustausch zur Förderrichtlinie Altlasten - Gewässerschutz
Informationsveranstaltung. zur. Förderrichtlinie Altlasten-Gewässerschutz. Die Orientierende Untersuchung
 Informationsveranstaltung zur Förderrichtlinie Altlasten-Gewässerschutz Die Orientierende Untersuchung Seite 1 Grundwasserbezug muss auf dem Erkenntnisniveau erster Anhaltspunkte plausibel sein -> allgemeine
Informationsveranstaltung zur Förderrichtlinie Altlasten-Gewässerschutz Die Orientierende Untersuchung Seite 1 Grundwasserbezug muss auf dem Erkenntnisniveau erster Anhaltspunkte plausibel sein -> allgemeine
Geothermieprojekt Südthurgau
 Geothermieprojekt Südthurgau Machbarkeitsstudie Generalversammlung VGTG Bearbeiter: Dieter Ollinger Andreas Blum Roland Wyss A B C D A B C D Indirekte Wärmenutzung zu Heizzwecken mittels Wärmepumpe Direkte
Geothermieprojekt Südthurgau Machbarkeitsstudie Generalversammlung VGTG Bearbeiter: Dieter Ollinger Andreas Blum Roland Wyss A B C D A B C D Indirekte Wärmenutzung zu Heizzwecken mittels Wärmepumpe Direkte
Arbeitspaket 2: Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit im quartären Grundwasserleiter der Stadt Dresden in der Folge des Augusthochwassers 2002
 BMBF-Projekt Hochwasser Nachsorge Grundwasser Dresden Arbeitspaket 2: Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit im quartären Grundwasserleiter der Stadt Dresden in der Folge des Augusthochwassers 2002
BMBF-Projekt Hochwasser Nachsorge Grundwasser Dresden Arbeitspaket 2: Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit im quartären Grundwasserleiter der Stadt Dresden in der Folge des Augusthochwassers 2002
Schäden durch Grundwassermessstellen
 Dr. Roland Kunz, Dipl.-Geologe IFB Eigenschenk GmbH für Geotechnik und Umweltschutz Schäden durch Grundwassermessstellen Pegel dienen in der Regel zur Grundwasserbeobachtung. An Grundwasserbeobachtungsbrunnen
Dr. Roland Kunz, Dipl.-Geologe IFB Eigenschenk GmbH für Geotechnik und Umweltschutz Schäden durch Grundwassermessstellen Pegel dienen in der Regel zur Grundwasserbeobachtung. An Grundwasserbeobachtungsbrunnen
BG NÖRDLICH DER STRAßE SÜDESCH
 BG NÖRDLICH DER STRAßE SÜDESCH IN LINGEN-HOLTHAUSEN GEOTECHNISCHER BERICHT Auftragnehmer Bearbeiter Auftraggeber Projektnummer Lage BG Nördlich der Straße Südesch Gutachten zur Versickerungsfähigkeit Büro
BG NÖRDLICH DER STRAßE SÜDESCH IN LINGEN-HOLTHAUSEN GEOTECHNISCHER BERICHT Auftragnehmer Bearbeiter Auftraggeber Projektnummer Lage BG Nördlich der Straße Südesch Gutachten zur Versickerungsfähigkeit Büro
Funktionsansprüche an die Hinterfüllung einer Erdwärmesonde
 Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Baugrunderkundung durch 2 Kleinrammbohrungen nach DIN 4021
 Baugrunderkundung durch 2 Kleinrammbohrungen nach DIN 4021 Fertigung AZ.-Nr.: 090214 Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses oder Doppelhauses ohne Keller Feldmannweg D-21614 Buxtehude Bauherr: n.n.
Baugrunderkundung durch 2 Kleinrammbohrungen nach DIN 4021 Fertigung AZ.-Nr.: 090214 Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses oder Doppelhauses ohne Keller Feldmannweg D-21614 Buxtehude Bauherr: n.n.
 Kartengrundlage: Auszug aus Topografische Karte 1 : 25.000 7221 Stuttgart-Südost Landesvermessungsamt Baden-Württemberg Standort des Untersuchungsgeländes Anlage 1 Lageplan des Untersuchungsgebietes Ostfildern-Scharnhausen
Kartengrundlage: Auszug aus Topografische Karte 1 : 25.000 7221 Stuttgart-Südost Landesvermessungsamt Baden-Württemberg Standort des Untersuchungsgeländes Anlage 1 Lageplan des Untersuchungsgebietes Ostfildern-Scharnhausen
Al t s t a n d o r t S ä g ew erk S t ö c k l e r K arl T eilber e i c h N or d
 1 9. O k t o b e r 201 5 B e i l a g e z u Z l. 1 1 3-6 0 2 / 1 5 Al t s t a n d o r t S ä g ew erk S t ö c k l e r K arl T eilber e i c h N or d Z u s a m m e n f a s s u n g Beim untersuchten Teilbereich
1 9. O k t o b e r 201 5 B e i l a g e z u Z l. 1 1 3-6 0 2 / 1 5 Al t s t a n d o r t S ä g ew erk S t ö c k l e r K arl T eilber e i c h N or d Z u s a m m e n f a s s u n g Beim untersuchten Teilbereich
Merkblatt Maschinengetriebene Bohrungen in Nordrhein-Westfalen Anzeige und Ergebnisübermittlung
 Merkblatt Maschinengetriebene Bohrungen in Nordrhein-Westfalen Anzeige und Ergebnisübermittlung Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) unterhält für das Land Nordrhein-Westfalen eine zentrale Bohrungsdatenbank,
Merkblatt Maschinengetriebene Bohrungen in Nordrhein-Westfalen Anzeige und Ergebnisübermittlung Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) unterhält für das Land Nordrhein-Westfalen eine zentrale Bohrungsdatenbank,
Präsentation. Sanierung einer LCKW-Verunreinigung in einem Wohngebiet mittels in-situ-chemischer Oxidation (ISCO) Dipl.-Geol.
 Präsentation Sanierung einer LCKW-Verunreinigung in einem Wohngebiet mittels in-situ-chemischer Oxidation () Dipl.-Geol. Thelen 1 Gliederung Standort, Kontaminationssituation Was ist? Sanierungsablauf
Präsentation Sanierung einer LCKW-Verunreinigung in einem Wohngebiet mittels in-situ-chemischer Oxidation () Dipl.-Geol. Thelen 1 Gliederung Standort, Kontaminationssituation Was ist? Sanierungsablauf
Bedeutung der Vor-Ort-Messung von Grundwasser- Milieukennwerten Probleme und Lösungen
 Bedeutung der Vor-Ort-Messung von Grundwasser- Milieukennwerten Probleme und Lösungen C. Nitsche BGD Boden- und Grundwasserlabor GmbH Tiergartenstraße 48 01219 Dresden cnitsche@bgd-gmbh.de Grundwassermonitoring
Bedeutung der Vor-Ort-Messung von Grundwasser- Milieukennwerten Probleme und Lösungen C. Nitsche BGD Boden- und Grundwasserlabor GmbH Tiergartenstraße 48 01219 Dresden cnitsche@bgd-gmbh.de Grundwassermonitoring
10. Juli 2006 ha/cs 05027g01.doc Projekt-Nr Bearbeiter: Dipl.-Ing. S. Halbach
 INGENIEURBÜRO FÜR GRUNDBAU, BODENMECHANIK UND UMWELTTECHNIK GMBH Felsmechanik ~ Hydrogeologie Deponietechnik ~ Altlastbewertung Erdstatik ~ Planung ~ Ausschreibung Erdbaulaboratorium 10. Juli 2006 ha/cs
INGENIEURBÜRO FÜR GRUNDBAU, BODENMECHANIK UND UMWELTTECHNIK GMBH Felsmechanik ~ Hydrogeologie Deponietechnik ~ Altlastbewertung Erdstatik ~ Planung ~ Ausschreibung Erdbaulaboratorium 10. Juli 2006 ha/cs
punktabstand kommen Werte zwischen 10 m und 20 m in Frage. Für die Anregungs- und Empfangslinien betragen die geplanten Abstände m.
 2 punktabstand kommen Werte zwischen 10 m und 20 m in Frage. Für die Anregungs- und Empfangslinien betragen die geplanten Abstände 60-160 m. Frage 2: Bis zu welcher Spaltbreite und Tiefe können diese Untersuchungen
2 punktabstand kommen Werte zwischen 10 m und 20 m in Frage. Für die Anregungs- und Empfangslinien betragen die geplanten Abstände 60-160 m. Frage 2: Bis zu welcher Spaltbreite und Tiefe können diese Untersuchungen
Messstellenbau und Probenahme zur GW-Beschaffenheit
 68. Deutsche Brunnenbauertage BAW-Baugrundkolloquium 26. bis 28. April 2017 Bau-ABC Rostrup / Bad Zwischenahn Messstellenbau und Probenahme zur GW-Beschaffenheit Dipl.-Ing. Lars Matthes Bundesanstalt für
68. Deutsche Brunnenbauertage BAW-Baugrundkolloquium 26. bis 28. April 2017 Bau-ABC Rostrup / Bad Zwischenahn Messstellenbau und Probenahme zur GW-Beschaffenheit Dipl.-Ing. Lars Matthes Bundesanstalt für
ErdEnergieManagement GmbH
 ErdEnergieManagement GmbH BauGrund Süd, Maybachstraße 5, 88410 Bad Wurzach Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach 8,9 und 10 WHG zur Grundwasserförderung aus einer Brauchwasserbrunnenanlage
ErdEnergieManagement GmbH BauGrund Süd, Maybachstraße 5, 88410 Bad Wurzach Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach 8,9 und 10 WHG zur Grundwasserförderung aus einer Brauchwasserbrunnenanlage
Grundwasserhochstand im März 2013
 Grundwasserhochstand im März 2013 Nachbildung mit dem Grundwassermodell Flutpolder Eltheim und Wörthhof Januar 2018 Arbeitsgemeinschaft Simultec tewag Simultec AG, Hardturmstr. 261, CH-8005 Zürich, +41
Grundwasserhochstand im März 2013 Nachbildung mit dem Grundwassermodell Flutpolder Eltheim und Wörthhof Januar 2018 Arbeitsgemeinschaft Simultec tewag Simultec AG, Hardturmstr. 261, CH-8005 Zürich, +41
Gemeinde Piding Thomastraße Piding Neubau Feuerwehrgerätehaus An der Lattenbergstraße / Berchtesgadener Straße In Piding
 BPR Bahnhofstraße 21a 83435 Bad Reichenhall Gemeinde Piding Thomastraße 2 83451 Piding BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 21a 83435 Bad Reichenhall Telefon 08651 76 299 0 Telefax 08651
BPR Bahnhofstraße 21a 83435 Bad Reichenhall Gemeinde Piding Thomastraße 2 83451 Piding BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 21a 83435 Bad Reichenhall Telefon 08651 76 299 0 Telefax 08651
9. Tantal SIMS-Ergebnisse RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN OFENGETEMPERTE SBT-PROBEN
 9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
Offene Masterarbeitsthemen der AG Geothermie am LS Hydrogeologie
 Thema: Geothermie/Wärmespeicherung (1 bis 2 MA Arbeiten) Bestimmung der Matrixwärmeleitfähigkeit von Sand- und Karbonatgesteinen durch Labormessungen und Inverse Numerische Modellierung mit FeFlow Die
Thema: Geothermie/Wärmespeicherung (1 bis 2 MA Arbeiten) Bestimmung der Matrixwärmeleitfähigkeit von Sand- und Karbonatgesteinen durch Labormessungen und Inverse Numerische Modellierung mit FeFlow Die
Standort Morgenstern / Altlast Florentz Maßnahmen und vertragliche Vereinbarungen
 Standort Morgenstern / Altlast Maßnahmen und vertragliche Vereinbarungen Schacht Fortuna 1 Hausmüll und Boden-/Bauschuttdeponie am Standort Morgenstern - Maßnahmen Sanierung Sickerwasserzentralschacht
Standort Morgenstern / Altlast Maßnahmen und vertragliche Vereinbarungen Schacht Fortuna 1 Hausmüll und Boden-/Bauschuttdeponie am Standort Morgenstern - Maßnahmen Sanierung Sickerwasserzentralschacht
BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz
 BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz MHW Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung und Untersuchungsumfang... 2 2 Schurf und hydrogeologische Verhältnisse... 2 3 Grundwasserstände... 3 4 Mittlerer Grundwasserhochstand...
BV Am Waldgraben GbR, Waldkirch Buchholz MHW Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung und Untersuchungsumfang... 2 2 Schurf und hydrogeologische Verhältnisse... 2 3 Grundwasserstände... 3 4 Mittlerer Grundwasserhochstand...
F E S T S T E L L U N G / B E M E R K U N G
 G R U N D B A U I N G E N I E U R E STEINFELD UND PARTNER GbR PROJEKT: Hamburg-Alsterdorf, Busbetriebshof Gleisdreieck AUFTRAGS-NR.: 020518 AKTENVERMERK: Nr. 2 DATUM: 05.08.2015 BESPRECHUNG VOM: 19.05.2015
G R U N D B A U I N G E N I E U R E STEINFELD UND PARTNER GbR PROJEKT: Hamburg-Alsterdorf, Busbetriebshof Gleisdreieck AUFTRAGS-NR.: 020518 AKTENVERMERK: Nr. 2 DATUM: 05.08.2015 BESPRECHUNG VOM: 19.05.2015
Monitoring Gesamtstandort Morgenstern Untersuchungskampagnen Mai, Juni, September und Dezember 2015
 Projekt 23200 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern, Bericht v. 18.05.2016 Seite 1 von 45 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern Untersuchungskampagnen Mai, Juni, September und Dezember 2015 Projekt-Nr.:
Projekt 23200 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern, Bericht v. 18.05.2016 Seite 1 von 45 Monitoring Gesamtstandort Morgenstern Untersuchungskampagnen Mai, Juni, September und Dezember 2015 Projekt-Nr.:
Volkswagen Immobilien GmbH. Kurzbericht
 Volkswagen Immobilien GmbH LOZ-Logistik-Optimierungs-Zentrum Braunschweig Bestimmung des Bemessungswasserstands im Untersuchungsgebiet Kurzbericht Mai 2013 13014-1 Ingenieurgesellschaft Heidt & Peters
Volkswagen Immobilien GmbH LOZ-Logistik-Optimierungs-Zentrum Braunschweig Bestimmung des Bemessungswasserstands im Untersuchungsgebiet Kurzbericht Mai 2013 13014-1 Ingenieurgesellschaft Heidt & Peters
Frank Burkhardt Bauingenieur (B.Eng), Brunnenbauer
 Herausforderungen im kritischen kritischen Stockwerksbau Lösungen und Hintergründe Fachgespräch Erdwärmenutzung Hessen 18.09.2014 Frank Burkhardt Bauingenieur (B.Eng), Brunnenbauer Burkhardt GmbH& Co.KG
Herausforderungen im kritischen kritischen Stockwerksbau Lösungen und Hintergründe Fachgespräch Erdwärmenutzung Hessen 18.09.2014 Frank Burkhardt Bauingenieur (B.Eng), Brunnenbauer Burkhardt GmbH& Co.KG
Bericht zu den Luftqualitätsmessungen
 Bericht zu den Luftqualitätsmessungen Holzhausenschule Hauptgebäude (Klassenräume) vom 02.12.2013 bis 20.12.2013 1 Messaufgabe und Erkenntnisse 1.1 Messaufgabe Zurzeit werden Überlegungen angestellt, wie
Bericht zu den Luftqualitätsmessungen Holzhausenschule Hauptgebäude (Klassenräume) vom 02.12.2013 bis 20.12.2013 1 Messaufgabe und Erkenntnisse 1.1 Messaufgabe Zurzeit werden Überlegungen angestellt, wie
Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Tappenbecker Moor Untergrundhydraulische Berechnung
 GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische
GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische
Korneuburger Bucht Grundwasserhydrologie
 Korneuburger Bucht Grundwasserhydrologie Bürger-Informationsveranstaltung 13.11.2013 Mag. Dr. Thomas Ehrendorfer, Abteilung Hydrologie und Geoinformation Amt der NÖ Landesregierung Inhalt Geologische hydrogeologische
Korneuburger Bucht Grundwasserhydrologie Bürger-Informationsveranstaltung 13.11.2013 Mag. Dr. Thomas Ehrendorfer, Abteilung Hydrologie und Geoinformation Amt der NÖ Landesregierung Inhalt Geologische hydrogeologische
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Erfahrungsaustausch zu Fördermaßnahmen im Altlastenbereich
 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Erfahrungsaustausch zu Fördermaßnahmen im Altlastenbereich 2. März 2017 Vorgehen zur qualifizierten Beprobung von leichtflüchtigen Schadstoffen und Bewertung
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Erfahrungsaustausch zu Fördermaßnahmen im Altlastenbereich 2. März 2017 Vorgehen zur qualifizierten Beprobung von leichtflüchtigen Schadstoffen und Bewertung
Untersuchungen zur Luftqualität im Einzugsbereich des Flughafen Frankfurt. Mörfelden-Walldorf
 Untersuchungen zur Luftqualität im Einzugsbereich des Flughafen Frankfurt Mörfelden-Walldorf Prof. Dr. S. Jacobi Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Luftmessstation Mörfelden-Walldorf Zweck? Dokumentation
Untersuchungen zur Luftqualität im Einzugsbereich des Flughafen Frankfurt Mörfelden-Walldorf Prof. Dr. S. Jacobi Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Luftmessstation Mörfelden-Walldorf Zweck? Dokumentation
Deponien und Isotope WASSER GEOTHERMIE MARKIERVERSUCHE SCHADSTOFFE FILTERTECHNIK LEBENSMITTEL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE ISOTOPE
 Deponien und Isotope WASSER GEOTHERMIE MARKIERVERSUCHE SCHADSTOFFE FILTERTECHNIK LEBENSMITTEL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE HYDROISOTOP GMBH Woelkestraße 9 85301 Schweitenkirchen Tel. +49 (0)8444 / 92890 Fax
Deponien und Isotope WASSER GEOTHERMIE MARKIERVERSUCHE SCHADSTOFFE FILTERTECHNIK LEBENSMITTEL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE HYDROISOTOP GMBH Woelkestraße 9 85301 Schweitenkirchen Tel. +49 (0)8444 / 92890 Fax
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Gutachten und Berichte im Zusammenhang mit dem Leckageereignis an der Kerosin-Rohrleitung, Stand:
 Gutachten und Berichte im Zusammenhang mit dem Leckageereignis an der Kerosin-Rohrleitung, Stand: 06.10.2017 Nr Gutachten 1 Gutachten für Rohrleitung 7 und Empfehlungen für diese und die in der Nordtrasse
Gutachten und Berichte im Zusammenhang mit dem Leckageereignis an der Kerosin-Rohrleitung, Stand: 06.10.2017 Nr Gutachten 1 Gutachten für Rohrleitung 7 und Empfehlungen für diese und die in der Nordtrasse
Ermittlung des zu erwartenden höchsten Grundwasserstandes in Berlin
 Ermittlung des zehgw in Berlin Titel Ermittlung des zu erwartenden höchsten Grundwasserstandes in Berlin Dipl.-Geol. A. Limberg, Dipl. Geol. U. Hörmann Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,
Ermittlung des zehgw in Berlin Titel Ermittlung des zu erwartenden höchsten Grundwasserstandes in Berlin Dipl.-Geol. A. Limberg, Dipl. Geol. U. Hörmann Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,
BS 2/16 BS 9/16 BS 7/16
 Baugrund - Erdbau - Beweissicherung Tatzendpromenade 2 07745 Jena Tel.: 03641-4527-0 Fax: 03641-4527-30 Jena-Burgau, Altes Gut Neubau Quartier für gemischte Stellungnahme Versickerbarkeit Lage- und Aufschlussplan
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung Tatzendpromenade 2 07745 Jena Tel.: 03641-4527-0 Fax: 03641-4527-30 Jena-Burgau, Altes Gut Neubau Quartier für gemischte Stellungnahme Versickerbarkeit Lage- und Aufschlussplan
Mittelwert, Standardabweichung, Median und Bereich für alle durchgeführten Messungen (in Prozent)
 3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
Hydrotechnische Berechnungen der Grundwasserabsenkungsmaßnahmen während der Bauzeit
 Landeshauptstadt München Beilage C1-3 Baureferat Ingenieurbau J 1 Hydrotechnische Berechnungen der Grundwasserabsenkungsmaßnahmen während der Bauzeit zum Antrag auf Planfeststellung für den Planfeststellungsabschnitt
Landeshauptstadt München Beilage C1-3 Baureferat Ingenieurbau J 1 Hydrotechnische Berechnungen der Grundwasserabsenkungsmaßnahmen während der Bauzeit zum Antrag auf Planfeststellung für den Planfeststellungsabschnitt
4 Diskussion 4.1 Korrelation der GW-Ganglinien
 4 Diskussion 4.1 Korrelation der GW-Ganglinien Die GW-Messstationen wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: Erstens unterliegen sie keiner Beeinflussung durch Grundwasserentnahmen. Zweitens sind die
4 Diskussion 4.1 Korrelation der GW-Ganglinien Die GW-Messstationen wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: Erstens unterliegen sie keiner Beeinflussung durch Grundwasserentnahmen. Zweitens sind die
1 VORBEMERKUNG 2 PLANGEBIET / UNTERSUCHUNGSPROGRAMM. Froelich & Sporbeck Massenbergstraße Bochum
 Halbach + Lange Ingenieurbüro ~ Agetexstraße 6 ~ 45549 Sprockhövel Froelich & Sporbeck Massenbergstraße 15-17 44787 Bochum INGENIEURBÜRO FÜR GRUNDBAU, BODENMECHANIK UND UMWELTTECHNIK GMBH Felsmechanik
Halbach + Lange Ingenieurbüro ~ Agetexstraße 6 ~ 45549 Sprockhövel Froelich & Sporbeck Massenbergstraße 15-17 44787 Bochum INGENIEURBÜRO FÜR GRUNDBAU, BODENMECHANIK UND UMWELTTECHNIK GMBH Felsmechanik
BV Hochmoselbrücke: Wasserhaushalt im W-Hang. BV Hochmoselbrücke Präsentation des aktuellen Kenntnisstands zum Wasserhaushalt im West-Hang
 BV Hochmoselbrücke: Wasserhaushalt im W-Hang BV Hochmoselbrücke Präsentation des aktuellen Kenntnisstands zum Wasserhaushalt im West-Hang Innen- und Wirtschaftsausschuss Landtag Mainz 05.06.2014, 10:00
BV Hochmoselbrücke: Wasserhaushalt im W-Hang BV Hochmoselbrücke Präsentation des aktuellen Kenntnisstands zum Wasserhaushalt im West-Hang Innen- und Wirtschaftsausschuss Landtag Mainz 05.06.2014, 10:00
4. Welche der folgenden glazialen Sedimente bilden in der Regel gute Grundwasserleiter:
 Testat Einführung Hydrogeologie 1. Was ist richtig: FEM und FDM unterscheiden sich nur in der Diskretisierung FEM und FDM basieren auf unterschiedlichen Algorithmen FEM sind in jedem Fall besser für Grundwasserfragestellungen
Testat Einführung Hydrogeologie 1. Was ist richtig: FEM und FDM unterscheiden sich nur in der Diskretisierung FEM und FDM basieren auf unterschiedlichen Algorithmen FEM sind in jedem Fall besser für Grundwasserfragestellungen
Darstellung und Beurteilung der aus sicherheitstechnisch-geologischer Sicht möglichen Wirtgesteine und Gebiete
 Geologische Tiefenlagerung der abgebrannten Brennelemente, der hochaktiven und langlebigen mittelaktiven Abfälle Darstellung und Beurteilung der aus sicherheitstechnisch-geologischer Sicht möglichen Wirtgesteine
Geologische Tiefenlagerung der abgebrannten Brennelemente, der hochaktiven und langlebigen mittelaktiven Abfälle Darstellung und Beurteilung der aus sicherheitstechnisch-geologischer Sicht möglichen Wirtgesteine
Gutachten. Auftraggeber: HEINRICH KLOSTERMANN GmbH & Co. KG Betonwerke Am Wasserturm Coesfeld
 Gutachten über die spezifischen Versickerungsleistung eines wasserdurchlässigen Pflastersystems vom Typ appiaston der Firma HEINRICH KLOSTERMANN GmbH & Co. KG Betonwerke in Coesfeld Auftraggeber: HEINRICH
Gutachten über die spezifischen Versickerungsleistung eines wasserdurchlässigen Pflastersystems vom Typ appiaston der Firma HEINRICH KLOSTERMANN GmbH & Co. KG Betonwerke in Coesfeld Auftraggeber: HEINRICH
