Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
|
|
|
- Günter Giese
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2018 Petra Horch Simon Hohl Micha Kipfer Tanja Koch Eva Ritschard Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Luzern sowie der Trägerschaft Vernetzungsprojekt Wauwiler Ebene, der am Vernetzungsprojekt beteiligten Landwirte und der das Projekt unterstützenden Stiftungen
2 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Impressum Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2018 Autoren Petra Horch, Simon Hohl, Micha Kipfer, Tanja Koch, Eva Ritschard und Dr. Reto Spaar Feldarbeit Simon Hohl, Micha Kipfer, Tanja Koch und Eva Ritschard Fotos, Illustrationen (Titelseite) Oben: Kiebitzbrachestreifen Ettiswiler Moos ( Petra Horch), unten: Kiebitzküken ( Marcel Burkhardt) Zitiervorschlag Horch, P., S. Hohl, M. Kipfer, T. Koch, E. Ritschard & R. Spaar (2018): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern: Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Kontakt Petra Horch, Schweizerische Vogelwarte, Seerose 1, 6204 Sempach Tel.: , (direkt), Fax: , petra.horch@vogelwarte.ch 2018, Schweizerische Vogelwarte Sempach
3 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 3 1. Einleitung Ausgangslage Artenförderung Vögel Schweiz Projektteam Material und Methoden Das Kiebitzprojekt wird digital Tageszählungen und Ringablesungen Nestersuche und Nestermarkierung Schutzzäune Schlupftermin, Kükenberingung und Kükenbeobachtung 6 3. Ergebnisse Kiebitz-Saison Verlauf der Brutsaison Die Brutgebiete Die Kiebitzbrache Schlüpf- und Aufzuchterfolg Wetter Prädation Landwirtschaftliche Aktivitäten Beringung Weitere Beobachtungen während der Feldarbeit Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene Die Entwicklung des Kiebitzbestands Feuchtwiesen im Wauwilermoos ein wertvoller Lebensraum Ein herzliches Dankeschön! Ausblick Literatur 21
4 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Zusammenfassung Der Kiebitz ist in der Schweiz vom Aussterben bedroht und wird auf der Roten Liste der Brutvögel in der höchsten Kategorie geführt (CR, critically endangered). Ungefähr 180 Brutpaare lassen sich Jahr für Jahr in der Schweiz nieder, um hier ihre Jungen grosszuziehen. Der kleine Bestand und der ungenügende Bruterfolg sind die Hauptgründe für die kritische Situation der Kiebitze. In der Wauwiler Ebene, dem wichtigsten Brutgebiet in der Schweiz, werden die Kiebitze seit 2005 durch gezielte Fördermassnahmen der Vogelwarte unterstützt und wissenschaftlich begleitet durchlebten die Wauwiler Kiebitze eine wenig erfolgreiche Brutsaison. Mit 47 Brutpaaren liessen sich in diesem Jahr erneut etwas weniger Vögel im Gebiet nieder. 21 Jungvögel erreichten das flugfähige Alter. Dies ergibt eine Bruterfolgsrate von 0,45 flüggen Küken pro Brutpaar. Dieser Wert liegt deutlich unter dem angestrebten Wert von 0,8 flüggen Küken pro Brutpaar, den es für den Erhalt des Bestands erfordert. Rund 26 % der Nester wurden von Beutegreifern ausgeraubt. Nach zwei Starkregen-Ereignissen wurden 4,9 % der Nester überschwemmt. Sonst war die Saison durch eine lange Trockenheit geprägt. Im Juni wurden viele Nester von den Altvögeln aufgegeben, bevor die Küken schlüpften (über die ganze Saison 18,5 % der Nester). Auf trockenen Böden finden die Kiebitze kaum genügend Nahrung. Als besonders wertvoll erwiesen sich daher Parzellen, auf welchen während der ganzen Brutsaison feuchte und weiche Bereiche zur Verfügung standen. Hier konnten auch die Küken Nahrung aufnehmen. Insbesondere der 2017 aufgewertete NAVO-Streifen erwies sich als äusserst wichtige Brut- und Nahrungs-Fläche wird das Förderprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene weitergeführt. Insbesondere das Angebot an Kiebitzbrachen und temporären Feuchtflächen soll in Zusammenarbeit mit dem Landwirten erhöht werden. 1. Einleitung 1.1 Ausgangslage Der Kiebitzbestand in der Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten stark zurück gegangen. Von den rund 1000 Brutpaaren, die in den 70er-Jahren bei uns brüteten, sind lediglich 180 Paare übriggeblieben. Die auffallend geringe Nachwuchsrate der Kiebitze ist einer der Hauptgründe für den Rückgang dieser Art. Regelmässige Einwanderungen von Tieren aus stabilen europäischen Populationen sorgen wahrscheinlich dafür, dass sich der Schweizer Kiebitzbestand trotz des geringen Bruterfolgs so lange halten konnte. Ein beträchtlicher Teil der Schweizer Population brütet seit Jahren in der Wauwiler Ebene im Kanton Luzern. In Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern und dem Kanton Luzern führt die Vogelwarte seit 2005 ein wissenschaftlich begleitetes Förderprojekt durch. Zusätzlich profitieren die Vögel von den kiebitzfreundlichen Bewirtschaftungsmassnahmen des regionalen Vernetzungsprojekts. Dank diesen Bemühungen hat sich der Bestand der Kiebitze in den letzten Jahren leicht erholt. Die schweizweit rund 180 Brutpaare reichen jedoch nicht aus, um die Art von der Roten Liste streichen zu können der Kiebitz gilt nach wie vor als vom Aussterben bedrohte Vogelart (Keller et al. 2010a). Kiebitze brüten in lockeren Kolonien, was besonders bei der Verteidigung gegen Fressfeinden einen grossen Vorteil hat. Nähert sich ein Prädator (z.b. Rotfuchs oder Rabenkrähe) tagsüber den Nestern, wird er von vielen Kiebitzen gleichzeitig angegriffen und meistens erfolgreich vertrieben. Das einzelne Brutpaar in der Kolonie muss so weniger Zeit und Energie in die Überwachung des Nestraumes inves-
5 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht tieren, als Pärchen, die weitab von den anderen alleine ihr Nest verteidigen müssen. Kolonienbrütenden Kiebitzen bleibt so mehr Zeit für die Nahrungssuche und die Betreuung des Nests oder der Jungen. Sinkt die Anzahl Brutpaare in einem Gebiet, wird die Verteidigung der Nester für die übriggebliebenen Vögel immer aufwändiger. Je grösser die Kiebitzkolonie, desto grösser sind die Überlebenschancen der Küken. Aus diesem Grund können auch lokale Fördermassnahmen, wie sie in der Wauwiler Ebene durchgeführt werden, einen merklich positiven Einfluss auf Kiebitze haben. 1.2 Artenförderung Vögel Schweiz Die Förderung des Kiebitzes ist eine Aufgabe des Programms Artenförderung Vögel Schweiz, welches partnerschaftlich von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und von BirdLife Schweiz durchgeführt und vom Bundesamt für Umwelt BAFU unterstützt wird. 50 national prioritären Vogelarten, welche auf artspezifische Fördermassnahmen angewiesen sind, soll mit diesem Programm gezielt geholfen werden (Keller et al. 2010a,b). Abb. 1. Frisch geschlüpftes Kiebitzküken noch in der Nestmulde ( Lukas Lindner). 1.3 Projektteam 2018 Seit 2011 steht das Kiebitzprojekt in der Wauwiler Ebene unter der Leitung von Petra Horch und Reto Spaar (Horch et al. 2017) wurde die Feldarbeit von Simon Hohl (Feld-Assistent), Micha Kipfer (Praktikant), Tanja Koch (Praktikantin) und Eva Ritschard (Praktikantin) durchgeführt. Das Feldteam betreute zudem 3 Schnupperschüler/-innen, die durch ihren Einsatz im Projekt einen Einblick in das Kiebitzprojekt und in die Arbeit einer Biologin/eines Biologen bekamen. Gabriele Hilke Peter als GIS-Verantwortliche kümmerte sich um den reibungslosen Betrieb des Feld- Tablets und half bei Fragen rund um das Programm QGIS.
6 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Material und Methoden 2.1 Das Kiebitzprojekt wird digital Per Feldsaison 2018 wurden die erhobenen Daten erstmals soweit als möglich digital erfasst. Dafür stand dem Feldteam ein Tablet mit dem Programm QField (Version) zur Verfügung. Als Basemap diente eine georeferenzierte Pixelkarte im Vektorformat. Für die Datenverarbeitung am Computer wurde das Opensource-Programm QGIS genutzt. Mit dieser Neuerung konnte der Arbeitsaufwand deutlich verringert werden, da die regelmässigen Fahrten aus der Wauwiler Ebene an die Vogelwarte nach Sempach entfielen, um die im Feld handschriftlich ausgefüllten Datenblätter in Access zu erfassen, entfielen. Das Fazit dieses ersten Probedurchlaufs war daher positiv. Wenige Verbesserungsvorschläge für die kommende Saison wurden notiert und an Gabriele Hilke Peter weitergeleitet. Das Monitoring der Familien war dann allerdings effizienter auf Papier, so dass wir schliesslich beide Arbeitsmittel nutzten. 2.2 Tageszählungen und Ringablesungen Tageszählungen und Ringablesungen sind wichtige Instrumente zur Untersuchung des Kiebitzbestandes. Um mehr über das Überleben, den Bruterfolg und die Standorttreue der Kiebitze zu erfahren, werden die Kiebitzküken mit einer individuellen Kombination aus drei Farbringen plus einem Aluring beringt. Zwei Ringe befinden sich oberhalb des Intertarsalgelenks und zwei unterhalb (Abb. 2). Speziell zu Beginn der Saison sind Tageszählungen und Ringablesungen von grosser Wichtigkeit, da vor allem das Ablesen der Farbringkombination bei zunehmender Vegetationshöhe schwieriger wird. Bei einer Tageszählung werden die Anzahl Kiebitze pro Parzelle, sowie das Wetter und die ungefähre Temperatur bei der Beobachtung ermittelt. Angaben über Datum, Uhrzeit, Parzellennummer, Gemeinde, Kultur und Vegetationshöhe müssen immer angegeben werden. Bei einer Ringablesung müssen möglichst alle vier Ringe identifiziert werden, da unvollständige Kombinationen keinen Aufschluss über das Individuum geben. Bei einer Ringablesung werden Angaben über das Datum und das Geschlecht des Tieres gemacht. Abb. 2. Ringkombination eines diesjährigen Jungvogels ( Eva Ritschard). 2.3 Nestersuche und Nestermarkierung Durch genaues Beobachten der Kulturen kann man brütende Weibchen entdecken, aber auch durch typisches Verhalten wie z.b. Hälmchen werfende Vögel. Wenn sich ein Männchen in der Brutsaison alleine auf einer Fläche befindet, kann man fast sicher sein, dass sich noch irgendwo gut versteckt ein Weibchen auf dem Nest befindet. Sieht man das typische Verhalten, dass das Männchen seine rost-
7 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht braunen Unterschwanzdeckfedern präsentiert, findet man allenfalls gleich in dessen Verlängerung ein Weibchen (Abb. 3). Sitzt das Weibchen tief am Boden, hat man ein Nest gefunden und kann es markieren gehen. Dazu werden ein nummeriertes Bambusstöckchen 5 m links des Nestes platziert und der Bewirtschafter telefonisch über den Nestfund informiert. Abb. 3. Typisches Balzverhalten (Männchen im Vordergrund; Simon Hohl). 2.4 Schutzzäune Zum Schutz der Nester und später auch der Familien, die auf der Brutparzelle bleiben, werden um den Brutplatz elektrische Weidezäune errichtet, sobald sich zwei oder mehr Nester auf einer Parzelle befinden. Der Bewirtschafter wird vorher um Erlaubnis gefragt. Nestschutzzäune wurden 2018 um insgesamt 14,5 ha und mit einer Länge von 5,0 km (Abb. 9, Tab. 2) aufgestellt. Wie im Vorjahr konnten wir auch dieses Jahr keine zusätzlichen Zäune zum Familienschutz errichten. Einige Familien waren zwar mobil und bewegten sich oft ausserhalb ihres Brutgebiets-Zauns, aber ein klarer Aufenthaltsort zur Nahrungssuche, der von einer Familie über mehrere Tage oder von mehreren Familien nacheinander genutzt wurde, konnte nicht festgestellt werden, wodurch sich nirgends Gründe für Familienzäune ergab. 2.5 Schlupftermin, Kükenberingung und Kükenbeobachtung Den ungefähren Schlupftermin der Kiebitzküken kann man mittels einer Formel berechnen, man kann aber auch einfach ca. 25 Tage nach Auffinden des Nestes und durch vermehrtes Beobachten den Schlupftag feststellen. Die 25-Tage-Regel setzt aber voraus, dass man das Nest gleich nach seiner Entstehung findet und nicht schon einige Tage vergangen sind. Sind die Küken geschlüpft, ändert sich das Verhalten der Mutter merklich. Man sieht sie plötzlich angespannt herumschauen und -laufen und dabei stösst sie typische Kiebitzlaute aus, mutmasslich, um ihre Jungen bei sich zusammenzuhalten. Es ist von Vorteil, die Küken gleich am Schlupftag zu entdecken, denn bereits am nächsten Tag können sie sich so weit vom Nest entfernen sobald sich Gefahr nähert, dass man sie nicht mehr finden und beringen kann. Die Küken kann man direkt vor Ort beringen, ausser das Nest befindet sich in einer Brutkolonie und man stört die anderen brütenden Weibchen mit seiner Anwesenheit. Dann packt man die Küken in eine Kiste und beringt sie am Feldrand (Abb. 4, Abb. 5). Bei kalten Temperaturen und starkem Regen ist es nicht sinnvoll, die Küken zu beringen, da sie schnell unterkühlen können. In diesem Fall beringt man die Küken besser zu einem späteren Zeitpunkt oder lässt sie unberingt. Um Kiebitze beringen zu können muss man den zweitägigen Beringungskurs der Schweizerischen Vogel-
8 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht warte absolviert und eine Beringerbewilligung vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) erhalten haben. Dann braucht es vor allem Übung. Die individuelle Ringkombination (siehe Kapitel 2.2) wird angelegt, jedes Küken gewogen und dann alle ungefähr am Fundort wieder ausgesetzt. Auf bereits vorbereiteten Datenblättern werden von nun an die Kükenbeobachtungen pro Familie notiert. Dies geht manuell besser als mit dem Tablet und ist ein sehr wichtiger Vorgang. Denn damit kann man am Ende der Saison feststellen, welche Jungtiere das flugfähige Alter erreicht haben und ab welchem Zeitpunkt die anderen verloren gingen oder nicht mehr beobachtet wurden. Abb. 4. Beringung eines Kiebitz-Kükens ( Tanja Koch). Abb. 5. Beringtes Kiebitz-Küken ( Simon Hohl). 3. Ergebnisse Kiebitz-Saison Verlauf der Brutsaison Im Gegensatz zum letzten Jahr kehrten die Kiebitze diesen März in eine schneebedeckte Wauwiler Ebene zurück und von sonnigem Wetter wie 2017 konnte keine Rede sein. Die Feldsaison startete offiziell am 15. März Am 26. März wurde das erste Nest durch das Feldteam im NAVO-Streifen entdeckt (Abb. 6). Der April zeigte sich dafür von seiner besten Seite und man sprach vom zweitwärmsten April seit Messbeginn 1864 (MeteoSchweiz 2018: Klimabulletin April Zürich). Diese milden Temperaturen und der geringe Niederschlag kamen dann (vorerst) auch den Kiebitzen zugute und am 19. April hatten sie bereits mehr als die Hälfte aller Nester dieses Jahres angelegt (41 von total 81 Nestern, Abb. 7). Nach knapp 1,5 Monaten ohne nennenswerte Niederschläge gab es Mitte Mai innerhalb von 2 Wochen 2 Starkniederschlagsereignisse und da beim zweiten Ereignis der Boden bereits gesättigt war, wurden vier Nester überschwemmt. Am 19. April schlüpften die ersten vier Küken. Dann dauerte es eine Woche bis weitere Küken schlüpften. Im Mai und Juni dieses Jahres verzeichneten wir im Vergleich zum letzten Jahr keine Hitzetage (über 30 C), aber wegen der ausgeprägten Trockenheit von April bis Juni war auch dieses Jahr klimatechnisch eine Herausforderung für die Kiebitze. Speziell auf der Kiebitzbrache hatte die Trockenheit gepaart mit einer zu hohen und dichten Vegetation dazu geführt, dass die Küken die eingezäunte Brache verliessen. Ohne Zaun waren sie den zahlreichen Prädatoren ausgesetzt und es erreichten nur 2 der 32 in der Kiebitzbrache geschlüpften Küken das flugfähige Alter. Das erste flügge
9 bis 31. März bis 5. April bis 10. April bis 15. April bis 20. April bis 25. April bis 30. April bis 5. Mai bis 10. Mai bis 15. Mai bis 20. Mai bis 25. Mai bis 30. Mai bis 4. Juli Anzahl Nester total bis 31. März bis 5. April bis 10. April bis 15. April bis 20. April bis 25. April bis 30. April bis 5. Mai bis 10. Mai bis 15. Mai bis 20. Mai bis 25. Mai bis 30. Mai bis 4. Juli Anzahl neue Nester Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Küken wurde am 22. Mai im NAVO-Streifen gesichtet, dort wo es auch geboren wurde. (Nest 1, als erstes geschlüpft, als erstes flügge). Ab dem 16. Juni wurde zum ersten Mal eine grössere Kiebitzgruppe mit zahlreichen flüggen Jungvögeln beobachtet. Sie hielten sich zuerst im Seemoos hinter dem NAVO-Streifen auf und gegen Ende der Saison mehrheitlich im Ettiswiler Moos pro Pentade Abb. 6. Brutsaison 2018: Anzahl neuer Nester pro Pentade pro Pentade Abb. 7. Brutsaison 2018: Anzahl Nester aufsummiert pro Pentade. Die rote Linie markiert die Hälfte der Nester. Diese wurde zwischen dem 20. und dem 25. April überschritten. Im Vergleich zur Saison 2017 hatten wir zwar deutlich weniger geschlüpfte Küken (2018: 136, 2017: 185) aber es erreichten doch mehr Küken das flugfähige Alter (2018: 21, 2017: 18). Dies entspricht einem Bruterfolg von 16 % im Vergleich zu 10 % im Jahr Gegenüber dem letzten Jahr schlüpf-
10 Anzahl Küken Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht ten die Küken diese Saison nicht gleichmässig verteilt über die Monate April bis Juni sondern deutlich geballt im Mai. (Abb. 8 und Tab. 1) Abb. 8. Anzahl geschlüpfter Küken pro Tag (in blau). Die Küken, welche an diesem Tag schlüpften und schliesslich flügge wurden, sind zusätzlich rot markiert (Leseweise: am 1. Mai schlüpften 9 Küken, wovon 2 das flugfähige Alter erreichten). Tab. 1. Vergleich Bruterfolg pro Monat (in % flügge von total geschlüpften Küken) im Jahr 2017 und im Jahr April % flügge von total geschlüpften Küken () Mai % flügge von total geschlüpften Küken () Juni % flügge von total geschlüpften Küken () % (66) 14 % (64) 2 % (55) % (22) 19 % (103) 0 % (11) Die Brutgebiete Kiebitze sind Gewohnheitstiere. Sie wählten auch in diesem Jahr wieder Gebiete als Brutorte, welche sich in der Vergangenheit bereits bewährt haben (Abb. 9). Es ist aber auffällig, dass sich seit zwei Jahren deutlich weniger Kiebitze im Kottwiler Moos und in der Kiebitzbrache niederlassen. Dieses Jahr zählten wir insgesamt nur 22 Nester, was seit 2005 den tiefsten Wert für diesen Teil der Wauwiler Ebene bedeutet. Die Ursachen für diese Entwicklung sind nicht einfach zu benennen. Spitzenreiter war dieses Jahr wie auch schon letztes Jahr die Parzelle 489 hinter dem NAVO-Streifen, welche vom Biobetrieb der Strafanstalt Wauwilermoos bewirtschaftet wird. Dort befanden sich dieses Jahr 29 Nester. Zusammen mit dem NAVO-Streifen (7 Nester) und dem Schötzer Moos (6 Nester) befanden sich die meisten Nester, nämlich knapp 52 % (42 von 81), auf Schötzer Boden. Des Weiteren fanden wir 13 Nester im Ettiswiler Moos und insgesamt 6 Nester auf übrigen Standorten. Bei letzteren handelte es sich meist um Einzelnester, die wir nach Methodik nicht schützen.
11 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht NAVO-Streifen Kiebitzbrache Abb. 9. Übersicht Brutgebiet: Nester mit Schlüpferfolg (grün) und erfolglose Nester (rot) [ swisstopo (DV 351.5)] Die Kiebitzbrache Kiebitze bevorzugen als Brutort Flächen mit wenig Vegetation, die ihnen aber trotzdem etwas Deckung bieten kann. Im Ackerbaugebiet wählen sie daher bevorzugt Stoppelfelder aus. Aufgrund der Bestimmungen bezüglich Bodenschutz findet man aber je länger je weniger unbepflanzte, also vorübergehend brachliegende Felder. Im Zuge des Vernetzungsprojektes Wauwiler Ebene erklärte sich 2012 ein Bewirtschafter bereit, im Kottwiler Moos eine sogenannte Kiebitzbrache einzusäen. Sie besteht bis heute und wird jedes Jahr neu eingesät. Beim Saatgut handelt es sich um eine Spezial- Gründüngungsmischung, welche im Winter grösstenteils abstirbt und den Kiebitzen während des Brutgeschäfts im Frühling das ideale Mass an Schutz und offenem Boden bietet (Abb. 10, Abb. 11). Die Brache bleibt die ganze Saison unbewirtschaftet und wird erst Ende Juli gemulcht, gepflügt und neu eingesät. In den vergangenen Jahren war die Kiebitzbrache als Brutort immer ein grosser Erfolg. Dieses Jahr schien die Kiebitzbrache aber nur mässig attraktiv für die Kiebitze. Es wurden nur 12 Nester in der Brache angelegt und nur 2 von 32 Küken erreichten das flugfähige Alter. Gemäss den Beobachtungen des Feldteams wuchs diese Saison die angesäte Vegetation extrem dicht und sowohl für die kleinen wie auch für die grossen Kiebitze war bald kein Durchkommen mehr. Ein Management- Eingriff wäre eine zu grosse Störung für die Brutvögel gewesen. So verliessen sie die Brache kaum waren die Küken geschlüpft. Ausserhalb des Elektrozauns waren die Familien den zahlreichen Prädatoren ausgesetzt und die angrenzenden Parzellen wurden intensiv bewirtschaftet (inkl. der Verwendung von Chemikalien zur Behandlung des Maises), so dass auch dort kein ungestörtes Verweilen möglich war. Ziehen die Familien auf Nahrungssuche herum, ist dies mit neuen Gefahren für die Küken verbunden erklärte sich ein Bewirtschafter im Ettiswiler Moos dazu bereit, eine Kiebitzbrache anzulegen. Dabei handelt es sich aber um eine deutlich kleinere Fläche und es halten sich naturgemäss eher
12 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht weniger Kiebitze im Ettiswiler Moos auf brütete denn auch noch kein Kiebitzpaar auf dieser Kiebitzbrache, doch sie wurde von den adulten Kiebitzen zur Nahrungssuche genutzt. Vermutlich ist die Fläche, die in einen Spitz ausläuft, insgesamt etwas zu schmal um als Brutfläche für die Kiebitze attraktiv zu sein. Ab 2019 wird noch eine weitere Fläche im Ettiswiler Moos mit Kiebitzbrachestreifen und einer temporären Flachwasserzone angeboten. Abb. 10. Kiebitzbrache im Kottwiler Moos am 1. Mai 2018: Mosaik aus abgestorbener Vegetation vom Vorjahr, neuer Vegetation und vegetationslosen Stellen. Mit den guten Bedingungen im Mai wuchs die Vegetation dann für die Kiebitze ungünstig dicht und hoch auf ( Petra Horch). Abb. 11. Kiebitzbrache im Kottwilermoos am 5. Oktober Besonders der Buchweizen ist sichtbar und deckt den Boden gut ab. Die Mischung besteht aus Buchweizen 67 %, Phacelia 20 %, Ölrettich 5 %, Sonnenblume 1 %, Blauer Lein 7 %; Saatmenge ca. 55 kg/a ( Petra Horch).
13 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Schlüpf- und Aufzuchterfolg 2018 Damit der Aufzuchterfolg der Population bei 0,8 1,0 flüggen Küken pro Paar liegt und so als ausreichend angesehen wird, ist es notwendig, dass mehr als 60 % der Gelege schlüpfen (Schifferli et al. 2009). Der Brutbestand 2018 war mit 47 Brutpaaren kleiner als in den letzten fünf Jahren (49 bis 60 Brutpaare). Von diesen 47 Brutpaaren wurden insgesamt 81 Gelege geschaffen. Die diesjährige Schlupfrate für die Gelege betrug 49,4 % (Tab. 2) und lag damit deutlich unter dem Zielwert von 60 %. Da wir seit 2014 nicht mehr zu den ungeschützten Nestern gehen, müssen wir aus der Entfernung feststellen, wieviele Eier hineingelegt wurden, was teilweise schwierig ist. Von fünf Nestern haben wir für 2018 keine Kenntnis darüber, wieviele Eier es darin hatte. Deshalb handelt es sich beim Wert Eier pro Paar um ein Minimum. Tab. 2. Ergebnisse der Brutsaison 2018 in der Wauwiler Ebene. Eier pro Paar berechnet den Durchschnitt von allen gelegten Eiern pro Paar (auch von Erst- und Ersatzgelegen) Anzahl Brutpaare 47 Anzahl Gelege 81 % geschlüpft 49,4 % verlassen 19,8 % ausgeraubt 25,9 % überschwemmt 4,9 Eier pro Paar (mindestens) 5,5 Geschlüpft pro Paar 3,0 Flügge pro Paar 0,45 Beringte Küken 125 Eingezäunte Fläche, ha 14,5 Länge Elektrozaun, km 5,0 Wie viele andere Watvögel legt der Kiebitz normalerweise vier Eier pro Gelege. Wird ein Gelege zerstört oder beraubt, legen viele Pärchen ein Ersatzgelege an. Diese sind in der Regel kleiner als Erstgelege (Jackson & Jackson 1975), da die Kiebitzweibchen nicht genügend Energiereserven haben um zwei Vollgelege zu produzieren umfassten in der Wauwiler Ebene 82 % der geschlüpften Gelege vier Eier und 18 % drei oder zwei Eier. Bebrütete Gelege mit nur einem oder mit fünf Eiern wurden keine beobachtet. Die Eier-Schlupfrate beschreibt den Anteil an Eiern in einem Gelege, aus welchen Küken schlüpfen. Aus 136 der insgesamt etwa 260 Eier, die während der Brutsaison 2018 gelegt wurden, sind Küken geschlüpft. Dies ergibt eine eher tiefe Eier-Schlupfrate von 52 %. Dieser Wert umfasst auch die Gelege, welche unvollständig blieben und berücksichtigt auch Prädation und frühzeitige Brutaufgabe. Insgesamt wurden in diesem Jahr 25,9 % der Gelege beraubt (Tab. 2). Dieser Wert liegt etwas unter dem letztjährigen (34,8 %), aber deutlich über dem Mittelwert aus den früheren Jahren von 13,7 %. Viele Felder standen nach starken Niederschlägen Ende Mai mehrere Tage unter Wasser. Dadurch wurden vier Nester mit insgesamt 11 Eiern zerstört. Eine Analyse der diesjährigen Daten zu den Nestern zeigt vermeintlich, dass vor allem der Verlust resp. die Zerstörung der Gelege den Aufzuchterfolg unserer Population stark beeinträchtigt (braune Balken, Abb. 12). Summiert man aber zum einen die Eierverluste und vergleicht sie mit den Kükenverlusten, so ist kaum ein Unterschied feststellbar. So verloren mindestens 126 potentielle Küken bereits als Ei ihr Leben, aber später auch 115 tatsächlich geschlüpfte Küken (mindestens 126 Eier weil oft der
14 als Eier (prädiert, zerstört, überschwemmt) als Eier (verlassen/kalt) als Eier (unbekannt) am 1. Tag Tag Tag Tag Tag ab Tag 34 (flügge) Anzahl Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht letzte Stand der Gelegegrösse nicht bekannt war, bevor das Nest verschwand ). Besonders kritische Lebensphasen für die Küken scheinen vor allem die ersten Tage ihres Lebens und dann wieder die Zeit kurz vor dem Erreichen des flugfähigen Alters zu sein. Bei Gelegen mit vier Eiern konnten wir oft beobachten, dass das vierte Küken erst etwas verzögert schlüpfte, bereits etwas schwächer war als seine Geschwister und schliesslich die ersten Tage nicht überlebten. Weshalb es hohe Ausfälle gerade vor dem Erreichen des flugfähigen Alters gibt, erklären wir damit, dass die Küken einerseits bereits gross sind und ihr Gefieder das Küken-Tarnmuster verloren hat, was sie auffälliger macht. Andererseits halten sie sich weiter von der Mutter entfernt auf, was sie angreifbarer macht, doch können sie bei Gefahr noch nicht wegfliegen. Diese Erklärungen sind sicher nicht definitiv, denn es kann durchaus sein, dass wir nicht alle Küken zum entscheidenden Zeitpunkt beobachten konnten und einige ohne unser Wissen flügge geworden sind Abb. 12. Übersicht über Art der Verluste von Eiern oder Küken (braun= Anzahl Eierverluste; blau=anzahl Kükenverluste pro Lebensdauer; grün: Anzahl Küken, die überlebt haben (gezählt bei Erreichen des flugfähigen Alters). 3.3 Wetter Kiebitzküken sind Nestflüchter. Die Fähigkeit, die Körpertemperatur selbständig und unabhängig von der Aussentemperatur gleichwarm halten zu können, entwickelt sich in den ersten Lebenstagen (Kooiker & Buckow 1997). Demzufolge sind die herrschenden Temperaturen zum Schlupfzeitpunkt von grosser Bedeutung. Der Brutbestand der Saison 2018 profitierte, im Vergleich zum Vorjahr, von einem warmen Frühling. Wie im Vorjahr waren jedoch auch in diesem Jahr Kälteeinbrüche zu verzeichnen welche sich genau dann einstellten, als mit 15 Küken am 29. April und 16 Küken am 12. Mai sehr viele Jungvögel schlüpften (Abb. 13). Diese fielen für die Kiebitzküken weniger dramatisch aus, da die mittleren Tagestemperaturen deutlich höher ausfielen als noch im Jahr zuvor. Die mittleren Nachttemperaturen fielen lediglich Mitte März noch einmal knapp unter den Gefrierpunkt. Auch tagsüber betrugen die Temperaturen im Mittel bereits ab Anfang April fast ausnahmslos mehr als 10 Grad Celsius. Im Vorjahr sind im Vergleich erst Anfang Mai Temperaturen von über 10 Grad Celsius gemessen worden. Verluste durch gefrorene Eier blieben aus und die Küken waren durch den ausbleibenden Schneefall auf den Flächen besser getarnt.
15 Temperatur ( C) Anzahl Küken geschlüpft Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Obwohl der Kiebitz ursprünglich ein Bewohner von Feuchtgebieten ist, sind die daunentragenden Küken in den ersten Tagen nach dem Schlüpfen noch nicht in der Lage, Nässe abzustossen. Somit sind für das Überleben der Küken neben der Temperatur auch die Niederschläge entscheidend. Zu starke Niederschläge kurz nach dem Schlüpfen führen dazu, dass die Jungvögel nass werden und schnell auskühlen. Bei Trockenheit ziehen sich die Beutetiere in die unteren Bodenschichten zurück und bleiben so für die Küken unerreichbar was zu Nahrungsmangel führt (Rickenbach et. al). Das erste Gelege wurde ähnlich wie im Vorjahr am 26. März im NAVO-Streifen gefunden, die Küken schlüpften am 19. April. Trotz der längeren Trockenphase im April war die Bodenfeuchtigkeit im Bereich der meisten Nester für die Futtersuche ausreichend. Lediglich die Küken auf den brachliegenden Äckern der Haftanstalt waren durch die Trockenheit gezwungen für die Futtersuche auf die umliegenden feuchteren Wiesen bzw. Maisfelder auszuweichen Anzahl Küken geschlüpft Tägliche mittlere Tagestemperatur Tägliche mittlere Nachttemperatur Abb. 13. Tägliche mittlere Nachttemperatur (2 Meter über Boden, schwarze Kurve, y-achse links), tägliche mittlere Tagestemperatur (2 Meter über Boden, rote Kurve, y-achse links) und Anzahl der täglich geschlüpften Küken über die Brutsaison (blaue Säulen, y-achse rechts). Im Verlauf der Feldsaison waren zwei Starkniederschläge zu verzeichnen (10. Mai mit 37,9 mm und am 22. Mai mit 56,9 mm Niederschlag; Abb. 14). Vor allem der Regen am 22. Mai auf den mehrheitlich wassergesättigten Boden führte dazu, dass der NAVO-Streifen, Teile auf Parzelle 489 sowie Flächen im Ettiswilermoos überschwemmt wurden. Im NAVO-Streifen waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle Küken geschlüpft. Anders im Ettiswilermoos und in Ettiswil/Seewagen, wo in den überfluteten Feldern vier Gelege untergingen. Die ab Mitte Mai vorhandenen durchnässten Böden boten den Kiebitzküken, die die davorliegenden trockenen 14 Tage überlebt hatten, eine gute Nahrungsgrundlage. Am 21. Mai schlüpften die letzten Küken, welche schliesslich flügge wurden (Abb. 8).
16 Niederschlag (mm) Anzahl Küken geschlüpft Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Anzahl Küken geschlüpft Niederschlagssumme Abb. 14. Summe der täglichen Niederschläge (in mm, blaue Kurve, y-achse link) und Anzahl der täglich geschlüpften Küken über die Feldsaison (braune Säulen, y-achse rechts). 3.4 Prädation Wie bereits durch Rickenbach et al (2011) bestätigt, ist durch den Nesterschutz mit Elektrozäunen die Prädationsrate erheblich gesunken. Vor allem an den Boden gebundene Prädatoren wie der Fuchs können mit den Elektrozäunen erfolgreich an der Prädation gehindert werden. Trotz den Bemühungen, wurde auf der Parzelle 489 in Schötz ein Küken innerhalb des Zaunes gerissen. Auch Hermeline (Mustela erminea) sind beim NAVO-Streifen sowie in verschiedenen Bereichen auf Parzelle 489 gesichtet worden. Anders als gegen den Fuchs, bietet der Elektrozaun gegen die Hermeline keinen wirksamen Schutz, können sie doch problemlos durch die Maschen schlüpfen. Beweise der Prädation von Kiebitzküken durch Hermeline konnten dieses Jahr jedoch keine erbracht werden. Weiter waren die Kiebitze ständig Störungen durch Rotmilane, Raben- und Saatkrähen, Turm- und Wanderfalken ausgesetzt. Durch Angriffe aus der Luft schützt sich der Koloniebrüter durch seine koordinierte Feindabwehr. Diese fällt jedoch nur effektiv aus, solange die Koloniegrösse nicht unter 6 12 Brutpaare fällt (Schifferli et al. 2009). Vom Aussichtsturm aus konnte häufig beobachtet werden, wie effizient die Kiebitze im NAVO-Streifen während der Brutzeit die Bedrohung aus der Luft abwehren konnten. Trotzdem liessen die gefundenen Kiebitzfedern am 3. Mai darauf schliessen, dass ein Altvogel dem Angriff eines Greifvogels zum Opfer gefallen ist. Per Zufall konnte auch beobachtet werden, wie ein Wanderfalke im Sturzflug ein Kiebitzweibchen beim Brüten attackierte. Dies jedoch ohne Erfolg. Obwohl die Prädation die Nachwuchsrate dezimiert, bleibt festzuhalten, dass auch das korrekte Aufstellen und Zusammenhängen der Elektrozäune für den optimalen Schutz entscheidend ist. Zudem sollte durch regelmässiges Mähen verhindert werden, dass die Vegetation in die Zäune einwächst und so die Stromführung abschwächt.
17 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Landwirtschaftliche Aktivitäten In diesem Jahr waren die Brutverluste in der landwirtschaftlich intensiv genutzten Wauwiler Ebene durch die Bodenbearbeitung im Vergleich zum Vorjahr eher gering. Dazu beigetragen hat sicherlich die frühzeitige Markierung der Nester, die sofortige Kontaktaufnahme mit den Landwirten sowie deren Entgegenkommen. Obwohl wir vor Ort waren sind in Einzelfällen trotzdem Gelege durch zu knappes Vorbeifahren des Bewirtschafters versehentlich zerstört worden. Der Versuch ein Gelege mit der Schaufel auszustechen und leicht versetzt wieder zu platzieren um die Bewirtschaftung zu erleichtern, schlug fehl und führte schliesslich zu einer Brutaufgabe. Aufgrund dieser Erkenntnis, wurden daraufhin Nester zwar noch mit der Schaufel ausgestochen jedoch exakt wieder an der ursprünglichen Stelle platziert, worauf die Brut meist fortgeführt wurde. Abb. 15. Bewirtschaftung rund um ein Kiebitznest (durch roten Kreis markiert, Simon Hohl). 3.6 Beringung Von den 136 geschlüpften Küken konnten 125 beringt werden (92 %, Tab. 2). Bei schlechten meteorologischen Bedingungen wurden die frisch geschlüpften Küken nicht beringt, um keine Unterkühlung der Jungen zu riskieren erreichten 21 Küken das flugfähige Alter von 34 Tagen. Dies ergibt bei 47 Brutpaaren einen Wert von 0,45 flüggen Nachkommen pro Paar (Tab. 2). Während der Brutsaison 2018 wurden zudem vier adulte Kiebitze beringt. Das milde und sonnige Wetter erlaubte es uns, während 30 Minuten eine Fangreuse über dem Nest aufzustellen, ohne dass die Eier auskühlten. So gelang es uns vier brütende Weibchen zu fangen und zu beringen. 3.7 Weitere Beobachtungen während der Feldarbeit Dieses Jahr wurden in der Wauwiler Ebene insgesamt 154 Vogelarten gesichtet. Hier eine kleine Auswahl der für das Gebiet nicht ganz alltäglichen Arten:
18 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Bekassine, Braunkehlchen, Brachpieper (Abb. 16), Eisvogel, Flussregenpfeifer, Grauschnäpper, Grünschenkel, Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Krickente, Kranich, Kuhreiher (Abb. 16), Kurzzehenlerche, Neuntöter, Rohrammer, Rotkehlpieper, Rotschenkel, Regenbrachvogel, Rohrweihe, Schwarzstorch, Sperber, Schwarzkehlchen, Seidenreiher, Stelzenläufer (Abb. 16), Schafstelze, Steinschmätzer, Sichler, Turteltaube, Teichrohrsänger, Trauerschnäpper, Waldwasserläufer, Waldohreule, Wiedehopf (Abb. 16), Wanderfalke, Wasserralle, Wiesenweihe. Abb. 16. Brachpiper ( Tanja Koch), Kuhreiher ( Simon Hohl), Wiedehopf ( Micha Kipfer), Stelzenläufer ( Simon Hohl), Bilder von o.l. im UZS. Des Weiteren konnten im Gebiet Kottwiler Moos sowie im Ettiswiler Moos junge Füchse beobachtet werden. Feldhasen konnten in der ganzen Ebene fast täglich gesichtet werden. Diese profitieren ganz klar von den laufenden Aufwertungsmassnahmen in der Wauwiler Ebene mit Buntbrachen und zahlreichen Altgrasstreifen. Im Gebiet Seemoos/NAVO-Streifen konnten auch zweimal Hermeline einmal sogar mit Nachwuchs beobachtet werden.
19 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene Die Entwicklung des Kiebitzbestands Das wissenschaftlich begleitete Förderprojekt startete 2005 mit 17 Brutpaaren. In den ersten beiden Jahren lag der Projektschwerpunkt auf der Erforschung der Gefährdungsursachen und möglicher Fördermassnahmen. Tab. 3 zeigt die beobachteten Zahlen der letzten zehn Jahre im Überblick. Über die Jahre stieg der Brutbestand an und erreichte 2015 und 2016 mit 60 Paaren den Höchststand. Erstmals 2017 und nun auch 2018 war ein Rückgang der Anzahl Brutpaare zu beobachten. Tab. 3. Die Daten aus dem Kiebitzprojekt in der Wauwiler Ebene für die Jahre im Überblick Mittel Anzahl Brutpaare ,7 Anzahl Gelege ,2 % geschlüpft ,7 % verlassen ,2 % ausgeraubt ,2 % überschwemmt ,8 Eier pro Paar 4,8 4,5 4,6 4,5 4,1 4,7 5,3 7,0 5,7 5,5 5,1 Geschlüpft pro Paar 3,6 3,8 3,0 3,3 3,1 3,3 4,1 3, ,0 3,4 Flügge pro Paar 1,26 0,89 1,13 1,13 1,26 0,59 1,27 0,12 0,37 0,45 0,8 Beringte Küken ,9 Eingezäunte Fläche (ha) 12,5 12,5 21,9 35,2 22,3 18,2 13,5 16,8 11,0 14,5 17,8 Länge Elektrozaun (km) 5,4 3,8 7,7 9,3 8,4 5,2 5,2 8,4 4,1 5,0 6,3 Erklärungen zur Tabelle 3: - Anzahl Brutpaare: entspricht im Prinzip der Anzahl brütende Weibchen. Die Anzahl brütender Männchen kann kleiner sein, weil ein Männchen gleichzeitig mehrere Weibchen haben kann. - Anzahl Gelege: Nester die gebaut wurden. Nicht alle davon werden bis zum Ende bebrütet, einige werden prädiert oder frühzeitig verlassen. - Eier pro Paar: hier werden alle während der Saison gelegten Eier berücksichtigt (2018 N = 260). - Flügge Küken pro Paar: Küken, welche 34 Tage alt werden, gelten als flügge (flugfähig und von den Eltern unabhängig).
20 n Brutpaare Bruterfolg (n Flügge/BP) Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Abb. 17. Die Entwicklung der Anzahl Brutpaare und des Bruterfolgs der Kiebitze in der Wauwiler Ebene (Brutbestand (Anzahl Brutpaare): grüne Säulen, y-achse links; Bruterfolg (Anzahl flügge Küken pro Brutpaar): blaue Kurve und y-achse rechts). 4.2 Feuchtwiesen im Wauwilermoos ein wertvoller Lebensraum Ein beliebter Brut- und Aufenthaltsort der Kiebitze war die im Winter 2016/17 angelegte Feuchtwiese nördlich des Naturschutzgebietes. Diese Fläche setzt sich aus dem ursprünglichen sogenannten NA- VO-Streifen (NAVO = Natur- und Vogelschutzverein Wauwil-Egolzwil und Umgebung) und einer Fläche, die der Strafanstalt Wauwilermoos gehört, zusammen. Gegen Norden wird die Fläche durch einen neuen Bewirtschaftungsweg gegenüber den weiteren Flächen der Strafanstalt abgegrenzt, deshalb wird sie der Einfachheit halber als NAVO-Streifen bezeichnet. Nach der Aufwertung präsentierte sich eine spärlich bewachsene und zeitweise überschwemmte Fläche, welche 2018 von sieben Paaren als Neststandort gewählt wurde. Die eingezäunte Feuchtfläche mit ihrem weichen Boden war besonders für die kleinen Küken ein optimaler Lebensraum. Im feuchten Boden gelangen sie mit ihrem noch kurzen Schnabel einfach an Futter. Auch viele Adultvögel profitierten von den angelegten Flutmulden und kehrten fast täglich zur Nahrungssuche und Gefiederpflege an die Wasserpfützen zurück. In trockenen Perioden waren die Feuchtwiesen besonders wertvoll adulte und junge Kiebitze versammelten sich an den Flutmulden und profitierten von deren Restwasser. Nicht nur Kiebitze, auch Flussregenpfeifer, Bruchwasserläufer, Bekassine und diverse andere Vogelarten nutzen die Feuchtwiesen als Rückzugs- und Nahrungsplatz. Damit dieser Standort auch in Zukunft hochwertig bleibt, gibt es zwei Punkte zu beachten. Zum einen muss mit manuellen Rodungen dafür gesorgt werden, dass die Flächen nicht von Sträuchern und Schilf überwachsen werden und als offene Feuchtstellen erhalten bleiben. Zweitens muss der neue Bewirtschaftungsweg, der von der Strafanstalt für die Bewirtschaftung der nördlich angrenzenden Flächen genutzt wird, für die Öffentlichkeit während der Brut- und Zugzeit weiterhin gesperrt bleiben. Nur so können Störungen durch Freizeitaktivitäten auf dem Weg, insbesondere auch Spaziergänger mit Hunden, minimiert werden, welche für brütende Weibchen und noch flugunfähige Küken wesentliche Stressfaktoren darstellen.
21 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Abb. 18. Im Rahmen der Aufwertung des Naturschutzgebietes Wauwilermoos neu geschaffene Flutmulden: Sporadisch überschwemmte Flächen sind nur lückig bewachsen und bieten auch während längeren Trockenphasen sumpfigen Boden. Beutetiere bleiben für die Kiebitzküken, die mit ihrem noch kurzen Schnabel nicht so weit stochern können wie die Altvögel, erreichbar ( M. Burkhardt). 5. Ein herzliches Dankeschön! Wir danken allen Landwirten herzlich für die Rücksicht, die sie beim Bewirtschaften der Felder auf die Kiebitze nehmen. Ein Rückgrat für die Kiebitzförderung sind insbesondere diejenigen Landwirte, welche bereit sind, im Rahmen des Vernetzungsprojekts Wauwiler Ebene Kiebitzmassnahmen zu vereinbaren und damit einen Teil ihrer Flächen kiebitzfreundlich zu bewirtschaften. Im Namen der Vogelwarte danken wir allen Stiftungen und privaten Geldgeber, die das Projekt in den letzten Jahren finanziell unterstützt haben. Insbesondere zwei Stiftungen, die beide ungenannt bleiben möchten, danken wir für die finanzielle Unterstützung des Förderprojektes für den Kiebitz in der Wauwiler Ebene im Jahr Nur dank dieser Unterstützung kann das Artenförderungsprojekt durchgeführt werden. 6. Ausblick 2019 Für die Saison 2019 stehen folgende Aufgaben in der Wauwiler Ebene im Vordergrund: Bezeichnen von Schwerpunktgebieten und Verhandlungen mit Landwirten um weitere Kiebitzbrachen (während Brutsaison unbewirtschaftet) zu definieren; Angebot an temporären Feuchtflächen erhöhen; Kiebitzförderung (Feldarbeit) Beobachtung der zurückkehrenden Kiebitze, der Paarbildung und der Brutplatzwahl; Schutz der Parzellen mit mehr als zwei Nestern durch Elektrozäune, Markierung der Nester; Beobachtung und Identifikation der Brutpaare, Fang der unberingten bzw. beringten, aber nicht identifizierbaren Altvögel; Beobachtung des Brutgeschehens, Berechnen des Schlüpftermins, Beringung der Küken, Bestimmen des Bruterfolgs; Beobachtung der Streifzüge der Familien auf Nahrungssuche und Schutz von besonders wichtigen (von mehreren Familien über mehrere Tage) genutzten Nahrungsgebieten durch Elektrozäune; Beobachtung der Entwicklung der Jungvögel und Bestimmen des Bruterfolgs.
22 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern Vorbereitung der Kiebitzbrachen; Unterstützung der Landwirte bei der Feldarbeit in Kiebitzflächen (Zäune wegräumen, Nester bezeichnen, falls ein Bewirtschaftungsgang notwendig ist Familien von der Fläche treiben oder Küken einsammeln); Finanzielle Unterstützung der Bewirtschafter bei ungeplanten Bewirtschaftungs-Aufschüben. Sensibilisierung, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit Gebietsbetreuung: Ansprechpersonen für Bewirtschafter und Passanten; Medienmitteilungen; Infoflyer und Projektplakate im Kerngebiet; Beteiligung am Moostag 2019 in der Wauwiler Ebene; Einbezug von Schnupperpraktikantinnen und -praktikanten; Leitung von Exkursionen für interessierte Personen ins Projektgebiet. 7. Literatur Horch, P., C. Gygax, S. Fischer, A. Egli, P. Bünter & R. Spaar (2017): Artförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern: Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Keller, V., A. Gerber, H. Schmid, B. Vogelt & N. Zbinden (2010a): Rote Liste Brutvögel. Gefährdete Arten der Schweiz, Stand Bundesamt für Umwelt, Bern, und Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Umweltvollzug Nr Keller, V., R. Ayé, W. Müller, R. Spaar & N. Zbinden (2010b): Die prioritären Vogelarten der Schweiz: Revision Ornithol. Beob. 107: Kooiker, G. & C.V. Buckow (1997): Der Kiebitz: Flugkünstler im offenen Land. AULA-Verlag, Wiesbaden. MeteoSchweiz 2018: Klimabulletin April Zürich. Rickenbach, O., M. U. Grüebler, M. Schaub, A. Koller, B. Naef-Daenzer & L. Schifferli (2011): Exclusion of ground predators improves Northern Lapwing Vanellus vanellus chick survival. Ibis 153: Schifferli, L., O. Rickenbach, A. Koller & M. Grüebler (2009): Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern): Schutz der Nester vor Landwirtschaft und Prädation. Ornithol. Beob. 106:
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2017 Petra Horch Cristina Gygax Simon Fischer Annina Egli Philipp Bünter Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2017 Petra Horch Cristina Gygax Simon Fischer Annina Egli Philipp Bünter Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft
Wie retten wir den Kiebitz? Teil 2
 Schweizerische Vogelwarte Wie retten wir den Kiebitz? Teil 2 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Artenförderung Kiebitz Erforschung der Ursachen für den Bestandsrückgang
Schweizerische Vogelwarte Wie retten wir den Kiebitz? Teil 2 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Artenförderung Kiebitz Erforschung der Ursachen für den Bestandsrückgang
Artenförderungsprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderungsprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2014 Petra Horch Alexandra Brunner Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und
Artenförderungsprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2014 Petra Horch Alexandra Brunner Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2016 Petra Horch Nicolas Guillod Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2016 Petra Horch Nicolas Guillod Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Wie retten wir den Kiebitz? Teil 1. Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler
 Wie retten wir den Kiebitz? Teil 1 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Bestandtrends In der Schweiz (1990 2013) Swiss BirdIndex Besiedelte Gebiete 2005-2013 Kartengrundlage
Wie retten wir den Kiebitz? Teil 1 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Bestandtrends In der Schweiz (1990 2013) Swiss BirdIndex Besiedelte Gebiete 2005-2013 Kartengrundlage
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2015 Petra Horch Nathalie Burgener Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2015 Petra Horch Nathalie Burgener Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene Jahresbericht 2013 Petra Horch Karin Feller Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Fischerei und Jagd des Kantons Luzern
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene Jahresbericht 2013 Petra Horch Karin Feller Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Fischerei und Jagd des Kantons Luzern
Exkursion Wauwilermoos
 Exkursion Wauwilermoos Samstag, 5. Mai 2018, 07:30 ca. 13:15 Uhr Exkursionsleitung: Beni und Edith Herzog Teilnehmer: 27 Personen Artenliste Reihenfolge der Beobachtung Art-Nr. gemäss ID Vogelwarte 5350
Exkursion Wauwilermoos Samstag, 5. Mai 2018, 07:30 ca. 13:15 Uhr Exkursionsleitung: Beni und Edith Herzog Teilnehmer: 27 Personen Artenliste Reihenfolge der Beobachtung Art-Nr. gemäss ID Vogelwarte 5350
Ackermaßnahmen für den Kiebitz im Erdinger und Freisinger Moos. Marina Stern, 19. Februar 2015
 Ackermaßnahmen für den Kiebitz im Erdinger und Freisinger Moos Marina Stern, 19. Februar 2015 Ausgangssituation Kiebitz 2006 365 Reviere / Acker 130 Reviere / Wiese 2 Aktuelle Situation
Ackermaßnahmen für den Kiebitz im Erdinger und Freisinger Moos Marina Stern, 19. Februar 2015 Ausgangssituation Kiebitz 2006 365 Reviere / Acker 130 Reviere / Wiese 2 Aktuelle Situation
Stockenten in Berlin. Hilfe für tierische Hausbesetzer
 Stockenten in Berlin Hilfe für tierische Hausbesetzer 2 Ausgangssituation Die Anpassungsfähigkeit der Stockente ist sehr groß. Natürlichweise werden die Nester gut versteckt in dichter Vegetation am Boden
Stockenten in Berlin Hilfe für tierische Hausbesetzer 2 Ausgangssituation Die Anpassungsfähigkeit der Stockente ist sehr groß. Natürlichweise werden die Nester gut versteckt in dichter Vegetation am Boden
Zur biologischen Vielfalt
 Jahresbericht 2016 Zur biologischen Vielfalt Jagd und Artenschutz Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 2.14 Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil Schleswig Seit 2014 werden
Jahresbericht 2016 Zur biologischen Vielfalt Jagd und Artenschutz Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 2.14 Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil Schleswig Seit 2014 werden
J u n g h a s e n : W o ü b e r l e b e n s i e d i e e r s t e n L e b e n s w o c h e n?
 H a s e n s c h u t z i n d e r S c h w e i z 29 J u n g h a s e n : W o ü b e r l e b e n s i e d i e e r s t e n L e b e n s w o c h e n? Von Denise Karp, Doktorandin Uni Zürich Der Bestand des Feldhasen
H a s e n s c h u t z i n d e r S c h w e i z 29 J u n g h a s e n : W o ü b e r l e b e n s i e d i e e r s t e n L e b e n s w o c h e n? Von Denise Karp, Doktorandin Uni Zürich Der Bestand des Feldhasen
Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2009
 Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2009 Januar 2009: 13.01. Acht Seidenschwänze und etliche Rotdrosseln waren zu Gast. 19.01. Sechs Bläßgänse und 18 Birkenzeisige wurden gezählt. 25.01.
Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2009 Januar 2009: 13.01. Acht Seidenschwänze und etliche Rotdrosseln waren zu Gast. 19.01. Sechs Bläßgänse und 18 Birkenzeisige wurden gezählt. 25.01.
Aktiver Gelege- und Kükenschutz von Wiesenbrütern. Ein Beispiel für eine produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme
 Aktiver Gelege- und Kükenschutz von Wiesenbrütern Ein Beispiel für eine produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme Idee des Gelegeschutzes stammt aus den Niederlanden Ehrenamtlicher Naturschutz Ursprünglich
Aktiver Gelege- und Kükenschutz von Wiesenbrütern Ein Beispiel für eine produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme Idee des Gelegeschutzes stammt aus den Niederlanden Ehrenamtlicher Naturschutz Ursprünglich
Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen
 Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen Wiesenbrüter sind Vögel, welche ihr Nest am Boden anlegen. Das Nest verstecken sie in einer Wiese oder Weide. In der Ausstellung Erlebnis Wiesenbrüter wird
Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen Wiesenbrüter sind Vögel, welche ihr Nest am Boden anlegen. Das Nest verstecken sie in einer Wiese oder Weide. In der Ausstellung Erlebnis Wiesenbrüter wird
Kiebitz und Feldlerche im Flachgau
 Kiebitz und Feldlerche im Flachgau 12.01.17 Regionalseminar ÖPUL-schutz in Salzburg: Wir haben es in der Hand Dr. Susanne Stadler Land Salzburg, Abt. 5 Referat schutzgrundlagen und Sachverständigendienst
Kiebitz und Feldlerche im Flachgau 12.01.17 Regionalseminar ÖPUL-schutz in Salzburg: Wir haben es in der Hand Dr. Susanne Stadler Land Salzburg, Abt. 5 Referat schutzgrundlagen und Sachverständigendienst
Nistkasten 01 in 2016
 Nachfolgend werden nur Bilder der Innenkamera angezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 71 GB Speicherplatz und können daher nicht in die vorliegende Datei eingebunden werden. Nistkasten 01
Nachfolgend werden nur Bilder der Innenkamera angezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 71 GB Speicherplatz und können daher nicht in die vorliegende Datei eingebunden werden. Nistkasten 01
Ein Jahr auf Bird Island
 Ein Jahr auf Bird Island Sehr heiß, aber immer noch etwas Wind aus Nordwesten. Das Meer ist normalerweise sehr ruhig und klar. Gelegentliche Regenschauer. Schöne Sonnenuntergänge. Das Riff trocknet im
Ein Jahr auf Bird Island Sehr heiß, aber immer noch etwas Wind aus Nordwesten. Das Meer ist normalerweise sehr ruhig und klar. Gelegentliche Regenschauer. Schöne Sonnenuntergänge. Das Riff trocknet im
Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012
 Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012 (Gerfried Klammer, Landsberg) Vom Ansitz abfliegende Sumpfohreule bei Langeneichstädt (Quelle: Dr. Erich Greiner, 13.07.2012) Erfahrungen aus diesjährigen Bruten
Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012 (Gerfried Klammer, Landsberg) Vom Ansitz abfliegende Sumpfohreule bei Langeneichstädt (Quelle: Dr. Erich Greiner, 13.07.2012) Erfahrungen aus diesjährigen Bruten
Januar 2013: Februar 2013:
 Januar 2013: 02.01. Silberreiher, 0,1 Kornweihe, 6 Kiebitze 05.01. 8 Silberreiher, 0,1 Kornweihe, 4 Blessgänse 07.01. 11 Silberreiher, Blessgänse, 2,1 Schnatterenten, 1,1 Pfeifenten, 26 Krickenten, 0,1
Januar 2013: 02.01. Silberreiher, 0,1 Kornweihe, 6 Kiebitze 05.01. 8 Silberreiher, 0,1 Kornweihe, 4 Blessgänse 07.01. 11 Silberreiher, Blessgänse, 2,1 Schnatterenten, 1,1 Pfeifenten, 26 Krickenten, 0,1
Jahresbericht 2013 Zabergäu / Leintal / Kraichgau
 Liebe Mitarbeiter, Streuobstwiesenbesitzer und Steinkauz-Interessierte, der Auftakt der Brutsaison 2013 war von sonnenscheinarmen Wintermonaten und einem verspäteten Wintereinbruch im März geprägt. Fortgesetzt
Liebe Mitarbeiter, Streuobstwiesenbesitzer und Steinkauz-Interessierte, der Auftakt der Brutsaison 2013 war von sonnenscheinarmen Wintermonaten und einem verspäteten Wintereinbruch im März geprägt. Fortgesetzt
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten?
 Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Silberreiher, 1 Eisvogel, 5 Kormorane, ca. 100 Erlenzeisige, 3 Zwergtaucher.
 Dezember 2016 01.12. 2 Silberreiher, 0,1 Sperber. 02.12. 2 Silberreiher, 7 Kormorane. 04.12. 9 Dohlen, 0,1 Sperber. 05.12. 1 Zwergtaucher, 4 Kormorane. 09.12. 2 Silberreiher, 1 Eisvogel, 5 Kormorane, ca.
Dezember 2016 01.12. 2 Silberreiher, 0,1 Sperber. 02.12. 2 Silberreiher, 7 Kormorane. 04.12. 9 Dohlen, 0,1 Sperber. 05.12. 1 Zwergtaucher, 4 Kormorane. 09.12. 2 Silberreiher, 1 Eisvogel, 5 Kormorane, ca.
Frühling Klimabulletin Frühling MeteoSchweiz. Sehr milder Frühling. Alpensüdseite trocken. Sonnige Frühlingmitte. 09.
 Frühling 2015 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2015 09. Juni 2015 Die Frühlingstemperatur lag über die ganze Schweiz gemittelt 1.1 Grad über der Norm 1981 2010. Auf der Alpensüdseite zeigte sich der
Frühling 2015 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2015 09. Juni 2015 Die Frühlingstemperatur lag über die ganze Schweiz gemittelt 1.1 Grad über der Norm 1981 2010. Auf der Alpensüdseite zeigte sich der
Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen. Von Martin Brühne & Benedikt Gießing
 Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen Von Martin Brühne & Benedikt Gießing Es war nicht das erste Mal, dass ein Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen Von Martin Brühne & Benedikt Gießing Es war nicht das erste Mal, dass ein Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
Nistkasten 01 in 2015
 Nistkasten 01 in 2015 Erste Brut In 2015 brüteten im Nistkasten 01 wieder Kohlmeisen. Aus den 6 Eiern sind 5 Jungvögel schlüpft. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Jungvögel vom 18.04.2015
Nistkasten 01 in 2015 Erste Brut In 2015 brüteten im Nistkasten 01 wieder Kohlmeisen. Aus den 6 Eiern sind 5 Jungvögel schlüpft. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Jungvögel vom 18.04.2015
aus dem Auracher Storchennest: Das erste Ei im Auracher Storchennest am 21. März 2015
 2015 - aus dem Auracher Storchennest: Das erste Ei im Auracher Storchennest am 21. März 2015 Das zweite Ei im Auracher Storchennest am 24. März 2015 Das dritte Ei im Auracher Storchennest am 27. März 2015
2015 - aus dem Auracher Storchennest: Das erste Ei im Auracher Storchennest am 21. März 2015 Das zweite Ei im Auracher Storchennest am 24. März 2015 Das dritte Ei im Auracher Storchennest am 27. März 2015
Seite Vogelforscher-Wissen Vögel bestimmen Enten, Gänse, Storch & Co Greifvögel, Eulen, Fasan & Co... 32
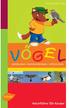 Das steht im Buch Seite Vogelforscher-Wissen... 4 Vögel bestimmen... 12 Enten, Gänse, Storch & Co... 15 Greifvögel, Eulen, Fasan & Co... 32 Tauben, Krähen, Spechte & Co... 42 Amsel, Meise, Fink & Co...
Das steht im Buch Seite Vogelforscher-Wissen... 4 Vögel bestimmen... 12 Enten, Gänse, Storch & Co... 15 Greifvögel, Eulen, Fasan & Co... 32 Tauben, Krähen, Spechte & Co... 42 Amsel, Meise, Fink & Co...
Bestandsentwicklung von Wiesenlimikolen in Deutschland - gibt es sie bald nur noch an der Küste
 Bestandsentwicklung von Wiesenlimikolen in Deutschland - gibt es sie bald nur noch an der Küste Heike Jeromin Michael-Otto-Institut im NABU 0162-9098071 Bergenhusen Aktionsplan Wiesenvögel Wiesenvogelzählgebiete
Bestandsentwicklung von Wiesenlimikolen in Deutschland - gibt es sie bald nur noch an der Küste Heike Jeromin Michael-Otto-Institut im NABU 0162-9098071 Bergenhusen Aktionsplan Wiesenvögel Wiesenvogelzählgebiete
Fach: Mensch und Umwelt/Natur und Technik/Grundlegende Arbeitsweisen Natürliche Vorgänge beobachten und sachlich beschreiben
 Aufgabe Aufgabe 1: Afrikanisches Gebirge: Raumnutzung und Verhaltensbeobachtung Ziel: Kinder können selbstständig beobachten und die Beobachtungen interpretieren. Fach: Mensch und Umwelt/Natur und Technik/Grundlegende
Aufgabe Aufgabe 1: Afrikanisches Gebirge: Raumnutzung und Verhaltensbeobachtung Ziel: Kinder können selbstständig beobachten und die Beobachtungen interpretieren. Fach: Mensch und Umwelt/Natur und Technik/Grundlegende
Das Oltner Wetter im April 2011
 Das Oltner Wetter im April 2011 Ein aussergewöhnlicher April Der Wetterablauf im April 2011 war von einem dominierenden Element geprägt, nämlich Hochdruckgebieten. Von Monatsbeginn bis zum 22. April lagen
Das Oltner Wetter im April 2011 Ein aussergewöhnlicher April Der Wetterablauf im April 2011 war von einem dominierenden Element geprägt, nämlich Hochdruckgebieten. Von Monatsbeginn bis zum 22. April lagen
Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern
 Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern Erste Ergebnisse zu Habitatwahl, Bruterfolg und Fördermaßnahmen Frank Gottwald, Andreas + Adele Matthews, Karin Stein-Bachinger DO-G Fachgruppentreffen
Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern Erste Ergebnisse zu Habitatwahl, Bruterfolg und Fördermaßnahmen Frank Gottwald, Andreas + Adele Matthews, Karin Stein-Bachinger DO-G Fachgruppentreffen
Frühling Klimabulletin Frühling MeteoSchweiz. Frühling mit insgesamt normaler Temperatur. Im Norden nasser Frühling. 10.
 Frühling 2016 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2016 10. Juni 2016 Die Frühlingstemperatur 2016 lag im Mittel über die ganze Schweiz im Bereich der Norm 1981 2010. Der Frühling lieferte verbreitet reichlich
Frühling 2016 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2016 10. Juni 2016 Die Frühlingstemperatur 2016 lag im Mittel über die ganze Schweiz im Bereich der Norm 1981 2010. Der Frühling lieferte verbreitet reichlich
Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte
 Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte Die Beringung soll AUSSCHLIESSLICH dem Gewinn wissenschaftlich relevanter Daten dienen Beringung nur der Fernfunde wegen ist nicht mehr zeitgemäß! Das AOC als
Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte Die Beringung soll AUSSCHLIESSLICH dem Gewinn wissenschaftlich relevanter Daten dienen Beringung nur der Fernfunde wegen ist nicht mehr zeitgemäß! Das AOC als
Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2012
 Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2012 Januar 2012: 03.01. 4 Silberreiher, 4 Lachmöwen, 15 Stieglitze, 3 Wiesenpieper 10.01. 1 Silberreiher, 1 Kiebitz, 200 Grau-, 60 Kanada-, 70 Nilgänse
Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2012 Januar 2012: 03.01. 4 Silberreiher, 4 Lachmöwen, 15 Stieglitze, 3 Wiesenpieper 10.01. 1 Silberreiher, 1 Kiebitz, 200 Grau-, 60 Kanada-, 70 Nilgänse
Bartgeier. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Bartgeier Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Michel Gunther / WWF-Canon Steckbrief Grösse:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Bartgeier Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Michel Gunther / WWF-Canon Steckbrief Grösse:
Unterrichtsmaterial zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC)
 Unterrichtsmaterial zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC) Titel: Die Bedeutung der Salzwiesen am Beispiel der Ringelgans Autor: Lennard Lüdemann Stufe: Sekundarstufe Art des Materials: Informationstexte
Unterrichtsmaterial zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC) Titel: Die Bedeutung der Salzwiesen am Beispiel der Ringelgans Autor: Lennard Lüdemann Stufe: Sekundarstufe Art des Materials: Informationstexte
Das Oltner Wetter im Februar 2010
 Das Oltner Wetter im Februar 2010 Winterlich mit Hauch von Frühling gegen Monatsende Auch der vergangene Februar war, wie schon der Januar 2010, mehrheitlich durch winterliches Wetter geprägt Diese Schlussfolgerung
Das Oltner Wetter im Februar 2010 Winterlich mit Hauch von Frühling gegen Monatsende Auch der vergangene Februar war, wie schon der Januar 2010, mehrheitlich durch winterliches Wetter geprägt Diese Schlussfolgerung
Limikolen 1. Fokpräsentation Jonas Landolt. FOK 12/13 Limikolen 1 - Jonas Landolt
 Limikolen 1 Fokpräsentation Jonas Landolt Übersicht heutiger Theorieabend Infos Postenlauf vom Übungsabend Einstiegsvortrag zur Biologie Übung zur Bestimmung Arten vorstellen Auswertung Evaluation Weitere
Limikolen 1 Fokpräsentation Jonas Landolt Übersicht heutiger Theorieabend Infos Postenlauf vom Übungsabend Einstiegsvortrag zur Biologie Übung zur Bestimmung Arten vorstellen Auswertung Evaluation Weitere
Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege
 Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Werner Eikhorst Bremen, Oktober 2007 Brutvögel am Unterlauf der
Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Werner Eikhorst Bremen, Oktober 2007 Brutvögel am Unterlauf der
Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen
 Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen Von Ernst-Günter Bulk, Stefan Bulk & Eckhard Möller Die Wetten liefen bereits seit ein Paar Jahren: Die weiten dünn besiedelten
Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen Von Ernst-Günter Bulk, Stefan Bulk & Eckhard Möller Die Wetten liefen bereits seit ein Paar Jahren: Die weiten dünn besiedelten
Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013
 Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013 Beate Wendelin Lachmöwe (Larus ridibundus) 2013 wurde der Brut-Bestand der Lachmöwe im Nationalpark Neusiedler
Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013 Beate Wendelin Lachmöwe (Larus ridibundus) 2013 wurde der Brut-Bestand der Lachmöwe im Nationalpark Neusiedler
Vernetzung im Kulturland Periode II,
 Vernetzungs- projekt Vernetzung im Kulturland Periode II, 2010-2015 Das Projekt Vernetzung im Kulturland des Kantons wurde von 2004 bis 2009 während 6 Jahren erfolgreich umgesetzt. Im Januar 2010 hat es
Vernetzungs- projekt Vernetzung im Kulturland Periode II, 2010-2015 Das Projekt Vernetzung im Kulturland des Kantons wurde von 2004 bis 2009 während 6 Jahren erfolgreich umgesetzt. Im Januar 2010 hat es
Das Oltner Wetter im März 2011
 Das Oltner Wetter im März 2011 Frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit Auch der erste Frühlingsmonat war, wie schon die Vormonate Januar und Februar, überwiegend von hohem
Das Oltner Wetter im März 2011 Frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit Auch der erste Frühlingsmonat war, wie schon die Vormonate Januar und Februar, überwiegend von hohem
Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII. Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni
 Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni 2015 - Vor den Osterferien werden alle Meisenkästen auf dem
Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni 2015 - Vor den Osterferien werden alle Meisenkästen auf dem
Dohlen-Vorkommen und -Beringung 2010 im Hohenlohekreis (KÜN)
 Dohlen-Vorkommen und -Beringung 2010 im Hohenlohekreis (KÜN) fast flügger Dohlen-Jungvogel am 03.06.2010 in Neuenstein 17.03.2010 Kloster Schöntal / Klosterkirche: Foto: Karl-Heinz Graef (49,32969 N /
Dohlen-Vorkommen und -Beringung 2010 im Hohenlohekreis (KÜN) fast flügger Dohlen-Jungvogel am 03.06.2010 in Neuenstein 17.03.2010 Kloster Schöntal / Klosterkirche: Foto: Karl-Heinz Graef (49,32969 N /
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Dr. Eckhard Gottschalk + Werner Beeke
 Dr. Eckhard Gottschalk + Werner Beeke Das Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen - Blühstreifen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Landwirten - Im europäischen Monitoring des European Bird
Dr. Eckhard Gottschalk + Werner Beeke Das Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen - Blühstreifen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Landwirten - Im europäischen Monitoring des European Bird
Reisebericht Spreewaldreise. Perlen in Brandenburgs Süden
 Reisebericht Spreewaldreise Perlen in Brandenburgs Süden 05.05.-10.05. 2015 Teilnehmer: 11 Reiseleiter Rolf Schneider Anzahl der beobachteten Vogelarten: 135 Beobachtungsorte bei www.naturgucker.de nachlesbar:
Reisebericht Spreewaldreise Perlen in Brandenburgs Süden 05.05.-10.05. 2015 Teilnehmer: 11 Reiseleiter Rolf Schneider Anzahl der beobachteten Vogelarten: 135 Beobachtungsorte bei www.naturgucker.de nachlesbar:
Meeresschildkröten. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Meeresschildkröten Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Jürgen Freund / WWF-Canon Steckbrief
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Meeresschildkröten Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Jürgen Freund / WWF-Canon Steckbrief
Zwischenbericht an die Stadt Puchheim ( )
 Monitoring einer Brutkolonie der Saatkrähe (Corvus frugilegus) im Alten Friedhof, im Schopflachwäldchen und in der unmittelbaren Umgebung, Stadt Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) Zwischenbericht an
Monitoring einer Brutkolonie der Saatkrähe (Corvus frugilegus) im Alten Friedhof, im Schopflachwäldchen und in der unmittelbaren Umgebung, Stadt Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) Zwischenbericht an
Die Wanderfalken im GKM
 Die Wanderfalken im GKM Unser Beitrag zum Artenschutz Wanderfalken im Kaminzimmer. Seit fast 20 Jahren engagiert sich das GKM erfolgreich für den Schutz des Wanderfalken. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeauftragten
Die Wanderfalken im GKM Unser Beitrag zum Artenschutz Wanderfalken im Kaminzimmer. Seit fast 20 Jahren engagiert sich das GKM erfolgreich für den Schutz des Wanderfalken. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeauftragten
Herbst Klimabulletin Herbst MeteoSchweiz. Extrem milder Oktober und November. Hochwasser im Tessin. 09. Dezember 2014
 Herbst 2014 MeteoSchweiz Klimabulletin Herbst 2014 09. Dezember 2014 Die Schweiz erlebte den zweitwärmsten Herbst seit Messbeginn vor 151 Jahren. Im Tessin und im Engadin war der Herbst zudem nass und
Herbst 2014 MeteoSchweiz Klimabulletin Herbst 2014 09. Dezember 2014 Die Schweiz erlebte den zweitwärmsten Herbst seit Messbeginn vor 151 Jahren. Im Tessin und im Engadin war der Herbst zudem nass und
Bilder aus den Nistkästen in 2017
 Bilder aus den Nistkästen in 2017 Nachfolgend werden keine Videodaten, sondern nur Bilder der Innen- und Außenkameras gezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 1300 GB Speicherplatz und können
Bilder aus den Nistkästen in 2017 Nachfolgend werden keine Videodaten, sondern nur Bilder der Innen- und Außenkameras gezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 1300 GB Speicherplatz und können
Verbreitungsentwicklung des Rotmilans im Kanton Graubünden im Jahr 2016
 Verbreitungsentwicklung des Rotmilans im Kanton Graubünden im Jahr 2016 Auch in diesem Jahr hat sich der Rotmilan in Graubünden weiter ausgebreitet. Die Anzahl der bei ornitho.ch gemeldeten Beobachtungen
Verbreitungsentwicklung des Rotmilans im Kanton Graubünden im Jahr 2016 Auch in diesem Jahr hat sich der Rotmilan in Graubünden weiter ausgebreitet. Die Anzahl der bei ornitho.ch gemeldeten Beobachtungen
Artenförderung Vögel im Wald
 Artenförderung Vögel im Wald Raffael Ayé, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Reto Spaar, Schweizerische Vogelwarte Sempach SVS-Naturschutztagung, Hünenberg ZG, 17. November 2012 Brutvogelarten
Artenförderung Vögel im Wald Raffael Ayé, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Reto Spaar, Schweizerische Vogelwarte Sempach SVS-Naturschutztagung, Hünenberg ZG, 17. November 2012 Brutvogelarten
Nahrung und Lebensraum der Störche
 DE SuS A7 Auftrag Zyklus 2a, Zyklus 2b Auftrag 7 Nahrung und Lebensraum der Störche Info für die Lehrperson Was? Ein genügend grosses Nahrungsangebot sowie gute klimatische Bedingungen während der Brutzeit
DE SuS A7 Auftrag Zyklus 2a, Zyklus 2b Auftrag 7 Nahrung und Lebensraum der Störche Info für die Lehrperson Was? Ein genügend grosses Nahrungsangebot sowie gute klimatische Bedingungen während der Brutzeit
Naturpädagogisches Programm
 Naturpädagogisches Programm Angebote für Schulen Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Die Forschungsstation Schlüchtern entstand aus einer wissenschaftlichen Zweigstelle der J.W. Goethe-Universität Frankfurt.
Naturpädagogisches Programm Angebote für Schulen Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Die Forschungsstation Schlüchtern entstand aus einer wissenschaftlichen Zweigstelle der J.W. Goethe-Universität Frankfurt.
Klimabulletin Winter 2016/2017 _
 Klimabulletin Winter 2016/2017 _ Der Winter 2016/17 zeichnete sich vor allem durch seine ausgeprägte Trockenheit aus. Die winterlichen Niederschlagmengen erreichten im landesweiten Mittel nur rund die
Klimabulletin Winter 2016/2017 _ Der Winter 2016/17 zeichnete sich vor allem durch seine ausgeprägte Trockenheit aus. Die winterlichen Niederschlagmengen erreichten im landesweiten Mittel nur rund die
Das Storchennest Otterwisch hat eine lange über 40 jährige Tradition. Die ersten vorliegenden
 Archiv über 40 Jahre Storchennest Otterwisch Das Storchennest Otterwisch hat eine lange über 40 jährige Tradition. Die ersten vorliegenden Beobachtungen sind aus dem Jahre 1968. Die erste beweisbare Brut
Archiv über 40 Jahre Storchennest Otterwisch Das Storchennest Otterwisch hat eine lange über 40 jährige Tradition. Die ersten vorliegenden Beobachtungen sind aus dem Jahre 1968. Die erste beweisbare Brut
Das Oltner Wetter im Oktober 2009
 Das Oltner Wetter im Oktober 2009 Anhaltende Trockenheit Das prägendste Wetterelement des vergangenen Monats war sicherlich der weiter nur spärlich fallende Niederschlag und der damit verbundene sehr tiefe
Das Oltner Wetter im Oktober 2009 Anhaltende Trockenheit Das prägendste Wetterelement des vergangenen Monats war sicherlich der weiter nur spärlich fallende Niederschlag und der damit verbundene sehr tiefe
Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2012
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 20. Dezember 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2012 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 20. Dezember 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2012 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
- 2 - Bei den Schmuckfedern des männlichen Pfaus handelt es sich um ein sogenanntes sekundäres Geschlechtsmerkmal.
 Beispielaufgabe 2 - 2 - Was Frauen wollen und wie Männer konkurrieren Der blaue Pfau ist vor allem wegen des farbenprächtigen Männchens bekannt. Er ist an Hals, Brust und Bauch leuchtend blau gefärbt und
Beispielaufgabe 2 - 2 - Was Frauen wollen und wie Männer konkurrieren Der blaue Pfau ist vor allem wegen des farbenprächtigen Männchens bekannt. Er ist an Hals, Brust und Bauch leuchtend blau gefärbt und
Wie viele ökologische Ausgleichsflächen braucht es zur Erhaltung und Förderung typischer Arten des Kulturlands?
 Wie viele ökologische Ausgleichsflächen braucht es zur Erhaltung und Förderung typischer Arten des Kulturlands? Dr. Markus Jenny Die Suche nach einfachen Antworten in einem komplexen System Welche Arten
Wie viele ökologische Ausgleichsflächen braucht es zur Erhaltung und Förderung typischer Arten des Kulturlands? Dr. Markus Jenny Die Suche nach einfachen Antworten in einem komplexen System Welche Arten
naturus Naturkundliche Studienreise Neusiedlersee 13. April April 2009 DO 16. Südlich Fertöuljak FR 17. vm Hansag DO 16.
 naturus Naturkundliche Studienreise Neusiedlersee 13. April - 20. April 2009 Liste der beobachteten Vogelarten (nach der Reiseteilnehmer zusammengestellt von Manfred Lüthy) * Artbestimmung nicht gesichert
naturus Naturkundliche Studienreise Neusiedlersee 13. April - 20. April 2009 Liste der beobachteten Vogelarten (nach der Reiseteilnehmer zusammengestellt von Manfred Lüthy) * Artbestimmung nicht gesichert
Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium. Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite
 Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite Der Rotmilan Der rote Drache The Red Dragon Steckbrief Rotmilan
Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite Der Rotmilan Der rote Drache The Red Dragon Steckbrief Rotmilan
Mal winterlich, mal mild, mal feucht - vor allem aber extrem wenig Sonne.
 Witterungsbericht Winter 2012 / 2013 Winter 2012 / 2013: Zwischen Winter und Winterling - mit insgesamt mehr Schnee als Schneeglöckchen Der meteorologische Winter 2012 / 2013 von Anfang Dezember bis Ende
Witterungsbericht Winter 2012 / 2013 Winter 2012 / 2013: Zwischen Winter und Winterling - mit insgesamt mehr Schnee als Schneeglöckchen Der meteorologische Winter 2012 / 2013 von Anfang Dezember bis Ende
Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern): Schutz der Nester vor Landwirtschaft und Prädation
 Der Ornithologische Beobachter / Band 106 / Heft 3 / September 2009 311 Aus der Schweizerischen Vogelwarte Sempach Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern):
Der Ornithologische Beobachter / Band 106 / Heft 3 / September 2009 311 Aus der Schweizerischen Vogelwarte Sempach Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern):
BirdLife Naturschutz. Exkursion: Vogelzug
 BirdLife Naturschutz Brugg und Umgebung Exkursion: Vogelzug Klingnauer Stausee Samstag, 3. September 2016, 13 bis 17 Uhr Kampfläufer Artenliste (Doris Schatzmann) 0570 Höckerschwan x 0710 Brandgans 4 0750
BirdLife Naturschutz Brugg und Umgebung Exkursion: Vogelzug Klingnauer Stausee Samstag, 3. September 2016, 13 bis 17 Uhr Kampfläufer Artenliste (Doris Schatzmann) 0570 Höckerschwan x 0710 Brandgans 4 0750
ENTWURFSSTAND 20. September 2016
 20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica
 Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
ABStadt. Glühwürmchen Zweite Zeile. Luzern. Stichwort. Bild 9.7 x ca öko-forum. Stadt Luzern. öko-forum
 Luzern öko-forum ABStadt Stichwort Glühwürmchen Zweite Zeile Bild 9.7 x ca. 7.25 Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34
Luzern öko-forum ABStadt Stichwort Glühwürmchen Zweite Zeile Bild 9.7 x ca. 7.25 Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34
Das Oltner Wetter im Januar 2011
 Das Oltner Wetter im Januar 2011 Zu mild, zu trocken und zu sonnig Das neue Jahr begann im Mittelland mit trübem Hochnebelwetter Auslöser war ein Hoch, welches in den folgenden Tagen wieder zunehmend kalte
Das Oltner Wetter im Januar 2011 Zu mild, zu trocken und zu sonnig Das neue Jahr begann im Mittelland mit trübem Hochnebelwetter Auslöser war ein Hoch, welches in den folgenden Tagen wieder zunehmend kalte
Anatiden Bericht 2015
 Anatiden Bericht 2015 Region Linthebene östliches Ende Oberer Zürichsee Kolbenentenfamilie; Altlinth bei der Grinau; 28.07.2015 Klaus Robin Robin Habitat AG Klaus Robin und Hanspeter Geisser 21.11.2015
Anatiden Bericht 2015 Region Linthebene östliches Ende Oberer Zürichsee Kolbenentenfamilie; Altlinth bei der Grinau; 28.07.2015 Klaus Robin Robin Habitat AG Klaus Robin und Hanspeter Geisser 21.11.2015
Gorillas. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Gorillas Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Gewicht: Alter: Nahrung: Lebensraum:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Gorillas Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Gewicht: Alter: Nahrung: Lebensraum:
Das Oltner Wetter im Juli 2011
 Das Oltner Wetter im Juli 2011 Der kühlste Juli seit dem Jahr 2000 Dem sonnigen, warmen und trockenen Wetter, das über weite Strecken das erste Halbjahr dominierte, ging in der zweiten Julihälfte die Luft
Das Oltner Wetter im Juli 2011 Der kühlste Juli seit dem Jahr 2000 Dem sonnigen, warmen und trockenen Wetter, das über weite Strecken das erste Halbjahr dominierte, ging in der zweiten Julihälfte die Luft
Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring
 Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring Bestandssituation im Leipziger Stadtgebiet und am Floßgraben Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping BioCart Ökologische Gutachten, Taucha 19. Stadt-Umland-Konferenz
Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring Bestandssituation im Leipziger Stadtgebiet und am Floßgraben Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping BioCart Ökologische Gutachten, Taucha 19. Stadt-Umland-Konferenz
Erfolgreiche Kiebitzbruten auf extensiv begrünten Flachdächern
 Erfolgreiche Kiebitzbruten auf extensiv begrünten Flachdächern Das Beispiel der Flachdächer der Firma ALSO Schweiz AG, Emmen, mit weiterführenden Massnahmen und Tipps für die Umsetzung Petra Horch Nathalie
Erfolgreiche Kiebitzbruten auf extensiv begrünten Flachdächern Das Beispiel der Flachdächer der Firma ALSO Schweiz AG, Emmen, mit weiterführenden Massnahmen und Tipps für die Umsetzung Petra Horch Nathalie
Beobachtete Vogelarten, naturus Reise Algarve, 28. März - 4. April 2016
 Beobachtete Vogelarten, naturus Reise Algarve, 28. März - 4. April 2016 = < 10 Ind. = > 10 Ind. = > 100 Ind. Brandgans 1 Schnatterente 1 Paar Pfeifente 1 Krickente 1 Paar Stockente Löffelente Kolbenente
Beobachtete Vogelarten, naturus Reise Algarve, 28. März - 4. April 2016 = < 10 Ind. = > 10 Ind. = > 100 Ind. Brandgans 1 Schnatterente 1 Paar Pfeifente 1 Krickente 1 Paar Stockente Löffelente Kolbenente
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Lehndorf, 01.12.2014 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Lehndorf, 01.12.2014 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Krokodil. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Krokodil Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Staffan Widstrand / WWF Steckbrief Grösse: Alter:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Krokodil Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Staffan Widstrand / WWF Steckbrief Grösse: Alter:
Wiesenbrüterschutz in Vorarlberg
 1 Zwischenbericht zum Projekt des Naturschutzbundes Vorarlberg und der Niederwildreviere Auer Ried, Lustenau, Dornbirn Nord, Dornbirn Süd, Lauterach und Wolfurt Wiesenbrüterschutz in Vorarlberg Großer
1 Zwischenbericht zum Projekt des Naturschutzbundes Vorarlberg und der Niederwildreviere Auer Ried, Lustenau, Dornbirn Nord, Dornbirn Süd, Lauterach und Wolfurt Wiesenbrüterschutz in Vorarlberg Großer
MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN
 MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN REGENPFEIFERARTIGE - CHARADRIIFORMES Text und Fotos von Katharina Kreissig Bei dem Besuch einer Pinguinkolonie kann man einige interessante Vogelarten beobachten, deren Lebensweise
MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN REGENPFEIFERARTIGE - CHARADRIIFORMES Text und Fotos von Katharina Kreissig Bei dem Besuch einer Pinguinkolonie kann man einige interessante Vogelarten beobachten, deren Lebensweise
Verhaltensbeobachtungen an Blau- und Kohlmeisen. Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen
 Verhaltensbeobachtungen an Blau- und Kohlmeisen Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen Leitung: Dr. Karsten B. Rütten Beteiligte Schülerinnen und Schüler: Andrea Kittner, Matthias Moos, Leonard Neumann, Robin
Verhaltensbeobachtungen an Blau- und Kohlmeisen Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen Leitung: Dr. Karsten B. Rütten Beteiligte Schülerinnen und Schüler: Andrea Kittner, Matthias Moos, Leonard Neumann, Robin
Einfluss von Windkraftanlagen auf die Brutplatzwahl ausgewählter Großvögel (Kranich, Rohrweihe und Schreiadler)
 Einfluss von Windkraftanlagen auf die Brutplatzwahl ausgewählter Großvögel (Kranich, Rohrweihe und Schreiadler) Wolfgang Scheller (Teterow) Windenergie im Spannungsfeld zwischen Klima- und Naturschutz
Einfluss von Windkraftanlagen auf die Brutplatzwahl ausgewählter Großvögel (Kranich, Rohrweihe und Schreiadler) Wolfgang Scheller (Teterow) Windenergie im Spannungsfeld zwischen Klima- und Naturschutz
Frühling Klimabulletin Frühling MeteoSchweiz. Sehr warmer März und April. Regional deutlich zu trocken
 Frühling 2014 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2014 10. Juni 2014 Der Frühling war in der Schweiz überdurchschnittlich warm, etwas zu trocken und recht sonnig. Zu den milden und sonnigen Verhältnissen
Frühling 2014 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2014 10. Juni 2014 Der Frühling war in der Schweiz überdurchschnittlich warm, etwas zu trocken und recht sonnig. Zu den milden und sonnigen Verhältnissen
Informationen für Bewirtschafter
 Vorschriften zur Bodenerosionsschutz Informationen für Bewirtschafter Juni 2018 Service de l agriculture SAgri Amt für Landwirtschaft LwA Direction des institutions, de l agriculture et des forêts DIAF
Vorschriften zur Bodenerosionsschutz Informationen für Bewirtschafter Juni 2018 Service de l agriculture SAgri Amt für Landwirtschaft LwA Direction des institutions, de l agriculture et des forêts DIAF
Polarfuchs. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Polarfuchs Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Klein & Hubert / WWF Steckbrief Grösse: 50-65
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Polarfuchs Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Klein & Hubert / WWF Steckbrief Grösse: 50-65
Kurz-Bericht über die Aktion Wiesenweihe 2003
 Kurz-Bericht über die Aktion Wiesenweihe 2003 Teilnehmer Hans Eichenberger, Lenzburg Thomas Jordi, Bern Silvana Bolli, Zürich Jost Bühlmann, Zürich Ausgangslage Im Winter regnete es wiederum genügend.
Kurz-Bericht über die Aktion Wiesenweihe 2003 Teilnehmer Hans Eichenberger, Lenzburg Thomas Jordi, Bern Silvana Bolli, Zürich Jost Bühlmann, Zürich Ausgangslage Im Winter regnete es wiederum genügend.
ABTEILUNG FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM für FELD- UND FLUR- KNIGGE Für ein verständnisvolles Miteinander
 ABTEILUNG FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM für FELD- UND FLUR- KNIGGE Für ein verständnisvolles Miteinander Rücksicht macht Wege breit Landwirtschaftliche Flächen sind die Existenzgrundlage der Landwirte. Auf ihnen
ABTEILUNG FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM für FELD- UND FLUR- KNIGGE Für ein verständnisvolles Miteinander Rücksicht macht Wege breit Landwirtschaftliche Flächen sind die Existenzgrundlage der Landwirte. Auf ihnen
naturus Naturkundliche Studienreise Lesbos 5. April April 2010 Do 8. nm Umgebung versteinerter Wald und Umgebung Apotheka
 naturus Naturkundliche Studienreise Lesbos 5. April - 12. April 2010 Liste der beobachteten Vogelarten (nach Beobachtungen der Reiseteilnehmer zusammengestellt von Manfred Lüthy) * Artbestimmung nicht
naturus Naturkundliche Studienreise Lesbos 5. April - 12. April 2010 Liste der beobachteten Vogelarten (nach Beobachtungen der Reiseteilnehmer zusammengestellt von Manfred Lüthy) * Artbestimmung nicht
Klimabulletin Sommer 2017 _
 Klimabulletin Sommer 2017 _ Die Schweiz registrierte nach dem drittwärmsten Frühling auch den drittwärmsten Sommer seit Messbeginn im Jahr 1864. Im landesweiten Mittel stieg die Sommertemperatur 1.9 Grad
Klimabulletin Sommer 2017 _ Die Schweiz registrierte nach dem drittwärmsten Frühling auch den drittwärmsten Sommer seit Messbeginn im Jahr 1864. Im landesweiten Mittel stieg die Sommertemperatur 1.9 Grad
Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 9. Januar 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 9. Januar 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Wochenbericht der Ulmet-Gruppe Oberer/Jeker:
 Wochenbericht der Ulmet-Gruppe Oberer/Jeker: Die zweite Gruppe um die Beringer, Corine Jeker und Mathias Oberer, übernahmen von der Vorgängergruppe bei bestem Spätsommerwetter die Option in einer Woche
Wochenbericht der Ulmet-Gruppe Oberer/Jeker: Die zweite Gruppe um die Beringer, Corine Jeker und Mathias Oberer, übernahmen von der Vorgängergruppe bei bestem Spätsommerwetter die Option in einer Woche
Durchschnittswerte Werner Neudeck Schenkstr Donauwörth -10,8 C 25 Niederschlagstagen Gesamteindruck: Erwähnenswert: Plus von 2,0 Grad
 Januar Bis Monatsmitte wies der Januar, ähnlich seinem Vormonat, mit einem Plus von 2,0 Grad einen beträchtlichen Temperaturüberschuss auf. Es wollten sich einfach keine winterlichen Temperaturen einstellen.
Januar Bis Monatsmitte wies der Januar, ähnlich seinem Vormonat, mit einem Plus von 2,0 Grad einen beträchtlichen Temperaturüberschuss auf. Es wollten sich einfach keine winterlichen Temperaturen einstellen.
Prädatorenmanagement als (neue) Säule des Wiesenvogelschutzes in Niedersachsen. Dr. Marcel Holy Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer e.v.
 Prädatorenmanagement als (neue) Säule des Wiesenvogelschutzes in Niedersachsen Dr. Marcel Holy Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer e.v. Gliederung Vorstellung NUVD Bedeutung des Landes Niedersachsen
Prädatorenmanagement als (neue) Säule des Wiesenvogelschutzes in Niedersachsen Dr. Marcel Holy Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer e.v. Gliederung Vorstellung NUVD Bedeutung des Landes Niedersachsen
Artenschutz durch nachhaltige Jagd und Hege Alsenz
 Artenschutz durch nachhaltige Jagd und Hege Alsenz 16.09 2015 Fotos C. Hildebrandt 1: Biotopverbesserung 2: Prädatorenmanagment Die drei Säulen der Niederwildhege in der Praxis Fotos C. Hildebrandt 3:
Artenschutz durch nachhaltige Jagd und Hege Alsenz 16.09 2015 Fotos C. Hildebrandt 1: Biotopverbesserung 2: Prädatorenmanagment Die drei Säulen der Niederwildhege in der Praxis Fotos C. Hildebrandt 3:
