Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
|
|
|
- Elvira Waldfogel
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2017 Petra Horch Cristina Gygax Simon Fischer Annina Egli Philipp Bünter Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Luzern sowie der Trägerschaft Vernetzungsprojekt Wauwiler Ebene, der am Vernetzungsprojekt beteiligten Landwirte und der das Projekt unterstützenden Stiftungen
2 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Impressum Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2017 Autoren Petra Horch, Cristina Gygax, Simon Fischer, Annina Egli, Philipp Bünter, Lukas Arn, Dr. Reto Spaar Feldarbeit Cristina Gygax, Simon Fischer, Annina Egli, Philipp Bünter, Lukas Arn, Yolanda Michel, Isabelle Kaiser Fotos, Illustrationen (Titelseite) Oben: Kiebitzküken ( Marcel Burkhardt), unten: Elektro-Zaun aufstellen ( Lukas Lindner) Zitiervorschlag Horch, P., C. Gygax, S. Fischer, A. Egli, P. Bünter & R. Spaar (2017): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern: Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Kontakt Petra Horch, Schweizerische Vogelwarte, Seerose 1, 6204 Sempach Tel.: , (direkt), Fax: , petra.horch@vogelwarte.ch 2017, Schweizerische Vogelwarte Sempach
3 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 3 1. Einleitung Ausgangslage Artenförderung Vögel Schweiz 4 2. Ergebnisse Kiebitz-Saison Projektteam Die Brutsaison Verlauf der Brutsaison Die Brutgebiete Die Kiebitzbrache im Kottwilermoos Begleitende Schutz- und Fördermassnahmen Schlüpf- und Aufzuchterfolg Diskussion der Ergebnisse Brutbestand Wetter Prädation Landwirtschaftliche Aktivitäten Adultberingung Weitere Beobachtungen während der Feldarbeit Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene Ein herzliches Dankeschön! Ausblick Literatur 17
4 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Zusammenfassung Mit ungefähr 180 Brutpaaren ist der Kiebitzbestand in der Schweiz so klein, dass der Kiebitz auf der Roten Liste der Brutvögel in der Kategorie vom Aussterben bedroht (CR, critically endangered) aufgeführt wird. Hauptgrund für den tiefen Bestand ist der ungenügend hohe Bruterfolg. Seit 2005 führt die Vogelwarte in der Wauwiler Ebene, dem wichtigsten Brutgebiet in der Schweiz, Fördermassnahmen durch und begleitet sie wissenschaftlich. Die Langfristigkeit des Projekts ist wichtig, denn nur so können Veränderungen und neue Herausforderungen im Umfeld dokumentiert und die Fördermassnahmen angepasst werden war wiederum kein ideales Brutjahr für den Kiebitz. Zum ersten Mal seit Projektbeginn siedelten sich mit 49 Brutpaaren einige Brutpaare weniger an als im Vorjahr. Der Bruterfolg lag mit 0,4 flüggen Küken pro Brutpaar zum zweiten Mal in Folge unter dem Zielwert (0,8 flügge Küken pro Brutpaar). Schwierige Wetterbedingungen während heiklen Phasen in der Brutsaison und ein hoher Prädationsdruck sind die Gründe dafür. Im Spätsommer 2017 wurde zum ersten Mal nicht nur die inzwischen bewährte Kiebitzbrache im Kottwiler Moos angelegt, sondern eine zweite Fläche im Ettiswiler Moos. Weitere Flächen in den vom Kiebitz bevorzugt besiedelten Teilgebieten sollen in Zukunft folgen. Die Verhandlungen dafür wurden aufgenommen, stehen aber noch am Anfang wird das Förderprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene weitergeführt. 1. Einleitung 1.1 Ausgangslage Die Bestände des Kiebitzes haben in den letzten Jahrzehnten sehr stark abgenommen. Mitte der 1970er-Jahre brüteten in der Schweiz rund 1000 Brutpaare. Heute, knapp 50 Jahre später, sind es noch etwa 180 Brutpaare, von denen ein bedeutender Teil in der Wauwiler Ebene im Kanton Luzern brütet (Ritschard 2015). Ein Hauptgrund für den Rückgang war die äusserst geringe Nachwuchsrate (Imboden 1974). Trotz des seit Jahrzehnten tiefen Bruterfolgs konnte sich der Schweizer Kiebitzbestand lange Zeit halten, was vermutlich einer regelmässigen Einwanderung aus gesunden europäischen Beständen zu verdanken war. Die Vogelwarte führt in der Wauwiler Ebene seit 2005 ein wissenschaftlich begleitetes Förderprojekt in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern und dem Kanton durch. Kiebitzfreundliche Bewirtschaftungsmassnahmen werden durch das regionale Vernetzungsprojekt gefördert. Dank solchen Projekten zählt der Kiebitz heute zu den wenigen Arten des Kulturlandes in der Schweiz, deren Bestände sich über die letzten Jahre leicht erholten. Der Bestand beträgt nach einem Tiefstand von 80 Brutpaaren 2004/05 heute schweizweit wieder etwa 180 Brutpaare. Trotz dieser Erholung ist der Bestand immer noch so klein, dass der Kiebitz nach wie vor auf der Roten Liste der Brutvögel (Keller et al. 2010a) in der Kategorie vom Aussterben bedroht (CR, critically endangered) aufgeführt wird. In Kolonien brütende Vogelarten wie der Kiebitz profitieren von der Einbindung in einen grösseren Verband von Artgenossen: In Nestnähe vordringende Prädatoren werden tagsüber gemeinsam angegriffen und vertrieben. Die einzelnen Vögel in einer Kolonie müssen weniger in die Überwachung der Nestumgebung investieren als dies bei Einzelpaaren der Fall ist, und deshalb bleibt mehr Zeit für die Nahrungssuche und die Bebrütung. Die meisten Kiebitz-Kolonien in der Schweiz sind aber inzwischen so klein, dass die Vertreibung von Eindringlingen durch die Altvögel einen grossen und energiezeh-
5 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht renden Aufwand verlangt. Ob und wie stark dies den Bruterfolg und die Überlebensraten von Bruten und Altvögeln beim Kiebitz beeinflusst, ist unbekannt. Optimal ist die aktuelle Situation aber sicher nicht. Etwa 70 % der Kiebitze siedeln sich im Folgejahr im Umkreis von 20 km des letztjährigen Brutplatzes an (Imboden 1974). Das Projekt in der Wauwiler Ebene zeigt, dass lokal umgesetzte Massnahmen den Bestand vor Ort entscheidend stärken können. 1.2 Artenförderung Vögel Schweiz Die Förderung des Kiebitzes ist eine Aufgabe des Programms "Artenförderung Vögel Schweiz", welches partnerschaftlich von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und von BirdLife Schweiz durchgeführt und vom Bundesamt für Umwelt BAFU unterstützt wird. 50 national prioritären Vogelarten, welche auf artspezifische Fördermassnahmen angewiesen sind, soll mit diesem Programm gezielt geholfen werden (Keller et al. 2010b). Abb. 1. Frisch geschlüpftes Kiebitzküken noch in der Nestmulde ( Lukas Lindner). 2. Ergebnisse Kiebitz-Saison Projektteam Seit 2011 steht das Kiebitzprojekt im Wauwilermoos unter der Leitung von Petra Horch und Reto Spaar (Horch et al. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Die Feldarbeit 2017 wurde von Lukas Arn (Zivildienstleistender), Philipp Bünter, Simon Fischer und Cristina Gygax (PraktikantInnen) und Annina Egli (Feld-Assistentin) durchgeführt. Das Feldteam betreute zudem Schnupperschülerinnen und Kurz-Praktikanten, die durch ihren Einsatz im Projekt einen Einblick in das Kiebitzprojekt und in die Arbeit einer Biologin/eines Biologen bekamen.
6 bis 15. März bis 20. März bis 25. März bis 31. März bis 5. April bis 10. April bis 15. April bis 20. April bis 25. April bis 30. April bis 5. Mai bis 10. Mai bis 15. Mai bis 20. Mai bis 25. Mai bis 31. Mai neue Nester Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Die Brutsaison Verlauf der Brutsaison Im März kehrten die Kiebitze bei sonnigem Wetter und milden Temperaturen in die Wauwiler Ebene zurück. Die Feldarbeit im Kiebitzprojekt in der Wauwiler Ebene startete am 13. März Von März bis April war das Wetter meist sonnig mit Temperaturen zwischen Grad am Tag und um die 0 Grad in der Nacht. Ab Mitte März wurden auch schon die ersten Eier gelegt und bebrütet (Abb. 2) pro Pentade Abb. 2. Anzahl neuer Nester pro Pentade im Frühling 2017 in der Wauwiler Ebene. Es gibt zwei Zeiträume, in welchen deutlich mehr Nester angelegt wurden, nämlich zu Beginn der Brutsaison ( März) und Anfang Mai (30. April 10. Mai). Am 20. April hatten die Kiebitze schon mehr als die Hälfte aller Nester (48 von insgesamt 89 Nestern, Abb. 3) dieses Jahres angelegt. Mitte April gab es zwei Kälteeinbrüche: die Temperaturen fielen in der Nacht unter den Gefrierpunkt, so dass Eier gefroren und Küken an Unterkühlung starben. In den auf die Kälteeinbrüche folgenden Tagen legten viele Kiebitze Ersatznester an (Abb. 2). Das Wetter blieb bis Anfang Mai regnerisch und kühl. Die Temperaturen stiegen danach deutlich an und brachten im Mai und Juni einige Hitzetage von bis zu 33 Grad. Während dieser Trockenperioden schlüpften viele Küken. Von den 55 im Juni geschlüpften Küken überlebte ein einziges bis zum flugfähigen Alter (Abb. 4.). Die meisten anderen überlebten schon die ersten Tage nicht, da das Nahrungsangebot in Trockenperioden gering ist die potenziellen Beutetiere ziehen sich vor der Hitze etwas tiefer in den Boden zurück und sind für die Küken unerreichbar. Die ersten flüggen Küken wurden am 24. Mai im Naturschutzgebiet bei den renaturierten Weihern im Seemoos gesichtet. Dort konnten wir ebenfalls Mitte Juni die erste grössere Kiebitzgruppe mit rund 20 Individuen beobachten. In der Kiebitzgruppe hielten sich auch diesjährige flügge Küken auf. Sie waren bis Ende Juli oft im Ettiswilermoos, Rorbelmoos oder Seemoos zu beobachten. Die Feldsaison 2017 wurde am 21. Juli beendet und dauerte 124 Tage.
7 Anzahl Küken bis 15. März bis 20. März bis 25. März bis 31. März bis 5. April bis 10. April bis 15. April bis 20. April bis 25. April bis 30. April bis 5. Mai bis 10. Mai bis 15. Mai bis 20. Mai bis 25. Mai bis 31. Mai Anzahl Nester total Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Pro Pentade Abb. 3. Anzahl Nester aufsummiert pro Pentade im Frühling 2017 in der Wauwiler Ebene. Zwischen dem 15. und 20. April wurde die Hälfte der Anzahl Nester erreicht (rote Linie) Abb. 4. Anzahl geschlüpfter Küken pro Tag (in blau). Die Küken, welche an diesem Tag schlüpften und schliesslich flügge wurden, sind zusätzlich rot markiert (Leseweise: am 17. April.schlüpften sieben Küken, drei davon erreichten das Flügge-Alter) Die Brutgebiete Mittels Beobachtungen wurde auch dieses Jahr erhoben, wieviele Kiebitze sich in welchen Gebieten zum brüten niederliessen (Abb. 5.). Wie in den letzten Jahren brüteten die Kiebitze vor allem auf von ihnen seit einigen Jahren bevorzugten Parzellen in den Gemeinden Kottwil (25 Nester), Schötz (32 Nester) und Ettiswil (19 Nester). Weitere Nester wurden auf landwirtschaftlichen Parzellen in den Gemeinden Egolzwil (8), Wauwil (1) und St. Erhard-Knutwil (1) gefunden.
8 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Abb. 5. Nester mit Schlupferfolg (grün), erfolglose Nester (rot) und Flächen, welche mit einem Elektrozaun geschützt wurden (blau) [ swisstopo (DV 351.5)]. Der gelbe Stern markiert die Kiebitzbrache Die Kiebitzbrache im Kottwilermoos Aus drei Gründen wurde ab 2012 die Kiebitzbrache im Kottwilermoos angelegt (Abb. 5): 1. Der Bewirtschafter wollte die Kiebitze bestmöglich fördern. 2. Kiebitze brüten am liebsten auf Flächen mit wenig Vegetation. Im Ackerbaugebiet wählen sie daher bevorzugt Stoppelfelder aus. Im Rahmen des Bodenschutzes werden aber auf immer mehr Ackerflächen im Herbst Kunstwiesen angesät, die im Frühling sehr schnell aufwachsen. Im Rahmen des Vernetzungsprojektes war es nun möglich, für die Zielart Kiebitz (unter Typ 16) die Kiebitzbrache zu entwickeln. Im August wird eine spezielle Kiebitzbrache-Spezial- Gründüngungsmischung eingesät, welche im Winter grösstenteils abstirbt. So finden die Kiebitze im Frühling ein Feld vor, das wie ein Stoppelfeld teilweise mit abgestorbenem Material bedeckt ist, also ein ideale Brutfläche. 3. Die Felder werden während der Brutzeit bewirtschaftet, was zu einer Störung bis Gefährdung des Brutgeschäfts führt. Die Kiebitzbrache bleibt in dieser Zeit unbewirtschaftet (= brach ). Dennoch gibt es meist einen kleinen Teil der Pflanzen aus der Ansaat vom Vorjahr, die es durch den Winter schafft und spärlich aufwächst, und also etwas Deckung bietet. Das Feld wird erst Ende Juli, also nach der Brutzeit, bewirtschaftet um wiederum die nächste Kiebitzbrache einzusäen. Inzwischen hat die Kiebitzbrache eine wichtige Bedeutung für den Kiebitzbestand in der Wauwiler Ebene. Auf den ca. 3 ha brüten die meisten Brutpaare. Der Schutzzaun wird zu Beginn der Brutsaison um die ganze Parzelle herum aufgestellt. Auch dieses Jahr wurden die meisten Nester (21 Nester) auf der Kiebitzbrache angelegt. Jedoch hatten es die Kiebitze auf der Kiebitzbrache dieses Jahr schwer. Von den 55 Küken, die auf der Kiebitzbrache aus dem Nest schlüpften, erreichten nur gerade vier das Flüggealter. Die letztjährige Einsaat scheint den Winter hindurch sehr gut abgestorben zu sein. Bis Mitte Mai war die Brachfläche selbst jedenfalls nur sehr spärlich bewachsen. Viele Kiebitz-Familien verliessen die Fläche unmittelbar nach dem Schlüpfen der Küken. Möglicherweise fehlte Deckung,
9 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht worin sich die Küken hätten verstecken können. Der Schutz der Gelege durch den Zaun war im Mai und Juni ungenügend (zu geringe Stromleistung), weil randlich Vegetation einwuchs. Die Kiebitzbrache war auch für viele andere Tiere als Nahrungsgebiet attraktiv, z.b. nutzen sie auch Weissstörche zur Nahrungssuche. Täglich wurden mögliche Prädatoren in Brachennähe beobachtet. An einem Tag hatte sich ein Fuchs Zugang auf die Brache verschafft. Bis wir eintrafen hatte er vier Nester ausgeräumt (insgesamt wurden auf der Kiebitzbrache fünf Nester prädiert). Wie üblich kontrollierten wir den Zaun und fanden eine herausgerissene Ecke. Kurz nach diesem Ereignis entdeckten wir an zwei verschiedenen Tagen, dass die Verbindungskupplungen, welche die elektrische Leitfähigkeit des Zauns gewährleisten, voneinander gelöst waren die Spannung war also unterbrochen. Ende Juli wurde die Fläche oberflächlich gepflügt, das Saatbeet vorbereitet und Mitte August wurde wiederum eine Kiebitzbrache-Spezial-Gründüngungsmischung eingesät (Abb. 6). Abb. 6. Kiebitzbrache im Kottwilermoos am 26. November 2017 ( Petra Horch). Die Kiebitzbrache-Spezial- Gründüngung enthält hauptsächlich nicht-winterhartes Saatgut (Buchweizen, Phacelia, Ölrettich, Sonnenblume, Blauer Lein). Zwei Streifen wurden mit überwinterndem Rotklee eingesät (einer der Streifen siehe Bildmitte). Diese Streifen bleiben während der nächsten Brutsaison bestehen und bieten niedere Deckung Begleitende Schutz- und Fördermassnahmen Um den Verlust an Gelegen und Kiebitzküken möglichst tief zu halten, informierten wir die Bewirtschafter umgehend, sobald wir ein Nest auf deren Parzelle entdeckt hatten. Damit wir die Nester zur Beobachtung und bei der Bewirtschaftung leichter wiederfanden, kennzeichneten wir sie mit nummerierten Fähnchen. Befanden sich zwei oder mehr Gelege auf einer Parzelle, umzäunten wir die Nester mit elektrischen Weidezäunen, sofern die Bewirtschafter einverstanden waren. In der Saison 2017 stellten wir im Wauwilermoos elektrische Weidezäune mit einer Gesamtlänge von 4,1 km auf und umzäunten eine Fläche von insgesamt 11,0 ha (Tab. 1, Abb. 7). Insgesamt befanden sich 61 Nester auf diesen geschützten Flächen. Da viele Kiebitze ihre Gelege auf grossen Parzellen anlegten, welche regelmässig bewirtschaftet wurden, umfassten wir die Kiebitznester relativ knapp mit den Zäunen (Abstand des Zauns von 20 m vom nächsten Nest). Mehrmals mussten daher die Zäune vergrössert werden, weil eine Kiebitzfamilie einige Meter ausserhalb des bestehenden Zauns ein neues Nest anlegte. Befand sich nur ein Nest auf einer Parzelle, so schützten wir dieses nach der gegebenen Pro-
10 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht jektmethode nicht. Wir näherten uns dem Nest auch nicht, um den Prädatoren keine Fährte zu hinterlassen. Deshalb konnten wir diese Eier auch nicht wägen und es war uns bei diesen Nestern kein genauer Schlupftermin bekannt. Damit wir die Küken aus einzeln angelegten Nestern trotzdem beringen konnten, um auch für sie einen Aufzuchterfolg ermitteln zu können, beobachteten wir auch diese Gelege täglich. Küken schlüpften aus nur vier von den insgesamt 28 ungeschützten Gelegen. 18 Gelege wurden nachweislich prädiert (v.a. Fuchs), vier Gelege beim Bewirtschaften zerstört und von zwei Gelegen ist das Schicksal unbekannt. Dieses Jahr blieben viele Familien in der Nähe der Zäune, oft suchten sie aber ausserhalb der Zäune nach Nahrung. Andere Familien waren sehr mobil und nutzen jeden Tag eine neue Parzelle. Deshalb stellten wir keine Zäune speziell für den Familienschutz resp. Schutz von Nahrungsgebieten auf. Abb. 7. Der elektrische Weidezaun schützt Brut- und Nahrungsflächen vor möglichen Boden-Prädatoren ( Marcel Burkhardt). In Absprache mit den Landwirten konnten Verluste an Nestern und von Kiebitzküken (durch landwirtschaftliche Aktivitäten) erheblich gesenkt werden. Die Landwirte erklärten sich bereit, bestimmte Felder erst nach dem Schlupftermin oder bestimmte Bereiche während der Präsenz der Kiebitze nicht zu bewirtschaften. Zudem kontaktierten uns die Landwirte, bevor sie die Parzellen bewirtschafteten. Dies gab uns die Möglichkeit, die Bewirtschaftung zu begleiten und eventuell Schutzmassnahmen zu ergreifen. Wichtig ist, dass wir genügend Zeit erhalten, um das Feld zu beobachten, bevor die Bewirtschaftung beginnt. So können wir neu angelegte Nester entdecken und beobachten, wo sich Küken aufhalten, denn am Morgen halten sich Kiebitzfamilien oft an einem anderen Ort auf der Parzelle auf als am Vorabend. So konnten wir zum Beispiel Nester mit einem Kübel abdecken, damit sie nicht gespritzt wurden, oder kleine Küken einfangen (Küken ducken sich vor dem 10. Lebenstag vor einer Gefahr auf den Boden und entfernen sich nicht aus der Gefahrenzone), bevor das Feld bearbeitet wurde, oder mit dem Landwirt absprechen, auf welcher Seite der Parzelle er mit der Bewirtschaftung beginnen sollte, sodass schon ältere Küken vor den Maschinen auf benachbarte, zum gleichen Zeitpunkt unbewirtschaftete Felder fliehen konnten. Ebenfalls wurden bei einigen Parzellen höhere Grasstreifen am Parzellenrand nicht gemäht. Diese Grassteifen wurden von den Küken als Rückzugsort und Schutz vor Prädatoren genutzt. Teilweise
11 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Landwirten etwas schwierig, da immer mehr Parzellen von Lohnunternehmen bewirtschaftet werden, welche die Information zu den Kiebitzen nicht erhalten. 2.3 Schlüpf- und Aufzuchterfolg 2017 Über 50 % der Gelege sollten schlüpfen. Nur dann ist ein ausreichender Aufzuchterfolg von 0,8 1,0 flüggen Küken pro Brutpaar erreichbar (Schifferli et al. 2009). Der Brutbestand 2017 war mit 49 Brutpaaren kleiner als in den letzten sechs Jahren (51 bis 60 Brutpaare). Von diesen 49 Brutpaaren wurden insgesamt 89 Gelege geschaffen. Die diesjährige Schlupfrate beträgt 60,7 % (Tab. 1). Daraus ergeben sich folgende Gelege-Schlupfraten pro Teilkolonie: Kottwil/Kottwilermoos (ohne Kiebitzbrache) 60,0 % (5 Brutversuche), Kottwil/Kottwilermoos (Kiebitzbrache) 76,2 % (21 Brutversuche), Ettiswil/Etiswilermoos 45,5 % (11 Brutversuche) Ettiswil/Stockmoos 0 % (6 Brutversuche), Ettiswil Undermoos 33,3 % (3 Brutversuche), Schötz/Rorbelmoos 0 % (3 Brutversuche), Egolzwil und Schötz/Seemoos/Seespitz 71,0 % (38 Brutversuche), St. Erhard-Knutwil/Stierenmoos 0 % (1 Brutversuch). Tab. 1. Ergebnis der Kiebitzsaison 2017 in der Wauwiler Ebene 2017 Anzahl Brutpaare 49 Anzahl Gelege 89 % geschlüpft 60,7 % verlassen 4,5 % ausgeraubt 34,8 % überschwemmt 0,0 Eier pro Paar 5,7 Geschlüpft pro Paar 3,8 Flügge pro Paar 0,4 Beringte Küken 130 Eingezäunte Fläche, ha 11,0 Länge Elektrozaun, km 4,1 Wie viele andere Limikolenarten legt der Kiebitz normalerweise vier Eier pro Gelege. Im Durchschnitt besteht eines von zehn Gelegen nur aus drei Eiern (Kooiker & Buckow 1997). Ersatzgelege sind in der Regel kleiner als Erstgelege (Jackson & Jackson 1975) bestanden in der Wauwiler Ebene 89,2 % der Gelege aus vier Eiern, 7,7 % aus drei Eiern und 3,1 % aus zwei Eiern. Gelege mit nur einem oder mit fünf Eiern gab es keine. Vergleicht man diese Werte mit den durchschnittlichen Werten von in der Wauwiler Ebene, ergibt sich, dass 2017 der Anteil an Gelegen mit drei Eiern um 4,3 % und der Anteil an Gelegen mit zwei Eiern um 0,7 % kleiner war. Dagegen gab es 2017 im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten der Vorjahre mehr Nester mit vier Eiern (+ 8,2 %). Es gab 2017 also mehr Vollgelege im Vergleich zum Durchschnitt aus den früheren Jahren. Die Eier-Schlupfrate beschreibt den Anteil an Eiern in einem Gelege, aus welchen Küken schlüpfen. Sie liegt nach Untersuchungen aus dem In- und Ausland bei % (z.b. Heim 1978, Matter 1982, Kooiker & Buckow 1997). Die durchschnittliche Eier-Schlupfrate in der Wauwiler Ebene liegt mit 92,9 % im unteren Bereich betrug die Eier-Schlupfrate sogar nur 74,9 %.
12 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Insgesamt wurden in diesem Jahr 34,8 % der Gelege prädiert (Tab. 1), was deutlich über dem Mittelwert aus den früheren Jahren von 13,7 % liegt. Dazu gerechnet wurden auch die 5,6 % bei der Bewirtschaftung zerstörte Gelege. 4,4 % der Gelege wurden vorzeitig verlassen (Tab. 1). Von den 185 geschlüpften Küken konnten 130 farbberingt werden (70,2 %, Tab. 1). In diesem Jahr konnte für 18 Jungvögel ein sicherer Flügge-Nachweis erbracht werden, was bei 49 Brutpaaren einem Wert von 0,4 überlebenden Küken pro Brutpaar entspricht (Tab. 1). 2.4 Diskussion der Ergebnisse Brutbestand Das Wetter zeigte sich schon zu Beginn der Saison wenig kiebitzfreundlich, der Februar und März 2017 waren recht warm und trocken. Zwar wurden während des Frühlingszugs Schwärme von über 100 Kiebitzen beobachtet. Doch es blieben schliesslich nur 49 Brutpaare zum Brüten da, so wenige wie seit 2010 nicht mehr Wetter Während der Brutsaison 2017 zeigte sich das Wetter als Herausforderung. Kiebitzküken sind Nestflüchter. Die Fähigkeit, die Körpertemperatur selbständig und unabhängig von der Aussentemperatur gleichwarm zu halten, entwickelt sich in den ersten Lebenstagen (Kooiker & Buckow 1997). Bis die Kiebitzküken diese Fähigkeit erreicht haben, werden sie von den Eltern (meist dem Weibchen) regelmässig gehudert, also gewärmt. In den ersten beiden Lebenstagen lockt das Weibchen die Küken, auch bei trockenem Wetter, alle 10 Minuten unter sich. Ist das Wetter schlecht, verlängert sich die Huderzeit. Kiebitzküken werden von ihren Eltern nicht gefüttert, sondern in nahrungsreiche Gebiete geführt, wo die Küken selbständig nach Nahrung suchen. Deshalb brauchen die Küken auch Zeit um genügend Nahrung zu finden. Bei niedrigen Temperaturen ist allerdings auch für die Nahrungssuche mehr Zeit nötig, denn es bleiben nur wenige Beutetiere für die Küken erreichbar an der Bodenoberfläche oder in der obersten Bodenschicht. Zieht sich die Schlechtwetterphase über mehrere Tage hin, kann es geschehen, dass die Balance zwischen genügend gewärmt werden und genügend Nahrung finden nicht mehr gelingt: Die Küken sind zwar warm aber verhungern oder finden zwar genug zu fressen aber verlieren zu viel Wärme die Überlebenschancen sind schlecht. Die Kälteeinbrüche mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von Mitte und Ende April führten zu Verlusten (Abb. 8). Es wurde auf zwei verschiedenen Parzellen ein gefrorenes Ei sowie zwei gefrorene Küken gefunden. Dazu kann davon ausgegangen werden, dass die schneereichen Tage mit geringem Nahrungsangebot zu erhöhter Prädation führten: Bebrütete Nester waren sofort sichtbar, wenn sich der Brutvogel davon entfernte. Die Küken in ihrem braun gemusterten Dunenkleid waren auf der Schneedecke ungetarnt. Von den Küken, die zwischen dem 24. und 28. April schlüpften, erreichte denn auch keines das Flüggealter. Die hohen Temperaturen im Mai und Juni scheinen in diesem Jahr zu früheren Schlüpfterminen geführt zu haben, so dass unsere seit Jahren angewendete Methode zur Vorhersage des Schlüpftermins (nach Galbraith & Green 1985) nicht mehr stimmte. Die meisten Küken schlüpften früher als der errechnete Schlüpftermin voraussagte, ein Nest sogar neun Tage früher. Die meisten dieser Küken konnten wir nicht beringen, weil wir sie am Schlupftag verpassten und viele von ihnen auch nicht lange lebten. Einige wenige konnten wir später einfangen und beringen. Insgesamt 55 Küken blieben unberingt. Als Art, die ursprünglich Feuchtgebiete besiedelte, profitiert der Kiebitz im Landwirtschaftsland meist von Regenphasen. Denn auf den Ackerflächen besteht eher das Risiko von Trockenheit. Wenn der Boden stark austrocknet, kommt es für die Küken zu einem Mangel an erreichbaren Beutetieren, da sich diese in tiefere Bodenschichten zurückziehen hatten die Kiebitze mit zwei Trockenperioden
13 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht zurechtzukommen (Abb. 9, eine Ende Mai und eine Mitte Juni), es wurden Temperaturen von bis zu 33 Grad erreicht (Abb. 8). Von den Küken, die um den 27. Mai schlüpften, konnten wir nur ein Flüggegewordenes nachweisen. Temperatur Anzahl geschlüpfter Küken Temperatur Abb. 8. Tägliche mittlere Tagestemperatur (in Grad C, 2 m über Boden; gelbe Linie, y-achse links) und Summe der täglich geschlüpften Küken (grüne Säulen, y-achse rechts). Um den 19. und den 25. April sank die mittlere Tagestemperatur unter 5 Grad. Niederschlag Niederschlagssumme Anzahl geschlüpfter Küken Abb. 9. Niederschlagssumme (24 Stunden von 5.40 Uhr am Tag x bis um 5.40 Uhr am Folgetag in mm; blauer Bereich, y-achse links) und Anzahl geschlüpfte Küken pro Tag (rote Säulen, y-achse rechts) Prädation Auch in dieser Saison war die Prädation durch Raubtiere und Vögel ein wichtiger Faktor für die Verluste von Kiebitzeiern und -küken. Neben dem Fuchs, der mit den Elektrozäunen bisher relativ erfolgreich von den Bruten ferngehalten werden konnte und der in unseren Untersuchungen als nächtlicher Hauptprädator identifiziert worden war (Rickenbach et al. 2011), können weitere Tierarten als Prädato-
14 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht ren auftreten, gegen die der Elektrozaun nicht wirkt. Zu berücksichtigen ist zudem, dass insgesamt schwierige Umweltbedingungen Prädation auch begünstigen können. In diesem Jahr beobachteten wir im und um das Gebiet der Wauwiler Ebene beinahe täglich Füchse. Am 13. April entdeckten wir einen Fuchs auf der Kiebitzbrache innerhalb des Zauns. Es ist davon auszugehen, dass er über eine längere Zeit innerhalb des Zauns war und wohl vier Nester ausraubte. Auch innerhalb eines weiteren Zauns entdeckten wir Fuchsspuren. Da dies auch schon im letzten Jahr beobachtet werden konnte, schliessen wir daraus, dass sich wahrscheinlich nicht mehr alle Füchse, wie zu Beginn des Projekts, durch einen elektrischen Weidezaun abschrecken lassen und einige gelernt haben über den Zaun zu gelangen vor allem bei den etwas weniger hohen Schafweidezäunen (90 cm hoch, wir verwenden auch Ziegenweidezäune, die 105 cm hoch sind) oder wenn die Stromführung wegen eingewachsener Pflanzen nur noch gering ist. Ebenfalls konnten wir beobachten wie eine kleine Gruppe von Rabenkrähen gemeinsam zwei Kiebitzküken attackierte. Diese Küken waren anschliessend verschwunden. Oft beobachteten wir untertags Rabenkrähen auf den Feldern auf Nahrungssuche, auf welchen Kiebitze brüteten. Die Kiebitze scheinen sie nicht immer zu vertreiben oder werden von anderen Gefahrenquellen, die gleichzeitig auftreten, abgelenkt, z.b. während das Feld bewirtschaftet wird. Zweimal konnten wir beobachteten wie ein Habicht ein Kiebitzweibchen auf der Kiebitzbrache angriff. Das eine Kiebitzweibchen überlebte den Angriff, zog aber auf eine weit entfernte Parzelle um und hatte dort mit einem neuen Partner ein neues Nest. Der zweite Angriff verlief weniger glimpflich. Von einem dritten Altvogel fanden wir nur noch die Federn an einem Rupfplatz. Weiter konnten wir dieses Jahr sehr viele Hermeline beobachten. Im Gegensatz zu 2016 konnten wir aber keinen Nachweis für Prädation von Küken durch Hermeline erbringen. Diese Beobachtungen bedeuten aber nicht, dass die Weidezäune wirkungslos sind und dass auf den Schutz der Brut- und Nahrungsgebiete durch Weidezäune verzichtet werden könnte. Es kommt wohl auch mit Zäunen zu Prädation, aber wenn die Prädationsrate von nicht eingezäunten Einzelnestern mit der Prädation von umzäunten Nestern vergleichen wird, liegt erstere bei fast 100 % und die zweite über die Jahre gesehen nur bei knapp 14 % Landwirtschaftliche Aktivitäten Das Wetter beeinflusste auch die Bewirtschaftung der Felder. Die Landwirte mussten teilweise lange auf günstige Bewirtschaftungsbedingungen warten. Und wenn das Wetter dann endlich geeignet war, um eine Wiese zu mähen oder einen Acker zu bestellen, hätte das Kiebitz-Feldteam auf 5 Feldern gleichzeitig sein sollen und Schutzzäune entfernen, neue Nester bezeichnen oder kleine Küken einsammeln. Mit den meisten Bewirtschaftern fanden wir Lösungen. Aber einigen fehlte die Geduld. Dies führte zu einem im Vergleich zu den Vorjahren erhöhten Anteil an überfahrenen Nestern und Küken. Im Vernetzungsprojekt Wauwiler Ebene (Graf 2015) ist der Kiebitz als Zielart aufgeführt. Für Bewirtschaftungsmassnahmen, welche den Kiebitz fördern, erhalten die Landwirte einen Vernetzungsbeitrag von CHF 1000/ha. 2.5 Adultberingung Es wurden dieses Jahr keine adulten Vögel beringt. Die kalte und nasse Witterung zu Beginn der Brutsaison verunmöglichten das Vorhaben unberingte Kiebitzweibchen zu beringen, denn die Rücksicht auf die Brut geht einem möglichen Fangerfolg vor. Sobald das Wetter trockener wurde und die Temperaturen anstiegen, waren auch die Landwirte täglich auf den Feldern. So waren wir vorwiegend mit Beobachten, der Absprache mit Landwirten und dem Abbrechen und Aufstellen der elektrischen Weidezäune beschäftigt und hatten keine Kapazität adulte Kiebitze zu fangen und zu beringen.
15 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Weitere Beobachtungen während der Feldarbeit Die Wauwiler Ebene ist nicht nur für Kiebitze attraktiv, sondern ist auch für zahlreiche andere Vogel-, Säugetier- und Amphibienarten von grosser Bedeutung. Insgesamt wurden vom Feldteam 130 Vogelarten beobachtet, unter denen folgende Highlights waren: Rotkehlpieper, Brachpieper, Goldregenpfeifer, Stelzenläufer, Zwergschnepfe, Schwarzstorch, Sumpfohreule, Wiesenweihe, Rotfussfalke und Fischadler. Zudem wurden auch sehr viele Greifvögel zum Teil auch in grösseren Gruppen beobachtet. Dazu gehörten der Rotmilan, der Schwarzmilan und der Mäusebussard. Gegen Ende Mai wurden auf einer Birke eine wenig scheue Waldohreulenfamilie mit fünf Jungen beobachtet. Von den in der Wauwiler Ebene vorkommenden Säugetieren konnten wir Feldhase, Reh, Fuchs und Hermelin beobachten, sowie Mäuse verschiedener Arten, welche wir aber nicht bestimmen konnten. Von den Amphibien waren die Wasserfrösche in den zahlreichen Flachgewässern nicht zu überhören. 3. Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene Das wissenschaftlich begleitete Förderprojekt startete 2005 mit 17 Brutpaaren (Tab. 2). Der Brutbestand stieg stetig an, erreichte 2015 und 2016 die Marke von 60 Brutpaaren und sank 2017 zum ersten Mal (Abb. 10). Tab. 2. Übersicht über die Daten aus der Wauwiler Ebene 2005 bis Angaben pro Jahr und Durchschnittswerte über die gesamte Projektdauer (Abb. 9) Mittel Anzahl Brutpaare ,6 Anzahl Gelege ,9 % geschlüpft ,5 % verlassen ,5 % ausgeraubt ,4 % überschwemmt ,5 Eier pro Paar 5,5 4,5 4,6 4,3 4,8 4,5 4,6 4,5 4,1 4,7 5,3 7,0 5,7 4,9 Geschlüpft pro Paar 3,1 3,4 3,2 2,2 3,6 3,8 3,0 3,3 3,1 3,3 4,1 3, ,3 Flügge pro Paar 0,82 0,25 0,15 0,78 1,26 0,89 1,13 1,13 1,26 0,59 1,27 0,12 0,37 0,8 Beringte Küken ,5 Eingezäunte Fläche, ha Länge Elektrozaun, km 8,1 7,3 11,5 19,9 12,5 12,5 21,9 35,2 22,3 18,2 13,5 16,8 11,0 16,2 3 2,1 3,7 6,1 5,4 3,8 7,7 9,3 8,4 5,2 5,2 8,4 4,1 3,6 Ein paar Definitionen Anzahl Brutpaare/Paar = Anzahl brütende Weibchen. Die Anzahl brütender Männchen kann kleiner sein, da es vorkommt, dass ein Kiebitzmännchen gleichzeitig mehrere Weibchen hat. Schlupferfolg = Nester, aus welchen mindestens ein Küken schlüpft, werden als erfolgreich behandelt. Aufzuchterfolg = flügge Küken = Küken, welche mindestens 34 Tage alt geworden sind.
16 Anzahl Brutpaare Kiebitz in der Wauwiler Ebene Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Abb. 10. Bestandsentwicklung des Kiebitzes in der Wauwiler Ebene seit 1980 bis Ab Mitte der 1980er- Jahre brach der Bestand deutlich ein und verblieb dann auf tiefem Niveau. Seit Beginn des Förderprojekts im Jahr 2005 steigt der Bestand wieder an und erreicht seit 2011 vergleichbare Werte wie in den Jahren Die im Winter 2016/17 neu geschaffenen Flutmulden nördlich des Naturschutzgebietes wurden von mehreren Familien als Nahrungsgebiet genutzt (Abb. 11). Die Flächen könnten für die Kiebitze auch in Zukunft eine wichtige Bedeutung haben, wenn der Bewirtschaftungsweg für Fussgänger während der Brutzeit der Kiebitze gesperrt bliebe. Ist dies nicht möglich, fordern wir, dass Hunde auf dieser Wegstrecke an der kurzen Leine ( bei Fuss ) geführt werden müssen. Abb. 11. Im Rahmen der Aufwertung des Naturschutzgebietes Wauwilermoos neu geschaffene Flutmulden: Sporadisch überschwemmte Flächen sind nur lückig bewachsen und bieten auch während längeren Trockenphasen sumpfigen Boden. Beutetiere bleiben für die Kiebitzküken, die mit ihrem noch kurzen Schnabel nicht so weit stochern können wie die Altvögel, erreichbar.
17 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Ein herzliches Dankeschön! Wir danken allen Landwirten herzlich für die Rücksicht, die sie beim Bewirtschaften der Felder auf die Kiebitze nehmen. Ein Rückgrat für die Kiebitzförderung sind insbesondere diejenigen Landwirte, welche bereit sind, im Rahmen des Vernetzungsprojekts Wauwiler Ebene Kiebitzmassnahmen zu vereinbaren und damit einen Teil ihrer Flächen kiebitzfreundlich zu bewirtschaften. Im Namen der Vogelwarte danken wir der Boguth-Jonak-Stiftung, der Raymund und Esther Breu- Stiftung, der Stiftung Dreiklang, der Stiftung für Suchende, der Ernst Göhner-Stiftung, der Steffen Gysel-Stiftung, der Marion Jean Hofer-Woodhead-Stiftung, der Yvonne Jacob Stiftung, der Rudolf und Romilda Kägi-Stiftung, der Leo und Dora Krummenacher Stiftung, der Walter und Eileen Leder- Stiftung für den Tierschutz der Paul Schiller-Stiftung, der Dr. Bertold Suhner-Stiftung, der Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung, der Ella und J. Paul Schnorf Stiftung, der Vontobel-Stiftung, der Zigerli-Hegi- Stiftung und dem Natur- und Vogelschutzverein Reigoldswil für die finanzielle Unterstützung des Förderprojektes für den Kiebitz in der Wauwiler Ebene. Nur dank dieser Mittel ist das Artenförderungsprojekt realisierbar. 5. Ausblick 2018 Für die Saison 2018 stehen folgende Aufgaben in der Wauwiler Ebene im Vordergrund: Bezeichnen von Schwerpunktgebieten und Verhandlungen mit Landwirten um weitere Kiebitzbrachen (während Brutsaison unbewirtschaftet) zu definieren. Kiebitzförderung (Feldarbeit) Beobachtung der zurückkehrenden Kiebitze, der Paarbildung und der Brutplatzwahl; Schutz der Parzellen mit mehr als zwei Nestern durch Elektrozäune, Markierung der Nester; Beobachtung und Identifikation der Brutpaare, Fang der unberingten bzw. beringten, aber nicht identifizierbaren Altvögel; Beobachtung des Brutgeschehens, Berechnen des Schlüpftermins, Beringung der Küken, Bestimmen des Bruterfolgs; Beobachtung der Streifzüge der Familien auf Nahrungssuche und Schutz von besonders wichtigen (von mehreren Familien über mehrere Tage) genutzten Nahrungsgebieten durch Elektrozäune; Beobachtung der Entwicklung der Jungvögel und Bestimmen des Bruterfolgs. Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern Vorbereitung der Kiebitzbrachen; Einrichten von weiteren, besonders kiebitzfreundlichen Feldern; Unterstützung der Landwirte bei der Feldarbeit in Kiebitzflächen (Zäune wegräumen, Nester bezeichnen, falls ein Bewirtschaftungsgang notwendig ist Familien von der Fläche treiben o- der Küken einsammeln); Finanzielle Unterstützung der Bewirtschafter bei ungeplanten Bewirtschaftungs-Aufschüben; Sensibilisierung, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit Gebietsbetreuung: Ansprechpersonen für Bewirtschafter und Passanten; Medienmitteilungen; Projektplakat im Kerngebiet; Einbezug von Schnupperpraktikantinnen und -praktikanten; Leitung von Exkursionen ins Projektgebiet.
18 Artenförderung Kiebitz Wauwiler Ebene: Jahresbericht Literatur Galbraith H. & Green, R.E. (1985): The prediction of hatching dates of Lapwing clutches. Wader Study Group Bull. 43: Graf, R. (2015): Vernetzungsprojekt Wauwiler Ebene Abschlussbericht der zweiten Umsetzungsperioden und Konzept für die dritte Umsetzungsperiode Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Heim, J. (1978): Populationsökologische Daten aus der Nuoler Kiebitzkolonie Vanellus vanellus, Ornith. Beob Horch, P., S. Michler & R. Spaar (2011): Artenförderung Kiebitz im Wauwilermoos LU. Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Horch, P., D. Ramseier & R. Spaar (2012): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene LU. Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Horch, P., K. Feller & R. Spaar (2013): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene: Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Horch, P., A. Brunner & R. Spaar (2014): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern: Jahres-bericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Horch, P., N. Burgener & R. Spaar (2015): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern: Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Horch, P., N. Guillod & R. Spaar (2016): Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern: Jahresbericht Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Imboden, C. (1974): Zug, Fremadansiedlung und Brutperiode des Kiebitz in Europa. Ornith. Beob. 71: Jackson R. & J. Jackson (1975): A study of breeding Lapwings in the New Forest, Hampshire, Ringing and Migration 1: Keller, V., A. Gerber, H. Schmid, B. Vogelt & N. Zbinden (2010a): Rote Liste Brutvögel. Gefährdete Arten der Schweiz, Stand Bundesamt für Umwelt, Bern, und Schweizerische Vogelwarte, Sempach. Umweltvollzug Nr Keller, V., R. Ayé, W. Müller, R. Spaar & N. Zbinden (2010b): Die prioritären Vogelarten der Schweiz: Revision Ornithol. Beob. 107: Kooiker, G. & C.V. Buckow (1997): Der Kiebitz: Flugkünstler im offenen Land. AULA-Verlag, Wiesbaden. Matter, H. (1982): Einfluss intensiver Felbewirtschaftung auf den Buterfolg des Kiebitzes Vanellus vanellus in Mitteleuropa. Ornithol. Beob. 79: Rickenbach, O., M. U. Grüebler, M. Schaub, A. Koller, B. Naef-Daenzer & L. Schifferli (2011): Exclusion of ground predators improves Northern Lapwing Vanellus vanellus chick survival. Ibis 153: Ritschard, M. (2015): Bestand und Bruterfolg des Kiebitzes in der Schweiz und Zusammenfassung getroffener Massnahmen zur Artförderung. Ergebnisse Bericht der Orniplan AG z. Hd. des Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife Schweiz und der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Schifferli, L., O. Rickenbach, A. Koller & M. Grüebler (2009): Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern): Schutz der Nester vor Landwirtschaft und Prädation. Ornithol. Beob. 106:
Wie retten wir den Kiebitz? Teil 2
 Schweizerische Vogelwarte Wie retten wir den Kiebitz? Teil 2 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Artenförderung Kiebitz Erforschung der Ursachen für den Bestandsrückgang
Schweizerische Vogelwarte Wie retten wir den Kiebitz? Teil 2 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Artenförderung Kiebitz Erforschung der Ursachen für den Bestandsrückgang
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2016 Petra Horch Nicolas Guillod Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2016 Petra Horch Nicolas Guillod Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2018 Petra Horch Simon Hohl Micha Kipfer Tanja Koch Eva Ritschard Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2018 Petra Horch Simon Hohl Micha Kipfer Tanja Koch Eva Ritschard Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft
Artenförderungsprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderungsprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2014 Petra Horch Alexandra Brunner Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und
Artenförderungsprojekt Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2014 Petra Horch Alexandra Brunner Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2015 Petra Horch Nathalie Burgener Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene, Kanton Luzern Jahresbericht 2015 Petra Horch Nathalie Burgener Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Jagd und Fischerei
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene
 Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene Jahresbericht 2013 Petra Horch Karin Feller Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Fischerei und Jagd des Kantons Luzern
Artenförderung Kiebitz in der Wauwiler Ebene Jahresbericht 2013 Petra Horch Karin Feller Reto Spaar Bericht zuhanden der Amtsstellen für Landwirtschaft und für Natur, Fischerei und Jagd des Kantons Luzern
Wie retten wir den Kiebitz? Teil 1. Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler
 Wie retten wir den Kiebitz? Teil 1 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Bestandtrends In der Schweiz (1990 2013) Swiss BirdIndex Besiedelte Gebiete 2005-2013 Kartengrundlage
Wie retten wir den Kiebitz? Teil 1 Petra Horch Dr. Luc Schifferli Dr. Reto Spaar Dr. Stephanie Michler Bestandtrends In der Schweiz (1990 2013) Swiss BirdIndex Besiedelte Gebiete 2005-2013 Kartengrundlage
Exkursion Wauwilermoos
 Exkursion Wauwilermoos Samstag, 5. Mai 2018, 07:30 ca. 13:15 Uhr Exkursionsleitung: Beni und Edith Herzog Teilnehmer: 27 Personen Artenliste Reihenfolge der Beobachtung Art-Nr. gemäss ID Vogelwarte 5350
Exkursion Wauwilermoos Samstag, 5. Mai 2018, 07:30 ca. 13:15 Uhr Exkursionsleitung: Beni und Edith Herzog Teilnehmer: 27 Personen Artenliste Reihenfolge der Beobachtung Art-Nr. gemäss ID Vogelwarte 5350
Zur biologischen Vielfalt
 Jahresbericht 2016 Zur biologischen Vielfalt Jagd und Artenschutz Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 2.14 Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil Schleswig Seit 2014 werden
Jahresbericht 2016 Zur biologischen Vielfalt Jagd und Artenschutz Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 2.14 Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil Schleswig Seit 2014 werden
Ackermaßnahmen für den Kiebitz im Erdinger und Freisinger Moos. Marina Stern, 19. Februar 2015
 Ackermaßnahmen für den Kiebitz im Erdinger und Freisinger Moos Marina Stern, 19. Februar 2015 Ausgangssituation Kiebitz 2006 365 Reviere / Acker 130 Reviere / Wiese 2 Aktuelle Situation
Ackermaßnahmen für den Kiebitz im Erdinger und Freisinger Moos Marina Stern, 19. Februar 2015 Ausgangssituation Kiebitz 2006 365 Reviere / Acker 130 Reviere / Wiese 2 Aktuelle Situation
Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012
 Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012 (Gerfried Klammer, Landsberg) Vom Ansitz abfliegende Sumpfohreule bei Langeneichstädt (Quelle: Dr. Erich Greiner, 13.07.2012) Erfahrungen aus diesjährigen Bruten
Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012 (Gerfried Klammer, Landsberg) Vom Ansitz abfliegende Sumpfohreule bei Langeneichstädt (Quelle: Dr. Erich Greiner, 13.07.2012) Erfahrungen aus diesjährigen Bruten
Nistkasten 01 in 2016
 Nachfolgend werden nur Bilder der Innenkamera angezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 71 GB Speicherplatz und können daher nicht in die vorliegende Datei eingebunden werden. Nistkasten 01
Nachfolgend werden nur Bilder der Innenkamera angezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 71 GB Speicherplatz und können daher nicht in die vorliegende Datei eingebunden werden. Nistkasten 01
Kiebitz und Feldlerche im Flachgau
 Kiebitz und Feldlerche im Flachgau 12.01.17 Regionalseminar ÖPUL-schutz in Salzburg: Wir haben es in der Hand Dr. Susanne Stadler Land Salzburg, Abt. 5 Referat schutzgrundlagen und Sachverständigendienst
Kiebitz und Feldlerche im Flachgau 12.01.17 Regionalseminar ÖPUL-schutz in Salzburg: Wir haben es in der Hand Dr. Susanne Stadler Land Salzburg, Abt. 5 Referat schutzgrundlagen und Sachverständigendienst
Nistkasten 01 in 2015
 Nistkasten 01 in 2015 Erste Brut In 2015 brüteten im Nistkasten 01 wieder Kohlmeisen. Aus den 6 Eiern sind 5 Jungvögel schlüpft. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Jungvögel vom 18.04.2015
Nistkasten 01 in 2015 Erste Brut In 2015 brüteten im Nistkasten 01 wieder Kohlmeisen. Aus den 6 Eiern sind 5 Jungvögel schlüpft. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Jungvögel vom 18.04.2015
Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen
 Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen Wiesenbrüter sind Vögel, welche ihr Nest am Boden anlegen. Das Nest verstecken sie in einer Wiese oder Weide. In der Ausstellung Erlebnis Wiesenbrüter wird
Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen Wiesenbrüter sind Vögel, welche ihr Nest am Boden anlegen. Das Nest verstecken sie in einer Wiese oder Weide. In der Ausstellung Erlebnis Wiesenbrüter wird
Aktiver Gelege- und Kükenschutz von Wiesenbrütern. Ein Beispiel für eine produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme
 Aktiver Gelege- und Kükenschutz von Wiesenbrütern Ein Beispiel für eine produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme Idee des Gelegeschutzes stammt aus den Niederlanden Ehrenamtlicher Naturschutz Ursprünglich
Aktiver Gelege- und Kükenschutz von Wiesenbrütern Ein Beispiel für eine produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme Idee des Gelegeschutzes stammt aus den Niederlanden Ehrenamtlicher Naturschutz Ursprünglich
Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen. Von Martin Brühne & Benedikt Gießing
 Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen Von Martin Brühne & Benedikt Gießing Es war nicht das erste Mal, dass ein Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen Von Martin Brühne & Benedikt Gießing Es war nicht das erste Mal, dass ein Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
J u n g h a s e n : W o ü b e r l e b e n s i e d i e e r s t e n L e b e n s w o c h e n?
 H a s e n s c h u t z i n d e r S c h w e i z 29 J u n g h a s e n : W o ü b e r l e b e n s i e d i e e r s t e n L e b e n s w o c h e n? Von Denise Karp, Doktorandin Uni Zürich Der Bestand des Feldhasen
H a s e n s c h u t z i n d e r S c h w e i z 29 J u n g h a s e n : W o ü b e r l e b e n s i e d i e e r s t e n L e b e n s w o c h e n? Von Denise Karp, Doktorandin Uni Zürich Der Bestand des Feldhasen
Förderungsprojekt Schleiereule und Turmfalke im St. Galler Rheintal
 Förderungsprojekt Schleiereule und Turmfalke im St. Galler Rheintal Kurzbericht 208 Ivo Moser 0.2.208 Verein Pro Riet Rheintal Schwalbenweg 6, 9450 Altstätten, Telefon 07 750 08 30, info@pro-riet.ch, www.pro-riet.ch
Förderungsprojekt Schleiereule und Turmfalke im St. Galler Rheintal Kurzbericht 208 Ivo Moser 0.2.208 Verein Pro Riet Rheintal Schwalbenweg 6, 9450 Altstätten, Telefon 07 750 08 30, info@pro-riet.ch, www.pro-riet.ch
Ein Jahr auf Bird Island
 Ein Jahr auf Bird Island Sehr heiß, aber immer noch etwas Wind aus Nordwesten. Das Meer ist normalerweise sehr ruhig und klar. Gelegentliche Regenschauer. Schöne Sonnenuntergänge. Das Riff trocknet im
Ein Jahr auf Bird Island Sehr heiß, aber immer noch etwas Wind aus Nordwesten. Das Meer ist normalerweise sehr ruhig und klar. Gelegentliche Regenschauer. Schöne Sonnenuntergänge. Das Riff trocknet im
Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium. Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite
 Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite Der Rotmilan Der rote Drache The Red Dragon Steckbrief Rotmilan
Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite Der Rotmilan Der rote Drache The Red Dragon Steckbrief Rotmilan
Erfolgreiche Kiebitzbruten auf extensiv begrünten Flachdächern
 Erfolgreiche Kiebitzbruten auf extensiv begrünten Flachdächern Das Beispiel der Flachdächer der Firma ALSO Schweiz AG, Emmen, mit weiterführenden Massnahmen und Tipps für die Umsetzung Petra Horch Nathalie
Erfolgreiche Kiebitzbruten auf extensiv begrünten Flachdächern Das Beispiel der Flachdächer der Firma ALSO Schweiz AG, Emmen, mit weiterführenden Massnahmen und Tipps für die Umsetzung Petra Horch Nathalie
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten?
 Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
aus dem Auracher Storchennest: Das erste Ei im Auracher Storchennest am 21. März 2015
 2015 - aus dem Auracher Storchennest: Das erste Ei im Auracher Storchennest am 21. März 2015 Das zweite Ei im Auracher Storchennest am 24. März 2015 Das dritte Ei im Auracher Storchennest am 27. März 2015
2015 - aus dem Auracher Storchennest: Das erste Ei im Auracher Storchennest am 21. März 2015 Das zweite Ei im Auracher Storchennest am 24. März 2015 Das dritte Ei im Auracher Storchennest am 27. März 2015
Bilder aus den Nistkästen in 2017
 Bilder aus den Nistkästen in 2017 Nachfolgend werden keine Videodaten, sondern nur Bilder der Innen- und Außenkameras gezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 1300 GB Speicherplatz und können
Bilder aus den Nistkästen in 2017 Nachfolgend werden keine Videodaten, sondern nur Bilder der Innen- und Außenkameras gezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 1300 GB Speicherplatz und können
Vernetzung im Kulturland Periode II,
 Vernetzungs- projekt Vernetzung im Kulturland Periode II, 2010-2015 Das Projekt Vernetzung im Kulturland des Kantons wurde von 2004 bis 2009 während 6 Jahren erfolgreich umgesetzt. Im Januar 2010 hat es
Vernetzungs- projekt Vernetzung im Kulturland Periode II, 2010-2015 Das Projekt Vernetzung im Kulturland des Kantons wurde von 2004 bis 2009 während 6 Jahren erfolgreich umgesetzt. Im Januar 2010 hat es
Seite Vogelforscher-Wissen Vögel bestimmen Enten, Gänse, Storch & Co Greifvögel, Eulen, Fasan & Co... 32
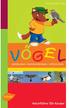 Das steht im Buch Seite Vogelforscher-Wissen... 4 Vögel bestimmen... 12 Enten, Gänse, Storch & Co... 15 Greifvögel, Eulen, Fasan & Co... 32 Tauben, Krähen, Spechte & Co... 42 Amsel, Meise, Fink & Co...
Das steht im Buch Seite Vogelforscher-Wissen... 4 Vögel bestimmen... 12 Enten, Gänse, Storch & Co... 15 Greifvögel, Eulen, Fasan & Co... 32 Tauben, Krähen, Spechte & Co... 42 Amsel, Meise, Fink & Co...
Meeresschildkröten. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Meeresschildkröten Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Jürgen Freund / WWF-Canon Steckbrief
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Meeresschildkröten Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Jürgen Freund / WWF-Canon Steckbrief
Stockenten in Berlin. Hilfe für tierische Hausbesetzer
 Stockenten in Berlin Hilfe für tierische Hausbesetzer 2 Ausgangssituation Die Anpassungsfähigkeit der Stockente ist sehr groß. Natürlichweise werden die Nester gut versteckt in dichter Vegetation am Boden
Stockenten in Berlin Hilfe für tierische Hausbesetzer 2 Ausgangssituation Die Anpassungsfähigkeit der Stockente ist sehr groß. Natürlichweise werden die Nester gut versteckt in dichter Vegetation am Boden
Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern): Schutz der Nester vor Landwirtschaft und Prädation
 Der Ornithologische Beobachter / Band 106 / Heft 3 / September 2009 311 Aus der Schweizerischen Vogelwarte Sempach Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern):
Der Ornithologische Beobachter / Band 106 / Heft 3 / September 2009 311 Aus der Schweizerischen Vogelwarte Sempach Massnahmen zur Förderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern):
Kiebitz-Wiederbesiedlung im Lkr. Böblingen Ökokontoprojekt in Gärtringen-Rohrau
 Kiebitz-Wiederbesiedlung im Lkr. Böblingen Ökokontoprojekt in Gärtringen-Rohrau Ökokonto-Maßnahme der Gemeinde Gärtringen in Kooperation mit NABU, LRA Böblingen und beteiligten Planungsbüros Fachliche
Kiebitz-Wiederbesiedlung im Lkr. Böblingen Ökokontoprojekt in Gärtringen-Rohrau Ökokonto-Maßnahme der Gemeinde Gärtringen in Kooperation mit NABU, LRA Böblingen und beteiligten Planungsbüros Fachliche
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich
 TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
ENTWURFSSTAND 20. September 2016
 20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
Nahrung und Lebensraum der Störche
 DE SuS A7 Auftrag Zyklus 2a, Zyklus 2b Auftrag 7 Nahrung und Lebensraum der Störche Info für die Lehrperson Was? Ein genügend grosses Nahrungsangebot sowie gute klimatische Bedingungen während der Brutzeit
DE SuS A7 Auftrag Zyklus 2a, Zyklus 2b Auftrag 7 Nahrung und Lebensraum der Störche Info für die Lehrperson Was? Ein genügend grosses Nahrungsangebot sowie gute klimatische Bedingungen während der Brutzeit
Vogel des Monats. Rotkehlchen. mit Fotos und Informationen von Beni und Edith Herzog.
 Vogel des Monats Rotkehlchen mit Fotos und Informationen von Beni und Edith Herzog www.lehrmittelperlen.net Das Rotkehlchen ist ein Singvogel. Es hat einen rundlichen Körper, lange, dünne Beine und ist
Vogel des Monats Rotkehlchen mit Fotos und Informationen von Beni und Edith Herzog www.lehrmittelperlen.net Das Rotkehlchen ist ein Singvogel. Es hat einen rundlichen Körper, lange, dünne Beine und ist
Jahresbericht 2013 Zabergäu / Leintal / Kraichgau
 Liebe Mitarbeiter, Streuobstwiesenbesitzer und Steinkauz-Interessierte, der Auftakt der Brutsaison 2013 war von sonnenscheinarmen Wintermonaten und einem verspäteten Wintereinbruch im März geprägt. Fortgesetzt
Liebe Mitarbeiter, Streuobstwiesenbesitzer und Steinkauz-Interessierte, der Auftakt der Brutsaison 2013 war von sonnenscheinarmen Wintermonaten und einem verspäteten Wintereinbruch im März geprägt. Fortgesetzt
Das Storchennest Otterwisch hat eine lange über 40 jährige Tradition. Die ersten vorliegenden
 Archiv über 40 Jahre Storchennest Otterwisch Das Storchennest Otterwisch hat eine lange über 40 jährige Tradition. Die ersten vorliegenden Beobachtungen sind aus dem Jahre 1968. Die erste beweisbare Brut
Archiv über 40 Jahre Storchennest Otterwisch Das Storchennest Otterwisch hat eine lange über 40 jährige Tradition. Die ersten vorliegenden Beobachtungen sind aus dem Jahre 1968. Die erste beweisbare Brut
Verbreitungsentwicklung des Rotmilans im Kanton Graubünden im Jahr 2016
 Verbreitungsentwicklung des Rotmilans im Kanton Graubünden im Jahr 2016 Auch in diesem Jahr hat sich der Rotmilan in Graubünden weiter ausgebreitet. Die Anzahl der bei ornitho.ch gemeldeten Beobachtungen
Verbreitungsentwicklung des Rotmilans im Kanton Graubünden im Jahr 2016 Auch in diesem Jahr hat sich der Rotmilan in Graubünden weiter ausgebreitet. Die Anzahl der bei ornitho.ch gemeldeten Beobachtungen
Tagfalter in Bingen. Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte
 Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte Die Beringung soll AUSSCHLIESSLICH dem Gewinn wissenschaftlich relevanter Daten dienen Beringung nur der Fernfunde wegen ist nicht mehr zeitgemäß! Das AOC als
Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte Die Beringung soll AUSSCHLIESSLICH dem Gewinn wissenschaftlich relevanter Daten dienen Beringung nur der Fernfunde wegen ist nicht mehr zeitgemäß! Das AOC als
Liebe macht blind. Krötenwanderung
 Krötenwanderung Arbeitsblatt 1 zum Mach-mit-Thema in TIERFREUND 2/2017 Liebe macht blind Bald ist es wieder so weit: Frösche, Kröten und andere Amphibien suchen ihre Laichplätze auf. Das ist für die Tiere
Krötenwanderung Arbeitsblatt 1 zum Mach-mit-Thema in TIERFREUND 2/2017 Liebe macht blind Bald ist es wieder so weit: Frösche, Kröten und andere Amphibien suchen ihre Laichplätze auf. Das ist für die Tiere
Gewinnen Sie CHF 1000.
 Gewinnen Sie CHF 1000. Gewinnen Sie CHF 1000. Sie können etwas dagegen tun! Die Höhe der Wildtierverluste beim Mähen von Grünland ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Schnitthöhe (je höher der Schnitt,
Gewinnen Sie CHF 1000. Gewinnen Sie CHF 1000. Sie können etwas dagegen tun! Die Höhe der Wildtierverluste beim Mähen von Grünland ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Schnitthöhe (je höher der Schnitt,
Das Tagebuch einer Kohlmeise
 Igisch Clara 7eO6 LMRL 2006-2007 Das Tagebuch einer Kohlmeise Beschreibung Kohlmeise (lux.: Schielmees, Kuelmees) Systematik Klasse: Vögel (Aves) Unterklasse: Neukiefervögel (Neognathae) Ordnung: Sperlingsvögel
Igisch Clara 7eO6 LMRL 2006-2007 Das Tagebuch einer Kohlmeise Beschreibung Kohlmeise (lux.: Schielmees, Kuelmees) Systematik Klasse: Vögel (Aves) Unterklasse: Neukiefervögel (Neognathae) Ordnung: Sperlingsvögel
Artenförderung Vögel im Wald
 Artenförderung Vögel im Wald Raffael Ayé, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Reto Spaar, Schweizerische Vogelwarte Sempach SVS-Naturschutztagung, Hünenberg ZG, 17. November 2012 Brutvogelarten
Artenförderung Vögel im Wald Raffael Ayé, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Reto Spaar, Schweizerische Vogelwarte Sempach SVS-Naturschutztagung, Hünenberg ZG, 17. November 2012 Brutvogelarten
Kurz-Bericht über die Aktion Wiesenweihe 2003
 Kurz-Bericht über die Aktion Wiesenweihe 2003 Teilnehmer Hans Eichenberger, Lenzburg Thomas Jordi, Bern Silvana Bolli, Zürich Jost Bühlmann, Zürich Ausgangslage Im Winter regnete es wiederum genügend.
Kurz-Bericht über die Aktion Wiesenweihe 2003 Teilnehmer Hans Eichenberger, Lenzburg Thomas Jordi, Bern Silvana Bolli, Zürich Jost Bühlmann, Zürich Ausgangslage Im Winter regnete es wiederum genügend.
Vogel des Monats. der Haubentaucher. Fotos und Informationen von Beni Herzog.
 Vogel des Monats der Haubentaucher Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Haubentaucher und seine Pulli Haubentaucher gehören zu den wenigen Vögeln, die bis in den Herbst
Vogel des Monats der Haubentaucher Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Haubentaucher und seine Pulli Haubentaucher gehören zu den wenigen Vögeln, die bis in den Herbst
Wiesenbrüterschutz in Vorarlberg
 1 Zwischenbericht zum Projekt des Naturschutzbundes Vorarlberg und der Niederwildreviere Auer Ried, Lustenau, Dornbirn Nord, Dornbirn Süd, Lauterach und Wolfurt Wiesenbrüterschutz in Vorarlberg Großer
1 Zwischenbericht zum Projekt des Naturschutzbundes Vorarlberg und der Niederwildreviere Auer Ried, Lustenau, Dornbirn Nord, Dornbirn Süd, Lauterach und Wolfurt Wiesenbrüterschutz in Vorarlberg Großer
Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 9. Januar 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 9. Januar 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Die Varroamilbe - ein Ektoparasit an der Honigbiene II
 Die Varroamilbe - ein Ektoparasit an der Honigbiene II Textinformationen Bienen gehören zu den holometabolen Insekten. Im Laufe ihrer Entwicklung machen sie also eine vollständige Verwandlung durch. Aus
Die Varroamilbe - ein Ektoparasit an der Honigbiene II Textinformationen Bienen gehören zu den holometabolen Insekten. Im Laufe ihrer Entwicklung machen sie also eine vollständige Verwandlung durch. Aus
Bartgeier. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Bartgeier Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Michel Gunther / WWF-Canon Steckbrief Grösse:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Bartgeier Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Michel Gunther / WWF-Canon Steckbrief Grösse:
Vogel des Monats. der Mäusebussard. Informationen und Fotos von Edith und Beni Herzog.
 Vogel des Monats der Mäusebussard Informationen und Fotos von Edith und Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Mäusebussard ist einer der häufigsten Greifvögel und kommt in ganz Europa mit Ausnahme des
Vogel des Monats der Mäusebussard Informationen und Fotos von Edith und Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Mäusebussard ist einer der häufigsten Greifvögel und kommt in ganz Europa mit Ausnahme des
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Kaiserpinguin. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Kaiserpinguin Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Bis 1.30 m (Kopf bis Fuss)
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Kaiserpinguin Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Bis 1.30 m (Kopf bis Fuss)
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN
 MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN REGENPFEIFERARTIGE - CHARADRIIFORMES Text und Fotos von Katharina Kreissig Bei dem Besuch einer Pinguinkolonie kann man einige interessante Vogelarten beobachten, deren Lebensweise
MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN REGENPFEIFERARTIGE - CHARADRIIFORMES Text und Fotos von Katharina Kreissig Bei dem Besuch einer Pinguinkolonie kann man einige interessante Vogelarten beobachten, deren Lebensweise
Legekreis Heimische Vögel
 Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Tiere im Winter. OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
Winter-Rallye Tiere im Winter
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Winter-Rallye Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Winter-Rallye Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst
Naturpädagogisches Programm
 Naturpädagogisches Programm Angebote für Schulen Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Die Forschungsstation Schlüchtern entstand aus einer wissenschaftlichen Zweigstelle der J.W. Goethe-Universität Frankfurt.
Naturpädagogisches Programm Angebote für Schulen Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Die Forschungsstation Schlüchtern entstand aus einer wissenschaftlichen Zweigstelle der J.W. Goethe-Universität Frankfurt.
Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013
 Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013 Beate Wendelin Lachmöwe (Larus ridibundus) 2013 wurde der Brut-Bestand der Lachmöwe im Nationalpark Neusiedler
Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013 Beate Wendelin Lachmöwe (Larus ridibundus) 2013 wurde der Brut-Bestand der Lachmöwe im Nationalpark Neusiedler
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Lehndorf, 01.12.2014 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Lehndorf, 01.12.2014 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Das Oltner Wetter im Juli 2011
 Das Oltner Wetter im Juli 2011 Der kühlste Juli seit dem Jahr 2000 Dem sonnigen, warmen und trockenen Wetter, das über weite Strecken das erste Halbjahr dominierte, ging in der zweiten Julihälfte die Luft
Das Oltner Wetter im Juli 2011 Der kühlste Juli seit dem Jahr 2000 Dem sonnigen, warmen und trockenen Wetter, das über weite Strecken das erste Halbjahr dominierte, ging in der zweiten Julihälfte die Luft
Gesamtbetriebliche Beratung im St. Galler Rheintal
 Gesamtbetriebliche Beratung im St. Galler Rheintal Jahresbericht 2015 Petra Horch Simon Birrer Bericht zu Handen der Projektpartner Maschinenring Ostschweiz-Liechtenstein und Pro Riet Rheintal, der beratenen
Gesamtbetriebliche Beratung im St. Galler Rheintal Jahresbericht 2015 Petra Horch Simon Birrer Bericht zu Handen der Projektpartner Maschinenring Ostschweiz-Liechtenstein und Pro Riet Rheintal, der beratenen
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief.
 Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Neues aus dem Vogelpark Viernheim. Newsletter Mai Liebe Freunde des Vogelpark Viernheim,
 Neues aus dem Vogelpark Viernheim Newsletter Mai 2018 Liebe Freunde des Vogelpark Viernheim, seit einigen Wochen ist der Frühling endlich da. Auch im Vogelpark wird nun wird an vielen Stellen gebalzt und
Neues aus dem Vogelpark Viernheim Newsletter Mai 2018 Liebe Freunde des Vogelpark Viernheim, seit einigen Wochen ist der Frühling endlich da. Auch im Vogelpark wird nun wird an vielen Stellen gebalzt und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale
 Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Unterrichtsmaterial zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC)
 Unterrichtsmaterial zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC) Titel: Die Bedeutung der Salzwiesen am Beispiel der Ringelgans Autor: Lennard Lüdemann Stufe: Sekundarstufe Art des Materials: Informationstexte
Unterrichtsmaterial zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC) Titel: Die Bedeutung der Salzwiesen am Beispiel der Ringelgans Autor: Lennard Lüdemann Stufe: Sekundarstufe Art des Materials: Informationstexte
Dr. Eckhard Gottschalk + Werner Beeke
 Dr. Eckhard Gottschalk + Werner Beeke Das Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen - Blühstreifen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Landwirten - Im europäischen Monitoring des European Bird
Dr. Eckhard Gottschalk + Werner Beeke Das Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen - Blühstreifen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Landwirten - Im europäischen Monitoring des European Bird
Übersicht. Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen
 Übersicht Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen Mehlschwalbe als Vogel des Jahres 2010 Im Internationalen Jahr der Biodiversität wirbt die Mehlschwalbe für mehr
Übersicht Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen Mehlschwalbe als Vogel des Jahres 2010 Im Internationalen Jahr der Biodiversität wirbt die Mehlschwalbe für mehr
Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern
 Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern Erste Ergebnisse zu Habitatwahl, Bruterfolg und Fördermaßnahmen Frank Gottwald, Andreas + Adele Matthews, Karin Stein-Bachinger DO-G Fachgruppentreffen
Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern Erste Ergebnisse zu Habitatwahl, Bruterfolg und Fördermaßnahmen Frank Gottwald, Andreas + Adele Matthews, Karin Stein-Bachinger DO-G Fachgruppentreffen
Lebensraumverbesserungen für die Heidelerche eine europaweit bedrohte Vogelart auf den Hochflächen des Schaffhauser Randens
 Lebensraumverbesserungen für die eidelerche eine europaweit bedrohte Vogelart auf den ochflächen des Schaffhauser Randens Sechster Zwischenbericht 2002 eidelerche (Bild: Schweizer Vogelschutz SVS BirdLife
Lebensraumverbesserungen für die eidelerche eine europaweit bedrohte Vogelart auf den ochflächen des Schaffhauser Randens Sechster Zwischenbericht 2002 eidelerche (Bild: Schweizer Vogelschutz SVS BirdLife
Das Oltner Wetter im Januar 2009
 Das Oltner Wetter im Januar 2009 Winterlich kalt und trocken Nach den beiden viel zu milden Januarmonaten der Jahre 2007 (+5.0 C) und 2008 (+2.8 C) war der diesjährige Januar massiv kälter. Die Mitteltemperatur
Das Oltner Wetter im Januar 2009 Winterlich kalt und trocken Nach den beiden viel zu milden Januarmonaten der Jahre 2007 (+5.0 C) und 2008 (+2.8 C) war der diesjährige Januar massiv kälter. Die Mitteltemperatur
Gerste: Sorten- und Intensitätsversuch
 Gerste: Sorten- und Intensitätsversuch In einem Gerstensorten- und Intensitätsversuch werden die wichtigen aktuellen und neuen Sorten in den zwei Anbauverfahren ÖLN und Extenso verglichen. Der Kleinparzellenversuch
Gerste: Sorten- und Intensitätsversuch In einem Gerstensorten- und Intensitätsversuch werden die wichtigen aktuellen und neuen Sorten in den zwei Anbauverfahren ÖLN und Extenso verglichen. Der Kleinparzellenversuch
Naturschutzgebiet Ostergau
 Jahresbericht 2012 Naturschutzgebiet Ostergau Hochwasser im November Pius Kunz Jahresbericht Ostergau 2012 Pius Kunz 1 1. Einleitung Ich erlaube mir, den Jahresbericht 2012 etwas kürzer zu fassen als in
Jahresbericht 2012 Naturschutzgebiet Ostergau Hochwasser im November Pius Kunz Jahresbericht Ostergau 2012 Pius Kunz 1 1. Einleitung Ich erlaube mir, den Jahresbericht 2012 etwas kürzer zu fassen als in
Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII. Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni
 Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni 2015 - Vor den Osterferien werden alle Meisenkästen auf dem
Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni 2015 - Vor den Osterferien werden alle Meisenkästen auf dem
Farbberingungsprojekt Wasseramseln in Norddeutschland Infoschreiben 2008/2009
 Farbberingungsprojekt Wasseramseln in Norddeutschland Infoschreiben 2008/2009 Liebe Wasseramselfreunde, eine weitere Wasseramselsaison, die Dritte in der wir unser Farbberingungsprojekt durchführen, haben
Farbberingungsprojekt Wasseramseln in Norddeutschland Infoschreiben 2008/2009 Liebe Wasseramselfreunde, eine weitere Wasseramselsaison, die Dritte in der wir unser Farbberingungsprojekt durchführen, haben
Das Oltner Wetter im Oktober 2009
 Das Oltner Wetter im Oktober 2009 Anhaltende Trockenheit Das prägendste Wetterelement des vergangenen Monats war sicherlich der weiter nur spärlich fallende Niederschlag und der damit verbundene sehr tiefe
Das Oltner Wetter im Oktober 2009 Anhaltende Trockenheit Das prägendste Wetterelement des vergangenen Monats war sicherlich der weiter nur spärlich fallende Niederschlag und der damit verbundene sehr tiefe
Polarfuchs. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Polarfuchs Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Klein & Hubert / WWF Steckbrief Grösse: 50-65
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Polarfuchs Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Klein & Hubert / WWF Steckbrief Grösse: 50-65
Nutznießer von Brachen Rebhuhn und Grauammer
 Nutznießer von Brachen Rebhuhn und Grauammer Vögel in der Kulturlandschaft: Was zeigen sie - was brauchen sie? LWK St.Pölten 11.8.2017, Katharina Bergmüller Rebhuhn: Verbreitung BirdLife, P.Buchner Ornitho.at
Nutznießer von Brachen Rebhuhn und Grauammer Vögel in der Kulturlandschaft: Was zeigen sie - was brauchen sie? LWK St.Pölten 11.8.2017, Katharina Bergmüller Rebhuhn: Verbreitung BirdLife, P.Buchner Ornitho.at
Artenschutzprogramm gefährdeter Ackerbegleitpflanzen
 Artenschutzprogramm gefährdeter Ackerbegleitpflanzen Anlage einer Ackerfläche zum Erhalt akut vom Aussterben bedrohter Ackerbegleitpflanzen Ziel: Erhaltung eines der letzten Standorte und Überlebenssicherung
Artenschutzprogramm gefährdeter Ackerbegleitpflanzen Anlage einer Ackerfläche zum Erhalt akut vom Aussterben bedrohter Ackerbegleitpflanzen Ziel: Erhaltung eines der letzten Standorte und Überlebenssicherung
Witterungsbericht. - Sommer
 Witterungsbericht - Sommer 2016 - Witterungsbericht Sommer 2016 Erstellt: September 2016 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email:
Witterungsbericht - Sommer 2016 - Witterungsbericht Sommer 2016 Erstellt: September 2016 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email:
Das Oltner Wetter im März 2011
 Das Oltner Wetter im März 2011 Frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit Auch der erste Frühlingsmonat war, wie schon die Vormonate Januar und Februar, überwiegend von hohem
Das Oltner Wetter im März 2011 Frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit Auch der erste Frühlingsmonat war, wie schon die Vormonate Januar und Februar, überwiegend von hohem
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum S 2. Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe
 Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Frühe Mahdzeitpunkte zur Förderung des Heilziest-Dickkopffalters (Carcharodus flocciferus) (Zeller, 1847) im württembergischen Allgäu
 Frühe Mahdzeitpunkte zur Förderung des Heilziest-Dickkopffalters (Carcharodus flocciferus) (Zeller, 1847) im württembergischen Allgäu Tagfalterworkshop Leipzig 01.-03. März 2018 Dr. Thomas Bamann (RP Tübingen)
Frühe Mahdzeitpunkte zur Förderung des Heilziest-Dickkopffalters (Carcharodus flocciferus) (Zeller, 1847) im württembergischen Allgäu Tagfalterworkshop Leipzig 01.-03. März 2018 Dr. Thomas Bamann (RP Tübingen)
Das Oltner Wetter im April 2011
 Das Oltner Wetter im April 2011 Ein aussergewöhnlicher April Der Wetterablauf im April 2011 war von einem dominierenden Element geprägt, nämlich Hochdruckgebieten. Von Monatsbeginn bis zum 22. April lagen
Das Oltner Wetter im April 2011 Ein aussergewöhnlicher April Der Wetterablauf im April 2011 war von einem dominierenden Element geprägt, nämlich Hochdruckgebieten. Von Monatsbeginn bis zum 22. April lagen
An dem Augsburg, Markt Mering Kirchplatz Mering
 Dr. Hermann Stickroth Sperberweg 4a 86156 Augsburg Tel. 0821 / 45 31 664 Fax. 0821 / 45 31 671 Abs.: Dr. Hermann Stickroth, Sperberweg 4a, 86156 Augsburg An dem Augsburg, 14.08.2017 Markt Mering Kirchplatz
Dr. Hermann Stickroth Sperberweg 4a 86156 Augsburg Tel. 0821 / 45 31 664 Fax. 0821 / 45 31 671 Abs.: Dr. Hermann Stickroth, Sperberweg 4a, 86156 Augsburg An dem Augsburg, 14.08.2017 Markt Mering Kirchplatz
Vernetzungs- projekt. Blumenwiesen und Buntbrachen in Vernetzungsgebieten. Thurgau. Nutzen für die Thurgauerinnen und Thurgauer!
 Blumenwiesen und Buntbrachen in Vernetzungsgebieten Mit dem Landschaftsentwicklungskonzept hat der Kanton wesentliche Impulse zur Aufwertung und zum Schutz seiner schönen Landschaft ausgelöst. Durch den
Blumenwiesen und Buntbrachen in Vernetzungsgebieten Mit dem Landschaftsentwicklungskonzept hat der Kanton wesentliche Impulse zur Aufwertung und zum Schutz seiner schönen Landschaft ausgelöst. Durch den
Arbeitshilfe. Arbeitshilfe 10. Projektspezifische Erfolgskontrollen. Vernetzungsprojekten. Amphibien, Reptilien
 Arbeitshilfe Ziel- und Leitarten in Vernetzungsprojekten und LEK Arbeitshilfe 10 Projektspezifische Erfolgskontrollen zu ÖQV- Vernetzungsprojekten Amphibien, Reptilien AMT FÜR LANDSCHAFT UND NATUR FACHSTELLE
Arbeitshilfe Ziel- und Leitarten in Vernetzungsprojekten und LEK Arbeitshilfe 10 Projektspezifische Erfolgskontrollen zu ÖQV- Vernetzungsprojekten Amphibien, Reptilien AMT FÜR LANDSCHAFT UND NATUR FACHSTELLE
Krokodil. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Krokodil Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Staffan Widstrand / WWF Steckbrief Grösse: Alter:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Krokodil Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Staffan Widstrand / WWF Steckbrief Grösse: Alter:
Vogel des Monats. der Hausrotschwanz. mit Fotos und Informationen von Beni Herzog.
 Vogel des Monats der Hausrotschwanz mit Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Hausrotschwanz ist ein Singvogel. Er sieht ähnlich aus wie der Haussperling, lässt sich jedoch
Vogel des Monats der Hausrotschwanz mit Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Hausrotschwanz ist ein Singvogel. Er sieht ähnlich aus wie der Haussperling, lässt sich jedoch
Pattonville Mehlschwalbenmonitoring. Ergebnisse 2017/2018. Auftraggeber: Zweckverband Pattonville
 Pattonville Mehlschwalbenmonitoring Ergebnisse 2017/2018 Auftraggeber: Zweckverband Pattonville 1. Einleitung 2. Methodik 4. Ausblick 1. Einleitung Mehlschwalbe (Delichon urbicum) Früher sehr häufiger
Pattonville Mehlschwalbenmonitoring Ergebnisse 2017/2018 Auftraggeber: Zweckverband Pattonville 1. Einleitung 2. Methodik 4. Ausblick 1. Einleitung Mehlschwalbe (Delichon urbicum) Früher sehr häufiger
Dohlen-Vorkommen und -Beringung 2010 im Hohenlohekreis (KÜN)
 Dohlen-Vorkommen und -Beringung 2010 im Hohenlohekreis (KÜN) fast flügger Dohlen-Jungvogel am 03.06.2010 in Neuenstein 17.03.2010 Kloster Schöntal / Klosterkirche: Foto: Karl-Heinz Graef (49,32969 N /
Dohlen-Vorkommen und -Beringung 2010 im Hohenlohekreis (KÜN) fast flügger Dohlen-Jungvogel am 03.06.2010 in Neuenstein 17.03.2010 Kloster Schöntal / Klosterkirche: Foto: Karl-Heinz Graef (49,32969 N /
Museumskiste Winterspeck und Pelzmantel
 Museumskiste Winterspeck und Pelzmantel Lösungen MS Wer ist hier der Dachs? Biber Wildschwein Baummarder Igel Murmeltier 1 - Umkreise den Dachs und schreibe die Namen der anderen Tiere dazu. 2 - Wer bleibt
Museumskiste Winterspeck und Pelzmantel Lösungen MS Wer ist hier der Dachs? Biber Wildschwein Baummarder Igel Murmeltier 1 - Umkreise den Dachs und schreibe die Namen der anderen Tiere dazu. 2 - Wer bleibt
Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege
 Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Werner Eikhorst Bremen, Oktober 2007 Brutvögel am Unterlauf der
Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Werner Eikhorst Bremen, Oktober 2007 Brutvögel am Unterlauf der
Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen
 Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen Von Ernst-Günter Bulk, Stefan Bulk & Eckhard Möller Die Wetten liefen bereits seit ein Paar Jahren: Die weiten dünn besiedelten
Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen Von Ernst-Günter Bulk, Stefan Bulk & Eckhard Möller Die Wetten liefen bereits seit ein Paar Jahren: Die weiten dünn besiedelten
Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring
 Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring Bestandssituation im Leipziger Stadtgebiet und am Floßgraben Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping BioCart Ökologische Gutachten, Taucha 19. Stadt-Umland-Konferenz
Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring Bestandssituation im Leipziger Stadtgebiet und am Floßgraben Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping BioCart Ökologische Gutachten, Taucha 19. Stadt-Umland-Konferenz
