4 Joachim Nerz Eine herpetologische Winterreise - der Südosten der Iberischen Halbinsel im Dezember
|
|
|
- Maximilian Braun
- vor 3 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 4 Joachim Nerz Eine herpetologische Winterreise - der Südosten der Iberischen Halbinsel im Dezember 10 Sergé Bogaerts Etwas genauer: Arten, Unterarten und genetische Unterschiede bei Amphibien im Südwesten Iberiens: zwei Beispiele 14 Magdalena Meikl & Julia Schauer Bestandsaufnahme von Feuer- und Alpensalamandern in Österreich 17 Joachim Nerz Alpensalamander Salamandra atra und Lanzas Alpensalamander Salamandra lanzai - ähnlich, aber nicht gleich 24 Catrin Grollich Beobachtungen zur Geburt und Aufzucht eines zweiköpfigen Feuersalamanders 27 Joachim Nerz Olme - eigenwillige Schwanzlurche mit seltsamer Verbreitung 33 Wolf-Rüdiger Grosse amphibia Literatur Magazin amphibia, 12(2),
2 Joachim Nerz Eine herpetologische Winterreise - der Südosten der Iberischen Halbinsel im Dezember Eigentlich keine Zeit, in der man normalerweise nach Spanien reist, im Dezember und Januar ist es hier verregnet und kühl. Warum dann also ausgerechnet im Winter nach Südspanien? Die Antwort ist einfach: Weil das die beste Jahreszeit ist, um dort Salamander und Molche zu sehen. Deshalb starteten meine Freundin und Katrin Hinderhofer und ich am ersten Weihnachtsfeiertag 2011 zu einer zweiwöchigen Reise nach Spanien. Nach einem unspektakulären Flug von Stuttgart nach Malaga machten wir uns auf den Weg nach Osten. Unser Ziel war das idyllische Städtchen Ronda am Nordostrand der Sierra de Grazalema. Die Fahrt führte durch eine sehr schöne Maccialandschaft hoch ins Gebirge bzw. ins Hochland. An kleinen Bachtälchen, die sich zuweilen in die Landschaft eingeschnitten haben, machten wir immer mal wieder einen Stop, um nach Salamanderlarven zu suchen. Die meisten der kleinen Bächlein waren weitestgehend ausgetrocknet. Am nächsten Tag ging es weiter nach Osten, von wo aus man eine wunderschöne Aussicht über fast schon alpine Gebirgslandschaften der Sierra de Grazalema hat, von hier aus nach Süden erstreckt sich das Verbreitungsgebiet einer recht ungewöhnlichen Feuersalamander-Subspecies: Salamandra s. longirostris (Andalusischer Feuersalamander). Der lateinische Name deutet bereits schon auf das hervorstechendste Merkmal der Tiere hin: die ungewöhnlich spitz verlängerte Schnauze der Tiere. Die mir bekannten Standorte von S. s. longirostris waren jedoch sehr trocken, so dass nicht einmal Larven zu finden waren, geschweige denn erwachsene Tiere. Wir fuhren weiter und später am Tag führte die Straße zuweilen entlang eines kleinen Bächleins ins Tal. Direkt am Bach war ein kleiner Brunnen mit einem kleinen Legesteinmäuerchen. Nach kurzer Suche konnte ich hier und da tatsächlich Salamanderlarven im Bach feststellen; es gibt sie an der Stelle also tatsächlich S.s. longirostris. Die Larven sind nicht zu unterscheiden von den Larven unserer heimischen Salamander. Unsere Reise führte uns weiter nach Süden. Die Landschaft änderte sich deutlich. Man dringt in eine typische mediterrane Maccia-Landschaft ein, mit vielen knorrigen Büschen und niedrigen Bäumchen, in denen hin und wieder auch Korkeichen zu finden sind. Wir befinden uns nun im Parque Natural de Los Alcomocales. Offene Flächen sind selten, eine der Wenigen steuerten wir an, um eine ungewöhnliche und sehr seltene Pflanze zu suchen Drosophyllum lusitanicum. Diese Art zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit ihren klebrigen Drüsen Insekten anlockt, fängt und verdaut; sie ist jedoch nicht mit dem recht ähnlich anmutenden Sonnentau verwandt, sondern mit einer Liane, die in den Regenwäldern Afrikas zu finden ist. Obwohl die Fläche relativ trocken und sandig war (Abb. 1 oben rechts), fand ich unter einem Stein einen sehr hübschen halbwüchsigen Salamandra salamandra longirostris (Abb. 1 oben links). Nachdem ich das Tier fotografiert hatte, setzte ich es wieder an die gleiche Stelle zurück und ich war umso erstaunter, als ich nach zwei Wochen wieder an eben jene Stelle zurückkehrte und das Tier immer noch quasi an derselben Stelle zu finden war. An einer dieser Stellen im Park nahe eines Baches beobachtete ich unter Steinen erstaunlich viele Dickschwanzskorpione der Gattung Buthus; hübsche große Tierchen, von denen man sich aber tunlichst nicht stechen lassen sollte, da die Tiere doch ordentlich toxisch sind. 4 amphibia, 12(2), 2013
3 Eine herpetologische Winterreise - der Südosten der Iberischen Halbinsel im Dezember Abb. 1: Exkursionsbilder aus Spanien: oben links Salamandra s. longirostris und oben rechts Habitat im Parque Natural de Los Arcornocales; Mitte oben rechts Habitat von Triturus pygmeus im Parque Natural de Los Arcornocales; Mitte oben links Triturus pygmaeus, männl, Parque Natural de Los Arcornocales; Mitte unten rechts See, N. Villa do Bispo, Habitat von Pleurodeles waltl, Triturus pygmaeus und Lissotriton maltzani;mitte unten links Lissotriton maltzani, männl, N. Villa do Bispo; unten links Salamandra s. morenica, weibl, Sierra de Aracena; unten rechts Habitat von Salamandra s. morenica, Sierra de Aracena. Alle Fotos: J. Nerz amphibia, 12(2),
4 Joachim Nerz Abb. 2: Männchen von Pleurodeles waltl, W Villa do Bispo. Foto: J. Nerz Weiter südlich im Park suchte ich ein permanentes Gewässer auf, wo ich Informationen hatte, daß dort unter anderem der Zwerg-Marmormolch Triturus pygmaeus zu finden sein sollte. Das stark verkrautete Gewässer führte nur im innersten tiefsten Teil noch Wasser (Abb. 1, mitte oben rechts). Das ganze Gewässer und vor allem der Gewässerrand war übersät von Findlingen, eigentlich ein ideales Amphibiengewässer. In der Tat dauerte es nicht lange, um einige der ersehnten Exemplare von Triturus pygmaeus zu erspähen (Abb. 1, mitte oben links). Die Tiere waren unter Steinen zu finden, die unmittelbar am Gewässerrand lagen; an diesem Tag waren es drei Männchen und ein Weibchen; die Färbung der Tiere war recht variabel, die meisten Tiere waren dorsal grün und dunkel marmoriert. Es gab jedoch auch Tiere, bei denen der dunkle, braunschwarze Anteil der Dorsalfärbung in den Vordergrund trat. Bei den Männchen war der Rückenkamm bereits deutlich erkennbar, wenn auch noch nicht voll ausgeprägt. Die Schwanzsäume waren bereits verbreitert. Bei einer späteren Kontrolle fiel auf, dass es sich bei den Molchen unter den Steinen fast ausschließlich um männliche Tiere handelte; unter ca. einem Dutzend Tiere, die ich dort gesehen hatte, waren nur zwei weibliche Tiere mit dabei. Auf dem Weg nach Osten besuchten wir noch den bekannten Parque National de Donana, direkt an der Küste. Es ist ein sehr schönes Gebiet mit Dünenlandschaften, offenen Savannen, in denen immer wieder kleinere und größere Teiche und Seen lagen inmitten von mediterranen Pinienwäldern. Ein idealer Platz, um Vögel zu beobachten. Die gesuchten Amphibien und Reptilien leben dort zwar auch, deren Habitate sind aber aufgrund der Holzbohlen-Pfade, die man nicht verlassen sollte, normalerweise kaum zugänglich. Unser eigentliches Ziel war jedoch der äußerste Südosten Europas, die Umgebung von Villa do Bispo in Portugal. Wir waren positiv überrascht, ein idyllisches kleines Örtchen umgeben von herr- 6 amphibia, 12(2), 2013
5 Eine herpetologische Winterreise - der Südosten der Iberischen Halbinsel im Dezember lichen Küstenlandschaften vorzufinden. Auf einer Straße zur Küste, inmitten einer recht ariden Landschaft fanden wir einen toten Feuersalamander. Aufgrund der Lokalität konnte es sich dabei nur um einen Algarve-Feuersalamander Salamandra salamandra crespoi handeln. Erstaunlich, in welch trockene Gebiete sich die Tiere wagen. In einem kleinen Tal war unter Steinen eine hübsche Erdkröte Bufo bufo und ein Tal weiter in einem kleinen Bach auch noch ein grüner Wasserfrosch Pelophylax perezi zu sehen. Später am Abend kehrten wir von der Küste durch ein anderes, ebenso arides Tal wie das erste wieder zurück und machten eine kurze Rast an einer kleinen Ruine mit einem breiten Brunnen. Das Wasser am Grunde war gut erkennbar und klar und ich war überrascht, dass am Grunde des Brunnens zahlreiche große Molche zu erkennen waren. Jawohl, es waren Rippenmolche Pleurodeles waltl. Die zumeist männlichen Tiere machten einen recht abgemagerten Eindruck (Abb. 2). Ganz im Gegensatz zu der zweiten Art, die am Grunde des Brunnens lebte der Portugiesische Teichmolch Lissotriton maltzani. Diese Tiere waren deutlich kräftiger als die Tiere, die ich danach noch in verschiedenen natürlichen Teichen gesichtet hatte. Für diese zierliche Molchart schien also in dem Brunnen genügend Futter vorhanden zu sein, ganz im Gegensatz zu seinen größeren Verwandten, den Pleurodeles. Man kann davon ausgehen, dass die Tiere dort ganzjährig aquatisch leben, es ist schwer vorstellbar, dass diese Tiere das Habitat am Grunde des Brunnens jemals verlassen, zumal die Umgebung mit Ausnahme eines Baches auch hier wiederum sehr aride war. Es gibt jedoch in der weiteren Umgebung von Villa do Bispo ideale Habitate für Amphibien, feuchte Sumpfwiesen, Seen mit großen verkrauteten Flachwasserbereichen in offenen Landschaften, umgeben von Pinienwäldern, bzw. offene Savannen mit feuchten Gräben (Abb. 1, mitte unten rechts). Hier konnte ich nachts auf den Feuchtwiesen einige wenige Exemplare von Triturus pygmaeus ausfindig Abb. 3: Weibchen von Triturus pygmaeus, N. Villa do Bispo. Foto: J. Nerz amphibia, 12(2),
6 Joachim Nerz machen (Abb. 3), allerdings ausschließlich weibliche Tiere, ganz im Gegensatz zu dem oben erwähnten Standort im Parque Natural de los Alcornocales, wo ja zu dieser Zeit fast nur Männchen zu finden waren. Mir fiel auch noch ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Populationen auf: während die Ventralfärbung der Tiere aus dem Parque Natural de los Alcornoclaes meist weißlich mit großen dunklen Flecken war, so zeigten die weiblichen Tiere aus der Region um Villa do Bispo eine blassorange bzw. ganz blasse Ventralfärbung ohne dunkle Flecken. Später konnte ich auch noch Lissotriton maltzani in wenigen Exemplaren in den kleineren Gräben auffinden, hier waren es jedoch nur männliche Tiere (Abb. 1, mitte unten links), die ich gesehen habe. Die Tiere waren hier deutlich zierlicher als die Tiere, die wir zuvor in dem Brunnen sichteten. Insgesamt erinnert diese hübsche, kleine Art in etwa an unsere Teichmolche. Lissotriton maltzani ist jedoch noch zierlicher, meist dunkler bzw. kräftiger in der Färbung, mit ausgeprägterem Orange auf der Ventralseite. Bei den Männchen fehlt ein Rückenkamm, hier ist lediglich eine Leiste erkennbar. Diese Art scheint dort weit verbreitet zu sein. Auf dem Weg nach Norden passiert man eine große feuchte Savanne, die im zentralen Teil immer wieder von feuchten Gräben durchzogen ist. In einem dieser Gräben konnte ich ein prächtiges, großes Weibchen von Pleurodeles waltl beobachten. Vor allem die weiblichen Tiere mit ihren massigen Körpern können beträchtliche Größen erreichen. Etwas weiter im Norden, in einer ausgedehnten Dünenlandschaft war ein kleiner Bach zu finden, der sich an einer Stelle zu einer Art Teich verbreiterte. Hier wurde ein großes, totes Weibchen von Pleurodeles waltl an den Rand des Gewässers geschwemmt. Auch Lissotriton maltzani war hier zu finden. Unser nächstes Ziel galt wiederum den Feuersalamandern. Wir steuerten die Sierra de Monchique an, in der Hoffnung den Abb. 4: Salamandra s. crespoi, weibl., Sierra de Monchique. Foto: J. Nerz 8 amphibia, 12(2), 2013
7 Eine herpetologische Winterreise - der Südosten der Iberischen Halbinsel im Dezember dort lebenden Algarve-Feuersalamander Salamandra s. crespoi zu finden. Ein Ausflug auf den höchsten Punkt, die Foia bietet einen traumhaften Ausblick über den Südwestzipfel Europas. Direkt im Gipfelbereich findet man einen kleinen Teich, in dem man mit etwas Glück wiederum Lissotriton maltzanzi beobachten kann. Nach Einbruch der Dunkelheit besuchten wir die Teiche und wurden fündig. Lissotriton maltzani war nicht selten vertreten und auch Pelophylax perezi tauchte immer wieder einmal aus den Tiefen des Gewässers auf. Am nächsten Morgen steuerten wir ein Bachtal umsäumt von einem kleinen Laubwald an, von dem ich Hinweise hatte, dass dort S. s. crespoi vorkommen sollte. Etwas weiter unterhalb des Baches war eine offene Fläche zu finden, z.t. mit Legesteinmäuerchen und einer kleinen Vertiefung im Fels, einer Art kleiner Höhle mit einer wassergefüllten Wanne. In dieser kleinen Wasseransammlung war eine beträchtliche Zahl von Salamanderlarven zu finden. In den Ritzen der Legesteinmauer fand ich das erste adulte Tier, in der folgenden Nacht konnte ich dann 4 weitere erwachsene Tiere ausfindig machen. Es waren sehr schöne große Salamander, vornehmlich schwarz mit relativ kleinen zahlreichen gelben unregelmäßigen Flecken, die zuweilen von der schwarzen Färbung überlagert wurden (Abb. 4). Einzelne Tiere hatten auch im Kopfbereich gewisse Rotanteile, dies war jedoch eher die Ausnahme. Unser letztes Ziel lag wieder ein deutliches Stück weiter östlich, weit ab von der Küste - die Sierra de Aracena. Hier hofften wir eine weitere endemische Salamanderunterart zu finden, den Morena-Feuersalamander Salamandra s. morenica. Die Sierra de Aracena ist ein typischer mediterraner Trockenwald, reich an Pinien. Allerdings werden diese Gebiete zuweilen von kleineren Flüssen durchzogen. Unser Ziel war ein künstlicher Kanal, der früher zur Wasserversorgung diente, heute jedoch trocken gelegt und von Brombeerbüschen zugewuchert ist (Abb. 1 rechts unten). Die Kanalwände wiesen in regelmäßigen Abständen kleine Öffnungen auf, die für kleinere Tiere ein ideales Versteck bieten. Und in der Tat dauerte es nicht lange, bis ich fündig wurde. Unter einem Stein saß ein kleiner Pelophylax perezi und unweit davon, unter einem anderen Stein ein halbwüchsiges Exemplar von Pleurodeles waltl in Landtracht. Beim inspizieren der kleinen Öffnungen fanden sich dicht gedrängt Salamandra s. morenica, Triturus marmoratus und Pleurodeles waltl. Nachts kehrte ich noch einmal in den Kanal zurück und fand insgesamt vier Exemplare von Salamandra s. morenica: zwei Weibchen, ein Männchen und ein halbwüchsiges Exemplar. Es handelt sich bei dieser Unterart um auffallend bunte Tiere mit sehr hohem Rotanteil (Abb. 1 links unten). Einige Tiere, vor allem die Weibchen wiesen einen Rotanteil auf, der genau so groß war wie der Gelbanteil, die Tiere waren regelrecht dreifarbig, rote und gelbe Flecken auf schwarzem Grund. Vor allem im Kopfbereich waren die z.t. Tiere mehr rot als gelb gefärbt. Auch diese Tiere wiesen eher kleine Flecken auf schwarzem Grund auf. Nachdem wir nun trotz anfänglicher Bedenken, zumindest was die Urodelen betrifft letztendlich doch alle Arten der Region nachgewiesen hatten, konnten wir uns getrost wieder auf den Rückweg machen. Insgesamt hatte ich einen sehr guten Eindruck von dem Gebiet. Erfreulich war, dass es dort durchaus noch große, zusammenhängende Naturschutzgebiete bzw. Nationalparks gibt. Dies war auf alle Fälle eine Reise wert. Danksagung: Für wichtige Tips und die Unterstützung bei der Reiseplanung möchte ich mich insbesondere bei Frank Deschandol, Sergé Boagerts, Frank Pasmans und Eike Amtshauer herzlich bedanken. Eingangsdatum: Autor Dr. Joachim Nerz, Jägerstraße Böblingen joachim.nerz@onlinehome.de amphibia, 12(2),
8 Sergé Bogaerts Etwas genauer: Arten, Unterarten und genetische Unterschiede bei Amphibien im Südwesten Iberiens: zwei Beispiele Einleitung Molekulare Untersuchungen sind in den letzten Jahren ein ziemlich haufig genutzter Tool, um Phylogenie und Taxonomy der Amphibien zu untersuchen. Oft unterstützt die molekulare Analyse die Fakten, die bereits aus morphologischen Untersuchungen bekannt waren. Beispielsweise ist die Erdkröte Bufo bufo spinosus durch zwei ausführliche Untersuchungen nur weinige Wochen nach einander publiziert seit Neuerem bestens untersucht (Garcia-Porta et al. 2012, Recuero et al. 2012). Speziell im Südwesten Iberiens gibt es zur Zeit ein Paar Beis- piele unklarem systematischen Status, auch für Anuren oder Reptilien. Ich will an zwei Beispeilen aus der Gruppe der Urodelen zeigen, wie man die Genetik zu neuen systematischen Erkenntnissen nutzt, wobei einige Autoren versuchen es (sich?) einfach zu machen und ich werde ihnen zeigen, warum das nicht überzeugt. Ist Lissotriton maltzani eine eigenstandige Art? Im Jahr 2006 erschien eine spanische Arbeit die zeigte, dass es auf dem Iberischen Halbinsel zwei genetisch zu unterscheide Abb. 1: Salamandra s. gallaica aus der Serra de Grandola (Portugal) Foto: S. Bogaerts 10 amphibia, 12(2), 2013
9 Arten, Unterarten und genetische Unterschiede bei Amphibien im Südwesten Iberiens Gruppen (Linien) des Spanischen Teichmolches ( Lissotriton boscai Lataste, 1879 ) gibt, die warscheinlich lange schon separiert sind, so dass sich möglicher Weise zwei Arten daraus ergeben. Martinez-Solano et al. (2006) schreiben: Our data suggest that lineages A and B have had a long independent evolutionary history and they might constitute different cryptic species. Clearly, however, new data from independent sources are needed to clarify the taxonomic status of these two divergent lineages, and morphological and molecular studies including data on variation in nuclear markers will be particularly helpful in this respect. Obwohl eindeutig darauf hingewiesen wird, dass eine morphologischen Diagnose dieser zwei genetisch unterschiedlichen Gruppen noch aussteht und dringend notwendig noch zu erstellen ist, kommen Dubois & Raffaëlli (2009) zum folgenden Schluss, es sei sehr einfach! The situation is rather simple in the subgenus Meinus (Sie haben auch noch eine neue Untergattung, Subgenus Meinus aufgestellt!). According to Martínez-Solano et al. (2006), a significant geographic variation exists in L. boscai, with two major holophyletic groups in western and central Iberian peninsula, a south-western and a central-northern one. These authors suggested that these two groups deserve recognition as separate species, and we implement this change here, by resurrecting the nomen Triton maltzani Boettger, 1879 for the south-western species. Lissotriton maltzani (new combination) can be distinguished from L. boscai by its smaller size (55-80 mm vs mm) and by its dorsal coloration, which is paler than in boscai, especially in females, with less distinct dark spots. Leider geben beide Autoren nicht an, wieviele Populationen und wieviele Tiere man untersucht hat, um zu diesem grundlegenden Schluss zu den morphologisch winzigen und nicht nachvollziehbaren Unterschieden zu kommen. Damit stellen sie selbst ihre Behauptung in Frage. Auch Speybroeck et al. (2010) erkennen deshalb Lissotriton maltzani nicht als selbständige Art neben Lissotriton boscai an, weil es noch immer keine neuen Untersuchungen gibt. Die Existenz von möglichen Übergangszonen ist bisher nicht untersucht worden. Die Spanische Herpetologische Gesellschaft (AHE) vermerkt in ihrer Lista Patron (Juli, 2011), dass neue Untersuchungsresultate abgewartet werden sollten. Aber mittlerweile wird die Name Lissotriton maltzani Boettger, 1879 (Portugiesischer Teichmolch) doch schon genutzt (Staniszewski 2011). Vielleicht sollte man doch erst nach Übergangszonen suchen und weitere genetische und morphologische Untersuchungen abwarten, bevor man einfach Arten beruft! Wo ist Salamandra salamandra crespoi verbreitet? Im Südwesten von Iberien leben drei Unterarten von Feuersalamandern. Der Algarve-Feuersalamander Salamandra s. crespoi Malkmus,1983 (Algarve, Portugal), Portugiesischer Feuersalamander Salamandra s. gallaica Seoane, 1884 und der Morena-Feuersalamander Salamandra s. morenica Joger & Steinfartz, S. s. crespoi und S. s. morenica sind eng miteinander verwandt und möglicher Weise ein und dieselbe Unterart (siehe Steinfartz 2000). Als Grenze der beiden Unterarten wird in vielen Publikationen der Fluss Rio Guadiana angegeben, der zufällig auch die Landesgrenze zwischen Portugal und Spanien ist. Wenn man aber die Tiere an beiden Seiten des Flusses miteinander vergleicht, sehen sie sehr ähnlich aus. Ist der Fluss den wirklich ein Barriere? Das müssen genauere Untersuchungen klarstellen. Leider haben sich Reis et al (2011) in Ihren Paper wieder nur durch die nationalen Grenzen leiten lassen und sich nur mit portugesischen Proben beschäftigt. S. s. morenica wird daher gar nicht genannt. Es würde aber interessant sein zu untersuchen, wo S. s. crespoi und S. s. morenica sich treffen oder ob es einfach nur eine Unterart ist? Schon Garcia-Paris et al. (2003) zeigen, dass die Populationen von Santiago do Cacém genetisch zu crespoi gehören. Das ist schon deshalb interessant, weil in der ursprünglichen amphibia, 12(2),
10 Sergé Bogaerts Beschreibung der Unterart S. s. crespoi von Malkmus (1983) oder in seiner klassichen Arbeit zu morphologischen Unterschieden zwischen den verschiedene Populationen (Malkmus 1991) lesen kann, dass die Tiere sehr gallaica -artig aussehen. Eine Kombination von morphologischen Arbeiten und genetischen Analysen würde dabei sehr interessant sein, stehen aber noch aus. In ihrem (Reis et al. 2011) Beitrag über die phylogenetische Verwantschaft des Feuersalamanders Salamandra salamandra im Süden Portugals wird aber nur auf genetischer Grundlage die Verbreitung von S. s. crespoi nach Norden entlang der südwestportugesischen Küste (wie schon bei Garcia-Paris et al. 2003) eingegangen. Dabei haben Reis et al. (2011) aber genau aus dieser Gegend nur sehr wenig Proben. Die Arbeiten von Malkmus (1983, 1991) werden nicht genannt oder genutzt. Genetik wird hier wieder einfach als einzigen Tool vorgestellt, um die Unterartverbreitung zu unterbauen. Aber jeder, der sich ein Tier aus dieser Gegend ansieht weiss, dass es keinem S. s. crespoi sondern ein S. s. gallaica ist (Abb. 1)! Und daher bringt diese Arbeit eigentlich gar nicht viel Neues, oder? Ja, wir erfahren etwas über den genetischen Austausch aber die morphologischen Unterschiede bleiben außen vor eigentlich schade! Es gibt aber zwei schöne Beispiele wobei mann schon zeigt das Genetik und Morphologie nicht immer überein stimmen. Babik et al (2005) zeigen das für Lissotriton vulgaris und Lissotriton montandoni und für Triturus karelinii und Triturus macedonicus fand Wielstra (2012) ähnliche Verhältnisse. Zum Schluss Man sollte doch ein bisschen vorsichtig sein mit schnellen Änderungen von taxonomischen Namen oder der Verbreitung von Unterarten. Für jeden, der sich mit Fotografie oder der Haltung und Vermehrung von Terrarientieren beschäftigt, sollten die Herkunft und die systematische Zuordnung seine Pfleglinge von größter Bedeutung sein. Gleiches gilt für die Dokumentation der Beobachtungen bei der Arbeit im Gelände. Literatur Babik, W., Branicki, W., Crnobrnja-Isailovic, J., Cogalniceanu, D., Sas, I., Olgun, K., Poyarkov, N.A., Garcia-Paris, M. & J.W. Arntzen (2005). Phylogeography of two European newt species - discordance between mtdna and morphology. - Molecular Ecology 14: Carretero, M.A., Ayllón, E. & G. Llorente (Comisión permanente de taxonomía de la AHE) (2011): Lista patrón de los anfibios y reptiles de España (Actualizada a julio de 2011) Dubois, A. & J. Raffaëlli (2009). A new ergotaxonomy of the family Salamandridae Goldfuss, 1820 (Amphibia, Urodela). - Alytes 26(1-4): Garcia-Paris, M., Alcobendas, M., Buckley, D. & D.B. Wake (2003): Dispersal of viviparity across contact zones in Iberian populations of fire salamanders (Salamandra) inferred from discordance of genetic and morphological traits. - Evolution 57(1): Malkmus, R. (1983): Beschreibung einer neuen Form des Feuersalamanders aus der Serra de Monchique/Portugal: Salamandra salamandra (gallaica) crespoi n. subsp. Faunistische Abhandlungen aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden 10: Malkmus, R. (1991): Einige Bemerkungen zum Feuersalamander Portugals (Salamandra salamandra gallaica Komplex; Amphibia, Orodela, Salamandridae) Zoologische Abahndlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden 46(11) : Martínez-Solano, I., Teixeira, J., Buckley, D. & M. García-París (2006): Mitochondrial DNA phylogeography of Lissotriton boscai (Caudata, Salamandridae): evidence for old, multiple refugia in an Iberian endemic. - Molecular Ecology 15: Montori, A., Llorente, G.A., Alonso-Zarazaga, M.A., Arribas, O., Ayllón, E., Bosch, J., Carranza, S., Carretero, M.A., Galán, P., García-París, M., Harris, D.J., Lluch, J., Márquez, R., Mateo, J.A., Navarro, P., Ortiz, M., Pérez Mellado, V., Pleguezuelos, J.M., Roca, V., Santos, X. & M. Tejedo (2005): Lista patrón actualizada de la herpetofauna española - Conclusiones de 12 amphibia, 12(2), 2013
11 Arten, Unterarten und genetische Unterschiede bei Amphibien im Südwesten Iberiens nomenclatura y taxonomía para las especies de anfibios y reptiles de España. AHE (ed.) Barcelona. 48 pp., ISBN: Garcia-Porta. J., Litvinchuk, S.N., Crochet, P.A., Romano, A., Geniez, P.H., Lo-Valvo, M., Lymberakis, P. & S. Carranza (2012): Molecular phylogenetics and historical biogeography of the west-palearctic common toads (Bufo bufo species complex). - Molecular Phylogenetics and Evolution 63(1): Recuero, E., Canestrelli, D., Vörös, J., Szabó, K., Poyarkov, N.A., Arntzen, J.W., Crnobrnja-Isailovic, J., Kidov, A.A., Cogălniceanu, D., Caputo, F.P., Nascetti, G. & I. Martínez-Solano (2012): Multilocus species tree analyses resolve the radiation of the widespread Bufo bufo species group (Anura, Bufonidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution 62(1): Reis, D.M., Cunha, R.L., Patrao, C., Rebelo, R. & R. Castilho (2011): Salamandra salamandra (Amphibia: Caudata: Salamandridae) in Portugal: not all black and yellow. - Genetica 139(9): Speybroeck, J., Beukema, W. & P.-A. Crochet (2010): A tentative species list of the European herpetofauna (Amphibia and Reptilia) an update. - Zootaxa 2492: Staniszewski, M. (2011): Salamander und Molche Europas, Nordafrikas und Westasiens. Edition Chimaira, Frankfurt am Main. Wielstra, B. (2012). Tracing Triturus through time: Phylogeography and spatial ecology. - Dissertation. ITC dissertation number 212. ITC, P.O. Box 6, 7500 AA Enschede, Netherlands ISBN science.naturalis.nl/media/348411/wielstra thesis.pdf Eingangsdatum: Autor Sergé Bogaerts Lupinelaan 25 NL 5582CG Waalre Niederlande s-bogaerts@hetnet.nl Abb. 2: Lissotriton maltzani, Männchen aus der Serra de Monchique, Algarve, Portugal. Foto: S. Bogaerts amphibia, 12(2),
12 Magdalena Meikl & Julia Schauer Bestandsaufnahme von Feuer- und Alpensalamandern in Österreich Das Alpensalamanderprojekt erforscht mit Schulen die aktuelle Verbreitung und Gefährdung von Feuer- und Alpensalamandern in Österreich und will dadurch Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen. Alpen- und Feuersalamander Sie lieben verregnete Sommer und haben schon die eine oder andere Bauernregel übers Sauwetter inspiriert. Jeder in der Alpenregion kennt die Alpen- und Feuersalamander, jedoch wissen wir nur sehr wenig über ihr genaues Verbreitungsgebiet, ihr Leben und wie es um die drolligen Lurche bestellt ist. Der Alpensalamander (Salamandra atra) ist ein ca cm großer, lackschwarzer Salamander, der bei uns auch unter dem Namen Wegnarr, Wegmandl oder Hölldeixl bekannt ist. Er lebt hauptsächlich in den Alpen in Höhenlagen von Meter. Alpensalamander bringen bereits fertig entwickelte Jungtiere zur Welt und brauchen daher im Gegensatz zu anderen Amphi- bien kein Gewässer. Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) ist durch seine spektakuläre schwarz-gelb Färbung sicherlich der bekannteste Lurch in Europa. Feuersalamander werden bis zu 20 cm groß und über 15 Jahre alt. Außergewöhnlich ist auch die Art der Fortpflanzung: ein Weibchen setzt pro Jahr bis zu 80 Larven ab, die dann in kleinen Bächen oder Quellgewässern zu landlebenden Salamandern heranwachsen. Der typische Lebensraum des Feuersalamanders sind Laubmischwälder (meist Buchenwälder) mit kleineren Fließgewässern. Beide Salamanderarten leben sehr versteckt in Ritzen, Erdspalten oder Höhlen, die sie nur in der Nacht oder bei sehr feuchtem, regnerischem Wetter verlassen (Böhme et al. 2003). Das Projekt: Alpen- und Feuersalamander stehen in Österreich auf der Roten Liste der bedrohten Tiere und sind streng geschützt. Gefahren für die Salamander sind die Zerstö- Abb. 1: Alpensalamander. Foto: R. Schwarzenbacher 14 amphibia, 12(2), 2013
13 Bestandsaufnahme von Feuer- und Alpensalamandern in Österreich Abb. 2: Feuersalamanderweibchen. Foto: M. Meikl rung ihrer Lebensräume durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, Ausbau von Schigebieten, Straßenbauten, Flussregulierungen und Trockenlegung von Flächen. Untersuchungen zum Lebensraum und zur Ökologie der Salamander, sowie Maßnahmen zum Schutz haben daher höchste Priorität. Obwohl Alpen- und Feuersalamander eine große Rolle in unserem Ökosystem spielen, fehlen aktuelle wissenschaftlich Studien über Verbreitung, Habitat und Lebensweise in Österreich. Aus diesem Grund hat ein Forschungsteam der Universität Salzburg im Juli 2009 die Website gegründet, um mit Hilfe der Öffentlichkeit das Verbreitungsgebiet der Salamander in Österreich festzustellen. Wenn jeder die Salamander, die er gesehen hat, auf einer Google-Maps Karte einträgt, bekommt man so ein genaues Verbreitungsgebiet der Salamander. Denn nur wenn man das genaue Verbreitungsgebiet dieser Tiere kennt, kann man Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen. Mittlerweile hat sich dieses Projekt im ganzen Land schon sehr gut etabliert und die Website ist mit über 8000 Einträgen (ständig steigend) mehr als erfolgreich. Eine aktuelle Verbreitungskarte für beide Salamander ist jederzeit für jeden abrufbar. Basierend auf diesen Daten können nun weitere Projekte (Monitoring, Umweltbildung etc.) durchgeführt werden. Alpen- und Feuersalamander in den Schulen Die Sparkling Science-Initiative des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung hat uns auf die Idee gebracht, das Projekt in die Schulen zu tragen und auch Kinder einzubinden. Das erste Sparkling Science Projekt Alpensalamander startete im September 2010 mit 30 Schulen (Volks- und Hauptschulen, Gymnasien) im ganzen Land Salzburg. Die Schulen wurden im Frühjahr 2011 besucht und durch Workshops und Ausstellungen wurden den SchülerInnen verschiedenste Bereiche näher gebracht: die Biologie der Salamander, Amphibienschutz, Umgang mit Google-Maps, Sammlung von wissenschaftlichen Daten. Viele Schulen nutzten auch die Möglichkeit, in die Laborarbeit hinein zu schnuppern und selbst eine Salamander-DNA-Extraktion zu machen. Weitere Teile waren Exkursionen und Feldforschung mit den Schulen in ihren Heimatorten, um die Salamandervorkommen vor Ort zu überprüfen. Bis zum Projektende im August 2012 wurden die gesammelten Daten zusammen mit den SchülerInnen ausgewertet. Außerdem wurden gemeinsam mit den SchülerInnen einige Aktivitäten durchgeführt, um auf die Salamander und ihre Gefährdung aufmerksam zu machen. Das waren unter anderem 2 Theaterstücke, 2 Beiträge im Fernsehen beim ORF Salzburg Heute, ein Lehrpfad, der entlang eines Wanderweges aufgestellt wird, und amphibia, 12(2),
14 Magdalena Meikl & Julia Schauer Trickfilme. Nachdem dieses erste Sparkling Science Projekt mehr als erfolgreich lief, wurde auch das 2. Projekt Alpensalamander II bewilligt. Dieses läuft nun wieder für 2 Jahre mit insgesamt 25 Schulen. Zu den 10 Schulen, die schon seit 2010 beim Projekt dabei sind, kommen 8 neue in Österreich und zusätzlich noch 3 Schulen in Spanien und 4 in Italien dazu. Die Zusammenarbeit mit internationalen Schulen und Partnern macht dieses Projekt besonders interessant, da es dort Unterarten von Alpen- und Feuersalamander gibt, die in einem völlig anderen Lebensraum vorkommen und teilweise auch stark gefährdet sind. Die Hauptziele beider Projekte sind die Bestandsaufnahme der aktuellen Alpenund Feuersalamanderpopulationen in Österreich und Europa, die Erfassung der historischen Entwicklung der Alpen- und Feuersalamander in den letzten 50 Jahren und die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für den Amphibienschutz durch Sensibilisierung und Einbindung der Jugend. Durch Interviews der SchülerInnen mit ihren Eltern, Großeltern, Bergsteigern, Bauern und Jägern kann der historischen Entwicklung der Alpen- und Feuersalamander in den letzten 50 Jahren noch besser nachgegangen werden. Für die Schulen, die nun schon Salamanderexperten sind, wird das gezielte Monitoring von Salamanderlarven eine besondere Aufgabe im neuen Projekt sein. Außerdem werden diese SchülerInnen den Lebensraum rund um ihre Heimatorte und andere geschützte Tierarten besonders genau kennenlernen. Das Projekt strebt eine langfristige Partnerschaft mit den Schulen an, denn die Einbindung der SchülerInnen in Erforschung und Konzeption von Schutzmaßnahmen für die Salamander ist der aussichtsreichste Weg für eine nachhaltige Umsetzung. Projektfortschritt und aktuelle Veranstaltungen können auf verfolgt werden. Literatur Böhme, W., Thiesmeier B. & K. Grossenbacher (Hrsg.) (2003): Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Feuersalamander. - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Bd.4/2B: Schwanzlurche (Urodela) IIB: Meikl, M., Reinthaler-Lottermoser U., Weinke E. & R. Schwarzenbacher (2010): Collection of Fire Salamander (Salamandra salamandra) and Alpine Salamander (Salamandra atra) distribution data in Austria using a new, community based approach. - eco.mont 2(1): Schauer J., Meikl M., Gimeno, A. & R. Schwarzenbacher (2012): Larval monitoring of fire salamanders within a Sparkling Science Project. - eco.mont 4(2): Eingangsdatum: Abb. 3: Kinder auf einer Salamanderexkursion. Foto: M. Meikl Autoren Magdalena Meikl & Julia Schauer Organismische Biologie Universität Salzburg Hellbrunnerstrasse 34 A-5020 Salzburg, Austria Kontakt- magdalena.meikl@stud. sbg.ac.at 16 amphibia, 12(2), 2013
15 Joachim Nerz Alpensalamander Salamandra atra und Lanzas Alpensalamander Salamandra lanzai - ähnlich, aber nicht gleich Einleitung Lange Zeit wurden alle lackschwarz glänzenden Salamander in Europa, vor allem wenn sie dann auch noch in montanen oder alpinen Habitaten vorkommen, einer Art - dem Alpensalamander zugeordnet. Bis Mitte der 1980er Jahre war damit die taxonomische Zuordnung mehr als einfach. Immer mal wieder kamen Vermutungen auf, dass auf der schwäbischen Alb Alpensalamander gesichtet wurden; zwar ungewöhnlich, aber man konnte es nicht ganz ausschließen. Der Untergrund ist dort zumeist, wie in den bevorzugten Habitaten der Alpen Kalk und auch die Habitate ähneln zuweilen (Buchenmischwälder, bzw. offene mit Gebüsch besetzte kühle Wiesen). Auch in der Botanik lassen sich durchaus typische alpine Elemente auf der Schwäbischen Alb finden, wie z.b. die Kugelorchis (Traunsteinera globosa). Allerdings hat es sich bei den Salamandern bei genauerer Betrachtung herausgestellt, dass es sich hierbei nicht um Alpen- salamander handelt, sondern um gänzlich bzw. fast gänzlich schwarze (melanistische) Exemplare des uns wohl bekannten Feuersalamanders (Salamandra s. terrestris). Dabei handelt es sich um eine Laune der Natur dass man bei Salamandra salamandra komplett schwarze Tiere findet (Nöllert & Nöllert 1992). Alpensalamander Salamandra atra Laurenti, 1768 Ansonsten ist der Alpensalamander mehr oder weniger homogen entlang der Alpen, vor allem im nördlichen Teil zu finden (Abb. 2). Verbreitungslücken finden sich vor allem am Südrand der Alpen. Hier sind die Habitate wahrscheinlich einfach zu trocken für die Salamander oder der Untergrund sagt den Tieren nicht zu. S. atra ist nur sehr selten außerhalb von Gebieten mit Kalkuntergrund zu finden. Aufgrund seines relativ großen Verbreitungsgebietes, welches sich von der Schweiz im Westen Abb. 1: Hügelkette, Areal von S. a. aurorae. Foto: J. Nerz amphibia, 12(2),
16 Joachim Nerz 18 amphibia, 12(2), 2013
17 Alpensalamander Salamandra atra und Lanzas Alpensalamander Salamandra lanzai Abb. 2: Verbreitung von Salamandra atra und S. lanzai (verändert nach mehreren Autoren). amphibia, 12(2),
18 Joachim Nerz Abb. 3: Alpensalamander, oben links S. a. atra und oben rechts typisches Habitat am Schachen, Mitte oben links S. a. aurorae und rechts Habitat in der Region um Bosco del Dosso, Mitte unten links S. a. pasubiensis und rechts Typushabitat im Pasubiogebirge, unten links Salamandra lanzai Pian del Re und unten rechts Habitat, Pian del Ré. Fotos: J. Nerz 20 amphibia, 12(2), 2013
19 Alpensalamander Salamandra atra und Lanzas Alpensalamander Salamandra lanzai über Deutschland und Österreich bis hin nach Slowenien und Herzegowina und sogar bis in den nördlichen Teil Albaniens erstreckt, ist die Nominatform Salamandra atra atra Laurenti, 1768 nicht wirklich selten. In Deutschland ist der Alpensalamander im Wesentlichen auf die alpinen Gebiete Bayerns beschränkt, in Baden Württemberg findet man Alpensalamander lediglich in der Region der allerletzten Alpenausläufer in der Region um Adelegg (Laufer et al. 2007). Da sich die meisten Habitate jedoch in den per sé schon geschützten Gebieten der Alpenhochlagen befinden, scheint diese Art derzeit nicht wirklich gefährdet zu sein. S. a. atra ist im Anhang II des Washingtoner Artenschutzabkommens geführt. Ganz anders sieht es mit den anderen Unterarten des Alpensalamanders aus, deren Gebiete sich auf den südlichen Verbreitungsrand der österreichischen bzw. italienischen Alpen beschränken. Diese Unterarten sind auf ein winziges Areal beschränkt: Salamandra atra aurorae Trevisan, 1982 (Abb. 3 Mitte oben links) und Salamandra atra pasubiensis Bonato & Steinfartz, 2005 (Abb. 3 Mitte unten links). Die wohl auffälligste Form des Alpensalamanders ist die Unterart S. a. aurorae. Hierbei handelt es sich um einen golden gefärbten Salamander. Es handelt sich hierbei um ausgesprochen attraktiv gefärbte Tiere (vgl. Abb. 3 Mitte oben links). Auch aufgrund ihrer Lebensweise ist diese Form ungewöhnlich. Das Vorkommen von S. a. aurorae ist auf einen winzigen Höhenzug von ca km Länge beschränkt (in Abb. 1 ist fast schon das gesamte Areal zu sehen), der etwas südlich der Alpen gelegen ist und eine Höhe am Grat von maximal ca m aufweist. Dies schlägt sich natürlich auch in den Habitaten nieder; so bevorzugt der Goldene Alpensalamander mesotrope Laubmischwälder (Abb. 3 Mitte oben rechts), die auf tiefgründigen Kalkgeröllschichten wurzeln; in diesen Geröllfeldern können sich die Salamander bei ungünstiger Witterung tief zurückziehen. Gerne scheinen sich die Tiere auch in der feuchten Umgebung entlang der Bachtäler aufzuhalten. Nadelwälder werden meist gemieden. Man geht davon aus, dass es sich bei dieser auffälligen Population in der Region des Bosco del Dosso um ein Reliktvorkommen handelt Parallelen finden sich in der Insektenwelt dieser Region) (Sindaco et al. 2009). in jüngster Vergangenheit wurde ein weiterer reliktärer Vertreter der Alpensalamander aus dem Pasubio-Gebirge beschrieben, welches sich lediglich ca. 60 km weiter südlich vom Habitat von S. a. aurorae befindet. Wie so oft spielte bei der Endedeckung dieses interessanten Tieres der Zufall eine große Rolle. Ein Wanderer wurde in diesem Gebiet auf einen Alpensalamander aufmerksam und beschrieb es einem befreundeten Herpetologen. Dieser wurde hellhörig, ist der Sache nachgegangen und in der Tat wurde er fündig, eine neue Form des Alpensalamanders wurde beschrieben: Pasubio-Alpensalamander Salamamdra atra pasubiensis Bonato & Steinfartz, Was zeichnet nun diese Art aus? Zum einen ist auch hier das Vorkommen auf einen Gebirgsstock beschränkt, der doch deutlich südlich vom eigentlichen Höhenzügen der Alpen gelegen ist. Zum anderen handelt es sich auch hier wieder um Tiere, die oftmals eine auffällig gelbe Fleckung auf schwarzem Grund aufweisen (Abb. 3 Mitte unten links). Die Fleckung ist jedoch lange nicht so stark ausgeprägt wie bei S. a. aurorae. Die Fleckung ist meist am ausgeprägtesten in der vorderen Hälfte des Körpers. Bei einer gemeinsamen Exkursion im Jahr 2011 mit Laura Tiemann und Sebastian Voitel stellten wir fest, dass die meisten Tiere entweder vollkommen schwarz gefärbt waren, ähnlich der Nominatform oder aber nur sehr spärlich mit einem einzigen winzigen gelben Fleck geziert. Lediglich ein einziges männliches Tier mit starker Gelbfleckung konnten wir beobachten (Abb. 3 Mitte unten links). Bis heute ist lediglich ein einziges Tal im Pasubio-Gebirge in einer Höhe von ca m NN bekannt, wo die Tiere gefunden worden sind. Die Alpensalamander bevorzugen dort meist offene Flächen mit größeren Geröllhalden bzw. Gelände mit Grasmatten (Abb. 3 Mitte un- amphibia, 12(2),
20 Joachim Nerz ten rechts). Ein Großteil des Gebiets ist aufgrund der steilen Geröllhalden recht schwer zugänglich. Nicht unerwähnt lassen möchte ich eine Beobachtung unserer Exkursion: so konnten wir das prächtigste Tier unter einem flachen Stein beobachten, den wir wenige Stunden zuvor schon einmal erfolglos inspiziert hatten, d.h. die Tiere sind auch tagsüber im Untergrund durchaus aktiv. Da das Habitat von S. a. pasubiensis weitab von befahrbaren Wegen ist, scheint die kleine bekannte Population heute ausreichend geschützt vor Habitatsveränderungen zu sein. Über die Phylogenie der Alpensalamander wird derzeit noch intensiv gearbeitet (Bonato & Steinfartz 2005). Nicht unerwähnt lassen möchte ich noch eine isolierte Population vom südöstlichen Rand des Gebietes in Montenegro; im Cvrinsca- und im Prenj-Gebirge findet man isolierte Populationen von S. atra. Wie die Nominatform sind auch diese Tiere alle komplett schwarz gefärbt und auch sonst sowohl morphologisch noch moleklarbiologisch kaum bis gar nicht unterscheidbar von S. a. atra. Die Tiere aus dieser Region wurden 1969 als eigene Unterart, der Bosnische Alpensalamander Salamandra atra Abb. 4: Unterschiede zwischen S. lanzai (links) und S. a. atra (rechts) an Kopf, Rücken (man beachte die fehlende dorsale Drüsenleiste bei S. lanzai) und Schwanz. Fotos: J. Nerz 22 amphibia, 12(2), 2013
21 Alpensalamander Salamandra atra und Lanzas Alpensalamander Salamandra lanzai prenjensis Miksic, 1969 beschrieben, allerdings wird der Status als Subspecies von den meisten Autoren heutzutage angezweifelt. Lanzas Alpensalamander Betrachten wir aber nun noch eine andere disjunkte Population der schwarzen Salamander, diesmal nicht ganz im Osten sondern ganz im Westen. Östlich von Turin erheben sich die Cottischen Alpen und der Monteviso, ein relativ isolierter Gebirgsstock mit wunderschönen Gebirgslandschaften und einem Gipfel, dem Monteviso, der sich 3841 m majestätisch über die Meereshöhe erhebt. Auch hier finden wir einen Untergrund aus Kalk vor, also an sich ein perfektes Habitat für die Alpensalamander (Abb. 3 unten rechts). Allerdings liegt das Gebiet doch deutlich südwestich vom eigentlichen Alpenkamm (Grossenbacher 2004, Guex & Grossenbacher 2004). Die dort lebenden Salamander sind zwar genau so schön lackschwarz glänzend, genau so agil wie unsere Alpensalamander und bewohnen auch ähnliche Habitate (Abb. 3 unten rechts). Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass die Tiere doch meist deutlich größer und kräftiger gebaut sind (Abb. 3 unten links). Erst 1988 wurde Lanzas Alpensalamander in den Artstatus erhoben (Salamandra lanzai Nascetti, Andreona, Capula & Bullini, 1988). Die dorsale Drüsenreihe fehlt bei diesen Tieren. Der Kopf ist insgesamt flacher (Abb. 4). Die Schwanzspitze ist rund und nicht spitz wie beim Alpensalamander. Der Schwanz ist auch länger. Molekularbiologische Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Tiere weniger mit Salamandra atra als vielmehr mit Salamandra corsica verwandt sind. Ähnlich unserem Alpensalamander ist auch S. lanzai vollmolchgebärend, ein Phänomen, das man zumindest in der Familie der echten Salamander ansonsten kaum kennt. Diese Strategie wird von beiden Arten, sowohl S. atra als auch S. lanzai verfolgt. Dies ist einfach die sicherste, wenn nicht die einzige Möglichkeit, den Nachwuchs unter diesen rauhen Umweltbedingungen auf Dauer zu sichern. Und wie die oftmals hohe Individuendichte beider Arten beweist, hat diese protektive Weise, für den Nachwuchs zu sorgen durchaus Erfolg. Eine konvergente Entwicklung beider Arten ist hier denkbar. Literatur Bonato, L. & S. Steinfartz (2005): Evolution of the melanistic colour in the Alpine salamander Salamandra atra as revealed by a new subspecies from the Venetian Prealps. - Ital. J. Zool., 72, Laufer, H., Fritz, K., & P. Sowig (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden Württembergs. - Ulmer-Verlag, Stuttgart. Nascetti, G., Andreone, F., Capula, M. & L. Bullini (1988): A new Salamandra species from southwestern Alps. - Boll. Mus. reg.sci.nat.torino 6: Nöllert, A. & C. Nöllert (1992): Kosmos Naturführer - Die Amphibien Europas. - Franck-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart. Sindaco, R., Giuliano, D., Razzetti, E. & F. Bernini (2009): Atlante degli Anfibi e dei Rettili d Italia - Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. - Edizioni Polistampa, Firenze. Guex, G.D. & K. Grossenbacher (2004): Salamandra atra Laurenti, Alpensalamander. S In: Thiesmeier, B & K. Grossenbacher: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. - Band 4/IIB Schwanzlurche IIB, AULA-Verlag, Wiebelsheim. Grossenbacher, K. (2004): Salamandra lanzai Nascetti, G, Andreone, F, Capula, M und L. Bullini, Lanzas Salamander. S In: Thiesmeier, B. & K. Grossenbacher: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. - Band 4/ IIB Schwanzlurche IIB, AULA-Verlag, Wiebelsheim. Eingangsdatum: Autor Dr. Joachim Nerz, Jägerstraße Böblingen joachim.nerz@onlinehome.de amphibia, 12(2),
22 Catrin Grollich Beobachtungen zur Geburt und Aufzucht eines zweiköpfigen Feuersalamanders Im Jahr 2003 erwarb ich aus einer langjährigen Terrarienzucht Jungtiere vom Feuersalamander (Salamandra s. terrestris). Ich pflegte die Gruppe in einem 80 x 40 cm großen Flachterrarium. Der Bodengrund bestand aus Lehmerde und Pinienrinde, darauf lagen Moos, Rindenstücke und Steinaufbauten als Unterschlupf. Eine flache Wasserschale aus Ton steht den Weibchen zum Absetzen der Larven zur Verfügung. Die Temperaturen im Kellerraum, wo das Terrarium steht, betrugen im Winter ca C. Sie steigen in den Sommermonaten auf 18 bis maximal 20 C an. Durch den Lichtschacht des Kellerfensters ist der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus für die Tiere wahrnehmbar. Da die Temperaturen für eine Winterruhe nicht tief genug sinken, verbringen adulte Salamander ca. acht Wochen in einem Kühlschrank bei 5 Grad. Nach der Winterruhe begannen die Weibchen im April/Mai 2011 mit dem Absetzen der Larven. Dabei wurde die zweiköpfige Larve am geboren. Zu diesem Zeitpunkt war sie genauso groß wie ihre Geschwister. Zur besseren Beobachtung und zum Schutz vor etwaigen Verbissen wurde dieses Tier von den anderen separiert in einem Flachwasseraquarium aufgezogen. Von Anfang an fraß die Larve mit beiden Köpfen, war agil und vom Abb. 1: Larve 15 Wochen. Foto: C. Grollich 24 amphibia, 12(2), 2013
23 Beobachtungen zur Geburt und Aufzucht eines zweiköpfigen Feuersalamanders Abb. 2: Übersicht zur Entwicklung, oben links 9 Wochen, oben rechts 12 Wochen, Mitte links Beginn der Metamorphosephase mit 15 Wochen, Mitte rechts 15 Wochen, unten links 6 Monate, unten rechts Salamander 15 Monate im Vergleich mit den Geschwistertieren. Fotos: C. Grollich amphibia, 12(2),
24 Catrin Grollich Verhalten im Wasser unauffällig. Auch das Wachstum war gleich dem seiner Geschwister. Diese gingen nach ca. acht bis neun Wochen an Land. Das zweiköpfige Tier begann sich erst mit neun Wochen umzufärben, blieb dann aber trotz gleicher Haltungsbedingungen deutlich länger im Wasser und verließ es erst nach 15 Wochen mit einer Gesamtlänge von 6 cm. Die Fortbewegung an Land gestaltete sich nach der Metamorphose für das Tier recht schwierig. Es hatte den Anschein, dass jeder Kopf mit seinen eigenen Willen, bedingt durch die verschiedenen Blickrichtungen und die daraus resultierenden Handlungen, durchzusetzen versuchte. Nach einigen Wochen wurde das Gangbild koordinierter, wobei der Salamander meist nur einige Schritte nacheinander setzte und die Richtung häufig änderte. Im Vergleich zu seinen Geschwistern bewegte er sich insgesamt deutlich weniger. Das Futter wurde anfangs ganz gezielt mit einer Pinzette vorgehalten. Beide Köpfe fraßen weiterhin, bei Angebot sogar gleichzeitig. Diese Art der Fütterung blieb auch später größtenteils bestehen um sicher zu gehen, dass der Salamander ausreichend Nahrung bekommt. Schwierigkeiten traten regelmäßig bei den Häutungen des Salamanders auf. Dieser konnte sich, nachdem die alte Haut über beide Köpfe bis zur Schulter abgestriffen war, nicht selbst weiter davon befreien. Deshalb mussten die beiden so entstandenen Rollkragen stets von der Hand des Pflegers geöffnet werden. Im weiteren Verlauf blieb das Wachstum des Salamanders deutlich hinter dem seiner Geschwister zurück. Die Rumpflänge erschien verkürzt (Abb. 3). Leider verstarb das Tier im Alter von 19 Monaten und einer Körperlänge von 7,5cm während der Winterruhe. Eingangsdatum: Autor Catrin Grollich Syrauer Str.13 a Plauen Abb. 3: Salamander 12 Monate. Foto: C. Grollich 26 amphibia, 12(2), 2013
25 Joachim Nerz Olme - eigenwillige Schwanzlurche mit seltsamer Verbreitung Die Familie der Olme besticht nicht gerade durch ihren Artenreichtum; in den USA sind 5 Arten der Gattung Necturus anzutreffen, in Europa lediglich eine Art aus der Familie, nämlich die Olme im eigentlichen Sinne, Gattung Proteus. Dennoch sollte man diese Familie nicht vernachlässigen, denn in vielerlei Hinsicht handelt es sich hierbei doch um ausgesprochen spannende und ungewöhnliche Tiere; nicht nur, daß alle Vertreter dieser Familie obligat neoten sind, der bekannteste Vertreter, unser Europäischer Olm -Proteus anguinus- hat sich sogar vollständig an eine troglodytische Lebensweise in Höhlen angepasst. Verbreitung und Abstammung Und hier sind wir schon beim nächsten spannenden Punkt, ähnlich wie bei den Europäischen Höhlensalamander der Gattung Speleomantes, hat auch diese Familie eine ausgesprochen disjunkte Verbreitung, so bewohnen die Necturus-Arten den östlichen Teil der USA, wohingegen Proteus in den Höhlen des Südöstlichen Europas zu finden ist, vornehmlich in Slowenien und Kroatien. Wie diese disjunkte Verbreitung zu erklären ist, liegt noch völlig im Dunkeln, so dass dies derzeit genügend Raum für Spekulationen bietet. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei der Familie der Proteidae um eine recht altertümliche Familie handelt, deren Ahnen bereits Ende des Jura, Anfang der Kreide vor über 60 Millionen Jahren anzutreffen waren. Zu dieser Zeit existierte noch der zusammenhängende Urkontinent Laurasia, wobei sich erst während des Eocän vor ca Millionen Jahren der amerikanische vom europäischen Kontinent endgültig trennte, was die seltsame Verbreitung der heutigen Proteide erklären könnte. Zu dieser Zeit existierte noch eine weitere Familie, die geheimnisvollen Batrachosauroididae, deren genauen Verwandtschaftsbeziehungen bis heute ungeklärt sind, man vermutet jedoch stark, dass es sich dabei um eine Familie handelt, die den Olmen, den Proteidae recht nahe gestanden hat. Dies läßt bereits die Namensgebung einiger Vertreter dieser Familie, z.b. die Gattung Paleoproteus vermuten; und in der Tat handelt es sich um Tiere, die mit ihrer langgestreckten Körperform und der vermuteten aquatischen und wahrscheinlich neotenen Lebensweise dem heutigen Proteus anguinus schon deutlich ähnelten. Allerdings handelte es sich hierbei noch um Tiere, die aus Schichten bekannt sind, die vermuten lassen, dass diese oberirdisch in Sümpfen lebten, und eine ähnliche Lebensweise führten, wie die heutigen Amphiumidae und Sirenidae, die ja mit ihrer aalartige Gestalt an solche Lebensräume angepasst sind. Von einer Art, Paleoproteus klatti wurde ein erstaunlich gut erhaltenes Skelett aus dem Eocän gefunden, Fundort war das Geiseltal in Sachsen-Anhalt. Gattung Necturus Zurück zu den rezenten Olmartigen. Beginnen wir mit Necturus, derzeit sind 5 Arten anerkannt, Necturus maculosus, N. beyeri, N. alabamensis, N. lewisi und Necturus alabamensis; wobei Necturus maculosus die größte Art ist und auch das größte Verbreitungsgebiet aufweist, das sich über große Teile des östlichen Nordamerikas erstreckt. Dies ist auch die einzige Necturus-Art, die sich aus dem Flachland ein wenig weiter nach oben in s Hügelland vorwagt. Dort bewohnt sie dann in der Regel Flüsse und amphibia, 12(2),
26 Joachim Nerz große Seen. In Tennessee, am südlichen Verbreitungsrand konnten wir diese Art in einem breiten Flußabschnitt, der jedoch recht flach war beobachten (Abb. 1 oben links). Dort lebt die Art im kühlen, langsam fließenden und klaren Wasser unter flachen Steinen. Im gleichen Habitat war auch der in der Zwischenzeit recht selten gewordene amerikanische Riesensalamander Cryptobranchus alleganiensis zu finden. Auffallend war, daß die Necturus cf. maculosus (Abb. 1 Mitte links), die dort vorkommen, eher etwas kleiner und stark gefleckt sind, verglichen zu typischen Vertretern dieser Art, die weiter im Norden zu finden sind. Auch sind aufgrund der Lebensweise im Fließgewässer die äußeren Kiemen nur relativ schwach ausgebildet. Insgesamt zeigte diese Form gewisse Ähnlichkeiten zu den weiter südlich vorkommenden Arten Necturus alabamensis und Necturus beyeri. Beide Arten sind recht nahe miteinander verwandt. Aus dem nördlichen Teil Floridas ist noch ein weiteres Taxon bekannt, Abb. 1: Oben links Necturus cf. maculosus aus Tennessee, oben rechts Habitat von Necturus cf. maculosus in Tennessee; Mitte links Necturus cf. beyeri, Apalachicola, Mitte rechts Habitat von Necturus cf. beyeri, Apalachicola/Florida; unten links Proteus anguinus, Slowenien, unten rechts Proteus anguinus parkelj, Südslowenien. Fotos: J. Nerz 28 amphibia, 12(2), 2013
27 Olme - eigenwillige Schwanzlurche mit seltsamer Verbreitung Abb. 2: Habitat von Proteus anguinus Nord-Slowenien. Foto: J. Nerz Necturus loedingi, in wieweit diese Art valide ist, ist fraglich, sie wird von den meisten Autoren nicht anerkannt. Während das Verbreitungsgebiet von Necturus alabamensis noch recht begrenzt ist, auf den nördlichen Teil Alabamas, findet man Necturus beyeri doch in einem recht großen Teil der südlichen USA. Hier konnten wir eine verwandte Form in Apalachicola beobachten (Abb. 1). Die Tiere sind dort vor allem in langsam fließenden Gewässern mit dicker Laubschicht und klarem, durch Tannine teefarben gefärbtem Wasser zu finden, ähnlich den Schwarzwasserflüssen, die aus den Tropen bekannt sind. Hier halten sie sich vor allem gerne in der dicken Laubschicht auf, z.t. zusammen mit Amphiuma und Siren. Die Habitate unterscheiden sich folglich beträchtlich von den Habitaten, die von Necturus maculosus bewohnt werden. Morphologisch war die Form von Necturus cf. maculosus, die wir in Tennessee beobachten konnten, abgesehen von der Größe erstaunlich ähnlich zu Necturus cf. beyeri. Beide zeigten von oben gesehen eine torpedoförmige Körperform mit relativ kleinen Extremitäten und starkem Ruderschwanz, beide zeigen große, dunkle Flecken auf braunem Grund (Abb. 1 oben links und Mitte links). Jedoch waren die beobachteten Exemplare von Necturus cf. beyeri wesentlich kleiner und die Ventralseite war weiß und ungefleckt, im Gegensatz zu Necturus cf. maculosus aus Tennesse, hier war die Ventralseite braun mit großen dunklen Flecken, ähnlich der Dorsalseite, nur etwas dunkler. Necturus alabamensis aus dem nördlichen Alabama scheint in gewisser Weise intermediär zwischen den südlichen Populationen von Necturus cf. maculosus in Tennessee und Necuturus cf. beyeri weiter im Süden zu sein. Ähnlich zu Necturus maculosus scheint diese Art eher Habitate mit steinigem Untergrund zu bevorzugen. Die eigentliche typische Art Necturus beyeri kommt weiter im Westen vor, in Lousiana, Missisippi und Texas. Necturus beyeri und Necturus cf. beyeri aus Appalachicola scheinen sich genetisch zu unterscheiden und die Tiere aus Apalachicola scheinen eine hellere Ventral- amphibia, 12(2),
28 Joachim Nerz seite aufzuweisen als die typische Necturus beyeri. Hier sind weitere taxonomische Studien wünschenswert, bzw. bereits in Gange und noch nicht publiziert. Kurz erwähnen möchte ich noch die beiden weiteren Arten, Necturus punctatus, eine eher zierliche Art, die deutlich von den anderen Arten zu unterscheiden ist durch die ungefleckte Dorsalseite; dies ist ein relativ seltener Bewohner der Flachlandsümpfe der amerikanischen Ostküste. Necturus lewisi, eine kräftigere, dorsal gefleckte Art, kommt nur recht lokal in einem kleinen Gebiet N-Carolinas vor. Gattung Proteus Machen wir nun einen großen Sprung nach Osten über den Atlantik und begeben wir uns in die Karstgebiete Sloweniens und Kroatiens. Große Teile der dortigen Laubwälder wachsen auf recht zerklüftetem Kalk, reich an Höhlen und Dolinen. Genau das ist der Lebensraum von einem der seltsamsten Lurche Europas - Proteus anguinus. Man vermutet, dass sich die Vorfahren der Tiere bereits vor Millionen von Jahren in die unterirdischen Lebensräume der Höhlen zurückgezogen haben (Abb. 2 und 3). Hier haben sich die Tiere perfekt an das Leben in den Höhlen angepasst und viele Organe auf ein Minimum reduziert, so haben die Tiere ihre Farbe verloren, die Augen sind komplett reduziert bzw. noch als kleine schwarze Punkte erkennbar (Abb. 4). Licht scheinen die Tiere jedoch zu registrieren, solange noch rudimentäre Augen nachweisbar sind, sobald man die Tiere in ihrem Habitat mit der Taschenlampe anleuchtet, schlängeln sie sich langsam davon. Auch die Gliedmaßen haben sich auf ein Minimum reduziert, so haben die eh schon recht reduzierten Gliedmaßen interessanterweise vorn nur noch 2 deutlich ausgeprägte Zehen und hinten drei. Mit ihrem fast schon aalartig verlängerten Körper (Abb. 1 unten links) bevorzugen die Tiere sich langsam schlängelnd durch das Wasser zu bewegen. Insgesamt sind die Tiere jedoch sehr träge, ideal an- Abb. 3: Karstquelle in Slowenien, hier kann man in seltenen Fällen Proteus anguinus außerhalb der Höhlen beobachten, normalerweise ist Proteus anguinus jedoch ein obligater Höhlenbewohner. Foto: J. Nerz 30 amphibia, 12(2), 2013
29 Olme - eigenwillige Schwanzlurche mit seltsamer Verbreitung Abb. 4: Kopf und Vorderbeine von Proteus anguinus, adult, komplett ohne Augen. Foto: J. Nerz gepasst an ein Leben ohne wirkliche Feinde aber auch mit wenig Futter; so geht man davon aus, dass die Tiere zuweilen über Wochen und Monate ohne Futter auskommen können, dementsprechend langsam wachsen die Tiere auch, so dass sie viele Jahre benötigen, um ihre endgültige Größe zu erreichen. Es gibt Vermutungen, daß diese zierlichen Tiere ein biblisches Alter von bis zu 100 Jahren erreichen können. Im Mai 2012 hatten wir die Gelegenheit, in Slowenien eine große Höhle mit einer recht gesunden Proteus-Population zu besuchen. So erwähnte unser Höhlenführer, dass zuweilen 50 Individuen bei einer einzigen Tour gesichtet wurden. Wir konnten innerhalb relativ kurzer Zeit immerhin schon 10 Tiere beobachten, zuweilen schlängelten sich 3 Tiere unter unserem Boot hindurch. Die Tiere bevorzugten Bereiche mit schlammigem Bodengrund, kaum Strömung und glasklarem Wasser. Es wurde ein Jungtier, welches bei einem starken Regenfall vor ca. sieben Jahren aus der Höhle herausgeschwemmt wurde, wieder in einen Pool in der Höhle gesetzt, um es dort zu beobachten; trotzdem dieses Tier dort schon seit sieben Jahren lebt, hatte es mit cm Gesamtlänge nicht annähernd die Größe der Adulttiere, die in de Regel um die 25 cm lang waren. Man kann sich also vorstellen, wie alt diese Tiere werden können. Proteus anguinus scheint perfekt an ein Leben unter Minimalbedingungen angepasst zu sein. Dementsprechend gemächlich sind auch die Bewegungen der Tiere, ohne viel Energie zu verbrauchen. Voraussetzung für solch eine gemächliche Lebensweise sind ganzjährig gleichmäßig kühle Bedingungen ohne Feinde und für die empfindlichen neotenen Tiere glasklares sauberes Wasser. Dieses Habitat machte zwar noch einen sehr intakten Eindruck mit einer sehr gesunden Proteus-Population, nichtsdestotrotz sind die Bestände insgesamt in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, da oberirdische Pestizidrückstände und sonstige Abwässer wie über einen Schwamm in den zerklüfteten Untergrund gelangen und dadurch auch die Bedingungen in den unterirdischen Gewässern beeinträchtigen. amphibia, 12(2),
30 Joachim Nerz Vor einigen Jahren wurde in Slowenien nach heftigen Regenfällen ein sehr eigenartiges Tier an die Oberfläche gespült; es hatte alle Anzeichen eines Proteus - Neotenie, langgestreckter Körper, reduzierte Gliedmaßen mit zwei Zehen vorne, drei hinten, jedoch waren die Tiere schwarz, hatten kleine Augen und eine wesentlich kürzere, stumpfere Schnauze. Was war das? In der Tat handelt es sich um eine hoch spezialisierte Form des Olmes, die erst 1994 als eine eigene Unterart Proteus anguinus parkelj (Abb. 1 rechts unten) beschrieben wurde. Aufgrund ihrer Lebensweise ist es fast unmöglich, diese Tiere zu beobachten, deshalb blieben die Tiere auch so lange Zeit unentdeckt. Man vermutet, dass die Tiere in den wassergetränkten, porösen Zwischenräumen des Kalkgebietes leben, die vollkommen unzugänglich sind, nicht jedoch in Höhlen vordringen und schon gar nicht an die Oberfläche. So wird die Nominaltform Proteus anguinus anguinus in unmittelbarer Nähe, keine 50 km von dieser Form entfernt in Höhlen gefunden, Zwischenformen oder Bastarde wurden jedoch nie beobachtet, vermutlich da die Tiere doch an sehr unterschiedliche, unterirdische Lebensräume angepasst sind. In der Zwischenzeit hat man jedoch drei winzige Stellen gefunden, die Verbindung zur Oberfläche haben und wo die Tiere zeitweise nachts aufsteigen. Über eine dieser Stellen hat man ein kleines Forschungszelt aufgestellt, so dass die Tiere dort zuweilen und mit viel Geduld beobachtet werden können. Bis heute ist nur sehr wenig über diese eigenartigen Tiere bekannt. Ihr äußeres Erscheinungsbild legt die Vermutung nahe, dass die Tiere noch bei weitem nicht so stark an das Leben im Untergrund angepasst sind, wie die Nominatform Proteus a. anguinus. Möglicherweise handelt es sich um eine Art Reliktvorkommen von Tieren, die ähnlich wie Necturus ursprünglich an der Oberfläche gelebt haben, sich in der Zwischenzeit aber in den Untergrund zurückgezogen haben. Es scheint, dass die Familie der Proteidae noch viele spannende Geheimnisse birgt. Und wer nicht erst in den adriatischen Karst reisen will, um die Olme zu sehen, kann das auch in Deutschland in Rübeland/Harz tun. Hier wurden vor nunmehr 65 Jahren erwachsene Olme aus der Adelsberger Grotte in der Herrmannshöhle ausgesetzt, von denen derzeit wahrscheinlich noch acht Tiere leben. Wie Wissenschaftler der Universität Halle u.a. Dr. W.-R. Grosse feststellten, handelte es sich dabei nur um männliche Tiere (Abb. 5), so dass ein dauerhaftes Überleben des Bestandes nicht möglich ist. Eingangsdatum: Abb. 5: Olmzählung in der Hermannshöhle in Rübeland/Harz. Foto: W.-R. Grosse Autor Dr. Joachim Nerz, Jägerstraße Böblingen joachim.nerz@onlinehome.de 32 amphibia, 12(2), 2013
31 Wolf-Rüdiger Grosse amphibia Literatur - Magazin Gärtnern für Tiere Die beliebten Gärten stehen im Mittelpunkt des Praxisbuches, wobei man sich im Klaren sein muss, dass jeder etwas für Wildtiere in seinem Garten tun kann. Doch tierfreundliches Gärtnern verlangt Toleranz und auch Schnecken, Ameisen und andere Kleinstlebewesen haben ihre Aufgabe, auch in unserem Garten. Der Autor stellt hervorragend bebildert sowohl Gartentypen als auch Tiergruppen im Garten vor, wo auch unsere Reptilien und Amphibien vertreten sind. Wichtige Arten wie Erdkröte, Grasfrosch und Molche werden vorgestellt. In Detaildarstellungen findet dann der Leser die Arten beispielsweise im Wassergarten wieder. Leider kommt am Ende des Buches die Literatur und wichtige Internetquellen zu kurz. Dafür ist das Register sehr umfangreich. Thomas, A. (2013): Gärtnern für Tiere. Das Praxisbuch für das ganze Jahr. Haupt Verlag AG, Bern. Praktische Parasitologie Häufig werden bei Heimtieren Parasitosen gar nicht erkannt oder die Erreger sind in der Literatur nicht so leicht zugänglich. Die vorliegende 2. Auflage der Praktischen Parasitologie bei Heimtieren wird aufgrund ihrer detaillierten Darstellungen besonders bei Tierärzten großen Zuspruch finden. Eine beiliegende DVD stellt besonders Parasitosen bei Zoo- und Wildtieren vor, wofür sicher ein großer Interessentenkreis vorhanden ist. Für den Amphibien- und Reptilienhalter ist das Buch als Sekundärliteratur zu empfehlen. Excellente Zeichnungen und Fotos sind in allen Kapiteln eine große Unterstützung beim Recherchieren. Beck. W. & N. Pantchev (2013): Praktische Parasitologie bei Heimtieren. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Schlütersche Verlagsgesellschaft mbh & Co, Hannover. Natur Kärnten Der Naturwissenschaftliche Verein Kärnten, Klagenfurt, stellt in seiner beliebten Natur Kärnten-Serie die Amphibien und Reptilien Kärntens vor. Beide Wirbeltierklassen werden sehr verständlich vorgestellt und in das regionale Umfeld Kärntens gesetzt. So gliedert sich der Amphibienteil in folgende Abschnitte: Was sind Amphibien? Lebensräume in Kärnten. Erhebungen zur Verbreitung in Kärnten und Gefährdung und Schutz. Insgesamt werden 15 Amphibienarten behandelt. Die Gliederung der Artkapitel ist logisch: Steckbrief, allgemeine Verbreitung und aktuelle Verbreitungskarte Kärnten, Lebensraum und Lebensweise, Feinde, Gefährdung und Schutz einschließlich Besonderheiten in Kärnten. amphibia, 12(2),
Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung,
 Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. biologische Systematik für den Hausgebrauch! Vortrag (gekürzt) gehalten auf der feldherpetologischen Konferenz Salamanderwanderung am 22.11.2014 in
Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. biologische Systematik für den Hausgebrauch! Vortrag (gekürzt) gehalten auf der feldherpetologischen Konferenz Salamanderwanderung am 22.11.2014 in
Hagen Schmidt. Bemerkungen zur Fortpflanzungsbiologie und zu den Farbvarianten von. Salamandra salamandra bernardezi
 Hagen Schmidt Bemerkungen zur Fortpflanzungsbiologie und zu den Farbvarianten von Salamandra salamandra bernardezi mit 5 Abbildungen vom Verfasser und 1 Abbildung von Kopetsch Zusammenfassung Es ist schon
Hagen Schmidt Bemerkungen zur Fortpflanzungsbiologie und zu den Farbvarianten von Salamandra salamandra bernardezi mit 5 Abbildungen vom Verfasser und 1 Abbildung von Kopetsch Zusammenfassung Es ist schon
Einheimische Amphibien Amphibia. Arbeitsblätter. Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien (Amphibia)
 Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Arbeitsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Arbeitsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
WISSENSWERTES rund um AMPHIBIEN
 WISSENSWERTES rund um AMPHIBIEN Schwerpunkt Bestimmung Zusammengestellt für f ZaunbetreuerInnen und Amphibieninteressierte im Rahmen des Projektes - Text, Grafik: Mag Axel Schmidt [www.axel-schmidt.at],
WISSENSWERTES rund um AMPHIBIEN Schwerpunkt Bestimmung Zusammengestellt für f ZaunbetreuerInnen und Amphibieninteressierte im Rahmen des Projektes - Text, Grafik: Mag Axel Schmidt [www.axel-schmidt.at],
Einheimische Amphibien Amphibia. Arbeitsblätter. Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien (Amphibia)
 Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Arbeitsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Arbeitsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Einheimische Amphibien Amphibia. Lösungsblätter. Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien (Amphibia)
 Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Pigeon Mountain Atlanta
 Pigeon Mountain Gegen späten Nachmittag landeten erst Joachim Nerz aus Stuttgart, als nächstes Eike Amthauer aus Kopenhagen und zum Schluss ich aus Frankfurt auf dem Flughafen Atlanta. Nach der Landung
Pigeon Mountain Gegen späten Nachmittag landeten erst Joachim Nerz aus Stuttgart, als nächstes Eike Amthauer aus Kopenhagen und zum Schluss ich aus Frankfurt auf dem Flughafen Atlanta. Nach der Landung
Schule mit Erfolg. Leseprobe Fische Sachtext Blatt 1
 Leseprobe Fische Sachtext Blatt 1 Fische Aale und Bachforellen Fische faszinieren viele Menschen. Für diese Faszination gibt es viele unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist die Tatsache, dass diese Tiere
Leseprobe Fische Sachtext Blatt 1 Fische Aale und Bachforellen Fische faszinieren viele Menschen. Für diese Faszination gibt es viele unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist die Tatsache, dass diese Tiere
Pantherschildkröten: Geochelone pardalis von Martin Fahz
 Pantherschildkröten: Geochelone pardalis von Martin Fahz Diese Art wird gelegentlich importiert und wird auch seit einigen Jahren regelmäßig nachgezüchtet. Verbreitungsgebiet: Von Äthiopien bis Namibia.
Pantherschildkröten: Geochelone pardalis von Martin Fahz Diese Art wird gelegentlich importiert und wird auch seit einigen Jahren regelmäßig nachgezüchtet. Verbreitungsgebiet: Von Äthiopien bis Namibia.
Bestimmungshilfe für die häufigen Amphibienarten
 Bestimmungshilfe für die häufigen Amphibienarten Silvia Zumbach Feb 2011 Fotos: Kurt Grossenbacher Erkennungsmerkmale Grasfrosch - Gestalt plump - glatte Haut - eher lange Beine - Grundfarbe graun, Rötlich
Bestimmungshilfe für die häufigen Amphibienarten Silvia Zumbach Feb 2011 Fotos: Kurt Grossenbacher Erkennungsmerkmale Grasfrosch - Gestalt plump - glatte Haut - eher lange Beine - Grundfarbe graun, Rötlich
Einheimische Amphibien Amphibia. Lösungsblätter. Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien (Amphibia)
 Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
2014 Artikel. article. Wolfgang Böckl & Jochen Zauner
 Wolfgang Böckl & Jochen Zauner 2014 Artikel article 4 - Online veröffentlicht / published online: 2014-06-15 Autor / Author: Jochen Zauner, Riedering, Germany. E-Mail: jochen.zauner@freenet.de Wolfgang
Wolfgang Böckl & Jochen Zauner 2014 Artikel article 4 - Online veröffentlicht / published online: 2014-06-15 Autor / Author: Jochen Zauner, Riedering, Germany. E-Mail: jochen.zauner@freenet.de Wolfgang
Köhlerschildkröten: Geochelone carbonaria von Martin Fahz
 Köhlerschildkröten: Geochelone carbonaria von Martin Fahz Seit über 25 Jahre halte und züchte ich Köhlerschildkröten. Diese Art wird seit vielen Jahren importiert und auch seit einigen Jahren nachgezüchtet.
Köhlerschildkröten: Geochelone carbonaria von Martin Fahz Seit über 25 Jahre halte und züchte ich Köhlerschildkröten. Diese Art wird seit vielen Jahren importiert und auch seit einigen Jahren nachgezüchtet.
Die Schwanzlurche des Peloponnes Teichmolch, Bergmolch, Feuersalamander
 Die Schwanzlurche des Peloponnes Teichmolch, Bergmolch, Feuersalamander MICHAEL & URSULA FRANZEN Zusammenfassung eines Vortrages im Rahmen der Jahrestagung der AG Urodela in Gersfeld am 15. Oktober 2005
Die Schwanzlurche des Peloponnes Teichmolch, Bergmolch, Feuersalamander MICHAEL & URSULA FRANZEN Zusammenfassung eines Vortrages im Rahmen der Jahrestagung der AG Urodela in Gersfeld am 15. Oktober 2005
Malawisee. Abb. 1 Abb. 2. Unterwasseraufnahmen aus dem See
 Malawisee Zunächst ein paar Zahlen und Fakten: Der Malawisee ist der neuntgrößte der See der Erde und der drittgrößte in Afrika nach dem Viktoriasee und dem Tanganjika See Er ist 560 Kilometer lang und
Malawisee Zunächst ein paar Zahlen und Fakten: Der Malawisee ist der neuntgrößte der See der Erde und der drittgrößte in Afrika nach dem Viktoriasee und dem Tanganjika See Er ist 560 Kilometer lang und
Anleitung zur Erfassung des Alpensalamanders 1
 Rote Listen Amphibien Erfassung - Alpensalamander_2018 2018/2019 1/6 Rote Listen Amphibien Anleitung zur Erfassung des Alpensalamanders 1 Benedikt Schmidt Juli 2016 1 Dies ist eine aktualisierte Version
Rote Listen Amphibien Erfassung - Alpensalamander_2018 2018/2019 1/6 Rote Listen Amphibien Anleitung zur Erfassung des Alpensalamanders 1 Benedikt Schmidt Juli 2016 1 Dies ist eine aktualisierte Version
Feuersalamander. Feuriger Blickfang im feuchten Wald
 Feuersalamander Feuriger Blickfang im feuchten Wald Bayerns UrEinwohner 2011 Hallo, ich bin Fred, der Feuersalamander. Ihr habt mich bestimmt schon erkannt. Aber gesehen haben mich wahrscheinlich noch
Feuersalamander Feuriger Blickfang im feuchten Wald Bayerns UrEinwohner 2011 Hallo, ich bin Fred, der Feuersalamander. Ihr habt mich bestimmt schon erkannt. Aber gesehen haben mich wahrscheinlich noch
Tier-Steckbriefe. Tier-Steckbriefe. Lernziele: Material: Köcher iege. Arbeitsblatt 1 - Welches Tier lebt wo? Methode: Info:
 Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
- 2 - Inzwischen ist anerkannt, dass sich der moderne Mensch aus einer Urform entwickelt hat.
 Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
9. Thüringer Landesolympiade Biologie Klassenstufe 9
 9. Thüringer Landesolympiade Biologie 2011 Klassenstufe 9 Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle an der Biologie interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 der Thüringer Gymnasien.
9. Thüringer Landesolympiade Biologie 2011 Klassenstufe 9 Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle an der Biologie interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 der Thüringer Gymnasien.
Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen
 Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen Ergebnisüberblick Heiko Hinneberg heiko.hinneberg@web.de Methoden Habitatbeschaffenheit
Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen Ergebnisüberblick Heiko Hinneberg heiko.hinneberg@web.de Methoden Habitatbeschaffenheit
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Arbeitshilfe. Arbeitshilfe 10. Projektspezifische Erfolgskontrollen. Vernetzungsprojekten. Amphibien, Reptilien
 Arbeitshilfe Ziel- und Leitarten in Vernetzungsprojekten und LEK Arbeitshilfe 10 Projektspezifische Erfolgskontrollen zu ÖQV- Vernetzungsprojekten Amphibien, Reptilien AMT FÜR LANDSCHAFT UND NATUR FACHSTELLE
Arbeitshilfe Ziel- und Leitarten in Vernetzungsprojekten und LEK Arbeitshilfe 10 Projektspezifische Erfolgskontrollen zu ÖQV- Vernetzungsprojekten Amphibien, Reptilien AMT FÜR LANDSCHAFT UND NATUR FACHSTELLE
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere
 Hüpfdiktat 1 - Waldtiere A B C D E 1 Weibchen zwei bis Diese Vögel werden jedoch jagen und haben ihre Augen der Nacht genannt. 2 Da Uhus vor allem in der 3 ihre Flügelspannweite 4 Leben lang zusammen,
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere A B C D E 1 Weibchen zwei bis Diese Vögel werden jedoch jagen und haben ihre Augen der Nacht genannt. 2 Da Uhus vor allem in der 3 ihre Flügelspannweite 4 Leben lang zusammen,
Muster Original 50 ct
 Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 8 Jahre Am Bach entlang: Einheimische Tiere Bevor du losgehst: Die Räume sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfindet. Rechts von der großen Säulenhalle steht
Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 8 Jahre Am Bach entlang: Einheimische Tiere Bevor du losgehst: Die Räume sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfindet. Rechts von der großen Säulenhalle steht
DIE BARTAGAME, ZWERGBARTAGAME & AUSTRALISCHE TAUBAGAME
 Christian Freynik Oliver Drewes DIE BARTAGAME, ZWERGBARTAGAME & AUSTRALISCHE TAUBAGAME Pogona henrylawsoni VORWORT Dieses Buch basiert auf der Publikation Die Zwergbartagame von Christian Freynik, das
Christian Freynik Oliver Drewes DIE BARTAGAME, ZWERGBARTAGAME & AUSTRALISCHE TAUBAGAME Pogona henrylawsoni VORWORT Dieses Buch basiert auf der Publikation Die Zwergbartagame von Christian Freynik, das
Nach etwa drei Wochen schlüpft die Froschlarve aus dem Ei. Larve nennt man ein Jungtier, das ganz anders aussieht als seine Eltern.
 Nach der Befruchtung quillt die Eihülle im Wasser auf und bildet so eine schützende Schicht um das Ei. Nach etwa drei Wochen schlüpft die Froschlarve aus dem Ei. Larve nennt man ein Jungtier, das ganz
Nach der Befruchtung quillt die Eihülle im Wasser auf und bildet so eine schützende Schicht um das Ei. Nach etwa drei Wochen schlüpft die Froschlarve aus dem Ei. Larve nennt man ein Jungtier, das ganz
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Praktikumsbericht. Tim Hartelt
 Praktikumsbericht Tim Hartelt Goro Research Camp, Südafrika 16.10.2017-11.12.2017 1. Vorbereitung 2016 war ich das erste Mal für ein Praktikum in Südafrika und es stand für mich sofort fest, dass ich irgendwann
Praktikumsbericht Tim Hartelt Goro Research Camp, Südafrika 16.10.2017-11.12.2017 1. Vorbereitung 2016 war ich das erste Mal für ein Praktikum in Südafrika und es stand für mich sofort fest, dass ich irgendwann
Tiere im Winter. OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
Biber. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Biber Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Fred F. Hazelhoff / WWF-Canon Steckbrief Grösse: 80-95
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Biber Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Fred F. Hazelhoff / WWF-Canon Steckbrief Grösse: 80-95
Wer schneckt denn da? Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein
 Wer schneckt denn da? Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2011 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Wer schneckt denn da? Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2011 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan Bleicherstraße/ Vollmerstraße Stadt Biberacha.d. Riß Baden-Württemberg
 Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan Bleicherstraße/ Vollmerstraße Stadt Biberacha.d. Riß Baden-Württemberg PE Peter Endl (Dipl. Biol.) Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan
Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan Bleicherstraße/ Vollmerstraße Stadt Biberacha.d. Riß Baden-Württemberg PE Peter Endl (Dipl. Biol.) Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan
Größe: Beide Geschlechter werden gleich groß, maximal 75 mm. KRL mm SL mm
 Lygodactylus capensis (Smith, 1849) Terra Typica: Kaffirland und nördliche Distrikte der Kap-Provinz Verbreitung: Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über das südliche bis östliche Afrika. Südlich des
Lygodactylus capensis (Smith, 1849) Terra Typica: Kaffirland und nördliche Distrikte der Kap-Provinz Verbreitung: Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über das südliche bis östliche Afrika. Südlich des
Wir sind die _ aus den ICE AGE Filmen Zwei in Originalgröße nachgebaute Exemplare siehst du im 1. Ausstellungsraum.
 wurde es immer kälter, bis zu 10 Grad kälter. Das war der Beginn der EISZEIT, in der viel Schnee fiel und große Gletscher entstanden. Es gab 5 Kaltzeiten, in denen sich die Gletscher über halb Deutschland
wurde es immer kälter, bis zu 10 Grad kälter. Das war der Beginn der EISZEIT, in der viel Schnee fiel und große Gletscher entstanden. Es gab 5 Kaltzeiten, in denen sich die Gletscher über halb Deutschland
Alpensalamander und Feuersalamander
 Die Biologie der Alpensalamander und Feuersalamander 1. Lurche: ein Leben an Land und im Wasser 2. Die Wanderung der Lurche 3. Die Außergewöhnliche Entwicklung der Salamander 4. Lurche sind Wirbeltiere
Die Biologie der Alpensalamander und Feuersalamander 1. Lurche: ein Leben an Land und im Wasser 2. Die Wanderung der Lurche 3. Die Außergewöhnliche Entwicklung der Salamander 4. Lurche sind Wirbeltiere
A: Eine Frage zum aktuellen Posten Lies dazu den Text an den Posten genau durch, dann kannst du die Frage beantworten.
 Naturlehrpfad am Bellacher Weiher Anleitung Auf deinen Postenkarten findest du immer drei Aufgaben: A: Eine Frage zum aktuellen Posten Lies dazu den Text an den Posten genau durch, dann kannst du die Frage
Naturlehrpfad am Bellacher Weiher Anleitung Auf deinen Postenkarten findest du immer drei Aufgaben: A: Eine Frage zum aktuellen Posten Lies dazu den Text an den Posten genau durch, dann kannst du die Frage
Christianna Serfling BÖSCHA GmbH, Hermsdorf
 Christianna Serfling BÖSCHA GmbH, Hermsdorf Amphibien Gesamtübersicht Untersuchungsgewässer Untersuchungsgewässer Anzahl Untersuchungsgewässer Anzahl Untersuchungsgewässer mit Amphibiennachweis GI 70
Christianna Serfling BÖSCHA GmbH, Hermsdorf Amphibien Gesamtübersicht Untersuchungsgewässer Untersuchungsgewässer Anzahl Untersuchungsgewässer Anzahl Untersuchungsgewässer mit Amphibiennachweis GI 70
- 2 - Inzwischen ist anerkannt, dass sich der moderne Mensch aus einer Urform entwickelt hat. Ich soll nun also herausfinden
 Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Liebe macht blind. Krötenwanderung
 Krötenwanderung Arbeitsblatt 1 zum Mach-mit-Thema in TIERFREUND 2/2017 Liebe macht blind Bald ist es wieder so weit: Frösche, Kröten und andere Amphibien suchen ihre Laichplätze auf. Das ist für die Tiere
Krötenwanderung Arbeitsblatt 1 zum Mach-mit-Thema in TIERFREUND 2/2017 Liebe macht blind Bald ist es wieder so weit: Frösche, Kröten und andere Amphibien suchen ihre Laichplätze auf. Das ist für die Tiere
Die Bundesrepublik Deutschland
 - 1 - Dossier Landeskunde Die Bundesrepublik Deutschland - 2 - DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Die natürlichen Grenzen Deutschlands sind die Nord- und Ostsee im Norden, die Alpen im Süden, der Rhein im
- 1 - Dossier Landeskunde Die Bundesrepublik Deutschland - 2 - DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Die natürlichen Grenzen Deutschlands sind die Nord- und Ostsee im Norden, die Alpen im Süden, der Rhein im
Auf der Suche nach Wildkatzen in Niederösterreich
 Auf der Suche nach Wildkatzen in Niederösterreich Hermann Friembichler Als im heißen Juli 2013 ein Salzburger Urlauberehepaar an der Straße zwischen Weißenkirchen und Weinzierl am Walde den Kadaver einer
Auf der Suche nach Wildkatzen in Niederösterreich Hermann Friembichler Als im heißen Juli 2013 ein Salzburger Urlauberehepaar an der Straße zwischen Weißenkirchen und Weinzierl am Walde den Kadaver einer
Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern WOLFGANG ZESSIN, Schwerin Einleitung Die Ordnung der Blattfußkrebse (Phyllopoda) ist in Mitteleuropa mit etwa hundert,
Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern WOLFGANG ZESSIN, Schwerin Einleitung Die Ordnung der Blattfußkrebse (Phyllopoda) ist in Mitteleuropa mit etwa hundert,
Frank und Katrin Hecker. t er u r. n entdecken & erforschen. Naturführer für Kinder. und ihre
 Frank und Katrin Hecker S t er P i u r e e und ihre n entdecken & erforschen Naturführer für Kinder 14 Huftiere 200 300 cm Elch Typisch Großer Hirsch mit pferdeähnlichem Kopf. Erwachsene Männchen mit mächtig
Frank und Katrin Hecker S t er P i u r e e und ihre n entdecken & erforschen Naturführer für Kinder 14 Huftiere 200 300 cm Elch Typisch Großer Hirsch mit pferdeähnlichem Kopf. Erwachsene Männchen mit mächtig
Arbeitsmappe für Helfer und Kartierer von Amphibienschutz-Zäunen
 Amphibienschutz Arbeitsmappe für Helfer und Kartierer von Amphibienschutz-Zäunen Seite 3 Erdkröte (Bufo bufo) Familie: Kröten (Bufonidae) Mittelgroße bis große, eher plumpe Kröte. Männchen ca. 90 mm, Weibchen
Amphibienschutz Arbeitsmappe für Helfer und Kartierer von Amphibienschutz-Zäunen Seite 3 Erdkröte (Bufo bufo) Familie: Kröten (Bufonidae) Mittelgroße bis große, eher plumpe Kröte. Männchen ca. 90 mm, Weibchen
Erstmals Springfrösche entdeckt
 Bund Naturschutz Ortsgruppe Holzkirchen Amphibienschutz- Projekt Eschenstr. 4 83607 Holzkirchen Tel. 08024-92599 Betreuungs-Team: Claudia Hüttl, Ulrike Langer, Susanne Sabaß, Stefan Schmucker, Victor von
Bund Naturschutz Ortsgruppe Holzkirchen Amphibienschutz- Projekt Eschenstr. 4 83607 Holzkirchen Tel. 08024-92599 Betreuungs-Team: Claudia Hüttl, Ulrike Langer, Susanne Sabaß, Stefan Schmucker, Victor von
PlausibilitÇtskontrolle bzgl. ausgewçhlter Faunenelemente im Rahmen der geplanten VerlÇngerung des Ostwestfalendamms in Ummeln
 PlausibilitÇtskontrolle bzgl. ausgewçhlter Faunenelemente im Rahmen der geplanten VerlÇngerung des Ostwestfalendamms in Ummeln Herford, im Dezember 2013 Auftraggeber: Bearbeiter: Dipl.-Biol. Dorothee GÄÅling
PlausibilitÇtskontrolle bzgl. ausgewçhlter Faunenelemente im Rahmen der geplanten VerlÇngerung des Ostwestfalendamms in Ummeln Herford, im Dezember 2013 Auftraggeber: Bearbeiter: Dipl.-Biol. Dorothee GÄÅling
Erfassung Hügelbauende Waldameisen 2011
 Erfassung Hügelbauende Waldameisen 11 Inhalt: 1. Einleitung 1.1 Was wird erfasst 1.2 Wie wird erfasst 1.3 Wann wird erfasst 1.4 Erfasste Fläche 2. Ergebnisse der Erfassung 11 2.1 Verteilung der Arten 2.2
Erfassung Hügelbauende Waldameisen 11 Inhalt: 1. Einleitung 1.1 Was wird erfasst 1.2 Wie wird erfasst 1.3 Wann wird erfasst 1.4 Erfasste Fläche 2. Ergebnisse der Erfassung 11 2.1 Verteilung der Arten 2.2
Stuttgarter Amazonen 2018
 mit Fotos von Tomoko Arai Stuttgarter Amazonen 2018 01/2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI
mit Fotos von Tomoko Arai Stuttgarter Amazonen 2018 01/2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI
Schul- und Arbeitsmaterial: Arbeitsblatt Seite 1/5
 Schul- und Arbeitsmaterial: Arbeitsblatt Seite 1/5 1. Waschbären sind ziemliche Faulpelze: Sie verschlafen einen grossen Teil des Tages. Schau genau: Wo überall kannst Du schlafende Waschbären entdecken?.....
Schul- und Arbeitsmaterial: Arbeitsblatt Seite 1/5 1. Waschbären sind ziemliche Faulpelze: Sie verschlafen einen grossen Teil des Tages. Schau genau: Wo überall kannst Du schlafende Waschbären entdecken?.....
Zur Fortpflanzung des Feuersalamanders in der Gefangenschaft
 Zur Fortpflanzung des Feuersalamanders in der Gefangenschaft Schon seit.jahren beschäftige ich mich mit Feuersalamandern und pflege z. Z. ein Pärchen in einem Terrarium von 75 cm Länge und 35 cm Breite.
Zur Fortpflanzung des Feuersalamanders in der Gefangenschaft Schon seit.jahren beschäftige ich mich mit Feuersalamandern und pflege z. Z. ein Pärchen in einem Terrarium von 75 cm Länge und 35 cm Breite.
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief.
 Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Peckoltia compta (L134), ein Zuchtbericht
 Peckoltia compta (L134), ein Zuchtbericht by Jost Borcherding Der häufig im Handel als Tapajós-Tiger bezeichnete Harnischwels gehört zur Gattung Peckoltia innerhalb der Loricariidae (Harnischwelse) und
Peckoltia compta (L134), ein Zuchtbericht by Jost Borcherding Der häufig im Handel als Tapajós-Tiger bezeichnete Harnischwels gehört zur Gattung Peckoltia innerhalb der Loricariidae (Harnischwelse) und
Waldeidechse. Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787)
 6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
Im Hochrhein ausgestorben, aber im Exil überlebt:
 Im Hochrhein ausgestorben, aber im Exil überlebt: Genetische Aspekte von Ansiedlungsversuchen bei der Gemeinen Kahnschnecke Theodoxus fluviatilis Dr. Sylvain Ursenbacher, Dr. Hans-Peter Rusterholz & Prof.
Im Hochrhein ausgestorben, aber im Exil überlebt: Genetische Aspekte von Ansiedlungsversuchen bei der Gemeinen Kahnschnecke Theodoxus fluviatilis Dr. Sylvain Ursenbacher, Dr. Hans-Peter Rusterholz & Prof.
Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen
 / 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
/ 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist:
 Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE
 Amphibien in Baden-Württemberg - ein kurzer Überblick - DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE Gliederung Amphibienarten in Baden-Württemberg siehe Anhang Rote Liste
Amphibien in Baden-Württemberg - ein kurzer Überblick - DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE Gliederung Amphibienarten in Baden-Württemberg siehe Anhang Rote Liste
Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist:
 Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Naturschutzbund Tirol
 Naturschutzbund Tirol 14.02.2011 Kontakt Die Kramsacher Loar Abb 1: Die unter Wasser stehende Loar in Blickrichtung Osten. Abb.2: Die trockengefallene Loar in Blickrichtung Osten. 1 von 5 04.11.17 06:36
Naturschutzbund Tirol 14.02.2011 Kontakt Die Kramsacher Loar Abb 1: Die unter Wasser stehende Loar in Blickrichtung Osten. Abb.2: Die trockengefallene Loar in Blickrichtung Osten. 1 von 5 04.11.17 06:36
Fischarten-Datenblatt
 Name: METALLPANZERWELS Wissenschaftl. Name: Corydoras aeneus Herkunft: tropische Weichbodenflüsse in Südamerika Größe: 7,5 cm Beckenlänge: 80 cm ph-wert: 6-8 Wasserhärte: 3-16 dgh Temperatur: 22-28 C Ernährung:
Name: METALLPANZERWELS Wissenschaftl. Name: Corydoras aeneus Herkunft: tropische Weichbodenflüsse in Südamerika Größe: 7,5 cm Beckenlänge: 80 cm ph-wert: 6-8 Wasserhärte: 3-16 dgh Temperatur: 22-28 C Ernährung:
4. UNTERRICHTSTUNDE: DIE LANDSCHAFTEN DER USA
 THEMA: USA 4. UNTERRICHTSTUNDE 54 4. UNTERRICHTSTUNDE: DIE LANDSCHAFTEN DER USA Ziele: Die Schüler sollen erkennen, dass die USA über verschiedene Landschaftstypen verfügen. Sprache der kognitiven Prozesse:
THEMA: USA 4. UNTERRICHTSTUNDE 54 4. UNTERRICHTSTUNDE: DIE LANDSCHAFTEN DER USA Ziele: Die Schüler sollen erkennen, dass die USA über verschiedene Landschaftstypen verfügen. Sprache der kognitiven Prozesse:
DIE KONTINENTALDRIFT
 DIE KONTINENTALDRIFT Siegfried Fleck 1994, Digitalisierung und Ergänzung von Markus Wurster, 2002-2013 DIE KONTINENTALDRIFT Die großen, zusammenhängenden Landstücke auf der Erde haben die Menschen "Kontinente"
DIE KONTINENTALDRIFT Siegfried Fleck 1994, Digitalisierung und Ergänzung von Markus Wurster, 2002-2013 DIE KONTINENTALDRIFT Die großen, zusammenhängenden Landstücke auf der Erde haben die Menschen "Kontinente"
Das Schmalblättrige Kreuzkraut ein Einwanderer. Dr. Tina Heger
 Das Schmalblättrige Kreuzkraut ein Einwanderer Dr. Tina Heger Schmalblättriges Kreuzkraut Senecio inaequidens wikipedia.de Ursprünglich heimisch in Südafrika Dort im "Highveld, 1400 to 2850 m ü. NN Heute
Das Schmalblättrige Kreuzkraut ein Einwanderer Dr. Tina Heger Schmalblättriges Kreuzkraut Senecio inaequidens wikipedia.de Ursprünglich heimisch in Südafrika Dort im "Highveld, 1400 to 2850 m ü. NN Heute
Die Sumpfschildkröte in Oberschwaben
 Die Sumpfschildkröte in Oberschwaben Von Dominik Hauser Einleitung Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist unsere einzige heimische Schildkrötenart. Sie erreicht eine Gesamtlänge von etwa
Die Sumpfschildkröte in Oberschwaben Von Dominik Hauser Einleitung Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist unsere einzige heimische Schildkrötenart. Sie erreicht eine Gesamtlänge von etwa
Anleitung zur Erfassung der Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra)
 Benedikt Schmidt benedikt.schmidt@unine.ch Silvia Zumbach silvia.zumbach@unine.ch Neuchâtel, 20. März 2017 Anleitung zur Erfassung der Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) Anleitung Feuersalamander
Benedikt Schmidt benedikt.schmidt@unine.ch Silvia Zumbach silvia.zumbach@unine.ch Neuchâtel, 20. März 2017 Anleitung zur Erfassung der Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) Anleitung Feuersalamander
Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Österreich: Was haben wir daraus gelernt?
 Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Österreich: Was haben wir daraus gelernt? Steven Weiss Institut für Zoologie, Karl-Franzens Universität Graz Datenübersicht Region Anzahl der Pop. Anzahl Fische
Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Österreich: Was haben wir daraus gelernt? Steven Weiss Institut für Zoologie, Karl-Franzens Universität Graz Datenübersicht Region Anzahl der Pop. Anzahl Fische
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg. 100 Tiere, Pflanzen und Pilze
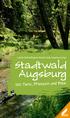 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
LÖSUNGEN. Der Tiger. Dein Schülerreferat
 LÖSUNGEN Der Tiger Dein Schülerreferat Die Unterarten des Tigers Lösungsblatt Auf der Karte 1 kannst du die Verbreitung der noch in der Wildnis lebenden fünf Unterarten und ihren jeweiligen Bestand erkennen.
LÖSUNGEN Der Tiger Dein Schülerreferat Die Unterarten des Tigers Lösungsblatt Auf der Karte 1 kannst du die Verbreitung der noch in der Wildnis lebenden fünf Unterarten und ihren jeweiligen Bestand erkennen.
Übersicht über die Stationen
 Übersicht über die Stationen Station 1: Station 2: Station 3: Station 4: Station 5: Station 6: Station 7: Station 8: Die Erdkröte Der Grasfrosch Die Geburtshelferkröte Der Feuersalamander Tropische Frösche
Übersicht über die Stationen Station 1: Station 2: Station 3: Station 4: Station 5: Station 6: Station 7: Station 8: Die Erdkröte Der Grasfrosch Die Geburtshelferkröte Der Feuersalamander Tropische Frösche
Im Wald. Mit Rätseln, Spielen und Entdecker-Klappen! SEHEN I HÖREN I MITMACHEN. Band 12
 nd Band 12 Im Wald SEHEN I HÖREN I MITMACHEN Mit Rätseln, Spielen und Entdecker-Klappen! Unterwegs im Wald Anna und Moritz sind heute mit Förster Albrecht im Wald unterwegs. Sie kennen ihn schon aus ihrer
nd Band 12 Im Wald SEHEN I HÖREN I MITMACHEN Mit Rätseln, Spielen und Entdecker-Klappen! Unterwegs im Wald Anna und Moritz sind heute mit Förster Albrecht im Wald unterwegs. Sie kennen ihn schon aus ihrer
Tagfalter in Bingen Der Kaisermantel -lat. Argynnis paphia- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Kaisermantel -lat. Argynnis paphia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3... 4 Puppe... 5 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Kaisermantel -lat. Argynnis paphia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3... 4 Puppe... 5 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Galicien REISEN. Von Miguel Vences, Dr. Burkhard Thiesmeier und Frank Glaw
 Galicien Von Miguel Vences, Dr. Burkhard Thiesmeier und Frank Glaw Schlägt man in den Reiseführern unter dem Stichwort Galicien" nach, findet man mit Sicherheit die typischen Maisspeicher und den heiligen
Galicien Von Miguel Vences, Dr. Burkhard Thiesmeier und Frank Glaw Schlägt man in den Reiseführern unter dem Stichwort Galicien" nach, findet man mit Sicherheit die typischen Maisspeicher und den heiligen
Arthur s Pass. Arthur`s Pass ->>>
 Arthur s Pass Von Christchurch aus mache ich mich über den Arthur s Pass wieder auf den Weg in Richtung Westküste, wobei hier natürlich der Weg das Ziel ist. Gleich zu Beginn der Passstraße geht es ordentlich
Arthur s Pass Von Christchurch aus mache ich mich über den Arthur s Pass wieder auf den Weg in Richtung Westküste, wobei hier natürlich der Weg das Ziel ist. Gleich zu Beginn der Passstraße geht es ordentlich
Vorträge und Exkursionen der Herpetologischen Arbeitsgemeinschaft des Hauses der Natur in Salzburg. Vorträge 2009
 1 von 5 31.01.2009 11:12 Vorträge und Exkursionen der Herpetologischen Arbeitsgemeinschaft des Hauses der Natur in Salzburg Jubiläum: 20 Jahre HerpAG! Vorträge 2009 ÖNJ Heim - Eingang links vom Eingang
1 von 5 31.01.2009 11:12 Vorträge und Exkursionen der Herpetologischen Arbeitsgemeinschaft des Hauses der Natur in Salzburg Jubiläum: 20 Jahre HerpAG! Vorträge 2009 ÖNJ Heim - Eingang links vom Eingang
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2002 Alle Rechte
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2002 Alle Rechte
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
A1: Zu Beginn kommen die Puritaner - Der Kapitän, Christopher
 A1: Zu Beginn kommen die Puritaner - Der Kapitän, Christopher Jones, berichtet! Im Jahr 1620 brachte ich mit meiner Mayflower, so heißt mein Schiff, nicht weniger als 102 Passagiere und rund 30 Mann Besatzung
A1: Zu Beginn kommen die Puritaner - Der Kapitän, Christopher Jones, berichtet! Im Jahr 1620 brachte ich mit meiner Mayflower, so heißt mein Schiff, nicht weniger als 102 Passagiere und rund 30 Mann Besatzung
Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) FABRICIUS, 1798
 Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) FABRICIUS, 1798 Orthetrum coerulescens erreicht eine Körperlänge von 3,6 bis 4,5 Zentimetern und eine Flügelspannweite von bis zu 6,5 Zentimetern. Nach ihrer
Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) FABRICIUS, 1798 Orthetrum coerulescens erreicht eine Körperlänge von 3,6 bis 4,5 Zentimetern und eine Flügelspannweite von bis zu 6,5 Zentimetern. Nach ihrer
Gorillas. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Gorillas Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Gewicht: Alter: Nahrung: Lebensraum:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Gorillas Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Gewicht: Alter: Nahrung: Lebensraum:
Welche Weiher für Amphibien?
 Welche Weiher für Amphibien? Benedikt Schmidt karch benedikt.schmidt@unine.ch Weiher für Amphibien. Weiher für Amphibien bauen hat Tradition ( Biotop ). Das ist gut. Aber warum braucht es Weiher? Und welche?
Welche Weiher für Amphibien? Benedikt Schmidt karch benedikt.schmidt@unine.ch Weiher für Amphibien. Weiher für Amphibien bauen hat Tradition ( Biotop ). Das ist gut. Aber warum braucht es Weiher? Und welche?
Microthlaspi erraticum
 Microthlaspi erraticum eine weitverbreitete, meist übersehene Art mit speziellen Standortansprüchen Marco Thines Übersicht Die Gattung Microthlaspi Verbreitungsgebiete von Microthlaspi perfoliatum und
Microthlaspi erraticum eine weitverbreitete, meist übersehene Art mit speziellen Standortansprüchen Marco Thines Übersicht Die Gattung Microthlaspi Verbreitungsgebiete von Microthlaspi perfoliatum und
Krokodil. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Krokodil Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Staffan Widstrand / WWF Steckbrief Grösse: Alter:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Krokodil Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Staffan Widstrand / WWF Steckbrief Grösse: Alter:
Portugals Feuersalamander ein bunter Reigen
 Rudolf Malkmus Portugals Feuersalamander ein bunter Reigen Systematik Unter den aktuell 11 anerkannten Unterarten des geografisch hochpolymorphen Feuersalamanders kommen 9 allein auf der Iberischen Halbinsel
Rudolf Malkmus Portugals Feuersalamander ein bunter Reigen Systematik Unter den aktuell 11 anerkannten Unterarten des geografisch hochpolymorphen Feuersalamanders kommen 9 allein auf der Iberischen Halbinsel
ABENTEUER FOTOGRAFIE
 ABENTEUER FOTOGRAFIE Stephanie Bernhard und Stefan Tschumi www.journeyglimpse.com ist ein Reise- und Fotografieblog aus der Schweiz Die Sonne blendet mir ins Gesicht während ich einen Fuss vor den anderen
ABENTEUER FOTOGRAFIE Stephanie Bernhard und Stefan Tschumi www.journeyglimpse.com ist ein Reise- und Fotografieblog aus der Schweiz Die Sonne blendet mir ins Gesicht während ich einen Fuss vor den anderen
Winter-Rallye Tiere im Winter
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Winter-Rallye Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Winter-Rallye Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Hochhausen Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg von Frank Buchali und Marco
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Hochhausen Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg von Frank Buchali und Marco
Wolf - NHMF Dossier «Wolfsrudel» (8-12Jahre)
 Wolf - NHMF 17.09.2016-20.08.2017- Dossier «Wolfsrudel» (8-12Jahre) 1. Der Wolf und du 1 VOR dem Museumsbesuch 1. Der Wolf lebt in der Schweiz. 2. Der Wolf ist böse. 3. Wölfe fressen manchmal Schafe. 4.
Wolf - NHMF 17.09.2016-20.08.2017- Dossier «Wolfsrudel» (8-12Jahre) 1. Der Wolf und du 1 VOR dem Museumsbesuch 1. Der Wolf lebt in der Schweiz. 2. Der Wolf ist böse. 3. Wölfe fressen manchmal Schafe. 4.
Braune Waldschildkröte (Indische Waldschildkröte): Manouria emys phayrei von Martin Fahz
 Braune Waldschildkröte (Indische Waldschildkröte): Manouria emys phayrei von Martin Fahz Vor 25 Jahren erhielt ich zwei Nachzuchttiere von Manouria emys phayrei. Diese Schildkrötenart ist in der Natur
Braune Waldschildkröte (Indische Waldschildkröte): Manouria emys phayrei von Martin Fahz Vor 25 Jahren erhielt ich zwei Nachzuchttiere von Manouria emys phayrei. Diese Schildkrötenart ist in der Natur
Willkommen im smac. Ein Heft in Leichter Sprache
 Willkommen im smac Ein Heft in Leichter Sprache 1 smac ist die Abkürzung für: Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz. Das Wort sprechen wir so aus: Ar - chä - o - lo - gie. Archäologie ist eine Wissenschaft.
Willkommen im smac Ein Heft in Leichter Sprache 1 smac ist die Abkürzung für: Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz. Das Wort sprechen wir so aus: Ar - chä - o - lo - gie. Archäologie ist eine Wissenschaft.
Ausgabe 124 Juni 2017/16
 Ausgabe 124 Juni 2017/16 Auch im Juli wieder auf nach Böhmen von Bernd, DL2DXA Nachdem ich Ende Juni auch wieder mal den sächsischen Bergen meine Aufwartung gemacht habe, geht es in den ersten Tagen im
Ausgabe 124 Juni 2017/16 Auch im Juli wieder auf nach Böhmen von Bernd, DL2DXA Nachdem ich Ende Juni auch wieder mal den sächsischen Bergen meine Aufwartung gemacht habe, geht es in den ersten Tagen im
S C.F.
 Rif. 1352 Lionard Luxury Real Estate Via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Fax. +39 055 0548150 Gardasee Moderne Luxusvilla zum Verkauf am Gardasee
Rif. 1352 Lionard Luxury Real Estate Via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Fax. +39 055 0548150 Gardasee Moderne Luxusvilla zum Verkauf am Gardasee
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum S 2. Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe
 Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Es gibt viele merkwürdige Erscheinungsformen
 1 Bildquelle:http://www.dailyworldfacts. com/giraffe-facts/, http://www.berlinerakzente.de Es gibt viele merkwürdige Erscheinungsformen bei Lebewesen allein der Hals einer Giraffe, dem höchsten Tier der
1 Bildquelle:http://www.dailyworldfacts. com/giraffe-facts/, http://www.berlinerakzente.de Es gibt viele merkwürdige Erscheinungsformen bei Lebewesen allein der Hals einer Giraffe, dem höchsten Tier der
Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche
 Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche Wolfgang Staeck Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert
Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche Wolfgang Staeck Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert
SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE
 Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
ASIEN Landkarte Sonnenaufgang Osten lautet die Übersetzung des Wortes Asien. Dieser Erdteil ist der größte der Erde und beansprucht ein Drittel der ge
 ASIEN Landkarte Sonnenaufgang Osten lautet die Übersetzung des Wortes Asien. Dieser Erdteil ist der größte der Erde und beansprucht ein Drittel der gesamten Landfläche. In Asien leben die meisten Menschen,
ASIEN Landkarte Sonnenaufgang Osten lautet die Übersetzung des Wortes Asien. Dieser Erdteil ist der größte der Erde und beansprucht ein Drittel der gesamten Landfläche. In Asien leben die meisten Menschen,
ab 10 Jahre Muster Reptilien Original 50 Cent im Museum
 Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 10 Jahre Reptilien Die Räume sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfinden kann. Rechts von der großen Säulenhalle steht der Elefant. Hier fangen alle Raumnummern
Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 10 Jahre Reptilien Die Räume sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfinden kann. Rechts von der großen Säulenhalle steht der Elefant. Hier fangen alle Raumnummern

 Rif. 1291 Lionard Luxury Real Estate Via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Fax. +39 055 0548150 Camaiore Prächtige historische Villa zum Verkauf in
Rif. 1291 Lionard Luxury Real Estate Via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Fax. +39 055 0548150 Camaiore Prächtige historische Villa zum Verkauf in