Das Verhalten der Chromosomen in arteigener und artfremder Umgebung
|
|
|
- Krista Kalb
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Das Verhalten der Chromosomen in arteigener und artfremder Umgebung Von A. R U T I S H A U S E R (Schaffhausen) (Mit 3 Abbildungen lm Text) (Nach dem am 8. November 1954 in der Naturforschenden Gesellchaft Zürich gehaltenen Vortrag.) Manche Pflanzen- oder Tierarten enthalten ganze Chromosomen oder auch nur einzelne Chromosomensegmente, die sich in Bezug auf ihre Färbbarkeit vom Rest des Chromosomensatzes unterscheiden. Sie erfahren während der Telophase nicht die übliche Rückbildung und bleiben daher während der Interkinese sichtbar erhalten. HEITz l) hat diese abweichenden Chromosomenregionen als Heterochromatin, das restliche Chromatinmaterial als Euchromatin bezeichnet. DARLINGTON und LA COUR 2 ) definieren Heterochromatin als solche Chromosomenteile, die sich in Bezug auf die Produktion von Thymonukleinsäure (DNA) den anderen (euchromatischen) Chromosomenabschnitten gegenüber als azyklisch erweisen. Nach den Untersuchungen von MULLER und PAINTER 3 ) u. a. unterscheidet sich das Heterochromatin auch genetisch von Euchromatin. Es ist arm an Genen oder auch gänzlich frei davon. MATHER4) hingegen nimmt an, es enthalte Gene besonderer Art (polygenes). Das abweichende Verhalten des Heterochromatins in zytologischer und genetischer Hinsicht hat uns dazu veranlasst, seine Verteilung auf die Nachkommen und seine Reaktion der arteigenen und artfremden Umgebung gegenüber zu untersuchen. Bei dieser Arbeit stiessen wir auf einige Zusammenhänge, die z. T. Bestätigungen, z. T. aber auch Abweichungen von unserer Auffassung über das Verhalten der Chromosomen darstellen. Sie betreffen: Die Resultate, über welche in diesem Vortrag berichtet wird, stammen z. T. aus einer Gemeinschaftsarbeit, die zusammen mit L. F. LA COUR, John Innes Horticultural Institution, geplant und mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds ausgeführt worden ist. 1) HEITZ, E., 1928, Jahrb. Wiss. Bot. 69, ) DARLINGTON, C. D. and LA COUR, F. L., 1940, J. Genet., 40, ) MULLER, H. J. und PAINTER, T. S., 1932, Z. f. ind. Abst. u. Vererbungsl. 62, ) MATHER, K., 1941, J. Genet. 41, 159.
2 18 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich 1955 a b Abb. 1 Trillium grandiflorum, Metaphasen kältebehandelter Pflanzen. a) Standardkomplement mit f-chromosom. b) Chromosomenkomplement mit einem hybriden Paar homologer Chromosomen (E 3 links aussen; E1 rechts daneben), Phot. bei einer Vergr. von 1 : die Form und Physiologie der homologen Chromosomen, 2. die Verteilung der Chromosomen auf die F1-Generation und 3. die Erhaltung der Chromosomenindividualität im Verlaufe der Entwicklung. Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der homologen Chromosomen sind schon früher von DARLINGTON und LA CouR 2) ausgeführt worden. Unsere eigenen Ergebnisse stellen nur Bestätigungen und Erweiterungen dieser Arbeiten dar. Sie wurden, wie jene von DARLING'TON und LA COUR, an einigen Liliaceen, nämlich Paris quadrifolius und Trillium grandiflorum, luteum, cernuum und erectum, durchgeführt. Bei allen Trillium-Arten lässt sich das Heterochromatin nur im Ruhekern oder zu Beginn der Prophase nachweisen. Die heterochromatischen Regionen sind dann in Feulgen-Präparaten dunkler gefärbt als das Euchromatin. Im Verlaufe der Prophase verschwinden die Unterschiede. Die Metaphase-Chromosomen sind (mit Ausnahme der SFA) gleichmässig gefärbt. Differenzen zwischen Eu- und Heterochromatin erscheinen aber auch an Pro-, Meta- und Anaphase-Chromosomen, wenn die Pflanzen vor der Fixierung einer Temperatur ausgesetzt werden, die nahe dem Gefrierpunkt liegt (starvation-effekt). Die heterochromatischen Regionen kältebehandelter Trillium-Chromosomen sind in Feulgen-Präparaten heller gefärbt als das Euchromatin. DARLINGTON und LA CouR2) nehmen an, dass bei tiefen Temperaturen die Produktion von Thymonukleinsäure (DNA) herabgesetzt und die eu- und heterochromatischen Blöcke verschieden stark mit DNA beladen sind. Die Anordnung und Zahl der grossen heterochromatischen Regionen ist nach einer 4 Tage dauernden Kältebehandlung in den Zellen derselben Pflanze
3 Jahrg. 100 A. RUTISHAUSER. Das Verhalten der Chromosomen 19 konstant. Da sich die homologen Chromosomenpaare in Bezug auf Zahl und Lage der heterochromatischen Blöcke unterscheiden, ist es möglich, ihr Verhalten in arteigener und artfremder Umgebung zu untersuchen. Wir bezeichnen die fünf homologen Chromosomenpaare von Trillium mit den Buchstaben A bis E und geben die Zahl der heterochromatischen Regionen mit einem Index an. E. ist also ein E-Chromosom mit zwei heterochromatischen Regionen. Die meisten untersuchten Individuen von T. grandiflorum weisen das Chromosomenkomplement A 0A 0B 1B 1 C 1C 1D 1 D 1E2E2 auf (Abb. 1a). Wir bezeichnen es als Standardkomplement. Wie schon DARLINGTON und LA COUR gezeigt haben, sind die Partner der homologen Chromosomenpaare nicht immer gleich gebaut. Hin und wieder unterscheiden sie sich in Bezug auf die Zahl oder die Länge der heterochromatischen Regionen. So gibt es homologe Paare von E-Chromosomen des Typus E1 E 3 (Abb. 1b) oder E 2E3 usw. Das Ausmass dieser «hybriden» oder «heteromorphen» Struktur der homologen Chromosomenpaare variiert von Pflanze zu Pflanze. Es wurden Individuen gefunden, die 3 Paare solcher heteromorpher Chromosomen aufwiesen. Messungen haben gezeigt, dass die euchromatischen Chromosomenabschnitte der E 2 - und E 3-Chromosomen oder der C 1- und C 2-Chromosomen zusammengenommen gleich gross sind. Die Aussage, die homologen Chromosomen seien hinsichtlich der Zahl der heterochromatischen Regionen verschieden, bedeutet also nicht, dass die Abschnitte, die im einen Chromosom euchromatisch sind, im anderen als Heterochromatin erscheinen. Die heterochromatischen Regionen von Trillium sind wahrscheinlich eingeschaltete, zusätzliche Chromosomenstücke, denen keine euchromatischen Abschnitte zugeordnet werden können. Es ist denkbar, dass sie durch Verdoppelung und Vervielfachung schon bestehender, kleinster heterochromatischer Teilchen entstehen. Tatsächlich können wir in euchromatischen Stücken von E 2-Chromosomen gelegentlich kleine Einschnitte sehen, die ungefähr an der Stelle liegen, an welcher in homologen E3-Chromosomen grössere heterochromatische Blöcke erscheinen. Für unser Hauptproblem, die Frage nach dem Verhalten der Chromosomen in arteigener und artfremder Umgebung, hat sich die Differenz zwischen den homologen Chromosomen als ausserordentlich wertvoll erwiesen. Wegen dieser Heteromorphie der homologen Chromosomen war es uns z. B. möglich, d i e Verteilung der Trillium -Chromosomen auf die Fi-Generation zu verfolgen. Trillium ist allerdings kein gutes genetisches Versuchsobjekt. Die Aufzucht von Nachkommenschaften benötigt mehrere Jahre. Diese Schwierigkeiten können aber, wenn es sich nur darum handelt, zytologische Studien zu treiben, umgangen werden. Es ist für solche Untersuchungen gar nicht nötig, die F1-Nachkommen voll auswachsen zu lassen. Bis zu einem gewissen Grade kommen wir sogar überhaupt ohne F 1-Tochterpflanzen aus. Wie das möglich ist, zeigt die folgende kurze Darstellung der Samenentwicklung von Trillium grandiflorum: locum:
4 20 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich 1955 C. C C, Abb. 2 Schematische Darstellung der Embryosackentwicklung von Trillium grandiflorum (Allium-Typus). Erklärung im Text. Bei Paris quadrifolius und Trillium grandiflorum entwickelt sich der Embryosack nach dem Allium-Typus (Abb. 2). Die EMZ führt die erste RT durch, worauf 2 Dyadenzellen entstehen. Die mikropylare Dyade degeneriert, die chalazale bildet den ES. Von den 3 Teilungsschritten, die zum achtkernigen ES führen, stellt der erste die homöotype oder zweite RT dar, die beiden anderen sind rein mitotisch. Im Anschluss daran werden in jedem Pol des ES 4 Kerne gebildet. Aus der oberen Vierergruppe entwickelt sich der Eiapparat, aus der unteren die Antipoden. Je ein Kern der oberen und unteren Gruppe wandern gegeneinander und verschmelzen später zum sekundären Embryosackkern. Zusammen mit dem zugehörigen Plasma bilden sie die Zentralzelle. Auf die Bestäubung folgt bei den Blütenpflanzen eine doppelte Befruchtung: ein Spermakern des Pollenschlauches verschmilzt mit dem Eikern, ein zweiter mit den beiden Kernen der Zentralzelle. Beide befruchtete Zellen entwickeln sich zu einem Gewebekörper, die Eizelle zum Embryo, die Zentralzelle zum Nährgewebe oder Endosperm. Unsere Untersuchungen über die Verteilung der Chromosomen führten wir am Endosperm durch. Obwohl seine Genetik wegen der dreifachen Kernverschmelzung etwas komplizierter ist, hat es dem Embryo gegenüber einen unschätzbaren Vorteil voraus: schon die einfachste monohybride Kreuzung vom Typus Aa X aa erlaubt es uns «Tetradenanalysen» durchzuführen. Das ist leicht abzuleiten. Nehmen wir an, die beiden homologen Chromosomen einer Samenpflanze seien verschieden, z. B. C 1 und C 2. Führen wir die Kreu-
5 4 Jahrg. 100 A. RUTISHAUSER. Das Verhalten der Chromosomen 21 zung Ci C 2 X C 1 C 1 aus, so sind in den Endospermen folgende Chromosomenkombinationen zu erwarten: 1. Zwischen den beiden verschiedenen Chromatiden findet kein Austausch statt (Abb. 2). Dann gelangen in die eine Dyadenzelle zwei C i-chromatiden, in die andere C 2 C 2 oder umgekehrt. Alle Kerne des ES führen daher entweder das Chromosom C 1 oder das Chromosom C 2. Mit dem Pollenkorn führen wir ein C 1-Chromosom zu; also sind Nährgewebe von der Konstitution C 1 C ic 1 oder C ic 2C2 zu erwarten. 2. Zwischen der Differenz der beiden Chromosomen und der SFA findet ein Austausch statt. Dann gelangen in beide Dyadenzellen 2 Chromatiden des Typus C 1 C 9. Durch die zweite RT werden die beiden Chromatiden getrennt, am einen Pol des ES entstehen daher lauter Kerne mit C1-Chromosomen, am anderen solche mit C 2-Chromosomen. Die Zentralzelle ist daher C1C2. Befruchtung mit C 1 -Pollen ergibt ein Endosperm der Konstitution C1C1C2. Man sieht sofort, dass es möglich ist, aus dem Genotypus des Nährgewebes abzuleiten, wie die Chromosomen verteilt worden sind. Alle C i C 1 C i - und Tabelle 1 Verteilung heteromorpher homologer Chromosomen auf Fi-Endosperme von Trillium-Rassenkreuzungen. Kreuzungskombinationen und Elternpflanzen Fi-Endosperme Itedektionswert 03 X042 G3 ><G4 G55 X042 GH6 X045 OH13XG49 GH2 X 1 GH1 X 1 1. C, C 2 X C, C, Total C1C,C, C, C, C C1 C2 C E2E,XE2E2 E2E2E2 E1E,E, E, E, E, GH2 X OH 13X049 3 G40 ><G G40 X G72 X Total B,B, B, B, B, B, B, B, 4 4 G23 X
6 22 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich 1955 C1C2C2-Nährgewebe sind Präreduktionen. Sie sollten, wenn die Verteilung wirklich so erfolgt, wie es unsere Darstellung verlangt, im Verhältnis 1:1 auftreten. Zu erwarten sind daneben aber auch CIC1C2-Nährgewebe (Postreduktionen), und zwar in einer Häufigkeit, die abhängig ist von der Frequenz der crossing-over. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, werden in den C 1 C 2 X CiC1-Kreuzungen alle erwarteten Chromosomenkombinationen gefunden. Das gleiche gilt auch für die E 2E 3 XE 2E 2- und die B IB 1 XB IB 1-Kreuzungen. In allen drei Ver- 4 suchen erscheinen die beiden Präreduktionstypen etwa im Verhältnis 1: 1, daneben in einem relativ hohen Prozentsatz auch Postreduktionen. Die aus unseren Versuchen errechneten Reduktionswerte (LUDWIG) 5 ) sind sehr hoch, stimmen aber mit entsprechenden genetischen Versuchen überein. So hat LLUPOLD5) in seinen Tetradenanalysen von Schizosaccharomyces pombe fast genau die gleichen Werte erhalten. Immerhin lässt sich zumindest einer der gefundenen Reduktionswerte (42 %) nur dann verstehen, wenn Interferenz oder Lokalisation der Chiasmata angenommen wird. Ganz andere Resultate zeitigten dagegen Kreuzungsversuche mit akzessorischen f-chromosomen. Annähernd 25 % unserer Versuchspflanzen von T. grandiflorum enthielten einzelne, seltener zwei kurze, zusätzliche Chromosomen, die sich auch in den starvation-versuchen als euchromatisch erwiesen haben (Abb. la). Ihre Verteilung auf die F 1-Endosperme war verschieden, je nachdem ob die Samen- oder die Pollenpflanze das f-chromosom enthielt. Die Kreuzung Standard X f ergab Endosperme mit einem oder solche ohne f-chromosomen im Verhältnis 1:1 (vergleiche Tabelle 2). Wie erwartet, hat also nur eine Hälfte der Pollenkörner akzessorische Chromosomen mitbekommen. Die Kreuzung f X Standard hingegen ergab 13 Endosperme ohne und 67 mit 2 f-chromosomen (Tabelle 2). Daneben erschienen vereinzelt noch Endosperme mit einem oder 3 f-chromosomen. Bei regelmässiger Verteilung wären zu erwarten gewesen Endosperme ohne und (weil die weibliche Pflanze mit 2 Sätzen am Chromosomenkomplement des Endosperms beteiligt ist) solche mit 2 f-chromosomen im Verhältnis 1: 1. Die 2 f-endosperme überwiegen also deutlich. Die Verteilung der f-chromosomen auf die Gameten dürfte daher auf der weiblichen Seite anders vor sich gehen als auf der männlichen. Verlassen wir nun aber das Problem der Verteilung der Chromosomen und wenden uns einem letzten Fragenkomplex, der E rh a 1 t u n g d er I n d i v du a l i t ä t der C h r o m o s o m e n zu. Es wird angenommen, dass die Chromosomen im Verlaufe der Entwicklung des Organismus ihre Individualität beibehalten. Jede Zelle einer C 1 C 2-Pflanze z. B. sollte also ein ganzes C 1 - und ein ganzes C2 -Chromosom erhalten. Diese Annahme hat in den letzten Jahren insofern einige Korrekturen über sich ergehen lassen müssen, als 5) LUDWIG, V., 1937, Z. f. ind. Abst. u. Vererbungsl. 73, 332. u ) LEUPOLD, U., 1950, Ctes rend. hab. Carlsberg, Ser. physiol. 24, 381.
7 Jahrg. 100 A. RUTISHAUSER. Das Verhalten der Chromosomen 23 Tabelle 2 Verteilung der f-chromosomen auf Endosperme von Trillium- Rassenkreuzungen. I{reuzungs1 ombinationen und Elternpflanzen Anzahl f O 1 I X f G34 X G46 XG X GH13XG Total f X 0 G23XG G40XG Total gezeigt werden konnte (GEITLER) 7), dass die Chromosomenzahl der differenzierten Zellen von zahlreichen Pflanzen- und Tierarten nicht immer mit der Chromosomenzahl der befruchteten Eizelle oder der meristematischen Zellen übereinstimmt. Die Chromosomenzahl verändert sich im Verlaufe der Zelldifferenzierung, und zwar in der Regel so, dass sie sich verdoppelt oder vervielfacht. An unserem eigenen Material, dem Nährgewebe von Trillium-Arten, konnte diese Beobachtung auch gemacht werden. Nicht selten fanden wir statt der erwarteten triploiden Chromosomenzahl 3n = 15 die hexaploide 6n = 30, in einzelnen Fällen sogar die duodecaploide 12n = 60. Zu unserer grössten Überraschung waren aber diese Vervielfachungen weder die einzigen noch die häufigsten Abweichungen. Viel häufiger, und zwar in einem vermutlich vom Verwandtschaftsgrad der Eltern abhängigen Mass erscheinen im Endosperm auch ausserordentlich auffällige Veränderungen der Chromosomenform und Grösse, welche zeigen, dass die C h r o m o s o m e n- individualität nicht unter allen Umständen aufrecht erhalten wird. Im arteigenen Plasma behalten zwar die Chromosomen in der Regel ihre Individualität bei. Schon hier gibt es aber Ausnahmen. Mit einer Häufigkeit von 0,8 % treten da und dort, über das Nährgewebe verstreut, Mitosen auf, die in einem oder in 2 der 15 Chromosomen Aberrationen aufweisen. Sie bestehen meist darin, dass einzelne Chromosomen Stückverlust erleiden. Die Bruchstellen liegen meistens in den euchromatischen Regionen. Nicht selten werden auch Rekombinationen gefunden, so z. B. dizentrische Chromosomen, die durch Translokation zwischen nicht homologen Chromosomen entstanden sind (Abb. 3a). 7 ) GEITLER, L., 1948, Oest. Bot. Z. 95, 277.
8 24 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich 1955 a Abb. 3 Spontane Chromosomenbrüche im Endosperm. a) Trillium grandiflorum, Metaphase mit dizentrischem Chromosom (B -F D rechts unten) und azentrischem Fragment. b) Paris quadrifolius x Trillium cernuum, Metaphase. Die 4 Chromosomen mit heterochromatischen Regionen stammen von T. cernuum. Stückverlust des A- Chromosoms mit Pfeil angegeben, Phot. bei einer Vergr. von 1 : 800. b Ähnliche Veränderungen der Chromosomenindividualität, nur in weit höherem Masse, treten auch in den hybriden Nährgeweben auf, die durch Gattungsbastardierungen entstanden sind. Die Kreuzung Paris quadrifolius X Trillium grandiflorum oder T. cernuum eignet sich ausgezeichnet für derartige Untersuchungen. Die Chromosomen von Paris quadrifolius sind auch nach Kältebehandlung stets rein euchromatisch. Die Trillium-Chromosomen lassen sich daher, sofern sie heterochromatische Blöcke einschliessen, leicht erkennen. In kältebehandelten Nährgeweben von Paris X Trillium-Kreuzungen ist es deshalb nicht nur möglich zu bestimmen, wie sich die einzelnen Chromosomen der beiden Arten verhalten, sogar das Verhalten der einzelnen Chromosomenregionen kann untersucht werden. Wie bei den Endospermen der Rassenkreuzungen treten auch in den Endospermen von Gattungskreuzungen spontane Chromosomenbrüche in den euchromatischen, seltener in den heterochromatischen Regionen auf (C; eu, Ci het, vgl. Tab. 3 und Abb. 3b). Im Anschluss an SR (sister reunion) oder Translokation werden dizentrische Chromosomen gebildet (C und C.;). Seltener erscheinen daneben auch monozentrische Ringe (C1r). Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, nimmt die Zahl der Chromosomenbrüche mit dem Alter der Samenanlagen zu. Das ist wohl so zu verstehen, dass zu den alten Brüchen, die wegen des «breakage-fusion-bridge-cycle» (MCCLINToCK) 8 ) oder aus anderen Gründen persistieren, immer neue dazu kommen. Die Zahl der Brüche dürfte pro Teilungswelle nur klein sein. Dafür spricht die geringe Zahl von azentrischen Fragmenten. Interessanterweise werden die Chromosomen nicht gleichmässig gebrochen. Die in Tabelle 3 zusammengestellten Versuchsresultate zeigen deutlich, dass 8 ) MCCLINTOCK, B., 1942, Proc. Nat. Acad. Sci. 28, 458.
9 Jahrg. 100 A. RUTISHAUSER. Das Verhalten der Chromosomen 25 Tabelle 3 Häufigkeit der Chromosomenbrüche im Endosperm der Kreuzung Paris quadrifolius x Trillium cernuum. Chromosomen- Bezeichnung Anzahl Normale Chromosomen eu C" ' C" SR het Non disj, Cir Cz C; Translokationen Fragmente Aberrante Chromosinnen in! Tage A ,3 B ,2 D E ,4 Total Co + 20,9 1 m Tage A ,7 B ,9 D ,4 E ,5 Total Co + 35, der höchste Anteil an Brüchen den A- und den E-Chromosomen zufällt. Die zwanzig rein euchromatischen Chromosomen von Paris quadrifolius und das euchromatische C-Chromosom von Trillium cernuum werden in der Regel nicht gebrochen. Es ist denkbar, dass das Heterochromatin auf die spontanen Chromosomenbrüche, die durch Bastardierung ausgelöst worden sind, einen Einfluss ausübt. Die hohe Frequenz spontaner Chromosomenbrüche im Nährgewebe von Paris X Trillium-Kreuzungen stellt uns meines Wissens vor eine neue Situation: Das Gesetz der Erhaltung der Chromosomenindividualität im Verlaufe der Entwicklung wird schon nach Rassenkreuzung, noch mehr aber nach Gattungskreuzung durchbrochen. Die Chromosomen verändern ihre Form, wenn sie in eine neue Umgebung verbracht werden; sie verlieren einzelne Abschnitte und fügen sich zu neuen Kombinationen zusammen. Es ist bekannt, dass ähnliche Veränderungen der Chromosomenindividualität mit Hilfe mutagener Agentien, wie X-, a-, /3- und y-strahlen und bestimmter chemischer Stoffe wie Senfgas, erreicht werden können. Ein wesentlicher Unterschied besteht zwar: Die spontanen Chromosomenbrüche sind mehr lokalisiert und scheinen insofern spezifischer zu sein, als nur ein Teil der bei Röntgenbestrahlung auftretenden Rekombinationen gefunden wurden. Der allgemeine genetische Effekt dürfte aber in beiden Fällen der gleiche sein: Die einfache Übertragung eines Chromosomensatzes in artfremde Umgebung führt ebenso zu einer Erhöhung der Mutationsrate wie die Behandlung mit mutagenen Agentien. Man ist natürlich versucht, aus der Tatsache, dass durch Kreuzung allein die Frequenz der Chromosomenbrüche erhöht werden kann, weitgehende Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jalug. 100,
10 26 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich 1955 Schlüsse in Bezug auf die Evolution zu ziehen. Nun sind aber alle Untersuchungen über die Erhöhung der spontanen Mutationsrate am Endosperm ausgeführt worden. Weil das Nährgewebe eine Funktion ausübt, die jener von Drüsenzellen gleicht, und weil es daher vermutlich einen lebhafteren, vielleicht auch anders gearteten Stoffwechsel aufweist als eine embryonale Zelle, ist sehr wohl denkbar, dass es empfindlicher reagiert als das meristematische Gewebe. Die durch Bastardierung ausgelösten Chromosomenbrüche könnten daher auf das Nährgewebe beschränkt sein. Wenn das der Fall sein sollte, sind die festgestellten Veränderungen der Chromosomenstruktur vom Standpunkt der Evolution aus gesehen ohne Bedeutung. Das Nährgewebe hat am Aufbau der neuen Tochterpflanze keinen Anteil. Ob die Frequenz der spontanen Chromosomenbrüche auch im Embryo durch Bastardierung erhöht wird, wissen wir noch nicht. Dagegen ist wahrscheinlich, dass die Samenfertilität durch das Vorkommen von spontanen Chromosomenbrüchen im Endosperm wesentlich beeinträchtigt wird. Weil der Keimling vom Endosperm ernährt werden muss, hängt seine Entwicklung in ganz entscheidendem Masse von der Funktionstüchtigkeit des Nährgewebes ab. Der Erfolg von Art- und Gattungskreuzungen wird deshalb nicht zuletzt von den zytologischen Vorgängen bestimmt, die im wachsenden Endosperm ablaufen. Bei Ranunculu's auricomus ist mir der Nachweis gelungen"), dass sogar Kreuzungen zwischen Mikrospecies derselben Sammelart wegen des Vorkommens spontaner Chromosomenbrüche im Endosperm fehlschlagen. Dort wirken die Mitoseanomalien als Isolationsmechanismen, welche die Vermischung zweier Kleinarten verhindern.
Verschmelzung zweier geschlechtsverschiedener
 Verschmelzung zweier geschlechtsverschiedener Zellen (Gameten) zu einer Zygote Plasmogamie - Karyogamie Der DNA Gehalt würde sich laufend verdoppeln. Daher: Im Entwicklungs-zyklus muss vor der Zygotenbildung
Verschmelzung zweier geschlechtsverschiedener Zellen (Gameten) zu einer Zygote Plasmogamie - Karyogamie Der DNA Gehalt würde sich laufend verdoppeln. Daher: Im Entwicklungs-zyklus muss vor der Zygotenbildung
Verschmelzung zweier geschlechtsverschiedener
 Verschmelzung zweier geschlechtsverschiedener Zellen (Gameten) zu einer Zygote Plasmogamie - Karyogamie Der DNA Gehalt würde sich laufend verdoppeln. Daher: Im Entwicklungs-zyklus muss vor der Zygotenbildung
Verschmelzung zweier geschlechtsverschiedener Zellen (Gameten) zu einer Zygote Plasmogamie - Karyogamie Der DNA Gehalt würde sich laufend verdoppeln. Daher: Im Entwicklungs-zyklus muss vor der Zygotenbildung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Wiederholung Dissimilation; biologische Oxidation; Atmung Hydrolyse der Stärke; Endo- ( -Amylase) und Exoamylasen ( -Amylase) Phosphorolyse der Stärke
 Wiederholung Dissimilation; biologische Oxidation; Atmung Hydrolyse der Stärke; Endo- ( -Amylase) und Exoamylasen ( -Amylase) Phosphorolyse der Stärke Wiederholung 1. Glukoseaktivierung 2. Glykolyse 3.
Wiederholung Dissimilation; biologische Oxidation; Atmung Hydrolyse der Stärke; Endo- ( -Amylase) und Exoamylasen ( -Amylase) Phosphorolyse der Stärke Wiederholung 1. Glukoseaktivierung 2. Glykolyse 3.
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr / Paket von 6 Sätzen
 "Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
Learn4Med. Ein Gen steuert die Haarfarbe einer Katze. Es gibt ein Allel (also eine Version) für ein schwarzes Fell und ein Allel für rote Haare.
 1. Mendelsche Regeln Bei Mendel ist ein Gen als Teil des Erbmaterials definiert, der für die Ausbildung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist. Gibt es für dieses Gen verschiedene Ausprägungen, nennt
1. Mendelsche Regeln Bei Mendel ist ein Gen als Teil des Erbmaterials definiert, der für die Ausbildung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist. Gibt es für dieses Gen verschiedene Ausprägungen, nennt
Grundlagen der Vererbungslehre
 Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Chromosomen & Populationsgenetik (1)
 Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: 1 Karyogramme Chromosomen & Populationsgenetik (1) Bestimmen Sie den Karyotyp der folgenden
Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: 1 Karyogramme Chromosomen & Populationsgenetik (1) Bestimmen Sie den Karyotyp der folgenden
Modul Biologische Grundlagen Kapitel I.2 Grundbegriffe der Genetik
 Frage Was sind Fachbegriffe zum Thema Grundbegriffe der Genetik? Antwort - Gene - Genotyp - Phänotyp - Genom - Dexoxyribonucleinsäure - Träger genetischer Information - Nukleotide - Basen - Peptid - Start-Codon
Frage Was sind Fachbegriffe zum Thema Grundbegriffe der Genetik? Antwort - Gene - Genotyp - Phänotyp - Genom - Dexoxyribonucleinsäure - Träger genetischer Information - Nukleotide - Basen - Peptid - Start-Codon
Teil Osiewacz, 8 Fragen, 55 Punkte)
 Teil Osiewacz, 8 Fragen, 55 Punkte) Frage 1: 8 Punkte Die Kernteilungsspindel ist aus verschiedenen Fasern aufgebaut. a) Welche Fasern sind das? (3 Punkte) b) Welche dieser Fasern setzen in der Metaphaseplatte
Teil Osiewacz, 8 Fragen, 55 Punkte) Frage 1: 8 Punkte Die Kernteilungsspindel ist aus verschiedenen Fasern aufgebaut. a) Welche Fasern sind das? (3 Punkte) b) Welche dieser Fasern setzen in der Metaphaseplatte
1 Regeln der Vererbung
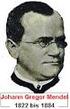 1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
2. Übung: Chromosomentheorie
 Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Zellzyklus G 1 Phase: postmitotische Phase oder Präsynthesephase Zelle beginnt wieder zu wachsen
Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Zellzyklus G 1 Phase: postmitotische Phase oder Präsynthesephase Zelle beginnt wieder zu wachsen
Ergebnisse einiger Hybridisierungsversudie zwischen Picea sitchensis (Bong.) Carr. und Picea Omorika (Pan&;) Purkyne
 (Aus der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Schmalenbeck) Ergebnisse einiger Hybridisierungsversudie zwischen Picea sitchensis (Bong.)
(Aus der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Schmalenbeck) Ergebnisse einiger Hybridisierungsversudie zwischen Picea sitchensis (Bong.)
-Generation sehen alle gleich aus (Uniformitätsregel). In der F 2. -Generation treten unterschiedliche Phänotypen auf (Spaltungsregel).
 Mendelsche Regeln 1 + 2 (1) Merkmale wie die Blütenfarbe können dominant-rezessiv oder intermediär vererbt werden. Bei einem intermediären Erbgang wird die Merkmalsausprägung von beiden Allelen (z. B.
Mendelsche Regeln 1 + 2 (1) Merkmale wie die Blütenfarbe können dominant-rezessiv oder intermediär vererbt werden. Bei einem intermediären Erbgang wird die Merkmalsausprägung von beiden Allelen (z. B.
Genetik-Protokolle 1.Teil
 Naturwissenschaft Sabrina Engels Genetik-Protokolle 1.Teil 1 Genetisches Blockpraktikum für Lehramt SII im Hauptstudium 1. Woche vom 18.2-23.2.2002 Cytogenetischer Teil - Chromosomen Gliederung. 1. Präparation
Naturwissenschaft Sabrina Engels Genetik-Protokolle 1.Teil 1 Genetisches Blockpraktikum für Lehramt SII im Hauptstudium 1. Woche vom 18.2-23.2.2002 Cytogenetischer Teil - Chromosomen Gliederung. 1. Präparation
Evolution, Genetik und Erfahrung
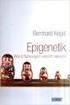 Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Wie werden Keimzellen gebildet?
 Wie werden Keimzellen gebildet? Keimzellen (Samenzellen und Eizelle) werden über eine neue Kernteilungsform erzeugt: die MEIOSE ( Reifeteilung I und II) Eizelle mit Zellkern Samenzellen mit Erbmaterial
Wie werden Keimzellen gebildet? Keimzellen (Samenzellen und Eizelle) werden über eine neue Kernteilungsform erzeugt: die MEIOSE ( Reifeteilung I und II) Eizelle mit Zellkern Samenzellen mit Erbmaterial
Entwicklung der Tiere
 Entwicklung der Tiere Entwicklung beginnt, wie immer, mit einer ersten Zelle. Diese Zelle ist die befruchtete, diploide Zygote, deren Kern durch Verschmelzung der Kerne einer männlichen und einer weiblichen
Entwicklung der Tiere Entwicklung beginnt, wie immer, mit einer ersten Zelle. Diese Zelle ist die befruchtete, diploide Zygote, deren Kern durch Verschmelzung der Kerne einer männlichen und einer weiblichen
Übungsaufgaben zum Zellzykler 1/5 Jahrgangsstufe
 Übungsaufgaben zum Zellzykler 1/5 Jahrgangsstufe 9 + 11 Übungsaufgaben zum Kapitel Genetik mit Hilfe des Lernprogramms Zellzykler Tipp: Vergleiche auf der KGA-Biologie-Unterrichtsmaterialseite im Lehrplan
Übungsaufgaben zum Zellzykler 1/5 Jahrgangsstufe 9 + 11 Übungsaufgaben zum Kapitel Genetik mit Hilfe des Lernprogramms Zellzykler Tipp: Vergleiche auf der KGA-Biologie-Unterrichtsmaterialseite im Lehrplan
CHROMOSOMENANOMALIEN
 CHROMOSOMENANOMALIEN Zur Diagnose best. genet. Krankheiten kultiviert man die Lymphozyten aus einer Blutprobe und blockiert den Mitoseablauf durch Colchicin. Die Anordnung der identifizierten Chromosomen
CHROMOSOMENANOMALIEN Zur Diagnose best. genet. Krankheiten kultiviert man die Lymphozyten aus einer Blutprobe und blockiert den Mitoseablauf durch Colchicin. Die Anordnung der identifizierten Chromosomen
2. Übung: Chromosomentheorie
 Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Regeln zur Vererbung Autosomal rezessiv: - Merkmal tritt auf in Nachkommen nicht betroffener Eltern
Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Regeln zur Vererbung Autosomal rezessiv: - Merkmal tritt auf in Nachkommen nicht betroffener Eltern
Bestäubung und Befruchtung. Michele Notari
 Michele Notari Vorstellung Vorgänge innerhalb der sexuellen Fortpflanzung von Blütenpflanzen Strategien zur Uebertragung von Gameten und Vorgang der Verschmelzung der Gameten 2 Lernziele Sie kennen die
Michele Notari Vorstellung Vorgänge innerhalb der sexuellen Fortpflanzung von Blütenpflanzen Strategien zur Uebertragung von Gameten und Vorgang der Verschmelzung der Gameten 2 Lernziele Sie kennen die
T 5 FF 16 Arbeitsblatt 4
 T 5 FF 16 Arbeitsblatt 4 Zell bestandteile als Teile eines Staates Ordne die folgenden Begriffe aus der Staatskunde den Beschreibungen zu : produktive Fläche Transportsystem Grenze Brachland / Speicher
T 5 FF 16 Arbeitsblatt 4 Zell bestandteile als Teile eines Staates Ordne die folgenden Begriffe aus der Staatskunde den Beschreibungen zu : produktive Fläche Transportsystem Grenze Brachland / Speicher
Bsp.: Trisomie 21 (früher: Mongolismus, heute: DOWN-Syndrom)
 3.3.4.5 Genommutationen Def.: Mutation = durch einen Verursacher hervorgerufene oder spontane Veränderung im Erbgut, die an die Nachkommen weiter gegeben wird. Mutationen können einzelne Gene betreffen,
3.3.4.5 Genommutationen Def.: Mutation = durch einen Verursacher hervorgerufene oder spontane Veränderung im Erbgut, die an die Nachkommen weiter gegeben wird. Mutationen können einzelne Gene betreffen,
6.1. Welche Merkmale besitzen die fünf Wirbeltierklassen? 6.2. Wodurch sind alle Wirbeltiere gekennzeichnet? 6.3
 6.1 Welche Merkmale besitzen die fünf Wirbeltierklassen? 6.2 Wodurch sind alle Wirbeltiere gekennzeichnet? Wirbelsäule mit Schädel knöchernes Innenskelett Kopf, Rumpf und Gliedmaßen geschlossener Blutkreislauf
6.1 Welche Merkmale besitzen die fünf Wirbeltierklassen? 6.2 Wodurch sind alle Wirbeltiere gekennzeichnet? Wirbelsäule mit Schädel knöchernes Innenskelett Kopf, Rumpf und Gliedmaßen geschlossener Blutkreislauf
DNA enthält Gene. DNA Struktur. DNA Replikation. Gentransfer in Bakterien
 6. DNA Bakteriengenetik Konzepte: DNA enthält Gene DNA Struktur DNA Replikation Gentransfer in Bakterien Bakteriophagen 2. Welcher der folgenden Sätze entspricht der Chargaff Regel? A) Die Menge von Purinen
6. DNA Bakteriengenetik Konzepte: DNA enthält Gene DNA Struktur DNA Replikation Gentransfer in Bakterien Bakteriophagen 2. Welcher der folgenden Sätze entspricht der Chargaff Regel? A) Die Menge von Purinen
Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte
 Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte Frage 1: 10 Punkte a) Die Bildung der Gameten bei Diplonten und bei Haplonten erfolgt im Verlaufe von Kernteilungen. Ergänzen Sie die angefangenen Sätze (2
Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte Frage 1: 10 Punkte a) Die Bildung der Gameten bei Diplonten und bei Haplonten erfolgt im Verlaufe von Kernteilungen. Ergänzen Sie die angefangenen Sätze (2
Vermehrung von Zellen Mitose und Meiose
 VI Genetik und Biotechnologie Beitrag 4 (Klasse 9/10) 1 von 26 Vermehrung von Zellen Mitose und Meiose Claudia Ritter und Joachim Poloczek, Winterbach In unserem Körper sterben täglich etwa 2 % der rund
VI Genetik und Biotechnologie Beitrag 4 (Klasse 9/10) 1 von 26 Vermehrung von Zellen Mitose und Meiose Claudia Ritter und Joachim Poloczek, Winterbach In unserem Körper sterben täglich etwa 2 % der rund
Korrektion für die 11. Auflage
 Korrektion für die 11. Auflage Seite 20 2.2.2 Meiose 5. Satz Kurz vor Beginn der 1. Reifeteilung verdoppeln die weiblichen und die männlichen Keimzellen, (primäre Oozyten und primäre Spermatozyten) ihre
Korrektion für die 11. Auflage Seite 20 2.2.2 Meiose 5. Satz Kurz vor Beginn der 1. Reifeteilung verdoppeln die weiblichen und die männlichen Keimzellen, (primäre Oozyten und primäre Spermatozyten) ihre
Zytologisch bedingte Ei- und Zygotensterilität bei tripoiden Apfelsorten (Vorläufige Mitteilung)
 Zytologisch bedingte Ei- und Zygotensterilität bei tripoiden Apfelsorten (Vorläufige Mitteilung) Autor(en): Steinegger, P. Objekttyp: Article Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft
Zytologisch bedingte Ei- und Zygotensterilität bei tripoiden Apfelsorten (Vorläufige Mitteilung) Autor(en): Steinegger, P. Objekttyp: Article Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft
Kreuzungsversuche mit Larix europaea D.C. und Larix leptolepis Gord.')
 (Aus der Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Abt. Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Schmalenbeck) Kreuzungsversuche mit Larix europaea D.C. und Larix leptolepis Gord.') Von WOLFGANG LANCNER
(Aus der Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Abt. Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Schmalenbeck) Kreuzungsversuche mit Larix europaea D.C. und Larix leptolepis Gord.') Von WOLFGANG LANCNER
- 2 - Der Affe in uns
 Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
- 2 - Der Affe in uns
 Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
Tier- & Pflanzenzelle
 B301 CYTOLOGIE: Tier- & Pflanzenzelle 1. Vergleichen Sie die hier dargestellten Strukturen. Welche Zelle ist eine pflanzliche, welche eine tierische Zelle? Zelle Zelle a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
B301 CYTOLOGIE: Tier- & Pflanzenzelle 1. Vergleichen Sie die hier dargestellten Strukturen. Welche Zelle ist eine pflanzliche, welche eine tierische Zelle? Zelle Zelle a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
27 Funktionelle Genomanalysen Sachverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Die Chromosomen sind im Zellkern immer paarweise vorhanden. In der menschlichen Zelle befinden sich 23 Chromosomenpaare. Diese bilden den diploiden
 Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Die Erbinformation ist in Form von Chromosomen = Kopplungsgruppen organisiert
 Die Erbinformation ist in Form von Chromosomen = Kopplungsgruppen organisiert Chromosom Chromatin Ausschnitt aus DNA-Doppelhelix Nukleosomen (Chromatin) Chromatinfaden höherer Ordnung Teil eines Chromosoms
Die Erbinformation ist in Form von Chromosomen = Kopplungsgruppen organisiert Chromosom Chromatin Ausschnitt aus DNA-Doppelhelix Nukleosomen (Chromatin) Chromatinfaden höherer Ordnung Teil eines Chromosoms
6. DNA - Bakteriengenetik
 6. DNA - Bakteriengenetik Konzepte: DNA Struktur DNA Replikation Gentransfer in Bakterien Francis Crick 2. Welcher der folgenden Sätze entspricht der Chargaff-Regel? A) Die Menge von Purinen (T und C)
6. DNA - Bakteriengenetik Konzepte: DNA Struktur DNA Replikation Gentransfer in Bakterien Francis Crick 2. Welcher der folgenden Sätze entspricht der Chargaff-Regel? A) Die Menge von Purinen (T und C)
Entwicklung aber anders...
 Entwicklung aber anders... Zwei der Merkmale des Lebens sind das Wachstum und die Fortpflanzung. (Welches sind die restlichen?) Einfache, einzellige Lebewesen haben ein beschränktes Wachstum, da die Größe
Entwicklung aber anders... Zwei der Merkmale des Lebens sind das Wachstum und die Fortpflanzung. (Welches sind die restlichen?) Einfache, einzellige Lebewesen haben ein beschränktes Wachstum, da die Größe
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ist der "Lacewing" Halsbandsittich wirklich ein Lacewing?
 Ist der "Lacewing" Halsbandsittich wirklich ein Lacewing? P. Frenger (7998) Lacewing!! Diese Bezeichnung für einen Farbschlag aus der Mutationszucht wurde ursprünglich von englischen Wellensittichzüchtern
Ist der "Lacewing" Halsbandsittich wirklich ein Lacewing? P. Frenger (7998) Lacewing!! Diese Bezeichnung für einen Farbschlag aus der Mutationszucht wurde ursprünglich von englischen Wellensittichzüchtern
Klassische Genetik. Die Mendelschen Regeln
 Klassische Genetik Die Mendelschen egeln Übersicht 1 Die klassische Genetik eine Einführung 1 2 Die Mendelschen egeln 1 2.1 Die Erste Mendel sche egel Die Uniformitätsregel..................... 3 2.2 Die
Klassische Genetik Die Mendelschen egeln Übersicht 1 Die klassische Genetik eine Einführung 1 2 Die Mendelschen egeln 1 2.1 Die Erste Mendel sche egel Die Uniformitätsregel..................... 3 2.2 Die
An den Chromatiden entstehen durch Anfärbung sichtbare Querbanden. Sie sind auf beiden Chromatiden gleich. (nur Autosome nicht Gonosome)
 Zusammenfassung / Vorbereitung auf Biologie Klausur Die Arme von Chromosomen werden unterteilt in: 1. kurzes Stück oben = p-arm 2. langes Stück unten = q-arm Die Arme der Chromosomen werden Chromatiden
Zusammenfassung / Vorbereitung auf Biologie Klausur Die Arme von Chromosomen werden unterteilt in: 1. kurzes Stück oben = p-arm 2. langes Stück unten = q-arm Die Arme der Chromosomen werden Chromatiden
vegetatives Nervensystem Zentrales Nervensystem ZNS Nervenzelle Synapse unwillkürlicher Teil des Nervensystems mit Sympathicus und Parasympathicus;
 vegetatives Nervensystem ( 9. Klasse 1 / 32 ) unwillkürlicher Teil des Nervensystems mit Sympathicus und Parasympathicus; innerviert innere Organe, Blutgefäße und Drüsen bestehend aus Zentrales Nervensystem
vegetatives Nervensystem ( 9. Klasse 1 / 32 ) unwillkürlicher Teil des Nervensystems mit Sympathicus und Parasympathicus; innerviert innere Organe, Blutgefäße und Drüsen bestehend aus Zentrales Nervensystem
Cox-Regression. Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells
 Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Bestehend aus Gehirn und Rückenmark. Bestehend aus den Gegenspielern (Antagonisten) Sympathikus und Parasympathikus;
 Neuron 9 1 9 1 kleinstes Bauelement des ZNS dient der Aufnahme, gerichteten Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen Bestandteile: Dendriten, Soma, Axon, Endknöpfchen 9 2 9 2 Zentrales Nervensystem
Neuron 9 1 9 1 kleinstes Bauelement des ZNS dient der Aufnahme, gerichteten Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen Bestandteile: Dendriten, Soma, Axon, Endknöpfchen 9 2 9 2 Zentrales Nervensystem
Pinschertage der OG Bonn Grundlagen der Zucht
 Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Tabelle 72: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Farbgebungen
 Tabelle 72: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Farbgebungen Deutschland Frankreich 4-Farb-Druck 87,5 75,0 Schwarz/weiß 6,9 12,5 S/w + 1 Farbe 5,6 12,5 Die restlichen Werbeanzeigen fallen durch eine
Tabelle 72: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Farbgebungen Deutschland Frankreich 4-Farb-Druck 87,5 75,0 Schwarz/weiß 6,9 12,5 S/w + 1 Farbe 5,6 12,5 Die restlichen Werbeanzeigen fallen durch eine
Bimagische Quadrate. 14 Tage wurde dann die Lösung veröffentlicht Abb. 11.1: Das erste bimagische Quadrat der Ordnung n = 8 von Pfeffermann
 K a p i t e l 11 Bimagische Quadrate Der Franzose G. Pfeffermann entdeckte 1890 das erste bimagische Quadrat der Welt und veröffentlichte es am 15. Januar 1891 in der Zeitschrift Les Tablettes du Chercheur
K a p i t e l 11 Bimagische Quadrate Der Franzose G. Pfeffermann entdeckte 1890 das erste bimagische Quadrat der Welt und veröffentlichte es am 15. Januar 1891 in der Zeitschrift Les Tablettes du Chercheur
Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge
 Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge Dominik Urig Saarbrücken, den 10.01.2012 Inhaltsangabe 1 Biologische
Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge Dominik Urig Saarbrücken, den 10.01.2012 Inhaltsangabe 1 Biologische
F2 aus der Kreuzung mit der ersten Mutante: 602 normal, 198 keine Blatthaare
 Klausur Genetik Name: Matrikelnummer: Sie haben 90 Minuten Zeit zur Bearbeitung der 23 Fragen (z. T. mit Unterpunkten). Insgesamt sind 42 Punkte zu vergeben. Die Klausur gilt als bestanden, falls 21 Punkte
Klausur Genetik Name: Matrikelnummer: Sie haben 90 Minuten Zeit zur Bearbeitung der 23 Fragen (z. T. mit Unterpunkten). Insgesamt sind 42 Punkte zu vergeben. Die Klausur gilt als bestanden, falls 21 Punkte
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Intermediäre Erbgänge
 Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Intermediäre Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Intermediäre Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Patienteninformation zur Präimplantationsdiagnostik V3 07/2015 Seite 1 von 5
 Medizinisch Genetisches Zentrum Prof. Dr. med. Dipl. chem. Elke Holinski-Feder, PD Dr. med. Angela Abicht Fachärztinnen für Humangenetik, MVZ Patienteninformation zur Präimplantationsdiagnostik Begriffserläuterung
Medizinisch Genetisches Zentrum Prof. Dr. med. Dipl. chem. Elke Holinski-Feder, PD Dr. med. Angela Abicht Fachärztinnen für Humangenetik, MVZ Patienteninformation zur Präimplantationsdiagnostik Begriffserläuterung
Das Satnengewicht bei Kreuzungen innerhalb der Sektion Populus Leuce als Funktion des weiblichen und männlichen Partners
 Erblichkeitslehre. Jena 1926. - KRISTENSEN, R. K.: Anlq og sigkeit im ostdeutschen Kiefernwald. Deutscher Forstwirt 20, Opgrarelse af Markfors~g. Tidskr. f. Planteavl. 31, 1925. - LIND- 509-514, 525-528,
Erblichkeitslehre. Jena 1926. - KRISTENSEN, R. K.: Anlq og sigkeit im ostdeutschen Kiefernwald. Deutscher Forstwirt 20, Opgrarelse af Markfors~g. Tidskr. f. Planteavl. 31, 1925. - LIND- 509-514, 525-528,
John Daltons Atomhypothese. 1. Wie kommt Dalton auf die Atomhypothese? a. Die Eigenschaften des Wassers
 John Daltons Atomhypothese 1. Wie kommt Dalton auf die Atomhypothese? a. Die Eigenschaften des Wassers 2. Welche Aussagen trifft Dalton mit Hilfe des Atommodells? A. Verhalten von Stoffen bei chem. Reaktionen
John Daltons Atomhypothese 1. Wie kommt Dalton auf die Atomhypothese? a. Die Eigenschaften des Wassers 2. Welche Aussagen trifft Dalton mit Hilfe des Atommodells? A. Verhalten von Stoffen bei chem. Reaktionen
Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick-
 Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
10 Kapitel I: Anschauliche Vektorrechnung
 10 Kapitel I: Anschauliche Vektorrechnung haben. In Mengenschreibweise ist G = {x x = a + tb für ein t R}. Wir werden für diese einführenden Betrachtungen im Interesse einer knappen Redeweise jedoch häufig
10 Kapitel I: Anschauliche Vektorrechnung haben. In Mengenschreibweise ist G = {x x = a + tb für ein t R}. Wir werden für diese einführenden Betrachtungen im Interesse einer knappen Redeweise jedoch häufig
(VerUg ^on Julius Springer, Berlin.) (Aus der Forschungsabteilung der F. v. Lochow-Petkus G.m.b.H.. Petkus/Mark) Polyploider Roggen.
 106 Sonderdruck aus,,der Zäditer*\ 12. Jahrgang J940, Heft 8. (VerUg ^on Julius Springer, Berlin.) (Aus der Forschungsabteilung der F. v. Lochow-Petkus G.m.b.H.. Petkus/Mark) m Laufe der letzten Jahrzehnte
106 Sonderdruck aus,,der Zäditer*\ 12. Jahrgang J940, Heft 8. (VerUg ^on Julius Springer, Berlin.) (Aus der Forschungsabteilung der F. v. Lochow-Petkus G.m.b.H.. Petkus/Mark) m Laufe der letzten Jahrzehnte
Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1. Übung
 Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: Einführung Übung Bitte bereiten Sie folgende Probleme vor der Übung am Mittwoch. Die Klausur
Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: Einführung Übung Bitte bereiten Sie folgende Probleme vor der Übung am Mittwoch. Die Klausur
Biologie für Mediziner WiSe 2007/08
 Biologie für Mediziner WiSe 2007/08 Praktikumsteilteil: Zellzyklus und Mitose (Zellteilung) Meiose (Reifeteilung) Leitung: PD Dr. Joachim Schachtner Folien zum download: http://web.uni-marburg.de/cyto
Biologie für Mediziner WiSe 2007/08 Praktikumsteilteil: Zellzyklus und Mitose (Zellteilung) Meiose (Reifeteilung) Leitung: PD Dr. Joachim Schachtner Folien zum download: http://web.uni-marburg.de/cyto
1. Gruppen. 1. Gruppen 7
 1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen. 1. Gruppen 7
 1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
Definition: Zelle. Die Zelle ist die kleinste, für sich lebensfähige biologische Einheit
 Definition: Zelle Die Zelle ist die kleinste, für sich lebensfähige biologische Einheit Zellen einfache Gewebe zusammengesetzte Gewebe Organe Organsysteme Zellen: Unterschiede Form... Größe... Lebensdauer...
Definition: Zelle Die Zelle ist die kleinste, für sich lebensfähige biologische Einheit Zellen einfache Gewebe zusammengesetzte Gewebe Organe Organsysteme Zellen: Unterschiede Form... Größe... Lebensdauer...
9. Polynom- und Potenzreihenringe
 64 Andreas Gathmann 9. Polynom- und Potenzreihenringe Bevor wir mit der allgemeinen Untersuchung von Ringen fortfahren, wollen wir in diesem Kapitel kurz zwei sehr wichtige weitere Beispiele von Ringen
64 Andreas Gathmann 9. Polynom- und Potenzreihenringe Bevor wir mit der allgemeinen Untersuchung von Ringen fortfahren, wollen wir in diesem Kapitel kurz zwei sehr wichtige weitere Beispiele von Ringen
Übungsaufgaben zum Kapitel Klassische Genetik mit Hilfe des Lernprogramms Mendler
 1. Durchführung: In der Parentalgeneration wird eine Erbsenpflanze mit roten Blüten mit einer Erbsenpflanze mit weißen Blüten gekreuzt. Beobachtung: Alle daraus resultierenden Nachkommen besitzen in der
1. Durchführung: In der Parentalgeneration wird eine Erbsenpflanze mit roten Blüten mit einer Erbsenpflanze mit weißen Blüten gekreuzt. Beobachtung: Alle daraus resultierenden Nachkommen besitzen in der
Biopsychologische Forschung
 Biopsychologische Forschung :: Kritisches Denken :: Wir verwenden nur einen kleinen Teil des Gehirns! Intelligenz kann vererbt werden! Homosexualität entsteht durch unangemessene Erziehung! Wir brauchen
Biopsychologische Forschung :: Kritisches Denken :: Wir verwenden nur einen kleinen Teil des Gehirns! Intelligenz kann vererbt werden! Homosexualität entsteht durch unangemessene Erziehung! Wir brauchen
Inhaltsverzeichnis. Einführung. 1. Prokaryoten, Eukaryoten 4
 Einführung 1. Prokaryoten, Eukaryoten 4 Prokaryoten 4 v Viren 5 X Bakterien 6 Cyanobakterien 7 Eukaryoten 7 Niedere Pflanzen als Objekte genetischer Forschung. 7 Höhere Pflanzen 9 Y Tierische Organismen
Einführung 1. Prokaryoten, Eukaryoten 4 Prokaryoten 4 v Viren 5 X Bakterien 6 Cyanobakterien 7 Eukaryoten 7 Niedere Pflanzen als Objekte genetischer Forschung. 7 Höhere Pflanzen 9 Y Tierische Organismen
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
PID -ZENTRUM. Patienteninformation PRÄIMPLANTATIONS- DIAGNOSTIK PID
 Patienteninformation PRÄIMPLANTATIONS- DIAGNOSTIK PID Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, das MGZ Medizinisch Genetische Zentrum ist ein von der Bayerischen Staatsregierung zugelassenes Zentrum
Patienteninformation PRÄIMPLANTATIONS- DIAGNOSTIK PID Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, das MGZ Medizinisch Genetische Zentrum ist ein von der Bayerischen Staatsregierung zugelassenes Zentrum
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
Zusammenfassungen. Biologieprüfung 23. März Ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung. Die Bildung der Keimzellen wird Meiose genannt
 Zusammenfassungen Biologieprüfung 23. März 2016 Ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung Die Bildung der Keimzellen wird Meiose genannt Janik, Steffi, Tom BIOLOGIE Ungeschlechtliche und geschlechtliche
Zusammenfassungen Biologieprüfung 23. März 2016 Ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung Die Bildung der Keimzellen wird Meiose genannt Janik, Steffi, Tom BIOLOGIE Ungeschlechtliche und geschlechtliche
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Dihybride Erbgänge
 Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Dihybride Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Dihybride Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Skript zum Thema Epigenetik
 Skript zum Thema Epigenetik Name: Seite! 2 von! 14 Worum geht s hier eigentlich? Zelle Erbgut im Zellkern Organismus 1 Die genetische Information, die jeder Mensch in seinen Zellkernen trägt, ist in jeder
Skript zum Thema Epigenetik Name: Seite! 2 von! 14 Worum geht s hier eigentlich? Zelle Erbgut im Zellkern Organismus 1 Die genetische Information, die jeder Mensch in seinen Zellkernen trägt, ist in jeder
Biologie für Mediziner WS 2007/08
 Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik, Prof. Dr. Uwe Homberg 1. Endozytose 2. Lysosomen 3. Zellkern, Chromosomen 4. Struktur und Funktion der DNA, Replikation 5. Zellzyklus und Zellteilung
Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik, Prof. Dr. Uwe Homberg 1. Endozytose 2. Lysosomen 3. Zellkern, Chromosomen 4. Struktur und Funktion der DNA, Replikation 5. Zellzyklus und Zellteilung
Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern
 Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
Biologischer Abbau (Physiologie)
 Ö K O L O G I E Biologischer Abbau (Physiologie) Der biologische Abbau organischer Substrate (u.a. Kohlenhydrate) durch Enzyme oder Mikroorganismen dient zu folgendem: --- zelleigenes Material (u.a. Proteine)
Ö K O L O G I E Biologischer Abbau (Physiologie) Der biologische Abbau organischer Substrate (u.a. Kohlenhydrate) durch Enzyme oder Mikroorganismen dient zu folgendem: --- zelleigenes Material (u.a. Proteine)
Abbildung 1: Ein höheres Oberfläche/Volumen-Verhältnis begünstigt den Stoffaustausch
 4.2 Struktur und Aufbau von Zellen 1. Zellen sind mikroskopisch klein. Weshalb? Die Oberfläche einer Zelle muss im Verhältnis zu ihrem Volumen möglichst gross sein, damit der lebenswichtige Stoffaustausch
4.2 Struktur und Aufbau von Zellen 1. Zellen sind mikroskopisch klein. Weshalb? Die Oberfläche einer Zelle muss im Verhältnis zu ihrem Volumen möglichst gross sein, damit der lebenswichtige Stoffaustausch
Vererbung - Grundlagen
 Vererbung - Grundlagen Grundbegriffe Was wird vererbt? Dass Kinder ihren Eltern in vielen Eigenschaften ähnlich sind, ist ja keine Neuigkeit, aber wie ist das möglich? Kinder entwickeln sich ja aus einer
Vererbung - Grundlagen Grundbegriffe Was wird vererbt? Dass Kinder ihren Eltern in vielen Eigenschaften ähnlich sind, ist ja keine Neuigkeit, aber wie ist das möglich? Kinder entwickeln sich ja aus einer
3.5 Moderne Genetik - Vorgänge
 3.5 Moderne Genetik - Vorgänge Der genetische Code Jedes Gen besteht aus sogenannten Basentriplets. Das ist eine Sequenz von drei aufeinanderfolgenden Nukleinbasen, die für eine bestimmte Aminosäure stehen.
3.5 Moderne Genetik - Vorgänge Der genetische Code Jedes Gen besteht aus sogenannten Basentriplets. Das ist eine Sequenz von drei aufeinanderfolgenden Nukleinbasen, die für eine bestimmte Aminosäure stehen.
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 R =
 Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Eine experimentelle Untersuchung der Evolution von W.H. Dallinger um 1887
 Eine experimentelle Untersuchung der Evolution von W.H. Dallinger um 1887 Weil mich diese Arbeit von Dallinger schon immer fasziniert hat, möchte ich hier einmal davon berichten. Dallinger war Mikrobiologe,
Eine experimentelle Untersuchung der Evolution von W.H. Dallinger um 1887 Weil mich diese Arbeit von Dallinger schon immer fasziniert hat, möchte ich hier einmal davon berichten. Dallinger war Mikrobiologe,
Zytologie, Zellteilung
 Biologie Zytologie, Zellteilung Zusammenfassungen Semesterprüfung Freitag, 17. Juni 2016 Zellbau Zelldifferenzierung Zellteilung (Zellzyklus, Mitose, Meiose) Marisa DESIGN + LAYOUT Steffi BIOLOGIE Zellbiologie
Biologie Zytologie, Zellteilung Zusammenfassungen Semesterprüfung Freitag, 17. Juni 2016 Zellbau Zelldifferenzierung Zellteilung (Zellzyklus, Mitose, Meiose) Marisa DESIGN + LAYOUT Steffi BIOLOGIE Zellbiologie
Kurvendiskussion. Nun Schritt für Schritt. Nehmen wir an, wir haben eine Funktion f(x) = x². Das Bild dazu kennen wir, es ist die Normalparabel.
 Kurvendiskussion Wozu braucht man eigentlich eine Kurvendiskussion und vor allem: Wie wird sie durchgeführt und wozu macht man Ableitungen und setzt sie dann 0 und so weiter und so fort... Es gibt viele
Kurvendiskussion Wozu braucht man eigentlich eine Kurvendiskussion und vor allem: Wie wird sie durchgeführt und wozu macht man Ableitungen und setzt sie dann 0 und so weiter und so fort... Es gibt viele
Mendel Gregor Mendel (*1822, 1884)
 Mendel Gregor Mendel (*1822, 1884) Mendels Vererbungsregeln 1. Mendel sche Regel Kreuzt man zwei reinerbige Rassen, die sich in einem Allelpaar unterscheiden, so sind die Nachkommen die erste Filialgeneration
Mendel Gregor Mendel (*1822, 1884) Mendels Vererbungsregeln 1. Mendel sche Regel Kreuzt man zwei reinerbige Rassen, die sich in einem Allelpaar unterscheiden, so sind die Nachkommen die erste Filialgeneration
Klausur zur Genetik Name, Stud.- Sem. Punkte Vorname gang
 Klausur zur Genetik Name, Stud.- Sem. Punkte 13.07.2005 Vorname gang Gesamtzahl der Punkte: 79 FRAGE Nr.1 7 Punkte Die nachstehenden Bilder zeigen Zellen einer seltenen Pflanzenart. Die Zellen befinden
Klausur zur Genetik Name, Stud.- Sem. Punkte 13.07.2005 Vorname gang Gesamtzahl der Punkte: 79 FRAGE Nr.1 7 Punkte Die nachstehenden Bilder zeigen Zellen einer seltenen Pflanzenart. Die Zellen befinden
Diversität in der Gattung Sorbus: Hybridisierung, Apomixis, taxonomische Probleme
 Diversität in der Gattung Sorbus: Hybridisierung, Apomixis, taxonomische Probleme Gregor Aas & Martin Feulner 1. Die Gattung 2. Diversität durch Hybridisierung Polyplodisierung Apomixis 3. Konsequenzen
Diversität in der Gattung Sorbus: Hybridisierung, Apomixis, taxonomische Probleme Gregor Aas & Martin Feulner 1. Die Gattung 2. Diversität durch Hybridisierung Polyplodisierung Apomixis 3. Konsequenzen
Sätze über ganzrationale Funktionen
 Sätze über ganzrationale Funktionen 1. Sind alle Koeffizienten a i ganzzahlig und ist x 0 eine ganzzahlige Nullstelle, so ist x 0 ein Teiler von a 0. 2. Haben alle Koeffizienten dasselbe Vorzeichen, so
Sätze über ganzrationale Funktionen 1. Sind alle Koeffizienten a i ganzzahlig und ist x 0 eine ganzzahlige Nullstelle, so ist x 0 ein Teiler von a 0. 2. Haben alle Koeffizienten dasselbe Vorzeichen, so
Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus
 45 4 Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus Alle 24 Stunden ist bei jeder Maus ein vaginaler Abstrich angefertigt worden, der auf einem Objektträger ausgestrichen und mittels Giemsa-Färbung gefärbt
45 4 Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus Alle 24 Stunden ist bei jeder Maus ein vaginaler Abstrich angefertigt worden, der auf einem Objektträger ausgestrichen und mittels Giemsa-Färbung gefärbt
Entwicklung aber anders...
 Entwicklung aber anders... Zwei der Merkmale des Lebens sind das Wachstum und die Fortpflanzung. (Welches sind die restlichen?) Einfache, einzellige Lebewesen haben ein beschränktes Wachstum, da die Größe
Entwicklung aber anders... Zwei der Merkmale des Lebens sind das Wachstum und die Fortpflanzung. (Welches sind die restlichen?) Einfache, einzellige Lebewesen haben ein beschränktes Wachstum, da die Größe
Konzepte: Vorteile der Analyse einzelner Meiosen. Centromerkartierung durch Tetraden/Oktaden. Berechnung korrekter kt Kartendistanzen
 5. Oktadenanalyse Konzepte: Vorteile der nalyse einzelner Meiosen Centromerkartierung durch Tetraden/Oktaden erechnung korrekter kt Kartendistanzen t 1. Sie führen bei Neurospora crassa eine Oktadenanalyse
5. Oktadenanalyse Konzepte: Vorteile der nalyse einzelner Meiosen Centromerkartierung durch Tetraden/Oktaden erechnung korrekter kt Kartendistanzen t 1. Sie führen bei Neurospora crassa eine Oktadenanalyse
3. Ergebnisse Ergebnisse. 3.1 MDR1-Polymorphismen
 . Ergebnisse. Ergebnisse. MDR-Polymorphismen Im Rahmen der Studie erfolgte die Untersuchung von Polymorphismen mittels PCR und RFLP und deren Auswirkung auf die Pharmakokinetik des P-gp-Substrates Digoxin.
. Ergebnisse. Ergebnisse. MDR-Polymorphismen Im Rahmen der Studie erfolgte die Untersuchung von Polymorphismen mittels PCR und RFLP und deren Auswirkung auf die Pharmakokinetik des P-gp-Substrates Digoxin.
Vererbungsgesetze, Modell
 R Vererbungsgesetze, Modell 65564.00 Betriebsanleitung Das Model besteht aus einem Satz von 204 Symbolkarten und 3 Kreuzungs- und Nachkommenslinien. 81 der Symbolkarten zeigen Erscheinungsbilder (Phänotypen),
R Vererbungsgesetze, Modell 65564.00 Betriebsanleitung Das Model besteht aus einem Satz von 204 Symbolkarten und 3 Kreuzungs- und Nachkommenslinien. 81 der Symbolkarten zeigen Erscheinungsbilder (Phänotypen),
Konzepte: Vorteile der Analyse einzelner Meiosen. Centromerkartierung durch Tetraden/Oktaden. Berechnung korrekter kt Kartendistanzen
 5. Oktadenanalyse Konzepte: Vorteile der nalyse einzelner Meiosen Centromerkartierung durch Tetraden/Oktaden erechnung korrekter kt Kartendistanzen t 1. Sie führen bei Neurospora crassa eine Oktadenanalyse
5. Oktadenanalyse Konzepte: Vorteile der nalyse einzelner Meiosen Centromerkartierung durch Tetraden/Oktaden erechnung korrekter kt Kartendistanzen t 1. Sie führen bei Neurospora crassa eine Oktadenanalyse
Generationswechsel Angiospermen (Bedecktsamer) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Generationswechsel Angiospermen (Bedecktsamer) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Der von freiem Wasser unabhängige Gymnospermen-Generationswechsel erlaubt erstmals die Besiedelung
1 Generationswechsel Angiospermen (Bedecktsamer) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Der von freiem Wasser unabhängige Gymnospermen-Generationswechsel erlaubt erstmals die Besiedelung
W-Seminar: Versuche mit und am Menschen 2017/2019 Skript
 3. Deskriptive Statistik Die deskriptive (auch: beschreibende) Statistik hat zum Ziel, [ ] Daten durch Tabellen, Kennzahlen [ ] und Grafiken übersichtlich darzustellen und zu ordnen. Dies ist vor allem
3. Deskriptive Statistik Die deskriptive (auch: beschreibende) Statistik hat zum Ziel, [ ] Daten durch Tabellen, Kennzahlen [ ] und Grafiken übersichtlich darzustellen und zu ordnen. Dies ist vor allem
Anat. Inst. d. Med. Fak., Univ. Okayama (Vorstand: Prof. M. SEKI). Bestimmung der Grosse der Milchkugelchen von verschiedenen im Elektronenmikroskop.
 Anat. Inst. d. Med. Fak., Univ. Okayama (Vorstand: Prof. M. SEKI). Bestimmung der Grosse der Milchkugelchen von verschiedenen Tieren im Elektronenmikroskop. (Eingegangen am 17. Juni 1955.) Neuerdings hat
Anat. Inst. d. Med. Fak., Univ. Okayama (Vorstand: Prof. M. SEKI). Bestimmung der Grosse der Milchkugelchen von verschiedenen Tieren im Elektronenmikroskop. (Eingegangen am 17. Juni 1955.) Neuerdings hat
