Festschrift 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ofterdingen Geschichtlicher Rückblick. Inhaltsverzeichnis:
|
|
|
- Hella Wolf
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Festschrift 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ofterdingen Hg. von der Gemeinde Ofterdingen 2014 Geschichtlicher Rückblick Gerhard Kittelberger Inhaltsverzeichnis: 1.- Die Zeit vor 1864 Obrigkeitliche Vorschriften Brand- und Feuerschutz.- 1 Die Land-Feuer-Ordnung vom 12. Januar Die Feuerlöschordnung vom 20. Mai Die Lokalfeuerordnung vom Dezember
2 Das Feuerlöschwesen in Ofterdingen Der vorbeugende Brandschutz bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.- 4 Die Feuerlöschmannschaft.- 4 Die Feuerfahnen.- 5 Die Feuerwagen.- 7 Die Feuerlöschgeräte.- 7 Die alte Stoßspritze des 18. Jahrhunderts.- 7 Die Feuereimer.- 10 Pflege und Reparaturen der alten Stoßspritze.- 10 Die Handfeuerspritze von Die Doppelspritze von Der Hydrophor von Die Karren-Feuer-Spritze von Die Ausstattung mit Schläuchen.- 15 Weitere Feuerlösch- und Rettungsgeräte.- 17 Die Unterbringung der Löschgeräte.- 18
3 Die Ereignisse im Brandfall Ein Brandfall im Dorf Ofterdingen.- 19 Die Brandhilfe in der Nachbarschaft.- 21 Die Vergütung der Löschmannschaft.- 23 Die Aufhebung der Gemeindefronen und die neuen Vergütungssätze der Feuerwehrmannschaft.- 23 Liste der Brandfälle Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 1864 Die Vorgeschichte.- 27 Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr.- 28 Die Löschmannschaft.- 28 Die Landesfeuerlöschordnung vom Die Lokalfeuerlöschordnung vom Die Uniformierung der Freiwilligen Feuerwehr.- 30 Die Feuerwehrabgabe und die Korpskasse der Feuerwehr.- 31 Die neue Ausrüstung.- 31 Die Teilung der Pflichtfeuerwehr
4 Auftritte der Feuerwehr in der Öffentlichkeit.- 34 Die Liste der Kommandanten.- 34 Brandfälle Die Freiwillige Feuerwehr nach dem 1. Weltkrieg Der Feuerwehrbezirksverband Rottenburg.- 37 Die Mannschaft.- 37 Die Hochdruckwasserleitung von Die Ausrüstung.- 39 Brandfälle Die Zeit der NS-Diktatur von 1933 bis zum Kriegsende 1945 Die Neuorganisation der Feuerwehr.- 41 Die Feuerwehr im Umbruch.- 41 Der Einheitsfeuerwehrmann.- 42 Die Löschmannschaft.- 43 Das 75-jährige Jubiläum im Jahr
5 Die Ausrüstung mit der Kleinmotorspritze von Die weitere Ausrüstung.- 48 Die Rettungsgeräte.- 48 Der Kommandant.- 49 Brandfälle Von der Neuorganisation nach 1945 bis zum Zehntscheuerbrand 1956 Die Situation nach dem Krieg.- 51 Feuerwehrgesetze und Satzungen.- 51 Die Feuerlöschverbände.- 52 Die Löschmannschaft.- 53 Das 90-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr Die neue Ausrüstung der Wehr mit Motorfahrzeugen.- 56 Brandfälle.- 57 Der Kommandant.- 57 Literatur und Quellen 59
6 Geschichtlicher Rückblick 1. Die Zeit vor Obrigkeitliche Vorschriften Brand- und Feuerschutz.- Als der Mensch begann, das Feuer zu nutzen, lernte er dessen segensreiche Kraft, aber auch dessen zerstörerische Gewalt kennen. Es galt, das Feuer zu begrenzen und die Entstehung eines Brandes zu verhindern. Schon im Altertum sah es die Obrigkeit als ihre Aufgabe an, Gesetze zum Brandschutz zu erlassen. In unserer Region, im Herzogtum Württemberg, begann der moderne Brand- und Feuerschutz mit den ersten landesweiten Gesetzen in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Land-Feuer-Ordnung vom 12. Januar In der Geschichte der Brandbekämpfung im Herzogtum Württemberg bildet die Feuer-Ordnung des Herzogs Karl Eugen (*1728, reg. 1744, +1793) vom Januar 1752 eine Zäsur. Die schweren Stadtbrände vor seiner Regierungszeit, in Reutlingen 1726, Schwäb. Hall 1728 und Kirchheim 1735, waren ihm bekannt, und er wußte, welche großen Vermögensschäden dabei entstanden waren. Es ist bekannt, dass sich der Herzog für alle Brandfälle, ob in den Städten oder auf dem Lande interessierte und Wert darauf legte, von jedem unterrichtet zu werden. Oft besuchte er auch selbst die Brandstätten. Es gelang ihm 1773, die Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt zu gründen. Sie entwickelte sich zu einer segensreichen Einrichtung, da sie die Brandschäden mildern konnte, aber auch darauf hinwirkte, den vorbeugenden Brandschutz zu verbessern. Auch in seiner späteren Regierungszeit erlebte der Herzog schwere Stadtbrände, so in Göppingen 1782 und in Neuenbürg Die erste allgemeine württembergische Land-Feuer-Ordnung von 1752 trat an die Stelle der Feuerordnungen einzelner Städte und Ämter (Paul Sauer). Sie nahm erstmals eine Aufgliederung der Bestimmungen in verschiedene Abteilungen vor und trennte die Themen Brandverhütung, Löschmannschaft und Löschgeräte sowie Nachsorge. Im Sinne der Brandverhütung waren zu dieser Zeit besonders die Strohdächer besorgniserregend. Im ersten Hauptteil bestimmte die Land-Feuer-Ordnung, bei Neubauten oder Reparaturen seien die Dächer nicht mehr mit Stroh oder Schindeln, sondern mit Ziegeln einzudecken. Daraus kann geschlossen werden, dass die Strohdächer noch weit verbreitet waren. Zur Mithilfe beim Löschen eines Brandes verpflichtet die Feuerordnung grundsätzlich alle Ortseinwohner. Als eigentliche Löschmannschaft hatten die Männer zu erscheinen, die Frauen mußten sich zu ihrer Unterstützung bereithalten. Bereits diese Bestimmungen lassen aber die Einsicht erkennen, die Masse der Einwohner gliedern zu müssen. Daher solle die Löschmannschaft der jeden Orts gewöhnlichen Einteilung der Einwohnerschaft in Rotten folgen. Um die Feuerspritzen mit gutem Effect gebrauchen zu können, seien diesen gewisse Leute zuzuordnen. Bei einem Brand in der Nachbarschaft müsse die Löschmannschaft, in Rotten eingeteilt und unter dem Kommando von Rott-Meistern, ausrücken. 1
7 1. Die Zeit vor 1864 Um die Löschtechnik zu verbessern, schrieb die Feuerordnung die Anschaffung von Feuerspritzen durch die Städte und größeren Dörfer vor. Die dazugehörigen ledernen Schläuche mußten durch Einschmieren mit Fett gepflegt und vor nagenden Mäusen und Ratten geschützt werden. Ausführliche Bestimmungen gelten dem Meldewesen. Der Herzog schrieb vor, ihm selbst seien an seinem jeweiligen Aufenthaltsort alle Brände durch eigene Postillons zu melden. Da die Städte und Dörfer zur gegenseitigen Brandhilfe verpflichtet waren, alarmierten beim Ausbruch eines Feuers die Postillons die Orte der Umgebung. Die jeweiligen Mannschaften und Löschgeräte hatten bis zu einer Entfernung von sechs Wegstunden auszurücken. In Zweifelsfällen mußte erst ein Postillon dem Feuer entgegengeschickt werden, um sich nach der Gefahr zu erkundigen. Damit ist der legendäre württembergische Feuerreiterdienst (Harald Bauer) angesprochen, der aber auf altes Herkommen zurückging. In Ofterdingen ist 1775 erstmals ein Feuerreiter erwähnt, der einer Feuersbrunst in Undingen zuritt. Die Feuerlöschordnung vom 20. Mai Diese neue, in der Regierungszeit von König Friedrich erlassene Ordnung wiederholt in vielen Punkten die Vorschriften der Land-Feuer-Ordnung von Sie nimmt aber auch detailreiche Regelungen neu auf. Ausdrücklich erwähnt werden z.b. Feuerreiter, Rotten und Feuerfahnen. Bezüglich der Rotten wird bestimmt, es sei die Bürgerschaft jedes Orts in mehrere Rotten einzuteilen, für jede ein oder mehrere Rottmeister zu ernennen und für jeden eine Fahne anzuschaffen, woran die Rotte ihren Führer erkennen kann. Bedeutsam sind auch die Vorschriften, die sich mit dem Einsatz der Feuerlöschmannschaften im Dorf selbst und in den benachbarten Dörfern befassen. Wie schon in der Vergangenheit wird angeordnet, dass nach einem Feueralarm durch Sturm schlagen die ganze Einwohnerschaft mit gefüllten Feuereimern zum Brandplatz zu eilen habe. Außerdem schreibt sie vor, dass in jedem Ort eine Local-Feuer-Ordnung aufzustellen sei, die die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen habe. Diese sollte besonderes Personale für Feuerspritze und Feuerwagen bestimmen sowie die Rottenmeister, die Zusammensetzung der Rotten und die als Feuerreiter geeigneten Männer festlegen. Eine solche Local-Feuer-Ordnung wurde in den folgenden Jahren in Ofterdingen nicht erlassen. Stattdessen machte das Oberamt Rottenburg der Gemeinde detaillierte Vorschriften über die Anschaffung von Feuerlöschgeräten. Vogt, Gericht und Rat reagierten auf die Bekanntmachung der Feuerordnung und das oberamtliche Schreiben mit der Feststellung: Die in der Feuerordnung enthaltenen Paragraphen fand der Magistrat für nicht notwendig, etwas weiter anzuschaffen, weil die Bürger mit dergleichen versehen, und der Ort die Lage hat, daß vieles davon entbehrlich ist... 2
8 Geschichtlicher Rückblick Die Ofterdinger Lokalfeuerordnung vom Dez Erstmals wird in dieser Feuerordnung sichtbar, wie es im Dorf im Brandfall zuging. Das Feuerlärmen, das die Einwohnerschaft zur Bekämpfung eines entstehenden Brandes zusammenrief, erfolgte mit dem Ruf FEUERIO und durch das Schlagen der Trommel. Die Kirchenglocken durften nur auf ausdrücklichen Befehl der Obrigkeit geläutet werden. Die wegen Bränden in der Nachbarschaft ankommenden Feuerreiter mußten sich beim Schultheißen melden, der dann das Feuerlärmen auslösen konnte. Die angeforderte Brandhilfe wurde aber auf eine Entfernung von 4-5 Wegstunden, mit der Spritze bis 4 Stunden begrenzt. Für alle Einwohner galt, mit einem gefüllten Feuereimer zum Brandplatz zu kommen. Die vorhandenen 168 Feuereimer waren im Rathaus aufbewahrt, wo sie geholt werden mußten. Sie wurden von der Gemeinde angeschafft und durch die Neubürger mit ihrer Aufnahmegebühr bezahlt. Um bei nächtlichem Feuerlärmen die Gassen notdürftig zu beleuchten, mußte jeder Bürger eine Laterne vor das Haus hängen. Nach dem Feuerlärmen mußten die bereits dazu aufgestellten Halter von Zugpferden ihre Pferde zum Rathaus bringen. Für die vier Pferde an der Spritze erhielten sie 5 Gulden. Dort mußten aber auch alle anderen Pferdehalter erscheinen, damit es nie fehlen möge, die Feuerspritzen und Wägen zum Brandplatz zu führen. Für schnelles Erscheinen an der Spritze oder mit einem Feuerwagen waren Prämien ausgesetzt. Prämien spornten auch die Halter von Reitpferden an, die als Feuerreiter in Frage kamen. Von ihnen wurde erwartet, dass sie der Gegend kundig seien. Auch für Feuerleitern und Feuerhaken war eine bestimmte Mannschaft verantwortlich, ebenso für die Rettung von Einrichtungsgegenständen und Hausrat an einem sicheren Ort und deren Bewachung. 3
9 1. Die Zeit vor 1864 Das Feuerlöschwesen in Ofterdingen Der vorbeugende Brandschutz bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.- Wie aus den Bestimmungen der Land-Feuer-Ordnung von 1752 zu schließen ist, waren auch in Ofterdingen die meisten Bauernhäuser in der Mitte des 18. Jahrhunderts noch mit Stroh gedeckt. Sichere Nachrichten darüber gibt es nicht, da in den Ofterdinger Gebäudeverzeichnissen von 1715 und 1823 die Art der Dachdeckung nicht angegeben wird. Die seit 1784 erhaltenen Feuerschauprotokolle lassen jedoch erkennen, dass die Strohdächer schon weitgehend verschwunden waren. Die Dächer der Wohnhäuser und Scheunen bestanden mit wenigen Ausnahmen aus Ziegeln oder Platten. Die meisten der in den Protokollen festgehaltenen Beanstandungen betrafen Strohdächer auf kleineren Nebengebäuden. Auch ein 1828 mit Erdbirenstroh bedeckter Schopf fand keine Gnade. Die Hauptsorge der Feuerschauer galt nun dem Zustand der Kamine, Kaminhüte und den oft schadhaften Haus- und Scheunenwänden. Bei einem Brand in der Nachbarschaft stellte der Funkenflug eine große Gefahr dar. Es mußte daher beanstandet werden, wenn Gebäude, vor allem Scheunen, Löcher in den Wänden hatten, die womöglich mit Heu oder Stroh ausgestopft waren. Das gleiche galt für bretterne Giebel oder speislose.., von Holz zusammengeflochtene Giebel und fehlende Flugläden. Gefahr ging auch von dem Brantenwein Ofen des Ochsenwirts und dem Hafner Brandofen im Ort an der Steinlach aus. Was die Bauart der Häuser im Inneren betraf, gab es Beanstandungen wegen der Kamine, zu denen auch die Rauchfänge gehörten, sowie der Feuerwände. Brandgefahr ging von Rauchfängen aus, die bisweilen von Holz oder geflochten waren, ebenso von manchen Feuerwänden, die noch Holzbalken enthielten. In erster Linie ging aber Gefahr von den Feuerstätten in den Häusern selbst aus. Hölzerne Küchenböden am Herd und unter dem Ofen waren mit Backsteinen oder Steinplatten zu besetzen und das Aschenhaus sorgfältig zu verwahren. Die Backöfen in den Häusern mußten gut abgedichtet werden. Auch der 1830 auf der Kirche angebrachte Blitzableiter diente dem Brandschutz. Die Feuerlöschmannschaft.- Die in allen Feuerordnungen enthaltene Verpflichtung der ganzen Einwohnerschaft, zur Brandstelle zu kommen, ist mit dem Begriff der Pflichtfeuerwehr verbunden. Die Pflichtfeuerwehr blieb auch noch nach dem Aufkommen der Freiwilligen Feuerwehren bis ins 20. Jahrhundert hinein bestehen. Dieses Zusammenlaufen der Einwohnerschaft hatte nicht nur den Vorteil, dass stets genügend Leute für Hilfestellungen zur Verfügung standen, sondern führte auch zu einem unübersichtlichen Getümmel. Die ersten, die am Brandplatz erschienen, begannen mit der Rettung von Menschen oder Hausrat aus dem brennenden Haus oder Häusern der Nachbarschaft. 4
10 Geschichtlicher Rückblick Andere bargen Vieh und brachten es in Sicherheit. Die eigentliche Brandbekämpfung konnte erst beginnen, wenn die Löschgeräte an Ort und Stelle waren, was einige Zeit dauerte. Der Schultheiß, bzw. in Ofterdingen der Dorfsvogt oder sein Stellvertreter übernahmen das Kommando. Für die Handhabung der Spritze waren die Spritzenmeister verantwortlich. Für die Verwendung von Feuerleitern und Feuerhaken hatte man schon vorher geeignete Männer bestimmt. Für das geordnete Vorgehen bei der Löscharbeit mußte vor allem die Pumpenmannschaft an der Feuerspritze eingeteilt und die Löschwasserversorgung organisiert werden. Über die Mannschaften, die bei einer Überlandhilfe die Spritze begleiteten, gibt es erste Nachrichten anläßlich der Brandhilfe bei der großen Feuersbrunst in der Rottenburger Vorstadt Ehingen im September Hier begleitete die Spritze eine Feuerrotte unter einem Rottmeister. Die Größe der Rotte bestimmte sich nach der für die Spritze erforderlichen Pumpenmannschaft. Diese zählte einschließlich der Ablösung rd. 30 Männer. Hinzu kamen die beiden Spritzenmeister und der Rottmeister. Solche Rotten hatte bereits die Land-Feuer-Ordnung von 1752 als bestehend vorausgesetzt. Die Feuerlöschordnung von 1808 enthält die Bestimmungen: es sei die Bürgerschaft jedes Orts in mehrere Rotten einzuteilen, für jede ein oder mehrere Rottmeister zu ernennen und für jeden eine Fahne anzuschaffen, woran die Rotte ihren Führer erkennen kann. Während in der früheren Zeit nur eine einzige Rotte nachweisbar ist, werden im Januar 1835 die Obmänner der Feuerrotten erwähnt. Vielleicht handelte es sich damals aber um einen Sonderfall: am 1. Januar brannte es in Reutlingen, am 7. Januar in Gomaringen, und beidesmal rückte die Löschmannschaft aus. Eine zweite Rotte mußte daher wohl gebildet werden, um die Männer nicht zu überfordern. Schließlich ist 1860 der Obmann der I. Feuerrotte erwähnt, was darauf schließen läßt, dass es auch eine zweite Rotte gab. Die Rotten hatten anscheinend auch besondere Kennzeichen, da der Flaschner Diegel 1858 einen Feuerrottenschild für die hohe Summe von 11 Gulden anfertigte. Die Feuerfahnen.- Feuerfahnen werden in der Feuerordnung von 1752 nicht erwähnt, geschweige denn vorgeschrieben. Ein Einsatz von Feuerrotten zur Brandhilfe in benachbarten Orten ist aber ohne die Führung von Feuerfahnen schwer vorstellbar. Die an den Brandorten zusammenkommenden Löschmannschaften waren damals überhaupt nicht gekennzeichnet. Uniformen und Abzeichen kamen erst mit den Freiwilligen Feuerwehren Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Daher konnten sich die Männer nur an den Feuerfahnen orientieren, um zu ihrer jeweiligen Truppe zu finden. Die Gemeinde Ofterdingen schaffte 1761 eine Feuerfahne an. In der Bürgermeisterrechnung von 1760/61 findet sich folgende Eintragung: Friderich Beken, 5
11 1. Die Zeit vor 1864 Kunstmaler von Reutlingen, bezahlten wir für einen neu verfertigten von den besten Farben gemalten Feuer Fahnen...15 fl, also einen stattlichen Preis. Dieser Friedrich Beck ( ) ist in Reutlingen als Stammvater einer Kunstmalerfamilie bekannt. Die einseitig bemalte Fahne zeigt das herzoglich-württembergische Wappen, darüber Offterdingen, darunter die Jahreszahl Da weitere Nachrichten fehlen, muß offen bleiben, ob die Fahne bereits vor 1761 eine Vorgängerin hatte. Die Gemeinde kam auch der Forderung der Feuerlöschordnung von 1808 nach, einen neuen Feuerfahnen anzuschaffen. Mit der Herstellung beauftragte man den Tübinger Hafner Johann Friedrich Schwab. Er erhielt dafür 4 Gulden und 32 Kreuzer. Dies ist eine wesentlich geringere Summe als die 15 Gulden von Dafür ist die Fahne von 1809 auch weniger kunstvoll bemalt, trägt jedoch auf beiden Seiten eine Darstellung. Nach der Anschaffung der neuen Feuerfahne scheint die alte von 1761 in Vergessenheit geraten zu sein. Da es zu dieser Zeit nur eine Feuerrotte gab, wurde sie auch gar nicht gebraucht. In dem 1810 angelegten Inventar ist sie nicht mehr verzeichnet, und auch im Inventar von 1848 wird nur die Feuerfahne von 1809 genannt. Erst wieder ein Inventar von 1878 scheint einen Hinweis zu geben, da in ihm zwei Feuerfahnen genannt sind. Die eine stammte von 1809, bei der anderen wurde erst nachträglich notiert: Ihr weiteres Schicksal und ihr Verbleib in den nächsten Jahren ist unbekannt. Die Feuerfahne von 1761 Die Feuerfahne von 1809 mit Wappen und Jahreszahl 6
12 Geschichtlicher Rückblick Durch einen glücklichen Dachbodenfund von 1982 kam sie wieder zum Vorschein, und nach der Restaurierung erstrahlt sie in neuem Glanz. Ende des Jahres 1865 brachte der Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr vor, es wäre nicht unbillig, wenn der Feuerwehr auch eine Fahne verwilligt würde. Die Gremien beschlossen darauf, zu der Anschaffung der Feuerwehrfahne einen Beitrag von 80 Gulden zu leisten. Die feierliche Fahnenweihe erfolgte am Sonntag, dem 23. September Da in dieser Zeit erstmalig der Begriff Feuerwehr verwendet wurde, kann jetzt zu Recht von einer Feuerwehrfahne die Rede sein. Ihr Aussehen ist unbekannt. Sie kam am Ende des 2. Weltkriegs abhanden. Die Feuerwagen.- Feuerwagen werden bereits in der Lokalfeuerordnung von 1824 erwähnt. Dabei handelte es sich vermutlich um normale Leiterwagen, die man vorübergehend zum Transport der Löschmannschaft zu auswärtigen Bränden herrichtete. Die Anschaffung eines ständig zum Feuerwagen bestimmten Wagens wurde 1843 beschlossen. Den dafür vorgesehenen Wagen kaufte man von dem Bäcker Christoph Luz. Schmid und Wagner erhielten den Auftrag, ihn für den neuen Verwendungszweck umzubauen. Dieser alte Feuerwagen war noch 1878 im Besitz der Feuerwehr. Für die bessere Ausstattung der Feuerwehr für die Fälle der Überlandhilfe stellte das Oberamt Rottenburg 1869 leihweise einen Feuerwagen zur Verfügung. Der Löwenwirt Steinhilber holte ihn in Rottenburg ab. Dieser neue Feuerwagen ging 1891 ins Eigentum der Gemeinde über. Er ist heute ein geschätztes Museumsstück der Feuerwehr, umso mehr, als er der letzte seiner Art in Baden-Württemberg ist. Die Tatsache, dass er uns erhalten blieb und nicht beim Zehntscheuerbrand 1956 vernichtet wurde, ist übrigens nur einem glücklichen Zufall zu verdanken. Er war zu dieser Zeit wegen kleinerer Reparaturen bei Albert Röcker, dem Vizekommandanten der Feuerwehr, untergebracht. Die Feuerlöschgeräte.- Die ältesten Nachrichten über die Feuerlöschgeräte finden sich in den Ofterdinger Bürgermeisterrechnungen seit 1759/60. Diese listen für jedes Rechnungsjahr alle Einnahmen- und Ausgabenposten auf. Zusammen mit anderen Schriftzeugnissen ergeben sie im Lauf der Jahre ein immer detaillierteres Bild. Die alte Stoßspritze des 18. Jahrhunderts.- In der ältesten erhaltenen Bürgermeister-Rechnung von 1759/60 steht: Die beiden Inspectores über die Feuerspritz, Sebastian Gulde, Schuster, und Sebastian Lutz, Schmied, haben die Feuerspritz zweimal auseinandergeschrauft, ausgeputzt und eingeölt. Neben ihrem dafür fälligen Lohn erhielten sie noch das Geld für ein halbes Pfund Baumöl für die Spritze und ein 7
13 1. Die Zeit vor 1864 Der Feuerwagen von 1862, in Ofterdingen seit Abgebildet sind (v.l.): Helmut Speidel, Walter Binder, Eugen Dürr, Karl Speidel und Waldemar Schmid (Foto: Klaus Franke) 8
14 Geschichtlicher Rückblick Viertel Pfund Schmer für die Wagenachsen. Damit ist bereits für diese Zeit eine Feuerspritze in Ofterdingen nachgewiesen. Die Anschaffung von Feuerspritzen war auch ein Anliegen der Land-Feuer-Ordnung von 1752, die ihre Anschaffung durch Städte und größere Dörfer vorschrieb. Ob die Ofterdinger Spritze aus den Jahren danach stammt oder noch älteren Ursprungs ist, muß unbestimmt bleiben. Jedenfalls verfügte Ofterdingen mit dieser Spritze über eine gute Ausstattung und war damit auf der Höhe der Zeit. Erst damals haben sich Feuerspritzen in unserer Gegend weiter verbreitet. Die von Karl Hermann erstellte Zusammenfassung der noch erhaltenen Handdruck-Feuerspritzen im Landkreis Tübingen erwähnt als älteste die Spritzen von Lustnau um 1750 und von Entringen Zu den ältesten gehört auch die Ergenzinger Spritze, die nach der Pfarrchronik 1723 angeschafft wurde. Ihr Holzwerk kann dendrochronologisch in die Zeit um 1790 datiert werden. Sie wurde damals vielleicht teilweise erneuert. Eine Vorreiterrolle bei den Feuerspritzen kam den finanzkräftigeren Städten zu. Die Residenzstadt Stuttgart hatte schon 1614 und 1663 Feuerspritzen. Hechingen erwarb seine erste 1717, und in Tübingen wurden erstmals 1723 Versuche mit Feuerspritzen angestellt. Einer der ältesten Hersteller von Feuerspritzen in der Region war die 1690 gegründete Glockengießerwerkstatt von Michael Kurtz in Reutlingen. Die noch bis ins 20. Jahrhundert gelieferten und verwendeten Handdruck-Spritzen weisen Bauteile auf, die sich seit dem 18. Jahrhundert nur wenig verändert haben. Angesichts der hohen Zahl der Brände und dem häufigen Einsatz der alten Ofterdinger Spritze im 18./19. Jahrhundert stellt sich die Frage, wie wirksam sie eigentlich sein konnte. Zum Spritzen diente ein feststehendes, aber bewegliches Strahlrohr. Da kein Windkessel vorhanden war, entstand ein Wasserstrahl nur beim Niedergehen eines Kolbens. Wegen dieser stoßweisen Wirkung nannte man sie Stoßspritze, und noch heute ist sie als Schuckere bekannt. Das Wasser entnahm die Spritze dem Wasserkasten, in den die ganze Mechanik auch eingebaut war. Zur Auffüllung der bescheidenen Wassermengen dienten Feuereimer oder Butten. Tatsache ist aber, dass es zu dieser Maschine keine Alternative gab. Nur eine Spritze war wenigstens in der Lage, Wasser aus einiger Entfernung in die Flammenglut zu tragen. Auf alle Fälle war sie dafür geeignet, die Dächer und Wände der benachbarten Häuser zu benetzen und damit vor der Glut zu schützen. Für das Löschen eines Vollbrandes war sie wohl kaum geeignet. Die alte Stoßspritze blieb jahrzehntelang die einzige in Ofterdingen. Eine wesentliche Verbesserung der Spritze bedeutete der Umbau der Röhre zu einer Schlaucheinrichtung. Dafür berechnete die Firma Kurtz in Reutlingen 1838 die hohe Summe von 85 Gulden. Mit der Zehntscheuer ist diese alte Spritze 1956 verbrannt. 9
15 1. Die Zeit vor 1864 Die Feuereimer.- Zur Wasserversorgung der Stoßspritze dienten hauptsächlich die Feuereimer. Von ihnen legte die Gemeinde im Rathaus einen Vorrat an, der teils durch die Abgaben von jedem Neubürger, teils durch Anschaffungen vermehrt wurde. Mußte ein Feuereimer nicht in natura abgeliefert werden, waren 1 Gulden, 12 Kreuzer zur Zahlung fällig. Im Rechnungsjahr 1759/60 wurden 42 Feuereimer abgeliefert. 1766/67 mußten alle älteren Feuereimer repariert werden, und so zählte man 1768/69 insgesamt 72 Feuereimer, welche auch da sind waren 168 und Eimer vorhanden. Erst 1814 erhielten sie eine Nummer und die Bezeichnung Ofterdingen. In den 1850er Jahren mußten wieder 35 Feuereimer mit dem Ortsnamen bezeichnet werden und entstanden über 70 Gulden Reparaturkosten. Anfangs des Jahres 1871 erhielt der Sattler Rockenbauch den Auftrag, alle 190 Feuereimer neu zu verharzen und zum Teil zu reparieren. Auch nach der Anschaffung des Hydrophors 1868 blieb die alte größere Fahrspritze in Betrieb, so dass weiterhin Feuereimer benötigt wurden. Es traten aber auch ständig Verluste an Feuereimern ein, wie z.b. bei einem Brand in Dußlingen im Spätjahr 1770, bei dem 11 Feuereimer verloren gingen. Ein Jahr später verschwanden in Tübingen 16 Stück. Auch 1786 in Rottenburg-Ehingen hatte die Mannschaft Feuereimer dabei. Das während des Brandes herrschende Durcheinander zeigt sich darin, dass am Ende 8 Ofterdinger Feuereimer nicht mehr vorgefunden werden konnten. Um solche Verluste in Zukunft tunlichst zu vermeiden, trug die Lokalfeuerlöschordnung von 1824 den Rottenmeistern auf, nach auswärtigen Einsätzen für die richtige Zurückgabe der Feuereimer zu haften. Pflege und Reparaturen der alten Stoßspritze.- Die erstmals aus der Bürgermeisterrechnung von 1759/60 zitierten Kosten für das Reinigen und Schmieren der Spritze finden sich gleichlautend auch in den Rechnungen der folgenden Jahrzehnte. Die beiden Inspectores, die die Arbeiten mehrmals jährlich vornahmen, waren häufig Schuster, Sattler, Schmiede oder Schlosser. Vor allem der häufige Einsatz des schweren Gefährts in Orte der Nachbarschaft beanspruchte Achsen und Räder. Nicht nur die Achsnaben, sondern auch die Achsen selbst bestanden aus Holz, was häufige Reparaturen erforderlich machte. Schon 1778 und 1781 hatte der Wagner Martin Göner neue Achsen und eine neue Felge zu fertigen. Danach beschlug der Schmied Hans Jerg Maier die Achse und machte auf das Rad einen Reifen. Hohe Kosten von über 12 Gulden verursachte die Reparierung der Feuerspritz im Jahr 1785 durch einen Schlosser, einen Schuster und einen Glaser. Nach dem Ehinger Stadtbrand von 1786 waren für Reparaturen bei Schmied und Wagner nochmals über 5 Gulden erforderlich. Im Jahr 1805 hatte die der Commun zuständige Feuerspritze eine durchgängige Reparation äußert nötig. Diese wurde von einem Handwerker in Öffingen (bei Stuttgart) vorgenommen, der 15 Tage lang auch 10
16 Geschichtlicher Rückblick mit Hilfe hiesiger Handwerker - daran arbeitete. Diese über 30 Gulden teuere Reparatur betraf offenbar weniger das Fahrwerk als die Spritzenmechanik. Am Fahrwerk mußten 1807 Wagner und Schmied neue Räder, Felgen, Spaichen und eine Deichsel machen, was wiederum 11 Gulden kostete. Um die Jahreswende 1817/18 waren wieder Reparaturen erforderlich. Der Schmied und der Wagner arbeiteten mit Hilfe von Kurtz in Reutlingen und berechneten fast 20 Gulden. Als im Spätjahr 1818 die Spritze bei einem Brand in Mössingen eingesetzt wurde, konnte sie anschließend nicht mehr durch die Löschmannschaft heimgefahren werden. Der Schmied Johannes Hartmaier, der sie reparieren sollte, mußte sie vorher selbst dort abholen. Zahlreiche kleinere Reparaturen beschäftigten die Ofterdinger Handwerker, den Schreinermeister Hausch, den Schlossermeister Gottlieb Schlegel, den Schmied Konrad Nill, den Kupferschmied Jacob Münsinger und den Wagner Johannes Schmid. Die Handfeuerspritze von Die Feuerlöschordnung von 1808 forderte jedes größere Dorf auf, wenigstens eine große auf Wagen und Rädern stehende gute Feuerspritze mit den dazu gehörigen Schläuchen und Seihkörben anzuschaffen. Mit der alten Stoßspritze hatte Ofterdingen zwar eine gute Feuerspritz, dennoch bestellte die Gemeinde von dem Feuerspritzenmeister und Glockengießer Kurtz & Sohn zu Reutlingen.. eine von 4 Mann tragbare Handfeuerspritze zum Preis von 120 Gulden. Balthas Röcker holte sie im Juli 1809 in Reutlingen ab. Die 1822 sogenannte kleine Commun Feuerspritze war 1868 nahezu unbrauchbar und und angeblich nicht wieder zu reparieren. Sie sollte daher 1869 verkauft werden. Dazu kam es aber vermutlich nicht, da noch 1954 eine kleine tragbare Spritze mit Wenderohr vorhanden war. In diesem Jahr kam sie bei der Feuerwehrübung auf der Insel zum Einsatz. Zwei Jahre später verbrannte sie in der Zehntscheuer. Vorführung der kleinen tragbaren Handdruckspritze beim Feuerwehrjubiläum 1954 auf der Insel (Foto: Alfred Göhner, Vorlage: Stadtarchiv Tübingen). 11
17 1. Die Zeit vor 1864 Die Doppelspritze von Im November 1823 war die alte Stoßspritze erneut ruiniert und mußte mit zwei Pferden zur Reparatur nach Reutlingen zu Kurtz gebracht werden. Vielleicht gab dieser neue Schaden mit Ausgaben von über 10 Gulden den Anstoß zum Kauf einer neuen doppelten Feuerspritze. Sie wurde mit Kurtz bereits im Januar 1823 zum Preis von 800 Gulden accordiert und 1825 geliefert. Auch diese Spritze verfügte nicht über eine Ansaugvorrichtung. Ihre Mechanik war in den Wasserbehälter eingebaut, in den das Löschwasser hineingeschüttet werden mußte. Als Schmuck trug sie eine Tafel mit der Inschrift: Mit meiner Wasserflut erstick ich Feuer und Glut. Da ihre kompliziertere Bauart einen höheren Wartungsaufwand erforderte, wurde ein weiterer Spritzenmeister aufgestellt. Diese Spritze wurde noch beim Feuerwehrjubiläum 1954 öffentlich gezeigt. Zwei Jahre später verbrannte sie in der Zehntscheuer. Im Brandschutt fand sich noch die Inschrifttafel. Die Doppelspritze von 1825, wie sie noch 1954 präsentiert werden konnte (Fotoarchiv der Gemeinde Ofterdingen, Nr. 391) 12
18 Geschichtlicher Rückblick Der Hydrophor von Im Mai 1868 beschloß die Gemeinde die Anschaffung einer Saugspritze nebst Schlauch. Davon versprach man sich eine wesentliche Verbesserung der Löschleistung. Zu dieser Zeit gab es schon erstaunlich viele Hersteller von Feuerspritzen. Dies zeigt sich darin, dass bei der Gemeinde 10 Offerten eingingen. Den Zuschlag erhielt der Maschinenfabrikant Carl Metz in Heidelberg für einen sogenannten Hydrophor. Dabei handelte es sich um die Stadtspritze II, dasselbe Modell, das das Pompiers-Corps Durlach 1846 erhalten hatte und mit Erfolg einsetzte. Diese Spritze verfügte erstmals über eine Vorrichtung, das Löschwasser selbst anzusaugen. Besonders vorteilhaft war es daher, wenn man die Spritze über den Mühlbach oder in die Steinlach stellen konnte. Allein die Spritze kostete 1100 Gulden, weitere 867 Gulden kamen für Schläuche, Rohre und Schlauchverbindungen hinzu. Diese Stadtspritze Nr.II war eine sogenannte Abprotzspritze auf einem zweiräderigen Karren. Dies bedeutete, dass sie zur sicheren Bedienung am Brandplatz abgenommen und auf den Boden gestellt werden konnte. Rund 20 Jahre später, im Jahr 1889, wurde der zweiräderige Karren auf Anordnung des Oberamts in einen vierräderigen Wagen umgearbeitet. Für die Pflege des Hydrophors wurden zusätzliche Spritzenmeister bestellt. Hinzu kam jetzt als eine weitere Aufgabe die Wartung der Schläuche. Der Hydrophor von 1868 bei einer Übung 1964 (Foto: Manfred Grohe) Der Hydrophor von 1868, bei der Präsentation 1984 (Foto: Karlheinz Lindner) 13
19 1. Die Zeit vor 1864 Als in den Jahren nach 1872 die Ehmann`schen Wasserleitungen verlegt wurden, verwendete man den Hydrophor, um das Wasser aus Schächten oder Deichelgräben abzupumpen. Dies erforderderte zusätzlichen Aufwand, besonders auch für das Reinigen und Einschmieren der Saugschläuche. Als Fett verwendete man 1874 Fischtran. Der Hydrophor konnte 1956 aus der brennenden Zehntscheuer gerettet werden. Er ist noch heute brauchbar und wird immer wieder bei festlichen Gelegenheiten vorgeführt. Die Karren-Feuer-Spritze von Diese Spritze, eine zweiräderige Feuerspritze Nr. III, Nr der Firma Heinrich Kurtz in Stuttgart im Wert von 360 Mark, bot die Aachener und Münchener Feuerversicherung der Gemeinde 1879 zum Geschenk an. Der Gemeinderat beschloß Ende Dezember, die Spritze wird unter Dankesbezeugungen angenommen. Wunschgemäß veröffentlichte er dies im Schwarzwälder Boten, dem Staatsanzeiger und im Amtsblatt. Damit verfügte die Ofterdinger Wehr über eine weitere moderne Spritze, allerdings ohne Saugvorrichtung. Sie wurde fortan als das zweiräderige Spritzchen bezeichnet. Auch sie konnte 1956 aus der brennenden Zehntscheuer gerettet werden. Entgegen den Angaben im Verzeichnis von 1921 verfügt sie über einen Windkessel. Die Karrenspritze von 1879 (Fotoarchiv der Gemeinde Ofterdingen) Die Plakette der Aachener und Münchener Feuerversicherung (Fotoarchiv der Gemeinde Ofterdingen) 14
20 Geschichtlicher Rückblick Die Ausstattung mit Schläuchen.- Für den Betrieb der alten Stoßspritze waren ursprünglich keine Schläuche erforderlich. Sie erhielt erst 1838 eine Schlaucheinrichtung, d.h. statt des Wenderohrs einen Schlauchanschluß. Nachdem 1809 die tragbare Handfeuerspritze angeschafft worden war, ist erstmals 1814 von einem Feuerspritzen Schlauch die Rede. Er war vermutlich aus Leder, da auch im Inventar von 1869 der lederne Schlauch zur Handspritze verzeichnet ist. Die Lederschläuche mußten nach jedem Einsatz gewaschen, getrocknet und eingeschmiert werden. Als Fett verwendete man 1874 Fischtran. Auf dem 2. Deutschen Feuerwehrtag in Stuttgart 1855 erfolgten auch bezüglich der Feuerwehrschläuche zukunftsweisende Beschlüsse. Es wurde gefordert, die Wenderohre an Feuerspritzen zu beseitigen und an den Schläuchen Normalgewinde zu verwenden. Daraufhin erhielt 1865 die Firma Kurtz in Reutlingen den Auftrag, 90 Fuß Schläuche mit 3 Paar Normalschrauben und Gewinden zu versehen. Bei der Anschaffung des Hydrophors 1868 wurden die zugehörigen Schläuche, Rohre und Messingverbindungen gleich mitbestellt. Wie aufwendig diese Ausstattung war, zeigt sich darin, dass sie mit 867 Gulden nur 233 Gulden weniger kostete als die Spritze mit 1100 Gulden. Sie bestand aus 800 Fuß Hydrophorschlauch in 16 Teilen mit 16 Messingverbindungen sowie sogenannten Doppelschläuchen, die ebenfalls aus 50 Fuß (rd. 14 m) langen Teilen bestanden. Im Inventar von 1876 wird zwischen Hanfschläuchen (à 10 m) und Hydrophorschläuchen (à 15 m) unterschieden. Weitere Anschaffungen folgten, so 1881 zweimal 61 m Schläuche. Dem Transport der Schläuche zum Brandplatz diente das Schlauchwägele, das 1872 anläßlich einer Reparatur genannt wird lieferte Kurtz in Stuttgart einen Schlauchwagen mit 6 Häspeln sowie 6 x 15 = 90 Meter Normalschläuche mit Normalgewinde. Die Schläuche mußten nach jedem Einsatz gereinigt und getrocknet werden. Gerade ihr Trocknen in hängendem Zustand erforderte geeignete Vorrichtungen. Um 1882 hängte man die Schläuche am Schulhaus, also wohl an dem nahe der Zehntscheuer 1864 errichteten Neubau auf. Dies sah man aber als unzulänglich an, weshalb schon damals ein Steigerhaus an der Zehntscheuer geplant wurde. Dies ließ aber auf sich warten. Noch um 1890 stellte der Schlosser Hausch eine Schlauchtrockenanstalt im Rathaus her. Der Bau des Steigerturms an der Zehntscheuer wurde schließlich 1909 begonnen und 1910 abgeschlossen. Der aus Fachwerk erbaute Steigerturm verbrannte 1956 restlos mit der Zehntscheuer. 15
21 1. Die Zeit vor 1864 Die 1984 vorgeführten alten Schlauchwagen (Foto: Karlheinz Lindner) 16
22 Geschichtlicher Rückblick Weitere Feuerlösch- und Rettungsgeräte.- Bei den im 18. und auch noch bis ins 20. Jahrhundert unzulänglichen Löschmitteln kam dem Rettungswesen eine hohe Bedeutung zu. Beim Brand eines Wohnhauses, eines Stalles oder einer Scheuer galt es zunächst, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Zugleich war man bemüht, möglichst viel von Inventar, Hausrat, Vorräten und Vieh zu retten. Die wichtigsten Geräte dafür waren die Feuerleitern. Eine Neuerung zur Rettung von Personen aus oberen Stockwerken war 1865 der Rettungsschlauch. Er hatte eine Länge von rd. 16 m, und der Sattler Rockenbauch berechnete für ihn 67 Gulden. Mit den Leitern konnten die oberen Stockwerke der Gebäude und die Dächer erreicht werden. Gefährdet waren auch die Strohdächer in der Nachbarschaft des Brandherdes. Sie mußten vor Flammen, Hitze und Funkenflug geschützt werden. Auch hier kamen die Leitern, Feuereimer und Haken zum Einsatz. Wagemutige Männer brachten nasse Tücher und Wasser auf die Dächer. Seit 1769/70 entstanden laufend Kosten für Ausbesserungen oder Neuanfertigungen von Leitern. Dies dürfte darauf hinweisen, dass sie häufig im Einsatz waren. Ein Inventar von 1777 verzeichnet 2 gute und eine alte Feuerleiter kamen 2 neue Feuerleitern hinzu und 1808 waren 4 Feuerleitern vorhanden. Eine spezielle Feuerwehr-Dachleiter wurde 1919 angeschafft. Der Steigerturm bei einer Übung 1954 Zu Anfang des 20. Jahrhunderts verbesserte sich die (Fotoarchiv der Gemeinde Ofterdingen) Konstruktion der Feuerleitern durch die Entwicklung 17
23 1. Die Zeit vor 1864 von mechanischen Leitern. Schon bei seiner Visitation der Ofterdinger Wehr im Jahr 1910 hatte der Bezirksfeuerlöschinspektor das Fehlen einer solchen Leiter bemängelt. Nun beschloß der Ofterdinger Gemeinderat 1913, im folgenden Jahr eine 12 m hohe, fahrbare mechanische Feuerwehrleiter der Fa. Magirus anzuschaffen. Häufig werden zusammen mit den Leitern auch Feuerhaken erwähnt. Sie dienten vor allem dazu, brennendes Stroh von den Dächern herunterzuziehen oder brennende Gebäudeteile niederzulegen. Die Feuerordnungen erlaubten auch, intakte Gebäude einzureißen, wenn damit die Ausbreitung eines Feuers verhindert werden konnte waren 4 Feuerhaken vorhanden, 1825 bezahlte die Gemeinde für neue Leitern und Haken über 21 Gulden und 1835 für neue Feuerhaken über 13 Gulden. Zur persönlichen Ausrüstung der Feuerwehrleute gehörten um 1864 auch Seile und Beile. Die Unterbringung der Löschgeräte.- Im 18. Jahrhundert, erstmals 1776 erwähnt, waren die Feuerspritze, Leitern und Haken im Wagenhäusle untergebracht, die Feuereimer lagerten im Rathaus. Im Jahr 1817 beschloß der Magistrat, das Gemein- oder Spritzenhäusle abzubrechen und die Spritze künftig im Rathaus, im ehemaligen Salzlager, unterzubringen. Als die Einrichtung dort fertig war, baute man das Wagenhäusle ab und stellte es auf dem Marktplatz (dem Burghof) zur Unterbringung von Marktutensilien wieder auf. Seine ursprüngliche Stelle ist unbekannt. Die kleine Spritze stand 1828 im Öhrn des Rathauses, was die Feuerschau beanstandete. Feuerleitern und Haken waren 1824 in der Fleckenscheuer aufbewahrt. Die Spritzen befanden sich 1836 ebenfalls in der Zehntscheuer, die die Gemeinde von der Kgl. Staatsfinanzverwaltung gepachtet hatte. Die Pachtzeit der Zehntscheuer, die zum Teil auch von Ofterdinger Einwohnern als Heu- und Fruchtlager genutzt wurde, lief wieder einmal 1854 ab. Da sich der Pachtzins bei der Pachtverlängerung erhöhen sollte, regte sich gegen die Verlängerung Widerstand. Die Gemeinde benötigte den Raum aber nach wie vor zur Unterbringung der Feuerspritzen und Feuerwagen. Sie entschloß sich daher, die Zehntscheuer um 800 Gulden vom Staat zu kaufen. 18
24 Geschichtlicher Rückblick Die Ereignisse im Brandfall Ein Brandfall im Dorf Ofterdingen.- Ein in Haus, Stall oder Scheuer entstehender Brand dürfte meist von den Bewohnern selbst oder Nachbarn bemerkt worden sein. Bei nachtschlafender Zeit waren es oft die Nachtwächter, die ein Feuer entdeckten oder den Rauch rochen und Feuerio riefen. Bereits 1759 waren von der Gemeinde zwei Nachwächter angestellt. Auf jeden Fall mußte der Brand sofort dem Dorfsvogt als der zuständigen Amtsperson gemeldet werden, der das Feuerlärmen durch das Schlagen der Trommel oder das Läuten der Kirchenglocken anordnete. War es schon bei Tag für die Einwohner nicht einfach, sich aus der Arbeit heraus der Brandbekämpfung zuzuwenden, so sahen sie sich bei einem nächtlichen Brand in einer ungleich schwierigeren Situation. Es ist heute nicht mehr leicht vorstellbar, dass die Nächte in früheren Jahrhunderten stockdunkel waren. Zumal bei Neumond oder Bewölkung gab es keinerlei Lichtquelle. Nur selten brannte in einem Haus eine Kerze oder ein Öllämpchen. Wer über die Gasse ging, trug, um nicht in Verdacht zu geraten, eine Laterne. Bekanntlich kam der elektrische Strom für die Straßen- und Hausbeleuchtung erst 1909 nach Ofterdingen. Nach einem nächtlichen Feuerlärmen mußte es den aus dem Schlaf aufgeschreckten Einwohnern zuerst darum gehen, in der Wohnung und vor dem Haus Licht zu machen. Die Gassen wurden zur Erleichterung der Löscharbeiten mit Laternen, Fackeln, aber auch Pechkränzen beleuchtet. Dafür besaß die Gemeinde z.b einen Vorrat von 29 Fackeln und 164 Pechringen. War ein, wie noch im 18. Jahrhundert üblich, mit Stroh gedecktes Fachwerkhaus in Brand geraten, stand es schnell in Flammen. Als erstes mußten daher, schon vor der Ankunft der Spritzen und anderer Geräte, die Hausbewohner und möglichst auch Wertsachen und Inventar gerettet werden. Bei Nacht war dies schwierig, die Bewohner konnten oft nur mit Mühe entkommen. Besonders gefährdet waren unter dem Dach schlafende Kinder. Dieser Gefahren waren sich alle Einwohner bewußt. Die Angst vor dem Feuer war dementsprechend groß und daher bei jedem Brand auch die Aufregung. Die Feuerordnungen verpflichteten alle Einwohner, soweit sie dazu in der Lage waren, sogleich zum Brandplatz zu kommen. Man kann davon ausgehen, dass nach dem Feuerlärmen bei Tag oder Nacht alle auf den Beinen waren. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte das Dorf rd. 500 Männer, aus deren Reihen sich die sogenannte Pflichtmannschaft formierte. Die für die Feuerspritzen, Feuereimer, Leitern und Haken eingeteilten Männer eilten zum Wagenhäusle und zum Rathaus. Alle Geräte mußten schnell herausgeholt bzw. zugänglich gemacht werden. Durch die aufgeregt herumlaufende Menge bahnten sich nun einige Pferdehalter mit ihren angeschirrten Pferden den Weg zum Wagenhäusle, um die Spritzen zur Brandstelle zu transportieren. Als Sachverständige für ihre Bedienung waren auch die Inspektores zuge- 19
25 1. Die Zeit vor 1864 gen. Im Galopp kamen die Feuerreiter zum Rathaus, um sich für ihre Ritte Anweisungen zu holen. Wenn die Feuerspritzen endlich am Brandplatz waren und die Mannschaft mit dem Löschen beginnen konnte, war schon viel Zeit verstrichen. Oft loderten jetzt schon die Flammen und stieg die Hitze an, so dass die Spritze in einiger Entfernung aufgestellt werden mußte. Nun galt es, aus der Menschenmenge Männer zum pumpen und Wasserträger für die Eimerkette einzuteilen. Die Pumpenmannschaft zählte 8-10 Männer an den beiden Schwengeln, die etwa alle 10 Minuten abgelöst werden mußten. Die Wasserversorgung der Spritzen war häufig eine schwierige Aufgabe. Da der Hydrophor mit seiner Ansaugvorrichtung erst 1868 nach Ofterdingen kam, mußte das Löschwasser herbeigetragen werden. In günstigen Fällen konnte man die Spritzen in der Nähe des Mühlgrabens, des Bachsatzgrabens oder der Steinlach aufstellen. Die wenigen Brunnentröge waren schnell geleert und daher keine dauerhafte Hilfe. Bei Bränden, die weiter von den Wasserstellen entfernt waren, konnten nur Butten oder eine Eimerkette helfen. Dabei stellt sich die Frage, wie weit eine Eimerkette ausgedehnt werden konnte. In den Jahren 1769 und 1777 standen 72 bzw. 84 Feuereimer zur Verfügung. Wenn man davon ausgeht, dass die Mitglieder der Eimerkette ca. 1-1,5 m voneinander standen, war die Länge einer Eimerkette mit 80 Eimern auf etwa m Abstand zwischen Wasserstelle und Spritze begrenzt. Als es Feuereimer gab, konnte sich die Länge der Kette verdoppeln. Friedrich Schiller hat in seinem Lied von der Glocke in eindrucksvoller Weise die Schrecken eines Brandes geschildert. In seiner Zeit hatten sie alle vor Augen, auch Schillers Gedicht scheint auf eigener Anschauung zu beruhen: Flackernd steigt die Feuersäule, durch der Strasse lange Zeile wächst es fort mit Windeseile; kochend, wie aus Ofens Rachen, glühn die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern unter Trümmern; alles rennet, rettet, flüchtet, taghell ist die Nacht gelichtet; durch der Hände lange Kette um die Wette fliegt der Eimer; hoch im Bogen spritzen Quellen, Wasser wogen. Heulend kommt der Sturm geflogen, der die Flamme brausend sucht. Prasselnd in die dürre Frucht fällt sie, in des Speichers Räume, in der Sparren dürre Bäume, und als wollte sie im Wehen mit sich fort der Erde Wucht reissen, in gewalt ger Flucht, wächst sie in des Himmels Höhen riesengross! 20
26 Geschichtlicher Rückblick Als in den Jahren nach 1872 die Ehmann`schen Wasserleitungen verlegt wurden, brachte dies für die Versorgung mit Löschwasser eine spürbare Verbesserung. Statt der wenigen Wasserläufe und Röhrenbrunnen standen jetzt 16 laufende Brunnen, 2 Ventil- und 1 Pumpbrunnen mit insgesamt 16 Brunnentrögen zur Verfügung. Daß aber auch sie Wünsche offenließen, zeigt die Äußerung des Bezirksfeuerlöschinspektors im Jahr 1910: Bei der Hauptübung am Rathaus war die Wasserbeschaffung schleppend. Die Brandhilfe in der Nachbarschaft.- Bei der in der Bevölkerung verbreiteten Angst vor einem Brand verursachte auch ein Feueralarm in der Nachbarschaft eine große Aufregung. In den meisten Fällen überbrachte die Nachricht ein Feuerreiter. Bei Tag oder Nacht mußte der Brand dem Dorfsvogt gemeldet werden, der dann über das Feuerlärmen oder andere Alarmzeichen entschied. Wenn mit den Kirchenglocken Sturm geläutet wurde, ließ die besondere Art des Anschlagens erkennen, dass es nicht im Dorf selbst brannte. Die Überland-Löschhilfe galt als selbstverständliche Pflicht, und auch die Land-Feuer-Ordnung von 1752 geht von diesem Normalfall aus. Die Löschmannschaften sollten aber nicht zu lange abwesend sein. Die Verpflichtung zu auswärtigen Einsätzen wurde daher auf die höchstens sechs Stunden weit von der Feuers-Brunst.. gelegene Orte begrenzt. Dies bedeutet umgekehrt (wenn eine Wegstunde mit rd. ½ Meile bzw. rd. 4,5 km berechnet wird), daß noch in rd. 27 km entfernten Or- ten Hilfe geleistet werden mußte. Die Feuerlöschordnung von 1808 reduzierte diese Entfernung auf vier Wegstunden (rd. 18 km). Eine Löschhilfe in der Nachbarschaft wird erstmals in der Ofterdinger Bürgermeister-Rechnung von 1765/66 verzeichnet. Der Rechner schrieb: Da es im Frühjahr 1765 zu Bodelshausen gebronnen, so wurde die hiesige Feuerspriz, weil es in der Nachbarschaft war, auch dahin abgeschickt. Bei auswärtigen Bränden war es üblich, zunächst einen Feuerreiter der Feuersbrunst zureiten zu lassen. Erst wenn sich nach dessen Rückkunft ein klareres Bild von dem Brand ergab, wollte man sich zur Absendung von Spritze und Mannschaft entschließen. Brandhilfezettel aus der Zeit um 1870 (Vorlage: Gemeindearchiv Ofterdingen) 21
27 1. Die Zeit vor 1864 Solche Feuerritte dürften in einzelnen Fällen an die Reiter hohe Anforderungen gestellt haben. Schwierige Ritte hatten z.b. im Juni 1775 Conrad Klett wegen eines Brandes in Undingen und im April 1778 Caspar Luz nach Balingen vor sich. Im Dezember dieses Jahres ritt der Hofbauer Hans Jacob Luz sogar nach Onstmettingen. Auch wegen der Brände des Jahres 1779 in Eningen, Hohenheim und Urach waren Feuerreiter unterwegs. Erst nach langer Zeit dürfte auch der Feuerreiter zurückgekommen sein, der im Juni 1791 wegen eines Brandes nach Stuttgart abgeritten war. Nicht ohne Grund schrieb die Feuerordnung von 1824 vor, der Reiter müsse der Gegend kundig sein. Um den durch diese Ritte entstehenden Zeitverlust gering zu halten, schrieb die Land-Feuer-Ordnung von 1752 vor, der Feuerreiter habe die Strecke von einer Stunde in einer halben Stunde zurückzulegen. Dies entsprach unter Zugrundelegung von einer Wegstunde = 4,5 km einer Geschwindigkeit von ca. 9 km/h. Was bedeutete dies in der Praxis? Im Extremfall, wenn der Feuerreiter einem über 25 km entfernten Brand, wie z.b in Balingen, zureiten mußte, brauchte er für den Hin- und Rückweg rd. 6 Stunden. Erst dann erhielt der Dorfsvogt Auskunft über den Brand und konnte er über den Einsatz der Spritze entscheiden. Wenn sich die Mannschaft und die mit 3 bis 4 Pferden bespannte Feuerspritze endlich auf den Weg machte, wird sie wesentlich länger unterwegs gewesen sein als der Feuerreiter. So vergingen viele Stunden, bis die Spritze zum Einsatz kommen konnte. Oft scheint aber bei einem weit entfernten Brandplatz der gesunde Menschenverstand erst spät gewirkt zu haben. Dies zeigt folgender Eintrag in der Gemeinderechnung: Im Spätjahr 1772 kam die Nachricht anhero, daß in Stuttgart Feuer ausgegangen sein solle. Man ließ sogleich darauf die Feuerspritze von hier abgehen, die aber nicht weiter, dann halbwegs nach Tübingen gekommen. Bis aber die Spritze tatsächlich auf dem Weg war, spielten sich im Dorf aufgeregte Szenen ab. Zwar war, wie bei einem Brand im Dorf selbst, nicht die ganze Einwohnerschaft betroffen. Jedoch hatten sich die Männer für die Bespannung und Bedienung der Spritze und der Mannschaftstransportwagen sowie die Feuerreiter in fliegender Eile vorzubereiten. Bei allen Bränden herrschte zwischen den Pferdebesitzern ein Wettstreit, wer unter den drei ersten war, die zur Spritze kamen. Diese erhielten nämlich nach der Reihenfolge ihres Eintreffens die herkömmlichen Prämien. Man kann sich vorstellen, welche Hektik ausbrach, wenn aus den Ställen Pferde heraus geholt und angeschirrt wurden und die Besitzer mit ihnen durchs Dorf zur Spritze rannten. Dasselbe galt für die Besitzer von Reitpferden, die mit den gesattelten Pferden zum Rathaus kommen mußten. Sie wollten sich die Prämie für das Feuerreiten sichern. 22
28 Geschichtlicher Rückblick Die Vergütung der Löschmannschaft.- In allen Brandfällen standen den Pferdebesitzern bei der Bespannung der Spritze sowie den Feuerreitern bestimmte Prämien zu. Sie blieben seit 1760 bis 1824 unverändert und betrugen für die drei ersten Pferde der Spritzenbespannung 1 Gulden, 45 und 30 Kreuzer. Die Feuerreiter erhielten je nach Entfernung des Zielorts 15 oder 30 Kreuzer. In der Lokalfeuerordnung von 1824 werden die Prämien und jetzt auch Vergütungen neu geregelt. Die Prämien stiegen stark an. Für die beiden ersten Pferde wurden jetzt 3 Gulden, für das dritte und vierte zwei Gulden, 30 Kreuzer bezahlt, für 4 Pferde allgemein 5 Gulden. Wer zuerst mit seinem Feuerwagen erschien, erhielt auf jedes Pferd einen Gulden. Jedem Feuerreiter standen jetzt 45 Kreuzer zu, dem zuerst erscheinenden ein Gulden. 25 Jahre später, im Jahr 1858, erhöhte der Gemeinderat die Prämie der Feuerreiter auf 1 Gulden, für einen Ritt nach Rottenburg sogar auf 2 Gulden. Die Bespannung der Spritze sollte außerdem eine Vergütung erhalten, wenn sie längere Zeit auf dem Brandplatz bleiben mußte.die Guldenwährung wurde im Deutschen Kaiserreich 1871 durch die Markwährung abgelöst. Die Umrechnung ergab für einen Gulden 1,71 Goldmark. Dies wurde in der Gemeindepflegrechnung von 1875/76 bei den Prämien und Vergütungen der Pferdebesitzer und Feuerreiter umgesetzt. Demnach erhielten die Pferdebesitzer nun statt 5 Gulden 8,57 Mark. Außer den festgelegten Prämien erhielten die Löschmannschaften in früherer Zeit in der Regel keine Entschädigungen. Ihr Dienst wurde offenbar als Fronpflicht betrachtet. Dies änderte sich erst in der Zeit nach der Aufhebung der Gemeindefronen 1865, besonders nach den Bestimmungen der Bezirksfeuerlöschordnung von Die Aufhebung der Gemeindefronen und die neuen Vergütungssätze der Feuerwehrmannschaft.- Die bürgerlichen Collegien beschlossen am 4. Dezember 1865 die Aufhebung der Fronen ab 1. Januar Fortan sollten sämtliche Geschäfte veraccordiert, d.h. in Auftrag gegeben werden. Dies scheint vor allem Auswirkungen auf die Unterhaltung der Straßen und Wege gehabt zu haben. Dafür war das Frongeld von 1 Gulden gedacht, das alle aktiven Bürger und Witwen ab Juli 1866 jährlich zu zahlen hatten. Die Aufhebung der Fronpflicht hatte auch zur Folge, daß man den Feuerwehrdienst als eine entgeltpflichtige Arbeitsleistung betrachtete. Besonders die zeitaufwendige Brandhilfe erforderte eine Regelung der durch Prämien und Entschädigungen entstehenden Kosten. Dies erfolgte durch die nach der Landesfeuerlöschordnung von 1885 erlassene Bezirksfeuerlöschordnung von Um die Kosten der Brandhilfe zu begrenzen, sollte diese nur in der näheren Umgebung geleistet werden. Von Ofterdingen aus kamen bevorzugt nur die Orte des Brandhilfsverbands in Frage, nämlich Mössingen, Bodelshausen, Dußlingen und Nehren. Alle dabei entstehenden Kosten 23
Chronik der Feuerwehr Heng
 MTBl Mai/Juni 2015 Chronik der Feuerwehr Heng - Ein Bericht von Ortsheimatpfleger Hans Bradl Die Feuerwehr Heng feiert ihr 125-jähriges Bestehen von Freitag, 19. Sonntag, 21. Juni 2015 auf dem Festplatz
MTBl Mai/Juni 2015 Chronik der Feuerwehr Heng - Ein Bericht von Ortsheimatpfleger Hans Bradl Die Feuerwehr Heng feiert ihr 125-jähriges Bestehen von Freitag, 19. Sonntag, 21. Juni 2015 auf dem Festplatz
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Chronik Freiwillige Feuerwehr Cappel bis 1960
 Chronik Freiwillige Feuerwehr Cappel - 1950 bis 1960 Da die Cappeler Wehr über zwei Gruppen verfügte, der Ort zentral gelegen war und der damalige Bürgermeister Konrad Werner sich dafür einsetzte, wurde
Chronik Freiwillige Feuerwehr Cappel - 1950 bis 1960 Da die Cappeler Wehr über zwei Gruppen verfügte, der Ort zentral gelegen war und der damalige Bürgermeister Konrad Werner sich dafür einsetzte, wurde
Chronik Gebenbach Ortschaft Atzmannsricht
 Dorfbrand 1845 Entschädigung 1846 Pfarrer Gallus Schwab, in der Pfarrei von 1825 bis 1832, hat eine Übersicht über die gesamte Pfarrei zum damaligen Zeitpunkt verfasst. In einer Anmerkung dieses Buches,
Dorfbrand 1845 Entschädigung 1846 Pfarrer Gallus Schwab, in der Pfarrei von 1825 bis 1832, hat eine Übersicht über die gesamte Pfarrei zum damaligen Zeitpunkt verfasst. In einer Anmerkung dieses Buches,
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung Wohnhaus
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174380989511/ ID: 174380989511 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 33 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174380989511/ ID: 174380989511 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 33 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
Ein Engel besucht Maria
 Ein Engel besucht Maria Eines Tages vor ungefähr 2000 Jahren, als Maria an einem Baum Äpfel pflückte, wurde es plötzlich hell. Maria erschrak fürchterlich. Da sagte eine helle Stimme zu Maria: «Ich tu
Ein Engel besucht Maria Eines Tages vor ungefähr 2000 Jahren, als Maria an einem Baum Äpfel pflückte, wurde es plötzlich hell. Maria erschrak fürchterlich. Da sagte eine helle Stimme zu Maria: «Ich tu
Brandschutzaufklärung für Senioren. Landesfeuerwehrverband Hessen
 Brandschutzaufklärung für Senioren Thomas Hain Landesfeuerwehrverband Hessen Brandschutzaufklärung für Senioren - warum? Was unterscheidet die Brandschutzaufklärung zur Brandschutzerziehung? Themen der
Brandschutzaufklärung für Senioren Thomas Hain Landesfeuerwehrverband Hessen Brandschutzaufklärung für Senioren - warum? Was unterscheidet die Brandschutzaufklärung zur Brandschutzerziehung? Themen der
Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096
 20 Musterbrandschutzordnung Objekt: Kammfabrik Adolf Schuppe Eigentümer: Karl-Heinz Schuppe Bahnhofstr. 42 43137 Stenkelfeld 1 Musterbrandschutzordnung 21 Inhaltsverzeichnis: a) Einleitung...................................................
20 Musterbrandschutzordnung Objekt: Kammfabrik Adolf Schuppe Eigentümer: Karl-Heinz Schuppe Bahnhofstr. 42 43137 Stenkelfeld 1 Musterbrandschutzordnung 21 Inhaltsverzeichnis: a) Einleitung...................................................
3 RB. Die Burg. Erklärung. Auftrag. Material
 3 RB Die Burg Erklärung Eine Burg war wie ein kleines Dorf. Es gab alles, was es zum Leben brauchte. Im Fall einer Belagerung mussten die Bewohner der Burg längere Zeit ohne Kontakt zur Aussenwelt überleben
3 RB Die Burg Erklärung Eine Burg war wie ein kleines Dorf. Es gab alles, was es zum Leben brauchte. Im Fall einer Belagerung mussten die Bewohner der Burg längere Zeit ohne Kontakt zur Aussenwelt überleben
1 Geltungsbereich. (3) Ersatzansprüche nach allgemeinen Vorschriften bleiben unberührt. 2 Kostenersatz für Leistungen
 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Magstadt und die Bereitstellung des öffentlichen Feuermeldeleitungsnetzes für private Frühwarnmeldeanlagen (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Magstadt und die Bereitstellung des öffentlichen Feuermeldeleitungsnetzes für private Frühwarnmeldeanlagen (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung
Brandschutzordnung nach DIN 14096
 Brandschutzordnung Medienpaket für den professionellen Brandschutz: Vorlagen und Checklisten - Sicherheitsaushänge - Berechnungstool nach ASR A2.2 Bearbeitet von Klaus Meding 2016 2016. Buch. 104 S. ISBN
Brandschutzordnung Medienpaket für den professionellen Brandschutz: Vorlagen und Checklisten - Sicherheitsaushänge - Berechnungstool nach ASR A2.2 Bearbeitet von Klaus Meding 2016 2016. Buch. 104 S. ISBN
Aussenaufnahmen
 Vor dem Umbau 2 Aussenaufnahmen 3 4 5 6 7 Die Besitzer und die Hausgeschichte 8 1816 Gemeinderat und am 21.05.1816 Wahl ins Sittengericht (Chorrichter) 1828-1839 Ammann 01.01.1839-06.08.1840 Sekelmeister.
Vor dem Umbau 2 Aussenaufnahmen 3 4 5 6 7 Die Besitzer und die Hausgeschichte 8 1816 Gemeinderat und am 21.05.1816 Wahl ins Sittengericht (Chorrichter) 1828-1839 Ammann 01.01.1839-06.08.1840 Sekelmeister.
Ihr starkes Team für schnelle Hilfe. 90 Jahre. Schutz und Hilfe für Glentorf. Ein kleiner Rückblick
 Ihr starkes Team für schnelle Hilfe 1924 2014 90 Jahre Schutz und Hilfe für Glentorf Ein kleiner Rückblick Wir feiern Heute mit Euch, 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Glentorf, lasst uns ein wenig zurück
Ihr starkes Team für schnelle Hilfe 1924 2014 90 Jahre Schutz und Hilfe für Glentorf Ein kleiner Rückblick Wir feiern Heute mit Euch, 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Glentorf, lasst uns ein wenig zurück
Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere
 Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere alte slawische Dörfer wie Krekow, Tantow und Klein-Reinkendorf
Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere alte slawische Dörfer wie Krekow, Tantow und Klein-Reinkendorf
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Umrathshausen
 Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Umrathshausen 1872 : gründeten Bürger aus Umrathshausen, Leitenberg, Höhenberg, Spöck, Pfaffing, Wilhelming, Dösdorf, Unterprienmühle und Weiher die Freiwillige Feuerwehr
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Umrathshausen 1872 : gründeten Bürger aus Umrathshausen, Leitenberg, Höhenberg, Spöck, Pfaffing, Wilhelming, Dösdorf, Unterprienmühle und Weiher die Freiwillige Feuerwehr
Podest stand. Darauf befand sich die schwere Urne, die mit stets brennendem, süß riechendem Öl gefüllt war. An diesem Abend kräuselte sich der
 Podest stand. Darauf befand sich die schwere Urne, die mit stets brennendem, süß riechendem Öl gefüllt war. An diesem Abend kräuselte sich der silbergraue Rauch träge hinauf zum runden Loch im kuppeiförmigen
Podest stand. Darauf befand sich die schwere Urne, die mit stets brennendem, süß riechendem Öl gefüllt war. An diesem Abend kräuselte sich der silbergraue Rauch träge hinauf zum runden Loch im kuppeiförmigen
Mein Weihnachtsbüchlein Klasse 4
 Heute ist der 19. Dezember. Es ist 11.00 Uhr. Mein Weihnachtsbüchlein Klasse 4 Am 24. Dezember ist um 19.00 Uhr ist Bescherung. Wie viele Tage und Stunden musst du noch warten? Weihnachtsstollen Wie viel
Heute ist der 19. Dezember. Es ist 11.00 Uhr. Mein Weihnachtsbüchlein Klasse 4 Am 24. Dezember ist um 19.00 Uhr ist Bescherung. Wie viele Tage und Stunden musst du noch warten? Weihnachtsstollen Wie viel
Als ich geboren wurde, stand da ein Wagen. Ich kam wahrscheinlich in einem Wagen auf die Erde gefahren. Ich glaubte lange, das wäre bei allen Kindern
 Als ich geboren wurde, stand da ein Wagen. Ich kam wahrscheinlich in einem Wagen auf die Erde gefahren. Ich glaubte lange, das wäre bei allen Kindern so. Der Wagen gab mir Schutz und Geborgenheit. Ich
Als ich geboren wurde, stand da ein Wagen. Ich kam wahrscheinlich in einem Wagen auf die Erde gefahren. Ich glaubte lange, das wäre bei allen Kindern so. Der Wagen gab mir Schutz und Geborgenheit. Ich
Mein Weihnachtsbüchlein Klasse 4
 Heute ist der 19. Dezember. Es ist 11.00 Uhr. Mein Weihnachtsbüchlein Klasse 4 Am 24. Dezember ist um 19.00 Uhr Bescherung. Wie viele Tage und Stunden musst du noch warten? 19.12. 13 Stunden 20. bis 23.12.
Heute ist der 19. Dezember. Es ist 11.00 Uhr. Mein Weihnachtsbüchlein Klasse 4 Am 24. Dezember ist um 19.00 Uhr Bescherung. Wie viele Tage und Stunden musst du noch warten? 19.12. 13 Stunden 20. bis 23.12.
Alarmübung in der VG Daaden
 Ausschnitt aus dem AK-Kurier (Internetzeitung) vom 29.07.2012 Alarmübung in der VG Daaden Unerwartet, einem realen Einsatz gleich, erhielten die Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Daaden am frühen Samstagnachmittag,
Ausschnitt aus dem AK-Kurier (Internetzeitung) vom 29.07.2012 Alarmübung in der VG Daaden Unerwartet, einem realen Einsatz gleich, erhielten die Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Daaden am frühen Samstagnachmittag,
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Stadt Breckerfeld vom Bekanntmachungsanordnung
 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Stadt Breckerfeld vom 27.08.2001 32.023 Beschluss der Stadtvertretung Aufsichtsbehördliche Genehmigung Bekanntmachungsanordnung
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Stadt Breckerfeld vom 27.08.2001 32.023 Beschluss der Stadtvertretung Aufsichtsbehördliche Genehmigung Bekanntmachungsanordnung
betreffend Beitragsleistungen der Kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt an die Kosten für die Feuerschutz- und Feuerbekämpfungsmassnahmen
 Beschluss vom 29. Dezember 1967 betreffend Beitragsleistungen der Kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt an die Kosten für die Feuerschutz- und Feuerbekämpfungsmassnahmen Der Staatsrat des Kantons Freiburg
Beschluss vom 29. Dezember 1967 betreffend Beitragsleistungen der Kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt an die Kosten für die Feuerschutz- und Feuerbekämpfungsmassnahmen Der Staatsrat des Kantons Freiburg
abgegangenes Wohnhaus (Anbau an Amtsgerichtsgasse 1)
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/203510473518/ ID: 203510473518 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 3 Amtsgerichtsgasse Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/203510473518/ ID: 203510473518 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 3 Amtsgerichtsgasse Lage des Wohnplatzes
Die Anfänge der Ermreuser Wehr gehen schon 140 Jahre und mehr zurück.
 Aus der Geschichte der Ermreuser Feuerwehr Die Anfänge der Ermreuser Wehr gehen schon 140 Jahre und mehr zurück. In einer Materialbeschaffungsliste der Ermreuser Gemeinde sind 2 Feuerhaken für vier Gulden
Aus der Geschichte der Ermreuser Feuerwehr Die Anfänge der Ermreuser Wehr gehen schon 140 Jahre und mehr zurück. In einer Materialbeschaffungsliste der Ermreuser Gemeinde sind 2 Feuerhaken für vier Gulden
MITMACH-KRIPPENSPIEL WEIHNACHTEN WELTWEIT
 MITMACH-KRIPPENSPIEL WEIHNACHTEN WELTWEIT MITMACH-KRIPPENSPIEL WEIHNACHTEN WELTWEIT Bei diesem Krippenspiel haben Sie verschiedene Möglichkeiten es mit Kindern aufzuführen und dabei viele Kinder miteinzubeziehen:
MITMACH-KRIPPENSPIEL WEIHNACHTEN WELTWEIT MITMACH-KRIPPENSPIEL WEIHNACHTEN WELTWEIT Bei diesem Krippenspiel haben Sie verschiedene Möglichkeiten es mit Kindern aufzuführen und dabei viele Kinder miteinzubeziehen:
Ursula Lassert: Freiarbeit mit Bildgeschichten 3/4 Auer Verlag GmbH, Donauwörth
 36 Bildgeschichte 6 1. Schneide die Bilder aus und klebe sie auf Blatt 2! a b c d e f 2. Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge! (Achtung! Die Anzahl der Sätze stimmt nicht mit der der Bilder
36 Bildgeschichte 6 1. Schneide die Bilder aus und klebe sie auf Blatt 2! a b c d e f 2. Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge! (Achtung! Die Anzahl der Sätze stimmt nicht mit der der Bilder
Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann 200 Jahre Klubgesellschaft Hamm 25. Juni, 11 Uhr, Kurhaus
 Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann 200 Jahre Klubgesellschaft Hamm 25. Juni, 11 Uhr, Kurhaus Sehr geehrte Damen und Herren! Die vergangenen 200 Jahre der Klubgesellschaft in Hamm haben zahlreiche Geschichten
Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann 200 Jahre Klubgesellschaft Hamm 25. Juni, 11 Uhr, Kurhaus Sehr geehrte Damen und Herren! Die vergangenen 200 Jahre der Klubgesellschaft in Hamm haben zahlreiche Geschichten
Freiwillige Feuerwehr Niederbrechen Brandschutzerziehung
 Seit 1992 Jahren besucht die Freiwillige Feuerwehr Niederbrechen die Kindergärten vor Ort zur. Seit 2001 wird auch das 4. Schuljahr der Grundschule besucht. bedeutet nicht, den Kindern alles zu verbieten,
Seit 1992 Jahren besucht die Freiwillige Feuerwehr Niederbrechen die Kindergärten vor Ort zur. Seit 2001 wird auch das 4. Schuljahr der Grundschule besucht. bedeutet nicht, den Kindern alles zu verbieten,
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dettenhausen (Feuerwehrkostenersatzsatzung)
 Ortsrecht der Gemeinde Dettenhausen AZ.: 131.01 Stand: 01/2003 Ansprechpartner: Herr Fauser, Tel. 126-40 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dettenhausen
Ortsrecht der Gemeinde Dettenhausen AZ.: 131.01 Stand: 01/2003 Ansprechpartner: Herr Fauser, Tel. 126-40 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dettenhausen
sechs - sieben Milliarden Mark
 Feuer und Rauch sind zwei gute Freunde...... aber nicht immer unsere! In Deutschland brennt es jährlich über 200.000 mal. Daraus resultieren Schäden in Höhe von sechs - sieben Milliarden Mark Durch Brände
Feuer und Rauch sind zwei gute Freunde...... aber nicht immer unsere! In Deutschland brennt es jährlich über 200.000 mal. Daraus resultieren Schäden in Höhe von sechs - sieben Milliarden Mark Durch Brände
Notfall Rufnummern. Rettungsdienst/Notarzt Tel Giftnotruf Tel. (0761) Stefan Bastians, Facharzt f. Allgemeinmedizin Tel.
 Notfall Rufnummern Unfall melden Erste Hilfe Material Telefon im Sanitätsraum Raum: im Sanitätsraum Rettungsdienst/Notarzt Tel. 112 Giftnotruf Tel. (0761) 1 92 40 Stefan Bastians, Facharzt f. Allgemeinmedizin
Notfall Rufnummern Unfall melden Erste Hilfe Material Telefon im Sanitätsraum Raum: im Sanitätsraum Rettungsdienst/Notarzt Tel. 112 Giftnotruf Tel. (0761) 1 92 40 Stefan Bastians, Facharzt f. Allgemeinmedizin
Es war einmal... mit diesen und vielen anderen Merkmalen von Märchen hat sich die Klasse 2b in den letzten Wochen beschäftigt.
 Es war einmal... mit diesen und vielen anderen Merkmalen von Märchen hat sich die Klasse 2b in den letzten Wochen beschäftigt. Nachdem einige bekannte Märchen der Gebrüder Grimm gelesen und erzählt wurden,
Es war einmal... mit diesen und vielen anderen Merkmalen von Märchen hat sich die Klasse 2b in den letzten Wochen beschäftigt. Nachdem einige bekannte Märchen der Gebrüder Grimm gelesen und erzählt wurden,
Feuerwehrreglement. Regionalen. Feuerwehr Schenkenbergertal
 Feuerwehr Schenkenbergertal Feuerwehrreglement der Regionalen Feuerwehr Schenkenbergertal Gemeinden: Oberflachs, Schinznach-Bad, Schinznach-Dorf und Veltheim gültig ab. Januar 008 A. Allgemeine Bestimmungen
Feuerwehr Schenkenbergertal Feuerwehrreglement der Regionalen Feuerwehr Schenkenbergertal Gemeinden: Oberflachs, Schinznach-Bad, Schinznach-Dorf und Veltheim gültig ab. Januar 008 A. Allgemeine Bestimmungen
5. Die Glocken mm unter dis)
 5. Die Glocken Nach dem großen Brand von 1690 ist noch viel verschmolzenes Metall von den vier zerschmolzenen Glocken gerettet worden. Auf einer der zerstörten Glocken stand folgender Reim: Arnold von
5. Die Glocken Nach dem großen Brand von 1690 ist noch viel verschmolzenes Metall von den vier zerschmolzenen Glocken gerettet worden. Auf einer der zerstörten Glocken stand folgender Reim: Arnold von
Brandschutzordnung für städtische Gebäude
 Brandschutzordnung für städtische Gebäude Stadt Kehl Brand- und Zivilschutz Arbeitssicherheit Am Läger 15 77694 Kehl Fassung 02/03 Brandschutzordnung für städtische Gebäude 2 VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ Um
Brandschutzordnung für städtische Gebäude Stadt Kehl Brand- und Zivilschutz Arbeitssicherheit Am Läger 15 77694 Kehl Fassung 02/03 Brandschutzordnung für städtische Gebäude 2 VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ Um
Glutnest in Heubühne in Bettenhausen
 Herzogenbuchsee, 8.2.2012 Lt Dennis Borgeaud Chef Kommunikation 079 406 49 41 Pressemitteilung Glutnest in Heubühne in Bettenhausen Die regionale Einsatz-Zentrale alarmierte die Feuerwehr Buchsi-Oenz am
Herzogenbuchsee, 8.2.2012 Lt Dennis Borgeaud Chef Kommunikation 079 406 49 41 Pressemitteilung Glutnest in Heubühne in Bettenhausen Die regionale Einsatz-Zentrale alarmierte die Feuerwehr Buchsi-Oenz am
Alarmmeldung Nachbarhilfe, Hubretter, Franziskanerplatz 12, 6000 Luzern, dringend
 Stützpunkt - Feuerwehr Einsatzbericht Einsatzart Brandbekämpfung Datum 02.05.2018 Zeit 12:28-21:30 Einsatzort Luzern Alarmmeldung Nachbarhilfe, Hubretter, Franziskanerplatz 12, 6000 Luzern, dringend Ereignis
Stützpunkt - Feuerwehr Einsatzbericht Einsatzart Brandbekämpfung Datum 02.05.2018 Zeit 12:28-21:30 Einsatzort Luzern Alarmmeldung Nachbarhilfe, Hubretter, Franziskanerplatz 12, 6000 Luzern, dringend Ereignis
Satzung über die Erhebung von Kosten für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Winterbach (Feuerwehrkostensatzung - FWKostS)
 Satzung über die Erhebung von Kosten für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Winterbach (Feuerwehrkostensatzung - FWKostS) Auf Grund von 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit
Satzung über die Erhebung von Kosten für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Winterbach (Feuerwehrkostensatzung - FWKostS) Auf Grund von 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit
BERND-LUTZ LANGE. Das gabs früher nicht
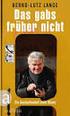 BERND-LUTZ LANGE Das gabs früher nicht BERND-LUTZ LANGE Das gabs früher nicht Ein Auslaufmodell zieht Bilanz MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen www.fsc.org FSC C083411 ISBN 978-3-351-03650-8
BERND-LUTZ LANGE Das gabs früher nicht BERND-LUTZ LANGE Das gabs früher nicht Ein Auslaufmodell zieht Bilanz MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen www.fsc.org FSC C083411 ISBN 978-3-351-03650-8
ZENTRALE KLASSENARBEIT Deutsch. Schuljahrgang 6
 GYMNASIUM Deutsch Schuljahrgang 6 Arbeitszeit: 45 Minuten Name, Vorname: Klasse: 1 Lies den Text gründlich! Bearbeite anschließend alle Aufgaben auf den Arbeitsblättern! (Du darfst im Text markieren.)
GYMNASIUM Deutsch Schuljahrgang 6 Arbeitszeit: 45 Minuten Name, Vorname: Klasse: 1 Lies den Text gründlich! Bearbeite anschließend alle Aufgaben auf den Arbeitsblättern! (Du darfst im Text markieren.)
Der Lehrer, der in einem Buch. wohnte
 Der Lehrer, der in einem Buch wohnte Norbert Berens Copyright: Norbert Berens rue des Bruyères, 12 L-8118 Bridel März 2012 Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Der Lehrer, der in einem Buch wohnte Norbert Berens Copyright: Norbert Berens rue des Bruyères, 12 L-8118 Bridel März 2012 Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
 Betreff: Brand in Pavelsbach am 4.Juli 1928 I. Auf Vorladung erscheint Ludwig Kneißl u. erklärt: Ich war bei Brandausbruch daheim. Plötzlich hieß es Feuer und da sah ich, dass das Anwesen der Kleesattel
Betreff: Brand in Pavelsbach am 4.Juli 1928 I. Auf Vorladung erscheint Ludwig Kneißl u. erklärt: Ich war bei Brandausbruch daheim. Plötzlich hieß es Feuer und da sah ich, dass das Anwesen der Kleesattel
Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Niddatal (FeuerwGebSatzung)
 6a Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Niddatal (FeuerwGebSatzung) Inhaltsverzeichnis: Seite 2 Präambel Seite 3 1 Gebührentatbestand Seite 4 2 Gebührenpflichtige
6a Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Niddatal (FeuerwGebSatzung) Inhaltsverzeichnis: Seite 2 Präambel Seite 3 1 Gebührentatbestand Seite 4 2 Gebührenpflichtige
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Aspach (Feuerwehrkostenersatzsatzung)
 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Aspach (Feuerwehrkostenersatzsatzung) mit Änderung vom 25. September 2012 Aufgrund von 4 der Gemeindeordnung
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Aspach (Feuerwehrkostenersatzsatzung) mit Änderung vom 25. September 2012 Aufgrund von 4 der Gemeindeordnung
Fachplaner Brandschutz Seminare der IngKH 1
 Fachplaner Brandschutz Seminare der IngKH 1 Sie haben sich angemeldet, wir haben zugesagt, Ihnen etwas näher zu bringen: Brandschutz. Mai 2019 Wir erproben den fliegenden Wechsel in der Führung von Dipl.-Ing
Fachplaner Brandschutz Seminare der IngKH 1 Sie haben sich angemeldet, wir haben zugesagt, Ihnen etwas näher zu bringen: Brandschutz. Mai 2019 Wir erproben den fliegenden Wechsel in der Führung von Dipl.-Ing
Einwohnergemeinde Lauterbrunnen Reglement über die Föhnwache
 871.3 Einwohnergemeinde Lauterbrunnen Reglement über die Föhnwache I. Feuerpolizeiliche Vorschriften Art. 1 Jedermann ist verpflichtet, mit Feuer und Licht sorgfältig umzugehen. Art. 2 In Scheunen, Ställen,
871.3 Einwohnergemeinde Lauterbrunnen Reglement über die Föhnwache I. Feuerpolizeiliche Vorschriften Art. 1 Jedermann ist verpflichtet, mit Feuer und Licht sorgfältig umzugehen. Art. 2 In Scheunen, Ställen,
Vorbereitete Kurzführungen durch SuS Thema 6. Alphütte um 1900 Teil 2 Arbeiten
 Historisches Museum Obwalden Sarnen Orientierungsstufe (LP 21 / 3. Zyklus) Unterlagen für die Arbeit im Museum Vorbereitete Kurzführungen durch SuS Thema 6 Arbeitsgruppe Thema Alphütte um 1900 Teil 2 Arbeiten
Historisches Museum Obwalden Sarnen Orientierungsstufe (LP 21 / 3. Zyklus) Unterlagen für die Arbeit im Museum Vorbereitete Kurzführungen durch SuS Thema 6 Arbeitsgruppe Thema Alphütte um 1900 Teil 2 Arbeiten
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) der Gemeinde Todtenweis. vom in der Fassung der 1.
 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) der Gemeinde Todtenweis vom 22.04.2009 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 07.06.2017 Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) der Gemeinde Todtenweis vom 22.04.2009 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 07.06.2017 Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
Richtlinien über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Achern
 Seite 1 P:\HOMEPAGE\FB 2\Satzungen\52 Richtlinien für die Erhebung von Kostenersatz für die Leistungen Richtlinien über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Achern Der
Seite 1 P:\HOMEPAGE\FB 2\Satzungen\52 Richtlinien für die Erhebung von Kostenersatz für die Leistungen Richtlinien über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Achern Der
Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Dornhan (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung FwKS)
 Stadt Dornhan Landkreis Rottweil Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Dornhan (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung FwKS) Aufgrund von 4 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg
Stadt Dornhan Landkreis Rottweil Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Dornhan (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung FwKS) Aufgrund von 4 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg
Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Mögglingen vom
 Ostalbkreis Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Mögglingen vom 23.09.2016 Aufgrund von 34 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg, 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Ostalbkreis Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Mögglingen vom 23.09.2016 Aufgrund von 34 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg, 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Wie ich das mechanical village in den USA gefunden habe
 1 Wie ich das mechanical village in den USA gefunden habe Kyburz ist Mitglied des internationalen Verein der mechanischen Musikinstrumenten-Sammler. Und da gibt es jeweils Ende August, anfangs September
1 Wie ich das mechanical village in den USA gefunden habe Kyburz ist Mitglied des internationalen Verein der mechanischen Musikinstrumenten-Sammler. Und da gibt es jeweils Ende August, anfangs September
Pelletbunker geht in Flammen auf
 Region Hinterland und Marburg Pelletbunker geht in Flammen auf FEUERWEHR 80 Einsatzkräfte löschen im Gewerbepark bei Mornshausen Gladenbach-Mornshausen. Ein Großbrand im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal
Region Hinterland und Marburg Pelletbunker geht in Flammen auf FEUERWEHR 80 Einsatzkräfte löschen im Gewerbepark bei Mornshausen Gladenbach-Mornshausen. Ein Großbrand im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal
Zu Besuch bei der Feuerwehr
 Zu Besuch bei der Feuerwehr Wie schon seit einigen Jahren eingebürgert durften die Kinder des Zyklus 2 die Feuerwehr auch dieses Jahr wieder vor Ort in der Feuerwehrhalle in Wintger besuchen, um etwas
Zu Besuch bei der Feuerwehr Wie schon seit einigen Jahren eingebürgert durften die Kinder des Zyklus 2 die Feuerwehr auch dieses Jahr wieder vor Ort in der Feuerwehrhalle in Wintger besuchen, um etwas
Stadt Kehl Brand- und Bevölkerungsschutz Am Läger Kehl
 Kostenersatzordnung für Leistungen der Feuerwehr Kehl vom 08. April 2002 mit Kostenverzeichnis Stand Januar 2009 Stadt Kehl Brand- und Bevölkerungsschutz Am Läger 15 77694 Kehl 1 Kostenersatzordnung für
Kostenersatzordnung für Leistungen der Feuerwehr Kehl vom 08. April 2002 mit Kostenverzeichnis Stand Januar 2009 Stadt Kehl Brand- und Bevölkerungsschutz Am Läger 15 77694 Kehl 1 Kostenersatzordnung für
Sabine Zett. Mit Illustrationen von Susanne Göhlich
 Sabine Zett Mit Illustrationen von Susanne Göhlich Vor mehr als zweitausend Jahren lebte in Nazaret, einem kleinen Dorf in Israel, eine junge Frau namens Maria. Sie führte ein sehr einfaches Leben, doch
Sabine Zett Mit Illustrationen von Susanne Göhlich Vor mehr als zweitausend Jahren lebte in Nazaret, einem kleinen Dorf in Israel, eine junge Frau namens Maria. Sie führte ein sehr einfaches Leben, doch
Das Kirchenschiff und der Turm
 Das Kirchenschiff und der Turm Der heutige Standort der Kirche lässt darauf schließen, dass an gleicher Stelle schon mehrere Kirchen bzw. Kapellen standen. In der Flurkarte von 1704 wird auf eine Kapelle
Das Kirchenschiff und der Turm Der heutige Standort der Kirche lässt darauf schließen, dass an gleicher Stelle schon mehrere Kirchen bzw. Kapellen standen. In der Flurkarte von 1704 wird auf eine Kapelle
Satzung. Zweck der Brandschau
 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und für die Erbringung sonstiger brandschutztechnischer Leistungen in der Stadt Fröndenberg/Ruhr vom 14. 12. 2009, geändert durch
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und für die Erbringung sonstiger brandschutztechnischer Leistungen in der Stadt Fröndenberg/Ruhr vom 14. 12. 2009, geändert durch
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Trebgast (BGS/ WAS) Vom
 Mit Änderungen der Satzungen vom 11.12.2012 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 52 des Landkreises Kulmbach vom 28.12.2012) und vom 14.12.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 51 des Landkreises Kulmbach
Mit Änderungen der Satzungen vom 11.12.2012 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 52 des Landkreises Kulmbach vom 28.12.2012) und vom 14.12.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 51 des Landkreises Kulmbach
OLM Dennis Buroh FF Großenaspe, FwDV3. Einheiten im Löscheinsatz
 FwDV3 Einheiten im Löscheinsatz Was haben wir Heute vor: Was ist überhaupt die FwDV3? Was ist eine Taktische Einheit? Sitzplatz = Aufgabe?! Aufgaben? Was macht eigentlich wer? Mit Bereitstellung oder ohne
FwDV3 Einheiten im Löscheinsatz Was haben wir Heute vor: Was ist überhaupt die FwDV3? Was ist eine Taktische Einheit? Sitzplatz = Aufgabe?! Aufgaben? Was macht eigentlich wer? Mit Bereitstellung oder ohne
Jesus kommt zur Welt
 Jesus kommt zur Welt In Nazaret, einem kleinen Ort im Land Israel, wohnte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie von König David,
Jesus kommt zur Welt In Nazaret, einem kleinen Ort im Land Israel, wohnte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie von König David,
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Bad Boll (Feuerwehrkostenersatzsatzung)
 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Seite F2-1 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Bad Boll (Feuerwehrkostenersatzsatzung)
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Seite F2-1 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Bad Boll (Feuerwehrkostenersatzsatzung)
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung Wohnhaus
 http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166059314120/ ID: 166059314120 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 63 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166059314120/ ID: 166059314120 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung Objektdaten Straße: Hausnummer: 63 Hauptstraße Lage des Wohnplatzes
4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.v.m. 2, 9 des Kommunalabgabengesetzes und 27, 36 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg
 Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Weilheim an der Teck (Feuerwehrkostenersatzsatzung) Rechtsgrundlage: 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Weilheim an der Teck (Feuerwehrkostenersatzsatzung) Rechtsgrundlage: 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Ich bin ein Boot VON ALEXANDER & MELANIE. Grafiken (Zeichnungen) von Melanie 10 Jahre. Erschienen Copywrite by Alexander Spanny
 Ich bin ein Boot VON ALEXANDER & MELANIE Grafiken (Zeichnungen) von Melanie 10 Jahre Erschienen 2019-01-11 Copywrite by Alexander Spanny VORANKÜNDIGUNG Weiter Kurzgeschichten sind bereits in Arbeit und
Ich bin ein Boot VON ALEXANDER & MELANIE Grafiken (Zeichnungen) von Melanie 10 Jahre Erschienen 2019-01-11 Copywrite by Alexander Spanny VORANKÜNDIGUNG Weiter Kurzgeschichten sind bereits in Arbeit und
Kleine Verkaufsstätten
 Brandschutztechnische Anforderungen an Kleine Verkaufsstätten 14 14 Dieses gemeinsame Merkblatt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der
Brandschutztechnische Anforderungen an Kleine Verkaufsstätten 14 14 Dieses gemeinsame Merkblatt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der
Was Requirements Engineers von den Schildbürgern lernen können Eine Schildbürgergeschichte statt einer Einleitung
 Was Requirements Engineers von den Schildbürgern lernen können Eine Schildbürgergeschichte statt einer Einleitung Große Augen. Weit aufgerissene Münder. Laute des Staunens. Plötzlich aufbrandender Applaus.
Was Requirements Engineers von den Schildbürgern lernen können Eine Schildbürgergeschichte statt einer Einleitung Große Augen. Weit aufgerissene Münder. Laute des Staunens. Plötzlich aufbrandender Applaus.
Ich gratuliere der St. Rochus Schützenbruderschaft Wahlen ganz herzlich zum 80-jährigen Bestehen.
 1 Rede des Schirmherren Landrat Günter Rosenke anlässlich des 80-jährigen Bestehens der St. Rochus Schützenbruderschaft Wahlen in Verbindung mit dem Bezirksschützenfest des Bezirksverbandes Schleiden am
1 Rede des Schirmherren Landrat Günter Rosenke anlässlich des 80-jährigen Bestehens der St. Rochus Schützenbruderschaft Wahlen in Verbindung mit dem Bezirksschützenfest des Bezirksverbandes Schleiden am
Satzung der Stadt Lüdenscheid über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr vom 11.02.2016
 Satzung der Stadt Lüdenscheid über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr vom 11.02.2016 Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 01.02.2016 folgende Satzung beschlossen: Inhaltsverzeichnis
Satzung der Stadt Lüdenscheid über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr vom 11.02.2016 Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 01.02.2016 folgende Satzung beschlossen: Inhaltsverzeichnis
Bericht aus den letzten Monaten des Weltkrieges 1945
 Bericht aus den letzten Monaten des Weltkrieges 1945 Dieser Bericht wurde Ende der vierziger Jahre von der Seifensiedertochter Emmy Iff geschrieben. Sie wohnte in der Marktstraße 12 und wurde am 6. Juni
Bericht aus den letzten Monaten des Weltkrieges 1945 Dieser Bericht wurde Ende der vierziger Jahre von der Seifensiedertochter Emmy Iff geschrieben. Sie wohnte in der Marktstraße 12 und wurde am 6. Juni
LWL-Gräftenhof :46 Uhr Seite 1. Gräftenhof. Arbeitsbogen Museumspädagogik
 LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 1 Gräftenhof 1 Arbeitsbogen Museumspädagogik LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 2 Text & Idee: Zeichnungen: Layout: Fotonachweis: LWL-Freilichtmuseum
LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 1 Gräftenhof 1 Arbeitsbogen Museumspädagogik LWL-Gräftenhof 1 23.09.2009 10:46 Uhr Seite 2 Text & Idee: Zeichnungen: Layout: Fotonachweis: LWL-Freilichtmuseum
FwDV 4 - Die Gruppe im Löscheinsatz
 FwDV 4 - Die Gruppe im Löscheinsatz Gliederung der Mannschaft: Aufgaben der Mannschaft: (GF) Maschinist (Ma) Melder (Me) (A-Trupp) (W-Trupp) (S-Trupp) - leitet den Einsatz seiner Gruppe. - er ist an keinen
FwDV 4 - Die Gruppe im Löscheinsatz Gliederung der Mannschaft: Aufgaben der Mannschaft: (GF) Maschinist (Ma) Melder (Me) (A-Trupp) (W-Trupp) (S-Trupp) - leitet den Einsatz seiner Gruppe. - er ist an keinen
Die Zukunft der Brandvorsorge beginnt
 Die Zukunft der Brandvorsorge beginnt wafix gmbh Itzgrund 25 95512 Neudrossenfeld 0 92 03/ 68 68 88 0 92 03/ 68 68 89 Mail: info@wafix.de www.wafix.de Der Eine Idee wurde Realität Die Idee entstand aus
Die Zukunft der Brandvorsorge beginnt wafix gmbh Itzgrund 25 95512 Neudrossenfeld 0 92 03/ 68 68 88 0 92 03/ 68 68 89 Mail: info@wafix.de www.wafix.de Der Eine Idee wurde Realität Die Idee entstand aus
Kinder laufen im Raum, auf Signal der Rahmentrommel bzw. Feuerwehrsignal und Ruf der Leiterin müssen sie schnell und richtig reagieren.
 Feuerwehrlektion Spiele: 1. Spiel: "Feuer, Wasser, Blitz" Kinder laufen im Raum, auf Signal der Rahmentrommel bzw. Feuerwehrsignal und Ruf der Leiterin müssen sie schnell und richtig reagieren. Feuer:
Feuerwehrlektion Spiele: 1. Spiel: "Feuer, Wasser, Blitz" Kinder laufen im Raum, auf Signal der Rahmentrommel bzw. Feuerwehrsignal und Ruf der Leiterin müssen sie schnell und richtig reagieren. Feuer:
Der unbesiegbare Cyborg
 Der unbesiegbare Cyborg Es war einmal ein sehr guter Boxer, er hieß Daniel und war der zweitbeste auf der ganzen Welt. Er wohnte in einem Haus. Zwanzig Jahre später kam die Zukunft und die Menschen bauten
Der unbesiegbare Cyborg Es war einmal ein sehr guter Boxer, er hieß Daniel und war der zweitbeste auf der ganzen Welt. Er wohnte in einem Haus. Zwanzig Jahre später kam die Zukunft und die Menschen bauten
Inselspital, Universitätsspital Bern Brandschutz
 Inselspital, Universitätsspital Bern Brandschutz Verhalten im Brandfall Einführung Ihr Verhalten bei einem Brandausbruch ist entscheidend. Oft wird die Feuerwehr erst nach misslungenen Löschversuchen alarmiert.
Inselspital, Universitätsspital Bern Brandschutz Verhalten im Brandfall Einführung Ihr Verhalten bei einem Brandausbruch ist entscheidend. Oft wird die Feuerwehr erst nach misslungenen Löschversuchen alarmiert.
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Tutzing (BGS/WAS) (Lesefassung Stand: Januar 2017)
 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Tutzing (BGS/WAS) (Lesefassung Stand: Januar 2017) Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt die Gemeinde Tutzing
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Tutzing (BGS/WAS) (Lesefassung Stand: Januar 2017) Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt die Gemeinde Tutzing
Erstsemesterwoche Oktober Brandschutzordnung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
 Erstsemesterwoche 12.-17.Oktober 2015 Brandschutzordnung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Pflicht Alle Mitglieder und Angehörige der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sind verpflichtet, gemäß
Erstsemesterwoche 12.-17.Oktober 2015 Brandschutzordnung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Pflicht Alle Mitglieder und Angehörige der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sind verpflichtet, gemäß
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Seeshaupt (BGS/WAS) vom
 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Seeshaupt (BGS/WAS) vom 04.10.2010 Auf Grund der Art.5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Seeshaupt folgende
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Seeshaupt (BGS/WAS) vom 04.10.2010 Auf Grund der Art.5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Seeshaupt folgende
Große Kreisstadt Bretten
 Große Kreisstadt Bretten Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bretten (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung FwKS) vom 24.04.2018 Aufgrund von 4 Gemeindeordnung für
Große Kreisstadt Bretten Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bretten (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung FwKS) vom 24.04.2018 Aufgrund von 4 Gemeindeordnung für
 8 Wissen Wissen 9 Wer hat das erfunden? Ein Leben ohne Auto und Computer können wir uns gar nicht vorstellen. Oder ein Leben ohne ein leckeres Eis! Aber all diese Dinge gab es nicht schon immer sie mussten
8 Wissen Wissen 9 Wer hat das erfunden? Ein Leben ohne Auto und Computer können wir uns gar nicht vorstellen. Oder ein Leben ohne ein leckeres Eis! Aber all diese Dinge gab es nicht schon immer sie mussten
Die Feuerwehr Grafeld war mit einem Fahrzeug und 12 Feuerwehrleuten für ca. eine halben Stunde im Einsatz.
 26.12.2016 Baum auf Fahrbahn Am 26.12.2016 gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Grafeld zu einem Baum auf Fahrbahn in die Herzlaker Straße alarmiert. Auf Grund der Starkwindlage brach ein großer Ast aus
26.12.2016 Baum auf Fahrbahn Am 26.12.2016 gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Grafeld zu einem Baum auf Fahrbahn in die Herzlaker Straße alarmiert. Auf Grund der Starkwindlage brach ein großer Ast aus
Zeitreise ins Mittelalter
 Zeitreise ins Mittelalter Vom Holzstoß bis zum schussbereiten Trebuchet Es war in der siebten Klasse, als wir im Geschichtsunterricht einen Film über den Bau von zwei Katapulten anschauten. In diesem Film
Zeitreise ins Mittelalter Vom Holzstoß bis zum schussbereiten Trebuchet Es war in der siebten Klasse, als wir im Geschichtsunterricht einen Film über den Bau von zwei Katapulten anschauten. In diesem Film
und fiel hin. Sie ärgerte sich über den blauen Fleck am Hintern und sagte:»siehst du, meine liebe Senka, wenn du von einem bosnischen Hocker ein Bein
 und fiel hin. Sie ärgerte sich über den blauen Fleck am Hintern und sagte:»siehst du, meine liebe Senka, wenn du von einem bosnischen Hocker ein Bein entfernst, geht alles zum Teufel.«In der Ulica Potekija
und fiel hin. Sie ärgerte sich über den blauen Fleck am Hintern und sagte:»siehst du, meine liebe Senka, wenn du von einem bosnischen Hocker ein Bein entfernst, geht alles zum Teufel.«In der Ulica Potekija
DAS ANDERE BEZIRKSBUCH DER FÜNFTE BEZIRK 2011 Hilla M. Faseluka
 DAS ANDERE BEZIRKSBUCH DER FÜNFTE BEZIRK 2011 Hilla M. Faseluka Dieses Bezirksbuch beschreibt die einzelnen Bezirke von Wien. Es beginnt mit es waren einmal ein paar kleine Dörfer, sie bildeten die Vorstädte
DAS ANDERE BEZIRKSBUCH DER FÜNFTE BEZIRK 2011 Hilla M. Faseluka Dieses Bezirksbuch beschreibt die einzelnen Bezirke von Wien. Es beginnt mit es waren einmal ein paar kleine Dörfer, sie bildeten die Vorstädte
Der Weihnachtsdrache von Sebastian Koesling Klasse 5 FGH
 Der Weihnachtsdrache von Sebastian Koesling Klasse 5 FGH 1. Kapitel: Winterferien Es war einmal in einer einsamen Höhle ein Drache. Dieser Drache hat noch nie das Tageslicht gesehen, weil er an eine große
Der Weihnachtsdrache von Sebastian Koesling Klasse 5 FGH 1. Kapitel: Winterferien Es war einmal in einer einsamen Höhle ein Drache. Dieser Drache hat noch nie das Tageslicht gesehen, weil er an eine große
Brände verhüten. Verhalten im Brandfall
 Brände verhüten Offenes Feuer verboten Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren Brand melden Feuerwehr 112 Wo brennt es (Anschrift u. Ort)? Was brennt? Sind Menschen in Gefahr? Wer meldet den Brand? In Sicherheit
Brände verhüten Offenes Feuer verboten Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren Brand melden Feuerwehr 112 Wo brennt es (Anschrift u. Ort)? Was brennt? Sind Menschen in Gefahr? Wer meldet den Brand? In Sicherheit
Das kurze Leben von Anna Lehnkering
 Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
Es war einmal das Christkind. Wie jedes Jahr am 24.Dezember machte es sich auf den Weg in die Stadt. Dort wollte es den Kindern die Geschenke
 1 Es war einmal das Christkind. Wie jedes Jahr am 24.Dezember machte es sich auf den Weg in die Stadt. Dort wollte es den Kindern die Geschenke bringen. Die würden sich freuen... 2 Aber das Christkind
1 Es war einmal das Christkind. Wie jedes Jahr am 24.Dezember machte es sich auf den Weg in die Stadt. Dort wollte es den Kindern die Geschenke bringen. Die würden sich freuen... 2 Aber das Christkind
Zu welchem Zweck wurden Burgen errichtet? Nenne mindestens 5 Bestandteile einer Burg! Wo wurden Burgen gebaut?
 Zu welchem Zweck wurden Burgen errichtet? Man baute Burgen als Stützpunkt und zum Schutz vor den Feinden. In den Notzeiten boten sie Unterschlupf für die bäuerliche Bevölkerung. Weiters waren sie auch
Zu welchem Zweck wurden Burgen errichtet? Man baute Burgen als Stützpunkt und zum Schutz vor den Feinden. In den Notzeiten boten sie Unterschlupf für die bäuerliche Bevölkerung. Weiters waren sie auch
Rechtsgrundlagen und Organisation der Feuerwehr
 Rechtsgrundlagen und Organisation der Feuerwehr Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren Feuerwehrdienstvorschrift 2/2 Allgemeine Grundlagen Rechtsgrundlagen Die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit
Rechtsgrundlagen und Organisation der Feuerwehr Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren Feuerwehrdienstvorschrift 2/2 Allgemeine Grundlagen Rechtsgrundlagen Die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit
Seniorentreff Cölbe 15. November 2011 Gemeindehalle Cölbe. Zum Löschen zu alt?
 Seniorentreff Cölbe 15. November 2011 Gemeindehalle Cölbe Zum Löschen zu alt? Fachvortrag zu dem Thema Brandverhütung im Haushalt und Verhalten im Brandfall Inhalt Vorstellung der Freiwilligen Feuerwehr
Seniorentreff Cölbe 15. November 2011 Gemeindehalle Cölbe Zum Löschen zu alt? Fachvortrag zu dem Thema Brandverhütung im Haushalt und Verhalten im Brandfall Inhalt Vorstellung der Freiwilligen Feuerwehr
V e r t r a g. zwischen den Gemeinden. Möhlin und Zeiningen. über die. gemeinsame Feuerwehr Möhlin
 Vertrag Feuerwehren Möhlin-Zeiningen / Entwurf 14.04.2008 / 29.04.2008 / 21.07.2008 Seite 0/6 V e r t r a g zwischen den Gemeinden Möhlin und Zeiningen über die gemeinsame Feuerwehr Möhlin Vertrag Feuerwehren
Vertrag Feuerwehren Möhlin-Zeiningen / Entwurf 14.04.2008 / 29.04.2008 / 21.07.2008 Seite 0/6 V e r t r a g zwischen den Gemeinden Möhlin und Zeiningen über die gemeinsame Feuerwehr Möhlin Vertrag Feuerwehren
Gemeinde Teising. Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Teising (BGS WAS) Vom 2. Juli 2012
 Gemeinde Teising Landkreis Altötting Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Teising (BGS WAS) Vom 2. Juli 2012 Auf Grund der Art. 5, 8 und Art. 9 des Kommunalabgabengesetzes
Gemeinde Teising Landkreis Altötting Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Teising (BGS WAS) Vom 2. Juli 2012 Auf Grund der Art. 5, 8 und Art. 9 des Kommunalabgabengesetzes
