Schulinternes Curriculum Russisch Sekundarstufe II
|
|
|
- Inken Förstner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schulinternes Curriculum Russisch Sekundarstufe II Stand: Januar 2015
2 Inhalt 1. Die Fachgruppe Russisch am St. Franziskus Gymnasium Olpe 3 2. Entscheidungen zum Unterricht Unterrichtsvorhaben Übersichtsraster für Unterrichtsvorhaben 5 Russisch als neu einsetzende Fremdsprache Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Lehr- und Lernmittel Entscheidung zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen Qualitätssicherung und Evaluation 27
3 1. Die Fachgruppe Russisch am St. Franziskus Gymnasium Olpe Bedeutung des Faches Russisch: Voraussetzungen für das Fach an der Schule: Aufgaben und Funktionen des Fachs an der Schule: Russisch ist in und außerhalb von Russland die Muttersprache von ca. 160 Millionen Menschen. Außerdem dient es auf dem Gebiet der ehemaligen SU als Verkehrssprache. Russisch als 3. Fremdsprache eröffnet daher auch für das spätere berufliche Umfeld vielerlei Perspektiven. Das Fach Russisch wird neben dem Fach Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache in der Oberstufe als Grundkurs angeboten und wird zumeist als dritte Fremdsprache gewählt. Schülerinnen und Schülern, die mit nur einer Fremdsprache in die gymnasiale Oberstufe wechseln, gibt sie die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache zu erlernen, die als Voraussetzung für das Abitur gilt. Der Russischunterricht soll unsere Schülerinnen und Schüler vor allem befähigen, ihre kommunikative Kompetenz in der Russischen Sprache zu erweitern, d.h. besonders im Zuge wachsender Internationalisierung und Globalisierung an fremdsprachlicher Kommunikation teilzunehmen und durch den landeskundlichen Vergleich kulturelle Unterschiede zu tolerieren und die Geschehnisse im eigenen Land kritisch zu reflektieren. Das Fach leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zu den Bildungs- und Erziehungszielen unserer Schule. Über den Unterricht hinaus bemüht sich die Fachschaft Russisch besonders darum, Schülerinnen und Schülern das Russische in authentischen Situationen erlebbar zu machen und auf diesem Wege für das Erlernen der Sprache und die fremde Kultur zu sensibilisieren. Unter diesem Anliegen sind besonders die Schulpartnerschaft mit dem Gymnasium Nr. 41 der Stadt St. Petersburg, die Teilnahme an Spracholympiaden des Russischlehrer-Verbandes NRW sowie am Bundescup Spielend Russisch lernen zu nennen. Ressourcen der Schule: Es gibt je einen Grundkurs Russisch pro Jahrgangsstufe, der mit 2,7 Stunden/Woche (67- Minuten) erteilt wird. Jährlich wählen einige Schüler das Fach als 3. oder 4. Abiturfach. Der Unterricht findet in der Regel im Russisch-Raum 207 statt.
4 Die Russisch-Fachschaft: Frau Dr. Görg Herr Muradjan 2.1 Unterrichtsvorhaben 2. Entscheidungen zum Unterricht Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan hat das Ziel, die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen abzudecken. Damit korrespondiert die Verpflichtung jeder Lehrkraft, bei den Lernenden die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans auszubilden und zu entwickeln. Im Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen zu verschaffen. Zum Zwecke der Klarheit und Übersichtlichkeit werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen ausgewiesen; die konkretisierten Kompetenzerwartungen finden dagegen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben (Kapitel 2.1.2) Berücksichtigung. Während das Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben (Kapitel 2.1.1) verbindlich, besitzt die exemplarische Ausweisung konkretisierter Unterrichtsvorgaben (Kapitel 2.1.2) empfehlenden Charakter ohne Bindekraft. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.b. Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.
5 2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Russisch als neu einsetzende Fremdsprache Einführungsphase EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erste Begegnung mit Russland (Конечно 1, урок 1 и 2) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Unterrichtsvorhaben II: Thema: Alltag in Russland (Конечно 1, урок 3 и 4) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenzen Interkulturelle kommunikative Kompetenzen Schreiben, Lesen, Aussprache, grundlegende grammatische Strukturen Sprechen, Hören, Lesen Text- und Medienkompetenz Text- und Medienkompetenz Zeitbedarf: ca. 30 Std. Unterrichtsvorhaben III: Thema: Familie und Freizeit (Конечно 1, урок 4 и 5) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen Interkulturelle kommunikative Kompetenzen Schreiben, Lesen, Hör-/Sehverstehen Text- und Medienkompetenz Zeitbedarf: ca. 30 Std. Unterrichtsvorhaben IV: Thema: Orientierung in Moskau, russische Feiertage (Конечно 1, урок 6 и 7) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen Interkulturelle kommunikative Kompetenzen Sprachmittlung, Sprechen, Hören Text- und Medienkompetenz Zeitbedarf: 30 Std. Zeitbedarf: 30 Std. Summe EF ca. 120 Stunden
6 Qualifikationsphase 1 Unterrichtsvorhaben I: Thema: Ferien in Russland und in Europa (Конечно 1, урок 8 и 9) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Sprechen, Lesen, Schreiben Text-und Medienkompetenz Zeitbedarf: 30 Std. Unterrichtsvorhaben III: Thema: Einkaufen und Wohnen (Конечно 1, урок 11) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Sprechen, Schreiben, Hören Text-und Medienkompetenz Zeitbedarf: 30 Std. Unterrichtsvorhaben II: Thema: Leben in Russland am Beispiel von St. Petersburg und Tula (Конечно 1, урок 9 и 10) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hören, Schreiben, Lesen Text-und Medienkompetenz Zeitbedarf: 30 Std. Unterrichtsvorhaben IV: Thema: Schule und Ausbildungssystem im Vergleich (Конечно 1, урок 12 und ggf. Zusatzmaterialien) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Sprechen, Schreiben, Hören Text-und Medienkompetenz Zeitbedarf: 30 Std. Summe Q1 ca. 120 Stunden
7 Qualifikationsphase 2 Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II: Thema: Reisen in und nach Russland (außergewöhnliche Reisen, Porträt einer Stadt oder einer Region) Thema: Aktuelle Probleme und Perspektiven Jugendlicher in Russland und Deutschland (Ausbildung und Beruf, Liebe und Partnerschaft) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hören, Sprechen, Lesen, Sprachmittlung Text- und Medienkompetenz Zeitbedarf: ca 30 Std. Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lesen, Schreiben, Hör- /Sehverstehen Text- und Medienkompetenz Zeitbedarf: ca 30 Std. Unterrichtsvorhaben III: Thema: Aktuelle gesellschaftliche Fragen und Probleme in Russland und ihre Relevanz für Jugendliche (Wiederholung und Vorbereitung auf die Abiturprüfung) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung Text-und Medienkompetenz Zeitbedarf: ca 30 Std. Summe Q2 ca. 90 Stunden
8 2.1.2Konkretisierung des Unterrichtsvorhabens Russisch als neu einsetzende Fremdsprache Thema: Ferien in Russland und in Europa (Конечно 1, урок 8 и 9) Qualifikationsphase 1, 1. Halbjahr, 1. Quartal, Unterrichtsvorhaben I Kompetenzstufe A2/ A2+ Gesamtstundenkontingent: ca. 40 Std. Obligatorik Schwerpunkte: Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Sprechen, Lesen, Schreiben, Text-und Medienkompetenz Soziokulturelles Orientierungswissen typische Ferienaktivitäten russ. Jugendlicher (Sommercamp, Ferien bei den Verwandten auf der Datscha); Sehenswürdigkeiten Sankt Petersburg, Informationen zum Stadtgründer Peter I. Interkulturelle kommunikative Kompetenz Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit soziokulturelles Wissen über typisch russische Ferienaktivitäten sowie über die Geschichte und Besonderheiten Sankt Petersburgs entwickeln; Vorlieben und Begründungen wahrnehmen und vergleichen Funktionale kommunikative Kompetenz Interkulturelles Verstehen und Handeln eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der russischen Bezugskultur vergleichen und sich dabei weitgehend in Denk- und Verhaltensweisen russischer Jugendlicher hineinversetzen und angemessen kommunikativ reagieren Hör-/Hör-Sehverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben Sprachmittlung Berichte über Feriengestaltung, Angaben zum Wetter sowie detailliertes Textverständnis in monologischen und nach Feriengestaltung erkundigen und über eigene Ferien sprechen, Vorlieben eine Postkarte/ einen Brief aus dem Urlaub zu bestimmten Aspekten sprachunkundigen Partnern Informationen zu Möglichkeiten der
9 Informationen im Rahmen einer Stadtrundfahrt in dialogischen Texten; ggf. äußern, nach Gründen fragen Arbeit mit dem Wörterbuch und darauf antworten; über verfassen; unterschiedliche Wetterlagen beschreiben Feriengestaltung in Russland bzw. Ferien in Deutschland Petersburg verstehen an Zusatztexten zu Peter I. Sehenswürdigkeiten Sankt Petersburgs sprechen sowie weitere Informationen zur Stadt geben ein Stadtporträt entwerfen; Informationen in zusammenhängende Texte integrieren vermitteln Verfügen über sprachliche Mittel (Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- und Intonationsmuster; Orthographie und Zeichensetzung) a Ländernamen, Wortfeld каникулы und погода, Sehenswürdigkeiten in St. Petersburg, Frage nach Begründungen und entsprechende Antwortstrukturen b Aspektbildung und gebrauch, reflexive Verben, Deklination der harten Adjektive im Singular, Deklination der Nomen (I./II. Dekl.) im Plural, Deklination der Personalpronomen, Verben auf -овать Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit elementare Strategien für die Verständigung über Ferien- und Reiseaktivitäten entwickeln; Wörter in Mindmaps strukturieren; Wortfelder erstellen; Notizen anfertigen; Regeln für die Bildung der Verbformen ableiten und für einen ökonomischeren Spracherwerb einsetzen; Regeln für die Anwendung des Aspekts ableiten und anwenden; Bezüge zwischen der Deklination der Adjektive und Pronomen erkennen Kategorie des Aspekts kennen lernen und Unterschiede zum Deutschen sowie Parallelen zum Englischen erkennen; unterschiedliche Verbindung von Verben mit der Kategorie der Reflexivität im Russischen und Deutschen erkennen; Differenzen in der Rektion der Verben (Instrumental) Text- und Medienkompetenz
10 Postkarte/ Brief über Urlaub und Aktivitäten; Wetterauskünfte in gesprochener Form; Informationen über Ferienangebote als Flyer; Steckbrief Peter I., Infoflyer St. Petersburg; Bilder zu Sehenswürdigkeiten Sonstige fachinterne Absprachen als Textteil der Klausur: Leistungsfeststellung Brief/Telefongespräch über die zurückliegenden Sommerferien nach teilweise vorgegebenen Informationen Projektvorhaben Diavortrag oder Plakat zu eigenen Ferien/ Sankt Petersburg/ Peter I. als längerfristige themendifferenzierte Gruppen-/ Partnerarbeit
11 Thema: Reisen in und nach Russland Qualifikationsphase 2, 1. Halbjahr, 1. Quartal, Unterrichtsvorhaben I Kompetenzstufe B1 Gesamtstundenkontingent: ca.30 Std. Schwerpunkte: Lesen, Hör-/Sehverstehen, Sprechen, Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Text- und Methodenkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Soziokulturelles Orientierungswissen Informationen zur Geographie Russlands, zu einzelnen Regionen bzw. Städten sowie zu Reise- und Urlaubsmöglichkeiten erwerben Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit Interesse für Russlands Weite und Vielseitigkeit entdecken und mit den Gegebenheiten in Deutschland vergleichen; Sensibilität für landesspezifische Traditionen und Bräuche entwickeln und dabei eigene Bräuche und Gewohnheiten hinterfragen Interkulturelles Verstehen und Handeln sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen in Russland hineinversetzen und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie kritische Distanz bzw. Empathie für den anderen entwickeln, in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten wahrnehmen und beachten Funktionale kommunikative Kompetenz
12 Hör-/Hör-Sehverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben Sprachmittlung Ausschnitte aus Filmen und Dokumentationen verstehen; Liedtexte verstehen Texte auch in Details verstehen; Informationen aus dem Internet global verstehen über ein Reiseziel und seine Charakteristika im Rahmen eines Vortrages sprechen, bewerten, Stellung zu Reisevorhaben nehmen Reiseberichte zusammenfassen und analysieren, Reisemöglichkeiten differenziert und kritisch bewerten Informationen über Reiseangebote von einer Sprache in die andere mitteln Verfügen über sprachliche Mittel (Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- und Intonationsmuster; Orthographie und Zeichensetzung) Wortschatz: geographische Bezeichnungen, Angaben zur geographischen Lage, Verkehrsmittel, Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten, Reiseaktivitäten, Redemittel zum Zusammenfassen und Bewerten; Satz- und Grammatikstrukturen: präfigierte Verben der Bewegung, Zeitangaben, kausale und finale Nebensätze, unregelmäßige Deklination von Substantiven, Steigerung, Konjunktiv Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit Stichwortgestützte Vorträge halten; gezielte Internetrecherchen durchführen; Präsentation anfertigen; Meinungsäußerungen strukturieren; im Rahmen der Sprachmittlung vereinfachen und umschreiben den Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der Kommunikationssituation anpassen, Differenzen in Ausdrucksmitteln zwischen Deutschem und Russischem reflektieren Text- und Medienkompetenz Authentische Materialien (Reklamen, Annoncen); Filme und Dokumentationen; (adaptierte) individuelle Reiseberichte
13 Sonstige fachinterne Absprachen Leistungsfeststellung Klausur: im Hinblick auf Textgrundlage, Aufgabenstellung und Bewertung bereits weitgehend ausgerichtet auf Niveau der Abiturprüfung; insb. inklusive einer Pro-Contra-Erörterung als Stellungnahme zu vorgestellter Reise Projektvorhaben ggf. Projekt/ komplexe Lernaufgabe Sibirien oder Moskau
14 2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit Überfachliche Grundsätze: 1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. 3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 4. Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 5. Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 6. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 7. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 8. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 9. Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei unterstützt. 10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. Fachliche Grundsätze: 15. Der Unterricht erfolgt in russischer Sprache. Die kurzzeitige Verwendung der deutschen Sprache ist im Sinne einer funktionalen Einsprachigkeit möglich. 16. Die Mündlichkeit wird im Russischunterricht verstärkt gefördert. 17. Im Unterricht werden authentische oder realitätsnahe mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen herbeigeführt. 18. Im Unterricht werden häufig Lernarrangements verwandt, die zu hohen Sprechanteilen möglichst aller Schülerinnen und Schüler führen. 19. Die Mehrsprachigkeitsprofile der Schülerinnen und Schüler werden aktiv genutzt, indem an individuelle Sprachlernerfahrungen und Sprachlernwissen angeknüpft wird. Sprachvergleiche können erfolgen, wenn sie die Sprachlernkompetenz und die Sprachbewusstheit fördern. 20. Zur Förderung individueller Lernwege und selbständigen Arbeitens werden regelmäßig differenzierte Lernaufgaben eingesetzt.
15 21. Die Materialien des eingeführten Lehrwerks werden funktional in Bezug auf die angestrebten Kompetenzen eingesetzt und ggf. durch weitere geeignete Materialien ergänzt. Prinzipiell richtet sich der Unterricht im neueinsetzenden Kurs bis zur Q1 nach der Lehrbuchprogression, um den Schülerinnen und Schülern durch eine klare Orientierung den Sprachlernprozess zu erleichtern. 22. Fehler werden als Lernchancen genutzt. Im Unterricht werden Verfahren angewandt, die eine sensible, konstruktive Fehlerkorrektur ermöglichen, ohne dass die Kommunikation gestört wird. Im schriftlichen Bereich werden Fehlerarten gekennzeichnet, so dass individuelle Fehlerschwerpunkte vom Lerner identifiziert und bearbeitet werden können. Bei angefertigter gewissenhafter Berichtigung der vorangehenden Klausur wird dem Lerner eine Positivkorrektur seiner Fehler gegeben. 2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen haben das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung zu treffen. Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in pädagogisch-didaktischer Orientierung an dem Regelstandard, der in Kap. 2 des KLP GOSt in Form der Kompetenzerwartungen ausgewiesen wird. Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Russisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. Übergeordnete Kriterien: Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung. Grundlage für die Grundsätze der Leistungsbewertung ist das Kapitel 3 des Kernlehrplans. Nach diesen Grundlagen gilt prinzipiell, dass erfolgreiches Lernen kumulativ ist und die Kompetenzerwartungen in ansteigender Progression und Komplexität formuliert werden. Lernerfolgsüberprüfungen geben Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, grundlegende Kompetenzen zu
16 wiederholen. Für die Lehrer der FK Russisch sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen ein lernprozessbegleitendes Feedback sowie Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen. Dies heißt konkret, dass die Grundsätze der Leistungsbewertung den Schülern u.a. zum Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel auch zum Halbjahresbeginn mitgeteilt werden. Ein Hinweis darauf sollte auch im Kursheft vermerkt werden. Kriterien der Leistungsbewertung im Zusammenhang mit unterschiedlichen Arbeitsformen werden den Schülerinnen und Schülern vor deren Beginn transparent gemacht. Die Leistungsrückmeldung erfolgt in regelmäßigen Abständen in mündlicher Form möglichst differenziert und individualisiert. Bei Elternsprechtagen und im Rahmen regelmäßiger Sprechstunden erhalten die Erziehungsberechtigten (bei nicht volljährigen Schülern) von Schülern und Schülerinnen der Sek. II oder die Schülerinnen und Schüler selbst die Gelegenheit, sich über den Leistungsstand zu informieren und dabei Perspektiven für die weitere Lernentwicklung zu besprechen. Schülerinnen und Schüler der Sek. II erhalten ebenfalls mindestens einmal Mal pro Quartal Rückmeldungen zu dem Leistungsstand bzw. Empfehlungen für die Verbesserungen der jeweiligen Leistungen. Verbindliche Absprachen: Pro Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben, von denen eine während der Einführungs- und Qualifikationsphase durch eine mündliche Prüfung ersetzt wird. Überprüfung der schriftlichen Leistung Zwei Klausuren je Halbjahr. Eine Facharbeit kann in Russisch als neu einsetzender Fremdsprache nur geschrieben werden, wenn die Facharbeit vollständig in der Zielsprache abgefasst werden kann (vgl. KLP S. 66). Dies ist nur bei Schülerinnen und Schülern mit umfassenden herkunftssprachlichen Vorkenntnissen möglich. Überprüfung der sonstigen Leistung Der Bewertungsbereich Sonstige Mitarbeit erfasst die Qualität und Kontinuität der mündlichen, schriftlichen (z.b. Vokabel- oder Grammatiktests, längerfristige Schreibaufgaben) und ggf. praktischen Beiträge (z. B. Aufführung von Spielszenen) im unterrichtlichen Zusammenhang. Die Sonstige Mitarbeit wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres als auch durch punktuelle Überprüfungen festgestellt.
17 Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden. Auch die Bewertung dieser sonstigen Leistungen erfolgt differenziert und kriterial geleitet im Hinblick auf die inhaltliche, methodische und die sprachliche Leistung / Darstellungsleistung, wobei auch hier die sprachliche Leistung bei der Beurteilung stärker gewichtet werden muss. Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmäßig und zeitnah eine transparente Rückmeldung zur Bewertung ihrer Leistungen. Dem Bereich Sonstige Mitarbeit wird in der Regel die gleiche Gewichtung zugestanden wie dem Bereich der Klausuren. (Quartalsnote) Klausuren Für alle Beurteilungsgrundlagen im Fach Russisch (für den GKn ab der Qualifikationsphase) gilt die Ausrichtung an den für die Abiturprüfung relevanten drei Anforderungsbereichen: Wiedergabe von Kenntnissen (Anforderungsbereich I), Anwendung von Kenntnissen (Anforderungsbereich II) und Werten (Anforderungsbereich III). Der Schwerpunkt liegt für die Grundkurs in den Anforderungsbereichen I und II, für den Leistungskurs in den Anforderungsbereichen II und III. Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse. Sie geben darüber Aufschluss, inwieweit im laufenden Kursabschnitt gesetzte Ziele erreicht worden sind. Im Verlauf der Qualifikationsphase müssen alle funktionalen kommunikativen Kompetenzen in schriftlichen Klausuren überprüft werden. Die in Kapitel 3 des KLP GOSt Russisch eröffneten vielfältigen Möglichkeiten der Kombination zu überprüfender Teilkompetenzen aus dem Bereich der Funktionalen kommunikativen Kompetenz sollen unter Berücksichtigung der Setzungen in Kap. 4 (Abitur) und in den Abiturvorgaben genutzt werden, um einerseits ein möglichst differenziertes Leistungsprofil der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu erhalten und sie andererseits gut auf die Prüfungsformate der schriftlichen Abiturprüfung vorzubereiten. Neben der integrierten Überprüfung von Textrezeption und -produktion (Leseverstehen bzw. Hör-/Hörsehverstehen und Schreiben) werden auch isolierte Überprüfungsformen (mittels geschlossener und halboffener Aufgaben bzw. mittels Schreibimpulsen) eingesetzt. Die Sprachmittlung wird gemäß Vorgabe durch den KLP stets isoliert überprüft, und zwar mit Blick auf die schriftliche Abiturprüfung in Klausuren in der Richtung Deutsch-Russisch. In der letzten Klausur der Qualifikationsphase wird diejenige Aufgabenart eingesetzt, die für das Zentralabitur vorgesehen ist, so dass die Klausur weitgehend den Abiturbedingungen entspricht. Immer stehen die Teile einer Klausur unter demselben thematischen Dach (Thema des jeweiligen Unterrichtsvorhabens). Die integrative Überprüfung von Leseverstehen und Schreiben bzw. Hör-/ Hörsehverstehen und Schreiben folgt dem Muster vom Ausgangstext zum Zieltext, und zwar gesteuert durch den Dreischritt Textverständnis, Analyse, Beurteilung, wobei letzterer Bereich durch eine Stellungnahme (Kommentar) oder eine kreative Textproduktion erfüllt werden kann, ggf. in Form einer Auswahl.
18 Die isolierte Überprüfung der rezeptiven Teilkompetenzen Leseverstehen bzw. Hör-/Hörsehverstehen erfolgt mittels einer hinreichend großen Zahl von Items, die in der Regel verschiedene Verstehensstile abdecken; dabei kommen halboffene und/oder geschlossene Formate zum Einsatz. In der Regel werden Hörtexte zweimal vorgespielt, Hörsehtexte dreimal. Bei der Wahl der Ausgangsmaterialien und der Schreibaufgaben sollen jeweils Textformate ausgewählt werden, deren vertiefte Behandlung innerhalb des jeweiligen Unterrichtsvorhabens den Schwerpunkt bildet. Der Textumfang (Textlänge bzw. -dauer) der Ausgangsmaterialien wird unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit im Laufe der Qualifikationsphase allmählich dem im KLP GOSt für die Abiturprüfung vorgesehenen Umfang angenähert. Korrektur und Bewertung Die Bewertung der Klausuren orientiert sich an den Bewertungsgrundsätzen des Zentralabiturs in NRW sowie des Lehrplans. Sie wird mit Hilfe eines Bewertungsrasters/ Erwartungshorizontes vorgenommen, um auf diese Weise einheitliche und transparente Bewertungskriterien sicher zu stellen. Die Bewertung orientiert sich spätestens mit der ersten Klausur der Q2 genau an den Bewertungsgrundsätzen des Zentralabiturs in NRW sowie des Lehrplans Russisch. Dabei werden im Russischen wie in den anderen Fremdsprachen die Bereiche inhaltliche Leistung (40%) und Darstellungsleistung/ sprachliche Leistung (60%) für die Ermittlung der Gesamtnote unterschieden. Die Darstellungsleistung wird nach den folgenden Kompetenzbereichen bewertet: Kommunikative Textgestaltung, Ausdrucksvermögen/ Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und Sprachrichtigkeit (Lexik, Grammatik, Orthographie). Die Klausur in Q2.2 ( Vorabi-Klausur ) wird unter Abiturbedingungen geschrieben.
19 Konkretisierte Kriterien für den Kurstyp GKn am St. Franziskus Gymnasium Olpe (Überprüfung des Spracherwerbs und Erwerbs von grundlegenden interkulturellen und methodischen Kompetenzen in der Einführungsphase und Qualifikationsphase 1 und 2.1 im GKn) Klausuren und Beurteilungsbereich Anzahl: 4 in EF und Q1 (3 in Q2) Leistungsbewertung Übersicht über Gewichtung / Punkteverteilung Verteilung: 2 je Halbjahr Dauer: 67 Minuten (EF 1), 90 Minuten (EF 2) In der EF wird die zweite Klausur im zweiten Halbjahr durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Dauer: 90 Minuten (Q1.1 und Q1.2) In der Q1 wird die zweite Klausur im ersten Halbjahr durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Dauer: 135 Minuten (Q2.1), 225 Minuten (Q2.2) Kompetenzen: Grammatische, lexikalische und kommunikative Kompetenzen (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben/Textproduktion, Sprachmittlung, Sprechen) Aufgabenformate: Geschlossene, halboffene und offene Aufgaben für die Überprüfung grammatischer und lexikalischer Kompetenzen. Der Anteil der offenen Aufgaben soll kontinuierlich zunehmen und ab der 3. Arbeit ca. 70% der Gesamtleistung erreichen. zugelassene Hilfsmittel: in der EF keine; ab der Q1 evtl. Wörterbuch nach Die Transparenz der Notengebung wird durch eine Punktzuordnung pro Aufgabe gewährleistet. Die Gewichtung der Punktvergabe verschiebt sich kontinuierlich auf die freien Teile. Bewertungskriterien: Umfang und Genauigkeit im Bereich der unterschiedlichen Kompetenzen: - Ausdrucksvermögen und Verfügbarkeit sprachlicher Mittel (Vokabular, Satzbau, Ausdruck) - Kommunikative Textgestaltung (Kohärenz, Struktur, Textformate) - Sprachrichtigkeit Für eine ausreichende Leistung (Note 4) müssen 45% der Punktzahl erreicht werden. Die übrigen Noten werden graduell ermittelt. Die Bewertungskriterien werden bei der Besprechung der Arbeit transparent gemacht.
20 Klausuren und Beurteilungsbereich Leistungsbewertung Abgabe des Grammatikteils. Facharbeit Eine Facharbeit kann in Russisch als neu einsetzender Fremdsprache nur geschrieben werden, wenn die Facharbeit vollständig in der Zielsprache abgefasst werden kann (vgl. KLP S. 66). Dies ist nur bei Schülerinnen und Schülern mit umfassenden herkunftssprachlichen Vorkenntnissen möglich. Die Bewertungskriterien orientieren sich an den allgemeinen Kriterien der Leistungsbeurteilung (s.o.). Gegebenenfalls ersetzt in diesem Fall die Facharbeit die dritte Klausur in der Q1.2. Die präzise Themenformulierung (am besten als problemorientierte Fragestellung mit eingrenzendem und methodenorientiertem Untertitel) und Absprachen zur Grobgliederung stellen sicher, dass die Facharbeit ein vertieftes Verständnis eines oder mehrerer Texte bzw. Medien, dessen/deren form- bzw. problemanalytische Durchdringung sowie eine wertende Auseinandersetzung erfordert. Wie bei den Klausuren kann auch ein rein anwendungs-/produktionsorientierter Zugang (kreatives Schreiben) gewählt werden. Bei der Beurteilung kann ein kriteriales Punkteraster oder ein Gutachten, das auf die Bewertungskriterien Bezug nimmt, eingesetzt werden. Die Bewertungskriterien sind den Schülerinnen und Schülern vor Anfertigung der Facharbeit bekannt zu machen und zu erläutern. Die Zuordnung der Noten (einschließlich der jeweiligen Tendenzen) geht im Schriftlichen und Mündlichen davon aus, dass die Note ausreichend (5 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd die Hälfte (mindestens 45%) der Gesamtleistung erbracht worden ist. dass die Note gut (11 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd vier Fünftel (mindestens 75%) der Gesamtleitung erbracht worden ist. dass die Noten oberhalb und unterhalb dieser Schwellen den Notenstufen annähernd linear zugeordnet werden. Vereinbarungen zur Korrektur von Klausuren und schriftlichen Arbeiten Die Verwendung von Randbemerkungen/Korrekturzeichen hat eine doppelte Funktion: Zum einen geben sie der Schülerin/dem Schüler eine differenzierte Rückmeldung zu den inhaltlichen und sprachlichen Stärken und Schwächen der Klausur/schriftlichen Arbeit und damit Hinweise für weitere individuelle Lernschritte. Zum anderen dienen die Randbemerkungen/Korrekturzeichen der Lehrkraft als Orientierung für die abschließende Bewertung mithilfe eines inhaltlichen und sprachlichen Kriterienrasters. Folglich ist es nicht ausreichend, lediglich Fehler und Defizite zu markieren. Vielmehr sind auch positive Aspekte der Klausur angemessen am Rand zu vermerken.
21 Bei angefertigter gewissenhafter Berichtigung der vorangehenden Klausur wird dem Lerner eine Positivkorrektur seiner sprachlichen Fehler zur Verfügung gestellt; wurde keine gewissenhafte Berichtigung der vorangehenden Klausur angefertigt, soll die Korrektur im sprachlichen Bereich auf die Kennzeichnung der Fehler beschränkt bleiben. Mündliche Prüfung anstelle einer Klausur Der Ersatz einer Klausur durch eine mündliche Prüfung in der Qualifikationsphase gemäß APO-GOSt erfolgt im GK in Q1.1. Grundsätzlich werden im Rahmen jeder Prüfung die Teilkompetenzen Sprechen: zusammenhängendes Sprechen (1. Prüfungsteil) und Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (2. Prüfungsteil) überprüft, und zwar so, dass der Prüfungsteil 2 die Inhalte des ersten Prüfungsteils verarbeitet; beide Prüfungsteile fließen mit gleichem Gewicht in das Gesamtergebnis ein. Die Prüfungen finden in der Regel als Paarprüfungen (Dauer: ca. 20 Minuten) statt. Falls im Einzelfall erforderlich, können auch Einzelprüfungen durchgeführt werden (Dauer: ca. 10 Minuten). Die Prüfungsaufgaben sind thematisch eng an das jeweilige Unterrichtsvorhaben angebunden, werden aber so gestellt, dass eine gezielte häusliche Vorbereitung auf die konkrete Aufgabenstellung nicht möglich ist. Die Vorbereitung erfolgt unter Aufsicht in einem Vorbereitungsraum in der Schule (20-25 Min.); bei der Vorbereitung stehen den Schülerinnen und Schülern ein einsprachiges sowie ein zweisprachiges Wörterbuch zur Verfügung. Grundsätzlich werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler von der Fachlehrkraft sowie einer weiteren Fachlehrkraft beobachtet und beurteilt, nach Möglichkeit unter Nutzung des vom Land empfohlenen Bewertungsrasters. Eine in Einzelfällen fachlich begründete Modifizierung des Bewertungsrasters kann durch die Fachkonferenz beschlossen werden. Die mündliche Leistung wird in folgenden Bereichen bewertet (Gewichtung in Klammern): Inhaltliche Leistung (40 %) Sprachliche Leistung (60 %), untergliedert nach: - Präsentations- bzw. Diskurskompetenz - Ausdrucksvermögen (Wortschatz, grammatische Strukturen) - Sprachliche Korrektheit (Wortschatz, grammatische Strukturen)
22 - Aussprache und Intonation Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach den mündlichen Prüfungen einen Rückmeldebogen, der ihnen Auskunft über die erreichten Punkte (nach Kriterien) sowie in der Regel Hinweise zu Möglichkeiten des weiteren Kompetenzerwerbs gibt. In einem individuellen Beratungsgespräch können sie sich von ihrem Fachlehrer bzw. ihrer Fachlehrerin weitere Hinweise geben lassen. Sonstige Mitarbeit Der Bereich Sonstige Mitarbeit erfasst alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht werden. In diesem Bereich werden besonders die Teilkompetenzen aus dem Bereich mündlicher Sprachverwendung berücksichtigt. Dies geschieht durch systematische und kontinuierliche Beobachtung der Kompetenzentwicklung und des Kompetenzstandes im Unterrichtsgespräch, in Präsentationen, Rollenspielen, etc. sowie in Gruppen- oder Partnerarbeit. Dabei ist aber darauf zu achten, dass es auch hinreichend Lernsituationen gibt, die vom Druck der Leistungsbewertung frei sind. Überprüfung im Bereich der sonstigen Mitarbeit allgemein kontinuierliche, punktuell fokussierte Beobachtung der individuellen Kompetenzentwicklung im Unterricht Beiträge zum Unterricht in Plenumsphasen sowie im Rahmen sonstiger Arbeitsprozesse (u.a. in den Unterricht eingebrachte Hausaufgaben, Recherchen, Gruppenarbeit, Ergebnispräsentationen, Rollenspiele, längerfristig anzufertigende Texte) regelmäßige Präsentationen/Referate einzelner Schüler bzw. Schülergruppen (angebunden an das jeweilige Unterrichtsvorhaben) regelmäßige kurze schriftliche Übungen (ca. eine Übung pro Quartal/Unterrichtsvorhaben) zur anwendungsorientierten Überprüfung des Bereichs 'Verfügbarkeit sprachlicher Mittel' und der Sprachlernkompetenz (Arbeitsmethoden und -techniken, z.b. Wortschatzarbeit, Wörterbuchbenutzung) kurze mündliche Überprüfungen (monologisches bzw. dialogisches Sprechen) als Wiederholung bereits erarbeiteter thematischer Bereiche («Зачёты», zur kontinuierlichen Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung)
23 Maßstäbe für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit - Sprachliche und inhaltliche Korrektheit - Engagement, aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen - Kontinuität, Qualität, Umfang, Selbständigkeit, Komplexität der Beiträge Die Beurteilung ist ergebnis- und prozessorientiert. Der Stellenwert jeweiliger Unterrichtsbeiträge wird von Fall zu Fall bestimmt eine punktuelle Bewertung einer Teilleistung ist nicht immer möglich. Wesentliche Kriterien bei der Bewertung der sprachlichen Leistung sind wie bei Klausuren die: Verfügbarkeit eines themenbezogenen Wortschatzes - sowie mit der Lernprogression zunehmend- eines Textbesprechungsvokabulars; Beherrschung der Ausdrucksmittel zur Unterrichtskommunikation sowie von Sprech- und Verständigungsstrategien; Beherrschung und Anwendung grundlegender Regeln der Grammatik. Die Bewertung der inhaltlichen Leistung berücksichtigt im Russisch-Unterricht insbesondere folgende Aspekte: die Fähigkeit, gehörte oder geschriebene Texte global oder detailliert zu verstehen Ideenreichtum, Risikobereitschaft in den Beiträgen; die Fähigkeit, behandelte Inhalte und Themen wiederzugeben, darzustellen, zu erklären und auf andere Kontexte zu übertragen; eine reflektierte Stellungnahme zu Aussagen und Meinungen; die Fähigkeit, neue Inhalte unter Nutzung des Sprach- und Sachwissens zu erschließen; die Mitarbeit an Projekten (z. B. Erkundungsprojekte zu russischsprachigen Mitbürgern, künstlerische Projekte, fächerübergreifende Projekte, Russisch-Olympiade, spielend Russisch lernen, Schul- und Stadtführungen, Betreuung von Gästen im Rahmen des Schüleraustauschs etc.).
24 Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen im Überblick Formen der sonstigen Mitarbeit Mündliche Beiträge zum Unterricht Regelmäßige Tests zur Überprüfung des Wortschatzes und/oder der Grammatik schriftliches/ mündliches Abfragen der Hausaufgaben (Grammatikübungen, Textkenntnisse) Beitrag zum Unterricht durch die Hausaufgaben (Im Gegensatz zum bloßen Erledigen der Hausarbeit) und ihr Vortrag im Unterricht Vorbereitung, Durchführung, Präsentation und Auswertung von Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten Heftführung: Vollständigkeit, äußere Form, Strukturierung, Vokabelheft Mitarbeit bei Projekten (individuelle Leistung, Auswertung von Materialien, Präsentation) Formen der Selbstevaluation (z.b. Lerntagebuch, Lesetagebuch, Portfolio, Selbstkontrolle) Präsentationen/Kurzreferate, fächerübergreifende Projekte, Protokolle als Dokumentation von Unterrichtsergebnissen Bewertungsgrundsätze Dem Bereich Sonstige Mitarbeit wird in der Regel die gleiche Gewichtung zugestanden wie dem Bereich der Klausuren. Die Quartalsnote ergibt sich also aus schriftlicher und mündlicher Note. Maßstäbe für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit Sprachliche und inhaltliche Korrektheit Engagement, aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen Kontinuität, Qualität, Umfang, Selbständigkeit, Komplexität der Beiträge Die Beurteilung ist ergebnis- und prozessorientiert Der Stellenwert jeweiliger Unterrichtsbeiträge wird von Fall zu Fall bestimmt eine punktuelle Bewertung einer Teilleistung ist nicht immer möglich.
25 Schriftliche Übungen (Aufgabenstellung ergibt sich aus dem Unterricht). Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. Eine Rückmeldung über die in Klausuren erbrachte Leistung erfolgt regelmäßig in Form der Randkorrektur samt Auswertungsraster (Erwartungshorizont bei Klausuren) sowie nach Bedarf im individuellen Beratungsgespräch. Analoges gilt für die Facharbeit. Die Beratung zur Facharbeit erfolgt gemäß den überfachlich vereinbarten Grundsätzen. Die in einer mündlichen Prüfung erbrachte Leistung wird den Schülerinnen und Schülern individuell zurückgemeldet (vgl. oben: Bewertungsraster und Hinweise zu Möglichkeiten des weiteren Kompetenzerwerbs) und bei Bedarf erläutert. Über die Bewertung substantieller punktueller Leistungen aus dem Bereich der Sonstigen Mitarbeit werden die Schülerinnen und Schüler in der Regel mündlich informiert, ggf. auf Nachfrage; dabei wird ihnen erläutert, wie die jeweilige Bewertung zustande kommt. Schriftliche Übungen und sonstige Formen schriftlicher Leistungsüberprüfung werden schriftlich korrigiert und bewertet, und zwar so, dass aus Korrektur und Bewertung der betreffende Kompetenzstand hervorgeht. Auch hier besteht die Möglichkeit mündlicher Erläuterung. Zum Ende eines Quartals erfolgt in einem individuellen Beratungsgespräch ein Austausch zwischen Fachlehrkraft und Schülerinnen und Schüler über den Kompetenzstand und Möglichkeiten des weiteren Kompetenzerwerbs. Im Rahmen der Portfolio-Arbeit üben sich die Schülerinnen und Schüler regelmäßig in der Selbsteinschätzung (besonders unter Einsatz von Selbsteinschätzungsbögen). Die Selbsteinschätzung kann auch Anlass für ein Beratungsgespräch sein. Die Feedbackkultur wird durch regelmäßiges leistungsbezogenes Feedback nach Referaten/Präsentationen, Gruppenarbeiten, etc. gefördert.
26 2.4 Lehr- und Lernmittel Lehr- und Lernmittel EF/ Q1 als grundständiges Lehrwerk: von Christine Amstein-Bahmann, u.a.: Конечно 1. Интенсивный курс. Russisch als dritte Fremdsprache. Stuttgart: Klett (Schülerbuch, Arbeitsheft, grammatisches Beiheft, Audio-CD s für Schüler, Daten-CD für Lehrer. ergänzend: adaptierte Gebrauchstexte, Lieder, landeskundliche Dokumentationen, Sachmaterialien, Bilder Q2 Themengeleitete Auswahl von Einzelmaterialien z.b. aus folgenden Lehrwerken: Amstein-Bahmann, Ch., u.a.: Конечно 2. Интенсивный курс. Russisch als dritte Fremdsprache. Stuttgart: Klett Borgwardt, U.: Конечно. В движении. Russisch als zweite und dritte Fremdsprache. Stuttgart Dr. Christine Heyer: ВМЕСТЕ. Russisch für die Oberstufe: Cornelsen 2010 Диалог. authentische Gebrauchstexte und kurze literarische Texte (Internet), Artikel aus der Zeitschrift «По свету», Lieder, Videoclips, Sachmaterialien, Filmausschnitte etc.
27 3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen Zusammenarbeit mit anderen Fächern / Mitarbeit in Schulprojekten Im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeit in der neu einsetzenden Fremdsprache findet eine enge Abstimmung mit der Fachschaft Spanisch statt. Im Rahmen der internationalen Projekte des St. Franziskus Gymnasiums engagiert sich die Fachschaft Russisch durch Austauschprojekte mit der Partnerschule Гимназия 41 der Stadt St. Petersburg. 4. Qualitätssicherung und Evaluation Zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Russischunterrichts auf der Grundlage des schulinternen Lehrplans werden die Vorgaben bei der Durchführung, in der Planung und Bewertung auf ihre Stimmigkeit, Anwendbarkeit und ihren Umfang überprüft und ggf. Fehler oder Verbesserungsvorschläge markiert und festgehalten, um entsprechende Regelungen und Verbesserungen in der Fachschaft spätestens zu Beginn des neuen Schuljahrs vereinbaren zu können. Auf dieser Basis wird der schulinterne Lehrplan kontinuierlich evaluiert und ggf. revidiert.
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Stand: Oktober 2015)
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Stand: Oktober 2015) Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in pädagogisch-didaktischer Orientierung an
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Stand: Oktober 2015) Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in pädagogisch-didaktischer Orientierung an
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung. im Fach Spanisch am Stadtgymnasium Köln-Porz
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Spanisch am Stadtgymnasium Köln-Porz Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Spanisch am Stadtgymnasium Köln-Porz Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
 Leistungskonzept Spanisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das
Leistungskonzept Spanisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung in der gymnasialen Oberstufe
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung in der gymnasialen Oberstufe Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des Kernlehrplans GOSt Englisch hat die Fachkonferenz
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung in der gymnasialen Oberstufe Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des Kernlehrplans GOSt Englisch hat die Fachkonferenz
Leistungskonzept für das Fach Englisch am
 1 Leistungskonzept für das Fach Englisch am Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des Kernlehrplans GOSt Englisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen
1 Leistungskonzept für das Fach Englisch am Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des Kernlehrplans GOSt Englisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen
Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Leistungsbewertung im Fach Englisch Grundlage für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind: 48 SchulG 6 APO SI Kernlehrplan Englisch SI (KLP) Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe
Leistungsbewertung im Fach Englisch Grundlage für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind: 48 SchulG 6 APO SI Kernlehrplan Englisch SI (KLP) Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe
Leistungsbewertung im Fach Französisch
 Ritzefeld-Gymnasium Stolberg Leistungsbewertung im Fach Französisch Grundlage für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind: 48 SchulG 6 APO SI Kernlehrplan Französisch SI (KLP) Richtlinien
Ritzefeld-Gymnasium Stolberg Leistungsbewertung im Fach Französisch Grundlage für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind: 48 SchulG 6 APO SI Kernlehrplan Französisch SI (KLP) Richtlinien
Heinrich-Heine-Gymnasium Herausforderungen annehmen Haltungen entwickeln Gemeinschaft stärken
 Heinrich-Heine-Gymnasium Herausforderungen annehmen Haltungen entwickeln Gemeinschaft stärken Grundsätze der Leistungsbewertung Im Fach Englisch 1 Gesetzliche Vorgaben als Basis der Leistungsbewertung
Heinrich-Heine-Gymnasium Herausforderungen annehmen Haltungen entwickeln Gemeinschaft stärken Grundsätze der Leistungsbewertung Im Fach Englisch 1 Gesetzliche Vorgaben als Basis der Leistungsbewertung
Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Russisch an den Gymnasien in Warendorf
 Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Russisch an den Gymnasien in Warendorf Auf den Internetseiten der Schulen können sich Eltern und Schüler sowie interessierte Besucher über die
Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Russisch an den Gymnasien in Warendorf Auf den Internetseiten der Schulen können sich Eltern und Schüler sowie interessierte Besucher über die
Vereinbarungen zur Leistungsfeststellung und Bewertung in der Sekundarstufe II
 Vereinbarungen zur Leistungsfeststellung und Bewertung in der Sekundarstufe II Englisch Stand: Juni 2015 Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des Kernlehrplans GOSt Englisch
Vereinbarungen zur Leistungsfeststellung und Bewertung in der Sekundarstufe II Englisch Stand: Juni 2015 Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des Kernlehrplans GOSt Englisch
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch
 Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Leistungskonzept im Fach Lateinisch am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte
 Leistungskonzept im Fach Lateinisch am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte I. Einleitung Grundsätze der Grundlage für die Grundsätze der sind 48 SchulG, 6 APO-SI und Kapitel 5 des Kernlehrplans Latein
Leistungskonzept im Fach Lateinisch am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte I. Einleitung Grundsätze der Grundlage für die Grundsätze der sind 48 SchulG, 6 APO-SI und Kapitel 5 des Kernlehrplans Latein
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
 2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen
Spanisch. - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept -
 Spanisch - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept - 1. Sonstige Mitarbeit Grundsätzliche Regelungen zum Bewertungsbereich der Sonstigen Mitarbeit finden sich im allgemeinen, fächerübergreifenden
Spanisch - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept - 1. Sonstige Mitarbeit Grundsätzliche Regelungen zum Bewertungsbereich der Sonstigen Mitarbeit finden sich im allgemeinen, fächerübergreifenden
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen
Leistungsbewertung im Fach Englisch, Sekundarstufe I (Stand: November 2016)
 Leistungsbewertung im Fach Englisch, Sekundarstufe I (Stand: November 2016) Diese Zusammenfassung basiert auf den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Fach Englisch (2003), dem Kernlehrplan
Leistungsbewertung im Fach Englisch, Sekundarstufe I (Stand: November 2016) Diese Zusammenfassung basiert auf den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Fach Englisch (2003), dem Kernlehrplan
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Auszug aus dem schulinternen Lehrplan, Kap 2.3.)
 SGB Fachschaft Englisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Auszug aus dem schulinternen Lehrplan, Kap 2.3.) Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des
SGB Fachschaft Englisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Auszug aus dem schulinternen Lehrplan, Kap 2.3.) Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des
Hinweise zur Leistungsüberprüfung im Fach Französisch
 Hinweise zur Leistungsüberprüfung im Fach Französisch I : Sekundarstufe I 1. Schriftliche Arbeiten 1.1 Schriftliche Arbeiten Arbeiten enthalten grundsätzlich geschlossene, halboffene und offene Aufgaben
Hinweise zur Leistungsüberprüfung im Fach Französisch I : Sekundarstufe I 1. Schriftliche Arbeiten 1.1 Schriftliche Arbeiten Arbeiten enthalten grundsätzlich geschlossene, halboffene und offene Aufgaben
Q2, 1 Halbjahr GK je 2 pro Halbjahr 3 Unterrichtsstunden Q2, 2. Halbjahr GK 1 für F als AB3 3 Zeitstunden, ggf. mit Themenauswahl
 Freiherr-vom-Stein- Leistungsbewertungskonzept Spanisch -1-1. Grundlage für das Leistungsbewertungskonzept 48 SchulG 6 APO-SI Kernlehrplan Spanisch SI (KLP), Kapitel 5 Richtlinien und Lehrpläne für die
Freiherr-vom-Stein- Leistungsbewertungskonzept Spanisch -1-1. Grundlage für das Leistungsbewertungskonzept 48 SchulG 6 APO-SI Kernlehrplan Spanisch SI (KLP), Kapitel 5 Richtlinien und Lehrpläne für die
Leistungsbewertung im Fach Englisch, Sekundarstufe II (Stand: November 2016)
 Leistungsbewertung im Fach Englisch, Sekundarstufe II (Stand: November 2016) Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Englisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit
Leistungsbewertung im Fach Englisch, Sekundarstufe II (Stand: November 2016) Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Englisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit
Grundlagen der Leistungsbewertung im Fach Französisch
 Grundlagen der Leistungsbewertung im Fach 1. Zu überprüfende Kompetenzen und Inhalte 1.1 Sekundarstufe I s. Kernlehrplan SI http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator s ii/gymnasiale
Grundlagen der Leistungsbewertung im Fach 1. Zu überprüfende Kompetenzen und Inhalte 1.1 Sekundarstufe I s. Kernlehrplan SI http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator s ii/gymnasiale
(F6) 6 3 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstunde 7 3 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstunde 8 5 pro Schuljahr
 Freiherr-vom-Stein- Leistungsbewertungskonzept Französisch -1-1. Grundlage für das Leistungsbewertungskonzept 48 SchulG 6 APO-SI Kernlehrplan Französisch SI (KLP), Kapitel 5 Richtlinien und Lehrpläne für
Freiherr-vom-Stein- Leistungsbewertungskonzept Französisch -1-1. Grundlage für das Leistungsbewertungskonzept 48 SchulG 6 APO-SI Kernlehrplan Französisch SI (KLP), Kapitel 5 Richtlinien und Lehrpläne für
Schulinternes Curriculum SII Fach Russisch (neu einsetzend)
 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Unterrichtsvorhaben I in EF Soziokulturelles Orientierungswissen erste Informationen zu Russland Hörverstehen Grundlagen der russischen Phonetik kennenlernen; Unterrichtsgespräche
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Unterrichtsvorhaben I in EF Soziokulturelles Orientierungswissen erste Informationen zu Russland Hörverstehen Grundlagen der russischen Phonetik kennenlernen; Unterrichtsgespräche
Leistungskonzept am Georg-Büchner-Gymnasium - Fachspezifische Ergänzungen im Fach Englisch - Sekundarstufe I
 Leistungskonzept am Georg-Büchner-Gymnasium - Fachspezifische Ergänzungen im Fach Englisch - Sekundarstufe I Es sind grundsätzlich die allgemein verbindlichen Vorgaben in 48 SchulG und 6 APO-S I sowie
Leistungskonzept am Georg-Büchner-Gymnasium - Fachspezifische Ergänzungen im Fach Englisch - Sekundarstufe I Es sind grundsätzlich die allgemein verbindlichen Vorgaben in 48 SchulG und 6 APO-S I sowie
Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Gymnasium der Stadt Frechen Fachschaft Englisch Leistungsbewertung im Fach Englisch Sekundarstufe I Auszüge aus dem Kernlehrplan Englisch (G8), Kapitel 5 Bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und
Gymnasium der Stadt Frechen Fachschaft Englisch Leistungsbewertung im Fach Englisch Sekundarstufe I Auszüge aus dem Kernlehrplan Englisch (G8), Kapitel 5 Bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung am Johannes-Kepler-Gymnasium (Stand: Januar 2016)
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung am Johannes-Kepler-Gymnasium (Stand: Januar 2016) Diese Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung gelten hochwachsend für die
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung am Johannes-Kepler-Gymnasium (Stand: Januar 2016) Diese Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung gelten hochwachsend für die
Leistungsbewertungskonzept. Spanisch
 Leistungsbewertungskonzept Spanisch Stand: November 2015 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1 Grundsätze zur Leistungsbewertung... 3 2 Schriftliche Arbeiten in der Sekundarstufe
Leistungsbewertungskonzept Spanisch Stand: November 2015 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1 Grundsätze zur Leistungsbewertung... 3 2 Schriftliche Arbeiten in der Sekundarstufe
Rollenspiele Leseübungen Grammatische Übungen Kurzvorträge Lernplakate
 1. Grundsätze Es gelten die allgemeinen rechtliche Grundsätze der Leistungsbewertung (Sek. I/II): 1. das Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (hier 48 Grundsätze der Leistungsbewertung), 2. die APO-SI, 3. die
1. Grundsätze Es gelten die allgemeinen rechtliche Grundsätze der Leistungsbewertung (Sek. I/II): 1. das Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (hier 48 Grundsätze der Leistungsbewertung), 2. die APO-SI, 3. die
Leistungsmessungskonzept Moderne Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch
 Leistungsmessungskonzept Moderne Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch Sek I 1. Vorbemerkungen Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG) sowie
Leistungsmessungskonzept Moderne Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch Sek I 1. Vorbemerkungen Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG) sowie
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe am Städtischen Gymnasium Bergkamen. Chemie
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe am Städtischen Gymnasium Bergkamen Chemie Inhalt Seite 1 Die Fachgruppe Chemie... 3 2.1 Unterrichtsvorhaben... 5 2.1.1 Übersichtsraster
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe am Städtischen Gymnasium Bergkamen Chemie Inhalt Seite 1 Die Fachgruppe Chemie... 3 2.1 Unterrichtsvorhaben... 5 2.1.1 Übersichtsraster
Leistungskonzept des Faches Psychologie
 Leistungskonzept des Faches Psychologie Inhalt Kriteriengestützte Korrekturen... 2 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 2 Sekundarstufe II... 2 Einführungsphase... 2 Qualifikationsphase...
Leistungskonzept des Faches Psychologie Inhalt Kriteriengestützte Korrekturen... 2 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 2 Sekundarstufe II... 2 Einführungsphase... 2 Qualifikationsphase...
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Deutsch
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Deutsch Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Deutsch Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb
Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst Vereinbarungen zur Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst Vereinbarungen zur Leistungsbewertung im Fach Englisch (Stand: 03/2017) Schriftliche Leistungsbewertung im Fach: Englisch Anzahl der Klassenarbeiten pro Halbjahr: Klasse
Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst Vereinbarungen zur Leistungsbewertung im Fach Englisch (Stand: 03/2017) Schriftliche Leistungsbewertung im Fach: Englisch Anzahl der Klassenarbeiten pro Halbjahr: Klasse
Hinweise zur Leistungsüberprüfung im Fach Spanisch
 Fachschaft Spanisch Hinweise zur Leistungsüberprüfung im Fach Spanisch I. Sekundarstufe I 1. Schriftliche Arbeiten 1.1 Klassenarbeiten Arbeiten enthalten eine Mischung aus geschlossenen oder halboffenen
Fachschaft Spanisch Hinweise zur Leistungsüberprüfung im Fach Spanisch I. Sekundarstufe I 1. Schriftliche Arbeiten 1.1 Klassenarbeiten Arbeiten enthalten eine Mischung aus geschlossenen oder halboffenen
Bei der Bewertung der Leistungen im Unterrichtsfach Italienisch bezieht sich die Fachkonferenz auf folgende Grundlagen:
 1 Prinzipien der Leistungsbewertung im Fach Italienisch ÜBERSICHT Alle Angaben beziehen sich auf den in der Jahrgangsstufe 10 neu einsetzenden Grundkurs Italienisch der Sekundarstufe II (Italienisch als
1 Prinzipien der Leistungsbewertung im Fach Italienisch ÜBERSICHT Alle Angaben beziehen sich auf den in der Jahrgangsstufe 10 neu einsetzenden Grundkurs Italienisch der Sekundarstufe II (Italienisch als
Leistungsbewertung / Lernerfolgsüberprüfung. A) Allgemeines
 A) Allgemeines Die kommunikative Kompetenz der SuS wird stark betont. D.h. das sog. "Mündliche" geht ab Kl. 5 in etwa gleichem Maße wie das Schriftliche in die Zeugnisnote ein. Die Kompetenz Sprechen soll
A) Allgemeines Die kommunikative Kompetenz der SuS wird stark betont. D.h. das sog. "Mündliche" geht ab Kl. 5 in etwa gleichem Maße wie das Schriftliche in die Zeugnisnote ein. Die Kompetenz Sprechen soll
Leistungskonzept am Georg-Büchner-Gymnasium - Fachspezifische Ergänzungen im Fach Englisch
 Leistungskonzept am Georg-Büchner-Gymnasium - Fachspezifische Ergänzungen im Fach Englisch Sekundarstufe I Es sind grundsätzlich die allgemein verbindlichen Vorgaben in 48 SchulG und 6 APO-S I sowie die
Leistungskonzept am Georg-Büchner-Gymnasium - Fachspezifische Ergänzungen im Fach Englisch Sekundarstufe I Es sind grundsätzlich die allgemein verbindlichen Vorgaben in 48 SchulG und 6 APO-S I sowie die
Zentralabitur 2019 Chinesisch
 Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Leistungskonzept für das Fach Biologie am Erich Kästner-Gymnasium, Köln
 Leistungskonzept für das Fach Biologie am Leistungskonzept für das Fach Biologie Auf der Grundlage von 48 SchulG, 3 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Biologie hat die Fachkonferenz im Einklang
Leistungskonzept für das Fach Biologie am Leistungskonzept für das Fach Biologie Auf der Grundlage von 48 SchulG, 3 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Biologie hat die Fachkonferenz im Einklang
Zentralabitur 2018 Russisch
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2018 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2018 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Für die Erfassung der Leistungen werden die jeweiligen Überprüfungsformen gem. Kapitel 3 des Lehrplans (S. 45f.) angewendet.
 1 Leistungsbewertung und -rückmeldung im Fach Geschichte Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geschichte hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden
1 Leistungsbewertung und -rückmeldung im Fach Geschichte Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geschichte hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden
Zentralabitur 2019 Niederländisch
 Zentralabitur 2019 Niederländisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten
Zentralabitur 2019 Niederländisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten
Leistungsbewertungskonzept Französisch
 Leistungsbewertungskonzept Französisch Bensberg 1. Allgemeines Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG), in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
Leistungsbewertungskonzept Französisch Bensberg 1. Allgemeines Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG), in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
Zentralabitur 2019 Russisch
 Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2020 Russisch
 Zentralabitur 2020 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2020 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
1. Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5-9 (G8)
 Konzept zur Leistungsbewertung Englisch Neben den rechtlich verbindlichen Grundsätzen der Leistungsbewertung gemäß 48 SchulG und 6 APO-SI gelten die folgenden in der Fachkonferenz beschlossenen Grundsätze,
Konzept zur Leistungsbewertung Englisch Neben den rechtlich verbindlichen Grundsätzen der Leistungsbewertung gemäß 48 SchulG und 6 APO-SI gelten die folgenden in der Fachkonferenz beschlossenen Grundsätze,
Zentralabitur 2019 Italienisch
 Zentralabitur 2019 isch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 isch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Jahrgangsstufe: Q1 (Qualifikationsphase) Jahresthema: Sprachkurs / Begegnung mit Russland. Inhaltsfeld: Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener
 Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben Schulinternes Curriculum SII Fach: Russisch Jahrgangsstufe: Q1 (Qualifikationsphase) Jahresthema: Sprachkurs / Begegnung mit Russland Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext:
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben Schulinternes Curriculum SII Fach: Russisch Jahrgangsstufe: Q1 (Qualifikationsphase) Jahresthema: Sprachkurs / Begegnung mit Russland Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext:
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
 Leistungskonzept Spanisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 2014 hat die Fachkonferenz im Einklang
Leistungskonzept Spanisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 2014 hat die Fachkonferenz im Einklang
In der Spracherwerbsstufe wird unterschieden nach geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben. Folgende Abstufungen ergeben sich im Einzelnen:
 Konzept zur Leistungsbewertung am DBG im Fach Französisch I. Klassenarbeiten und Klausuren Aufgabenformate: Die Konzeption der Klassenarbeiten richtet sich nach den Aufgabenformaten und Vorgaben des Kernlehrplans
Konzept zur Leistungsbewertung am DBG im Fach Französisch I. Klassenarbeiten und Klausuren Aufgabenformate: Die Konzeption der Klassenarbeiten richtet sich nach den Aufgabenformaten und Vorgaben des Kernlehrplans
Konzept zur Leistungsbewertung: Englisch (Sek. II)
 L I S E - M E I T N E R - G Y M N A S I U M L E V E R K U S E N Lise-Meitner-Gymnasium -Sekundarstufen I u. II Stadt Leverkusen Am Stadtpark 50 51373 Leverkusen 08.06.2016 Konzept zur Leistungsbewertung:
L I S E - M E I T N E R - G Y M N A S I U M L E V E R K U S E N Lise-Meitner-Gymnasium -Sekundarstufen I u. II Stadt Leverkusen Am Stadtpark 50 51373 Leverkusen 08.06.2016 Konzept zur Leistungsbewertung:
Interkulturelle kommunikative Kompetenz. Funktionale kommunikative Kompetenz:
 Unterrichtsvorhaben I und II Yo me presento/los jóvenes y su ámbito social Soziokulturelles Orientierungswissen grundlegende fremdsprachliche Kommunikationsvorhaben in Alltagssituationen verwirklichen
Unterrichtsvorhaben I und II Yo me presento/los jóvenes y su ámbito social Soziokulturelles Orientierungswissen grundlegende fremdsprachliche Kommunikationsvorhaben in Alltagssituationen verwirklichen
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. Einführung, Überblick und Ausblick
 Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Zentralabitur 2019 Spanisch
 Zentralabitur 2019 Spanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Spanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Leistungskonzept für das Fach Spanisch
 Leistungskonzept für das Fach Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache in der Oberstufe (GK) Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung 1. Grundlagen für die Leistungsbewertung 1.1 Grundsätzliche Bezugsrahmen
Leistungskonzept für das Fach Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache in der Oberstufe (GK) Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung 1. Grundlagen für die Leistungsbewertung 1.1 Grundsätzliche Bezugsrahmen
Leistungsbewertung im Fach Französisch, Sekundarstufe I Gültig ab dem Schuljahr 2016/2017 laut FK-Beschluss vom
 Leistungsbewertung im Fach Französisch, Sekundarstufe I Gültig ab dem Schuljahr 2016/2017 laut FK-Beschluss vom 22.08.2016 Diese Zusammenfassung basiert auf den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss
Leistungsbewertung im Fach Französisch, Sekundarstufe I Gültig ab dem Schuljahr 2016/2017 laut FK-Beschluss vom 22.08.2016 Diese Zusammenfassung basiert auf den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss
Vereinbarungen zur Leistungsbewertung im Fach Französisch
 . Grundsätze Es gelten die allgemeinen rechtliche Grundsätze der Leistungsbewertung (Sek. II):. das Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (hier 8 Grundsätze der Leistungsbewertung), 2. die APO-GOSt bzw. die
. Grundsätze Es gelten die allgemeinen rechtliche Grundsätze der Leistungsbewertung (Sek. II):. das Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (hier 8 Grundsätze der Leistungsbewertung), 2. die APO-GOSt bzw. die
Leistungsbewertung Englisch Sekundarstufe I. Stand: August 2010
 Leistungsbewertung Englisch Sekundarstufe I Stand: August 2010 Bereiche der Leistungsfeststellung Klasse 5/6 Leistungsbewertung Grundsätze: Die im Folgenden aufgeführten Vereinbarungen sind, beruhend auf
Leistungsbewertung Englisch Sekundarstufe I Stand: August 2010 Bereiche der Leistungsfeststellung Klasse 5/6 Leistungsbewertung Grundsätze: Die im Folgenden aufgeführten Vereinbarungen sind, beruhend auf
Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Spanisch
 Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Spanisch 1 GK (n) EF Yo me presento Soziokulturelles Orientierungswissen über persönliche Angaben, Befinden, Familie,
Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Spanisch 1 GK (n) EF Yo me presento Soziokulturelles Orientierungswissen über persönliche Angaben, Befinden, Familie,
Zentralabitur 2019 Türkisch
 Zentralabitur 2019 Türkisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Türkisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Leistungsbewertung Informatik
 1 Leistungsbewertung im Fach Informatik Sek I Grundsätze der Leistungsbewertung Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler Aufschluss geben. Sie soll auch
1 Leistungsbewertung im Fach Informatik Sek I Grundsätze der Leistungsbewertung Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler Aufschluss geben. Sie soll auch
LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH ENGLISCH (SEK II) Stand: Schuljahr 2015/16
 Klausuren LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH ENGLISCH (SEK II) Stand: Schuljahr 2015/16 1.1 Dauer Jahrgangsstufe Grundkurs Leistungskurs 11 2 Stunden ---- 12.1 3 Stunden 4 Stunden 12.2 3 Stunden 4 Stunden 13.1
Klausuren LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH ENGLISCH (SEK II) Stand: Schuljahr 2015/16 1.1 Dauer Jahrgangsstufe Grundkurs Leistungskurs 11 2 Stunden ---- 12.1 3 Stunden 4 Stunden 12.2 3 Stunden 4 Stunden 13.1
Zentralabitur 2019 Japanisch
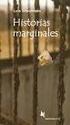 Zentralabitur 2019 Japanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Japanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
ZENTRALE PRÜFUNGEN 10 ENGLISCH INFORMATIONEN ZUR PRÜFUNG 2018
 ZENTRALE PRÜFUNGEN 10 ENGLISCH INFORMATIONEN ZUR PRÜFUNG 2018 GRUNDLAGEN DER PRÜFUNG 2 Bezug zum Kernlehrplan Die Anforderungen der ZP 10 Englisch basieren auf den für das Ende der Klasse 10 ausgewiesenen
ZENTRALE PRÜFUNGEN 10 ENGLISCH INFORMATIONEN ZUR PRÜFUNG 2018 GRUNDLAGEN DER PRÜFUNG 2 Bezug zum Kernlehrplan Die Anforderungen der ZP 10 Englisch basieren auf den für das Ende der Klasse 10 ausgewiesenen
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch Fachschaft Englisch Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers Stand Januar 2015 1 Leistungsbewertung im Englischunterricht der Sekundarstufe I 1 Leistungsbewertung
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch Fachschaft Englisch Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers Stand Januar 2015 1 Leistungsbewertung im Englischunterricht der Sekundarstufe I 1 Leistungsbewertung
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Chinesisch in der Sekundarstufe I
 Leibniz Gymnasium Dortmund International School Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Chinesisch in der Sekundarstufe I Bei der Leistungsbewertung sind gemäß Kernlernplan für die Sekundarstufe I für
Leibniz Gymnasium Dortmund International School Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Chinesisch in der Sekundarstufe I Bei der Leistungsbewertung sind gemäß Kernlernplan für die Sekundarstufe I für
Leistungsbewertungskonzept. Philosophie
 EMIL-FISCHER-GYMNASIUM Schulprogramm Schulinterne Lehrpläne Philosophie Leistungsbewertungskonzept für das Fach Philosophie Sekundarstufe II Stand 2015 29.01.2016-1 - Philosophie Grundsätze der Leistungsbewertung
EMIL-FISCHER-GYMNASIUM Schulprogramm Schulinterne Lehrpläne Philosophie Leistungsbewertungskonzept für das Fach Philosophie Sekundarstufe II Stand 2015 29.01.2016-1 - Philosophie Grundsätze der Leistungsbewertung
Fachspezifische Grundsätze für die Leistungsüberprüfung, -bewertung und -rückmeldung
 Ernst Barlach Gymnasium Fachschaft Französisch Konzept zur Leistungsbewertung Auf der Grundlage von 48 SchulG, 6 APO-SI und Kapitel 5 des Kernlehrplans Französisch für die Sekundarstufe I am Gymnasium
Ernst Barlach Gymnasium Fachschaft Französisch Konzept zur Leistungsbewertung Auf der Grundlage von 48 SchulG, 6 APO-SI und Kapitel 5 des Kernlehrplans Französisch für die Sekundarstufe I am Gymnasium
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft (SI) und Sozialwissenschaften (SII)
 Sekundarstufe I Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft 1. Grundsätze 1 Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs-
Sekundarstufe I Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft 1. Grundsätze 1 Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs-
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Latein. 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen
 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Leistungsbewertung im Fach Französisch
 Leistungsbewertung im Fach Französisch Bei der Leistungsbewertung im Fach Französisch orientiert sich die FK an den im Kernlehrplan G8 ausgewiesenen Bereichen: - Kommunikative Kompetenzen - Interkulturelle
Leistungsbewertung im Fach Französisch Bei der Leistungsbewertung im Fach Französisch orientiert sich die FK an den im Kernlehrplan G8 ausgewiesenen Bereichen: - Kommunikative Kompetenzen - Interkulturelle
Schulinterner Lehrplan der Erzbischöflichen Liebfrauenschule Köln. Spanisch
 Schulinterner Lehrplan der Erzbischöflichen Liebfrauenschule Köln Spanisch 1 Inhalt Seite 2 Entscheidungen zum Unterricht 5 1 Unterrichtsvorhaben 5 1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 6 2 Konkretisierte
Schulinterner Lehrplan der Erzbischöflichen Liebfrauenschule Köln Spanisch 1 Inhalt Seite 2 Entscheidungen zum Unterricht 5 1 Unterrichtsvorhaben 5 1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 6 2 Konkretisierte
Zentralabitur 2017 Italienisch
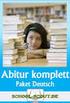 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Italienisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Italienisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Schulinterner Lehrplan für das Fach Englisch
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Englisch Städtische Realschule Gevelsberg Stand: August 2016 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Englisch 2014 1. Allgemeine Grundsätze Die Leistungsbewertung
Schulinterner Lehrplan für das Fach Englisch Städtische Realschule Gevelsberg Stand: August 2016 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Englisch 2014 1. Allgemeine Grundsätze Die Leistungsbewertung
Biologie Stand
 Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Biologie Stand 02.07.2014 Inhalt: 1. Leistungsbewertung Biologie Sekundarstufe I 2. Leistungsbewertung Biologie Sekundarstufe II 3. Facharbeiten 1. Leistungsbewertung
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Biologie Stand 02.07.2014 Inhalt: 1. Leistungsbewertung Biologie Sekundarstufe I 2. Leistungsbewertung Biologie Sekundarstufe II 3. Facharbeiten 1. Leistungsbewertung
Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II
 Vorbemerkung Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II - basierend auf den Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Englisch in der Sekundarstufe II (RLP, 1999) Gemäß 48 SchulG erfolgt die
Vorbemerkung Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II - basierend auf den Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Englisch in der Sekundarstufe II (RLP, 1999) Gemäß 48 SchulG erfolgt die
Zentralabitur 2020 Spanisch
 Zentralabitur 2020 Spanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2020 Spanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Mathematik - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept -
 Mathematik - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept - Grundlagen Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Mathematik hat die Fachkonferenz im Einklang mit
Mathematik - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept - Grundlagen Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Mathematik hat die Fachkonferenz im Einklang mit
Leistungsbewertung im Fach Erdkunde in der Sekundarstufe I + II
 Leistungsbewertung im Fach Erdkunde in der Sekundarstufe I + II 1. Grundlagen Sekundarstufe I Allgemein (Auszüge aus dem Kernlehrplan NRW Erdkunde G8): Die Kompetenzerwartungen im Lehrplan sind jeweils
Leistungsbewertung im Fach Erdkunde in der Sekundarstufe I + II 1. Grundlagen Sekundarstufe I Allgemein (Auszüge aus dem Kernlehrplan NRW Erdkunde G8): Die Kompetenzerwartungen im Lehrplan sind jeweils
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Geographie in der Oberstufe
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Geographie in der Oberstufe Auf der Grundlage von 13-16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geographie für die gymnasiale Oberstufe
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach Geographie in der Oberstufe Auf der Grundlage von 13-16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geographie für die gymnasiale Oberstufe
Grundätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik
 Grundätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik Die von der Fachkonferenz Mathematik getroffenen Vereinbarungen bzgl. der Leistungsbewertung basieren auf den in 48 des Schulgesetzes und in 6 der APO
Grundätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik Die von der Fachkonferenz Mathematik getroffenen Vereinbarungen bzgl. der Leistungsbewertung basieren auf den in 48 des Schulgesetzes und in 6 der APO
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch. Fachkonferenz Englisch Max-Ernst-Gesamtschule Köln
 Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch Fachkonferenz Englisch Max-Ernst-Gesamtschule Köln Stand: April 205 Verbindlichkeit Auf der Grundlage des Kernlehrplans für das Fach Englisch in der Sekundarstufe
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch Fachkonferenz Englisch Max-Ernst-Gesamtschule Köln Stand: April 205 Verbindlichkeit Auf der Grundlage des Kernlehrplans für das Fach Englisch in der Sekundarstufe
B. Fachspezifische Ergänzungen für das Fach Latein
 Leistungskonzept 1 B. Fachspezifische Ergänzungen für das Fach Latein I.Rechtliche Grundlagen (Fachspezifische Ergänzungen) Die Beurteilung der Schülerleistungen ist gesetzlich geregelt durch 1 : a) die
Leistungskonzept 1 B. Fachspezifische Ergänzungen für das Fach Latein I.Rechtliche Grundlagen (Fachspezifische Ergänzungen) Die Beurteilung der Schülerleistungen ist gesetzlich geregelt durch 1 : a) die
Leistungsbewertung im Fach Geschichte
 Leistungsbewertung im Fach Geschichte Die Leistungsbewertung für die Sekundarstufe I bezieht sich auf den Kernlehrplan Geschichte gemäß 29 SchulG (BASS1-1) vom 01. 08. 2007, S. 32/33 Grundsätzlich gilt:
Leistungsbewertung im Fach Geschichte Die Leistungsbewertung für die Sekundarstufe I bezieht sich auf den Kernlehrplan Geschichte gemäß 29 SchulG (BASS1-1) vom 01. 08. 2007, S. 32/33 Grundsätzlich gilt:
Leistungskonzept des Faches Mathematik
 I. Sekundarstufe I Leistungskonzept des Faches Mathematik 1. Grundsätze der Leistungsbewertung Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler informieren und
I. Sekundarstufe I Leistungskonzept des Faches Mathematik 1. Grundsätze der Leistungsbewertung Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler informieren und
Schulinternes Curriculum Englisch (Mantelteil) - Sekundarstufe II - Georg-Büchner-Gymnasium, Kaarst. Version August 2017
 Schulinternes Curriculum Englisch (Mantelteil) - Sekundarstufe II - Georg-Büchner-Gymnasium, Kaarst Version August 2017 1 Inhaltsverzeichnis 1 Die Fachgruppe Englisch am Georg-Büchner-Gymnasium Kaarst
Schulinternes Curriculum Englisch (Mantelteil) - Sekundarstufe II - Georg-Büchner-Gymnasium, Kaarst Version August 2017 1 Inhaltsverzeichnis 1 Die Fachgruppe Englisch am Georg-Büchner-Gymnasium Kaarst
Leistungsbewertung im Fach Latein Sekundarstufe I/II
 Leistungsbewertung im Fach Latein Sekundarstufe I/II Inhalt: 1. Allgemeine Vorbemerkung 2. Schriftliche Leistungsüberprüfung: Klassenarbeiten 3. Sonstige Leistungen im Unterricht 4. Bildung der Zeugnisnote
Leistungsbewertung im Fach Latein Sekundarstufe I/II Inhalt: 1. Allgemeine Vorbemerkung 2. Schriftliche Leistungsüberprüfung: Klassenarbeiten 3. Sonstige Leistungen im Unterricht 4. Bildung der Zeugnisnote
Grundsätze der Leistungsbewertung. im Fach Physik
 Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Physik 1. Rechtliche Grundlagen Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Physik hat die Fachkonferenz Physik des Max-Planck-Gymnasiums
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Physik 1. Rechtliche Grundlagen Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Physik hat die Fachkonferenz Physik des Max-Planck-Gymnasiums
Englisch Leistungskonzept
 Englisch Leistungskonzept Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch Leistungsbewertung im Englischunterricht der SI und SII: Stand September 2015 Inhalt: 1 Zusammensetzung der Gesamtnote 2 Schriftliche
Englisch Leistungskonzept Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch Leistungsbewertung im Englischunterricht der SI und SII: Stand September 2015 Inhalt: 1 Zusammensetzung der Gesamtnote 2 Schriftliche
Leistungskonzept des Faches Französisch
 Leistungskonzept des Faches Französisch Inhalt Einleitung... 2 Kriteriengestützte Korrekturen... 2 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 3 Sekundarstufe I... 3 Französisch ab Klasse 6
Leistungskonzept des Faches Französisch Inhalt Einleitung... 2 Kriteriengestützte Korrekturen... 2 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 3 Sekundarstufe I... 3 Französisch ab Klasse 6
Englisch - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept -
 Englisch - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept - 1. Sonstige Mitarbeit Grundsätzliche Regelungen zum Bewertungsbereich der Sonstigen Mitarbeit finden sich im allgemeinen, fächerübergreifenden
Englisch - Fachspezifische Ergänzungen zum Leistungskonzept - 1. Sonstige Mitarbeit Grundsätzliche Regelungen zum Bewertungsbereich der Sonstigen Mitarbeit finden sich im allgemeinen, fächerübergreifenden
Leistungsbewertungskonzept für das Fach Französisch in der Sek. I. I. Allgemeine Grundsätze
 Leistungsbewertungskonzept für das Fach Französisch in der Sek. I I. Allgemeine Grundsätze Das folgende Konzept beruht auf den Bestimmungen des Schulgesetztes NRW, insbesondere 48 der Ausbildungs- und
Leistungsbewertungskonzept für das Fach Französisch in der Sek. I I. Allgemeine Grundsätze Das folgende Konzept beruht auf den Bestimmungen des Schulgesetztes NRW, insbesondere 48 der Ausbildungs- und
Leistungsbewertung im Fach Evangelische Religionslehre Sekundarstufe II
 Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe II (Abschnitt 3 APO-GOSt) dargestellt.
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz ( 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe II (Abschnitt 3 APO-GOSt) dargestellt.
Formen und Bewertung der Sonstigen Leistungen
 Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten Jgst Anzahl pro Schuljahr Dauer je Klassenarbeit 5/6 6 ca. 45 Min. 7 6 ca. 45 Min. 8 5 1-2 Unterrichtsstd. 9 4 1-2 Unterrichtsstd. In der Jgst. 9 wird ab 2014 eine
Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten Jgst Anzahl pro Schuljahr Dauer je Klassenarbeit 5/6 6 ca. 45 Min. 7 6 ca. 45 Min. 8 5 1-2 Unterrichtsstd. 9 4 1-2 Unterrichtsstd. In der Jgst. 9 wird ab 2014 eine
Anlage zu den Schulinternen Curricula Spanisch. Grundlagen der Leistungsbewertung. 1. Rechtliche Grundlagen. 2. Schriftliche Arbeiten
 Anlage zu den Schulinternen Curricula Spanisch Grundlagen der Leistungsbewertung 1. Rechtliche Grundlagen 2. Schriftliche Arbeiten 2.1. Sekundarstufe II: Klausuren 2.2. Sekundarstufe II: mündliche Kommunikationsprüfungen
Anlage zu den Schulinternen Curricula Spanisch Grundlagen der Leistungsbewertung 1. Rechtliche Grundlagen 2. Schriftliche Arbeiten 2.1. Sekundarstufe II: Klausuren 2.2. Sekundarstufe II: mündliche Kommunikationsprüfungen
Leistungskonzept SEK II Erdkunde Stand: Mai 2016
 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Allgemeine Absprachen/ Vereinbarungen (etwa in Bezug auf Aufgabenformate, Analysemethoden, Korrekturverfahren, Feedback) Aufgabenformate und Analysemethoden
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Allgemeine Absprachen/ Vereinbarungen (etwa in Bezug auf Aufgabenformate, Analysemethoden, Korrekturverfahren, Feedback) Aufgabenformate und Analysemethoden
1. Grundlagen zur Konzeption und Bewertung von Klassenarbeiten in der Sek. I
 Grundlagen zur Konzeption und Bewertung von Klassenarbeiten in der Sek. I Vorgaben des Kernlehrplans Englisch Schriftliche Arbeiten sollen in der Regel aus mehreren Teilaufgaben bestehen, die inhaltlichthematisch
Grundlagen zur Konzeption und Bewertung von Klassenarbeiten in der Sek. I Vorgaben des Kernlehrplans Englisch Schriftliche Arbeiten sollen in der Regel aus mehreren Teilaufgaben bestehen, die inhaltlichthematisch
Fachspezifisches Konzept zur Leistungsbewertung. im Fach Philosophie Sek. II
 Fachspezifisches Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Philosophie Sek. II ( Stand: September 2016) Auf der Grundlage von 48 SchulG, 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Philosophie hat die Fachkonferenz
Fachspezifisches Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Philosophie Sek. II ( Stand: September 2016) Auf der Grundlage von 48 SchulG, 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Philosophie hat die Fachkonferenz
Grundsätze der Leistungsbewertung (ab 2015/16 bzw. Abitur 2017)
 Grundsätze der Leistungsbewertung (ab 2015/16 bzw. Abitur 2017) Übergeordnete Kriterien Sowohl die schriftlichen als auch die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung orientieren sich an den folgenden
Grundsätze der Leistungsbewertung (ab 2015/16 bzw. Abitur 2017) Übergeordnete Kriterien Sowohl die schriftlichen als auch die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung orientieren sich an den folgenden
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Italienisch
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Italienisch1 1 http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/italienisch/hinweiseund-beispiele/schulinterner-lehrplan/schulinterner-lehrplan-italienisch.html,
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Italienisch1 1 http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/italienisch/hinweiseund-beispiele/schulinterner-lehrplan/schulinterner-lehrplan-italienisch.html,
