Energetische und betriebswirtschaftliche Bewertung von Kühlsystemen für Kühllager
|
|
|
- Busso Kappel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Energetische und betriebswirtschaftliche Bewertung von Kühlsystemen für Kühllager Groß, R., Timmer, H. Lehrstuhl für Wärmeübertragung und Klimatechnik RWTH Aachen Einleitung Kühlhäuser stellen heute einen unverzichtbaren Bestandteil der Lebensmitteldistribution dar. Vor allem wegen der stetig zunehmenden Nachfrage an schnell zubereitbarer Tiefkühlkost, deren Kühlkette auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher gewahrt werden muß, trifft man bei Kühlhäusern heute auf einen Wachstumsmarkt. Zur Bereitstellung der erforderlichen Kühlenergie sind neben den zur Zeit auf diesem Gebiet bundesweit ausschließlich eingesetzten Kompressionskälteanlagen auch Alternativen auf Basis des Absorptionsprozesses in Betracht zu ziehen und zu bewerten. Hierbei kann im Einzelfall die Abwärme zur Deckung des Wärmebedarfs von angrenzenden Räumen, Gebäuden oder zur Brauchwassererwärmung genutzt werden. Um bereits in der Planungsphase, je nach Standort und vorhandener Infrastruktur, die richtige Kühlsystemauswahl treffen zu können, benötigt man einfache Bewertungsmaßstäbe für die unterschiedlichen Systeme. Vorgehensweise Ziel der nachfolgenden Überlegungen ist daher, eine Systemauswahl für Kühllager für die Lebensmitteldistribution bei unterschiedlichen Lagergrößen, die aber im wesentlichen geometrisch ähnlich sind, durchführen zu können. Derartige Kühllager werden in der Regel als kombinierte Kühl- / Tiefkühlhäuser mit auf zwei unterschiedlichen Temperaturniveaus konzipierten Gebäudebereichen ausgeführt. Unter Zugrundelegung der architektonischen Gestaltung und bauphysikalischen Umsetzung eines zu planenden Kühlhauses lassen sich als Eingangsgröße für eine weitergehende Analyse der durchschnittliche, über das Jahr integrierte Bedarf an Kälte und Wärme sowie die auftretenden Spitzenlasten ermitteln. Am Ende der Analyse steht die Systementscheidung bezüglich der Anlagentechnik, Kompressions- oder Absorptionskälte, sowie einer eventuellen Abwärmenutzung zur Wärmebedarfsdeckung im Bereich Heizung oder Brauchwassererwärmung. Dazu können aus einfachen Energie- und Kostenbetrachtungen Bewertungskriterien in Form von Kennzahlen gebildet werden. 1
2 Bei dem Referenzfall handelt es sich um den Anbau eines Kühl- und Tiefkühlzentrums an ein vorhandenes Trockenlager mit zwei Kühlzellen als Haus in Haus -Bauweise innerhalb eines Hohlraums mit je 2. m 2 Grundfläche und Betriebstemperaturen von +2 C für die Kühlung bzw. -22 C für die Tiefkühlung (Bild 1). Angeliefertes Kühlgut wird von den Rampen über eine Schleuse in den Vorraum und von dort in die jeweilige Kühlzelle transportiert. Oberhalb der Schleuse befinden sich Technik- und Sozialräume. Sozialräume: > + 21 C Hohlraum: > + 5 C Anlieferung Schleuse Rolltor Vorraum: + 2 C Kühltrakt: + 2 C Tiefkühltrakt: - 22 C hintereinanderliegend Rampe Bild 1: Prinzipskizze eines Kühl- und Tiefkühllagers. In der hier erstellten Auswahlroutine für Kühlsysteme werden folgende Aspekte berücksichtigt bzw. Annahmen getroffen: Personen-, Beleuchtungs-, Maschinenwärme Luftwechsel infolge Öffnung der Schleusen und Rolltore [1] Hinterlüftung des Hohlraums mit Außenluft Lagerumschlag in der Kommissionierungsphase [1] Zugrundelegung mittlerer Monatstemperaturen nach DIN 471 [2] Vernachlässigung der Sonneneinstrahlung Mit diesen Randbedingungen lassen sich alle Energieflüsse sowie der Wärme- und Kältebedarf im Jahresverlauf in Abhängigkeit von der Lagergröße ermitteln. Hierbei zeigt sich, daß bei einer mittleren Jahrestemperatur von 9 C und einem Umschlagfaktor von 1/Woche der Anteil des Kältebedarfs durch Lagerumschlag ca. 4 % beträgt und sich somit jede Veränderung des Umschlagfaktors deutlich auf den Kältebedarf auswirkt. Charakterisierung von Kühlsystemen Wird das Referenzlager auf eine andere Größe skaliert, können die Wärmeströme durch Leitung, Konvektion, Luftwechsel, Lagerumschlag und sonstiger Quellen im Auslegungsfall 2
3 entsprechend der veränderten Kühlflächen und Volumina des Gebäudes angepaßt werden. Die zur energetischen Bewertung eines in der Lebensmitteldistribution üblichen, kombinierten Kühl- / Tiefkühlprozesses und anschließende Systemauswahl herangezogene Kenngröße muß berücksichtigen, daß die Kühlenergie bei zwei verschiedenen Niveaus zur Verfügung zu stellen ist. Hierzu wird das Kühlenergieverhältnis κ als Anteil der auf dem niedrigen Temperaturniveau anfallenden Kälteleistung zu der insgesamt benötigten Kälteleistung eingeführt und als Funktion der Kühllagerfläche berechnet (s. Bild 2). Q& tiefes Temperaturniveau κ = [ ; ] Q& 1 (1) Für das Lager des Referenzfalls ergibt sich ein Kühlenergieverhältnis von,6, das auch bei einer Skalierung des Lagers nur geringfügig variiert. Leistung [kw] Kühlraum Tiefkühlraum Vorraum Sozialräume Kühlenergieverhältnis,62,61,6,59,58 Kühlenergieverhältnis, Netto-Kühllagerfläche [qm],56 Bild 2: Bei mittlerer Jahrestemperatur erforderliche Kälte- und Wärmeleistung und Kühlenergieverhältnis in Abhängigkeit von der Kühllagerfläche. Unter Verwendung des Kühlenergieverhältnisses werden im folgenden beispielhaft zwei Kühlsysteme, eine Kompressions- bzw. Absorptionskälteanlage, anhand zweier Leistungskennzahlen miteinander verglichen. 3
4 Kompressionskälteanlage Im hier geforderten Leistungsbereich von ca. 25 kw kommen handelsübliche, zweistufige Kompressionsmaschinen mit Mitteldruckflasche und Abwärmenutzung nach Bild 3 in Betracht. Ein solcher Kompressionsprozeß mit Abwärmenutzung ermöglicht mit dem Kältemittel Ammoniak Verdampfertemperaturen von -35 C zur Tiefkühlung und -8 C zur Vorkühlung. 5 Q H 4 log p 45 C P t,hd Q H HD 5* C P t,nd -35 C ND 8 6* Q N h Bild 3: Zweistufiger Kompressionsprozeß mit Mitteldruckflasche. Als Kriterien zur Bewertung der Anlage dienen zum einen die Leistungsziffer ε als das Verhältnis von erzeugter Kälteleistung zur zugeführten technischen Leistung sowie der Wärmerückgewinnungsfaktor ψ als das Verhältnis von nutzbarer Abwärme zur gesamten erzeugten Kälteleistung. ε = &Q P t Q& A ψ = Q& (2) (3) Beide Kennzahlen lassen sich als Funktion des Kühlenergieverhältnisses beschreiben (Bild 4). Der Abfall der Leistungszahl mit steigendem Kühlenergieverhältnis ist durch die Zunahme an Kälteenergie auf dem niedrigen Temperaturniveau zu erklären. Dies bedingt eine Erhöhung des Wärmerückgewinnungsfaktors, da dann mehr Abwärme zur Verfügung steht. Wie aus Bild 4 zu ersehen, verbessert die Unterkühlung im Hochdruckteil den Prozeß. 4
5 Leistungsziffer ε 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 Leistungsziffer Unterkühlung Leistungsziffer Standardprozeß WRG-Faktor Standardprozeß WRG-Faktor mit Unterkühlung,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 Kühlenergieverhältnis κ Referenzfall 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 Wärmerückgewinnungsfaktor ψ Bild 4: Leistungsziffer und Wärmerückgewinnungsfaktor als Funktion des Kühlenergieverhältnisses für eine Kompressionskälteanlage. Absorptionskälteanlage Zweistufige, direktbefeuerte Ammoniak - Absorptionsanlagen im Leistungsbereich um 25 kw und Verdampfertemperaturen von -3 C / -8 C mit der Möglichkeit der Abwärmenutzung sind zur Zeit auf dem deutschen Markt nicht erhältlich [3], befinden sich aber in der Entwicklung. Zur energetischen Bewertung dieses Anlagentyps wird das Wärmeverhältnis COP herangezogen, das als Quotient aus erzeugter Kälteleistung zur erforderlichen Heizleistung definiert und in Bild 5 für einen theoretischen NH 3 - Vergleichsprozeß ebenfalls als Funktion des Kühlenergieverhältnisses κ dargestellt ist. COP Q& & = Q H (4) 5
6 ,25 Wärmeverhältnis Wärmerückgewinnungsfaktor Wärmeverhältnis COP,2 11 1,15 9 8,1 7 6,5 5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 Referenzfall Kühlenergieverhältnis κ Wärmerückgewinnungsfaktor ψ Bild 5: Wärmeverhältnis und Wärmerückgewinnungsfaktor als Funktion des Kühlenergieverhältnisses für eine Absorptionskälteanlage. Für ein Kühlenergieverhältnis von κ =,6 ergibt sich ein COP-Wert von nur,12. Die hohe Kondensationstemperatur des derart konzipierten Prozesses von 6 C ermöglicht jedoch die vollständige Rückgewinnung der Abwärme, sofern gleichzeitig ein ausreichend hoher Wärmebedarf vorliegt. Ein handelsüblicher einstufiger, etwa mit Prozeßdampf indirekt beheizter Ammoniak- Absorptionsprozeß kann aufgrund der zu geringen Kondensatorendtemperatur nur ohne Abwärmenutzung betrieben werden, arbeitet aber im Auslegungsfall mit einem COP-Wert von,4. Direkt mit Gas beheizte Absorptionsanlagen erreichen aufgrund der Feuerungsverluste einen etwas niedrigeren COP-Wert von,36. Systementscheidung durch Kostenanalyse Neben den Investitionskosten sind zur Bewertung der Prozeßvarianten die Betriebskosten von entscheidender Bedeutung. Um einen Vergleich zwischen Kompressions- und Absorptionsmaschinen zu ermöglichen, muß das Wärmeverhältnis über das Energiepreisverhältnis zwischen Strom und dem Energieträger zur Beheizung des Austreibers auf die Leistungsziffer abgebildet werden. Bei direkt befeuerten Absorptionsanlagen ergibt sich ein Wärmepreisverhältnis von 7 und somit ein korrigierter COP-Wert von 2,5, der nun direkt mit der Leistungsziffer des Kompressionsprozesses zu vergleichen ist (Bild 4: Leistungsziffer 2,4 bei κ=,6). 6
7 Bild 6 zeigt in Form eines Ablaufschemas das Verfahren, mit dessen Hilfe eine Kühlsystemauswahl für kombinierte Kühl- / Tiefkühlhäuser durchgeführt werden kann, die ausgehend von einem Referenzfall geometrisch ähnlich und somit skalierbar sind. Lagerkapazität gesamte Lagerfläche bestimmen κ = f(a) Korrektur Lagerumschlag Wärmebedarf, Kältebedarf = f(a) Kühlenergieverhältnis Kältebedarf im Jahresverlauf Wärmebedarf im Jahresverlauf COP = f(κ) ε = f(κ) Ψ = f(κ) Wärmeverhältnis Leistungsziffer Wärmerückgewinnungsfaktor Nutzbare Abwärme bestimmen Betriebskosten ermitteln Investitionskosten Systementscheidung Bild 6: Systemauswahl für kombinierte Kühl- / Tiefkühlhäuser. Fazit Marktanalysen haben gezeigt, daß Absorptionsanlagen zur Zeit in dem betrachteten Anwendungsfall aufgrund der hohen Investitionskosten trotz geringerer Betriebskosten vor allem wegen der fehlenden Möglichkeit zur Abwärmenutzung nicht wirtschaftlich sind. Eine zukünftige Entscheidung wird allerdings maßgeblich von neuen technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Absorptionskälteanlagen und dem aktuellen Energiepreisverhältnis abhängen. 7
8 Literatur: [1] Drees, H.: Kühlanlagen", 15. Auflage, Verlag Technik GmbH Berlin, [2] Recknagel/Sprenger: Heizung + Klimatechnik 94/95", Oldenbourg Verlag [3] Deutsche Babcock-Borsig AG: Kälte aus Wärme", Informationsbroschüre und Referenzliste,
Willkommen. Welcome. Bienvenue. Raumlufttechnik Wärmepumpe Energierückgewinnung und Energieeffizienztechnologien
 Willkommen Bienvenue Welcome Raumlufttechnik Wärmepumpe Energierückgewinnung und Energieeffizienztechnologien in der Lüftungstechnik Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup c.kaup@umwelt-campus.de Dipl.-Ing. Christian
Willkommen Bienvenue Welcome Raumlufttechnik Wärmepumpe Energierückgewinnung und Energieeffizienztechnologien in der Lüftungstechnik Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup c.kaup@umwelt-campus.de Dipl.-Ing. Christian
Potenziale der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik für die (Ab)Wärmeerzeugung
 Potenziale der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik für die (Ab)Wärmeerzeugung Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e. V. (DKV) 1 Gliederung Funktion einer Wärme pumpende Anlage Bedeutung der
Potenziale der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik für die (Ab)Wärmeerzeugung Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e. V. (DKV) 1 Gliederung Funktion einer Wärme pumpende Anlage Bedeutung der
Thermodynamik Prof. Dr.-Ing. Peter Hakenesch
 Thermodynamik Thermodynamik Prof. Dr.-Ing. Peter Hakenesch peter.hakenesch@hm.edu www.lrz-muenchen.de/~hakenesch Thermodynamik 1 Einleitung 2 Grundbegriffe 3 Systembeschreibung 4 Zustandsgleichungen 5
Thermodynamik Thermodynamik Prof. Dr.-Ing. Peter Hakenesch peter.hakenesch@hm.edu www.lrz-muenchen.de/~hakenesch Thermodynamik 1 Einleitung 2 Grundbegriffe 3 Systembeschreibung 4 Zustandsgleichungen 5
KÄLTEVERSORGUNG. Ein Unternehmen von Bayer und LANXESS
 KÄLTEVERSORGUNG Ein Unternehmen von Bayer und LANXESS KÄLTEVERSORGUNG - Einführung EINFÜHRUNG In vielen Produktionsbereichen der chemischen Industrie ist die richtige Betriebstemperatur eine Grundvoraussetzung
KÄLTEVERSORGUNG Ein Unternehmen von Bayer und LANXESS KÄLTEVERSORGUNG - Einführung EINFÜHRUNG In vielen Produktionsbereichen der chemischen Industrie ist die richtige Betriebstemperatur eine Grundvoraussetzung
Umbau und energetische Sanierung des Stadtarchivs Stuttgart
 Umbau und energetische Sanierung des Stadtarchivs Stuttgart Dr. Jürgen Görres Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz, Abteilung Energiewirtschaft Gaisburgstraße 4, D 70182 Stuttgart Telefon 0711/216-88668,
Umbau und energetische Sanierung des Stadtarchivs Stuttgart Dr. Jürgen Görres Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz, Abteilung Energiewirtschaft Gaisburgstraße 4, D 70182 Stuttgart Telefon 0711/216-88668,
Kraft-Wärme-Kälte Kopplung
 Kraft-Wärme-Kälte Kopplung ökologische und ökonomische Aspekte vorgestellt durch Marco Henning M.Sc., Dipl.-Ing (FH) Tel. 0201/2400-4107 Mobil 0162/ 1098458 Email marco.henning@jci.com Vertriebsleiter
Kraft-Wärme-Kälte Kopplung ökologische und ökonomische Aspekte vorgestellt durch Marco Henning M.Sc., Dipl.-Ing (FH) Tel. 0201/2400-4107 Mobil 0162/ 1098458 Email marco.henning@jci.com Vertriebsleiter
Abwärme oder Wärmequelle ein schlummerndes Potenzial Thermodynamik und erfolgreiche Anwendungen
 Abwärme oder Wärmequelle ein schlummerndes Potenzial Thermodynamik und erfolgreiche Anwendungen Dipl. Ing. (FH) Helmut Krames Stellvertretender Bereichsleiter Energieeffizienz und erneuerbare Energien
Abwärme oder Wärmequelle ein schlummerndes Potenzial Thermodynamik und erfolgreiche Anwendungen Dipl. Ing. (FH) Helmut Krames Stellvertretender Bereichsleiter Energieeffizienz und erneuerbare Energien
CO 2 -Emissionen und Energiekosten verschiedener Systeme der Kraft-Wärme- Kälte-Kopplung
 CO 2 -Emissionen und Energiekosten verschiedener Systeme der Kraft-Wärme- Kälte-Kopplung 26. 27. Oktober 2010 Prof. Dr. Bernd Biffar Hochschule Kempten Inhalt 1. Einleitung 2. Referenzsysteme 3. CO 2 -Emissionen
CO 2 -Emissionen und Energiekosten verschiedener Systeme der Kraft-Wärme- Kälte-Kopplung 26. 27. Oktober 2010 Prof. Dr. Bernd Biffar Hochschule Kempten Inhalt 1. Einleitung 2. Referenzsysteme 3. CO 2 -Emissionen
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung
 Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
SUN MEMORY WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT. Sonnenstrom. 4 kw. = 1 kw. Wärme.
 SUN MEMORY WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT Sonnenstrom 4 kw = 1 kw Wärme www.waermepumpensysteme.com Mehr Unabhängigkeit durch die effiziente Nutzung des eigenproduzierten,
SUN MEMORY WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT Sonnenstrom 4 kw = 1 kw Wärme www.waermepumpensysteme.com Mehr Unabhängigkeit durch die effiziente Nutzung des eigenproduzierten,
COFELY in Germany. Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) 7 Abwärmenutzung. Rebranding Campaign. Dipl. Ing. M. Enzensperger
 Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) 7 Abwärmenutzung COFELY in Germany Rebranding Campaign Dipl. Ing. M. Enzensperger Seite 1 Gesetz zur Förderung der Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 1 Zweck
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) 7 Abwärmenutzung COFELY in Germany Rebranding Campaign Dipl. Ing. M. Enzensperger Seite 1 Gesetz zur Förderung der Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 1 Zweck
Wirtschaftlichkeit verschiedener Luftführungssysteme in Industriehallen
 Wirtschaftlichkeit verschiedener Luftführungssysteme in Industriehallen Dipl.-Ing. Detlef Makulla Leiter Forschung & Entwicklung der Caverion Deutschland GmbH, Aachen Auswirkungen auf Energiekosten und
Wirtschaftlichkeit verschiedener Luftführungssysteme in Industriehallen Dipl.-Ing. Detlef Makulla Leiter Forschung & Entwicklung der Caverion Deutschland GmbH, Aachen Auswirkungen auf Energiekosten und
Die neue Heizung ohne Gas und Öl
 HOCHSCHULE BIBERACH Die neue Heizung ohne Gas und Öl Seite 1 Energieverbrauch der deutschen Haushalte Quelle: Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.v. Seite 2 Gefährliche Schere zwischen Weltnutzenergiebedarf
HOCHSCHULE BIBERACH Die neue Heizung ohne Gas und Öl Seite 1 Energieverbrauch der deutschen Haushalte Quelle: Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.v. Seite 2 Gefährliche Schere zwischen Weltnutzenergiebedarf
Frigopol Infotage 19.03.2009. aus Wärme
 Kälte aus Wärme Dr. Thomas Ebner Allgemeines: Geschichtliche Entwicklung Kältetechnik ist ca. 175 Jahre alt 1824 Carnot Grundlagen 1834 Perkins (1. Kaltdampfkältemaschine) 1844 Gorrie (1. Luftkompressionskältemaschine)
Kälte aus Wärme Dr. Thomas Ebner Allgemeines: Geschichtliche Entwicklung Kältetechnik ist ca. 175 Jahre alt 1824 Carnot Grundlagen 1834 Perkins (1. Kaltdampfkältemaschine) 1844 Gorrie (1. Luftkompressionskältemaschine)
Bessere Kälte Energieeinsparung aus einem anderen Blickwinkel
 Bessere Kälte Energieeinsparung aus einem anderen Blickwinkel 2012 / Raymond Burri Blickwinkel aus verschiedenen Positionen Kompressoren von Kälteanlagen und Wärmepumpen verbrauchen in der Schweiz rund
Bessere Kälte Energieeinsparung aus einem anderen Blickwinkel 2012 / Raymond Burri Blickwinkel aus verschiedenen Positionen Kompressoren von Kälteanlagen und Wärmepumpen verbrauchen in der Schweiz rund
Netzwerk Kälteeffizienz Grundlagen zur Gewerbekälte
 Grundlagen zur Gewerbekälte Energieeffizienz in der Gewerbekälte 20.02.2009 Dipl.-Ing. (FH) Olaf Henk, Schulung Gewerbekälte 20.02.2009 1 Übersicht Der Kälteprozess Leistungsregelung des Kälteprozesses
Grundlagen zur Gewerbekälte Energieeffizienz in der Gewerbekälte 20.02.2009 Dipl.-Ing. (FH) Olaf Henk, Schulung Gewerbekälte 20.02.2009 1 Übersicht Der Kälteprozess Leistungsregelung des Kälteprozesses
Vergleich zwischen Systemen der getrennten und der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme bei unterschiedlichen Bedarfsstrukturen
 KWK-Systemvergleich 1 Vergleich zwischen Systemen der getrennten und der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme bei unterschiedlichen Bedarfsstrukturen Aufgabe 1: Verschiedene Systeme der getrennten
KWK-Systemvergleich 1 Vergleich zwischen Systemen der getrennten und der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme bei unterschiedlichen Bedarfsstrukturen Aufgabe 1: Verschiedene Systeme der getrennten
Wärmepumpen/ Kältemaschinen im größeren Leistungsbereich
 Wärmepumpen/ Kältemaschinen im größeren Leistungsbereich Referent Dipl.- Ing. Thomas Maintz Viessmann Anlagentechnik KWT Vorlage 1 Wärmepumpen in Nahwärmenetzen Themen: Zentrale Heizwärmeversorgung dezentrale
Wärmepumpen/ Kältemaschinen im größeren Leistungsbereich Referent Dipl.- Ing. Thomas Maintz Viessmann Anlagentechnik KWT Vorlage 1 Wärmepumpen in Nahwärmenetzen Themen: Zentrale Heizwärmeversorgung dezentrale
Abluftanlagen und maschinelle Be- und Entlüftungsanlagen mit WÜT Ermittlung der Kennzahlen nach DIN V Teil 10
 Abluftanlagen und maschinelle Be- und Entlüftungsanlagen mit WÜT Ermittlung der Kennzahlen nach DIN V 4701- Teil 10 von Dipl. Ing. (FH) Thomas Busler TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb Abt. Kälte- und
Abluftanlagen und maschinelle Be- und Entlüftungsanlagen mit WÜT Ermittlung der Kennzahlen nach DIN V 4701- Teil 10 von Dipl. Ing. (FH) Thomas Busler TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb Abt. Kälte- und
Energiekonzept. Energieeffizienz in der Versorgung Grundlagen am Beispiel Nürnberg Vergleich von Versorgungsvarianten Kosten
 Energiekonzept. Energieeffizienz in der Versorgung Grundlagen am Beispiel Nürnberg Vergleich von Versorgungsvarianten Kosten Warum ein Energiekonzept? Ziel: kostengünstige und ressourcen-schonende Energieversorgung
Energiekonzept. Energieeffizienz in der Versorgung Grundlagen am Beispiel Nürnberg Vergleich von Versorgungsvarianten Kosten Warum ein Energiekonzept? Ziel: kostengünstige und ressourcen-schonende Energieversorgung
Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG. Ersatzmaßnahmen
 Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisführung und ist der unteren Bauaufsicht
Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisführung und ist der unteren Bauaufsicht
Austausch von Nachtstromspeicherheizungen
 Freie Universität Berlin Fachkonferenz Stromsparen in privaten Haushalten. Appelle an die Vernunft oder vernünftige Politiksteuerung? Modellvorhaben des BMVBS zum Austausch von Nachtstromspeicherheizungen
Freie Universität Berlin Fachkonferenz Stromsparen in privaten Haushalten. Appelle an die Vernunft oder vernünftige Politiksteuerung? Modellvorhaben des BMVBS zum Austausch von Nachtstromspeicherheizungen
Kälte erzeugen. Warum ist es in hohen Luftschichten kälter als in tiefen? Verdunstungskälte. - frieren nach dem Bad - schwitzen zur Körperkühlung
 Kälte erzeugen Warum ist es in hohen Luftschichten kälter als in tiefen? Verdunstungskälte - frieren nach dem Bad - schwitzen zur Körperkühlung - Luft komprimieren -> Erwärmung - Luft dekomprimieren (
Kälte erzeugen Warum ist es in hohen Luftschichten kälter als in tiefen? Verdunstungskälte - frieren nach dem Bad - schwitzen zur Körperkühlung - Luft komprimieren -> Erwärmung - Luft dekomprimieren (
Marktentwicklung, Einsatzbereiche, Betriebsdaten, Energie-politische Rahmenbedingungen, Förderungsprogramme, Zukunftsoptionen
 Die Technik in Österreich 2006 Marktentwicklung, Einsatzbereiche, Betriebsdaten, Energie-politische Rahmenbedingungen, Gerhard Faninger, iff, Universität Klagenfurt gerhard.faninger@uni- klu.ac.at http://www.uni-
Die Technik in Österreich 2006 Marktentwicklung, Einsatzbereiche, Betriebsdaten, Energie-politische Rahmenbedingungen, Gerhard Faninger, iff, Universität Klagenfurt gerhard.faninger@uni- klu.ac.at http://www.uni-
Konzept zur Klimatisierung einer Produktionshalle. Limón Case Study Designprodukte für die Kosmetikindustrie Seidel GmbH & Co. KG
 Konzept zur Klimatisierung einer Produktionshalle Limón GmbH 13.06.2016 1 Unternehmen Standort Branche Seidel GmbH & Co. KG Fronhausen, Deutschland Kosmetikindustrie Produkte Designprodukte aus Aluminium
Konzept zur Klimatisierung einer Produktionshalle Limón GmbH 13.06.2016 1 Unternehmen Standort Branche Seidel GmbH & Co. KG Fronhausen, Deutschland Kosmetikindustrie Produkte Designprodukte aus Aluminium
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
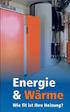 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Studienrichtung Master Umwelt- und Verfahrenstechnik
 Studienarbeit Studienrichtung Master Umwelt- und Verfahrenstechnik Betriebswirtschaftslehre Investitionsrechnung zum Vergleich zwischen dem Betrieb eines Kältenetzes mit Kompressionskälteanlage oder einer
Studienarbeit Studienrichtung Master Umwelt- und Verfahrenstechnik Betriebswirtschaftslehre Investitionsrechnung zum Vergleich zwischen dem Betrieb eines Kältenetzes mit Kompressionskälteanlage oder einer
chillii Cooling thermisch kühlen
 chillii Cooling thermisch kühlen chillii Technology Solare Kühlung als Chance für eine regenerative Kälteversorgung Katrin Spiegel Firmenvorstellung Gegründet 2006 Spezialist für Systemlösungen im Bereich
chillii Cooling thermisch kühlen chillii Technology Solare Kühlung als Chance für eine regenerative Kälteversorgung Katrin Spiegel Firmenvorstellung Gegründet 2006 Spezialist für Systemlösungen im Bereich
Ammoniak-Wärmepumpen mit Schraubenverdichtern
 Ammoniak-Wärmepumpen mit Schraubenverdichtern GEA Refrigeration Technologies Germany Thomas Lergenmüller Engineering und Produktmanagement Inhalt I. Vorstellung Unternehmen II. Die GEA Wärmepumpe III.
Ammoniak-Wärmepumpen mit Schraubenverdichtern GEA Refrigeration Technologies Germany Thomas Lergenmüller Engineering und Produktmanagement Inhalt I. Vorstellung Unternehmen II. Die GEA Wärmepumpe III.
Wärmerückgewinnung aus Abwasser
 Wärmerückgewinnung aus Abwasser Alexander Schitkowsky Leiter Industriedienstleistungen, Prokurist 13.12.2010 Alexander Schitkowsky Wärmerückgewinnung aus Abwasser Einführung Beispiel IKEA Weitere Beispiele
Wärmerückgewinnung aus Abwasser Alexander Schitkowsky Leiter Industriedienstleistungen, Prokurist 13.12.2010 Alexander Schitkowsky Wärmerückgewinnung aus Abwasser Einführung Beispiel IKEA Weitere Beispiele
pakt. Kältetechnik // Vortrag Energetische Optimierung von Kälteanlagen 04.2009 pakt GmbH
 pakt. Kältetechnik // Vortrag Energetische Optimierung von Kälteanlagen 04.2009 pakt GmbH Etwa 14 % des gesamten Elektroenergiebedarfs der Bundesrepublik werden für den Betrieb von Kälte- und Klimaanlagen
pakt. Kältetechnik // Vortrag Energetische Optimierung von Kälteanlagen 04.2009 pakt GmbH Etwa 14 % des gesamten Elektroenergiebedarfs der Bundesrepublik werden für den Betrieb von Kälte- und Klimaanlagen
Mitsubishi Electric Air Conditioning Division Gothaer Str Ratingen T F
 Mitsubishi Electric Air Conditioning Division Gothaer Str. 8 40880 Ratingen T 02102 486-5240 F 02102 486-4664 Klima-Abc 7 Minuten zum Klima-Experten Kältemittel- Kreislauf COP/EER C 1 2 3 Ein wichtiges
Mitsubishi Electric Air Conditioning Division Gothaer Str. 8 40880 Ratingen T 02102 486-5240 F 02102 486-4664 Klima-Abc 7 Minuten zum Klima-Experten Kältemittel- Kreislauf COP/EER C 1 2 3 Ein wichtiges
Fossile Energieträger. Funktionsprinzip der Wärmepumpe. Die Umwelt entlasten und gleichzeitig Heizkosten sparen
 Fossile Energieträger Der hohe Anteil fossiler Energieträger an der Gesamtenergieversorgung wird aufgrund der begrenzten Vorräte schon in diesem Jahrhundert zur Erschöpfung der Ressourcen an Erdöl, Erdgas
Fossile Energieträger Der hohe Anteil fossiler Energieträger an der Gesamtenergieversorgung wird aufgrund der begrenzten Vorräte schon in diesem Jahrhundert zur Erschöpfung der Ressourcen an Erdöl, Erdgas
Vortrag Wärmepumpen. Novelan GmbH
 Vortrag Wärmepumpen Referent: Bernd Happe Novelan GmbH Die Entwicklung zur Komfortheizung Die Entwicklung zur Komfortheizung Die Entwicklung zur Komfortheizung So leben wir, so leben wir, so leben wir
Vortrag Wärmepumpen Referent: Bernd Happe Novelan GmbH Die Entwicklung zur Komfortheizung Die Entwicklung zur Komfortheizung Die Entwicklung zur Komfortheizung So leben wir, so leben wir, so leben wir
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis. Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen
 Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen Netzwerktreffen Kälteenergie, 4. September 2013 Dr. Friederike Mechel,
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen Netzwerktreffen Kälteenergie, 4. September 2013 Dr. Friederike Mechel,
Best Practice Beispiel Serviceeinheit Wäsche und Reinigung
 Best Practice Beispiel Serviceeinheit Wäsche und Reinigung Die Firma Serviceeinheit Wäsche und Reinigung ist Teil des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Derzeit sind in diesem Betrieb etwa 200 Personen
Best Practice Beispiel Serviceeinheit Wäsche und Reinigung Die Firma Serviceeinheit Wäsche und Reinigung ist Teil des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Derzeit sind in diesem Betrieb etwa 200 Personen
Aktuelle Anwendungsbeispiele zur Nutzung von Wärmespeichern zur Klimatisierung von Gebäuden
 Aktuelle Anwendungsbeispiele zur Nutzung von Wärmespeichern zur Klimatisierung von Gebäuden Materialien, Anwendungen, Systeme Stefan Gschwander Energie- und Energiespeichertechnologien Forschung trifft
Aktuelle Anwendungsbeispiele zur Nutzung von Wärmespeichern zur Klimatisierung von Gebäuden Materialien, Anwendungen, Systeme Stefan Gschwander Energie- und Energiespeichertechnologien Forschung trifft
Heutrocknung durch Belüftung. 1. Trocknung durch Verdampfen des Wassers. 2. Trocknung durch Kondensieren des Wassers
 Heutrocknung durch Belüftung 1. Trocknung durch Verdampfen des Wassers Kaltbelüftung Kaltbelüftung mit Lufterwärmung 2. Trocknung durch Kondensieren des Wassers Wärmepumpen-Luftentfeuchter Wärmepumpen-Luftentfeuchter
Heutrocknung durch Belüftung 1. Trocknung durch Verdampfen des Wassers Kaltbelüftung Kaltbelüftung mit Lufterwärmung 2. Trocknung durch Kondensieren des Wassers Wärmepumpen-Luftentfeuchter Wärmepumpen-Luftentfeuchter
Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden ggmbh. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von RLT-Anlagen
 Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden ggmbh Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von RLT-Anlagen Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke Gliederung Einleitung Definitionen i i Nutzungsbedingungen Haupteinflussgrößen
Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden ggmbh Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von RLT-Anlagen Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke Gliederung Einleitung Definitionen i i Nutzungsbedingungen Haupteinflussgrößen
Thema: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) Ersatzmaßnahmen
 Thema: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) Ersatzmaßnahmen 2012 Referent: Dr. Gerd Huber Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vom 01.05.2011 schreibt den Anteil regenerativer Energien
Thema: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) Ersatzmaßnahmen 2012 Referent: Dr. Gerd Huber Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vom 01.05.2011 schreibt den Anteil regenerativer Energien
Pilotanlage zur Wärmerückgewinnung aus Laserschneidmaschinen. Dipl.-Ing. (FH) Christoph Reuter
 Pilotanlage zur Wärmerückgewinnung aus Laserschneidmaschinen Dipl.-Ing. (FH) Christoph Reuter Motivation Frage.. Wie schafft man es, in einem energieintensiven, blechverarbeitenden Betrieb - den Gas- und
Pilotanlage zur Wärmerückgewinnung aus Laserschneidmaschinen Dipl.-Ing. (FH) Christoph Reuter Motivation Frage.. Wie schafft man es, in einem energieintensiven, blechverarbeitenden Betrieb - den Gas- und
Die EN auf dem Prüfstand
 Eine Untersuchung der Anwendbarkeit in öffentlichen Liegenschaften Hochschule Rosenheim Agenda Norm & Tools Ergebnisse der Untersuchung Anwendbarkeit der EN 15232 2 Energieeffizienz: Normen EN 15232 Grundlegende
Eine Untersuchung der Anwendbarkeit in öffentlichen Liegenschaften Hochschule Rosenheim Agenda Norm & Tools Ergebnisse der Untersuchung Anwendbarkeit der EN 15232 2 Energieeffizienz: Normen EN 15232 Grundlegende
WIR KÜHLEN MIT SYSTEM. Gesamtheitliche Energiekonzepte im Supermarkt mit dem neuen GeoPack System von HM, Betriebserfahrungen
 Gesamtheitliche Energiekonzepte im Supermarkt mit dem neuen GeoPack System von HM, Betriebserfahrungen Firmenstruktur HM Bereiche Geschäftsbereiche Industriekälte Gewerbekälte OEM Service HM-I HM-G HM-O
Gesamtheitliche Energiekonzepte im Supermarkt mit dem neuen GeoPack System von HM, Betriebserfahrungen Firmenstruktur HM Bereiche Geschäftsbereiche Industriekälte Gewerbekälte OEM Service HM-I HM-G HM-O
Solare Kühlung Solare Kühlung für Büros, Geschäfts-/ Schulungsräume und Hotels
 Solare Kühlung Solare Kühlung für Büros, Geschäfts-/ Schulungsräume und Hotels Dipl.-Ing. Uwe Ibanek Verkaufsleiter Schüco Int. KG Inhalt 1 Vorstellung 2 Auslegung und Rahmenbedingungen 3 Portfolio 4 Beispielanlagen
Solare Kühlung Solare Kühlung für Büros, Geschäfts-/ Schulungsräume und Hotels Dipl.-Ing. Uwe Ibanek Verkaufsleiter Schüco Int. KG Inhalt 1 Vorstellung 2 Auslegung und Rahmenbedingungen 3 Portfolio 4 Beispielanlagen
Planung und Realisierung des Energiemanagements am Beispiel des Inselspitals Bern
 Seite 1 Planung und Realisierung des Energiemanagements am Beispiel des Inselspitals Bern Dieter Többen, CEO Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Energiemanagement Masterplan/ Strategie Messen / Optimieren Projekte
Seite 1 Planung und Realisierung des Energiemanagements am Beispiel des Inselspitals Bern Dieter Többen, CEO Dr. Eicher+Pauli AG Seite 2 Energiemanagement Masterplan/ Strategie Messen / Optimieren Projekte
Mitsubishi Electric Europe B.V. Air Conditioning Division Gothaer Str Ratingen. Art.-Nr /2007
 Mitsubishi Electric Europe B.V. Air Conditioning Division Gothaer Str. 8 40880 Ratingen Klima-Abc Art.-Nr. 207223-2 10/2007 in 7 Minuten KLIMAEXPERTE Kältemittel- Kreislauf COP/EER C 1 2 3 Ein wichtiges
Mitsubishi Electric Europe B.V. Air Conditioning Division Gothaer Str. 8 40880 Ratingen Klima-Abc Art.-Nr. 207223-2 10/2007 in 7 Minuten KLIMAEXPERTE Kältemittel- Kreislauf COP/EER C 1 2 3 Ein wichtiges
Dipl. Ing. Michael Hildmann Strom- und Wärmeerzeugung mit BHKW. BHKW s heute in der Praxis
 Dipl. Ing. Michael Hildmann Strom- und Wärmeerzeugung mit BHKW BHKW s heute in der Praxis 03.12.2009 Grundlagen für die Auslegung monatlicher Brennstoff-/Wärmebedarf über 2 bis 3 Jahre monatlicher Stromverlauf
Dipl. Ing. Michael Hildmann Strom- und Wärmeerzeugung mit BHKW BHKW s heute in der Praxis 03.12.2009 Grundlagen für die Auslegung monatlicher Brennstoff-/Wärmebedarf über 2 bis 3 Jahre monatlicher Stromverlauf
KWK kann s besser. Was ist Kraft-Wärme-Kopplung? Folie 1
 Was ist Kraft-Wärme-Kopplung? Folie 1 Grundprinzip Effizienz Wirkungsgrad Getrennte Energieerzeugung Strom und Wärme werden unabhängig voneinander in getrennten Prozessen erzeugt (Kraftwerk oder Heizkessel)
Was ist Kraft-Wärme-Kopplung? Folie 1 Grundprinzip Effizienz Wirkungsgrad Getrennte Energieerzeugung Strom und Wärme werden unabhängig voneinander in getrennten Prozessen erzeugt (Kraftwerk oder Heizkessel)
Der Weg zur Nahwärmeversorgung 5 Schritte zum eigenen Nahwärmenetz
 8. Bayerisches Energieforum Garching Der Weg zur Nahwärmeversorgung 5 Schritte zum eigenen Nahwärmenetz Knecht Ingenieure GmbH Dipl. Ing. Thomas Knecht Im Öschle 10 87499 Wildpoldsried Tel.: 08304/929305-0
8. Bayerisches Energieforum Garching Der Weg zur Nahwärmeversorgung 5 Schritte zum eigenen Nahwärmenetz Knecht Ingenieure GmbH Dipl. Ing. Thomas Knecht Im Öschle 10 87499 Wildpoldsried Tel.: 08304/929305-0
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
Was gibt der Energieausweis für die Wärmepumpenplanung Welche relevanten Kennzahlen sind enthalten? Sind die enthaltenen Kennzahlen auch brauchbar?
 Was gibt der Energieausweis für die Wärmepumpenplanung her? Welche relevanten Kennzahlen sind enthalten? Sind die enthaltenen Kennzahlen auch brauchbar? Systemgrenze 3: Primärenergie PEB Transmissionswärmeverluste
Was gibt der Energieausweis für die Wärmepumpenplanung her? Welche relevanten Kennzahlen sind enthalten? Sind die enthaltenen Kennzahlen auch brauchbar? Systemgrenze 3: Primärenergie PEB Transmissionswärmeverluste
Zusammenfassung. 1. Einleitung
 Zusammenfassung 1. Einleitung Es ist technisch möglich Photovoltaik- und Solarthermiemodule zu einem Hybridmodul zu vereinen. Diese Kombination wird kurz PVT genannt. Dabei können grundsätzlich zwei Systeme
Zusammenfassung 1. Einleitung Es ist technisch möglich Photovoltaik- und Solarthermiemodule zu einem Hybridmodul zu vereinen. Diese Kombination wird kurz PVT genannt. Dabei können grundsätzlich zwei Systeme
Wärmepumpen. Profitieren Sie von der HM-Wärmepumpe ein Plus für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Effiziente Kälteund Wärmesysteme
 Wärmepumpen Bild zeigt Wärmepumpe mit Sonderausstattung Effiziente Kälteund Wärmesysteme Made in Germany Profitieren Sie von der HM-Wärmepumpe ein Plus für die Umwelt und Ihren Geldbeutel CO 2 -Energieemissionen
Wärmepumpen Bild zeigt Wärmepumpe mit Sonderausstattung Effiziente Kälteund Wärmesysteme Made in Germany Profitieren Sie von der HM-Wärmepumpe ein Plus für die Umwelt und Ihren Geldbeutel CO 2 -Energieemissionen
SolarPowerPack Solar-Dachpfannen-Kollektor System
 SolarPowerPack MS 5 PV & MS 5 2Power 2Power SolarPowerPack Solar-Dachpfannen-Kollektor System SolarPowerPack Wärmepumpe SolarPowerPack Funktionsprinzip www.revolution-ist-jetzt.de SOLARTECHNIK OHNE ARCHITEKTONISCHE
SolarPowerPack MS 5 PV & MS 5 2Power 2Power SolarPowerPack Solar-Dachpfannen-Kollektor System SolarPowerPack Wärmepumpe SolarPowerPack Funktionsprinzip www.revolution-ist-jetzt.de SOLARTECHNIK OHNE ARCHITEKTONISCHE
Passnummer Nr. Aussteller Erstellt am Gültig bis P IP/ Adresse (Straße) Mustermannstrasse, 3694
 geringer Energiebedarf Passivhaus hoher Energiebedarf Die Einstufung in die erfolgt nach dem sogenannten Primärenergiebedarf. Dieser berücksichtigt neben dem Wärmeschutz des Gebäudes auch die verwendete
geringer Energiebedarf Passivhaus hoher Energiebedarf Die Einstufung in die erfolgt nach dem sogenannten Primärenergiebedarf. Dieser berücksichtigt neben dem Wärmeschutz des Gebäudes auch die verwendete
Thermodynamik 2 Klausur 11. März 2011
 Thermodynamik 2 Klausur 11. März 2011 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 4 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind als
Thermodynamik 2 Klausur 11. März 2011 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 4 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind als
Solares Kühlen, Graz 12.11.2013 Sorptionskühlung in einer Molkerei. Jürgen Fluch
 Sorptionskühlung in einer Molkerei Fallstudie Jürgen Fluch AEE Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) A-8200 Gleisdorf, Feldgasse 19 AUSTRIA Überblick Zielsetzungen im Projekt und Projektablauf
Sorptionskühlung in einer Molkerei Fallstudie Jürgen Fluch AEE Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) A-8200 Gleisdorf, Feldgasse 19 AUSTRIA Überblick Zielsetzungen im Projekt und Projektablauf
EnEV 2014 und Gebäudeautomation
 und Gebäudeautomation Martin Hardenfels WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 1 Was ist der Unterschied zu den Energie Einspar Verordnungen davor? In der wird erstmals der Automationsgrad des Gebäudes berücksichtigt.
und Gebäudeautomation Martin Hardenfels WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 1 Was ist der Unterschied zu den Energie Einspar Verordnungen davor? In der wird erstmals der Automationsgrad des Gebäudes berücksichtigt.
Stromerzeugen mit BHKW. Heizen und Kühlen mit der Kraft der Sonne. Projektpräsentation der technischen Lösung
 Stromerzeugen mit BHKW. Heizen und Kühlen mit der Kraft der Sonne. Energie sparen. Kosten senken. Ertrag steigern. Das patentierte aeteba SolarCooling System Projektpräsentation der technischen Lösung
Stromerzeugen mit BHKW. Heizen und Kühlen mit der Kraft der Sonne. Energie sparen. Kosten senken. Ertrag steigern. Das patentierte aeteba SolarCooling System Projektpräsentation der technischen Lösung
FKT 19.03.2014 Kälteerzeugung im Krankenhaus
 Kälteerzeugung im Krankenhaus Ist der Einsatz einer Absorptionskältemaschine in Verbindung mit einem BHKW wirtschaftlich? Stefan Bolle GASAG Contracting GmbH Im Teelbruch 55 45219 Essen Tel. 02054-96954
Kälteerzeugung im Krankenhaus Ist der Einsatz einer Absorptionskältemaschine in Verbindung mit einem BHKW wirtschaftlich? Stefan Bolle GASAG Contracting GmbH Im Teelbruch 55 45219 Essen Tel. 02054-96954
Kühlen mit thermischer Solarenergie und Fernwärme Christian Rakos Energieverwertungsagentur
 Kühlen mit thermischer Solarenergie und Fernwärme Christian Rakos Energieverwertungsagentur Prozesse zur Kälteerzeugung Mechanisch getriebene Verfahren Mechanisch getriebene Kaltdampfprozesse: Kompressionskältemaschienen
Kühlen mit thermischer Solarenergie und Fernwärme Christian Rakos Energieverwertungsagentur Prozesse zur Kälteerzeugung Mechanisch getriebene Verfahren Mechanisch getriebene Kaltdampfprozesse: Kompressionskältemaschienen
GEOTHERMIEZENTRUM Bochum
 Beispiele für Heizen und Kühlen mit oberflächennaher h Geothermie sowie Wirtschaftlichkeit und Amortisation von Erdwärmeanlagen Gregor Bussmann Timm Eicker Rolf Bracke GeothermieZentrum, Lennershofstraße
Beispiele für Heizen und Kühlen mit oberflächennaher h Geothermie sowie Wirtschaftlichkeit und Amortisation von Erdwärmeanlagen Gregor Bussmann Timm Eicker Rolf Bracke GeothermieZentrum, Lennershofstraße
Effiziente Nutzung von Strom, Wärme und Kälte: Einsatzmöglichkeiten von Adsorptionskältemaschinen mit BHKWs
 Effiziente Nutzung von Strom, Wärme und Kälte: Einsatzmöglichkeiten von Adsorptionskältemaschinen mit BHKWs Sören Paulußen InvenSor GmbH, Berlin ASUE-Fachtagung: Heizen, Kühlen + Klimatisieren mit Erdgas
Effiziente Nutzung von Strom, Wärme und Kälte: Einsatzmöglichkeiten von Adsorptionskältemaschinen mit BHKWs Sören Paulußen InvenSor GmbH, Berlin ASUE-Fachtagung: Heizen, Kühlen + Klimatisieren mit Erdgas
Kälteerzeugung mittels Biomasseheizkessel
 Fachsymposium - Wärme + Kälte + Strom aus Biomasse Roland Weidner Kälteerzeugung mittels Biomasseheizkessel 04.12.2009 Hamburg Berlin Dortmund Frankfurt Westenfeld Stuttgart München 1 Firmenverbund WEGRA
Fachsymposium - Wärme + Kälte + Strom aus Biomasse Roland Weidner Kälteerzeugung mittels Biomasseheizkessel 04.12.2009 Hamburg Berlin Dortmund Frankfurt Westenfeld Stuttgart München 1 Firmenverbund WEGRA
Kälteerzeugung Potenziale zur Energieeinsparung. www.energieagentur.nrw.de
 Kälteerzeugung Potenziale zur Energieeinsparung www.energieagentur.nrw.de 2 Anlagentechnik optimieren und Energieverbrauch senken In den meisten Betrieben in Industrie und Gewerbe sind Anlagen zur Kälteerzeugung
Kälteerzeugung Potenziale zur Energieeinsparung www.energieagentur.nrw.de 2 Anlagentechnik optimieren und Energieverbrauch senken In den meisten Betrieben in Industrie und Gewerbe sind Anlagen zur Kälteerzeugung
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Büro- und Verwaltungsgebäude Modul Nutzen + Betreiben
 Relevanz und Zielsetzungen Der tatsächliche (gemessene) Energieverbrauch ist ein wichtiger Indikator sowohl für die ökologische Qualität, das heißt die reale und Umweltbelastung, als auch für die ökonomische
Relevanz und Zielsetzungen Der tatsächliche (gemessene) Energieverbrauch ist ein wichtiger Indikator sowohl für die ökologische Qualität, das heißt die reale und Umweltbelastung, als auch für die ökonomische
Kraft Wärme Kältekopplung im Leistungsbereich 10 kw bis 50 kw
 14. Netzwerktreffen Innovationen und Entwicklungswege in der Kältetechnik Kraft Wärme Kältekopplung im Leistungsbereich 10 kw bis 50 kw Klima- und Anlagentechnik Schindler Klima- und Anlagentechnik Schindler
14. Netzwerktreffen Innovationen und Entwicklungswege in der Kältetechnik Kraft Wärme Kältekopplung im Leistungsbereich 10 kw bis 50 kw Klima- und Anlagentechnik Schindler Klima- und Anlagentechnik Schindler
Wärmepumpe & Photovoltaik und eine gute Kombination
 Wärmepumpe & Photovoltaik und eine gute Kombination 1. Willicher Praxistage Geothermie, 25.09.2015, Willich Leonhard Thien, EnergieAgentur.NRW, Leiter Netzwerk Geothermie NRW Inhalt EnergieAgentur.NRW
Wärmepumpe & Photovoltaik und eine gute Kombination 1. Willicher Praxistage Geothermie, 25.09.2015, Willich Leonhard Thien, EnergieAgentur.NRW, Leiter Netzwerk Geothermie NRW Inhalt EnergieAgentur.NRW
Die Wärmepumpe Unsere Antwort auf steigende Energiepreise
 Die Wärmepumpe Unsere Antwort auf steigende Energiepreise Inhaltsübersicht A. Funktionsprinzip & Arbeitsweise: Wärme aus der Umwelt - Die Physik macht s möglich B. Die Betriebsarten C. Die Wärmequelle
Die Wärmepumpe Unsere Antwort auf steigende Energiepreise Inhaltsübersicht A. Funktionsprinzip & Arbeitsweise: Wärme aus der Umwelt - Die Physik macht s möglich B. Die Betriebsarten C. Die Wärmequelle
Anergienetze und Wärmepumpen. Marco Nani
 Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
Anergienetze und Wärmepumpen Marco Nani Anergie aus Sicht der Heiztechnik Was ist Anergie? Als Anergie wird die von der Umgebung entnommene nicht nutzbare Wärme bezeichnet, welche mit elektrischer Energie
2.3 Energetische Bewertung von
 Seite 1 Die Norm DIN V 18599 entstand im Ergebnis der Arbeit eines gemeinsamen Arbeitsausschusses der DIN- Normenausschüsse Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik und Lichttechnik. Die Veröffentlichung der
Seite 1 Die Norm DIN V 18599 entstand im Ergebnis der Arbeit eines gemeinsamen Arbeitsausschusses der DIN- Normenausschüsse Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik und Lichttechnik. Die Veröffentlichung der
6. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 6. 1 Reversibel-isotherme Arbeitsprozesse 1. Hauptsatz für geschlossene Systeme
 6. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 6. 1 Reversibel-isotherme Arbeitsprozesse 1. Hauptsatz für geschlossene Systeme Für isotherme reversible Prozesse gilt und daher mit der
6. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 6. 1 Reversibel-isotherme Arbeitsprozesse 1. Hauptsatz für geschlossene Systeme Für isotherme reversible Prozesse gilt und daher mit der
Geothermienutzung im Neubau für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg
 Geothermienutzung im Neubau für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg Vortragender: Dr.-Ing. Uwe Römmling Freier Energieberater in Zusammenarbeit mit Schwerpunkte 1. Der Neubau der Behörde
Geothermienutzung im Neubau für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg Vortragender: Dr.-Ing. Uwe Römmling Freier Energieberater in Zusammenarbeit mit Schwerpunkte 1. Der Neubau der Behörde
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gültig bis: 08 / 2023 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche A N Erneuerbare
gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gültig bis: 08 / 2023 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche A N Erneuerbare
Mörlbach. - ist Ortsteil der Gemeinde Gallmersgarten
 Mörlbach - ist Ortsteil der Gemeinde Gallmersgarten - ein Dorf mit 150 Einwohnern - hat obwohl es nur ein kleines Dorf ist, nun im Umkreis die erste Hackschnitzelheizung dieser Größe Wo befindet sich die
Mörlbach - ist Ortsteil der Gemeinde Gallmersgarten - ein Dorf mit 150 Einwohnern - hat obwohl es nur ein kleines Dorf ist, nun im Umkreis die erste Hackschnitzelheizung dieser Größe Wo befindet sich die
Aktionskreis Energie. Energetische Sanierung aus Sicht des Eigentümers Wirtschaftliche Chance und Stolpersteine
 Aktionskreis Energie Energetische Sanierung aus Sicht des Eigentümers Wirtschaftliche Chance und Stolpersteine Sicht des Eigentümers Randbedingungen des Mietverhältnisses Bei der energetischen Modernisierung
Aktionskreis Energie Energetische Sanierung aus Sicht des Eigentümers Wirtschaftliche Chance und Stolpersteine Sicht des Eigentümers Randbedingungen des Mietverhältnisses Bei der energetischen Modernisierung
Dynamische exergetische Bewertungsverfahren
 Dynamische exergetische Bewertungsverfahren Dr.-Ing. Joachim Seifert Professur für Heiz- und Raumlufttechnik, TU Dresden Dipl.-Ing. Alexander Hoh EBC Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik Zielgrößen
Dynamische exergetische Bewertungsverfahren Dr.-Ing. Joachim Seifert Professur für Heiz- und Raumlufttechnik, TU Dresden Dipl.-Ing. Alexander Hoh EBC Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik Zielgrößen
Abwärme nutzen - Kosten sparen
 Abwärme nutzen - Kosten sparen Dipl. Ing. (FH) Helmut Krames Stellvertretender Bereichsleiter Energieeffizienz und erneuerbare Energien Saarbrücken 23. Januar 2013 Grundlagen I Was ist Abwärme? Ist der
Abwärme nutzen - Kosten sparen Dipl. Ing. (FH) Helmut Krames Stellvertretender Bereichsleiter Energieeffizienz und erneuerbare Energien Saarbrücken 23. Januar 2013 Grundlagen I Was ist Abwärme? Ist der
Biomasse betriebene Doppeleffekt Absorptionskältemaschine
 Biomasse betriebene Doppeleffekt Absorptionskältemaschine Themen Ausgangslage, Kriterien Projektdaten Anlagekomponenten Installierte Doppeleffekt Absorptionskältemaschinen Energiedaten Betriebs- und Unterhaltskosten
Biomasse betriebene Doppeleffekt Absorptionskältemaschine Themen Ausgangslage, Kriterien Projektdaten Anlagekomponenten Installierte Doppeleffekt Absorptionskältemaschinen Energiedaten Betriebs- und Unterhaltskosten
Ein neues Konzept zur energetischen Gebäudesanierung unter Verwendung von Infrarotheizungen und Photovoltaik
 Ein neues Konzept zur energetischen Gebäudesanierung unter Verwendung von Infrarotheizungen und Photovoltaik Vortrag auf der sportinfra 2014, Frankfurt am Main 13.11.2014 Dr.-Ing. Peter Kosack Technische
Ein neues Konzept zur energetischen Gebäudesanierung unter Verwendung von Infrarotheizungen und Photovoltaik Vortrag auf der sportinfra 2014, Frankfurt am Main 13.11.2014 Dr.-Ing. Peter Kosack Technische
Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG)
 Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten,
Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten,
saisonale Wärmespeicherung
 saisonale Wärmespeicherung Der Schlüssel zur Nutzung des wertvollen Überschusses an erneuerbarer Wärmeenergie S 1 cupasol GmbH S2 Vorstellung Robert Hegele, Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau kaufmännischer
saisonale Wärmespeicherung Der Schlüssel zur Nutzung des wertvollen Überschusses an erneuerbarer Wärmeenergie S 1 cupasol GmbH S2 Vorstellung Robert Hegele, Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau kaufmännischer
KWK-Impulsprogramm.NRW
 KWK-Impulsprogramm.NRW Potentiale und Einsatzmöglichkeiten Peter Lückerath, EnergieAgentur.NRW Folie 2 KWK-Impulsprogramm.NRW Autor: Peter Lückerath Was ist KWK? Folie 3 KWK-Impulsprogramm.NRW Autor: Peter
KWK-Impulsprogramm.NRW Potentiale und Einsatzmöglichkeiten Peter Lückerath, EnergieAgentur.NRW Folie 2 KWK-Impulsprogramm.NRW Autor: Peter Lückerath Was ist KWK? Folie 3 KWK-Impulsprogramm.NRW Autor: Peter
Integration einer Wärmepumpe zur gesteigerten Rauchgaskondensation Holzwärme Flachau
 Integration einer Wärmepumpe zur gesteigerten Rauchgaskondensation Holzwärme Flachau 10.04.2014 1. Leistungssteigerung 2. Reduktion des Ölverbrauches 3. Entscheidung Biomassekessel oder Wärmepumpe 4. Auslegung
Integration einer Wärmepumpe zur gesteigerten Rauchgaskondensation Holzwärme Flachau 10.04.2014 1. Leistungssteigerung 2. Reduktion des Ölverbrauches 3. Entscheidung Biomassekessel oder Wärmepumpe 4. Auslegung
Abwärmenutzung: Erfahrungsbericht aus einem Unternehmen. 16. August 2016, Schladen-Werda
 Abwärmenutzung: Erfahrungsbericht aus einem Unternehmen 16. August 2016, Schladen-Werda BS ENERGY Abwärme: Quellen, Nutzungsmöglichkeiten und Knackpunkte Abwärme im Braunschweiger Fernwärmenetz Konzept
Abwärmenutzung: Erfahrungsbericht aus einem Unternehmen 16. August 2016, Schladen-Werda BS ENERGY Abwärme: Quellen, Nutzungsmöglichkeiten und Knackpunkte Abwärme im Braunschweiger Fernwärmenetz Konzept
Fachveröffentlichung
 Fachveröffentlichung Luftkühler, Luftströmungen und Temperaturverteilung in großen Kühllagern Themenschwerpunkte: Große Kühllager: Große Dimensionen und automatische Lagertechnik stellen neue Anforderungen
Fachveröffentlichung Luftkühler, Luftströmungen und Temperaturverteilung in großen Kühllagern Themenschwerpunkte: Große Kühllager: Große Dimensionen und automatische Lagertechnik stellen neue Anforderungen
IBW ENERGIEMANAGEMENT Gebäudeenergieberatung
 Der Weg vom Altbau zum Energiesparhaus Ein Sanierungsbeispiel aus der Praxis von Dipl. Ing. Bernd Schütz Gebäudeenergieberater GIH Vorgehensweise : 1. Vor Ort Aufnahme der Gebäudesubstanz : Schäden Maße
Der Weg vom Altbau zum Energiesparhaus Ein Sanierungsbeispiel aus der Praxis von Dipl. Ing. Bernd Schütz Gebäudeenergieberater GIH Vorgehensweise : 1. Vor Ort Aufnahme der Gebäudesubstanz : Schäden Maße
Sinn oder Unsinn Lösungsansätze mit erneuerbaren Energien. Die Wärmepumpe im denkmalgeschützten Haus Heizung Lüftung Warmwasser - Photovoltaik
 Ingo Rausch Trainer Schulungsakademie Chemnitz 2.3.2015 Sinn oder Unsinn Lösungsansätze mit erneuerbaren Energien. Die Wärmepumpe im denkmalgeschützten Haus Heizung Lüftung Warmwasser - Photovoltaik Firmenzentrale:
Ingo Rausch Trainer Schulungsakademie Chemnitz 2.3.2015 Sinn oder Unsinn Lösungsansätze mit erneuerbaren Energien. Die Wärmepumpe im denkmalgeschützten Haus Heizung Lüftung Warmwasser - Photovoltaik Firmenzentrale:
Ganzheitliche Betrachtung bei der Klimatisierung! Geht das?
 Ganzheitliche Betrachtung bei der Klimatisierung! Geht das? Dr.-Ing. Jürgen Röben Menerga Apparatebau GmbH Mülheim an der Ruhr 18.03.2005 Meridiantermiten Schnitt durch einen Termitenhügel Geographische
Ganzheitliche Betrachtung bei der Klimatisierung! Geht das? Dr.-Ing. Jürgen Röben Menerga Apparatebau GmbH Mülheim an der Ruhr 18.03.2005 Meridiantermiten Schnitt durch einen Termitenhügel Geographische
Theorie. 1.1. Das Grundprinzip der Wärmegewinnung
 d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Das Grundprinzip der Wärmegewinnung Der Mensch als biologisches System empfindet naturgemäß eine Temperatur von rund 0 Celsius als eine angenehme Raumtemperatur. Höhere
d i e e n e r g i e f a m i l i e.. Das Grundprinzip der Wärmegewinnung Der Mensch als biologisches System empfindet naturgemäß eine Temperatur von rund 0 Celsius als eine angenehme Raumtemperatur. Höhere
Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkungen auf das Bauen mit Stahl
 Deutscher Stahlbau-Verband Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkungen auf das Bauen mit Stahl Ausarbeitung der RWTH Aachen Lehrstuhl für Stahlbau G. Sedlacek M. Kuhnhenne B. Döring Chr. Heinemeyer
Deutscher Stahlbau-Verband Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkungen auf das Bauen mit Stahl Ausarbeitung der RWTH Aachen Lehrstuhl für Stahlbau G. Sedlacek M. Kuhnhenne B. Döring Chr. Heinemeyer
Kühlung durch Wärme? Doch, das geht!
 Kühlung durch Wärme? Doch, das geht! (Ein)blick ins Rechenzentrum der SW Schönebeck. Kälte aus Kraft-Wärme-Kopplung für die IT-Infrastruktur DRZP in Darmstadt, 19./20.04.2016 Schönebeck an der Elbe, im
Kühlung durch Wärme? Doch, das geht! (Ein)blick ins Rechenzentrum der SW Schönebeck. Kälte aus Kraft-Wärme-Kopplung für die IT-Infrastruktur DRZP in Darmstadt, 19./20.04.2016 Schönebeck an der Elbe, im
Neu von Dimplex: Heizen und Kühlen mit einem System
 Neu von Dimplex: Heizen und Kühlen mit einem System f Innovative Toptechnik: Die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen von Dimplex, die auch kühlen können. f Kombinierte Regelung für Heizen und stilles oder dynamisches
Neu von Dimplex: Heizen und Kühlen mit einem System f Innovative Toptechnik: Die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen von Dimplex, die auch kühlen können. f Kombinierte Regelung für Heizen und stilles oder dynamisches
Cool2Heat basic (Mitte) als Bindeglied zwischen Kälte- und Gebäudeleittechnik
 KK - Die Kälte + Klimatechnik Ausgabe: 06-2015 MODUL ERSCHLIESST DIE ABWÄRME AUS DER KÄLTEERZEUGUNG EFFEKTIVER Kältetechnik spricht mit Gebäudeleittechnik Cool2Heat basic (Mitte) als Bindeglied zwischen
KK - Die Kälte + Klimatechnik Ausgabe: 06-2015 MODUL ERSCHLIESST DIE ABWÄRME AUS DER KÄLTEERZEUGUNG EFFEKTIVER Kältetechnik spricht mit Gebäudeleittechnik Cool2Heat basic (Mitte) als Bindeglied zwischen
Kälteerzeugung Technische Aspekte und Einsparpotentiale
 Kälteerzeugung Technische Aspekte und Einsparpotentiale Referent: Dipl. Ing. Steffen Roß Datum: 28. Oktober 2014, Mettmann Definition Kälte In der Physik und der Thermodynamik gibt es keine Kälte, sondern
Kälteerzeugung Technische Aspekte und Einsparpotentiale Referent: Dipl. Ing. Steffen Roß Datum: 28. Oktober 2014, Mettmann Definition Kälte In der Physik und der Thermodynamik gibt es keine Kälte, sondern
5. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 5.1 Reversibel-isotherme Arbeitsprozesse Energiebilanz für geschlossene Systeme
 5. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 5.1 Reversibel-isotherme Arbeitsprozesse Energiebilanz für geschlossene Systeme Für isotherme reversible Prozesse gilt und daher Dies
5. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 5.1 Reversibel-isotherme Arbeitsprozesse Energiebilanz für geschlossene Systeme Für isotherme reversible Prozesse gilt und daher Dies
BRÖTJE-Fachinformation. (Juli 1999) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen
 BRÖTJE-Fachinformation (Juli 1999) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Informationsblatt Nr. 12 Juli 1999 Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Die
BRÖTJE-Fachinformation (Juli 1999) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Informationsblatt Nr. 12 Juli 1999 Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Die
kg K dp p = R LuftT 1 ln p 2a =T 2a Q 12a = ṁq 12a = 45, 68 kw = 288, 15 K 12 0,4 Q 12b =0. Technische Arbeit nach dem Ersten Hauptsatz:
 Übung 9 Aufgabe 5.12: Kompression von Luft Durch einen Kolbenkompressor sollen ṁ = 800 kg Druckluft von p h 2 =12bar zur Verfügung gestellt werden. Der Zustand der angesaugten Außenluft beträgt p 1 =1,
Übung 9 Aufgabe 5.12: Kompression von Luft Durch einen Kolbenkompressor sollen ṁ = 800 kg Druckluft von p h 2 =12bar zur Verfügung gestellt werden. Der Zustand der angesaugten Außenluft beträgt p 1 =1,
Badhausstrasse 11a B B B
 BEZEICHNUNG WA Igls BT Süd Gebäude(-teil) Letzte Veränderung Badhausstrasse 11a Katastralgemeinde Igls 6080 Innsbruck-Igls KG-Nr. 910 m SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN
BEZEICHNUNG WA Igls BT Süd Gebäude(-teil) Letzte Veränderung Badhausstrasse 11a Katastralgemeinde Igls 6080 Innsbruck-Igls KG-Nr. 910 m SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN
EnEV Gesetzliche Forderungen im Bestand und der Energieausweis" Dipl. Ing. (FH) für Energetik Ulrich Kleemann Freiberuflicher Energieberater
 EnEV Gesetzliche Forderungen im Bestand und der Energieausweis" Dipl. Ing. (FH) für Energetik Ulrich Kleemann Freiberuflicher Energieberater Energieverbrauchsanteile für Industrienationen: mit über 1/3
EnEV Gesetzliche Forderungen im Bestand und der Energieausweis" Dipl. Ing. (FH) für Energetik Ulrich Kleemann Freiberuflicher Energieberater Energieverbrauchsanteile für Industrienationen: mit über 1/3
