ISSN Sauerland. Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes DEZEMBER 2013 / 4
|
|
|
- Irmgard Winkler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ISSN Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes Sauerland DEZEMBER 2013 / 4
2 Se n Sehnsuchts- S eh nsuc ns hn u jahre Wohn- und alltagskultur Der fünfziger jahre Ausstellung im Sauerland-Museum Alter Markt Arnsberg Telefon / Fax / sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de 2 9. S e p t e m b e r F e b r u a r Öffnungszeiten: Di Fr Uhr Sa Uhr So Uhr Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr bleibt das Museum geschlossen.
3 Sauerland 4/ Sauerland Nr. 4/Dezember 2014 Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes Aus dem Inhalt Einladung zum 1. Werkstattgespräch des SHB am Samstag, den 1. Februar 2014 von Uhr bis Uhr in der Akademie Biggesee in Attendorn, Ewiger Straße 7 Thema: Demografischer Wandel von der Analyse bis zur Bewältigung Dazu haben wir den Fachdienstleiter der Stabstelle Strukturförderung und Regionalentwicklung beim Hochsauerlandkreis, Herrn Franz-Josef Rickert und von der Dorfgemeinschaft des Bundesgolddorfes Niederhelden Herrn Johannes Jürgens gewinnen können. Mit ihnen ist verabredet jeweils ein Impulsreferat zu halten und danach im wahrsten Sinne des Wortes untereinander und mit den Referenten in s Gespräch zu kommen. Während Herr Rickert mehr für den Teil Analyse und regionale Betrachtungen auftreten kann, wird Herr Jürgens vom Dorfinnenentwicklungskonzept berichten, dass in Verbindung mit der Stadt Attendorn von der Dorfgemeinschaft erarbeitet wird und das den Anspruch hat, auch modellhafte Entwicklungen aufzuzeigen, die auf andere Dörfer im Sauerland evtl. übertragen werden können. Der Ablauf ist so vorgesehen, den 1. Teil von bis Uhr im Plenum anzubieten, danach werden wir eine Mittagsmahlzeit reichen, Gelegenheit geben für Gespräche untereinander und dann die Veranstaltung mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, Verabredungen zum weiteren Verfahren gegen Uhr ausklingen zu lassen. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber wir bitten Sie herzlich sich anzumelden, damit wir gemeinsam mit dem Haus eine funktionierende Tagungsorganisation hinbekommen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle bis zum 10. Jan per Mail an karin.kraft@hochsauerlandkreis.de oder telefonisch unter Ihr Elmar Reuter, 1. Vorsitzender Geschichte Kinder und Jugendliche in den Gemeinden der heutigen Stadt Sundern im Ersten Weltkrieg 148 Das Clemens-August-Wappen in Kloster Brunnen 166 Spuren alten Bergbaus bei Olsberg-Helmeringhausen 173 Neue bronzene Lanzenspitze aus dem Sauerland 175 Natur Landschaft Siedlung Der Eichholzfriedhof in Arnsberg 157 Sprache und Literatur Mitgliederversammlung am 31. Aug., aber Plattdeutsch 176 Leserbriefe 195 Religion und Glaube Ein altes Gebetbuch aus Attendorn 163 Mantelteilung als Symbol der Nächstenliebe 171 Olper Franziskanerinnen und Seligsprechung der Gründerin Mutter Theresia Bonzel 177 Weihnachten in St. Johannes Baptist Serkenrode 192 Heiliger Abend Heilige Nacht 193 Heimat Kultur Renovierung der Pfarrkirche in Schönholthausen erfolgreich abgeschlossen 168 Ofenkunst im Sauerland 182 Mein Vater August Klobes, Visionäres Projekt Lichtturm lockt 193 Wirtschaft Dr. Bernd Walters Ein Herz für die Wasserkraft 183 Der Windenergie die Flügel stutzen 187 Rezensionen Personalien Bücher Schrifttum 196 Personalien 198 Unser Titelbild zeigt den Eichholzfriedhof in Arnsberg. Das Foto stellte uns Wolfgang Becker zur Verfügung.
4 148 Sauerland 4/2013 Kinder und Jugendliche in den Gemeinden der heutigen Stadt Sundern im Ersten Weltkrieg von Werner Neuhaus Jeder, der an Pädagogik, Bildung und Erziehung interessiert ist, hat zumindest eine grobe Vorstellung von der fundamentalen Bedeutung, welche Kindheit und Jugend für die weitere Entwicklung jedes Menschen haben. Dabei geht es in unserem Zusammenhang nicht um die in der heutigen Diskussion im Zentrum stehenden Aspekte wie Spracherwerb, Intelligenz und formale Bildung, sondern eher um politische Überzeugungen, soziale Einstellungen und kulturelle Neigungen. Daher könnte es anlässlich der 100. Wiederkehr des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 interessant sein zu fragen, wie Kinder und Jugendliche im kölnischen Sauerland Aspekte dieses Krieges erlebt haben, wie er ihr Leben beeinflusste und sie prägte. Aus arbeitsökonomischen Gründen beschränke ich mich dabei räumlich auf Ortschaften der heutigen Stadt Sundern, wobei jedoch alles dafür spricht, dass der Weltkrieg als Erzieher 1 im Sauerland und darüber hinaus in weiten Teilen der deutschen Provinz ähnliche Wirkungen zeigte. 2 Insofern soll diese Untersuchung ausdrücklich dazu anregen, hier gemachte Beobachtungen mit Kriegsereignissen in anderen Kommunen des Sauerlandes und in weiteren ländlichen Regionen zu vergleichen. 1. Die Ausgangslage Wie im übrigen kölnischen Sauerland kann auch im Raum Sundern am Vorabend des Ersten Weltkrieges davon ausgegangen werden, dass der Kulturkampf zwischen katholischer Kirche und preußischem Staat nicht mehr wie dies im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen war das alles überragende Thema war. Natürlich war die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung noch immer katholisch, und die unter der Druckglocke des Kulturkampfes entstandene absolute Dominanz des katholischen Zentrums hatte sich bei allen Wahlen seit den 1870er Jahren bestätigt. Aber dieser politische Katholizismus hatte spätestens seit der Jahrhundertwende seinen Frieden mit der protestantischen preußischen Militärmonarchie und dem reichsdeutschen Nationalismus gemacht. 3 So konnte der Sunderner Unternehmer und Kaufmann Niemeyer im Jahre 1912 in einer Rede festhalten, dass in einer Zeit, wo die Sturmflut des Sozialismus die Wogen immer höher schnellen lässt, wo Kronen fallen und Throne wanken, der Katholizismus in Sundern in punkto vaterländischer Gesinnung seinen Mann stehe 4. In die gleiche Kerbe hieb das zentrumsnahe Arnsberger Central-Volksblatt im gleichen Jahr: Dass tatsächlich in Sundern noch Vaterlandsliebe und Königstreue herrscht, das hat die letzte Reichstagswahl gezeigt, bei der noch nicht mal eine einzige Stimme auf einen Sozialdemokraten fiel. 5 Daher prägten Katholizismus und Nationalismus das Milieu im Amt Sundern, und Schützen-, Gesang-, Musik-, Turn-, Handwerker- und Kriegervereine bestimmten das gesellschaftliche und kulturelle Leben, in welchem Liberalismus, Sozialismus und Pazifismus ohne Chancen waren. Auch die Jugendarbeit war weitgehend kirchlich geprägt. Vikar Franz Schiller leitete in Sundern die Borromäus-Bücherei, die Jünglingssodalität und die Marianische Jungfrauenkongregation, und auch in anderen Orten des Amtes standen Priester an der Spitze vieler weltlicher und kirchlicher Vereine. Außerdem waren die Pfarrer durch den preußischen Staat qua Amt mit der lokalen Schulaufsicht betraut. An den Schulen in den verschiedenen Ortschaften des Amtes unterrichteten ausschließlich katholische Lehrkräfte, wobei in mehrklassigen Schulen Lehrerinnen die Mädchenklassen unterrichteten, während die einklassigen Zwergschulen, in denen ein Lehrer alle Kinder der Klassen 1 bis 8 unterrichtete, in kleineren Orten wie Amecke, Brenschede, Enkhausen, Meinkenbracht, Stemel oder Weninghausen nach wie vor eine reine Männerdomäne waren. An allen Schulen wurden auf Weisung der vorgesetzten Dienstbehörden nationale Feiertage festlich begangen, wie einige von den jeweiligen Schulleitern verfasste >Schulchroniken< belegen. 6 So wurde in Hellefeld vor dem Ersten Weltkrieg in jedem Jahr der Kaisergeburtstag gefeiert, 1901 wurde feierlich des 200jährigen Jubiläums der Gründung des Königreichs Preußen gedacht, und ebenso wurden der 100. Todestag von Königin Luise sowie die 200. Wiederkehr des Geburtstages König Friedrichs II. festlich begangen. In jedem Jahr wurde am 2. September, dem Sedanstag, der Sieg über Frankreich im Jahre 1870 gefeiert und die Kinder auf die Bedeutung dieses denkwürdigen Tages hingewiesen. Es war schulfrei. 7 In Stemel, wo Lehrer Wilhelm Hauss seine Teilnahme an einer freiwilligen Militärübung im Sommer 1913 in die Schulchronik eintrug, fiel der Unterricht im Schuljahr 1913/14 an mehreren Schultagen nicht nur wegen der Kartoffelernte, sondern auch wegen der Gedenktage für die Völkerschlacht bei Leipzig sowie wegen der Geburtstagsfeier des Kaisers aus. 8 Ähnlich sah es in Langscheid aus, wo Lehrer Sies in der Schulchronik für 1896 festhielt: 9 Am 18. Januar, dem Tage der 25jährigen Wiederkehr der Errichtung des deutschen Reiches, wurde nach voraufgegangenem Gottesdienste in hiesiger Kapelle eine Schulfeier abgehalten. (...) Vaterländische Lieder u. Gedichte wurden vorgetragen. Die Feier endete mit einem Hoch auf unsere drei letzten deutschen Kaiser, auf die siegreiche Armee u. das geeinigte Deutschland. Am Abend fand unter Vorantritt der hiesigen Musikkapelle und einer zahlreichen Teilnehmerschaft ein ganz schöner Fackelzug statt. In derselben Weise wurde auch der 27. Januar, der Geburtstag Sr. Majestät, gefeiert. Zwar halten nicht alle Schulchroniken diese nationalistischen Feiern detailliert fest, aber es kann kein Zweifel sein, dass sie nach den Vorgaben des preußischen Schulministeriums 10 an allen Schulen im Raum Sundern mit Ansprachen, Gedichtrezitationen und patriotischen Liedern gefeiert wurden. In Langscheid wurden die Schulkinder sogar auf Kosten der Gemeindekasse zu einigen Kaisergeburtstagen und Krönungsjubiläen mit Kaffee und Kuchen bewirtet! 11 Da es dort noch keinen Kriegerverein gab, organisierte Lehrer Sies aus Anlass des 100jährigen Geburtstage(s) des Hochseligen Kaisers Wilhelm I. (...) eine gemütliche Zusammenkunft ehemaliger Soldaten Langscheids 12. Es steht also zu vermuten, dass Kinder und Jugendliche auch auf Grund des Unterrichts und des Beispiels mancher Dorfschulmeister eine positive Vorstellung von der preu-
5 Sauerland 4/ ßischen Monarchie, ihren Herrschern und deren siegesdeutsch angestrichenen (Jacob Burckhardt) Geschichte hatten, als im Sommer 1914 der Krieg ausbrach Der Kriegsausbruch Zwar wird die jahrzehntelang geltende Behauptung einer allumfassenden deutschen Kriegsbegeisterung im August 1914 seit einiger Zeit durch kritische Lokal- und Regionaluntersuchungen in Frage gestellt 14, aber insgesamt wird man auch heute noch für das Sauerland festhalten können, dass bei aller Besorgnis zunächst Zuversicht und teilweise patriotische Begeisterung vorherrschten. 15 Für Sundern schildert Hauptlehrer Heinrich Freisen das Augusterlebnis aus der Sicht eines national eingestellten preußischen Beamten: Die Mobilmachung wurde mit patriotischer Begeisterung aufgenommen. (...) Trupps von jungen Leuten und Gestellungspflichtigen durchzogen unter Hochs auf Kaiser und Vaterland und patriotischen Liedern die Straßen. Bei Versammlungen am Kriegerdenkmal und der Verabschiedung der Soldaten am Bahnhof spielten die Musikkapelle des Turnvereins und die zwei Jahre zuvor von Vikar Franz Schiller gegründete Kapelle des Jünglingsvereins patriotische Lieder und Marschmusik, Amtmann Reich, Fabrikant Scheffer-Hoppenhöfer und Vikar Rotthoff hielten die Abschiedsreden. 16 Ähnlich ging es auch in benachbarten Orten zu. In Hachen gestalteten die Krieger- und Schützenvereine eine patriotische Veranstaltung bei der Verabschiedung der eingezogenen Soldaten, und Lehrer Mische hielt zu diesem Anlass die Abschiedsrede an die scheidenden Krieger. 17 In den Quellen tauchen immer wieder Lokalpolitiker, Priester und Lehrer als Redner bei der Verabschiedung der Feldgrauen auf, so dass anzunehmen ist, dass sich in den kleinen Ortschaften des Sauerlandes diese sozialen Gruppen aus der dünnen Schicht der örtlichen Honoratioren in den ersten Kriegswochen als meinungsbildend herauskristallisierten. In Stemel feuerte der dortige Lehrer Wilhelm Hauss Gewehrschüsse ab, um die Einwohner des Ortes von der Mobilmachung zu unterrichten, die jedoch unterschiedlich reagierten 18 : Hauss notierte über den 1. August: Die Begeisterung für den Krieg hat an diesem Tag ihren Höhepunkt erreicht. (...) Die Jugend singt Deutschland, Deutschland, Es braust ein Ruf, Heil dir im Siegerkranz, Siegreich woll n wir Frankreich schlagen usw. Viele Frauen weinen. Diese geschlechtsspezifisch unterschiedliche Reaktionsweise scheint ebenfalls typisch für die damalige Zeit zu sein. 19 Während Frauen auch im öffentlichen Raum ihren Gefühlen, Ängsten und Sorgen durch Tränen Ausdruck verleihen konnten, war dies für junge Männer gerade in der damaligen Zeit undenkbar. Sie kannten den Krieg nur aus häufig heroisierenden Erzählungen von Veteranen im Schützen- und Kriegerverein und natürlich aus der Volksschule, auch wenn diese vor 1914 keine eindimensional auf militärischen Drill und Kriegsbejahung ausgerichtete Erziehung vermittelte. 20 Neben die Sorge um die Gefahr für Leib und Leben der zu den Fahnen gerufenen Väter, Männer, Verlobten und Brüder trat bei vielen Frauen auch die pragmatische Frage, wie die schwere körperliche Arbeit in Feld und Wald ohne Männer bewerkstelligt werden könnte. Diese zwiespältige Reaktion wird auch in der Schulchronik von Altenhellefeld deutlich. Viele Jugendliche zogen durch das Dorf und sangen das Lied Es braust ein Ruf wie Donnerhall (die Wacht am Rhein). Manche Jugendliche meldeten sich freiwillig zu den Waffen. Es wurde aber auch viele (Tränen aus) Trauer geweint von Müttern und von Ehefrauen. (...) Man merkte es im Dorfe, dass viele zu den Waffen geeilt waren. An manchem Tisch und hinter manchem Pflug fehlten die Leute. Hier bei uns war die Ernte kaum eingebracht. 21 Diese Gemengelage von mit Sorge gepaarter nationaler Ent- und Geschlossenheit, von Kriegsfurcht und Kampfbereitschaft (Christian Geinitz), scheint typisch für viele ländliche Gebiete im August 1914 gewesen zu sein Schulische Probleme Diese Probleme bekamen auch die Kinder zu spüren, die sich zunächst in allen Orten Preußens über die durch die stellvertretenden Militärbefehlshaber der jeweiligen Armeekorpsbezirke befohlenen schulfreien Tage unmittelbar nach Kriegsausbruch freuen durften. An manchen deutschen Schulen beteten die Kinder: Hilf uns Deutschen, lieber Gott, Gib uns Milch und Butterbrot. Doch der Feind im Schützengraben Soll von alledem nichts haben. Mach, daß unsre Truppen siegen, Daß wir wieder schulfrei kriegen. 23 In der Folgezeit waren es jedoch weniger nationale Begeisterung oder punktuelle Organisationsschwierigkeiten, die einen geordneten Unterricht verhinderten, sondern vor allen Dingen zwei strukturelle Probleme: Auch im Sauerland gab es im August 1914 Kriegsbegeisterung: Kriegsfreiwillige auf dem Arnsberger Neumarkt. Zum einen wurden bald viele >kriegstaugliche< jüngere Lehrer eingezogen und mussten in den Krieg ziehen. In Stemel notierte Lehrer Hauss mit einer Mischung aus Sorge und nationaler Pflichterfüllung: Die Kinder habe ich noch einmal zum Gebet ermahnt. Meine Einberufung wird wohl bald erfolgen. Mit Gott für Kaiser und Reich! 24 Tatsächlich wurde Hauss bald darauf einberufen, und die Stemeler Kinder mussten mehrere Wochen nach Hachen zur Schule gehen, bis die Lehrerinnen Berens, Laumann und Winterhoff jeweils für kurze Zeit die Vertretung übernahmen,
6 150 Sauerland 4/2013 bevor Hauss zum vom Kriegsdienst befreit wurde und wieder in Stemel unterrichtete. An fast allen Schulen musste improvisiert werden, da häufig nur pädagogisch unzulänglich qualifiziertes Lehrpersonal für den stark verkürzten Unterricht zur Verfügung stand. So berichtet die Stockumer Schulchronik davon, wie im ersten Schulhalbjahr 1915 die erste Klasse mit ihren 74 Kindern (...) durchgezogen wurde: 1. Stunde: Rechnen bzw. Geschichte: Herr Vikar Fleitmann, 2. u. 3. Std: Frl. Ebermann; letzte Stunde Herr Pfarrer Patrzek. Der Nachmittagsunterricht fiel aus. 25 In Allendorf musste Lehrer Kruse zunächst die 135 Allendorfer Kinder allein unterrichten, da Lehrer Wenniges gleich zu Beginn des Krieges eingezogen wurde und erst nach Kriegsende zurückkehrte. 26 Auch viele junge Lehrer ließen im Krieg ihr Leben. Der Allendorfer Lehrer Wenniges konnte sich glücklich schätzen, vergleichsweise glimpflich davon gekommen zu sein, aber dieses Glück war nicht allen Lehrern der verschiedenen Volksschulen im Raum Sundern beschieden: So starben während des Weltkrieges als Soldaten die Lehrer Schäfer (Sundern), Schmidt (Allendorf), Aufmkolk (Altenhellefeld), Sedler (Amecke), Zwingmann (Hagen) und Koch (Brenschede). Über den Letztgenannten heißt es in der Brenscheder Schulchronik: Am 10. April (1915) starb Herr Lehrer Koch den Tod fürs Vaterland. Er ruht in Frankreichs Erde. Das Bild von dem gefallenen Helden ist im Schulzimmer angebracht. 27 Diese massenhaften Einberufungen und der Tod vieler Lehrer hatten unter anderem die Folge, dass es immer wieder zu Unterrichtsausfall, Lehrerwechsel und langfristig zu einer starken Konzentration von Lehrerinnen als Lehrpersonal in den Volksschulen kam. Am deutlichsten lässt sich dieser Trend an der Johannesschule in Sundern fassen, über welche das Central- Volksblatt im Jahre 1915 berichtete, dass dort vor dem Krieg drei Lehrerinnen und vier Lehrer unterrichtet hätten, während im zweiten Kriegsjahr ein Hauptlehrer und sechs Lehrerinnen beschäftigt waren! 28 Ein zweites strukturelles Schulproblem wurde bereits bei den gerade erwähnten Lehrerwechseln angesprochen: der Unterrichtsausfall. Waren es zu Kriegsbeginn und im ersten Kriegsjahr noch nationale Begeisterung und psychologische Kriegsführung gewesen, welche bei Siegesmeldungen Schülern und Lehrerinnen einige freie Tage bescherten, 29 so wurden gerade auf dem Lande im Laufe des Krieges die Schulkinder immer stärker für Arbeiten in Haus und Feld benötigt. Zwar hatte es in der Landwirtschaft immer Kinderarbeit gegeben, und Schulbehörden und Lehrer mussten auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch tadelnd eingreifen, wenn Eltern ihre Kinder zu bestimmten besonders arbeitsintensiven Zeiten wie etwa der Heu- oder der Kartoffelernte vom Unterricht befreit haben wollten, aber diese Anträge auf Unterrichtsbefreiung nahmen im Laufe des Krieges stark zu, da viele arbeitsfähige Männer als Soldaten eingezogen waren und Frauen und die auch im Raum Sundern eingesetzten ausländischen Kriegsgefangenen die anfallenden Arbeiten nicht vollständig erledigen konnten. Alle Schulchroniken berichten von sich häufenden Anträgen auf Beurlaubungen der Kinder zu landwirtschaftlichen und häuslichen Arbeiten 30, je länger sich der Krieg hinzog. Besonders die älteren Jahrgänge der Jungenklassen waren hiervon betroffen, wie eine Eintragung aus Stockum aus dem Jahre 1915 zeigt: Im diesjährigen Sommerhalbjahr (hat) die Oberklasse nur Vormittags-Unterricht gehabt, um sich des Nachmittags in der Landwirtschaft nützlich zu machen. Auch im benachbarten Allendorf fiel in den Sommern 1915 und 1916 nachmittags der Unterricht für die Oberklasse aus. Dafür sollten die Kinder in der Landwirtschaft helfen. 32 Manchmal wurden aber auch die Ferien für die gesamte Schule teilweise um mehrere Wochen verlängert, etwa um die Kartoffelernte einzubringen. So hält der Stemeler Chronist fest: Im Jahre 1916 dauerten die Herbstferien neun Wochen. 33 Wegen des immer deutlicher spürbaren Arbeitskräftemangels wurde im Februar 1917 das Schulentlassungsalter in Preußen herabgesetzt, wie die Stockumer Schulchronik berichtet: Die königl. Regierung verfügt, dass 13 1/2 jährige Schulkinder sofort aus der Schule entlassen werden können, wenn sie den Anforderungen genügen und nachweisen, dass sie eine Beschäftigung finden, die im allg. Interesse liegt. 34 Da eine Beschäftigung in der Rüstungsindustrie oder Landwirtschaft selbstredend im allgemeinen d. h. in erster Linie staatlichen - Interesse lag, bedeutete dies eine weitere Verkürzung des Unterrichts für den Schulentlassungsjahrgang. Überhaupt fiel gegen Kriegsende immer mehr Unterricht aus. Im Winter 1916/17 kam es auch wegen einer allgemeinen Transportkrise zu einem reichsweiten Kohlemangel, der Industrie, Privathaushalte und öffentliche Gebäude in Mitleidenschaft zog, so dass an vielen Schulen die Weihnachtsferien verlängert wurden, da die Gebäude nicht geheizt werden konnten. Je nach Kohlevorräten wurden die Schulen wochen- oder monatelang nicht beheizt, wie über Stemel für das Jahr 1917 lakonisch berichtet wird: Im Januar und Februar war die Schule vier Wochen wegen Kohlenmangels geschlossen. 35 Noch drastischer machten sich die Demobilisierungsmaßnahmen im Herbst 1918 bemerkbar, als Hunderttausende von deutschen Soldaten von der Westfront heim ins Reich zurückkehrten und dabei mangels anderer geeigneter Unterkünfte auch in Schulen übernachteten, um an den folgenden Tagen weiter zu ziehen. So hielt z. B. die Stockumer Schulchronik fest: Der Unterricht fiel vom 28. Nov. bis zum 16. Dez. wegen Benutzung der Schule zur Einquartierung für die rückziehenden Truppen aus. 36 Ähnlich verhielt es sich in Sundern, Enkhausen, Hachen, Hellefeld und Meinkenbracht. Einen Sonderfall stellt die Schule in Westenfeld dar: Nachdem man mehr als 80 Jahre lang versucht hatte eine eigene Schule zu bekommen, war in den Jahren 1913/14 endlich die Schule in Westenfeld genehmigt und gebaut worden. Aber obwohl sie im September 1914 fertig gestellt worden war, wurde die Ingebrauchnahme der Schule bis zur Beendigung des Ersten Weltkrieges zurückgestellt. 37 Abschließend sei hier noch ein Aspekt erwähnt, der besonders auf das damals bereits hochindustrialisierte Sundern zutraf. Dort mussten viele Soldatenfrauen eine Arbeitsstelle z. B. in der Papierfabrik annehmen, da die staatliche finanzielle
7 Sauerland 4/ Unterstützung für den Lebensunterhalt der häufig vielköpfigen Familien nicht ausreichte, von der völlig unzulänglichen Witwen- und Waisenrente ganz zu schweigen. Dagegen mussten Frauen in den Dörfern häufig auch typische Männerarbeiten wie z. B. das körperlich sehr anstrengende Lohschälen in den Wäldern verrichten. 38 Hier mussten dann häufig ältere Geschwister für die jüngeren Kinder sorgen, während die Mütter versuchten, durch Arbeit in den Fabriken sowie in Feld und Wald das Geld für die im Verlauf des Krieges immer knapper und teurer werdenden Lebensmittel zu verdienen Kinderarbeit Nicht nur die Kinder von Bauern halfen auf den Höfen ihrer Eltern, sondern zu bestimmten Zeiten, etwa bei der Kartoffelernte, halfen auf dem Lande traditionell auch andere Kinder und verdienten sich etwas Taschengeld dazu. Durch eine ganze Reihe von Erlassen erlaubte die preußische Regierung den Schulen ausdrücklich, Kinder für landwirtschaftliche Tätigkeiten frei zu stellen, denn im Weltkrieg waren immer mehr Kinder gezwungen, nach dem häufig eingeschränkten Schulunterricht durch Arbeiten aller Art wie z. B. Ährenlesen sowie Buch eckern- oder Beerensammeln zur Ernährung ihrer Familien beizutragen. 40 Dabei wurden die hiesigen Wälder nicht nur von Einheimischen zu Sammelzwecken aufgesucht, so dass besonders gegen Kriegsende die Gemeinderäte von Endorf und Stockum sowie die Amtsverwaltung Sundern über das Central-Volksblatt darauf aufmerksam machten, dass nur Einheimischen das Beerensammeln erlaubt sei. 41 Wie stark der Andrang von auswärtigen Beerensammlern, von denen die meisten Frauen und Kinder waren, in den Wäldern des Sauerlandes im Sommer 1917 war, zeigt die Tatsache, dass vom Bahnhof Menden manchmal Sonderzüge eingesetzt wurden, um die an einigen Wochenendtagen etwa 1500 Beerensammler im Hönnetal Richtung Balve zu befördern. 42 Von dieser privaten Sammeltätigkeit von Schulkindern als Beitrag zur Ernährung ihrer Familien ist die Sammeltätigkeit während der Schulzeit zu unterscheiden, obwohl die Grenzen wie z. B. beim weiter unten geschilderten Sammeln von Laubheu manchmal fließend waren. Auch in Sundern mussten Frauen im Feld und in der Fabrik ihren Mann stehen. Fast alle Schulchroniken und viele Zeitungsartikel berichten übereinstimmend von zahlreichen Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit, mit welchen versucht wurde, angesichts der offensichtlich völlig unzureichenden staatlichen wirtschaftlichen Kriegsvorbereitungen die im Felde stehenden Soldaten sowie Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder den Malteserorden zu unterstützen, wodurch die Schüler ihre vaterländische Gesinnung bestätigten, wie Lehrer Michaelis in Weninghausen formulierte..43. Die Liste der Sammlungen und der Dinge, die gesammelt wurden, ist derartig umfangreich, dass nicht alle Aktivitäten von Schulkindern und deren Ergebnisse hier aufgeführt werden können, aber einige Schwerpunkte sollen kurz genannt werden. Wahrscheinlich sammelten an allen Schulen des Sauerlandes Kinder auch während der Schulzeit Bucheckern, Eicheln, Weißdornfrüchte, Kastanien, Obstkerne und Brennnesseln, 44 von denen erstere zur Ölgewinnung und letztere zur Herstellung von Verbandsstoff verwendet wurden. Offensichtlich wurden diese Aktivitäten als derartig kriegswichtig angesehen, dass die Behörden anordneten, diese Tätigkeiten im Kreis Arnsberg durch die Schulträger zu organisieren. 45 Weiterhin wurden überall Geld, Metallschrott, Textilien, Lumpen und Laub gesammelt. Über die letztgenannte Tätigkeit wird gegen Kriegsende aus Endorf berichtet: Im Frühling und Sommer zogen die Kinder unter Aufsicht des Lehrers in den Wald, um Laubheu zu sammeln. Die Kinder suchen außer während des Vormittags auch sehr viel nachmittags. Das Laub trockneten die Kinder selbst und lieferten es an einem bestimmten Tage in von der Firma Surmann- Hüsten gestellten Säcken ab. Für das Pfund Laubheu wurden 18 Pf(ennige) bezahlt. 5 Waggons Laubheu mit ca. 210 Zentnern konnten versandt werden. Daß das Laubsammeln für die Kinder recht lohnend war, mag daraus ersehen werden, dass 4 5 Kinder über 120 M(ark), jedes Kind durchschnittlich über 20 M. ausgezahlt erhielt. Das Laub soll, nachdem es gemahlen, mit Melasse durchsetzt und in Kuchenform gepreßt ist, als Pferdefutter verwandt werden. 46 Teilweise durften Kinder also Geld behalten, das sie etwa für die Arbeit in ihrer Freizeit beim Kartoffellesen oder Laubheusammeln bekamen. Allerdings empfahl der preußische Staat ihnen gleich einen Weg, wie das so verdiente Geld, sofern es nicht für den Lebensunterhalt der Familien absolut unabkömmlich war, angelegt werden konnte, wobei eine fünfprozentige Verzinsung versprochen wurde. Die Endorfer Schulchronik berichtet für das Jahr 1916: Nach Anordnung des Landrates bzw. Amtmanns wurden die Kinder auf die Bedeutung der 4ten Kriegsanleihe hingewiesen und ermuntert, ihre Ersparnisse dem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg war überraschend. Vom März 1916 wurden von 113 (Oberund Unterklasse) 1600 M. gezeichnet. (...) Bei der 5ten Kriegsanleihe zeichneten die Kinder wieder ca M. 47 Angesichts der Tatsache, dass auf Anweisung der preußischen Regierung die Lehrer die Zeichnung von Kriegsanleihen dringend empfahlen 48 in Hachen tat dies bei einer Versammlung des Volksvereins für das katholische Deutschland laut Zeitungsbericht sogar Pfarrer Schütte, ist es nicht weiter verwunderlich, dass in allen Schulen im Raum Sundern teilweise erstaunlich hohe Summen von Schulen für Kriegsanleihen ausgegeben wurden. Manchmal scheint sogar ein regelrechter Wettbewerb stattgefunden zu haben, welcher Ort die höchste Summe bei dieser patriotischen Pflichterfüllung aufbrachte, 50 zumal es an einigen Schulen einen Ausflug als Belohnung gab, wenn die Schülerinnen und
8 152 Sauerland 4/2013 Auf Gedenkblättern wurde die Sammeltätigkeit von Schulkindern gefordert und gelobt. Schüler eine besonders hohe Summe bei einer Kriegsanleihe gezeichnet hatten. 51 Dabei wurde z. B. an der Schule in Weninghausen das Kriegssparbuch vom Hellefelder Pfarrer aufbewahrt, und den Kindern und ihren Eltern wurde von den Lehrern versprochen: Zwei Jahre nach Friedensschluß wird das Geld mit Zinseszinsen zurückbezahlt. 53 In Wirklichkeit sollte es bis zum Jahre 1925 dauern, bis die Gelder im Verhältnis 1:40 zurückgezahlt wurden! Auch wenn Hunderte von Kindern der hiesigen Volksschulen bei den verschiedenen Kriegsanleihen für ihre Verhältnisse beträchtliche Summen spendeten, fiel dies kaum ins Gewicht im Vergleich zu den Summen, die etwa der Sunderner Unternehmer Johannes Scheffer-Hoppenhöfer, der allein im Herbst 1917 in einer für ihn typischen Mischung aus Patriotismus, Profitstreben und Publicity 1 Million Mark in die 7. Kriegsanleihe investierte und dies der Presse mitteilte, bei verschiedenen Anleihen zeichnete. Offensichtlich gingen die Geschäfte mit Verbandsmaterial aus Papier im Kriege glänzend! Kinder aller Schulformen wurden aufgefordert Kriegsanleihen zu finanzieren, und das Arnsberger Centrale Volksblatt druckte die an jeder Schule eingesammelte Summe ab. Schulkinder wurden weiterhin eingesetzt, um Feldfrüchte vor Schädlingen zu schützen. So sammelten z. B. die Schulkinder von Hachen im Herbst 1917 nach einem Zeitungsbericht etwa Maden von Kohlweißlingen! 54
9 Sauerland 4/ Schulkinder wurden auch in der Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Die einzige Art von Sammlung, die in den Schulen der heutigen Stadt Sundern nicht nachweisbar ist, waren so genannte Kriegsnagelungen, bei denen Nägel gegen einen geringen Betrag in angezeichnete Löcher in ein Brett geschlagen wurden, so dass sich ein bestimmtes Bild wie z. B. ein Adler oder ein Eisernes Kreuz ergab. Solche Nagelungen sind z. B. in Städten wie Arnsberg. Meschede und Brilon nachweisbar, waren aber auf den Dörfern des kölnischen Sauerlandes offensichtlich nicht so populär wie in den altpreußischen Gemeinden der Mark oder Minden-Ravensbergs. 55 Während diese Sammlungen von Geld, Laub und Waldfrüchten aller Art für Jungen und Mädchen gleichermaßen verbindlich waren, gab es einen Bereich, in dem nur Mädchen aktiv waren: Fast alle Schulchroniken berichten davon, dass Mädchen der Oberklassen, also die 12- bis 14-jährigen Schülerinnen, während und nach dem Unterricht Strümpfe, Leibbinden, Ohrwärmer und andere wärmende Textilien strickten, um die offensichtlich nur schlecht ausgestatteten Soldaten mit solchen Liebesgaben aus der Heimat zu beglücken. Häufig musste z. B. aus Anlass der >Reichswollwoche< 1915 sogar erst noch Geld gesammelt werden um davon Wolle zu kaufen, die dann u. a. während Unterrichts verstrickt wurde. 56 Letztendlich waren mit Fortdauer des Krieges auch auf dem Lande immer mehr Kinder direkt von Hunger bedroht, auch wenn dieser dort längst nicht ein solches Problem darstellte wie in den Städten. Im Dezember 1914 hielt der Lehrer von Stockum noch fest, dass bei der bodenständigen Bevölkerung der hiesigen Gemeinde alle landwirtschaftlichen Produkte reichlich vorhanden seien 57, aber dennoch wurden auch hier ab 1915 immer mehr Nahrungsmittel rationiert und man konnte diese nur noch gegen von den Behörden verteilte Marken erhalten. 58 Die Endorfer Schulchronik hielt fest: In vielen Häusern sah man die Kinder statt mit belegten Schinken- bzw. Wurstbutterbroten mit einer Pfanne oder Schüssel Kartoffeln bewaffnet. Damit war aber die Talsohle noch nicht erreicht, denn im >Steckrübenwinter< von 1916/17 lernten auch die Kinder im hiesigen Raum, dass Rüben zur Streckung der Kartoffeln nicht nur für das Vieh zum Verzehr geeignet waren, auch wenn sie von manchen Menschen nicht sonderlich geschätzt wurden, wie der Stockumer Lehrer etwas beschönigend hinzufügte. 60 Dennoch ging es gerade im Hinblick auf die Ernährung den Kindern auf dem Lande geradezu üppig, wenn man ihre Situation mit der katastrophalen Ernährungslage in den Großstädten vergleicht. Dies war auch der Hauptgrund, weshalb im Laufe des Krieges immer mehr Kinder auf s Land verschickt wurden, da sie dort wenn auch mehr schlecht als recht besser ernährt werden konnten. Die einklassige Zwergschule Meinkenbracht nahm z. B. in den Jahren 1917/18 dreizehn Kinder aus dem Ruhrgebiet auf, welche bei Vikar Schulte und den Landwirten des Dorfes untergebracht wurden und dort natürlich bei Arbeiten in Haus, Hof und Feld helfen mussten. 61 Trotz der im Vergleich zu den Städten besseren Versorgung mit Lebensmitteln wurden auch in den Orten des Sauerlandes die unter verstärktem Arbeitseinsatz, Unterernährung und psychischem Druck stehenden Schulkinder gegen Kriegsende häufig von einer >Spanische Grippe< genannten Epidemie heimgesucht, an welcher z. B. in Allendorf von den 138 Schulkindern über einhundert erkrankten. 62 Diese Epidemie wütete in den Jahren weltweit und kostete weit mehr Menschen das Leben als die Kampfhandlungen aller am Krieg beteiligten Mächte Jugendliche während des Krieges Während Hunger und Krankheiten Opfer von Menschen jedes Alters und Geschlechts verlangten, waren einige Kriegsfolgen geschlechtsspezifisch unterschiedlich. So waren von der überall bald nach Kriegsende wegen Lehrermangels erfolgten Schließung der >Landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen< nur männliche Jugendliche betroffen, da in diesen in einigen größeren Dörfern bestehenden Schulen nur etwa 14- bis 17-jährige Söhne von Handwerkern und Bauern unterrichtet wurden. 64 Dagegen wurden Textilarbeiten und Stricktätigkeiten aller Art nur von Schülerinnen oder den bereits aus der Schule entlassenen Mädchen, die der katholischen Marianischen Jungfrauenkongregation in Sundern angehörten, durchgeführt. Zusätzlich veranstalteten diese Theaterabende, von deren Erlös unseren tapferen Soldaten auf dem rauhen Kriegsfelde eine Weihnachtsfreude bereitet werden sollte 65, und kurze Zeit später gab der katholische Jünglingsverein Sundern im Saale der Frau Witwe Becker-Jostes hierselbst einen patriotischen Abend, dessen Erlös für unsere Krieger im Felde bestimmt war. 66 Während also patriotische Theaterstücke, Gedichtdeklamationen und Liederabende von jungen Leuten beiderlei Geschlechts durchgeführt wurden, lag die bei weitem größte Belastung, nämlich als Soldat Leib und Leben an der Front zu riskieren, allein auf den Männern. Bei einer Durchsicht der Listen der Gefallenen fällt auf, dass offensichtlich eine Reihe von jungen Männern, die noch nicht oder erst kurz vorher das Erwachsenenalter von damals 21 Jahren erreicht hatten, im Kriege ihr Leben ließen. Häufig waren dies gut ausgebildete Bürgersöhne, die sich in den ersten Kriegswochen aus nationaler
10 154 Sauerland 4/2013 Überzeugung freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatten und diesen Schritt mit dem Leben bezahlten. Dazu gehörten aus Sundern etwa der Schulamtsbewerber Joseph Freisen (20 Jahre) sowie die 21jährigen Studenten Franz Ulrich und Franz Schröder. Aus Allendorf fiel der 20jährige Lehramtskandidat Franz Schmidt gt. Richter und der Abiturient Hermann Peters, aus Hövel der 20jährige Gymnasiast Hermann Honert, aus Langscheid der Referendar August Oberste. Für die freiwillige Meldung zum Kriegsdienst war bei diesen jungen Männern neben einer nationalen Prägung durch das Elternhaus wahrscheinlich der teilweise chauvinistische Ton an den damaligen Gymnasien, Universitäten, Hochschulen und Lehrerseminaren verantwortlich. 67 Das wohl bekannteste Beispiel für einen solchen jungen Kriegsfreiwilligen aus dem hiesigen Raum ist der spätere Bundespräsident Heinrich Lübke, der auf dem Briloner Gymnasium Petrinum viele nationalistische Feiern erlebt hatte, in Bonn im 1. Semester der farbentragenden katholischen Studentenverbindung Ascania beigetreten war und sich Anfang August 1914 sofort als Freiwilliger gemeldet hatte. 68 Eine genauere Untersuchung würde sicherlich weitere Namen junger Freiwilliger mit höheren Bildungsabschlüssen zu Tage fördern, die auf dem Felde der Ehre blieben oder wie Lübke überlebten. von Kindern und Jugendlichen im Raum Sundern beeinflusst, geprägt und manchmal auch vorzeitig beendet hat. Sicherlich hat der kriegsbedingte Unterrichtsausfall die formale Bildung der Kinder negativ beeinträchtigt, aber wahrscheinlich haben die sozialen, physischen und psychischen Anforderungen eine größere Belastung für die Weltkriegskinder die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Weimarer Republik dargestellt. So hält Theo Simon noch im Jahre 1970 für das Kirchspiel Enkhausen fest, wie tief der Krieg gerade junge Menschen trotz Niederlage und Inflation geprägt hat: Trotz dieser Rückschläge war der Krieg das große Erlebnis der Jugend gewesen, und trotz der Niederlage, die man nicht wahrhaben wollte, zehrte man noch lange davon. Der Krieg war unerschöpfliches Gesprächsthema, und wenn man davon sprach, geschah es meistens stolz und selbstsicher. Das Bewusstsein, sich trotz der Niederlage, die man als Ungerechtigkeit empfand, bewährt zu haben, klang mit, und die Augen derer, die nicht dabei gewesen waren, leuchteten mit. 69 Gedankengut nicht nur in konservativnationalistischen Kreisen, sondern auch im katholischen und sozialistischen Lager und in den betreffenden Jugendverbänden dargestellt. 70 In den 1920er Jahren wurde in fast allen Vereinen Sunderns häufig mehrmals in einem Jahr der Toten des Krieges gedacht, wobei häufig Lehrer Willi Sommer eine herausragende Rolle spielte. In immer wiederkehrenden Variationen, eingebettet in patriotisch-militärische Gedicht- und Liedervorträge, sprach er bei der Enthüllung einer Gedenktafel des Kriegervereins Sundern, bei der Weihnachtsfeier des Turnvereins Sauerlandia und Totenehrungen des MGV Cäcilia über die Frontkämpfer im Schützengraben und die großen Entbehrungen und Heldentaten der gefallenen Mitglieder 71. Es kann nicht bezweifelt werden, dass dieser umtriebige Lehrer, der u. a. auch in der Theaterabteilung der Kolpingfamilie, im Festkomitee des Gesangvereins Sängerlust, im Ortsausschuss für Jugendpflege sowie in der Sauerlandia als Vertreter für die Jugendpflege aktiv war, tatkräftig versucht hat, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für völkisch-nationalistisches Gedankengut zu gewinnen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang hinzu zu fügen, dass im hiesigen Raum nicht nachweisbar ist, dass dieser Einsatz zu einer politischen Radikalisierung, die sich etwa in verstärktem Engagement junger Erwachsener bei antidemokratischen Kampfbünden oder rechtsradikalen Jugendorganisationen manifestieren konnte, geführt hätte. 72 Wahrscheinlich waren dazu das katholische Milieu und seine vielfältigen Verwurzelungen im Familien-, Schul-, Alltags- und Vereinsleben noch immer zu stark 73, zumal es dieses Milieu auch im Raum Sundern erlaubte, bei Festen oder aus Anlass von Gedenktagen wie dem Volkstrauertag den im Felde unbesiegten Helden für ihr Opfer für Volk und Vaterland an verschiedenen Kriegerehrenmalen zu danken. 74 Bei Abiturienten und jungen Akademikern waren Kriegsbegeisterung und Opferzahlen besonders hoch. 6. Schlussbetrachtung Wir haben anhand einer Reihe von Beispielen gesehen, wie scharf und mit der Dauer des Krieges immer stärker zunehmend der Erste Weltkrieg auch das Leben Konkret soll hier besonders eine Folge des Weltkrieges, die allerdings nicht nur für junge Menschen von Bedeutung war, angedeutet werden. In der neueren Kulturgeschichtsschreibung über die Weimarer Republik wird übereinstimmend der Totenkult, also die Erinnerungen an die auf dem Felde der Ehre gefallenen feldgrauen Helden, als Einfallstor für völkisch-nationales und revanchistisches Auch die weitaus meisten im Sauerland tätigen Lehrer, deren politische und soziokulturelle Heimat sich vor und im Krieg im national eingestellten Katholizismus befand, blieben in der Weimarer Zeit diesem Milieu treu. Am deutlichsten kommt dies in der Meinkenbrachter Schulchronik zum Ausdruck, die im Januar 1919 festhält: Der Wahlkampf hat begonnen. (...) Im Grunde gibt es, seitdem die sozialdemokratischen Machthaber einen neuen Kulturkampf angesagt haben, nur zwei Lager: ein gläubiges und ein glaubensloses. Am heutigen Tage wurde in der hiesigen Schule eine Zentrumsversammlung abgehalten. 75 In Hachen beklagte Lehrer Franz Mische,
11 Sauerland 4/ der nach dem Krieg den Vorsitz des dortigen Kriegervereins übernahm, dass dort bei der Wahl zur Nationalversammlung im Januar 1919 dem Zuge der Zeit entsprechend 28 Mann rot gewählt hätten. 76 Auch in Sundern unterzeichnete Lehrer Paul Zengerling Wahlaufrufe des Zentrums für die Kommunalwahl im März 1919, und Hauptlehrer Heinrich Freisen vertrat das Zentrum jahrelang im Gemeinderat. 77 Natürlich unterstützte auch der Sunderner Pfarrer Johannes Soer das Zentrum in jeder Beziehung, machte aber gleichzeitig nach den nationalsozialistischen Wahlerfolgen des Jahres 1930 namentlich unter den jugendlichen Wählern auf die Pflicht aufmerksam, unter der Jugend politische Aufklärung zu verbreiten. 78 Für nationalsozialistische, sozialistische oder pazifistische Gedanken war hier wie fast überall im Sauerland 79 weniger Platz als für einen wenn auch nicht radikalen Revisionismus, und diese Mentalität erwies sich spätestens ab 1933 wenn man von wenigen Ausnahmen absieht als unfähig zu Resistenz oder gar Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus. 01 Arndt Weinrich, Der Weltkrieg als Erzieher. Jugend zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus, Essen So zeigt bereits ein flüchtiger Blick in die Forschung zur Geschichte von deutschen Kindern und Jugendlichen während des Weltkrieges erhebliche Schnittmengen mit den hier vorgestellten Befunden: Eberhard Demm, Deutschlands Kinder im Ersten Weltkrieg: Zwischen Propaganda und Sozialfürsorge, in: Militärgeschichtliche Zeitschrift 60 (2001), S ; Andrew Donson, Youth in the Fatherless Land. War Pedagogy, Nationalism and Authority in Germany, , Cambridge Mass Vgl. Werner Neuhaus, Die Herausbildung eines katholisch-nationalistischen Milieus in Sundern im Kaiserreich , in: Sauerland Nr.4/2008, S , bes. S. 185ff. 04 Tremonia, Nr. 320, , II. Blatt. 05 Central-Volksblatt (=CV), Diese Schulchroniken (=SC), die leider nicht von allen Schulen erhalten sind, zählen zu den besten Quellen nicht nur für das Schulleben, sondern allgemein für die Sauerländer Lokalgeschichte im Ersten Weltkrieg: vgl. z. B. Bärbel Michels,... was ihren Diensteifer fürs Vaterland verrät. Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, dargestellt anhand von Kirchen- und Schulchroniken sowie persönlichen Aufzeichnungen, in: Jahrbuch Hochsauerlandkreis, 1996, S. 8-15; Werner Neuhaus, Sundern im Ersten Weltkrieg, in: Sunderner Heimatblätter, 17. Folge, 2009, S Die noch erhaltenen Schulchroniken befinden sich in aller Regel in den einzelnen Schularchiven oder im Stadtarchiv Sundern, für Hachen, Stemel und Amecke wird nach den jeweiligen Abdrucken zitiert. 07 Archiv der Gemeinschaftsschule Altes Testament, Hellefeld, Schul-Chronik der kath. Volksschule zu Hellefeld vom Jahr , zit. S. 47.; vgl. auch Archiv der St. Pankratius Grundschule Stockum, Schul-Chronik der kath. Volks-Schule zu Stockum, S Vgl. Hubert Wienecke, 725 Jahre Stemel, Balve 2011, S Schul-Chronik für die katholische Schule zu Langscheid, Typoskript o.o. o.j., S. 15 (Das Original liegt im Archiv der kath. Grundschule Langscheid) 10 Vgl. E. Demm, Deutschlands Kinder (wie Anm. 2), bes. S. 51 ff. 11 SC Langscheid, S. 17, Ebd., S Zum Nationalismus der Lehrer vor und bei Kriegsausbruch vgl. A. Donson, Youth (wie Anm. 2), S Vgl. die Übersicht bei Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4, München 2003, S sowie die dort in den Anm. 5 u. 6, S f. angegebene Literatur. 15 Vgl. die Beispiele bei Jürgen Schulte Hobein, Staat und Politik im kölnischen Sauerland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Harm Klueting, Jens Foken, Hg., Das Herzogtum Westfalen, Bd. 2, Teilband 1, Münster 2012, S , bes. S ; Johannes Bödger, Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 75 Jahren im Spiegel Marsberger Chroniken, in: Sauerland Nr. 3/1989, S. 84 f. 16 Archiv der Johannesschule Sundern, Schulchronik, S. 21 f. 17 CV 179, Vgl. auch die Darstellung der Siegeszuversicht und Begeisterung in den Mobilmachungstagen des August 1914 in Hachen durch Lehrer Mische in Theo Simon, Bearb., Chronik der Freiheit Hachen, Sundern 1955, S. 84 f. 18 Zit. nach Hubert Wienecke, 725 Jahre Stemel, S Vgl. z.b. die Darstellung der Reaktionen auf die Mobilmachung in Eversberg durch Lehrer Johann Hengesbach, abgedruckt bei Peter Bürger, Liäwensläup, Eslohe 2012, S. 797, Anm Ute Frevert, Die kasernierte Nation. Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland, München 2001, S Arbeitskreis 1100 Jahre Kirchspiel Altes Testament, Hg., 1100 Jahre Kirchspiel Altes Testament, Sundern 1985, S. 210.; vgl. auch SC Langscheid, S. 45f.; Stadtarchiv Sundern, 40.1/44, K. 453, Chronik Schule Weninghausen, von Lehrer Johannes Michaelis, S. 14, wo sowohl auf die patriotische Begeisterung als auch auf das gute Erntewetter hingewiesen wird, welches auch die Schüler zum Einbringen der Ernte nutzten. 22 Vgl. Benjamin Ziemann, Front und Heimat: ländliche Kriegserfahrungen im südlichen Bayern , Essen 1997, S ; Christian Geinitz, Kriegsfurcht und Kampfbereitschaft. Das Augusterlebnis in Freiburg. Eine Studie zum Kriegsbeginn, Essen Zit. nach E. Demm, Deutschlands Kinder (wie Anm. 2), S H. Wienecke, 725 Jahre Stemel, S SC Stockum, S. 103; vgl. auch Stadtarchiv Sundern B 40.1/90 I, Schulchronik der katholischen Volksschule zu Enkhausen. Begonnen am 31. März 1913 von Lehrer Albert Follmann, S. 6f. über vielfachen Lehrerwechsel und Unterrichtsausfall für die Kinder aus Hachen, Hövel und Enkhausen. Allgemein: A. Donson, Youth (wie Anm. 2), S. 70 f.; 129 ff. 26 Josef Keilig, Helmut Kukulenz, Christa Selter, Schulgeschichte(n), in: Fickeltünnes e.v., Hg., Allendorfer Lesebuch, Balve 2006, S , S Schularchiv Stockum, Chronik-Buch für Schule zu Brenschede, S CV 133, , S So wurde z.b. in der Schulchronik von Amecke festgehalten: Die Siege unserer verbündeten Armeen wurden durch Glockengeläute verkündet. Nachdem in der Schule eine kurze Siegesfeier gehalten worden war, fiel der Unterricht an dem betreffenden Tage aus : Hubert Schmidt, 800 Jahre Amecke, Sundern 1965, S Auch in Meinkenbracht gab es nach großen Siegen patriotische Lehrervorträge und vaterländische Gedichte und Lieder: Danach hatten die Kinder zu ihrer größten Freude siegesfrei. Stadtarchiv Sundern, B. 40.1/ K. 51: Schul-Chronik der kath. Volksschule Meinkenbracht, S SC Sundern, S. 144; SC Stockum, S. 157; H. Schmidt, Amecke, S. 155; 31 SC Stockum, S J. Keilig u.a., Schulgeschichte(n), (wie Anm. 26), S H. Wienecke, 725 Jahre Stemel, S. 119; vgl. H. Schmidt, Amecke, S. 155; 34 SC Stockum, S H. Wienecke, 725 Jahre Stemel, S. 119; Vgl. auch. SC Stockum, S Ebd.; vgl. SC Sundern, S. 29; SC Meinkenbracht, S. 20; SC Enkhausen, S Schul-Chronik der einklassigen Volks-Schule zu Westenfeld, Typoskript Westenfeld 1981, o.s. 38 Vgl. SC Endorf, S. 13; SC Weninghausen, S Vgl. allgemein zu diesen Entwicklungen A. Donson, Youth (wie Anm. 2), S. 133 f.; 140 ff. 40 Vgl. die Aufstellung dieser Erlasse bei Dr. Schapler, Dr. Groeteken, Hg., Kriegserlasse für die preußische Volksschule, Arnsberg o.j. (1918), S CV 170, , S. 3, wo auch auf die in den letzten Tagen vorgekommenen zahlreichen Felddiebstähle hingewiesen wird. 42 CV 157, , S SC Weninghausen, S Vgl. z.b. die Aufstellungen in SC Weninghausen, S. 129 f.; SC Enkhausen, S. 12; SC Langscheid, S Vgl. CV 170, , S SC Endorf, S. 22; weitere Beispiele für das Sammeln von Laubheu finden sich in: SC Sundern, S. 28 (164 Zentner); H. Schmidt, Amecke, S. 156 (85 Zentner); SC Meinkenbracht (45 Zentner); SC Weninghausen, S. 130 (55 Zentner). 47 SC Endorf, S. 2 f.; fast alle Schulchroniken berichten von Kriegsanleihen ihrer Schüler: vgl. SC Meinkenbracht, S ; SC Enkhausen, S. 12; SC Weninghausen, S. 129 f.; SC Langscheid, S. 53, 75, 81; SC Stockum, S Vgl. Schapler/Groeteken, Hg. Kriegserlasse (wie Anm. 40), S. 43 f. 49 CV 66, , S Vgl. die Übersicht über die von den Schulen der Ämter Hüsten und Sundern jeweils gezeichnete Summe für die 4., 5., 6. und 7. Kriegsanleihe in CV 76, , S. 3. Auch Pfarrer Schütte rief die Bewohner des Kirchspiels Enkhausen auf, bei der neuen Kriegsanleihe den Ruhm des Kirchspiels, bei den früheren Anleihen mit an der Spitze marschiert zu sein, zu bewahren : CV, 66, ) 51 SC Hellefeld, S. 51 ( ) 52 SC Weninghausen, S CV 241, , S CV 204, , S Vgl. Stefan Goebel, Kohle und Schwert. Zur Konstruktion der Heimatfront in Kriegswahrzeichen des Ruhrgebietes im Ersten Weltkrieg, in: Westfälische Forschungen 51/2001, S SC Meinkenbracht, S. 15; dort strickten neben den Schülerinnen auch die Jungfrauen und Frauen des Dorfes Wollsachen für unsere Krieger in den Schützengräben, nachdem die Marianische Jungfrauenkongregation des Ortes im Januar 1915 zwei Geldsammlungen durchgeführt und vom Erlös Wolle gekauft hatte; vgl. auch SC Stockum, S Diese Aktionen waren derartig umfassend, dass kritische Historikerinnen von einer Militarisierung des Handarbeitens im Ersten Weltkrieg (Christa Hämmerle) sprechen. 57 SC Stockum, S Vgl. allgemein zur immer unzulänglicher werdenden Lebensmittelversorgung Anne Roerkohl, Hungerblockade und Heimatfront. Die kommunale Lebensmittelversorgung in Westfalen während des Ersten Weltkrieges, Stuttgart SC Endorf, S. 21; ähnlich SC Weninghausen, S. 121 f. 60 SC Stockum, S. 12 f. 61 Archiv der Johannesschule Sundern, Gesamt-Schüler-Verzeichnis der einkl. Schule zu Meinkenbracht, o.s., Nr ; vgl. auch SC Stockum, S. 11; allgemein hierzu: A. Donson, Youth (wie Anm. 2), S. 144 ff.; E. Demm, Deutschlands Kinder (wie Anm. 2), S. 65 f. 62 J. Keilig u.a., Schulgeschichte(n), (wie Anm. 26), S. 379.
12 156 Sauerland 4/ SC Meinkenbracht, S. 22f.- Schon im November 1918 hatte der Verfasser beklagt, die Revolution habe in Deutschland eine sozialdemokratische Partei- und Klassenherrschaft errichtet : ebd., S T. Simon, Bearb., Hachen (wie Anm. 17), S Stadtarchiv Sundern, Stufe 2, Fach 17, Nr Archiv der Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist Sündern, Chronik der Pfarrei Sundern von , Eintragung Pfarrer Soers vom Hier ist etwa an den Briloner Linkskatholiken und Heimatforscher Josef Rüther zu denken, der bereits früh und konsequent einen pazifistischen Weg einschlug: vgl. Sigrid Blömeke, Nur Feiglinge weichen zurück. Josef Rüther ( ). Eine biographische Studie zur Geschichte des Linkskatholizismus, Brilon Weitere Hinweise auf das Auftreten dieser Grippe im Raum Sundern finden sich in SC Langscheid, S.105; SC Sundern, S. 28; SC Enkhausen, S Vgl. allgemein: Manfred Vasold, Die Spanische Grippe. Die Seuche und der Erste Weltkrieg, Darmstadt Vgl. für Hellefeld die Schulchronik der Ländlichen Fortbildungsschule Hellefeld, gegr. 1903, S. 178, wonach der Unterricht von 1914 bis 1920 ausfiel; vgl. auch die Schulchronik der Ländlichen Fortbildungsschule Endorf im Schularchiv Stockum. 65 CV 280, , S CV 297, 24, , Erstes Blatt, S Vgl. hierzu die Bemerkungen bei Konrad H. Jarausch, Deutsche Studenten , Frankfurt a. M. 1984, S ; A. Donson, Youth (wie Anm. 2), S. 87f. 68 Vgl. Rudolf Morsey, Heinrich Lübke. Eine politische Biographie, Paderborn u.a. 1996, S Theo Simon, Das Kirchspiel Enkhausen. Grundriss seiner Geschichte, Balve 1971, S Vgl. die jüngste Übersicht bei Arndt Weinrich, Der Weltkrieg (wie Anm. 1), bes. S Vgl. z.b. Protokollbuch für den Krieger-Verein Sundern, S. 70f.; Protokollbuch des Turnvereins Sauerlandia Sundern 1894, Bd. II, Weihnachtsfeier 1919; Protokollbuch MGV Cäcilia, Bd. II, S. 96f.; zu Sommers politischer Tätigkeit vgl. Berthold Schröder, Die Zeit des Nationalsozialismus ( ), in 700 Jahre Sundern Freiheit und Kirche e.v., Hg: 700 Jahre Sundern Freiheit und Kirche, Bd. 1, Sundern 2009, S , S. 216f. 72 So blieben z.b. die Bemühungen des späteren überzeugten Nationalsozialisten Willi Sommer, in Sundern in den 1920er Jahren eine Organisation des >Jungdeutschen Ordens< aufzubauen, ohne Erfolg: Vgl. allgemein dazu Werner Neuhaus, Der Jungdeutsche Orden als Kern der völkischen Bewegung im Raum Arnsberg in den Anfangsjahren der Weimarer Republik, in: Sauerland Nr. 1/2010, S Vgl. hierzu die Beiträge in Joachim Kuropka, Hg., Grenzen des katholischen Milieus. Stabilität und Gefährdung katholischer Milieus in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit, Münster Eine Untersuchung über die Hintergründe der Errichtung der teilweise gigantischen Kriegerehrenmale z.b. in Langscheid, Hachen oder Sundern steht noch aus. SÜDwestfalen oder SüdwestFALEN... oder doch nur Sauerland, Siegerland, Haarstrang? Ich behaupte, dass 99% aller Menschen, die hier wohnen, unüberlegt von SüdwestFALEN sprechen, wenn sie ihre wirtschaftsstarke Heimat nennen. Die Landräte/-in der fünf Landkreise haben mit Südwestfalen eine schöne Bezeichnung für die starke Wirtschaftsregion Sauerland, Siegerland und den Kreis Soest gefunden. Die Sprachmelodie dazu haben sie nicht mitgeliefert. Und was machen wir? Anstatt den Begriff wie gewünscht zu einer Marke zu machen, bleiben wir bescheidenen Südwestfalen auch im Sprachgebrauch unter unseren Möglichkeiten. Es wäre doch ein Leichtes und auch folgerichtig, wenn wir die Sprachmelodie bei Südwestfalen ein wenig zu unseren Gunsten ändern würden: Die Betonung der ersten Wortsilbe SÜDwestfalen grenzt unsere Heimat mit weltweit tätigen Unternehmen und tüchtigen Menschen ab z. B. gegen OSTwestfalen. Diese Menschen dort haben die richtige Sprachmelodie schon lange im Sprachgebrauch. OSTwestfalen kommt leicht über die Lippen und OWL ist ein Begriff für eine starke Region in NRW geworden. Und wir reden weiter von SüdwestFALEN und tun so, als ob uns der Süden in Westfalen gar nichts anginge. Landrat, Kreisdirektor, Abgeordneter, Lokalredakteur, Oberlehrer, Grundschule, Kindergarten... Beinahe alle zusammengesetzten Substantive werden auf der ersten Silbe betont. Warum nicht auch SÜDwestfalen? Jeder von uns braucht doch nur ein kleines Up-Date auf seiner Festplatte und schon würden wir mit tausend Zungen ein wenig Marketing für eine Region betreiben, die es verdient hat, in den Vordergrund gerückt zu werden. Wir alle können mit der richtigen Sprachmelodie für unsere Heimat unentgeltlich mehr tun als alle südwestfälischen Sterne zusammen. Anton Lübke, Sundern-Allendorf
13 Sauerland 4/ Dichtes Efeu bedeckt die Erde über den Gräbern, in denen die Toten seit vielen Jahren ruhen. Herbstsonne dringt durch das lichte Laub der alten Bäume. Friedhofsruhe. Nur fallende Kastanien zerreißen hin und wieder die Stille. Ein Tor führt durch eine hohe Hecke an der Straßenseite auf den Eichholzfriedhof in Arnsberg. Die Grabreihen sind stufenförmig angelegt. Seit 1807 befindet sich die Begräbnisstätte an dieser Stelle. Zuvor wurden die Toten in unmittelbarer Nähe am Kloster Wedinghausen beigesetzt. Als Kurköln nach der Säkularisation 1803 in hessischen Besitz gelangt war, ordneten die Behörden aus gesundheitspolizeilichen Gründen die Verlegung des Ehrenmal für die Gefallenen der Kriege zwischen 1864 und 1871 Der Eichholzfriedhof in Arnsberg von Theo Hirnstein Alle Fotos: Wolfgang Becker Friedhofs an. Er wurde mehrfach, zuletzt 1938/39, erweitert und in 1950er Jahren nach der Anlegung des Waldfriedhofs an der Sunderner Straße geschlossen. Wohl nirgendwo im Sauerland sind stumme Grabsteine so beredte Zeugen kunstgeschichtlicher Entwicklungen und wohl nirgendwo anders haben ganz normale Bürgern so viele bedeutsame und illustre Zeitgenossen ihre letzte Ruhestätte gefunden, wie etwa der Geheime Regierungsrat Friedrich Freiherr von Blomberg ( ) oder der Sanitätsrat und Kreisphysikus Dr. Eduard Liese. Dort liegen auch der Sparkassenrendant Theodor Wurm nebst Ehefrau, der Fuhrunternehmer Heinrich Schäfer ( ) und der Eisenbahn-Oberinspektor Franz Henke. Auch die Dichterin Johanna Baltz ( ) wurde auf dem Eichholzfriedhof bestattet. Nebeneinander liegen die Gräber des Landforstmeisters Hermann Euler und des in Arnsberg noch heute hoch angesehenen Bürgermeisters Max Löcke ( ) und dessen Frau Toni geb. Letterhans.
14 158 Sauerland 4/2013 Zwischen den Grabreihen immer wieder Rasenfelder. Hier mögen sich einmal Gräber befunden haben. Manchmal liegen auch nur uralte Grabsteine da. Moos hat sich darauf ausgebreitet, die eingemeißelten Namen sind kaum oder gar nicht mehr zu lesen. Auf Steinen über gepflegten Gräbern finden sich auch die Namen uralter Arnsberger Familien: Beleke, Risse, Menge, Kämper, Edel - broich, Neuhaus, Pieper, Stemmer, Becker. In der Mitte des Friedhofs steht seit etlichen Jahren das alte Ehrenmal für die Gefallenen der Kriege zwischen 1864 und 1871, das früher seinen Platz auf dem Neumarkt hatte. Auch Teile des Ehrenmals für die Opfer der Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert, ehedem auf dem Schlossberg, wurde auf den Eichholzfriedhof versetzt, wo auch sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter bestattet worden sind. Vorbei führt der Weg an den Grabstätten auch über die Stadt hinaus bekannter Männer, die Leben und Beruf nach Arnsberg geführt hatten: Johann Graf von Flämming ( ), Christian Fürst zu Hohenlohe-Bartenstein ( ), Ignatz Pieler ( ) oder Johann Nikolaus Emmerich ( ). Hier ruht Prof. Dr. theol. Peter Hake ( ), Religionslehrer am Gymnasium zu Arnsberg steht zu lesen. Engelbert und J. S. Seibertz liegen ebenfalls hier, Historienmaler der eine, Dr. jur. und Dr. phil. der andere, zudem Nestor der westfälischen Historiographie. Der Landpfennigmeister Carl Harbert ( ) hat hier seinerzeit sein Grab gefunden.
15 Sauerland 4/ Das Grab von Prof. Karl Feaux de Lacroix, einer der wichtigsten Männer westfälischer und Arnsberger Geschichtsschreibung, befindet ich auf dem Eichholzfriedhof, ebenso die Ruhestätte des Königlichen Gymnasialdirektors Dr. Franz- Joseph Scherer, geboren 1835 zu Olpe. Darunter auf dem Stein Zeugnisse schwerer Schicksalsschläge: In fremder Erde ruhen Wilhelm Scherer, 1866, gefallen 1914 in Flandern; Jos. Scherer, Kaufmann, Leutnant d. R., geb. 1875, gefallen 1918 in der Ukraine; Der Enkel Fr. Jos. Scherer, Fahnenjunker, geb. 1899, gefallen am 11. Mai 1917 in der Champagne. Ganz unten auf dem Friedhof, an der Böschung zum Mühlengraben hin, steht der Grabstein des Kaiserlichen Bergrats Hermann von Skal. Geboren am 12. April 1858 in Tarnowitz/Schlesien, gestorben am 29. September 1926 in Arnsberg/W. Vormals langjähriger Geschäftsführer des Vereins für die bergbaulichen Interessen Elsass-Lothringens in Metz, bis der unglückliche Ausgang des Krieges ihn aus seiner zweiten Heimat vertrieb. Unbeugsame Kraft, Siegerwille und Pflichttreue bis zum letzten Atemzug widmete er alsdann dem dankbaren Arbeitgeberverein für das südöstliche Westfalen in Arnsberg.
16 160 Sauerland 4/2013
17 Sauerland 4/ Der Eichholzfriedhof im Herbst. Zeitzeuge. Geschichtenerzähler, Parkanlage und Ort der Besinnung zugleich. Der Wind wirbelt ein Blatt durch die Luft und lässt es zu Boden gleiten Symbol der Vergänglichkeit. Wie alles hier.
18 162 Sauerland 4/2013 Mitglieder des Arnsberger SKT, des Seniorenkompetenzteams oder der sogenannten Seniortrainer haben ein neues Projekt in Arnsberg angestoßen und dafür auch weitere Bürger zur Mitarbeit gewonnen. Das Projekt betrifft den Arnsberger Eichholzfriedhof, diesen besonderen Ort der Ruhe, Meditation, des Gedenkens und der Ehrung der Toten und nicht zuletzt einen Ort als Kulturdenkmal, an dem sich die Geschichte der Stadt im 19. und 20. Jahrhundert manifestiert. Der Aufgabenbereich wird vielfältig sein: wie die Auflistung von Erhalt-, Sanierungs- und Pflegearbeiten und deren Durchführung sowie die Konzeptentwicklungen und Planungen für die Zukunft und Photodokumentationen. Geplant sind des Weiteren auch Arbeiten zur Erkundung und Erforschung der Biographien der dort Begrabenen und ihrer Familien und die Erstellung einer Dokumentation und Broschüre darüber und anderes mehr. Anlass der ehrenamtlichen Initiative war und ist die Tatsache, dass die Stadt Arnsberg personell und finanziell nicht mehr in der Lage ist, diesen Friedhof auf Dauer so zu erhalten, wie er jetzt ist, und es unklar ist, wie er in einigen Jahrzehnten gestaltet sein wird und ob er dann überhaupt erhalten bleibt. Mit den zuständigen städtischen Behörden ist das Projekt erörtert und Zusammenarbeit vereinbart worden. Die jetzigen Teilnehmer wären erfreut über weitere Interessenten, denen die Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen dieses Projektes eine Herzensangelegenheit sein könnte, besonders auch um es salopp auszudrücken über handfeste, arbeitsfreudige und in praktischen Tätigkeiten nicht gerade ungeschickte Mitbürger. Alle Interessierten können sich melden bei der Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg Tel oder Norbert Baumeister Tel oder Friedhelm Frohn Tel Zurzeit sind an dem ehrenamtlichen Projekt ca. 15 Personen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen beteiligt wie der handwerklichen Tätigkeit, Photodokumentationen, historisch-biographischen Arbeiten, Einwerben von Spenden und Sponsorengeldern und jetzt bald auch Führungen über den Friedhof. Für die praktische Arbeit und die Biographiearbeit könnten noch weitere Teilnehmer hinzustoßen. Die Arbeiten auf den Friedhof beinhalten Freischneiden, Auffinden und Aufrichten von Grabsteinen, Herrichten neuer Fundamente und Sockel, Entrosten und Pflege und Schweißen von Gittern und Geländern, Pflege und einfache Bepflanzungen von verwilderten Gräbern und Erneuerung von Inschriften. Bei Sanierungen, die schweres Gerät oder besondere Fachkenntnisse erfordern, ergehen Aufträge an heimische Firmen. Besonders aber auch für Arbeitsmaterialen benötigen wir Spenden, die über die Stadt Arnsberg, Konto-Nr. 26 bei der Sparkasse Arnsberg-Sundern, BLZ , Verwendungszweck: Amt für Engagementförderung, Projekt Eichholzfriedhof laufen und damit auch steuerlich anerkannt werden können. Norbert Baumeister
19 Sauerland 4/ Das Himmlisch Palm-Gärtlein des rheinischen Jesuiten Wilhelm Nakatenus ( ) ist im ehemals kölnischen Sauerland nichts Besonderes. Es war vom Barock bis ins 19. Jahrhundert das am weitesten verbreitete Gebetbuch und ist noch heute allenthalben in einschlägigen Bibliotheken und Sammlungen zu finden. Kurt Küppers hat in seinen Untersuchungen zu Ausgaben, Ein altes Gebetbuch aus Attendorn Hier soll nun ein Exemplar vorgestellt werden, welches im Jahre 1764 durch Franz Wilhelm Joseph Metternich in Köln verlegt und zwei Jahre später, Anno 1766 den 5ten Martii, durch die ursprüngliche Eigentümerin Maria Teresia Ackerscheit von Bremicke (Attendorn-Bremge) erworben wurde. Es befindet sich noch ganz im Zustand des 18. Jahrhunderts in altem Familienbesitz. Der reich ausgestattete dunkle Lederband ist außer den in Silber gefassten Kanten mit prachtvollen Schließen versehen. Diese sind als vier große und zwei kleinere silberne Doppeladler gestaltet und verweisen damit auf die seit 1475 freie Reichsstadt Köln als Herkunftsort. Da es das Palmgärtlein in vielen verschiedenen, unterschiedlich aufwendigen Ausführungen gab, muss man annehmen, dass die erste Erwerberin eine besondere Beziehung zu Köln hatte. Dies zeigt sich auch an einem anderen Ausstattungsdetail des Buches, das neben dem ganzseitigen Titelkupfer acht halbseitige Kupferstiche zu einzelnen Texten enthält und darüber hinaus angereichert als Geschichtsquelle für das ehemals kurkölnische Sauerland von Werner F. Cordes Inhalt und Verbreitung eines katholischen Gebetbuchs der Barockzeit 1 nachgewiesen, dass das Werk im Laufe von 300 Jahren seit der ersten Ausgabe im Jahre 1662 etwa 670 Editionen erlebt hat. Unter dem Titel Coeleste Palmetum erschien es auch als Übersetzung ins Lateinische und wurde in weitere Sprachen übertragen. Die wichtigsten Verlagsorte waren Köln und mit einigem Abstand Antwerpen. Zuerst in Köln gedruckt, erfuhr das Buch während seiner langen Erscheinungsdauer nach den Feststellungen von Küppers 2 nur geringfügige Ergänzungen und Änderungen. Inhaltlich bietet es dem Leser ein umfangreiches Angebot an Gebeten und Betrachtungen für alle Tageszeiten und Gelegenheiten im Laufe des Jahres. Es wendet sich in verständlicher Sprache auch an einfache Menschen. 3 Darin liegt wohl der Grund für die Beliebtheit über einen ungewöhnlich ausgedehnten Zeitraum. In einem umfassenden Sinn diente es der persönlichen Frömmigkeit, indem es eine Verbindung herstellte zwischen der Liturgie der Kirche, der Bibel und dem Katechismus mit seinen Vorschriften und Informationen, und war somit geeignet, den Gläubigen ein ganzes Leben lang zu begleiten. Einband (17,5 x 11 cm) Alle Fotos: Reiner Potyka wurde durch teilweise kostbare, lose eingelegte Andachtsbildchen, welche besonders aufschlussreich sind für die Verbindung zum Leben in der Stadt Köln mit ihren zahlreichen Kirchen und den dortigen religiösen Bräuchen.
20 164 Sauerland 4/2013 Bild- und Worttitel S. Nicolaus (Pergament 13,8 x 8,5 cm) Auch auf den Herkunftsort der Eigentümerin gibt es einen wichtigen Hinweis. Zu den kunstvollen Gouachen, die in das Buch eingelegt sind, gehört auch ein Blatt mit dem heiligen Nikolaus. Die Kapelle in Bremge ist diesem Heiligen geweiht und liegt an einem Wege, der von Förde (Lennestadt) mit Nikolauspatrozinium der dortigen Kirche und St. Claas, das seine Nikolausbeziehung schon im Namen verrät, über Helden ins heute überflutete Biggetal führte. Albert Hömberg stellt 1951 in einem Aufsatz über Grundlagen und Entwicklung der mittelalterlichen Landesorganisation im Gebiet des heutigen Kreises Olpe 4 fest, dass Nikolauspatrozinien auf die Nähe alter Landstraßen hinweisen. S. Jacobus (Pergament 13,7 x 8,5 cm)
21 Sauerland 4/ Ein weiteres gemaltes Bildchen zeigt St. Jakobus den Älteren und deutet das Motiv des Pilgerns an. Das Blatt gibt einen Einblick in die künstlerischen Verflechtungen der Barockzeit in Bild und Wort. Ein Ziel für den Pilgerweg von Bremge aus wird deutlich durch eine auf gelber Seide gedruckte Darstellung der Heiligen Drei Könige und des Dreikönigsmausoleums im Kölner Dom, worunter der Spruch zu lesen ist: SS 3 Reges Caspar Melchior Balthasar orate pro nobis nunc et in hora mortis (Heilige Drei Könige Caspar Melchior Balthasar bittet für uns jetzt, und in der Stunde des Todes) 5. Das hier anklingende Thema der Todesangst stellt die Verbindung her zu einer Gouache des heiligen Benedikt. Das ungleich beschnittene Papierblatt ist eine originale Wasserfarbenmalerei, in der sich die Vorzeichnung noch teilweise erkennen lässt. Die Benedictus-Verehrung war in Köln, besonders aber in Deutz, wo die Pilger aus dem kurkölnischen Sauerland ankamen, lebendig. Seit 1823 gab es an der Kirche St. Heribert eine Bruderschaft vom guten Tode unter dem Schutze und der Fürbitte des heiligen Benedictus, sonderbaren (besonderen) Patronen der Sterbenden, die sich auf eine ältere Tradition berief. 6 Die Kurzgefasste Lebensbeschreibung des heiligen Benedictus im Bruderschafts- Büchelchen zum Gebrauch der Deutzer Bürgersodalität berichtet:... wegen der merkwürdigen Begebenheiten, welche den Tod des heiligen Benedictus verherrlichten, haben sich schon vor langer Zeit an mehreren Orten die Christgläubigen unter dem Namen Benedictus-Bruderschaft vereiniget, um durch die mächtige Fürsprache dieses Heiligen eine selige Sterbestunde zu erhalten. 7 Für zwei weitere in das Gebetbuch eingelegte Andachtsbildchen mit der heiligen Katharina (von Alexandrien) und dem heiligen Laurentius lässt sich ein unmittelbarer Dreikönigsandenken auf gelber Seide (8,3 x 6,5 cm) S. Benedictus (Papier 13,4 x 8,5 cm) Bezug zu Köln erkennen. So gibt es heute noch die Straßennamen An St. Katharinen und Laurenzgittergäßchen. 8 Eine Specification deren Kirchen, in welchen außer den 40stündigen Gebeths- Tägen das Venerabile (Monstranz) zur Mittags-Zeit ausgestellt bleibet, und der hundert-tägiger Ablaß, auch zum Trost der armen Seelen im Fegfeuer zu verdienen ist 9, nennt neben dem Dom auch die Pfarrkirche St. Laurenz und die St. Catharinae-Kirche auf der Severinstraße. Der genannte Ablass wurde 1729 von Rom verliehen und durch den damaligen Kölner Generalvikar Johann Arnold de Reux publiziert. 10 Weitere Bildeinlagen beziehen sich hauptsächlich auf die Christus- und Marienverehrung und sollen hier mit einer Ausnahme nicht näher behandelt werden. Ein Augsburger Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert mit dem Titel Jesus cor ornans (Jesus schmückt das Herz) ist jedoch besonders aufschlussreich. Er ist aus einem Gebet- oder Betrachtungsbuch entnommen und trägt die Nummer 12 als Teil einer Bildfolge. Wahrscheinlich war er das Vorbild des Kölner Graphikers Peter Overradt für den Kupferstich Nr. 15 im Hertzen-Spiegel, einem emblematischen Gebetbuch, das 1632 ohne Verfasserangabe ( eine der Societet Jesu wolmeinde Geistliche Ordens Person ) in Paderborn gedruckt wurde. Anmerkungen 1 Kurt Küppers, Nakatenus, Wilhelm, in: Lexikon f. Theologie u. Kirche, Freiburg 2009, 7. Bd, Sp Kurt Küppers, Das Himmlisch Palm-Gärtlein des Wilhelm Nakatenus SJ ( ), Regensburg 1981, S Kurt Küppers (wie Anm. 2), S Albert K. Hömberg, Grundlagen und Entwicklung der mittelalterlichen Landesorganisation im Gebiet des heutigen Kreises Olpe, in: Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe, 8. Folge, 1951, S. 469, Anm Vgl. dazu: Die Heiligen Drei Könige (Ausstellungskatalog), Köln 1982, S. 282, Nr. 277 u. S. 284, Nr. 285 u Bruderschafts-Büchelchen zum Gebrauch der Deuzer Bürger Sodalität, Köln 1803, darin: Bruderschaft vom guten Tode unter dem Schutze und der Fürbitte des heiligen Benedictus, sonderbaren Patronen der Sterbenden, S Wie Anmerkung 6, S Helmut Signon, Alle Straßen führen durch Köln, 2. Auflage Köln 1982, S. 54 u Ohne 0. u. J. und ohne Paginierung angebunden an: Kurzes Gebeth- und Gesangbüchlein, bei dem in der H. Stadt Köln am Rhein, wie auch durch das ganze kurkölnische hohe Erzstift uralt gewöhnlichen vierzigstündigen Gebeth zu gebrauchen, Köln Als Einzelblatt beigebunden, wie unter Anm. 9. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15. Februar 2014
22 166 Sauerland 4/2013 In den Ordensregeln der Kapuziner heißt es 1644: Unsere Kirchen sollen klein und arm, aber andächtig und zum saubersten sein. Daran hielten sich auch die Jünger des Hl. Franziskus im Kloster am Brenscheder Brunnen, als sie von 1742 bis 1748 ihre Kirche bauten. Als es zur Errichtung des prächtigen Hochaltars kam, war es allerdings mit der kapuzinischen Bescheidenheit vorbei. Clemens August von Bayern ( ), Erzbischof und Kurfürst von Köln und damit Landesherr im kurkölnischen Sauerland, der große Förderer der Kapuziner, hatte schon einen tüchtigen Zuschuss für den Rohbau der Klosterkirche gegeben. Um sein Repräsentationsbedürfnis als barocker Länderfürst zu befriedigen, griff er noch einmal tief in Das Clemens- August-Wappen in Kloster Brunnen Wie der Arnsberger Adler auf die Insel Mainau im Bodensee kam von Klaus Baulmann Festliches Wappen des Kölner Kurfürst-Erzbischofs Clemens August von Bayern ( ) am Hochaltar der ehemaligen Kapuzinerkirche von 1748 in Sundern-Kloster Brunnen Fotos: Jochen Ottersbach Friedrich Barbarossa ernannte 1180 nach der Entmachtung Heinrich des Löwen den Erzbischof von Köln zum Herzog von Westfalen und Engern. Ein wenig vom Deutschordens-Adler verdeckt erscheint der weiße bzw. silberne Arnsberger Adler auf blauem Grund. Es ist der Adler der Grafschaft Arnsberg, die 1368 auch politisch Teil des kurkölnischen Herzogtums Westfalen wurde. Die drei goldenen Seerosenblätter (auch Seeblätter oder Schröterhörner) in Rot stehen für Engern, lat. Angaria. Engern meint den altsächsischen Bereich um ca n. Chr. zwischen Ostfalen und Westfalen, etwa ein größeres Gebiet westlich und östlich der Weser. Zur Orientierung helfen seine kurfürstliche Schatulle zugunsten des Hochaltars. Ein Kulminationspunkt des Hochaltars in Kloster Brunnen ist das kurfürstliche Wappen. Von zwei Engeln gehalten, dokumentiert das Wappen in hervorragender Weise seinen herrschaftlichen Anspruch als Erzbischof und kurfürstlicher Landesherr. Clemens August wurde 1732 auch Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ordens mit dem Hauptsitz in Mergentheim. Das Kreuz dieses Deutschen Ordens gliedert das Wappen in vier Felder. Das prominenteste Feld ist das heraldisch vom Wappen aus gesehene Feld rechts oben, vom Betrachter aus gesehen ist es links oben. Es ist wieder in vier Felder eingeteilt und präsentiert das kurkölnische Gebiet. Das schwarze Kreuz im weißen bzw. silbernen Feld steht für das Kölner Erzstift im Rheinland. Im roten Feld das weiße springende Pferd, auch bezeichnet als Westfalenross, Sachsenross oder Welfenross, steht für das Herzogtum Westfalen, nämlich Kurkölnisches Sauerland zuzüglich Hellwegzone von Werl bis Geseke außer Soest, das sich ja bekanntlich durch die Soester Fehde ( ) aus dem kölnischen Herrschaftsbereich verabschiedet hat. Kaiser Johann Christoph Manskirch ( 1762) fertigte das Clemens-August-Wappen am Brunnen
23 Sauerland 4/ die Städte Paderborn und Bremen. Es gab zwar nie ein reales politisches Territorium namens Engern, aber als Landschaftsbezeichnung hielt sich der Begriff bis in die geschichtliche Neuzeit. Die Bezeichnung taucht auf bis in den östlichen Bereich von Werl. Es dauerte noch bis zum 18. Jahrhundert, ehe sich der Begriff Sauerland ganz in Richtung Osten gegen Angaria durchgesetzt hatte. Der Altkreis Brilon zeigte bis 1975 die drei Seerosenblätter in seinem Kreiswappen. Wenn wir bei der Betrachtung des Clemens-August-Wappens im Uhrzeigersinn fortfahren, folgt im Viertel rechts oben das Wappen des Fürstbistums Hildesheim, längsgespalten in Gold und Rot. Rechts unten folgt das Wappen von Fürstbistum und Stadt Münster. Das Viertel links unten müssen sich die Fürstbistümer Paderborn und Osnabrück teilen. Für Osnabrück steht das siebenspeichige rote Rad in Weiß bzw. Silber, für Paderborn die goldenen Kreuze auf rotem Grund und in Weiß/Silber die roten Pyrmonter Ankerkreuze. Das schon erwähnte Ordenskreuz ist belegt mit dem Adler des Deutschen Ordens. In seinem Herzschild erscheint das Hauswappen der Wittelsbacher mit den weiß-blauen Rauten für die altbayerische Münchner und den aufsteigenden Löwen für die pfälzische Linie. Schließlich ist Clemens August der letzte von fünf bayerischen Kurfürst-Erzbischöfen, die von 1583 bis 1761 den Kölner Kurstaat regierten. Als Bekrönung seines Wappens dient der Kurhut mit fünf Hermelinschwänzen, perlenbesetzten Bügeln, Weltkugel und Kreuz. Hinterlegt sind Bischofsstab und Schwert als Zeichen der geistlichen und weltlichen Macht des geistlichen Staates. Zusätzlich ist das Wappen umlegt mit einer Kette, an der sechs kleinere le-Medaillons mit weiß-blauen Rauten aufgereiht sind, unterbrochen von vier Harnischen. In der Mitte erscheint ein größeres Medaillon, darunter ein goldumrandetes Kreuz mit einer Darstellung des Erzengels Michael in einer Gloriole. Der Vorgänger von Clemens August, sein Onkel Josef Clemens ( ), hatte am 8. Mai in seinem Schloss Josephsburg in München-Berg am Laim eine Michaels-Bruderschaft für alle Stände und am 29. September 1693 einen Michaels-Ritterorden gestiftet. Diese beiden Organisationen arbeiteten eng zusammen und gewannen bald großen Einfluss. Clemens August ließ einen Teil seiner Wappen mit der Ordenskette ausstatten. Die Ritter des Ordens führten den Titel Deutschordens-Schloss auf der Insel Mainau im Bodensee, erbaut von Johann Caspar Bagnato im Jahr 1739 Beschützer göttlicher Ehre unter dem Schutze des heiligen Erzengels Michael und mussten bei der Aufnahme eidlich versprechen, den römisch-katholischen Glauben gegen Heiden, Juden und Ketzer zu verteidigen. Auch soziale Leistungen wurden verlangt, z. B. Unterstützung von Kriegsversehrten, Witwen und Waisen. Großmeister sollte immer ein Wittelsbacher sein. Auf dem Bruderschaftskreuz standen die Buchstaben F. P. F. P. fideliter = getreu, pie = fromm, fortiter = tapfer und perseveranter = beharrlich. In Bonn kann man heute noch den Einfluss des Michaelsordens nachempfinden. Während Joseph Clemens mit der Michaelskapelle und einem kleinen Versammlungsraum in Bad Godesberg auskam, ernannte Clemens August die Bonner Franziskanerkirche zur Ordenskirche und baute das repräsentative Michaelstor, heute Koblenzer Tor an die Residenz an. Wenn man versucht, die Bedeutung des Clemens-August-Wappens von Kloster Brunnen vergleichend einzuordnen, so ist es sicher einmalig im ehemaligen Herzogtum Westfalen, was die Wappen in Kirchen betrifft. Vergleichbare Wappen im Herzogtum gab es wahrscheinlich im Schloss in Arnsberg oder in Hirschberg oder in der Benediktinerkirche in Grafschaft. Sie sind wohl alle verschwunden. In anderen Bereichen des ehemaligen Clemens-August-Reiches findet man heute noch konkurrenzfähige Wappen u. a. in der Franziskanerkirche in Brühl/Rheinland und in Wohldenberg in der Diözese Hildesheim. Ein sehr schönes Exemplar hat sich im Diözesanmuseum in Osnabrück erhalten, das früher an der Orgelbrüstung im Dom hing. Auch dieses ist wie das in Kloster Brunnen von Johann Christoph Manskirch ( 1762) gefertigt. Immerhin führt der Sauerländer Heimatbund den kurkölnischen Teil des Wappens, den es in dieser Form seit dem Kölner Erzbischof Hermann von Wied (reg. von ) gibt, in seiner Zeitschrift Sauerland und seit 1921 in seinem Briefkopf, der Sunderner Heimatbund seit Der Arnsberger Karnevalsverein KlAKaG ziert damit seine Uniformen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich bei sorgfältigem Hinsehen das Clemens- August-Wappen in Kloster Brunnen als gewichtiges Geschichtsbuch des 18. Jahrhunderts erweist. Von den erhaltenen Clemens-August- Wappen im Außenbereich ist das Wappen am Schloss der Insel Mainau im Bodensee wohl eines der größten. Das Schloss Großes Wappen des Deutschordensmeisters Clemens August auf der Insel Mainau Fotos Mainau: Klaus Baulmann
24 168 Sauerland 4/2013 gehörte dem Ordenskomtur von Roll, Minis ter für Ordensangelegenheiten bei Clemens August in Bonn. Clemens August wurde 1732 Hoch- und Deutschmeister des Ordens, das Schloss 1739 gebaut. Da der Chef einen Zuschuss zum Schlossbau aus der Ordenskasse veranlasste, musste auch sein Wappen her. So kam der Arnsberger Adler auf die Insel Mainau im Bodensee. Literatur: Baulmann, Klaus: Kloster Brunnen, Westfälische Kunststätten Heft 101, Münster 2005 Sauerländer Heimatbund e.v. (Hg.): Kommunale Wappen des Herzogtums Westfalen, Arnsberg 1986 Quis ut Deus, 300 Jahre Erzbruderschaft St. Michael, Berg am Laim München, München 1994 Im Juli 2008 hatte das Generalvikariat in Paderborn signalisiert, dass es eine Renovierung der Kirche genehmigen und einen Zuschuss aus Kirchensteuermitteln gewähren würde. Nachdem dann im Oktober 2008 eine neue Mahr-Heizung in der Kirche eingebaut war, stimmte das Bauamt des Erzbischöflichen Generalvikariates zu, dass die Durchführung einer Gesamtrenovierung beginnend mit der Heizungserneuerung richtig sei. Auch die Untere Denkmalbehörde Gemeinde Finnentrop erteilte im Juni Renovierung der Pfarrkirche in Schönholthausen erfolgreich abgeschlossen und Geschichtliches zur Innenausstattung von Franz-Josef Huß 2010 die Genehmigung zur Restaurierung der Einrichtung u. a.: barocker Hoch- und Seitenaltar, Kanzel, Brüstung der Orgelempore mit Stützsäulen, Kommunionbank, Zelebrationsaltar, die Figurengruppen, Kreuzwegstationen, Aufarbeiten der Kirchenbänke. Diese Arbeiten mussten fristgerecht bis zum Jahresende 2010 durchgeführt werden, um den Zuschuss aus dem Denkmalförderungsprogramm 2010 des Landes NRW abrufen zu können. Der 2. Bauabschnitt begann mit dem Ausräumen der Kirche, nachdem die Erstkommunionfeier am 5. Mai 2012 noch stattgefunden hatte. Die wichtigste Renovierungsmaßnahme betreffend der großen Risse über den Fenstern, teilweise waren bereits Steinbrocken in den Kirchenraum gefallen, bedurfte einer guten Überlegung und Vorbereitung. Die Außenwände hatten sich vor 275 Jahren schon beim Kirchbau vom Gewölbe gelöst (Geburtsfehler). Hierzu musste die Dachhaut geöffnet werden um den Bauschutt in den Zwickeln über den Fenstern beseitigen zu können. Hochaltarretabel von Düringer Alle Fotos: Franz-Josef Huß Zudem wurden die beiden Chorbänke wieder aufgearbeitet, so dass die Messdiener und die Eucharistiehelfer in diesen Platz nehmen können. Diese Bänke erinnern an die Zeit um 1500 (Renaissance), als in Schönholthausen vier Geistliche (Pfarrer, Kaplan und zwei Vikare) ihren Dienst versahen und regelmäßig Chorgebet hielten. Die wertvolle mechanische Turmuhr (Firma Weule in Bockenemen am Harz, 1900) wurde bisher einmal pro Woche
25 Sauerland 4/ von Hand aufgezogen. Um den weiteren Betrieb sicherzustellen, ist ein elektrischer Aufzug für die Gewichte eingebaut worden. Der Kirchenvorstand einigte sich mit dem Denkmalamt, die Raumschale mit einem dezenten Grauton zu versehen. Für diese Farbgebung sprach, dass die barocke Helligkeit und Einheitlichkeit des Raumgefühls zurückgeholt wurde, was eben durch diesen dezenten Grauton geschehen sollte. Die denkmalpflegerische Herangehensweise sieht bei solchen Maßnahmen zunächst vor, Befunde älterer Ausmalungen an den Wänden und Gewölben zu sichten bzw. auch Hinweisen in der Literatur oder im Archiv nachzugehen. Bei dieser Recherche ergab sich, dass, wie in barocken Kirchen üblich, der bauzeitliche Anstrich des Kirchenraumes kalkfarben gewesen sein muss. Erst 150 Jahr später, im Jahr 1870, wurde ein Ausmalungsprogramm für den Innenraum erdacht und umgesetzt, das mit kräftigen Farben figürliche und ornamentale Motive einbrachte. Darunter waren Engelsköpfe, Symbole des Altarsakraments sowie die einzig aus dieser Zeit im Gewölbe des Chorjochs verbliebenen Medaillons der vier Kirchenväter. Schöpfer dieser Medaillons war der im westfälischen Raum bedeutende Künstler Franz Georg Goldkuhle ( ) aus Wiedenbrück. Das nun umgesetzte Farbkonzept nimmt insbesondere Bezug auf die bauzeitliche Raumgestaltung und Ausstattung des 18. Jahrhunderts. (Aus der Stellungnahme des LWL vom ). Übrigens: Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönholthausen feierte in diesem Jahr den 270. Tag der Kirchweihe. Aus dem Jahr 1743 wird gemeldet, dass am 15. August (Fest Aufnahme Mariens in den Himmel) die neue Kirche von Weihbischof Johann Adolph von Hörde konsekriert wurde wird berichtet, dass der neue Altar aufgerichtet ist und Weihbischof von Hörde daran zum ersten Mal zelebrierte. Erwähnenswert ist: Johann Friedrich Adolph von Hörde wurde am 4. Dezember 1688 in Schönholthausen geboren. Am 23. Februar 1709 empfing er die Subdiakonatsweihe wurde er Weihbischof und 1728 Generalvikar von Osnabrück, gleichzeitig war er Domherr zu Hildesheim (1711) und Münster ( ). Geschichtlicher Hintergrund zur Innenausstattung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Schönholthausen: Der barocke Hochaltar aus der St.- Cyriakus-Kirche in Berghausen wurde im Januar 1962 in die Kirche von Schönholthausen übernommen und aufgebaut. Bisher war der Altarbauer unbekannt geblieben. Pfarrer i. R. Johannes Arens, der im Pfarrhaus in Berghausen wohnt, hat im dortigen Pfarrarchiv erforscht, dass der Hochaltar aus der Bildhauerwerkstatt des Johann Nikolaus Düringer stammt. (* 20. April 1700 in Großwenkheim bei Bad Neustadt an der Fränkischen Saale; 29. Dezember 1756 in Rüblinghausen). Dieser Künstler ließ sich 1730 in Rüblinghausen nieder, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1756 wirkte. Die Entstehung dieses Altars fällt also in die Zeit von Mit dem Umzug des Altars von Berghausen nach Schönholthausen kam auch die Figur des Hl. Jakobus des Älteren nach hier. Figur des Hl. Jakobus Schönholthausen lag zwar nicht an der Heidenstraße und nicht am Römerweg, aber an einer Nebenstrecke/Verbindungsweg von Soest nach Siegen. Dieser Weg tangierte auch Schliprüthen und Fretter. Das Dekanat Südsauerland hat in seinem Logo die Muschel des Hl. Jakobus aufgenommen, zur Erinnerung an das alte Dekanat Elspe. Eine weitere Bildhauerarbeit von Düringer ist die Figur vom Guten Hirten erwarb Pfarrer Midderhoff diese für 7 Taler. Sie fand zuerst ihren Platz auf dem Schalldeckel der Kanzel. Heute hat sie ihren Platz auf dem neubarocken Beichtstuhl. Die beiden aus der früheren Kirche übernommenen Beichtstühle haben, so zeigt es ein Foto um 1900, Platz gefunden in den Nischen neben den Seitenaltären. Ob diese Nischen allerdings für sie von Anfang an vorgesehen waren, kann man bezweifeln, beides passt nicht zusammen. Aus dem Jahr 1738 heißt es auch: Dem Sohn Franz (Schilling?) mit seinen Gesellen, die die Turmtür gebrochen, den Turm instand setzten, die Öffnungen für die Beichtstühle gebrochen und die Treppensteine gelegt haben, zahlt 10 Taler. Dies könnte bedeuten, die Beichtstühle behielten zunächst ihren Platz in der Turmwand, die hier dafür bearbeitet wurde. Irgendwann später wurden sie in die Nischen vorn in der Kirche eingebaut. Im Jahr 1739 hatte Meister Johann Hermann Piper aus Fretter Arbeiten an den Beichtstühlen und an den Windfängen durchgeführt. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts beklagt Pfarrer Peter Spielmann die unbequemen Beichtstühle. Zunächst wurde ein neubarocker Beichtstuhl aufgestellt, der dann in den 30er oder 40er Jahren zur Amtszeit von Pfarrer Vetter in die Wand eingelassen wurde. Ob zu dieser Zeit der Beichtstuhl vor der Kanzel ausgebaut wurde? Der jetzige neubarocke Beichtstuhl wurde auf Empfehlung der Liturgiekommission des Generalvikariates zu einem Beichtraum umgebaut. Die ehemalige barocke Strahlenmadonna mit Putten findet keine Erwähnung, aus welcher Zeit und von welchem Bildhauer sie stammte. Unter Pfarrer Peter Spielmann ( Pfarrer in Schönholthausen) ist sie im Jahr 1907 wegen Holzwurmbefall dem Feuertod zum Opfer gefallen. Nach dem Einbau von vier elektronisch gesteuerten Drehstromläutemaschinen ergab sich ein unregelmäßiges, meist einseitig und mit vielen Aussetzern miserables Geläut. Die Firma Junker, Brilon, hatte 1949 die Klöppel, damals typisch fürs Handgeläute, geliefert. Diese funktionierten bei den an sehr schweren Holzjochen hängenden Schönholthausener Glocken nur bei sehr hohen Schwungwinkeln. Außerdem waren sie ungünstig für die Klangwirkung der Glocken, da sie wegen der zu kleinen Ballen die tiefen Teiltöne unterdrückten. Daraufhin hat der Glockensachverständige des Erzbistums Paderborn, Herr Halekotte, vorgeschlagen, drei neue Ellipsoidklöppel aus weichem Schmiedeeisen für drei Glocken einzubauen. Die 1949 von der Firma Albert Junker gegossenen Turmglocken bestehen aus der sogenannten Briloner Sonderbronze
26 170 Sauerland 4/2013 aus ca. 92% Kupfer/6-7% Silizium und etwas Zink, einer Legierung mit ähnlichen akustischen Eigenschaften wie die althergebrachte Glockenbronze, allerdings einer fast unbegrenzten Haltbarkeit. Die Schönholthausener Glocken haben eine recht gute Resonanz (Klangfülle). Leider sind die Glocken wie fast alle damaligen Bronzeglocken nicht nach dem Guss gestimmt worden. So bilden die Schlagtöne der beiden großen Glocken eine saubere temperierte kleine Terz e - g. Die a - Glocke (St. Josef, Glocke 3) steht etwas zu hoch, was für sich allein noch nicht stören würde, wenn nicht die kleine h - Glocke (St. Maria, Glocke 4) zu tief stehen würde. Dadurch liegt das Intervall zwischen Glocke 3 und Glocke 4 unentschieden zwischen kleiner und großer Sekunde, was den Gesamtklang des Geläutes empfindlich beeinträchtigt. Deshalb war es notwendig, die beiden kleinen Glocken im Turm nachstimmen zu lassen. (Aus dem Gutachten des Glockensachverständigen Theo Halekotte, Werl, vom ) Nach der Kirchenrestaurierung von 1870 erschien am 20. Juli 1870 im Sauerländischen Volksblatt folgender Text: Endlich ist unser schönes romanisches Gotteshaus vollständig und aufs Geschmackvollste dekoriert. Es gewährt einen herrlichen Anblick, wenn das Auge des Beschauers die geräumigen Hallen durchmisst. Alles prangt in frischen, kräftigen und lebendigen Farben. Wohin auch das Auge sich wendet, zur Höhe des Gewölbes oder nach den Seitenwänden oder nach dem Chore, überall dieselbe Schönheit, dieselbe ansprechende Zeichnung. Frei von Überfüllung, frei von haschenem Effekt, alles einfach und wahrhaft schön. Aber nicht ein einziger Gegenstand ist zu finden, der nicht mit gleicher Liebe und Sorgfalt behandelt wäre. Orgelbühne, Bänke, Predigtstuhl, Beichtstühle, Vesperbild, Fahnenstücke und anderes. Doch den Glanzpunkt bilden die drei Altäre, unter ihnen wieder der Hochaltar. Alle Statuen sind in Holzfarbe gehalten und ansprechend poligromiert. Auf dem ersten Bogen zwischen Schiff und Chor finden sich die bekannten Symbole des allerheiligsten Altarssakraments, auf dem zweiten Bogen neun Engelköpfe, darstellend die neun Chöre der Engel. Zwischen diesen beiden Triumphbögen ist das eigentliche Arbeitsfeld des Herrn Malers Goldkuhle aus Wiedenbrück. Da selbst befinden sich in der Höhe des Gewölbes in unvergleichlicher Pracht auf Goldgrund gemalt vier Medaillons der abendländischen Kirchenväter und zwar nach Osten über dem Hochaltare der Heilige Gregorius und ihm gegenüber nach Westen der Heilige Hieronymus, nach Süden der Heilige Augustinus und nach Norden der Heilige Ambrosius. Diese vier Kirchenväter sind nach der eigensten Konzeption des Künstlers entworfen und lassen auch die gediegensten Kunstkenner nicht unbefriedigt. Alle, die bisher Gelegenheit hatten, dieselben zu besichtigen, waren voll des Lobes, voll von Anerkennung für die gediegene Befähigung des Herrn Goldkuhle. Ebenso prachtvoll sind die gebrannten Fenster aus Düsseldorf. Das nördliche Chorfenster zeigt uns Mariä Verkündigung und das südliche Mariä Heimsuchung. Die übrigen Fenster des Schiffes enthalten einzelne Rosetten und sonstige Verzierungen und sind mehr im Teppichmuster gehalten. Die Pfarre Schönholthausen besitzt jetzt ein Gotteshaus, wie es schöner und geschmackvoller im ganzen Sauerlande nicht dürfte anzutreffen sein. Und wenn auch die Gesamtkosten sich auf 9000 Mark belaufen, so weiß und sagt doch jeder, es ist nicht zu viel. Denn alles ist gut und dauerhaft gearbeitet. Schließlich sei hiermit allen edlen Wohltätern der herzliche Dank abgestattet. Der Verfasser schließt sich dieser Lobwürdigung an und gratuliert der Pfarrgemeinde für die erneut gelungene Restaurierung. In der Advents- und Weihnachtszeit ist zu dem Medaillon des Heiligen Ambrosius, Bischof von Mailand, in würdigender Weise zu sagen: Medaillon des Hl. Ambrosius von Goldkuhle Er wurde um 339 in Trier(?) geboren und verstarb am 4. April 397 in Mailand. Dargestellt wird er als Bischof mit Buch und Schreibfeder. Diese vier Kirchenväter werden auch Vier Weltweise genannt. In einer bewegten Zeit im 4. Jahrhundert war Ambrosius Bischof von Mailand. Die Überlieferung zeichnet von ihm das Bild eines aufrechten, gelehrten und diskussionsfreudigen Menschen, der gegenüber dem Kaiser und anderen Autoritäten kein Blatt vor den Mund nahm. Von eben diesem Ambrosius stammt der Text des ältesten Weihnachtsliedes, das heute noch gesungen wird : Komm, du Heiland aller Welt. Im Gotteslob findet er sich in einer gekürzten Version unter der Nummer 108, unterlegt mit einer Melodie aus dem zwölften Jahrhundert. Es ist ein Text von beeindruckender Kraft und schlichter Schönheit jenseits von Glöckchengeklingel und Engelsgesang. Als Ambrosius ihn schrieb, feierten die Christen erst seit etwa fünfzig Jahren Weihnachten. Die theologische Diskussion darüber, ob Jesus nur Mensch oder auch Gott gewesen sei, war seit Jahrzehnten in vollem Gang. Im Jahr 451 schließlich beendet das Konzil von Chalcedon den erbitterten Streit und definiert Christus als wahren Menschen und wahren Gott zugleich. Ambrosius Text gibt wieder, was die Menschen damals bewegte. Und er zeigt, wovon er selbst überzeugt war: Darob staune, was da lebt: Also will Gott werden Mensch, heißt es in der ersten Strophe. Strophe drei führt weiter aus: So erschien es in der Welt, wesenhaft ganz Gott und Mensch. Christus als Gott, Christus als Mensch, Ambrosius soll diesen Text bewusst als Gesang im Gottesdienst eingesetzt haben, um seine Position unters Kirchenvolk zu bringen. Abschließend zur geschichtlichen Zuordnung der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönholthausen: Aufgrund des Konkordates zwischen Papst Pius VII. und König Friedrich Wilhelm III. erließ der Papst am 16. Juli 1821 die Bulle De salute animarum. Dadurch ging ein Teilgebiet vom Erzbistum Köln, das Herzogtum Westfalen mit 51 Pfarreien, auf das Bistum Paderborn über, und somit war Schönholthausen dem Dekanat Elspe zugeordnet. Im Jahr 1832 wurde aus 13 Pfarreien, zu denen auch die Pfarrei Schönholthausen gehörte, das Dekanat Meschede errichtet wurde Schönholthausen in das Dekanat Attendorn eingegliedert. Mit Wirkung vom 1. Juni 2001 wurde die Pfarreien Schliprüthen, Fretter mit Schöndelt, Serkenrode und Schönholthausen mit Ostentrop unter Beibehaltung ihrer Selbstständigkeit zum Pastoralverbund Frettertal zusammengeschlossen. Die Zusammenlegung der bisherigen Dekanate Attendorn, Elspe und Olpe zum Dekanat Südsauerland erfolgte zum 1. Juli Mit Wirkung vom 1. Dezember 2013 wurde die Pfarrei Schönholthausen dem neuen Pastoralverbund mit dem Namen Pastoraler Raum Pastoralverbund Bigge-Lenne-Fretter-Tal zugeordnet.
27 Sauerland 4/ Sankt Martin! Sankt Martin! Du heil ger Mann, wir folgen! wir folgen! - Du reitest uns voran! so singen im Refrain des Balver St.- Martinsliedes Balver Kinder jährlich am 11. November. Sie sangen das Lied erstmals am 11. November Hunderte begleiten den Reitersmann zur Mantelteilung Heute wie damals schwenken Kinder in ihren Händen Laternen, werden sorgsam begleitet von Eltern und bei ihrem Gesang kräftig unterstützt von den Bläsern des Mantelteilung als Symbol der Nächstenliebe De Suerlänner druckte 1952 Pröpper s Balver St.-Martinslied von Rudolf Rath Musikvereins Balve. Bei einbrechender Dunkelheit ziehen sie so durch die Straßen der Innenstadt, an ihrer Spitze hoch zu Ross: Sankt Martin. Kleine wie Große werden Augenzeuge der immer wieder beeindruckenden Abschlussszene vor der St.- Johannes-Grundschule: Seit Jahren bereitet Peter-Josef John, früherer Schulleiter, mit dem Bettler die großherzige Mantelteilung durch den ritterlich gewandeten Martin vor. Dieser historische Reitersmann entpuppt sich nur bei genauem Hinsehen als Andreas Fritz. Den kennen die meisten vor allem vom alljährlichen Schützenfest. Da führt er als Oberst ebenfalls hoch zu Ross den Festzug an. Den gewaltigen Martinsumzug aber bilden jährlich etwa 500 Teilnehmer. Und dass er, an mindestens ebenso vielen Zuschauern am Wegesrand vorbei, mit der Bettlerszene seinen Abschluss finden kann, dafür sorgen die Balver Schützen. Nach der Bettlerszene mit einer Brezel beschenkt, treten die Kinder mit ihren Eltern ihren Heimweg an. Ob es sie überhaupt interessiert, dass der Leckerbissen in ihrer Hand von der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve gestiftet wurde? Tradition wird seit über 60 Jahren gepflegt Wenige Jahre nach Kriegsende, in den ersten Jahren des mühsamen Wiederaufbaus, hatte die Arbeitsgemeinschaft Balver Vereine auf Anregung der Heimwacht Balve beschlossen, den St.-Martins-Zug in Balve, in unserer Stadt einzuführen. Gleichlautend dann auch der Titel in der Hönne-Zeitung am 5. November 1949, der ersten Ausgabe dieses Blattes, das, nach rund 8-jähriger kriegs- bzw. politischbedingter Zwangspause, wieder für den Balver Raum gedruckt werden durfte. Unter dem Pseudonym -r. verbarg sich als Verfasser der Balver Kirchenmusikdirektor und Heimatschriftsteller Theodor Pröpper, das bestätigt ein Blick in sein Werkverzeichnis von 1970 (Seite 9, Nr. 149). Er mahnt: Es ist wichtig, daß dem St.- Martins-Zug gleich bei seiner erstmaligen Durchführung in Balve kein falscher Sinn unterstellt wird, daß er nicht zu einer reinen Äußerlichkeit zu einem poetisch verbrämten Allotria der Jugend wird. Der Sinn des St. Martinszuges besteht darin, den hl. Ritter zu feiern als ein großes Vorbild erbarmender Nächstenliebe, zu besingen die edle Tat, darin der Heilige sich helfend herabneigte zum Armen und Bedürftigen, sich von der großen Liebe St. Martins zu allen Notleidenden zur Nachahmung begeistern zu lassen. Martinus wird verehrt als Nothelfer und Wundertäter Der Martinszug eine jährlich wiederkehrende Erinnerung an den heiligen Martin, dessen Geburtstag am 11. November im Jahre 316 oder 317 war, und an sein Leben und Wirken vor rund 1700 Jahren hier nur in Kurzform: Martinus, ursprünglich Offizier des römischen Heeres, das gegen die Alemannen kämpfte, stammte aus einem heidnischen Elternhaus. Er ließ sich früh als Christ taufen, verließ vorzeitig den Heeresdienst und wurde später, nach längerem Weg, auf dem er der Legende nach als Nothelfer und Wundertäter wirkte, im Jahre 372 zum Bischof von Tours geweiht. Im Alter von 81 Jahren starb Martin am 8. November 397. Theodor Pröpper: Kinder sollen ein kleines Opfer bringen Und im Hinblick auf eine weitere verehrungswürdige Person mahnte der bereits zuvor zitierte Theodor Pröpper in der o. g. Ausgabe der Hönne-Zeitung: Im Bewußtsein der Kinder soll keine Rivalität zwischen dem St.-Nikolaus-Tag und dem St.-Martins-Tag entstehen. Von St. Martin sollen die Kinder nicht wie von St. Nikolaus Gaben empfangen. Am St. Martinstag sollen die Kinder nicht nehmen, sondern geben. Schon die Kinder sollen an diesem Tag lernen, aus ihrer Spardose ein kleines Opfer zu bringen und die Großen sollen durch den St.-Martins-Zug an ihre soziale Verpflichtung erinnert werden. Sicherlich findet so der St.-Martins-Zug jene Sinndeutung, die in unseren Tagen von besonderer Aktualität ist. Eine Überlegung, die durch die an vielen Orten verteilten Martinsbrezeln nichts an Sinn und Wert verliert, wenn die Kinder durch ihren Kollektenbeitrag einen wichtigen sozialen Zweck unterstützen können. Martinslied durch das Jahrbuch De Suerlänner 1952 weit bekannt Vor über 60 Jahren veröffentlichte Theodor Pröpper den Text seines Balver St.- Martinslied im De Suerlänner 1952, dem Heimatkalender für das kurkölnische Sauerland, herausgegeben vom Sauerländer Heimatbund Arnsberg. Während der Text dort noch 10 Strophen umfasste, hat das Lied, zwar nun mit Noten versehen, im Klingemund von Theodor Pröpper (S. 25) nur noch 9 Strophen. Dieses Sauerländische Liederbuch gab 1960 der Westfälische Heimatbund heraus; gedruckt wurde es vom Gebr. Zimmermann- Verlag, Balve. Es fand seinen Weg in viele Schulen und Einrichtungen des südlichen Westfalens, aber vor allem in fast jeden Haushalt der damaligen Stadt. Warum allerdings der Verfasser bei dieser erneuten Veröffentlichung den Text um 1 Strophe reduzierte, ist mir nicht bekannt. Bei einem Blick in die Nachbarstadt machen wir noch eine interessante Feststellung: Der Balver Theodor Pröpper verfasste einen Dialog zur Mantelteilung am Martinstag eigens für die katholische Volksschule in Hüingsen, das berichtet die Westfalenpost vom auf ihrer Mendener Lokalseite. Dazu heißt es, dass dieses Spiel nun bereits zum dritten Male vor dem Schultore vorgetragen wurde. Johannes Levermann wurde 1964 Rektor der heutigen Adolf- Kolping-Schule. Auf meine Nachfrage bestätigt er: Ich erinnere mich noch gut daran, dass der Martinszug, organisiert vom Bürgerschützenverein, noch viele Jahre mit der Bettler-Szene / Mantelübergabe beendet wurde. Wo aber blieb vom Martinslied die dritte Strophe? Zurück zum Balver Martinslied: Etwa ein Jahrzehnt später finden wir den St.- Martins-Text diesmal wieder mit der zuvor unterschlagenen ursprünglich 3. Strophe veröffentlicht, diesmal in der Hönne-Zeitung (HZ) vom , mit folgendem Wortlaut: Martin griff zum Mantel sein, der war gar bunt und schön; er hüllte drin gar warm sich ein,
28 172 Sauerland 4/2013 war herrlich anzuseh n. Und weiter ritt er dann fürbaß durch Wind und Wetter seine Straß. /: Sankt Martin!... :/ Günther Brücker machte auf diese Differenz bereits kurz darauf in seinem Leserbrief (HZ ), aber auch auf einige Textunterschiede an weiteren Liedstellen aufmerksam. Eine Erklärung dafür hatte er nicht. Allerdings scheinen mir diese Änderungen durch den Textdichter Pröpper wohl weniger von inhaltlicher Bedeutung, sie dienen eher einer Glättung des Textes. Viel mehr ging es dem Balver Chorleiter Brücker in seiner wohlmeinenden Kritik darum, Vorschläge zu machen, um unser Martinslied enger mit der Bettlerszene zu verbinden, um sie dadurch aufzuwerten. An dieser Stelle sei vermerkt: Bereits im Dezember 1961 hatte Theodor Pröpper für seine Leistungen als Musiker und Schriftsteller die Ehrenbürgerschaft der Stadt Balve erhalten. Und um auch hier den Bogen in unsere Zeit zu schlagen: Die 50. Wiederkehr dieses Anlasses wurde, verbunden mit dem 90-jährigen Bestehen der Heimwacht Balve und der Übergabe des Pröpper-Nachlasses an das Pfarrarchiv St. Blasius, vor knapp zwei Jahren, nämlich am 16. Dezember 2011, mit einer Festveranstaltung im Pfarrsaal der Kath. Kirchengemeinde gewürdigt. Martinszüge sind weit verbreitet Martinszüge entwickelten sich auch andernorts zum jährlichen Brauch, prägen das christliche Erscheinungsbild und die kulturelle Tradition, so auch in Gemeinden unserer Stadt. Schauen wir in die Veröffentlichungen der heimischen Presse oder auch in den Balver Veranstaltungskalender, so finden wir zahlreiche Hinweise auf die Martinszüge am Vorabend, 10. November, oder auch am 11. November mit Einladungen unterschiedlicher Träger bzw. Veranstalter, vor allem aber aus dem kirchlichen Bereich. Man möge mir nachsehen, dass ich auf eine ganz andere historische Bedeutung des Martinitages im Rahmen dieses Beitrags nicht näher eingehen kann: auf den Martinitag, dem in früherer Zeit als jährlicher Termin für Geschäfte, Lieferungen und Dienstverhältnisse große Bedeutung zukam. Das wäre dann noch einmal ein neues Thema. Theodor Pröpper, , Dichter und Komponist des Balver St.-Martinsliedes, war 55 Jahre lang Organist in der St.-Blasius-Pfarrkirche in Balve St.-Martinslied Fassung mit 9 Strophen gemäß Veröffentlichung im Klingemund, Balve Sankt Martin, heil ger Reitersmann, heut künden wir dein Lob, und jeder singt, der singen kann, weil Gott dich hoch erhob. Du bist der Armen Freund und Schutz, bist allem Bösen Feind und Trutz. /: Sankt Martin! Sankt Martin! Du heil ger Mann! Wir folgen, wir folgen; du reitest uns voran.:/ 2. Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, schlug seinen Mantel zu. Das Rößlein fror, drum lief s geschwind und nahm sich keine Ruh. Am Zaum die Schellen klangen hell, den Klang trug fort der Wind so schnell. /: Sankt Martin! :/ 3. Ein Bettler lag am Wegesrand, trug keinen Mantel warm, hob flehend seine kalte Hand und fror, daß Gott erbarm. Vom Zähneklappern flog sein Mund, die Augen naß, die Füße wund. /: Sankt Martin! :/ 4. Sankt Martin sah die große Not und hielt die Zügel an. Dem Rößlein schnell er Halt gebot, grad vor dem Bettelmann, stieg eilend dann herab vom Pferd, nahm in die Hand sein blankes Schwert. /: Sankt Martin! :/ 5. Sankt Martin griff zum Mantel sein voll Mitleid war sein Blick dann schlug er mit dem Schwert hinein, hielt in der Hand zwei Stück. Das eine er dem Bettler gab, dazu noch Trank und gute Lab. /: Sankt Martin! :/ 6. Darauf der heil ge Reitersmann stieg wieder hoch zu Roß mit halbem Mantel angetan, ein Glanz ihn hell umfloß. Im Bettler seltsam es geschah er Christi Augen leuchten sah. /: Sankt Martin! :/ 7. Sankt Martin ritt von hinnen dann, verließ die eitle Welt. Der Ritter ward ein Gottesmann, für Gottes Reich bestellt. Er suchte Menschen in der Not, in allem Leid er Hilfe bot. /: Sankt Martin! :/ 8. Sankt Martin, steig aus deinem Grab, dich aller Not erbarm! Reit alle Straßen auf und ab, mach alle Herzen warm, daß einer trag des andern Last und hilf, wie du geholfen hast! /: Sankt Martin!... :/ 9. Sankt Martin, kehr auf deinem Ritt bei uns in Balve ein. Sieh, alle Kinder gehen mit bei hellem Fackelschein. In unsrer alten Stadt verweil, daß jeder gern den Mantel teil! /: Sankt Martin!... :/
29 Sauerland 4/ Spuren alten Bergbaus bei Olsberg- Helmeringhausen Die Expertengruppe am Schmalenberg bei Helmeringhausen: Volker Haller, Gerd Mengelers, Prof. Dr. Reinhard Schaeffer, Hans-Ludwig Knau, Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, Dr. Christoph Bartels, Reinhard Köhne, vorne: Lukas Mengelers. (von links nach rechts) von Wilfried Reininghaus Am 21. September 2013 fand bei Helmeringhausen die Begehung eines alten Bergwerkbezirkes statt. Er war schon vor einiger Zeit von Hans- Martin Köster (Olsberg) entdeckt worden und geriet seitdem in den Blick der Archäo logie und des Arbeitskreises Bergbau im Sauerland. Anlass für die erneute Begehung war die vergleichsweise günstige schriftliche Quellenlage zu Helmeringhausen. In der Bearbeitung von Dr. Manfred Wolf (Münster) wird die Historische Kommission die Edition des Liber iurium et feudorum Westphaliae herausgeben. Darin sind die Rechte, Güter und Lehen des Kölner Erzbischofs im Sauerland im 15. Jahrhundert aufgelistet. Die quellenkundliche Einleitung zu dieser Edition, die sich derzeit in Druck befindet, verweist auf die wirtschaftliche Bedeutung des sog. Fernbesitzes an Lehen und Gütern geistlicher Einrichtung im Mittelalter hin. Nicht nur Kölner, sondern auch andere Klöster und Stifte waren seit dem frühen Mittelalter im Sauerland begütert. Auffällig war, dass das Erzstift Magdeburg bereits 973 u. a. mit Besitz in Brilon ausgestattet wurde. Die Lehnbücher des 15. Jahrhunderts führten diesen Besitz detaillierter auf. Darin sind Güter bei Brilon näher aufgeführt. Sie lagen sämtlich in Gebieten, die Spuren alter Bergwerke aufweisen: bei Hoppecke, bei Alme und bei Altenbüren. Erwähnt wurde im Magdeburger Lehnkopiar von 1423 auch der Zehnt zu Helmeringhausen. Hieraus ergab sich die spannende Frage: Was kann das ferne Magdeburg an Helmering hausen so sehr interessiert haben, dass es wahrscheinlich über mehrere Jahrhunderte hinweg diesen Besitz verteidigte? Die Suche nach Helmeringhausen im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Münster ergab weitere überraschende Befunde schenkte Johann von Scharfenberg, ein Ritter, dem Stift Meschede Erzhalde
30 174 Sauerland 4/2013 seinen Besitz in Helmeringhausen und erwähnte, dass er diese Güter selbst von Johann von Plettenberg erworben habe. Mit der Familie Scharfenberg war eine sichere Verbindung zu Magdeburg gewonnen, denn das Lehen des Erzstiftes wurde an einen jüngeren Johann von Scharfenberg ausgegeben. Die Familie Scharfenberg aus dem niederen Adel sammelte Besitz in Bergwerksgebieten ebenso an wie die Familie von Plettenberg. Zum Olper Stadtjubiläum 2011 konnte nachgewiesen werden, dass sie um 1311 wahrscheinlich im Besitz der Kupfervorkommen auf der Rhonard südlich von Olpe war. Soweit die schriftlichen Spuren, die sich wie Indizien in einem Kriminalfall zusammenfügen. Wie reihen sich die heute noch im Gelände anzutreffenden Spuren alten Bergbaus in diese Befunde ein? Südlich von Helmeringhausen liegen zwei Bergbaubezirke in der Gemarkung. Am Nordhang der 611 m hohen Steinhelle befindet sich vom Dorf aus gesehen der erste Pingenzug. Von dort steigt das Gelände bis zur Wiedegge auf über 700 m Höhe an. Nahe eines Forstwegs liegt ein zweiter, größerer Bereich. Er wurde im September durch Geologen, Montanhistoriker, Verhüttungsexperten und Ortskundige untersucht. Unterhalb des Wegs beißt ein Erzgang aus. Zu finden ist Brauneisenstein, der in mehreren großen Pingen erschlossen wurde. Daneben liegen große Halden, die z. T. hochmanganhaltiges Erz enthalten, das offenbar nicht verhüttet wurde. Die Befunde schlossen Rennfeuerschlacke auf den Halden aus. Ohne Rennfeuerschlacke ist jedoch keine genaue Datierung der Stelle möglich. Wahrscheinlich ist das Erz im Bezirk am Schmalenberg in einer frühen Phase gefördert und dann zu tie fer gelegenen Rennfeueröfen transportiert worden. Als der Briloner Eisenberg und der Assinghauser Grund im 16. Jahrhundert boomten, fehlte Helmeringhausen unter den fördernden Gruben. Im 19. Jahrhundert wurden hier zwar zwei Felder (Clara, Macdonald) bergrechtlich verliehen, um sich Reserven für Hüttenwerke zu sichern. Doch genutzt wurden diese Rechte nicht mehr. Wegen des entlegenen Standorts entgingen die Halden in den Weltkriegen der Aufmerksamkeit der Erzsucher, die ansonsten massenweise Schlacken in die Hochöfen des Ruhrgebiets abtransportierten. So war es noch 2013 möglich, dieses alte, wenngleich nicht näher zu datierende Bergbaugebiet in Augenschein zu nehmen. Die Befunde bei Helmeringhausen zeigen einmal mehr, dass sich die Archive im Gelände und auf dem Papier sinnvoll ergänzen können. Ein ausführlicher Bericht mit Nachweisen über die Quellenlage und die Befunde im Gelände wird im SüdWestfalenArchiv Pinge mit dahinterliegender Erzhalde Fotos: Reinhard Köhne 2013 erscheinen, das der Arnsberger Archivar Michael Gosmann für die Stadt Arnsberg herausgibt. Besuchen Sie uns im Internet
31 Sauerland 4/ Vor mehr als 3000 Jahren vergraben: Neue bronzene Lanzenspitze aus dem Sauerland Abb. 2: In der Zeichnung ist an der verdrückten Tülle deutlich das runde Befestigungsloch erkennbar (Andreas Müller/LWL-Archäologie für Westfalen). bekannt. Lanzenspitzen sind größtenteils in ihrem Aussehen sehr unterschiedlich, weshalb es schwer fällt, sie zu Gruppen oder Typen zusammenzufassen. Man versucht sie hauptsächlich über äußerlich sichtbare Merkmale zu gruppieren, technologische Untersuchungen finden dabei keine Berücksichtigung. Eigenständige westfälische Typen sind bis jetzt nicht bekannt, einige Funde lassen sich aber, wie unser Neufund, in anderen Regionen vergleichbaren Formen anschließen. Die Merkmale unseres Neufunds sprechen für eine Zuordnung zu dem Typ Lüneburg III nach Jacob-Friesen. Friedrich Laux nennt den Typ Lüneburger Stoßlanzenspitze. Seine Variante A bezeichnet dabei die Exemplare ohne Mittelrippe, denen unser Stück anzuschließen ist. Darüber hinaus gliedert Laux diesen Typ in weitere Varianten auf. Die Kiersper Spitze lässt sich seiner Variante Hagen zuordnen, bei der es sich um kleine Lanzenspitzen mit relativ schmalem Blatt handelt. Die größte Blattbreite liegt bei diesen Exemplaren immer im unteren Drittel. Wie der Name bereits andeutet, ist der Typ der Lüneburger Stoßlanzenspitze hauptsächlich in Norddeutschland verbreitet. Vom Typ der von Eva Cichy Ein bronzezeitlicher Neufund ist für Archäologen in Westfalen immer ein Grund zur Freude, denn im bronzearmen Westfalen sind derartige Funde nicht so häufig, wie in den benachbarten Regionen. Dementsprechend begeistert wurde der Fund des ehrenamtlichen Sondengängers Marcus Hänsch im Juli 2012 von der LWL-Archäologie für Westfalen entgegengenommen. Dieser war zunächst irrtümlich bei den rheinländischen Kollegen der Außenstelle Overath des LVR- Amts für Bodendenkmalpflege abgegeben worden, die jedoch schnell feststellen mussten, dass der aus Kierspe (Märkischer Kreis) stammende Fund in den westfälischen Zuständigkeitsbereich fiel. Es handelt sich um eine Lanzenspitze aus Bronze von ca. 14,4 cm Länge, sie ist für eine Lanzenspitze relativ zierlich und klein. Das Stück weist einige rezente und ältere Beschädigungen auf. So ist das Blatt im Randbereich stark beschädigt, weil das etwas dünnwandigere Material dort gebrochen ist. Die Tülle des Stücks ist verdrückt und dadurch gebrochen. Das Blatt ist glatt und schmal, die Tülle ist ebenfalls glatt und unverziert. Der runde Tüllenmund weist einen Durchmesser von 1,5-2,2 cm auf. Ca. 1,3 cm oberhalb des Tüllenmunds befinden sich runde Löcher mit 0,4 cm Durchmesser. Durch diese Löcher wurde die Bronzespitze mit dem hölzernen Schaft, auf den sie aufgesteckt war, durch Nägel verbunden. Das Blatt ist an seiner breitesten Stelle 3 cm breit, der freie Tüllenteil (ohne Blatt) ist ca. 4 cm lang und entspricht damit etwa 35 % der Gesamtlänge des Stücks. Die beiden Schneiden verlaufen konvex. Das Stück besteht aus stabil gegossener, nicht blechartig dünn ausgeschmiedeter Bronze. Mit dem Neufund aus Kierspe sind nun aus Westfalen insgesamt 77 Lanzenspitzen Abb. 1: Den Aufenthalt im Boden über mehr als drei Jahrtausende hat die Lanzenspitze aus Kierspe nicht unbeschadet überstanden. Glücklicherweise blieb sie aber, bis auf kleinere Beschädigungen an den Schneiden, größtenteils intakt (Foto: Hermann Menne/LWL-Archäologie für Westfalen).
32 176 Sauerland 4/2013 Stoßlanzenspitze ohne Mittelrippe kennen wir nun aus ganz Nordrhein-Westfalen insgesamt acht Exemplare, von denen vier (unser Neufund sowie drei Funde aus Dors ten und Wesel) vermutlich der Variante Hagen zugeordnet werden können. Die Lanzenspitze aus Kierspe verweist also auf Kontakte in den norddeutschen Raum. Ob Sie von dort mitgebracht wurde oder doch in der Region selbst hergestellt wurde und lediglich eine aus dem Norden vermittelte Form aufgriff, ist nicht festzustellen. Der größte Teil dieser nordrhein-westfälischen Lanzenspitzen wurde ohne weitere Funde entdeckt, so auch unser Stück aus Kierspe. Diese Spitze wurde im Bereich einer Anhöhe in der Nähe einer alten Wegeverbindung entdeckt. Noch heute zeugen hier im Gelände deutlich erkennbare Hohlwegereste von einer von Frankfurt kommenden und über Kierspe nach Amsterdam führenden wichtigen mittelalterlichen Wegeverbindung, die auch als sogenannte Eisenstraße bekannt ist. Derartige Wegetrassen können durchaus seit Jahrtausenden bestanden haben. Grabhügel der Bronzezeit finden sich häufig in der Nähe alter Wegeführungen stammt die Lanzenspitze vielleicht aus einem derartigen Grab, das nicht mehr im Gelände sichtbar erhalten ist? Ein Grabensemble mit einer Lanzenspitze des Typs ist aus Etteln, Stadt Borchen (Kreis Paderborn) bekannt. Wie einige Funde z. B. aus dem Hönnetal eindrücklich belegen (darunter auch ein Exemplar des Typs Lüneburger Stoßlanzenspitze) ist aber auch die Deponierung (als Opfer?) von Lanzen an markanten Höhenpunkten nicht ungewöhnlich. Nur 18% der westfälischen Spitzen sind tatsächlich Grabfunde, stattdessen wurden sie häufig als Opfergabe meist an landschaftlich auffälligen Orten oder in Gewässern deponiert. Die drei niederrheinischen Funde des Typs aus Wesel und Xanten wurden z. B. aus Kiesgruben ausgebaggert, waren also wohl ehemals als Opfer in Gewässern deponiert worden. Da Lanzenspitzen größtenteils alleine ohne weitere Beifunde geborgen wurden, lassen sie sich meistens schlecht zeitlich einordnen. Nur einige der Lüneburger Stoßlanzenspitzen sind zusammen mit anderen Funden in Grabhügeln gefunden worden. Über diese gemeinsam niedergelegten Grabbeigaben, die zeitlich besser einzuordnen sind, können auch Rückschlüsse auf das Alter unserer Spitze gezogen werden. Demnach dürfte der Kiersper Fund aus der mittleren Bronzezeit (ca v. Chr.) stammen. Welche Funktion hatten die Lanzenspitzen? Generell geht man davon aus, dass die größeren Stücke eher als Stoßwaffen (Lanzen) und die kleineren als Wurfwaffen (Speere) benutzt wurden. Als dritte mögliche Verwendung zeichnet sich für Lanzen mit kurzem Schaft die Handhabung als Fechtwaffe ab so ließen sich Beschädigungsmuster an spätbronzezeitlichen Spitzen experimentell durch eine entsprechende Kampfesweise rekonstruieren. Dass diese Spitzen durchaus als Waffen eingesetzt wurden, zeigt sich auch im archäologischen Befund, z. B. auf der späturnenfelderzeitlichen Heunischenburg bei Kronach (Oberfranken), einer eindrucksvollen umkämpften Befestigungsanlage mit zahlreichen Militariafunden, darunter auch Lanzenspitzen mit charakteristischen Kampfspuren. Auch Skelettfunde mit erkennbaren Lanzenverletzungen oder sogar noch erhaltenen Lanzenresten belegen Diän Optakt gaffen dai Alphornbläösers van Körbke, un dai Vüörsitter vamme Verein, Elmar Reuter, begruißere de Luie. Äok de Bürgermester Dicke wünskere allen imme Saole ne guerren Dag. Hai praolere suine Gemeinde wahne. Hai wies op de Schoinheit van MÖHNESEE hen, op dai schoinen Wanderwiäge, dai hunnertjäöhrige Talsperre, dai friske Luft un dat Vergnaigen op un Noch einmal, aber Plattdeutsch: Mitgliederversammlung am 31. August 2013 von Evamarie Baus-Hoffmann amme Water. Met diän Finanzen genk dat imme Dingen genau säo in Uordnunge. Frau Dr. Gilhaus as Landrätin betuiknere dat Moihnedaal as en Juwel. Un se saggte Danke füor dai bestännige Aarbett vamme Siuerlänner Hoimatbund. Bui diäm Vüörsitter vamme Hoimatverein MÖHNESEE, Herrn Tolkacz, har- re me fottens diän Indruck, dat Ierwe van düseme schoinen Pläcksken Ääre wärt hui guet verwollen. Me kuiere dann äok van Windkraft. Me hält se nit füör Duibelstuigs, owwer me saiht se kritisk. Fracking, dat well me nit in dai Regiäon hewwen. De Regularien wassen fix affhannelt. Dao blitt alles buime Ollen. De Finanzen vamme SHB sin säo, biu dat bui ues imme Siuerlanne suin mott. Vui maket diän Ächsten nit grötter ase de Büxe ies! Peter Klein kuiere dann üewert Water. In uese Giegend, saggte hai, genk ues dat Water nit säo bolle iut. Gaß interessant was de Vüördrag van Karl Does. Füör mui was dat nigge, dat dai Moihnesoi inner Wanne van Grauwacke legget, säo kann dat Water nit wiägläupen. Un wuil et huier säo schoin ies, kuemmet vielle Mensken innet Moihnedaal as Suemmerfriesklers. Dat giet Geld in de Kasse, owwer dai Taustänniigen möttet dafüör äok liuter strack staohn. Dat Middages van de Sparkasse Säost was guet un genaug. Me mot dai fixen un fröndliken Frugges van dai Theuke loawen. Nummedags was iek unnerwiägens met Franz Kuschel op diäm Haar-Höhenweg un düör dat Moihnedaal. Me konn hui viell üewer Flora un Fauna, üewer Kultiuer un olle Geschichte lähren. Wunnerschoine olle Boime konn me saihen un Bäomstraoten. Un üewer hunnert Wiägkruiße stoiht huier in guerrer katholsker Traditiäon. Dao fellte me in, muine fruemme Oma Maria was huier te Hoime. Opa saggte fake, wann Oma nit säo woll as hai: Diu biss ne ollen Haariesel. Niu woit iek wat hai mennte: Oma was en biettken riubästig owwer met me guerren Hiärten. Imme üewergen hevve iek op dr Haar keine Iesels saihen. Dai Affschloat van düeseme Dag was de Guorresdenst in Sünte Pankratius. Dechant Best verkläöre ues dai schoine Kiärke. In suine Priäke schlaug Pastor Günther diän Boagen biet innet Mönsterland tau Augustin Wibbelt, ueseme plattduitsken Brauer. Dai Meßtexte harre Jupp Balkenhol met viel Ingefoil üewersatt. Dat Inganksleid nao dai Melodie Hier liegt vor deiner Majestät konn me van Hiärten un harre metsingen. Danke an alle, dai siek sülke Mögge gafften, ues Buihäörige diän Dag säo schoin un interessant te maken.
33 Sauerland 4/ dies. Den Einsatz von Lanzen bei der Jagd belegt ein Fund aus der Schorfheide, Ldkr. Barnim (Brandenburg). Hier wurde eine in einem Hirschschädel steckende Spitze gefunden. Auf andere Funktionen der Lanze lassen vor allem antike Quellen Rückschlüsse zu: So dienten Lanzen als Herrschaftszeichen, als Symbol einer militärischen Auszeichnung oder zeichneten ihren Träger als Besitzer übernatürlicher Kräfte aus. Darüber hinaus konnte sie bei der Verehrung bestimmter Götter (im germanischen Bereich z. B. Wotan) eine Rolle spielen. Der Besitz eines derartigen Stücks, welches schon einen nicht unbedeutenden Materialwert darstellte, zugleich eine fremde oder fremdländisch wirkende Waffe war, lässt einen gehobenen Status seines Besitzers vermuten. Gerne wüsste man mehr über diesen bronzezeitlichen Lanzenträger, der uns vor mehr als 3000 Jahren im märkischen Sauerland seine Lanze hinterließ. Literatur: Abels, B.-U., Die urnenfelderzeitliche Befestigung Heunischenburg, In: Menghin, W./Planck, D. (Hrsg.), Menschen Zeiten Räume. Archäologie in Deutschland (Berlin/Stuttgart 2002), 181. Bunnefeld, J.-H., Die Lanzenspitzen in Westfalen. In: Laux 2012, Herring, B., Die Gräber der frühen bis mittleren Bronzezeit in Westfalen. Eine Analyse der Bestattungssitten unter besonderer Berücksichtigung des Grabbaus und ihre Einbettung in die angrenzenden Gebiete, Bodenaltertümer Westfalens 48 (Mainz 2009). Hoffmann, S., Die Entstehung und Entwicklung der mittleren Bronzezeit im westlichen Mittelgebirgsraum. URL: hoffmann-stephanie (abgerufen am ) Jacob-Friesen, G., Bronzezeitliche Lanzenspitzen Norddeutschlands und Skandinaviens. Veröffentlichungen der Urgeschichtlichen Sammlung des Landesmuseums Hannover 17 (Hildesheim 1967). Laux, F., Die Lanzenspitzen in Niedersachsen. Prähistorische Bronzefunde V/4 (Stuttgart 2012). Tarot, J., Die bronzezeitlichen Lanzenspitzen der Schweiz. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 66 (Bonn 2000). Weber, C., Die bronzezeitlichen Lanzen- und Pfeilspitzen im Rheinland, Bonner Jahrbücher 201, 2001 (2004), Mutter Theresias Auftrag Am eigentlichen Jubiläumstag, dem 20. Juli 2013 begann die Generaloberin der Gemeinschaft, Schwester Magdalena Krol, ihre Ansprache mit folgenden Worten: In einem Psalm beten wir: Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz. (Ps 90,12) Genau dies versuchen Menschen oder Institutionen, wenn sie ein Jubiläum feiern. Rückschau und Nachdenken kann neue Einsichten und Handlungsentscheidungen schenken. Wir feiern in diesem Jahr die 150 Jahre unserer Ordensgemeinschaft 150 Jahre Er führt, ich gehe Olper Franziskanerinnen und Seligsprechung der Gründerin Mutter Maria Theresia Bonzel als krönender Abschluss aller Feierlichkeiten von Schw. Mediatrix Nies OSF Und wenn wir da zurückblicken stellen wir fest, dass Mutter Theresia die Anliegen und den Auftrag der Gemeinschaft in den Worten Anbetung und Werke der Barmherzigkeit wirklich gelebt hat und dass auch in den späteren Jahren, diese Worte Triebfeder für viele Aktionen waren, durch viele Risiken und Erfolge getragen haben. Auch für eine Ordensgemeinschaft verändern sich die Situationen und Herausforderungen. Auch schwindende Mitglieder gehören dazu. Aber wir wissen, dass es nicht die Zahlen sind, sondern es kommt darauf an, dass wir Mutter Theresias Auftrag auch heute noch zu erfüllen bereit sind und uns auf unsere Zeit und die Bedürfnisse der Menschen einstellen. Dazu gehört auch die Entscheidung, wieder einen Konvent in der Olper Innenstadt zu eröffnen, dass wir als Schwestern auch dort noch gesehen und wahrgenommen werden und die Schwestern für die Menschen zur Verfügung stehen. Das Jubiläumsjahr Wenn wir auf die Jahre 2012/13 zurückblicken, dann werden ganz besondere Erinnerungen wach. Da gab es viele Gedanken und Planungen, wie es denn gelingen könnte, diese Zeit des Erinnerns und des Dankens auch mit vielen Menschen zu feiern. Eröffnet wurde der Jubiläumsfestkreis schon mit der thematisch besonders gestalteten Klosternacht am 18. Januar 2013, die bereits seit einigen Jahren ein feststehender Termin ist. Und da sie immer von jungen Menschen gestaltet und besucht wird, war es uns wichtig, dass auch dort die Festzeit des Klosters genannt und erklärt wurde, denn für Mutter Theresia waren Kinder und Jugendliche bis ans Ende ihres Lebens ein Teil ihrer Sorge und ihres Engagements. Auch danach gab es immer neue Möglichkeiten, die Gemeinschaft und ihre Gründerin auch in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Der Gedanke, Jugendliche zusätzlich noch durch ein besonderes Projekt zu animieren, einmal darüber nachzudenken, was Ordensleben denn heute bedeuten kann oder soll, führte zu einer großen Aktion. Wir starteten einen Aufruf, wer denn wohl bereit sei, als Kundschafterin den Alltag der Schwestern heute zu erkunden, und zwar in Deutschland, aber auch in den verschiedenen Provinzen im Ausland. Klare und anspruchsvolle Aufgaben waren zur Bewerbung zu erfüllen und vorzulegen. Nachdem es zunächst sehr still war und kaum eine Reaktion zu vernehmen war, kamen in den letzten drei Wochen so viele schöne und gute, auch sehr eindrucksvolle Unterlagen im Mutterhaus an, dass es der Organisationsgruppe nicht leicht gefallen ist, eine gute Auswahl zu treffen. Aber die Entscheidung fiel und die Gruppen machten sich im Sommer und Herbst auf den Weg. Die Ergebnisse, d. h. auch die Sichtweisen der Jugendlichen zu dem, was sie erlebt haben, wird in einem oder mehreren Filmen verarbeitet, und auch wir Schwestern sind gespannt auf diese Erfahrungen, die gemacht wurden. Das große Jubiläum wollten wir auf jeden Fall im Mutterhaus selbst feiern und nicht in die Stadthalle oder dergleichen ausweichen. Das bedeutet aber, dass wir außer dem 20. Juli noch einen zusätzlichen Festtag einplanen und vorbereiten mussten, weil wir ja auch mit Familien mit ihren Kindern und möglichst vielen Menschen aus Olpe und Umgebung feiern wollten.
34 178 Sauerland 4/2013 War es doch das erste und vorrangige Anliegen der Gründerin, gerade für die Kinder da zu sein. Wenn es in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch zuerst um die vielen unversorgten Kinder ging, denen ein Zuhause und die Möglichkeit der Voraussetzung für ein selbständiges und unabhängiges Leben geschaffen werden sollte, so bin ich sicher, dass Mutter Maria Theresia viel Freude an den vielen Familien mit ihren Kindern hatte, die sich im und um das Mutterhaus herum tummelten und ihre Freude an den vielen Angeboten hatten. Mitarbeiter aus der Schule und den Einrichtungen der Jugendhilfe waren schier unerschöpflich mit ihren Ideen und haben dieses Fest Mutter Maria Theresia (gest. 1905) Foto: Franziskanerinnen in Olpe erst möglich gemacht. Unterstützt wurden sie dabei von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der GFO Geschäftsführung, den Mädchen, die als Kundschafterinnen ausgesandt werden sollten und vielen anderen hilfreichen Händen, wie z. B. auch von den vielen Kuchenbäcker/innen! Der Tag war gleichzeitig als Tag des offenen Klosters bezeichnet worden, an dem Führungen durch das Mutterhaus angeboten wurden, um endlich mal die Gelegenheit zu geben, hinter die Kulissen zu schauen und auch Fragen zu stellen, die schon so lange auf der Seele brannten. Das Interesse war viel größer als wir erwartet hatten, und wir Schwestern haben das wirklich genossen und standen gern Rede und Antwort. Als Abschluss des Tages waren alle Gäste eingeladen, in der Kirche an einer Vesper teilzunehmen, die vom Kammerchor unter der Leitung von Herrn Schneider vorbereitet und gesungen wurde. Es war ein würdiger und sehr schöner Abschluss des Tages! Der 20. Juli, der eigentliche Jubiläumstag, war so ganz anders, aber es war auch ein Tag, der zum Nachdenken, aber auch zu dankbarem Erinnern anregte. Eingeladen waren an diesem Tag offiziell Verantwortliche aus Kirche und Politik, aus all unseren Einrichtungen, die heute zur GFO gehören, Angehörige in dritter oder gar vierter Generation von Mutter Maria Theresia und viele Wohltäter der Gemeinschaft, aber auch Freunde und Angehörige der Schwestern und wer immer über die Pressemitteilungen sich auf den Weg gemacht hatte, um mit uns zu feiern. Für den Festgottesdienst war Erzbischof Hans Josef Becker aus Paderborn gekommen, der als Hauptzelebrant dem Pontifikalamt mit sechs Konzelebrantenvorstand und in seiner Predigt das Werk Mutter Maria Theresias und den unermüdlichen Dienst der Schwestern in vielen Gemeinden der Diözese würdigte. Während wir an dem Familientag eine Woche vorher draußen, vor dem Haupteingang der Kirche den Altar stehen hatten und die Menschen sich, wie bei der Brotvermehrung in Gruppen über die ganze Wiese verteilten, mussten an diesem Tag ca. 600 Personen in der Mutterhauskirche untergebracht werden. Es ist gelungen und es war eine großartige Atmosphäre, die auch durch die anschließenden Grußworte nicht gestört, sondern noch zusätzlich verstärkt wurde. Durch die Kabarettistin und Wahlsauerländerin Anja Geuecke, die die Moderation nach dem Gottesdienst übernahm, waren alle immer wieder bereit, auch dem nächsten Grußwort noch zuzuhören. Anschließend ließen sich dann aber auch alle gern von ihr einladen zu einem Imbiss oder auch zu einem Mittagessen und vor allem, dem zwanglosen Beisammensein. Die einzigen, die damit ein Problem hatten, waren die Olper Schützen, die zwar nur inkognito anwesend waren, die sich aber nach der Feier gleich auf den Weg machen mussten, um noch rechtzeitig am Marktplatz oder wo auch immer in Olpe zu sein, wo schließlich das Olper Hochfest, das Schützenfest seinen Anfang nahm. Für uns Schwestern waren beide Festtage unvergesslich schön und wir haben vielen Helfern und Helferinnen zu danken, die das möglich gemacht haben, und Pfarrer Clemens Steiling gilt in dieser Runde ein ganz besonderer Dank! Die Seligsprechung der Gründerin Nach den Jubiläumsfeierlichkeiten waren dann alle Augen auf den 10. November gerichtet, den Tag, an dem Mutter Maria Theresia selig gesprochen wurde. Einen Tag später wurde sie vom Mutterhaus in die Olper Pfarrkirche St. Martinus überführt und somit im Schatten ihres Elternhauses beigesetzt. Sie wird durch die Seligsprechung auch offiziell als ein Mensch bestätigt, dem es gelungen ist, ein Leben aus der Kraft des Evangeliums und aus dem Vertrauen in Gottes weise Führung zu leben. Natürlich gibt es viele Menschen denen das unter mehr oder weniger schwierigen Bedingungen gelingt und von denen niemand spricht. Umso notwendiger ist es gerade auch in unserer heutigen Zeit dass sich Gruppen und Vertreter der Kirche auf den Weg machen, solch beispielhafte Lebenswege auch darzustellen, um dadurch immer wieder neu deutlich zu machen, dass die Auseinandersetzung mit dem Evangelium, und das Hineinnehmen dieser Botschaft Jesu in das eigene Leben durchaus möglich und auch erstrebenswert ist. Darum ist die Frage berechtigt und zur Begründung all der Jubiläums-Feierlichkeiten unumgänglich und soll auch hier bedacht werden: Wer war Mutter Maria Theresia und was waren ihre Anliegen? Im Zuge der Neugründungen entstand 1859/60 in Olpe, unter der Leitung von Mutter Clara Pfänder, eine franziskanisch geprägte Frauengemeinschaft. Clara Pfänder hatte durch Regina Löser Aline Bonzel in Olpe kennengelernt, die schon sehr früh die Entscheidung für sich getroffen hatte, sich einer Ordensgemeinschaft anzuschließen. Dieser Plan wurde erst durch die Mutter verhindert und konnte dann, aufgrund einer schweren Herzerkrankung, nicht verwirklicht werden. Regina Löser und Clara Pfänder konnten sie aber überzeugen, und sie begannen in Olpe ihr religiöses Leben, dass durch den Dienst am Menschen, besonders in der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch in der Krankenpflege deutlich und erfahrbar werden sollte. Am 30. Oktober 1860 wurden sie als Ordensgemeinschaft unter dem Namen Schwestern des heiligen Franziskus, Töchter der heiligen Herzen Jesu und Mariä vom Bischof in Paderborn anerkannt und Schwester Clara Pfänder wurde als Oberin eingesetzt. Im Dezember 1860 war die erste Einkleidung, während der auch Aline Bonzel den Namen Schwester Maria Theresia vom heiligsten Sakrament bekam. Da es aber schon bald Probleme mit der in Olpe ansässigen Gemeinschaft der Vinzentinerinnen gab, wurden sie gebeten, ihre Zentrale, das Mutterhaus, an einen
35 Sauerland 4/ anderen Ort zu verlegen. Mutter Clara und Schwester Theresia fanden dann in Salzkotten ein passendes Gebäude, und schon bald wechselte Mutter Clara mit einer größeren Gruppe der Schwestern nach dort. Schwester M. Theresia blieb, auf Drängen der Olper Bevölkerung, mit wenigen Schwestern in Olpe, wo nun die erste Filiale des Mutterhauses in Salzkotten war. Für die damalige Zeit war die Entfernung zwischen Olpe und Salzkotten recht groß, und das wirkte sich nicht sehr positiv auf die Zusammenarbeit aus. Es gab immer mehr Missverständnisse und Probleme, die schließlich dazu führten, dass Bischof Konrad Martin sich für eine vollständige Trennung der beiden Gemeinschaften entschied und das entsprechende Schreiben am 20. Juli 1863 die Schwestern in Olpe erreichte. Für Schwester Theresia war das absolut nicht das, was sie wollte, und sie überlegte auch jetzt wieder, sich mit den Schwestern in Olpe einer anderen Kongregation anzuschließen und bat darum, wenigstens eine erfahrene Ordensfrau einer anderen Gemeinschaft als Oberin und Leitung für die ersten Jahre einzusetzen. Aber diese Bitte wurde ihr nicht gewährt, und sie musste sich selbst auf den Weg machen. Ihr selbst wurde immer deutlicher, dass hier mehr als nur menschlicher Entscheidung zu folgen war. Sie erkannte für sich, dass hier ein Auftrag Gottes zu erfüllen war und sie betete: Gott, du hast mich nun hier hergestellt, nun hilf mir auch, dass ich das kann. Und sie machte sich nun daran, neue Statuten für die kleine Gemeinschaft in Olpe zu erarbeiten und holte sich dazu die Beratung von Mutter Franziska Schervier und dem Franziskaner Pater Bonaventura. Geprägt waren ihre Pläne jetzt von einem immer tiefer werdenden Gottvertrauen. Alle Probleme und Schwierigkeiten, die zu bewältigen und zu lösen waren, legte sie in die Hand Gottes und vertraute der göttlichen Vorsehung. Ihr Leitspruch Er führt ich gehe bekam immer mehr Bedeutung und ermutigte sie, alle gestellten Herausforderungen anzunehmen und zu tun, was immer ihr möglich war, denn dann so sagt sie wird Gott das Seine dazu tun und uns helfen. Die Statuten und Aufgaben Am 6. Juli 1865 genehmigte Bischof Konrad Martin die neu ausgearbeiteten Statuten nach der Regel des III. Ordens des hl. Franziskus für die Gemeinschaft der Armen Franziskanerinnen von der Ewigen Anbetung in Olpe. Die Gemeinschaft wuchs, übernahm immer mehr Aufgaben in der Erziehung Aus der Redaktion Zur vierten und damit zur letzten Sitzung des Jahres trafen sich unsere Redaktionsmitglieder am 8. Oktober wie gewohnt in Cobbenrode. Der Vorsitzende der Redaktionskonferenz, Dieter Wurm, teilte bei der Begrüßung mit, dass ihn hinsichtlich der letzten Ausgaben unserer Zeitschrift viele positive Rückmeldungen erreicht haben. Diese betrafen sowohl die Bildauswahl als auch den Inhalt und die Vielseitigkeit der Textbeiträge. In diesem Zusammenhang begrüßte er auch die Zunahme der Leserbriefe. Für das kommende Jahr will man sich weiterhin mit wichtigen Schwerpunktthemen befassen. Unser l. Vorsitzender Elmar Reuter erklärte sich bereit, in Anknüpfung an seine früheren Arbeiten zum Thema Windenergie nunmehr einen Grundsatzartikel zu verfassen, in dem der neueste Sachstand wiedergegeben wird. Bekanntlich bewegt dieses Thema zurzeit nicht nur die kommunalen Parlamente im Sauerland, sondern auch viele unserer Bürger, die mittelbar oder unmittelbar von neuen Windkraftanlagen betroffen sind. Susanne Falk bittet, in dem Artikel nach Möglichkeit auch den aktuellen Beratungsstand in den einzelnen Kommunen anzugeben. Eine weitere wichtige Anregung Elmar Reuters betrifft die Veranstaltung von Werkstattgesprächen, um mit Fachleuten und interessierten Laien die Arbeit unseres Vorstandes auf eine breitere Basis zu stellen. Zunächst ist ein Gespräch über die Auswirkung des demographischen Wandels auf die Städte und Dörfer des Sauerlandes geplant. Unsere Zeitschrift wird auch darüber umfassend berichten. Der Vorschlag von Kreisheimatpfleger Hans-Jürgen Friedrichs, auch ein Werkstattgespräch zum Thema Heimat vorzubereiten, wird von allen begrüßt. Abschließend bedankt sich Dieter Wurm als Vorsitzender der Redaktionskonferenz für die konstruktive Mitarbeit im vergangenen Jahr. Unter dem Beifall aller Teilnehmer hebt er dabei die Arbeit unseres Heimatfreundes Hans Wevering hervor, dem nun schon seit vielen Jahren die bekanntlich mit viel Arbeit verbundene technische Schlussredaktion anvertraut ist. Dr. Adalbert Müllmann und Bildung junger Menschen, bes. der Mädchen; aber auch in der Krankenpflege, und sie wurden von vielen Gemeinden angefordert. Der Einsatz in der Pflege von Kranken in den Familien außerhalb Olpes, wurde schnell zu einem Einsatz in kleinen Krankenhäusern, die zunächst in kleinen und armseligen Räumlichkeiten stattfand, in denen nur einzelne Kranke untergebracht werden konnten, die Krankenhäuser wurden aber schon bald zu immer größer werdenden Hospitälern ausgebaut. Dazu gehören z. B. noch vor dem Kulturkampf das Karolinen-Hospital in Hüsten (1870), auch Morsbach 1871 ( Idioten ), Eckenhagen, Wissen 1871 u. a. Mutter Maria Theresia, wie sie nun genannt wurde, sah die Nöte ihrer Zeit, und mit ihren Schwestern reagierte sie darauf und half überall dort, wo Hilfe gebraucht wurde, auch in den Lazaretten oder während der Typhusepidemie in der Zeit nach dem Deutsch-Französischem Krieg 1870/71. Durch die Kulturkampfgesetze 1875 wurde die junge Gemeinschaft ganz gravierend an ihrer Arbeit und auch ordensinternen Entwicklung behindert. Mutter M. Theresia reagierte auch auf diese Zeichen der Zeit, nahm Kontakt auf mit einem Bischof in USA und schickte ihre ersten Schwestern im Spätherbst 1875 bereits nach Nordamerika, wo ihre Dienste gebraucht und gern angenommen wurden. Auch dort entwickelte sich die Gemeinschaft weiter, und es mussten später zwei Provinzen errichtet werden, um organisatorisch besser planen zu können. Die übernommenen Aufgaben und Tätigkeiten, vor allem in Schulen, auch Universitäten und im Krankenhauswesen, waren gern gesehen und sind bis heute noch aktuell und geschätzt. Erst nach 1882 konnten neue Mitglieder aufgenommen werden und damit auch Schwestern in die Pfarreien und Gemeinden geschickt werden. Und es entstanden Krankenhäuser, Kindergärten, Erholungseinrichtungen für Frauen und Mütter, und besonders im Sauerland, im Ruhrgebiet aber auch anderswo, entstanden Möglichkeiten der Mädchenbildung durch Kochund Nähkurse, aber auch Pensionate und
36 180 Sauerland 4/2013 SEIT 1928 Lange Wende 94 Mendener Straße 8 Tel / Tel / Arnsberg-Neheim Schulen zur Fort- und Weiterbildung. In keinem der Orte wurde die Krankenpflege vergessen. Als Beispiele für viele andere Gründungen seien genannt: In Allendorf gab es seit 1894 eine Ambulante Krankenpflege und es folgten viele weitere Orte, wohin die Schwestern gerufen wurden und wo sie ihre Tätigkeit aufnahmen. In Sundern wurde erst 1918 mit der Krankenpflege begonnen, wo die Lungenfürsorge eine besondere Bedeutung hatte, aber auch der Kindergarten und die Handarbeitsschule wurden eröffnet. Die Gemeinnützige Gesellschaft für Krankenpflege und Kindererziehung Auf dem Hintergrund all der Erfahrungen, die mit den politischen Bedingungen während des Kulturkampfes verbunden waren, war es für Mutter M. Theresia sehr wichtig, alles zu tun, um die Gemeinschaft mit all denen, für die sie zu sorgen hatten, auch wirtschaftlich so gut wie möglich abzusichern. Mit ihrer Assistentin Schwester Paula und durch fachliche Beratung und Unterstützung erreichte sie, dass die Gemeinnützige Gesellschaft für Krankenpflege und Kindererziehung bereits 1902 gegründet werden konnte. Mutter M. Theresia, die Franziskanerin geworden war, weil ihr gerade das franziskanische Armutsideal so wichtig und wertvoll war, hatte genügend Weitblick, und aus der Sorge um die Menschen, die sich ihr anvertraut hatten, traf sie diese Entscheidung. Auch hier galt das Wort: Alles ist in Gottes Hand, und wenn wir tun, was an uns ist, kann man ruhig sein. Und ihr unerschütterliches Gottvertrauen hat sie auch durch diese schwierigen Zeiten getragen und ihr die Kraft gegeben, ihren Schwestern durch ihr Beispiel voranzugehen. Die Gemeinschaft wuchs, die Aufgaben nahmen zu, und als sie 1905 starb, waren etwa 1500 Schwestern auf dem Weg, den sie vorbereitet und organisiert hatte, in dem Auftrag tätig, die Anbetung Gottes mit den Werken der Barmherzigkeit zu verbinden und so Zeugnis für die Liebe Gottes abzulegen, in Kindergärten, Schulen, Universitäten, Krankenhäusern usw. in USA und in Deutschland. Gegenwärtige Situation in Deutschland Heute haben wir in Deutschland noch 127 Schwestern, von denen die meisten Altenheimbewohnerinnen sind. Von der Richtung unseres Einsatzes, in der es nach außen ging, nach neuen Betätigungsfeldern usw., haben wir uns weitgehend verabschieden müssen, und eine wichtige Aufgabe ist die gute Versorgung unserer älteren und alten Schwestern, die auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken und denen wir alles verdanken, was uns heute noch zur Verfügung steht. Aber auch wenn unsere älteren Schwestern nicht mehr an großen Aktionen und sichtbaren Leistungen beteiligt sind, so machen sie uns doch durch ihr Leben, durch die vielen Begegnungen, die ja auch in der Krankheit noch möglich sind und durch die Art wie sie mit ihrer Krankheit und dem Alt-Sein und Alt-Werden umgehen, darauf aufmerksam, dass auch dadurch etwas vom Reich Gottes deutlich werden kann. Dass das nicht immer so gelingt, wie sie es auch selbst gern möchten, ist eine menschliche Erfahrung eigener Schwachheit. Aber zu wissen, dass wir gerade durch diese Schwestern eine große Schar intensiver Beter hinter uns haben, die auch für die wenigen jungen Schwes tern so etwas wie ein festgetretener Boden sind, auf dem es gut gelingt, auch für die heutige Zeit Ideen zu entwickeln und gerade jungen Menschen, aber auch allen, die an der Tür stehen, gute Ansprechpartner und Mit-Pilger auf dem Weg durch unsere heutige Zeit sind. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Ideen da entwickelt werden und wie Menschen darauf reagieren, ob im pastoralen Dienst, in der Arbeit in sozialen Brennpunkten oder in der Obdachlosigkeit. Auch hier trifft das Wort Mutter M. Theresias zu: Wenn wir alles tun, was in uns möglich ist, dann wird Gott auch das Seine dazu tun und darauf dürfen wir vertrauen, ob hier in Deutschland, in USA, in Brasilien oder auf den Philippinen. ER führt auch heute noch, und es ist gut, wenn wir IHM folgen und das gilt nicht nur Ordensangehörigen, sondern jedem, der/die sich Christ nennt. Seligsprechungsprozess und die öffentliche Verehrung Fast 60 Jahre waren vergangen, bis der damalige Paderborner Erzbischof, Kardinal Lorenz Jaeger durch Gespräche und Ermutigung der Generaloberin der Gemeinschaft erreichte, dass ein Seligsprechungsprozess eingeleitet wurde. Eigentlich muss ein solcher Prozess spätestens 30 Jahre nach dem Tod eingeleitet worden sein. Aber dem Antrag wurde zugestimmt, und Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger eröffnete den Prozess am 18. September Die Freude bei den Schwestern war groß, doch niemand ahnte, wie weit und beschwerlich der Weg bis zur Seligsprechung wirklich sein würde. Darum sind wir sehr froh, dass der lange Prozess am 28. März 2013 durch die bestätigende Unterschrift des Dekretes durch Papst Franziskus beendet war und uns wenig später der Seligsprechungstermin für den 10. November mitgeteilt wurde. Nach diesem Festakt der Seligsprechung am 10. November 2013 ist es dann auch möglich, sie nicht nur privat zu verehren, sondern sie auch öffentlich an einem Gedenktag, dem 9. Februar, zu feiern. Ihr Werk und ihre Anliegen sind nie in Vergessenheit geraten und wurden jetzt schriftlich für die Ewigkeit festgehalten. Mögen wir alle, ihren Leitsatz ER führt Ich gehe hin und wieder bedenken und dabei von ihrem Beispiel eines unerschütterlichen Gottvertrauens lernen!
37 - Hochsauerlandkreis.de Das Museumserlebnis im Sauerland Öffnungszeiten: Mi. bis Sa.: 15:00-17:00 Uhr So.: 10:00-12:00 Uhr (vom 1.11 bis 31.3) So.: 10:00-16:00 Uhr (vom 1.4 bis 31.10) Gruppen ab 10 Personen nach Vereinbarung. Bahnfahrten jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 15:00 Uhr - 17:00 Uhr. (vom 1.4 bis 31.10) Gruppenfahrten nach Anmeldung möglich. Auf über m² erwarten Sie: Historische Dampf-, Benzin-, Diesel- und Elektromaschinen Heimat- und Volkskunde der Region Eslohe Traditionelle Handwerke und Landwirtschaft Schmiede Wechselausstellungen Idyllische Freianlagen mit historischen Gebäuden, Wasserkraftanlagen und Energiespielplatz Besondere Angebote des Museums: Fahrten mit der Werksbahn Maschinenvorführungen unter Dampf zweimal jährlich Dampftage Museumsküche und Werkstattangebote Sonderausstellungen Konzerte verschiedener Arten Museumsverein Eslohe e.v. Homertstraße Eslohe Tel.: oder Web: Mail: info@museum-eslohe.de Sauerland-Literatur aus dem DampfLandLeute-MUSEUM ESLOHE Zu unserem Sortiment gehören Klassiker des Sauerlandes, unterhaltsame Heimatlektüre und Werke der Regionalforschung. Folgende Bücher können Sie per Internet, Post und Telefax bestellen oder während unserer Öffnungszeiten im Museum erwerben: Unsere besondere Überraschung zum Winterbuchmarkt 2013: Fang dir ein Lied an! Selbsterfinder, Lebenskünstler und Minderheiten im Sauerland (688 Seiten 25 ) Die Klassikerin der Sprache des Sauerlandes Werkausgabe Christine Koch 1. Gedichte in sauerländischer Mundart (15 ) 2. Erzählungen und andere Mundartprosa (15 ) 3. Hochdeutsche Werke (12 ) 4. Liäwensbauk Biographie der Dichterin (19 ) 5. Hochdeutsches Arbeitsbuch (12 ) 6. CD Christine Koch-Lieder Mon-Nacht (12 ) 3. STRUNZERDAL: Literatur des 19. Jahrhunderts und Klassiker (324 Seiten 20 ) 4. LIÄWENSLÄUP: Mittelalter; Zeit vom Kulturkampf bis zum 1. Weltkrieg (856 Seiten 30 ) Alles ist Wandel: Autobiographie der Josefa Berens-Totenohl (238 Seiten 12 ) Vgl. dazu daunlots Nr. 60: Das Buch vom Pampel Geschichten aus Eslohe Der Klassiker über ein sauerländisches Dorforiginal (224 Seiten 14 ) Joseph Pape Lesebuch (13 ) Joseph Pape als Theologe (12 ) Esloher Forschungen Bd. II: Wirtschaft und Verkehr (608 Seiten 25 ) Bd. III: Politik und Verwaltung (494 Seiten 30 ) Bd. IV: Kunst und Kultur (743 Seiten 40 ) Esloher Museumsnachrichten Landschaft, Geschichte, Kultur (je nach Jahrgang 6 oder 8 ) Internet-Informationen zu unseren Buchangeboten auf und Forschungsreihe zu Mundartliteratur & Kulturgeschichte des Sauerlandes shop@museum-eslohe.de 1. IM REYPEN KOREN: Nachschlagewerk zu Autoren & Werken (768 Seiten 30 ) Telefonische Bestellungen unter: 02973/6212 oder Fax AANEWENGE: Leutegut und Leuteleben im Sauerland (704 Seiten 30 ) Dampf Land Leute-MUSEUM ESLOHE, Homertstraße 27, Eslohe.
38 182 Sauerland 4/2013 Ofenkunst im Sauerland Der gegossene Prunkofen ist um 1905 in der Olsberger Hütte gefertigt worden. Die weißen angeschraubten Ornamente sind in dem Werk liert. Höhe des Ofens 180 cm Der Ofen stand in einer Wohnung in Bestwig. Testamentarisch war festgelegt, dass der Ofen in das Heimatmuseum Eversberg kommt. Ausschnitt im oberen Bereich des Ofens. Fotos: Winfried Kotthoff
39 Sauerland 4/ Idyllisch schmiegt sich der See in die Landschaft. Als Ort, an dem im Sommer Wasserratten Abkühlung suchen, an 365 Tagen im Jahr Spaziergänger, Jogger und Angler Entspannung finden, ist der Hillebachsee in Niedersfeld an sich schon eine tolle Sache. Die wenigsten wissen, dass sich neben dem trichterförmigen Abfluss ein kleiner Schatz befindet: Eine Turbine, angetrieben vom Wasser auf seinem Weg in die Ruhr. Im Jahr produziert sie ca kwh Strom. Installiert hat die Turbine ein Mann, der sich mit Leib und Seele der Wasserkraft Dr. Bernd Walters Ein Herz für die Wasserkraft von Silke Kloock verschrieben hat: Dr. Bernd Walters aus Brilon. Der Allgemeinmediziner ist über die Grenzen des Sauerlandes dafür bekannt, dass er mit hohem technischen Können, Engagement und jeder Menge Herzblut alte Wasserkraftanlagen aufkauft, saniert und wieder instand setzt. Oder eben, wie am Beispiel in Niedersfeld, neue aufbaut und so vor einigen Jahren das höchstgelegene Wasserkraftwerk im Sauerland ins Leben rief. In Herford ist Bernd Walters geboren, hier hat er die ersten Lebensjahre verbracht. Viele Mühlen stehen dort und die haben ihn schon als Kind begeistert. Seit 1962 lebt er in Brilon. Bis Juni 2010 hat er eine Praxis für Allgemeinmedizin betrieben und ist bis heute als Arbeitsmediziner tätig. Dr. Bernd und Gesa Walters bei der Aktivierung der Rechenreinigungsmaschine Eigentlich nur Anschauen wollte er sich 1982 die alte Mühle im Möhnetal. Ob er der neue Besitzer sei wurde er dort gefragt und erfuhr, dass die Mühle zum Verkauf stand. Der Kontakt zum Verkäufer wurde schnell hergestellt, Bernd Walters gab sein Gebot ab und war bald Eigentümer der alten Stadtmühle, die schon vor 500 Jahren urkundlich erwähnt worden war. Das Besondere daran: Das weitaus höhere Gebot eines zweiten Interessenten hat der Verkäufer ausgeschlagen, denn dieser wollte die Mühle abreißen, während für Bernd Walters ausschließlich Sanierung in Frage kam. Mit Hilfe seines Vaters verbrachte er seine Freizeit in den nächsten drei Jahren an der Mühle, bis wieder ein Rad ins andere griff, genau das, was ihn als Kind schon so fasziniert hatte und sich das Mühlenrad wieder drehte. (Siehe dazu: Jahrbuch Westfalen 2010, S ) Weitere Mühlen und Wasserkraftanlagen folgten, in vielen steckt jahrelange Arbeit, die auf den Arzt nach Praxisschluss zukam, noch dazu die Tatsache, dass die Patienten viele Kilometer Fahrweg in Anspruch nahmen. Besucherdemonstration Mittlerweile ist er Eigentümer bzw. Miteigentümer von 19 Wasserkraftanlagen an Möhne, Hoppecke, Diemel, Ruhr, Lenne, Bocholter Aa, Röhr und Agger. An vielen hat er selbst Hand angelegt und wieder funktionsfähig gemacht. Insgesamt werden im Jahr ca Mio. umweltfreundliche kwh Strom erzeugt. Frei von CO², Feinstaub und ohne atomaren Endmüll. In Tagen der Klimakonferenzen und Diskussionen um erneuerbare Energien eine erfreuliche Bilanz, für die er sicherlich viel Schulterklopfen erhält? Leider nicht, selbst unter Naturschützern gibt es immer wieder Kritiker. Sie möchten die Gewässer in einen Ur-Zustand zurückversetzen. Seit dem Jahr 2000 gilt die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die sich den Gewässerschutz auf die Fahne geschrieben hat. Unter anderem geht es dort um die Durchgängigkeit der Fließgewässer und intakte Ökosysteme, was unbestritten wichtig ist. Es liegt auf jeden Fall in meinem Interesse, naturnah zu arbeiten! betont Bernd Walters ausdrücklich. Zu fast jedem seiner Wasserkraftwerke gehört mittlerweile eine Fischtreppe, um die Durchgängigkeit für Fische zu gewährleisten. Noch keinen Umweltpreis aber immerhin viel Lob gab es zum Beispiel für die Fischtreppe in Nuttlar. Rechen verhindern zudem, dass Fische in die Turbinen geraten. Leider kann es in den Wanderzeiten mal vorkommen, dass Fische sich durch die engen Abstände der Rechen regelrecht durchzwängen aber ansonsten gewährt der Rechen wirklich guten Schutz!
40 184 Sauerland 4/2013 Die automatische Fettpumpe im Turbinenraum Auch auf die Mindestwassermenge achtet er gewissenhaft, damit im Mutterbett ausreichend Wasser für Fische und Flussbewohner vorhanden ist. So hat beispielsweise das Wehr der alten Mühle in Giershagen eine Messsonde bekommen, um den Wasserstand der neu angelegten Fischtreppe zu kontrollieren, da durch das natürliche Gefälle dieser am Ende des 780 m langen Wehrkanals niedriger als am Anfang ist. Weiterhin ist die Fischtreppe mit sogenannten Störsteinen und Becken versehen worden, um die Strömungsgeschwindigkeit für die wandernden Fische zu reduzieren. Wo früher mit dem Wasser eine Getreidemühle und ein Eisenhammer betrieben wurden, werden heute bis zu 70 kwh Strom erzeugt. Und das an nahezu 365 Tagen im Jahr, denn an der Diemel wird die 100 PS starke Turbine, Bj. 1948, der Giershagener Mühle davon profitieren, dass im Sommer Wasser aus der Diemeltalsperre abgelassen wird, um den Wasserstand zu regulieren und die Weser damit schiffbar zu halten. Ein Jahr hat die Sanierung des ehemaligen Charlottenhammers gedauert, aber seit drei Monaten läuft hier alles wieder reibungslos! erzählt Bernd Walters sichtlich stolz. Im Turbinenraum zeigt er auf die automatische Fettpumpe, die alle Lager mit Schmierstoff versorgt: Früher fehlte es an Fett, es gab einfach keins. Dadurch sind oft die Teile kaputt gegangen. Zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Frau Gesa, die der Doktor mit seiner Leidenschaft angesteckt hat, haben Neu angelegte Fischtreppe der Giershagener Mühle sie in gut 700 Arbeitsstunden die Giershagener Mühle wieder zum Leben erweckt. Den Eingang zum Wehrkanal mauerten sie mit historischen Steinen wieder auf. Die Wasserkraft ist die Perle der regenerativen Energien! hebt er hervor. Sie wird gleichmäßig angeboten. Windräder stehen still ohne Wind, Sonnenenergie funktioniert nur mit Sonne und ich würde mich sehr freuen, wenn die Wasserkraft wieder mehr Anerkennung finden würde! In ganz trockenen Sommermonaten kann es mal vorkommen, dass eine Anlage stillsteht, aber ansonsten kann jederzeit Strom produziert werden, der ins öffentliche Netz von RWE, E.ON, Agger Energie und der Stadtwerke Fröndenberg gespeist wird. Für viele ist der Begriff Industriekultur ausschließlich mit dem Ruhrgebiet verbunden. Weit gefehlt, das Sauerland muss sich nicht verstecken: Hier stehen Wasserkraftwerke, oftmals architektonisch eindrucksvolle Gebäude sowie alte Stauwehre, mit denen früher an zahlreichen Stellen Sauerländer Flüsse gestaut wurden, um Wasserräder z. B. für die Eisenhämmer und Mühlen anzutreiben. Sie sind es wirklich wert,
41 Sauerland 4/ Der Eingang zum Wehrkanal, aufgemauert mit historischen Steinen als Industriedenkmal erhalten zu bleiben. Zweifellos ist es oftmals schwierig, Naturschutz und Industriekultur in Einklang zu bringen, jedoch sollte es möglich sein, von beiden Seiten aufeinander zuzugehen statt von vornherein zu sperren. Vor einigen Wochen kam die Anfrage seitens der Bezirksregierung Arnsberg, ob ich nicht am alten Wehr der Firma Busch an der Ruhr in Velmede eine Wasserkraftanlage bauen möchte. Das ist doch ein guter Ansatz, mit vorhandenem Material dem Wehr, dem Wasser sowie der Investition in Technik, Strom zu erzeugen. Hier lobt er ausdrücklich die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis und der Bezirksregierung Arnsberg. An anderen Stellen ist eine Kooperation unmöglich: Dort wird eher ruiniert statt erhalten. Dabei sind wunderschöne Bauwerke aus Natursteinen dabei. Fischtreppen werden rigoros abgelehnt: Wenn die Anlage bald abgebaut wird, genehmigen wir doch vorher keine Fischtreppe, bekomme ich dort zur Antwort, redet sich Bernd Walters den Ärger von der Seele. In Warburg gab es eine Firma, die seit vierzig Jahren Wasserkraftwerke gepflegt hat. Heute ist sie insolvent, weil Behörden Investitionen blockieren und Schwierigkeiten machen. Turbine Sechs Festangestellte und Aushilfskräfte helfen ihm, die Anlagen instand zu halten. Sie sind genauso mit dem Herzen dabei wie ihr Chef, manche rund um die Uhr erreichbar und verrichten trotz zum Teil fortgeschrittenen Alters mit körperlichen Einschränkungen hochmotiviert die beschwerliche Arbeit. Auf die Frage, welches für ihn das schönste Wasserkraftwerk ist, überlegt er kurz und erzählt: Das Kraftwerk in Wickede! Im Sommer 2011 hat es 100jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Meine Frau und ich haben nach einer Störung bis morgens um 3.00 Uhr die Original-Turbine in Gang gesetzt. Und an welchem hängt sein Herz am meisten? Hier kommt die Antwort prompt und die Augen leuchten: Die alte Stadtmühle in Rüthen! Das war meine erste Mühle, mit der fing alles an... Wer einmal die Gelegenheit bekommen hat, sich mit ihm über sein ehemaliges Hobby zu unterhalten, wird sich nicht gewundert haben, dass eines Morgens in der Westfalenpost folgende Anzeige zu finden war: Rechenreinigungsmaschine Am gebe ich meine Praxis für Allgemeinmedizin auf, um mich von nun an meiner großen Leidenschaft, der Wasserkraft zu widmen!
42 186 Sauerland 4/2013 Der ehemalige Charlottenhammer (Bildquelle: Infotafel Giershagener Bergbauspuren, abfotografiert) Und die ist nach wie vor ungebremst: So soll noch in diesem Jahr in Hachen ein Wasserkraftwerk in Betrieb gehen und die Sanierung des Bocholter Eisenhammers aus dem 17. Jhd. steht vor der Tür. Viel Gutes sei ihm für die Zukunft gegönnt: Weiterhin Erfolg und Glück beim Konsens mit Behörden und Naturschützern sowie viel Freude und Gesundheit für die Zukunft in seinem unermüdlichen Bemühen um die Wasserkraft und historischen Anlagen! Auflistung der Wasserkraftwerke und Anlagen an der Möhne Stadtmühle in Rüthen Ölmühle Rüthen Liethwerk Allagen Wasserkraftanlage Möhnebogen Neheim an der Hoppecke Wasserkraftanlage Brilon Wald an der Diemel Giershagener Mühle an der Ruhr Hillebachsee Niedersfeld Wasserkraftanlage Mühlheim Wasserkraftanlage Wildshausen Wasserkraftanlage Wickede an der Lenne Wasserkraftanlage Elverlingsen am Bocholter Aa Wasserkraftanlage Eisenhütte an der Röhr Wasserkraftanlage Hachen an der Agger (Aggerkette) Wasserkraftanlage Bieberstein Wasserkraftanlage Osberghausen Wasserkraftanlage Wiehlmünden Wasserkraftanlage Haus Ley Wasserkraftanlage Ohl-Grünscheidt Wasserkraftanlage Ehreshoven I + Wasserkraftanlage Ehreshoven II Mitarbeiter dieser Ausgabe: Werner Neuhaus, Sundern Theo Hirnstein, Sundern-Altenhellefeld Norbert Baumeister, Arnsberg Werner F. Cordes, Attendorn Klaus Baulmann, Sunderm Franz-Josef Huß, Eslohe Rudolf Rath, Balve Wilfried Reininghaus, Düsseldorf Eva Cichy, Olpe Evamarie Baus-Hoffmann Schwester Mediatrix Nies OSF, Olpe Dr. Adalbert Müllmann, Brilon Winfried Kotthoff, Meschede Silke Kloock, Olsberg Elmar Reuter, Olsberg Dr. Peter Klobes, Berlin Stephanie Schnura, Arnsberg Dr. Erika Richter, Meschede Franz-Josef Keite, Eslohe Birgit Haberhauer-Kuschel, Attendorn
43 Sauerland 4/ Es ist an der Zeit, sich in Sachen Ausbau der Windenergie im Sauerland erneut zu Wort zu melden. Angesichts dessen, was uns in unserem Lebensraum mit den Ausbauplänen von unterschiedlichen Akteuren zugemutet werden soll, will dieser Beitrag dazu dienen, die Sauerländer aufzurütteln, um sich in die Bauleitplanverfahren-Verfahren der Kommunen einzubringen und sich für diesen Fall und die öffentliche Diskussion mit Argumenten zu versehen. Denn beileibe nicht alles, was unter dem Deckmantel der nationalen Energiewende betrieben wird, ist von Wertschätzung und Vernunft geprägt. Der Windenergie die Flügel stutzen von Elmar Reuter Die Windkraftanlagen (WKA) nach dem derzeitigen Stand der Technik (noch größere Dimensionen sind schon angekündigt) mit ihrer durchschnittlichen Höhe von etwa 200 m dominieren die Landschaft und geben ihr ein technisch-industrielles Gepräge. Der Blick in die Landschaft wird auf die Anlagen fokussiert. Die Landschaft erhält eine neue Orientierung: natürliche Elemente, sog. Landmarken und bauliche Höhepunkte bisheriger Prägung verlieren ihre Bedeutung in einer modernen Technik landschaft. Die WKA definieren jetzt den Horizont und die Blickachsen im weiten Umkreis. Materialien (Zuwegungen, Fundamente, etc.) und Proportionen stehen im Gegensatz zu natürlichen Landschaftselementen und dies fast ausnahmslos an exponierten Standorten. Ihre kontinuierliche Bewegung verbunden mit der Geräuschkulisse verträgt sich nicht mit Stille und Ruhe beim Landschaftsgenuss. Sie wird zum störenden manchmal sicher auch bedrohlich wirkenden Element am Horizont. Das muss wohl hingenommen werden, wenn die Energiewende gelingen soll, sagen diejenigen, die sich dem Ausbau der Windenergie verschrieben haben, also aus pekuniären Gründen (und in dieser Reihenfolge:) Projektierer, Grundstückseigentümer und Investoren, dazu die vom Geist der Energiewende Beflügelten. Mehr und mehr wird die Gruppe derer in unserer Gesellschaft größer, die dies mit ihren wachsenden Erkenntnissen kritisch hinterfragen und da reicht als Quelle schon die Beobachtung der Nachrichtenlage in den Medien. Während ich diesen Beitrag niederschreibe, kommen auch die ersten Signale aus den Koalitionsverhandlungen in Berlin, dass sich etwas ändern wird. Hier möchte ich den Versuch machen, dass was da um uns geschieht mit der Elle des magischen Dreiecks der energiepolitischen Ziele (s. Abbildung) zu messen. Das magische Dreieick der energiepolitischen Ziele Versorgungssicherheit Bezahlbarkeit Umweltverträglichkeit Diese Ziele müssen gleichmäßig ausbalanciert werden. Wenn eines der Ziele mehr betont wird als das andere könnte das Dreieck kippen. Vielleicht heißt es auch deswegen magisches Dreieck, weil es eben eine besondere Kunst ist, diese Balance zu halten. Wir starten mit Versorgungssicherheit, die für eine Volkswirtschaft wie die unsere ein hohes Gut ist. Erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie und Fotovoltaik, sind fluktuierend. Um diese Schwankungen und das zeitliche Auseinanderdriften von Erzeugung und Bedarf zu bewältigen, brauchen wir Speicherkapazitäten, mit deren Hilfe elektrische Energie bereitgehalten und auf Abruf geliefert werden kann. Das aber gelingt nur nach Ansicht von Fachleuten mit dem Ausbau der Höchstspannungsnetze und dem Umbau der Mittel- und Niederspannungsnetze, die auch um unnötige Netzausbaukosten zu vermeiden mit einem zentralen technischen Energie management, das Verbraucher, Erzeuger und Netzbetreiber umfasst, optimal gesteuert werden. Niemand kann derzeit zuverlässige überzeugende Antworten auf die Lösung dieser Aufgabenstellung geben, außer vermeintlich kluge Absichtserklärungen abzusetzen. Aber wen stört das, man plant und baut locker drauf los neue WKA-Riesen. Nach Aussagen des Bundesumweltministers im Frühjahr 2013 sind in der BRD ca Anlagen im Bau oder in der Planung. Die zurzeit bekannten Pläne in den Bundesländern übertreffen die bundesweiten Ausbauziele für die Windkraft um mehr als 60 %. So droht die Aufblähung einer Blase, die irgendwann platzen wird mit schwerwiegenden Folgen für Wirtschaft und Umwelt ha Windparkflächen will NRW mit Hilfe des neuen Landesentwicklungsplanes ausweisen, davon ha im Planungsgebiet der Bezirksregierung Arnsberg. Das ist für diese Region etwa das Achtfache der heute in Anspruch genommenen Flächen! Zum Vergleich: Dem Planungsgebiet des Regionalverbandes Ruhr (= dem Ruhrgebiet) werden stolze 1500 ha (!!) vorgegeben. Wieso gehen wir mit solch einer intensiven Flächenausweisung in die Mittelgebirge, wenn die Offshore-Anlagen vor der Küste als grundlastfähig gelten (d. h. keine Speicherproblematik)? Diese Anlagen fahren 4500 Volllaststunden p. a., solche an der Küste 3000 und im Binnenland an guten Standorten 1800, meist weniger. Fazit 1: Der derzeit favorisierte intensive Ausbau der Windenergie bietet keine Versorgungsicherheit. Was soll da der Druck auf die Kommunen als Träger der Planungshoheit? Die Rolle der Kommunen will ich hier im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeit behandeln: Zunächst: Anlagen, mit den Charakteristika wie sie am Anfang dieses Beitrages beschrieben werden, per se als umweltverträglich zu bezeichnen, bedarf schon einer gewissen Verblendung. Diese Argumentation steht im Zusammenhang mit der sprachlichen Irreführung, die die Windenergie stets als saubere Form der Energieerzeugung bezeichnet. Aber wer die Bedenken örtlicher Gliederungen des BUND oder NABU bei der Standortwahl für WKA liest, der erkennt, dass für die Windenergiestandorte manchmal Tabukriterien zurecht gebogen werden, wie man
44 188 Sauerland 4/2013 es für andere Infrastrukturprojekte in der Vergangenheit niemals zugelassen hätte. Mit dieser Problematik sind nun auch die Kommunen befasst, die die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit nutzen wollen, indem sie mit Hilfe der Bauleitplanung die Zulassung von WKA in ihren Gebieten durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen steuern wollen. Sie haben dabei die Vorgaben der Rechtsprechung zu beachten, wonach der Windenergienutzung im Rahmen eines schlüssigen Gesamtkonzeptes für ihre Hoheitsgebiete substantiell Raum zu verschaffen ist. Jetzt gibt es neue Herausforderungen aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom , weil es sich mit Abwägungskriterien und der Definition harter und weicher Tabukriterien befasst. Mal abgesehen davon, dass ein angesehener Jurist aus der Judikative das Urteil in seiner Gesamtheit als desaströse Entscheidung bezeichnet hat, muss man darauf verweisen, dass das Urteil selbst feststellt, dass es kein verbindliches Modell gibt, anhand welcher Kriterien eine Konzentrationsflächenplanung den Ansprüchen der Rechtsprechung genügt. Also erwarten wir Mut und Entscheidungsfreude in den Stadt- und Gemeinderäten der Region, und das heißt für uns zwingend das Tabukriterium in die Abwägung aufzunehmen, das da heißt: Landschaftsbild, natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert sowie Erhalt historischer Kulturlandschaften. Beide Belange sind fachwissenschaftlichen Aussagen zufolge nicht subjektiv als beliebig abzugrenzen sondern harte Abwägungskriterien. Auf einer Fachtagung im Landeshaus in Münster wurde gerade mit Blick auf die industriellen Windenergie-Großanlagen von Fachwissenschaftlern unter großem Applaus des Forums ein Konvent zum Erhalt unserer Kulturlandschaften als ständige Einrichtung gefordert, um Einhalt gebieten zu können. Aus der Sicht der Umweltbelange ist Energiegewinnung aus Windkraft nur an schon belasteten Standorten zu situieren, also solchen, die bereits technisch, gewerblich oder industriell geprägt sind. Fazit 2: Bei einer Vielzahl von geplanten Standorten dürfte die Umweltverträglichkeit im Lichte dieser Ausführungen nicht nachzuweisen sein. Die vorbereitenden Verfahren in den Gemeinden zur Ausweisung von Konzentrationsflächen leiden vor allen Dingen darunter, dass sie völlig losgelöst von der Frage des Bedarfes und der Kosten für diese Art der Energieerzeugung betrieben werden müssen. Im Fachplanungsrecht, z.b. beim Straßenbau ist die Planrechtfertigung, also die Notwendigkeit der Maßnahme zu begründen, ein wichtiger Bestandteil des Verfahrens. Dafür interessiert sich hier niemand, denn es gibt ja garantierte Preise für diese Erzeugungsart mit diversen Auswüchsen, die mit tödlicher Sicherheit nur eine einzige Folge haben: Für alles was da getan und unterlassen wird, zahlen wir, die Verbraucher und das kostet nicht nur unser Geld sondern im Falle der gewerblichen Wirtschaft gefährdet es die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. So sind wir nun bei der Bezahlbarkeit angelangt. Der Kern des Übels ist der fehlende Wettbewerb in diesem Teil des Energiemarktes. Die Vollsubventionierung der erneuerbaren Energien summiert sich inzwischen auf rund 21 Mrd. EUR jährlich. Übrigens werden ähnliche hohe Summen nach Ansicht von Experten jeweils für den Ausbau der Höchstspannungsnetze und der intelligenten Netze erforderlich, also mehr als 40 Mrd. EUR, die wer bezahlen darf? Na, das wissen wir ja inzwischen. Übrigens hier fehlt noch der Ansatz für den Ausbau von Speichertechnologien. Schauen wir auf die Auswüchse: Wenn aufgrund von Engpässen im Netz der Strom aus Windkraft und Photovoltaik nicht aufgenommen werden kann, gibt es Geld. Wenn der Strompreis an der Börse sinkt, weil es große Mengen aus den erneuerbaren Energien gibt, erhöht sich die EEG-Umlage, die inzwischen höher ist als der Strompreis. In 2013 betrug der durchschnittliche Strompreis 3,7 Cent/ KWh an der Börse, die EEG-Umlage steigt in 2014 auf 6,2 Cent/KWh. Das System ist so schizophren, dass die Erneuerbaren Energien (EE) einerseits die Preise senken und andererseits durch mangelhafte Berechnungsmethoden Opfer ihres eigenen Erfolges werden. Von den zweifelhaften Ökostromrabatten für bestimmte Wirtschaftszweige wollen wir hier nicht weiter reden. Wenn systemrelevante Kraftwerke stillstehen, weil der Wind weht und die Sonne scheint, gibt es Geld und ach ja, wie sichern wir eigentlich den Betrieb der sogenannten Grundlastkraftwerke finanziell ab, usw., usw.? Fragen über Fragen, die aber leider nicht zum behutsam durchdachten Vorgehen beim Bau von WKA führen. Wen wundert es, gilt es doch Geld zu machen. Lt. Handelsblatt bis EUR Pacht je Standort an Grundstückseigentümer und die Abnahmepreise für die Erzeugung sind auf 20 Jahre garantiert. Bleibt zu hoffen, dass die Mahnung der Monopolkommission aus dem Frühherbst diesen Jahres Früchte zeigt: Der Umbau der Energieversorgung funktioniert nur mit mehr Wettbewerb! An erster Stelle muss eine zügige und grundlegende Reform der EEG-Regelungen stehen. Mit 25 % Marktanteil sind die Erneuerbaren Energien keine Nischentechnologie mehr, die sich dem Marktgeschehen entziehen kann und allein auf Kosten der Verbraucher marktfern gestützt wird. Fazit 3: Der zügellose Ausbau der Windenergie unter den derzeitigen Bedingungen wird dauerhaft zur weiteren Steigerung der Energiepreise beitragen. Wir, der Sauerländer Heimatbund, stellen fest, je länger dieser Prozess nun beobachtet wird und dessen mehrschichtige Wirkungen bekannt werden, um so mehr sehen wir uns der Pflicht, gegen den Ausbau der Windenergie im großen Stile bei uns im Sauerland mahnend die Stimme zu erheben. So wie die Verfahren laufen, wird es nicht gelingen, der Messlatte Magisches Dreieck der energiepolitischen Ziele gerecht zu werden. Wir brauchen einen Neustart der Energiewende mit anderen Bedingungen und weniger offenen Fragen als heute. Das heißt in der Konsequenz für die Kommunen: nicht im vorauseilenden Gehorsam staatliche Vorgaben möglichst kurzfristig um jeden Preis umzusetzen. Die nationale Aufgabe der Energiewende kann wegen ihrer erheblichen Auswirkungen auf die Menschen, unsere Landschaft und die Umwelt nicht auf den Höhen des Sauerlandes gestemmt werden. Das ist der Maßstab: Die Zukunft der Energieversorgung muss nicht nur sauber sondern auch bezahlbar und verlässlich sein. Anmerkung des Verfassers: Bedingt durch den Redaktionsschluss für diese Ausgabe enthält der Beitrag den Sachstand, der vor den Koalitionsverhandlungen in Berlin existiert hat.
45 Sauerland 4/ Am 21. September 1973, also vor nunmehr 40 Jahren, ging eine Meldung durch die Presse, die sicherlich einige Mitbürger in Niedereimer sowie Arnsberg und Umgebung, die meinen Vater noch aus der Zeit vor 1945 gekannt hatten, aufhorchen ließ: Ein heißer Draht zwischen den Grenzsicherungsorganen der Bundesrepublik und der DDR soll die gemeinsame Bekämpfung von Schäden und Unglücksfällen an der innerdeutschen Grenze erleichtern. Mein Vater August Klobes Klassenfoto 1930 Ein nicht ganz alltäglicher Lebensweg im geteilten Deutschland von Dr. Peter Klobes Diese Übereinkunft sowie eine Vereinbarung über Instandhaltung und Ausbau der Grenzgewässer wurde von Günter Pagel vom Bundesinnenministerium und August Klobes vom DDR-Außenministerium gestern in Bonn unterzeichnet. Bereits einige Monate zuvor war gemeldet worden: Deutsch-deutsche Grenzkommission gebildet, der leitende Vertreter der DDR-Seite in der Kommission, August Klobes, ist Beamter des DDR-Außenministeriums. Wie konnte es dazu kommen, dass mein Vater, der ja aus dem Sauerland stammte und aus einem streng katholischen Elternhaus kam, als hochrangiger DDR-Beamter 1973/74 in dieser Grenzkommission die andere Seite vertrat? Ich möchte hier versuchen, anhand seines Lebenslaufs und aus persönlichen Erinnerungen heraus dieser Frage ein wenig näher zu kommen. Geboren wurde mein Vater August Klobes am 19. Juli 1920 in Arnsberg- Niedereimer/Westfalen als Sohn des Metallarbeiters August Klobes und seiner Ehefrau Florentine geb. Deimel. Bereits im Jahre 1934 verstarb mein Großvater nach einer Gallenoperation, was für die kleine Familie August Klobes im Turnverein Dicke Eiche 1934 einen schweren Schicksalsschlag, verbunden mit vielen Entbehrungen, bedeutete. Von 1926 bis 1933 besuchte mein Vater die Volksschule in Arnsberg-Niedereimer und daran anschließend die kaufmännische Handelsschule in Arnsberg. Nach Beendigung der Schulzeit begann er 1935 bei den R-M-W Motorradwerken in Neheim/Ruhr eine dreijährige Lehre als Industriekaufmann. Bei der gleichen Firma verblieb er nach Beendigung der Lehrzeit zunächst als kaufmännischer Angestellter. Im Mai 1940 musste mein Vater zum Reichsarbeitsdienst und wurde in Holland bis zum September in der Nähe von Arnheim beim Flugplatzbau eingesetzt. Anfang Dezember 1940 wurde er zur faschistischen Wehrmacht eingezogen (Infanterie-Nachrichten-Ersatzkompanie 253) und im April 1941 dem Marsch- Bataillon 253 im damaligen Ostpreußen zugeteilt. Wie er es selbst in einem mir vorliegenden Lebenslauf aus dem Jahre 1968 formulierte, überschritt er mit dieser Einheit am ersten Tag des verräterischen und heimtückischen Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion die sowjetische Grenze. Bald darauf kam er dann als Infanterist zur 9. Kompanie des 464. Infanterie-Regiments. Am 27. Oktober 1941 wurde mein Vater bei einem Spähtrupp in der Nähe des Ortes Selischarowo am Oberlauf der Wolga beim Versuch, einem von Schüssen getroffenen Kameraden zu Hilfe zu eilen, selbst schwer verwundet und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dazu liegt mir die Kopie des Briefes seines Kompanieführers, Oberleutnant Rother, vom an meine Großmutter Florentine vor, in welchem dieser nach einer Schilderung der Ereignisse schrieb: August und Paul, meine besten Soldaten aus dem Kompanietrupp habe ich verloren. Dafür, dass mein Vater bis dahin ein wohl recht tapferer Gefreiter der deutschen Wehrmacht war, der als HJ-Mitglied von 1934 bis 1938 zunächst vollkommen vom Kampf gegen den Bolschewismus überzeugt gewesen sein muss, spricht die Verleihung des Infanterie-Sturmabzeichens sowie des EK II innerhalb der ersten drei Monate des Russlandfeldzuges. In der Gefangenschaft begann dann für ihn der innerliche Umbruch. Er selbst formulierte es in seinem Lebenslauf so: In dieser für die Sowjetmenschen so schweren Zeit, in der sie unter unermess-
46 190 Sauerland 4/2013 lichen Opfern Entbehrungen und Leiden ihre Heimat vor den Faschisten verteidigten, taten sowjetische Ärzte, Soldaten und einfache Menschen alles, um mein Leben zu retten. Bis April 1942 wurde ich in verschiedenen sowjetischen Lazaretten gepflegt und meine Gesundheit wieder hergestellt. In diesen Monaten des großen Nachdenkens kamen mir die ersten echten Zweifel an der Richtigkeit der Nazi- Propaganda. An meinem eigenen Beispiel erlebte ich das Gegenteil dessen, was die faschistische Propaganda als sogenannte Wahrheiten verbreitete. Ich selbst kann mich an Gespräche mit ihm erinnern, in denen er folgende Kurzfassung dieses Prozesses formulierte: Unsere Vorgesetzten in der Wehrmacht haben uns immer wieder eingeschärft, dass der Russe keine Gefangenen macht und insbesondere verwundete Deutsche sofort erschießt. Ich habe das dann völlig anders erlebt. Da begann mein damaliges Weltbild zu wanken. Abschlussunterzeichnung der Grenzkommission 1973 (sitzend von links August Klobes und Dr. Günter) Im April 1942 wurde er in das Kriegsgefangenenlager 99 bei Karaganda verlegt. Dort musste er im Kohlebergbau arbeiten und kam im Lager zum ersten Mal in seinem Leben mit antifaschistischer Literatur in Berührung, die ihm zusammen mit zahlreichen Diskussionsveranstaltungen und Aussprachen mehr und mehr die Augen über den verbrecherischen Charakter des faschistischen Krieges gegen die damalige Sowjetunion öffnete. Von Ende Oktober 1943 bis April 1944 nahm er an Lehrgängen der Antifa-Schulen in Wjasniki und Krasnogorsk teil. Danach wurde er Mitte Mai 1944 als Beauftragter des Nationalkomitees Freies Deutschland an der dritten Belorussischen Front bei Witebsk eingesetzt. Hier leistete er zunächst im Bereich einer Division und später im Bereich der 5. Russischen Armee bis zum Kriegsende unter Einsatz seines Lebens einen aktiven Beitrag dafür, den Krieg schneller zu beenden, indem er u. a. eingekesselte deutsche Soldaten, also seine ehemaligen Kameraden, in vorderster Linie über Lautsprecher dazu aufforderte, nicht für Adolf Hitler zu sterben, sondern ihr Leben zu retten und die sinnlos gewordenen Kampfhandlungen einzustellen. Wie er in vielen Gesprächen über diese Zeit berichtete, zog er nach der deutschen Kapitulation nochmals eine persönliche Bilanz der Kriegsjahre und kam zu dem Schluss, auf der richtigen Seite gestanden zu haben. Er kam häufig darauf zurück, dass die verbrecherische Politik der Nazis dazu geführt habe, dass Millionen Menschen im Krieg und in den Konzentrationslagern sinnlos sterben mussten, Deutschland 1945 in Schutt und Asche lag und große Teile seines Territoriums für immer verloren waren. Nunmehr müsse alles daran gesetzt werden, auf den Trümmern des Dritten Reiches ein neues, friedliebendes Deutschland aufzubauen, von dem nie wieder ein Krieg ausgehen würde. Dies war nach seiner Meinung aber nur im Osten möglich, nicht dagegen im Westen Deutschlands, den er auch später als Hort der rückwärts gewandten Kräfte mit zahlreichen ehemals maßgeblichen Nazis und Kriegsverbrechern in führenden Positionen angesehen hat. Diese Grundüberzeugung hat er trotz vieler Widersprüche und Unzulänglichkeiten in der SBZ und der späteren DDR, die er zweifellos auch selbst sah, diese aber immer als lösbar und überwindbar eingeschätzt hat, bis an sein Lebensende beibehalten und zur Richtschnur seines Handels gemacht. Der Eintritt in die damalige KPD war für ihn durch seine Kriegserlebnisse ein folgerichtiger Schritt. Ende Mai 1945 wurde mein Vater mit einer Gruppe ausgewählter Kader von den Sowjets zunächst nach Stettin geschickt, um sich auf die Übernahme von Verwaltungsposten im Land Mecklenburg vorzubereiten. Anfang Juli 1945, nachdem auch der westliche Teil Mecklenburgs zur damaligen sowjetischen Besatzungszone gekommen war, wurde er durch die Landesleitung der KPD mit dem Aufbau und der Leitung des Verlages der Volkszeitung in Schwerin beauftragt. Dort lernte er meine Mutter Irma kennen, die im Herbst 1945 aus ihrem Geburtsort Stettin umgesiedelt worden war und zufälligerweise ebenfalls in Schwerin landete. Am 15. Dezember 1945 heirateten beide und am 12. Oktober 1946 erblickte ich als Erstgeborener von später insgesamt drei Söhnen das Licht der Welt. Im selben Jahr übernahm mein Vater die Funktion des Geschäftsführers der Landesdruckerei in Schwerin. Im Oktober 1949 wurde er zusätzlich noch mit der Leitung der Mecklenburgischen Volkshaus G.m.b.H. beauftragt. In diesem Jahr war dann auch die politische Spaltung Deutschlands perfekt, als in der SBZ offiziell als Antwort auf die bereits im Mai 1949 auf dem Territorium der drei westlichen Besatzungszonen erfolgte Gründung der Bundesrepublik am 7. Oktober die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen wurde. Dieser neu gegründete Staat mit seiner anfangs noch provisorischen Regierung wurde damals auf Betreiben der Westmächte und später der Bundesrepublik (Stichwort Hallstein-Doktrin ) international fast völlig boykottiert und zuerst nur von den osteuropäischen Ländern im sowjetischen Machtbereich anerkannt. Obwohl das nur einige wenige Staaten waren, fehlte es anfangs an geeignetem Personal für die zu beschickenden Auslandsvertretungen des jungen Staates DDR, da Nazi-Diplomaten, die ja größtenteils ohnehin bereits im Westteil Deutschland schon wieder aktiv waren, natürlich nicht in Frage kamen. So
47 Sauerland 4/ suchte man in allen gesellschaftlichen Bereichen nach bewährten und geeigneten Kadern für den neuen diplomatischen Dienst. Auch mein Vater fiel in diese Auswahl und begann am 1. Februar 1950 seine Tätigkeit im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA). Von April 1950 bis Dezember 1953 war er zunächst als dritter und später als zweiter Sekretär der Diplomatischen Mission bzw. der Botschaft der DDR in der VR Bulgarien tätig. Unsere Familie (meine Eltern, mein 1949 geborener Bruder und ich) lebte daher von 1950 bis 1953 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, wo meine Mutter ebenfalls an der Botschaft als Schreibkraft tätig war. Da es in Sofia für mich keine Möglichkeit für den Besuch einer deutschen Schule gab, bemühte sich mein Vater um seine Rückversetzung nach Berlin, der im Dezember 1953 stattgegeben wurde. In Berlin arbeitete er dann zunächst als Länderreferent im MfAA und war von 1956 bis 1962 Leiter der Kaderabteilung (Personalchef) dieses Ministeriums. Nach dem Besuch der Parteihochschule beim ZK der KPdSU in Moskau von April 1962 bis Juli 1963 war er im MfAA bis April 1964 für Fragen im Zusammenhang mit dem sogenannten Alliierten Reiseamt in Westberlin zuständig, über das damals alle Reisen von DDR-Bürgern ins westliche Ausland abgewickelt wurden (was in der Praxis natürlich nur für Politiker, höhere Funktionsträger und ausgewählte Wissenschaftler zutraf). Dann folgte eine Tätigkeit in der Abteilung Koordination und Kontrolle des Ministeriums. Im Juli 1966 begann mein Vater seinen Dienst in der Konsularabteilung des MfAA, zunächst als stellvertretender Leiter und später ab November 1968 im Range eines Botschafters als Leiter der inzwischen gebildeten Hauptabteilung Konsularische Angelegenheiten. 1973/74 wurde er wie bereits eingangs erwähnt zum DDR-Verhandlungsführer in der deutsch-deutschen Grenzkommission berufen und leitete die DDR-Delegation von der ersten bis zur 10. Sitzung. In diese Zeit nach Abschluss des Grundlagenvertrages zwischen der BRD und der DDR fielen für ihn auch zahlreiche Dienstreisen in westliche Staaten als Leiter von Verhandlungsdelegationen zum Abschluss von Konsularverträgen mit der DDR, so u. a. nach Österreich, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Belgien und den USA. Zuvor hatte er bereits im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit zahlreiche Staaten im Ausland besucht, neben Auszeichnung mit Vaterländischen Verdienstorden in Gold, 1980 den Ostblock-Ländern erinnere ich mich vor allem noch an seine Reisen nach China und nach Kuba, wovon er uns auch noch später sehr häufig berichtet hat. Seine Leistungen sind von der DDR-Regierung mit zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen gewürdigt worden, u. a. mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, in Silber und in Gold. In russischer Uniform 1944 Zum 1. Januar 1981 ist er vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden, da er noch einmal als Botschafter für mehrere Jahre ins Ausland geschickt werden sollte, was er angesichts seines Alters aber ablehnte. Als anerkannter Verfolgter des Naziregimes (VdN) stand ihm ohnehin eine Pensionierung ab dem 60. Lebensjahr zu, wovon er dann Gebrauch machte. Von da an hatte er nun endlich mehr Zeit für sein Wochenendgrundstück am Rande der Schorfheide in der Nähe von Berlin sowie für seine inzwischen sieben Enkelkinder, zu denen er immer ein sehr herzliches und liebevolles Verhältnis hatte. Leider waren die drei letzten Lebensjahre von seiner zunehmenden Alzheimer-Erkrankung überschattet, an der er letztlich auch verstorben ist. Durch diese Erkrankung war es zum Schluss auch nicht mehr möglich, mit ihm eingehend über die Ursachen für das Scheitern der DDR, der er doch mit ganzer Kraft gedient hatte, zu sprechen. Dass ihn das sehr bedrückt hat, war zu spüren, vielleicht haben diese Ereignisse auch den Verlauf seiner Erkrankung beschleunigt. Am 26. Februar 1992 ist er dann in Berlin verstorben. In meiner Erinnerung war mein Vater ein mitunter strenger, aber stets gerechter, warmherziger und humorvoller, ja lebenslustiger Mensch. Für immer unvergessen bleiben viele frohe Stunden im privaten Kreis mit ihm, besonders wenn er zu seiner Ziehharmonika griff und für ausgelassene Stimmung sorgte. Er war in Gesellschaften ein ausgezeichneter Unterhalter, der gern den Ton angab und seine Zuhörer durch interessante und faktenreiche Ausführungen aus seinem bewegten Leben und seiner beruflichen Tätigkeit zu fesseln vermochte. Mein Vater ist nach dem Krieg konsequent seinen in der Gefangenschaft als richtig erkannten Weg gegangen. Dafür nahm er auch persönliche Einschränkungen in Kauf, so u. a. ein jahrelanges Kontaktverbot zu seiner Mutter in Arnsberg-Niedereimer in den Anfangsjahren der DDR, das erst Ende der 1950er Jahre gelockert wurde, wodurch dann auch Besuche meiner Großmutter in Berlin möglich wurden. Nach meiner Einschätzung hat mein Vater mit seiner Tätigkeit im diplomatischen Dienst der DDR mit dazu beigetragen, die Verkrampfungen des Kalten Krieges zwischen Ost und West zu überwinden und der Entspannung insbesondere zwischen der Bundesrepublik und der DDR den Weg zu bereiten. Bei vielen Verhandlungen, an denen er leitend beteiligt war, ist es nicht zuletzt durch sein stets von großer Sachkenntnis geprägtes Auftreten gelungen, einvernehmliche Regelungen für oft sehr komplizierte und diffizile Fragen zu finden. Für mich bemerkenswert war, dass er sich selbst im privaten Kreis niemals in irgend einer Weise abfällig über westliche Verhandlungspartner geäußert hat, sondern diese trotz erheblicher Meinungsunterschiede stets respektiert hat. Aus kleinen Verhältnissen kommend nutzte er zur Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben jede Gelegenheit, um sich weiterzubilden. Nicht nur in dieser Hinsicht ist er mir stets ein Vorbild gewesen.
48 192 Sauerland 4/2013 Weihnachten in St. Johannes Baptist Serkenrode Text und Foto: Franz-Josef Huß Vor 200 Jahren, am 22. Februar 1813 genehmigte der Generalvikar Caspars von Köln als Bevollmächtigter des vakanten erzbischöflichen Stuhls die Stiftung einer Schulvikarie in Serkenrode. Letzter Schulvikar war Bernhard Koch aus Amecke 1885 zu Serkenrode. Der erste weltliche Lehrer war Ferd. Rath, der bis 1922 höchst segensreich hier gewirkt hat. Am 14. Mai 1813 schließt sich der Großherzog Ludwig von Hessen-Darmstadt dieser Genehmigung an. Am 22. Dezember 1813 bestätigte das Kölner Generalvikariat, dass damit die Vikarie am 22. Februar errichtet wurde. Damit kamen die Kapellengemeinden St. Antonius Abt, Dormecke und St. Agatha, Ramscheid zur Serkenroder Vikarie; sie gehörten bisher zur Mutterpfarrei St. Georg Schliprüthen. Vor 700 Jahren wurde im Güterverzeichnis der Grafen von Arnsberg 1313 Serkenrode als Filiale mit Rittersitz und Kapelle ad S. Joan. Baptist aufgeführt. Vorstand und Redaktionsausschuss wünschen allen Mitgliedern und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2014!
49 Sauerland 4/ H E I L I G E R A B E N D H E I L I G E N A C H T Dein Morgen, Heiliger Abend, ist nicht anders, als jeder Morgen dieser winterlichen Woche, wenn sich die Räder der Mobile drehen und Menschen hetzen, diesem Tag den Abend zu verklären, der unter seiner Last des Namens Heilig fast zusammenbricht. Heilig ist doch, was nicht von dieser Erde. Du, armer Heiliger Abend, sollst an diesem einen Tag den Himmel auf die Erde bringen? Du tust mir leid. Und widerlegst mich gleich. Der Himmel ist in Spuren hier bereits zu finden. Christrosen, weiße Blütenknospen, drängen sich durchs Faulige, um ihr Versprechen dieser Heiligen Nacht zu geben: Aus Moder und Verwesung wachsen Schönheit, Leben! Wen drängt es nicht, sich in der Christnacht himmelwärts zu schrauben und Hoffnung, Sehnen, unerfüllte Wünsche mitzunehmen. Und weiß im tiefen Herzen die Gewissheit: Es gibt die Schönheit, sie ist in Tönen, Farben, Dichterworten zu erfühlen und ist ein Stück vom Himmel, das wir sehnend locken. Wie das Kind. Komm in die Krippe unsres Herzens! beten wir. Wenn s nur geriet! Die Welt säh anders aus. Ob s dann den Obdachlosen gäb, der diese Heilige Nacht auf abgewetzter Decke, die Flasche neben sich, im Kaufhauseingang schnarcht? Und kaum entfernt ertrinkt der Raum im Glanz der Kandelaber, biegt sich der Tisch mit Hummer, Salm aus Rauch, gefüllter Gans. O Heiliger Abend! Überfrachtet mit Erinnerung aus Kinderseligkeiten, die sich nach Zahl der Jahre potenzieren und Leid und Unfug dieser heiligen Tage unterschlagen. Wie Hirten aus glasiertem Ton, die, ihre Schafe weidend, sich der Krippe nähern, geköpft, geschlachtet wurden, weil Kinder wissen wollten, wies von innen ist. Der Christbaum stürzte, Kinder zündelten und Kerzen tropften. Wie Opa sich beim Rutsch auf Nüssen prompt die Hüfte stauchte. Wie Mutter vor gebratner Gans, umlegt mit Birnen, Preiselbeeren, vor Erschöpfung einschlief. O Heiliger Abend! Gebettet licht in Engelchöre, Posaunen blasend an barock gewölbten Himmeln, gelockte Cherubinen, die Gloria und Halleluja jubeln. Wen riss es nicht empor: Gesang, Orchester, Solo-Ouvertüren, der Rausch der Orgelklänge und Oboen. O Heiliger Abend. Die Welt wird bleiben, was sie ist: ein Wechselbad aus Warmem, Kalten. Die Helle ist nur hell, weil s auch das Dunkle gibt. Und Liebe lebt vom Gegensatz zum Hass. Es hat die Erde Süd- und Nordpol und alles, was dazwischen ist, ist Welt, in der die Kräfte fließen. O Heilige Nacht, es muss dich geben! Ein Gott wird Kind, das in die Welt gebiert, was niemand möglich ist: die Poligkeit zurückzuspulen in den einen Punkt, in den sich alle Energie des Universums einrollt. Ein Kind ist der Garant, die Spannung Welt zu tragen. O Heilige Nacht. Unmöglich-Mögliche! Du stehst der Welt im Wort! Und dir die Welt! Maria Sperling Auf einer Reise durch Raum und Zeit Visionäres Projekt Lichtturm lockt Besucher aus aller Welt nach Arnsberg von Stephanie Schnura Es muss eine Fälschung sein, denken viele zunächst einmal. Denn was der Besucher im Arnsberger Limpsturm erblickt, ist mehr als nur ein Bild, das auf dem Kopf steht, mehr als eine bloße Abbildung der Wirklichkeit wenn es diese überhaupt gibt. Er sieht die Welt aus einer neuen Perspektive und spürt sofort, wie seine Wahrnehmung neue Züge annimmt, beschreibt der Fotograf Manfred Haupthoff das, was sich in der im Turm aufgebauten begehbaren Camera Obscura abspielt. Als Herzstück des restaurierten ehemaligen Wehrturms lockt die begehbare Kamera seit Eröffnung im August 2012 Besucher aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland nach Arnsberg. Sie alle kommen, um etwas zu erleben, das es in dieser Form nur an wenigen anderen Orten auf der Welt gibt: Als eine von nur 40 Kameras dieser Art überhaupt ermöglicht es unsere Camera Obscura, sich in das Innere eines Fotoapparates und damit auf eine Reise in eine neue Welt zu begeben, schwärmt Haupthoff, der das künstlerische Gesamtkonzept des neuen Limpsturms austüftelte. Und er übertreibt nicht: Besucher der Camera Obscura werden vor eine Glasscheibe geführt, die zunächst milchigdurchsichtig erscheint. Nach einigen Sekunden beginnt sich dann vor den Blicken des faszinierten Zuschauers ein Bild auf der Scheibe zu formen, das langsam deutlicher wird. Und dann, mit einem Mal, zeichnet sich mit großer Klarheit auf der Scheibe die Stadt vor dem Turm ab natürlich, wie das im Inneren von Kameras der Fall ist, seiten- und spiegelverkehrt. Verblüffend ist an diesem Schauspiel nicht nur die Schärfe des Bildes, die noch die kleinsten Baumwipfel erkenntlich macht, sondern auch die Echtzeit der Darstellung: Vögel, die am Himmel fliegen,
50 194 Sauerland 4/2013 Blitze, die aus den Wolken zucken, die Sonne, die die Wolkendecke durchbricht: Alles wird in Bewegung auf der Scheibe vor den Augen des Besuchers abgebildet. Nur dass die Blitze eben von unten nach oben einschlagen, die Vögel in den Himmel fliegen und die Sonnenstrahlen aus dem Boden zu kommen scheinen. Und genau das ist es, was hier jeden mitreißt, beschreibt Haupthoff die Reaktionen der vielen Besucher, die das Schauspiel bisher mit eigenen Augen verfolgen durften. In einer Welt, die heutzutage von visuellen Reizen nur so durchflutet ist, haben wir verlernt, das Wesentliche zu erblicken. Genau hinzuschauen. Uns Zeit zu lassen. Einfach mal genauer hinschauen Die Camera Obscura umgeht diesen Zustand und führt ihren Besucher wieder zurück in eine Zeit, in der Details bemerkt wurden, weil sie nicht augenblicklich von Neuem zugedeckt wurden. Wer vor dieser Scheibe steht, muss sich schon allein aufgrund der gespiegelten Darstellung völlig neu orientieren. Nichts ist an der Stelle wo es zuvor war, und zugleich ist doch alles ganz genau so, wie es ist. Und das schärfer als es die meisten je zuvor wahrgenommen haben. Anders als andere Kameras dieser Art blickt der Besucher im Limpsturm, der nun Lichtturm heißt, nicht von oben auf das projizierte Bild hinab, sondern direkt auf das vor seinem Gesicht schwebende Motiv. Das macht eine sehr viel unmittelbarere Empfindung möglich, erläutert Haupthoff. Die Camera Obscura ist Teil eines Gesamtkonzepts, mit dem der ehemalige alte Wehrturm der Arnsberger Stadtbefestigung in den modernen Lichtturm umgestaltet wurde. Ziel des ehrgeizigen Projekts war und ist es, das Neue in unvergleichlicher Weise mit den historischen Ursprüngen des Gemäuers zu verknüpfen. In jahrelanger Arbeit entstand so die Idee, den Wachturm, der im Jahr 1293 erbaut wurde, auf eine Art zu modernisieren, die eine Brücke von modernem Erlebnischarakter zu alter gewachsener Tradition schlägt. Das ist gelungen: Auf insgesamt fünf Ebenen ist in rund vier Jahren eine Multimedia-Vision entstanden, die keinesfalls schrill und aufdringlich daherkommt, sondern den Besucher subtil und elegant in eine Welt der Klänge, Farben und Bilder entführt: Musikalische und bildgewaltige Inszenierung Wer den engen Turm betritt, wird von leise tönenden sphärischen Klängen empfangen, die sich mal steigern, mal senken. Parallel dazu wechselt die Innenbeleuchtung der Räume stetig innerhalb eines festgelegten Farbrahmens. Das kann mal Magentapink sein, mal sonnengelb und auch mal grasgrün. Theoretisch ermöglicht unsere Lichtanlage viele Tausend unterschiedliche Lichttöne, beschreibt Haupthoff. Faktisch aber haben wir die Farbwahl auf jene Töne beschränkt, die den ursprünglichen Charakter des Limpsturms unterstreichen. Wie sehr die Geschichte des Turms trotz der aufwändigen und modernen Sanierung fortlebt, wird gleich beim ersten Blick ins Innere des Gemäuers deutlich: Die Wände wurden mit Lehm neu verputzt, darüber hinaus kamen ausschließlich Baumaterialien zum Einsatz, die einfacher Natur sind also zum Beispiel Holz und Stahl. An den Wänden ebenso wie an den Zwischendecken wurden bewusst Teilbereiche unverputzt gelassen, damit der Besucher erkennt, wie es früher im Limpsturm ausgesehen haben muss als dieser noch ein Gefängnis, ein Wachturm, ein Teil der Stadtmauer war. Wer die enge Treppe emporsteigt, erblickt gleich in der ersten Etage eine eindrucksvolle Galerie von Bildern, die Manfred Haupthoff in aller Welt mit kleinen Camera Obscuras festgehalten hat. So unterschiedlich die Motive sind, verbindet sie alle eine mystische Stimmung, ein Gefühl, als würden sich die Grenzen von Raum und Zeit auflösen. Mehr als nur ein Gefühl, sagt Haupthoff: Das Besondere an einer Camera Obscura ist, dass sie stundenlang belichtet, bevor ein Foto entsteht. Das heißt, dass auf ihren Bildern nur das zu sehen ist, was lange Zeit ruhig an einer Stelle blieb. Alles Schnelle, Bewegliche, Kurzlebige ist auf den Bildern komplett unsichtbar. Eine Kamera also, die nur Bleibendes festhält, Hektik ausblendet und damit eine ganz eigene Realität schafft. Wellen beispielsweise sind als große verschwommene Masse zu erkennen, da das Wasser zwar über Stunden hinweg gewellt ist, die einzelne Welle jedoch nur kurze Zeit existiert. Multimedia-Show in großem Stil Weiter geht es in die nächste Etage des Turms, die den Besucher das eben Gesehene nun selbst erleben lässt: Als eine einzige große Camera Obscura fordert diese Ebene vom Besucher, sich Zeit zu nehmen und das Bild, das die Camera ins Turminnere wirft, ganz in sich aufzunehmen. Doch damit ist die spannende Reise nicht beendet, denn auf der obersten Etage des Lichtturms erwartet den Besucher schließlich eine beeindruckend Multimedia-Vision: Über die gesamte Turmbreite spannt sich ein überdimensionaler Bildschirm. Motive und Filme, die hier abgespielt werden, umfließen den Zuschauer ebenso wie der umgebende Sound, vermitteln ihm das Gefühl, sich durch die dargestellten Wälder und Stadtzüge zu bewegen. Eine einzigartige Chance für das Stadtmarketing, meint Haupthoff: Hier lassen sich die einzelnen Stadtteile Arnsbergs miteinander verbinden und als die Einheit darstellen, die sie sind. Angesichts der vielen Besucher, die den Lichtturm schon jetzt aus ganz Deutschland aufsuchen, ergibt sich damit die einmalige Chance, die Schönheit der Stadt Arnsberg eindrucksvoll nach außen zu transportieren. Auch der Keller des Turms, der bisher noch leer steht, wird in den kommenden Jahren neu aufgearbeitet: Über eine Projektionsfläche an der Decke will man Filme zeigen, die die Historie des Gebäudes und der Stadt beleuchten. Darüber hinaus werden die darüber liegenden Zwischendecken des Turms durch einen Trick unsichtbar gemacht: Eine Kamera oben auf dem Turm zeichnet das auf, was als Film an der Decke des Kellerraums eingespielt wird. Das ist mal der Sternenhimmel, mal ein Regenschauer, mal strahlender Sonnenschein. Dass das umfangreiche Gesamtkonzept, das Manfred Haupthoff ehrenamtlich unter Unterstützung der Bürgerstiftung Arnsberg, Sponsoren und zahlreichen Mitdenkern und Förderen entwickelte, nun Realität wurde, ist vor allem dem Einsatz des Arnsberger Bürgermeisters Hans-Josef Vogel zu verdanken: Im Jahr 2008 initiierte er das Projekt mit dem Ziel, das kulturelle Erbe der Stadt mit der Restaurierung und zugleich Neuwidmung des Limpsturms aufrecht zu erhalten. Indem dem Turm ein neuer Zweck gegeben wurde, machte man ihn für Besucher der heutigen Zeit interessant und das, ohne die Spuren der Geschichte verschwinden zu lassen: Einst vermutlich von der Arnsberger Schmiedezunft erbaut, bildete der Limpsturm zusammen mit der Limpspforte viele Jahre die Toranlage, die als westlicher Durchgang zur Stadt fungierte. Der Nutzungszweck des Turms wandelte sich über die Jahre hinweg beträchtlich: Vom Wachturm über eine Unterkunft für Ziegenböcke bis hin zum Stadtgefängnis war alles dabei. Und dank dem unermüdlichen Einsatz vieler Helfer ist die Geschichte des Gemäuers noch lange nicht zu Ende geschrieben.
51 Sauerland 4/ Sauerland Leserbriefe Leserbrief Die Orgelbauer-Familie Ahmer aus Letmathe geht zurück auf den Schultenhof auf dem Ahm in Letmathe (Werner Hofmann, Engelbert Ahmer Orgelbauer aus Letmathe, Sauerland, Heft 2/2013, S. 82). Ein anderer Sohn der Familie, Caspar vom Ahm, wanderte ca von Letmathe nach Neheim aus. Die Schreibweise des Namens im Taufbuch veränderte sich innerhalb einer Generation über Ahmer zu Amerman und schließlich zu Ammermann. Caspar vom Ahm ist 1725 in Neheim als Müller verzeichnet. Aus seiner Familie sind im 18. und 19. Jahrhundert mehrfach die Pächter und später Eigentümer der ehemals kurkölnischen Kornmühle in Neheim an der Möhne hervorgegangen, zuletzt Hermann Josef Ammermann ( ). Von den Neheimer Ammermanns stammte im 19. Jahrhundert die Lehrerfamilie in Scheidingen bei Soest ab: Von 1818 bis 1923 stellten die Ammermanns dort über drei Generationen in direkter Folge von Vater und Sohn den Dorfschullehrer. Zu diesem Zweig gehören auch die Mescheder Ammermanns, z. B. Dr. Wilhelm Ammermann, Oberkreisdirektor des Alt-Kreises Meschede von So hat die westfälische Familie Ammermann ihren Ursprung im Schultenhof auf dem Ahm in Letmathe. Den Hof gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Nur noch alte Obstbäume und zerfallene Trockenmauern erinnern an seine frühere Lage auf der Hochfläche des Ahm. Dr. Gert Ammermann, Dormagen Straßenumbenennung Leserbrief: Zeitschrift: Sauerland, September 2013 / 3, S Jetzt keine Straßen-Umbenennung Eine andere Position zur Straßen-Umbenennung: Zur Zeit bitte keine Straßen- Umbenennung mehr für unsere Sauerländischen Heimat-Dichterinnen. Freilich eine Straßen-Benennung in gut 5 Jahren. Die Zeit hat sich dann geändert und wir uns in ihr. Konkret haben wir, politisch aktive Bürger und Politiker, erstens unsere Einschätzung systemisch ausgerichtet und nicht defizitorientiert, zweitens unsere Wahrnehmung auch bei uns selbst entwicklungspsychologisch und theologisch-geschichtlich bereichert und drittens: speziell für Christen die Erkenntnis gewonnen einer Ökumenischen Neu-Evangelisierung bezüglich der Christologie nach Auschwitz. Zwei Argumente dank der Erfahrungen aus der Jetztzeit: Das erste Argument: In Deutschland wurde um 1970 die historisch-kritische Bibel-Verstehens-Methodik oft ohne die Offenbarungs-Theologie als größerer Zusammenhang wahrgenommen. Diese enge Sicht von Christlichkeit hat sich erst recht in gut 5 Jahren verbessert. Das zweite Argument zunächst mit einem Beispiel aus der Schul-Praxis: Dank des angereicherten Entwicklungsalters konnte um 1990 der Religions- und Deutsch-Unterricht im Berufskolleg Meschede für die Klassen Höhere Handelsschule für Abiturienten und Bankkaufleute (zukünftige, auch Abiturienten) ein ungewohnter Lern-Weg gegangen werden mit dem Lern-Ziel, dass Frauen und Männer auch aus nicht üblichem Blickwinkel beurteilt werden: Dichten Frauen anders als Männer? So lautete die erste Motivation. Für die jungen Damen: selbstverständlich. Die Herren zogen bei den unterschiedlichen Texten nach. Die Frauen-Beispiele: Annette von Droste-Hüllshoff ( ), Christine Koch ( ), Josefa Behrens-Totenohl ( ) und Maria Kahle ( ). Zum Reisebericht entlang der Ruhr von Annette zeigten Texte damaliger Sauerländischer Herren, dass heutzutage Männer, Politiker jene Frauen auch anders sehen können. Deutlicher wurde das im Religionsunterricht: Denken und glauben Frauen anders als Männer? Die Praxis-Texte schilderten Leben von Mädchen und Frauen im Sauerland in ihrer Kinderzeit: ihre religiöse Erziehung in ihrer Familie, Nachbarschaft Gemeinde, Schule, Sonntagsmesse und nachmittags Christenlehre, Erstkommunion mit 14 Jahren, Biblische Geschichte, Katechismus, Lesen in der Haus-Postille mit den Heiligen-Legenden, alle 5 Jahre Volksmission; morgens, mittags und abends gemeinsames Beten in der Familie; Firmung, Konfirmation... und leider noch die Negativ-Wertung der Juden. Im Religionsunterricht wurden danach diese Frauen kennengelernt: Hroswita von Gandersheim ( ), Katharina von Siena ( ), Teresa von Avila ( ) und Edith Stein ( ). Auch den Herren in der Klasse war klar geworden: Frauen denken und glauben anders. Weiter in Reli : Beim unbekannten Ort und Datum der Ermordung von Edith Stein war da plötzlich die Frage: Kommt Adolf Hitler in den Himmel? Stille. Menschen entscheiden das nicht. Ein Zugang: In der Bibel steht (Mt 6,12), dass Jesus von Nazareth (vor)gebetet hat: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern! Im Gottesdienst beten Christen das einmal, im alt-europäischen Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung und Veröffentlichung vorbehalten. Rosenkranzgebet: sechsmal. Unsere Sauerländischen Heimatdichterinnen haben diese Bitte seit Kindesbeinen gewiss auch gebetet, unzählbar. Bei ihrer für Lehrerinnen notwendigen Zugehörigkeit zur NS- Lehrergewerkschaft und gleich hinterher zur NSDAP und bei ihrer Reise-Propaganda für ihre Vorstellung von Deutschland werden sie die Vokabeln KZ und Grauer Bus, vielleicht auch TK 4 gekannt haben. Was dann nach dem Aussteigen aus den Eisenbahnwaggons und dem Grauen Bus mit den Menschen passierte und wie im KZ Dachau gemordet wurde, das werden sie wohl nicht gewusst haben. In ihrer Lyrik und Prosa sehen ihre Traum-Vorstellungen vom neuen Deutschland ganz anders aus als die massenmörderische Praxis des NS- Regimes. Die jungen Damen und Herren in der Schule wurden gebeten, ihre Eltern und Großeltern nach ihrem Wissen zu befragen und ob Frauen anders entscheiden als Männer. Im Religionsunterricht durchgenommen wurde schließlich die Plötzensee-Liturgie, immer am 20. Juli im Hinrichtungs-Schuppen, die kein ökumenischer Wortgottesdienst ist, sondern das evangelische Abendmahl und die katholische Eucharistie, weil hier katholische und evangelische Geistliche gleichzeitig gemeinsam hingerichtet worden sind; ein zutiefst begeisternder Gottesdienst dank der außerordentlichen Erlaubnis des damaligen Bischofs Meisner von Berlin (Kardinal und Erzbischof von Köln). Für die Jetztzeit und damit für eine Straßen-Benennung (nicht Straßen-Umbenennung) in gut 5 Jahren für unsere Sauerländischen Heimat-Dichterinnen lohnt sich nach dem möglichen Vaterunser-Beten: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern die Veröffentlichung zu lesen des aus Brilon stammenden Sauerländer Prof. Dr. Dr. Christian Göbel jun., Professor an San Anselmo in Rom, in Boston / USA und ab und zu Dozent an der Bundeswehr-Akademie in Hamburg und Berlin (Gebirgsjäger-Offizier d. R.): Zur Logik des Christentums. Eine philosophische Grundlegung ökumenischen Denkens im Ausgang von Anselm von Canterbury. Leiden Von Anselm ( ) bis heute lautet darin der Kernsatz: Gott ist unbedingte Liebe.
52 196 Sauerland 4/2013 Schließlich zur Zusammenfassung: Für eine systemische, entwicklungspsychologisch, politisch-geschichtlich orientierte Reflexion, auch unabhängig vom Common Sense im Medien-Mainstream mag praktikabel sein das Buch von Reinhard Haller von der Narzissmus-Falle mit ihren Fallen Egozentrizität, Empfindlichkeit, Entwertung und Empathiemangel: Wem die Kipp-Figur einfällt: Ein Hase oder eine Ente? schmunzelt nicht nur. Heinrich Pasternak Anmerkung: Damit der Text nicht noch länger wurde: Wikipedia kennt die meisten Fremdwörter auch. Plattdeutscher Gottesdienst in Körbecke Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im Sauerländer Heimatbund. In der Einladung zur Mitgliederversammlung 2013 war nicht die Rede von einem Plattdeutschen Gottesdienst. Wir haben in Körbecke eine herrliche Plattdeutsche Runde, zu der monatlich 25 Freunde des Plattdeutschen regelmäßig erscheinen. Am Freitag vor der Versammlung habe ich alle Mitglieder der Runde angerufen. Da es versäumt wurde, in der Presse auf einen Plattdeutschen Gottesdienst hinzuweisen, wussten nur 2 Mitglieder der Runde davon, aber alle, soweit sie im Lande waren, sind gekommen. Gewiss hätten bei einer Ankündigung des Plattdeutschen Gottesdienstes in der Zeitung auch viele Freunde des Plattdeutschen aus dem Kreis Soest den Weg in unsere schöne Pankratiuskirche gefunden. Mit den besten Wünschen Guet gaoh Jupp Balkenhol Red. Aus Platzgründen können wir den eingesandten Text der Plattdeutschen Messe hier nicht veröffentlichen. Bücher Schrifttum JAHRBUCH HOCHSAUERLANDKREIS 2014 Berichte Erzählungen Aufsätze (30. Ausgabe) Bärbel Michels: Rund um den Strumpf. Heinrich Feldmann Vom Handelsmann zum Gründer einer Strumpffabrik. Dr. Thomas Delker, Dr. Wilhelm Föckeler: 100 Jahre Freitags- Kegelgesellschaft in Brilon. Um ein bestehendes Vakuum an Daseinsfreude auszufüllen... Hubertus Flügge, Martin Gast, Bruno Hümmeler, Thomas Jostes: Grevenstein feiert dreifach. Stadtrechteverleihung 1314, selbstständige Pfarrei 1364, 350-jähriges Bestehen der Schützen. Titia Susanna Hensel: Tugend im Trend. Mode und Frauenideal in den westfälischen Damenporträts von Engelbert Seibertz ( ). Franz-Josef Keite: DampfLandLeute MUSEUM Eslohe. Ein Museum mit überregionaler Ausstrahlung in der Weiterentwicklung. Manfred Spata: Wie hoch ist denn nun das Sauerland? Die Achthunderter des Rothaargebirges. Prof. Dr. Wilfried Stichmann: Kraniche über dem Sauerland. Herbert Somplatzki: Vom Venetianerstollen zum Besucherbergwerk. 40 Jahre Kulturzeche Ramsbeck. Dr. Alfred Bruns: Historisches über Winterberg. 2. Teil Die Stadt am Astenberg im Spiegel der Presse des beginnenden 20. Jahrhunderts. Angelika Schröder: Die Tücken des Landlebens. Ein Kurzkrimi aus dem Sauerland. Haymo Wimmershof: Die Veramed Klinik in Beringhausen. Die wechselvolle Geschichte von einer Heilanstalt zur Geisterklinik. Msgr. Dr. Wilhelm Kuhne: Eine Mark Steigerhaus Aurora wird Ferienparadies. Wandlung in einer Hochsauerlandregion. Dr. Karl Schneider: Die Regionale 2013 im Hochsauerlandkreis. Ein Wandel mit Chancen. Siegfried Deventer: 40 Jahre Topografie die leise Vermessung. Landkartenherstellung vor Ort vom Doppelschritt über die Messtischaufnahme bis zur Satellitennavigation. Beruflicher Rückblick eines Topografen der Bezirksregierung Arnsberg. Fotografien von Barbara Anneser: Menschen im Sauerland. Dr. Erika Richter: Landrat Meinulf Georg Maria von Mallinckrodt. Stramm im Dienst, milde in der Ausführung. Prof. Dr. Walter Fritzsch: Der Elektrizitäts- Verband Büren-Brilon Dr. Karl Schneider: Bier ist ein Kulturgut HSK-Wirtschaftspreis 2013 für Susanne Veltins. Ludwig Stappert: Ein sporthistorischer Umbruch. Fußballkreise Meschede und Brilon haben sich zusammengeschlossen. Meinolf Strackbein: Ausstellung und Denkmal für Heinrich Knoche. Der Rechenmeister reformierte den Rechenunterricht. Norbert Föckeler: Rückblick aus dem Kreisarchiv. Zahlen, Daten, Fakten. Herausgeber: Der Landrat des Hochsauerlandkreises. Verlag und Vertrieb: Podszun-Verlag GmbH, Brilon, ISBN Preis: 12,90 Ein Papenburger Sauerländer erinnert sich Die vorliegende Schrift wird viele interessierte Leser finden, spricht hier doch eine im gesamten Hochsauerland bekannte und geschätzte Persönlichkeit: der HSK-Oberkreisdirektor von Dr. Adalbert Müllmann. Er ist aber auch als langjähriger Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes über den Kreis weithin bekannt und als Mitarbeiter unserer Zeitschrift SAUERLAND bis heute stets präsent. Wenn er nun seine Erinnerungen vorlegt, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss. Wie kommt es zu dem Titel? Der Autor Müllmann, den wir so selbstverständlich unserer Region zurechnen, hat das Sauerland erst spät zu seiner Heimat gemacht. Er stammt aus Papenburg im Emsland, heute durch den Bau großer Passagierschiffe der Meyer-Werft weltbekannt. Das galt noch nicht, als der kleine Adalbert am 13. April 1922,vierter von fünf Geschwistern, zur Welt kam. Seine Kindheit im Elternhaus im Mikrokosmos der Friederikenstraße schildert er mit liebevoller Anschaulichkeit z. B. die vielen kleinen Werkstätten der Handwerker, in denen sich der neugierige Junge heimisch fühlte. Es ist eine tief katholische Welt, in der er die Grundschule besucht und 1932 ins Gymnasium aufgenommen wird. Gute Noten sind von Beginn an für ihn kennzeichnend, sie werden es bis zum Ende seiner beruflichen Laufbahn bleiben.
53 Sauerland 4/ Ein Kriegshilfsdienst, 1939 im Torfmoor abgeleistet, bringt ihm 1940 den Reifevermerk, damit den gymnasialen Abschluss. Ausführlich schildert er dann sein Soldatenleben in der Kriegsmarine, von seiner Rekrutenzeit 1940 bis zum Rang eines Kapitänleutnants beim Stabe 1944 (S ), vor allem nach den erhaltenen Briefen an seine Mutter der Vater war 1936 als Kapitän im schweren Sturm verunglückt. Im Vorwort nennt er die Kriegsdarstellung nicht immer sachgerecht. Um seiner Mutter Mut zu machen, habe er das weniger Erfreuliche abgeschwächt und die Erfolgserlebnisse betont. Der Leser gewinnt jedoch den Eindruck, dass hier ein zielstrebiger und verantwortungsbewusster junger Mann seine ereignisreiche Laufbahn schildert, bis er vom 6. Mai bis 8. August 1945 in britische Kriegsgefangenschaft kommt. Schon im November 1945 beginnt er sein Jurastudium im stark kriegszerstörten Münster unter den schwierigsten Bedingungen. Aber sein zielstrebiger Einsatz lohnt sich. Schon 1948 macht er sein Referendarexamen und kann 1952 nach der Promotion auch sein Assessorexamen als Bester abschließen. Seine Bewerbung im öffentlichen Dienst bringt ihm im Juni 1952 die Berufung ins Beamtenverhältnis und die Zuweisung an den Regierungspräsidenten in Arnsberg. Der nun Dreißigjährige kannte weder die Stadt noch überhaupt das Sauerland. Eine wichtige persönliche Entscheidung fällt in die ersten Arnsberger Jahre, als er 1954 seine Verlobte Maria heiratet, die er als Mitstudentin kennen gelernt hatte. Sie wird die Mutter seiner drei Kinder. Die Arnsberger Zeit endet 1956, als der Arnsberger Regierungspräsident Biernat als Innenminister ins Düsseldorfer Kabinett, nun SPD geführt, berufen wird, und Müllmann, ihm als persönlicher Referent nach Düsseldorf folgt dann eine weitreichende Entscheidung: auf seine Bewerbung hin wird er in Brilon mit 37 von 38 Stimmen von allen Parteien vom Kreistag zum Oberkreisdirektor gewählt. Damit ist er nun fest im Sauerland verankert. Ausführlich berichtet er u. a. über die Ämter, die ihm in der Folge zufielen, vor allem aber über seine Aufgaben im Landkreis Brilon, z. B. die Wirtschaftförderung und die wachsende Bedeutung des Fremdenverkehrs mit der 1977 fertiggestellten Winterberger Bobbahn, einem kostspieligen Projekt, das, wie er anmerkt, später vom Sportausschuss des Deutschen Bundestages ausreichend gefördert wurde. Seinem besonderen Anliegen, der Gründung von Naturparks widmet er sich in den Erinnerungen eingehend. Als schwierigsten, aber interessantesten Abschnitt seiner beruflichen Arbeit nennt er die kommunale Neugliederung 1974/75, die nach vielen Debatten zum Großkreis Arnsberg-Meschede-Brilon führte, wobei er selbst dann zum Oberkreisdirektor dieses flächengrößten Kreises in NRW gewählt wurde. Als Ziel nannte er nach der Wahl, dass er eine bürgerschaftliche Verwaltung, die sich übergeordneter sittlicher Werte bewusst sei, anstreben wolle. Große neue Aufgaben warteten nun auf ihn, bis er 1987 Abschied vom aktiven Dienst nehmen musste. Er lässt ihn mit sehr lesenswerten Abschiedsreden ausklingen. Doch endet das Erinnerungsbuch damit nicht. Im Kapitel Im Ruhestand schildert er seine ehrenamtlichen Funktionen, eine geradezu überwältigende Fülle von Ämtern, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Erwähnt sei jedoch mit Nachdruck auch hier sein Vorsitz im Sauerländer Heimatbund von , dessen Bedeutung allen Mitgliedern des SHB ganz bewusst ist und für den sie dankbar sind. Dr. Müllmann schließt seine Erinnerungen mit einem Bericht über seine Vorfahren, die Großeltern und die Generation seines Vaters. Besonders eindringlich ist der Schlussabschnitt über den Vater, Kapitän Hans Müllmann, und dessen tragischer Tod. Mit Bewegung legt der Leser die Darstellung aus der Hand, dankbar für den Gesamttext mit den zahlreichen ausdrucksvollen Fotos. Das schöne Layout von Hans Wevering spiegelt die Fülle dieses erfolgreichen Lebens in überzeugender Weise. Dr. Erika Richter Scharfenberg und seine Pastöre 700 Jahre Kirchengeschichte St. Laurentius Die Verabschiedung des letzten Pfarrers von Scharfenberg in den Ruhestand ist für Ortsheimatpfleger Wilfried Finke Anlass, über die Pfarrer in der Gemeinde zu recherchieren und zu forschen. Die Kirche ist noch da, aber der eigene Pfarrer, der seit Menschengedenken immer zum Dorf gehört hat wie die eigene Kirche, den gibt es jetzt nicht mehr. Diese Situation wird sich so auch in Zukunft in fast allen unseren Kirchengemeinden darstellen. Wer waren diese Pastöre, woher stammten sie, was ist über ihre Vergangenheit und ihren weiteren Werdegang zu erfahren? Wie haben sie gelebt, wie haben sie gewohnt und wie wurden sie entlohnt? Diesen Fragen geht der Autor in sorgfältigen und umfangreichen Recherchen in alten Urkunden und Kirchenbüchern nach. Dabei zeigt er auch die oft großen Schwierigkeiten auf, sichere Informationen über die bloßen Namen und ungefähre Jahreszahlen hinaus zu erhalten. Entsprechend sind auch die Darstellungen der einzelnen Priesterpersönlichkeiten mehr oder weniger umfangreich. Probst Dr. Reinhard Richter aus Brilon drückt es in seinem Geleitwort treffend aus: Vom Lumpen, der seinen Geldbeutel zu füllen wusste, vom vereinsamten Mann, der seine Gefährtin in kühlen Zeiten ersehnte und fand, bis zum eifrigen Lehrer, Seelenhirten und bescheidenen Beter und Gottesmann in Scharfenberg waren sie im Laufe der Jahrhunderte alle zu Hause. Ein lesenswertes und interessantes Werk, ein wertvoller Beitrag zur Kirchen- und Heimatgeschichte. Heinz-Josef Padberg Herausgeber: Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius Ortsverein Scharfenberg Esloher Museumsnachrichten 2013 Inhaltsverzeichnis mit Autoren, vorläufig 03 Bericht des Museumsvereins Die Highlights aus dem Jahr 2012 Franz-Josef Keite 08 Lebenskünstler und Minderheiten im Sauerland Ein neues Buch aus dem Museum Eslohe: Fang dir ein Lied an! Peter Bürger 09 Zur Linde Geschichte einer Dorfkneipe Ein Relikt aus vergangener Zeit? Wilhelm Feldmann 12 Ausflug nach Lüdge Gedenktafel ehrt Vikar Otto Günnewich Siegbert Tillmann 14 Spurensuche zu Dr. Johannes Hambroer Nachfolger von Otto Günnewich in Salwey Siegbert Tillmann 18 Flur-, Gewässer- und Ortsnamen der Gemeinde Eslohe. Teil I: Kirchspiel Cobbenrode Werner Beckmann 37 Kochen in der guten alten Zeit Mathilde Rischen 41 Aus dem Leben Johann Georg Husemanns Obervogt der Herren von Greiffenclau in Gereuth Heinrich Weisel 46 Mitgebracht haben wir, was wir auf dem Leib hatten Ostflüchtlinge und Heimatvertriebene in Eslohe nach 1945 Teil 2 Dr. Hans Dürr 54 Eine Sprengung mit Überraschungen Der Wasserturm in Wenholthausen wurde von Pionieren aus Höxter gesprengt Rainer Braun 58 Wo sie blieben, was sie wurden... Sr. M. Danielis Müller ehemals Anneliese Müller Paul Rötz nach Aufzeichnungen von Sr. Danielis 63 Kommunionbild Museumsstück des Jahres Rudolf Franzen 64 Dr. Heinrich Biesenbach Zum Gedenken an seinen 150. Geburtstag Franz-Josef Huß 66 Wiedersehen mit der Martinsklause Eine Reise in die Vergangenheit Stefan Kuntze 70 Liebes Christkind! Frielinghäuser Weihnachtswünsche 1932 Alfred Bruns
54 198 Sauerland 4/2013 Personalien Dank an Werner Saure Unser Heimatfreund Werner Saure hatte kürzlich gebeten, ihn wegen seines vorgerückten Alters von seiner Mitarbeit im Vorstand dem er seit 1984 angehört zu entbinden. Das war für unseren 1. Vorsitzenden Elmar Reuter Anlass, ihm im Verabschiedung von Werner Saure zur Hauptversammlung des SHB in Möhnesee-Körbecke durch den 1. Vorsitzenden Elmar Reuter und stellv. Vorsitzende Birgit Haberhauer-Kuschel Foto: Hans Wevering Rahmen der letzten Mitgliederversammlung am 31. August in der Gemeinde Möhnesee für seine langjährige heimatbezogene Arbeit zu danken. Ich selbst erinnere mich gern an unsere erste Begegnung anlässlich der Vorbereitung der Mitgliederversammlung 1984, an der er verantwortlich beteiligt war. Diese Versammlung fand im Nonnenchor des Klosters Oelinghausen statt, ein besonders eindrucksvoller Rahmen. Ebenso wird unseren älteren Mitgliedern das Konzert an der historischen Orgel im Gedächtnis geblieben sein. Besonders hervorzuheben sind seine Verdienste um die Herausgabe der Urkunden des Klosters Oelinghausen, die als Band 10 unserer Landeskundlichen Schriftenreihe im Dezember 1992 der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnten. Im örtlichen Bereich hat er sowohl in Oelinghausen als auch in Neheim-Hüsten mehrere wichtige heimatbezogene Funktionen wahrgenommen und durch eine ganze Anzahl von historischen Beiträgen, auch in unserer Zeitschrift Sauerland, unser Wissen um die Vergangenheit bereichert. Am 13. September 1995 wurde ihm im Rahmen einer Feierstunde im Kloster Oelinghausen durch Landrat Franz-Josef Leikop das Bundesverdienstkreuz überreicht. Ad multos annos. Dr. Adalbert Müllmann Bernd Follmann 70 Seit 1992 ist er Mitglied im Vorstand des Sauerländer Heimatbundes. Hauptamtlich war Bernd Follmann lange Jahre bei der Stadtverwaltung Marsberg tätig, zuletzt als Stadtoberverwaltungsrat und hauptamtlicher Vertreter des Bürgermeisters. Er verstand es in vorbildlicher Weise, im Rahmen seiner dienstlichen Verpflichtungen die Belange der Heimatpflege zu unterstützen, angesichts der historischen Bedeutung Marsbergs von besonderem Gewicht. Mehrere Jahre nahm er mit Erfolg die ehrenamtliche Geschäftsführung des Fördervereins Kloster Bredelar wahr des für unsere ganze Region bedeutsamen alten Zisterzienserklosters, eine in der Aulbauphase besonders schwierige Aufgabe. In unserer Zeitschrift meldet er sich mit fundierten Beiträgen zu Wort, so zuletzt mit dem Bericht über die Grafen Stolberg-Stolberg und die Familie Freiherr von Twickel und ihre Bedeutung für den Raum Marsberg-Westheim ( Sauerland Heft 4 Seiten 141 ff.). Am 5. Oktober wurde er 70 Jahre alt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Dr. Adalbert Müllmann Ortsheimatpfleger Albert Schnepper, Mecklinghausen, verstorben Nur wenige Tage nach seinem 91. Geburtstag am 18. August ist der Ortsheimatpfleger von Mecklinghausen, Albert Schnepper, am 5. September 2013 verstorben. Das Gründungsmitglied des Kreisheimatbundes Olpe und langjährige Mitglied des Sauerländer Heimatbundes widmete sich neben seiner Tätigkeit als Gerbermeister im familieneigenen Unternehmen und später als Grundschullehrer und Schulleiter insbesondere der Familienund Höfeforschung im heimischen Repetal. Ohne seine Mitarbeit wäre der 3. Band der Schriftenreihe der Stadt Attendorn über das Repetal mit der Geschichte der Kirchspiele Helden und Dünschede (2008) kaum denkbar gewesen. Um die genealogischen Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können, fügte man diesem umfangreichen Band eine DVD mit den familienkundlichen Forschungen von Albert Schnepper und Herbert Menke sowie weiterführenden Quellen bei. Damit erhielt dieser Band der Schriftenreihe neben seinen lexikalisch aufbereiteten Informationen auch die Qualität eines Ortsfamilienbuches. Für sein mehr als 4 Jahrzehnte andauerndes ehrenamtliches Engagement im Bereich der Heimatpflege und Heimatforschung und die großen Verdienste um die Chronik des Repetales wurde Albert Schnepper als einer der 5 Preisträger bei der Verleihung des Attendorner Bürgerpreises 2010 geehrt. Durch seine heimat- und familiengeschichtlichen Forschungen wird er uns stets in bester Erinnerung bleiben. Birgit Haberhauer-Kuschel I mpressum SAUERLAND Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes (früher Trutznachtigall, Heimwacht und Sauerlandruf) 46. Jahrgang Heft 4, Dezember 2013 ISSN Herausgeber und Verlag: Sauerländer Heimatbund e.v., Postfach 14 65, Meschede Vorsitzender: Elmar Reuter, Unterm Hagen 39, Olsberg, Tel. (02962) , Reuter.Elmar@t-online.de Stellv. Vorsitzende: Birgit Haberhauer-Kuschel, Wesetalstraße 90, Attendorn, Tel. ( ) 7473, bk@ra-kuschel.eu. Ehrenvorsitzender: Dr. Adalbert Müllmann, Jupiterweg 7, Brilon, Tel. ( ) Geschäftsstelle: Hochsauerlandkreis, Fachdienst Kultur/Musikschule, Karin Kraft, Telefon (02 91) , Telefax (02 91) , Karin.Kraft@hochsauerlandkreis.de, Postfach 14 65, Meschede Internet: Konten: Sparkasse Arnsberg-Sundern (BLZ ) Jahresbeitrag zum Sauerländer Heimatbund einschließlich des Bezuges dieser Zeitschrift 15, EUR. Einzelpreis 4, EUR. Erscheinungsweise vierteljährlich. Redaktion: Günther Becker, Lennestadt. Werner Cordes, Attendorn. Dr. Theo Bönemann, Menden. Su san ne Falk, Lennestadt. Norbert Föckeler, Brilon. Hans-Jürgen Friedrichs, Bestwig. Helmut Fröhlich, Warstein. Birgit Haberhauer-Kuschel, Attendorn. Professor Dr. Huber tus Halbfas, Drolshagen. Heinz Lettermann, Bigge-Olsberg. Dr. Adalbert Müllmann, Brilon. Heinz-Josef Pad berg, Meschede. Elmar Reuter, Olsberg. Dr. Erika Richter, Meschede. Michael Schmitt, Sundern. Dr. Jür gen Schulte- Hobein, Arnsberg. Dieter Wurm, Meschede. Schlussredaktion: Hans Wevering, Schlossstraße 54, Arnsberg, Tel. ( ) 32 62, Fax ( ) , hanswevering@t-online.de Redaktionsanschrift: Sauerländer Heimatbund, Postfach 14 65, Meschede Lithografie, Layout und techn. Redaktion: Hans Wevering, Schlossstraße 54, Arnsberg, Tel. ( ) 32 62, Fax ( ) , hanswevering@t-online.de, Druck: becker druck, F. W. Becker GmbH Anzeigenverwaltung: becker druck, F. W. Becker GmbH, Grafenstr. 46, Arnsberg, Ansprechpartner: Eckhard Schmitz, E.-Mail: schmitz@becker-druck.de Tel. ( ) , Fax ( ) Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10 vom 1. Jan Hinweis: Dieser Ausgabe liegt der Prospekt Pilger reisen gestern und heute des Stadt- und Landständearchivs Arnsberg bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.
55 DER DIGITALE VOGEL & DER WURM Kein Märchen, sondern normales Marketing. Print to web PDF E-Paper ebooks CRM Lettershop Mailings Digitaldruck Machen wir sehr gut & gern. Digital
56 Sparkassen-Finanzgruppe 200 Sauerland 4/2013 Jetzt Finanz-Check machen! Das Sparkassen-Finanzkonzept: ganzheitliche Beratung statt 08/15. Service, Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen Sparkassen im Hochsauerlandkreis Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung
 Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung Teil 1 Kriegsbeginn und Fronterlebnis Trotz seines labilen Gesundheitszustandes wurde der Mannheimer Fritz
Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung Teil 1 Kriegsbeginn und Fronterlebnis Trotz seines labilen Gesundheitszustandes wurde der Mannheimer Fritz
Schule im Kaiserreich
 Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
über das Maß der Pflicht hinaus die Kräfte dem Vaterland zu widmen.
 Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Feldpostkarten aus dem I. Weltkrieg
 Ausstellung Feldpostkarten aus dem I. Weltkrieg 1914-1918 Waldperlacher Familien haben die Zeitdokumente bewahrt. Kommunalwahlen am 16. März und Europawahlen am 25. Mai 2014 im Eingangsbereich der Gänselieselschule
Ausstellung Feldpostkarten aus dem I. Weltkrieg 1914-1918 Waldperlacher Familien haben die Zeitdokumente bewahrt. Kommunalwahlen am 16. März und Europawahlen am 25. Mai 2014 im Eingangsbereich der Gänselieselschule
Auswirkungen des Kriegs am Beispiel Dormagen
 Verwundet wurden bis jetzt: Peter Kemper, Peter Schweren, Friedrich Hinsen,.. Den Heldentod für Kaiser und Vaterland starben Johann Nix, Hubert Ripphahn, Peter Hesch... Die Aushungerungspolitik Englands
Verwundet wurden bis jetzt: Peter Kemper, Peter Schweren, Friedrich Hinsen,.. Den Heldentod für Kaiser und Vaterland starben Johann Nix, Hubert Ripphahn, Peter Hesch... Die Aushungerungspolitik Englands
Aus: Inge Auerbacher, Ich bin ein Stern, 1990, Weinheim Basel: Beltz & Gelberg
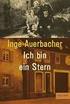 Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Aufgabe 1. Info: Das Bild ist von Käthe Kollwitz. Der Namen des Bildes lautet Gefallen. Käthe Kollwitz Sohn fiel 1916 in der Schlacht von Verdun.
 Aufgabe 1 Info: Das Bild ist von Käthe Kollwitz. Der Namen des Bildes lautet Gefallen. Käthe Kollwitz Sohn fiel 1916 in der Schlacht von Verdun. Arbeitsauftrag 1. Beschreibe das Bild. 2. Überlege, wie
Aufgabe 1 Info: Das Bild ist von Käthe Kollwitz. Der Namen des Bildes lautet Gefallen. Käthe Kollwitz Sohn fiel 1916 in der Schlacht von Verdun. Arbeitsauftrag 1. Beschreibe das Bild. 2. Überlege, wie
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt
 Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Predigt zur Profanierung der Kirche St. Pius X in Neunkirchen. am 1. Nov (Allerheiligen) (Liturgische Texte vom Hochfest Allerheiligen )
 1 Predigt zur Profanierung der Kirche St. Pius X in Neunkirchen am 1. Nov. 2015 (Allerheiligen) (Liturgische Texte vom Hochfest Allerheiligen ) Liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht einfach, an solch
1 Predigt zur Profanierung der Kirche St. Pius X in Neunkirchen am 1. Nov. 2015 (Allerheiligen) (Liturgische Texte vom Hochfest Allerheiligen ) Liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht einfach, an solch
DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die
 DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die USA besetzten Deutschland. Deutschland bekommt im VETRAG
DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die USA besetzten Deutschland. Deutschland bekommt im VETRAG
Begrüßungs-/Eröffnungsrede. des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern. Serhat Sarikaya
 1 Entwurf Begrüßungs-/Eröffnungsrede des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern Serhat Sarikaya anlässlich der Ehrung der Mitglieder des SPD Stadtverbands Sundern am 24. September 2016 Ehrengast: Bundeskanzler
1 Entwurf Begrüßungs-/Eröffnungsrede des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern Serhat Sarikaya anlässlich der Ehrung der Mitglieder des SPD Stadtverbands Sundern am 24. September 2016 Ehrengast: Bundeskanzler
Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler)
 Archivale im August 2013 Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler) 1. Brief von Hanna Fries aus Ludwigshafen vom 7.2.1917 an Jakob Ziegler, Weyher (Quellennachweis: Landesarchiv Speyer, Bestand
Archivale im August 2013 Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler) 1. Brief von Hanna Fries aus Ludwigshafen vom 7.2.1917 an Jakob Ziegler, Weyher (Quellennachweis: Landesarchiv Speyer, Bestand
Abitursrede von 1987 von Lars Baumbusch
 Lars O. Baumbusch Max-Planck-Gymnasium - http://www.max-planck-gymnasium.de 77933 Lahr Beim Durchforsten meiner alten Schulunterlagen fiel mir meine Abitursrede von 1987 in die Hände. Mir war damals vom
Lars O. Baumbusch Max-Planck-Gymnasium - http://www.max-planck-gymnasium.de 77933 Lahr Beim Durchforsten meiner alten Schulunterlagen fiel mir meine Abitursrede von 1987 in die Hände. Mir war damals vom
Rede von Ulla Schmidt
 BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE Rede von Ulla Schmidt in Leichter Sprache bei der Mitglieder-Versammlung der Lebenshilfe in Berlin 16.09.2016 Der Text in Leichter Sprache ist von der Bundesvereinigung Lebenshilfe.
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE Rede von Ulla Schmidt in Leichter Sprache bei der Mitglieder-Versammlung der Lebenshilfe in Berlin 16.09.2016 Der Text in Leichter Sprache ist von der Bundesvereinigung Lebenshilfe.
Wähler des 3. Wahlkreises!
 Baustein zur Regionalgeschichte: Wähler des 3. Wahlkreises! Zwei Aufrufe zur Reichstagswahl im Januar 1874 Zur Information: Nach der Gründung des Deutschen Reiches gehörte das Oldenburger Münsterland bei
Baustein zur Regionalgeschichte: Wähler des 3. Wahlkreises! Zwei Aufrufe zur Reichstagswahl im Januar 1874 Zur Information: Nach der Gründung des Deutschen Reiches gehörte das Oldenburger Münsterland bei
Ihnen allen gemeinsam ist die Trauer, die sie erfüllt hat und jetzt noch in Ihnen ist. Niemand nimmt gerne Abschied von einem lieben Menschen.
 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen Liebe Gemeinde viele von Ihnen sind heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen, weil sie einen lieben Menschen verloren haben, einen Menschen, mit dem
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen Liebe Gemeinde viele von Ihnen sind heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen, weil sie einen lieben Menschen verloren haben, einen Menschen, mit dem
Wie wählte Rinteln? Thomas Gräfe. Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln
 Geschichte Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln 1867-1912 Wissenschaftlicher Aufsatz Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen
Geschichte Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln 1867-1912 Wissenschaftlicher Aufsatz Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen
Samuel, Gottes Kindlicher Diener
 Bibel für Kinder zeigt: Samuel, Gottes Kindlicher Diener Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Lyn Doerksen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Samuel, Gottes Kindlicher Diener Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Lyn Doerksen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Katholische Grundschule Mainzer Straße Mainzer Straße Köln. Tel.: 0221/ Fax: 0221/
 Katholische Grundschule Mainzer Straße Mainzer Straße 30-34 50678 Köln Offene Ganztagsschule www.mainzer-strasse.koeln Tel.: 0221/3566636-0 Fax: 0221/3566636-37 Weihnachten 2016 Silber und Gold Wir wünschen
Katholische Grundschule Mainzer Straße Mainzer Straße 30-34 50678 Köln Offene Ganztagsschule www.mainzer-strasse.koeln Tel.: 0221/3566636-0 Fax: 0221/3566636-37 Weihnachten 2016 Silber und Gold Wir wünschen
So lebten die Menschen während der Industrialisierung
 So lebten die Menschen während der Industrialisierung Aus: Fairclough, Oliver and Emmeline Leary, Textiles by William Morris and Morris & Co. 1861-1940, Birmingham Museums and Art Gallery, 1981, Photo
So lebten die Menschen während der Industrialisierung Aus: Fairclough, Oliver and Emmeline Leary, Textiles by William Morris and Morris & Co. 1861-1940, Birmingham Museums and Art Gallery, 1981, Photo
Predigt zum Interview-Buch mit Papst Benedikt Letzte Gespräche Thema: Kirchensteuer
 Predigt zum Interview-Buch mit Papst Benedikt Letzte Gespräche Thema: Kirchensteuer 1 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Letzte Gespräche An diesem Freitag erschien in Deutschland ein Interview-Buch mit unserem
Predigt zum Interview-Buch mit Papst Benedikt Letzte Gespräche Thema: Kirchensteuer 1 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Letzte Gespräche An diesem Freitag erschien in Deutschland ein Interview-Buch mit unserem
Das Problem mit der Nationalhymne: Einheitshymne vs. SED-Doktrin
 Politik Marc Castillon Das Problem mit der Nationalhymne: Einheitshymne vs. SED-Doktrin Essay Castillon, Marc Humboldt Universität zu Berlin Sommersemester 2007 Hauptseminar Die DDR und die nationale
Politik Marc Castillon Das Problem mit der Nationalhymne: Einheitshymne vs. SED-Doktrin Essay Castillon, Marc Humboldt Universität zu Berlin Sommersemester 2007 Hauptseminar Die DDR und die nationale
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg?
 Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Daniel als Gefangener
 Bibel für Kinder zeigt: Daniel als Gefangener Text: Edward Hughes Illustration: Jonathan Hay Adaption: Mary-Anne S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible
Bibel für Kinder zeigt: Daniel als Gefangener Text: Edward Hughes Illustration: Jonathan Hay Adaption: Mary-Anne S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
beten singen feiern Ein Gebet- und Messbuch für Kinder Zur Feier der heiligen Messe und zur Buße Von Karl Heinz König und Karl Joseph Klöckner Kösel
 beten singen feiern Ein Gebet- und Messbuch für Kinder Zur Feier der heiligen Messe und zur Buße Von Karl Heinz König und Karl Joseph Klöckner Kösel 2 Begrüßung Hallo, liebes Mädchen, lieber Junge! Beten,
beten singen feiern Ein Gebet- und Messbuch für Kinder Zur Feier der heiligen Messe und zur Buße Von Karl Heinz König und Karl Joseph Klöckner Kösel 2 Begrüßung Hallo, liebes Mädchen, lieber Junge! Beten,
Predigt zu Philipper 4, 4-7
 Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Predigt Joh 2,1-11 St. Lukas, Liebe Gemeinde! Wenn Ihr, Konfirmandinnen und Konfirmanden, einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin
 1 Predigt Joh 2,1-11 St. Lukas, 17.1.2016 Liebe Gemeinde! Wenn Ihr, Konfirmandinnen und Konfirmanden, einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin bekommt, die oder der neu an der Schule ist, dann seid Ihr
1 Predigt Joh 2,1-11 St. Lukas, 17.1.2016 Liebe Gemeinde! Wenn Ihr, Konfirmandinnen und Konfirmanden, einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin bekommt, die oder der neu an der Schule ist, dann seid Ihr
2. Der Dreißigjährige Krieg:
 2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
Lukas 15,1-32. Leichte Sprache. Jesus erzählt 3 Geschichten, wie Gott ist.
 Lukas 15,1-32 Leichte Sprache Jesus erzählt 3 Geschichten, wie Gott ist. Als Jesus lebte, gab es Religions-Gelehrte. Die Religions-Gelehrten wissen viel über Gott. Die Religions-Gelehrten erzählen den
Lukas 15,1-32 Leichte Sprache Jesus erzählt 3 Geschichten, wie Gott ist. Als Jesus lebte, gab es Religions-Gelehrte. Die Religions-Gelehrten wissen viel über Gott. Die Religions-Gelehrten erzählen den
TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG WARUM TAUFEN WIR: MT 28,16-20
 GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
Franz Jägerstätter Märtyrer
 Franz Jägerstätter 1907 1943 Märtyrer Franz Jägerstätter wird am 20. Mai 1907 in St. Radegund, Oberösterreich (Diözese Linz), als Kind der ledigen Bauernmagd Rosalia Huber geboren. Sie und der Vater, Franz
Franz Jägerstätter 1907 1943 Märtyrer Franz Jägerstätter wird am 20. Mai 1907 in St. Radegund, Oberösterreich (Diözese Linz), als Kind der ledigen Bauernmagd Rosalia Huber geboren. Sie und der Vater, Franz
Und deshalb erinnere ich hier und heute wie im vergangenen Jahr zum Volkstrauertag an die tägliche Trauer hunderttausender Mütter, Väter und Kinder.
 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Volkstrauertag im November 2010 wir verstehen heute den Volkstrauertag, wie das Wort sagt als einen Tag der Trauer auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg Eigentlich müßte
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Volkstrauertag im November 2010 wir verstehen heute den Volkstrauertag, wie das Wort sagt als einen Tag der Trauer auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg Eigentlich müßte
Willkommen! In unserer Kirche
 Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt um mit einem lauten Ooohh euer Bedauern auszudrücken ;-)
 Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Verwandten und Freunde, liebe Lehrer, meine Damen und Herren, die zu keiner dieser Gruppen gehören ICH HABE FERTIG! Das hat Giovanni Trappatoni, der
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Verwandten und Freunde, liebe Lehrer, meine Damen und Herren, die zu keiner dieser Gruppen gehören ICH HABE FERTIG! Das hat Giovanni Trappatoni, der
Archivale des Monats November. Erstes Kriegsjahr 1914. Schulaufsatz von Herta Morgens, Schülerin der 5. Klasse, vom 19.
 Archivale des Monats November Erstes Kriegsjahr 1914 Schulaufsatz von Herta Morgens, Schülerin der 5. Klasse, vom 19. November 1914 I. Nachweis: Landesarchiv Speyer, Best. P 31, Nr. 303 Herkunft des Aufsatzheftes:
Archivale des Monats November Erstes Kriegsjahr 1914 Schulaufsatz von Herta Morgens, Schülerin der 5. Klasse, vom 19. November 1914 I. Nachweis: Landesarchiv Speyer, Best. P 31, Nr. 303 Herkunft des Aufsatzheftes:
Wie soll ich dich empfangen und wie begegn' ich dir? (Paul Gerhardt)
 Wie soll ich dich empfangen und wie begegn' ich dir? (Paul Gerhardt) Die Weihnachtsbotschaft kündigt Jesus an (Gottes Angebot) und im Abendmahl erinnern wir uns an das was Jesus getan hat! (Unsere Antwort)
Wie soll ich dich empfangen und wie begegn' ich dir? (Paul Gerhardt) Die Weihnachtsbotschaft kündigt Jesus an (Gottes Angebot) und im Abendmahl erinnern wir uns an das was Jesus getan hat! (Unsere Antwort)
Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig
 90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
Das moderne Bayern. Noch viele weitere Reformen sorgten dafür, dass Bayern politisch gesehen zu einem der fortschrittlichsten Staaten Europas wurde.
 Das moderne Bayern Durch das Bündnis mit Napoleon konnte sich das Königreich Bayern zu einem der modernsten Staaten Europas wandeln. Das Staatsgebiet vergrößerte sich, am Ende der napoleonischen Ära ist
Das moderne Bayern Durch das Bündnis mit Napoleon konnte sich das Königreich Bayern zu einem der modernsten Staaten Europas wandeln. Das Staatsgebiet vergrößerte sich, am Ende der napoleonischen Ära ist
Die Salvatorschule in Kolwesi/Kongo. Der Kongo zählt zu den ärmsten Ländern der Welt
 Die Salvatorschule in Kolwesi/Kongo BERLIN Kolwesi/Kongo Der Kongo zählt zu den ärmsten Ländern der Welt Eine Untersuchung der kongolesischen Regierung im Jahr 2006 ergab folgende Zahlen: 76 % der Bevölkerung
Die Salvatorschule in Kolwesi/Kongo BERLIN Kolwesi/Kongo Der Kongo zählt zu den ärmsten Ländern der Welt Eine Untersuchung der kongolesischen Regierung im Jahr 2006 ergab folgende Zahlen: 76 % der Bevölkerung
Das Eiserne Kreuz im Nationalsozialismus
 Geschichte Florian Butter Das Eiserne Kreuz im Nationalsozialismus Wirkung und Bedeutung im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und Propaganda Studienarbeit 1. Einleitung Anlässlich der Befreiungskriege
Geschichte Florian Butter Das Eiserne Kreuz im Nationalsozialismus Wirkung und Bedeutung im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und Propaganda Studienarbeit 1. Einleitung Anlässlich der Befreiungskriege
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012
 Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin
 Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin Es gilt das Gesprochene Wort! Vom Sterben vor der Zeit hat Bruno Kreisky manchmal
Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin Es gilt das Gesprochene Wort! Vom Sterben vor der Zeit hat Bruno Kreisky manchmal
Kinder. Jugend. Gottesdienstgestaltung. Familie. Danken teilen helfen Kindergottesdienst zu Erntedank KJ KJS Burgenland
 Gottesdienstgestaltung Kinder Familie Jugend Danken teilen helfen Kindergottesdienst zu Erntedank KJ KJS Burgenland www.kath-kirche-vorarlberg.at/liturgieboerse Danken teilen helfen Kindergottesdienst
Gottesdienstgestaltung Kinder Familie Jugend Danken teilen helfen Kindergottesdienst zu Erntedank KJ KJS Burgenland www.kath-kirche-vorarlberg.at/liturgieboerse Danken teilen helfen Kindergottesdienst
Behinderten-Politisches Maßnahmen-Paket für Brandenburg
 Behinderten-Politisches Maßnahmen-Paket für Brandenburg Das macht Brandenburg für die Rechte von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen Zusammen-Fassung in Leichter Sprache. 2 Achtung Im Text gibt es
Behinderten-Politisches Maßnahmen-Paket für Brandenburg Das macht Brandenburg für die Rechte von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen Zusammen-Fassung in Leichter Sprache. 2 Achtung Im Text gibt es
Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck.
 Einleitung Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck. Anna ist ein liebes und ruhiges Mädchen. Aber
Einleitung Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck. Anna ist ein liebes und ruhiges Mädchen. Aber
SCHAUEN BETEN DANKEN. Ein kleines Gebetbuch. Unser Leben hat ein Ende. Gott, wir möchten verstehen: Unser Leben hat ein Ende.
 Unser Leben hat ein Ende Gott, wir möchten verstehen: Unser Leben hat ein Ende. Wenn wir nachdenken über den Tod: Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Alles gut? Alles schlecht? Halb gut? Halb schlecht?
Unser Leben hat ein Ende Gott, wir möchten verstehen: Unser Leben hat ein Ende. Wenn wir nachdenken über den Tod: Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Alles gut? Alles schlecht? Halb gut? Halb schlecht?
Manfred Eckert. Geschichte der Berufserziehung und der Berufspädagogik. Theorien zur Entstehung von Schule
 Manfred Eckert Geschichte der Berufserziehung und der Berufspädagogik Fünfte Vorlesung: Theorien zur Entstehung von Schule Theorien zur Entstehung von Schulen: Qualifikationsdefizite, Integrations- und
Manfred Eckert Geschichte der Berufserziehung und der Berufspädagogik Fünfte Vorlesung: Theorien zur Entstehung von Schule Theorien zur Entstehung von Schulen: Qualifikationsdefizite, Integrations- und
Kinderrechte und Glück
 Kinderrechte gibt es noch gar nicht so lange. Früher, als euer Urgroßvater noch ein Kind war, wurden Kinder als Eigentum ihrer Eltern betrachtet, genauer gesagt, als Eigentum ihres Vaters. Er hat zum Beispiel
Kinderrechte gibt es noch gar nicht so lange. Früher, als euer Urgroßvater noch ein Kind war, wurden Kinder als Eigentum ihrer Eltern betrachtet, genauer gesagt, als Eigentum ihres Vaters. Er hat zum Beispiel
Der Bayerische. Land-Tag. in leichter Sprache
 Der Bayerische Land-Tag in leichter Sprache Seite Inhalt 2 Begrüßung 1. 4 Der Bayerische Land-Tag 2. 6 Die Land-Tags-Wahl 3. 8 Parteien im Land-Tag 4. 10 Die Arbeit der Abgeordneten im Land-Tag 5. 12 Abgeordnete
Der Bayerische Land-Tag in leichter Sprache Seite Inhalt 2 Begrüßung 1. 4 Der Bayerische Land-Tag 2. 6 Die Land-Tags-Wahl 3. 8 Parteien im Land-Tag 4. 10 Die Arbeit der Abgeordneten im Land-Tag 5. 12 Abgeordnete
Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18.
 Annette Schavan Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2005 I. Politik braucht Vertrauen. Ich
Annette Schavan Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2005 I. Politik braucht Vertrauen. Ich
1 Die Ausgangssituation: Die Wohnung in Trümmern und Trümmer im Gehirn
 1 Die Ausgangssituation: Die Wohnung in Trümmern und Trümmer im Gehirn Für Menschen von heute ist es selbstverständlich, Weiterbildungseinrichtungen nutzen zu können. Es gibt vielfältige Angebote und auch
1 Die Ausgangssituation: Die Wohnung in Trümmern und Trümmer im Gehirn Für Menschen von heute ist es selbstverständlich, Weiterbildungseinrichtungen nutzen zu können. Es gibt vielfältige Angebote und auch
Wo Himmel und Erde sich berühren
 Einführung: Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema: Wo Himmel und Erde sich berühren Was bedeutet Wo Himmel und Erde sich berühren? Nun, unser Leben ist ein ewiges Suchen nach Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
Einführung: Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema: Wo Himmel und Erde sich berühren Was bedeutet Wo Himmel und Erde sich berühren? Nun, unser Leben ist ein ewiges Suchen nach Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
Spannende Lokalgeschichte: Aufklärung über Rudolf Müllers gymnasiale Tätigkeit in Stuttgart
 Spannende Lokalgeschichte: Aufklärung über Rudolf Müllers gymnasiale Tätigkeit in Stuttgart Von Christian B. Schad, Konventionsbeauftragter des DRK-Kreisverbandes Stuttgart Auf Seite 120 der bekannten
Spannende Lokalgeschichte: Aufklärung über Rudolf Müllers gymnasiale Tätigkeit in Stuttgart Von Christian B. Schad, Konventionsbeauftragter des DRK-Kreisverbandes Stuttgart Auf Seite 120 der bekannten
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich. 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz. am 23. November 2009 im Spiegelsaal
 Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Es gilt das gesprochene Wort
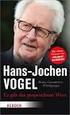 Rede OB in Susanne Lippmann anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November 2011, am Ehrenmal auf dem Münsterkirchhof Es gilt das gesprochene Wort 2 Anrede, es ist November,
Rede OB in Susanne Lippmann anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November 2011, am Ehrenmal auf dem Münsterkirchhof Es gilt das gesprochene Wort 2 Anrede, es ist November,
Adolf Hitler. Der große Diktator
 Adolf Hitler Der große Diktator Biografie Die frühen Jahre Herkunft, Kindheit und erster Weltkrieg Aufstieg Polit. Anfänge, Aufstieg und Kanzlerschaft Der Diktator Politische Ziele und Untergang Hitlers
Adolf Hitler Der große Diktator Biografie Die frühen Jahre Herkunft, Kindheit und erster Weltkrieg Aufstieg Polit. Anfänge, Aufstieg und Kanzlerschaft Der Diktator Politische Ziele und Untergang Hitlers
Sprüche für die Parte und das Andenkenbild
 (1) Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, nur fern! Tot ist nur, wer vergessen wird. (7) Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh`, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
(1) Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, nur fern! Tot ist nur, wer vergessen wird. (7) Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh`, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
5. Januar. Hl. Johann Nepomuk Neumann. Bischof. Gedenktag
 Hl. Johann Nepomuk Neumann 7 5. Januar Hl. Johann Nepomuk Neumann Bischof Gedenktag Johann Nepomuk Neumann wurde am 28. März 1811 in Prachatitz in Böhmen geboren. Die theo logischen Studien absolvierte
Hl. Johann Nepomuk Neumann 7 5. Januar Hl. Johann Nepomuk Neumann Bischof Gedenktag Johann Nepomuk Neumann wurde am 28. März 1811 in Prachatitz in Böhmen geboren. Die theo logischen Studien absolvierte
Laternenumzüge. Martinigänse
 Laternenumzüge Am Martinstag feiert man den Abschluss des Erntejahres. Für die Armen war das eine Chance, einige Krümel vom reichgedeckten Tisch zu erbetteln. Aus diesem Umstand entwickelten sich vermutlich
Laternenumzüge Am Martinstag feiert man den Abschluss des Erntejahres. Für die Armen war das eine Chance, einige Krümel vom reichgedeckten Tisch zu erbetteln. Aus diesem Umstand entwickelten sich vermutlich
Gesellschaftlicher Wandel im Jahrhundert der Politik
 Gesellschaftlicher Wandel im Jahrhundert der Politik Nordwestdeutschland im internationalen Vergleich 1920-1960 Herausgegeben von Michael Prinz FERDINAND SCHÖNINGH Paderborn München Wien Zürich Inhaltsverzeichnis
Gesellschaftlicher Wandel im Jahrhundert der Politik Nordwestdeutschland im internationalen Vergleich 1920-1960 Herausgegeben von Michael Prinz FERDINAND SCHÖNINGH Paderborn München Wien Zürich Inhaltsverzeichnis
Sperrfrist: Uhr. Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort
 Sperrfrist: 16.00 Uhr Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort Meine Damen und Herren! Wir haben Sie zu einer Veranstaltung ins Hohe
Sperrfrist: 16.00 Uhr Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort Meine Damen und Herren! Wir haben Sie zu einer Veranstaltung ins Hohe
Gebete: Amen. Daniel Meyer Do Santos. Gott, die Sache des Friedens und der Gerechtigkeit hast du uns ans Herz gelegt.
 Gebete: Guter Gott, immer wieder kommt unser Glaube ins Wanken. Wir kämpfen mit unseren Zweifeln oder lassen uns von ihnen unterkriegen. Immer wieder braucht unser Glauben eine Stärkung. Wir bitten dich:
Gebete: Guter Gott, immer wieder kommt unser Glaube ins Wanken. Wir kämpfen mit unseren Zweifeln oder lassen uns von ihnen unterkriegen. Immer wieder braucht unser Glauben eine Stärkung. Wir bitten dich:
Texte für die Eucharistiefeier III. Thema: Geistliche Berufe
 Texte für die Eucharistiefeier III (zusammengestellt P. Lorenz Voith CSsR) Thema: Geistliche Berufe 15. März Hl. Klemens Maria Hofbauer Ordenspriester Begrüßung: Im Namen des Vaters... Die Gnade unseres
Texte für die Eucharistiefeier III (zusammengestellt P. Lorenz Voith CSsR) Thema: Geistliche Berufe 15. März Hl. Klemens Maria Hofbauer Ordenspriester Begrüßung: Im Namen des Vaters... Die Gnade unseres
Februar 2006 in Oldenburg
 2006 Februar 2006 in Oldenburg Am Donnerstag, dem 16. Februar fand ein Informationsabend im Neuen Gymnasium für die Eltern und die Kinder der jetzigen 4. Grundschulklassen statt: Das Lernangebot, die Sprachenprofile
2006 Februar 2006 in Oldenburg Am Donnerstag, dem 16. Februar fand ein Informationsabend im Neuen Gymnasium für die Eltern und die Kinder der jetzigen 4. Grundschulklassen statt: Das Lernangebot, die Sprachenprofile
Inhaltsverzeichnis. Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10. Nach dem Ersten Weltkrieg: Neue Entwürfe für Staat und Gesellschaft
 Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Ein Glück, dass du da bist!
 Wallfahrtsstunde: Ein Glück, dass du da bist! Vorzubereiten: Spiegel Schriftkarten mit den Versen Psalm 139, 5.13-16 Schriftkarten mit Psalm- und Bibelverse für die Kinder Liedkopien Einstimmung und Versammlung:
Wallfahrtsstunde: Ein Glück, dass du da bist! Vorzubereiten: Spiegel Schriftkarten mit den Versen Psalm 139, 5.13-16 Schriftkarten mit Psalm- und Bibelverse für die Kinder Liedkopien Einstimmung und Versammlung:
Rosenkranzandacht. Gestaltet für Kinder. Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach
 Rosenkranzandacht Gestaltet für Kinder Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach Die Geschichte vom Rosenkranz Vor langer Zeit, im 15. Jahrhundert, also vor ungefähr
Rosenkranzandacht Gestaltet für Kinder Pfarreiengemeinschaft Dirmstein, Laumersheim mit Obersülzen und Großkarlbach Die Geschichte vom Rosenkranz Vor langer Zeit, im 15. Jahrhundert, also vor ungefähr
8. Kreisjugendfeuerwehrtag des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen sowie 20jähriges Bestehen der JF Straß-Moos
 8. Kreisjugendfeuerwehrtag des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen sowie 20jähriges Bestehen der JF Straß-Moos von Samstag, 02. Juli bis Sonntag, 03. Juli 2011 (Markt Burgheim) 8. Kreisjugendfeuerwehrtag
8. Kreisjugendfeuerwehrtag des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen sowie 20jähriges Bestehen der JF Straß-Moos von Samstag, 02. Juli bis Sonntag, 03. Juli 2011 (Markt Burgheim) 8. Kreisjugendfeuerwehrtag
Schloss Sythen kulturelles Zentrum
 20 Jahre Förderverein Schloss Sythen e.v. eine spannende Entwicklung Luftaufnahme von 1928 Von der Fliehburg zum Schloss Sythen kulturelles Zentrum Vorsitzender: Wilhelm Haverkamp Brinkweg 62 45721 Haltern
20 Jahre Förderverein Schloss Sythen e.v. eine spannende Entwicklung Luftaufnahme von 1928 Von der Fliehburg zum Schloss Sythen kulturelles Zentrum Vorsitzender: Wilhelm Haverkamp Brinkweg 62 45721 Haltern
Ansprache zum 25. Geburtstag der Freien Waldorfschule am Bodensee in Überlingen-Rengoldshausen Seite 1
 Seite 1 Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde unserer Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen
Seite 1 Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde unserer Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Inhalt. 3 Wir Kinder dieser Welt. 4 Kindheit im Wandel der Zeit. 5 Zahlen und Fakten zu Kindern weltweit. 8 Wir Kinder dieser Welt
 Inhalt 3 Wir Kinder dieser Welt 4 Kindheit im Wandel der Zeit 5 Zahlen und Fakten zu Kindern weltweit 8 Wir Kinder dieser Welt 9 Portraits aus aller Welt 10 Impressum Wir Kinder dieser Welt Kinderarbeit
Inhalt 3 Wir Kinder dieser Welt 4 Kindheit im Wandel der Zeit 5 Zahlen und Fakten zu Kindern weltweit 8 Wir Kinder dieser Welt 9 Portraits aus aller Welt 10 Impressum Wir Kinder dieser Welt Kinderarbeit
man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum
 man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum Christentum bekehren. Wenn der Westfale sich aber mal
man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum Christentum bekehren. Wenn der Westfale sich aber mal
Leitungswechsel zum Schuljahr 2007/2008. St. Raphael-Schulen/Gymnasium Heidelberg. OStD Dr. Franz Kuhn und OStD Ulrich Amann
 Mit Erreichen der Altersgrenze trat OStD Dr. Franz Kuhn nach mehr als 25 Jahren in der Verantwortung als Schulleiter des Gymnasiums der St. Raphael-Schulen Heidelberg in den Ruhestand. 1942 in Heidelberg
Mit Erreichen der Altersgrenze trat OStD Dr. Franz Kuhn nach mehr als 25 Jahren in der Verantwortung als Schulleiter des Gymnasiums der St. Raphael-Schulen Heidelberg in den Ruhestand. 1942 in Heidelberg
Bibel für Kinder zeigt: Vierzig Jahre
 Bibel für Kinder zeigt: Vierzig Jahre Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Lyn Doerksen Auf der Basis des englischen Originaltexts nacherzählt von Markus Schiller Produktion: Bible
Bibel für Kinder zeigt: Vierzig Jahre Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Lyn Doerksen Auf der Basis des englischen Originaltexts nacherzählt von Markus Schiller Produktion: Bible
10 Vorurteile über Flüchtlinge
 10 Vorurteile über Flüchtlinge Ein Text in Leichter Sprache Flüchtlinge sind Menschen, die aus ihrem Land fliehen. Weil dort Krieg ist. Weil sie dort hungern und leiden. Weil sie dort bedroht sind. Weil
10 Vorurteile über Flüchtlinge Ein Text in Leichter Sprache Flüchtlinge sind Menschen, die aus ihrem Land fliehen. Weil dort Krieg ist. Weil sie dort hungern und leiden. Weil sie dort bedroht sind. Weil
Es gilt das gesprochene Wort!
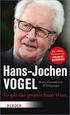 Es gilt das gesprochene Wort! 140jähriges Stiftungsfest und 40 Jahre Damenwehr der Freiwilligen Feuerwehr Eibelstadt am 15. März 2014 in Eibelstadt Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen
Es gilt das gesprochene Wort! 140jähriges Stiftungsfest und 40 Jahre Damenwehr der Freiwilligen Feuerwehr Eibelstadt am 15. März 2014 in Eibelstadt Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen
Sonntag, 30. August Würdigung der Städtepartnerschaft durch die Stadt Rendsburg
 1 Sonntag, 30. August 2015 Würdigung der Städtepartnerschaft durch die Stadt Rendsburg Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, chers amis de Vierzon, zunächst ein herzliches Dankeschön,
1 Sonntag, 30. August 2015 Würdigung der Städtepartnerschaft durch die Stadt Rendsburg Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, chers amis de Vierzon, zunächst ein herzliches Dankeschön,
2. Weihnachtsfeiertag 26. Dezember 2015 Hebräer 1, 1-3. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
 Predigten von Pastorin Julia Atze 2. Weihnachtsfeiertag 26. Dezember 2015 Hebräer 1, 1-3 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Habt ihr ein Zimmer für uns? Meine Maria ist
Predigten von Pastorin Julia Atze 2. Weihnachtsfeiertag 26. Dezember 2015 Hebräer 1, 1-3 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Habt ihr ein Zimmer für uns? Meine Maria ist
CASA HOGAR DE JESÚS PADRES ESCOLAPIOS ORDEN DE LAS ESCUELAS PÍAS Diócesis de Santo Domingo en Ecuador Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador
 MONATSBERICHT MÄRZ 2014 Das erste Quartal des Jahres 2014 ist beendet und wieder wollen wir euch an unserem Alltag mit den Kindern teilhaben lassen. Sie sind diejenigen, die uns dazu bewegen, den Mut zu
MONATSBERICHT MÄRZ 2014 Das erste Quartal des Jahres 2014 ist beendet und wieder wollen wir euch an unserem Alltag mit den Kindern teilhaben lassen. Sie sind diejenigen, die uns dazu bewegen, den Mut zu
Ein Haus erzählt Geschichten. Das Buddenbrookhaus
 Ein Haus erzählt Geschichten Das Buddenbrookhaus Herzlich willkommen im Buddenbrookhaus! as Buddenbrookhaus ist das vielleicht bekannteste Haus Lübecks. Warum? Hier spielt eine weltberühmte Geschichte.
Ein Haus erzählt Geschichten Das Buddenbrookhaus Herzlich willkommen im Buddenbrookhaus! as Buddenbrookhaus ist das vielleicht bekannteste Haus Lübecks. Warum? Hier spielt eine weltberühmte Geschichte.
Zunächst gehörte die Filiale Wallersheim, wie die Pfarrgemeinde seinerzeit genannt wurde, zu Büdesheim.
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim Rede des Ortsbürgermeisters Josef Hoffmann zur 150 - Jahr - Feier am 04.07.2010 Liebe Christengemeinde Liebe Gäste Die alte Kirche, an manchen Stellen in früheren
Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim Rede des Ortsbürgermeisters Josef Hoffmann zur 150 - Jahr - Feier am 04.07.2010 Liebe Christengemeinde Liebe Gäste Die alte Kirche, an manchen Stellen in früheren
Der Weise König Salomo
 Bibel für Kinder zeigt: Der Weise König Salomo Text: Edward Hughes Illustration: Lazarus Adaption: Ruth Klassen Auf der Basis des englischen Originaltexts nacherzählt von Markus Schiller Produktion: Bible
Bibel für Kinder zeigt: Der Weise König Salomo Text: Edward Hughes Illustration: Lazarus Adaption: Ruth Klassen Auf der Basis des englischen Originaltexts nacherzählt von Markus Schiller Produktion: Bible
Gott wurde für uns Mensch. Predigt über Johannesevangelium 1,14 Heiligabend 2016
 Gott wurde für uns Mensch Predigt über Johannesevangelium 1,14 Heiligabend 2016 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen
Gott wurde für uns Mensch Predigt über Johannesevangelium 1,14 Heiligabend 2016 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen
Das 2. Deutsche Kaiserreich Von Bismarck gegründet?
 Das 2. Deutsche Kaiserreich Von Bismarck gegründet? Gruppe 1: Die Kartenspezialisten (aus: Geschichte, Der Weg zum 2. Kaiserreich, 3/2002, S. 45) 1) Betrachte die Karte vom Deutschen Reich von 1871! a)
Das 2. Deutsche Kaiserreich Von Bismarck gegründet? Gruppe 1: Die Kartenspezialisten (aus: Geschichte, Der Weg zum 2. Kaiserreich, 3/2002, S. 45) 1) Betrachte die Karte vom Deutschen Reich von 1871! a)
HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest
 15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
Die Heilung des Aussätzigen Pädagogisches Material zum Schwerpunktthema alle welt 1/2009
 1-6 Die Heilung des Aussätzigen Pädagogisches Material zum Schwerpunktthema alle welt 1/2009 Religion Jesus heilt einen Aussätzigen 2 Einheiten Schulstufe Volksschule 2. 4. Klasse HS/AHS 1. Klasse Lehrplanbezug
1-6 Die Heilung des Aussätzigen Pädagogisches Material zum Schwerpunktthema alle welt 1/2009 Religion Jesus heilt einen Aussätzigen 2 Einheiten Schulstufe Volksschule 2. 4. Klasse HS/AHS 1. Klasse Lehrplanbezug
Erziehung in staatlichen Institutionen im Nationalsozialismus
 Erziehung in staatlichen Institutionen im Nationalsozialismus Gliederung Erziehungsziele Lernmittel (Schulbücher, etc.) Schulpraxis Umgang mit Minderheiten Hochschule Veränderungen im schulischen Bereich
Erziehung in staatlichen Institutionen im Nationalsozialismus Gliederung Erziehungsziele Lernmittel (Schulbücher, etc.) Schulpraxis Umgang mit Minderheiten Hochschule Veränderungen im schulischen Bereich
90 Jahre St. Martin Verein Dorthausen 1926
 90 Jahre St. Martin Verein Dorthausen 1926 Am 20. November 1926 wurde der St.Martin Verein Dorthausen in der Gastwirtschaft Eckers heute Dorthausener Hof gegründet. Gewählt wurde damals Johann Eckers zum
90 Jahre St. Martin Verein Dorthausen 1926 Am 20. November 1926 wurde der St.Martin Verein Dorthausen in der Gastwirtschaft Eckers heute Dorthausener Hof gegründet. Gewählt wurde damals Johann Eckers zum
GOTTESDIENST vor den Sommerferien in leichter Sprache
 GOTTESDIENST vor den Sommerferien in leichter Sprache Begrüßung Lied: Daniel Kallauch in Einfach Spitze ; 150 Knallersongs für Kinder; Seite 14 Das Singen mit begleitenden Gesten ist gut möglich Eingangsvotum
GOTTESDIENST vor den Sommerferien in leichter Sprache Begrüßung Lied: Daniel Kallauch in Einfach Spitze ; 150 Knallersongs für Kinder; Seite 14 Das Singen mit begleitenden Gesten ist gut möglich Eingangsvotum
Die heilige Cäcilia. OHP-Folien, Projektor. Thema
 Wortgottesdienst 22. November Die heilige Cäcilia Material: Thema OHP-Folien, Projektor Heute darf ich euch eine ganz besondere Frau aus der Kirchengeschichte vorstellen. Sie hiess Cäcilia und lebte um
Wortgottesdienst 22. November Die heilige Cäcilia Material: Thema OHP-Folien, Projektor Heute darf ich euch eine ganz besondere Frau aus der Kirchengeschichte vorstellen. Sie hiess Cäcilia und lebte um
Jesus kommt zur Welt
 Jesus kommt zur Welt In Nazaret, einem kleinen Ort im Land Israel, wohnte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie von König David,
Jesus kommt zur Welt In Nazaret, einem kleinen Ort im Land Israel, wohnte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie von König David,
Die Zwanziger Jahre Tanz auf dem Vulkan Aufgabenteil A und B
 A Beobachtungsaufgaben Eine oder mehrere der jeweils vier (a d) genannten Lösungen sind richtig. Markiere den entsprechenden Buchstaben durch Umkreisen! A1 Im Zuge der Inflation fehlte es zahlreichen Menschen
A Beobachtungsaufgaben Eine oder mehrere der jeweils vier (a d) genannten Lösungen sind richtig. Markiere den entsprechenden Buchstaben durch Umkreisen! A1 Im Zuge der Inflation fehlte es zahlreichen Menschen
Arbeitsblatt 2 Kriegsbegeisterung am Anfang des Ersten Weltkrieges Trauer und Tote am Ende
 Arbeitsblätter des in Kooperation gefördert Volksbundes Deutsche mit durch Kriegsgräberfürsorge e.v. Arbeitsblatt 2 Kriegsbegeisterung am Anfang des Ersten Weltkrieges Trauer und Tote am Ende Die vor euch
Arbeitsblätter des in Kooperation gefördert Volksbundes Deutsche mit durch Kriegsgräberfürsorge e.v. Arbeitsblatt 2 Kriegsbegeisterung am Anfang des Ersten Weltkrieges Trauer und Tote am Ende Die vor euch
Pfarrei Hl. Geist Mühlried
 Pfarrei Hl. Geist Mühlried Infoabend, 20. Oktober 2015 Schön das ihr da seid Im Sakrament der Firmung geht es um die Begegnung mit dem Heiligen Geist. WAS ODER WER IST DER HEILIGE GEIST PFINGSTEREIGNIS
Pfarrei Hl. Geist Mühlried Infoabend, 20. Oktober 2015 Schön das ihr da seid Im Sakrament der Firmung geht es um die Begegnung mit dem Heiligen Geist. WAS ODER WER IST DER HEILIGE GEIST PFINGSTEREIGNIS
Sie durften nicht Oma zu ihr sagen. Auf keinen Fall! Meine Mutter hasste das Wort Oma.
 Der Familien-Blues Bis 15 nannte ich meine Eltern Papa und Mama. Danach nicht mehr. Von da an sagte ich zu meinem Vater Herr Lehrer. So nannten ihn alle Schüler. Er war Englischlehrer an meiner Schule.
Der Familien-Blues Bis 15 nannte ich meine Eltern Papa und Mama. Danach nicht mehr. Von da an sagte ich zu meinem Vater Herr Lehrer. So nannten ihn alle Schüler. Er war Englischlehrer an meiner Schule.
Heiliger Abend Wir feiern Weihnachten
 Heiliger Abend 2013 Wir feiern Weihnachten Heiliger Abend 2013 u Lied: Ihr Kinderlein, kommet / Kommet, ihr Hirten u Gebet u Weihnachtsevangelium u Lied: Es ist ein Ros' entsprungen u Zum Nachdenken u
Heiliger Abend 2013 Wir feiern Weihnachten Heiliger Abend 2013 u Lied: Ihr Kinderlein, kommet / Kommet, ihr Hirten u Gebet u Weihnachtsevangelium u Lied: Es ist ein Ros' entsprungen u Zum Nachdenken u
