MASARYKOVA UNIVERZITA. Filozofická fakulta. Bakalářská práce
|
|
|
- Timo Bruhn
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Bakalářská práce BRNO 2007 Jana Kourková 1
2 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky německý jazyk a literatura Jana Kourková Komposita in der Prager Zeitung Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Anna Mikulová
3 Prohlašuji, že jsem bakalářkou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 3
4 Velmi děkuji paní PhDr. Anně Mikulové za poskytnutí pomoci, cenných rad a konzultací při odborném vedení této práce. 4
5 Inhaltverzeichnis 1.0. Die Einleitung Die Prager Zeitung Daten und Fakten Profil der Prager Zeitung Deutsche Wortbildung Grundlage der deutschen Wortbildung Historie der deutschen Wortbildung Gegenwärtige deutsche Wortbildung Allgemeine Informationen Die Derivation (Die Ableitung) Implizite Derivation Explizite Derivation Die Präfixbildung Die Komposition (Die Zusammensetzung) Allgemeine Informationen Das Determinativkompositum Kompositionsfuge Nominalkompositum Adjektivkompositum Verbalkompositum Pseudokompositum Rektionskompositum Possessivkompositum Klammerform Verdeutlichendeskompositum Iterativkompositum 36 5
6 3.7. Übergang zum Kopulativkompositum Das Kopulativkompositum Praktischer Teil Methodik der Arbeit Analyse des ersten Artikels Der Inhalt des ersten Artikels Analyse der Nominalkomposita Komposita mit Bindestrich Analyse der Verbalkomposita Komposita mit Partizip Analyse der Adjektivkomposita Analyse der Adverbkomposita Analyse der Präpositionalkomposita Analyse des zweiten Artikels Inhalt des zweiten Artikels Analyse der Nominalkomposita Komposita mit Bindestrich Analyse der Verbalkomposita Komposita mit Partizip Analyse der Adjektivkomposita Analyse der Adverbkomposita Analyse der Präpositionalkomposita Zusammenfassung Verwendete Abkürzungen Literaturverzeichnis 55 6
7 1. 0. EINLEITUNG In meiner Bakkalararbeit beschäftige ich mich mit einem der wichtigsten Teile der deutschen Grammatik Wortbildung. In diesem, sehr umfangreichen Bereich habe ich die Bildung der deutschen Komposita ausgewählt. Wie werden die Komposita gebildet, wie häufig sie sind und wo benutzt man diese Zusammensetzungen zeige ich am Beispiel der Texte aus der Prager Zeitung. Aus Wikipedie, der freien Enzyklopädie habe ich sehr interessante Information erfahren. Ich möchte auf dem Namen eines Gesetzes aus dem Jahr 1999 im deutschen Bundesland Mecklenburg- Vorpommern hinweisen. Ein Teil des Gesetzes trägt den Namen Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungaufgabeübertragungsgesetz. Ich wundere mich nicht, dass als dieses Gesetz genannt wurde, ausbrach in dem Landtag ein schallendes Gelächter. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat dieses Wort zum Wort des Jahres 1999 vorgeschlagen. Das ist nur ein Beleg dafür, dass das Thema der Komposition sehr interessant ist. Die Arbeit besteht aus 4 Teilen: 1) Die Vorstellung der Prager Zeitung 2) Die Wortbildung der deutschen Sprache in allgemeinem Sinn 3) Wortbildungstendenzen der Komposita in der deutschen Gegenwartssprache 4) Praktische Analyse der Prager Zeitung im Zusammenhang mit den Komposita. Erste 3 Teile behandle ich in dem theoretischen Teil meiner Arbeit, den praktischen Teil bildet der Punkt 4. In dem ersten Teil möchte ich ein bisschen ausführlicher die Prager Zeitung vorstellen. Um welche Zeitung handelt es sich: Daten, Fakten und Zahlen. Der zweite Teil zeigt uns, was deutsche Wortbildung eigentlich ist und welche Regeln befolgt. 7
8 Die Arten und Bestandteile der Zusammensetzungen, (weiter nur die Abkürzung ZS) ihre Bildung und Nutzung in der Sprache bildet den Hauptteil des Teiles drei. Der rein praktisch orientierter Teil vier beschäftigt sich mit einzelnen Beispielen. Zur Verfügung sind mir viele Exemplare von 2004 bis 2007 gestanden. Dieses Thema habe ich auch darum ausgewählt, weil in der heutigen Sprache, eine Tendenz, die Sprache zu sparen ist. Die Merkmale, die man in dem Sprachbereich benutzt, sind sehr anregend. Man spart alles: Geld, Zeit, Platz und leider auch Sprache. Heute hören wir wenig wunderschöne Metaphern, die im 18. Jahrhundert sehr häufig benutzt wurden. Dieses Sparen, das heute überall sichtbar ist, können wir auch in der Sphäre der Publizistik bemerken. Es ist selbstverständlich logisch. Die Zeitungen, die im 18. Jhr. 60 Seiten hätten, haben heute einen halfen Umfang. Zu dieser Sprachökonomie in der Presse gehört auch immer eine gröβere Benutzung des Kompositums, wo zwei oder mehrere Worte in eine einzelnen verbunden sind. Es gibt viele Grammatikbücher, die sich mit der deutschen Wortbildung beschäftigen. In dem theoretischen Teil, das sich mit der Terminologie und Theorie der deutschen Wortbildung beschäftigt, habe ich die grundlegenden Informationen für meine Arbeit hauptsächlich von der Duden-, Fleischer/Stepanova-, Fleischer- und Uhrová Grammatik entnommen. Im praktischen Teil der Arbeit habe ich mit der Prager Zeitung aus den Jahren 2004 und 2007 gearbeitet. 8
9 2. 0. PRAGER ZEITUNG Nach dem Übertragungskanal handelt es sich bei der Prager Zeitung (PGZ) um Printmedien und nach der Leserorientierung um eine seriöse Zeitung. Trotz der elektronischen Form, die sie auch hat, ist die gedruckte Form immer sehr beliebt. Die Prager Zeitung hat ein hochstrukturiertes und komplexes System und ist hinsichtlich ihrer Funktion ausdifferenziert. Der Spielraum des Redakteurs und Journalisten ist einerseits größer, d.h. investigative Journalistik, andererseits ist er durch den Druck der Agentursprache eingeschränkt (Automatisierung der Nachricht). Die PGZ bietet dem Leser viele kommunikative Funktionen an. a) informative Funktion Es handelt sich vornehmlich um Nachrichten, Reportagen und Berichte sowohl aus dem Ausland, als auch aus dem Inland. b) persuasive Funktion Es geht um eine Überzeugung und Meinungsbeeinflussung oder lenkung der Leser. Es kann z.b. eine Werbung oder ein Kommentar sein. c) phatische Funktion Die Unterhaltung und die Kontaktherstellung sind im Vordergrund dieser Funktion der Zeitung DATEN UND FAKTEN: Bereits kurz nach der Samtenen Revolution entstand die Idee, in der Tradition des Prager Tagblatts der 20er und 30er Jahre wieder eine deutschsprachige Zeitung in der tschechoslowakischen Hauptstadt zu gründen. Trotz Mühe und Skepsis gelang es, offizielle Stellen in Prag, Bonn und Wien von dem Projekt zu überzeugen. Im Herbst 1991 bekam man grünes Licht für finanzielle Hilfe. Ein paar Monate später war es dann soweit: am 5. Dezember 1991 erschien die erste Ausgabe der Prager Zeitung. 9
10 Die Arbeitsbedingungen zu jener Zeit waren abenteuerlich: Die Besatzung hockte in drei kleinen Räumen und hatte gerade sechs Mitarbeiter. Geschrieben wurde auf mechanischen Schreibmaschinen, der Satz wurde von tschechischen Kollegen einer anderen Firma gefertigt, die Korrekturen verschlangen häufig die Hälfte der Arbeitszeit. Auch finanziell waren die Anfangsjahre bescheiden. Ein Anzeigenmarkt die wichtigste Geldquelle eines Printmediums existierte in der Tschechoslowakei nur in Ansätzen. Auf der Suche nach Investoren fanden sich zwei Unternehmer aus der ostbayerischen Werbe- und Tourismusbranche, die das langfristige Überleben des Blattes sicherten. Gemeinsam gründete man Mitte 1992 die "Prago-Media GmbH", seitdem Herausgeber der PGZ. Nach einer neuerlichen Durststrecke Mitte der 90er Jahre sprang man ins kalte Wasser der freien Marktwirtschaft. Im Jahre 1996 kam dann der Durchbruch: die Leserschaft wurde stabil, die Mitarbeiterstruktur konstant. Seitdem schreibt die PGZ schwarze Zahlen. Heute beschäftigt die PGZ viele Redakteuren, sie hat ihren Sitz im Stadtteil Vinohrady und hat Korrespondenten in Deutschland, Osterreich, Polen, Ungarn und der Slowakei. Hinzu kommen freie Mitarbeiter und Praktikanten. Die Redaktion besteht hauptsächlich aus Deutschen, so wird die Grafik von Einheimischen gestaltet. In der Anzeigen und Vertriebsabteilung sitzen ebenfalls fast ausschließlich Tschechen. In diesem Miteinander entsteht nicht nur eine inspirierende Teamatmosphäre. Die internationale Zusammensetzung des kleinen Unternehmens trägt auch zur praktischen Versöhnungsarbeit bei. Die PGZ ist eine deutschsprachige Zeitung, erscheint wöchentlich und Erstverkaufstag ist Donnerstag. Die Zeitung kann man für 50 TK kaufen und es ist auch kein Problem die PGZ zu abonnieren. So wie viele andere Zeitungen hat auch diese Zeitung verschiedene Beilagen. Es sind Prager Tagblatt (wöchentliche Magazin-Beilage) und Holiday World (regelmäßig erscheinende Tourismus-Beilage). Sehr interessant ist, dass die PGZ als Bordexemplar der Lufthansa auf allen Flügen zwischen Prag und Frankfurt bereit liegt und wöchentlich stehen 4000 kostenlose Exemplare der PGZ in Internationalen Fernreisezügen SuperCity, InterCity und EuroCity zur Verfügung. 10
11 Das Prager Blatt ist eine wöchentliche Magazin-Beilage. Thematisch beschäftigt sich die PGZ mit Politik und touristischen Empfehlungen, aber auch die Vertreibung der Deutschen ist kein Tabu. Dieses Magazin knüpft an die journalistische Tradition von Egon Erwin Kisch, Franz Werfel und Max Brod an. Die Leser finden auf diesen Seiten Interviews, Portraits, Glossen - kurz gesagt: alles, was das Leben in Prag charakterisiert und ausmacht. Ebenso gehören ein ausführliches Kulturprogramm und Insidertipps aus der Prager Szene dazu. Im Prago-Media Verlag der PGZ erscheinen unter anderen die Branchen-Ratgeber: Wer ist wer - Tschechiens Consulting-Branche und Wer ist wer - Tschechiens IT-Branche Das PROFIL der Prager Zeitung Die PGZ erscheint im gesamten deutschsprachigen Ausland: In Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in der Slowakei. Ihre Beliebtheit ist sehr markant. Ein zwingender Beweis ist, dass sie die meistgelesene fremdsprachige Wochenzeitung in Tschechien ist. In der Publizistik unterscheiden wir das Umfeld der Informationen der Redaktoren. In der PGZ gilt es als seriös. Die PGZ erfasst aktuelle Hintergrund- Informationen aus erster Hand für Investoren und ist Ratgeber, Kultur- und Reiseführer für jährlich über 30 Mio. deutschsprachige Touristen. Als sehr interessant wirken auch die Informationen, dass die PGZ die Pflichtlektüre deutscher und österreichischer Bundesbehörden sind. Wir selbst haben die Möglichkeit, diese Zeitung an der Masaryk Universität kostenlos zu bekommen. Sie dient als ein inoffizielles Lehrmittel von Universitäten, Hochschulen, Sprachschulen und anderen Bildungseinrichtungen. Heute hat sie bis zu 48 Seiten und eigenen Angaben zufolge eine Auflage von Exemplaren, wovon etwa die Hälfte in Tschechien verkauft wird. Der Rest geht nach Deutschland, Österreich und Polen. Ende 2006 beschäftigt die unabhängige Wochenzeitung 22 Mitarbeiter und die Abonnentenzahl, der in Deutschland lebender Leser, beträgt
12 3. 0. Die DEUTSCHE WORTBILDUNG Die GRUNDLAGEN der deutschen Wortbildung Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel. Wie sich der Welt entwickelt, ändert sich auch der Wortschatz der Menschen. Viele verschiedene Faktoren haben diese Entwicklung begünstigt. Neue menschliche Tätigkeiten, die im Laufe der Zeit entstanden sind, Ausbildung der Menschen oder mentale Fähigkeiten der Sprecher spielen auch eine groβe Rolle. Nicht nur diese, sondern auch viele andere Bedingungen haben groβen Anteil daran, dass jede Person einen anderen Wortschatz hat. Die Zahl der Wörter im Deutschen beträgt bis Wörter. Diese große Differenz ergibt sich daraus, was in diese Zahl eingerechnet wird Stammwörter oder auch Zusammensetzungen, Ableitung, nur lebende oder auch veraltete Wörter usw. /Uhrová, 1996, S. 2/. Die Komposita sind ein Teil der deutschen Wortbildung (WB). Bevor ich mich ausschließlich mit den Zusammensetzungen beschäftigen werde, ist es sehr wichtig, grundlegende Punkte der allgemeinen deutschen WB zu erwähnen. 12
13 3. 2. Die GESCHICHTE der deutschen Wortbildung Es gibt viele verschiedene Grammatiken, die das Thema WB behandeln. Es ist selbstverständlich, dass immer neuere Grammatiken im Laufe der Zeit entstehen. Zur Verfügung stehen uns so die historischen und gegenwärtigen Grammatiken. In der letzter Zeit ist die WB und ihre Stellung im Sprachsystem ein recht lebhaftes Thema. Es gab groβe Diskussionen, ob die Wortbildungslehre theoretisch Syntax, Morphologie oder Lexikologie erörtert. Man kann sagen, dass die Wortbildungslehre eine verhältnismäβig junge Wissenschaft ist /Fleischer, 1975, S.26/. Von den Junggrammatikern wurde die WB als selbständiger Bestandteil der Grammatik behandelt (W. Wilmanns, H. Paul). Auch neuere Gesamtdarstellungen der Grammatik enthalten Kapitel über Wortbildung. In den Darstellungen von Brinkmann und Erben hat die WB nicht als ein eigenes Kapitel etwa neben Satz- und Flexionslehre existiert, sondern sie ist in die Wortlehre überhaupt integriert /Fleischer, 1975, S.26/. W. Admoni, H. Glinz, H. Renicke und W. Schmidt haben sich dagegen in Ihren Darstellungen mit der Wortbildung überhaupt nicht befasst. Heute wird die Wortbildungslehre in die Lexikologie eingeordnet, aber es ist nicht so einfach, weil abgesehen von den bereits erörterten Beziehungen zur Syntax auch solche zur Flexionslehre bestehen, zumal insbesondere in den flektierenden Sprachen auch unmittelbar die primär fortbildenden Vorgänge für die Wortableitung ausgenützt werden /Fleischer, 1975, S. 28/. Die Wortbildungslehre wird zurzeit als eine selbständige Disziplin zwischen Lexikologie und Grammatik ausgegliedert. 13
14 3. 3. Die GEGENWÄRTIGE WORTBILDUNG Allgemeine Informationen Was ist eigentlich die WB? Kurz gesagt: Es ist das Bilden anderer oder neuer Wörter durch die Kombination vorhandener Wörter miteinander. Die Wortbildung ist ein in allen natürlichen Sprachen verwendetes Prinzip, mit dem der Wortschatz auf ökonomische und einleuchtende Weise strukturiert und vergrößert werden kann, ohne von Grund auf neue Wörter zu benötigen. Die WB ist also ein morphologischer Prozess, mit Hilfe dessen neue Lexeme (Wurzeln oder Stämme) aus anderen (bereits existierenden) Lexemen (Wurzeln oder Stämmen) abgeleitet werden. Man unterscheidet usuelle oder okkasionelle Wortbildungen. Wenn man usuelle WB erwähnt, spricht man über den Wortschatz, der fest ist, also im Lexikon eingetragen ist und oft demotiviert oder idiomatisiert ist (z.b. Augenmensch). Während die okkasionelle WB spontan entstanden ist, ist kontextabhängig und die Bedeutung der Wörter ist aus den Bestandteilen des Wortes erschlieβbar (z.b. Friedensverhandlung) 1. Der DUDEN Grammatik nach wird der Terminus Wortbildung im Allgemeinen in zwei Bedeutungen gebraucht. Man versteht darunter zum einen den Prozeβ der Bildung neuer Wörter aus vorhandenen sprachlichen Einheiten nach bestimmten Modellen (jmdm. folgen + ver jmdn. verfolgen), zum Anderen das Ergebnis dieses Prozeβes, das gebildete Wort (jmdn. verfolgen). Beide Erscheinungen, sowohl Bildungsprozess als auch Bildungsergebnis, machen den Gegenstand der Wortbildungslehre aus. Sie beschreibt v.a. Regeln und Bedingungen für die Bildung neuer Wörter sowie die Struktur und Bedeutung vorhandener Wortbildungen /Duden, 2005, S.641/. Nach Wikipedia, der freien Enzyklopädie, untersucht und beschreibt die Wortbildung die Gesetzmäßigkeiten bei bereits bestehenden Wörtern oder bei der Bildung neuer komplexer Wörter aus Morphemen oder auf andere Weise. Die Wortbildung ist neben 1 Im theoretischen Teil sind die Beispiele aus der Prager Zeitung mittels unterbrochener Linie bezeichnet, die anderen Beispiele sind aus den Grammatiken. 14
15 Bedeutungswandel und Entlehnung eines der Hauptverfahren der Bezeichnungsfindung beziehungsweise des Bezeichnungswandels, diese sind Untersuchungsgegenstand der Onomasiologie. Wortbildung vollzieht sich heute als Kombination vorhandener Wörter oder Stämme miteinander oder mit besonderen frei beweglich im Satz nicht vorkommenden Bildungselementen: Umgehungsstraβe auch Umgehung und Straβe, auskühlen aus ausund kühlen usw. Es wird also sozusagen an vorhandene Bausteine, bedeutungstragende Elemente angeknüpft, die nach bestimmten Gesetzmäβigkeiten ausgebaut werden. Gänzlich neue Phonem- oder Lautkomplexe mit Bedeutungen, die von der Bedeutung der vorhandenen Elemente völlig gelöst sind, werden dabei nicht geschaffen. /Fleischer, 1975, S. 10/. Ebenso gilt diese für Kurzwörter, Abkürzungen und Kunstwörter, die an heimische oder fremdsprachige Elemente anknüpfen. Im Deutschen gibt es produktives und unproduktives Wortbildungsmuster: Produktive WB bildet in der Gegenwartssprache noch neue Wörter wie die Suffixe ung, -er oder bar, (z.b. verwendbar, Restaurierung). Unproduktives Muster ist in der Gegenwartssprache nicht mehr an der Bildung neuer Wörter beteiligt. Es sind z.b. die Suffixe t oder de (Licht, Freude). Die Einheit (Identität) des Wortes realisiert sich in Form und Inhalt (Bedeutung). /Fleischer, 1975, S. 32/ Im allgemeinen kann man Wörter nach ihrer Form in Simplizia und Wortbildungskonstruktionen (Morphemkonstruktionen) einteilen. /Uhrová, 2002, S. 89/ Die Wortbildunkskonstruktionen (WBK) zeichnen sich durch die Kombination von zwei unmittelbaren Konstituenten (UK) aus. Wenn eine Analyse in zwei UK nicht möglich ist, handelt es sich um ein Simplex. Das ist für die Wortbildung unwesentlich. Es sind Wörter wie Haus, Tür, gut. Ihre Bedeutung ist nicht aus der Bedeutung einzelner Bestandteile erschließbar. Solche Wörter werden als unmotiviert bezeichnet. Haustür und häuslich bestehen aus zwei komplexen Bestandteilen und sind motiviert durch ihre Bedeutung. 15
16 Man hat viele Möglichkeiten zur Verfügung, wie den Wortschatz einer Sprache zu erweitern: / Die wichtigsten und gebrauchten Mittel der Wortbildungsarten im Deutschen sind: 1) Komposition: die Konstruktion nennt man Kompositum und sind nach Determinativund Kopulativkompositum differenziert. 2) Derivation: Derivat ist die Wortbildungskonstruktion und ist nach impliziter und expliziter Derivation differenziert. 3) Präfigierung: Die Konstruktion ist Präfixwort. Nicht nur diese Möglichkeiten bieten heutiges Deutsch sondern auch viele besondere Arten: Diese besonderen Modelle zeichnen sich mit der geringeren Intensität der Gebräuchlichkeit aus. Es sind folgende Arten: 4) Kontamination: (Wortkreuzung) Es ist die Vermischung zweier Wörter zu einem neuen Wort. (z.b. tragikomische, Kurlaub) 5) Wortkürzung: Es handelt sich um ausdrucksseitige Verkürzung eines Wortes ohne Wortartwechsel oder Bedeutungsveränderung. Zu der Wortkürzung gehören zwei Untergruppen: 5a) Initialwörter (Acronyme) (z.b. PKW von Personenkraftwagen, AG von Aktiengesellschaft), 5b) Kurzwörter: Schwanzwort: Cola (von Coca-Cola), Bus (von Omnibus) Kopfwort: Uni (von Universität), Limo (von Limonade), Abi (von Abitur) 16
17 Kopf-Schwanz-Wort: Kudamm (von Kurfürstendamm), Kripo (von Kriminalpolizei) 5c) Reduplikation: einfache Doppelungen, Reimbildungen und Ablautdoppelungen (z.b. Mama, Hokuspokus, Zigzag). Jetzt kehre ich zu den meist gebrauchten WBK zurück: Derivation, Präfigierung und Komposition Die DERIVATION Derivation: Die Ableitung ist ein anderes Benennungswort für Derivat, also ein Resultat des Derivationsprozesses. Man unterscheidet eine explizite und implizite Derivation. Der Bauplan ist folgender: Basismorphem (/Morphemkomplex) und Wortbildungsmorphem. Bei der Derivation wird an eine Wurzel ein Derivationsaffix angehängt. Die weitere Bestimmung des Wortbildungstyps richtet sich nach der Reihenfolge und Kombination der UK. Die Wortart der Wortbildung kann das Derivationsaffix ändern aber es ist keine Regel. Die Derivationsaffixe haben eine eigene Bedeutung, so dass sie immer die Bedeutung ändern. Es kommt ein komplexes Wort auf, das eine andere Bedeutung alle seine Wurzel hat. Die Basis für die Derivation kann ein Substantiv, ein Adjektiv ein Verb oder ein Adverb sein: a. Monat (Substantiv) + lich = monatlich (Adjektiv) b. dunkel (Adjektiv) + heit = Dunkelheit (Substantiv) c. aufschieb (Verb) + bar = aufschiebbar (Adverb) d. jetzt (Adverb) + ig = jetzig (Adverb) 17
18 Ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein Verb kann das Derivativum sein. a. Angst (Substantiv) = ängstigen (Verb) b. machbar (Adverb) = Machbarkeit (Substantiv) c. Kind (Substantiv) = kindisch (Adverb) Es gibt verschiedene Derivationsaffixe, die man von der Wortart unterscheidet, die sie bilden. a. Die Derivationsaffixe, die Substantive bilden (z.b.: -nis, -heit, -keit, -ung). b. Die Adjektivaffixe, die Adjektive bilden (z.b.: -ig, -bar, -lich). c. Die Verbalaffixe, die Verben bilden (z.b.: be-, ent-, ver-, zer-). In den oben genannten Beispielen ist sehr gut ablesbar, dass bei der Derivation nur ein Grundmorphem existiert, deren Affixe keine eigenständige lexikalische Bedeutung haben. Aus den Derivaten kann man auch verschiedene komplexe Wörter bilden. Also ein Derivat ist ein Ausgangspunkt für eine andere Ableitung und es kann mit anderen Wörtern zusammengesetzt werden. z.b. a. Fachbereichsratsvorsitzendenverordnungen b. Unfruchtbarkeitsgottheiten c. Ledersesselbeistelltischdeckchen d. Steuererhöhungsbeschlussvorlagensitzungsprotokoll IMPLIZITE Derivation Bei einer impliziten Derivation wird kein Derivationsmorphem (Wortbildungssuffixes) verwendet. Es sind die Wörter, die mittels eines Nullmorphems gebildet sind. Es handelt sich um Wörter aus einem freien Morphem oder einer freien Konstruktion, die als Ganzes durch ihre semantische und formale Beziehung auf andere freie Morpheme oder Konstruktionen motiviert sind /Stepanova, Fleischer, 1985, S.109/. 18
19 Der Wortstamm ändert seine Kategorie ohne morphologische Veränderung. (z.b. grün - Adjektiv grün(en) - Verb, werfen - Verb Wurf - Substantiv, fallen - Verb fällen - Verb). Es handelt sich eigentlich um einen Prozess deverbaler Derivation von Substantiven und Verben ohne Affigierung mit Wechsel des Stammvokals. Heute ist diese Methode unproduktiv. Oft geht es um eine Transposition. Es ist ein Wortbildungsprozess, bei dem ein Wort von einer Wortart in eine andere transformiert wird. (z.b. versuchen als Wortbildungsprozess zum e Versuchung, r Versuch als Resultat des Prozesses, drucken r Drucker, fliegen r Flug). Eine weitere Art der impliziten Derivation nennt man Konversion (Wortartwechsel). Es ist eigentlich der Übergang eines Wortes aus einer Wortklasse in eine andere, wobei keine formalen Änderungen erfolgen /Uhrová, 2002, S. 95/. Ein Wort wird in eine andere Wortart umgesetzt und wichtig ist, dass es ohne Beteiligung von Affixen durchgeführt wird. Die Form des Derivates mit der Grundform der Basis identisch. Zwischen Konversionen kann man folgende Typen unterscheiden: 1) Bildung von Substantiven: Man kann sagen, dass alle Wörter substantiviert werden. Substantivierung von Adjektiv = der Kranke, ein Fremder, das Blau Partizip = der Reisende, ein Angestellter, der Anwesende Verb = das Lesen, der Trank, das Essen, das Lachen 2) Bildung von Verben = härten, ölen 3) Bildung von Adjektiven = ernst, reizend, ausgezeichnet, auffassend Aus den Punkten 1 und 3 können wir verschiedene Typen von Derivativen herausbekommen: Es sind die Derivative, die nach der Wortart des Kernmorphems klassifiziert werden. 19
20 Desubstantiva: Das Morphem ist ein Substantiv (z.b. Unfall, freundlich, hämmern). Deadjektiva: Das Kernmorphem ist ein Adjektiv (z.b. Klugheit, lediglich, unklar, glätten). Deverbativa: Das Kernmorphem ist ein Verb (z.b. Senkung, lesbar, vorweisen, verstehen). Wenn eine Wortbildungskonstruktion aus freien Wortbildungskonstituenten besteht und die andere sind gebunden, handelt es sich entweder um ein Präfixwort oder um ein explizites Derivat EXPLIZITE Derivation Die erste unmittelbare Konstituente (UK) bildet eine Wortgruppe, die zweite Konstituente ist ein Suffix. Die UK schlieβt das Wort nicht ab (z.b. frei Freiheit, faul faulen, schön Schönheit, Sand sandig, tätig - Tätigkeit). Danach werden alle Wortbildungskonstruktionen mit einer gebundenen unmittelbaren Konstituente (Suffix oder Präfix) als Derivate bezeichnet. Ebenso wichtig sind die genannten Suffigierungen von den Ableitungen zu trennen. Entsprechend ist auch eine Bildung wie Inbetriebnahme (in Betrieb nehmen) wie Zunahme (zunehmen) zu behandeln. Die historische Wortbildungslehre spricht hier von Zusammenbildungen und bezeichnet sie als eine besondere Art von Wortbildung /Fleischer, 1976, S. 64/ Die Präfixbildung Die Präfigierung gehört zu der EXPLIZITEN DERIVATION. Die UK bestehen aus Derivationsbasis und Derivationsaffix. Derivationsbasis ist ein Morphem oder eine Morphemkonstruktion und Derivationsaffix ist entweder Suffix oder Präfix. 20
21 Suffix: (z.b. Ordn-ung, fröh-lich, krise-l-n). Es kann eintreffen, dass eine Kombination beider Derivationsaffixe vorkommt (z.b. Ge-mein-schaft, ver-rein-ig-en). Die Präfixe stehen vor dem Wort und können die Wortart nicht verändern. Es ist eine Art von Modifikation. Die Veränderung der formativen Bestandteile des Wortes: insbesondere Ausdruckserweiterung durch gebundene Elemente. Die Wortart bleibt erhalten. Präfix: (ab-laufen, ver-laufen, ent-laufen, aus-mahlen). Ein Präfixwort tritt meistens bei einem Verb auf. Es gibt 3 Präfigierungsarten von Verben. a) Präfixverb (z.b. be- kommen, er- gänzen). Der Akzent steht auf dem Verbalstamm. Das bedeutet, dass verbale WBK mit be-, ge-, ent-, er-, ver-, zer- als Präfixbildungen angesehen werden und diese Präfixe ohne homonyme freie Morpheme sind auch als ältere Schicht der Präfixe bezeichnet. Alle anderen wie: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, durch-, los-, nach-, um-, unter-, über-, vor-, zu- werden als Partikelkomposita angeschaut und es geht um Präfixe mit homonymem freien Morphemen. b) Partikelpräfixverb: (z.b. über- ziehen). Noch stammbetont. c) Partikelverb: (z.b. über-ziehen). Partikelbetont, d.h. die Betonung liegt auf der dem Verbstamm vorgehenden Silbe. Die Partikel ändert die Bedeutung des Grundmorphems komplett. über- ziehen = sich anziehen über-ziehen = überschreiten Ein Präfixwort liegt vor, wenn die freie UK das Wort abschlieβt. (z.b. Un-glück, ur-alt, er-innern). Das zweite Glied des Wortes ist kategoriebestimmend und die Reihenfolge ist fest: Präfix vor Stamm. Der Wortakzent liegt auf dem Stamm mit der Ausnahme des Negationspräfixes. Wie Derivative sind auch Komposita nach der bestimmten morphologischen Regel gebildet, d.h. nach der Regel, die die grammatischen Kategorien des gesamten Wortes bestimmt. 21
22 3. 5. Die KOMPOSITION Allgemeine Informationen Jetzt gehe ich auf den wichtigsten Teil meiner Arbeit über. Die deutsche Sprache ist auffällig produktiv und so meistens in der Bildung neuer Wörter mittels Zusammensetzungen (ZS). Zusammen mit der Derivation ist die Komposition (Zusammensetzung) das wichtigste Wortbildungsmittel der deutschen Sprache. Ihr Bedarf wächst ständig schon aus dem Bedürfnis nach neuen Fachbegriffen. Die Komposition gehört zu dem produktiven Mittel der deutschen WB, das heiβt, sie wird heute, in der Gegenwart, zur Bildung neuer Wörter verwendet. Die Komposition wird durch Kombination von Wortstämmen gebildet. Also der Bauplan ist folgender: Bauplan: Basismorphem (/Morphemkomplex) + Basismorphem (/Morphemkomplex) Man setzt zwei Wörter zusammen und entsteht ein neues Wort. Die Betonung ist auf dem ersten Glied (Bestimmungswort). Sowohl Komposita als auch Derivative nehmen häufig eine eigenständige Bedeutung an, die sich nicht mehr unmittelbar aus ihren Bestandteilen herleiten lässt. Diese Wörter müssen dann selbst ins Lexikon eingetragen werden (z.b. die Krankenversicherungsdschungel) Dieses Wort kann man nicht im Wörterbuch finden. Es entsteht aus drei selbständigen Wörtern: Kranken + versicherungs + dschungel = ein Chaos im Krankenversicherungssystem. In vielen Grammatiken gibt es viele Definitionen von Komposita: Definition von Bußmann: Verbindung von zwei oder mehreren sonst frei vorkommenden Morphemen oder Morphemfolgen... /Bußmann, S. 400/. Wenn zwei oder mehrere selbständige Wörter zu einer neuen Einheit verbunden werden, sprechen wir von einem Kompositum (Zusammensetzung) /Uhrová, 1992, S. 91/. 22
23 Komposita sind komplexe Wörter aus wortfähigen unmittelbaren Konstituenten /Duden 4, 2005, S. 672/. Es handelt sich also um eine Ausdruckserweiterung durch freie Elemente. Das Grundwort (GW) bestimmt die Wortart und bei Nomen das Genus. Es können alle Wortarten kombiniert werden. Die Komposition differenziert nach Determinativ- und Kopulativkompositum und wird entweder mit einer Kopplung (Bindestrich) oder durch Zusammenschreibung, oft mit Fugenlauten, miteinander verbunden. Ein Kompositum ist sowohl eine formale Einheit als auch eine semantische Einheit es wird als ein Wort behandelt, es trägt einen Hauptakzent und wird als ganzes flektiert. Da Komposita semantische Einheiten sind, kommt es auch zu einer bestimmten Idiomatisierung (z.b. die Muttersprache = es ist nicht die Redeweise einer Mutter gemeint) /Uhrová 1992, S. 92/. Wie ich schon oben geschrieben habe, bildet man ein Kompositum aus (in der Regel: zwei) freien UK und es kann verschiedene Formen ausweisen: Sie können aus zwei komplexen Wörtern bestehen und sie werden durch die Derivation gebildet. Sie haben ein Fugenelement. (z.b. Arbeitsaufenthalten = Arbeit(-s) + Aufenthalten). Ein Kompositum kann aus zwei lexikalischen Morphemen bestehen (z.b. Hochbahn = hoch + Bahn). Es tritt auch als Mehrfachzusammensetzung (MFZS) auf. (z.b. Vertragskrankenversicherung = Das Kompositum Krankenversicherung wird mit Fugenelement und Vertrag zu einem neuen Kompositum). Bei Komposita ist der letzte Bestandteil (fast) immer der wichtigste, also hier Versicherung. Dieses Grund- oder Basiswort (manchmal nennt man es auch Determinatum) bestimmt die grammatischen Eigenschaften des Wortes. Das GW bestimmt auch die Grundbedeutung des Wortes. Das BW (auch Determinants genannt) gibt dann nähere Informationen zum GW. Die Wörter (z.b. Arbeithose, Damenhose, Herrenhose, Unterhose, Strumpfhose, Sporthose und Lederhose bezeichnen alle Hose, 23
24 aber die erste trägt man nur in der Arbeit, die zweite ist für Damen bestimmt, die dritte ist nur für den Herren und die vorletzte ist gut zum Spielen und die letzte ist aus Leder). Das BW in unserem Beispiel ist die Hose. In den Komposita können Begriffe und Sachverhalte zusammengefasst werden, die sonst durch längere syntaktische Fügungen wiedergegeben werden. Es gibt verschiedene Arten der Interpretation von Komposita: Die Bedeutungsbeziehungen in einer Determinativkomposition können auch prinzipiell offen sein, d.h. nicht auf eine festgelegte Interpretation beschränkt. Es bietet uns verschiedene Paraphrasierungen: Bedeutung von Stierfrau: Frau, die Stier kauft Frau des Stieres Frau, die Stier is(s)t Frau, die Stier produziert Frau, die im Sternbild des Stieres geboren ist Frau, die vom Stier abstammt Frau, die Kraft wie Stier hat [...] Es gibt keine finite, festgelegte Menge möglicher semantischer Relationen zwischen Komposita. Die Komposita können wir nach ihrer Funktion einteilen, genauer nach den grammatischen Funktionen der Konstituenten. Komposita mit Verben und Komposita ohne Verben. Die Komposita mit Verben können diesen Plan haben: Substantiv + Verb Vater + lieben die Vaterliebe Liebe des Vaters, Verb + Substantiv schreien + Kind das Schreikind ein Kind, das schreit, Substantiv + Verb - Objekt Obst + verkaufen der Obstverkäufer der Mann, der die Obst verkauft. 24
25 Die Komposita ohne Verben nennt man Komposita mit Pro-V. In folgenden Beispielen beschreibt man verschiedene Möglichkeiten der syntaktischen Paraphrasen. Subjekt treibt Objekt: Subjekt + Objekt Pferd + Wagen ein Pferdewagen Ein Wagen mit einem Pferd, Subjekt besteht aus Objekt: Subjekt + Objekt Glas + Dose eine Glasdose eine Dose aus Glas, Objekt wird von Subjekt gebracht Objekt + Subjekt Möbel + Händler Subjekt produziert Objekt Subjekt + Objekt Lamm + Fleisch ein Möbelhändler ein Händler mit Möbel, ein Lammfleisch Fleisch aus Lamm, Subjekt befindet sich auf. Subjekt + Adverb Feld + Stein ein Feldstein aus dem Feld beseitigter Stein. / Determinativkomposita, Kopulativkomposita, Verstärkungskomposita und verdunkelte Komposita sind die Arten der Komposita. Zuerst möchte ich die Determinativkomposita ausführlicher darlegen, weil sie nicht nur in der Alltagssprache sondern auch in der Literatur am häufigsten vorkommen. 25
26 3. 6. Die DETERMINATIVKOMPOSITA Wenn eine unmittelbare Konstituente der anderen untergeordnet, so handelt es sich um ein Determinativkompositum, d.h., das durch das Grundwort (=die zweite UK) bezeichnete Objekt wird durch das Bestimmungswort (= die erste UK) näher bestimmt, determiniert, aus der allgemeineren Begriffsbenennung wird eine speziellere /Stepanova, Fleischer, 1985, S. 110/. Es handelt sich um das Prinzip der Informationsverdichtung oder Univerbindung. Im Sinne der Sprachökonomie ist ein Syntagma als ein Wort ausgedrückt. Das so entstehende Determinativkompositum ist eine endozentrische Konstruktion. Die zweite UK eines Determinativkompositums ist das Grundwort (GW). Es ist bestimmend für die Wortklasse und das Genus. Das GW kann ein Substantiv (Speiseöl, Aufenthaltsstatus,) Adjektiv (Deckweiβ, originaltreu) oder Verb (zurückholen, wegkommen) sein. Es ist gleichzeitig der semantische Kern des gesamten Kompositums. Im Deutschen ist es rechtes Glied des Wortes und ist vom linken Glied (BW) semantisch näher bestimmt. (z.b. sichergehen = jemand geht mit Sicherheit). Das BW kann jede Wortart vertreten, aber es bestimmt keine grammatischen Eigenschaften eines Wortes, d.h. es kann die Wortart des ganzen Kompositums nicht angeben. Die beiden UK sind fest bestimmt. Wenn wir sie vertauschen, ändert sich auch die gesamte Konstruktion (z.b. die Stuhllehne x der Lehnstuhl, die Baumnadel x der Nadelbaum). Bei einigen Determinativkomposita können wir verschiedene Wörter betrachten, bei denen die Analyse in zwei Konstituenten keinen Sinn mehr macht (z.b. Himbeere, Junggeselle). Diese Wörter bezeichnen wir schon als Simplizia. 26
27 Wie schon oben geschrieben ist, der Kopf des Determinativkompositums kann ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein Verb sein und dementsprechend unterscheiden wir zwischen Nominal-, Adjektiv- und Verbalkomposita. Das BW kann ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Verb oder eine Präposition sein: Unter die Kompositionsfuge wird die Nahtstelle verstanden, an der die beiden unmittelbaren Konstituenten aneinandertreffen /Stepanova, Fleischer, 1985, S. 113/ Die KOMPOSITIONSFUGE Es gibt Komposita, wo ZS entweder kein zusätzliches Fugenelement (FE) gibt oder Komposita mit einem FE und danach unterscheiden wir die echte und unechte ZS. Die Nahtstelle zwischen den unmittelbaren Konstituenten eines Kompositums heiβt Kompositionsfuge. Sie kann unterschiedlich gestaltet sein: - ohne Veränderung der verknüpften Glieder und ohne Fugenelement: Hausfrau, - ohne Fugenelement, aber mit Tilgung des Vokals e (Schwa) im Auslaut des Erstesgliedes: Schulbuch, - mit Fugenelement: Tagesreise. Etwa 30% aller Komposita weisen ein Fugenelement auf. Welche Fugenelemente das jeweils sind, hängt es von der Wortart des Erstgliedes ab, auβerdem von dessen Laut-, Silben- und Wortbildungsstruktur sowie, wenn es ein Substantiv ist, von seiner Flexionsklasse /Duden 4, 2005, S.721/. Die FE gehören zum BW (zur ersten UK) eines Kompositums. Das Lesen und die Aussprache mit einem FE sind dann erleichtert. In der deutschen Sprache kommen mehrere FE vor. Das meist gebrauchte FE ist (e)s-, dann ist die Frequenz des Gebrauchs ähnlich und so: -(e)n-, -ens-, -e-, oder er-. Die FE dienen zur Verhinderung des Aufeinanderfolgens zweier betonter Silben, da alle FE außer -s zu nicht betontbaren Silben gehören. 27
28 Als ein Fugenzeichen kann auch ein Bindestrich dienen. Der Bindestrich ist eigentlich kein Wortbildungselement. Er hat in der Wortableitung und der Wortbedeutung weder eine formale noch eine inhaltliche Funktion. Er wird in der Rechtschreibung zur Verdeutlichung der geschriebenen Form bestimmter Wörter verwendet. Es kommt auch vor, dass einzelne Wörter des ganzen Kompositums mit einem Durchkopplungsbindestrich verbunden sind. Es handelt sich um ein Axiom, dass Wörter im Deutschen kein Leerzeichen enthalten können. Innerhalb einer WBK gibt es eine Mischung von Koordination (Kopulation) und Subordination (Determination). Z.B. Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist ein Determinativkompositum: ein Arzt für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten. Bei Adjektiven und flexionslosen Wörtern fehlen die FE. -e- Gäst-e-haus -en- Held-en-tat -n- Blende-n-einstellung -ens- Frau-ens-person -er Ei-er-schale -es- Wald-es-rand Die Fugenelemente sind aus ehemaligen Flexionssuffixen entstanden. Fugenelement (e)s- Die ursprüngliche Endung des Genitiv Singulars der starken Deklination. Es ist am häufigsten und tritt auch bei pluralischem Verhältnis und bei Feminina auf. Häufig wird dieses s als Wohllaut-s bezeichnet (z.b. Arbeit-s-bedingungen, Auftrag-s-lage). Es ist wichtig, ob ein FE bei einem Kompositum anwesend ist. Es kann nämlich zum Bedeutungsunterschied vorkommen. (z.b. Landmann ist etwas ganz anderes als Landsmann. Landmann ist ein Mann vom Lande aber Landsmann ist ein Mann, der aus derselben Gegend stammt). Dieses FE -s kann allen Lauten am Ende einer Silbe folgen, aber es kann nicht vor einem Konsonanten am Anfang einer Silbe stehen. 28
29 Fugenelement (e)n- Es ist die ursprüngliche Genitivendung der schwachen Feminina aber in der heutigen Sprache wird die Verwendung vor allem durch das Pluralmorphem der ersten UK bestimmt. Zu dem Kreis der Feminina (z.b. Scheune(n)-tor, Urkunde(n)-fälschung) gehören hier auch die Maskulina, vor allem Personenbezeichnungen (z.b. Pause-n-brote, Präsident-en-honorar, Krank-en-haus). Schlieβlich tritt en- bei einer Reihe von Neutra auf, deren Pluralform nicht auf en, sondern auf e endet (z.b. Zitat-en-schatz, Inserat-en-annahme) /Stepanova, Fleischer, 1985, S.114/. Fugenelement ens- Dieses Element kommt sehr selten vor. (z.b. Herz-ens-angst) Fugenelement e- Sehr isoliert treffen wir das Element e bei einsilbigen Femina (z.b. Städt-e-bund), öfter bei maskulinen und neutralen UK (z.b. Hund-e-hütte, Bind-e-glied). Das Element finden wir immer in Übereinstimmung mit Pluralformen auf e (z.b. Gast-haus Gäst-e-haus). Es kommt auch oft bei den UK vor, die aus einem Verbstamm besteht (z.b. Reib-e-käse, Bind-e-glied). Fugenelement er- Die Wörter, die den Plural auf er bilden, haben das Fugenelement er (z.b. Männ-er-stimme, Licht-er-glanz). Sehr oft stehen Plural- und Singularformen nebeneinander (z.b. Völk-er-kunde x Volkskunde). Die Fugenelemente werden wir aus der synchronen Beschreibung nicht als Flexionsmorphem, sondern als funktionslose Verbindungselemente betrachten. In der diachronen Beschreibung sind die Fugenelemente aus Flexionsmorphemen hervorgegangen. 29
30 Die NOMINALKOMPOSITA Bei den Nominalkomposita ist das letzte Glied sowohl die Wortart als auch die Flexionsklasse bestimmt. Auf der semantischen Ebene gibt es sehr unterschiedliche Relationen zwischen den Kompositionsgliedern. Semantische Grundrelationen bei Nomen + Nomen Komposita (N+N) bei Fandrych und Thurmair aus dem Jahr SITUATION: Das Zweitglied steht in lokaler oder temporaler Relation zum Erstglied. <ist in> Stadtautobahn, Gartenbrunnen; <führt zu> Gartentür, Mondrakete; <stammt aus/von> Erdöl, Fabriknagel; <ist zum Zeitpunkt/ im Zeitraum> Mittagessen, Abendkonzert SITUATION-URHEBER: Das Zweitglied steht in kausaler Relation zum Erstglied <ist verursacht von> Feuerschaden, Polizeirazzia, KONSTITUTION: Das Zweitglied hat das Erstglied als konstitutiven Bestandteil. <besteht ganz aus> Holztisch, Goldring, Glasflasche; <hat> Henkeltasse, Nusskuchen, Giebelhaus; <in der Art/Form/Farbe... von> Würfelzucker, Zitronenfalter, Milchglas KONSTITUTION-THEMA: Das Zweitglied hat das Erstglied als konstitutiven thematischen Bereich. <hat als Thema> Tierbuch, Friedenszeichen; <im Bereich> Verkehrsministerium, Rektorenkonferenz ZWECK: Das Zweitglied wird bezüglich seines Anwendungsbereichs (Erstglied) bestimmt. <dient zu> Arbeitstisch, Malerpinsel, Schulranzen; <schützt vor> Schmerztablette, Hustensaft, Windjacke 30
31 INSTRUMENT: Das Zweitglied wird in seiner Funktionsweise durch das Erstglied charakterisiert. <funktioniert mit Hilfe von> Benzinmotor, Handbremse Windmühle, Dampfkochtopf /staff.uni-mainz.de/steinbac/lehre/grammatik/wortbildung/. Der BW ist natürlich nicht nur ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Verb oder eine Präposition sondern auch ein Adverb, ein Pronomen, ein Numerale oder ein Partikel. Die meist gebrauchten sind aber ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Verb oder eine Präposition. Nominalkompositum: Nomen + Nomen Holz + Haus das Holzhaus ein Haus aus Holz Kirche + Halle die Kirchenhalle eine Halle in der Kirche Adjektiv + Nomen Grün + Licht die Grünlicht eine Licht, die grün scheint Hoch + Spannung die Hochspannung eine groβe Spannung Verb + Nomen Zerr + Bild das Zerrbild eine Karikatur Mal + Buch das Malbuch ein gemaltes Buch Präposition + Nomen Hinter + Haus das Hinterhaus ein hinterer Teil des Hauses Mit + Arbeit die Mitarbeit die Arbeit zwischen den Leuten Adverb + Nomen Innen + Bemalung die Innenbemalung eine Bemalung in einem Haus Partikel + Nomen Ja + Stimme Ja-Stimme eine Stimme für etwas Zustimmung Pronomen + Nomen Ich + Mensch Ich-Mensch Ich selbst Numerale + Nomen Erst + Versorgung die Erstversorgung eine erste Hilfe 31
32 Bei N + N Komposita werden oft Fugenmorpheme eingefügt und sind am meisten gebraucht. Ihr Auftreten ist zum Teil phonologisch motiviert. Bei der Interpretation von N+N- Komposita gibt es oft mehrere Möglichkeiten (z.b. Glashaus als Haus, das aus Glas hergestellt ist oder als Haus, in dem Glas aufbewahrt ist, interpretiert wird). Die Interpretation von N+N-Komposita erfolgt aufgrund inhärenter semantischer Eigenschaften des Zweitglieds (bei relationalen Nomen) und aufgrund bestimmter Grundrelationen zwischen dem Zweitglied und dem Erstglied Die ADJEKTIVKOMPOSITA Sie werden nach der Beziehung zwischen linkem und rechtem Glied klassifiziert. Das GW ist immer ein Adjektiv und das BW variiert. Die Adjektivkomposita werden nicht so häufig wie die Nominalkomposita. Nomen + Adjektiv Nacht + blind nachtblind jd., der in der Nacht nicht sieht Welt + bekannt weltbekannt überall bekannt, groβe Popularität Adjektiv + Adjektiv dunkel + rot dunkelrot dunkles rot original + treu originaltreu einem Original treu sein Verb + Adjektiv stink(en) + faul stinkfaul saloppe Bezeichnung, jd. ist sehr faul trink(en) + fest trinkfest jd. ist gegen Alkohol beständig Präposition + Adjektiv über + lang überlang zu sehr lang vor + schnell vorschnell hastig sein 32
33 Die VERBALKOMPOSITA Das Verbalkompositum besteht aus dem Verb als GW und das BW kann variieren. Die Fälle sind folgender: Der N + V Typ ist nicht unproblematisch, da es sich entweder um ein Verb und sein Objekt oder um Rückbildungen handelt. Zu dem verhalten sich viele N + V Bildungen syntaktisch nicht wie normale Verben, da sie keine Verbzweitstellung zulassen. Nomen + Verb Staub + saugen staubsaugen gründlich aufräumen Stand + halten standhalten einem Gegner widerstehen Adjektiv + Verb weit + springen weitspringen in die Weite springen froh + locken frohlocken vergnügen Verb + Verb kennen + lernen kennen lernen Bekanntschaft machen j-ds. stehen + bleiben stehen bleiben in Ruhe stehen. Präposition + Verb zer + legen zerlegen etw. auflösen mit + spielen mitspielen zusammenspielen Die gebräuchlichste ist die Kombination von Präposition und Verb gebrauchen. In der deutschen Sprache gibt es sehr groβe Zahl von Präpositionen, die man mit einem Verb verbinden kann. Jedoch kommen Probleme vor, in denen bestimmte Präpositionen präfigiert werden und man betrachtet sie als Partikel, weil sie eine lexikalische Bedeutung haben (z.b. vorbei/kommen, hinunter/fallen). Deswegen rechnen manche Forscher der genannten Präfigierung zu den Kompositionen, zumindest nicht zu den Derivationen. Den Grammatiken nach handelt es sich um: 33
34 Die PSEUDOKOMPOSITA Es geht um die trennbaren Verben, die den Wortakzent auf dem Erstglied tragen und das zweite Glied ist kategoriebestimmend, wie bei den Komposita. Der Bauplan ist auch identisch: Stamm + Stamm = morphologischer Komplex Das Erstglied kann getrennt werden und trotzdem ist begriffliche Einheit erhalten (z.b. umbauen, durcharbeiten, zusammenleben). Diese Elemente ab-, an-, aus-, auf- und ähnlicher, denen homonyme freie Morpheme als Präposition oder Adverb gegenüberstehen. Sie haben in Konstruktionstypen in Verbindung mit einem Verb Wortbildungsbedeutungen entwickelt und werden deshalb als Präfixe betrachtet. Andere Auffassungen werden z.b. vertreten von M. Bierwisch (Präfix nur bei nichttrennbaren Konstruktionen) sowie von G. Zifonun (grundsätzlich keine Präfixe, sondern Kompositionsglieder als sog. Präverbien ) und von M.D. Stepanova ( Halbpräfixe) /Stepanova, Fleischer, 1985, S / Die REKTIONSKOMPOSITA Die Determinativkomposita, deren Wortbildungsbedeutung valenzgrammatisch erläutert ist, heiβen Rektionskomposita. Die WBK besteht aus BW und aus deverbalem Substantiv als GW, das vom Verb eine semantische Valenzstelle hat (z.b. etw. untersuchen die Untersuchung). Die Valenzstelle ist im Kompositum vom BW belegt (z.b. Blutuntersuchung = Die Ärzte untersuchen seines Blut = Die Untersuchung des Blutes). Der Kopf des Rektionskompositums ist von einem transitiven Verb abgeleitet. suchen AGENS, THEMA Sucher THEMA Goldsucher. Das BW ist ein Argument des Verbs. Es gibt verschiedene SONDERFÄLLE des Determinativkompositums 34
35 Zu diesen Sonderfällen gehören: Possessivkomposita, Klammerform und verdeutlichende Komposita. Alle diese WBK haben die Struktur von Determinativkomposita. Ihre Besonderheiten ergeben sich aus ihrer Referenz Die POSSESSIVKOMPOSITA Die UK bezeichnen ein Lebewesen anhand von Eigenschaften. Bei diesem Kompositum ist die Referenz nicht durch die zweite UK gegeben. Das rechte Glied ist im übertragenen Sinn gebraucht. Oft werden sie als PARS PRO TOTO Konstruktion genannt. (z.b. Langbein oder Groβmaul). Alle diese ZS können wir mit einer haben-paraphrase umschreiben ( Jemand, der ein großes Maul hat oder einen langen Bein hat ). Mit zeitlicher Entfernung kann die Empfindung der einzelnen Komponenten dann aber verloren gehen, die Paraphrasierung sinnlos werden: Bei Lengbein oder Groβmaul etc. ist die Idiomatisierung bereits so stark fortgeschritten, dass sie als Simplizia empfunden werden können. Bei den Possessivkomposita trägt das GW meistens ein Kleidungsstück, einen Körperteil oder etwas Ähnliches, was näher den Besitzer oder Träger charakterisiert. Sie werden als auch EXOZENTRISCHE Komposita genannt. Die Bezugsgröβe wird in der Bildung nicht genannt. Die semantische Kategorie erfahren wir aus keinem Bestandteil des Kompositums. Sehr oft kommen diese Zusammensetzungen als Tier- und Pflanzennamen vor: (z.b. Torkehlchen, Pfauenauge oder Schwalbenschwanz) /Uhrová, S. 99/ Die KLAMMERFORM Sie bestehen meist aus ein Substantiv + Substantiv und zeichnen sich dadurch aus, dass der mittlere Teil der ZG fehlt (z.b. Bier[glas]deckel oder Tank[stellen]wart). 35
36 Die VERDEUTLICHENDE KOMPOSITA Sie werden nach Eichinger auch Explikativkomposita genannt. Eine der beiden unmittelbaren Konstituenten (entweder die erste oder die zweite) wird durch ein zweites Element lediglich sekundär teilmotiviert, ohne daβ eine semantische Modifikation oder eine syntaktische Transposition stattfindet (z.b. Turteltaube mit gleicher Bedeutung wie Turtel allein). Heute vielfach bei Fremdwörtern: (z.b. Fachexperte) /Stepanova, Fleischer, S. 117/. Sowohl das BW als auch das GW kann semantisch allein das ganze Kompositum vertreten. Verdeutlichend werden schlieβlich auch solche Komposita genannt, deren Erst- oder Zweitglied eine semantische Entsprechung des jeweils anderen, meist entlehnten Gliedes darstellt /Duden 4, 2005, S /. Diese Gruppe von Wörtern vertreten die lexikalisierte Wörter (z.b. Lösungsmittel = Das Mittel zur Auflösung) und okkasionelle Wörter (z.b. Farbzusammensetzung, Servicediens, Versicherungsdschungel). Aus einem allgemeinen Sprecherbedürfnis erklärt sich ihre Bildung. Bei mehrdeutigen Fremdwörtern stellt das Kompositum Eindeutigkeit her. Die Komposition mit Fremdelementen nennt man hybride Komposition. Es handelt sich um eine Kombination heimischer und fremder Elemente (z.b. Biomasse, Psychodrama, VZP-Filialen) Die ITERATIVKOMPOSITA Sie werden auch als Autokomposita genannt. Es handelt sich um eine schwach produktive WB. Sie sind durch reduplizierende Wortbildung entstanden und sie bestehen aus Wortstämmen, die wörtlich variiert oder wiederholt werden. Die Variation ist meisten bei einem Stammvokal des Ausgangswortes aber ein Konsonant kann auch variieren 36
37 (z.b. variierter Stammvokal: Wischiwaschi, variierter Konsonant Schickimicki). Aber ich nehme zur Vorsicht, um die Reduplikation nicht mit den onomatopoetischen Wörtern (z.b. Kuckuck, Wauwau) vertauscht wird. Die Onomatopoetika sind nicht aus Wörtern gebildet, sondern sie sind lautmalerisch Der ÜBERGANG ZUM KOPULATIVKOMPOSITUM In der deutschen Sprache kommt ein Typ von ZS vor, der zwischen Determinativ- und Kopulativkompositum steht. Die erste UK ist ein Nomen (Substantiv) und es hat die Funktion eines attributiv gebrauchten Adjektivs, aber wir können zugleich als Kopulativkompositum betrachten, wo die beiden Konstituenten nebengeordnet sind. Fleischer unterscheidet 3 unterschiedliche Untergruppen des Übergangskompositums. 1) Das Bestimmungswort ist eine Personenbezeichnung. Das Bedeutungsverhältnis zwischen dem BW und GW verstehen wir noch eher determinativ (z.b. Bruderpartei, Brudearmee. Die Bruderpartei können wir sowohl eine Partei als Bruder oder eine brüderliche Partei erklären. Die beiden UK kann man nicht vertauschen z.b. Parteibruder, Armeebruder bedeuten ganz etwas Anderes als Bruderpartei oder Bruderarmee). 2) Sowohl Bestimmungswort als auch Grundwort sind Personenbezeichnungen. Die Semantik der Konstruktion legt großen Wert auf die zweite Konstituente (GW). Auch bei diesen ZS können wir immer ein determinatives Verhältnis bemerken (z.b. Mördergeneral ist ein General, der zugleich als Mörder bezeichnet wird aber ein Generalsmörder wäre der Mörder eines Generals). Hier spielt eine appositionelle Relation groβe Rolle. Es kann auch geschehen, dass das semantische Gewicht auf der ersten Konstituente (BW) liegt (z.b. Amtskollege ist zuerst ein Beamter und dann Kollege). Auch hier sind die Konstituenten nicht vertauschbar. 37
Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester Morphologie. Walther v.hahn. v.hahn Universität Hamburg
 Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester 2006 Morphologie Walther v.hahn v.hahn Universität Hamburg 2005 1 Morphologie: Definition Definitionen: Morphologie ist die Lehre von den Klassen
Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester 2006 Morphologie Walther v.hahn v.hahn Universität Hamburg 2005 1 Morphologie: Definition Definitionen: Morphologie ist die Lehre von den Klassen
Wortbildung und Wortbildungswandel
 Germanistik Kira Wieler Wortbildung und Wortbildungswandel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Wortbildung... 2 2.1 Morphologische Grundbegriffe... 2 2.2 Arten der Wortbildung... 3 2.3
Germanistik Kira Wieler Wortbildung und Wortbildungswandel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Wortbildung... 2 2.1 Morphologische Grundbegriffe... 2 2.2 Arten der Wortbildung... 3 2.3
Die Wortbildung des Deutschen. Wortbildungsmittel
 Die Wortbildung des Deutschen Wortbildungsmittel Voraussetzungen und Ziele der Wortbildungsanalyse Bildung von Wörtern folgt best. Wortbildungstypen Bildung nach Vorbild eines bereits bekannten Wortes
Die Wortbildung des Deutschen Wortbildungsmittel Voraussetzungen und Ziele der Wortbildungsanalyse Bildung von Wörtern folgt best. Wortbildungstypen Bildung nach Vorbild eines bereits bekannten Wortes
Wortbildungsarten. Louisa Reichelt, Sarah Fritzsche, Laura Gersdorf
 Wortbildungsarten Louisa Reichelt, Sarah Fritzsche, Laura Gersdorf 1 Gliederung 1. Begründung der Systematik 2. Komposition 3. Derivation 4. Konversion 5. Kurzwortbildungen 6. Partikelverbbildungen 7.
Wortbildungsarten Louisa Reichelt, Sarah Fritzsche, Laura Gersdorf 1 Gliederung 1. Begründung der Systematik 2. Komposition 3. Derivation 4. Konversion 5. Kurzwortbildungen 6. Partikelverbbildungen 7.
WORTBILDUNG - MORPHOLOGIE
 WORTBILDUNG - MORPHOLOGIE Bs: Eindringlichkeit Eindringlichkeit Eindringlich keit + Eindringlich / keit Traurig / keit Haltbar / keit Regsam / keit SUBSTANTIVE Übel / keit SUBSTANTIV bei Abtrennung von
WORTBILDUNG - MORPHOLOGIE Bs: Eindringlichkeit Eindringlichkeit Eindringlich keit + Eindringlich / keit Traurig / keit Haltbar / keit Regsam / keit SUBSTANTIVE Übel / keit SUBSTANTIV bei Abtrennung von
Lemmatisierung und Stemming in Suchmaschinen
 Lemmatisierung und Stemming in Suchmaschinen Hauptseminar Suchmaschinen Computerlinguistik Sommersemester 2016 Stefan Langer stefan.langer@cis.uni-muenchen.de Trefferquote (Recall) und Genauigkeit (Precision)
Lemmatisierung und Stemming in Suchmaschinen Hauptseminar Suchmaschinen Computerlinguistik Sommersemester 2016 Stefan Langer stefan.langer@cis.uni-muenchen.de Trefferquote (Recall) und Genauigkeit (Precision)
Morphologie. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Morphologie Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Morphologie Was ist ein Wort? Morphologie ist linguistische Teildisziplin, die sich mit dem Gestalt, Flexion (Beugung) und Bildung von Wörtern beschäftigt.
Morphologie Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Morphologie Was ist ein Wort? Morphologie ist linguistische Teildisziplin, die sich mit dem Gestalt, Flexion (Beugung) und Bildung von Wörtern beschäftigt.
Wortbildung und Flexion. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Wortbildung und Flexion Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Wortbildung und Flexion Wie wird ein Wort gebildet? Wortbildung ist der Prozess der Bildung der Wörter, welcher der Erweiterung des Wortschatzes
Wortbildung und Flexion Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Wortbildung und Flexion Wie wird ein Wort gebildet? Wortbildung ist der Prozess der Bildung der Wörter, welcher der Erweiterung des Wortschatzes
In den Text von Thomas Mann begegnen z.b.: diese Komposita: Vormittagsstunde, Frühlingsnachmittag, Halteplatz oder Gedächtnistafel.
 WORTBILDUNG 2 1. Komposition 2. Derivation 1. Komposition Kompositum DEF: Komposita oder Zusammensetzungen sind Wortbildungen in denen die unmittelbaren Konstituenten Wörter oder Grundmorpheme sind, die
WORTBILDUNG 2 1. Komposition 2. Derivation 1. Komposition Kompositum DEF: Komposita oder Zusammensetzungen sind Wortbildungen in denen die unmittelbaren Konstituenten Wörter oder Grundmorpheme sind, die
Klausur Sprachwissenschaft Deutsch
 Systematische Vorbereitung, Druckdatum: Donnerstag, 20. Mai 2004 1 Klausur Sprachwissenschaft Deutsch Phonetik & Phonologie des Deutschen Laut = Phon, besteht aus einer charakteristischen Mischung von
Systematische Vorbereitung, Druckdatum: Donnerstag, 20. Mai 2004 1 Klausur Sprachwissenschaft Deutsch Phonetik & Phonologie des Deutschen Laut = Phon, besteht aus einer charakteristischen Mischung von
Morphologie und Syntax
 Morphologie und Syntax Gerhard Jäger 27. Juni 2006 1 Wortbildung: Komposition Zusammenfügen von Wörtern (bzw. Stämmen 1 ) zu neuen Wörtern ist rekursiv: Kompositum (Ergebnis eines Wortbildungsprozesses)
Morphologie und Syntax Gerhard Jäger 27. Juni 2006 1 Wortbildung: Komposition Zusammenfügen von Wörtern (bzw. Stämmen 1 ) zu neuen Wörtern ist rekursiv: Kompositum (Ergebnis eines Wortbildungsprozesses)
Die denominalen Verben des Französischen
 Pädagogik Anonym Die denominalen Verben des Französischen Studienarbeit I. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Definition...2 2.1 Nullsuffigierung (implizite Derivation)...5 2.2 Explizite Derivation...7
Pädagogik Anonym Die denominalen Verben des Französischen Studienarbeit I. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Definition...2 2.1 Nullsuffigierung (implizite Derivation)...5 2.2 Explizite Derivation...7
Inhalt. Einleitung. Wortarten 1
 Inhalt Einleitung XI Wortarten 1 1 Was sind Wörter? 2 1.1 Mehr oder weniger als ein Wort 2 Erster Problemfall: Verbzusätze trennbarer Verben 3 Zweiter Problemfall: Infinitivkonjunktion bei trennbaren Verben
Inhalt Einleitung XI Wortarten 1 1 Was sind Wörter? 2 1.1 Mehr oder weniger als ein Wort 2 Erster Problemfall: Verbzusätze trennbarer Verben 3 Zweiter Problemfall: Infinitivkonjunktion bei trennbaren Verben
Die Wortbildung des Deutschen
 Elke Donalies Die Wortbildung des Deutschen Ein Überblick Zweite, überarbeitete Auflage Gunter Narr Verlag Tübingen Inhalt Vorwort 11 Vorwort zur 2. Auflage 12 1. Einleitung: Warum sich die Auseinandersetzung
Elke Donalies Die Wortbildung des Deutschen Ein Überblick Zweite, überarbeitete Auflage Gunter Narr Verlag Tübingen Inhalt Vorwort 11 Vorwort zur 2. Auflage 12 1. Einleitung: Warum sich die Auseinandersetzung
Grundkurs Linguistik Wintersemester 2014/15. Morphologie. Jens Fleischhauer & Anja Latrouite
 Grundkurs Linguistik Wintersemester 2014/15 Morphologie Jens Fleischhauer & Anja Latrouite Morpho-logie morpho ( Gestalt ) logos ( Lehre ); Goethe 1796 Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die
Grundkurs Linguistik Wintersemester 2014/15 Morphologie Jens Fleischhauer & Anja Latrouite Morpho-logie morpho ( Gestalt ) logos ( Lehre ); Goethe 1796 Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die
Das Wort und die Wortbildung. Frühlingssemester 2012 Assist. Daumantas Katinas 14. Februar 2012
 Das Wort und die Wortbildung Frühlingssemester 2012 Assist. Daumantas Katinas 14. Februar 2012 Übersicht Definitionen Das Wort Die Motivation des Wortes Untersuchungsebenen der Wörter Wortbildung Wortbildungsarten
Das Wort und die Wortbildung Frühlingssemester 2012 Assist. Daumantas Katinas 14. Februar 2012 Übersicht Definitionen Das Wort Die Motivation des Wortes Untersuchungsebenen der Wörter Wortbildung Wortbildungsarten
VL Morphologie Derivation 2. Anke Lüdeling Sommersemester 2008
 VL Morphologie Derivation 2 Anke Lüdeling anke.luedeling@rz.hu-berlin.de Sommersemester 2008 produktiv aktiv stündlich, minütlich, zweimonatlich, täglich Basis: N, gibt Zeitraum an Ergebnis: jedes N produktiv
VL Morphologie Derivation 2 Anke Lüdeling anke.luedeling@rz.hu-berlin.de Sommersemester 2008 produktiv aktiv stündlich, minütlich, zweimonatlich, täglich Basis: N, gibt Zeitraum an Ergebnis: jedes N produktiv
Inhalt.
 Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Wortbildung Derivation
 Wortbildung Derivation Durch Komposition setzt man bestehende Stämme zu komplexeren Stämmen zusammen Durch Derivation erzeugt man neue Wörter durch Kombination mit Affixen Das Beispiel aus der ersten Sitzung:
Wortbildung Derivation Durch Komposition setzt man bestehende Stämme zu komplexeren Stämmen zusammen Durch Derivation erzeugt man neue Wörter durch Kombination mit Affixen Das Beispiel aus der ersten Sitzung:
Deutsche Lexikologie Das Wort und die Wortbildung
 Übersicht Definitionen Das Wort Die Motivation des Wortes Untersuchungsebenen der Wörter Wortbildung Wortbildungsarten Wortbildungsanalyse Literatur Definition(en) Keine einheitliche Definition des Wortes?
Übersicht Definitionen Das Wort Die Motivation des Wortes Untersuchungsebenen der Wörter Wortbildung Wortbildungsarten Wortbildungsanalyse Literatur Definition(en) Keine einheitliche Definition des Wortes?
Wortbildung: Komposition und Derivation
 Wortbildung: Komposition und Derivation Die Wortbildung beschäftigt sich mit den möglichen systematischen Verfahren zur Bildung neuer Wörter, genauer gesagt neuer Lexeme (Lexembildung). Ein neues Lexem
Wortbildung: Komposition und Derivation Die Wortbildung beschäftigt sich mit den möglichen systematischen Verfahren zur Bildung neuer Wörter, genauer gesagt neuer Lexeme (Lexembildung). Ein neues Lexem
Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
Einführung in die Computerlinguistik. Morphologie IV
 Einführung in die Computerlinguistik Morphologie IV Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 14.12.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie (IV)
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie IV Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 14.12.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie (IV)
Wort. nicht flektierbar. flektierbar. nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert. nach Genus, Kasus, Numerus flektiert
 Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Wortklasse oder part of speech hat verschiedene Merkmale. Nach dem traditionellen System werden die deutschen Wortklassen in zehn Klassen unterteilt (Gross,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Wortklasse oder part of speech hat verschiedene Merkmale. Nach dem traditionellen System werden die deutschen Wortklassen in zehn Klassen unterteilt (Gross,
Terminus Sprache, Phonologie und Grammatik
 Terminus Sprache, Phonologie und Grammatik Terminus Sprache Beinhaltet 4 verschiedene Bedeutungen Langage: menschliche Fähigkeit Langue: eine bestimmte Sprache, Untersuchungsgebiet der Linguistik Parole:
Terminus Sprache, Phonologie und Grammatik Terminus Sprache Beinhaltet 4 verschiedene Bedeutungen Langage: menschliche Fähigkeit Langue: eine bestimmte Sprache, Untersuchungsgebiet der Linguistik Parole:
I. Verfahren der Wortbildung: Komposition
 Germanistisches Institut der Ruhr-Universität Bochum `Wortbildung des Deutschen Protokoll: Nazan Nizamogullari (Übung Germanistische Linguistik) Sitzung am 12.11.03 Daniel Händel M.A. WS 2003 / 04 I. Verfahren
Germanistisches Institut der Ruhr-Universität Bochum `Wortbildung des Deutschen Protokoll: Nazan Nizamogullari (Übung Germanistische Linguistik) Sitzung am 12.11.03 Daniel Händel M.A. WS 2003 / 04 I. Verfahren
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Denominale und deadjektivische Partikelverben Nominale, adjektivische und verbale Präverbien
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 9 1. Einleitung... 11 1.1. Erhebungsmethode und Korpus... 11 1.2. Carmens allgemeine Sprachentwicklung... 14 1.3. Terminologisches: Analogie, Produktivität, Erwerb.... 16
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 9 1. Einleitung... 11 1.1. Erhebungsmethode und Korpus... 11 1.2. Carmens allgemeine Sprachentwicklung... 14 1.3. Terminologisches: Analogie, Produktivität, Erwerb.... 16
Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach Gegenstand und Aufgaben der Lexikologie. Geschichte der deutschen Lexikologie als Wissenschaft. Innere Bezie
 Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach Шакирова Л.Р., канд.пед.наук,, доц. каф. ЛиП Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach Gegenstand und Aufgaben der Lexikologie. Geschichte der deutschen Lexikologie
Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach Шакирова Л.Р., канд.пед.наук,, доц. каф. ЛиП Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach Gegenstand und Aufgaben der Lexikologie. Geschichte der deutschen Lexikologie
Morphologie. Lexikon Morphologie Syntax
 Wörter alt, neu, einfach, komplex (1) Bullen, zu, Layoutlaie, recyceln, Dachhase, AG, Wegfahrsperre, mächlich, TFT, mobben, Karaoke, Service-Team, outsourcen, andenken, quackelhaft, schneesicher, Seniorenresidenz,
Wörter alt, neu, einfach, komplex (1) Bullen, zu, Layoutlaie, recyceln, Dachhase, AG, Wegfahrsperre, mächlich, TFT, mobben, Karaoke, Service-Team, outsourcen, andenken, quackelhaft, schneesicher, Seniorenresidenz,
2.3 Der Ansatz der generativen Transformationsgrammatik Wiederbelebung des historischen Ansatzes Begriffsklärung, theoretische
 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 1 1 Geschichte der deutschen Komposition vom Althochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen im Überblick... 5 1.1 Komposition im Althochdeutschen (2. Hälfte 8. Jh.- 2. Hälfte
Inhaltsverzeichnis Einleitung... 1 1 Geschichte der deutschen Komposition vom Althochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen im Überblick... 5 1.1 Komposition im Althochdeutschen (2. Hälfte 8. Jh.- 2. Hälfte
1 Das Lernen der norwegischen Sprache Begrifflichkeit... 11
 Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13
Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13
SATZGLIEDER UND WORTARTEN
 SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
Dante Bemabei. Der Bindestrich. Vorschlas zur Systematisierung. PETER LANG Europäischer Verla3 der Wissenschaften
 Dante Bemabei Der Bindestrich Vorschlas zur Systematisierung PETER LANG Europäischer Verla3 der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 11 2 EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMATIK 14 2.1 Historische Aspekte
Dante Bemabei Der Bindestrich Vorschlas zur Systematisierung PETER LANG Europäischer Verla3 der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 11 2 EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMATIK 14 2.1 Historische Aspekte
Vorlesung Öhlschläger: WS 2010/11 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Theoretische und methodische Grundlagen
 Vorlesung Öhlschläger: WS 2010/11 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Theoretische und methodische Grundlagen 6. Wortbildung 6.1 Einleitende Bemerkungen 6.2 Funktionen der Wortbildung 6.3
Vorlesung Öhlschläger: WS 2010/11 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Theoretische und methodische Grundlagen 6. Wortbildung 6.1 Einleitende Bemerkungen 6.2 Funktionen der Wortbildung 6.3
Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung Uni München Repetitorium ZP Sommersemester 09. Morphologie. Alla Shashkina
 Morphologie Alla Shashkina Morphologie (= Formenlehre) untersucht systematische Beziehungen zwischen Wörtern und Wortformen Regeln, nach denen Wörter/Wortformen gebildet werden 2 Ziel in der Computerlinguistik
Morphologie Alla Shashkina Morphologie (= Formenlehre) untersucht systematische Beziehungen zwischen Wörtern und Wortformen Regeln, nach denen Wörter/Wortformen gebildet werden 2 Ziel in der Computerlinguistik
Die Regeln der deutschen Rechtschreibung
 Die Regeln der deutschen Rechtschreibung Vollständig und verständlich dargeboten von Klaus Heller OLMS- WEIDMANN 1 Grundsätzliches 11 1.1 Schreibung und Lautung 11 1.2 Schreibung und Bedeutung 12 2 Die
Die Regeln der deutschen Rechtschreibung Vollständig und verständlich dargeboten von Klaus Heller OLMS- WEIDMANN 1 Grundsätzliches 11 1.1 Schreibung und Lautung 11 1.2 Schreibung und Bedeutung 12 2 Die
KAPITEL V DIE SCHLUSSFOLGERUNG
 A. Schlussfolgerung KAPITEL V DIE SCHLUSSFOLGERUNG Basierend auf dem Ergebnis der Untersuchung werden die folgenden Schlussfolgerung gezogen: 1. Die Strukturbildung der Nomenkomposita, die es In der deutschen
A. Schlussfolgerung KAPITEL V DIE SCHLUSSFOLGERUNG Basierend auf dem Ergebnis der Untersuchung werden die folgenden Schlussfolgerung gezogen: 1. Die Strukturbildung der Nomenkomposita, die es In der deutschen
ABSCHNITT I EINLEITUNG
 1 ABSCHNITT I EINLEITUNG A. Hintergrund des Problems Sprache wird von allen genutzt, um ihre Wünsche, Ideen und Überlegungen zu äußern. Außerdem benutzen Menschen auch Sprache, damit sie miteinander in
1 ABSCHNITT I EINLEITUNG A. Hintergrund des Problems Sprache wird von allen genutzt, um ihre Wünsche, Ideen und Überlegungen zu äußern. Außerdem benutzen Menschen auch Sprache, damit sie miteinander in
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der infiniten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der infiniten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestmung der Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestmung der Verben An anderer Stelle diente der unten stehende Text bereits zur Bestmung der Formen des. Unterstreiche
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestmung der Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestmung der Verben An anderer Stelle diente der unten stehende Text bereits zur Bestmung der Formen des. Unterstreiche
Morphologie III. Speicherung und Verarbeitung im Lexikon Komposition Verbale Wortbildung Konversion. Morphologie III 1
 Morphologie III Speicherung und Verarbeitung im Lexikon Komposition Verbale Wortbildung Konversion Morphologie III 1 Speicherung im Lexikon Im Lexikon sind freie Morpheme (Haus, rot, nur), aber auch sogenannte
Morphologie III Speicherung und Verarbeitung im Lexikon Komposition Verbale Wortbildung Konversion Morphologie III 1 Speicherung im Lexikon Im Lexikon sind freie Morpheme (Haus, rot, nur), aber auch sogenannte
Morphologie. 1. Flexion und Derivation 2. Analyse mittels lexikalischer Regeln
 Morphologie 1. Flexion und Derivation 2. Analyse mittels lexikalischer Regeln Morphologie Flexion Deklination Flexion der Nomina: Deklination Hund Hund-es Hund-e Hund-en (Stamm + Suffix) Mann Mann-es Männ-er
Morphologie 1. Flexion und Derivation 2. Analyse mittels lexikalischer Regeln Morphologie Flexion Deklination Flexion der Nomina: Deklination Hund Hund-es Hund-e Hund-en (Stamm + Suffix) Mann Mann-es Männ-er
Flexion. Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman Derivationsmorphem vs. Flexionsmorphem
 Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman 23.11.04 vs. Wortbildung (1)a. [saft - ig] b. [[An - geb] - er] Derivationsmorphem vs. smorphem (4)a. Angeber - saftiger b. saftig - Safts c.
Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman 23.11.04 vs. Wortbildung (1)a. [saft - ig] b. [[An - geb] - er] Derivationsmorphem vs. smorphem (4)a. Angeber - saftiger b. saftig - Safts c.
2 Sprachliche Einheiten
 2 Sprachliche Einheiten Inhalt Semiotische Begriffe Wörter Wortbestandteile Wortzusammensetzungen Wortgruppen Text und Dialog Wort- und Satzbedeutung 2.1 Semiotische Begriffe Semiotische Begriffe Semiotik
2 Sprachliche Einheiten Inhalt Semiotische Begriffe Wörter Wortbestandteile Wortzusammensetzungen Wortgruppen Text und Dialog Wort- und Satzbedeutung 2.1 Semiotische Begriffe Semiotische Begriffe Semiotik
Morphologie II. Morphologische Grundbegriffe Typen der Wortbildung Wortstruktur Wortbildungsregeln. Morphologie II 1
 Morphologie II Morphologische Grundbegriffe Typen der Wortbildung Wortstruktur Wortbildungsregeln Morphologie II 1 Terminologie Morphem: kleinste bedeutungstragende Einheit: Haus, auf, rot. Silbe: Silben
Morphologie II Morphologische Grundbegriffe Typen der Wortbildung Wortstruktur Wortbildungsregeln Morphologie II 1 Terminologie Morphem: kleinste bedeutungstragende Einheit: Haus, auf, rot. Silbe: Silben
Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 4b 1 Morphologische Analyse:
 Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 4b 1 Morphologische Analyse: Segmentieren in Morphe (gegebenenfalls) Zusammenfassen von Morphen als Realisierungen eines Morphems Erfassen von Allomorphie-Beziehungen (Art
Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 4b 1 Morphologische Analyse: Segmentieren in Morphe (gegebenenfalls) Zusammenfassen von Morphen als Realisierungen eines Morphems Erfassen von Allomorphie-Beziehungen (Art
Thema der Sitzung : Verfahren I (Komposition)
 Germanistisches Institut der Ruhr-Universität Bochum Stundenprotokoll Übung: Wortbildung des Deutschen Sitzung am 12.11.2003 Dozent: Daniel Händel M.A. Protokollantin: Elvisa Eminic Thema der Sitzung :
Germanistisches Institut der Ruhr-Universität Bochum Stundenprotokoll Übung: Wortbildung des Deutschen Sitzung am 12.11.2003 Dozent: Daniel Händel M.A. Protokollantin: Elvisa Eminic Thema der Sitzung :
PS Lexikologie. Sitzung 10 & 11: Wortbildungstypen Flexion, Derivation, Komposition Verschiedene Typen von Affixen Konversion.
 PS Lexikologie Sitzung 10 & 11: Wortbildungstypen Flexion, Derivation, Komposition Verschiedene Typen von Affixen Konversion Sitzung 10 1 PS Lexikologie Bisher haben wir hauptsächlich die Zusammensetzung
PS Lexikologie Sitzung 10 & 11: Wortbildungstypen Flexion, Derivation, Komposition Verschiedene Typen von Affixen Konversion Sitzung 10 1 PS Lexikologie Bisher haben wir hauptsächlich die Zusammensetzung
Neue Rechtschreibung
 Neue Rechtschreibung Sie finden hier eine Zusammenfassung der Regeln, durch die es nach der Rechtschreibreform vom 1. August 2006 zu Neuschreibungen kommt. Änderungen betreffen die Bereiche Getrennt- und
Neue Rechtschreibung Sie finden hier eine Zusammenfassung der Regeln, durch die es nach der Rechtschreibreform vom 1. August 2006 zu Neuschreibungen kommt. Änderungen betreffen die Bereiche Getrennt- und
Deutsche Grammatik Grundfragen und Abriß
 Gerhard Heibig Deutsche Grammatik Grundfragen und Abriß iudicium vertag INHALTSVERZEICHNIS 1. ZUM BEGRIFF DER GRAMMATIK 11 2. DAS WORT 14 2.1. Wortarteneinteilung 14 2.1.1. Kriterien für die Wortartenklassifizierung
Gerhard Heibig Deutsche Grammatik Grundfragen und Abriß iudicium vertag INHALTSVERZEICHNIS 1. ZUM BEGRIFF DER GRAMMATIK 11 2. DAS WORT 14 2.1. Wortarteneinteilung 14 2.1.1. Kriterien für die Wortartenklassifizierung
Grammatik des modernen Chinesisch
 Grammatik des modernen Chinesisch von Manfred und Shuxin Reichardt Verlag Enzyklopädie Leipzig Vorbemerkungen 11 Abkürzungen und Symbole 14 1 Wortklassen im Chinesischen 15 1.1. Vollwörter und Hilfswörter
Grammatik des modernen Chinesisch von Manfred und Shuxin Reichardt Verlag Enzyklopädie Leipzig Vorbemerkungen 11 Abkürzungen und Symbole 14 1 Wortklassen im Chinesischen 15 1.1. Vollwörter und Hilfswörter
3 Art des Leistungsnachweises: 80 % Vortragender/ Vortragende:
 Titel des Kurses Morphologie 1 3 Art des Morphologie als eine der grundlegenden linguistischen Disziplinen. Die Seminare geben einen Überblick über das deutsche Verb: Klassifikation von Verben und ihre
Titel des Kurses Morphologie 1 3 Art des Morphologie als eine der grundlegenden linguistischen Disziplinen. Die Seminare geben einen Überblick über das deutsche Verb: Klassifikation von Verben und ihre
Romanische Wortbildung
 Jens Lüdtke Romanische Wortbildung Inhaltlich -jdiachronisch - synchronisch STAÜEEENBURG PRLAG INHALT Abkürzungen x Vorwort '. 1 0. Einleitung.' 3 1. Allgemeine Grundlagen 7 1.1. Wortbildung und sprachliche
Jens Lüdtke Romanische Wortbildung Inhaltlich -jdiachronisch - synchronisch STAÜEEENBURG PRLAG INHALT Abkürzungen x Vorwort '. 1 0. Einleitung.' 3 1. Allgemeine Grundlagen 7 1.1. Wortbildung und sprachliche
Tokenisierung und Lemmatisierung in Suchmaschinen
 Tokenisierung und Lemmatisierung in Suchmaschinen Hauptseminar Suchmaschinen Computerlinguistik Sommersemester 2010 Stefan Langer stefan.langer@cis.uni-muenchen.de Übung: Tokenisierung (5 min) Was ist
Tokenisierung und Lemmatisierung in Suchmaschinen Hauptseminar Suchmaschinen Computerlinguistik Sommersemester 2010 Stefan Langer stefan.langer@cis.uni-muenchen.de Übung: Tokenisierung (5 min) Was ist
Einleitung 3. s Die unpersönlichen Sätze 14 Übungen Die bejahenden und die verneinenden Sätze 17 Übungen 20
 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 3 Kapitel I Der einfache Satz 1. Allgemeines 4 2. Der Aussagesatz, der Fragesatz und der Aufforderungssatz 5 6 3. Stellung der Nebenglieder des Satzes 8 1 9 4. Die unbestimmt-persönlichen
INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 3 Kapitel I Der einfache Satz 1. Allgemeines 4 2. Der Aussagesatz, der Fragesatz und der Aufforderungssatz 5 6 3. Stellung der Nebenglieder des Satzes 8 1 9 4. Die unbestimmt-persönlichen
Fortsetzung: Worin die Struktur von Konstruktionen besteht. kleinste (grammatische) Bausteine: Morpheme, realisiert durch (Allo-)Morphe;
 Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 5a 1 Fortsetzung: Worin die Struktur von Konstruktionen besteht kleinste (grammatische) Bausteine: Morpheme, realisiert durch (Allo-)Morphe; Konstruktionen mit diesen Bausteinen,
Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 5a 1 Fortsetzung: Worin die Struktur von Konstruktionen besteht kleinste (grammatische) Bausteine: Morpheme, realisiert durch (Allo-)Morphe; Konstruktionen mit diesen Bausteinen,
HPSG. Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer
 HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
Wortbildung des Deutschen Robert J. Pittner
 Wortbildung des Deutschen Robert J. Pittner Möglichkeiten den Wortschatz einer Sprache zu erweitern: -Urschöpfung -Entlehnung -Bedeutungswandel -Wort(stamm)bildung: Neukombination bereits vorhandener Einheiten
Wortbildung des Deutschen Robert J. Pittner Möglichkeiten den Wortschatz einer Sprache zu erweitern: -Urschöpfung -Entlehnung -Bedeutungswandel -Wort(stamm)bildung: Neukombination bereits vorhandener Einheiten
Was ist ein Wort? Morphologie I Einf. in die Linguistik
 Morphologie I Einf. in die Linguistik Was ist ein Wort? Ich will Rad fahren Ich will radfahren Ich will Räder fahren *Ich will räderfahren 1 Wenn es flektiert ist, ist es ein Wort. (und wenn es keine sichtbare
Morphologie I Einf. in die Linguistik Was ist ein Wort? Ich will Rad fahren Ich will radfahren Ich will Räder fahren *Ich will räderfahren 1 Wenn es flektiert ist, ist es ein Wort. (und wenn es keine sichtbare
Grammatik des Standarddeutschen. Michael Schecker
 Grammatik des Standarddeutschen Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente Tempora
Grammatik des Standarddeutschen Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente Tempora
Verlaufsform. Verlaufsform. Aufbau (Zusammensetzung) Gliederung. Verlaufsform. Ähnliche Phänomene. Einleitung Geschichte der Verlaufsform :
 Ruhr-Universität Bochum Germanistisches Institut Hauptseminar WS `04/`05 Dozentin: Dr. Pittner Referentinnen: Victoria Gilmuddinova, Nadine Herbst & Julia Kunze Verlaufsform Gliederung Einleitung Geschichte
Ruhr-Universität Bochum Germanistisches Institut Hauptseminar WS `04/`05 Dozentin: Dr. Pittner Referentinnen: Victoria Gilmuddinova, Nadine Herbst & Julia Kunze Verlaufsform Gliederung Einleitung Geschichte
Überblick Wortarten (Einteilung nach Formveränderung bzw. Flexion)
 Überblick Wortarten (Einteilung nach Formveränderung bzw. Flexion) Flektierbar (veränderlich) nicht flektierbar (Partikeln) konjugierbar deklinierbar komparierbar nach Person und Zahl veränderbar Beugen
Überblick Wortarten (Einteilung nach Formveränderung bzw. Flexion) Flektierbar (veränderlich) nicht flektierbar (Partikeln) konjugierbar deklinierbar komparierbar nach Person und Zahl veränderbar Beugen
Masarykova Univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
 Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Bc. Markéta Dovrtělová Problematik der Übersetzung von nominalen Komposita in Texten aus dem Bereich der deutschen
Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Bc. Markéta Dovrtělová Problematik der Übersetzung von nominalen Komposita in Texten aus dem Bereich der deutschen
Wortbildungsmorphologie. Morphologie. Flexion: Bildung der Wortformen eines Worts (aus einer Wurzel oder einem Stamm)
 Wörter und ihre Teile: Morphologie Wortbildung Morphologie Flexion: Bildung der Wortformen eines Worts (aus einer Wurzel oder einem Stamm) Wortbildung: Wortschatzerweiterung durch vorhandenes Sprachmaterial
Wörter und ihre Teile: Morphologie Wortbildung Morphologie Flexion: Bildung der Wortformen eines Worts (aus einer Wurzel oder einem Stamm) Wortbildung: Wortschatzerweiterung durch vorhandenes Sprachmaterial
Landesaktionsplan Schleswig-Holstein
 Einleitung Landesaktionsplan Schleswig-Holstein Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und allen Menschen soll es gut gehen. Deshalb gibt es in Deutschland viele Regeln und Gesetze. Und auch in vielen
Einleitung Landesaktionsplan Schleswig-Holstein Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und allen Menschen soll es gut gehen. Deshalb gibt es in Deutschland viele Regeln und Gesetze. Und auch in vielen
Das Nomen (= Namenwort = Substantiv)
 1 Grammatik Wortarten Das Nomen (= Namenwort = Substantiv) 1.Es gibt 3 Geschlechter (= Genus) Maskulin (= männlich) : der Feminin (= weiblich): die Neutrum (= sächlich) :das Bei vielen Wörtern kann man
1 Grammatik Wortarten Das Nomen (= Namenwort = Substantiv) 1.Es gibt 3 Geschlechter (= Genus) Maskulin (= männlich) : der Feminin (= weiblich): die Neutrum (= sächlich) :das Bei vielen Wörtern kann man
Pluralbildung VORSCHAU. Demonstrativartikel. Unbestimmter Artikel ein und kein im Nominativ und Akkusativ. Artikel im Dativ
 Inhaltsübersicht Seite Titel / Thema Hilfsmaterialien 3 der Schüler die Schülerin Bestimmung des Genus bei Personen Wortschatzbox 1, Infobox 1 und 2 4 der Fußball die Fußballmannschaft Erkennung des Genus
Inhaltsübersicht Seite Titel / Thema Hilfsmaterialien 3 der Schüler die Schülerin Bestimmung des Genus bei Personen Wortschatzbox 1, Infobox 1 und 2 4 der Fußball die Fußballmannschaft Erkennung des Genus
Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache
 Katja Kessel/Sandra Reimann Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache A. Francke Verlag Tübingen und Basel Inhalt Vorwort XI I. Syntax 1. Was ist ein Satz? Zur Satzdefinition 1 2. Das Verb 2 3. Satzklassifikation
Katja Kessel/Sandra Reimann Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache A. Francke Verlag Tübingen und Basel Inhalt Vorwort XI I. Syntax 1. Was ist ein Satz? Zur Satzdefinition 1 2. Das Verb 2 3. Satzklassifikation
Syntax und Morphologie. Einführungskurs 2. Vorlesung
 Syntax und Morphologie Einführungskurs 2. Vorlesung Grundbegriffe der Morphologie Gliederung Überblick über die traditionelle Sprachtypologie Der Wortbegriff Morpheme als Einheiten der Wortstruktur Morphemklassifikation
Syntax und Morphologie Einführungskurs 2. Vorlesung Grundbegriffe der Morphologie Gliederung Überblick über die traditionelle Sprachtypologie Der Wortbegriff Morpheme als Einheiten der Wortstruktur Morphemklassifikation
Fugenelemente oder Kompositionsstammformen?
 Fugenelemente oder Kompositionsstammformen? Referat: Fugenelemente oder Kompositionsstammformen Antje Herold-Langer, Angelika Port, Silke Peters, Pauline Villentschuk, Stefan Büch, Sascha Filyuta Lehrstuhl
Fugenelemente oder Kompositionsstammformen? Referat: Fugenelemente oder Kompositionsstammformen Antje Herold-Langer, Angelika Port, Silke Peters, Pauline Villentschuk, Stefan Büch, Sascha Filyuta Lehrstuhl
Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik
 Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Der leckere Käse schmeckt dem kleinen Mäuschen sehr gut.
 Adjektiv (Wie-Wort, Eigenschaftswort) Adjektive geben deinem Satz Farbe. Sie begleiten das Nomen, beschreiben es haargenau oder drücken Empfindungen aus. Du benötigst sie in Erzählungen und Beschreibungen.
Adjektiv (Wie-Wort, Eigenschaftswort) Adjektive geben deinem Satz Farbe. Sie begleiten das Nomen, beschreiben es haargenau oder drücken Empfindungen aus. Du benötigst sie in Erzählungen und Beschreibungen.
Crowd Guru Häufige Fehler beim Erstellen von Texten
 Crowd Guru Häufige Fehler beim Erstellen von Texten Im Folgenden sind Fehler aufgelistet, die häufig in Texten im Crowdmodul zu finden sind. Fehler I Fehler II Anführungszeichen Der Gedankenstrich/ Der
Crowd Guru Häufige Fehler beim Erstellen von Texten Im Folgenden sind Fehler aufgelistet, die häufig in Texten im Crowdmodul zu finden sind. Fehler I Fehler II Anführungszeichen Der Gedankenstrich/ Der
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie (morphembasiert mit Transduktoren)
 Einführung in die Computerlinguistik Morphologie (morphembasiert mit Transduktoren) Dozentin: Wiebke Petersen 7. Foliensatz Wiebke Petersen Einführung CL 1 Morphologische Grundbegrie Wort / Lexem: abstrakte
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie (morphembasiert mit Transduktoren) Dozentin: Wiebke Petersen 7. Foliensatz Wiebke Petersen Einführung CL 1 Morphologische Grundbegrie Wort / Lexem: abstrakte
Die Grammatik. sowie ausführlichem Register. Auflage
 Die Grammatik Unentbehrlich für richtiges Deutsch Umfassende Darstellung des Aufbaus der deutschen Sprache vom Laut über das Wort und den Satz bis hin zum Text und zu den Merkmalen der gesprochenen Sprache
Die Grammatik Unentbehrlich für richtiges Deutsch Umfassende Darstellung des Aufbaus der deutschen Sprache vom Laut über das Wort und den Satz bis hin zum Text und zu den Merkmalen der gesprochenen Sprache
PS Lexikologie. Quiz Einführung Terminologie. PS Lexikologie 1
 Quiz Einführung Terminologie PS Lexikologie 1 Was ist ein Wort? Wieviele Wörter hat der folgende Satz? Katharina hat den Kühlschrank nicht zugemacht. PS Lexikologie 2 Kommt drauf an! Wir unterscheiden
Quiz Einführung Terminologie PS Lexikologie 1 Was ist ein Wort? Wieviele Wörter hat der folgende Satz? Katharina hat den Kühlschrank nicht zugemacht. PS Lexikologie 2 Kommt drauf an! Wir unterscheiden
Morphologie. Dazu gehört auch: Wortarten und ihre Einteilung. Morphologie ist die Lehre vom Strukturaufbau der Wörter.
 Wörter und ihre Teile: Morphologie Flexion Morphologie von Goethe geprägter Begriff für Form und Struktur lebender Organismen im 19. Jh. in die Sprachwissenschaft übernommen Morphologie ist die Lehre vom
Wörter und ihre Teile: Morphologie Flexion Morphologie von Goethe geprägter Begriff für Form und Struktur lebender Organismen im 19. Jh. in die Sprachwissenschaft übernommen Morphologie ist die Lehre vom
1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988)
 Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Partizip als Adjektiv
 Partizip als Adjektiv Media: TV, newspapers, radio Grammar & Structure Level B1 www.lingoda.com 1 Partizip als Adjektiv Leitfaden Inhalt In dieser Lektion erfahrt ihr mehr über die Bildung und den Gebrauch
Partizip als Adjektiv Media: TV, newspapers, radio Grammar & Structure Level B1 www.lingoda.com 1 Partizip als Adjektiv Leitfaden Inhalt In dieser Lektion erfahrt ihr mehr über die Bildung und den Gebrauch
Stichwortverzeichnis. Anhang. Bedingungssatz siehe Konditionalsatz Befehlsform
 Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Definition. Zusammenwachsen/-schmelzung zweier oder mehrerer Wörter zu einem einzigen Wort
 Univerbierung Definition Zusammenwachsen/-schmelzung zweier oder mehrerer Wörter zu einem einzigen Wort Wörter werden häufig nebeneinander gebraucht handhaben, aufgrund, mithilfe, anstelle, infrage, zugunsten,
Univerbierung Definition Zusammenwachsen/-schmelzung zweier oder mehrerer Wörter zu einem einzigen Wort Wörter werden häufig nebeneinander gebraucht handhaben, aufgrund, mithilfe, anstelle, infrage, zugunsten,
1 Das Geschlecht der Substantive
 1 Das Geschlecht der Substantive NEU Im Deutschen erkennst du das Geschlecht (Genus) der Substantive am Artikel: der (maskulin), die (feminin) und das (neutral). Das Russische kennt zwar keinen Artikel,
1 Das Geschlecht der Substantive NEU Im Deutschen erkennst du das Geschlecht (Genus) der Substantive am Artikel: der (maskulin), die (feminin) und das (neutral). Das Russische kennt zwar keinen Artikel,
2 ARISTRANS WÖRTERBUCHAKTUALISIERUNG Morphologiereihen Semantische Angaben Verben...
 Seite 10 Schwanke: Sprachdidaktik und Computer Inhalt VORWORT... 9 INHALT... 10 1 EINLEITUNG... 13 2 ARISTRANS... 16 2.1 WÖRTERBUCHAKTUALISIERUNG... 17 2.1.1 Morphologiereihen... 19 2.1.2 Semantische Angaben...
Seite 10 Schwanke: Sprachdidaktik und Computer Inhalt VORWORT... 9 INHALT... 10 1 EINLEITUNG... 13 2 ARISTRANS... 16 2.1 WÖRTERBUCHAKTUALISIERUNG... 17 2.1.1 Morphologiereihen... 19 2.1.2 Semantische Angaben...
Inhalt. Vorwort Verbreitung und Gliederung des Deutschen Transkription 3. A Die Standardaussprache in Deutschland 3
 Vorwort V Verbreitung und Gliederung des Deutschen i Transkription 3 A Die Standardaussprache in Deutschland 3 1 Standardaussprache - Begriff und Funktionen 6 2 Geschichte, Grundsätze und Methoden der
Vorwort V Verbreitung und Gliederung des Deutschen i Transkription 3 A Die Standardaussprache in Deutschland 3 1 Standardaussprache - Begriff und Funktionen 6 2 Geschichte, Grundsätze und Methoden der
Die Betonung der Wörter
 Die Betonung der Wörter I. Anmerkungen zur Notation Der Vokal der betonten Silbe wird markiert. EH]HLFKQHWHLQHQkurzen Vokal, einen langen Vokal. Bei Diphtongen (au, äu, eu, ei) spielt die Unterscheidung
Die Betonung der Wörter I. Anmerkungen zur Notation Der Vokal der betonten Silbe wird markiert. EH]HLFKQHWHLQHQkurzen Vokal, einen langen Vokal. Bei Diphtongen (au, äu, eu, ei) spielt die Unterscheidung
Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik
 Hans-Rüdiger Fluck Unter Mitarbeit von Jü Jianhua, Wang Fang, Yuan Jie Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik Einführung in die Fachsprachen und die Didaktik/Methodik des fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
Hans-Rüdiger Fluck Unter Mitarbeit von Jü Jianhua, Wang Fang, Yuan Jie Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik Einführung in die Fachsprachen und die Didaktik/Methodik des fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
Die Partikeln. Adverbien Präpositionen Konjunktionen
 Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
DUDEN. Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. Regeln, Kommentar und Verzeichnis wichtiger Neuschreibungen. von Peter Gallmann und Horst Sitta
 DUDEN Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung Regeln, Kommentar und Verzeichnis wichtiger Neuschreibungen von Peter Gallmann und Horst Sitta DUDENVERLAG Mannheim Leipzig Wien Zürich Inhaltsverzeichnis
DUDEN Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung Regeln, Kommentar und Verzeichnis wichtiger Neuschreibungen von Peter Gallmann und Horst Sitta DUDENVERLAG Mannheim Leipzig Wien Zürich Inhaltsverzeichnis
Syntax und Morphologie. Einführungskurs. Vorlesung
 Syntax und Morphologie Einführungskurs. Vorlesung Wortbildung WBK und Wortgruppe (I) Zwei Arten der Verknüpfung von Zeichen: Syntaktische Verbindung als Wortgruppe oder Satz Wortbildungskonstruktion (WBK)
Syntax und Morphologie Einführungskurs. Vorlesung Wortbildung WBK und Wortgruppe (I) Zwei Arten der Verknüpfung von Zeichen: Syntaktische Verbindung als Wortgruppe oder Satz Wortbildungskonstruktion (WBK)
MORPHOLOGIE: WORTBILDUNG UND FLEXION. Untersuchungsgegenstand der Morphologie ist die interne Struktur der Wörter.
 Prof. Dr. Beatrice Primus Seminarunterlagen SoSe 2008 1 MORPHOLOGIE: WORTBILDUNG UND FLEXION Vorbereitung: Grewendorf et al. Kap. V; Vater Kap. 3; Meibauer et al. Kap. 2, Brandt et al. Kap. 13 Untersuchungsgegenstand
Prof. Dr. Beatrice Primus Seminarunterlagen SoSe 2008 1 MORPHOLOGIE: WORTBILDUNG UND FLEXION Vorbereitung: Grewendorf et al. Kap. V; Vater Kap. 3; Meibauer et al. Kap. 2, Brandt et al. Kap. 13 Untersuchungsgegenstand
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Alles über Wortarten - Grundlagen der deutschen Grammatik verstehen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Alles über Wortarten - Grundlagen der deutschen Grammatik verstehen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Alles über Wortarten - Grundlagen der deutschen Grammatik verstehen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Segmentierung (Beispielanalyse)
 Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Di. 12:15-13:45 Do.! 12:15-13:45 Fr.! 12:15-13:45 Infos etc. http://ling.uni-konstanz.de => Lehre Einführung in die Linguistik Segmentierung (Beispielanalyse)
Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Di. 12:15-13:45 Do.! 12:15-13:45 Fr.! 12:15-13:45 Infos etc. http://ling.uni-konstanz.de => Lehre Einführung in die Linguistik Segmentierung (Beispielanalyse)
Fremdwörter in der Jugendsprache
 Miwako Oda Fremdwörter in der Jugendsprache 1.Thema In letzter Zeit ändern sich Moden sehr schnell. Unter Jugendlichen kann man das deutlich erkennen: Musik, Kleidung, Frisur, Fernsehschauspieler und so
Miwako Oda Fremdwörter in der Jugendsprache 1.Thema In letzter Zeit ändern sich Moden sehr schnell. Unter Jugendlichen kann man das deutlich erkennen: Musik, Kleidung, Frisur, Fernsehschauspieler und so
Wortarten I: Die Deklinierbaren
 Wortarten I: Die Deklinierbaren 1.) Substantive: Morphologische Grundmerkmale: 1.) Zugehörigkeit zu jeweils bestimmten Typenklassen der Deklination und der Pluralbildung. 2.) Festes Genus. Syntaktisches
Wortarten I: Die Deklinierbaren 1.) Substantive: Morphologische Grundmerkmale: 1.) Zugehörigkeit zu jeweils bestimmten Typenklassen der Deklination und der Pluralbildung. 2.) Festes Genus. Syntaktisches
in der deutschen Sprache Eine theoretische Forschungsarbeit Vorgelegt von Sawsan Kasim Neaama Al-Badri
 Eine theoretische Forschungsarbeit Vorgelegt von Sawsan Kasim Neaama Al-Badri 1. Einleitung 1.1. Ziele und Problemstellung der Arbeit Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bildung neuer Wörter
Eine theoretische Forschungsarbeit Vorgelegt von Sawsan Kasim Neaama Al-Badri 1. Einleitung 1.1. Ziele und Problemstellung der Arbeit Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bildung neuer Wörter
Begriffsammlung Deutsch. Das kleine Huser sche Nachschlagewerk
 Begriffsammlung Deutsch Das kleine Huser sche Nachschlagewerk Erklärungen zu folgenden Begriffen Singular Plural Imperativ Verbale Wortkette Wortarten maskulin feminin neutrum Infinitiv Partizip 2 Weiter
Begriffsammlung Deutsch Das kleine Huser sche Nachschlagewerk Erklärungen zu folgenden Begriffen Singular Plural Imperativ Verbale Wortkette Wortarten maskulin feminin neutrum Infinitiv Partizip 2 Weiter
Wort. nicht flektierbar. flektierbar. Satzgliedwert. ohne Satzwert. mit Fügteilcharakter. ohne. Fügteilcharakter
 Wort flektierbar nicht flektierbar mit Satzwert ohne Satzwert mit Satzgliedwert ohne Satzgliedwert mit Fügteilcharakter ohne Fügteilcharakter mit Kasusforderung ohne Kasusforderung Modalwort Adverb Präposition
Wort flektierbar nicht flektierbar mit Satzwert ohne Satzwert mit Satzgliedwert ohne Satzgliedwert mit Fügteilcharakter ohne Fügteilcharakter mit Kasusforderung ohne Kasusforderung Modalwort Adverb Präposition
Rechtschreibung und Grammatik Der praktische Grundlagen-Ratgeber
 Mit zahlreichen Tipps zu Zweifelsfällen Ratgeber Rechtschreibung und Grammatik Der praktische Grundlagen-Ratgeber Grundlagen Achtung! Bei einer Substantivierung werden beide Wörter zusammengeschrieben,
Mit zahlreichen Tipps zu Zweifelsfällen Ratgeber Rechtschreibung und Grammatik Der praktische Grundlagen-Ratgeber Grundlagen Achtung! Bei einer Substantivierung werden beide Wörter zusammengeschrieben,
Fremde Elemente in Wortbildungen des Deutschen
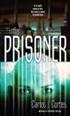 Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik 10 Fremde Elemente in Wortbildungen des Deutschen Zu Hybridbildungen in der deutschen Gegenwartssprache am Beispiel einer raumgebundenen Untersuchung
Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik 10 Fremde Elemente in Wortbildungen des Deutschen Zu Hybridbildungen in der deutschen Gegenwartssprache am Beispiel einer raumgebundenen Untersuchung
