Zeittafel. Friedrich Gok April: Geburt der Schwester Johanna Christiana. 3. November: Tod der Urgroßmutter Sutor.
|
|
|
- Simon Fuchs
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 513 Zeittafel 1770 Lauffen 20. März: H. in Lauffen am Neckar als erstes Kind von Heinrich Friedrich Hölderlin, geb , und Johanna Christiana Heyn, geb , geboren. 21. März: Taufe auf den Namen Johann Christian Friedrich April: Geburt der Schwester Johanna Christiana Friederike. 3. November: Tod der Urgroßmutter Sutor Juli: Plötzlicher Tod des Vaters nach einem Schlaganfall. 7. Juli: Begräbnis des Vaters. Die ältere, ebenfalls verwitwete Schwester des Vaters, Elisabeth von Lohenschiold (geb. 1732), zieht zu ihrer Schwägerin. 15. August: Geburt der Schwester Maria Eleonora Heinrike (»Rike«). 25. September: Tod des Großvaters Heyn Mai: auf Grund der von der Mutter wegen ihrer Absicht, sich mit Johann Christoph Go[c]k zu vermählen, in Lauffen beantragten Inventur und»eventualteilung«(des Vermögens zwischen der Mutter und den Kindern) werden dem Sohn 2230 Gulden zugesprochen. Dieses Vermögen wird fortan von der Mutter für den Sohn, der niemals eine eigene Verfügung darüber fordern wird, verwaltet. 30. Juni: Gok erwirbt in Nürtingen den Schweizerhof, ein stattliches Anwesen mit landwirtschaftlichen Gebäuden und Kellern, für 4500 Gulden. 10. Oktober: Heirat der Mutter mit Gok in Nürtingen. Gok beginnt einen Weinhandel, betreibt Landwirtschaft, versieht städische Ämter und wird 1776 Bürgermeister Nürtingen 18. August: Geburt der Schwester Anastasia Carolina Dorothea. 16. November: Tod der am geborenen Schwester Johanna Christiana Friederike. 19. Dezember: Tod der Stiefschwester Anastasia Carolina Dorothea Beginn des Besuchs der Lateinschule in Nürtingen, ergänzt durch Privatunterricht zur Vorbereitung auf das Landexamen, das der Aufnahme in eine der niederen evangelischen Klosterschulen von Württemberg diente. 29. Oktober: Geburt des Stiefbruders Karl Christoph Friedrich Gok Mai: Tod der Tante Elisabeth von Lohenschiold. Von ihrem Vermögen erbt H. ein Viertel, 1393 Gulden. Zusammen mit dem Erbe vom Vater und dem der 1775 verstorbenen Schwester beläuft sich H.s Vermögen auf 4400 Gulden. Aus den Zinsen dieses von der Mutter verwalteten und in Pfandbriefen und Darlehen angelegten Vermögens finanziert sie die Unterhaltszuschüsse H.s. 16./18. November: Geburt, Tod und Begräbnis eines Stiefbruders (anonym) November: Geburt der Stiefschwester Friederike Rosina Christiana. November: Starkes Hochwasser, Gok zieht sich in»der eifrigen Erfüllung seiner Berufspflichten«eine»Brustkrankheit«zu März: Tod des Stiefvaters Gok nach einer Lungenentzündung. Die Großmutter Heyn zieht zu ihrer Tochter Beginn des (privaten) Klavierunterrichts, bald ergänzt durch Flötenunterricht, Mitte September: Erste Absolvierung des Landexamens in Stuttgart zur Aufnahme in eine der ev. Klosterschulen.
2 514 Zeittafel 1782 Täglich eine Stunde Privatunterricht bei Diakonus ( Helfer ) Nathanael Köstlin ( ) und Präzeptor Kraz Bekanntschaft mit dem fünf Jahre jüngeren Schelling, der bei seinem Onkel Köstlin wohnt und ebenfalls die Lateinschule besucht. 9./11. September: Viertes (letztes) Landexamen in Stuttgart. 20. Dezember: Tod der Stiefschwester Friederike Rosina Christiana (Scharlach) April: Konfirmation H.s. 20. Oktober: H. tritt in die niedere Klosterschule in Denkendorf ein. Er unterzeichnet eine Urkunde, mit der er sich verpflichtet, sich»auf keine andere Profession, dann die Theologiam«zu legen. Bald danach legt die Mutter eine Liste an der»ausgaben vor den L. Fritz, welche aber, wann Er im Gehorsam bleibt, nicht sollen abgezogen werden«(von seinem Erbe). Sie trägt die Ausgaben seit 1776 ein und führt die Liste bis fast zu ihrem Tod am 17. Februar 1828 fort März: Lokation auf Grund der Zeugnisse des feierlichen Examens (»Examen solenne«). Unter den 29 Alumnen seines Schuljahrgangs rangiert H. auf Platz Sechs. November: erster erhaltener Brief H.s, zugleich beginnt H. eine handschriftliche Sammlung von Gedichten anzulegen /19. Oktober: Einzug der Promotion (des Schuljahrgangs) H.s in die höhere Klosterschule Maulbronn. Bald danach erste Bekanntschaft mit der jüngsten Tochter des Klosterverwalters, Louise Nast (geb ), mit der sich H. verlobt. 7./8. November: Empfang für den durchreisenden Herzog Karl Eugen von Württemberg, H. trägt sein Huldigungsgedicht an dessen Gattin Franziska vor, 18. Dezember: Erster erhaltener Stammbucheintrag (in dasjenige des Kompromotionalen Johann Christian Rümelin) Januar: Besuch von Louises Vetter Immanuel Nast (geb. 1769) in Maulbronn, eine herzliche Freundschaft zwischen H. und ihm beginnt, um dieselbe Zeit auch Freundschaft mit Franz Karl Hiemer ( ). März: begeisterte Ossian-Lektüre; des weiteren von Klopstock, Schiller, Schubart, Young und Wieland. Sommer: H. ist mehrmals krank, wirft Blut aus. Wiederkehrende Überlegungen, aus dem Kloster auszuscheiden. Schmerzlicher Abschied von Immanuel Nast, der ihn besucht. September: im Zeugnis des Herbstexamens Griechisch, Poesie und Rhetorik»recht gut«, Mathematik»mittelmäßig«, H.s»Gaben«insgesamt als»gut«beurteilt Tübingen 11. Februar: H. hat bei der festlichen Feier des 60. Geburtstages des Herzogs»die Ehre, [ ] als Dichter aufzutreten«. März: Schillers Gedicht Die Götter Griechenlands erscheint in Wielands Teutschem Merkur (vgl. H.s Frühe Hymnen). 18. März: H. reist mit der Mutter zu seiner todkranken Tante Volmar nach Markgröningen, die Tante stirbt am 18. April. April: erneute Lektüre Ossians, erste von Schillers Don Carlos Juni: Reise in die Pfalz. Sommer/Herbst: Anlage des Marbacher Quartheftes. 21. Oktober: Einzug von H.s Promotion ins Tübinger Stift, gleichzeitig von vier Schülern des Stuttgarter Gymnasiums, darunter Hegel. Die ersten zwei Studienjahre gelten der Philosophie, die folgenden drei der Theologie. Professoren: Christian Friedrich Schnurrer (Ephorus), Ludwig Joseph Uhland, Gottlob Christian Storr (Superattendenten). Unter den Repententen ab 1789 Christoph Gottfried Bardili ( , Vetter Schellings) und Karl Philipp Conz ( ). 10. November: Erste Quartalszeugnisse mit Lokation (H. der sechste). 3. Dezember: H. erhält den Grad des Baccalaureus. Winter: Beginn der Freundschaft mit Christian Ludwig Neuffer ( ) und Rudolf Magenau ( ), die bereits seit 1786 im Stift sind.
3 Zeittafel Februar: anläßlich der Hochzeit von Heinrike Nast erster Druck eines (verlorenen) Gedichts H.s. März/April: Lösung des Verlöbnisses mit Louise Nast, die Freundschaft mit Immanuel Nast erlischt ebenfalls. 20./21. April: Besuch bei Neuffer in Stuttgart, Besuch auch bei Christian Friedrich Daniel Schubart ( ), vielleicht auch schon Bekanntschaft mit Gotthold Friedrich Stäudlin ( ). 14. Juli: Sturm auf die Bastille in Paris, Beginn der Französischen Revolution, 26. August Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Sommer: H. erhält Flötenunterricht bei Friedrich Ludwig Dulon. Anfang Oktober Mit Neuffer in Stuttgart, Besuch bei Stäudlin, Bekanntschaft mit den drei Schwestern Stäudlins. 5. November: Herzog Karl Eugen besucht das Stift, Disput mit dem Ephorus und den Repetenten über deren Amt, Karl Eugen mahnt bei den teilweise republikanisch gesinnten Stiftlern»strenge Ordnung und Gesetzlichkeit«an. 16. November: H. werden sechs Stunden Karzer»wegen Ungebühr auf offener Straße«diktiert (er hatte einem Schullehrer, der ihm den Gruß schuldig blieb, den Hut vom Kopf geschlagen). Mitte/Ende November: H. will»wegen des Druks«aus dem Stift heraus und Jura studieren; eine Fußverletzung erlaubt am 24./25. Nov. die Abreise zu einem vierwöchigen Kur-Urlaub nach Nürtingen, am 29. Dez. kehrt H. ins Stift zurück Jahresanfang: Friedrich Philipp Immanuel Niethammer ( ) hospitiert nach dem Konsistorialexamen im Stift, unter seinem Einfluß erste Beschäftigung mit Kant; war der»kantische enragé«carl Immanuel Diez ( ) Repetent im Stift, Johann Friedrich Flatt ( ) vertrat dort einen gemäßigten Kantianismus. 9. März: Nach dem Vorbild der Gelehrtenrepublik Klopstocks Erster»Aldermannstag«der Freunde H., Neuffer und Magenau, bei dem Gedichte vorgetragen und ästhetische Fragen diskutiert wurden. Sommer: Bekanntschaft mit Elise Lebret (geb. 1774), der Tochter des Universitätskanzlers, Vorbereitung auf das Magisterium: H. arbeitet als Specimina Geschichte der schönen Künste unter den Griechen und Parallele zwischen Salomons Sprüchwörtern und Hesiods Werken und Tagen aus. 17. September: Magisterexamen und Abschluß der ersten beiden (der Philosophie und Philologie gewidmeten) Studienjahre. Beginn des Unterrichts in den theologischen Fächern, neben der Lektüre Kants nun auch intensive Beschäftigung mit Leibniz, Herder, Heinse und Jacobi. Oktober: In Stuttgart bei Neuffer, Gespräch mit Stäudlin über die Teilnahme an dessen künftigem Musenalmanach fürs Jahr Oktober: Schon mit 15 Jahren tritt Schelling ins Tübinger Stift ein. Ab Ende Oktober: Wiederbegegnung mit Elise Lebret und Beginn der (schwierigen) Liaison März: In einem Brief an die Schwester dokumentiert H. als seinen derzeitig»höchsten Wunsch«:»in Ruhe und Eingezogenheit einmal zu leben und Bücher schreiben zu können, ohne zu hungern«. April: Mit Christian Friedrich Hiller und Friedrich August Memminger Reise in die Schweiz. Am 19. April Besuch bei Johann Kaspar Lavater in Zürich, H. trägt sich in dessen Fremdenbuch ein, Lavater notiert daneben»nb.«. Wanderungen nach Kloster Einsiedeln, zum Vierwaldstätter See, auf dem Rück- wie auch auf dem Hinweg durchquert H. das Gebiet der oberen Donau. Anfang September: Stäudlins Musenalmanach fürs Jahr 1792 erscheint und in ihm vier Gedichte H.s. Ende September: nach Magenaus vorzeitigem Ausscheiden im Juli verläßt auch Neuffer das Stift und wird Vikar am Waisenhaus in Stuttgart. 10. Oktober: Tod von Christian Daniel Friedrich Schubart. Mitte November: auf den erneuten Wunsch, das Stift zu verlassen, verzichtet H. der Mutter zuliebe, Lektüre Rousseaus, Beschäftigung mit Astronomie, Bezug der Plutarch-Ausgabe von Hutten (deren Band bei Cotta erscheint).
4 516 Zeittafel 1792 Ende Februar: Sorge H.s über zunehmende Repression am Stift durch die Neuen Statuten. Februar: Österreich und Preußen schließen eine Koalition gegen Frankreich. März/April: In Stuttgart im Kreis von Neuffers»Freunden und Freundinnen«Neigung zu einer Unbekannten (»holden Gestalt«). Nicht lange danach entsteht der erste Entwurf zum Hyperion. 20. April: Frankreich erklärt Österreich den Krieg. Durch den Kriegseintritt Preußens kommt es im Juli zum ersten (bis 1797 dauernden) Koalitionskrieg gegen Frankreich. H. sieht die Franzosen als»verfechter der menschlichen Rechte«an. 25. Juli: die Pariser Massen erstürmen die Tuilerien. Sommer: Bekanntschaft mit dem Jura-Studenten Franz Karl Leopold (Leo) von Seckendorf ( ) vermutlich in einem revolutionärpatriotischen Studentenkreis. Hegel gilt zu dieser Zeit als»derber Jakobiner«(auch H. sei»dieser Richtung zugetan«, neigt aber wohl den Girondisten zu). Anfang September: Auf Anstiftung Marats Septembermorde in Paris. 20. September: Kanonade von Valmy, 21. Sept.: Abschaffung des Königtum, die Girondisten treten aus dem Jakobinerklub aus. 22. September: Jahr I der Republik Beginn des (bis 1806 gültigen) republikanischen Kalenders. 9. Oktober: H. nimmt an der Hochzeit der Schwester mit Christoph Matthäus Theodor Breunlin (geb. 1752) in Nürtingen teil und überreicht der Schwester das Pastellbild von Hiemer. 21. Oktober: Besetzung von Mainz durch die französischen Revolutionstruppen, Gefährdung Süddeutschlands. 19. November: Dekret des Konvents, in dem Frankreich allen Völkern, die frei sein wollen, Brüderschaft und Hilfe anbietet Januar: Ludwig XVI. in Paris öffentlich hingerichtet. 6. April: Bildung des Comité du salut public (Wohlfahrtsausschuß, Vorsitzender zunächst Georges Danton). 13. Mai: Verkündung der Neuen Statuten im Stift in Gegenwart des Herzogs und der Herzogin. Kurz zuvor war der»democrata«wetzel aus dem Stift geflohen. 23. Mai: Charlotte von Kalb ( ) bittet Schiller um Hilfe bei der Suche nach einem neuen Hofmeister für ihren neunjährigen Sohn Fritz. 2. Juni: Verhaftung von 29 führenden Girondisten in Paris, an deren Schicksal H. Anteil nimmt. Maximilien de Robespierre löst Danton als Vorsitzender des Wohlfahrtsausschusses ab. Juni: Abschlußexamen von H.s Promotion. 27. Juni: H. trägt Friedrich Matthison, der zusammen mit Neuffer und Stäudlin das Stift besucht, die Hymne Dem Genius der Kühnheit vor. Juli: Enthusiastische Platon-Lektüre (Symposion, Timaios, Phaidros). 13. Juli: Charlotte Corday ermordet Marat. 14. Juli: Angeblich Errichtung eines Freiheitsbaums auf einer Wiese vor Tübingen durch die Stiftler, darunter H., Hegel und Schelling. Ende Juli: H. bezeichnet Marat wie die anderen demagogischen Jakobiner als»schändliche Tyrann(en)«. 5. September: Der Pariser Konvent stimmt systematischen Terrormaßnahmen zu. September: Bekanntschaft mit dem Jura-Studenten Isaac von Sinclair. 19. September: Vorzeitiges Konsistorialexamen Hegels, der eine Hofmeisterstelle in Bern antritt. Abschied von H. mit der»losung: Reich Gottes!«. 20. September: Stäudlin empfiehlt Schiller H. für die Hofmeisterstelle bei der Familie von Kalb. Kurzer Besuch H.s. bei Schiller am 1. Oktober, dieser leitet die Empfehlung weiter. Frau von Kalb stimmt dann bis Ende Oktober zu. 31. Oktober: Hinrichtung der Führer der Gironde. Ende November: Abschied von Magenau. 6. Dezember: Konsistorialexamen in Stuttgart als Abschluß der theologischen Studien und Voraussetzung für die geistliche Laufbahn. Probepredigt über Röm Mitte Dezember: H. verläßt Tübingen, Abschied vermutlich auch von Elise Lebret, Reise über Stuttgart, Nürnberg, Erlangen, Bamberg und Coburg nach Walterhausen. 28. Dezember: Ankunft im Hause von Kalb in Waltershausen.
5 Zeittafel Waltershausen Januar: H. tritt die Hofmeisterstele im Hause von Kalb an und unterrichtet Fritz von Kalb von 9 bis 11 und von 15 bis 17 Uhr. Bekanntschaft mit dem Pfarrer Johann Friedrich Nenninger ( ) und Freundschaft mit Wilhelmine Marianne Kirms ( ), der Gesellschafterin von Charlotte von Kalb. 20. März: H. berichtet Schiller über seine pädagogischen Grundsätze; das Verhältnis zu seinem Zögling wird bald schwieriger. 5. April: Hinrichtung Dantons, organisierter Terror unter der Diktatur Robespierres. Frühsommer/Sommer: intensive Lektüre der»griechen«und Kants, insbesondere der Kritik der Urteilskraft. 8./9. Juni: Reise mit der Familie von Kalb nach Völkershausen in der Rhön. H. wandert anschließend allein durch die Rhön bis Fulda. Sommer: Arbeit am Fragment von Hyperion. 28. Juli: Hinrichtung Robespierres, Gewaltmaßnahmen gegen die militanten Jakobiner (»weißer Terror«). August: Lektüre Fichtes (Charlotte von Kalb erhält dessen wöchentlich erscheinende Vorlesungen zur Wissenschaftslehre zugesandt). November: Reise H.s mit Fritz von Kalb nach Jena (das Verhältnis zwischen Erzieher und Zögling verschlechtert sich in Jena zusehends). Besuche bei Schiller, erste Begegnung mit Goethe. Bekanntschaft mit Sophie Mereau (geb. 1770), häufiger Umgang mit Niethammer. H. besucht täglich Fichtes Vorlesungen. Ende Dezember: H. siedelt mit Charlotte und Fritz von Kalb nach Weimar über. Besuch bei Herder, trifft mit Goethe bei Charlotte von Kalb zusammen Jena Januar: Trennung vom Hause von Kalb in beiderseitigem Einvernehmen. H. kehrt nach Jena zurück und wohnt dort neben Fichtes Haus, der erste Band von Wilhelm Meisters Lehrjahren beeindruckt H., Besuche bei Schiller (wo H. auch»meist Göthen«trifft, vielleicht auch Begegnung mit Wilhelm von Humboldt). 9. März: Schiller empfiehlt Cotta den Verlag des Hyperion, Cotta sagt am zu, seit Anfang des Jahres Arbeit an Hyperions Jugend. März: die intensive Freundschaft mit Isaac von Sinclair beginnt, H. zieht im April in dessen Gartenhaus um, Bekanntschaft auch mit Böhlendorff. 27. März: die Mutter verkauft das Haus in Nürtingen, bewohnt dort aber noch bis Frühjahr 1798 einige Zimmer. Ende März/Anfang April: Siebentägige Fußreise nach Halle (Franckesche Stiftungen, Zentrum des Pietismus), Dessau»herrlicher Tag (in den) Gärten von Luisium und Wörlitz«bei Dessau Leipzig (Besuch des Philosophen Heydenreich und des Verlegers Göschen) und Lützen. 25. April: Tod von Rosine Stäudlin (Neuffers Braut), der H. das Gedicht Freundeswunsch gewidmet hatte. 15. Mai: Eintrag in die Matrikel der Universität Jena. Frühsommer: Im Haus von Niethammer, seit 1793 Professor für Philosophie in Jena, Zusammentreffen mit Fichte und Friedrich von Hardenberg (Novalis). 27. Mai: Studententumult in Jena. Anfang Juni: Plötzlicher Aufbruch H.s aus Jena. Auf der Rückreise trifft H. in Heidelberg den Arzt und Naturforscher Johann Gottfried Ebel ( ), der der Frankfurter Kaufmannsund Bankiersfamilie Gontard nahesteht. Nürtingen Ende Juli: Besuch in Tübingen. H. spricht sich mit Elise Lebret aus, bedeutsames Gespräch mit Schelling, Arbeit an der vorletzten Fassung des Hyperion. August: durch Ebel Angebot der Hofmeisterstelle bei den Gontards. 2. September: H. antwortet mit dem Entwurf eines Erziehungsprogramms, da»in unserer jezigen Welt die Privaterziehung noch beinahe das einzige Asyl wäre, wohin man flüchten könne mit seinen Wünschen und Bemühungen für die Bildung des Menschen«. September: Wiedersehen mit Neuffer in Stuttgart, Bekanntschaft und Freundschaft mit dem Kaufmann Christian Landauer ( ). Anfang Dezember: durch Ebel (die von H. zunehmend ungeduldiger erwartete) Bestätigung der Hofmeisterstelle im Hause Gontard, H. sagt am zu. Mitte Dezember: Besuch Schellings in Nürtingen, Fortsetzung der philosophischen Diskussionen, die»nicht immer accordirend«waren, Aufbruch von Nürtingen.
6 518 Zeittafel 28. Dezember: H. trifft in Frankfurt ein, am 30.12, besucht ihn sein zukünftiger Zögling Henry Gontard, wohl noch am 31. Dezember erster Besuch H.s bei der Familie Gontard im»weißen Hirsch« Frankfurt Januar: Antritt der Hofmeisterstelle im Hause Gontard: Jakob (Cobus) Friedrich Gontard ( ); Susette Gontard, geb. Borkenstein ( ), Mutter von Henry ( ), Henriette, Helene und Amalie Gontard. Die drei Schwestern werden von der aus Bern stammenden Freundin und Gesellschafterin Susette Gontards, Marie Rätzer ( ), erzogen. H. unterrichtet nur vormittags und erhält (bei freier Kost und Logis) 400 Gulden Jahresgehalt. Das Verhältnis zu Henry zeichnet schnell gegenseitige Sympathie aus. Erster Besuch bei Sinclair in Homburg, dort Bekanntschaft mit dem Homburger Hofrat (und Mentor Sinclairs) Franz Wilhelm Jung ( ). April: Schelling auf der Durchreise in Frankfurt. Mai: die Familie Gontard zieht in ein gemietetes Haus auf der Pfingstweide (im Osten der Stadt) um. Hier wohl Beginn der Liebe zwischen H. und Susette Gontard (vgl. die Reimhymne Diotima). Anfang Juli: Vordringen der französischen Armeen, die Sambre-Maas-Armee stößt gegen Frankfurt vor, die Rhein-Mosel-Armee bricht in Württemberg ein. 10. Juli: Flucht der Familie Gontard (ohne den Hausherrn) mit H. und Marie Rätzer über Hanau und Fulda nach Kassel. Am trifft H. dort mit dem mit der Familie Gontard befreundeten Wilhelm Heinse ( ) zusammen: Besuch der Gemäldegalerie und des Fridericianums. 9. August: Weiterreise nach Driburg. Die Flucht, die ursprünglich nach Hamburg, zur Familie von Susette Gontard, führen sollte, wird hier bis Mitte September unterbrochen. Hegel widmet H. Eleusis. 8. September: Sieg des Erzherzogs Karl Eugen von Württemberg über die französischen Truppen, Räumung Frankfurts, im September geht Ebel als überzeugter Republikaner nach Paris. 13. September: Rückreise nach Kassel, Aufenthalt dort bis Ende September September: bei Kehl Selbstmord Stäudlins im Rhein. 20. September: Tod der Mitte Juli 1795 geborenen Tochter von Wilhelmine Marianne Kirms in Meiningen. Ende September: Rückkehr nach Frankfurt, Gontard ist in Nürnberg. Herbst: endgültige Fassung von Hyperion, Bd. I. Oktober: desillusionierter Brief Ebels aus dem Paris des Direktoriums; der Weinhändler (Bilder- und Büchersammler) Johann Noë Gogel ( ) bietet Hegel eine Hofmeisterstelle an, H. übermittelt am 24. Okt. das Angebot, Hegel nimmt es im November an. 20. November: anläßlich der Ablehnung einer Präzeptoratsstelle in Nürtingen der Mutter gegenüber erstes offenes Bekenntnis, daß ihm das poetische Geschäft»durch Natur und Gewohnheit [ ] unentbehrliches Bedürfniß geworden«sei. 21. November: Bitte an den Bruder, die»zwei schwäbischen Almanache«mit den Tübinger Hymnen zum»(d)urchfeilen«zu übersenden Januar: Hegel tritt in Frankfurt seine Hofmeisterstelle bei der Familie Gogel. 30. Januar: H. lehnt erneut eine von der Mutter angeratene Pfarrei ab. April: der erste Band des Hyperion erscheint. Carl Gok besucht H. in Frankfurt, rasche Abreise wegen der Bedrohung Frankfurts durch die Sambre-Maas Armee. 22. April: durch die Ankunft eines Kuriers von Bonaparte wird ein Handstreich der franz. Kavallerie auf das Bockenheimer Tor nur mit Mühe aufgehalten. Mai: die Familie Gontard zieht für den Sommer auf den Adlerflychtschen Hof im Norden der Stadt. 20. Juni: H. sendet Schiller den ersten Band des Hyperion zusammen mit An den Aether und Der Wanderer. 27. Juni: Beginn eines Briefwechsels zwischen Schiller und Goethe: H. wird wie Jean Paul (und Siegfried Schmid, s.u.) als»subjektivistisch«und»überspannt«abgekanzelt. August: Erster Plan zum Empedokles. 22. August: letztes Zusammentreffen mit Goethe, der H. rät»kleine Gedichte zu machen« September: Neuffer und Landauer in Frankfurt, Neuffer bewundert die»hohe Schönheit«Susette Gontards.
7 Zeittafel 519 Oktober: Bekanntschaft mit Siegfried Schmid ( ) aus Friedberg. 17. Oktober: Friede von Campo Formio, nachdem Bonaparte große Teile von Ober- und Mittelitalien erobert hatte, Ende des ersten Koalitionskrieges: Österreich stimmt der Abtretung Belgiens, der Lombardei und des linken Rheinufers zu. Die Entschädigung der betroffenen Fürsten soll auf dem Rastatter Kongreß (bis 1799) geregelt werden, der aber ergebnislos verläuft. 22. Dezember: in Blaubeuren Geburt des zweiten Kindes der Schwester, Fritz: H. wird in absentia Pate. 29. Dezember: Franz Wilhelm Jung bietet Cotta seine Ossian-Übersetzung an und nennt dabei H. als»kompetenten Richter« Februar/März: revolutionäre Bewegungen in der Schweiz, in Italien und auch in Süddeutschland mit dem Ziel einer Alemannischen Republik. März: einsetzende Kritik an dem Milieu (»lauter ungeheure Kartikaturen«) in Frankfurt. Sommer: wieder Umzug auf den Adlerflychtschen Hof, die Situation im Hause Gontard beginnt für H. objektiv krisenhaft zu werden. Von Juni bis August schickt er 18 epigrammatische Oden an Neuffer. Ende September: Trennung vom Hause Gontard. Sinclair besorgt ihm eine Unterkunft in Homburg (bei Glaser Wagner in der Haingasse). Homburg 4./5. Oktober: Erstes Wiedersehen mit Susette Gontard, weitere folgen. Oktober: H. wird am Homburger Hof vorgestellt, die Prinzessin Auguste (von Hessen-Homburg, ) faßt eine schwärmerische Neigung zum»dichter«. November: vermutlich Abschluß der Arbeit am zweiten Band des Hyperion. Auf Einladung Sinclairs kommt H. zum Rastatter Kongreß, Bekanntschaft mit Friedrich Muhrbeck ( ), Fritz Horn ( ), Johann Arnold Joachim von Pommer-Esche ( ) und Johann Heinrich Schenk ( ). 6. Dezember: Treffen mit Susette Gontard. 30. Dezember: H. verfaßt ein (von der Mutter erbetenes) Gedicht zum 73. Geburtstag der Großmutter Heyn Januar: Arbeit am Empedokles (Erster Entwurf). Februar: Sinclair kehrt mit Muhrbeck nach Homburg zurück. Rege, vermutlich politische Diskussionen der drei; Ausbruch des zweiten Koalitionskrieges. 2. März: A.W. Schlegel lobt in einer Rezension (von Neuffers Taschenbuch auf 1799) H.s Gedichte. 11. März/5. April: Treffen mit Susette Gontard. April (bis Ende Juli): Böhlendorff in Homburg, er schreibt über H., dieser sei»republikaner im Geist und in der Wahrheit«. 9. Mai: Treffen mit Susette Gontard. Mai/Juni: Arbeit am Empedokles (Zweiter Entwurf). 4. Juni: an Neuffer Mitteilung des Plans einer»poëtischen Monatschrift«(Iduna), die der Verleger Steinkopf ( ) in Stuttgart übernehmen soll. Steinkopf bittet H., einige»männer mit Namen«zur Mitarbeit einzuwerben das gelingt nicht, im Herbst ist das Projekt gescheitert. 3. Juli: H. schickt (zusammen mit Gedichten Böhlendorffs) die Idylle Emilie vor ihrem Brauttag an Neuffer; einige Gedichte (u.a. Diotima (Jüngere Fassung), Der Tod fürs Vaterland, Der Zeitgeist) schickt er in der zweiten Julihälfte nach, 1. August: Treffen mit Susette Gontard. August: H.s Frankfurter Ersparnisse sind verbraucht, er bedarf wieder der finanziellen Unterstützung durch die Mutter. 5. September: Treffen mit Susette Gontard. September/Oktober: wegen des Scheiterns des Journalplans ist H.»in sehr gedrückter Lage«und erwägt, nach Jena (wegen eines»kleinen Postens«in der Nähe Schillers) oder Stuttgart zu gehen (»um einer kleinen Anzahl junger Leute Privatvorlesungen zu halten«). Ende Oktober: der zweite Band des Hyperion erscheint, flüchtiges Wiedersehen mit Susette Gontard. 7. November: Treffen mit Susette Gontard, H. übergibt ihr den zweiten Band des Hyperion mit der Widmung»Wem sonst als Dir«. 9. November: Staatsstreich vom 18. Brumaire in Paris: Das Direktorium wird aufgelöst, Bonaparte Erster Konsul (»eine Art von Dictator«, so H.). November: Antwort an Ebel zu dessen Bericht aus Paris:»Ihr Urtheil über Paris ist mir sehr nahe
8 520 Zeittafel gegangen«. Das Fazit des Briefs»Glüklich sind wir dann, wenn uns noch eine andere Hofnung bleibt! Wie finden Sie denn die neue Generation, in der Welt, die Sie umgiebt?«formuliert das Zusammentreffen politischer wie biographischer Enttäuschungen:»Manche Erfahrungen [ ] haben mein Zutrauen zu allem, was mir sonst vorzüglich Freude und Hofnung gab, [ ] so ziemlich erschüttert«. Entscheidende Peripetie in H.s Werk. 28. November: H. widmet der Prinzessin Auguste von Homburg zu deren 23. Geburtstag ein Gedicht. 15. Dezember: Bonaparte erklärt die Revolution für»beendet«. Jahreswechsel 1799/1800: H. gibt die Arbeit am Empedokles auf. Den Umbruch und den Neuansatz in H.s Werk, der damit einhergeht, reflektieren insbesondere die theoretischen Fragmente Das untergehende Vaterland (Das Werden im Vergehen) und Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist (Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes) Januar: Landauer (aus geschäftlichen Gründen in Frankfurt) besucht H. in Homburg. 6. Februar: Treffen mit Susette Gontard. 2. März: Tod des Schwagers Breunlin in Blaubeuren. Die Schwester zieht bald darauf mit den Kindern zur Mutter nach Nürtingen. Ostern: H. zu Besuch in Nürtingen. 25. April: General Moreau beginnt am Oberrhein einen Feldzug und dringt nach Schwaben vor. 8. Mai: Am Adlerflychtschen Hof letztes Wiedersehen mit Susette Gontard. 15. Juni: der Friede von Marengo festigt Napoleons Machtstellung (in Frankreich Einführung des zentralistischen Präfektensystems) und läßt H. die baldige Befreiung»von kriegerischen Unruhen«in Württemberg erhoffen. 20. Juni: H. zieht nach einem zehntägigen Aufenthalt in Nürtingen in Landauers Haus nach Stuttgart. Stuttgart Juli: Privatlektionen für die Registratoren Gutscher und Fritsch. Bekanntschaft mit Landauers Bekannten Haug und Huber. H. arbeitet an zahlreichen Oden, hexametrischen Entwürfen und den Elegien. Dezember: Emanuel von Gonzenbach (geb. 1778) aus Hauptwil bietet H. im Auftrag seiner Eltern eine Hofmeisterstelle für seine jüngeren Schwestern an. H. nimmt an, da das Honorar für die Privatlektionen zum Unterhalt nicht ausreicht. 11. Dezember: 31. Geburtstag Landauers. 18. Dezember: der Fabrikant und Kaufherr Anton von Gonzenbach ( ) sagt H. die Hofmeisterstelle in Hauptwil zu. Vor Weihnachten: Abschiedsbesuch in Nürtingen. 25. Dezember: Nach der Niederlage der Österreicher bei Hohenlinden am Waffenstillstand von Steyr, Aussicht auf baldigen Frieden Januar: Von Nürtingen nach Stuttgart. 11. Januar: Aufbruch nach Hauptwil (über Tübingen zu Fuß über Ebingen nach Sigmaringen, von dort»mit einem Gefährt«an den Bodensee nach Überlingen, Überfahrt nach Konstanz, von dort am zu Fuß weiter über Sulgen und Bischofszell nach Hauptwil). H. soll im Hause Gonzenbach die beiden jüngsten Töchter, Barbara Julia (geb. 1786) und Augusta Dorothea (geb. 1787) unterrichten. 9. Februar: Frieden von Lunéville (Bestätigung der Vereinbarungen von Campo Formio) vgl. Friedensfeier. 11./13. April: Kündigung der Hofmeisterstelle, Trennung vom Hause Gonzenbach. H. reist nach Nürtingen ab. Nürtingen 2. Juni: (Letzter) Brief H.s an Schiller und Brief an Niethammer: H. möchte in Jena Vorlesungen über griechische Literatur halten. Die Briefe bleiben ohne Antwort, der Plan wird aufgegeben. Es entstehen die ersten Gesänge. 6. August: Huber teilt H. mit, daß Cotta bereit ist, seine Gedichte zu Ostern 1802 zu verlegen. H. legt Reinschriften (von Oden, Elegien und Gesängen) an, die Buchausgabe kommt jedoch nicht zustande. Herbst: Friedrich Jakob Ströhlin ( ) vermittelt H. eine Hofmeisterstelle in Bordeaux bei dem aus Hamburg stammenden Konsul Daniel Christoph Meyer ( ). Mitte Dezember: nach dem 11. Dez. (Landauers 32. Geburtstag in Stuttgart) von Nürtingen aus Aufbruch nach Bordeaux. Zu Fuß über Tübingen,
9 Zeittafel 521 Horb, Freudenstadt nach Kehl und Straßburg, wo H. am 15. Dez. eintrifft und bis zum 30. Dez. mit der Weiterreise nach Lyon warten muß Januar: H. in Lyon, der Aufenthalt ist behördlicherseits auf vier Tage beschränkt. Von Lyon aus Weiterreise nach Bordeaux (ca. 600 Km), meist zu Fuß auf den Poststraßen über die»gefürchteten überschneiten Höhen der Auvergne«. 28. Januar: Ankunft im Hause des Konsuls Meyer in Bordeaux. H. ist mit seiner Stelle zufrieden:»der Anfang [ ] könnte nicht besser seyn.«möglicherweise beginnt er hier mit der Übersetzung der Trauerspiele des Sophokles. Januar: Ebel kehrt von Paris nach Frankfurt zurück. 14. Februar: Tod der Großmutter Heyn in Nürtingen. 10. Mai: H. läßt sich einen Paß von Bordeaux nach Straßburg ausstellen und trennt sich vom Hause Meyer im beiderseitigen Einvernehmen. Rückweg nach Deutschland über Paris, wo er wahrscheinlich die»antiquen«im Musée Napoléon besichtigt. 7. Juni: H. erhält in Straßburg das Ausreise- Visum. Stuttgart/Nürtingen Mitte Juni: Rückkehr zunächst nach Stuttgart, dann nach Nürtingen. Kurz danach wieder in Stuttgart. 22. Juni: Tod von Susette Gontard. 30. Juni: Sinclair glaubt H. in Bordeaux und berichtet in einem über Landauer an ihn geschickten Brief vom Tod Susette Gontards. Sommer: H. in Behandlung bei dem Oberamtsphysikus Dr. Planck. 29. September: H. reist auf Einladung von Sinclair zum Reichstag in Regensburg. Begegnung mit dem Landgrafen von Homburg und Wiedersehen mit Fritz Horn, dem Bevollmächtigten Bremens. Mitte/Ende Oktober: Rückkehr nach Nürtingen. In der Folge intensive Arbeit, insbesondere an der Übersetzung der Trauerspiele des Sophokles. Wahrscheinlich legt H. um diese Zeit das Homburger Folioheft an. 20. Dezember: Der erste (erhaltene) Brief der Mutter an Sinclair Januar: Brief an Sinclair mit der Widmungshandschrift von Patmos. Dem Landgrafen von Homburg. Sinclair überreicht dem Landgrafen das Gedicht zu dessen 55. Geburtstag am 30. Januar. 25. Februar: Reichsdeputationshauptschluß (faktische Auflösung der Machtstrukturen des alten Reichs: Säkularisation der geistlichen Herrschaften und Mediatisierung der kleineren Territorien): Baden, Hessen-Kassel und Württemberg werden Kurfürstentümer. 14. März: Tod Klopstocks. 3. Juni: Friedrich Wilmans ( ) übernimmt den Verlag der Übersetzung der Trauerspiele des Sophokles. H.s Antwort erfolgt erst am 28. September. Juni: Treffen mit Schelling in Murrhardt, der dort mit seiner Frau Caroline seine Eltern besucht. 22. Juni: Tod von Heinse in Aschaffenburg. 28. September: später Dank an Wilmans, der Die Trauerspiele des Sophokles verlegt. Ende des Jahres: Arbeit an»einzelnen lyrischen größeren Gedichten 3 oder 4 Bogen«und»Durchsicht einiger Nachtgesänge«(diese erscheinen in Wilmans Taschenbuch für das Jahr 1805) April: H. erhält von Wilmans zwölf Freiexemplare von Die Trauerspiele des Sophokles. 11. Juni: Sinclair reist über Würzburg, wo er Schelling trifft, nach Stuttgart, wo er mit dem homburgischen Hofkommissar Blankenstein sowie Baz, Weishaar und Seckendorf politische Gespräche führt. 19. Juni: Sinclair fährt mit H. von Nürtingen über Tübingen nach Stuttgart. Teilnahme an einem Abendessen, bei dem Sinclair von einer gewaltsamen Lösung für die Auseinandersetzung der Landstände mit dem Kurfürsten gesprochen haben soll so Blankensteins spätere Denunziation (vgl ). 22. Juni: Sinclair reist mit H. und Blankenstein nach Homburg ab. Bei der Durchreise in Würzburg letztes Treffen mit Schelling. 26. Juni: Ankunft in Homburg. H. erhält in der Dorotheenstraße, nicht weit von Sinclairs Haus, Unterkunft bei dem französischen Uhrmacher Calame.
10 522 Zeittafel Homburg 7. Juli: Sinclair bittet den Landgrafen, die seit erhaltene Besoldungszulage (von 200 Gulden) für die Stelle eines Hofbibliothekars verwenden zu dürfen und an H. auszahlen zu lassen. Die Bitte wird sofort genehmigt. H. dürfte in der Bände umfassenden Bibliothek keine dienstliche Tätigkeit ausgeübt haben. 2. November: Sinclair reist als Abgesandter Homburgs zu Verhandlungen und zur Teilnahme an Napoleons Kaiserkrönung (am 2. Dezember) nach Paris. H.s nimmt sich Sinclairs Mutter, Frau von Proeck, an. Vermutlich 1804: H. erhält von der Prinzessin Auguste ein Klavier Januar: Sinclair kehrt aus Paris zurück, er überwirft sich mit Blankenstein wegen dessen fragwürdiger Lotteriegeschäfte. Daraufhin bezichtigt ihn dieser am 29. Jan. in einem Schreiben an den Kurfürsten von Württemberg der Verschwörung. 26. Februar: Sinclair wird von einem württembergischen Beamten in militärischer Begleitung unter der Anschuldigung eines geplanten Anschlags auf den Kurfürsten verhaftet und abtransportiert. 27. Februar: In Ludwigsburg beginnt der Hochverratsprozeß gegen Sinclair, Baz, Weishaar und Seckendorf. Da H. als Mitwisser»der ganzen Sache«von Blankeinstein denunziert worden war, werden von der Untersuchungskommission auch über ihn»nähere Nachrichten«und Auskünfte in Nürtingen, beim Konsistorium und in Homburg eingeholt. Das Gutachten des Dr. Müller attestiert, daß H.s»Wahnsinn in Raserei übergegangen ist«. Das bringt die Erkundigungen gegen ihn zum Stillstand. Frühsommer: H. muß bei Calame aus- und zum Sattlermeister Lattner (in die Haingasse) umziehen. 9. Mai: Tod von Schiller. 10. Juli: Sinclair kehrt nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft nach Homburg zurück. 13. September: Sinclair reist nach Berlin, wo er bei Charlotte von Kalb wohnt. Diese berichtet am Jean Paul über H. 29. Oktober: der einzig erhaltene Brief der Mutter an H. 24. November: Besuch des nach seiner Haft des Landes Württemberg verwiesenen Leo von Sekkendorf Januar: Kurfürst Friedrich von Württemberg wird König. 14. Januar: die Mutter beantragt beim Konsistorium ein Gratial für H., das der König nach mehreren Gesuchen schließlich am 9. Oktober in einer Höhe von 150 Gulden bewilligt 12. Juli: die Landgrafschaft Hessen-Homburg geht gemäß der Rheinbundakte im neuen Großherzogtum Hessen-Darmstadt auf. Nach diesen»veränderungen«sieht Sinclair keine Möglichkeit mehr, daß H. länger»eine Besoldung beziehe und hier in Homburg bleibe«. 6. August: Franz II. legt auf ein Ultimatum Napoleons hin die Kaiserwürde nieder: faktisches Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Anfang September: Friedrich in Schlegel in Homburg, ohne mit H. zusammenzutreffen. 11. September: H., der sich von Leibwächtern entführt glaubt, wird nach Tübingen in das Autenriethsche Klinikum verbracht, in dem er am 15. Sept. aufgenommen wird. Tübingen Oktober: Im Autenriethschen Klinikum führt Justinus Kerner H.s Krankenbuch bis zum 21. Oktober. November: In Seckendorfs Musenalmanach für 1807 erscheinen ohne H.s Wissen Die Herbstfeier (Stutgard), Die Wanderung, Die Nacht (1. Strophe von Brod und Wein) als H. davon 1807 erfährt, ist er»sehr ungehalten« Mai: H. wird als unheilbar aus dem Klinikum entlassen (der Arzt gibt ihm»höchstens noch drei Jahre«) und dem Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer ( ) und seiner Frau Marie Elisabetha ( ) zur Pflege anvertraut. H. bewohnt in Zimmers Haus in der Bursagasse bis zu seinem Tod das Turmzimmer. Dort hat er zu Anfang anscheinend sehr viel geschrieben, wovon nur wenig überliefert ist später schreibt er allein auf Bitten der Besucher. Herbst: in Seckendorfs Musenalmanach für 1808 erscheinen Patmos (Erste Fassung), Der Rhein und Andenken.
11 Zeittafel H. bekommt wieder ein Klavier; auch das Spiel mit der Flöte nimmt er wieder auf Januar: H. schreibe für einen geplanten Almanach»täglich eine Menge Papiers voll« November: Geburt von Charlotte Zimmer, die nach dem Tod von Ernst Zimmer H.s Betreuung fortsetzt April: Tod Sinclairs in Wien August/September: Entscheidende Initiative zu einer Sammlung von H.s Gedichten durch den preußischen Infanterie-Leutnant Heinrich von Diest ( ). Cotta erklärt sich am 7. September dazu grundsätzlich bereit März: Diest bittet Kerner wegen der geplanten Gedicht-Sammlung um Hilfe. Carl Gok, an den Kerner die Bitte weiterleitet, ist zur Hilfe bereit. Die Herausgeberschaft übernehmen Ludwig Uhland ( ) und Gustav Schwab ( ); an der Sammlung von Handschriften, Drucken usw. beteiligen sich u.a. Achim von Arnim, Conz, Varnhagen von Ense, Fouqué, Haug, Hegel, Kerner, und (der Tübinger Stiftler) Carl Ziller; unterstützt wird die Arbeit von der Prinzessin Marianne von Preußen Vertrag zwischen Carl Gok und Cotta über die zweite Auflag des Hyperion und eine erste Ausgabe»sämtlicher Gedichte«. 3. Juli: Erster Besuch von Wilhelm Waiblinger ( ) bei H. Oktober: Waiblinger sowie Eduard Mörike und Johannes Mährlein ( ) treten ins Stift ein. Ab 24. Okt. besucht Waiblinger H. häufig(er) Juni: H. begleitet wie dann wöchentlich den ganzen Sommer über Waiblinger in das von diesem auf dem Österberg gemietete Gartenhaus. 27. Juli: Mörike besucht mit Rudolf Lohbauer ( ) und Johann Georg Schreiner ( ) H., Lohbauer und Schreiner fertigen eine Zeichnung von H. an Schreiner fertigt, nach der Angabe von Mörike, bei einem weiteren Besuch eine kleine Kohlezeichnung von H. an Juni: die»gedichte«erscheinen (ohne Nennung der Herausgeber Uhland und Schwab) Frühjahr: Gustav Schwab veröffentlicht in den Blättern für literarische Unterhaltung einen Aufsatz über H. und seine Gedichte Februar: Tod der Mutter in Nürtingen. Nach der Eröffnung und Mitteilung ihres Testaments entsteht ein langwieriger Erbstreit zwischen der Schwester Heinrike Breunlin und dem Stiefbruder Carl Gok. Dessen Kern ist die Frage der Aufteilung des Gesamtvermögens unter die drei Kinder (Gok vertritt die Auffassung, daß H. gar nichts mehr zu fordern habe). Der Schlichtungsvorschlag vom sieht u.a. vor, daß a) Heinrike Breunlin und Carl Gok je 5230 Gulden erhalten (H. hingegen 9074 Gulden), und b) daß H.s Nachlaß zu sieben Achteln Frau Breunlin oder ihren Nachkommen, zu einem Achtel Gok oder seinen Nachkommen zufallen soll. Der Vergleich wird am angenommen; tiefgreifende Verstimmung zwischen Gok und Heinrike Breunlin Juni: Auf Grund des Attests des Oberamtsarztes Dr. Uhland, daß H.»auch jetzt noch geisteskrank«sei, wird das von der Mutter 1806 beantragte Gratial von 150 Gulden weiter ausbezahlt. September: Neuffer gibt in der Zeitung für die elegante Welt fünfzehn (in der Ausgabe von 1826 fehlende) Gedichte heraus.
12 524 Zeittafel Januar: Waiblinger stirbt in Rom Waiblingers Aufsatz Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn erscheint posthum. 14. November: Hegel stirbt in Berlin Juni: Mörike erhält einen (nicht erhaltenen)»rummel Hölderlinscher Papiere«. 18. November: Tod Ernst Zimmers Januar: nach dem Besuch am zweiter Besuch von Christoph Theodor Schwab ( ), der»einige Gedichte«von H. abholen will. H. nennt sich zum ersten Mal»Scardanelli«und schreibt diesen Namen unter ein Gedicht. 16. Februar: Vertrag zwischen Gok, dem Nürtinger Oberamtspfleger Burk und Cotta über eine zweite Auflage der Gedichte als»elegante Taschenausgabe« Frühjahr: Louise Keller ( ) fertigt bei einem Besuch die Bleistiftzeichnung an, die dem Titelbild der zweiten Ausgabe der Gedichte zugrundeliegt. November: die zweite Auflage der Gedichte erscheint (auf 1843 datiert) Januar: Uhland, Adalbert Keller ( , Freund und Nachfolger Uhlands auf dessen Tübinger Lehrstuhl) und Christoph T. Schwab besuchen H.; Schwab wird nach H.s Tod die erste Ausgabe»sämmtliche(r) Werke«herausgeben. Anfang Juni: die letzten Gedichte Der Frühling. Die Sonne kehrt und Die Aussicht. Wenn in die Ferne geht entstehen. 7. Juni: H. stirbt um 11 Uhr nachts, am 10. Juni wird er auf dem Tübinger Friedhof beerdigt.
13 525 Bibliographie Die bibliographischen Angaben dieses Handbuchs verstehen sich als Auswahlbibliographie. Eine Gesamtbibliographie fortlaufend aktualisiert und im Internet zugänglich bietet die»internationale H. Bibliographie«vgl. den folgenden Hinweis: Internationale Hölderlin- Bibliographie (IHB) Bibliographie 1922 erste Hölderlin-Bibliogr. von Friedrich Seebaß. Nach Gründung des Hölderlin-Archivs der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart 1941 (Homepage:< archive/hoeld2.htm>) bibliogr. Erschließung durch Maria Kohler; Verzeichnung der selbständig und unselbständig erschienenen Dokumente auf der Grundlage der Erwerbungen des Archivs. (Daneben verdienen der Forschungsbericht von A. Pellegrini, Berlin 1965, sowie einige Spezialverzeichnisse zu Vertonungen, Inszenierungen der Sophokles-Übersetzungen und zur Rezeption in Spanien, Griechenland und Japan Beachtung; s. HJb /91, S. 276). Seebaß, Friedrich: Hölderlin-Bibliographie. München, S. Verzeichnet Primär- und Sekundärlit. sowie Rezeption in Dichtung und Kunst. Rezensionen in Auswahl. Kohler, Maria; Alfred Kelletat: Hölderlin-Bibliographie Stuttgart, VII, 103 S. Weist nur Primär- und Sekundärlit. nach. Fortführung durch Maria Kohler in: Hölderlin- Jahrbuch. Tübingen /56; /60; /62; /66; /74; 19/ /77. Internationale Hölderlin-Bibliographie (IHB) / hrsg. vom Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, bearb. von Maria Kohler. 1. Ausg Stuttgart, XV, 756 S. Schlagwortbibliogr. auf der Grundlage des Bestands des Hölderlin-Archivs. Berücksichtigt Sekundärlit. und lit. Rezeption. Im Anhang Hölderlin-Ausgaben und Übersetzungen, sofern neue Lesarten, Kommentare, Einführungen u. dgl. enthalten. Internationale Hölderlin-Bibliographie : (IHB) ; auf der Grundlage der Neuerwerbungen des Hölderlin-Archivs der Württembergischen Landesbibliothek ; Quellen und Sekundärliteratur, Rezeption und Rezensionen / hrsg. vom Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, bearb. von Werner Paul Sohnle und Marianne Schütz. Stuttgart. Berichtsjahre 1984/88 (1991) 1995/96 (1998). [Je 2 Teilbände] // Sonderbd.: Musikalien und Tonträger zu Hölderlin Stuttgart, XXVIII, 596 S. Verzeichnet neben Ausgaben und Übersetzungen auch Graue Lit., Medien und, soweit bekannt, die internat. Rezeption im gesamten Kunstbereich. Nachträge lfd. eingearbeitet. Grundlage der Erschließung ist eine thesaurusbasierte Datenbank. Syst. und alph. Schlagwortreg., Personen- und Titelreg. Im Sonderbd. zusätzlich chronolog. Reg., Besetzungs- und Komponistenverz. Internationale Hölderlin-Bibliographie Online (1984ff.) < Seit im Internet kostenlos zugänglich. Orientiert sich an der gedruckten Ausgabe. Erlaubt einfache und kombinierte Recherchen; lfd. aktualisiert. Vierfach gegliederte Eingabemaske mit anwählbaren Hilfetexten: 1. Einstieg in den Alph. oder Syst. Thesaurus bzw. die Syst. Übersicht. Wahlweise Beschränkung auf die Teildatenbanken Sekundärlit. bzw. Quellen. Gesondert: Neuerwerbungen des Archivs. 2. Festlegung der Ergebnis-Anzeige: Alph. oder chronolog., wahlweise mit Schlagwörtern, Rezensionen, Teildokumenten, ausgewerteten Werken. Ausdruckbare Trefferliste mit Suchkriterien.
14 526 Bibliographie 3.»Spezielle Recherche«durch Beschränkung auf Teildatenbanken, z.b. Ausgaben, Dokumente, Lit. Rezeption, Theateraufführungen usw. Einschränkungen möglich. 4. Aufklappbare Eingabefelder für Einzel- und Kombinationsrecherchen nach inhaltlichen und / oder formalen Kriterien; Verknüpfungen mit den beiden Thesauri, der»speziellen Recherche«sowie mit Erscheinungsjahr und Sprachbezeichnung möglich. Ausgaben Gesamtausgaben Sämtliche Werke (»Große Stuttgarter Ausgabe«, StA), hg. von Friedrich Beißner, Adolf Beck und Ute Oelmann, Stuttgart Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Günter Mieth, Berlin/Weimar Sämtliche Werke.»Frankfurter Ausgabe«. Historisch-kritische Ausgabe (FHA), hg. von Dietrich E[berhard] Sattler u.a., Frankfurt/M. 1975ff. Sämtliche Werke. Kritische Textausgabe (KTA), hg. von Dietrich E[berhard] Sattler. Mithg. Wolfram Groddeck, Darmstadt/Neuwied 1979ff. Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Michael Knaupp (MA), München 1992f. Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Jochen Schmidt (KA), Frankfurt/M Teilausgaben Werke, Briefe, Dokumente. Ausgewählt u. Nachwort v. Pierre Bertaux. Mit Anmerkungen und Lit.hinweisen von Christoph Prignitz, München Friedrich Hölderlin. Der Dichter und sein Werk, hg. v. Friedrich Beißner, München 1973 / Neuauflage: Dichter über ihre Dichtungen, hg. v. Bernhard Böschenstein, München 1996 Sämtliche Gedichte. Studienausgabe, hg. von Detlev Lüders, Bad Homburg 1970, Wiesbaden Friedrich Hölderlin. Ausgewählt v. Peter Härtling, Köln 1984/München 1988.»Bevestigter Gesang«: die neu zu entdeckende Spätdichtung bis 1806, hg. von Dietrich Uffhausen, Stuttgart J.C.F. Hölderlin, Theoretische Schriften. Mit einer Einleitung hg. v. J. Kreuzer, Hamburg Friedrich Hölderlin, Gedichte, hg. v. Gerhard Kurz in Zusammenarbeit mit Wolfgang Braungart. Nachwort v. Bernhard Böschenstein, Stuttgart Friedrich Hölderlin, hesperische gesänge, hg. v. Dietrich E[berhard] Sattler, Bremen 2001 Faksimiles Die umfangreichsten Faksimiles bietet die FHA (s.o.), in den Supplementbänden in Vierfarbdruck: Supplement I: Frankfurter und Homburger Entwurfsfaszikel, hg. v. Dietrich E[berhard] Sattler u. Hans Gerhard Steimer, Frankfurt/M. 1999, Supplement II: Stuttgarter Foliobuch, hg. v. Dietrich E. Sattler u. Hans Gerhard Steimer, Frankfurt/M. 1989, Supplement III: Homburger Folioheft, hg. v. Dietrich E. Sattler u. Emery E. George, Frankfurt/M Daneben: Hölderlin. Patmos. Dem Landgrafen von Homburg überreichte Handschrift. Mit einem Nachwort v. Ludwig Kirchner, Tübingen Hölderlin. Friedensfeier. Lichtdrucke der Reinschrift und ihrer Vorstufen. Hg. v. Wolfgang Binder u. Alfred Kelletat, Tübingen Hölderlin. Stutgard. Originalgetreue Wiedergabe der Londoner Handschrift. Erläuterungen v. Cyrus Hamlin, Stuttgart Hölderlin. Die Maulbronner Gedichte Faksimile des»marbacher Quartheftes«, hg. v. Werner Volke, Marbach a.n Dokumentarisches Hilfsmittel/Periodika/Lexika Dokumentarisches (Das umfangreichste Material enthalten die Bde der StA) Beck, Adolf (Hg.): H.s Diotima Susette Gontard. Gedichte, Briefe, Zeugnisse. Mit Bildnissen, Frankfurt 1980.
15 Dokumentarisches Hilfsmittel/Periodika/Lexika 527 Bertaux, Pierre: H. und die Französische Revolution, Frankfurt/M Härtling, Peter: H. Ein Roman, Darmstadt/Neuwied 1976 H. Eine Chronik in Text und Bild. Hg. v. Adolf Beck u. Paul Raabe, Frankfurt/M Kirchner, Werner: Der Hochverratsprozeß gegen Sinclair. Ein Beitrag zum Leben H.s, Marburg 1949 Michel, Wilhelm: Das Leben F. H.s, Bremen 1940 (ND Frankfurt/M. 1967). Wittkop, Gregor (Hg.): H. Der Pflegsohn. Texte und Dokumente ( ) mit den neu entdeckten Nürtinger Pflegschaftsakten, Stuttgart Wolf, Gerhard: Der arme H., Berlin 1972, 2 Stuttgart Hilfsmittel Autenrieth, Johanne/ Kelletat, Alfred: Katalog der H.-Handschriften, Stuttgart 1961 Barthélémy, Jean Jacques: Reise des jüngeren Anacharsis durch Griechenland. Neuere wohlfeile Ausgabe Berlin Böschenstein, Bernhard: Konkordanz zu H.s Gedichten nach Auf Grund des zweiten Bandes der Großen Stuttgarter Ausgabe, Göttingen 1964 Chandler, Richard: Travels in Greece, dtsch.: Reisen in Kleinasien, Leipzig Repr. mit einem Vorwort von Ludwig v. Pigenot Hildesheim Cornelissen, Maria: Orthographische Tabellen zu Handschriften H.s, Stuttgart H. Texturen. Hg. v. Ulrich Gaier, Valérie Lawitschka, Stefan Metzger, Wolfgang Rapp, Violetta Waibel, Bde. 1 4, Tübingen und Marbach Internationale Hölderlin-Bibliographie (s.o.). Kohler, Maria: H.s Antiquen, Tübingen Scheel, H.: Süddeutsche Jakobiner Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen Süden, Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin 1962, Gustav Schlesier. H.-Aufzeichnungen. Hg. v. Hans Gerhard Steimer, Weimar [de Volnay, Constantin-François:] Les ruines ou méditation sur les révolutions des empires: par M. Volney, Député à l Assemblée Nationale de 1789, Sec. éd. Paris 1792: Die Ruinen [oder Betrachtungen über die Revolutionen der Reiche]. Aus dem Franz. Des Herrn von Volney übers. v. Georg Forster. Bei Friedr.Vieweg dem Älteren, Berlin Wörterbuch zu F. H. I. Teil: Die Gedichte auf der Grundlage der Großen Stuttgarter Ausgabe. Bearbeitet v. Heinz-Martin Dannhauser u.a., Tübingen 1983; II. Teil: Hyperion. Auf der Textgrundlage der Großen Stuttgarter Ausgabe. Bearb. V. Hans Otto Horch u.a., Tübingen Periodika Bad Homburger H.-Vorträge, Hg. v. der Stadt Bad Hamburg v.d.h. in Zus.arbeit mit der H.-Gesellschaft, Bad Homburg 1986ff. H.-Jahrbuch. Begründet v. Friedrich Beißner u. Paul Kluckhohn, Tübingen/Stuttgart/Eggingen 1944ff. (Bd.1:»Iduna«). Le pauvre Holterling. Blätter zur Frankfurter Ausgabe, Frankfurt/M. 1976ff. Turm-Vorträge. Hg. v. Uvo Hölscher u. Valérie Lawitschka, Tübingen 1986ff. Lexika Adelung, Johann Christoph: Geschichte der Philosophie für Liebhaber, 3 Bde., Leipzig Ders.: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen ( ), Wien 1807/08 (Repr. Hildesheim 1970). Grimm, Jacob u. Wilhelm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854ff., ND München 1984 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hg. v. Bächthold Stäubli, Berlin (Repr. Berlin/New York 1987) Hederich, Benjamin: Gründliches mythologisches Lexicon, Leipzig 1724, vermehrt und verbessert v. Johann Joachim Schwaben (Repr. Darmstadt 1986). Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. v. Joachim Ritter, Karlfried Gründer u.a., Basel/ Darmstadt 1971ff. Iselin, Jacob Christoff: Historisches und Geographisches Allgemeines Lexicon, Neue Auflage, Zürich Oetinger, Friedrich Christoph: Biblisches und
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur
 Inhalt Vorwort... 4... 6 1.1 Biografie... 6 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 12 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 18 2. Textanalyse und -interpretation... 19 2.1 Entstehung
Inhalt Vorwort... 4... 6 1.1 Biografie... 6 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 12 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 18 2. Textanalyse und -interpretation... 19 2.1 Entstehung
Johann Wolfgang Goethe
 Johann Wolfgang Goethe Vita: 1749 Am 28. August wird Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt am Main geboren als Sohn des Kaiserlichen Rats Johann Caspar Goethe und seiner Frau Catharina Elisabeth, geb. Textor.
Johann Wolfgang Goethe Vita: 1749 Am 28. August wird Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt am Main geboren als Sohn des Kaiserlichen Rats Johann Caspar Goethe und seiner Frau Catharina Elisabeth, geb. Textor.
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur
 Inhalt Vorwort... 5 1. Heinrich von Kleist: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 16 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und
Inhalt Vorwort... 5 1. Heinrich von Kleist: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 16 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und
Vita Johann Christian Friedrich Hölderlin wird am 20. März in Lauffen am Neckar geboren.
 Vita 1770 1784 1786-88 1788 1793 Johann Christian Friedrich Hölderlin wird am 20. März in Lauffen am Neckar geboren. Hölderlin tritt in die niedere Klosterschule in Denkendorf bei Nürtingen ein. Besuch
Vita 1770 1784 1786-88 1788 1793 Johann Christian Friedrich Hölderlin wird am 20. März in Lauffen am Neckar geboren. Hölderlin tritt in die niedere Klosterschule in Denkendorf bei Nürtingen ein. Besuch
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur
 Inhalt Vorwort... 4... 5 1.1 Biografie... 5 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 14 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 21 2. Textanalyse und -interpretation... 24 2.1 Entstehung
Inhalt Vorwort... 4... 5 1.1 Biografie... 5 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 14 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 21 2. Textanalyse und -interpretation... 24 2.1 Entstehung
SCHILLERS WERKE NATIONALAUSGABE NEUNUNDDREISSIGSTER BAND TEIL I BRIEFWECHSEL BRIEFE AN SCHILLER (TEXT) Herausgegeben von
 /C - sf- SCHILLERS WERKE NATIONALAUSGABE NEUNUNDDREISSIGSTER BAND TEIL I BRIEFWECHSEL BRIEFE AN SCHILLER 1. 1. 1801-31. 12. 1802 (TEXT) Herausgegeben von Stefan Ormanns WEIMAR HERMANN BÖHLAUS NACHFOLGER
/C - sf- SCHILLERS WERKE NATIONALAUSGABE NEUNUNDDREISSIGSTER BAND TEIL I BRIEFWECHSEL BRIEFE AN SCHILLER 1. 1. 1801-31. 12. 1802 (TEXT) Herausgegeben von Stefan Ormanns WEIMAR HERMANN BÖHLAUS NACHFOLGER
INVENTARE SCHILLERBESTAND
 INVENTARE DES GOETHE- UND SCHILLER-ARCHIVS Band 1 SCHILLERBESTAND Redaktor GERHARD SCHMID 1989 HERMANN BÖHLAUS NACHFOLGER WEIMAR INHALT Vorwort 9 Einleitung 13 Geschichte des Schillerbestandes im Goethe-
INVENTARE DES GOETHE- UND SCHILLER-ARCHIVS Band 1 SCHILLERBESTAND Redaktor GERHARD SCHMID 1989 HERMANN BÖHLAUS NACHFOLGER WEIMAR INHALT Vorwort 9 Einleitung 13 Geschichte des Schillerbestandes im Goethe-
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur
 Inhalt Vorwort... 5 1. Johann Wolfgang von Goethe: Leben und Werk... 9 1.1 Biografie... 9 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 15 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 20 2. Textanalyse
Inhalt Vorwort... 5 1. Johann Wolfgang von Goethe: Leben und Werk... 9 1.1 Biografie... 9 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 15 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 20 2. Textanalyse
Staatsarchiv Hamburg 622-1/512. Wächter. Findbuch
 622-1/512 Wächter Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Archivguteinheiten 1 622-1/512 Wächter Vorwort I. Biografische Notiz Georg Philipp Ludwig Leonhard Wächter wurde am 25. November 1762 in Uelzen
622-1/512 Wächter Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Archivguteinheiten 1 622-1/512 Wächter Vorwort I. Biografische Notiz Georg Philipp Ludwig Leonhard Wächter wurde am 25. November 1762 in Uelzen
Inhalt. Einleitung Das Genie
 Inhalt Einleitung...... 11 1. Das Genie Johann Kaspar Lavater: Physiognomische Fragmente.... 35 Johann Gottfried Herder: Shakespear... 50 Journal meiner Reise im Jahr 1769... 62 Johann Wolfgang Goethe:
Inhalt Einleitung...... 11 1. Das Genie Johann Kaspar Lavater: Physiognomische Fragmente.... 35 Johann Gottfried Herder: Shakespear... 50 Journal meiner Reise im Jahr 1769... 62 Johann Wolfgang Goethe:
Inhalt. 1. Das Genie. JOHANN KASPAR LAVATER: Physiognomische Fragmente Der Mensch und sein Herz
 Inhalt Einleitung 11 1. Das Genie JOHANN KASPAR LAVATER: Physiognomische Fragmente 35 JOHANN GOTTFRIED HERDER: Shakespear 50 Journal meiner Reise im Jahr 1769 62 JOHANN WOLFGANG GOETHE: Wanderers Sturmlied
Inhalt Einleitung 11 1. Das Genie JOHANN KASPAR LAVATER: Physiognomische Fragmente 35 JOHANN GOTTFRIED HERDER: Shakespear 50 Journal meiner Reise im Jahr 1769 62 JOHANN WOLFGANG GOETHE: Wanderers Sturmlied
Inhalt. Einleitung 9. digitalisiert durch: IDS Basel Bern. Gedichte des Sturm und Drang und der Klassik 1997
 Inhalt Einleitung 9 I. Dein Schwert, wie ist's von Blut so rot?... 17 1. Das Lied vom Herrn von Falckenstein. Volksballade aus dem Elsaß, überliefen von Johann Wolfgang Goethe 2. Dein Schwert, wie ist's
Inhalt Einleitung 9 I. Dein Schwert, wie ist's von Blut so rot?... 17 1. Das Lied vom Herrn von Falckenstein. Volksballade aus dem Elsaß, überliefen von Johann Wolfgang Goethe 2. Dein Schwert, wie ist's
DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION
 DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION Niklas Roth Die Französische Revolution hatte in vielerlei Hinsicht große Auswirkungen auf die damaligen sozialen und politischen Verhältnisse und ihre Prinzipien der Freiheit,
DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION Niklas Roth Die Französische Revolution hatte in vielerlei Hinsicht große Auswirkungen auf die damaligen sozialen und politischen Verhältnisse und ihre Prinzipien der Freiheit,
Die Französische Revolution in Deutschland
 Die Französische Revolution in Deutschland Zeitgenössische Texte deutscher Autoren Augenzeugen Pamphletisten, Publizisten Dichter und Philosophen HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH EBERLE UND THEO STAMMEN PHILIPP
Die Französische Revolution in Deutschland Zeitgenössische Texte deutscher Autoren Augenzeugen Pamphletisten, Publizisten Dichter und Philosophen HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH EBERLE UND THEO STAMMEN PHILIPP
Hyperion oder der Eremit von Griechenland. Friedrich Hölderlin
 Hyperion oder der Eremit von Friedrich Hölderlin Inhaltsangabe Informationen zum Buch Inhalt Erster Band Buch 1 Buch 2 Zweiter Band Buch 1 Buch 2 Autor Lebenslauf Bekannteste Werke Literaturepoche Informationen
Hyperion oder der Eremit von Friedrich Hölderlin Inhaltsangabe Informationen zum Buch Inhalt Erster Band Buch 1 Buch 2 Zweiter Band Buch 1 Buch 2 Autor Lebenslauf Bekannteste Werke Literaturepoche Informationen
Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz
 Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 2003 Herausgegeben von Günther Wagner Verlag J.B. Metzler Stuttgart Weimar 3 INHALT Vorwort......................................................
Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 2003 Herausgegeben von Günther Wagner Verlag J.B. Metzler Stuttgart Weimar 3 INHALT Vorwort......................................................
Ein Drama von Georg Büchner. Präsentiert von: Sabrina Schwichtenberg
 Ein Drama von Georg Büchner Präsentiert von: Sabrina Schwichtenberg Autor Georg Büchner Revolution und Verfolgung Steckbrief und wichtige Werke Exil und Tod Buch Dantons Tod Sprachliche Form Literarische
Ein Drama von Georg Büchner Präsentiert von: Sabrina Schwichtenberg Autor Georg Büchner Revolution und Verfolgung Steckbrief und wichtige Werke Exil und Tod Buch Dantons Tod Sprachliche Form Literarische
Die, Witteisbacher in Lebensbildern
 Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
FRIEDRICH SCHILLER BRIEFE II
 FRIEDRICH SCHILLER BRIEFE II 1795-1805 Herausgegeben von Norbert Oellers DEUTSCHER KLASSIKER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 415. An Johann Wolfgang von Goethe,' 15. 6. 179 5. 9 416. An Sophie Mereau, 18.6.
FRIEDRICH SCHILLER BRIEFE II 1795-1805 Herausgegeben von Norbert Oellers DEUTSCHER KLASSIKER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 415. An Johann Wolfgang von Goethe,' 15. 6. 179 5. 9 416. An Sophie Mereau, 18.6.
Übersetzungen deutschsprachiger literarischer Werke ins Japanische
 Übersetzungen deutschsprachiger literarischer Werke ins Japanische Ein Überblick 1. In welchen Jahren sind wieviele Übersetzungen erschienen? 300 250 200 150 100 50 0 1900-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30
Übersetzungen deutschsprachiger literarischer Werke ins Japanische Ein Überblick 1. In welchen Jahren sind wieviele Übersetzungen erschienen? 300 250 200 150 100 50 0 1900-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30
INHALT EINLEITUNG. Abriß einer Entwicklungsgeschichte der Friedensidee vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution 7
 INHALT EINLEITUNG Abriß einer Entwicklungsgeschichte der Friedensidee vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution 7 1794 Christoph Martin Wieland: Über Krieg und Frieden 59 Christoph Martin Wieland:
INHALT EINLEITUNG Abriß einer Entwicklungsgeschichte der Friedensidee vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution 7 1794 Christoph Martin Wieland: Über Krieg und Frieden 59 Christoph Martin Wieland:
Grundbegriffe der romantischen Poesie
 Grundbegriffe der romantischen Poesie Romantisch leitet sich von den Begriffen Roman oder Romanze ab und meint das Wunderbare, Abenteuerliche, Sinnliche und Schaurige. Die Romantiker interessieren sich
Grundbegriffe der romantischen Poesie Romantisch leitet sich von den Begriffen Roman oder Romanze ab und meint das Wunderbare, Abenteuerliche, Sinnliche und Schaurige. Die Romantiker interessieren sich
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Georg Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Georg Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Inhaltsverzeichnis. Auf die Plätze. Zeiteinordnung/Epoche Kindheit/Jugend Studienzeit Erste Arbeitserfahrungen Privatleben ab 1775
 Inhaltsverzeichnis Zeiteinordnung/Epoche Kindheit/Jugend Studienzeit Erste Arbeitserfahrungen Privatleben ab 1775 Flucht nach Italien Leben in Weimar Italien/Frankreich Goethe und Schiller Zeit bis Tod
Inhaltsverzeichnis Zeiteinordnung/Epoche Kindheit/Jugend Studienzeit Erste Arbeitserfahrungen Privatleben ab 1775 Flucht nach Italien Leben in Weimar Italien/Frankreich Goethe und Schiller Zeit bis Tod
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur (Auswahl)...
 Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 14 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und -interpretation... 21 2.1 Entstehung
Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 14 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und -interpretation... 21 2.1 Entstehung
Heinrich von Kleist. Moritz Carmesin. 8. Juli Heinrich von Kleist. Moritz Carmesin. Bild. Familie. Die frühen Jahre. Erste Schaffensperiode
 8. Juli 2009 Gliederung 1 2 3 4 5 6 7 Ein (1801) Die VON KLEIST alter pommerscher Adel viele hochrangige Militärs und Diplomaten Vater JOACHIM FRIEDRICH VON KLEIST Ehe mit CAROLINE LOUISE VON WULLFEN Ehe
8. Juli 2009 Gliederung 1 2 3 4 5 6 7 Ein (1801) Die VON KLEIST alter pommerscher Adel viele hochrangige Militärs und Diplomaten Vater JOACHIM FRIEDRICH VON KLEIST Ehe mit CAROLINE LOUISE VON WULLFEN Ehe
Gottfried Keller ( )
 Gottfried Keller (1819-1890) 1819 19. Juli: Gottfried Keller wird in kleinbürgerlichen Verhältnissen als Sohn des Drechslermeisters Hans-Rodolf Keller und der Arzttochter Elisabeth, geb. Scheuchzer, in
Gottfried Keller (1819-1890) 1819 19. Juli: Gottfried Keller wird in kleinbürgerlichen Verhältnissen als Sohn des Drechslermeisters Hans-Rodolf Keller und der Arzttochter Elisabeth, geb. Scheuchzer, in
Frühromantik Epoche - Werke - Wirkung
 Frühromantik Epoche - Werke - Wirkung Von Lothar Pikulik Verlag C.H.Beck München Inhaltsverzeichnis Einführung 9 Abkürzungen der zitierten Quellen 13 Erster Teil: Entstehung I. Kapitel: Die Geburt der
Frühromantik Epoche - Werke - Wirkung Von Lothar Pikulik Verlag C.H.Beck München Inhaltsverzeichnis Einführung 9 Abkürzungen der zitierten Quellen 13 Erster Teil: Entstehung I. Kapitel: Die Geburt der
Friedrich von Gentz und Fürst Metternich
 Geschichte Stephan Budde Friedrich von Gentz und Fürst Metternich Duo der Unterdrückung? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...... 2 2. Gentz und Metternich, zwei Biografien......3 2.1 Friedrich
Geschichte Stephan Budde Friedrich von Gentz und Fürst Metternich Duo der Unterdrückung? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...... 2 2. Gentz und Metternich, zwei Biografien......3 2.1 Friedrich
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte... 68
 Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 12 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 14 2. Textanalyse und -interpretation... 16 2.1 Entstehung
Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 12 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 14 2. Textanalyse und -interpretation... 16 2.1 Entstehung
D 84 - Nachlass Albert Bacmeister
 LANDESKIRCHLICHES ARCHIV STUTTGART Archivinventar D 84 - Nachlass Albert Bacmeister 1826, 1860-1920, 1958-1959 Bearbeitet von: Lena Kremp Stuttgart 2017 Findbucheinleitung Findbucheinleitung Biografische
LANDESKIRCHLICHES ARCHIV STUTTGART Archivinventar D 84 - Nachlass Albert Bacmeister 1826, 1860-1920, 1958-1959 Bearbeitet von: Lena Kremp Stuttgart 2017 Findbucheinleitung Findbucheinleitung Biografische
Peter Härtling. Zwischen Untergang und Aufbruch. Aufsätze, Reden, Gespräche
 Peter Härtling Zwischen Untergang und Aufbruch Aufsätze, Reden, Gespräche Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1990 Inhalt I. Lauschend den vorauseilenden Echos des großen Umsturzes Marktstraße in Nürtingen
Peter Härtling Zwischen Untergang und Aufbruch Aufsätze, Reden, Gespräche Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1990 Inhalt I. Lauschend den vorauseilenden Echos des großen Umsturzes Marktstraße in Nürtingen
Goethe an Schiller, Weimar, 6. Dezember 1794
 S. 1 Goethe an Schiller, Weimar, 6. Dezember 1794 GSA 28/1046 Bl 1r Geburt und Tod eines Kindes: Carl von Goethe Geburt und Tod eines Kindes: Carl von Goethe Geburt und Tod eines Kindes: Carl von Goethe
S. 1 Goethe an Schiller, Weimar, 6. Dezember 1794 GSA 28/1046 Bl 1r Geburt und Tod eines Kindes: Carl von Goethe Geburt und Tod eines Kindes: Carl von Goethe Geburt und Tod eines Kindes: Carl von Goethe
Die rheinbündischen Reformen: Das Ende des Alten Reiches und die Gründung des Rheinbundes
 Geschichte Thorsten Kade Die rheinbündischen Reformen: Das Ende des Alten Reiches und die Gründung des Rheinbundes Napoleon als Motor der Modernisierung? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung
Geschichte Thorsten Kade Die rheinbündischen Reformen: Das Ende des Alten Reiches und die Gründung des Rheinbundes Napoleon als Motor der Modernisierung? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung
Zeittafel zu Friedrich Schiller: Leben und Werk
 Zeittafel zu Friedrich Schiller: Leben und Werk 1759 Am 10. November wird Johann Christoph Friedrich Schiller als Sohn Johann Kaspar Schillers, eines Leutnants in württembergischen Diensten, und Elisabetha
Zeittafel zu Friedrich Schiller: Leben und Werk 1759 Am 10. November wird Johann Christoph Friedrich Schiller als Sohn Johann Kaspar Schillers, eines Leutnants in württembergischen Diensten, und Elisabetha
Inhalt. Vorwort... 5. 3. Themen und Aufgaben... 99. 4. Rezeptionsgeschichte... 102. 5. Materialien... 113. Literatur... 117
 Inhalt Vorwort... 5 1. Friedrich Schiller: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 16 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 22 2. Textanalyse und
Inhalt Vorwort... 5 1. Friedrich Schiller: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 16 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 22 2. Textanalyse und
NATIONALAUSGABE VIERZIGSTER BAND TEIL I BRIEFWECHSEL BRIEFE AN SCHILLER (TEXT)
 SCHILLERS WERKE NATIONALAUSGABE VIERZIGSTER BAND TEIL I BRIEFWECHSEL BRIEFE AN SCHILLER 1.1. 1803-17. 5. 1805 (TEXT) Herausgegeben von Georg Kurscheidt und Norbert Oellers W E I M A R HERMANN BÖ HLAUS
SCHILLERS WERKE NATIONALAUSGABE VIERZIGSTER BAND TEIL I BRIEFWECHSEL BRIEFE AN SCHILLER 1.1. 1803-17. 5. 1805 (TEXT) Herausgegeben von Georg Kurscheidt und Norbert Oellers W E I M A R HERMANN BÖ HLAUS
Bayerns Könige privat
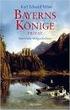 Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
PD Dr. Frank Almai Epochenschwellen im Vergleich: 1550, 1720, 1800, 1900
 Institut für Germanistik Professur für Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte : 1550, 1720, 1800, 1900 9. Vorlesung: Block III: 1800: Klassik und Romantik III Gliederung 2.2 Romantik und Wissenschaft
Institut für Germanistik Professur für Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte : 1550, 1720, 1800, 1900 9. Vorlesung: Block III: 1800: Klassik und Romantik III Gliederung 2.2 Romantik und Wissenschaft
622-1/99. von Sienen
 622-1/99 von Sienen Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Jakob Albrecht von Sienen (I), Bürgermeister 1 Personalpapiere und Papiere über amtliche Tätigkeit 1 Papiere über seine Familie 1 Private Aufzeichnungen
622-1/99 von Sienen Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Jakob Albrecht von Sienen (I), Bürgermeister 1 Personalpapiere und Papiere über amtliche Tätigkeit 1 Papiere über seine Familie 1 Private Aufzeichnungen
Mathilde Planck. Für Frieden und Frauenrechte. Mascha Riepl-Schmidt. DRW-Verlag
 Mathilde Planck Für Frieden und Frauenrechte Mascha Riepl-Schmidt DRW-Verlag 29. 11. 1861 Geboren in Ulm, Büchsengasse 359, als viertes Kind von Auguste, geb. Wagner (1834 1925) und Karl Christian Planck
Mathilde Planck Für Frieden und Frauenrechte Mascha Riepl-Schmidt DRW-Verlag 29. 11. 1861 Geboren in Ulm, Büchsengasse 359, als viertes Kind von Auguste, geb. Wagner (1834 1925) und Karl Christian Planck
Königs Erläuterungen und Materialien Band 176. Auszug aus: Friedrich Hebbel. Maria Magdalena. von Magret Möckel
 Königs Erläuterungen und Materialien Band 176 Auszug aus: Friedrich Hebbel Maria Magdalena von Magret Möckel Friedrich Hebbel: Maria Magdalena. Ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten. Mit Hebbels Vorwort
Königs Erläuterungen und Materialien Band 176 Auszug aus: Friedrich Hebbel Maria Magdalena von Magret Möckel Friedrich Hebbel: Maria Magdalena. Ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten. Mit Hebbels Vorwort
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur... 89
 Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 15 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und -interpretation... 24 2.1 Entstehung
Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 15 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 19 2. Textanalyse und -interpretation... 24 2.1 Entstehung
 Liste der AutorInnen Arp, Hans Bachmann, Ingeborg Ball, Hugo Bayer, Konrad Benn, Gottfried Brecht, Bertolt Brentano, Clemens Braun, Volker Busch, Wilhelm Celan, Paul Claudius, Matthias Droste-Hülshoff,
Liste der AutorInnen Arp, Hans Bachmann, Ingeborg Ball, Hugo Bayer, Konrad Benn, Gottfried Brecht, Bertolt Brentano, Clemens Braun, Volker Busch, Wilhelm Celan, Paul Claudius, Matthias Droste-Hülshoff,
Der Hofmeister im Wandel der Zeit
 Germanistik Fabian Schäfer Der Hofmeister im Wandel der Zeit "Der Hofmeister": Zu Lenz' Zeiten, in Brechts Bearbeitung und heute Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1. Parallelen zwischen dem Hofmeister
Germanistik Fabian Schäfer Der Hofmeister im Wandel der Zeit "Der Hofmeister": Zu Lenz' Zeiten, in Brechts Bearbeitung und heute Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1. Parallelen zwischen dem Hofmeister
Die Biographie Georg Büchners. Unter Berücksichtigung ihrer Bezüge zu Woyzeck
 Die Biographie Georg Büchners Unter Berücksichtigung ihrer Bezüge zu Woyzeck Inhaltsangabe - Zeiteinordnung - Biographie - Kindheit - Studium - Zeit bis zu seinem Tod - Wichtige Werke Büchners - Entstehung
Die Biographie Georg Büchners Unter Berücksichtigung ihrer Bezüge zu Woyzeck Inhaltsangabe - Zeiteinordnung - Biographie - Kindheit - Studium - Zeit bis zu seinem Tod - Wichtige Werke Büchners - Entstehung
Götter im poetischen Gebrauch
 Jörg Ennen Götter im poetischen Gebrauch Studien zu Begriff und Praxis der antiken Mythologie um 1800 und im Werk H. v. Kleists LlT Inhaltsverzeichnis : Seite 0. Einleitung 1 0.1. Gegenstand und Zielsetzung
Jörg Ennen Götter im poetischen Gebrauch Studien zu Begriff und Praxis der antiken Mythologie um 1800 und im Werk H. v. Kleists LlT Inhaltsverzeichnis : Seite 0. Einleitung 1 0.1. Gegenstand und Zielsetzung
Herausgegeben von Wolfgang Grünberg und Wolfram Weiße. (Hamburger Universitätsreden Neue Folge 8. Herausgeber: Der Präsident der Universität Hamburg)
 VITA aus: Zum Gedenken an Dorothee Sölle Herausgegeben von Wolfgang Grünberg und Wolfram Weiße (Hamburger Universitätsreden Neue Folge 8. Herausgeber: Der Präsident der Universität Hamburg) S. 111-112
VITA aus: Zum Gedenken an Dorothee Sölle Herausgegeben von Wolfgang Grünberg und Wolfram Weiße (Hamburger Universitätsreden Neue Folge 8. Herausgeber: Der Präsident der Universität Hamburg) S. 111-112
Begegnung und Abschied
 VIKTOR VON WEIZSÄCKER GESELLSCHAFT Begegnung und Abschied Krankengeschichten Poesie (Hölderlin-Bild) Lese- und Gesprächsseminar im Predigerseminar der Evangelischen Landeskirche Braunschweig 15. 17. April
VIKTOR VON WEIZSÄCKER GESELLSCHAFT Begegnung und Abschied Krankengeschichten Poesie (Hölderlin-Bild) Lese- und Gesprächsseminar im Predigerseminar der Evangelischen Landeskirche Braunschweig 15. 17. April
Reichstage und Reichsversammlungen unter Kaiser Karl V. ( )
 Reichstage und Reichsversammlungen unter Kaiser Karl V. (1519-1555) Zur Einberufung wird das kaiserliche oder königliche Ausschreiben bzw. die Festsetzung durch eine vorausgehende Reichsversammlung mit
Reichstage und Reichsversammlungen unter Kaiser Karl V. (1519-1555) Zur Einberufung wird das kaiserliche oder königliche Ausschreiben bzw. die Festsetzung durch eine vorausgehende Reichsversammlung mit
Leseverstehen: Fichte, Novalis und Caroline Schlegel.
 Ende des 18. Jahrhunderts lebten und wirkten in Jena äußerst interessante Persönlichkeiten. Der exzellente Ruf der Universität zog Dichter und Denker, Philosophen und Naturwissenschaftler in die Stadt.
Ende des 18. Jahrhunderts lebten und wirkten in Jena äußerst interessante Persönlichkeiten. Der exzellente Ruf der Universität zog Dichter und Denker, Philosophen und Naturwissenschaftler in die Stadt.
Grußwort. von. Herrn Minister. Professor Dr. Wolfgang Reinhart MdL. Buchpräsentation. Tagebuch der Prinzessin Marianne.
 Grußwort von Herrn Minister Professor Dr. Wolfgang Reinhart MdL Buchpräsentation Tagebuch der Prinzessin Marianne von Preußen im Rahmen eines Pressegesprächs am 15.11.06 11.00 Uhr im Raum Hohenzollern
Grußwort von Herrn Minister Professor Dr. Wolfgang Reinhart MdL Buchpräsentation Tagebuch der Prinzessin Marianne von Preußen im Rahmen eines Pressegesprächs am 15.11.06 11.00 Uhr im Raum Hohenzollern
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Die Räuber" von Friedrich von Schiller - Inhaltserläuterungen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Die Räuber" von Friedrich von Schiller - Inhaltserläuterungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Inhaltserläuterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Die Räuber" von Friedrich von Schiller - Inhaltserläuterungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Inhaltserläuterungen
INHALT März Geburt und Taufe, Lauffen am Neckar 9
 770 Geburt und Taufe, Lauffen am Neckar 77 7 Geburt der ersten Schwester Johanna Christiana Friderica 0 Hochzeit der jüngeren Schwester des Vaters 0 2 Tod der Urgroßmutter Johanna Juditha Sutor 0 772 5
770 Geburt und Taufe, Lauffen am Neckar 77 7 Geburt der ersten Schwester Johanna Christiana Friderica 0 Hochzeit der jüngeren Schwester des Vaters 0 2 Tod der Urgroßmutter Johanna Juditha Sutor 0 772 5
Friihromantik Epoche - Werke - Wirkung
 Friihromantik Epoche - Werke - Wirkung Vow Lothar Pikulik Zweite Auflage Verlag C.H.Beck Miinchen Inh altsverzeichnis Einfiihrung 9 Abkiirzungen der zitierten Quellen 13 Erster Teil: Entstehung I. Kapitel:
Friihromantik Epoche - Werke - Wirkung Vow Lothar Pikulik Zweite Auflage Verlag C.H.Beck Miinchen Inh altsverzeichnis Einfiihrung 9 Abkiirzungen der zitierten Quellen 13 Erster Teil: Entstehung I. Kapitel:
Lajos Némedi DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR IM 18. JAHRHUNDERT
 Lajos Némedi DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR IM 18. JAHRHUNDERT KLTE Egyetemi Könyvtár DEBRECEN "0247 "1402" Tankönyvkiadó, Budapest Inhalt Vorwort Einführender Überblick Európa im 18. Jahrhundert..
Lajos Némedi DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR IM 18. JAHRHUNDERT KLTE Egyetemi Könyvtár DEBRECEN "0247 "1402" Tankönyvkiadó, Budapest Inhalt Vorwort Einführender Überblick Európa im 18. Jahrhundert..
Nietzsches Kritik am Christentum
 Geisteswissenschaft Ramadan Attia Nietzsches Kritik am Christentum Studienarbeit Inhalt 0. Einleitung 02 1.Kapitel 03 1.1. Kurzbiographie zu Deutschland bekanntesten Philosoph des 19. Jhts. 03 1.2. Der
Geisteswissenschaft Ramadan Attia Nietzsches Kritik am Christentum Studienarbeit Inhalt 0. Einleitung 02 1.Kapitel 03 1.1. Kurzbiographie zu Deutschland bekanntesten Philosoph des 19. Jhts. 03 1.2. Der
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Willy Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Willy Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Max Albert Wilhelm Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Max Albert Wilhelm Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965
 Arbeitsbibliographie Literatur Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Ders., Vorlesungen
Arbeitsbibliographie Literatur Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Ders., Vorlesungen
Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland. Findbuch. Sammlung Petersen
 Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland Findbuch Sammlung Petersen 8SL 016 bearbeitet von Lena Wörsdörfer 2004 Inhaltsverzeichnis I. Vorwort 01. Biografisches 01.01. Fotos 01.02. Grußkarten 01.03.
Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland Findbuch Sammlung Petersen 8SL 016 bearbeitet von Lena Wörsdörfer 2004 Inhaltsverzeichnis I. Vorwort 01. Biografisches 01.01. Fotos 01.02. Grußkarten 01.03.
Daten zur Person des Porzellanmalers Philipp Magnus Bechel und seiner Familie, aus: Ludwigsburger Porzellan, von Hans Dieter Flach, 1997
 Daten zur Person des Porzellanmalers Philipp Magnus Bechel und seiner Familie, aus: Ludwigsburger Porzellan, von Hans Dieter Flach, 1997 Diese Daten sind nachfolgend kursiv wiedergegeben Johann Philipp
Daten zur Person des Porzellanmalers Philipp Magnus Bechel und seiner Familie, aus: Ludwigsburger Porzellan, von Hans Dieter Flach, 1997 Diese Daten sind nachfolgend kursiv wiedergegeben Johann Philipp
Der Brief von Anna Blöcker
 Der Brief von Anna Blöcker Im Familienarchiv befinden sich Faksimiles von drei Seiten eines bzw. zweier Briefe, die Anna Elsabe Christina Blöcker (geb. Vader, 1826-1905) im Frühjahr 1872 an eine ihrer
Der Brief von Anna Blöcker Im Familienarchiv befinden sich Faksimiles von drei Seiten eines bzw. zweier Briefe, die Anna Elsabe Christina Blöcker (geb. Vader, 1826-1905) im Frühjahr 1872 an eine ihrer
Napoleon Bonaparte ( )
 Napoleon Bonaparte (1769 1821) Aufstieg als Offizier während der Revolutionskriege 1796 Sieg gegen die österreichischen Heere 1798 Sieg in Ägypten 1799 Sturz der Direktoriumsregierung, neue Verfassung,
Napoleon Bonaparte (1769 1821) Aufstieg als Offizier während der Revolutionskriege 1796 Sieg gegen die österreichischen Heere 1798 Sieg in Ägypten 1799 Sturz der Direktoriumsregierung, neue Verfassung,
LITERATUR II. Lehrstuhl für Germanistik, Päd. Fakultät der Karls-Universität in Prag PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 LITERATUR II Lehrstuhl für Germanistik, Päd. Fakultät der Karls-Universität in Prag PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Themenkreis 5 STURM UND DRANG Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte (1983, 204) In
LITERATUR II Lehrstuhl für Germanistik, Päd. Fakultät der Karls-Universität in Prag PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Themenkreis 5 STURM UND DRANG Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte (1983, 204) In
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur... 86
 Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 14 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 17 2. Textanalyse und -interpretation... 19 2.1 Entstehung
Inhalt Vorwort... 5... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 14 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 17 2. Textanalyse und -interpretation... 19 2.1 Entstehung
Inhalt. Vorwort... 5. 3. Themen und Aufgaben... 94. 4. Rezeptionsgeschichte... 97. 5. Materialien... 100. Literatur... 109
 Inhalt Vorwort... 5... 6 1.1 Biografie... 6 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 7 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 14 2. Textanalyse und -interpretation... 27 2.1 Entstehung und
Inhalt Vorwort... 5... 6 1.1 Biografie... 6 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 7 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 14 2. Textanalyse und -interpretation... 27 2.1 Entstehung und
Christian Weber. Max Kommerell. Eine intellektuelle Biographie. De Gruyter
 Christian Weber Max Kommerell Eine intellektuelle Biographie De Gruyter Inhalt I. Einleitung 1 1.1 Fragestellung 3 1.2 Forschungsstand 5 1.3 Bemerkungen zur Biographie als wissenschaftliches Genre 12 1.4
Christian Weber Max Kommerell Eine intellektuelle Biographie De Gruyter Inhalt I. Einleitung 1 1.1 Fragestellung 3 1.2 Forschungsstand 5 1.3 Bemerkungen zur Biographie als wissenschaftliches Genre 12 1.4
HÖLDERLINS SPÄTE GEDICHTFRAGMENTE
 HÖLDERLINS SPÄTE GEDICHTFRAGMENTE DIETER BURDORF Hölderlins späte Gedichtfragmente : "Unendlicher Deutung voll" Verlag 1. B. Metzler Stuttgart Weimar Diese Arbeit wurde durch ein Promotionsstipendium der
HÖLDERLINS SPÄTE GEDICHTFRAGMENTE DIETER BURDORF Hölderlins späte Gedichtfragmente : "Unendlicher Deutung voll" Verlag 1. B. Metzler Stuttgart Weimar Diese Arbeit wurde durch ein Promotionsstipendium der
Carl Joseph Anton Mittermaier
 Carl Joseph Anton Mittermaier 1787 1867 Ein Heidelberger Professor zwischen nationaler Politik und globalem Rechtsdenken im 19. Jahrhundert Katalog zur Ausstellung in der Universitätsbibliothek Heidelberg
Carl Joseph Anton Mittermaier 1787 1867 Ein Heidelberger Professor zwischen nationaler Politik und globalem Rechtsdenken im 19. Jahrhundert Katalog zur Ausstellung in der Universitätsbibliothek Heidelberg
Auswanderungen aus der Gemeinde Bodenheim
 en aus der Gemeinde Bodenheim (Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt) Name Herkunft Datum der Beruf Ziel Alter Bemerkungen Baumgärtner, Johann Bodenheim?? USA geb. 1904 28 Jahre Becker, Adam II. Bodenheim
en aus der Gemeinde Bodenheim (Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt) Name Herkunft Datum der Beruf Ziel Alter Bemerkungen Baumgärtner, Johann Bodenheim?? USA geb. 1904 28 Jahre Becker, Adam II. Bodenheim
Staatsarchiv Hamburg 622-1/284. Claudius. Findbuch
 622-1/284 Claudius Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Archivguteinheiten 1 622-1/284 Claudius Vorwort I. Biografische Notiz Matthias Claudius (1740-1815) wirkte als Journalist und Schriftsteller 1768-1776
622-1/284 Claudius Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Archivguteinheiten 1 622-1/284 Claudius Vorwort I. Biografische Notiz Matthias Claudius (1740-1815) wirkte als Journalist und Schriftsteller 1768-1776
Archiv für Geographie. Findbuch. Hans Fischer ( )
 Archiv für Geographie Findbuch Hans (1860 1941) , Hans (1860 1941) * 13.6.1860 Bautzen 1.5.1941 Leipzig Kartograph K 204 1880 Reifeprüfung am König-Albert-Gymnasium in Leipzig, anschl. Studium der Geographie
Archiv für Geographie Findbuch Hans (1860 1941) , Hans (1860 1941) * 13.6.1860 Bautzen 1.5.1941 Leipzig Kartograph K 204 1880 Reifeprüfung am König-Albert-Gymnasium in Leipzig, anschl. Studium der Geographie
DOROTHEE ENTRUP ADOLPH MENZELS ILLUSTRATIONEN ZU FRANZ KUGLERS GESCHICHTE FRIEDRICHS DES GROSSEN
 DOROTHEE ENTRUP ADOLPH MENZELS ILLUSTRATIONEN ZU FRANZ KUGLERS GESCHICHTE FRIEDRICHS DES GROSSEN Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Entrup, Dorothee: Adolph Menzels Illustrationen zu Franz Kuglers
DOROTHEE ENTRUP ADOLPH MENZELS ILLUSTRATIONEN ZU FRANZ KUGLERS GESCHICHTE FRIEDRICHS DES GROSSEN Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Entrup, Dorothee: Adolph Menzels Illustrationen zu Franz Kuglers
Verzeichnis der Musiknachlässe in Deutschland
 Verzeichnis der Musiknachlässe in Deutschland Berlin 2000 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut Inhalt Einführung 9 Hinweise 10 Literatur 10 Aufbau und Inhalt 11 Abkürzungen 12 Nachlassverzeichnis 15
Verzeichnis der Musiknachlässe in Deutschland Berlin 2000 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut Inhalt Einführung 9 Hinweise 10 Literatur 10 Aufbau und Inhalt 11 Abkürzungen 12 Nachlassverzeichnis 15
Der Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi und Helene Elisabeth von Clermont Bildnisse und Zeitzeugnisse. Jan Wartenberg
 Der Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi und Helene Elisabeth von Clermont Bildnisse und Zeitzeugnisse Jan Wartenberg Jan Wartenberg DER FAMILIENKREIS FRIEDRICH HEINRICH JACOBI UND HELENE ELISABETH
Der Familienkreis Friedrich Heinrich Jacobi und Helene Elisabeth von Clermont Bildnisse und Zeitzeugnisse Jan Wartenberg Jan Wartenberg DER FAMILIENKREIS FRIEDRICH HEINRICH JACOBI UND HELENE ELISABETH
JOHANN PAUL ANSELM FEUERBACH SEIN LEBEN ALS DENKER, GESETZGEBER UND RICHTER
 JOHANN PAUL ANSELM FEUERBACH SEIN LEBEN ALS DENKER, GESETZGEBER UND RICHTER VON EBERHARD KIPPER 2., UNVERÄNDERTE AUFLAGE CARL HEYMANNS VERLAG KG KÖLN BERLIN BONN MÜNCHEN INHALTSÜBERSICHT I- I. Einleitung:
JOHANN PAUL ANSELM FEUERBACH SEIN LEBEN ALS DENKER, GESETZGEBER UND RICHTER VON EBERHARD KIPPER 2., UNVERÄNDERTE AUFLAGE CARL HEYMANNS VERLAG KG KÖLN BERLIN BONN MÜNCHEN INHALTSÜBERSICHT I- I. Einleitung:
Sturm und Drang Epoche - Werke - Wirkung
 Sturm und Drang Epoche - Werke - Wirkung Von Ulrich Karthaus unter Mitarbeit von Tanja Manß Zweite, aktualisierte Auflage Verlag C. H. Beck München Inhalt Vorwort 11 Zur Zitierweise 13 I. Kapitel: Die
Sturm und Drang Epoche - Werke - Wirkung Von Ulrich Karthaus unter Mitarbeit von Tanja Manß Zweite, aktualisierte Auflage Verlag C. H. Beck München Inhalt Vorwort 11 Zur Zitierweise 13 I. Kapitel: Die
Klee in Bern in Leichter Sprache
 Zentrum Paul Klee Klee ohne Barrieren Klee in Bern in Leichter Sprache 2 Um was geht es? Die Stadt Bern hat eine wichtige Rolle im Leben von Paul Klee gespielt. Die Ausstellung Klee in Bern zeigt das auf.
Zentrum Paul Klee Klee ohne Barrieren Klee in Bern in Leichter Sprache 2 Um was geht es? Die Stadt Bern hat eine wichtige Rolle im Leben von Paul Klee gespielt. Die Ausstellung Klee in Bern zeigt das auf.
QUELLEN UND ABHANDLUNGEN ZUR MITTELRHEINISCHEN K I RCHENGESCH I CHTE IM AUFTRAGE DER GESELLSCHAFT FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE
 QUELLEN UND ABHANDLUNGEN ZUR MITTELRHEINISCHEN K I RCHENGESCH I CHTE IM AUFTRAGE DER GESELLSCHAFT FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE HERAUSGEGEBEN VON FRANZ RUDOLF REICHERT BAND 17 BEITRÄGE ZUR MAINZER
QUELLEN UND ABHANDLUNGEN ZUR MITTELRHEINISCHEN K I RCHENGESCH I CHTE IM AUFTRAGE DER GESELLSCHAFT FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE HERAUSGEGEBEN VON FRANZ RUDOLF REICHERT BAND 17 BEITRÄGE ZUR MAINZER
Paul Klee und Wassily Kandinsky in Leichter Sprache
 Zentrum Paul Klee Klee ohne Barrieren Paul Klee und Wassily Kandinsky in Leichter Sprache 2 Die frühen Jahre Paul Klee Paul Klee ist 1879 in Bern geboren. Hier verbringt er seine Kindheit und Jugend. Seine
Zentrum Paul Klee Klee ohne Barrieren Paul Klee und Wassily Kandinsky in Leichter Sprache 2 Die frühen Jahre Paul Klee Paul Klee ist 1879 in Bern geboren. Hier verbringt er seine Kindheit und Jugend. Seine
Die Bibliothek des Frey-Grynaeischen Instituts
 Die Bibliothek des Frey-Grynaeischen Instituts eine einzigartige Gelehrtenbibliothek? Vortrag von lic.phil. Susanne Schaub Fachreferentin / Leiterin Bibliothek Theologische Fakultät Universität Basel Themenabend
Die Bibliothek des Frey-Grynaeischen Instituts eine einzigartige Gelehrtenbibliothek? Vortrag von lic.phil. Susanne Schaub Fachreferentin / Leiterin Bibliothek Theologische Fakultät Universität Basel Themenabend
Nachfahren von Hans Rexsrodt
 1 Hans Rexsrodt * um 1480 um 1540 Wannfried a. d. Werra (Heidi Banse) Kinder 1.1 Joachim Rexsrodt * um 1510 um 1570 Wannfried a. d. Werra (Chronik der Familie Rexroth aus Wannfried a.d Werra) (Heidi Banse)
1 Hans Rexsrodt * um 1480 um 1540 Wannfried a. d. Werra (Heidi Banse) Kinder 1.1 Joachim Rexsrodt * um 1510 um 1570 Wannfried a. d. Werra (Chronik der Familie Rexroth aus Wannfried a.d Werra) (Heidi Banse)
Ingeborg Bachmanns 'An die Sonne': Loboder
 Germanistik Daniela Becker Ingeborg Bachmanns 'An die Sonne': Loboder Klagelied? Studienarbeit Eberhard-Karls-Universität Tübingen Deutsches Seminar Hauptseminar: Ingeborg Bachmann: Gedichte und frühe
Germanistik Daniela Becker Ingeborg Bachmanns 'An die Sonne': Loboder Klagelied? Studienarbeit Eberhard-Karls-Universität Tübingen Deutsches Seminar Hauptseminar: Ingeborg Bachmann: Gedichte und frühe
Q.. 1m Schatten cler Moclernitiit (1)
 1m Schatten cler Moclernitiit ~ o...... 2.... Q.. (1) ~: NIKLAUS PETER 1m Schatten cler Moclernitat - Franz Overbecks Weg zur» Christlichkei t unserer heutigen Theologie«J.B. METZLER VERLAG STUTTGART WEIMAR
1m Schatten cler Moclernitiit ~ o...... 2.... Q.. (1) ~: NIKLAUS PETER 1m Schatten cler Moclernitat - Franz Overbecks Weg zur» Christlichkei t unserer heutigen Theologie«J.B. METZLER VERLAG STUTTGART WEIMAR
Karl Otmar v. Aretin. Das Alte Reich Band 3: Das Reich und der österreichisch-preußische Dualismus ( ) Klett-Cotta
 Karl Otmar v. Aretin Das Alte Reich 1648-1806 Band 3: Das Reich und der österreichisch-preußische Dualismus (1745-1806) Klett-Cotta Vorwort 11 Einleitung...: 13 Kapitel 1 Das Heilige Römische Reich unter
Karl Otmar v. Aretin Das Alte Reich 1648-1806 Band 3: Das Reich und der österreichisch-preußische Dualismus (1745-1806) Klett-Cotta Vorwort 11 Einleitung...: 13 Kapitel 1 Das Heilige Römische Reich unter
Bestand C Nachlass Alexander Ecker bearbeitet von Agata Chojnacka
 UNIVERSITÄTSARCHIV DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG I. BR. Bestand C 0120 Nachlass Alexander Ecker 1808-1892 bearbeitet von Agata Chojnacka 2005 Universitätsarchiv der Albert-Ludwigs-Universität,
UNIVERSITÄTSARCHIV DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG I. BR. Bestand C 0120 Nachlass Alexander Ecker 1808-1892 bearbeitet von Agata Chojnacka 2005 Universitätsarchiv der Albert-Ludwigs-Universität,
ROMANTIK. Sie war in allen Künsten und in der Philosophie präsent. Die Romantik war eine Gegenwelt zur Vernunft, also zur Aufklärung und Klassik
 ROMANTIK Eine gesamteuropäische Geistes- und Kunstepoche, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts andauerte Sie war in allen Künsten und in der Philosophie
ROMANTIK Eine gesamteuropäische Geistes- und Kunstepoche, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts andauerte Sie war in allen Künsten und in der Philosophie
Lyriktheorie. Philipp Reclam jun. Stuttgart. Texte vom Barock bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Ludwig Völker
 Lyriktheorie Texte vom Barock bis zur Gegenwart Herausgegeben von Ludwig Völker 14905340 Philipp Reclam jun. Stuttgart Inhalt Einleitung 7 1. Martin Opitz: Von der Disposition oder abtheilung der dinge
Lyriktheorie Texte vom Barock bis zur Gegenwart Herausgegeben von Ludwig Völker 14905340 Philipp Reclam jun. Stuttgart Inhalt Einleitung 7 1. Martin Opitz: Von der Disposition oder abtheilung der dinge
Ausstellungen der Universitätsbibliothek
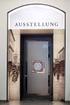 der Universitätsbibliothek 16.01.2001-23.02.2001 [113] Thomas Mann, Dr. Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde Professor Dr. Ruprecht Wimmer: Thomas Manns
der Universitätsbibliothek 16.01.2001-23.02.2001 [113] Thomas Mann, Dr. Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde Professor Dr. Ruprecht Wimmer: Thomas Manns
Arbeitsblätter zu Episode 2: Wohin es geht!
 Arbeitsblätter zu Episode 2: Wohin es geht! Arbeitsblatt 1 Erste Stunde Aktivität 1: Comic Sieh die Zeichnungen an. Welche Farben dominieren? Unterstreiche. gelb braun blau rot grün weiß schwarz grau rosa
Arbeitsblätter zu Episode 2: Wohin es geht! Arbeitsblatt 1 Erste Stunde Aktivität 1: Comic Sieh die Zeichnungen an. Welche Farben dominieren? Unterstreiche. gelb braun blau rot grün weiß schwarz grau rosa
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Caspar Rudolph von Jurist Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Caspar Rudolph von Jurist Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
als Sohn einer Arztfamilie in Portiers (Frankreich) Doppelstudium: Philosophie und Psychologie. Ausbildung durch:
 Zeittafel Geb. 1926 als Sohn einer Arztfamilie in Portiers (Frankreich) Doppelstudium: Philosophie und Psychologie. Ausbildung durch: Jean Hyppolite Maurice Merleau-Ponty Louis Althusserl u.a. Arbeitet
Zeittafel Geb. 1926 als Sohn einer Arztfamilie in Portiers (Frankreich) Doppelstudium: Philosophie und Psychologie. Ausbildung durch: Jean Hyppolite Maurice Merleau-Ponty Louis Althusserl u.a. Arbeitet
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Philosoph Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Philosoph Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Vorwort. Brief I An Claudine. Brief II Die Idylle und die Zäsur. Brief III Ein Hurenhaus in Wien. Brief IV Wiener Kreise
 Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
SE + VL: Erziehungskonzepte: Schiller und Rousseau Mo Uhr (aus SE und VL kombinierte Intensivveranstaltung) Wintersemester 2016/17
 SE + VL: Erziehungskonzepte: Schiller und Rousseau Mo 8.30 11.30 Uhr (aus SE und VL kombinierte Intensivveranstaltung) Wintersemester 2016/17 Prof. Dr. Jutta Osinski PROGRAMM 1) 17.10. Organisation des
SE + VL: Erziehungskonzepte: Schiller und Rousseau Mo 8.30 11.30 Uhr (aus SE und VL kombinierte Intensivveranstaltung) Wintersemester 2016/17 Prof. Dr. Jutta Osinski PROGRAMM 1) 17.10. Organisation des
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Heinrich Ritter von Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Heinrich Ritter von Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Alfred Altphilologe Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Alfred Altphilologe Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
FRANKFURTER GOETHE-HAUS FREIES DEUTSCHES HOCHSTIFT Textsammlung Jean Paul und Goethe zwei Leben
 1 Die Geburt in Frankfurt Die Geburt in Wunsiedel Die Geburt in Bethlehem Seite 5-7 Geburtsmythen Vergleichen Sie die drei Geburtsmythen: Unter welchem Stern wird das Kind geboren? Welche Rolle soll es
1 Die Geburt in Frankfurt Die Geburt in Wunsiedel Die Geburt in Bethlehem Seite 5-7 Geburtsmythen Vergleichen Sie die drei Geburtsmythen: Unter welchem Stern wird das Kind geboren? Welche Rolle soll es
