Optimale Förderung des Mädchenfußballs aus Vereinssicht
|
|
|
- Stefanie Fromm
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Optimale Förderung des Mädchenfußballs aus Vereinssicht Heinz Reinders Vertiefende Ergebnisse der BFV-Studie 2015 Schriftenreihe des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen - Band 3
2 Nachwuchsförderzentrum für Juniorinnen Unterfranken Ein Kooperationsprojekt des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung mit dem Sportzentrum der Julius-Maximilians- Universität Würzburg. Sportzentrum am Hubland D Würzburg Fon +49 (931) Fax +49 (931) Dieses Dokument wird bereitgestellt durch den Online-Publikationsserver der Universität Würzburg Universitätsbibliothek Würzburg Am Hubland Würzburg Tel.: +49 (931) Fax: +49 (931) opus@bibliothek.uni-wuerzburg.de ISSN eisbn Coverfoto: NFZ Unterfranken Gestaltung und Design: Heinz Reinders
3 Optimale Förderung des Mädchenfußballs aus Vereinssicht Heinz Reinders Vertiefende Ergebnisse der BFV-Studie 2015 Schriftenreihe des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen - Band 3
4
5 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 09 2 Über die Studie Befragte Stichprobe Differenzierung der Vereine 14 3 Ziele im Mädchenfußball Soll-Zustände der Vereinsziele Ist-Zustände der Vereinsziele Fazit 20 4 Hemmnisse beim Zugang zum Mädchenfußball Ursachen geringer Mädchenbeteiligung Unterschiede zwischen den Vereinstypen Fazit 25 5 Vorstellungen zur Talentförderung aus Vereinssicht Vorstellungen zur Talentförderung Unterschiede zwischen den Vereinstypen Fazit 32 6 Merkmale von Leistungssportvereinen Modell zu Merkmalen von Leistungsvereinen Fazit 35 7 Diskussion und Ausblick 36 Literaturverzeichnis 38 Der Autor 40 5
6
7 Zusammenfassung Dieser Band berichtet die Ergebnisse einer Befragung bei Fußballvereinen aus Bayern, die ab Herbst 2015 in Kooperation des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung der Universität Würzburg mit dem Bayerischen Fußball-Verband durchgeführt wurde. Vertiefend zu den Gesamtergebnissen der Studie werden in dieser Publikation die Einschätzungen der Vereine zur Talentförderung im Mädchenfußball in den Blick genommen. Die drei Hauptfragen sind: Welchen Stellenwert haben Ziele der Mädchenförderung und deren Umsetzung in den Vereinen? Welche Hemmnisse werden beim Zugang von Mädchen zum Vereinsfußball wahrgenommen? Welche Vorstellungen von Talentförderung im Mädchenfußball haben die Vereine? Alle drei Fragestellungen wurden nochmals danach aufgegliedert, welche Erfahrungen die Vereine im Mädchenfußball haben und Leistungssportvereine sowie Breitensportvereine im Mädchenfußball mit Vereinen ohne Mädchenfußball verglichen. Der bayerische Mädchenfußball steuert auf eine Krise zu Nicht nur die Anzahl aktiver Spielerinnen und gemeldeter Mädchenteams geht in den Vereinen seit 2011 zurück. Auch die Ziele der Mädchenförderung haben seither deutlich an Prominenz eingebüßt. Bayerische Fußballvereine erachten die Förderung von Mädchen und die Etablierung des Mädchenfußballs immer weniger als erreichbares oder umgesetztes Ziel. Details hierzu ab Seite 15. Strukturelle Hürden verhindern den Zugang zum Vereinsfußball Vereine nehmen eine zu geringe Begeisterung von Mädchen für den Fußball durch Schule und Elternhaus sowie tendenziell durch die Möglichkeiten der Vereine wahr. Mädchen werden als sehr geeignet für Fußball angesehen, aber es fehlt Vereinen an Unterstützung, sie in den Mädchenfußball zu holen. Details hierzu ab Seite 22. Der bayerische Mädchenfußball wünscht sich den Wandel Die große Mehrheit der Vereine wünschen sich den Wandel in der Talentförderung von Mädchen. Sie begrüßen eigene Förderstützpunkte für Mädchen, sehen den Weg in den Leistungssport nicht nur über den Jungenfußball und brauchen die breite Basis für die Förderung in der Spitze. Vor allem Leistungsfußball-Vereine suchen den Wandel im Mädchenfußball. Details hierzu ab Seite 27. 7
8 Auch Mädchen werden im Stützpunktprogramm des BFV gleichberechtigt gefördert. Broschüre Die Talentförderung des BFV 8
9 1 Einleitung Die Förderung von Mädchen im Vereinsfußball und die Talentförderung an besonderen Leistungszentren für Mädchen ist das Schwerpunktthema des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen in Unterfranken (NFZ). Der Grund hierfür ist die aktuelle Ausgangslage im bayerischen Fußball. Sie sieht, ebenso wie die Gesamtstrategie des Deutschen Fußball-Bundes vor, Mädchen in den Verbandszentren gemeinsam mit Jungen trainieren zu wollen. Hiervon unbenommen sind die Nachwuchsleistungszentren, die direkt bei den Vereinen der Frauen-Bundesliga angesiedelt sind, in denen eine spezifische Förderung für Mädchen angeboten wird. Die Einschätzung von Verbandsseite ist demgegenüber eindeutig, wonach eine optimale Förderung von Mädchen nur erfolgen könne, wenn diese gemeinsam mit Jungen an den Stützpunkten trainiert werden. Landläufige Behauptungen sind, dass Mädchen möglichst lange in Jungenteams spielen sollten. Hinzu kommen offizielle Aussagen im BFV-Flyer zur Talentförderung, wonach Mädchen im Stützpunktprogramm des BFV gleichberechtigt gefördert werden. Diese Aussage ist jedoch für die 2014 gesichteten Mädchen in Bayern empirisch betrachtet unzutreffend. Jungen wiesen bei der Sichtung in Bayern eine knapp 1,4-fach höhere Wahrscheinlichkeit als Mädchen auf, Eingang in das verbandliche System zu erhalten (Reinders, Hoos & Haubenthal, 2015, S. 14f.). Dieses Beispiel zeigt die Möglichkeiten empirischer Forschung auf: subjektive Annahmen oder aufgestellte Aussagen kritisch zu hinterfragen und Daten zu sammeln und zu sortieren, die einen differenzierteren Blick ermöglichen. Besonders wesentlich erscheint dies hinsichtlich der verschiedenen Perspektiven auf die optimale Förderung im Mädchenfußball. Basiert die offizielle Verbandspolitik auf wissenschaftlich fundierten Daten und berücksichtigt sie die Erfahrungen aus den Fußballvereinen? Die erste Frage konnte bereits bearbeitet werden. Die offizielle Linie gemeinsamer Stützpunkttrainings von Mädchen und Jungen entspricht nicht den allgemeinen geschlechtsspezifischen Entwicklungen im motorischen und psychosozialen Bereich. Zu sehr unterscheiden sich die körperlichen Entwicklungsprozesse und Selbstkonzepte, als dass generell vom gemischten Fördermodell als passende und optimale Förderung gesprochen werden kann (für eine Zusammenfassung des Forschungsstands siehe Reinders, Hoos & Haubenthal, 2015). Die zweite Frage ist bislang unbeantwortet. Handelt es sich um eine breite Mehrheit der Vereine, die eine gemeinsame Förderung von Mädchen und Jungen befürworten? Sind die meisten Vereine der Ansicht, talentierte Mädchen müssten möglichst lange in Jungenteams spielen, um ihr Talent optimal entwickeln zu können? Dass die InitiatorInnen des NFZ diese Perspektive nicht vertreten, sondern eine spezifische Mädchenförderung für sinnvoll erachten, ist Grundpfeiler für die Gründung des NFZ. Insofern würden die Antworten aus dem NFZ nicht verwundern. Dass allerdings die zum Teil deutliche Mehrheit der Vereine in Bayern nicht der offizi- Unterschiedliche Auffassungen optimaler Förderung Zwei Fragestellungen 9
10 Vereinsansichten als aggregierte Erfahrungen ellen Verbandslinie folgt, ist demgegenüber durchaus überraschend. Eine Mehrheit der im Rahmen der BFV-Studie 2015 befragten Vereinsfunktionäre sieht die Förderlandschaft durchaus differenziert und kann sich neben dem bestehenden System durchaus eine weitere Förderrichtung vorstellen. Die Ansichten der Vereine werden dabei als eine Art Zusammenfassung der Alltagserfahrungen aus der Vereinsarbeit angesehen. Die in der BFV-Studie 2015 geäußerten Perspektiven sind das Resultat langjähriger Basisarbeit in der Breiten- und in der Leistungsförderung. Gleichzeitig wird sich zeigen, dass diese Perspektiven nicht einheitlich sind, sondern sich anhand bestimmter Merkmale der Vereine differenzieren lassen. So befürworten etwa Vereine mit Mädchenteams im Leistungsbereich die Etablierung von Mädchenstützpunkten deutlicher als Vereine mit Mädchenfußball im Breitensport. Daraus folgt, dass sich systematisch Gründe dafür ableiten lassen, warum und unter welchen Bedingungen Fußballvereine andere Wege als die bislang genutzten gehen wollen. Es ist dabei eine Unterscheidung zwischen tatsächlich wirksamen Maßnahmen einerseits und Erfahrungen aus den Vereinen andererseits vorzunehmen. Nur weil bspw. die Mehrheit der Vereine die Etablierung eigener Stützpunkte für den Mädchenfußball befürwortet, ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass dies tatsächlich eine bessere Talentförderung ermöglicht. Zumindest aber ist die in der Befragung der Vereine kondensierte Basiserfahrung ein weiterer Baustein zur Verbesserung der Förderstrukturen. Dieser Band widmet sich daher diesen Fragen und leistet einen Beitrag zu empirisch gesicherten Aussagen über die aktuelle Situation und Handlungsbedarfe für die Zukunft. Zunächst wird die Datenbasis der Studie vorgestellt, um sodann deskriptive Befunde zur Wahrnehmung der Mädchenförderung aus Perspektive der Vereine zu berichten. Unterschiede zwischen den Vereinen werden anhand ausgewählter Strukturmerkmale dieser Vereine erklärt und ein Modell zu Merkmalen von Leistungssportvereinen im Mädchenfußball präsentiert. In der abschließenden Diskussion werden die Befunde kritisch beleuchtet und Folgerungen für die Praxis der Mädchenförderung gezogen. 10
11 2 Über die Studie Die in diesem Band dargestellten Ergebnisse zur Vereinssicht auf die Mädchenförderung basieren auf Daten einer repräsentativen Befragung von Vereinen mit Jugendfußball in ganz Bayern. Diese als BFV-Studie bekannte Untersuchung wird seit 2011 im zweijährigen Turnus durchgeführt und richtet sich an Funktionsträger (Vorstand, Abteilungsleitung Fußball, Abteilungsleitung Jugendfußball) in den Vereinen. Die Vereine wurden mittels elektronischem Postfachsystem des BFV auf die Studie aufmerksam gemacht und zur Teilnahme aufgefordert (vgl. ausführlich Reinders, 2016). 2.1 Befragte Stichprobe Die diesjährige Online-Befragung von insgesamt Vereinen ab Herbst 2015 wurde um den Fragebereich der Förderung im Mädchenfußball erwei- können alle Bezirke des Bayerischen Fußball-Verbandes gleichermaßen berücksichtigt werden (vgl. Abbildung 1). Über befragte Vereine Verteilung nach Bezirken Unterfranken Mittelfranken Oberfranken Oberpfalz Schwaben Niederbayern Oberbayern 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Oberbayern Niederbayern Schwaben Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken BFV-Studie 20,2 12,4 14,0 9,7 12,6 13,8 17,3 BFV 20,4 11,6 13,7 9,4 12,9 14,0 18,0 Abbildung 1: Verteilung der befragten Vereine auf die Bezirke des BFV und Gesamtverteilung aller BFV-Vereine Mit Ausnahme kleinerer, statistisch nicht relevanter Abweichungen in bspw. Unterfranken oder Niederbayern, wird der zahlenmäßige Anteil der Gesamtvereine im BFV gut durch die gezogene Stichprobe abgebildet. So basieren die Daten mehrheitlich auf Angaben aus Vereinen aus Oberbayern (20,2 Prozent), 17,3 Prozent der Vereine sind in Unterfranken angesiedelt. Gemäß der BFV-Relationen bildet auf der anderen Seite des Spektrums auch in der BFV-Studie die Oberpfalz mit 9,7 Prozent der befragten Fußballvereine den kleinsten bayerischen Bezirk. Repräsentative Stichprobe für Bayern 11
12 Sinkender Anteil an Mädchen im Verein Im Durchschnitt verfügen die befragten Vereine über 128,6 Mitglieder (SD = 83,41) in ihren Jugendabteilungen, darunter im Durchschnitt 15,8 Mädchen (SD = 25,66). Dies entspricht einer Quote von knapp über zwölf Prozent. Der Vergleich mit den Erhebungen aus den Jahren 2011 und 2013 Jugendabteilungen (vgl. Abbildung 2). Abbildung 2: Relativer Anteil der Mädchen und Jungen in den Jugendabteilungen zwischen 2011 und 2015 (Angaben in Prozent) Zwar stieg der Anteil an Mädchen zwischen 2011 und 2013 von 13,4 auf liegt mit 12,3 Prozent noch unter dem Anteil von vor vier Jahren. Bei den weiteren Auswertungen wird zwischen Vereinen differenziert, die über mehr als zehn Prozent Mädchenanteil verfügen (44,5 Prozent) und solchen, die über weniger Mädchen verfügen (55,5 Prozent). Abnahme der Mädchenteams Auch in den Befragungen der Vereine spiegelt sich ein Trend wider, wonach die Zahl der Mädchenteams im bayerischen Spielbetrieb seit 2011 deutlich In der befragten Stichprobe sinkt der Anteil gemeldeter Mädchenteams vor allem bei den U17- sowie U13-Juniorinnen zwischen 2013 und Darin abgebildet ist noch nicht der Wechsel innerhalb der U17 vom Groß- zum Kleinfeld. Weiterhin ist die sehr geringe Anzahl an Teams im Bereich der U11-Juniorinnen augenfällig. Lediglich vier Prozent aller befragten Vereine geben an, in diesem Alter bereits U11-Juniorinnen für den Spielbetrieb gemeldet zu haben. Dabei ist die Stichprobe in diesem Bereich selektiv und überschätzt den prozentualen Anteil an Vereinen mit U11-Mädchenteams. In ganz Bayern guläre U11-Teams gemeldet. Dies entspricht bei derzeit bayerischen Fußballvereinen einer Quote von gerade einmal 1,6 Prozent. Von diesen 73 12
13 U7 U9 U11 U13 U15 U Abbildung 3: Relativer Anteil gemeldeter Mädchenteams 2015 (Angaben in Prozent) Vereinen haben 52 an der Studie teilgenommen, so dass offenbar vor allem engagierte Vereine mit Mädchenteams ein großes Interesse daran haben, ihre Sichtweisen auf den Jugendfußball darstellen zu können. Reine Mädchenteams sind bei der U7 und U9 kaum vorhanden. Eigene Ligen bestehen in Bayern für diese Altersgruppe nicht, so dass diese Teams, falls überhaupt, im Spielbetrieb der Jungen gemeldet sein müssten. Teilnahme engagierter Mädchenvereine Für die weiteren Auswertungen werden Vereine danach unterschieden, ob sie Mädchenteams im Spielbetrieb gemeldet haben (Mädchenfußballvereine, MV; 16,1 Prozent) oder nicht (Jungenfußballvereine, JV; 83,9 Prozent). Innerhalb dieser Vereine mit Mädchenfußball zeigen sich in der Stichprobe nochmals Unterschiede hinsichtlich der Teilnahme in unterschiedlichen Ligen. Bei den U11-Juniorinnen bietet der BFV nur den Spielbetrieb in der Abbildung 4: Gemeldete Mädchenteams 2015 nach Liga (Angaben in Prozent) 13
14 Höhere Spielklassen in oberen Jugenden Gruppe an, in der U13 sind 79 Prozent der Teams auf Gruppenebene gemeldet, in der U15 noch 70,8 Prozent und in der U17 schließlich noch 63 Prozent. Die verbleibenden Vereine haben ihre Teams in den Ligen gemeldet, die in Abbildung 4 dargestellt sind. Dabei wird deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit mit den höheren Jugenden zunimmt, Teams in höheren Spielklassen zu finden. Während bei den U13- Mädchen nur 2,8 Prozent in der Bezirksliga oder Bezirksoberliga spielen, steigt dieser Anteil bis zur U17 auf 11,9 Prozent an. Auch in der Kreisklasse bzw. -liga sind vermehrt U17- und U15- als U13-Teams zu finden. Dies hängt aber auch damit zusammen, dass in den unteren Jahrgängen nicht ausreichend Teams zusammenkommen, um einen nach Leistung gestaffelten Spielbetrieb ermöglichen zu können. Insgesamt ist die Quote der höherklassig spielenden Teams im Bereich der U17-Juniorinnen am größten. Für die weiteren Auswertungen werden Vereine anhand ihrer höchsten Spielklasse unterschieden. Vereine mit einer Beteiligung von mindestens einem Team ab der Bezirksliga werden als Leistungssportvereine (LV; 5,0 Prozent)) typisiert. Alle anderen Vereine, die maximal für den Spielbetrieb bis zur Kreisliga gemeldet haben, werden als Breitensportvereine (BV; 11,1 Prozent) angesehen. 2.2 Differenzierung der Vereine Merkmale der Vereine Die Darstellung der Stichprobe hat gezeigt, dass es sich bezogen auf die Bezirke des BFV um eine repräsentative Stichprobe für den bayerischen Jugendfußball handelt. Zudem wurden Differenzierungen eingeführt, die für eine detaillierte Betrachtung der Vereine sinnvoll sind, wenn Aussagen über die Förderung des Mädchenfußballs aus Vereinssicht gemacht werden sollen. So werden Vereine ohne Mädchenfußball zum einen mutmaßlich anders über Mädchenfußball denken als Vereine mit viel Erfahrung in diesem Bereich. Zum anderen resultiert daraus auch eine unterschiedliche Interpretationsqualität. Erfahrene Vereine werden zuverlässigere Aussagen zu Anforderungen und Bedarfen liefern können als Vereine mit geringer Erfahrung. Auch Leistungssportvereine sollten auf Grund ihrer Ausrichtung andere Vorstellungen von Förderung haben als reine Breitensportvereine. Daher werden Aussagen zur Förderung im Mädchenfußball nach folgenden Merkmalen der Vereine differenziert: Vereine mit weniger vs. mit mehr als 10 Prozent Mädchenanteil; Vereine mit Jungenfußball vs. mit Mädchenfußball; Vereine mit Breiten- vs. mit Leistungssport im Mädchenfußball. Diese Differenzierung ist nicht gleichbedeutend damit, dass in allen Bereichen der Mädchenförderung Unterschiede zwischen den Vereinen bestehen müssen. Es wird vielmehr geprüft ob und in welchem Ausmaß sich diese Strukturmerkmale der Vereine darauf auswirken, welche Vorstellungen Vereine von einer optimalen Mädchenförderung haben. 14
15 3 Ziele im Mädchenfußball Den Vereinen wurden verschiedene Aussagen darüber vorgelegt, welche Ziele sie in ihren Vereinen verfolgen. Darunter waren neben allgemeinen Zielen auch spezifisch auf die Förderung von Mädchen bezogene Aussagen. Diese Ziele wurden in fünf Zielbereiche untergliedert und mit je zwei Items erfasst. Jedes Item wurde zum einen bezogen auf den Ist-Zustand beantwortet ( Bitte geben Sie an, inwieweit diese Ziele für Ihren Verein zutreffen. ), zum anderen hinsichtlich der tatsächlichen Zielerreichung ( Geben Sie nun bitte an, inwieweit Ihr Verein die folgenden Ziele erreicht hat. ): Leistungsziele Die Förderung des sportlichen Erfolgs. Die Förderung junger Talente im Fußball. Gesundheitsziele Die Förderung unsportlicher Kinder. Die Förderung gesunder Lebensweisen. Integrationsziele Die Förderung von Migrantenkindern. Die Förderung des interkulturellen Zusammenlebens. Sozialziele Die Förderung des sozialen Miteinanders. Die Förderung sozial benachteiligter Kinder. Ziele im Juniorinnen-Bereich Die Förderung des Mädchenfußballs im Verein. Die Förderung von Mädchen im Fußball. Der Soll-Zustand wurde auf einer Likertskala von 1-Trifft nicht zu bis 4-Trifft voll zu beantwortet, der Ist-Zustand der Zielerreichung auf einer Skala von 1-Gar nicht bis 4-Vollständig. Die Ergebnisse zu allen Zielen im Soll- und Ist-Zustand werden hier dargestellt, um den relativen Stellenwert der Ziele im Juniorinnen-Bereich über alle Vereine hinweg deutlich zu machen. Fünf Bereiche der Vereinsziele 3.1 Soll-Zustände der Vereinsziele Der Soll-Zustand zu jedem einzelnen Ziel bildet ab, wie wichtig den Vereinen ein Ziel ist. Je höher die Zustimmung zu einem Soll-Ziel, desto wichtiger ist dies auch für die Vereinsarbeit. Dies drückt sich in der Gesamtstichprobe dann in einem Mittelwert aus, der dem Maximalwert 4 näher rückt. Eine geringe Relevanz eines Vereinszieles drückt sich entgegengesetzt in einem kleinen Mittelwert aus, der gegen 1 geht. Die Ergebnisse zu den verschiedenen Zielen wurden bereits ausführlich in der BFV-Studie 2015 dargestellt (vgl. Reinders, 2016). Im vorliegenden Fall ist aufschlussreich, wie die Vereine die Ziele im Juniorinnen-Bereich im Vergleich zu den anderen Zielen gewichten. Die Befundlage hierzu ist Bedeutung von Zielen für Vereine 15
16 in der BFV-Studie von 2015 noch eindeutiger als in den Jahren zuvor. Die beiden Ziele, die die Förderung des Mädchenfußballs adressieren, sind über alle Vereine hinweg von deutlich nachrangiger Relevanz (vgl. Abbildung 5). des sozialen Miteinander 3,5 junger Talente im Fußball des sportlichen Erfolgs gesunder Lebensweisen sozial benachteiligter Kinder unsportlicher Kinder von Migrantenkindern interkulturellen Zusammenlebens von Mädchen im Fussball des Mädchenfußballs im Verein 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,4 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Abbildung 5: Relevanz von Vereinszielen 2015 (Angaben in Mittelwerten) Deutliche Abnahme der Ziele im Juniorinnen-Bereich Während Ziele des sozialen und sportlichen Erfolges weit oben angesiedelt werden, spielen neben Zielen der interkulturellen Integration die beiden Aspekte der Mädchenförderung eine klar unterdurchschnittliche Rolle. Ob nun Mädchen allgemein im Fußball gefördert werden (M = 2,4) oder ein Ziel ist, spielt dabei keine Rolle. In beiden Fällen liegen die Mittelwerte unterhalb des theoretischen Mittelwerts von 2,5 und damit im eher ablehnenden Bereich. 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3 2, von Mädchen im Fussball des Mädchenfußballs im Verein Abbildung 6: Relevanz der Mädchenförderung 2011 bis 2015 (Angaben in Mittelwerten) 16
17 Der Blick auf den zeitlichen Verlauf dieser Ziele verdeutlicht sodann die prekäre Entwicklung in den letzten vier Jahren (vgl. Abbildung 6). Im Jahr 2011 wurden beide Ziele noch als deutlich wichtiger erachtet als bei der jüngsten Umfrage. Insbesondere die Förderung des Mädchenfußballs, also das Stellen eigener Mädchenteams bzw. die Etablierung von Mädchenfußball im Verein, hat seit 2011 stark an Prominenz eingebüßt. Hier sinkt der Mittelwert von M = 2,5 auf M = 2,2 ab. Auch die allgemeine Förderung von Mädchen, was auch in Jungenteams erfolgen könnte, ist ein weniger wichtiges Ziel geworden. Zwischen 2011 und 2013 sinkt die mittlere Zustimmung von M = 2,7 auf M = 2,4 im Jahr 2013 und stagniert seither. Die Vermutung liegt nahe, dass im Zuge der Frauen-Weltmeisterschaft 2011 im eigenen Land eine gewisse Euphorie der Vereine zu spüren war, die dann aber deutlich zurückgegangen ist. Prekäre Entwicklung der letzten Jahre Gleichzeitig lassen sich Vereine aber auch anhand ihrer Strukturdaten differenzieren. Nicht jeder Verein schätzt die Ziele der Förderung im Mädchenfußball gleich ein (vgl. Abbildung 7) ,9 2,3 2,6 3,2 2,8 2,4 3,1 2 2,0 1,7 1,9 1 Förderung von Mädchen Förderung Mädchenfußball MQ- MQ+ JV BV LV Abbildung 7: Relevanz der Mädchenförderung 2015 nach Vereinstypen (Angaben in Mittelwerten) (MQ- Geringe Mädchenquote; MQ+ Hohe Mädchenquote; JV - Jungenverein; BV - Breitensportverein Mädchen; LV - Leistungssportverein Mädchen) Vor allem Vereine mit weniger als zehn Prozent Mädchen (MQ-) erteilen den beiden Zielen der Mädchenförderung eine deutliche Absage, egal ob es sich um die Förderung von Mädchen oder der Förderung des systemischen Ansatzes handelt. Hier liegen die Mittelwerte mit M = 2,0 resp. M = 1,7 deutlich niedriger als bei Vereinen, deren Jugendabteilungen mehr als zehn Prozent Mädchen zählt. Hier fällt die Zustimmung zu beiden Zielen mit M > 2,8 deutlich größer aus und liegt im zustimmenden Bereich des Antwortspektrums. Die Unterschiede erweisen sich bei beiden Items als si- Mädchenanteil wichtig für Zielsetzung Auch die Unterschiede zwischen Jungenvereinen (JV), Breiten- (BV) sowie Leistungssportvereinen (LV) im Mädchenfußball sind statistisch bedeutsam 17
18 Leistungsvereine mit hoher Zielsetzung bei den Leistungssportvereinen besonders hoch (M = 3,2 resp. M = 3,1) und erreicht damit einen Wert, der selbst jenen der Breitensportvereine M 2,6 resp. M = 2,4) deutlich überragt. Reine Jungenvereine hingegen können beiden Zielen kaum etwas abgewinnen (M = 2,3 resp. M = 1,9). Vor allem die Förderung des Mädchenfußballs trifft bei diesen Vereinen auf wenig Gegenliebe. Diese Ergebnisse zeigen deutlich an, dass die Umsetzung und das Engagement im Mädchenfußball eng mit entsprechenden Zielsetzungen korrespondieren. Vereine, die eine höhere Quote an Mädchen erreichen, eigene Mädchenteams stellen und vor allem wenn sie diese im Leistungsbereich verortet haben, formulieren auch entsprechende Ziele. Das bedeutet, dass vor allem Breiten- und gerade auch Leistungssportvereine als Katalysatoren zur Förderung des Mädchenfußballs in Bayern genutzt werden können. Dies wird sich auch auf der Erfahrungsebene zeigen, wenn es um den Grad der tatsächlichen Umsetzung dieser Ziele geht. 3.2 Ist-Zustände der Vereinsziele Umsetzung der Ziele Neben der Relevanz von Zielen in der Vereinsarbeit wurden die Vereine auch um eine Einschätzung darüber gebeten, inwieweit die anvisierten Ziele bereits erreicht wurden. Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass Insofern spiegelt sich die relative Rangfolge der Vereinsziele auch in den Einschätzungen wieder, in welchem Ausmaß Ziele als erreicht gelten können (vgl. Abbildung 8). des sozialen Miteinander 3,1 junger Talente im Fußball des sportlichen Erfolgs sozial benachteiligter Kinder von Migrantenkindern interkulturellen Zusammenlebens unsportlicher Kinder gesunder Lebensweisen 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 von Mädchen im Fussball 1,9 Förderung Mädchenfußball 1,4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Abbildung 8: Aktueller Stand erreichter Vereinsziele 2015 (Angaben in Mittelwerten) Auch bei den Vereinserfolgen steht das Erreichen des sozialen Miteinanders ganz oben auf der Liste, gefolgt von der Talentförderung bzw. der Förderung des sportlichen Erfolges. Weit abgeschlagen von den anderen erreichten 18
19 Zielen sind jene der Förderung von Mädchen im Fußball (M = 1,9) sowie der Förderung des Mädchenfußballs insgesamt (M = 1,4). Damit bleiben nicht nur viele Vereine hinter ihren eigenen Zielen im Bereich Mädchenfußball zurück. Auch drückt sich gerade im abgeschlagenen Wert bei der Förderung des Mädchenfußballs aus, dass hier ein erhebliches Entwicklungspotenzial enthalten ist. Denn ein Mittelwert von M = 1,4 bedeutet, dass im Grunde fast alle Vereine der Ansicht sind, dieses Ziel kaum oder gar nicht erreicht zu haben (vgl. Kapitel 5). Faktisch kaum Zielerreichung im Mädchenfußball Die Erfolge im Bereich des Mädchenfußballs werden zudem seit 2011 von den befragten Vereinen zunehmend skeptischer eingeschätzt. Dies gilt sowohl für die Förderung von Mädchen als auch jene des Mädchenfußballs insgesamt im Verein (vgl. Abbildung 9). 2,3 2,0 1,9 1,7 1,6 1, Förderung Mädchenfußball von Mädchen im Fussball Abbildung 9: Aktueller Stand erreichter Vereinsziele in der Mädchenförderung 2011 bis 2015 (Angaben in Mittelwerten) Bereits im Jahr 2011 waren die befragten Vereine eher zurückhaltend in ihren Einschätzungen zur Mädchenförderung (M = 1,7 resp. M = 2,3). Seither ist der Stand dieser Vereinsziele noch weiter kontinuierlich gesunken und er- wie bei den Soll-Zuständen verfolgter Vereinsziele ist der Rückgang auch beim Ist-Zustand der Förderung des Mädchenfußballs deutlich. Das bedeutet, dass die Vereine in nur schwach moderater Form Mädchen im Verein fördern (was der geringen Zahl an Mädchen in den Vereinen entspricht). Mädchenfußball als systemischer Ansatz wird aber noch mal deutlicher als unerreicht angesehen. Der negative Trend zeigt sich in den verschiedenen Vereinstypen in unterschiedlicher Ausprägung. Dabei wird das Muster aus den Soll-Zuständen der Vereinsziele auch beim erreichten Ist-Zustand repliziert. Strukturdaten der Vereine zu ihrer Beteiligung am Mädchenfußball stehen in einem sehr deutlichen Zusammenhang zur Erreichbarkeit von Zielen. Allgemein ergibt sich das Bild einer steigenden Zielerreichung mit steigender Anzahl Mädchen und höherer Beteiligung am Leistungsfußball (vgl. Abbildung 10). Bei bei- Negativer Trend bei unterschiedlichen Vereinstypen 19
20 4 3 2,8 2 1,5 2,4 1,8 2,1 1,1 1,9 1,3 1,7 2,3 1 Förderung von Mädchen Förderung Mädchenfußball MQ- MQ+ JV BV LV Abbildung 10: Erreichte Ziele der Mädchenförderung 2015 nach Vereinstypen (Angaben in Mittelwerten) (MQ- Geringe Mädchenquote; MQ+ Hohe Mädchenquote; JV - Jungenverein; BV - Breitensportverein Mädchen; LV - Leistungssportverein Mädchen) den Items erweisen sich die Unterschiede zwischen den Vereinstypen als Besonders selten wird das Ziel der Förderung von Mädchen in Vereinen mit weniger als zehn Prozent Mädchenanteil erreicht (MQ-), gleiches gilt für die allgemeine Förderung des Mädchenfußballs. Leistungsvereine (LV) haben am ehesten den Eindruck, dass ihnen die Förderung beider Bereiche gelingt, wobei sie mit dem Status ihrer Förderung des Systems Mädchenfußball weniger zufrieden sind als mit der Förderung von Mädchen im Besonderen. Historischer Tiefststand bei der Zielerreichung Damit kann für die Zielerreichung bayerischer Jugendfußballvereine festgehalten werden, dass beide Ziele der Förderung im Mädchenfußball als besonders schlecht erreicht angesehen werden, es sich 2015 um einen historischen Tiefststand der Zielerreichung handelt und lediglich Leistungssportvereine mit ihrer Zielerreichung in den positiven Antwortbereich hineinragen. 3.3 Fazit genen Vereinsziele mit anderen Zielbereichen verglichen, im historischen Vergleich dargestellt und Unterschiede zwischen strukturell verschiedenen Vereinstypen herausgearbeitet. Als Ergebnis dieser Analysen kann festgehalten werden, dass die Ziele des Mädchenfußballs eine deutlich nachrangige Rolle im bayerischen Jugendfußball spielen. Dies gilt sowohl für deren seit Beginn der systematischen Vereinsbefragung in Bayern die 20
21 schlechtesten Werte bei dem Soll- und Ist-Zustand der beiden Ziele zur Förderung des Mädchenfußballs zu verzeichnen sind; lediglich Leistungssportvereine im Mädchenfußball zu tendenziell positiveren Einschätzungen der Förderziele kommen als Breitensportvereine oder Vereine ohne (nennenswerte) Beteiligung von Mädchen. Es fehlt bedauerlicherweise an Vergleichsdaten aus anderen Landesverbänden und deren Vereinen, um das Ausmaß abschätzen zu können, in dem der bayerische Mädchenfußball in der Krise steckt. Da in Bayern seit 2011 ein Rückgang der gemeldeten Mädchenteams um ein Viertel zu verzeichnen ist (Reinders, Hoos & Haubenthal, 2015), passen diese sinkenden Zielerreichungswerte in dieses Bild und lassen zumindest die Aussage zu, dass es sich um den schlechtesten Zustand seit vier Jahren handelt. Nun ist Mädchenfußball keine Massensportart wie der Jungenfußball. Er kann sich entsprechend nicht mit den darin verfolgten Zielen messen lassen. Dies gilt zumindest quantitativ, weil eine größere Zahl an Vereinen und Teams die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, Zustimmungswerte zu Zielen und ihrer Erreichung zu dokumentieren. Gleichzeitig liegen aber mit den Daten aus 2011 und 2013 Referenzwerte vor, die besagen, dass die Förderung des Mädchenfußballs 2011 und 2013 unter den Top 4-Zielen gelandet ist, 2015 aber nicht mal mehr unter den Top 5 zu finden war (Reinders, 2016). Fehlende Vergleichsdaten Das heißt, dass unabhängig vom größeren Gewicht des Jungenfußballs eine Abnahme in der Bedeutung des Mädchenfußballs zu verzeichnen ist. Und es wird aus den Zahlen deutlich, dass diese abnehmende Bedeutung nicht langsam und schleichend erfolgt, sondern in vergleichsweise kurzem Zeitraum sehr rasch vonstatten geht. Es hat zumindest den Anschein, dass der bayerische Mädchenfußball auf eine erhebliche Krise zusteuert. Hierdurch steigt die Bedeutung von Maßnahmen, die diesem Trend entgegenwirken, um den Mädchenfußball als wichtiges Standbein im Breitenund Leistungssport in Bayern neu aufbauen zu können. Allein schon der demographische Wandel wird hier auf Verbands- und Vereinsebene Handlungsdruck erzeugen. Wünschenswerter wäre aber eine - unabhängig vom äußeren Druck formulierte - Motivation, die Mädchenfußball als qualitativ hochwertige Sportart in Bayern entwickelt. Steigende Bedeutung von Gegenmaßnahmen Nach derzeitigem Stand müssen Investitionen in diesen Bereich getätigt werden, die finanziell substanziell über die bisherigen Mittel hinausgehen und strukturell ein Neudenken in der Förderung des Mädchenfußballs ermöglichen. Das nachfolgende Kapitel wird zeigen, dass die bayerischen Jugendfußballvereine hier Wünsche äußern, die über die derzeitigen Strukturen hinausgehen und die Förderung des Mädchenfußballs weiter denken. 21
22 4 Hemmnisse beim Zugang zum Mädchenfußball Aussagen resultieren aus Vereinserfahrung Erstmals wurden in der BFV-Studie bei der Befragung 2015 Aussagen aufgenommen, die sich mit spezifischen Formen der Mädchenförderung befassen. Die Vereine hatten die Möglichkeit, ihre Ablehnung oder Zustimmung zu diesen Aussagen zu äußern. Dabei wurden Themenbereiche fokussiert, zu denen es entweder eine uneinheitliche Praxis in den Verbänden des DFB gibt (z.b. Kooperationen mit Schulen zur Etablierung von Mädchenfußball- AGs), zu denen unterschiedliche Meinungen bei TrainerInnen bestehen (z.b. Förderung talentierte Mädchen in Jungen- oder Mädchenteams) und die die Frage betreffen, welche Rolle Schule, Elternhaus aber auch die Mädchen selber beim Übergang in den Vereinssport spielen. Die Aussagen der Vereine sind dabei nicht im Sinne dessen, was (sport-) wissenschaftlich gesehen die beste Förderung darstellt. Es handelt sich vielmehr um eine Einschätzung, die aus der Erfahrung der Vereinsbasis resultiert. Deshalb ist es unumgänglich, diese Vereinseinschätzungen danach zu qualifizieren, wie umfassend die Erfahrung im Mädchenfußball ist. Während Aussagen aus reinen Jungenvereinen eher als Meinungen oder subjektive Theorien zu behandeln sind, werden Aussagen aus Mädchenvereinen als Aggregat faktischer Erfahrungen interpretiert, mithin also als verlässlichere Indikatoren, was aus Vereinssicht eine optimale Mädchenförderung darstellt. Im Folgenden werden dabei zwei Themenbereiche beleuchtet. Dies ist zum einen die Frage nach Ursachen für das Fernbleiben von Mädchen vom Fußball (vgl. Kapitel 4.1). Zum anderen werden sodann die Strukturmerkmale in den Blick genommen, die auf Unterschiede in den Einschätzungen für Hemmnisse im Mädchenfußball verweisen (vgl. Kapitel 4.2). Die Ergebnisse werden abschließend zu einem Fazit verdichtet (vgl. Kapitel 4.3). 4.1 Ursachen geringer Mädchenbeteiligung Fehlende Begeisterung in Schule und Familie Bereits seit 2011 werden die Vereine um eine Einschätzung gebeten, warum Mädchen aus ihrer Sicht seltener in den Verein gehen als Jungen (Kreiselmeyer & Reinders 2014). Seit dieser Zeit hat sich die Einschätzung über die wichtigsten und weniger wichtigen Ursachen nicht maßgeblich gewandelt (Möhwald & Weigelt-Schlesinger, 2013). Ein besonders erfreuliches Ergebnis über die die Jahre hinweg ist jenes zur Tauglichkeit von Mädchen für Fußball. Die Zeiten, in denen der DFB offiziell verlautbaren ließ, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden (DFB-Beschluss vom zum Verbot des Frauenfußballs), sind auch aus Sicht der Vereine offenbar vorbei. Kaum ein Vereinsvertreter erachtet körperliche Schwäche noch als Ursache dafür, dass Mädchen nicht Fußball spielen (können). Vielmehr sehen die Vereine Herausforderungen bei der Werbung und Begeisterung für den Mädchenfußball durch Schule und Eltern sowie auch bei der Motivation der Mädchen selbst (vgl. Abbildung 11). 22
23 Mädchen in Schule nicht für Fussball begeistert 2,7 Es gibt zu wenig Betreuerinnen im Fussball 2,6 Mädchenfussball wird zu wenig beworben 2,5 Mädchen interessieren sich nicht für Fussball 2,5 Es gibt zu wenige Vereinsangebote für Mädchen 2,5 Mädchen werden von den Eltern nicht unterstützt 2,5 Mädchen werden zu selten vom Verein eingeladen 2,2 Mädchen spielen nicht gern mit Jungen Fussball 2,1 Mädchen fühlen sich nicht ernst genommen 2,1 Mädchen sind körperlich zu schwach 1,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Abbildung 11: Ursachen der Nichtbeteiligung von Mädchen aus Vereinssicht 2015 (Angaben in Mittelwerten) An erster Stelle wird die Ursache bei Schulen gesehen, die nicht ausreichend für den Mädchenfußball begeistern würden (M = 2,7). Dahinter drängt sich ein enges Feld weiterer Ursachen, die sich auf die Vereinsbedingungen (zu Motivation der Eltern (M = 2,5) und jener der Mädchen selbst (M = 2,5) beziehen. Enges Feld verschiedener Ursachen Im Gegenzug haben die Vereine nicht den Eindruck, dass zu seltene Einladungen die Ursache für eine geringe Partizipation von Mädchen sind (M = 2,1). Auch sind die Vereine der Ansicht, dass sich Mädchen durchaus 2,9 2,6 2, Abbildung 12: Einschätzung abnehmender Werbung für den Mädchenfußball zwischen 2011 und 2015 (Angaben in Mittelwerten) 23
24 Ernst genommen fühlen und ebenso gern mit Jungen Fußball spielen würden (M jeweils 2,1). Körperliche Unzureichungen werden, wie eingangs erwähnt, im Grunde nicht als Hinderungsursache wahrgenommen (M = 1,7). Strukturelle statt individuelle Gründe Damit lässt sich als Tendenz herauslesen, dass weniger individuelle Merkmale der Mädchen, sondern eher strukturelle Charakteristika der Umgebung der Mädchen (Schule, Elternhaus, Verein) dazu führen, dass sie seltener zum Fußball in den Verein kommen. In dieses Muster fügt sich auch ein, dass der Mädchenfußball aus Sicht der Vereine zu wenig beworben wird (M = 2,5). Der Blick auf die früheren Jahre zeigt hier jedoch einen positiven Trend auf (vgl. Abbildung 12). Zwischen 2011 und 2013 nahm die Zustimmung zur fehlenden Werbung für den Mädchenfußball zu. Mittlerweile sind wieder deutlich weniger Vereine der Ansicht, dass zu wenig Werbung für den Mädchenfußball gemacht wird. Der Trend von 2011 zu 2013 lässt sich vermutlich am ehesten mit der intensiven Werbekampagne zur Frauen-WM 2011 erklären. Deren Fehlen zwei Jahre später wurde unter Umständen als massiver Einbruch in der Werbung für den Mädchen- und Frauenfußball wahrgenommen, so dass bis 2015 der Referenzrahmen Veränderungen unterlag und eine Normalisierung der Einschätzungen erfolgt ist. Insgesamt aber wünschen sich etwa die Hälfte der Vereine mehr Werbung für den Mädchenfußball. 4.2 Unterschiede zwischen den Vereinstypen Unterschiede zwischen den Vereinstypen bestehen hinsichtlich der Mädchenquote in den Jugendabteilungen lediglich im Bereich der Vereinsursachen (vgl. Abbildung 13). Abbildung 13: Zustimmung zu Vereinsursachen nach Mädchenquote der Vereine 2015 (Angaben in Mittelwerten; MQ- geringe Mädchenquote; MQ+ hohe Mädchenquote) an, dass Mädchen zu selten vom Verein eingeladen werden (M = 2,3) und dass zu wenige Vereinsangebote bestehen (M = 2,6). Sind in den Vereinen 24
25 jedoch mehr als zehn Prozent Mädchen (MQ+), sehen sie sowohl seltene Einladungen (M = 2,1) als auch wenige Angebote (M = 2,4) kaum als Ursache für die geringe Beteiligung der Mädchen an. Beide Unterschiede übrigen Ursachen unterscheiden sich Vereine nicht in Abhängigkeit ihres Mädchenanteils. ob gemeinsames Fußball spielen mit Jungen einen Hinderungsgrund darstellt. Die Gegenüberstellung von Vereinen ohne Mädchenfußball, mit terschiedliche Erfahrungen mit sich bringt (vgl. Abbildung 14). Gemeinsames Fußballspielen mit Jungen als Hemmnis 3 2,4 2,2 2 2,0 1 Ohne Juniorinnen Breitensport Leistungssport Abbildung 14: Zustimmung zur Aussage Mädchen spielen nicht gerne mit Jungen Fußball im Jahr 2015 nach Vereinstyp (Angaben in Mittelwerten) Während Sportvereine ohne Juniorinnen-Fußball der Ansicht sind, das gemeinsame Spielen mit Jungen stelle keine Zugangshürde zum Verein dar, stimmen vor allem Vereine mit Mädchen-Leistungsfußball dieser Aussage Förderung talentierter Mädchen noch am ehesten die Erfahrung einer erhöhten Hemmschwelle durch gemeinsames Fußballspielen von Mädchen und Jungen machen (vgl. ausführlich Kapitel 6). Aber auch Vereine im Breitensportfußball für Mädchen sind hier etwas skeptischer als die übrigen Vereine. Leistungsvereine sehen Hemmnis stärker 4.3 Fazit Wenn gerade Leistungssportvereine im Mädchenfußball zu der Einschätzung kommen, dass zumindest teilweise reine Mädchenteams den Zugang zum Fußball erleichtern, dann scheint dies zumindest auch ein Modell zu sein, dass als förderlich für den Leistungsfußball gesehen wird. Es handelt sich nicht um die Mehrheit der Leistungssportvereine, die diese Hemmschwelle sehen. Gleichzeitig stellt sich dann die Frage, ob nicht aus Sicht gerade des Leistungssports Mischmodelle aus Spielerinnen, die über den Jungenfußball 25
26 und solchen, die über den Mädchenfußball in den Leistungssport übertreten, eine sinnvolle Alternative darstellen. Insgesamt sehen die Vereine sehr einheitlich, dass strukturelle Hemmnisse den Zugang von Mädchen zum Vereinsfußball erschweren. Mehr Begeisterung in Schule, Elternhaus und Verein, so das zentrale Bild, senken die Schwellen für Mädchen, Fußball in ihrem Verein um die Ecke zu spielen. Maßnahmen setzen richtige Akzente Insofern setzen Maßnahmen wie Kicking Girls, bei denen Mädchen durch Schul-AGs unter Anleitung erfahrener Trainerinnen mit Fußball in Kontakt kommen, richtige Akzente. Unterschiede zwischen den Vereinstypen zeigen dann aber auch, dass vor allem Vereine mit geringer Mädchenquote noch mehr Möglichkeiten benötigen, Mädchen für Fußball zu werben, wohingegen Vereine mit höherem Mädchenanteil hier eher ihr Umfeld in der Verantwortung sehen. Schließlich ist ein bedeutsamer Befund, dass Vereine mit Mädchenfußball die Erfahrung machen, dass Mädchen in Teilen auch gerne beim Training und den Spielen unter sich bleiben. Da insbesondere Leistungssportvereine diese psychologische Hürde bei Mädchen wahrnehmen, ist hier ein genauer Blick auf gewünschte Instrumente zur Förderung von Mädchen interessant. 26
27 5 Vorstellungen zur Talentförderung aus Vereinssicht In den Katalog der BFV-Studie 2015 wurden Fragen neu aufgenommen, die sich mit der Wahrnehmung einer optimalen Talentförderung im Mädchenfußball befassen. Hintergrund hierfür ist die international unterschiedliche Herangehensweise, aber auch Differenzen, die sich zwischen den Landesverbänden des DFB ergeben. Der DFB selbst legt fest, dass die Talentförderung im Mädchenfußball über eine gemeinsame Förderung mit Jungen an den DFB- durch den sukzessiven Aufstieg in Regional- bis zu überregionalen einen möglichst langen Verbleib von Mädchen in Jungenteams bedeutet. Von diesen Vorstellungen weichen, wie benannt, einige Landesverbände in Teilen ab, andere orientieren sich eher eng an diesen Vorgaben. Interessant ist, dass diese Vorgaben nicht durch empirische Nachweise abgesichert sind. Auch lassen die fortschreitenden Erfolge anderer Nationalverbände, die ein anderes Fördermodell präferieren, die Frage nach ergänzenden Förderwegen aufkommen. Unterschiede in der Förderpraxis 5.1 Vorstellungen zur Talentförderung In diesem Abschnitt werden die Erfahrungen der Vereine zusammengefasst, die zu Aussagen über eine optimale Talentförderung verdichtet werden. Dabei stehen die Fragen im Mittelpunkt, ob Vereine grundsätzlich nur Talentierte Mädchen gibt es auch in Mädchenteams 93,6 Mädchenteams sollen gegen Jungenteams spielen 73,3 Mädchen benötigen eigene Stützpunkte zur Talentförderung Es werden zu wenige talentierte Mädchen gefördert 54,1 62,0 Talentierte Mädchen sollen nur in Jungenteams spielen 28,3 Mädchen-Leistungsfußball sollte erst ab der U17 gefördert werden 12,9 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Abbildung 15: Zustimmung zu Aussagen einer optimalen Talentförderung aus Vereinssicht 2015 (Angaben in Prozent) 27
28 Überraschende Befunde zur Förderung Fehlende Umsetzung im Verbandsfußball den Förderweg gemeinsam mit Jungen präferieren und ab welchem Alter sie eine spezifische Leistungsförderung in den Strukturen für sinnvoll erachten. Und obwohl im Nachwuchsförderzentrum für Juniorinnen prinzipiell der Ansatz einer reinen Mädchenförderung für bestimmte Spielerinnen- Typen präferiert wird und die Hoffnung besteht, dass viele Vereine dieser Philosophie folgen, waren die Auswertungen gleichwohl sehr überraschend (vgl. Abbildung 15). Zum einen stimmte die deutliche Mehrheit der Vereine der Aussage zu, dass talentierte Spielerinnen auch in Mädchenteams zu finden seien. Beeindruckende 93,6 Prozent gaben an, hier eher oder voll zuzustimmen. Damit ist nicht ausgesagt, dass es talentierte Spielerinnen aus Vereinssicht nicht in Jungenteams gibt. Auch bedeutet dies nicht, dass diese Einschätzung pauschal für alle Altersgruppen vorgenommen wird. Vielmehr ist diese hohe Zustimmung auch ein Ergebnis von Beobachtungen in höheren Altersgruppen, in denen Mädchen nur noch mit Mädchen zusammenspielen können (also ab der U17). Dennoch verweist der große Zuspruch zu dieser Aussage auch darauf, dass es kein zwingendes Merkmal guter Spielerinnen sein muss, möglichst lang in einem Jungenteam zu spielen. Für diese Interpretation spricht, dass nur 28,3 Prozent der befragten Vereine glauben, talentierte Mädchen sollten ausschließlich in Jungenteams spielen. Dieser sehr geringe Wert ist besonders überraschend, weil in informellen Gesprächen und subjektiven Theorien von TrainerInnen, selbst bis in die höchste Verbandsebene hinein, die Einschätzung vorherrscht: talentierte Mädchen sollen möglichst lange bei Jungen spielen. Knapp drei Viertel der befragten Vereine in Bayern kommen hier zu einer anderen Schlussfolgerung. Weiterhin überraschend ist, dass ebenfalls fast drei Viertel der Vereine die Ansicht äußern, Mädchenteams sollen (auch) gegen Jungenteams spielen, um eine gute Talentförderung zu ermöglichen. Mit 73,3 Prozent ist der Zuspruch auch deshalb überraschend hoch, weil im Rahmen der BFV- Strukturen gar nicht vorgesehen ist, dass Mädchenteams gegen Jungen spielen können. So wird nach Stand April 2016 die Empfehlung der DFB-Jugendordnung, dass Juniorinnen jahrgangsälter gegen Junioren spielen können (also bspw. U12-Juniorinnen im Spielbetrieb der U11-Junioren), im Bayerischen Fußballverband durch den zuständigen Ausschuss nicht genehmigt. Da drei Viertel der bayerischen Vereine Spiele gegen Junioren als geeignetes Instrument der Talentförderung erachten und Mädchen im Verlauf des Grundschulalters den Jungen in fußballrelevanten Bereichen körperlich unterlegen werden (Reinders, Hoos & Haubenthal, 2015), stellt sich die Frage, mit welcher Begründung diese Weigerung erfolgt. Auch in einem anderen, für das NFZ sehr wesentlichen Bereich, folgt die Mehrheit der Vereine nicht den Vorgaben des DFB bzw. des BFV. Fast zwei Drittel der befragten Vereine stimmen der Aussage eher oder voll zu, dass es für Mädchen eigener Stützpunkte zur Talentförderung bedarf. Damit ist noch keine Begründung geliefert, warum solche Stützpunkte eingerichtet 28
29 werden sollen. Die bloße Forderung nach eigenen Stützpunkten ist noch kein Anlass zur Annahme, dass deren Einrichtung die Talentförderung optimiert. Die Aufgliederung nach Vereinstypen wird jedoch noch zeigen, dass hinter dieser Forderung Erfahrungswerte stehen. Die Zufriedenheit mit der Förderung talentierter Spielerinnen teilt sich etwa hälftig. Mit 54 Prozent ist es etwas mehr als jeder zweite Verein, der sich hier eher weniger zufrieden zeigt. Immerhin 46 Prozent sehen hier aber keinen Nachholbedarf. Dass aber diese Förderung erst ab den U17-Juniorinnen beginnen soll, dass wollen die Vereine mehrheitlich nicht unterschreiben. Nur 12,9 Prozent der Vereine in Bayern sind der Ansicht, dass Talentförderung erst bei den 15- und 16-Jährigen starten sollte. Dies entspricht ohnehin nicht der Förderpraxis des DFB, der Spielerinnen bereits ab dem älteren Jahrgang der U11-Juniorinnen sichtet. In den übrigen Bereichen haben die Vereine durchaus Vorstellungen einer optimalen Talentförderung im Mädchenfußball, die über die Förderpraxis des DFB bzw. des BFV hinausgehen. Eigene Stützpunkte für Mädchen befürworten knapp zwei Drittel der Vereine, drei von vier Vereinen halten Spiele von Mädchen- gegen Jungenteams für ein geeignetes Förderinstrument. Gemischte Zufriedenheit bei der Förderung 5.2 Unterschiede zwischen den Vereinstypen Wie in allen vorherigen Themenbereichen auch muss bei Fragen zur optimalen Talentförderung der unterschiedliche Erfahrungshintergrund der Talentierte Mädchen gibt es auch in Mädchenteams Mädchenteams sollen gegen Jungenteams spielen Mädchen benötigen eigene Stützpunkte zur Talentförderung Es werden zu wenige talentierte Mädchen gefördert 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,7 2,7 2,8 2,5 2,5 Talentierte Mädchen sollen nur in Jungenteams spielen Mädchen-Leistungsfußball sollte erst ab der U17 gefördert werden 1,8 2,0 2,0 1,4 1,7 1,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Leistungssport Breitensport Ohne Juniorinnen Abbildung 16: Zustimmung zu Aussagen einer optimalen Talentförderung nach Vereinstypen 2015 (Angaben in Mittelwerten) 29
30 Differenzen zu Leistungsvereinen deutlich Präferenz für Mädchen- Stützpunkte Vereine berücksichtigt werden. Bei Vereinen ohne Juniorinnen-Fußball handelt es sich mutmaßlich eher um Meinungen und subjektive Theorien ohne konkrete Erfahrungsbasis. Auch bei Vereinen mit Teams im Breitensport sind die Erfahrungen zu Anforderungen im Leistungsfußball nicht aus eigener Perspektive präsent. Daher kommt für die Frage danach, wie Mädchen optimal im Leistungsfußball gefördert werden können, vor allem den Vereinen mit entsprechenden Erfahrungen besonderes Gewicht zu. Und obwohl diese Gruppe unter den Vereinen den deutlich kleinsten Anteil ausmacht, sind die Differenzen zu den übrigen beiden Vereinstypen in der Regel deutlich und fallen systematisch aus: Leistungssportvereine stimmen alternativen Formen der Talentförderung häufiger zu als Vereine im Breitensport oder ohne Juniorinnen-Teams im Spielbetrieb (vgl. Abbildung 16). Dies beginnt bereits bei der Frage, ob talentierte Mädchen auch in Juniorinnen- Teams zu finden sind. Diese Erfahrung machen Leistungssportvereine häufiger (M = 3,5) als Vereine aus dem Breitensport (M = 3,4) und vor allem als Vereine ohne Mädchenfußball. Eher einig sind sich die Vereine zwar unabhängig vom Typus darin, dass Mädchenteams gegen Jungenteams spielen sollten, ob aber Mädchen zur Talentförderung eigene Stützpunkte brauchen, befürworten mit deutlichem Abstand die Vereine im Leistungsbereich (M = 3,0 gegenüber M = 2,7). Das bedeutet, dass diejenigen Vereine mit der größten Expertise der Talentförderung bei Mädchen auch besonders nachdrücklich die Etablierung eigener Stützpunkte fordern. Im übrigen sind es auch diese Vereine, die besonders häufig der Ansicht sind, dass noch mehr talentierte Mädchen gefördert werden müssen (M = 2,8 gegenüber M = 2,5). Auch spricht die Erfahrung dieser Vereine gegen das Modell einer Talentförderung von Mädchen bei den Jungen. Gerade Leistungsvereine sind der Ansicht, dass Mädchen nicht nur in Jungenteams spielen sollen, um zu Talenten heranzureifen (M = 1,8 gegenüber M = 2,0). Und dass talentierte Mädchen erst ab den U17-Juniorinnen gefördert werden sollen, passt den Leistungsvereinen grundsätzlich nicht ins Konzept. Bei den Leistungsvereinen ist die Ablehnung gegenüber diesem Modell nochmals deutlicher (M = 1,4) als bei Breitensportvereinen (M = 1,7) oder bei Vereinen aus dem Jungenfußball (M = 1,6). Werden die Leistungsvereine aufgliedert zwischen jenen, die mindestens Landesliga oder höher spielen, wird die Zustimmung zu eigenen Förderstützpunkten (M = 3,2) und die Ablehnung zur Aussage Mädchen sollen möglichst lange bei Jungen spielen (M = 1,3) nochmals deutlicher. Um sich das Ausmaß der unterschiedlichen Zustimmungswerte nochmals plastisch vor Augen zu führen, werden die Prozentanteile der Leistungsvereine jenen aller befragten Vereine gegenübergestellt. In Abbildung 17 sind die relativen Anteile der befürwortenden Aussagen (stimmt eher, stimmt völlig) dargestellt. Da es sich im Leistungsbereich mit 65 Vereinen um eine vergleichsweise kleine Stichprobe handelt, sind vor allem große Abweichungen von besonderem Interesse. 30
31 Talentierte Mädchen gibt es auch in Mädchenteams 95,4 93,6 Mädchenteams sollen gegen Jungenteams spielen 77,3 73,3 Mädchen benötigen eigene Stützpunkte zur Talentförderung 62,0 74,6 Es werden zu wenige talentierte Mädchen gefördert 54,1 72,3 Talentierte Mädchen sollen nur in Jungenteams spielen 21,6 28,3 Mädchen-Leistungsfußball sollte erst ab der U17 gefördert werden 9,3 12,9 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Leistungsvereine Alle Abbildung 17: Zustimmung zu Aussagen einer optimalen Talentförderung bei Leistungsvereinen 2015 (Angaben in Prozent) Hier fällt insbesondere die Differenz bei der Aussage zu eigenen Förderstützpunkten für Mädchen auf. Wie bereits benannt stimmen 62,0 Prozent aller bayerischen Fußballvereine dieser Aussage zu. Unter den Vereinen mit Mädchen-Leistungsfußball steigt dieser Anteil auf 74,6 Prozent an. Damit wünschen sich drei von vier Vereinen im Leistungsbereich Leistungszentren nur für Mädchen. Dies sind immerhin 50 Vereine allein in Bayern. Ebenfalls auffällig ist der Anstieg bei der Aussage, wonach zu wenige Mädchen gefördert werden. Auch hier sind es fast drei Viertel aller Leistungsvereine (72,3 Prozent), die sich eine Intensivierung in der Talentförderung von Mädchen wünschen. In der Gesamtzahl aller Vereine liegt die Zustimmung bei nur 54,1 Prozent. Drei Viertel der Leistungsvereine wollen Mädchen- Stützpunkte Auch die Auffassungen darüber, ob talentierte Mädchen nur bei Jungen spielen sollten, gehen zwischen Leistungsvereinen und der Gesamtheit aller Vereine auseinander. Allgemein stimmen 28,3 Prozent dieser Aussage zu, bei den Leistungsvereinen sinkt der Zuspruch auf 21,6 Prozent. Nur jeder fünfte Leistungsverein vertritt demnach die Ansicht, dass Mädchen möglichst lange bei Jungen spielen sollten, um ihre Talente zu entfalten. Die große Mehrheit (78,4 Prozent) teilt diese bisherige Lehrmeinung aus eigener Erfahrung nicht. In allen anderen Bereichen sind die Differenzen nicht so deutlich ausgeprägt und inwieweit diese Systematik auch bei größeren Stichproben be- 31
32 lastbar ist, wäre potenziell in einer bundesweiten Studie zu klären, um mehr Leistungsvereine als Vergleichsmaßstab zu erreichen. 5.3 Fazit Wandel in der Förderung des Mädchenfußballs Die Ergebnisse zur optimalen Förderung talentierter Mädchen sprechen eine deutliche Sprache. Die Mehrheit der Vereine wünscht sich einen Wandel in der Förderung von jungen Talenten. Besonders überzeugend an diesem Befund ist aber, dass vor allem Leistungsvereine diesen Wandel wollen. Wenn auch die bisherigen Förderinstrumente nicht rundweg abgelehnt werden, wird die Botschaft alternativer und ergänzender Förderwege doch sehr deutlich. Selbst wenn die Ergebnisse nicht im Sinne des Nachwuchsförderzentrums gelesen werden, bleibt als Kernaussage: Leistungsvereine wollen eigene Stützpunkte für Mädchen und sie erleben verschiedene Wege in den Leistungsfußball als förderlich für die jungen Talente. Eine facettenreiche Förderkultur entspricht demnach eher den Bedürfnissen der Vereinslandschaft in Bayern und Überlegungen sind sinnvoll, wie Möglichkeiten für verschiedene Förderkulturen geschaffen werden. Änderungen in den Vorgaben und Strukturen sind ebenso denkbar wie die Etablierung von Pilotprojekten, um die Wirksamkeit von Alternativen zu überprüfen. Denn auch wenn die Vereine hier eine deutliche Aussage für mehr Fördervielfalt treffen, ist dies nicht damit gleichzusetzen, dass diese Vorstellungen auch zielführend für eine Optimierung der Talentförderung sind. Es sind zunächst einmal aggregierte Ansichten aus den Vereinen, die - das haben die Differenzierungen nach Vereinstypen gezeigt - auf einem unterschiedlichen Erfahrungshorizont basieren. Hier werden diese Erfahrungswerte der Leistungsvereine eine erste wichtige empirische Grundlage für entsprechende Veränderungen sein. 32
33 6 Merkmale von Leistungssportvereinen Es gehört zu den Herausforderungen in der Förderung von Talenten und des Leistungssports, Merkmale erfolgreicher Arbeit im Sport zu identifizieren (Höner, 2012). Was macht Vereine aus, die sich in der Leistungsspitze etablieren? Was sind Unterschiede zwischen den Modellen in Wolfsburg oder Hoffenheim und München als relativ junge Titelaspirantinnen im Vergleich zu Traditionsfrauenvereinen wie Frankfurt oder Potsdam? Spielt Geld alleine eine Rolle oder sind es die dahinter liegenden Konzepte? Was bereits im Bundesliga-Bereich schwierige Schlussfolgerungen sind, erweist sich im Nachwuchsbereich als noch größere Herausforderung. Es ist bislang für den Mädchenfußball noch nicht bekannt, was Merkmale erfolgreicher Talentförderung und erfolgreicher Vereinsarbeit sind. Was unterscheidet einen Verein, der es in den Leistungsbereich geschafft hat von solchen Vereinen, die stärker den Breitensportansatz vertreten? Die Daten der BFV-Studie 2015 wurden genutzt, um erste Antworten auf diese Frage zu finden. Dabei hat sich auch in den vorliegenden Daten gezeigt, dass Erfolgsindikatoren nur schwer zu finden sind und ihre Aussagekraft eher moderat ausfällt. Ein Grund hierfür ist, dass eine Vielzahl an Vereinsmerkmalen durch die begrenzte Zahl möglicher Fragen nicht erhoben werden konnte. Die Ergebnisse des Modells lassen erwarten, dass weitere Strukturmerkmale für den Vereinserfolg verantwortlich sind. Ein weiterer Grund ist die hohe Dynamik sozialer Systeme. Vereine sind eher lose gekoppelte Systeme, die zudem gerade im Mädchenfußball stark von der Präsenz einzelner Personen abhängig sind und in einem steten Wechselverhältnis zu ihrer Umwelt stehen. Diese Dynamik erschwert es, stabile Prädiktoren zu identifizieren. Gleichwohl konnten vier Merkmale ausgemacht werden, die Leistungssportvereine im Mädchenfußball von anderen Vereinen unterscheiden. Der große Varianzunterschied aufgrund ungleich großer Gruppen würde jedoch statistische Analysen erschweren. Daher wurde die zu erklärende Variable dreifach gestuft in die Analysen gegeben: 1 - Jungenvereine, 2 - Breitensportvereine Mädchen, 3 - Leistungssportvereine Mädchen. Das bedeutet, dass die Einflüsse der Prädiktoren als Vorhersage einer quasi-ordinalskalierten Information betrachtet werden. Dahinter liegt die Annahme, dass reine Jungenvereine am weitesten vom Zustand des Leistungsvereins im Juniorinnen-Bereich entfernt sind und Mädchenvereine im Breitensport näher am Zustand des Leistungsvereins sind, also der Übergang zu einem Leistungsverein wahrscheinlicher als bei reinen Jungenvereinen ist. Herausforderungen bei der Bestimmung von Erfolgsfaktoren Vier Merkmale von Leistungsvereinen 6.1 Modell zu Merkmalen von Leistungsvereinen Die Suche nach Merkmalen von Leistungsvereinen erfolgte dabei explorativ. Alle Items, in denen ein Bezug zum Mädchenfußball bestand, kamen als Prädiktoren in Betracht und wurden in schrittweisen Regressionen auf ihren Zusammenhang zum Zustand des Leistungsvereins geprüft. Es handelt sich demnach nicht um eine theoriegeleitete Vorgehensweise, die durch ihren 33
34 erkundenden Charakter anfälliger für Stichprobenfehler ist. Angesichts der hohen Fallzahlen und der für Bayern repräsentativen Auswahl an Vereinen keine systematischen Erkenntnisse zu Merkmalen von Leistungsvereinen, so dass die hier berichteten Befunde als Grundlage für die Theorieentwicklung dienen können. Anzahl an Mädchen und Zufriedenheit mit Mädchenförderung In den schrittweisen Regressionen zeigen sich vier der insgesamt acht ausgewählten Merkmale als statistisch bedeutsam. Dies sind die absolute Anzahl wie die Einschätzung, dass Mädchen nicht gerne mit Jungen Fußball spielen Abbildung 18: Regressionsmodell zu Merkmalen von Leistungssportvereinen (standardi- Das Modell erklärt insgesamt 13 Prozent der bei der abhängigen Variablen auftretenden Varianz. Dies ist eine moderate Erklärungsquote dafür, unter welchen Bedingungen es sich um einen Leistungssportverein handelt. Nach diesem Modell sind es also die absolute Anzahl an Mädchen als breite Basis im Spielerinnen-Kader einerseits und eine höhere Zufriedenheit mit der Förderung des Mädchenfußballs im Verein andererseits, die Leistungsvereine von anderen Vereinen unterscheiden. Hinzu kommt in Migrationshintergrund in ihren Reihen haben und als Hinderungsgrund für den Zugang von Mädchen erleben, dass diese nicht gerne mit Jungen spielen. Der Befund zu Mädchen mit Migrationshintergrund deutet das integrative Potenzial des Leistungsfußballs an. Auch machen Leistungssportvereine häu- Vereinssport erleichtert wird, wenn sie mit Mädchen zusammenspielen können. Vor dem Hintergrund der absoluten Anzahl an Mädchen als Prädiktor 34
35 spricht dies dafür, dass Leistungssportvereine im Juniorinnenbereich offenbar eine breite Basis benötigen, aus der sie die Leistungsspitze heranziehen. Tatsächlich haben Leistungssportvereine signifikant häufiger U11- (c 2 = 13,22; p < 0,001), U13- (c 2 = 21,83; p < 0,001) und U15-Teams (c 2 = 28,95; p < 0,001) als Breitensportvereine im Mädchenfußball. Das bedeutet, dass Vereine eine höhere Wahrscheinlichkeit auf hochklassigen Fußball haben, wenn sie über einen konstant vertretenen Unterbau ab mindestens der U11 verfügen. Dies erklärt, warum Leistungsvereine sehr deutlich artikulieren, eine Talentförderung beginnend mit der U17 sei kontraproduktiv für den Leistungsbereich (vgl. Kapitel 5.2). 6.2 Fazit Es ist erst der empirisch geleitete Beginn von Analysen zu Merkmalen von Leistungsvereinen im Mädchenfußball. Zu unklar ist die Gesamtdynamik, die im Vereinssport besteht, als dass eine explorative Herangehensweise bereits als verlässliche Basis für Entscheidungen in der Praxis dienen kann. In jedem Forschungsbereich besteht jedoch immer ein Beginn, der dann weitere Studien und Erkenntnisse mit sich bringt. Angesichts der geringen Kenntnislage dazu, wann Vereine im Juniorinnen-Leistungssport angesiedelt sind, können die berichteten Befunde als erster Anhaltspunkt dienen. Erste Annäherung an Erfolgsmerkmale Nach den vorliegenden Informationen sind Vereine dann als Leistungsvereine aktiv, wenn sie über eine breite Spielerinnen- und Team-Basis verfügen, ihnen die Integration von Mädchen mit Migrationshintergrund gelingt, sie Mädchen das Fußballspielen mit Mädchen ermöglichen und der Gesamtverein die Mädchenarbeit fördert. Drei dieser vier Faktoren gehören in den Bereich der Erreichbarkeit und Einbindung von Mädchen in den Vereinsfußball, lediglich die Zufriedenheit mit der Vereinsförderung ist ein Aspekt, der sich auf das Mikrosystem Verein selbst bezieht. Daraus lässt sich für zukünftige Forschung die Bedeutung von Transitionen zwischen Systemen (Schule - Verein, Elternhaus - Verein, Peergroup - Verein) einerseits und die Bedeutung individueller Zugänge zu diesen Transitionen andererseits ableiten. Anders ausgedrückt: was sind individuelle Faktoren für den Übergang und was sind Merkmale des Übergangs selbst, die in den Vereinsmädchenfußball führen (Kreiselmeyer & Reinders, 2014; Pahmeier & Blumhoff, 2014). 35
36 7 Diskussion und Ausblick Drei Themenschwerpunkte Dieser Band berichtet Ergebnisse zu der Frage, wie die Talentförderung im Mädchenfußball aus Sicht bayerischer Vereine mit Jugendfußball gestaltet sein sollte. Grundlage für die Befunde ist die BFV-Studie, die im Jahr 2015 bei Vereinen mittels Online-Erhebung durchgeführt wurde. Die Daten wurden in Weiterführung der BFV-Studie (Reinders, 2016) unter dem spezifischen Blickwinkel des Mädchenfußballs betrachtet, um ein besseres Verständnis davon zu erhalten, wie die Vereinsbasis zu bisherigen und zukünftigen Möglichkeiten im Mädchenfußball steht. Der Band gliedert sich dabei in die Themenschwerpunkte Bedeutung und Umsetzung von Vereinszielen, Hemmnisse für den Zugang von Mädchen zum Vereinsfußball und Vorstellungen zu optimaler Talentförderung, die abschließend um ein Modell zu Merkmalen von Leistungssportvereinen ergänzt wurden. Die Ergebnisse lassen sich pointiert in der Aussage zusammenfassen, dass der bayerische Mädchenfußball auf dem Weg in eine beachtenswerte Krise ist, weil zu viele Hemmnisse für den Zugang von Mädchen zum Vereinsfußball bestehen und Vereine einen bisher nicht beachteten Wandel in der Talentförderung wünschen. Ergebnisse deutlicher als erwartet Besonders deutlich wird der Wunsch nach Wandel bei Vereinen mit hoher Leistungsorientierung, die über den größten Unterbau verfügen, die meiste Erfahrung im Juniorinnen-Leistungsfußball haben und tradierten Vorstellungen von gemeinsamen Jungen-Mädchen-Stützpunkten einerseits und einem möglichst langen Verbleib von Mädchen in Jungenteams andererseits kaum mehr Erfolgversprechendes abgewinnen können. Diese Ergebnisse sind ganz im Sinne der Philosophie des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen. Sie entsprechen genau den Gründen, warum sich die vier regionalen Vereine, der 1. FC Nürnberg Mädchen- und Frauenfußball sowie das Sportzentrum und die Bildungsforschung der Universität Würzburg zur Gründung des NFZ entschlossen haben. Da liegt der Gedanke nahe, dass die Ergebnisse im Sinne der Gründungsphilosophie interpretiert werden. Tatsächlich fallen aber die Ergebnisse noch deutlicher und überraschender aus, als dies bei der Konzeption der Fragen für die Studie - die vom Bayerischen Fußballverband genehmigt wurden - auch nur annähernd erwartbar gewesen wäre. Es bestand die Hoffnung, dass möglichst viele Vereine die Idee eines eigenen Förderstützpunkts für Mädchen positiv sehen. Dass es letztlich fast zwei Drittel aller Vereine sind, war nicht vorhersehbar. Auch bestand die Hoffnung, dass die bayerischen Vereine nicht nur den Weg über Jungenteams in den Leistungsfußball sehen, sondern der Vielfalt der Mädchen-Talente gerecht werden. Eine Zustimmung von fast drei Viertel der Vereine zu dieser Vielfalt übertrifft dann doch jede vorab als vernünftig eingestufte Erwartung. Vor allem der nochmal höhere Zuspruch der Leistungsvereine war mehr als überraschend. 36
37 Entscheidend ist aber nicht, ob die Ergebnisse den im NFZ gewählten Weg stützen - was erfreulicherweise der Fall ist - sondern welche Konsequenzen sich daraus ziehen lassen. Zunächst einmal ist die erste Konsequenz, die Befunde zur Kenntnis zu nehmen und kritisch zu prüfen. Eine Hauptkritik wurde bereits mehrfach erwähnt. Nur weil Vereine mehrheitlich Mädchenstützpunkte für förderlicher erachten, ist damit noch nicht der Beweis ihrer faktischen Überlegenheit in der Talentförderung erbracht. Es bedeutet lediglich, dass die Vereine, allen voran die Leistungsvereine, die These vertreten, sie wären das bessere Modell in der Talentförderung. Diese These ist genau so wenig belegt wie jene, dass gemischte Stützpunkte geeigneter seien. Bislang sind empirische Evidenzen zwar eher auf Seiten des monoedukativen Modells reiner Mädchenstützpunkte, weil vor allem Vereine mit reichhaltiger Erfahrung im Juniorinnen-Leistungsfußball diese Förderung für besser erachten. Was aber der nächste Schritt sein muss ist, die Entwicklung von talentierten Mädchen in beiden Varianten empirisch zu begleiten und Stärken beider Ansätze zu identifizieren. Sodann ist die zweite Konsequenz, die Befunde als Ausgangspunkt für weitere Fragen zu nutzen. Wenn insbesondere die Leistungsvereine in fast allen Bereichen so deutlich hervortreten, dann ist ein genauer Blick auf deren Erfahrungen lohnenswert. Was genau sind die Erfahrungen, die zu der Einschätzung führen, reine Mädchenförderung sei begrüßenswert? Warum sind Leistungsvereine mehr noch als andere Vereine der Ansicht, dass Mädchen nicht zwingend bis zum Ende der U15 bei Jungen spielen sollten? Auf welchen Indikatoren basieren diese Schlussfolgerungen? Die dritte Konsequenz ist, parallel zu diesen beiden Forschungsfragen (Sind Mädchenstützpunkte ein gutes Modell? Welche Erfahrungen führen bei Leistungsvereinen zu ihren Einschätzungen?), die Diskussionen über die Förderung des Mädchenfußballs anzuregen. Empirische Befunde sind eine gute Ausgangsbasis, um bisherige Praxen zu betrachten und zu hinterfragen bzw. ihre Stärken zu erkennen. In solchen Diskussionen besteht die Möglichkeit, strukturelle Rahmenbedingungen, Ziele und Erfordernisse der Vereinsbasis und des Verbands gemeinsam zu beleuchten und die hier berichteten Befunde als Anknüpfungspunkt für offenbar notwendige Veränderungsprozesse zu nutzen. Gerade die Diskussion über den Stellenwert und die Aussagekraft der hier berichteten Ergebnisse muss dabei viel Raum gewährt werden. Der Mädchenfußball in Bayern befindet sich aus Sicht der Vereine in einem krisenhaften Wandel und die Vereine haben Lösungsvorschläge, wie mit diesem Wandel umgegangen werden kann. Vielleicht ist die Diskussion tatsächlich nicht erst die dritte, sondern bereits die erste Konsequenz aus dieser Studie. Drei Konsequenzen aus den Befunden Diskussion zur Förderkultur initiieren 37
38 Literaturverzeichnis Höner, O. (2012). Herausforderungen an die Talentforschung im Fußball. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 63(2), Kreiselmeyer, K., & Reinders, H. (2014). Bedingungen der Beteiligung von Mädchen im Jugendfußball. Eine empirische Studie bei bayerischen Fußballvereinen. In S. Sinning, J. Pargätzi, & B. Eichmann (Hg.), Frauen- und Mädchenfußball im Blickpunkt. Empirische Untersuchungen - Probleme und Visionen (S ). Münster: Lit. Möhwald, M., & Weigelt-Schlesinger, Y. (Hg.). (2013). Mädchenfußball: Analysen und Perspektiven für die Praxis. München: AVM. Pahmeier, I., & Blumhoff, G. (2014). Motive von Mädchen und Frauen in Sportspielen. In S. Sinning, J. Pargätzi, & B. Eichmann (Hg.), Frauen- und Mädchenfußball im Blickpunkt. Empirische Untersuchungen - Probleme und Visionen (S ). Münster: Lit. Reinders, H. (2016). Der bayerische Jugendfußball im Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung. Ergebnisse der BFV-Studie Schriftenreihe Empirische Bildungsforschung, Band 34. Würzburg: Universität Würzburg. Reinders, H., Hoos, O., & Haubenthal, G. (2015). Bedingungen erfolgreicher Förderung von Mädchen im Breiten- und Leistungsfußball. Ein Forschungsüberblick über motorische und psychosoziale Unterschiede bei Mädchen und Jungen ab der frühen Kindheit. Schriftenreihe des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen, Band 01. Würzburg Julius- Maximilians-Universität Würzburg. Röger, U., Weigelt-Schlesinger, Y., Kugelmann, C., & Steib, S. (2008). Talentförderung im Mädchenfußball. In U. Röger, C. Kugelmann, Y. Weigelt-Schlesinger, & M. Möhwald (Hg.), Frauen am Ball. Analysen und Perspektiven der Genderforschung (S ). Hamburg: Czwalina Verlag. 38
39 Neuerscheinung Bereits seit 2011 werden die bayerischen Vereine zur Zufriedenheit im Nachwuchsbereich, ihren Zielen, ihrem Umgang mit Integration und sportlicher Förderung befragt. Die dritte BFV-Studie aus dem Jahr 2015 zeigt wichtige Trends im bayerischen Jugendfußball auf und widmet sich der gesellschaftlich relevanten Frage, wie im Jugendfußball mit der neuen Zuwanderung umgegangen wird. Es handelt sich um die deutschlandweit einzige Studie dieses zeitlichen Ausmaßes. Der bayerische Jugendfußball im Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung Schriftenreihe Empirische Bildungsforschung - Band 34 Ergebnisse der BFV-Studie 2015 Prof. Dr. Heinz Reinders In Kooperation mit
40 Das Nachwuchsförderzentrum Das Nachwuchsförderzentrum für Juniorinnen in Unterfranken ist ein Forschungsprojekt des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung mit dem Sportzentrum der Universität Würzburg. Es erforscht die Bedingungen zur optimalen Förderung talentierter Mädchen im Leistungsfußball. Hierzu werden die jungen Talente nach neuesten sport- und trainingswissenschaftlichen Methoden sowie pädagogischen Konzepten ganzheitlich gefördert und die Entwicklung wissenschaftlich begleitet. Das Nachwuchsförderzentrum ist damit in seiner dualen Struktur aus Praxisförderung und wissenschaftlichem Forschungsprojekt einzigartig in Deutschland. Die Autoren Der Autor Univ.-Prof. Dr. Heinz Reinders Diplom-Pädagoge, ist Inhaber des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung der Universität Würzburg, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und langjähriger Trainer im Mädchenfußball. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Evaluation pädagogischer Maßnahmen sowie Entwicklungsprozesse in Kindheit und Jugend. Zitation dieser Publikation Reinders, Heinz (2016). Optimale Förderung des Mädchenfußballs aus Vereinssicht. Schriftenreihe des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen, Band 03. Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Der bayerische Jugendfußball im Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung
 Der bayerische Jugendfußball im Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung Ergebnisse der BFV-Studie 2015 Schriftenreihe Empirische Bildungsforschung - Band 34 Prof. Dr. Heinz Reinders In Kooperation mit
Der bayerische Jugendfußball im Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung Ergebnisse der BFV-Studie 2015 Schriftenreihe Empirische Bildungsforschung - Band 34 Prof. Dr. Heinz Reinders In Kooperation mit
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 November 2015 q5600.01/32438 Rd, Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 November 2015 q5600.01/32438 Rd, Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen
 Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Wahrnehmung und Bewertung der Gentherapie in Deutschland
 Wahrnehmung und Bewertung der Gentherapie in Deutschland Gentherapie in Deutschland Medizinischer Stand und gesellschaftliche Bewertung Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 12.11.2008 Gentechnik
Wahrnehmung und Bewertung der Gentherapie in Deutschland Gentherapie in Deutschland Medizinischer Stand und gesellschaftliche Bewertung Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 12.11.2008 Gentechnik
Umfrage. Einstellungen in der Bevölkerung zu Verteilungsfragen. in Kooperation mit dem Bündnis
 Umfrage Einstellungen in der Bevölkerung zu Verteilungsfragen in Kooperation mit dem Bündnis Gerechtigkeit in Deutschland: Einstellungen der Bevölkerung zu Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und Steuerpolitik
Umfrage Einstellungen in der Bevölkerung zu Verteilungsfragen in Kooperation mit dem Bündnis Gerechtigkeit in Deutschland: Einstellungen der Bevölkerung zu Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und Steuerpolitik
Konjunkturumfrage bei Biogasanlagenbetreibern in Bayern. Stand:
 Konjunkturumfrage bei Biogasanlagenbetreibern in Bayern Stand: 29.1.13 C.A.R.M.E.N. C.A.R.M.E.N. führte im Dezember und Januar eine Umfrage unter den Betreibern von Biogasanlagen in Bayern durch. Dabei
Konjunkturumfrage bei Biogasanlagenbetreibern in Bayern Stand: 29.1.13 C.A.R.M.E.N. C.A.R.M.E.N. führte im Dezember und Januar eine Umfrage unter den Betreibern von Biogasanlagen in Bayern durch. Dabei
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 September 2015 q5542.01/32113 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 September 2015 q5542.01/32113 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie von GMS im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung vom Frühjahr 2016
 Ausgabe vom 15. Juli 2016 8/2016 Wahl und Nichtwahl Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie von GMS im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung vom Frühjahr 2016 Gerhard Hirscher /// Eine repräsentative Umfrage
Ausgabe vom 15. Juli 2016 8/2016 Wahl und Nichtwahl Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie von GMS im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung vom Frühjahr 2016 Gerhard Hirscher /// Eine repräsentative Umfrage
Der bayerische Jugendfußball zwischen Leistung und sozialer Teilhabe
 Der bayerische Jugendfußball zwischen Leistung und sozialer Teilhabe Ergebnisse der BFV-Studie 2013 Schriftenreihe Empirische Bildungsforschung - Band 27 Prof. Dr. Heinz Reinders In Kooperation mit Lehrstuhl
Der bayerische Jugendfußball zwischen Leistung und sozialer Teilhabe Ergebnisse der BFV-Studie 2013 Schriftenreihe Empirische Bildungsforschung - Band 27 Prof. Dr. Heinz Reinders In Kooperation mit Lehrstuhl
Eine kleine Berat(er)ungsevaluation
 Eine kleine Berat(er)ungsevaluation Neben Aspekten der Struktur- und Prozessqualität interessieren nicht nur uns immer wieder Fragen dazu, wie das Produkt letztlich bei den Ratsuchenden ankommt und bestenfalls
Eine kleine Berat(er)ungsevaluation Neben Aspekten der Struktur- und Prozessqualität interessieren nicht nur uns immer wieder Fragen dazu, wie das Produkt letztlich bei den Ratsuchenden ankommt und bestenfalls
Ergebnisbericht 2012/2013
 Unterstellte Wirkungen Wirkungen von Unterstellungen Befragung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Forschungsprojekts Politische Kommunikation in der Online Welt Ergebnisbericht 0/0 Düsseldorf,.
Unterstellte Wirkungen Wirkungen von Unterstellungen Befragung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Forschungsprojekts Politische Kommunikation in der Online Welt Ergebnisbericht 0/0 Düsseldorf,.
Demographie und Fußball
 Demographie und Fußball Eike Emrich 1, Werner Pitsch & Christian Rullang Einleitung Die Bevölkerung Deutschlands wird sich in den kommenden Jahrzehnten nach der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Demographie und Fußball Eike Emrich 1, Werner Pitsch & Christian Rullang Einleitung Die Bevölkerung Deutschlands wird sich in den kommenden Jahrzehnten nach der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Die Landesanstalt für Medien Nordrhein Westfalen (LfM) hat bereits 2016 eine Studie zum Thema Hate Speech im Internet durchgeführt.
 Hate Speech Datenbasis: 1.011 Befragte im Alter ab 14 Jahren, die privat das Internet nutzen Erhebungszeitraum: 4. bis 9. Mai 2017 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Methode: Online-Befragung
Hate Speech Datenbasis: 1.011 Befragte im Alter ab 14 Jahren, die privat das Internet nutzen Erhebungszeitraum: 4. bis 9. Mai 2017 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Methode: Online-Befragung
Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch
 Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch Einleitung: Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? Das Diagramm zeigt... Die Grafik stellt... dar.
Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch Einleitung: Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? Das Diagramm zeigt... Die Grafik stellt... dar.
Umfrageergebnisse der Studie: Psychotherapie in Deutschland Versorgung, Zufriedenheit, Klima (PVZK) 2008
 Umfrageergebnisse der Studie: Psychotherapie in Deutschland Versorgung, Zufriedenheit, Klima (PVZK) 2008 Wie wichtig ist der deutschen Bevölkerung die eigene seelische Gesundheit? Und wie zufrieden sind
Umfrageergebnisse der Studie: Psychotherapie in Deutschland Versorgung, Zufriedenheit, Klima (PVZK) 2008 Wie wichtig ist der deutschen Bevölkerung die eigene seelische Gesundheit? Und wie zufrieden sind
Umfragen und Stimmungsbilder zu aktuellen Themen aus Steuerpolitik, Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Europapolitik und Management. 1.
 Ausgabe 01 16 Umfragen und Stimmungsbilder zu aktuellen Themen aus Steuerpolitik, Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Europapolitik und Management. 1. Februar 2016 Gleichbehandlung Meinung zur quote nach wie
Ausgabe 01 16 Umfragen und Stimmungsbilder zu aktuellen Themen aus Steuerpolitik, Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Europapolitik und Management. 1. Februar 2016 Gleichbehandlung Meinung zur quote nach wie
Pfadfinden wirkt! Jugendliches Ehrenamt fördert demokratische Kompetenzen
 VCP Bundeszentrale. Wichernweg 3. 34121 Kassel An die Mitglieder der Leitungsgremien auf Bundes- und Landesebene Mitglieder der Fach- und Projektgruppen auf Bundesebene Hauptberuflichen Mitarbeiterinnen
VCP Bundeszentrale. Wichernweg 3. 34121 Kassel An die Mitglieder der Leitungsgremien auf Bundes- und Landesebene Mitglieder der Fach- und Projektgruppen auf Bundesebene Hauptberuflichen Mitarbeiterinnen
Erwartungen junger Führungskräfte und wie Selbstständige und Arbeitgeber darüber denken Zentrale Ergebnisse
 Erwartungen junger Führungskräfte und wie Selbstständige und Arbeitgeber darüber denken Zentrale Ergebnisse Steinbeis-Studie in Kooperation mit den Zentrale Ergebnisse der Steinbeis-Studie in Kooperation
Erwartungen junger Führungskräfte und wie Selbstständige und Arbeitgeber darüber denken Zentrale Ergebnisse Steinbeis-Studie in Kooperation mit den Zentrale Ergebnisse der Steinbeis-Studie in Kooperation
EIMO-Studie zur Akzeptanz von Sportgroßveranstaltungen in der deutschen Bevölkerung am Beispiel der Olympiabewerbung München 2018
 EIMO-Studie zur Akzeptanz von Sportgroßveranstaltungen in der deutschen Bevölkerung am Beispiel der Olympiabewerbung München 2018 Juli 2011 Umfrage zum Thema Olympiabewerbung Datenbasis: 1.005 Bürger ab
EIMO-Studie zur Akzeptanz von Sportgroßveranstaltungen in der deutschen Bevölkerung am Beispiel der Olympiabewerbung München 2018 Juli 2011 Umfrage zum Thema Olympiabewerbung Datenbasis: 1.005 Bürger ab
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation )
 Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Corporate Social Responsibility
 Corporate Social Responsibility Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bankenverbandes Januar 2015 Thema und Intention der Umfrage Das über die reine Geschäftstätigkeit hinausgehende gesellschaftliche
Corporate Social Responsibility Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bankenverbandes Januar 2015 Thema und Intention der Umfrage Das über die reine Geschäftstätigkeit hinausgehende gesellschaftliche
Jeder dritte Autor ist unzufrieden mit seinem Verlag
 Zürich, 22. April 2013 Jeder dritte Autor ist unzufrieden mit seinem Verlag 1200 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sagen ihre Meinung Anlässlich des UNESCO-Welttags des
Zürich, 22. April 2013 Jeder dritte Autor ist unzufrieden mit seinem Verlag 1200 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sagen ihre Meinung Anlässlich des UNESCO-Welttags des
Items Einstellungen sportliches Engagement der Freundinnen und Freunde Frauen keinen Wenige / niemand meiner Freundinnen und Freunde sind der Meinung,
 9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 November 2015 q5600.03/32457 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 November 2015 q5600.03/32457 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Geschichtsunterricht. 5. September 2017 q7472/35239 Sh, Le
 Geschichtsunterricht 5. September 2017 q7472/35239 Sh, Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30 10317 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung
Geschichtsunterricht 5. September 2017 q7472/35239 Sh, Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30 10317 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung
Umfrage zum Thema Klimafreundliche Geldanlagen. Ergebnisbericht. März TNS Emnid. Political Social
 Umfrage zum Thema Klimafreundliche Geldanlagen Ergebnisbericht Political Social TNS 2013 Inhalt 1 Studiendesign... 2 2 Hintergrund der Studie... 3 3 Marktpotenzial klimafreundlicher Finanzprodukte... 4
Umfrage zum Thema Klimafreundliche Geldanlagen Ergebnisbericht Political Social TNS 2013 Inhalt 1 Studiendesign... 2 2 Hintergrund der Studie... 3 3 Marktpotenzial klimafreundlicher Finanzprodukte... 4
Jeder dritte Autor ist unzufrieden mit seinem Verlag
 Berlin Wien Zürich am 23. April 2013 Jeder dritte Autor ist unzufrieden mit seinem Verlag Gemeinsamen Befragung unter Autorinnen und Autoren über ihre Beziehungen zu Verlagen 1.200 Autorinnen und Autoren
Berlin Wien Zürich am 23. April 2013 Jeder dritte Autor ist unzufrieden mit seinem Verlag Gemeinsamen Befragung unter Autorinnen und Autoren über ihre Beziehungen zu Verlagen 1.200 Autorinnen und Autoren
Kundenzufriedenheit: Ausgewählte Branchen im Mehrjahresvergleich
 Forschungsprogramm UNIVOX 2002/2003 Teil III D Konsum 2003 / Trendbericht Kundenzufriedenheit: Ausgewählte Branchen im Mehrjahresvergleich Thomas Bamert (Autor) Prof. Dr. Hans Peter Wehrli (Verantwortung)
Forschungsprogramm UNIVOX 2002/2003 Teil III D Konsum 2003 / Trendbericht Kundenzufriedenheit: Ausgewählte Branchen im Mehrjahresvergleich Thomas Bamert (Autor) Prof. Dr. Hans Peter Wehrli (Verantwortung)
Befragungen für Piratenfraktion im Landtag NRW. 2. Teilerhebung: Verfassungsbarometer, 2. Welle
 Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum GmbH Befragungen für Piratenfraktion im Landtag NRW 2. Teilerhebung: Verfassungsbarometer, 2. Welle Durchführung: Befragungsart: Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum
Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum GmbH Befragungen für Piratenfraktion im Landtag NRW 2. Teilerhebung: Verfassungsbarometer, 2. Welle Durchführung: Befragungsart: Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum
Zufriedenheit mit der Verwendung von Studiengebühren in Deutschland
 Ergebniszusammenfassung Gebührenkompass 2011 Wie bereits in den Jahren 2007 bis 2010 hat der Lehrstuhl für Marketing I der Universität Hohenheim mit seinen Studierenden auch im Mai dieses Jahres die Zufriedenheit
Ergebniszusammenfassung Gebührenkompass 2011 Wie bereits in den Jahren 2007 bis 2010 hat der Lehrstuhl für Marketing I der Universität Hohenheim mit seinen Studierenden auch im Mai dieses Jahres die Zufriedenheit
Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse. Bachelorarbeit
 Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Gerechtigkeit alles eine Frage der Wahrnehmung
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Gerechtigkeit 10.08.2017 Lesezeit 4 Min. Gerechtigkeit alles eine Frage der Wahrnehmung Diese Daten dürften all jene überraschen, die in Deutschland
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Gerechtigkeit 10.08.2017 Lesezeit 4 Min. Gerechtigkeit alles eine Frage der Wahrnehmung Diese Daten dürften all jene überraschen, die in Deutschland
Wahrnehmung und Bewertung der Ukraine-Krise und Meinungen zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland
 Wahrnehmung und Bewertung der Ukraine-Krise und Meinungen zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland 11. August 2014 q4561/30373 Le, Gü Max-Beer-Str. 2/4 10119 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis
Wahrnehmung und Bewertung der Ukraine-Krise und Meinungen zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland 11. August 2014 q4561/30373 Le, Gü Max-Beer-Str. 2/4 10119 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis
Zivildienst- Einsatzbetriebe: Zufrieden mit Zivis und offen für Neues
 Zivildienst- Einsatzbetriebe: Zufrieden mit Zivis und offen für Neues Zusammengefasste Resultate der CIVIVA- Umfrage im Frühjahr 2012 bei allen Schweizer Zivildienst- Einsatzbetrieben Hohe Zufriedenheit
Zivildienst- Einsatzbetriebe: Zufrieden mit Zivis und offen für Neues Zusammengefasste Resultate der CIVIVA- Umfrage im Frühjahr 2012 bei allen Schweizer Zivildienst- Einsatzbetrieben Hohe Zufriedenheit
Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung
 Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Ergebniszusammenfassung: Befragung zur Evaluation des Mitarbeiter Vorgesetzten Gesprächs durchgeführt von der AG Personalentwicklung
 Ergebniszusammenfassung: Befragung zur Evaluation des Mitarbeiter Vorgesetzten Gesprächs durchgeführt von der AG Personalentwicklung (1) Hintergrund Auf Basis einer Dienstvereinbarung zwischen der Hochschulleitung
Ergebniszusammenfassung: Befragung zur Evaluation des Mitarbeiter Vorgesetzten Gesprächs durchgeführt von der AG Personalentwicklung (1) Hintergrund Auf Basis einer Dienstvereinbarung zwischen der Hochschulleitung
Statistischer Infodienst
 3. März 6 Statistischer Infodienst Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung www.freiburg.de/statistik Erste Ergebnisse aus der Repräsentativen Wahlstatistik für die Landtagswahl 6 in Freiburg
3. März 6 Statistischer Infodienst Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung www.freiburg.de/statistik Erste Ergebnisse aus der Repräsentativen Wahlstatistik für die Landtagswahl 6 in Freiburg
Studieneingangsphase: Resultate der Umfrage von 2015
 Studieneingangsphase: Resultate der Umfrage von 2015 zhe zuerich.ch/themen/studieneingangsphase/umfrage2015_resultate/ Das ZHE Zürich befragte in der zweiten Jahreshälfte 2015 mehr als 300 Vertreterinnen
Studieneingangsphase: Resultate der Umfrage von 2015 zhe zuerich.ch/themen/studieneingangsphase/umfrage2015_resultate/ Das ZHE Zürich befragte in der zweiten Jahreshälfte 2015 mehr als 300 Vertreterinnen
Arbeiten trotz Krankheit
 Arbeiten trotz Krankheit Wie verbreitet ist Präsentismus in Deutschland? Wer krank zur Arbeit geht, nimmt eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in Kauf, hat ein größeres Fehler- und Unfallrisiko
Arbeiten trotz Krankheit Wie verbreitet ist Präsentismus in Deutschland? Wer krank zur Arbeit geht, nimmt eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in Kauf, hat ein größeres Fehler- und Unfallrisiko
Pilotierung der Unterrichtsbeispiele im Schuljahr 2008/2009 Englisch
 Pilotierung der Unterrichtsbeispiele im Schuljahr 2008/2009 Englisch Im Schuljahr 2008/2009 wurde die Pilotierung der Unterrichtsbeispiele für Englisch durchgeführt. Insgesamt waren für die Pilotierung
Pilotierung der Unterrichtsbeispiele im Schuljahr 2008/2009 Englisch Im Schuljahr 2008/2009 wurde die Pilotierung der Unterrichtsbeispiele für Englisch durchgeführt. Insgesamt waren für die Pilotierung
Evaluation Förderunterricht Deutsch Klasse 5 und 6
 Evaluation Förderunterricht Deutsch Klasse 5 und 6 Diese Evaluation ist die Folgeerhebung zum vergangenen Jahr, um in einer vergleichenden Betrachtung Entwicklungen und Veränderungen im Förderunterricht
Evaluation Förderunterricht Deutsch Klasse 5 und 6 Diese Evaluation ist die Folgeerhebung zum vergangenen Jahr, um in einer vergleichenden Betrachtung Entwicklungen und Veränderungen im Förderunterricht
I N F O R M A T I O N
 I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Gemeinde-Referent Landesrat Dr. Josef Stockinger und DDr. Paul Eiselsberg, IMAS International am 8. Juni zum Thema "Aktuelle
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Gemeinde-Referent Landesrat Dr. Josef Stockinger und DDr. Paul Eiselsberg, IMAS International am 8. Juni zum Thema "Aktuelle
Das Mitarbeiter-Vorgesetzten -Gespräch (MVG) Bedarfs-Befragung September/Oktober 2006
 Das Mitarbeiter-Vorgesetzten -Gespräch (MVG) Bedarfs-Befragung September/Oktober 2006 1 Jutta Bonnet/Susanne Schulz Themenbereiche des FB und Rücklaufquote Themenbereiche des Fragebogens: Bewertung der
Das Mitarbeiter-Vorgesetzten -Gespräch (MVG) Bedarfs-Befragung September/Oktober 2006 1 Jutta Bonnet/Susanne Schulz Themenbereiche des FB und Rücklaufquote Themenbereiche des Fragebogens: Bewertung der
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Projekt wohl:finden durch Stärkung des Selbstwertgefühls der SchülerInnen
 Projekt wohl:finden durch Stärkung des Selbstwertgefühls der SchülerInnen Schülerbericht aus dem Jahresbericht 2005/06 Umfrage zum Einfluss der LehrerInnen auf das Selbstwertgefühl der SchülerInnen im
Projekt wohl:finden durch Stärkung des Selbstwertgefühls der SchülerInnen Schülerbericht aus dem Jahresbericht 2005/06 Umfrage zum Einfluss der LehrerInnen auf das Selbstwertgefühl der SchülerInnen im
10 Schulzeit und Hausaufgaben
 10 Schulzeit und Hausaufgaben Das Thema Schule wurde im diesjährigen Kinderbarometer unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf
10 Schulzeit und Hausaufgaben Das Thema Schule wurde im diesjährigen Kinderbarometer unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf
Meinungen zur Inneren Sicherheit März Präsenz und Ausstattung der Polizei in Nordrhein-Westfalen
 Meinungen zur Inneren Sicherheit März 2004 1 1. Präsenz und Ausstattung der Polizei in Nordrhein-Westfalen Die Innere Sicherheit stellt aus Sicht der Bürger seit vielen Jahren ein besonders gravierendes
Meinungen zur Inneren Sicherheit März 2004 1 1. Präsenz und Ausstattung der Polizei in Nordrhein-Westfalen Die Innere Sicherheit stellt aus Sicht der Bürger seit vielen Jahren ein besonders gravierendes
Studie Risikobewusstsein Hamburger Bürger für Naturkatastrophen 2010
 Prof. Dr. Beate M.W. Ratter Institut für Küstenforschung Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) GKSS-Forschungszentrum Max-Planck-Str.1 21502 Geesthacht Studie Risikobewusstsein Hamburger Bürger für Naturkatastrophen
Prof. Dr. Beate M.W. Ratter Institut für Küstenforschung Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) GKSS-Forschungszentrum Max-Planck-Str.1 21502 Geesthacht Studie Risikobewusstsein Hamburger Bürger für Naturkatastrophen
1 Einleitung. Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde
 1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
Fragebogen Trainer und Trainerinnen Sportoberschule Mals
 Fragebogen Trainer und Trainerinnen Sportoberschule Mals Gesamtbericht Allgemeine Angaben dieser Befragung Abschlussdatum der Befragung: 22.01.2016 Verwendeter Fragebogen: Fragebogen Trainer Sportoberschule
Fragebogen Trainer und Trainerinnen Sportoberschule Mals Gesamtbericht Allgemeine Angaben dieser Befragung Abschlussdatum der Befragung: 22.01.2016 Verwendeter Fragebogen: Fragebogen Trainer Sportoberschule
Pilotierung der Unterrichtsbeispiele im Schuljahr 2007/2008. Naturwissenschaften
 Pilotierung der Unterrichtsbeispiele im Schuljahr 2007/2008 Naturwissenschaften Im Schuljahr 2007/2008 wurde die Pilotierung der Unterrichtsbeispiele für die Naturwissenschaften durchgeführt. Insgesamt
Pilotierung der Unterrichtsbeispiele im Schuljahr 2007/2008 Naturwissenschaften Im Schuljahr 2007/2008 wurde die Pilotierung der Unterrichtsbeispiele für die Naturwissenschaften durchgeführt. Insgesamt
Es haben persönlich schon (vermutliche) Fake News bzw. Falschnachrichten im Internet bemerkt
 Fake News Datenbasis: 1.011 Befragte im Alter ab 14 Jahren, die privat das Internet nutzen Erhebungszeitraum: 4. bis 9. Mai 2017 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Methode: Online-Befragung
Fake News Datenbasis: 1.011 Befragte im Alter ab 14 Jahren, die privat das Internet nutzen Erhebungszeitraum: 4. bis 9. Mai 2017 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Methode: Online-Befragung
Jugendliche und Alkohol Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Eltern
 Jugendliche und Alkohol Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Eltern 23. Januar 2017 q666/3298 Mü/Pl forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30 10317 Berlin Telefon:
Jugendliche und Alkohol Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Eltern 23. Januar 2017 q666/3298 Mü/Pl forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30 10317 Berlin Telefon:
COBUS Marktforschung GmbH
 Imageanalyse der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice Januar 2012 1 Inhaltsverzeichnis Seite A. Erhebungs- und Auswertungsmethodik........3-4 B. Bekanntheit und Besuch.......5-10 C. Assoziation und Einschätzung.......11-18
Imageanalyse der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice Januar 2012 1 Inhaltsverzeichnis Seite A. Erhebungs- und Auswertungsmethodik........3-4 B. Bekanntheit und Besuch.......5-10 C. Assoziation und Einschätzung.......11-18
2 Allgemeines Verständnis, Bedeutung und Ziele der Integrierten Kommunikation
 2 Allgemeines Verständnis, Bedeutung und Ziele der Integrierten 2.1 Verständnis der Integrierten Die Frage zum Verständnis der Integrierten zu Beginn der Umfrage dient dazu, die Umfrageteilnehmer in die
2 Allgemeines Verständnis, Bedeutung und Ziele der Integrierten 2.1 Verständnis der Integrierten Die Frage zum Verständnis der Integrierten zu Beginn der Umfrage dient dazu, die Umfrageteilnehmer in die
FORSCHUNGSTELEGRAMM 10/2009
 FORSCHUNGSTELEGRAMM 10/2009 Peter Zellmann / Sonja Mayrhofer IFT Institut für Freizeit- und Tourismusforschung Neues Arbeitszeit/Gehaltsmodell? Weniger Verdienst für mehr Freizeit für viele eine Alternative
FORSCHUNGSTELEGRAMM 10/2009 Peter Zellmann / Sonja Mayrhofer IFT Institut für Freizeit- und Tourismusforschung Neues Arbeitszeit/Gehaltsmodell? Weniger Verdienst für mehr Freizeit für viele eine Alternative
UNICEF-Umfrage für Jugendliche zur Bundestagswahl 2017
 UNICEF-Umfrage für Jugendliche r Bundestagswahl 2017 HINTERGRUND Am 24. September 2017 wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht an der Wahl teilnehmen,
UNICEF-Umfrage für Jugendliche r Bundestagswahl 2017 HINTERGRUND Am 24. September 2017 wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht an der Wahl teilnehmen,
Verbleibstudie Europa-Universität Viadrina
 Zusammenfassung der Verbleibstudie Europa-Universität Viadrina Erste umfassende Absolventinnen- und Absolventenbefragung Vor 20 Jahren wurde die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder gegründet.
Zusammenfassung der Verbleibstudie Europa-Universität Viadrina Erste umfassende Absolventinnen- und Absolventenbefragung Vor 20 Jahren wurde die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder gegründet.
Wie sich Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen
 Wie sich Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen In ihrem IAB-Kurzbericht 10/2017 haben Torsten Lietzmann und Claudia Wenzig untersucht, ob und wie die Arbeitszeitwünsche von Frauen und
Wie sich Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen In ihrem IAB-Kurzbericht 10/2017 haben Torsten Lietzmann und Claudia Wenzig untersucht, ob und wie die Arbeitszeitwünsche von Frauen und
AUSGLEICHSKASSE IV-STELLE SCHWYZ Gute Noten für die berufliche Eingliederung der IV-Stelle Schwyz
 Gute Noten für die berufliche Eingliederung der IV-Stelle Schwyz Umfrage vom Juni 2014 bei Arbeitgebern, die in der beruflichen Eingliederung bereits mit der IV- Stelle Schwyz zusammengearbeitet hatten.
Gute Noten für die berufliche Eingliederung der IV-Stelle Schwyz Umfrage vom Juni 2014 bei Arbeitgebern, die in der beruflichen Eingliederung bereits mit der IV- Stelle Schwyz zusammengearbeitet hatten.
Allgemeine bildungsökonomische Rahmenbedingungen in Deutschland
 Executive Summary Der KfW-Studienkredit wurde von der KfW Bankengruppe im Jahr 2006 als bundesweites Angebot eingeführt. Er dient der Finanzierung der Lebenshaltungskosten während eines Hochschulstudiums.
Executive Summary Der KfW-Studienkredit wurde von der KfW Bankengruppe im Jahr 2006 als bundesweites Angebot eingeführt. Er dient der Finanzierung der Lebenshaltungskosten während eines Hochschulstudiums.
Wie sich Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen
 Wie sich Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen In ihrem IAB-Kurzbericht 10/2017 haben Torsten Lietzmann und Claudia Wenzig untersucht, ob und wie die Arbeitszeitwünsche von Frauen und
Wie sich Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen In ihrem IAB-Kurzbericht 10/2017 haben Torsten Lietzmann und Claudia Wenzig untersucht, ob und wie die Arbeitszeitwünsche von Frauen und
Online Befragung "Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren: Einschätzungen und Vorgehensweisen von medizinischen Fachpersonen"
 Online Befragung "Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren: Einschätzungen und Vorgehensweisen von medizinischen Fachpersonen" Zusammenfassung der Resultate Im Zeitraum November 2013
Online Befragung "Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren: Einschätzungen und Vorgehensweisen von medizinischen Fachpersonen" Zusammenfassung der Resultate Im Zeitraum November 2013
80,8 65,8 64,3 60,8 46,5 38,0 19,9 16,8 12,6 11,2 10,9 10,5 10,4 9,9 9,6 8,5 8,1 7,2 5,6 5,5 5,4 5,1 4,6 4,5 4,2 2,9 2,1 2,0 1,8 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1
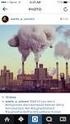 Oberbayern Schwaben Mittelfranken Unterfranken Niederbayern Oberpfalz Oberfranken 19,9 16,8 12,6 11,2 10,9 10,5 10,4 9,9 9,6 8,5 8,1 7,2 5,6 5,5 5,4 5,1 4,6 4,5 4,2 2,9 2,1 2,0 1,8 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1
Oberbayern Schwaben Mittelfranken Unterfranken Niederbayern Oberpfalz Oberfranken 19,9 16,8 12,6 11,2 10,9 10,5 10,4 9,9 9,6 8,5 8,1 7,2 5,6 5,5 5,4 5,1 4,6 4,5 4,2 2,9 2,1 2,0 1,8 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1
$QDO\VHXQG*UXQGODJHQ.RQ]HSW I UGLH1HXHLQI KUXQJYRQ/HLVWXQJV]HQWUHQ GHV6FKZHL]HULVFKHQ9ROOH\EDOO9HUEDQGHV
![$QDO\VHXQG*UXQGODJHQ.RQ]HSW I UGLH1HXHLQI KUXQJYRQ/HLVWXQJV]HQWUHQ GHV6FKZHL]HULVFKHQ9ROOH\EDOO9HUEDQGHV $QDO\VHXQG*UXQGODJHQ.RQ]HSW I UGLH1HXHLQI KUXQJYRQ/HLVWXQJV]HQWUHQ GHV6FKZHL]HULVFKHQ9ROOH\EDOO9HUEDQGHV](/thumbs/68/58615939.jpg) %HUQHU)DFKKRFKVFKXOH Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern Diplomarbeit $QDO\VHXQG*UXQGODJHQ.RQ]HSW I UGLH1HXHLQI KUXQJYRQ/HLVWXQJV]HQWUHQ GHV6FKZHL]HULVFKHQ9ROOH\EDOO9HUEDQGHV eingereicht
%HUQHU)DFKKRFKVFKXOH Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern Diplomarbeit $QDO\VHXQG*UXQGODJHQ.RQ]HSW I UGLH1HXHLQI KUXQJYRQ/HLVWXQJV]HQWUHQ GHV6FKZHL]HULVFKHQ9ROOH\EDOO9HUEDQGHV eingereicht
Mismatch zwischen Bedarf und Qualifikation verhindert Vollbeschäftigung
 Mismatch zwischen Bedarf und Qualifikation verhindert Vollbeschäftigung Bericht der IW Consult GmbH Köln, den 26. Mai 2011 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668
Mismatch zwischen Bedarf und Qualifikation verhindert Vollbeschäftigung Bericht der IW Consult GmbH Köln, den 26. Mai 2011 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668
Europa in der Krise?
 Europa in der Krise? Das Meinungsbild der Deutschen Repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken März 2017 Die Deutschen sehen die Europäische Union zunehmend in der Krise
Europa in der Krise? Das Meinungsbild der Deutschen Repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken März 2017 Die Deutschen sehen die Europäische Union zunehmend in der Krise
Mädchen bleiben am Ball
 Mädchen bleiben am Ball Welche Mädchen machen Teamsport? Wie sind sie darauf gekommen? Welche Mädchen machen keinen Teamsport und warum? Was bringt der Teamsport den Mädchen und was schätzen Mädchen an
Mädchen bleiben am Ball Welche Mädchen machen Teamsport? Wie sind sie darauf gekommen? Welche Mädchen machen keinen Teamsport und warum? Was bringt der Teamsport den Mädchen und was schätzen Mädchen an
Ärztestudie zum Thema Mangelernährung. im Auftrag von
 Ärztestudie zum Thema Mangelernährung im Auftrag von Ergebnispräsentation Dienstag, 26.04.2016 Projektbeschreibung Im Auftrag des Bundesverbandes Initiative 50Plus e.v. und der HIPP GmbH & Co. Vertrieb
Ärztestudie zum Thema Mangelernährung im Auftrag von Ergebnispräsentation Dienstag, 26.04.2016 Projektbeschreibung Im Auftrag des Bundesverbandes Initiative 50Plus e.v. und der HIPP GmbH & Co. Vertrieb
Themen für Bachelor-Arbeiten (Betreuung S. Tittlbach) Motorische und psychosoziale Entwicklung von Nachwuchs-Fußballspielern
 INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT Lehrstuhl Sportwissenschaft III Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports Prof. Dr. Susanne Tittlbach Telefon Sekretariat: 0921/ 55-3461 Email: susanne.tittlbach@uni-bayreuth.de
INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT Lehrstuhl Sportwissenschaft III Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports Prof. Dr. Susanne Tittlbach Telefon Sekretariat: 0921/ 55-3461 Email: susanne.tittlbach@uni-bayreuth.de
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020
 Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Fragestellung Fragestellungen
 Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Deutsche Schule Madrid Pädagogisches Qualitätsmanagement. Interne Evaluation März Ausgewählte Ergebnisse
 Deutsche Schule Madrid Pädagogisches März 2015 Ausgewählte Ergebnisse im Schuljahr 2014-2015 Ausgewählte Ergebnisse der Befragung 1. Allgemeine Schulzufriedenheit - 1.1. Sehr hohe Zustimmungswerte unter
Deutsche Schule Madrid Pädagogisches März 2015 Ausgewählte Ergebnisse im Schuljahr 2014-2015 Ausgewählte Ergebnisse der Befragung 1. Allgemeine Schulzufriedenheit - 1.1. Sehr hohe Zustimmungswerte unter
Ärztliche Psychotherapie für bestimmte Patientengruppen
 98 6 Stellenwert der Ärztlichen Psychotherapie für spezielle psychotherapeutische Verfahren sollte grundsätzliche ärztliche Fähigkeit werden. Das bedingt, die wichtigen, auch neueren Verfahren (nicht nur
98 6 Stellenwert der Ärztlichen Psychotherapie für spezielle psychotherapeutische Verfahren sollte grundsätzliche ärztliche Fähigkeit werden. Das bedingt, die wichtigen, auch neueren Verfahren (nicht nur
Jenaer Geschäftsklimaindex. Gesamtauswertung der Befragung des Basisjahres 2011
 Jenaer Geschäftsklimaindex Gesamtauswertung der Befragung des Basisjahres 2011 Inhaltsverzeichnis 1. Kurze Charakterisierung der befragten Unternehmen 2. Gesamtauswertung 3. Handel 4. Verarbeitendes Gewerbe
Jenaer Geschäftsklimaindex Gesamtauswertung der Befragung des Basisjahres 2011 Inhaltsverzeichnis 1. Kurze Charakterisierung der befragten Unternehmen 2. Gesamtauswertung 3. Handel 4. Verarbeitendes Gewerbe
Auswertung der Zentralen Klassenarbeiten Deutsch im Schuljahrgang 6 am Gymnasium sowie am Gymnasialzweig der KGS des Schuljahres 2007/2008
 Auswertung der Zentralen Klassenarbeiten Deutsch im Schuljahrgang 6 am Gymnasium sowie am Gymnasialzweig der KGS des Schuljahres 2007/2008 0 Vorbemerkungen Mit der Auswertung der ZKA Deutsch Schuljahrgang
Auswertung der Zentralen Klassenarbeiten Deutsch im Schuljahrgang 6 am Gymnasium sowie am Gymnasialzweig der KGS des Schuljahres 2007/2008 0 Vorbemerkungen Mit der Auswertung der ZKA Deutsch Schuljahrgang
Traditionelle Hausfrauenrolle und Konfession
 In % 16 14 12 1 Es ist für alle Beteiligten besser, wenn der Mann voll im Erwerbsleben steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Zustimmung: Antworten stimme voll
In % 16 14 12 1 Es ist für alle Beteiligten besser, wenn der Mann voll im Erwerbsleben steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Zustimmung: Antworten stimme voll
Muslimfeindlichkeit in Berlin 2003 bis Eine Sonderauswertung von Langzeitstudien im Auftrag des Mediendienstes Integration. von Daniela Krause
 Muslimfeindlichkeit in Berlin 2003 bis 2014 Eine Sonderauswertung von Langzeitstudien im Auftrag des Mediendienstes Integration von Daniela Krause (Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung,
Muslimfeindlichkeit in Berlin 2003 bis 2014 Eine Sonderauswertung von Langzeitstudien im Auftrag des Mediendienstes Integration von Daniela Krause (Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung,
Online-Befragung Wahlausschuss Mitgliederbefragung. Oktober 2017
 Online-Befragung Wahlausschuss Mitgliederbefragung Oktober 2017 METHODIK METHODIK GRUNDGESAMTHEIT: wahlberechtigte Mitglieder des FC Schalke 04 ERHEBUNGSZEITRAUM: 14.10.2017 18.10.2017 EINLADUNGEN: 105.000
Online-Befragung Wahlausschuss Mitgliederbefragung Oktober 2017 METHODIK METHODIK GRUNDGESAMTHEIT: wahlberechtigte Mitglieder des FC Schalke 04 ERHEBUNGSZEITRAUM: 14.10.2017 18.10.2017 EINLADUNGEN: 105.000
Fußballberichterstattung in der NS-Zeit
 Geschichte Tobias Bunse Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Eine Analyse der Fachzeitschrift "Der Kicker" Examensarbeit Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Schriftliche Hausarbeit vorgelegt im
Geschichte Tobias Bunse Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Eine Analyse der Fachzeitschrift "Der Kicker" Examensarbeit Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Schriftliche Hausarbeit vorgelegt im
Talentförderung auf Kreisebene, ein Teil der Kette
 Talentförderung auf Kreisebene, ein Teil der Kette Die Talentförderung auf Kreisebene ist ein kleiner Teil der Kette vom Verein bis zur Nationalmannschaft Nur wenige schaffen den Weg in die Junioren/Innen-Auswahlteams
Talentförderung auf Kreisebene, ein Teil der Kette Die Talentförderung auf Kreisebene ist ein kleiner Teil der Kette vom Verein bis zur Nationalmannschaft Nur wenige schaffen den Weg in die Junioren/Innen-Auswahlteams
Bestandserhebung ambulant betreuter Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg 2017
 Bestandserhebung ambulant betreuter Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg 2017 Herausgegeben von der Fachstelle ambulant unterstützte Wohnformen Baden-Württemberg Senefelderstraße 73 70176 Stuttgart
Bestandserhebung ambulant betreuter Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg 2017 Herausgegeben von der Fachstelle ambulant unterstützte Wohnformen Baden-Württemberg Senefelderstraße 73 70176 Stuttgart
Die Wirkungsweise des Talentförderprogramms des DFB und die Auswirkungen auf den deutschen Profifußball
 Die Wirkungsweise des Talentförderprogramms des DFB und die Auswirkungen auf den deutschen Profifußball - Eine Untersuchung der Zeiträume vor und nach Einführung der DFB- Talentförderung zur Überprüfung
Die Wirkungsweise des Talentförderprogramms des DFB und die Auswirkungen auf den deutschen Profifußball - Eine Untersuchung der Zeiträume vor und nach Einführung der DFB- Talentförderung zur Überprüfung
Befragung im INSA-Meinungstrend ( KW 2017)
 Befragung im INSA-Meinungstrend (34. 35. KW 2017) Befragungsmethode 2 Feldzeit: 25.08. 28.08.2017 Methodik: Die Umfrage wurde als Online-Befragung durchgeführt. Stichprobe: 2.034 Personen aus ganz Deutschland
Befragung im INSA-Meinungstrend (34. 35. KW 2017) Befragungsmethode 2 Feldzeit: 25.08. 28.08.2017 Methodik: Die Umfrage wurde als Online-Befragung durchgeführt. Stichprobe: 2.034 Personen aus ganz Deutschland
Psychologie des Bewertens
 HolidayCheck Studie zur Psychologie des Bewertens Erweiterte Hintergrunddaten Studiensteckbrief Methode Panel-Befragung im BurdaForward Opinion-Pool Grundgesamtheit Teilnehmer des BurdaForward-Online-Panels
HolidayCheck Studie zur Psychologie des Bewertens Erweiterte Hintergrunddaten Studiensteckbrief Methode Panel-Befragung im BurdaForward Opinion-Pool Grundgesamtheit Teilnehmer des BurdaForward-Online-Panels
Ergebnisbericht. des Inklusions-Monitors 2017 im Auftrag des Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen.
 Ergebnisbericht des Inklusions-Monitors 2017 im Auftrag des Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen Auftragnehmerin INSA-CONSULERE GmbH Herr Hermann Binkert Arndtstraße 1 99096 Erfurt Tel:
Ergebnisbericht des Inklusions-Monitors 2017 im Auftrag des Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen Auftragnehmerin INSA-CONSULERE GmbH Herr Hermann Binkert Arndtstraße 1 99096 Erfurt Tel:
Ja-Prozente bei 6-stufigen Antwortskalen
 Ja-Prozente bei 6-stufigen Antwortskalen Andreas Kögel Zusammenfassung Im Gegensatz zu den gängigeren 5er-Skalen sind bei Antwortskalen mit 6 Antwortabstufungen zwei Varianten der Ermittlung von Ja-Prozenten
Ja-Prozente bei 6-stufigen Antwortskalen Andreas Kögel Zusammenfassung Im Gegensatz zu den gängigeren 5er-Skalen sind bei Antwortskalen mit 6 Antwortabstufungen zwei Varianten der Ermittlung von Ja-Prozenten
Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung
 Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung Die Folgen der Finanzkrise verunsichern viele Menschen. Vor allem Berufseinsteiger sind bei möglichen Entlassungen als erste betroffen.
Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung Die Folgen der Finanzkrise verunsichern viele Menschen. Vor allem Berufseinsteiger sind bei möglichen Entlassungen als erste betroffen.
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung
 Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer & Dr. Kirstin Hallmann Factsheet zur Studie Akzeptanz des Spitzensports,
 Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer & Dr. Kirstin Hallmann Factsheet zur Studie Akzeptanz des Spitzensports, 15.08.2016 Die Studie wurde finanziell unterstützt durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Im Folgenden
Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer & Dr. Kirstin Hallmann Factsheet zur Studie Akzeptanz des Spitzensports, 15.08.2016 Die Studie wurde finanziell unterstützt durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Im Folgenden
Präsentation ausgewählter Ergebnisse der schriftlichen Befragung Wohnen und Leben in Grünau im Mai/Juni 2015
 Präsentation ausgewählter Ergebnisse der schriftlichen Befragung Wohnen und Leben in Grünau im Mai/Juni 2015 Projektleiterin: Prof. Dr. Sigrun Kabisch Mitarbeiter: Maximilian Ueberham, Max Söding Department
Präsentation ausgewählter Ergebnisse der schriftlichen Befragung Wohnen und Leben in Grünau im Mai/Juni 2015 Projektleiterin: Prof. Dr. Sigrun Kabisch Mitarbeiter: Maximilian Ueberham, Max Söding Department
Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg
 Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Ergebnisse der Telefonbefragung 13 Prof. Dr. Thorsten Faas Institut für Politikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Rüdiger
Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Ergebnisse der Telefonbefragung 13 Prof. Dr. Thorsten Faas Institut für Politikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Rüdiger
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Tabak: Einstellungen zu Werbung, Preiserhöhungen und Verkaufseinschränkungen (Zusammenfassung)
 H A N S K R E B S Kommunikations- und Publikumsforschung Tabak: Einstellungen zu Werbung, Preiserhöhungen und Verkaufseinschränkungen (Zusammenfassung) Tabakmonitoring Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum
H A N S K R E B S Kommunikations- und Publikumsforschung Tabak: Einstellungen zu Werbung, Preiserhöhungen und Verkaufseinschränkungen (Zusammenfassung) Tabakmonitoring Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum
STAR: Entwicklung der Strukturen und Beschäftigtenzahlen in Rechtsanwaltskanzleien
 Quelle: BRAK-Mitteilungen 4/2000 (S. 166-169) Seite 1 STAR: Entwicklung der Strukturen und Beschäftigtenzahlen in Rechtsanwaltskanzleien Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg In nachstehendem
Quelle: BRAK-Mitteilungen 4/2000 (S. 166-169) Seite 1 STAR: Entwicklung der Strukturen und Beschäftigtenzahlen in Rechtsanwaltskanzleien Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg In nachstehendem
lab. studie. Medienperspektiven in der Unternehmensberichterstattung. stand: 17. september online reporting evolved
 online reporting evolved lab. studie. Medienperspektiven in der Unternehmensberichterstattung. stand: 17. september 2014. nexxar gmbh mariahilfer strasse 121b/4 1060 vienna, austria office@nexxar.com www.nexxar.com
online reporting evolved lab. studie. Medienperspektiven in der Unternehmensberichterstattung. stand: 17. september 2014. nexxar gmbh mariahilfer strasse 121b/4 1060 vienna, austria office@nexxar.com www.nexxar.com
MCI-Studie 2013 zu. Naturgewalten, Risikoempfinden & Sicherheit. Pressekonferenz. TIROLER VERSICHERUNG und MCI Management Center Innsbruck
 MCI-Studie 2013 zu Naturgewalten, Risikoempfinden & Sicherheit - Eine aktuelle Einschätzung durch die Tiroler Bevölkerung - Pressekonferenz TIROLER VERSICHERUNG und MCI Management Center Innsbruck Innsbruck,
MCI-Studie 2013 zu Naturgewalten, Risikoempfinden & Sicherheit - Eine aktuelle Einschätzung durch die Tiroler Bevölkerung - Pressekonferenz TIROLER VERSICHERUNG und MCI Management Center Innsbruck Innsbruck,
Corporate Governance Report 2012
 Corporate Governance Report 2012 April 2012 Berlin Center of Corporate Governance Prof. Dr. Axel v. Werder Dipl.-Kffr. Jenny Bartz Corporate Governance Report 2012 Neuer Studienansatz Kodexklima statt
Corporate Governance Report 2012 April 2012 Berlin Center of Corporate Governance Prof. Dr. Axel v. Werder Dipl.-Kffr. Jenny Bartz Corporate Governance Report 2012 Neuer Studienansatz Kodexklima statt
Dialego Market Research Online For Better Decisions
 Dialego Market Research Online For Better Decisions Wellness Eine Befragung der Dialego AG Januar 2007 Bei Veröffentlichung durch Dritte Belegexemplar erbeten Inhaltsverzeichnis Projektdokumentation Hauptbefragung
Dialego Market Research Online For Better Decisions Wellness Eine Befragung der Dialego AG Januar 2007 Bei Veröffentlichung durch Dritte Belegexemplar erbeten Inhaltsverzeichnis Projektdokumentation Hauptbefragung
