Jahresbericht der Biologischen Station Rieselfelder Münster ISSN
|
|
|
- Steffen Waldemar Weber
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Jahresbericht 2007 der Biologischen Station Rieselfelder Münster ISSN
3 II Impressum Impressum Herausgeber: Biologische Station Rieselfelder Münster Coermühle Münster Tel.: Fax.: Internet: Redaktion und Layout: Giselheid Reding Titelbild: Blässgänse Michael Klein Druck Druckhaus Stegemöller Virnkamp Münster Auflage: ca. 750 Band 10 ISSN
4 Jahresbericht Inhaltsverzeichnis Vorwort... 2 Jahreszeitliches Auftreten ausgewählter Vogelarten in den Rieselfeldern Münster Brutvögel der Rieselfelder...27 Möwen in den Rieselfeldern: Die Vertreibung aus dem Paradies...31 Kammmolch und Kleiner Wasserfrosch...36 Biotop-Management Maßnahmen...42 Besonderheiten und Impressionen der Vogelwelt in den Rieselfeldern Ergebnisse der Vegetationskartierung Januar 2007: Kyrill...62 Öffentlichkeitsarbeit Vogel und landschaftskundliche Exkursionen des Freundes- und Förderkreises des Europareservates Rieselfelder Münster Verkehrszählung Presse-Echo...88
5 2 Vorwort Vorwort Michael Harengerd Abgesehen vom nahezu ausgefallenen Winter 2006/2007, bescherte uns der März ein zunächst etwas rätselhaftes Karpfensterben, das aber sehr schnell von Fischereisachverständigen als Bauchwassersucht eine Viruserkrankung übertragen von Egeln und Läusen - identifiziert und als nicht gerade selten für etwa 4-6 Jahre alte Karpfen bezeichnet wurde. Das Sterben hörte prognosegemäß mit steigenden Wassertemperaturen im April auch wieder auf. Einen nicht unerheblichen Schaden richtete auch bei uns der Orkan Kyrill an: Mehrere Beobachtungsstände wurden beschädigt einer sogar so stark, dass er vorübergehend geschlossen werden musste. Etliche ältere Obstbäume wurden umgeweht, so dass manche Wegstrecken vorübergehend unpassierbar waren. Auf auch öffentliches Interesse stießen die (von uns so erwarteten) Folgen der allmählichen Abdeckung der Zentraldeponie II: Im Berichtsjahr 2007 waren praktisch alle Möwen und Rabenvögel von der Deponie verschwunden, weil sie keine Nahrung mehr fanden. Da die Rieselfelder selbst diesen müllbedingten Nahrungsüberfluss nicht bereitstellen, wurden diese Arten auch im Reservat seltener. Aus ökologischer Sicht ist eine solche Entwicklung sinnvoll und erfreulich, da sie die vor allem winterliche Mortalitätsrate dieser Arten wieder auf einen natürlicheren Wert erhöht. Neben den Möwen und Rabenvögeln waren auch etliche Störche betroffen, die in früheren Jahren versucht hatten, mit Hilfe der Mülldeponie hier zu überwintern. Wenn durch diesen Umstand wieder mehr Störche dazu gebracht werden, abzuziehen, wäre auch dies ein erfreulicher Aspekt der fehlenden Abfälle. Denn auch die massenhafte Überwinterung von frei fliegenden Zoostörchen wie etwa in Rheine ist nicht unproblematisch, weil sie der natürlichen Wiederbesiedlung entgegensteht. Erwartungsgemäß gab es auch 2007 keine Probleme mit der Vogelgrippe ; zwar haben wir wieder zahlreiche Kotproben und einzelne Kadaver zur Untersuchung eingereicht, aber alle Ergebnisse waren negativ. Dieses kann nicht erstaunen, denn es war eben von Anfang an ein unzutreffender Ansatz, von einer Ausbreitung der
6 Jahresbericht auch für den Menschen gefährlichen Variante H5N1 durch Wildvögel auszugehen. Es gab nämlich für diese Annahme seit 2005 keinerlei überzeugende Hinweise, eher im Gegenteil. Zum Tag des offenen Denkmals am 9. September konnte erstmals der inzwischen fertig gestellte Seminarraum im oberen Trakt des ehemaligen Schweinestalls der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Sobald auch der untere Trakt (Technik, Toiletten, Garderobe usw.) ausgebaut ist, kann der Umbau und die Renovierung der gesamten Hofstelle als abgeschlossen betrachtet werden, sieht man von kleineren Maßnahmen wie den Ersatz der alten Tore an der Remise und am Anbau des Schweinestalls ab. Was dann noch fehlt, ist die geplante Außenausstellung hinter dem Schweinestall. Diese wird voraussichtlich noch etwa zwei Jahre auf sich warten lassen müssen. Wir haben uns nämlich an dem landesweiten Wettbewerb Erlebnis.NRW beteiligt, worin auch die Einrichtung dieser Außenausstellung enthalten ist. Relativ viel Zeit nahmen die Gespräche mit dem Land Nordrhein- Westfalen und der Stadt Münster über einen neuen Betreuungsvertrag zwischen der Biologischen Station und der Stadt ein. Dies lag im Wesentlichen an den Problemen, die es auf Landesebene mit der Umstellung der Förderung von Biologischen Stationen gab. Da es hier jedoch wie schon im letzten Jahresbericht ausgeführt gar nicht um die Förderung der Station geht, sondern um den Unterhalt und die Optimierung des Gebietes, konnte schließlich Einvernehmen erzielt werden. Der Rat der Stadt Münster hat im Dezember 2007 dem neuen Vertrag zugestimmt, der in den wesentlichen Teilen der alte geblieben ist. Wenn dieser Jahresbericht erschienen ist, haben wir das 40jährige Jubiläum unserer Station gefeiert. Ihre Anfänge reichen nämlich bis 1968 zurück. Sie ist damit die älteste ( nichtbehördliche ) Biologische Station in NRW. Im Jahresbericht 2008 werden wir etwas ausführlicher über die Geschichte unserer Station und den Ablauf der Jubiläumsfeierlichkeiten berichten. Bei den Mitgliedern des weiter gewachsenen Freundes- und Förderkreises bedanken wir uns für die besonders in schwierigeren Zeiten so wichtige auch inhaltliche - Unterstützung. Diese wird zukünftig noch wichtiger, denn für die meisten der neueren Förderprogramme mit EU-Beteiligung werden 10-20% Eigenmittel benötigt.
7 4 Phänologie Jahreszeitliches Auftreten ausgewählter Vogelarten in den Rieselfeldern Münster 2007 Christian Müller, Andrea und Michael Klein Aus dem Jahr 2007 liegen der folgenden Auswertung Zähldaten von insgesamt 344 Exkursionstagen zugrunde. Dabei wurden die Bestände der feuchtgebietstypischen Vogelarten an 280 Tagen komplett und 64 Tagen teilweise erfasst. Bezogen auf die Komplettzählungen entspricht dies einem Durchschnitt von 5,4 Erfassungen pro Woche und liegt damit geringfügig über dem Vorjahresergebnis. Die hohe Zähldichte konnte demnach auch in diesem Jahr gehalten werden. Erfasst wurden in diesem Jahr 145 Vogelarten bzw. deren Unterarten. Wie in jedem Jahr werden in der folgenden Tabelle alle nachgewiesenen Vogelarten mit Angaben zu den Maximalbeständen und den Erst- bzw. Letzt-Beobachtungstagen aufgeführt. In den nachfolgenden Detailbetrachtungen wird das Zuggeschehen bei 37 Vogelarten näher vorgestellt. Unser herzlichster Dank gilt all jenen, die Vogeldaten an die Biologische Station gegeben haben, sowie den ehrenamtlichen Zählerinnen und Zählern. Im Jahr 2007 waren dies neben den Zivildienstleistenden, Praktikanten und Autoren: D. Biermann, U. Eschmann, B. Feldmann, Th. Hafner, H. Heise-Grunwald, C. Heuft, T. Kepp, H. Lauruschkus, E. Taute, M. Röhlen, C. Schulte, H.U. Schütz, K.H. Westhoff. Besonders bedanken möchten wir uns außerdem bei den vielen weiteren Beobachtern, die mit ihren Einträgen im Beobachtungsforum auf unserer Internetseite ( weitere Mosaiksteine zum Vogelmonitoring beitrugen. Schnatterenten-Erpel (Foto: T. Kepp)
8 Jahresbericht Tab. 1: Artenliste feuchtgebietstypischer Vogelarten in den Rieselfeldern Münster Eu- ring- Code Art Taucher Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand max. Bestand Status 70 Zwergtaucher Bv 90 Haubentaucher Bv 120 Schwarzhalstaucher Ruderfüßer udz 720 Kormoran Sg, Wg 950 Schreitvögel Große Rohrdommel Wg 1040 Nachtreiher A 1210 Silberreiher Sg, Wg 1220 Graureiher Bv, Wg 1310 Schwarzstorch A 1340 Weißstorch Bv, Wg 1440 Löffler udz Gänse und Schwäne 1520 Höckerschwan Bv, Wg 1535 Trauerschwan Gf 1540 Singschwan udz 1570 Saatgans Wg 1590 Blässgans Wg 1610 Graugans Bv, Wg 1620 Streifengans Sg, Wg 1640 Zwergschneegans Gf 1660 Kanadagans Bv, Wg 1670 Weißwangengans udz 1700 Nilgans Bv
9 6 Phänologie Eu- ring- Code Art Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand max. Bestand Status 1710 Rostgans rdz 1730 Brandgans Bv Enten 1770 Brautente Gf 1790 Pfeifente rdz, Wg 1820 Schnatterente Bv, Wg 1840 Krickente Bv, Wg 1860 Stockente Bv, Wg 1890 Spiessente rdzv 1910 Knäkente Bv 1930 Zimtente Gf 1940 Löffelente Bv, Gj 1960 Kolbenente udz 1980 Tafelente Bv, Gj 2030 Reiherente Bv, Gj 2180 Schellente rdz 2200 Zwergsäger A 2230 Gänsesäger Bv, rdz 2250 Schwarzkopfruderente Greifvögel Gf 2310 Wespenbussard rdz 2380 Schwarzmilan rdz 2390 Rotmilan rdz 2430 Seeadler A 2600 Rohrweihe Bv 2610 Kornweihe Wg 2670 Habicht Bv? 2690 Sperber Bv, Wg
10 Eu- ring- Code Art Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand Jahresbericht max. Bestand Status 2870 Mäusebussard Bv, Wg 2980 Zwergadler A 3010 Fischadler rdz 3040 Turmfalke Bv, Wg 3070 Rotfußfalke A 3090 Merlin A 3100 Baumfalke Bv 3200 Wanderfalke Sg, Wg Hühnervögel 3670 Rebhuhn Bv Rallen und Kraniche 4070 Wasserralle Bv, Wg Bv 4240 Teichhuhn Bv, Wg 4290 Blässhuhn Bv, Wg 4330 Kranich rdz Watvögel 4500 Austernfischer Bv 4550 Stelzenläufer A 4560 Säbelschnäbler rdz Tüpfelsumpfhuhn Flussregenpfeifer Sandregenpfeifer Goldregenpfeifer Kiebitzregenpfeifer Bv rdz udz udz 4930 Kiebitz Bv, rdz 4960 Knutt udz 4970 Sanderling udz
11 8 Phänologie Eu- ring- Art Code 5010 Zwergstrandläufer 5020 Temminckstrandläufer 5070 Graubruststrandläufer 5090 Sichelstrandläufer 5120 Alpenstrandläufer Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand max. Bestand Status rdz rdz A rdz rdz 5170 Kampfläufer rdz 5180 Zwergschnepfe rdz 5190 Bekassine Uferschnepfe Sg 5322 Isländische Uferschnepfe rdz, Bv? A 5340 Pfuhlschnepfe udz 5380 Regenbrachvogel 5410 Großer Brachvogel Dunkler Wasserläufer udz rdz rdz 5460 Rotschenkel rdz 5470 Teichwasserläufer A 5480 Grünschenkel rdz 5530 Waldwasserläufer 5540 Bruchwasserläufer rdz, Wg rdz 5560 Flussuferläufer rdz 5610 Steinwälzer udz Möwen/Seeschwalben 5660 Spatelraubmöwe 5750 Schwarzkopfmöwe A rdz 5780 Zwergmöwe rdz 5820 Lachmöwe rdz, Wg 5900 Sturmmöwe rdz, Wg
12 Jahresbericht Eu- ring- Code Art Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand max. Bestand Status 5910 Heringsmöwe rdz 5920 Silbermöwe rdz, Wg 5926 Mittelmeermöwe rdz, Wg 5927 Steppenmöwe rdz, Wg 6000 Mantelmöwe A 6150 Flussseeschwalbe 6160 Küstenseeschwalbe 6260 Weißbartseeschwalbe 6270 Trauerseeschwalbe 6280 Weißflügelseeschwalbe Kuckucke udz udz A rdz A 7240 Kuckuck ? > Bv Eulen 7350 Schleiereule > Bv 7570 Steinkauz > Bv Rackenvögel 8310 Eisvogel Bv 8460 Wiedehopf A Spechte 8480 Wendehals A Singvögel 9810 Uferschwalbe ? > Sg 9920 Rauchschwalbe ? > Bv, Sg Mehlschwalbe ? > Bv, Sg Wiesenpieper rdz Rotkehlpieper A
13 10 Phänologie Eu- ring- Code Art Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand max. Bestand Status Bergpieper Wg Schafstelze Bv, rdz Nördliche Schafstelze rdz Maskenstelze A Gebirgsstelze Bv, Wg Bachstelze > Gj Nachtigall ? Bv Blaukehlchen > Bv Braunkehlchen rdz Schwarzkehlchen Steinschmätzer Bv, rdz rdz Ringdrossel A Feldschwirl ? Bv Rohrschwirl A Schilfrohrsänger Sumpfrohrsänger Teichrohrsänger Drosselrohrsänger Bv? > Bv > Bv > , - - Bv Taigazilpzalp A Bartmeise Bv, Gj Beutelmeise Bv, Gj Pirol Raubwürger Wg Zwergammer A Bv?, rdz Rohrammer > Bv, Gj Grauammer A
14 Jahresbericht Eu- ring- Code Art Hybride Grau- x Kanadagans Grau- x Hausgans Stock- x Spießente Erste Beob. Letzte Beob. max. Bestand max. Bestand Status Gj Gj Gf 1) Es werden nur feuchtgebietsgebundene bzw. seltene Singvögel erfasst. Abkürzungen: Bv Sg Wg Gj rdz udz A Gf Brutvogel Sommergast Wintergast ganzjährig anwesend regelmäßiger Durchzügler unregelmäßiger Durchzügler Ausnahmegast Gefangenschaftsflüchtling Rastende Enten und Säger (Foto: T. Kepp)
15 12 Phänologie Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 60 Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Zwergtaucher Mit max. 27 Ind. im Frühjahr und 35 Ind. im Herbst ist trotz eines etwas höheren Brutbestandes ein weiterer leichter Rückgang der Bestandszahlen beim Zwergtaucher im Vergleich zu den Vorjahren zu beobachten. Anzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Kormoran Phalacrocorax carbo Der Winterbestand des Kormorans liegt mit bis zu 150 Ind. um ein Viertel unter dem Vorjahresmaximum. Die Kormorane der weiteren Umgebung sammeln sich mittlerweile an mehreren Schlafplätzen, die sie bei Störungen teilweise auch noch in der späteren Dämmerung und in der Nacht wechseln. Inwieweit die Wiederaufnahme der Bejagung dieser geschützten Art in NRW zu dem Rückgang beigetragen hat, lässt sich noch nicht sagen. Anzahl Kormoran 200 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Weißstorch Ciconia ciconia Während des Hauptdurchzugs im Herbst wurden max. 56 Störche am gezählt. Der Winterbestand hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Es handelt sich bei diesen Ind. wahrscheinlich überwiegend um Gäste aus dem Allwetterzoo Münster. Anzahl Weißstorch Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
16 Jahresbericht Höckerschwan Cygnus olor Mit 95 Ind. am bewegt sich der Höckerschwanbestand auf dem Niveau der Vorjahre. Deutlich erkennbar ist der Einschnitt ab etwa Mitte des Jahres Durch Botulismus wurde der Bestand in diesem extrem heißen Sommer erheblich dezimiert. Von diesem Rückgang hat sich die Art noch nicht wieder erholt. Anzahl Höckerschwan 140 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Höckerschwanfamilie Höckerschwan (Foto: M. Harengerd) 250 Höckerschwan Anzahl Jahr
17 14 Phänologie Blässgans Anser albifrons Mit maximal 615 Ind. hat sich der Winterbestand gegenüber dem Vorjahr noch einmal verdoppelt. Die starken Schwankungen zum Jahresende sind wahrscheinlich auf die intensive Gänsejagd in der unmittelbaren Umgebung der Rieselfelder zurückzuführen. Die Gänse kommen teilweise nach Anbruch der Nacht zu ihrem Schlafplatz in der E1-Zone. Anzahl Blässgans 800 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Graugänse (Foto: T. Kepp) Graugans Anser anser Der Winterbestand hat sich mit bis zu 897 Ind. auf hohem Niveau stabilisiert. Bemerkenswert ist jedoch der starke Anstieg während des Wegzuges im August mit maximal 1530 Ind. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Graugans Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
18 Kanadagans Branta canadensis 1000 Jahresbericht Kanadagans Die Winterbestände der Kanadagans sind mit maximal 937 Ind. am Schlafplatz in der E1-Zone deutlich zurück gegangen. Ursache hierfür dürfte die intensive Gänsejagd sein, bei der vom Ostrand des Gebiets in die abends einfliegenden Gänseschwärme geschossen wird. Der Gesamtbestand der Kanadagans in der weiteren Umgebung ist von diesem Rückgang allerdings wahrscheinlich nicht betroffen, da die Gänse auf andere Gewässer als Schlafplätze ausweichen und sich insgesamt über ein größeres Gebiet verteilen. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Brandgans Tadorna tadorna Brandgans (Foto: T. Kepp) Der Frühjahrsbestand hat sich in den vergangenen Jahren bei einem in etwa konstanten Brutbestand positiv entwickelt. Das Jahresmaximum wurde mit 62 Ind. am erreicht. Deutlich zu erkennen ist die starke Abnahme bis Ende August, wenn die Brandgänse zu ihren Mauserplätzen aufbrechen. Anzahl Brandgans Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
19 16 Phänologie Gänsesäger Mergus merganser Der Überwinterungsbestand des Gänsesägers steigt seit einigen Jahren kontinuierlich an. Allabendlich fliegen die Säger auf ihrem Schlafplatz auf der Fläche 28/A ein. Tagsüber sind sie auf den Seen der weiteren Umgebung der Rieselfelder zu finden. Anzahl Gänsesäger Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat 60 Gänsesäger Anzahl Monat
20 Jahresbericht Pfeifente Anas penelope Mit maximal 100 Ind. am liegt der Winterbestand deutlich unter dem des Vorjahres. Der Bestandseinbruch ab Ende November dürfte auf die einsetzende kalte Witterung zurückzuführen sein. Die Bestandsschwankungen im Frühjahr sind damit zu erklären, dass die Pfeifenten sich auch auf den umliegenden Baggerseen aufhalten und dann tageweise im Reservat fehlen. Anzahl Pfeifente 140 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Schnatterente Anas strepera Der Aufwärtstrend in der Bestandentwicklung scheint bei dieser Entenart weiter ungebrochen zu sein. Mit 1270 Ind. am ist ein neuer Bestandsrekord ermittelt worden. Während die Art bei den Brutbeständen die Stockente bereits von ihrem Spitzenplatz verdrängt hat, scheint sich eine ähnliche Entwicklung auch bei den Rastbeständen abzuzeichnen. Anzahl Schnatterente 1400 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Krickente 2500 Krickente Anas crecca 2000 Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Die Herbstbestände der Krickente liegen etwas unter denen des Vorjahres. Das Maximum fällt mit 1730 Ind. am ebenfalls geringer aus. Anzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
21 18 Phänologie Stockente Anas platyrhynchos Die Rast- und Winterbestände der Stockente liegen im Durchschnitt der letzten Jahre. Das Maximum liegt mit 1930 Ind. am unter dem des Vorjahres. Die positive Tendenz des Vorjahres konnte nicht fortgeführt werden. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Stockente 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Spießente Anas acuta Bei der Spießente hat es in diesem Jahr einen starken Bestandeinbruch gegeben. Mit 33 Ind. am liegt das Maximum erheblich unter dem des Vorjahres. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Spießente Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Knäkente Anas querquedula Die negative Bestandsentwicklung bei dieser Entenart auf dem Herbstzug setzt sich auch in diesem Jahr fort. Mit 47 Ind. liegt das Maximum deutlich unter dem des Vorjahres. Anders sieht die Entwicklung im Frühjahr aus. Hier konnte mit 43 Ind. das Maximum gegenüber dem Vorjahr verdoppelt werden. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Knäkente 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
22 Jahresbericht Löffelente Anas clypeata Zwar konnte das gute Ergebnis des Vorjahres nicht wieder erreicht werden. Die Bestandsentwicklung liegt bei der Löffelente aber weiterhin über dem Durchschnitt der Vorjahre. Erfreulich ist zudem der steigende Anteil an überwinternden Löffelenten im Gebiet. Anzahl Löffelente 1000 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Tafelente Aythya ferina Auch bei dieser Entenart sind 2007 rückläufige Zahlen zu beobachten. Auffällig ist insbesondere der Rückgang im ersten Quartal des Jahres. Anzahl Tafelente Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Reiherente Aythya fuligula Mit maximal 354 Ind. am bleibt der Rastbestand der Reiherente auf einem hohen Niveau. Deutlich erkennbar im Diagramm ist die Zweigipfligkeit des Durchzuges Mitte März und Mitte Mai. Anzahl Monat Reiherente Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
23 20 Phänologie Blässhuhn Fulica atra Mit bis zu 875 Ind. am liegt das Maximum bei dem Blässhuhn unter dem des Vorjahres. Auffällig ist vor allem der Bestandsrückgang im ersten Quartal im Vergleich zum langjährigen Mittel. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Blässralle Blässhuhn 0 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Teichhuhn Gallinula chloropus Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bestand vor allem im Herbst wieder deutlich erholt. Mit 90 Ind. am reicht das Maximum an das des langjährigen Mittels fast wieder heran. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Teichralle Teichhuhn 20 Flußregenpfeifer Charadrius dubius und Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula 0 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Bei beiden Arten sind einzelne Massendurchzugstage auffällig. Beim Flussregenpfeifer wurden 26 Ind. am bzw. 25 Ind. am gezählt. Der Sandregenpfeifer fiel mit 24 Ind. am aus dem Rahmen. Ansonsten war diese Art über das Jahr gesehen etwas unterrepräsentiert. Teichhuhn (Foto: T. Kepp)
24 Jahresbericht Flussregenpfeifer Sandregenpfeifer Pentadenmittel Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Tageszählungen Anzahl 15 Anzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Monat Kiebitz Vanellus vanellus Kiebitz (Foto: T. Kepp) Der Negativtrend bei dieser Art 3000 Kiebitz konnte 2007 deutlich durchbro Pentadenmittel Tageszählungen 2007 chen werden. Mit bis zu 2620 Ind. am konnte das Vorjahres maximum fast verdoppelt werden. Anzahl 1500 Auch darüber hinaus war der Kie bitz über das gesamte Jahr gesehen überdurchschnittlich vetreten Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
25 22 Phänologie Strandläufer Die vier kleinen Strandläuferarten, die regelmäßig in größeren Zahlen im Gebiet zu beobachten sind, haben in diesem Jahr sehr unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen. Während der Temminckstrandläufer (Calidris temminckii) im Gegensatz zu den letzten Jahren nur sporadisch auftrat, haben Zwergstrandläufer (Calidris minuta) und Sichel- strandläufer (Calidris ferruginea) positive Bestandsentwicklungen zu verzeichnen. Mit bis zu 29 Ind. beim Zwergstrandläufer und 17 Ind. beim Sichelstrandläufer konnten die Vorjahresmaxima deutlich übertroffen werden. Wie schon im Vorjahr lässt sich beim Alpenstrandläufer (Calidris alpina) kein Bestandstrend erkennen. Zwergstrandläufer Temminckstrandläufer Pentadenmittel Tageszählungen Pentadenmittel Tageszählungen Anzahl 15 Anzahl Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Sichelstrandläufer Alpenstrandläufer Pentadenmittel Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Tageszählungen Anzahl 15 Anzahl Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 0 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Monat
26 Jahresbericht Kampfläufer Philomachus pugnax Während der Frühjahrszug mit maximal 20 Ind. unterdurchschnittlich verlaufen ist, liegt der Herbstzug mit bis zu 25 Ind. im Mittel der vergangenen Jahre. Das insgesamt eher schlechte Ergebnis lässt sich auf die sehr feuchte Witterung zurückführen, bei der die Kampfläufer genügend Rastplätze auf überschwemmten Wiesen und Äckern vorfinden konnten. Anzahl Kampfläufer Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Bekassine Gallinago gallinago Ähnlich wie der Kampfläufer profitiert auch die Bekassine von der ungewöhnlich feuchten Witterung während des gesamten Sommers. Entsprechend niedrig fallen die Rastbestände in diesem Jahr aus. Das Maximum des Vorjahres wird mit 140 Ind. deutlich unterschritten. Anzahl Bekassine Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Uferschnepfe Limosa limosa Der Aufwärtstrend des vorigen Jahres im Vergleich zum langjährigen Mittel setzt sich in diesem Jahr zumindest beim Wegzug fort. Das Maximum lag mit 63 Ind. allerdings unter dem Vorjahresergebnis. Anzahl Uferschnepfe Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
27 24 Phänologie Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus Die Bestandsentwicklung des Dunklen Wasserläufers verlief in diesem Jahr positiv. Mit 32 Ind. am liegt das Maximum deutlich höher als im Vorjahr. Auffällig ist im Unterschied zum langjährigen Mittel allerdings das weitgehende Fehlen der Art ab etwa Mitte Oktober. Anzahl Dunkler Wasserläufer 40 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Rotschenkel Tringa totanus Auch beim Rotschenkel lässt sich in diesem Jahr ein positiver Trend vermelden. Mit 76 Ind. am konnte der höchste Bestand seit 1980 ermittelt werden. Auch während des Herbstzuges liegen die Bestandszahlen mit maximal 20 Ind. über dem langjährigen Mittel. Grünschenkel Tringa nebularia Mit maximal 60 Ind. konnte das Vorjahresmaximum zwar nicht wieder erreicht werden, der Durchzug fällt aber insgesamt ähnlich gut aus wie im Vorjahr. Auffällig ist diesmal die ausgeprägte Zweigipfeligkeit des Frühjahrszuges. Anzahl Anzahl Rotschenkel 100 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Grünschenkel 80 Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
28 Jahresbericht Waldwasserläufer Tringa ochropus Ähnlich wie im Vorjahr liegt auch in diesem Jahr das Frühjahrsmaximum des Waldwasserläufers mit 59 Ind. deutlich über dem des Herbstzuges mit 42 Ind. Der Herbstzug fällt insgesamt etwas schlechter aus als im Vorjahr. Anzahl Waldwasserläufer Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Bruchwasserläufer Tringa glareola Während der Frühjahrszug mit maximal 60 Ind. im Mittel der letzten Jahre liegt, hat es im Herbst mit maximal 30 Ind. wieder einen deutlichen Bestandseinbruch gegeben. Anzahl Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Bruchwasserläufer 20 Flussuferläufer Actitis hypoleucos 0 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Im Gegensatz zum Vorjahr haben sich die Rastbestände des Flussuferläufers in diesem Jahr wieder leicht erholt. Das Frühjahrsmaximum lag bei 16 Ind. am , das Herbstmaximum mit 25 Ind. am Anzahl Flussuferläufer Pentadenmittel Tageszählungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat
29 26 Phänologie Möwen Der Rückgang in den Beständen der Möwen hat nun auch die Sturmmöwe (Larus canus) erreicht. Ihr Rastbestand ist in diesem Jahr komplett zusammengebrochen, wenn man den Massendurchzug am mit 100 Ind. hier unberücksichtigt lässt. Der Bestand der Silbermöwe (Larus argentatus) hat sich mit einem Maximum von 768 Ind. am stabilisiert. Die Zahlen der Heringsmöwe (Larus fuscus) sind mit maximal 400 Ind. am weiter rückläufig. Insbesondere der Bestand an Übersommerern ist stark zurück gegangen. Das Vorkommen dieser Art beschränkt jetzt sich im Wesentlichen auf die Zugzeiten. Die Lachmöwe (Larus ridibundus) profitiert weiterhin vom Rückgang der anderen Möwenarten. Ihre Bestandsmaxima lagen mit 2300 Ind. während des Frühjahrszuges bzw Ind. auf dem Herbstzug so hoch wie zuletzt im Jahr Sturmmöwe Silbermöwe Pentadenmittel Pentadenmittel Tageszählungen Tageszählungen Anzahl 150 Anzahl Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 0 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Monat Heringsmöwe Lachmöwe Pentadenmittel Tageszählungen 2007 Pentadenmittel Tageszählungen Anzahl 200 Anzahl Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 0 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat Monat
30 Brutvögel Jahresbericht Brutvögel der Rieselfelder Andrea und Michael Klein Im Vergleich zum Vorjahr sind nur wenige Veränderungen in den Brutbeständen zu verzeichnen. Besonderheiten der diesjährigen Brutvogelkartierung werden im Folgenden näher erläutert. Taucher Bei dem Brutbestand der Zwergtaucher gab im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen. Der Haubentaucher kam mit zwei erfolgreichen Paaren nur auf der fischreichen Fläche 28/A vor. Weißstorch Das bereits seit Jahren regelmäßig in den Rieselfeldern brütende Storchenpaar war auch dieses Jahr wieder bei der Jungenaufzucht zu beobachten. Es wurden zwei Küken erfolgreich großgezogen. Beide Jungstörche wurden in Zusammenarbeit mit Michael Joebges vom LANUV beringt. Dazu wurden speziell für Weißstörche entwickelte sechseckige Farbringe bei den noch nicht flüggen Jungstörchen angebracht. Am konnten die Jungstörche zum letzten Mal abgelesen werden und wurden seitdem nicht wieder gesichtet. Schwäne und Gänse Mit 14 Paaren lag die Zahl der Höckerschwanpaare etwas über dem Vorjahresergebnis. Allerdings ist sie noch weit von den 25 Brutpaaren vor dem Einbruch im Jahr 2004 entfernt. Letzterer war auf die Verluste durch Botulismus im Sommer 2003 zurückzuführen. Die Brutpaarzahl der Kanadagänse stieg nicht weiter an. Sie blieb wie in den Vorjahren auf einem konstanten Niveau von Brutpaaren. Die Anzahl der Grauganspaare ist in den letzten Jahren stark angestiegen, liegt aber in diesen Jahr im Bereich des Vorjahres. Ob die Art ihr Maximum in den Rieselfeldern erreicht hat, wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Um mehr über das Wanderverhalten der Graugänse in den Rieselfeldern zu erfahren, wurden diese in Zusammenarbeit mit S. Homma und O. Geiter vom Neozoenprojekt farbberingt. Es kamen blaue Fußringe und gelbe Halsringe zum Einsatz, welche eine Zahlen- und Buchstabenkombination eingraviert haben. So wird man bald erfahren, ob die Graugänse nach der Mauser das Münsterland wie die Kanadagänse verlassen oder den ganzen Winter
31 28 Brutvögel hier verbringen. Am Ende des Jahres lagen noch keine Fremdfunde vor. Bei der Nilgans blieb die Zahl mit 3 erfolgreichen Paaren weiterhin konstant. Auch hier konnte bei einer Familie das Küken mit einen Halsring beringt werden. Wie für Nilgänse üblich verschwand das Küken nach ein Paar Wochen aus seinem Schlupfgebiet. Enten Bei den Brutbeständen der Enten gibt es gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen. Die Schnatterente scheint nach dem Anstieg in den letzten Jahren ein Brutbestandsmaximum zu erreichen. Die Stockente bleibt ebenfalls konstant und scheint nicht weiter abzunehmen. Rallen Die Erfassung der Brutpaarzahlen bei den kleinen Rallenarten (Wasserralle und Tüpfelsumpfhuhn) bleibt weiterhin auf vorsichtige Schätzungen angewiesen. Diese beruhen auf der Kartierung der rufenden Männchen, die Reviere besetzt halten. Der Brutbestand der Wasserralle liegt im Bereich des Vorjahres. Der Schwerpunkt der Rufer liegt den schilfreichen Zonen im nördlichen Teil des Schutzgebietes. Das Tüpfelsumpfhuhn war in diesem Jahr nicht so stark vertreten wie im Vorjahr. Watvögel Die einzigen Brutnachweise liegen für Flussregenpfeifer und Kiebitz vor. Der Bestand an Kiebitzen im Gebiet blieb mit 10 Paaren konstant. Darüber hinaus haben wieder viele Paare ihre Jungen von den benachbarten Ackerflächen auf die Schlammflächen der Rieselfelder geführt. Für Bekassine, Rotschenkel und Uferschnepfe liegen auch in diesem Jahr keine Brutnachweise vor. Lachmöwe Der Brutbestand der Lachmöwe hat gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen. Auf den Inseln in der E-Zone I wurden alleine über 120 Nester gezählt. Am konnten 220 junge Lachmöwen ausgezählt werden, was aber als Minimum anzusehen ist. Aufgrund der vielen Inseln und der Vegetation ist eine komplette Einsicht nicht möglich. Singvögel Bemerkenswert ist in diesem Jahr der deutlich Anstieg im Brutbestand des Blaukehlchens. Mit 42 Brutpaaren wurde ein neues Maximum erreicht. Positiv ist ebenfalls die Entwicklung beim Rohrschwirl, der sich mit 4-5 Paaren stabilisiert hat. Die übrigen schilfbewohnenden Singvogelarten liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau.
32 Jahresbericht Tab. 1: Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2007 im Vergleich zu 2006 Angaben zur Roten Liste NRW: Kat. 0 ausgestorben, Kat. 1 vom Aussterben bedroht, Kat. 2 stark gefährdet, Kat. 3 gefährdet, V = Vorwarnliste, N = von Naturschutzmaßnahmen abhängig, R = arealbedingt selten. Rote Liste NRW Anzahl Reviere 2007 Anzahl Reviere 2006 Zwergtaucher Haubentaucher N 2 2 Weißstorch 1N 1 1 Höckerschwan Graugans Kanadagans Nilgans 3 3 Brandgans R 6 7 Schnatterente R ~ 110 ~ 115 Krickente Stockente ~ 100 ~ 110 Knäkente Löffelente Tafelente Reiherente Rohrweihe 2N Turmfalke 1 1 Rebhuhn 2N Wachtel 2-1 Wasserralle Tüpfelsumpfhuhn Teichhuhn V Blässhuhn ~ 120 ~ 145 Flussregenpfeifer Kiebitz Lachmöwe ~ 180 ~ 120 Steinkauz 3N 3 3 Kuckuck V Eisvogel 3N 2 2 Wiesenpieper 3-1 Schafstelze Gebirgsstelze Blaukehlchen 2N 42 31
33 30 Brutvögel Rote Liste NRW Anzahl Reviere 2007 Anzahl Reviere 2006 Schwarzkehlchen Feldschwirl Rohrschwirl Drosselrohrsänger Schilfrohrsänger Sumpfrohrsänger ~ 180 ~ 180 Teichrohrsänger 3 ~ 175 ~ 170 Dorngrasmücke V Bartmeise R Rohrammer V ~ 100 ~ 100 Phyllosocopus spec. auf Futtersuche (Foto: T. Kepp)
34 Möwen in den Rieselfeldern Jahresbericht Möwen in den Rieselfeldern: DIE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES Manfred Röhlen Zu einem optimalen Lebensraum von Möwen im Binnenland gehören besonders drei Komponenten: ein sicherer Schlafplatz, eine Möglichkeit zur ausreichenden Nahrungsaufnahme und, in der Nähe, ein so genanntes Komfortgewässer. Letzteres muss die Möglichkeit bieten, bei Pausen in der Nahrungsaufnahme tagsüber auszuruhen und sich der Gefiederpflege widmen zu können. In Münster waren diese drei Komponenten geradezu ideal gegeben. Sicher schlafen konnten die Möwen in den Tiefgewässer- Parzellen der Rieselfelder, auf dem in der Stadtmitte gelegenen Aasee oder auf den Flachdächern der Industriebauten im Gewerbegebiet Loddenheide im Südosten der Stadt am Dortmund-Ems- Kanal. Eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme bot die Zentrale Mülldeponie II im Münsterschen Stadtteil Coerde. Möwen fressen vor allem tierische oder fleischliche Nahrung, dabei verschmähen sie auch Aas und Abfälle nicht. Sie sind als Nahrungs-Opportunisten bekannt. Die nötige Tagesration von etwa 750 g Nahrung für eine Großmö- we, lässt sich auf einer Mülldeponie, wie in Münster, auch von großen Möwenzahlen relativ problemlos finden. Und schließlich liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mülldeponie die Rieselfelder, die sich als Komfortgewässer anboten. So wundert es nicht, dass die Großmöwen, nach ihrer in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts beginnenden Ausbreitung von der Nordseeküste ins Binnenland, in den letzten etwa 20 Jahren auch in Münster in ständig wachsender Zahl auftraten. Dies galt vor allem für Silber- und Heringsmöwen, aber auch für die kleineren Sturm- und Lachmöwen. Dabei wurden für die verschiedenen Möwenarten unterschiedliche Höchstzahlen je nach Jahreszeit ermittelt. Lach-, Sturm- und Silbermöwen erreichten im Winter ihre Höchstbestände in den Rieselfeldern. Die Heringsmöwe dagegen wurde im Frühjahr in Höchstzahlen festgestellt. Die hohen Rast-Bestände der Möwen in den Rieselfeldern brachen im Herbst 2005 und in der
35 32 Möwen in den Rieselfeldern Folgezeit geradezu in sich zusammen. Was war passiert? Eine der drei oben genannten Komponenten für einen optimalen Möwenlebensraum war plötzlich ausgefallen. Auf der Zentralen Mülldeponie II der Stadt Münster wurde im Gegensatz zu den Vorjahren kein unbehandelter Hausmüll mehr abgelagert. Die technische Anleitung Siedlungsabfall (1993) und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (1996) setzten den Kommunen den als Termin um keine unbehandelten Hausmüll-Abfälle auf Deponien abzulagern. In Münster wurde eine mechanischbiologische Restabfallbehandlungsanlage am vollständig in Betrieb genommen. Lag der Anteil des unbehandelt auf der Hochdeponie gelagerten Abfalls im Jahr 1990 noch bei knapp Tonnen, ging er bis zum kontinuierlich auf etwa Tonnen zurück. Danach fehlte diese Müllfraktion ganz. Damit verloren die Möwen, die sich in Münster und Umgebung aufhielten, die notwendige Nahrungsgrundlage. Ein Ausweichen auf andere Deponien, etwa in Altenberge, war für die Möwen unmöglich, da auch die Betreiber dieser Deponien die gesetzlichen Vorschriften zur Behandlung des Hausmülls umgesetzt hatten. Welche gravierenden Auswirkun- gen der Wegfall der Nahrungsgrundlage für die Möwenbestände in den Rieselfeldern Münster nach sich zog, soll im folgenden an den Beispielen Lachmöwe, Sturmmöwe, Silbermöwe und Heringsmöwe kurz aufgezeigt werden. Dabei werden für die einzelnen Möwenarten die Bestände aus dem Jahr 2002 mit denen aus dem Jahr 2006 verglichen. Für Lach-, Sturm- und Silbermöwen wurde dabei der Januar, für die Heringsmöwe der Mai als Vergleichsmonat ausgewählt. Die Wahl der unterschiedlichen Monate erklärt sich aus dem jahreszeitlich verschiedenen Auftreten der jeweiligen Möwenart in größeren Zahlen in den Rieselfeldern Münster. So kann der deutliche Rückgang der Möwen-Zahlen besser illustriert werden, als dies der Fall ist, wenn man Monate mit jeweils kleineren Zahlen gegenüberstellen würde. Trotzdem stimmt der eindeutige Trend des Rückgangs der hier verwendeten Monatszahlen auch mit den anderen Monaten des jeweiligen Jahres in etwa überein. In den folgenden Tabellen werden diese Abkürzungen benutzt: BT = Anzahl der Beobachtungstage im betreffenden Monat, HZ = an einem Tag ermittelte Höchstzahl im betreffenden Monat, Ø = Anzahl der im jeweiligen Monat insgesamt erfassten Möwen-Individuen
36 Jahresbericht geteilt durch die Zahl der Beobachtungstage im jeweiligen Monat, also die Zahl der durch- schnittlich an jedem Tag des betreffenden Monats anwesenden Möwen. LACHMÖWE Januar Januar BT: HZ: Ex. 450 Ex. Ø: Ex. 235 Ex. Jeweilige HZ ermittelt am: und STURMMÖWE Januar Januar BT: HZ: Ex. 280 Ex. Ø: 236 Ex. 46 Ex. Jeweilige HZ ermittelt am: und Damit ergibt sich für die Lachmöwe zwischen Januar 2002 (100%) und Januar 2006 (16,6%) ein Rückgang von 83,4 Prozent im Tagesdurchschnitt. Damit ergibt sich für die Sturmmöwe zwischen Januar 2002 (100%) und Januar 2006 (19,5%) ein Rückgang von 80,5 Prozent im Tagesdurchschnitt. SILBERMÖWE Januar Januar BT: HZ: Ex. 665 Ex. Ø: Ex. 197 Ex. Jeweilige HZ ermittelt am: und HERINGSMÖWE Mai Mai BT: HZ: 400 Ex. 35 Ex. Ø: 166 Ex. 19 Ex. Jeweilige HZ ermittelt am: und Damit ergibt sich für die Silbermöwe zwischen Januar 2002 (100%) und Januar 2006 (11,0%) ein Rückgang von 89,0 Prozent im Tagesdurchschnitt. Damit ergibt sich für die Heringsmöwe zwischen Mai 2002 (100%) und Mai 2006 (11,5%) ein Rückgang von 89,5 Prozent im Tagesdurchschnitt.
37 34 Möwen in den Rieselfeldern Alle vier hier untersuchten Möwenarten verzeichnen also zwischen 2002 und 2006 einen Rückgang in den Rastbeständen von über 80 Prozent. Da sich sowohl bei den Schlafplätzen im Bereich der Stadt Münster als auch in den Rieselfeldern Münster, wo vor allem der große Ems- Ableiter-Stausee gegenüber der Biologischen Station als meist genutztes Komfortgewässer nahezu unverändert geblieben ist, keine erkennbaren Verschlechterungen ergeben haben, kann nur die Situation auf der Zentralen Mülldeponie II der Stadt Münster für den Rückgang verantwortlich sein. Das Fehlen der nicht behandelten Haushaltsabfälle als Nahrungsreservoir stellt offensichtlich einen begrenzenden Faktor für das Rast-Vorkommen von Möwen in Münster dar. Dieses Bild wird durch eine Inaugenscheinnahme der Deponie deutlich bestätigt. Flogen vor Mitte 2005 hunderte bis tausende Möwen, Krähen und einzelne Greifvögel (vor allem Mäusebussard und Turmfalke) um die Müll-Lastwagen, die zum Abkippen auf die Deponie fuhren, herum, hat sich das Bild heute total gewandelt. Die Möwen, die auf der Deponie nach Nahrung suchen, sind auf etwa ein Zehntel der Bestände zu Beginn des Jahrtausends zurückgegangen. Auch bei anderen, in der Nähe der Rieselfelder liegenden Deponien, haben sich die Bestandszahlen der Möwen ähnlich entwickelt, so zum Beispiel bei der Deponie in Altenberge. So kann, wie in diesem Fall, also auch eine vom Menschen verursachte Nahrungsverknappung ursächlich für den Rückgang des Möwen-Rastbestands sein. Es muss nicht immer auf die Vögel geschossen werden, um sie zu dezimieren. In Zukunft ist wahrscheinlich kein weiterer Rückgang der Möwenzahlen in den Rieselfeldern Münster zu erwarten. Zumindest haben sich die Bestände in den Jahren 2006 und 2007 kaum mehr verändert. Wo die Tausende von Möwen, die in Münster jetzt fehlen, verblieben sind, muss eine offene Frage bleiben. Auch scheint dies von Möwenart zu Möwenart durchaus unterschiedlich zu sein. Während Sturm- und Heringsmöwen beinahe spurlos abhanden gekommen zu sein scheinen, nimmt die Beobachtung von Lach- und Silbermöwen im Umland der Rieselfelder in den letzten Jahren deutlich zu. So sind z. B. auf frisch eingesäten Wintergetreide-Äckern und im Grünland rund um Telgte vermehrt Beobachtungen im Winterhalbjahr durchaus üblich. Für alle Möwenarten wäre es interessant zu wissen, ob die großen Vorkommen an der Nordseeküste seit 2005 noch gewachsen sind. Dies könn-
38 Jahresbericht te etwas über den Verbleib der ehemaligen Binnenland-Möwen aussagen. Letztlich scheint auch eine Rast in anderen Ländern (ohne rigorose Müllbehandlungs- Vorschriften) nicht unmöglich zu sein. So sind also einige Tausend Möwen verschiedener Arten durch vom Menschen für die Gesundheit (Grundwasserbelastung usw.) und das Wohlbefinden (Geruchsbelastungen usw.) gemachte Gesetze und Verordnungen aus Ihrem Paradies in Münster vertrieben worden. Damit fehlen die großen Zahlen einiger auffälliger Vogelarten in den Rieselfeldern Münster. Aber nicht nur die großen Zahlen bleiben aus, sondern auch die Beobachtungen von einzelnen Individuen seltener Möwenarten nehmen ab. Wurden solche Raritäten bis 2005 schon einmal von den großen Möwenschwärmen, die die Rieselfelder besuchten, mitgerissen, sind sie heute deutlich seltener zu beobachten. Interessant wäre es auch zu untersuchen, wie sich die Veränderung in der Deponierung der Haushaltsabfälle auf andere Vogelarten auswirkt. Weißstorch, Mäusebussard, Turmfalke, Dohle sowie Saat- und Rabenkrähe haben sich in der Vergangenheit ebenfalls im Schnellimbiss Zentrale Mülldeponie II in Coerde bedient. Ich danke Michael Klein für die Bereitstellung der Daten der Vogelzählungen in den Rieselfeldern Münster. Nicht zuletzt gilt mein Dank aber auch allen haupt- und ehrenamtlichen Zählern, ohne deren fast tägliche Bestandszählung der Vögel der Rieselfelder Auswertungen, wie die hier vorgelegte, kaum möglich wären. Literatur: Stadt Münster: Abfallwirtschafts betriebe Münster, Internetpräsentation ( awm/infodep.html), 2007 Bauer/Bezzel/Fiedler: Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Nonpasseriformes-Nichtsingvögel, AULA- Verlag Wiebelsheim, 2. Auflage 2005 Ruhende Lachmöwen (Foto: T. Kepp)
39 36 Kammmolch und Kleiner Wasserfrosch Kammmolch (Triturus cristatus) und Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) im Europareservat Rieselfelder Münster Perspektiven für seltene Arten von André de Saint-Paul Einleitung Die Rieselfelder Münster sind inzwischen seit über drei Jahrzehnten nicht mehr das einzige Klärwerk für die Abwässer der Stadt Münster. Seit 1975 erfolgt die biologisch-mechanische Reinigung in der Zentralkläranlage, die wenige Jahre später durch eine Phosphat- und eine Nitratfällungsstufe erweitert wurde. Das geklärte Vorfluterwasser, das seitdem auf die Polder des Vogelschutzgebietes geleitet wurde, veränderte das Reservat nach und nach grundlegend, und zwar nicht nur für die Avifauna. Siedlungschronologie Es dauerte noch Jahre, bis Amphibien, die bis dahin eher eine Randerscheinung im Reservat waren, häufiger wurden. Dies waren zunächst relativ anspruchslose Arten wie die Erdkröte (Bufo bufo), der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) und der Bergmolch (Mesotriton alpestris), aber auch der Grasfrosch (Rana temporaria) wurde häufiger. Erst in den frühen 1990er Jahren traten die ersten Grünfrösche (Pelophylax [Rana] synkl. esculentus) auf. Wenig früher, nämlich in der 1980er Jahren wurden an mindestens drei Stellen nördlich von Münster Grünfrösche unterschiedlicher Herkunft ausgesetzt (Wienburgpark, Wilkinghege und südlich des Heidekruges). Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), eine in der westfälischen Bucht heimische aber seltenere Art, erschien gemeinsam mit dem Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus) etwa zwischen 1990 und 1992 im Reservat. Sicher nachgewiesen wurde er 2005 durch morphometrische Reihenuntersuchungen (vgl. SCHRÖER 1997a, MUTZ 2006). Erst 1994 erreichten die ersten Seefrösche die Rieselfelder, aber schon 1996 wurden mehr rufende Seefrösche als andere Wasserfrösche festgestellt (de Saint-Paul 1997). In den Rieselfeldern kamen bis etwa 2000 noch gelegentlich einzelne Laubfrösche (Hyla arborea) vor; seit aber die kleine Population in der Coerheide erloschen
40 Jahresbericht ist, gibt es keine weiteren Beobachtungen. Eine Reproduktion des Laubfrosches konnte nie nachgewiesen werden, und war aufgrund der hydrochemischen Befunde im Reservat wenig wahrscheinlich (AGAR-Münster 1997). Der erste Kammmolch-Fund (Triturus cristatus) in den Rieselfeldern stammt aus dem Jahr 1994 (DE SAINT-PAUL 1997), ein weiterer aus dem Jahr 2006 (DE SAINT-PAUL 2007). Weitere Arten, die in der Umgebung der Rieselfelder vorkommen, wie Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Moorfrosch (Rana arvalis) und Kreuzkröte (Bufo calamita), sind im Reservat in nächster Zeit nicht zu erwarten. Entweder fehlen Zuwanderungsmöglichkeiten, die Habitatbedingungen sind im Schutzgebiet ungünstig oder diese Arten sind insgesamt so selten, dass sie im Münsterland sogar vor dem Aussterben stehen. Was sind Grünfrösche? Hinter dem Sammelbegriff Grünfrösche verbergen sich im Münsterland zumindest zwei Arten, der Seefrosch und der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax ridibundus & lessonae) und ein fertiler Hybrid, der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus), der hybridogenetisch zwischen den beiden Arten interagiert (DUBOIS & GÜNTHER 1982). Stark vereinfacht gesagt, bedient sich der hemiklonale Hybrid der Fertilität der Elternarten unter Eliminierung ihres Genoms. Paarungen mit Hybriden führen also stets zu Hybriden. Der Hybrid ist also ein Gendieb und schädigt zu seinem Nutzen als Sexualparasit den Fortpflanzungserfolg der jeweiligen Elternart. Das kann augenblicklich in Mitteleuropa der Seefrosch, aber auch der Kleine Wasserfrosch sein, seltener beide gleichzeitig (SCHRÖER 1997b). Grünfrosch (Foto: H.- U. Schütz)
41 38 Kammmolch und Kleiner Wasserfrosch Durch den Zusatz kl. (kl. = klepton von gr. = der Dieb) im wissenschaftlichen Namen wird kenntlich gemacht, dass es sich beim Teichfrosch nicht um eine Art im Sinne Linnés handelt. Entsprechend wird die Gesamtheit der Grünfrösche als Synklepton (Pelophylax synkl. esculentus) bezeichnet. Verdrängen Seefrösche die Kleinen Wasserfrösche in den Rieselfeldern? Von den drei im Augenblick im Reservat vorkommenden Grünfröschen ist der Seefrosch (Pelophylax ridibundus) ein Neubürger aus Osteuropa. Landois et al. (1893) kannten diese Art nicht aus Westfalen. Und auch aus eigener Erinnerung, also aus den 1970er und 1980er Jahren sind dem Autor keine Seefrösche aus dem Münsterland bekannt. Angesichts der Bestandsentwicklung der letzten Jahre begünstigt durch zahlreiche Aussetzungen v. a. in Ballungsräumen (KORDGES 1988) kann mit Fug und Recht auch in Westfalen von einem successful invader (ZEISSET & BEEBEE 2003) gesprochen werden. Untersuchungen aus Westeuropa zeigen, dass dort freigesetzte osteuropäische Seefrösche eine Gefahr für die heimischen Grünfrosch-Vorkommen darstellen und sie unter ungünstigen topografischen Voraussetzungen sogar an den Rand des Aussterbens bringen können (VORBURGER & REYER 2003). Insbesondere neuere Ergebnisse zeigen, dass die Seefrösche vor allem in sauerstoffreichen und salzarmen Gewässern erheblich produktiver sind als die übrigen Grünfrösche (SCHMELLER et al. 2007). Darüber hinaus sind die Seefrosch-Weibchen langlebiger und können insgesamt mehr Nachkommen zeugen als andere Grünfroschweibchen. Überträgt man diese Erkenntnis auf die Gewässer der Rieselfelder Münster mit ihren relativ hohen Ionenbelastungen (AGAR-Münster 1997, DE SAINT-PAUL 1999, REDING 2006) und gelegentlich auftretenden Sauerstoffdefiziten vor allem auf den größeren Polderflächen, müsste das die Vitalität der in der Regel durchsetzungsstarken Seefrösche gegenüber den anderen Grünfröschen schwächen. Vielleicht ist auch gerade das ein bedeutender Faktor, der zu einer Koexistenz und zu einem Gleichgewicht aller aktuell im Reservat vorkommenden Grünfrösche führt, während andernorts Verdrängungen vorkommen. Dennoch sollte die Grünfrosch- Population im Schutzgebiet regelmäßig beobachtet werden, weil
42 Jahresbericht sich immer wieder Veränderungen einstellen können, die nicht kalkulierbar sind. Ob ein regelmäßiges Monitoring-Programm für die Grünfrosch-Population möglich wäre, gilt es zu klären. Vor allem gilt es, das Vorkommen des Kleinen Wasserfrosches (Pelophylax lessonae) zu beobachten und zu fördern. Ein Schritt in die richtige Richtung scheint in diesem Zusammenhang die Gebietserweitung südlich der Straße Coermühle gewesen zu sein. Hier stehen dem am wenigsten aquatischen Grünfrosch ausgedehnte Grünlandbereiche als terrestrischer Lebensraum zur Verfügung. Außerdem scheinen die zahlreichen Gräben dieses Reservatsteils für adulte Seefrösche weniger attraktiv zu sein; hier entgehen die sehr viel kleineren Tiere leichter den kannibalistischen großen Verwandten. Solche Habitate sind nördlich der Coermühle, also im alten Reservat relativ selten. Leider wurden außerdem in den letzten Jahren hier etliche Flächen zusammengelegt, was den Überlebensbedingungen für den Kleinen Wasserfrosch sicherlich nicht zuträglich war. Realistische Zukunft für den Kammmolch Obwohl der Nachweis einer existierenden Kammmolch-Population in den Rieselfeldern bislang aussteht, kann man davon ausgehen, dass auch der Kammmolch inzwischen zum Arteninventar gehört. Ziel im Frühjahr 2008 wird es deshalb sein, im Südwesten des Reservats in den Abschnitten 21 bis 28 weitere Nachweise zu erbringen. Vor allem im Südwesten scheinen die Bedingungen für den Wasserdrachen günstiger als anderswo im Reservat zu sein. Hier liegt auch das nächstgelegene Kammmolchgewässer außerhalb des Reservats, von dem vermutlich eine Zuwanderung stattfindet. Außerdem sind die beiden anderen Molcharten hier bereits deutlich häufiger als in anderen Teilen der Rieselfelder. Ferner stellt die Umgebung des Wöstebaches, den eine Waldkulisse begleitet, einen geeigneten und relativ gut gegliederten Landlebensraum dar. Problematisch für Molche insgesamt sind syntop vorkommende Fische. Der Wöstebach selbst ist inzwischen kein fischfreier Ableiter mehr (EDLER 2006). Entscheidender dürften aber die Vorkommen von Fischen auf den Rieselfeld-Flächen selbst sein. Vor allem für die Amphibienlarven sind die Fische, insbesondere Stichlinge, eine Gefahr, wenn sie sich in unstrukturierten, gleichmäßig wasserbespannten Parzellen rasant
43 40 Kammmolch und Kleiner Wasserfrosch vermehren können (KAPA 2004). Hier hilft ein regelmäßiges vollständiges Trockenfallenlassen, wenn keine Amphibienlarven im Gewässer sind. Des Weiteren sollten diese Flächen, um sie Molchfreundlicher zu gestalten, mit einem Bodenrelief ausgestattet werden. Der Wechsel aus tieferem Wasser, Untiefen oder auch beständig trockenen Bereichen führt zu einem Mosaik in der sich einstellenden Verlandungsvegetation und somit auch zu mehr räumlichen Nischen. Sie böten den Amphibien mehr Schutz und würden ihre Reproduktionschancen erhöhen. Speziell für den Kammmolch von Bedeutung sind vor allem tiefere Gewässerabschnitte, die günstigstenfalls auch mit artenreicher Vegetation ausgestattet sein sollten. Anschrift des Autors: Dipl.-Biol. André de Saint-Paul Enkingweg Münster Junger Grünfrosch (Foto: H.- U. Schütz)
44 Jahresbericht Literatur AGAR-MÜNSTER (1997): Hydrochemie und Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der Laubfroschgewässer im Nordosten von Münster. Unveröff. Gutachten i. A. d. Stadt Münster, 198 S. u. Anhang. DUBOIS, A. & R. GÜNTHER (1982): Klepton and synklepton: two new evolutionary systematics categories in zoology. Zool. Jb. (Systematik) 211 (1/2): EDLER, CH. (2006): Untersuchungen zum Fischbestand von ausgewählten Stillwasserparzellen und Fließgewässerabschnitten im Gebiet der Rieselfelder Münster. Jahresber. Biol. Stat. Rieselfelder Münster 2005: KAPA, R. (2004): Ergebnisse ichthyologischer Untersuchungen der Rieselfelder und des Wöstebaches. Jahresber. Biol. Stat. Rieselfelder Münster 2002/3: MUTZ, T. (2006): Erfassung der Amphibien im südlichen Teil der Rieselfelder Münster (Erweiterungsteil) Jahresber. Biol. Stat. Rieselfelder Münster 2005: KORDGES, T. (1988): Zur Wasserfroschproblematik in Ballungsräumen eine Essener Fallstudie. Jb. Feldherpetol., Beih. 1: LANDOIS, H., E. RADE & F. WESTHOFF (1892): III. Buch: Westfalens Amphibien. In: LANDOIS, H. (Hrsg.): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. Dritter Band: Die Reptilien, Amphibien und Fische: Schöningh, Paderborn. REDING, G. (2006): Wählt die Knäkente (Anas querquedula) ihr Habitat in dem Europareservat Rieselfelder Münster nach der Dichte der Nahrungsorganismen? Unveröff. Dipl.-Arb. Univ. Münster, 219 S. SAINT-PAUL, A. DE (1997): Aktivität und Reproduktion der Grünfrösche in den Rieselfeldern Münster. Gutachten i. A. d. Biol. Stat. Rieselfelder Münster. In: Jahresber. Biol. Stat. Rieselfelder Münster 1996: SAINT-PAUL, A. DE (1999): Aktivität und Reproduktion der Grünfrösche in den Rieselfeldern Münster. Gutachten i. A. d. Biol. Stat. Rieselfelder Münster. In: Jahresber. Biol. Stat. Rieselfelder Münster 1998: SAINT-PAUL, A. DE (2007): Ergebnisbericht zweier Amphibienwanderungs erhebungen 2003 und 2006 in den Rieselfeldern Münster In: Jahresber. Biol. Stat. Rieselfelder Münster 2006: SCHMELLER, D. & A. PAGANO, S. PLÉNET, M. VEITH (2007): Introducing water frogs Is there a risk for indigenous species in France? Comptes Rendus Biologies 330: SCHRÖER, T. (1997a): Lassen sich Wasserfrösche phänotypisch bestimmen? - Eine Feld- und Laborstudie an 765 Wasserfröschen aus Westfalen. Zeitschr. f. Feldherpetologie 4: SCHRÖER, T. (1997b): Untersuchung zur Populationsgenetik und Ökologie westfälischer Wasserfrösche (Anura: Ranidae). Diss. Univ. Düsseldorf, 129 S. u. Anhang. VORBURGER, CH. & H.-U. REYER (2003): A genetic mechanism of species replacement in European waterfrogs? Conservation Genetics 4 (2): ZEISSET, I. & T. J. C. BEEBEE (2003): Population genetic of a successful invader: the marsh frog Rana ridibunda in Britain. Molecular Ecology 12 (3):
45 42 Biotop-Management Maßnahmen 2007 Biotop-Management Maßnahmen Thomas Hafner Verbesserung der Biotop- Funktionen Der alljährliche Weidenschnitt am Anfang und Ende des Berichtszeitraumes erfolgte 2007 größtenteils in der Außenausstellung der Biologischen Station und entlang der Straße 'An der Schlüppe' (vgl. Karte 1). Außer dem Schneiteln der 23 Kopfweiden in diesem Bereich wurden ca. 35 Weidengehölze auf den Stock gesetzt. Die Maßnahme dient dazu, das Gebiet für die hier beheimateten oder rastenden Vogelarten geeignet zu halten und den Charakter der Landschaft zu bewahren. Diese Maßnahmen werden 2008 fortgesetzt. Die Auswahl der bearbeiteten Kopfweiden richtet sich an einer durchwachsenen Altersstruktur innerhalb der Baumgruppen aus, um den ökologischen Nutzen als Rast- und Brutplatz zu erhalten. Somit erhalten die Kopfweiden etwa alle 5 bis 10 Jahre einen Schnitt, wobei das Schnittmaterial einzelner geeigneter Bäume gelegentlich für angebotene Veranstaltungen benötigt wird. Der Holzschnitt aus diesen Maßnahmen wird anschließend vor Ort mit dem Häcksler verarbeitet. Weiteres Schnittgut resultierte aus dem Windbruch durch Orkan Kyrill Mitte Januar So konn- te aus größtenteils selbst gewonnenem Material das Wegesystem der Außenaustellung, der Wanderwege entlang der 17er Weide sowie die Zuwegungen des Turmes und einiger Hütten neu bedeckt werden. Dadurch wird ein Zuwachsen verhindert und es entsteht ein angenehm begehbarer Belag. Der im Vorjahr durchgeführte Rohrkolbenschnitt erwies sich als erfolgreich und musste nur an wenigen Stellen im 31er Komplex erneut ausgeführt werden. Dank der weniger ausgeprägten Eutrophierung der bewässerten Parzellen sowie der Nutrias hat Typha latifolia ohnehin deutlich weniger Konkurrenzkraft als in früheren Jahrzehnten, so dass der Rohrkolben keine Pro-blempflanze mehr ist erfolgte die alljährliche Heuernte auf den Flächen 22/11, 23/8, 30/8 und der 17er Heckrindweide. Ungefähr 1600 Bund Heu wurden 2007 als Winternahrung für die Herde geerntet. An dieser Stelle gilt besonderer Dank unseren Nachbarn Christian Oertker und seinem Vater Heribert Oertker, die durch ihre tatkräftige Mithilfe und zusätzlichen Maschineneinsatz die letztjährige Heuernte so reibungsfrei ermöglicht haben. Auch die freundliche Leih-
46 Jahresbericht gabe eines zusätzlichen Schleppers von Hermann Mersch- Vormann vereinfachte den Ablauf erheblich. Die Grünlandflächen, die weder Beweidung noch Heumahd erhielten, wurden mit dem Schlegelmäher gemulcht, um aufkommendes Gehölz zu verhindern und reines Grünland zu erhalten. Unterhaltung des Kläranlagenablaufes, der Gräben, Böschungen, Dämme, Wege, Beobachtungseinrichtungen und Rinderweiden Im Berichtsjahr war es nötig, sich vor allem der Qualität der Rinderweide im 13er und 14er Komplex anzunehmen. Die zunehmende Ausbreitung des Jakobkreuzkrautes (s. Kapitel Vegetation) und die dadurch drohende Verbuschung dieser Flächen veranlassten uns diese Flächen umzubrechen und neue Weide- bzw. Heuflächen daraus zu entwickeln. Dazu wurde die Grasnarbe dieser Flächen gefräst um den Boden und den Bewuchs dann mit dem Pflug unterzuarbeiten. Daraufhin erfolgte ein weiteres Fräsen um die Fläche zu begradigen und schließlich die Einsaat mit einer kleehaltigen Weidegrasmischung. Die 13er-Weide konnte durch Reparieren und Ergänzen des alten Zaunes ohne großen Aufwand von der 14er-Weide abgetrennt werden, damit die frische Einsaat nicht durch die Hufe der Heckrinder zerstört wurde. Das bearbeitete Teilstück der 14er-Weide benötigte allerdings aus gleichem Grund einen neu errichteten Zaun auf einer Länge von ca. 250 Metern. Der erhöhte Weidedruck auf die restliche Weide des 14er- Komplexes begünstigt auch dort eine optimale Beweidung durch die dort ansässige Herde, die aus maximal 12 Tieren besteht. Durch die starken Niederschläge Anfang des Jahres 2007 und das schlechte Ablaufverhalten der 18er-Weide stand diese Fläche zeitweise annähernd flächig unter Wasser. Um den Tieren so schnell wie möglich relativ trockene und damit begehbare Flächen zu gewährleisten, mussten als erste Maßnahme mehrere kleine Entwässerungsgräben in Handarbeit gegraben werden. Das Hauptproblem bestand jedoch darin, dass der 18er-Graben nicht abfließen konnte, da er im Bereich des 18er-Weges versandet und der darauf folgende Graben zugewachsen war. So wurde diese Versandung sowie der störende Bewuchs mit Hilfe des Mobilbaggers auf einer Länge von ca. 70 Metern entfernt. Die Restaurierung dieses Grabens senkte den Wasserspiegel auf der Hälfte des Grabens um mehr als 30 cm innerhalb von 2 Tagen. Die andere Hälfte des 18er-Grabens ist durch
47 44 Biotop-Management Maßnahmen 2007 eine verrohrte Überfahrt getrennt und dort senkte sich der Wasserspiegel nicht. Um diesem Problem auf den Grund zu gehen und gleichzeitig das Wasser abzutransportieren wurde diese Hälfte des Grabens mittels Schlepper und Schlammpumpe mehrmals über die Verrohrung hinweg komplett leergepumpt. Dabei entdeckten wir, dass die Rohrverbindung der Gräben ca. 1 Meter unter Sand begraben liegt, da die Grabenböschung innerhalb der letzten Jahre langsam erodierte. Da eine Restaurierung des Grabens in den Urzustand aufgrund dieser Bodensituation keine sinnvolle Perspektive bot, entschlossen wir uns dazu die Gräben auf dem derzeitigen Sohlniveau mit einem offenen Gerinne zu verbinden um einen ausreichenden Abfluss zu gewährleisten. Die gewählte Methode hat sich im Laufe des Jahres bewährt. Da allerdings nun keine hinreichende Überfahrt für den Schlepper über den Graben mehr existiert, musste für die Mäharbeiten im September ein zusätzliches Tor zwischen 18er- Graben und 19er-Komplex eingebaut werden. Eine dauerhafte Lösung des Problems, für die Rinderherde ausreichend trockene Flächen zu gewährleisten, war aber erst die Reaktivierung der Flächen 19/A, B,C sowie 15/C,D als Erweiterung der 18er Weide. Seitdem ist es den Heckrindern wieder möglich den Damm des Hauptzuleiters zwischen 18er und 19er zu nutzen, der eine trockene Rastfläche in ausreichender Größe garantiert. Die bestehende Umzäunung dieses Teiles des Erweiterungsgebietes musste auf gesamter Länge (ca. 450m) mit großem zeitlichem Aufwand instand gesetzt werden. Ungefähr 65 Zaunpfähle wurden ersetzt, was zur Hälfte in reiner Handarbeit zu leisten war, da diese Stellen nicht mit dem Schlepper zu erreichen sind. Der größtenteils zugewachsene Stacheldraht wurde freigelegt und ergänzt. Da diese Arbeiten bis zum Ende des Berichtsjahres 2007 andauerten, entschied man sich, die Anbindung der neuen Weidenflächen an die 18er-Weide erst Anfang 2008 vorzunehmen, da über die Weihnachtsfeiertage eine hinreichende Beobachtung der Tiere nicht möglich war. Mittlerweile sind die Weiden verbunden und werden wie geplant von der Herde angenommen. Im August und September des Berichtsjahres erhielten alle Weiden einen Schnitt mit dem Scheibenmäher um die Ausbreitung der Binsen einzudämmen und den Futterpflanzen ein besseres Wachstum zu ermöglichen. Eine dauerhafte Verdrängung der Binsen ist allerdings auf diesem Wege nicht zu erwarten. Eine der Hauptaufgaben ist im Zeitraum
48 Jahresbericht von April bis Oktober die Pflege der Sichtschneisen und der Bewässerungswege. Etwa 180 Sichtschneisen, die im NSG die Sicht auf die Wasserflächen ermöglichen, werden 3-mal jährlich von aufkommendem Schilf und anderem Bewuchs mit der Motor- oder Handsense befreit. Die Bewässerungswege, die sich im gesamten Gebiet auf eine Länge von ca. 9 km belaufen, werden ebenfalls 2-3-mal jährlich mit Motorsense oder Agria-Mäher geschnitten um eine ständige Erreichbarkeit der Schiebervorrichtungen sowie der Ein- und Überläufe zu gewährleisten. Um einen ungehinderten Abfluss des eingeleiteten Wassers der Kläranlage zu garantieren, muss die gesamte Böschung des Hauptableitergrabens jährlich bis Ende September geschnitten werden. Diese Arbeit wird mit dem Mobiloder Kettenbagger und einem speziellen Mähkorb verrichtet. Dieses Gerät ist im Stande nicht nur den Bewuchs oberhalb der Wasseroberfläche zu schneiden, sondern vermag auch unter Wasser die Grabensohle zu mähen. Außerdem ist mit dieser Technik ein Räumen der geschnittenen Vegetation in einem Arbeitsgang vollbracht. Auf einer Strecke von ca. 200 m von insgesamt 2,4 km Böschung ist es nicht möglich mit dem Bagger an die Böschungskrone heranzufahren. Dort wird der Bewuchs mit Handsense geschnitten und mit der Harke geräumt. Ebenfalls in Handarbeit erfolgte die Räumung der nördlichen Grenzgräben der 36er- und 38er-Komplexe. Der am Ableiter entlang führende Wirtschaftsweg sowie alle öffentlichen und gesperrten unbefestigten Wege im NSG wurden im Berichtszeitraum zweimal mittels Schlegelmäher bearbeitet. In diesem Zuge wurden auch alle Wegbanketten der geteerten Straßen im gesamten Gebiet ebenfalls zweimal auf einer Länge von ca. 15 km gemäht (vgl. Karte 1). Beobachtungseinrichtungen Aufgrund des weiterhin steigenden Vandalismus an Beobachtungseinrichtungen, Stegen, Informationstafeln und Wegweisern wurden auch 2007 ständig kleinere Reparaturen und Erneuerungen vorgenommen. Herausgetretene Verbretterungen und gebrochene Geländer wurden umgehend ersetzt um keine Gefahr für die Besucher entstehen zu lassen. Diese Arbeiten werden hauptsächlich von den ehrenamtlichen Mitarbeitern Peter Watermann und Hermann Lenz verrichtet, denen unser herzlicher Dank gilt. Darüber hinaus verdanken wir diesen Herren einen komplett erneuerten Steg in der Außenausstellung, unzählige Reparaturen an der Biologischen Station sowie einen
49 46 Biotop-Management Maßnahmen 2007 ausgiebigen Rückschnitt der Brombeerhecke zur Freilegung der Obstbäume im Bereich des hinteren Parkplatzes. Zum Ende des Berichtjahres nahmen sich Herr Watermann und Herr Lenz der Restaurierung der wegen Baufälligkeit gesperrten Hütte an der 29er- Fläche an. Diese aufwendige Reparatur wird 2008 fertig gestellt und im folgenden Bericht genauer erläutert. Instandhalten des Bewässerungssystems und Aufrechterhaltung der Bewässerung Die Bewässerung des NSG stellte uns auch 2007 wieder vor zahlreiche Probleme. Wie in den Jahren zuvor gab es ständig kleine Brüche in dem mittlerweile über dreißig Jahre alten PVC-Rohrsystem. Schäden an DN 150- und DN 200- Leitungen im 35er-, 31er-, 28er-, 25er- sowie 23er-Komplex wurden nach bewähren Verfahren behoben (ausgraben, heraustrennen, ersetzen und neu vermuffen) um ein Überschwemmen der betroffenen Bereiche zu verhindern. Jeder Eingriff bedeutet für eine oder mehrere Wasserflächen eine zeitweise Abtrennung vom Bewässerungssystem, was in verdunstungsstarken Sommermonaten je nach Länge der Reparaturarbeiten gelegentlich das Trockenfallen zur Folge hat. Besonders die Parzellen, die an den öffentlich zugänglichen Straßen und Wegen liegen, dürfen aufgrund dieser ständigen Gefahr eines Rohrbruches nur in überschaubaren Intervallen bewässert und müssen ständig kontrolliert werden, um den Kfz- sowie Besucherverkehr nicht zu gefährden oder zu behindern. Mehrere kleinere Undichtigkeiten am DN 500- Hauptzuleiter sind seit längerer Zeit bekannt, werden aber aufgrund des enormen technischen Aufwandes einer Sanierung hingenommen. Der daraus resultierende Druckverlust erschwert die Beschickung der Wasserflächen im nördlichen Teil des NSG erheblich. Zusätzlich kommt es zu immer mehr Problemen mit Schiebereinrichtungen, die wegen normaler Verschleißerscheinungen immer schwergängiger zu öffnen oder zu schließen sind. Mittlerweile benötigt man für mindestens 10 dieser Schieber Hebelverlängerungen und einen erheblichen Kraftaufwand für die Bedienung. Die 2006 erfolgte Reparatur des PE-Rohrsystems im Bereich 19B erwies sich als stabil und der Damm konnte wieder aufgefüllt werden. Das Bewässerungssystem des Erweiterungsgebietes lief wartungsfrei. Durch einen defekten Schalttransformator sind in der Pumpensteuerung zwei Schütze durchgebrannt und mussten ebenso wie der Transformator ausgetauscht werden. Dadurch wurden auch
50 Jahresbericht ständige Unregelmäßigkeiten im Pumpbetrieb der beiden größeren Pumpen behoben, die man bis zu diesem Zeitpunkt mehrmals untersucht hatte ohne allerdings die Ursache zu finden. Die jährliche Wartung aller Pumpen durch die Firma Flygt fand Anfang April statt (Abb. 5). Auch das Wehr des Aa-Anstaus bedurfte 2007 einer Reparatur. Der Gewindeantrieb des Absenkrinnenschiebers wurde durch zu große Toleranzen in der Motoraufhängung so starker Reibung ausgesetzt, dass das Gewinde gänzlich zerstört wurde. Das defekte Teil wurde ersetzt, die Aufhängung neu gebohrt, mit selbstsichernden Muttern fixiert; anschließend wurde der Schieber unter häufigen Kontrollen wieder angeschlossen. Seit 2007 gehört die vom Forstamt neu gebaute Brücke (Abb. 6) über den Kläranlagenablauf zum Betreuungsumfang der Biologischen Station. Um auch bei Nässe eine gefahrlose Querung zu ermöglichen wurden die Brückenbohlen gleich nach der Fertigstellung mit Drahtgeflecht bespannt. Abb. 1: Entwässerung des Grabens auf der 18er-Weide (Foto: T. Hafner) Abb. 2: Instandsetzung der Weide-Umzäunung (Foto: Archiv d. Biologischen Station Rieselfelder Münster )
51 48 Biotop-Management Maßnahmen 2007 Abb. 5: Pumpen- Wartung (Foto: T. Hafner) Abb. 3: Freischneiden einer Sichtschneise (Foto: H.-U. Schütz) Abb. 6: Neubau der Brücke über den Kläranlagen- Ablauf (Foto: H.-U. Schütz) Abb. 4: Zufüttern der Heckrinder im Winter (Foto: T. Hafner)
52 Jahresbericht Karte 1: Durchgeführte Biotopmanagementmaßnahmen im Jahr 2007
53 50 Vogelimpressionen 2007 Besonderheiten und Impressionen der Vogelwelt in den Rieselfeldern 2007 Bachstelze (Foto: H. Heise-Grunwald) Blaukehlchen (Foto: C. Schulte) Sichelstrandläufer (Foto: M. Klein) Bruchwasserläufer (Foto: M. Klein) Kraniche (Foto: A. Klein)
54 Jahresbericht Lachmöwe mit Karpfen (Foto: M. Klein) Dunkler Wasserläufer (H. Heise-Grunwald) Rostgans (Foto: H. Heise-Grunwald) Purpurreiher (Foto: C. Schulte) Silberreiher (Foto: M. Klein) Streifengans (Foto: H. Heise-Grunwald)
55 52 Vegetationskartierung 2007 Ergebnisse der Vegetationskartierung 2007 Hans-Uwe Schütz Abb. 1: Ergebniskarte der Vegetationskartierung im Sommer 2007
56 Jahresbericht Abb. 3: Bereiche mit Jakobs-Greiskraut für den Pflegeumbruch im 13er- Komplex (Foto: T. Kepp) Abb. 4: Der mittlere Bestand von Jakobs-Greiskraut aus Abb. 3 (Foto: H.-U. Schütz)
57 54 Vegetationskartierung 2007 Abb. 5. : Beginnende Birnenblüte am 8. April 2007 und Praktikantin Mareike Schlüter (Foto: H.- U. Schütz) Abb 6.: Früchte des Pfaffenhütchens (Foto: H.- U. Schütz)
58 Jahresbericht Die jährlich durchgeführte Kartierung der Wasserflächen und Vegetation zeigt neben den subjektiven Kartiereinflüssen von Jahr zu Jahr wechselnder Kartierer auch Veränderungen an, die abhängig sind von dem aktuellen Bewässerungs- und Pflegezustand der Einzelflächen sowie von der Witterung während der Aufnahmezeit. Nachfolgend werden die Veränderungen gegenüber dem Zustand im Jahr 2006 beschrieben. In der Kartierung im Sommer 2007 (August bis September) wurden 59 Vegetationseinheiten (Dominanzbestände) erfasst und in einer Karte dokumentiert (Abb. 1). Eine Auswahl der für das Management wichtigen Einheiten sind in der Tabelle 1 dargestellt. Die angegebene Anzahl entspricht der Zahl in der Karte eingetragenen Polygone und bildet somit Teilflächen der jeweiligen Rieselfeldparzellen ab. Einige Flächen (Polygone) sind von so geringer Ausdehnung, dass sie selbst auf einer DIN A3 Karte kaum sichtbar sind. Diese Flächen sind aber auf jeden Fall in dem Geographischen Informationssystem der Rieselfelder digital dargestellt und abrufbar. Die Gesamtausdehnung der Wasserflächen gibt immer Auskunft über den augenblicklichen Zustand der Bewässerung zum Zeitpunkt der Kartierung. Mit 91 ha. ist die Kartiereinheit Wasser ca. 3 ha kleiner als im Vorjahr, aber immer noch ausgedehnter als im Jahr Die unterschiedliche Anzahl der Teilflächen von 118 im Jahr 2006 und 123 in 2007 ist dadurch erklärbar, dass bei unterschiedlichem Wasserstand zeitweise aus einer Fläche mehrere Teilflächen werden. Die Reduzierung der Wasserausdehnung ist in geringem Umfang der Verlandung durch Schilf zuzuschreiben. Im wesentlichen ist der Schwund durch die Verlandung der Fläche 31/5 begründet. Diese Fläche fiel in Folge unterirdischer Erosion durch einen schadhaften alten aber aktiven Drainagesammler trocken. Es hatte sich ein kleiner Erosionskrater gebildet (Abb. 2). Die Fläche konnte in der Vegetationsperiode 2007 nicht wieder bewässert werden. August und September waren in 2007 überdurchschnittlich nass und wiesen einige Starkregenereignisse auf. Der dadurch bedingte hohe Wasserstand in den Rieselfeldflächen führte automatisch zu einem Rückgang sichtbarer Verlandungsbereiche. Einige Vegetationsbestände wur-den nicht erfasst da sie zum Zeitpunkt der Aufnahme unter Wasser standen (vgl. nicht aufgenommen in Tab. 2).
59 56 Vegetationskartierung 2007 Abb. 2: Erosionstrichter in der Fläche 31/5 (Foto: H.- U. Schütz) Tab. 1: Ausgewählte Kartiereinheiten 2006 und Kartiereinheit Anzahl ha Anzahl ha Wasserfläche , ,2 Verlandungspioniere 123 8, ,0 Schlammfläche 65 5,0 74 7,7 Schilfröhricht , ,6 Rohrglanzgrasröhricht 19 1,5 23 1,2 Rohrkolbenröhricht 11 0,2 12 0,3 Binsenröhricht 90 7,6 83 5,6 Grünland (u. Streuobstwiesen) , ,6 Brache , ,4 Gehölze , ,2
60 Jahresbericht Röhrichte Weiterhin ist das Schilfröhricht im Naturerlebnisgebiet auf dem Vormarsch (vgl. auch Tab. 1). Besonders an den beiden Anstauflächen sowie in den 0er-Flächen (v.a. 0A und 0B) breitete sich das Schilf weiter aus. Eine untergeordnete Rolle fällt in den Flächen weiterhin dem Rohrkolbenröhricht zu. Es bildet meist nur ein kurzzeitiges Zwischenstadium nach dem Trockenfallen von Flächen aus. Nach anschließender Bearbeitung (mulchen, fräsen) und Wiedervernässung ist es nicht in der Lage sich flächig auszudehnen. Augenfällig ist auch weiterhin eine Zunahme von Rohrkolben in den kleinen Seitengräben. Diese werden durch die Kartierung nicht erfasst, so dass diese Entwicklung nicht quantifizierbar ist. Gegenüber dem Vorjahr sind die Rohrglanzgrasröhrichte von geringerer Ausdehnung. Allerdings hat das Rohrglanzgras in den Grünlandbereichen um 1,3 ha. zugenommen und wurde dort als Rohrglanzgrasbrache kartiert. Brache Wasserhaltungsprobleme im 15er-Komplex behinderten 2007 die Bildung von Wasserflächen und förderten die Ausdehnung von Binsen dominierter Brachestadien. Die Ausbreitung des Gewöhnlichen Jakobs-Greiskrautes (Senecio jacobaea ssp. jacobaea) vor allem auf den 13er-Weideflächen erfolgte in der Vegetationsperiode 2007 wegen des selektiveren Weidegangs der Rinder. Da die Rinder diese Pflanze verschmähen (die geringen Alkaloid-Gehalte können bei Weidetieren chronische Lebervergiftungen hervorrufen), konnten im Bereich der mittlerweile geschlossenen Hochstauden-Bestände neben Weidenröschen auch weitere Brache-Zeiger wie z.b. Disteln und sogar Brombeeren ausschlagen. Zur festgeschriebenen Offenhaltung der Flächen war auf drei Teilflächen ein Pflegeumbruch mit anschließender Grünlandneueinsaat erforderlich. Ein anderes Flächenmanagement wäre denkbar und aus der Sicht eines umfassenden Artenschutzes zu begrüßen. Bei einem Verzicht auf die Umzäunung des angrenzenden Kanonenwäldchens könnte man die Gehölzentwicklung auf dem gesamten 13er-/ 14er Weidekomplex sich selbst und den Rindern überlassen. Dort wo Jakobs-Greiskraut einen selektiven Weidegang fördert, könnten eventuell in den verschmähten Bereichen neue Gehölze aufkommen, während die alten Gehölzstrukturen sicherlich mit der Zeit von den Rindern aufgelichtet wer-
61 58 Vegetationskartierung 2007 den. Als Ergebnis entwickelt sich möglicherweise ein mit fleckenartig aufkommenden Gebüschen durchsetztes Weideland, dass weniger Pflegeeingriffe bedarf und auch so genannte ungewollte Arten (hier Jakobs-Greiskraut) zulässt. Die Bekämpfung der Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) setzte sich am Rand der Flächen 22/A, B, und C auch im Jahr 2007 fort. Nach wie vor treiben Pflanzen entlang von Nutria- Wechseln wieder aus und finden sich im Bereich der Spülsäume der Flächen. Die Pflanzen wurden zum Teil ausgegraben oder zumindest der Blütenstand kurz vor der Samenreife entfernt. Grünland Der Rückgang des Grünlandes ist vor allem durch die Ausbreitung der Hochstaudenbrachen in den 13er und 14er Komplexen bedingt. Im Bereich des 38er-Komplexes wurden in 2007 ehemals als Grünland eingestufte Flächen als Rohrglanzgrasbrachen ausgewiesen. Die hohen Grundwasserstände des feuchten Sommers sowie der selektive Verbiss der Rehe und Gänse, die das Rohrglanzgras meiden, begünstigten die Ausbreitung des Rohrglanzgrases. Die zusätzliche Schafhaltung konnte die Ausbreitung vielleicht etwas bremsen aber nicht aufhalten, da auch Schafe dieses Gras wegen des Alkaloidgehaltes meiden. In den 16er und 7er Wiesen wurde nicht in Grasland und Weidelgras-Weißklee-Weide unterschieden, da zum Zeitpunkt der Geländeaufnahme der zweite Schnitt zur Grassilagegewinnung durch die Landwirte erfolgte und somit die Grünlandarten nicht sicher anzusprechen waren. Die Vegetationsperiode war so nass, dass einige Landwirte kein Heu sondern nur Grassilage einfuhren. Zudem breiteten sich die Brachestadien auf der 17er Weide weiter aus. Günstige Bereiche im 17er Komplex wurden 2007 geheut. Um die Brachezeiger weiter zu verdrängen, erfolgte auf der gesamten Weide, soweit sie befahrbar war, im Herbst ein Mulchdurchgang. Gehölze Der geringfügige Unterschied in der Flächenausdehnung der Streuobstwiesen in den Jahren 2006 und 2007 (Tab. 2, Anhang) ist bedingt durch das erneute Abgreifen / Digitalisieren der Flächen durch einen anderen Bearbeiter.
62 Jahresbericht Auch in 2007 sind viele kleine Gebüschgruppen kartiert worden, wie die 233 kartierten Weidengebüsche zeigen (Tab. 2). Die Weidengebüsche haben weiterhin leicht zugenommen. In den folgenden Wintern müssen im Sinne der Offenhaltung des Reservatbereiches Gebüsche auf den Stock gesetzt werden. Auffallend ist, dass seit dem Abschluss der Kanalbauarbeiten die Wasserstände im Bereich Blauer See, Huronensee und weiter rückstauend im nördlichen Gebiet der Gelmerheide angestiegen sind. Dies bewirkt, dass der Mischwaldbestand des NSG Gelmerheide am nördlichen Rand durch absterbende Bäume zunehmend den Charakter eines Bruchwaldes zeigt. Da die Artenzusammensetzung noch nicht entsprechend ist, wurden diese Bereiche weiter als Mischgehölz kartiert. Darüber hinaus gibt es bei den anderen Gehölzarten keine Ab- weichungen (Tab. 2). Besonderheiten Der milde aber im Januar und Februar nasse Winter 2006 / 2007 sowie ein relativ warmer März und ein April mit Bilderbuchwetter begünstigten bei vielen Pflanzen einen frühen Zeitpunkt der Blütenentfaltung - auch bei den Obstbäumen (Abb. 5). Im Mai setzte ein Witterungswechsel ein der letztendlich bis in den Herbst viel Regen bei durchschnittlich warmen Temperaturen brachte. In der Vegetationszeit gab es ab Mai nur zwei Phasen von drei bis vier aufeinander folgenden trockenen Tagen. Wer da nicht schnell sein Heu einfuhr hatte Pech gehabt. Auch in den Rieselfeldern wurde von den Landwirten vorrangig Grassilage (nur kurze Antrockenzeit) eingefahren. Durch das sonnige Frühjahr gab es reichlich Fruchtansatz, die Obstqualität war aber durch die nasse Witterung während der Reifezeit eher mäßig. Tab. 2: Einheiten der Vegetationskartierungen 2006 und Kartiereinheit Kürzel ha Anzahl ha Anzahl Acker aa 11,03 2 nicht aufgenommen Ampfer dominierte Brache ba 1, ,35 12 Brennesselbrache bb 6, , Distel dominierte Brache bd 3, ,25 48
63 60 Vegetationskartierung Kartiereinheit Kürzel ha Anzahl ha Anzahl Grünlandbrache bg 9, ,81 27 Hochstaudenbrache bh 0, ,53 10 Hochstaudenbrache, feucht bhf 5, ,86 41 Hochstaudenbrache, trocken bht 0,41 4 0,08 3 Binsenbrache bj 3, ,71 40 Rohrglanzgrasbrache br 10, ,55 71 Sonstige Brache bs 9, ,99 85 Brache (Summe) b 50, , Binsenrasen dicht gbd 5, ,54 21 Binsenrasen licht gbl 1, ,06 27 Flutrasen gf 0,53 6 0, Binsen/100m2 gf2 2,56 6 1, Binsen/100m2 gf4 2, , Binsen/100m2 gf6 1,00 4 0, Binsen/100m2 gf8 5, , Binsen/100m2 gf10 1,06 4 0, Binsen/100m2 gf12 1,49 3 1,49 3 Flutrasen, dichte Binse gfd 1,76 8 3,32 10 Flutrasen, lichte Binse gfl 1,09 5 5,42 18 Grasland gg 61, ,04 55 Streuobst go 3,33 5 2,87 4 Fuchsschwanz gs 0,88 2 0,74 2 Grünland (Summe) g 89, , anderes Gehölz ha 1, ,48 13 Erlenbruch hag 3, ,92 14 Buchen-Eichen hb 0,76 3 0,76 3 Eiche Birke he 6, ,06 12 Mischgehölze hm 17, ,94 6 Weidicht hw 7, , Roteiche hr 0,42 1 0,42 1 Holundergehölz hs 0, ,94 10 Gehölze (Summe) h 37, ,17 292
64 Jahresbericht Kartiereinheit Kürzel ha Anzahl ha Anzahl Heide hw 6,47 4 5,70 1 Binsenröhricht rb 7, ,58 83 Sumpfbinse re 0, ,42 12 Rohrkolben rk 0, ,29 12 Rohrglanzgras rr 1, ,23 23 Schilf rs 67, , Teichsimse rt 0,45 9 0,23 6 Röhrichte (Summe) r 77, , Strandampfer va 0,05 1 Froschlöffel dicht vfd 0,02 1 nicht aufgenommen nicht aufgenommen Froschlöffel licht vfl 0,14 1 0,14 1 Hühnerhirse vh 0,31 2 nicht aufgenommen Rohrkolbenverl., dicht vkd 0,61 9 0,20 2 Rohrkolbenverl., licht vkl 0,03 1 nicht aufgenommen sonst. Verlandung vs 7, ,58 96 Wolfstrapp vw 0,08 8 0,07 6 Zweizahnflur vz 0,09 6 0,01 2 Krebsschere wk 0,03 1 0,03 1 Verlandungsveg. (Summe) (v+wk) 8, , Schlamm ws 5, ,74 74 Wasser w 93, , Gesamt 374,3 ha ,4 ha 1594
65 Januar 2007: Kyrill 18. Januar 2007: Kyrill Hans-Uwe Schütz Der Orkan Kyrill fegte am 18. Januar 2007 mit maximalen Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h über Mitteleuropa und sorgte für weitreichende Verwüstungen. Auch in den Rieselfeldern hatte Kyrill Spuren hinterlassen. Allerdings war der angerichtete Schaden gegenüber anderen Landstrichen gering. Mehrere Obstbäume an der Straße Coerheide und an den Wanderwegen des Naturerlebnisgebietes wurden schräggestellt oder geworfen. Am Hessenweg brach ein dicker Ast aus einem Obstbaum. Das Bruchholz und die geworfenen Bäume wurden durch die Zivildienstleistenden am folgenden Tag aufgearbeitet. In der darauf folgenden Nacht stahlen Unbekannte das zugesägte Holz der zwei geworfenen Apfelbäume an der Coerheide. Die Beobachtungshütte im Südosten der Emsableiteranstaufläche wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Windböen deckten einige Pfannen ab und drückten den Sichtschutz neben der Treppe nieder. Ebenfalls leicht eingedrückt wurde der Sichtschutz auf dem Stichweg zum Aussichtsturm. Einige Dachpfannen zerschmetterte Kyrill auch am Rieselwärterhäuschen und an Gebäuden am Rieselfeldhof. Die Schäden konnten nach kurzer Zeit behoben werden. Nicht so einfach in Stand setzen ließ sich die erste Beobachtungshütte am Hessenweg. Hier griff der Wind richtig zu und verursachte eine deutliche Neigung der gesamten Hütte. Die Hütte musste vorerst gesperrt werden. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen werden noch einige Zeit beanspruchen. Bemerkenswert ist: Das Schilf in den Rieselfeldern blieb stehen und wurde nicht gebrochen oder gänzlich niedergedrückt wie im Verlauf des sogenannten Schneechaos vom November Somit waren die augenfälligen Schäden schnell beseitigt. Und wenn die entwurzelten Apfelbäume an der Coerheide wieder ersetzt sind, werden wohl alle Spuren Kyrills in den Rieselfeldern getilgt sein. Übrigens gab es bei den Heckrindern direkt am Tag nach Kyrill eine Sturmgeburt : Roller ein Bullenkalb erblickte das Licht der 18er Weidegründe. Roller mit der Ohrmarke mag uns noch einige Zeit an den Sturm erinnern.
66 Sturmbilder: Jahresbericht Eingedrückter Sichtschutz an einer Beobachtungshütte (Foto: H.-U. Schütz) Von Kyrill abgedecktes Rieselwärterhäuschen (Foto: H.-U. Schütz)
67 Januar 2007: Kyrill Vom Sturm geworfene Obstbäume (Foto: H.-U. Schütz) Abgebrochene Äste (Foto: H.-U. Schütz)
68 Jahresbericht Schräg gestellter Obstbaum (Foto: H.-U. Schütz) Eingedrückte Sichtschutzwand am Beobachtungsturm (Foto: H.-U. Schütz)
69 Januar 2007: Kyrill Schräg gestellte Hinweistafel (Foto: H.-U. Schütz) Aufräumarbeiten (Foto: H.-U. Schütz)
70 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Öffentlichkeitsarbeit 2007 Hans-Uwe Schütz Natur- und Umweltbildung Gegenüber dem Vorjahr wurden in 2007 wieder mehr Veranstaltungen durchgeführt. Insgesamt nahmen 3740 Besucher an 233 Veranstaltungen der Biologischen Station teil. In diesem Jahr beeinflussten weder die Geflügelpest noch eine Fußballweltmeisterschaft den Veranstaltungskalender. Das Spektrum der Veranstaltungen ist auch weiterhin im wesentlichen auf Kinder und Familien ausgerichtet (Abb. 1). So wuchs die Anzahl von Familien bzw. von Erwachsenen und Kindern besuchter Veranstaltungen von 14 in 2006 auf 28 in 2007 an. Ausschließlich Erwachsene besuchten fast ein Drittel der Veranstaltungen (Programm Erwachsene u. gebuchte Führungen). Einen höheren Anteil an der Gesamtzahl hatten in 2007 Schulklassen, Kindergartengruppen und vor allem Kindergeburtstage. 40 Schulklassen besuchten 2007 ein Programm der Biologischen Station, doppelt soviel wie in Die Zahl der Kindergartengruppen stieg von 10 in 2006 auf 18 an. Im besonderen Maße stieg auch die Anzahl der Kindergeburtstage. 38 Geburtstage wurden in 2007 in den Rieselfeldern gefeiert (Abb. 1 u. Tab. 1).
71 68 Öffentlichkeitsarbeit Die höhere Anzahl an Veranstaltungen in 2007 entfiel ausschließlich auf den Anteil der zusätzlich gebuchten Veranstaltungen (Tab. 1 und Tab. 2). Dabei bestimmten die gestiegene Anzahl an Schulklassen, Kindergartengruppen und Kindergeburtstagen diesen Anteil, während die zusätzlichen Gebietsführungen von 50 in 2006 auf 44 in 2007 etwas zurückgingen. Das Spektrum bei den gebuchten Gebietsführungen war wieder sehr weit. Es kam Besuch von der Chuo-Universität in Tokio / Japan. Prof. Noriyasu Kunori informierte sich im März ausführlich über die Natur aus Menschenhand. Dabei wurde er begleitet von der Münsteraner Dolmetscherin und Journalistin Madoka Omi, die diesen Aufenthalt in Deutschland auch organisierte. Verschiedene Sozialdienste erlebten z.t. als Betriebsausflug die Rieselfelder und erhielten einen kurzen Einblick in die Geschichte des Gebietes. Auch einige Gruppen von Menschen mit Behinderungen, Kinder und Erwachsene, fanden den Weg zur Biologischen Station. Dabei fiel auf, dass gerade Mitmenschen mit Down-Syndrom die Rieselfelder mit allen Sinnen erlebten und die Natur förmlich in sich aufsogen. Andererseits wurde bedauert, dass gerade Gehbehinderte keine Möglichkeit haben, die Beobachtungsstände zu benutzen. Hier besteht noch Handlungsbedarf! Darüber hinaus kamen Lehrerkollegien, Heimatvereine sowie Naturschutzgruppen, um die Rieselfelder kennen zu lernen. Unter anderem reiste auch eine Ornithologen-Gruppe aus dem Badischen an, um die Rieselfelder als einen Hotspot der Vogelbeobachtung in Deutschland mit ihren Spektiven in Augenschein zu nehmen. Relativ kurz war eine Führung für eine Journalisten-Gruppe, die auf Einladung der Münsterland-Touristik unter anderem auch die Rieselfelder beschrieb. Es sollte den Journalisten gezeigt werden, dass das Münsterland mehr zu bieten hat als nur Pferde. Strömender Regen ließ nur einen kurzen Blick vom Turm und einen Rundgang durch die Ausstellung am Rieselfeldhof zu. Es erwuchsen daraus einzelne Berichte der Journalisten, die in den Beschreibungen des Münsterlandes auch die Rieselfelder erwähnten. Vom 1. bis zum 3. Mai präsentierte sich die Biologische Station Rieselfelder Münster im Weltgarten im Allwetterzoo. Der Weltgarten entstand im Auftrag des Eine Welt Netz NRW als multimediale, interaktive Ausstellung zum Thema Globalisierung und fairer Handel im Jahr 2005 an-
72 Jahresbericht lässlich der Landesgartenschau in Leverkusen und ist seitdem als Wanderausstellung in Nordrhein- Westfalen unterwegs. Umweltgruppen können einen Teil der Ausstellungsfläche zur Eigenprä- sentation nutzen. Wir ergriffen die Gelegenheit, gerade bei der Ausstellungseröffnung, dem medienwirksamsten Zeitfenster, präsent zu sein. Abb. 2: Präsentation der Rieselfelder im Eine-Welt-Pavillion Da fast alle Veranstaltungen in den Rieselfeldern draußen stattfinden, bleibt es nicht aus, dass das Wetter auch einen Einfluss auf die Veranstaltungs- und Teilnehmerzahlen ausübt. Dies zeigt uns die monatsweise Auflistung der Veranstaltungen in der Tabelle 3. Besonders der März und April warteten 2007 mit sehr schönem Wetter auf, so dass die Zahl der Veranstaltungen in diesen Monaten deutlich höher war als im Vorjahr. Demgegenüber sorgte der regnerische und sturmtiefreiche November für eine besonders geringe Veranstaltungsnachfrage.
73 70 Öffentlichkeitsarbeit Tab.1: Veranstaltungen- und Teilnehmerzahl in 2006 und 2007 Anzahl der Veranstaltungen Anzahl [ % ] Veranstaltungsart \ Jahr Programm Erwachsene ,2 9,0 Programm Eltern u. Kind ,1 12,0 Programm Kinder ,2 12,9 Programm öffentl. Führung ,1 5,2 externe Diavorträge 4 2 2,0 0,9 Gebuchte Führung ,3 18,9 Schulklassen ,1 17,2 Kindergarten ,1 7,7 Kindergeburtstage ,1 16,3 Summen ,0 100,0 Teilnehmerzahl Anzahl [ % ] Veranstaltungsart \ Jahr Programm Erwachsene ,1 7,2 Programm Eltern u. Kind ,9 12,7 Programm Kinder ,8 10,2 Programm öffentl. Führung ,4 2,5 externe Diavorträge ,6 1,4 Gebuchte Führung ,4 23,2 Schulklassen ,8 26,0 Kindergarten ,9 7,2 Kindergeburtstage ,1 9,5 Summen ,0 100,0
74 Jahresbericht Tab.2: Programmveranstaltungen und frei gebuchte Veranstaltungen in 2006 und 2007 Anzahl der Veranstaltungen Anzahl [ %] Veranstaltungsart \ Jahr Programmveranstaltung ,9 39,1 Frei gebuchte Veranstaltungen ,4 60,9 Summen ,0 100,0 Teilnehmerzahl Anzahl [ %] Veranstaltungsart \ Jahr Programmveranstaltung ,2 32,6 Frei gebuchte Veranstaltungen ,8 67,4 Summen ,0 100,0 Tab. 3: Monatsweise Veranstaltungszahl Anzahl der Veranstaltungen Monat \ Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summen
75 72 Öffentlichkeitsarbeit Presse, Funk und Fernsehen Nach wie vor ist die Berichterstattung in den Printmedien, vor allem in den Tageszeitungen, die beste Werbung für die Rieselfelder. Das Veranstaltungsprogramm ist z.t. mehrmals pro Woche Gegenstand in den Zeitungen. Ihnen folgt das lokale Radio, Antenne Münster, in dem regelmäßig Hinweise auf unser Programm gesendet werden. Das WDR- Fernsehen war dreimal zu Gast in den Rieselfeldern einmal sogar aus Düsseldorf zu einer Berichterstattung über Rabenvögel. Mehrfach hat die WDR Fernsehsendung Lokalzeit Münsterland Nachrichten mit Rieselfeld-Bildern eingerahmt. Die Presse begleitete auch die Eröffnung der Ausstellung über das Lebenswerk von Herrn Prof. Dr. Ant im Dezember 2007 im ehemaligen Kuhstall des Rieselfeldhofes. Der von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster emeritierte Professor für die Didaktik der Biologie gilt als eine Galionsfigur des Naturschutzes im Münsterland gründete er die "Arbeitsgemeinschaft für Biologisch- ökologische Landesforschung" (ABÖL), 1976 war er Mitbegründer der Landesgemeinschaft für Natur- und Umwelt (LNU). Als Hochschullehrer gehörte er auch zu den Gründungsmitgliedern des Zentrums für Umweltforschung (ZUFO) der Universität Münster. Als Forscher untersuchte er Schnecken in verschiedenen Lebensräumen und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zu Wasserlebensräumen und Naturschutz. Abb. 3 : Ausstellungseröffnung zu Ehren des Lebenswerkes von Prof. Dr. Ant (Vordergrund, Mitte) (Foto: H.-U. Schütz)
76 Jahresbericht Ausstellung Rieselfeldhof In 2007 besuchten insgesamt 2585 interessierte Rieselfeld- Besucher die Ausstellung zur Landschaftsgeschichte der Rieselfelder im ehemaligen Kuhstall des Rieselfeldhofes. Trotz des regnerischen Eindruckes, den das Jahr 2007 im allgemeinen hinterließ, bedeutet dies einen Aufwärtstrend für die Dauerausstellung. Auffällig ist auch hier die Abhängigkeit der Besucherzahlen von der Witterung am Wochenende. Der April war eindeutig der schönste Monat des Jahres 2007 mit Maximaltemperaturen bis +25 C. Daher wartete der April auch mit der höchsten Besucherzahl (Tab. 4 : 355) auf. Es ist jedoch meist nicht die Temperatur, die den Ausschlag für den Rieselfeld-Besuch gibt, sondern die Regenwahrscheinlichkeit. So zeichnete sich der Februar mit Ausnahme eines dreitägigen Temperatureinbruchs durch besonders mildes Wetter aus (der Winter 2006 / 2007 fand am 8. Februar statt: Schneefall). Die Besucherzahl war dennoch sehr niedrig, da es gerade zu den Wochenenden immer regnerisch war. Regen und Wind hielten auch im November die Menschen in stärkerem Maße von den Rieselfeldern fern, wie ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen zeigt (Tab. 4). Tab. 4: Besucherzahlen der Rieselfeldhofausstellung Monat \ Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
77 74 Öffentlichkeitsarbeit Praktika Aufgrund der unsicheren Finanzlage in 2007 und der damit verbundenen nicht gesicherten Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten fiel deren Zahl geringer aus als in den Vorjahren. Dennoch leisteten sie auch in 2007 ihren Beitrag in der Unterstützung des arbeitsintensiven Managements in den Rieselfeldern. Für die Universitätsprakti- kantinnen und -praktikanten bedeutete dies, unter Anleitung Kartierungen durchzuführen und bei der Gebietspflege aktiv mitzuarbeiten. Für die Schülerinnen und Schüler ergaben sich sicherlich ungeahnte Einblicke in die Arbeitsbereiche an einer Biologischen Station. Für ihr Engagement bedanken wir uns bei: Berufs- und Universitätspraktika: Schwan Hosseiny (Berufspraktikum) Jens Kockerbeck (Berufspraktikum) Thomas Neeten (Geographie, Bonn) Senta Ossen (Biogeographie, Trier) Sarah Sherwin (Landschaftsökologie, Münster) Julian Waas (Biogeographie, Trier) Schülerpraktika: Tim Burschyk Lea Dammann Robin Dirks Nils Grabbe Nicholas Kottmeyer Jonas Neudorf Mareike Schlüter Ehrenamtliches Engagement Die Biologische Station Rieselfelder Münster könnte nicht sein, was sie ist, ohne das ehrenamtliche Engagement. Nicht nur die Stationsleitung erfolgt schon immer ehrenamtlich, auch viele Arbeiten am Rieselfeldhof und im Gelände werden ehrenamtlich bestritten. So engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei jedem Wetter im Vogelmonitoring (Brigitte Feldmann, Abb. 4), aber auch bei anderen handfesten Tätigkeiten ist ehrenamtlicher Einsatz nicht weg zu denken. Zwei Studentinnen der Landschaftsökologie (Kathrin Sliwka u. Kristin Fleischer) arbeiten ehrenamtlich jeweils einen Tag pro Woche für die Biologische Station. Nicht gesucht aber gefunden haben sich Peter Watermann (62 Jahre) und
78 Jahresbericht Hermann Lenz (72 Jahre) zwei Senioren im Unruhestand. Peter Watermann ist Elektriker und von Natur aus praktisch veranlagt. Er fand den Weg über die Freiwilligenagentur in die Rieselfelder. Hermann Lenz war früher Amtsrat für Versicherungsfragen und ist seit einem Jahr zu seinem Jugendspielplatz Rieselfelder zurückgekehrt. Zusammen reparie- ren sie Spendenboxen, Steganlagen, Schautafeln und Beobachtungshütten. Für ausdauerndes und genaues Arbeiten, Improvisation und handwerkliches Geschick stehen die beiden Senioren, die dankenswerter Weise zusammen jede Woche einen Tag ihrer Schaffenskraft für die Rieselfelder einsetzen. Abb. 4: Brigitte Feldmann, hier auf einer Exkursion an den Niederrhein (Foto: H.-U. Schütz)
79 76 Öffentlichkeitsarbeit Abb. 5 : Peter Watermann (l.) und Hermann Lenz bei der Instandsetzung eines Steges (Foto: H.-U. Schütz)
80 Freundes- und Förderkreis- Exkursionen Jahresbericht Vogel- und landschaftskundliche Exkursionen des Freundes- und Förderkreises des Europareservates Rieselfelder Münster 2007 Manfred Röhlen Nach einer kurzen Aufwärmphase im Jahr 2006 konnten im Jahr 2007 vier vogel- und landschaftskundliche Exkursionen für die Mitglieder des Freundes- und Förderkreis des Europareservates Rieselfelder Münster angeboten werden. Die Exkursionen waren durchschnittlich besucht und sollten dazu dienen, den Vogelarten, die in den Rieselfeldern Münster zu beobachten sind, auch einmal in anderen Landschaften Nordrhein-Westfalens nachzuspüren. Die erste Ganztagestour führte Ende März in die Ahsewiesen und die Lippeaue bei Lippborg. Unter der hervorragenden Leitung von Birgit Beckers von der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) im Kreis Soest konnten viele Vogelarten entdeckt werden, die die Teilnehmer schon aus den Rieselfeldern kannten. Die Exkursion hatte reichlich Höhepunkte: Ein Kranich-Paar, mindestens vier Paare Großer Brachvogel, eine äußerst aggressive Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Bekassinen, die ersten Rauchschwalben des Jahres und nicht zuletzt mindestens fünf singende Feldlerchen begeisterten die Teilnehmer. Insgesamt konnten an diesem herrlichen Frühlingstag 63 verschiedene Vogelarten beobachtet werden. Die Landschaftskunde kam auch nicht zu kurz. Frau Beckers erklärte ausführlich und sehr interessant die Renaturierungsmaßnahmen in den Feuchtwiesen und an der Lippe, die einen solchen Vogelreichtum erst ermöglichten. Anfang Mai ging es dann in die Feuchtwiesen zwischen Westladbergen und Saerbeck. Neben balzenden Großen Brachvögeln und Uferschnepfen waren hier auch Bekassinen, Rotschenkel und Kampfläufer zu sehen. Zu den 46 beobachteten Vogelarten gehörten auch ein Paar Braunkehlchen sowie knapp 40 Steinschmätzer. Wann immer ein Weidezaun ins Blickfeld der Spektive und Ferngläser geriet, saß mindestens einer dieser Zugvögel dort. Ein überwältigender Anblick. Manfred Röhlen erklärte den Teilnehmern Entstehung, Schutz und Bedeutung der Feuchtwiesen-Landschaft.
81 78 Freundes- und Förderkreis-Exkursionen Mitte November stand der Dümmer mit seinen umliegenden Mooren auf dem Programm. Gelang im Rhedener Geestmoor noch 2006 eine herrliche Beobachtung des Schlafplatzzuges der Kraniche, fehlte im Jahr 2007 etwas das Glück. Vier Tage vor der Exkursion zog ein Großteil der rastenden Kraniche Richtung Südwesteuropa ab. Nur eine relativ kleine Zahl ließ sich noch beobachten. Allerdings entschädigten unter anderem ein Seeadler, Kornweihen, Schwarzkehlchen sowie mindestens 40 Silberreiher die Teilnehmer. Auch bei dieser Tour kamen Erläuterungen zur Entstehungsgeschichte, zur Entwicklung und zum Schutz der beeindruckenden Landschaft nicht zu kurz. Kurz vor Weihnachten führte die letzte Exkursion des Jahres an die Überschwemmungsgebiete und Altarme des Niederrheins. Beeindruckt waren die Teilnehmer von der großen Zahl der Bläss-, Weißwangen- und Graugänse und von den weiten Überschwemmungsflächen des Hochwasser führenden Rheins. Aber auch ein Pärchen der äußerst seltenen Moorente, ein Seeadler, eine Waldschnepfe sowie ein Hybrid von Reiherente-Männchen mit Tafelente-Weibchen, deren Bestimmungsmerkmale von Martin Temme hervorragend verdeutlicht wurden, sorgten für gute Laune. Die hielt auch im weiteren Verlauf des Tages bei der Beobachtung eines Zwergschwans und größerer Gruppen von Großen Brachvögeln an. Insgesamt wurden 72 Vogelarten gesehen. Abb. 1: Ahse-Wiesen am (Foto: H.-U. Schütz) Abb. 2: Beobachtung von Wiesenvögeln und Störchen (Foto: H.-U. Schütz)
82 Jahresbericht BEI EXKURSIONEN DES FFK BEOBACHTETE VOGELARTEN IM JAHR = Ahsewiesen und Lippeaue bei Lippborg; = Feuchtwiesenschutzgebiete Westladbergen-Saerbeck und Umgebung; = Dümmer und umliegende Moore; = Unterer Niederrhein zwischen Bislicher Insel und Altrhein Griethausen; Höckerschwan 1,3,4 Großer Brachvogel 1,2,3,4 Zwergschwan 4 Uferschnepfe 1,2 Kanadagans 1,2,4 Waldschnepfe 4 Weißwangengans 4 Bekassine 1,2 Tundrasaatgans 4 Rotschenkel 2 Blässgans 1,3,4 Waldwasserläufer 1 Graugans 1,2,3,4 Kampfläufer 2 Grau- x Hausgans 1 Lachmöwe 1,3,4 Nilgans 1,2,4 Sturmmöwe 3,4 Rostgans 1,4 Mantelmöwe 4 Schnatterente 1,3,4 Silbermöwe 3,4 Pfeifente 1,3,4 Heringsmöwe 4 Krickente 1,3,4 Hohltaube 1,2,4 Stockente 1,2,3,4 Ringeltaube 1,2,3,4 Spießente 1,4 Türkentaube 4 Löffelente 1,2,3,4 Kuckuck 2 Tafelente 3,4 Eisvogel 4 Reiherente 1,2,3,4 Grünspecht 1,2,4 Reiher- x Tafelente 4 Buntspecht 1,2,4 Schellente 4 Elster 1,3,4 Zwergsäger 4 Eichelhäher 1,3,4 Gänsesäger 4 Dohle 1,3,4 Jagdfasan 1,2,3,4 Saatkrähe 3,4 Zwergtaucher 1,3,4 Rabenkrähe 1,2,3,4 Haubentaucher 3,4 Blaumeise 1,3,4 Kormoran 1,3,4 Kohlmeise 1,2,3,4 Silberreiher 1,3,4 Feldlerche 1,4 Graureiher 1,2,3,4 Rauchschwalbe 1,2 Kornweihe 3,4 Schwanzmeise 1,3,4 Rohrweihe 1 Fitis 2 Sperber 3,4 Zilpzalp 1,2
83 80 Freundes- und Förderkreis-Exkursionen Seeadler 3,4 Mönchsgrasmücke 2 Mäusebussard 1,2,3,4 Gartengrasmücke 2 Baumfalke 2 Dorngrasmücke 2 Turmfalke 1,3,4 Zaunkönig 1,2,3,4 Kranich 1,3 Kleiber 1 Teichhuhn 2,4 Gartenbaumläufer 2,4 Blässhuhn 1,2,3,4 Star 1,2,3,4 Kiebitz 1,2,3,4 Amsel 1,2,3,4 Wacholderdrossel 1,3,4 Baumpieper 2 Singdrossel 1,2 Wiesenpieper 1,3,4 Rotdrossel 1,3,4 Bachstelze 1,2,4 Misteldrossel 1,2,4 Buchfink 1,2,3,4 Braunkehlchen 2 Grünfink 1 Schwarzkehlchen 3 Stieglitz 1,3 Rotkehlchen 1,3,4 Erlenzeisig 4 Steinschmätzer 2 Bluthänfling 1,2,3 Heckenbraunelle 1,2 Goldammer 1,2 Haussperling 1,3,4 Rohrammer 1,2 Feldsperling 3,4 Artenzahl gesamt: 99 Nimmt man alle vier Exkursionen zusammen, kamen 99 verschiedene Vogelarten zur Beobachtung. Einzelheiten sind aus der vorstehenden Tabelle zu entnehmen. Arten, die an allen vier Terminen wahrgenommen werden konnten, sind besonders hervorgehoben. Neben den tollen Beobachtungen fiel bei allen Touren auch die hervorragende Stimmung auf, an der das regelmäßige mobile Kuchenbüffet von Dr. Hans-Uwe Schütz seinen gehörigen Anteil hatte. Kommen Sie doch demnächst auch einmal mit!
84 Jahresbericht Abb. 3: Beobachtungsturm im Ochsenmoor, Dümmer-Niederung: Warten auf einfliegende Kraniche (Foto: H.-U. Schütz)
85 82 Freundes- und Förderkreis-Exkursionen Abb. 4: Pappel-Weg auf der Bislicher Halbinsel: FFK- Mitglieder unterwegs (Foto: H.-U. Schütz) Abb. 5: FFK Mitglieder und Sympathisanten auf einem Damm am Biener Altarm (v.l. nach r.: B. Feldmann, M. Temme, E. Boeker, M. Grote, K. Kappenberg, M. Röhlen und D. Kosmeier) (Foto: H.-U. Schütz)
86 Verkehrszählung Jahresbericht Verkehrszählung 2007 Hans-Uwe Schütz Die Verkehrszählung fand am Dienstag, dem 24. April 2007 von 6 bis 21 Uhr statt. Vormittags war es zunächst bewölkt, aber trocken und warm. Im Tagesverlauf setzte sich die Sonne durch und das Thermometer erreichte bis zu 25 C - eigentlich bestes Fahrradwetter. 15 Stunden Verkehrsbeobachtung an der Kreuzung Coermühle und Hessenweg erfordern auch einigen personellen Aufwand. Es teilten sich 9 Personen die Zählzeiten. Die Verkehrszählung wird seit 2003 nach der gleichen Methode durchgeführt. Von der Kreuzung Hessenweg / Coermühle ausgehend werden die Ortskennzeichen (MS, ST, WAF, Sonstige) aller vorbei fahrenden Kraftfahrzeuge in den vier Fahrtrichtungen (Rieselfeldhof / Innenstadt, Gittrup, Gimbte / Sprakel, Kanalbrücke / Gelmer) an einem Zähltag Ende März / Anfang April erfaßt. Geändert hat sich gegenüber den Vorjahren der Zeitraum der Verkehrszählung. Er wurde den veränderten Ladenschlusszeiten (seit Juli 2005) angeglichen und bis 21 Uhr ausgedehnt. Ob sich die Verkehrsströme tatsächlich entspre- chend ändern, werden die Zählungen der nächsten Jahre zeigen. Bei Vergleichen mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2006 wird nur der Erfassungszeitrahmen bis 19 Uhr berücksichtigt. Der späte Zähltermin im April ist durch den Vorrang anderer Arbeiten begründet. Für den 24. April sind keine besonderen Umstände zu verzeichnen gewesen, die das Zählergebnis hätten beeinflussen können. Solch ein Ereignis könnte z.b. ein schwerer Unfall auf der A1 zwischen Greven und Münster in den Hauptverkehrszeiten sein. Dann ziehen lange Kraftfahrzeugschlangen auf der Coermühle in Richtung Innenstadt. Verbotsschilder wie die Sperrung für Lastwagen werden dann zu einer Farce. Die Zahl der Kraftfahrzeuge auf der stark befahrenen Coermühle ist gegenüber den Zähltagen im Vorjahr und an den vorangegangenen Jahren gestiegen (Tab. 1). Von 6 bis 19 Uhr fuhren am des Vorjahres 799 Kraftfahrzeuge auf der Coermühle in Richtung Innenstadt / Heidekrug. In 2007 konnten im gleichen Zeitraum am Zähltag 845 Fahrzeuge erfasst werden. In Richtung Gittrup stieg der Zahl der erfass-
87 84 Verkehrszählung ten Fahrzeuge von 438 in 2006 auf 569 in Der Hessenweg in Richtung Kanalbrücke / Gelmer ist ebenso wie die Coermühle in Richtung Gittrup mittelmäßig befahren. Im Vergleich zu 2006 (542 Kraftfahrzeuge) war die Zahl der Kraftfahrzeuge im Referenzzeitraum von 6 bis 19 Uhr auf 583 angestiegen. Im Jahr 2005 war diese Zahl mit 599 gezählten Fahrzeugen noch etwas höher. Als rückläufig kann nur das Verkehrsaufkommen auf dem Hessenweg in Richtung Gimbte / Sprakel bezeichnet werden. 247 Fahrzeuge befuhren den Hessenweg am Zähltag in 2007 in diese Richtung. Im Jahr 2006 waren es 258. Nur diese Fahrtrichtung verzeichnet über die letzten Jahre (seit 2003) eine kontinuierlich fallende Tendenz des Verkehrsaufkommens am Zähltag. An der Straßenkreuzung Coermühle / Hessenweg wurden am von 6 bis 19 Uhr 2244 Kraftfahrzeuge durch die Zähler erfasst. Bis 21 Uhr stieg die Zahl noch auf 2444 motorisierte Fahrzeuge. Also waren trotz des deutlich schöneren Wetters in 2007 mehr Autos, Motorräder und Lastwagen zu verzeichnen als am schen 16 und 17 Uhr. In 2006 lag die Heimfahrtsspitze zwischen 15 und 16 Uhr, in den Jahren 2003 und 2005 ebenfalls zwischen 16 und 17 Uhr (Abb. 2). Am 24. April 2007 befuhren zwischen 18 und 19 Uhr deutlich mehr Fahrzeuge den Kreuzungsbereich als in den Vorjahren. Ob dies ein Hinweis auf den späteren Ladenschluss in Münster sein kann, müssen die Zählungen der nächsten Jahre zeigen. Bei den Anteilen der Herkünfte (Abb. 3) hat es nur geringe prozentuale Verschiebungen gegeben. Prozentual war am Zähltag der Anteil mit Warendorfer und Steinfurter Kennzeichen in 2007 etwas geringer als am Die Absolutzahlen zeigten in den meisten Fahrtrichtungen kaum einen Rückgang. Dafür stieg der Anteil mit Münsteraner Kennzeichen absolut und prozentual etwas an. Auf dem Hessenweg in Richtung Gimbte fiel dies besonders auf. Während Steinfurter (-24) und Warendorfer (-12) Kennzeichen in 2007 rückläufig waren, stieg die Anzahl motorisierter Münsteraner Verkehrsteilnehmer von 103 auf 138 deutlich an. Wie die Abb. 1 und 2 zeigen ist der Haupt-Feierabendverkehr zwi-
88 Jahresbericht Tab.1: Verkehrsaufkommen an der Kreuzung Coermühle / Hessenweg an den Zähltagen von 2003 bis 2007 (* Zähltage: , , ) Coermühle ->Heidekrug Coermühle ->Gittrup Uhrzeit 2003* 2005* 2006* 2007* 2003* 2005* 2006* 2007* Gesamt Uhr Uhr 569 Hessenweg ->Gimbte Hessenweg ->Gelmer Uhrzeit 2003* 2005* 2006* 2007* 2003* 2005* 2006* 2007* Gesamt Uhr Uhr 583
89 86 Verkehrszählung Abb. 1: Verkehrsaufkommen in den vier Fahrtrichtungen im Tagesverlauf Abb. 2: Veränderungen ( ) des Gesamtaufkommens an Kraftfahrzeugen im Tagesverlauf
90 Jahresbericht Abb. 3: Anteile der Herkünfte (Kennzeichen) der Kraftfahrzeuge in den vier Fahrtrichtungen
91 88 Presse-Echo
92 Jahresbericht
93 90 Presse-Echo
94 Jahresbericht
95 92 Presse-Echo
96 Jahresbericht
97 94 Presse-Echo
naturus Naturkundliche Studienreise Neusiedlersee 13. April April 2009 DO 16. Südlich Fertöuljak FR 17. vm Hansag DO 16.
 naturus Naturkundliche Studienreise Neusiedlersee 13. April - 20. April 2009 Liste der beobachteten Vogelarten (nach der Reiseteilnehmer zusammengestellt von Manfred Lüthy) * Artbestimmung nicht gesichert
naturus Naturkundliche Studienreise Neusiedlersee 13. April - 20. April 2009 Liste der beobachteten Vogelarten (nach der Reiseteilnehmer zusammengestellt von Manfred Lüthy) * Artbestimmung nicht gesichert
Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2009
 Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2009 Januar 2009: 13.01. Acht Seidenschwänze und etliche Rotdrosseln waren zu Gast. 19.01. Sechs Bläßgänse und 18 Birkenzeisige wurden gezählt. 25.01.
Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Münster des Jahres 2009 Januar 2009: 13.01. Acht Seidenschwänze und etliche Rotdrosseln waren zu Gast. 19.01. Sechs Bläßgänse und 18 Birkenzeisige wurden gezählt. 25.01.
Birdingtoursreise Texel Reisebericht von Micha Arved Neumann
 Birdingtoursreise Texel 29.07.-02.08.2015 Reisebericht von Micha Arved Neumann Birdingtoursreisegruppe bei der Arbeit Mittwoch 29.07. Eine Reise mitten im Hochsommer auf eine Nordseeinsel um dort Vögel
Birdingtoursreise Texel 29.07.-02.08.2015 Reisebericht von Micha Arved Neumann Birdingtoursreisegruppe bei der Arbeit Mittwoch 29.07. Eine Reise mitten im Hochsommer auf eine Nordseeinsel um dort Vögel
Erlebnis Nordsee mit Sylt und Helgoland August 2010
 Reisbericht 90 Erlebnis Nordsee mit Sylt und Helgoland 20. 29. August Foto: Rainer Windhager Exkursionstage: 20.08.10 Fahrt Hamburg Husum; Einzelbeob. in Husum; Tönning/Multimar Wattforum entlang der Eider
Reisbericht 90 Erlebnis Nordsee mit Sylt und Helgoland 20. 29. August Foto: Rainer Windhager Exkursionstage: 20.08.10 Fahrt Hamburg Husum; Einzelbeob. in Husum; Tönning/Multimar Wattforum entlang der Eider
Birdingtoursreise Texel
 Birdingtoursreise Texel 09.-13.08.2017 Mittwoch 09.08. Nach dem Zimmerbezug und einer gemeinsamen Suppe zieht es uns zu einem ersten Erkundungsgang nach draußen. Wir lernen verschiedene Lebensräume auf
Birdingtoursreise Texel 09.-13.08.2017 Mittwoch 09.08. Nach dem Zimmerbezug und einer gemeinsamen Suppe zieht es uns zu einem ersten Erkundungsgang nach draußen. Wir lernen verschiedene Lebensräume auf
Naturkundliche Reise Ungarische Tiefebene 30. April bis 7. Mai 2016
 Naturkundliche Reise Ungarische Tiefebene 30. April bis 7. Mai 2016 Naturus GmbH Artenliste Vögel (Nach Beobachtungen der ReiseteilnehmerInnen, zusammengestellt von Pius Kunz) 1. Höckerschwan 2. Graugans
Naturkundliche Reise Ungarische Tiefebene 30. April bis 7. Mai 2016 Naturus GmbH Artenliste Vögel (Nach Beobachtungen der ReiseteilnehmerInnen, zusammengestellt von Pius Kunz) 1. Höckerschwan 2. Graugans
LANDKREIS NIENBURG/WESER Stand: Verzeichnis der Schutzgebiete des Netzes Natura 2000 im Landkreis Nienburg/Weser
 Blatt Nr. 1 V 40 Diepholzer Moorniederung (12.648) 3.834,84 Goldregenpfeifer (B), Sumpfrohreule (B), Ziegenmelker (B), Kornweihe (G), Krickente (B), Baumfalke (ZB), Bekassine (ZB), Großer Brachvogel (ZB),
Blatt Nr. 1 V 40 Diepholzer Moorniederung (12.648) 3.834,84 Goldregenpfeifer (B), Sumpfrohreule (B), Ziegenmelker (B), Kornweihe (G), Krickente (B), Baumfalke (ZB), Bekassine (ZB), Großer Brachvogel (ZB),
Birdingtoursreise Texel Ein Reisebericht von Micha Arved Neumann
 Birdingtoursreise Teel 16.07.-20.07.2014 Ein Reisebericht von Micha Arved Neumann Birdingtoursreisegruppe mit Zwergen Foto: Sonja Loner Mittwoch 16.07. Die Reisegruppe trifft sich zur Begrüßungssuppe in
Birdingtoursreise Teel 16.07.-20.07.2014 Ein Reisebericht von Micha Arved Neumann Birdingtoursreisegruppe mit Zwergen Foto: Sonja Loner Mittwoch 16.07. Die Reisegruppe trifft sich zur Begrüßungssuppe in
Starker Wandel der Brutvogelwelt am Bodensee
 Starker Wandel der Brutvogelwelt am Bodensee eine Bilanz nach 30 Jahren Stefan Werner ein Gemeinscha=sprojekt der Ornithologischen Arbeitsgemeinscha= Bodensee OAB OGBW, Freiburg, 20.02.2016 Bearbeitungsgebiet
Starker Wandel der Brutvogelwelt am Bodensee eine Bilanz nach 30 Jahren Stefan Werner ein Gemeinscha=sprojekt der Ornithologischen Arbeitsgemeinscha= Bodensee OAB OGBW, Freiburg, 20.02.2016 Bearbeitungsgebiet
Die typischen Arten auf einen Blick
 Die typischen Arten auf einen Blick Höckerschwan (Cygnus olor) Typisch orangefarbener Schnabel mit Höcker, durchziehende Sing- und Zwergschwäne besitzen schwarz-gelbe Schnäbel. Größe: bis 160 cm Saatgans
Die typischen Arten auf einen Blick Höckerschwan (Cygnus olor) Typisch orangefarbener Schnabel mit Höcker, durchziehende Sing- und Zwergschwäne besitzen schwarz-gelbe Schnäbel. Größe: bis 160 cm Saatgans
Birdingtoursreise Texel
 Birdingtoursreise Texel 18.-22.08.2013 Sonntag 18.08. Am frühen Nachmittag trifft sich die Reisegruppe zu einer schmackhaften Begrüßungssuppe im Hotel. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde machen wir uns
Birdingtoursreise Texel 18.-22.08.2013 Sonntag 18.08. Am frühen Nachmittag trifft sich die Reisegruppe zu einer schmackhaften Begrüßungssuppe im Hotel. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde machen wir uns
Beringungsbericht 1971 für das Gebiet der OAG - 7. Bericht -
 - 127 - Beringungsbericht 1971 für das Gebiet der OAG - 7. Bericht - Von Reinhard HEINS Die Zusammenstellung umfaßt die Ergebnisse von 24 Beringern, die 25 583 Vögel (7772 njg, nfl., 17 811 Fgl) von 160
- 127 - Beringungsbericht 1971 für das Gebiet der OAG - 7. Bericht - Von Reinhard HEINS Die Zusammenstellung umfaßt die Ergebnisse von 24 Beringern, die 25 583 Vögel (7772 njg, nfl., 17 811 Fgl) von 160
birdingtours Reisebericht
 birdingtours Reisebericht Reise: Viel los im Donaumoos! Reiseleiter: Tobias Epple Datum: 16.05.2013 20.05.2013 Teilnehmerzahl: 8 Unterkunft: Hotel Hirsch Fotobericht: https://www.facebook.com/birdingtours.gmbh/photos_albums
birdingtours Reisebericht Reise: Viel los im Donaumoos! Reiseleiter: Tobias Epple Datum: 16.05.2013 20.05.2013 Teilnehmerzahl: 8 Unterkunft: Hotel Hirsch Fotobericht: https://www.facebook.com/birdingtours.gmbh/photos_albums
Rastbestände von regelmäßig vorkommenden Vogelarten in an den Standortbereich der geplanten Großkraftwerke angrenzenden Grünlandbereichen
 Anhang 5: Rastbestände von regelmäßig vorkommenden Vogelarten in an den Standortbereich der geplanten Großkraftwerke angrenzenden Grünlandbereichen (aus: FROELICH & SPORBECK 2002) Graureiher, Ardea cinerea
Anhang 5: Rastbestände von regelmäßig vorkommenden Vogelarten in an den Standortbereich der geplanten Großkraftwerke angrenzenden Grünlandbereichen (aus: FROELICH & SPORBECK 2002) Graureiher, Ardea cinerea
Von Hüde zur Hohen Sieben
 Von Hüde zur Hohen Sieben Tafelenten sind häufig an der Ostseite des Sees anzutreffen. An der Ostseite des Dümmers befindet man sich häufig direkt an der Wasserfläche des Sees. Durch überwiegende Westwinde
Von Hüde zur Hohen Sieben Tafelenten sind häufig an der Ostseite des Sees anzutreffen. An der Ostseite des Dümmers befindet man sich häufig direkt an der Wasserfläche des Sees. Durch überwiegende Westwinde
Schweinswale,
 Reisebericht: Nordseeinsel Sylt, 24. bis 30. September 2017 24.09. Gleich die erste Art auf unserer Liste hatte zwar keine Federn, war aber besonders prominent: Zwei Schweinswale flanierten direkt vorm
Reisebericht: Nordseeinsel Sylt, 24. bis 30. September 2017 24.09. Gleich die erste Art auf unserer Liste hatte zwar keine Federn, war aber besonders prominent: Zwei Schweinswale flanierten direkt vorm
Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)
 Taucher Sterntaucher 6800 ~ Prachttaucher 2700 ~ Zwergtaucher 12000-19000 + 8001-20000 ~ Haubentaucher 21000-31000 + 39000 + Rothalstaucher 1800-2600 = 900 - Ohrentaucher 0 = 1100 + Schwarzhalstaucher
Taucher Sterntaucher 6800 ~ Prachttaucher 2700 ~ Zwergtaucher 12000-19000 + 8001-20000 ~ Haubentaucher 21000-31000 + 39000 + Rothalstaucher 1800-2600 = 900 - Ohrentaucher 0 = 1100 + Schwarzhalstaucher
Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)
 Taucher Sterntaucher keine berichteten Vorkommen 6800 ~ Prachttaucher keine berichteten Vorkommen 2700 ~ Zwergtaucher 12000-19000 + 8001-20000 ~ Haubentaucher 21000-31000 + 39000 + Rothalstaucher 1800-2600
Taucher Sterntaucher keine berichteten Vorkommen 6800 ~ Prachttaucher keine berichteten Vorkommen 2700 ~ Zwergtaucher 12000-19000 + 8001-20000 ~ Haubentaucher 21000-31000 + 39000 + Rothalstaucher 1800-2600
Naturkundliche Reise Camarque/Südfrankreich, 2. Mai bis 9. Mai 2015
 Naturkundliche Reise Camarque/Südfrankreich, 2. Mai bis 9. Mai 2015 Naturus GmbH Artenliste Vögel (Nach Beobachtungen der ReiseteilnehmerInnen, zusammengestellt von Pius Kunz) 1. Höckerschwan 3.Mai, Mas
Naturkundliche Reise Camarque/Südfrankreich, 2. Mai bis 9. Mai 2015 Naturus GmbH Artenliste Vögel (Nach Beobachtungen der ReiseteilnehmerInnen, zusammengestellt von Pius Kunz) 1. Höckerschwan 3.Mai, Mas
Exkursionsziel Leipheimer Stausee und Auwald Seit 2007 sechs Exkursionen
 Exkursionsziel Leipheimer Stausee und Auwald Seit 2007 sechs Exkursionen 4. März 2018, 8:30 12:25 Uhr, 7 Personen Der Tag begann neblig, es wurde dann aber freundlicher, bei 0-3 C. Damit endete ein Wintereinbruch
Exkursionsziel Leipheimer Stausee und Auwald Seit 2007 sechs Exkursionen 4. März 2018, 8:30 12:25 Uhr, 7 Personen Der Tag begann neblig, es wurde dann aber freundlicher, bei 0-3 C. Damit endete ein Wintereinbruch
Wetter: Sehr abwechslungsreiches Wetter mit viel Sonnenschein, aber auch zeitweiligen Regenfällen. Insgesamt für die Jahreszeit recht warm.
 Müritz-Nationalpark und Mecklenburgische Schweiz 25. 31.März 2016 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkunft: Gutshaus Federow Teilnehmer: 7 Beobachtungsorte: Ostufer der Müritz, Renaturierungsgebiet Großer
Müritz-Nationalpark und Mecklenburgische Schweiz 25. 31.März 2016 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkunft: Gutshaus Federow Teilnehmer: 7 Beobachtungsorte: Ostufer der Müritz, Renaturierungsgebiet Großer
Vogelzug auf der Kurischen Nehrung (Litauen) 20. bis 27. September 2015
 Vogelzug auf der Kurischen Nehrung (Litauen) 20. bis 27. September 2015 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Unterkunft in der Herberge des Nationalparkzentrums im Dzükijos- Nationalpark, Hotel Neringa,
Vogelzug auf der Kurischen Nehrung (Litauen) 20. bis 27. September 2015 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Unterkunft in der Herberge des Nationalparkzentrums im Dzükijos- Nationalpark, Hotel Neringa,
Rote Liste rote Zahlen
 Rote Liste rote Zahlen Hessen im Spiegel der neuen Roten Liste gefährdeter Brutvogelarten VSW & HGON (2014) VSW: M. Werner, G. Bauschmann, M. Hormann & D. Stiefel HGON: J. Kreuziger, M. Korn & S. Stübing
Rote Liste rote Zahlen Hessen im Spiegel der neuen Roten Liste gefährdeter Brutvogelarten VSW & HGON (2014) VSW: M. Werner, G. Bauschmann, M. Hormann & D. Stiefel HGON: J. Kreuziger, M. Korn & S. Stübing
Reisebericht Helgoland mit Birdingtours
 Text und Fotos: Micha A. Neumann 10.09. Reisebericht Helgoland 10.09. 14.09.2014 mit Birdingtours Es weht ein frischer Wind über der Nordsee an unserem Anreisetag. Die Überfahrt mit der Fähre ist ein wenig
Text und Fotos: Micha A. Neumann 10.09. Reisebericht Helgoland 10.09. 14.09.2014 mit Birdingtours Es weht ein frischer Wind über der Nordsee an unserem Anreisetag. Die Überfahrt mit der Fähre ist ein wenig
Exkursionsziel Donaurieder Stausee
 Exkursionsziel Donaurieder Stausee Die Kombination der Vogelarten bei diesen Stausee-Exkursionen mag überraschen, aber wir starten ja im Ort Donaurieden, und ab dem Startpunkt wird gezählt. Die Vögel sind
Exkursionsziel Donaurieder Stausee Die Kombination der Vogelarten bei diesen Stausee-Exkursionen mag überraschen, aber wir starten ja im Ort Donaurieden, und ab dem Startpunkt wird gezählt. Die Vögel sind
ESG Weidmoos. Ornithologischer Bericht H. Höfelmaier
 ESG Weidmoos Ornithologischer Bericht 2012 H. Höfelmaier Inhaltsverzeichnis 1. Erfassungsmethoden und Ergebnis.. 3 2. Besonderheiten des Jahres 2012.. 3 3. Artenliste.... 4 4. Arten des Anhang I der EU
ESG Weidmoos Ornithologischer Bericht 2012 H. Höfelmaier Inhaltsverzeichnis 1. Erfassungsmethoden und Ergebnis.. 3 2. Besonderheiten des Jahres 2012.. 3 3. Artenliste.... 4 4. Arten des Anhang I der EU
Reisebericht der Pilotreise birdingtrip: Uckermark light vom
 Reisebericht der Pilotreise birdingtrip: Uckermark light vom 8.7. - 10.7.2016 Reiseleiter: Rolf Nessing (Lychen) Freitag, 8.7.2016: Nach einer individuellen Anreise in die Uckermark, die mit eigenen Autos
Reisebericht der Pilotreise birdingtrip: Uckermark light vom 8.7. - 10.7.2016 Reiseleiter: Rolf Nessing (Lychen) Freitag, 8.7.2016: Nach einer individuellen Anreise in die Uckermark, die mit eigenen Autos
Nationalpark Neusiedler See Seewinkel Highlights & Hot Spots
 Nationalpark Neusiedler See Seewinkel Highlights & Hot Spots Die vorliegende Auflistung interessanter Naturerscheinungen und guter Beobachtungsplätze soll einen groben Überblick über das jahreszeitliche
Nationalpark Neusiedler See Seewinkel Highlights & Hot Spots Die vorliegende Auflistung interessanter Naturerscheinungen und guter Beobachtungsplätze soll einen groben Überblick über das jahreszeitliche
Jahresbericht 2002/03
 Jahresbericht 2002/03 der Biologischen Station Rieselfelder Münster Vögel: Zuggeschehen und Brut Weisstörche in den Rieselfeldern Gesamtvegetation im Überblick Partnerprojekte Senegal und Litauen Ichtyologische
Jahresbericht 2002/03 der Biologischen Station Rieselfelder Münster Vögel: Zuggeschehen und Brut Weisstörche in den Rieselfeldern Gesamtvegetation im Überblick Partnerprojekte Senegal und Litauen Ichtyologische
Vertragsverletzungsverfahren
 Vertragsverletzungsverfahren 2001/ 5003 Vogelschutz-Richtlinie VSG Unterer Niederrhein Nordrhein-Westfalen Aktualisierte Abgrenzung Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) Dr. Martin
Vertragsverletzungsverfahren 2001/ 5003 Vogelschutz-Richtlinie VSG Unterer Niederrhein Nordrhein-Westfalen Aktualisierte Abgrenzung Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) Dr. Martin
Italien Po-Delta Reise zu den Flamingos im Po-Delta
 Italien Po-Delta Reise zu den Flamingos im Po-Delta 10. bis 1 April 2013 Rosaflamingo, 13.02013 Camacchio Exkursionsbericht 112 Fürstenfeld, April 2013 1 Italien Po-Delta Reise zu den Flamingos im Po-Delta
Italien Po-Delta Reise zu den Flamingos im Po-Delta 10. bis 1 April 2013 Rosaflamingo, 13.02013 Camacchio Exkursionsbericht 112 Fürstenfeld, April 2013 1 Italien Po-Delta Reise zu den Flamingos im Po-Delta
Spechte, Eulen, Rauhfußhühner und arktische Wintergäste Ornithologische Frühjahrsexkursion nach Estland Tag 1: Tag 2:
 Spechte, Eulen, Rauhfußhühner und arktische Wintergäste Ornithologische Frühjahrsexkursion nach Estland 9. 15.4. 2016 Reiseleitung: Andreas Weber, Bert Rähni und Triin Ivandi Unterkünfte: Ferienhäuser
Spechte, Eulen, Rauhfußhühner und arktische Wintergäste Ornithologische Frühjahrsexkursion nach Estland 9. 15.4. 2016 Reiseleitung: Andreas Weber, Bert Rähni und Triin Ivandi Unterkünfte: Ferienhäuser
An der Oder alle Adler Ostdeutschlands Unsere Reise vom Mai
 Unsere Reise vom 20.-25. Mai 2014-05-20 Reiseleitung: Dr. Christian Wagner Teilnehmer: 15 Unterkunft: Oder Hotel Zützen Dienstag, 20. Mai: Ankommen und erste Beobachtungen Pünktlich zum Reisebeginn endet
Unsere Reise vom 20.-25. Mai 2014-05-20 Reiseleitung: Dr. Christian Wagner Teilnehmer: 15 Unterkunft: Oder Hotel Zützen Dienstag, 20. Mai: Ankommen und erste Beobachtungen Pünktlich zum Reisebeginn endet
birdingtours Reisebericht
 birdingtours Reisebericht Reise: Texel - Inselvögel im Frühjahr! Reiseleiter: Tobias Epple Datum: 30.03.2016 03.04.2016 Teilnehmerzahl: 15 Unterkunft: Hotel Tatenhove De Koog Fotobericht: https://www.facebook.com/birdingtours.gmbh/photos_albums
birdingtours Reisebericht Reise: Texel - Inselvögel im Frühjahr! Reiseleiter: Tobias Epple Datum: 30.03.2016 03.04.2016 Teilnehmerzahl: 15 Unterkunft: Hotel Tatenhove De Koog Fotobericht: https://www.facebook.com/birdingtours.gmbh/photos_albums
Kalberlah - Bodenbiologie / regioplan Landschaftsplanung Anhang. Fachbeitrag Avifauna WP Wiesens-Schirum und Dietrichsfeld / Stadt Aurich 63
 Kalberlah - Bodenbiologie regioplan Landschaftsplanung 2015 Anhang Fachbeitrag Avifauna WP Wiesens-chirum und Dietrichsfeld tadt Aurich 63 Kalberlah - Bodenbiologie regioplan Landschaftsplanung 2015 Anlage
Kalberlah - Bodenbiologie regioplan Landschaftsplanung 2015 Anhang Fachbeitrag Avifauna WP Wiesens-chirum und Dietrichsfeld tadt Aurich 63 Kalberlah - Bodenbiologie regioplan Landschaftsplanung 2015 Anlage
Wertbestimmende Vogelarten* der EU-Vogelschutzgebiete in Niedersachsen
 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Vogelarten der e 01.10.2014 Seite 1 von 11 Vogelarten* der e in Niedersachsen als V01 DE2210-401 Niedersächsisches
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Vogelarten der e 01.10.2014 Seite 1 von 11 Vogelarten* der e in Niedersachsen als V01 DE2210-401 Niedersächsisches
Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 1998
 1. Einleitung Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 1998 Von Peter Zach Das Rötelseeweihergebiet zählt zu
1. Einleitung Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 1998 Von Peter Zach Das Rötelseeweihergebiet zählt zu
Reisebericht Kerkinisee - Griechenland
 Reisebericht Kerkinisee - Griechenland Termin 28. Februar bis 4. März 2017 Reiseleitung: Georgius Spiridakis und Andreas Weber Unterkunft: Chrysochorafa am Kerkinisee Teilnehmer: 12 Beobachtungsorte: Kerkinisee,
Reisebericht Kerkinisee - Griechenland Termin 28. Februar bis 4. März 2017 Reiseleitung: Georgius Spiridakis und Andreas Weber Unterkunft: Chrysochorafa am Kerkinisee Teilnehmer: 12 Beobachtungsorte: Kerkinisee,
2. Quartal Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache mit der AG-Ornithologie und den Beobachtern.
 robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler 2. Quartal 2014 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler 2. Quartal 2014 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Ausgabe Nr. 3-2009 Zeitraum: März 2009
 www.oaghn.de www.ornischule.de Ausgabe Nr. 3-2009 Zeitraum: März 2009 Schwarzhalstaucher (Aufnahme J. Fischer) Herausgeber: OA G HN & ORNI Schule Vorwort Liebe VogelbeobachterINNEN, ich freue mich, dass
www.oaghn.de www.ornischule.de Ausgabe Nr. 3-2009 Zeitraum: März 2009 Schwarzhalstaucher (Aufnahme J. Fischer) Herausgeber: OA G HN & ORNI Schule Vorwort Liebe VogelbeobachterINNEN, ich freue mich, dass
Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Hotel Ventiane am Kurischen Haff, Hotel Neringa, und Bauernhof Miniskiniskes.
 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Hotel Ventiane am Kurischen Haff, Hotel Neringa, und Bauernhof Miniskiniskes. Teilnehmer: 7 aus Deutschland Beobachtungsorte: Memeldelta, Kurische Nehrung, und
Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Hotel Ventiane am Kurischen Haff, Hotel Neringa, und Bauernhof Miniskiniskes. Teilnehmer: 7 aus Deutschland Beobachtungsorte: Memeldelta, Kurische Nehrung, und
Jagdbar. Anzahl Junge oder Eier. Grösse (cm) Gewicht (Kg) Nahrung. Lebensraum. Nistorte. Schonzeit. Jagdbar. Anzahl Junge oder Eier.
 Lappentaucher Ruderfüssler Lappentaucher Kormorane Zwergtaucher Kormoran Schreitvögel Schreitvögel Reiher Störche Graureiher Weissstorch Schwäne Gänse Höckerschwan Saatgans Schwimmenten Schwimmenten Krickente
Lappentaucher Ruderfüssler Lappentaucher Kormorane Zwergtaucher Kormoran Schreitvögel Schreitvögel Reiher Störche Graureiher Weissstorch Schwäne Gänse Höckerschwan Saatgans Schwimmenten Schwimmenten Krickente
Moore, Taiga und baltische Küsten ornithologische Reise nach Estland
 Moore, Taiga und baltische Küsten ornithologische Reise nach Estland Teilnehmer: 14 Wetter: fast durchweg sonnig bei anfänglich kühlen, später sehr warmen Temperaturen, nur etwas Regen; an den meisten
Moore, Taiga und baltische Küsten ornithologische Reise nach Estland Teilnehmer: 14 Wetter: fast durchweg sonnig bei anfänglich kühlen, später sehr warmen Temperaturen, nur etwas Regen; an den meisten
Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 1999
 AKTUELLE MITTEILUNGEN Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at dass der Vogel unterseits von Kopf bis Schwanz einheitlich dunkel aussieht, obwohl in der Bürzelgegend eigentlich
AKTUELLE MITTEILUNGEN Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at dass der Vogel unterseits von Kopf bis Schwanz einheitlich dunkel aussieht, obwohl in der Bürzelgegend eigentlich
-4o- Beringungsbericht 1968 für das Gebiet der OAG Schleswig-Holstein und Hamburg e.v Bericht. Zusammengestellt von Reinhard HEINS, Moorhusen
 -4o- Beringungsbericht 1968 für das Gebiet der OAG Schleswig-Holstein und Hamburg e.v. - 4. Bericht Zusammengestellt von Reinhard HEINS, Moorhusen Für den Hamburger Raum hat Uwe Peter STREESE auch für
-4o- Beringungsbericht 1968 für das Gebiet der OAG Schleswig-Holstein und Hamburg e.v. - 4. Bericht Zusammengestellt von Reinhard HEINS, Moorhusen Für den Hamburger Raum hat Uwe Peter STREESE auch für
Wetter: Weitgehend niederschlagsfrei, für die Jahreszeit sehr warm und windstill. Im Osten gab es Gewitter.
 Bären, Wölfe und baltische Zugwege 12. bis 19. September 2015 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Hotel Altmoisa und Hotel Villa Theresa in Rakvere Teilnehmer: 14 Beobachtungsorte: Nordwestküste und
Bären, Wölfe und baltische Zugwege 12. bis 19. September 2015 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkünfte: Hotel Altmoisa und Hotel Villa Theresa in Rakvere Teilnehmer: 14 Beobachtungsorte: Nordwestküste und
Bodensee Brutvogelatlas 2000
 Bodensee Brutvogelatlas bearbeitet von: H.-G. Bauer, G. Heine Stand: Oktober 5 Bodensee - Brutvogelatlas / Die (OAB) hat in den Jahren die dritte Brutvogelkartierung im gesamten Seegebiet auf > km durchgeführt
Bodensee Brutvogelatlas bearbeitet von: H.-G. Bauer, G. Heine Stand: Oktober 5 Bodensee - Brutvogelatlas / Die (OAB) hat in den Jahren die dritte Brutvogelkartierung im gesamten Seegebiet auf > km durchgeführt
Anhang 1: Ergebnis der Relevanzprüfung
 Radwanderweg Taxon (kurz) Auswahl zum Filtern streng geschützte Art ARTeFAKT sonstige Quellen eigene Kartierung Potenzielle Lebensräume im Wirkraum Vorkommen der Art im Wirkraum Beeinträchtigung durch
Radwanderweg Taxon (kurz) Auswahl zum Filtern streng geschützte Art ARTeFAKT sonstige Quellen eigene Kartierung Potenzielle Lebensräume im Wirkraum Vorkommen der Art im Wirkraum Beeinträchtigung durch
Archiv Aktuelle Beobachtungen: 2. Quartal 2012
 Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: 2. Quartal 2012 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: 2. Quartal 2012 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Frühjahrszug an der Nordadria
 Exkursionsbericht Nr. 130 Frühjahrszug an der Nordadria 11. - 16. 5. 2015 Leander Khil www.khil.net Titelfotos: Dünnschnabelmöwe (l.o.), Bienenfresser (r.o.) und Rosa Flamingos (u.). 3 5 8 6 7 4 1 2 1
Exkursionsbericht Nr. 130 Frühjahrszug an der Nordadria 11. - 16. 5. 2015 Leander Khil www.khil.net Titelfotos: Dünnschnabelmöwe (l.o.), Bienenfresser (r.o.) und Rosa Flamingos (u.). 3 5 8 6 7 4 1 2 1
Standort für Tagesexkursionen: Greetsiel im Hotel Greetsieler Börse
 REISEBERICHT OSTFRIESLAND VOGELZUG AN DER NORDSEEKÜSTE 9.9. 14.9.2014 8 Teilnehmer(innen) Reiseleiter: Dr. Peter Mende Standort für Tagesekursionen: Greetsiel im Hotel Greetsieler Börse 9.9. Dienstag:
REISEBERICHT OSTFRIESLAND VOGELZUG AN DER NORDSEEKÜSTE 9.9. 14.9.2014 8 Teilnehmer(innen) Reiseleiter: Dr. Peter Mende Standort für Tagesekursionen: Greetsiel im Hotel Greetsieler Börse 9.9. Dienstag:
Klingnauer Stausee. Bulletin
 Klingnauer Stausee Abt. Landschaft und Gewässer Sektion Natur und Landschaft Baudepartement Aargau Bulletin Nr. Jahresübersicht Beobachtungsperiode:. Januar bis. Dezember Schlangenadler zusammengestellt
Klingnauer Stausee Abt. Landschaft und Gewässer Sektion Natur und Landschaft Baudepartement Aargau Bulletin Nr. Jahresübersicht Beobachtungsperiode:. Januar bis. Dezember Schlangenadler zusammengestellt
Reisebericht Schreiadler, Schlagschwirl und Ortolan Müritz und Mecklenburgische Schweiz
 Reisebericht Schreiadler, Schlagschwirl und Ortolan Müritz und Mecklenburgische Schweiz Termin 12. Bis 18. Juni 2016 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkunft: Gutshaus Federow Teilnehmer: 5 Beobachtungsorte:
Reisebericht Schreiadler, Schlagschwirl und Ortolan Müritz und Mecklenburgische Schweiz Termin 12. Bis 18. Juni 2016 Reiseleitung: Andreas Weber Unterkunft: Gutshaus Federow Teilnehmer: 5 Beobachtungsorte:
des NATURSCHUTZAMTES des LANDKREIS STADE mit Unterstützung des LANDES NIEDERSACHSEN und des
 Verbesserung des Bruterfolges und der Eignung als Rastlebensraum für Wat- und Wasservögel. Ein des NATURSCHUTZAMTES des LANDKREIS STADE mit Unterstützung des LANDES NIEDERSACHSEN und des im EU-Vogelschutzgebiet
Verbesserung des Bruterfolges und der Eignung als Rastlebensraum für Wat- und Wasservögel. Ein des NATURSCHUTZAMTES des LANDKREIS STADE mit Unterstützung des LANDES NIEDERSACHSEN und des im EU-Vogelschutzgebiet
Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet DE Unterelbe bis Wedel. Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume
 sziele für das Vogelschutzgebiet DE-2323-401 Unterelbe bis Wedel 1. sgegenstand Das Gebiet ist für die folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume a) von besonderer Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I
sziele für das Vogelschutzgebiet DE-2323-401 Unterelbe bis Wedel 1. sgegenstand Das Gebiet ist für die folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume a) von besonderer Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I
Liste der Vogelschutzgebiete mit den jeweils gebietsspezifischen Vogelarten
 Anlage 2 (zu 1 Nr. 2 BayNat2000V) Liste der Vogelschutzgebiete mit den jeweils gebietsspezifischen Vogelarten Regierungsbezirk(e) 1 Gebiets- OB (teilweise MFr.) DE7132471 Felsen und Hangwälder im Altmühltal
Anlage 2 (zu 1 Nr. 2 BayNat2000V) Liste der Vogelschutzgebiete mit den jeweils gebietsspezifischen Vogelarten Regierungsbezirk(e) 1 Gebiets- OB (teilweise MFr.) DE7132471 Felsen und Hangwälder im Altmühltal
Archiv Aktuelle Beobachtungen: 3. Quartal 2011
 Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: 3. Quartal 2011 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: 3. Quartal 2011 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Dachs 42 Fischotter 42 Europäischer Seehund 43 Waschbär 44 Marderhund 44 Nutria 45 Mink 45
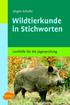 Inhalt Auf einen Blick (Haarwild) Tabelle 1 Lebensraum, Lebensweise, Nahrung Tabelle 2 Brunft/Rauschzeit, Tragezeit, Zahl der Jungen Tabelle 3 Fährte/Spur, Trophäe, Losung, Zahnformel Auf einen Blick (Federwild)
Inhalt Auf einen Blick (Haarwild) Tabelle 1 Lebensraum, Lebensweise, Nahrung Tabelle 2 Brunft/Rauschzeit, Tragezeit, Zahl der Jungen Tabelle 3 Fährte/Spur, Trophäe, Losung, Zahnformel Auf einen Blick (Federwild)
Vorab-Veröffentlichung Stand 10.10.2014
 Anhang V Tabellarische Betrachtung der einzelnen Trassenkorridorsegmente bezüglich der Erforderlichkeit von en bzw. Vorprüfungen Betrachtungsgegenstand Betrachtet werden: Freileitung - alle FFH- und SPA-Gebiete,
Anhang V Tabellarische Betrachtung der einzelnen Trassenkorridorsegmente bezüglich der Erforderlichkeit von en bzw. Vorprüfungen Betrachtungsgegenstand Betrachtet werden: Freileitung - alle FFH- und SPA-Gebiete,
Biotope für Vögel aus Menschenhand - die Offsteiner Klärteiche und eine Bienenfresserkolonie bei Eisenberg
 Biotope für Vögel aus Menschenhand - die Offsteiner Klärteiche und eine Bienenfresserkolonie bei Eisenberg - Ornithologische Halbtagesexkursion - Führung: Bernd Remelius, Hettenleidelheim, Donnerstag,
Biotope für Vögel aus Menschenhand - die Offsteiner Klärteiche und eine Bienenfresserkolonie bei Eisenberg - Ornithologische Halbtagesexkursion - Führung: Bernd Remelius, Hettenleidelheim, Donnerstag,
Reiseziel Gülper See - oder Mir sin ja net zum Spass hier!
 Reiseziel Gülper See - oder Mir sin ja net zum Spass hier! notiert von Tim Mattern Vom Donnerstag, 29. September, bis Montag, 3. Oktober 2005 genoss das Team des Vogelkundlichen Jahresberichts ein verlängertes
Reiseziel Gülper See - oder Mir sin ja net zum Spass hier! notiert von Tim Mattern Vom Donnerstag, 29. September, bis Montag, 3. Oktober 2005 genoss das Team des Vogelkundlichen Jahresberichts ein verlängertes
-5B- Tote Vögel im Spülsaum der Nordseeküste von Schleswig-Holstein in den Jahren Von R. HELDT sen., Friedrichstadt
 -5B- Tote Vögel im Spülsaum der Nordseeküste von Schleswig-Holstein in den Jahren 1959-1969 Von R. HELDT sen., Friedrichstadt In den "Mitteilungen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein,
-5B- Tote Vögel im Spülsaum der Nordseeküste von Schleswig-Holstein in den Jahren 1959-1969 Von R. HELDT sen., Friedrichstadt In den "Mitteilungen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein,
Wintergäste und Durchzügler
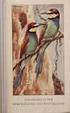 Wintergäste und Durchzügler 1. Nicht-Singvögel Kormoran - Reiher - Enten Kormoran: Die Art wurde nur im Herbst beobachtet. Datum/Anzahl Vögel: 11.9./7Ex.; 28.9./19Ex.; 1.10./18Ex.; 2.10./79Ex.; 3.10./111Ex.;
Wintergäste und Durchzügler 1. Nicht-Singvögel Kormoran - Reiher - Enten Kormoran: Die Art wurde nur im Herbst beobachtet. Datum/Anzahl Vögel: 11.9./7Ex.; 28.9./19Ex.; 1.10./18Ex.; 2.10./79Ex.; 3.10./111Ex.;
ADEBAR-Erfassung. MTB 1732 (Grube) und MTB 1832 (Kellenhusen) Bemerkungen zum erfassten Gebiet. To do (Stand Mitte Mai 2008)
 ADEBAR-Erfassung MTB 1732 (Grube) und MTB 1832 (Kellenhusen) Bemerkungen zum erfassten Gebiet Im nördlichen Teil (MTB 1732, Quadrant I) herrscht großflächige Agrarlandschaft mit wenig Knicks vor. Zwischen
ADEBAR-Erfassung MTB 1732 (Grube) und MTB 1832 (Kellenhusen) Bemerkungen zum erfassten Gebiet Im nördlichen Teil (MTB 1732, Quadrant I) herrscht großflächige Agrarlandschaft mit wenig Knicks vor. Zwischen
Ornithologische Beobachtungen im Bereich der NABU Ortsgruppe Süßen und Umgebung
 31.12.06 Süßen - Lauter - Bahnbrücke Süßen - Fils - Badplätzle Gebirgsstelze, 2 Ex-., Gartenbaumläufer, 2 Ex., Süßen - Fils - Lautermündung Schwanzmeise, 2 Ex., Rabenkrähe, 1 Ex., badend in der Fils Stockente,
31.12.06 Süßen - Lauter - Bahnbrücke Süßen - Fils - Badplätzle Gebirgsstelze, 2 Ex-., Gartenbaumläufer, 2 Ex., Süßen - Fils - Lautermündung Schwanzmeise, 2 Ex., Rabenkrähe, 1 Ex., badend in der Fils Stockente,
ORNITHOLOGISCHER. Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg. Liechtensteinischer Ornithologischer Landesverband
 Bulletin III / 17 September Dezember ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST Zahlreiche Gimpel als Wintergäste Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg Kraniche in Balzers
Bulletin III / 17 September Dezember ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST Zahlreiche Gimpel als Wintergäste Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg Kraniche in Balzers
Durch das Ochsenmoor zum See
 Durch das Ochsenmoor zum See Sumpfrohrsänger gehören zu den Spöttern, sie flechten in ihre Gesänge die Lieder anderer Vogelarten ein. Der östliche Randbereich des Ochsenmoores liegt etwas höher als das
Durch das Ochsenmoor zum See Sumpfrohrsänger gehören zu den Spöttern, sie flechten in ihre Gesänge die Lieder anderer Vogelarten ein. Der östliche Randbereich des Ochsenmoores liegt etwas höher als das
Ornithologischer Bericht 2013
 ESG Weidmoos/Sbg. Ornithologischer Bericht 2013 H. Höfelmaier Inhaltsverzeichnis 1. Erfassungsmethode und Ergebnis.......... 3 2. Besonderheiten des Jahres 2013...... 3 3. Artenliste........ 4 4. Arten
ESG Weidmoos/Sbg. Ornithologischer Bericht 2013 H. Höfelmaier Inhaltsverzeichnis 1. Erfassungsmethode und Ergebnis.......... 3 2. Besonderheiten des Jahres 2013...... 3 3. Artenliste........ 4 4. Arten
Streng geschützte Arten
 Streng geschützte Arten Die nachfolgende Übersicht enthält streng geschützte Arten, die in Bremen nachgewiesen sind oder deren Vorkommen in Bremen nach derzeitigem Kenntnisstand möglich erscheint. Anhand
Streng geschützte Arten Die nachfolgende Übersicht enthält streng geschützte Arten, die in Bremen nachgewiesen sind oder deren Vorkommen in Bremen nach derzeitigem Kenntnisstand möglich erscheint. Anhand
Ornika 16. Jahrgang 2004 Jahresbericht über ornithologische Beobachtungen im westlichen Kreis Ravensburg
 Ornika 16. Jahrgang 2004 Jahresbericht über ornithologische Beobachtungen im westlichen Kreis Ravensburg Bearbeitet und kommentiert von Martin Lechner Nestlinge der Schleiereule im Nistkasten ISSN 1439-8435
Ornika 16. Jahrgang 2004 Jahresbericht über ornithologische Beobachtungen im westlichen Kreis Ravensburg Bearbeitet und kommentiert von Martin Lechner Nestlinge der Schleiereule im Nistkasten ISSN 1439-8435
Reisebericht vom in die Vorpommersche Boddenlandschaft
 Reisebericht vom 13.10-19.10. 2014 in die Vorpommersche Boddenlandschaft Zeit: 13.-19.10.14 Unterkunft: Pension Boddenblick in Bresewitz Teilnehmerzahl: 10 Reiseleiter: Stefan Lilje Wechselhaftes, aber
Reisebericht vom 13.10-19.10. 2014 in die Vorpommersche Boddenlandschaft Zeit: 13.-19.10.14 Unterkunft: Pension Boddenblick in Bresewitz Teilnehmerzahl: 10 Reiseleiter: Stefan Lilje Wechselhaftes, aber
Beschlussantrag Nr. zur Sitzung am. an den Stadtrat. nichtöffentlich gemäß SächsGemO. Gegenstand: Artenschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden
 Beschlussantrag Nr. an den Stadtrat Einreicher: Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung am öffentlich gemäß SächsGemO nichtöffentlich gemäß SächsGemO Gegenstand: Artenschutzmaßnahmen an öffentlichen
Beschlussantrag Nr. an den Stadtrat Einreicher: Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung am öffentlich gemäß SächsGemO nichtöffentlich gemäß SächsGemO Gegenstand: Artenschutzmaßnahmen an öffentlichen
- Die methodischen Grundlagen sind in der "Arbeitsanleitung zur Brutvogelkartierung M-V 1994-1997" beschrieben.
 Geodaten der Abteilung Naturschutz Artvorkommen Tierarten Vögel natur arten fauna voegel Name: Punktdaten Brutvogelkartierung (1994-1998), Neudigitalisierung, reduziert Kurz: bvkr94_98p.doc Seite 1 05.06.13
Geodaten der Abteilung Naturschutz Artvorkommen Tierarten Vögel natur arten fauna voegel Name: Punktdaten Brutvogelkartierung (1994-1998), Neudigitalisierung, reduziert Kurz: bvkr94_98p.doc Seite 1 05.06.13
Zugvögel. Klasse 4a Hermann-Löns-Schule
 Zugvögel Expertenarbeit angefertigt von Robert Hentges Klasse 4a Hermann-Löns-Schule Widmung Frau Kothe und meiner Mutter 2 Inhaltsverzeichnis 0. Vorwort... 1. Einleitung... 2. Was sind Zugvögel?... 3.
Zugvögel Expertenarbeit angefertigt von Robert Hentges Klasse 4a Hermann-Löns-Schule Widmung Frau Kothe und meiner Mutter 2 Inhaltsverzeichnis 0. Vorwort... 1. Einleitung... 2. Was sind Zugvögel?... 3.
Kenndaten zu den Berechnungen der anderen Länder
 Kenndaten zu den Berechnungen der anderen Länder Auf den nachfolgenden Seiten sind für die Länder, für die aufgrund aktuelle Brutvogelatlanten eine Berechnung des avifaunistischen Flächenwertes (AFw) möglich
Kenndaten zu den Berechnungen der anderen Länder Auf den nachfolgenden Seiten sind für die Länder, für die aufgrund aktuelle Brutvogelatlanten eine Berechnung des avifaunistischen Flächenwertes (AFw) möglich
Kartierung von auentypischen und wertgebenden Brutvögel im EU-Vogelschutzgebiet (VSG) Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula im Jahr 2013
 Gruppe Bad Hersfeld Übersicht In diesem Jahr überwiegend nur Zufallsfunde! Zielarten des Vogelschutzgebietes (nach der Verordnung) in Grünschrift Kartierung von auentypischen und wertgebenden Brutvögel
Gruppe Bad Hersfeld Übersicht In diesem Jahr überwiegend nur Zufallsfunde! Zielarten des Vogelschutzgebietes (nach der Verordnung) in Grünschrift Kartierung von auentypischen und wertgebenden Brutvögel
Rastvogelkartierung auf dem Gelände des geplanten Gewerbegebietes Langes Feld im Jahr 2010
 Rastvogelkartierung auf dem Gelände des geplanten Gewerbegebietes Langes Feld im Jahr 2010 Im Auftrag der Stadt Kassel Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel durchgeführt
Rastvogelkartierung auf dem Gelände des geplanten Gewerbegebietes Langes Feld im Jahr 2010 Im Auftrag der Stadt Kassel Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel durchgeführt
Texel
 Exkursionsbericht Nr. 126 Texel 18. - 22. 10. 2014 Leander Khil www.khil.net Titelfotos: Silbermöwe (l.o.), Meerstrandläufer (r.o.) und alle Reiseteilnehmer in De Bol (u.). 9 10 2 1 8 Auf Texel besuchte
Exkursionsbericht Nr. 126 Texel 18. - 22. 10. 2014 Leander Khil www.khil.net Titelfotos: Silbermöwe (l.o.), Meerstrandläufer (r.o.) und alle Reiseteilnehmer in De Bol (u.). 9 10 2 1 8 Auf Texel besuchte
Die Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie in Niedersachsen eine Bilanz
 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Die Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie in Niedersachsen eine Bilanz Thorsten Krüger Staatliche Vogelschutzwarte I) Die
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Die Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie in Niedersachsen eine Bilanz Thorsten Krüger Staatliche Vogelschutzwarte I) Die
Archiv Aktuelle Beobachtungen: 1. Quartal 2012
 Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: 1. Quartal 2012 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Arbeitsgemeinschaft Ornithologie Leitung: Robert Kugler robert_kugler@maxi-dsl.de Archiv Aktuelle Beobachtungen: 1. Quartal 2012 Zitierung und weitere Verwendung der Beobachtungsdaten nur nach Rücksprache
Ornithologische Mitteilungen für den Hohenlohekreis (KÜN) 11 / 2011
 Ornithologische Mitteilungen für den Hohenlohekreis (KÜN) 11 / 2011 Liebe Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter im Hohenlohekreis, besten Dank für die vielen interessanten Meldungen. Die Einleitung
Ornithologische Mitteilungen für den Hohenlohekreis (KÜN) 11 / 2011 Liebe Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter im Hohenlohekreis, besten Dank für die vielen interessanten Meldungen. Die Einleitung
Brandenburger Fluss- und Luchlandschaften
 Brandenburger Fluss- und Luchlandschaften 18.-22.10.2008 Exkursionsbericht 75 Wien Dez 2008 Brandenburger Fluss- und Luchlandschaften 18.-22.10.2008 Reiseleiter vor Ort: Mathias Putze Reiseleiter (BirdLife):
Brandenburger Fluss- und Luchlandschaften 18.-22.10.2008 Exkursionsbericht 75 Wien Dez 2008 Brandenburger Fluss- und Luchlandschaften 18.-22.10.2008 Reiseleiter vor Ort: Mathias Putze Reiseleiter (BirdLife):
Reisebericht Rügen und Hiddensee im Vorfrühling
 Reisebericht Rügen und Hiddensee im Vorfrühling Zeit: 20.03.-27.03.15 Unterkunft: In Sassnitz/Rügen und Kloster/Hiddensee Teilnehmerzahl: 13 Reiseleiter: Stefan Lilje Landschaftsvielfalt: Steilküste, Strand,
Reisebericht Rügen und Hiddensee im Vorfrühling Zeit: 20.03.-27.03.15 Unterkunft: In Sassnitz/Rügen und Kloster/Hiddensee Teilnehmerzahl: 13 Reiseleiter: Stefan Lilje Landschaftsvielfalt: Steilküste, Strand,
Reisebericht Helgoland mit Birdingtours. Text: Micha A. Neumann, Fotos siehe Unterschrift
 Reisebericht Helgoland 17.05. 21.05.2017 mit Birdingtours Text: Micha A. Neumann, Fotos siehe Unterschrift 17.05. Das neue, moderne Seebäderschiff gleitet ruhig über die heute nur sanft gewellte Nordsee
Reisebericht Helgoland 17.05. 21.05.2017 mit Birdingtours Text: Micha A. Neumann, Fotos siehe Unterschrift 17.05. Das neue, moderne Seebäderschiff gleitet ruhig über die heute nur sanft gewellte Nordsee
 Küstenvögel im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft Art - Familie - Gattung BV R/W Rote Listen 1%- deutsch lateinisch englisch D M-V O Krit. Seetaucher - Gaviidae Sterntaucher - Gavia stellata -
Küstenvögel im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft Art - Familie - Gattung BV R/W Rote Listen 1%- deutsch lateinisch englisch D M-V O Krit. Seetaucher - Gaviidae Sterntaucher - Gavia stellata -
Kurze Mitteilungen. Beuteliste für die Jahre 2001 bis 2010 der Wanderfalken Falco peregrinus aus Brokdorf (Krs. Steinburg, Schleswig-Holstein)
 Kurze Mitteilungen Beuteliste für die Jahre 2001 bis 2010 der Wanderfalken Falco peregrinus aus Brokdorf (Krs. Steinburg, Schleswig-Holstein) Der Ort Brokdorf liegt in der Wilstermarsch, einem Gebiet der
Kurze Mitteilungen Beuteliste für die Jahre 2001 bis 2010 der Wanderfalken Falco peregrinus aus Brokdorf (Krs. Steinburg, Schleswig-Holstein) Der Ort Brokdorf liegt in der Wilstermarsch, einem Gebiet der
ALBATROS-TOURS ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN JÜRGEN SCHNEIDER
 ALBATROS-TOURS ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN JÜRGEN SCHNEIDER Altengaßweg 13 64625 Bensheim Tel.: +49 (0) 6251 22 94 Fax: +49 (0) 6251 644 57 http//www.albatros-tours.com E- Mail: schneider@albatros-tours.com
ALBATROS-TOURS ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN JÜRGEN SCHNEIDER Altengaßweg 13 64625 Bensheim Tel.: +49 (0) 6251 22 94 Fax: +49 (0) 6251 644 57 http//www.albatros-tours.com E- Mail: schneider@albatros-tours.com
Friedrichsau, Stadtpark von Ulm
 Friedrichsau, Stadtpark von Ulm 6. Dezember 2015 9:00 12:00 Uhr, 19 Personen Der Winter war wieder sehr mild, und wie im vorigen Jahr gab es im Park keine seltenen Wintergäste. Sie sind wohl noch weit
Friedrichsau, Stadtpark von Ulm 6. Dezember 2015 9:00 12:00 Uhr, 19 Personen Der Winter war wieder sehr mild, und wie im vorigen Jahr gab es im Park keine seltenen Wintergäste. Sie sind wohl noch weit
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich
 TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
Reisebericht Birdingtours-Reise vom in die Vorpommersche Boddenlandschaft
 Reisebericht Birdingtours-Reise vom 06.-12.10.2015 in die Vorpommersche Boddenlandschaft Unterkunft: Pension Boddenblick in Bresewitz Teilnehmerzahl: 15 Reiseleiter: Stefan Lilje Zuerst regnerisch-windiges,
Reisebericht Birdingtours-Reise vom 06.-12.10.2015 in die Vorpommersche Boddenlandschaft Unterkunft: Pension Boddenblick in Bresewitz Teilnehmerzahl: 15 Reiseleiter: Stefan Lilje Zuerst regnerisch-windiges,
Reisebericht von BORUT STUMBERGER & ANDREAS RANNER. Zusammenfassung
 Bericht zur Lage der Wasservögel in drei Grenz-Feuchtgebieten an der Adria in Kroatien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina zwischen 11. und 18. Januar 2017 im Hinblick auf die exzessive Vogeljagd
Bericht zur Lage der Wasservögel in drei Grenz-Feuchtgebieten an der Adria in Kroatien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina zwischen 11. und 18. Januar 2017 im Hinblick auf die exzessive Vogeljagd
Steinbruch bei Haunsheim bisher 8 Exkursionen
 Steinbruch bei Haunsheim bisher 8 Exkursionen Hauptattraktion dieses Gebiets sind die Bienenfresser, die sich seit einigen Jahren hier angesiedelt haben. Sie nisten in von Jahr zu Jahr unterschiedlicher
Steinbruch bei Haunsheim bisher 8 Exkursionen Hauptattraktion dieses Gebiets sind die Bienenfresser, die sich seit einigen Jahren hier angesiedelt haben. Sie nisten in von Jahr zu Jahr unterschiedlicher
Der Kormoran in der Steiermark
 Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Hochwasserschutz Thunersee, Betriebsreglement Entlastungsstollen. Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf Brutvögel
 Hochwasserschutz Thunersee, Betriebsreglement Entlastungsstollen. Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf Brutvögel Gutachten im Auftrag der IC Infraconsult, Bern. Dr. Luc Schifferli, Hans Schmid &
Hochwasserschutz Thunersee, Betriebsreglement Entlastungsstollen. Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf Brutvögel Gutachten im Auftrag der IC Infraconsult, Bern. Dr. Luc Schifferli, Hans Schmid &
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
 www.vogelschutzlaupen.ch Nr. 94 / Januar 17 NVL NATUR- UND VOGELSCHUTZ LAUPEN EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG FREITAG, 10. FEBRUAR 2017 UM 19.30 UHR IM GEMEINDEHAUS (MEHRZWECKRAUM) LAUPEN Schwarzspecht
www.vogelschutzlaupen.ch Nr. 94 / Januar 17 NVL NATUR- UND VOGELSCHUTZ LAUPEN EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG FREITAG, 10. FEBRUAR 2017 UM 19.30 UHR IM GEMEINDEHAUS (MEHRZWECKRAUM) LAUPEN Schwarzspecht
Reisebericht der birdingtour zwischen Elb- und Wesermündung und auf Neuwerk 2016
 Reisebericht der birdingtour zwischen Elb- und Wesermündung und auf Neuwerk 2016 Stefan Lilje Zeit: 28.04.-05.05.16 Unterkunft: Hotels in Otterndorf und auf Neuwerk Teilnehmerzahl: 14 Reiseleiter: Stefan
Reisebericht der birdingtour zwischen Elb- und Wesermündung und auf Neuwerk 2016 Stefan Lilje Zeit: 28.04.-05.05.16 Unterkunft: Hotels in Otterndorf und auf Neuwerk Teilnehmerzahl: 14 Reiseleiter: Stefan
Steinbruch bei Haunsheim bisher 9 Exkursionen
 Steinbruch bei Haunsheim bisher 9 Exkursionen Hauptattraktion dieses Gebiets sind die Bienenfresser, die sich seit einigen Jahren hier angesiedelt haben. Sie nisten in von Jahr zu Jahr unterschiedlicher
Steinbruch bei Haunsheim bisher 9 Exkursionen Hauptattraktion dieses Gebiets sind die Bienenfresser, die sich seit einigen Jahren hier angesiedelt haben. Sie nisten in von Jahr zu Jahr unterschiedlicher
Zur Ökologie einiger Wasservögel im Seewinkel
 70 EGRETTA 24/2/1981 Zur Ökologie einiger Wasservögel im Seewinkel Von Josef Ursprung, Andrea Seh leger, Hans Winkler und Irene Zweimüller 1. Einleitung Der Seewinkel ist eines der bedeutendsten Wasservogelgebiete
70 EGRETTA 24/2/1981 Zur Ökologie einiger Wasservögel im Seewinkel Von Josef Ursprung, Andrea Seh leger, Hans Winkler und Irene Zweimüller 1. Einleitung Der Seewinkel ist eines der bedeutendsten Wasservogelgebiete
Friedrichsau, Stadtpark von Ulm
 Friedrichsau, Stadtpark von Ulm 4. ember 2016 9:00 12:00 Uhr, 19 Personen Es war Hochnebel, windstill und mit -1,5 C nicht besonders kalt. Leider war auch nicht besonders viel zu beobachten! Die Kormorane
Friedrichsau, Stadtpark von Ulm 4. ember 2016 9:00 12:00 Uhr, 19 Personen Es war Hochnebel, windstill und mit -1,5 C nicht besonders kalt. Leider war auch nicht besonders viel zu beobachten! Die Kormorane
Ökologische Aufwertung des Kantonalen Naturreservats Aareinsel Altreu: Die Brut- und Zugvögel im Jahr 2016
 Ökologische Aufwertung des Kantonalen Naturreservats Aareinsel Altreu: Die rut- und Zugvögel im Jahr 206 Die Vegetation hat stark zugenommen, das Innere der Aareinsel ist vom Ufer aus kaum noch einsehbar,
Ökologische Aufwertung des Kantonalen Naturreservats Aareinsel Altreu: Die rut- und Zugvögel im Jahr 206 Die Vegetation hat stark zugenommen, das Innere der Aareinsel ist vom Ufer aus kaum noch einsehbar,
