Auf neuen Wegen. Journal der Leibniz-Institute MV ISSN Nr
|
|
|
- Meike Giese
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Leibniz Nordost Journal der Leibniz-Institute MV ISSN Nr Auf neuen Wegen LIKAT: Zero Carbon für das Klima IAP: Scharfer Blick per Radar FBN: Digitalisierung im Rinderstall INP: Biologische Effekte durch Plasma IOW: Phosphor im Meer: Lösung an Land
2 Editorial Editorial ial Liebe Leserinnen, liebe Leser! Stephen Hawking, der im März verstarb, verdanken wir einige der aufregendsten Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Universums. Die betreffen die sogenannten Schwarzen Löcher, die schon deshalb die Phantasie befeuern, weil Kosmologen sie sich als raumzeitliche Singularitäten vorstellen, ähnlich dem Zustand des Universums zum Zeitpunkt des Urknalls. Im Grunde ist es erstaunlich, dass Hawking sich so wenig mit der Philosophie vertrug. Wo doch die Grundfragen seiner Disziplin so philosophisch anmuten. Was war am Anfang? Wie sieht das Ende aus? Jedenfalls hatte Hawking schon 1988 in seinem Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit beklagt, wie unfähig die Philosophen seien, mit der Entwicklung naturwissenschaftlicher Theorien Schritt zu halten. Der Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn ( ) hatte Verständnis für die Abstinenz der Naturwissenschaft gegenüber der Philosophie. Wer im Labor zu viel hinterfrage, opfere der Reflexion seine wissenschaftliche Effizienz. Mag sein, dass das Philosophische an der Wissenschaft derzeit also vornehmlich für das Publikum von Interesse ist. Ich zumindest lasse mir gern von Wissenschaftshistorikern und -philosophen Ideen und Phänomene erklären. Und wie die Erkenntnisse in die Welt gelangen. Oft tun sie das nämlich als Abweichung von der Regel, als etwas höchst Unerwartetes, ja Störendes. Ein ungewöhnlicher Messwert, der wieder und wieder völlig danebenliegt. Eine logische Konsequenz, die so gar nicht zur geltenden Lehre passt. Solche Erfahrungen begegnen mir bei meinen Recherchen, auch an Leibniz-Instituten hier im Nordosten. Spannend werde es im Labor immer dann, sagte einmal ein Chemiker in Rostock, wenn etwas partout nicht gelingen will. So kommt das Neue in die Welt. Indem ich etwas Störendes, Unerklärliches erkenne und erst einmal aushalte. Samt dem Umstand, dass es für mich zunächst keinen Reim darauf gibt. Wissenschaftsphilosophen sprechen von einem Nichtwissen höherer Ordnung. Auch Kosmologen werden das kennen. Ihre Weltformeln enthalten nach eigenen Angaben etliche Schönheitsfehler. Oder nehmen wir den Urknall. Was war davor? Typische Laien- Frage! hieß es noch vor Jahren. Stephen Hawking sagte einst: Die Frage zu stellen sei so sinnlos, wie danach zu fragen, was nördlich vom Nordpol liege. Nun: Ganz so sicher ist sich seine Disziplin in diesem Punkt heute nicht mehr. Auch da erkunden Forscher neuen Wege. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre! Inhalt 2 - Editorial 3 - Grußwort 4 - Chemie und Klimaschutz: Zero Carbon 6 - Scharfe Radar-Bilder 8 - Digitalisierung im Rinderstall 10 - Spuren der Spezies biologische Effekte durch Plasma 12 - Zuviel Phosphor im Meer Lösungssuche an Land 14 - News aus den Instituten 17 - Bibliotheken der Zukunft 18 - Die Leibniz-Institute Mecklenburg-Vorpommerns 19 - Nachgefragt bei Ronny Brandenburg Titelbild: Doktorand Christoph Steinlechner vom LIKAT erprobt hier mit zwei Substanzgemischen einen Katalysator, der mittels Sonnenlicht das Klimagas CO 2 in hochwertige Grundstoffe umzuwandeln hilft. Diese Arbeiten zur Photokatalyse erfolgen im Instituts-Bereich Katalyse für Energietechnologien. Foto: nordlicht/likat Rückseite: Institutstierarzt Olaf Bellmann bei einer Routineuntersuchung der Rinder in den Tieranlagen des FBN in Dummerstorf. Foto: nordlicht/fbn 2
3 Editorial Editorial Liebe Leserinnen, liebe Leser, die aktuelle Ausgabe steht unter dem Motto: Wie kommt das Neue in die Welt? Diese allzeit spannende Frage richteten in ihrem gleichnamigen Buch die Autoren Heinrich von Pierer und Bolko von Oetinger Ende der 1990-Jahre an Spitzenmanager und Unternehmer, Wissenschaftler, Künstler und Politiker. Die Antworten fallen unterschiedlich aus, zeigen aber Gemeinsamkeiten: Das Neue braucht ein zum kreativen (Quer-) Denken ermutigendes Umfeld. Visionen werden dann zu Innovationen, wenn diese Lösungen für drängende Probleme in der Gesellschaft aufzeigen wenn also ein Bedarf an Neuem vorhanden und dessen Nutzung gewollt ist. Wie andere verantwortliche Politiker und Mitgestalter von Rahmenbedingungen für unsere gemeinsame Zukunft bin auch ich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und auf neue Denkansätze bei der Lösung von Herausforderungen angewiesen. In den Einrichtungen der Leibniz- Gemeinschaft wird Spitzenforschung auf gesichert hohem Niveau betrieben. Die Forscherinnen und Forscher sind dem Leibniz schen Motto theoria cum praxi verpflichtet die Kooperation von Praxis und Wissenschaft ist ein Garant für Erkenntnisgewinn und Innovation. Wie zahlreiche weitere Politiker im Bund und in den Ländern schätze ich diese wissenschaftliche Sachkenntnis. Die meisten Entscheidungen sind Abwägungen zwischen verschiedenen Aspekten zu einem Problem. Umso wichtiger ist es, die wissenschaftliche Expertise und Sachkenntnis in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern Die fünf in unserem Bundesland ansässigen Leibniz-Institute bieten diese wissenschaftliche Expertise und liefern Neues zur Gestaltung der Zukunft, wenn sie zu den vielschichtigen Themen etwa der Digitalisierung, der Kreislaufwirtschaft, der erneuerbaren Energien oder der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt forschen und neue Erkenntnisse gewinnen. Mein Ressort steht ebenso wie die gesamte Landesregierung dafür ein, insbesondere im Bereich der Forschung für das kreative Umfeld zu sorgen, das zur Lösung von Problemen und zur Entwicklung von Visionen vonnöten ist. Die Forschung ihrerseits hat die große Verantwortung, das entscheidende Neue zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit und unserer Region in die Welt zu bringen. Kreatives (Quer-)Denken ist dabei absolut erwünscht. Foto: Fotostudio Berger 3
4 Das Ziel: Zero Carbon Das Ziel: Zero Carbon Chemie und Klimaschutz: Das LIKAT entwickelt Verfahren für eine grüne Chemie, die in einem neuen Technikum für die Anwendung fit gemacht wird. Modell Von Regine Rachow Das LIKAT-Planungsteams für das Technikum Zero Carbon (v. l. n. r.): Andreas Schupp, Udo Armbruster, Jennifer Strunk, David Linke. Foto: nordlicht/likat. Grafik: Modell des Technikums (rechts auf der Grafik) vor dem LIKAT-Hauptgebäude, ein verglaster Gang wird beide verbinden. Grafik: LIKAT Das Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT) in Rostock wird seine Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung künftig unter eigenem Dach bis zur Praxisreife führen. In diesem Jahr soll zu diesem Zweck der Bau eines Technikums beginnen, gefördert mit 10 Millionen Euro hälftig aus Bundes- und Landesmitteln. Ab 2021 können LIKAT-Forscherinnen und -Forscher dann die Zuverlässigkeit ihrer Verfahren und Katalysatoren unter anwendungsnahen Bedingungen testen. Dabei geht es um eine grüne Chemie, die Ressourcen schont und zu CO 2 - neutralen Stoffkreisläufen verhilft. Zero Carbon unter diesem Titel laufen die Planungen für das Technikum. Ziel ist, Kohlenstoff (Carbon) nicht mehr aus fossilen Rohstoffen zu verwenden und somit den CO 2 -Fußabdruck der Zivilisation zu verkleinern. Die Kohlendioxid-Emission gilt als Hauptverursacher der Klimaerwärmung. LIKAT-Forscher Udo Armbruster vom Planungsteam, zu dem noch Jennifer Strunk, David Linke und Andreas Schupp gehören, sagt: Wir werden im Technikum Kohlenstoff auf klimaneutrale Weise für die chemische Industrie nutzbar machen. Und wir werden dazu Wasserstoff als Reaktionspartner verwenden. Grundstoffe aus grünen Quellen Konkret geht es um klimafreundliche Alternativen der Energiespeicherung, der Produktion von Kraftstoffen und der Gewinnung von Grundstoffen für die Chemie. Auch der Wasserstoff, der für solche Reaktionen gebraucht wird, soll künftig aus grünen Quellen stammen. Etwa aus der Weiterverarbeitung von Biomasse oder aus der Wasser-Elektrolyse mit Strom, der von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen kommt. Die chemische Nutzung nachwachsender Rohstoffe setzt große Mengen an Wasserstoff voraus. Pflanzen, Öle und Zellulose z. B. enthalten im Vergleich zu fossilen Rohstoffen sehr viel mehr Sauerstoff, der bei der Weiterverarbeitung stören würde. Er wird durch Zugabe von Wasserstoff entfernt. Udo Armbruster spricht von einem regelrechten H 2 -Hunger in der chemischen Industrie, der Raffinerieindustrie und zunehmend auch der Energiewirtschaft. Raffinerien verwenden derzeit schätzungsweise fünf bis zehn Prozent des Erdöls allein dafür Wasserstoff zu erzeugen, etwa für die Entschwefelung. Zusätzliche Grüne Quellen anzuzapfen könnte es regionalen Erzeugern von Elektroenergie aus Wind und Sonne ermöglichen, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und der Kohlenstoff? Der ist notwendig für die Produktion von Medikamenten, Kraftstoffen und Energie, Farbe und Reinigungsmitteln, Textilfasern, Kunststoff, Dünger. Bisher stammt er meist aus fossilen Rohstoffen. Und im Grunde wissen alle von den Chemie-Konzernen bis zur Politik, dass es so nicht weitergeht. Udo Armbruster weiß mit vielen Beispielen zu belegen, dass es auch anders gehen könnte. Kerosin für den Flieger Nehmen wir das Synthesegas, ein Gemisch aus H 2 und Kohlenmonoxid. Üblicherweise entsteht es durch Kohlevergasung oder aus Rohöldestillaten. Es 4 Leibniz Nordost
5 Zwei technische Anlagen, die im LIKAT entworfen und gebaut wurden. In ähnlicher Gestalt, aber wesentlich größer, werden sie auch im neuen Technikum zu Testzwecken aufgestellt werden. Fotos: nordlicht/likat ließe sich jedoch ebenso gut durch die Reaktion von Methan mit CO 2 herstellen, die beide in Biogasanlagen anfallen. Eine andere nachhaltige Variante wäre die Nutzung von Biomasse analog zur Kohlevergasung. Um Kohlenstoff zu gewinnen, könnte man Synthesegas überdies sehr effizient zu Methanol umwandeln, einem der wichtigsten chemischen Grundstoffe für weitere Synthesen. Auch langkettige Kohlenwasserstoffe könnten aus nachhaltig erzeugtem Synthesegas entstehen, etwa für die Produktion von Kerosin. Ein hochaktuelles Thema, denn die Luftfahrt verzeichnet stetige Zuwächse. Eine solche grüne Chemie erfordert völlig neue Prozesse und Technologien, sagt Udo Armbruster. Das LIKAT arbeitet an geeigneten Katalysatoren dafür. Und ein jeder der Reaktionsschritte, die für diese Prozesse nötig sind, braucht einen eigenen Katalysator. In diesem Falle werden es heterogene Katalysatoren sein. Im ersten Entwicklungsstadium werden diese üblicherweise in Form von Pulver in einem kleinen Rohrreaktor dem Gas-Strom ausgesetzt werden. Wir arbeiten dazu im Labor oft mit Mengen im Milligrammbereich, die auf einen kleinen Fingernagel passen, erläutert Udo Armbruster. Die Reaktorröhrchen seien mitunter nicht viel größer als ein Kugelschreiber. Bis zum Tonnen- Maßstab in der Industrie dort arbeiten Rohrbündelreaktoren mit tausenden Rohrreaktoren oder bis zu 20 Meter hohe Reaktorkolonnen erscheint es ein riesiger Schritt, und genau dafür braucht es das Technikum. Partner auch für KMU Im Großmaßstab taugen die Pülverchen nach den Worten von Udo Armbruster wenig, sie würden die Reaktoren verstopfen und für Druckverlust sorgen. Die Industrie arbeitet deshalb mit Katalysatoren beispielsweise in Tablettenform, das gewährleiste einen kontinuierlichen chemischen Prozess. Wenn eine Forschungsgruppe am LIKAT ihren neuen Katalysator im Labor erfolgreich getestet hat, dann wird das Pulver zu Tabletten oder Granulat gepresst und für die Erprobung in Pilotanlagen vorbereitet. Die arbeiten bereits im Kilogramm-Maßstab. Zum Alleinstellungsmerkmal des LI- KAT zählt, dass Jahr für Jahr zwei bis drei innovative Verfahren aus dem Institut bis zur Anwendungsreife gelangen, indem sie in Pilotanlagen von Industriepartnern getestet werden. Das sind meist große Chemie-Konzerne, denn kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verzichten aus wirtschaftlichen und Kapazitätsgründen gemeinhin auf solche Technika. KMU sind für das LIKAT jedoch wichtige Kooperationspartner. Mit einem eigenen Technikum macht sich die Rostocker Katalyseforschung nun noch attraktiver für diese Unternehmen. Und sie kann vor allem viel mehr Ideen als bisher aus ihrer Grundlagenforschung bis zur Praxisreife führen. Gesellschaftliche Motivation Der letzte Schritt zu den Großtonnagen ist dann nur noch klein. Denn das eigentliche Knowhow entsteht im Labor und in den eigens dafür errichteten Pilotanlagen, die am künftigen LIKAT-Technikum bis zu 10 Meter Höhe einnehmen können. Wenn ein Verfahren dort seine Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt hat, dann hat es bereits 90 Prozent des Weges bis zum fertigen Industrieprodukt geschafft. Matthias Beller, Direktor des LIKAT, verweist auf die Rahmendaten des Weltklimagipfels, die Deutschland leider gerissen hat. Wir wissen, dass die Wissenschaft eine gesellschaftliche Verantwortung hat und dass wir hier etwas beizutragen haben, die Klimakonvention womöglich doch noch zu verwirklichen. Wir entwickeln gerade die Technologien dafür. Wissenschaftlicher Ansprechpartner: Dr.-Ing. Udo Armbruster udo.armbruster@catalysis.de Telefon:
6 Scharfe Radar-Bilder de Scharfe Radar-Bilder ar-bilde IAP verbessert Radarsysteme zur Analyse ionosphärischer Unregelmäßigkeiten. Von Jorge L. Chau und J. Miguel Urco Die Autoren Jorge L. Chau (links) und Miguel Urco bei der Diskussion des MIMO-Konzepts für MAARSY-Anlage in Nord-Norwegen. Foto: Maosheng He, IAP Für die Aufklärung dynamischer Prozesse in der Atmosphäre entwickelt das IAP in seiner Radar-Abteilung modernste Messsysteme mit hoher Auflösung. Herkömmlich werden beim atmosphärischen Radar ein Sender und mehrere Empfangsantennen eingesetzt, um räumliche und zeitliche Genauigkeit der Daten im Messbereich zu verbessern. Inzwischen nutzen wir ein neuartiges Radarverfahren, das als kohärentes Mehrgrößen- oder MIMO- System (MIMO = Multiple Input Multiple Output) bezeichnet wird. Auch hier werden mehrere Antennen eingesetzt. Doch anders als bisher strahlt jede Sendeantenne unabhängig von den übrigen Sendeantennen eine beliebige Wellenform aus. Diese Signale können von jeder Empfangsantenne im System empfangen werden. Dadurch ergeben sich zusätzliche virtuelle Empfangselemente, also im Grunde unzählige Antennen. Diese virtuelle Anordnung ermöglicht eine höhere räumliche Auflösung als frühere Standardsysteme. Wir nutzen mehrere Methoden, um mit atmosphärischen Radarsystemen solche voneinander unabhängigen Sendewellenformen zu erzeugen. Und wir haben erste Ergebnisse der Anwendung des kohärenten MIMO-Systems auf atmosphärische Ziele. Dazu zählen äquatoriale ionosphärische Unregelmäßigkeiten. Konzept und Umsetzung Sind Sender und Empfänger fast nebeneinander angeordnet oder befindet sich das Ziel im Fernfeld, so bezeichnet man die MIMO-Konfiguration als kohärentes MIMO-System. Das Ziel der Beobachtung sind physikalische Objekte, wie freie Elektronen oder Dichteschwankungen in der Luft, die die ausgesandten elektromagnetischen Wellen streuen. Die Signale werden von den Empfängern registriert, sie enthalten Informationen über die Streueigenschaften des jeweiligen Ziels sowie seine Position. So ist es möglich, Punkt für Punkt dreidimensionale Ziele abzutasten (siehe Abb. 1). Zur Umsetzung einer MIMO-Konfiguration muss ein separater Zugang zu räumlich getrennten Antennen gewährleistet sein, und auch die Sendewellenformen müssen voneinander unabhängig sein, d. h. beim Senden ist eine gewisse Variabilität erforderlich. Je nach den physikalischen Eigenschaften des Ziels können unabhängige Wellenformen durch Variierung der Zeit, der Frequenz, der Polarisierung und der Pulsfolge erzeugt werden. Das Ziel kann z. B. unterschiedlich auf die beiden Schwingungsebenen der elektromagnetischen Welle des Radars reagieren, was dann unterschiedliche Signale in den Empfängerantennen hervorruft. Die Ableitung der Informationen aus den empfangenen Signalen, etwa zur räumlichen Lage und den physikalischen Eigenschaften des Ziels, ist Aufgabe der mathematischen Auswertung. Ionosphärische Unregelmäßigkeiten Wir haben erstmals kohärente MIMO- Konfigurationen im Jicamarca-Radioobservatorium (JRO) in Lima (Peru) eingesetzt. Angesichts der hervorragenden technischen Bedingungen vor Ort richteten wir im Mai 2017 drei verschiedene Arten der Sendevarianz ein, um Unregelmäßigkeiten des äquatorialen Elektrojets (Equatorial Electrojet, EEJ) zu untersu- 6 Leibniz Nordost
7 chen. Bei diesem Phänomen handelt es sich um ein Starkwindband, das aus freien Elektronen besteht, die von der Sonne ionisiert und im elektrischen Feld der Erde beschleunigt werden. Normalerweise strömt der EEJ also auf der Tagseite der Erde in 100 bis 130 km Höhe entlang des Äquators. Sein Einfluss lässt sich im Magnetfeld in Bodennähe nachweisen. Die Signale, die wir messen, haben jedoch nicht nur einen Tagesgang, sondern sie zeigen auch Unregelmäßigkeiten. Mit der MIMO-Konfiguration konnten nun sowohl Modulationen des EEJ durch die Sonneneinstrahlung als auch durch Gezeiten nachgewiesen werden. In allen drei Fällen der Messkampagne setzten wir zwei räumlich getrennte Sender und vier Empfänger ein. Die Radaraufnahmen, die mittels SIMO und MIMO mit zeitlicher Varianz erfolgten, sind in Abbildung 2 dargestellt. Die besten Ergebnisse werden mit MIMO und einem ganz bestimmten statistischen Verfahren erzielt, das wir MaxEnt nennen. Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass sich die räumliche Auflösung atmosphärischer und ionosphärischer Unregelmäßigkeiten, die mit Radaren beobachtet wurden, durch die kohärente MI- MO-Konfiguration tatsächlich verbessern lässt. Das ist das Hauptergebnis einer Doktorarbeit (von Miguel Urco, Doktorvater: Jorge L. Chau, d. R.). Die technischen und mathematischen Herausforderungen wurden so exzellent gelöst, dass die ersten Ergebnisse in den weltweit vielbeachteten IEEE-Transactions veröffentlicht wurden. In den kommenden Jahren beabsichtigen wir, MIMO-Ansätze auf weitere atmosphärische Radarziele anzuwenden. Die ersten Tests mit dem IAP-Radarsystem in Nordnorwegen, MAARSY, zur Beobachtung sogenannter mesosphärischer Sommerechos verlaufen vielversprechend (siehe Abb. 3). Abb. 1 (Links): Radar-Diagramm mit MIMO-Konfiguration. Bei SIMO-Konfigurationen lassen sich Winkeldaten des Ziels ermitteln, indem die Daten der beiden Empfangsantennen zu dem von einem Sender beleuchteten Ziel miteinander kombiniert werden. Dies ist die herkömmliche Vorgehensweise. Bei zwei räumlich getrennten Sendern mit unabhängigen Wellenformen können die Winkeldaten mithilfe eines einzelnen Empfängers (MISO) ermittelt werden, d. h. durch Kombination der Daten des Empfängers mit jedem einzelnen Sender. Die MIMO-Konfiguration ist eine Mischform aus den beiden Konfigurationen. Abb. 2 (Oben): Ergebnisse der kohärenten MIMO-Konfiguration für Unregelmäßigkeiten bei äquatorialen Elektrojets. Jede Grafik zeigt einen Schnappschuss der EEJ- Unregelmäßigkeiten mit Zeitangabe, zonalem Abstand und Höhe. Die Farben enthalten Informationen zu unterschiedlichen Parametern. Rot steht für Objekte, die sich schnell auf das Radar zubewegen, Blau für Objekte, die sich schnell vom Radar wegbewegen, und Grün für langsame Objekte. In der linken Spalte wurden SIMO-Daten und in der rechten Spalte MIMO-Daten benutzt. Die obere Zeile zeigt das Ergebnis der Auswertung mit Capon, die untere mit MaxEnt, das sind zwei unterschiedliche statistische Auswertungsverfahren. Grafiken: M. Urco, IAP Abb. 3: Plan der Verteilung der Empfänger für die MAARSY-Anlage in Nord-Norwegen. Die Farbe gibt die Anzahl der vom Zielobjekt zufällig zurückgestreuten Radarstrahlen an. Für SIMO sind das maximal 12, für MIMO maximal 25. Das und die schiere Anzahl der Empfänger trägt zu besser aufgelösten Verteilungen bei. Grafik: M. Urco, IAP Wissenschaftlicher Ansprechpartner: Prof. Prof. J. L. Chau chau@iap-kborn.de Telefon:
8 Digitalisierung im Rinderstall Digitalisierun italisierun isierun ierun Neue Technologien zur automatischen, tierindividuellen Erfassung des Verhaltens im Laufstall Abb. 1: Doktorandin Borbála Fóris legt einer Kuh ein Halsband mit einem UWB-Sender an, eine Art GPS für drinnen (unten am Halsband ein Transponder). Fotos: Melzer, FBN Von Nina Melzer und Jan Langbein Nicht nur in unserem Zuhause wird alles smarter. Auch im Zuhause der Nutztiere hält die Digitalisierung unter dem Stichwort Precision Livestock Farming Einzug. Dabei kommen immer mehr Verfahren zum Einsatz, die verschiedene tierbezogene Parameter und Daten zum Tierverhalten automatisch erfassen und eine Verarbeitung in digitalisierter Form ermöglichen. Beispiele im Bereich der Rinderhaltung: die Detektion von Gangunterschieden mittels videobasierten Bildauswerteverfahren oder Bodensensoren zur Erkennung von Lahmheiten, die detaillierte Erfassung des Futteraufnahmeverhaltens mittels computergesteuerter Fress-Wiegetröge und Radio Frequency Identification (RFID) Technologie und die tierindividuelle, kontinuierliche Positionsbestimmung der Tiere im Stall in Echtzeit mittels Ultraweitband (UWB)-Tracking Technologie, eine Art GPS für drinnen. Digitale Daten erlauben es, eine Vielzahl von Tieren simultan zu überwachen, und zwar mit einem geringen manuellen Arbeitsaufwand. Aus den Daten können objektive Parameter und Kriterien zur Beurteilung des Produktionsprozesses und der Tiergesundheit und auch des Tierwohls abgeleitet werden, ohne dass dies zusätzlichen Stress für die Tiere bedeutet. Komplexe Sozialbeziehungen Ein Einsatzgebiet in der Rinderhaltung, das bei der Digitalisierung in letzter Zeit in den Fokus gerückt ist, stellt die Registrierung des raumzeitlichen Verhaltens des Einzeltieres und die darauf basierende Analyse komplexer sozialer Strukturen in der Herde dar. Rinder sind soziale Tiere. In ihren Gruppen gibt es sowohl stabile dyadische als auch komplexere soziale Beziehungen, die sich unter anderem mittels Rangpositionen für die einzelnen Tiere beschreiben lassen. In modernen Rinderlaufställen wird den Tieren die Etablierung solcher sozialen Beziehungen in Gruppen mit unterschiedlicher Tieranzahl ermöglicht. Allerdings werden die Gruppen im Rahmen des Managements häufig um- oder neugruppiert, meistens um homogene Gruppen zu bilden, etwa um Tiere mit ähnlicher Produktionsleistung oder ähnlichem Trächtigkeitsstadium zusammenzustellen. Dies hat zur Folge, dass die sozialen Beziehungen in den Gruppen aufgebrochen bzw. neue Beziehungen aufgebaut werden müssen. Dabei kann es vermehrt zu agonistischen Interaktionen und Kämpfen kommen, was wiederum sozialen Stress bewirkt, mit negativen Auswirkungen auf Produktivität, Gesundheit und somit letztlich auf das Tierwohl. Raumzeitliches Verhalten Eine wesentliche Voraussetzung zur Beurteilung von Tiergesundheit und Wohlbefinden ist die kontinuierliche Identifizierung und Erfassung des Verhaltens von Einzeltieren im Stall. In den heutzutage üblichen großen Tierbeständen kann dies nur über neue automatische Systeme erfolgen. Ein Beispiel ist der Einsatz von digitalen Videokameras, die es ermöglichen solche Daten auch computergestützt auszuwerten. Mittels komplexer Analyseverfahren (z. B. real-time compressive tracking) wird die Position jedes einzelnen Tieres im Stall mit hoher zeitlicher Auflösung bestimmt und darauf basierend werden verschiedene Aspekte des Verhaltens (Aktivität, Inaktivität, Liegen, Fressen, Gangprobleme etc.) abgeleitet. 8 Leibniz Nordost
9 Verschiedene Systeme wurden im wissenschaftlichen Einsatz erfolgreich getestet, u. a. auch bei Schweinen und Hühnern. Neben Verfahren des Videotracking kommen vor allem funkwellenbasierte Systeme zur Tierüberwachung im Stall zum Einsatz. Dazu zählt die RFID-Technologie: Durch Stalleinbauten (die oft metallisch sind) kann es zu Detektionsstörungen kommen, was zu längeren Ausfallzeiten oder auch zu höheren Ungenauigkeiten der Positionsbestimmung (mehr als die 30 cm als vom Hersteller angegeben) in bestimmten Stallbereichen führt. Positionsdaten für die Analyse des komplexen Sozialverhaltens evaluiert werden. Langzeitdaten für das Tierwohl In einem ersten Ansatz konnten wir unter Nutzung der Daten von den Fress-Wiege- Abb 2: Screenshot einer Rindergruppe (links) und Trackingdaten derselben Gruppe über eine Minute (rechts). Die roten Markierungen im rechten Bild zeigen die aktuellen Positionen der Kühe auf dem Screenshot. Grafik: Melzer, FBN Informationen zwischen Sendern am Tier und festinstallierten Empfangsstationen im Stall werden über Radiowellen ausgetauscht. Für automatische Melksysteme oder Futtersysteme zum Beispiel werden bereits kommerzielle Lösungen angeboten (z. B. GrowSafe ). Andere Echtzeit-Lokalisationssysteme für Innenräume nutzen UWB-Funkwellen (z. B. Ubisense ). Auch beim UWB-Tracking wird ein Sender, auch Tag genannt, am Tier befestigt (s. Abb. 1), dessen Position dann kontinuierlich durch Antennen im Stall bestimmt wird. Auch hierfür gibt es kommerzielle Software-Lösungen, welche Analysen von räumlichem tierindividuellen Verhalten erlauben (z. B. TrackLab, CowView). Auswertung von Positionsdaten Erste Veröffentlichungen zur Nutzung von UWB-Technologie im Rinderstall gibt es bereits, wobei der Fokus auf Anwendbarkeit und Genauigkeit der Technologie liegt. Dabei werden anhand der UWB- Positionsdaten Zonen bestimmt, in denen sich die Tiere aufhalten (z. B. Liegebereich, Futterbereich, s. Abb. 2) und diese dann wiederum mit anderen Ortungssystemen oder auf RFID-Technik beruhenden Lokalisierungen verglichen. Inwieweit diese Technologie für die Analyse komplexer Verhaltensweisen in der Herde wie soziopositiver und sozionegativer Interaktionen und somit für die Ableitung relevanter Parameter zur automatisierten Beschreibung des Sozialverhaltens von Rindern nutzbar ist, wird als ein Forschungsschwerpunkt von der Nachwuchsgruppe Phänotypisierung des Tierwohls im Institut für Genetik und Biometrie (finanziert von BMBF/FBN) untersucht und zwar in enger Kooperation mit dem Institut für Verhaltensphysiologie am FBN. Hierfür wurden vor Ort exzellente Voraussetzungen geschaffen. Im Laufstall der Experimentalanlage Rind installierten wir neben automatischen Fress-Wiege- Trögen ein Echtzeit-Lokalisationssystem (Ubisense ). Parallel überwachen Videokameras den gesamten Stallbereich. Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts werden die Daten der verschiedenen Systeme simultan aufgezeichnet. Dies bildet zum einen eine geeignete Datengrundlage, um computergestützte Auswertungsprogramme zu entwickeln und den Einfluss verschiedener Filterungsansätze auf die Positionsdaten zu untersuchen. Andererseits kann durch den Abgleich mit Video- und Fressdaten die Eignung der Trögen zeigen, dass es möglich ist, sozionegative Interaktionen am Fressplatz basierend auf UWB-Positionsdaten mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. Inwieweit etwa auch soziopositive Interaktionen anhand von automatisch generierten Positionsdaten detektiert werden können, soll im Projekt untersucht werden. Wir hoffen, mit unserer Forschung das generelle Verhalten von Rindern und insbesondere ihr komplexes Sozialverhalten weitgehend automatisiert und basierend auf Langzeitdaten viel detaillierter beschreiben zu können als es bisher möglich war. Ein besseres Verständnis der Tiere und ihres Verhaltens ist die Voraussetzung für ein besseres Management und mehr Tierwohl. Wissenschaftliche Ansprechpartner: Dr. Nina Melzer Telefon: Dr. Jan Langbein Telefon:
10 Spuren Spezies der Spuren der Am INP wird untersucht, welche biologischen Effekte durch Plasma ausgelöst werden Farbstoffassays sind altmodisch richtig eingesetzt aber Gold wert: Mit diesem Test wird atomarer Sauerstoff in plasmabehandelten Flüssigkeiten nachgewiesen. Von Henning Kraudzun Es sind kleinste Teilchen, die Kristian Wende an einer Nanoquelle erzeugt: In einem elektrischen Feld werden flüssige Proben zerstäubt, es entstehen Ionen. Diese elektrisch geladenen Winzlinge untersucht der Greifswalder Forscher anschließend in einem Massenspektrometer. Ein Detail, um mehr über die Wirkung von Plasmen auf Flüssigkeiten oder menschliche Zellen zu erfahren. Unstrittig ist mittlerweile, dass Plasma, der energiegeladene Mix aus Atomen, Ionen, Elektronen und Molekülen, eine heilende Wirkung auf chronische Wunden und andere Hauterkrankungen entfaltet. Allerdings müssen viele der zugrundeliegenden biochemischen Prozesse noch entschlüsselt werden. Im Blickpunkt stehen insbesondere reaktive Spezies Atome oder Moleküle mit einem ungepaarten Elektron beziehungsweise einer instabilen elektronischen Struktur. Wer passiert die Grenzschicht? Wende, studierter Pharmazeut, leitet seit gut einem Jahr eine Nachwuchsforschergruppe am Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK) plasmatis, angesiedelt im Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Hochaufgelöste Massenspektrometrie ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Analytik am INP Greifswald. Hier nutzt Kristian Wende eine Nano-Elektrosprayquelle, um Modifikationen an Proteinen zu messen. Fotos: Henning Kraudzun Technologie (INP). Sie beschäftigt sich mit Plasma-Flüssigkeits-Effekten also der Interaktion von kalten Plasmen mit Flüssigkeiten und Gewebeschichten. Seit Jahren schon werden in Kliniken und Arztpraxen plasmamedizinische Geräte eingesetzt, die am INP entwickelt wurden. Bekannt ist vor allem der handliche kinpen Med. An der Spitze dieses Plasma-Jets leuchtet eine bläuliche Flamme, die punktgenau über die Haut streicht. Die an unserem Institut entwickelten Applikationen waren schneller auf dem Markt, als wir gedacht haben, sagt Wende. Jetzt gehe es darum, die Wirkungsweise noch besser zu verstehen. Erst wenn klar ist, welche Spezies die gewünschten Effekte erzielen, können spezifische Plasmaquellen für therapeutische Anforderungen entwickelt werden. Zusammen mit seinen Kollegen geht der Forscher nunmehr der Frage nach, welche mit Plasmen erzeugte Spezies die Grenzschicht zu einer Flüssigkeit und letztlich zu den Zellen durchdringen können. Vor allem angeregte Sauerstoff- und Stickstoffverbindungen gelten als Hauptträger der biologischen Effektivität und spielen bei einer Vielzahl von körpereigenen Prozessen, etwa der Immunabwehr, eine entscheidende Rolle. Die Wissenschaftler wollen mit vielerlei Hilfsmitteln den kleinsten Einheiten des Organismus noch mehr Geheimnisse entlocken. Trotz gewaltiger Fortschritte könne man Zellen immer noch als Blackbox bezeichnen, erklärt der INP- Mitarbeiter, der bereits in Großbritannien und in den USA geforscht hat. Es gibt unglaublich viele Signalwege, von denen wir bislang noch nichts wissen. Die Spurensuche ist schwierig: Laut Schätzungen existieren mehr als eine Million unterschiedliche Proteinmoleküle im menschlichen Körper. Entsprechend vielfältig sind die möglichen Interaktio- 10 Leibniz Nordost
11 1200 bar Druck zumindest in den Kapillaren helfen zu verstehen, was beim Wechselspiel zwischen einem Atmosphärendruckplasma und einer Flüssigkeit passiert. Grafisches Element links: Stilisierte Computerdarstellung einer Zelle. Grafik: Carsten Desjardins Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK) plasmatis Das ZIK plasmatis wurde 2009 gegründet und vereint Expertisen aus Physik, Biochemie, Pharmazie, Biologie und Medizin. Die am INP Greifswald angesiedelte Einrichtung kombiniert interdisziplinäre Grundlagenforschung innerhalb der Plasmamedizin. Auf diesem Gebiet hat sich das ZIK plasmatis in den vergangenen Jahren zu einem internationalen Themenführer entwickelt. Mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entstanden dort seit 2016 zwei neue Nachwuchsforschergruppen, die sich mit Plasma-Flüssigkeits-Effekten (FKZ: 03Z22DN12) und Plasma-Redox-Effekten (FKZ: 03Z22DN11) beschäftigen. In beiden Gruppen arbeiten jeweils sechs junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. nen zwischen diesen. Zudem produzieren kalte Plasmen eine Vielzahl reaktiver Spezies, etwa Ionen des Trägergases, freie Elektronen sowie ionische und neutrale Zustände von Heteroatomen beziehungsweise der daraus entstehenden Moleküle. Verschiedene Zustände des Sauerstoffs wie Singulet-Sauerstoff oder Superoxid- Radikale zählen dazu. Es ist ein großer Baukasten, sagt Wende. Ein Schlüsselmolekül? Die bisherigen Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass einige Schräubchen aus diesem Baukasten nur den Bruchteil einer Sekunde überleben und demzufolge nur schwer nachweisbar sind. Andere Spezies, wie Wasserstoffperoxid, könnten zwar über definierte Poren in der Zellmembran die Lipidschichten durchdringen, würden aber im Zellinneren sofort ausgelöscht, erläutert Wende. Für die Forschergruppe ist unter anderem das Stickstoffmonoxid (NO) von großem Interesse, ein Radikal mit immenser Bedeutung in der Physiologie. NO kann sich an Rezeptoren auf der Zelloberfläche binden, wodurch eine Signalkaskade in Gang gesetzt wird, die neben muskulären Effekten viele Prozesse in der menschlichen Haut reguliert. Daneben kann es zu chemischen Veränderungen an Proteinen kommen, insbesondere an chemisch reaktiven Aminosäuren wie das Tyrosin oder das Cystein. Die Rolle dieser post-translationalen Proteinmodifikationen muss noch aufgeklärt werden. Sicher ist, dass es neben der Speicherung des NO auch um eine Veränderung von Enzymaktivitäten geht. Mit einem gestörten NO-Signaling wiederum werden Wundheilungsstörungen und Hautkrebs, aber auch Volkskrankheiten wie Schuppenflechten (Psoriasis), in Verbindung gebracht. Dieses Molekül könnte ein Schlüssel sein, mit dem wir Parameter finden, um die Wirkung von Plasmaquellen vorauszusagen, erklärt Wende. Im Visier: multiresistente Keime Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die ZIK-Nachwuchsforscher eine zweite Arbeitsgruppe ergründet den Einsatz von Plasma in der Krebstherapie über fünf Jahre mit insgesamt 9,7 Millionen Euro. Gelingt ihnen im Zusammenspiel, Tumorzellen durch freie Radikale zu zerstören und gleichzeitig wieder für das Immunsystem sichtbar zu machen es wäre der Durchbruch. Die Voraussetzungen am ZIK sind ideal: Biologen, Chemiker, Pharmazeuten, Physiker und Ingenieure arbeiten unter einem Dach zusammen, wodurch neue Anwendungen der noch jungen Plasmamedizin mit interdisziplinärem Know-how erschlossen werden. Wir können zum Beispiel die Redoxbiologie mit physikalischen Plasmaquellen verknüpfen, das ist einmalig, betont Wende. Zudem gilt kaltes Plasma als entscheidendes Mittel, um die Ausbreitung von multiresistenten Erregern einzudämmen. So warnen Experten seit Jahren vor einer schleichenden Epidemie. Klinische Studien verliefen bereits erfolgreich. Allerdings müssen unerwünschte Effekte ausgeschlossen werden: Plasma darf die Keime nicht so verändern, dass sie noch weniger empfindlich auf Antibiotika reagieren. Jedoch gibt es darauf bislang keine Hinweise. Das seien große Ziele, sagt Wende. Im Schnelldurchlauf werden wir die noch offenen Fragen nicht lösen können. Es geht nur in kleinen Schritten. Wissenschaftlicher Ansprechpartner: Dr. Kristian Wende inp-greifswald.de Telefon:
12 Zuviel Phosphor im Meer Zuviel Phosphor hor im Beim IOW erfolgt die Lösungssuche auch an Land. Inga Krämer (links), Monika Nausch und Günther Nausch suchen nach Möglichkeiten, die Phosphor-Zufuhr in die Ostsee zu reduzieren. Foto: S. Kube, IOW Von Barbara Hentzsch Wenn im Hochsommer die Blaualgenblüte ihren Höhepunkt hat, bedecken gelbbraune Teppiche weite Bereiche der Ostsee. Foto: IOW Isaac Asimov, der für seine Science-Fiction Romane bekannte russisch-amerikanische Biochemiker, brachte es in den 1970er Jahren auf einen kurzen Nenner: Wir können vielleicht Kohle durch Kernenergie ersetzen und Holz durch Plastik [...], aber es gibt keinen Ersatz für Phosphor. Heute, vierzig Jahre später, wissen wir, dass er Recht damit tat das relativierende vielleicht zu benutzen: weder Kernenergie noch Plastik erwiesen sich als wirkliche Alternativen. Und doch ist eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten entstanden oder in Entwicklung. Nach wie vor gilt jedoch ultimativ: wir haben keine Alternativen zu Phosphor! Dabei ist Phosphor für alles Leben auf der Erde essentiell. In der Landwirtschaft spielt er deshalb eine entscheidende Rolle als nicht ersetzbarer Bestandteil von Dünger. Soweit so gut. Nun verfügen jedoch viele bevölkerungsreiche Länder, wie Indien, und auch die Europäische Union, wenn überhaupt, nur über kleine Phosphor-Lagerstätten. Sie sind auf eine Versorgung ihrer Landwirtschaft aus dem Ausland angewiesen. Die meisten der bekannten Phosphor- Lagerstätten liegen aber in geopolitisch schwierigen Regionen wie Algerien, Syrien oder Marokko schlechte Voraussetzungen für eine geregelte Versorgung mit dem lebensnotwendigen Nährstoff! Gebündelte Expertise im LeibnizCampus In Rostock begegnet der Leibniz-WissenschaftsCampus Phosphorforschung dem Dilemma mit einem multidisziplinären Ansatz: ForscherInnen aus den Bereichen Nutztierbiologie, Agrarwissenschaft, Umwelt- und Meeresforschung sowie Chemie suchen unter anderem nach Möglichkeiten den Phosphor-Einsatz in der Landwirtschaft so gering und wirkungsvoll wie möglich zu gestalten. Die MeeresforscherInnen des IOW haben dabei einen besonderen Blick auf das Thema: Sie sorgt der Phosphor- Überschuss in der Ostsee, der zu ihrem größten Umweltproblem führt: der Überdüngung. Monika Nausch, Biologin am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, untersucht die Konsequenzen: Eine drastische Folge sind die sommerlichen Blaualgenblüten. Sie sorgen regelmäßig für Schlagzeilen, weil sie zur besten Badesaison wachsen und das in solchen Massen, dass die von ihnen abgesonderten Giftstoffe für Badende schädliche Konzentrationen annehmen. Cyanobakterien, wie Blaualgen wissenschaftlich korrekt heißen, brauchen wie alle Organismen Phosphor und Stickstoff. Im Unterschied zu ihren Nahrungskonkurrenten sind sie aber in der Lage, ihren Stickstoff-Bedarf über den unbegrenzt verfügbaren atmosphärischen Stickstoff zu decken. Folglich hängt ihr Wachstum nur davon ab, dass sie genügend Phosphor bekommen. Und diesen bieten wir Menschen ihnen im Überschuss an. Neben dem negativen Effekt, den das Massenauftreten von Blaualgen für den Tourismus hat, gibt es einen weiteren gravierenden, ökologischen Effekt, berichtet Monika Nausch: Abgestorbene Blaualgen sinken massenhaft auf den Meeresboden, wo bei ihrer Zersetzung Sauerstoff verbraucht wird. Die toten Zonen am Meeresboden breiten sich aus! Ostseeanrainer wollen reduzieren Angesichts dieser Dramatik hat sich die Bundesrepublik Deutschland gemein- 12 Leibniz Nordost
13 Weitere als die hier beschriebenen Aspekte von PhosWaM werden durch Partner an der Universität Rostock, dem Unternehmen biota Institut für ökologische Forschung und Planung sowie dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bearbeitet. Das Projekt PhosWaM wird vom BMBF im Rahmen der Maßnahme Regionales Wasserressourcenmanagement für nachhaltigen Gewässerschutz in Deutschland (ReWaM) gefördert. Lisa Genn (links) und Lisa Felgentreu bei der Probenahme auf der Warnow. Für jeden Standort müssen die Begleitparameter erfasst werden. Foto: Christoph Kamper sam mit den übrigen Ostseeanrainerstaaten im Baltic Sea Action Plan verpflichtet, bis zum Jahr 2021 das Problem der Überdüngung in den Griff zu bekommen. Momentan sieht es jedoch nicht so aus, als ob dies gelänge. Günther Nausch hat am IOW über 20 Jahre lang die Nährstoff-Konzentrationen in der Ostsee ermittelt. Wie kein Zweiter kennt er die Entwicklung: Die Daten der letzten 5 Jahre, wie sie erst kürzlich von der Helsinki Kommission veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Einleitung von Stickstoff und Phosphor in die Ostsee zurückgegangen sind. Insgesamt sind 13 % weniger Stickstoff und 19 % weniger Phosphor in die Ostsee eingeleitet worden. Trotzdem können wir keine Verringerung der Nährstoff-Konzentrationen im Oberflächenwasser erkennen. Ursache sind Umweltsünden, die lange zurückliegen und dazu geführt haben, dass in den Sedimenten der Ostsee hohe Phosphorreserven gespeichert wurden. Gleichzeitig sind die Einleitungen wenn auch reduziert so doch immer noch auf einem zu hohen Niveau. Weitere Möglichkeiten einer Phosphor-Reduktion bei der Einleitung sind also dringend auszuloten. Was passiert an Land? Seit rund zwei Jahren arbeitet ein Projektkonsortium daran, am Beispiel des Einzugsgebietes der Warnow Stellschrauben für die Phosphor-Reduktion zu finden. In dem BMBF-geförderten Projekt PhosWaM (Phosphor von der Quelle bis ins Meer Integriertes Phosphorund Wasserressourcenmanagement für nachhaltigen Gewässerschutz) wird die gesamte Fließstrecke von der Quelle bis in die Ostsee betrachtet. Am Ende sollen über Computermodelle die wichtigsten Phosphor-Quellen und damit auch mögliche Reduktionsmaßnahmen gefunden werden. Funktionieren kann das nur, wenn man die wichtigsten Prozesse im Phosphorkreislauf des Warnowsystems verstanden hat. In PhosWaM werden deshalb unter anderem Prozessstudien zu Quellen, Transportwegen, Umsatzprozessen und Fraktionen des Phosphors durchgeführt. Phosphor kommt in unseren Gewässern in den Fraktionen Phosphat sowie gelöster organischer und partikulärer Phosphor vor, wobei jede Fraktion in eine der anderen umgewandelt werden kann. Dies geschieht ständig, so dass sich die Zusammensetzung des Phosphor-Pools entlang der Fließstrecke im Einzugsgebiet mehrfach ändern kann. Regelmäßig gemessen werden aber nur der Gesamt-Phosphor-Gehalt und die Phosphat-Fraktion. In PhosWaM werden nun auch die anderen Fraktionen und ihr Eutrophierungspotential berücksichtigt. Akribisch wird an 10 Stationen im Verlauf der Warnow bis zur Schleuse und 10 weiteren im Übergangsbereich von der Schleuse bis in die Ostsee untersucht, in welchen Formen Phosphor vorliegt, wo Umwandlungen von der einen in die andere Fraktion stattfinden, wie unterschiedlich die Bioverfügbarkeit der einzelnen Fraktionen ist und wie der Phosphor-Speicher in den Sedimenten aussieht. Rückhalt durch Vegetation Inga Krämer, Leiterin des Gesamtprojektes, liegen konkrete Maßnahmen, wie die Offenlegung verrohrter Fließgewässer (allein 950 km im Warnow-Einzugsgebiet), am Herzen. Während in einem offen fließenden Bach die Vegetation und das Sediment dafür sorgen, dass im Wasser befindliche Phosphor-Verbindungen gebunden werden, rauscht in einem Rohr, unter Lichtausschluss, alles was hineingelangt, mehr oder weniger unverändert hindurch. Wir untersuchen, ob solch eine Maßnahme, verbunden z. B. mit gezielter Vegetationsentnahme, die Phosphor-Konzentrationen effektiv reduzieren kann. Aber sie weiß auch, dass die Landwirtschaft davon nicht begeistert ist. Mit PhosWaM erarbeiten wir eine solide Datengrundlage. Ich hoffe, dass das die Diskussionen versachlicht. Wissenschaftliche Ansprechpartnerinnen: Dr. Monika Nausch monika.nausch@ io-warnemuende.de Telefon: Dr. Inga Krämer inga.kraemer@ io-warnemuende.de Telefon:
14 Kurze Meldungen Kurze Meldungen en INP: Plasma in der Krebstherapie Die am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) entwickelten medizinischen Plasmageräte werden bereits in vielen Kliniken zur Behandlung von Wundinfektionen und Hauterkrankungen eingesetzt. Ein neues Forschungsfeld am Institut ist die Anwendung von kaltem Plasma im Kampf gegen Krebs. Um dieses Thema ging es beim 5. Internationalen Workshop Plasma zur Krebsbehandlung, der am 21. und 22. März in Greifswald und somit erstmals in Deutschland stattfand. Rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Ländern tauschten sich auf dem Kongress über aktuelle Forschungsergebnisse sowie erste klinische Studien in diesem Bereich aus. Gastgeber waren das INP und die Universitätsmedizin Greifswald. Die Wissenschaftsministerin des Landes, Birgit Hesse, betonte in ihrer Rede die Bedeutung des hochrangig besetzten Workshops und verwies auf die große wissenschaftliche Strahlkraft von Universität und INP. Nach ihren Worten hat sich Greifswald eine Spitzenposition in der Plasmamedizin erarbeitet. Ein Wissenschaftlerteam am Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK) plasmatis, einer Einrichtung des INP, erforscht derzeit nicht nur, wie Krebszellen mit einer gut verträglichen Plasmatherapie eliminiert werden können, sondern auch Wechselwirkungen auf das körpereigene Immunsystem. INP: Netzwerkinitiative etabliert neue Therapie Über zwei Millionen Patienten in Deutschland leiden unter chronischen Wunden. Um plasmamedizinische Therapien in der Behandlung langfristig zu etablieren, hat eine Netzwerkinitiative des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie (INP), der PLASMA Wundzirkel, in zahlreichen Veranstaltungen die Hersteller, Ärzte und Patienten zusammengeführt. Das erfolgreiche Programm wurde zwei Jahre durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Die Organisatoren des PLASMA Wundzirkels, Christine Zädow und Norman Kalbfleisch. Foto: U. Haeder, INP Gruppenbild der Teilnehmer vor der Universitätsmedizin Greifswald. Foto: Uta Haeder,INP FBN: Forschungspreis an Nachwuchswissenschaftlerin Maren Kreiser vom FBN hat im November 2017 den Forschungspreis der Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN), verbunden mit einem Preisgeld von Euro, erhalten. Der Preis würdigt ihre Masterarbeit Untersuchung zur Impulskontrolle bei Schweinen hinsichtlich quantitativer und qualitativer Unterschiede in der Belohnung. Die Arbeit entstand am Institut für Verhaltensphysiologie des FBN Dummerstorf und wurde von Manuela Zebunke und Birger Puppe betreut. Hanno Würbel (IGN), Maren Kreiser (FBN) und Nina Keil (IGN) bei der Preisverleihung (von links). Foto: IGN IOW: Küste im Wandel Unter diesem Motto kamen vom 28. Februar bis 3. März rund 180 Experten aus über 60 Institutionen in Berlin zusammen, um gemeinsam zu erarbeiten, wo der zukünftige Bedarf in der Küstenmeerforschung liegt und mit welchen Forschungsstrategien er abgedeckt werden kann. Das IOW organisierte das Symposium gemeinsam mit dem Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM) als einen wichtigen Teilschritt in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung organisierten Agenda-Prozess. Dessen Ziel ist ein engeres Zusammengehen von Forschung, Behörden, Nutzern und Gesellschaft, um die Herausforderungen einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Meeresforschung zu meistern. Das Küstensymposium brachte Wissenschaft und Anspruchsgruppen zusammen. Foto: S. Kube, IOW 14 Leibniz Nordost
15 Kurze Meldungen IAP: Sondertatbestand VAHCOLI genehmigt Wind und Temperatur dreidimensional bis in 100 km Höhe mittels multipler Lidare zu vermessen ist ein innovatives Vorhaben, das als Sondertatbestand VAH- COLI (englisch für Vertical And Horizontal COverage by LIdar) mit ca. zwei Millionen Euro für zwei Jahre vom Bund und vom Land Mecklenburg/Vorpommern unterstützt wird. Mit der Entwicklung eines neuartigen, diodengepumpten Alexandrit-Lasers samt hochintegrierter Elektronik und Optik ermöglicht das IAP erstmals die dazu notwendigen kompakten und automatischen Systeme. Der wissenschaftliche Nutzen besteht in hochauflösenden Messungen, die z.b. eine gezielte Untersuchung von Schwerewel- Illustration: Durch die Kombination von mehreren schwenkbaren und mobilen Lidaren soll erstmals die thermische und dynamische Struktur im gesamten Höhenbereich der mittleren Atmosphäre zeitaufgelöst vermessen werden, und zwar sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Quelle: Lübken, IAP len erlaubt. Nach jahrelangen Vorbereitungen kann nun der Bau beginnen. LIKAT: Initiative Travelling Conferences Im Rahmen der BMBF-Initiative Travelling Conferences waren Jennifer Strunk und Marcus Klahn vom LIKAT im Februar in Asien und Australien unterwegs. Auf Workshops an der Monash University (Malaysia), an der National University of Singapore und an der University of South Australia warben sie um Forschungspartner. Mit ihnen reisten Chemiker von der Universität Ulm, vom Dechema Forschungsinstitut sowie von den Unternehmen Siemens und Gensoric, einem Rostocker Hightech-Startup. Es ging um hochaktuelle Umweltthemen wie die Reinigung der Luft von Stickoxiden (NO X ) und die Nutzung des Klimagases CO 2 für eine umweltneutrale Herstellung von Grundchemikalien. Ergebnis ist ein Netzwerk von Partnern und erste Absprachen für den Austausch von Equipment und Proben. Künftig werden Doktoranden zu Forschungsaufenthalten an Partnerinstitute reisen. Die LIKAT-Chemiker hoffen nun, dass alle Partner mit gemeinsamen Projektanträgen die nationalen Instrumente der Forschungsförderung nutzen werden. Kaffeepause in Australien. Foto: Klahn, LIKAT FBN: Signatures of Selection : Schlüsselmechanismen der Fruchtbarkeit Bis heute gibt es kaum kurative Therapien zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei Mensch und Tier. Denn das komplexe Netzwerk molekularer Mechanismen, die den Fortpflanzungserfolg von Säugetieren bestimmen, ist noch weitgehend unbekannt. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft und Industrie will das FBN nun Teile dieses Netzwerkes entschlüsseln. Das Kick-Off-Meeting zu diesem im Leibniz-Wettbewerb eingeworbenen Projekt fand am 8. Februar in Dummerstorf statt. Im FBN wurden bereits in den 1970er Jahren zwei Mauslinien etabliert, die nach mehr als 45 Jahren konsequenter Selektion auf Fruchtbarkeitsmerkmale die Anzahl ihrer Nachkommen pro Wurf verdoppelt haben und somit weltweit einzigartige Tiermodelle für erhöhte Fruchtbarkeit darstellen. Der jahrzehntelange Selektionsprozess hat molekulare Signaturen im Genom dieser Mäuse hinterlassen (signatures of selection), die eine Identifikation entsprechender Gene und Signalwege erlauben. Vergleichende Studien Teilnehmer des Kick-Off-Meetings. Foto: Pöhland, FBN an Nutz- und Wildtieren untersuchen, ob die bei den Mauslinien durch Selektion entstandenen genomischen Signaturen generelle biologische Relevanz für die Fruchtbarkeit von Säugetieren besitzen. 15
16 Kurze Meldungen Kurze Meldungen en IOW: Die Folgen von Megastädten für Küstenmeere Im chinesischen Guangzhou fand Ende letzten Jahres das Kick-off-Treffen für zwei neue deutsch-chinesische Verbundprojekte statt, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in den kommenden drei Jahren mit insgesamt 1,25 Mio. Euro fördert. Ziel der Vorhaben ist, den Fingerabdruck von Megastädten in Deutsch-chinesisches Treffen auf dem Forschungsschiff HAIYANG 10: Joanna Waniek (3. v. l.) ist die deutsche Koordinatorin der neuen Projekte. Foto: IOW den Meeresablagerungen von chinesischen Randmeeren zu erkennen. Beide Projekte werden auf deutscher Seite vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) koordiniert. Als Megastädte werden Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern bezeichnet. Angesichts einer weltweit zunehmenden Zahl solcher extremen Ballungszentren sind die Projektergebnisse nicht nur in China als Beratungsgrundlage politischer Gremien von hohem Interesse. IAP: J. L. Chau ins SCOSTP- Büro entsandt Seit Dezember 2017 ist Jorge L. Chau, Leiter der Abteilung Radarsondierungen am IAP, als Foto: Chau, IAP Vertreter der International Union of Radio Science (URSI) ins Büro von SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) entsandt worden. Während URSI die wissenschaftlichen Aktivitäten auf dem Gebiet der Radiowellen-Physik begleitet, umfasst SCOSTEP die gesamte Erforschung des Systems Sonne Erde. Nunmehr sind also mit dem Vizepräsidenten, IAP-Direktor Franz-Josef Lübken, zwei Institutsmitglieder ins Büro dieser internationalen Wissenschaftsorganisation berufen. INP: Alternativen zu Pestiziden Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft hat Anfang März grünes Licht für ein bedeutsames Forschungsprojekt in der Region gegeben. Zunächst erarbeiten das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) sowie die Hochschule Neubrandenburg ein Strategiekonzept für den Einsatz physikalischer Technologien in der Landwirtschaft. Das geschieht im Rahmen des Förderprogramms "WIR! Wandel durch Innovation in der Region". Ziel ist, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Agrarsektor deutlich zu reduzieren und die Haltbarkeit der Produkte auf umweltschonende Weise zu verbessern ohne jedoch die Erträge zu gefährden. In einem weiteren Schritt soll Saatgut, dessen Keimfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Pflanzenkrankheiten durch spezielle physikalische Verfahren erhöht wurde, auf Versuchsfeldern angebaut werden. Die INP-Forscherinnen Henrike Brust (r.) und Nicola Wannicke betrachten Proben mit Saatkörnern unter dem Mikroskop. Foto: H. Kraudzun, INP FBN: Eine ganzheitliche Sicht auf Leistung, Tierwohl und Umweltschutz Zusammen mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank veranstaltete das FBN am 19. Januar in Berlin die Podiumsdiskussion Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Tierwohl Herausforderungen und Zielkonflikte einer nachhaltigen Nutztierhaltung im Kontext globaler Märkte. Eine hochrangige Runde aus Praxis-, Verbands- und FAO-Vertretern diskutierte mit spanischen und deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über globale Zielkonflikte einer standortgerechten nachhaltigen Nutztierhaltung. Die Veranstaltung war eine von acht Podiumsdiskussionen auf dem diesjährigen Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), einer internationalen Konferenz zu zentralen Zukunftsfragen der globalen Land- und Ernährungswirtschaft. Von links: Diskussionsteilnehmer Josef Gelb (Gelb GbR), Cornelia Metges (FBN), Reinhard Grandke (DLG), Wendy Rauw (INIA, Madrid). Foto: N. Borowy, FBN 16 Leibniz Nordost
17 Bibliothek der Zukunft Bibliothek der Zukunft Digitalisierung und die Suche nach neuen Formen der Interaktion mit der Nutzerschaft. Von Olivia Diehr und Gunther Viereck Die Digitalisierung hat die Bibliotheken innerhalb weniger Jahre tiefgreifend verändert. Die elektronische Nutzung der Bestände löste die physische Nutzung vor Ort ab zumindest in den naturwissenschaftlichen Spezialbibliotheken. Auf der einen Seite hat die dynamische Entwicklung der Informationstechnologien einiges für die Bibliotheken und ihre Nutzer und Nutzerinnen vereinfacht, auf der anderen Seite sind neue, komplexe Abläufe hinzugekommen. Schon jetzt übernehmen Bibliothekarinnen und Bibliothekare in diesen Bereichen zunehmend Gestaltungs- und Beratungsaufgaben. So betreuen die Bibliotheken des IOW und des FBN z. B. die aktuellen Publikationslisten ihrer Institute sowie die Open-Access-Fonds, die Publikationen in Open-Access-Zeitschriften fördern. Beide Bibliotheken sind als Datencenter registriert und können bei Bedarf Digital-Object-Identifier (DOI) für Dokumente und Forschungsdaten ver- karische Kompetenzen auch helfen, die Erosion von Qualitätsstandards zu vermeiden. Auf Bibliotheken als Spezialisten des Informationstransfers wird nicht verzichtet werden können. In Zeiten einer wachsenden Diversifizierung von Medien müssen sie jedoch ihre Dienstleistungen mehr denn je an die Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzer anpassen. Durch die Schaffung neuer, innovativer Angebote bei gleichzeitiger Bewahrung des Be- Links: Als das Wissen noch auf dem Papier archiviert und gesammelt wurde: Klosterbibliothek in Prag. Foto: tilialucida, fotolia. Rechts: Heute brauchen Nutzer wissenschaftlicher Bibliotheken auch Computer und Internet. Blick in die Bibliothek des IOW. Foto: IOW Der Wandel der Arbeit wird in Bibliotheken in besonderem Maße sichtbar. Vieles, etwa Literaturrecherchen, kann heute mittlerweile online quasi hinter den Kulissen erledigt werden. Es wird dadurch immer weniger als Bibliotheksservice wahrgenommen, stellt aber für die Bibliothekare eine gewaltige Herausforderung dar. Es gilt daher, neue Formen der Interaktion mit der Nutzerschaft zu finden z. B. durch neue wissenschaftsbasierte Dienstleistungen und damit weitere Tätigkeitsfelder zu erschließen, die von bibliothekarischen Qualifikationen profitieren können. Hier sind vor allem das Forschungsdatenmanagement, das Publikationsmanagement, die Digitalisierung von Medien und die Langzeitarchivierung zu nennen. geben. Zusammen mit dem Qualitätsmanagement werden Workshops zu Themen wie Open Access, Plagiatsvermeidung/ Plagiatserkennung, Literaturrecherche und -verwaltung durchgeführt. In enger Abstimmung mit den Forschenden und der IT-Gruppe koordiniert die Bibliothek des FBN die Umsetzung der FBN-Forschungdatenpolicy. Kerngeschäft der Bibliotheken wird auch in der Zukunft das Management der gedruckten und elektronischen Ressourcen bleiben. Indem sie professionelle Informationsinfrastrukturen etablieren, nachhaltig pflegen und global integrieren, unterstützen Bibliotheken die Schaffung wissenschaftlicher Ergebnisse maßgeblich. Dabei können klassische bibliothewährten können sie zuversichtlich in die Zukunft schauen. Kontakt zu den AutorInnen: Olivia Diehr, IOW, Leiterin Bibliothek io-warnemuende.de Dr. Gunther Viereck, FBN, Leiter der Wissenschaftsdokumentation/Bibliothek 17
18 Das ist die Leibniz-Gemeinschaft Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 91 Forschungseinrichtungen, die wissenschaftliche Fragestellungen von gesamtstaatlicher Bedeutung bearbeiten. Sie stellen Infrastruktur für Wissenschaft und Forschung bereit und erbringen forschungsbasierte Dienstleistungen Vermittlung, Beratung, Transfer für Öffentlichkeit, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Sie forschen auf den Gebieten der Natur-, Ingenieurs- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Sozial- und Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. Und das ist Leibniz im Nordosten Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) Das FBN Dummerstorf erforscht die funktionelle Biodiversität von Nutztieren als entscheidende Grundlage einer nachhaltigen Landwirtschaft, als bedeutendes Potenzial für die langfristige globale Ernährungssicherung und wesentliche Basis des Lebens. Erkenntnisse über Strukturen und komplexe Vorgänge, die den Leistungen des Gesamtorganismus zugrunde liegen, werden in interdisziplinären Forschungsansätzen gewonnen, bei denen Resultate von den jeweiligen Funktionsebenen in den systemischen Gesamtzusammenhang des tierischen Organismus als Ganzes eingeführt werden. Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) Das IOW ist ein Meeresforschungsinstitut, das sich auf die Küsten- und Randmeere und unter diesen ganz besonders auf die Ostsee spezialisiert hat. Mit einem interdisziplinären systemaren Ansatz wird Grundlagenforschung zur Funktionsweise der Ökosysteme der Küstenmeere betrieben. Die Ergebnisse sollen der Entwicklung von Zukunftsszenarien dienen, mit denen die Reaktion dieser Systeme auf die vielfältige und intensive Nutzung durch die menschliche Gesellschaft oder auf Klimaänderungen veranschaulicht werden kann. Leibniz-Institut für Katalyse e. V. (LIKAT) Katalyse ist die Wissenschaft von der Beschleunigung chemischer Prozesse. Durch die Anwendung leistungsfähiger Katalysatoren laufen chemische Reaktionen unter Erhöhung der Ausbeute, Vermeidung von Nebenprodukten und Senkung des Energiebedarfs ressourcenschonend ab. In zunehmendem Maße findet man katalytische Anwendungen neben dem Einsatz in der Chemie auch in den Lebenswissenschaften und zur Energieversorgung sowie beim Klima- und Umweltschutz. Hauptziele der wissenschaftlichen Arbeiten des LIKAT sind die Gewinnung neuer Erkenntnisse in der Katalyseforschung und deren Anwendung bis hin zu technischen Umsetzungen. Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) Das IAP erforscht die mittlere Atmosphäre im Höhenbereich von 10 bis 100 km und die dynamischen Wechselwirkungen zwischen unterer und mittlerer Atmosphäre. Die mittlere Atmosphäre ist bisher wenig erkundet, spielt aber für die Wechselwirkung der Sonne mit der Atmosphäre und für die Kopplung der Schichten vom Erdboden bis zur Hochatmosphäre eine entscheidende Rolle. Das IAP verwendet moderne Fernerkundungsmethoden, wie Radar- und Lidar-Verfahren und erhält damit aufschlussreiches Beobachtungsmaterial über physikalische Prozesse und langfristige Veränderungen in der mittleren Atmosphäre. Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. (INP) Mit mehr als 180 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Fachkräften gilt das INP Greifswald europaweit als größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung für Niedertemperaturplasmen. Das INP betreibt anwendungsorientierte Grundlagenforschung und entwickelt plasmagestützte Verfahren und Produkte, derzeit vor allem für die Bereiche Materialien und Energie sowie für Umwelt und Gesundheit. Innovative Produktideen aus der Forschung des INP werden durch die Ausgründungen des Instituts transferiert. Gemeinsam mit Kooperationspartnern findet das Institut maßgeschneiderte Lösungen für aktuelle Aufgaben in der Industrie und Wissenschaft Leibniz Nordost
19 Auskünfte Auskünfte Name: Prof. Dr. Ronny Brandenburg Institut: Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Beruf: Physiker Funktion: Leiter des Forschungsschwerpunkts Plasmachemische Prozesse Was wollten Sie werden, als Sie zehn Jahre alt waren? In diesem Alter hatte ich noch keinen Berufswunsch. Später war es dann Elektronikfacharbeiter, allerdings musste ich diesen Berufswunsch wegen meiner Farbschwäche verwerfen. Ich konnte die Farben der Drähte nicht unterscheiden. Auf dem Weg zum Abitur war dann aber schnell klar, dass ich Physik studieren möchte. Zu welchem Gegenstand forschen Sie derzeit? Im Forschungsschwerpunkt Plasmachemische Prozesse am INP beschäftigen wir uns mit der Physik und Chemie reaktiver Plasmen, also Gasentladungen, die chemisch aktive oder durch Elektronenstoßprozesse aktivierbare Komponenten enthalten. Solche Plasmen findet man in der Oberflächenbehandlung, beispielsweise beim Ätzen oder Nitrieren, aber auch in der Herstellung von Ozon als wichtigem Oxidationsmittel oder beim Abbau von Gerüchen aus Abluft. Was genau sagen Sie einem Kind, wenn Sie erklären, was Sie tun? Als meine Kinder ungefähr fünf Jahre alt waren, habe ich ihnen einmal erzählt, dass ich an kleinen Blitzen forsche und damit die Luft saubermachen kann. Als ich ihnen dann eine Plasmakugel schenkte, konnten sie noch mehr mit meiner Arbeit anfangen. Was war bisher Ihr größter Aha-Effekt? Das war während meiner Diplomarbeit. Wir untersuchten eine Gasentladung in der Luft. Dann stellten wir die Gasversorgung auf Stickstoff um, nahmen also quasi der Luft den Sauerstoff weg. Die Entladung sah völlig anders aus nicht nur optisch, sondern im ganzen Verhalten. Der Strom hatte sich verändert. Das war noch kein Aha-Effekt im eigentlichen Sinne, aber dennoch ein spannender Moment, zumal die Aufklärung dieses Phänomens heute noch Teil meiner Forschungsarbeit ist. Was würden Sie am liebsten erfinden, entdecken, entwickeln? Es wäre natürlich toll, wenn man irgendwann behaupten kann, dass es eine industrielle Anwendung ohne meine Grundlagenforschungen nicht geben würde. Ich denke, dass ich das auch noch erleben werde. Es gibt doch einige Fortschritte, insbesondere in der Anwendung von Plasmen in der Medizin. Da habe ich an einigen neuen Plasmaquellen mitgearbeitet. In welchem Bereich Ihrer Wissenschaftsdisziplin gibt es derzeit den größten Erkenntnisfortschritt? Die Plasmaforschung ist in den letzten Jahren immer interdisziplinärer geworden. Wir arbeiten nun mit Medizinern, Pharmazeuten, Biochemikern und Biologen zusammen und ich denke, dass die Reaktion von Zellen auf die Plasmabehandlung auch viel über die Zellbiologie verraten kann. Aber da stehen die Kollegen noch am Anfang. Ansonsten sehe ich auch Fortschritte im Verständnis von Prozessplasmen, zum Beispiel in der Beschichtung von Materialien. Ronny Brandenburg. Foto: Henning Kraudzun Studium der Physik und Promotion an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald Wissenschaftler bei der Vanguard AG Seit 2008 im INP Gastwissenschaftler an der TU Eindhoven 2014 Hershkowitz Early Career Award 2015 Habilitation an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald 2017 Ernennung zum Universitätsprofessor Plasmen für Oberflächen an der Universität Rostock Wagen Sie eine Prognose: Was wird es in zehn Jahren Neues in diesem Bereich geben? Ich denke, dass es immer besser möglich sein wird, Plasmaprozesse gezielt zu steuern. Oberflächen werden immer besser auf ihre Erfordernisse hin designt sein und man wird sich hier weiterhin viel von der Natur abschauen. Und ich glaube, dass es neue Verfahren geben wird, mit der man Chemikalien bei Bedarf aus einfachen Grundstoffen erzeugen kann. inp-greifswald.de Homepage: Impressum Leibniz Nordost Nr. 26, November 2018 Herausgeber: Die Leibniz-Institute in MV Anschrift: Redaktion Leibniz Nordost c/o Regine Rachow, Habern Koppel 17 a, Gneven. Redaktion: Dr. Norbert Borowy (FBN), Dr. Hans Sawade (INP), Dr. Barbara Heller (LIKAT), Dr. Barbara Hentzsch (IOW), Dr. Christoph Zülicke (IAP), Regine Rachow Grafik: Werbeagentur Piehl Druck: ODR GmbH Auflage: 2000 Die nächste Ausgabe von Leibniz Nordost erscheint im Herbst
20 Leibniz Nordost
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Auftaktveranstaltung Carbon2Chem 27. Juni 2016, Duisburg Es gilt das gesprochene Wort. (Verfügbare
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Auftaktveranstaltung Carbon2Chem 27. Juni 2016, Duisburg Es gilt das gesprochene Wort. (Verfügbare
Biotechnologische Herstellung von Chitosanen
 Für eine narbenfreie Wundheilung Biotechnologische Herstellung von Chitosanen Münster (7. April 2011) - Krabbenschalen liefern wertvolle Rohstoffe: sogenannte Chitosane. Diese Zuckerverbindungen können
Für eine narbenfreie Wundheilung Biotechnologische Herstellung von Chitosanen Münster (7. April 2011) - Krabbenschalen liefern wertvolle Rohstoffe: sogenannte Chitosane. Diese Zuckerverbindungen können
1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze
 1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze Die Chemie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Sie befasst sich mit der Zusammensetzung, Charakterisierung und Umwandlung von Materie. Unter Materie
1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze Die Chemie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Sie befasst sich mit der Zusammensetzung, Charakterisierung und Umwandlung von Materie. Unter Materie
Wissensplattform Nanomaterialien
 Daten und Wissen zu Nanomaterialien - Aufbereitung gesellschaftlich relevanter naturwissenschaftlicher Fakten Wissensplattform Nanomaterialien Neueste Forschungsergebnisse zu Auswirkungen von Nanomaterialien
Daten und Wissen zu Nanomaterialien - Aufbereitung gesellschaftlich relevanter naturwissenschaftlicher Fakten Wissensplattform Nanomaterialien Neueste Forschungsergebnisse zu Auswirkungen von Nanomaterialien
Neue Diagnostik für akute myeloische Leukämie
 Neue Diagnostik für akute myeloische Leukämie Neuherberg (9. März 2011) - Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben eine Methode entwickelt, mit
Neue Diagnostik für akute myeloische Leukämie Neuherberg (9. März 2011) - Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben eine Methode entwickelt, mit
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen,
 1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
Sorgsamer, besser, gesünder: Innovationen aus Chemie und Pharma bis 2030
 VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE e.v. Ausführungen von Dr. Marijn E. Dekkers, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie, am 3. November 2015 in Berlin anlässlich des Tags der Deutschen Industrie
VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE e.v. Ausführungen von Dr. Marijn E. Dekkers, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie, am 3. November 2015 in Berlin anlässlich des Tags der Deutschen Industrie
Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung
 Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung Meine Herren und Damen, kann man mit Vitaminen der Krebsentstehung vorbeugen? Welche Kombination von Medikamenten bei AIDS ist
Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung Meine Herren und Damen, kann man mit Vitaminen der Krebsentstehung vorbeugen? Welche Kombination von Medikamenten bei AIDS ist
Die Next-up Organisation rät davon ab, den hinteren rechten Beifahrersitz des Toyota Prius Hybrid zu benutzen
 Die Next-up Organisation rät davon ab, den hinteren rechten Beifahrersitz des Toyota Prius Hybrid zu benutzen Diverse KFZ-Hersteller sehen sich derzeit mit gewaltigen Problemen konfrontiert. Immer wieder
Die Next-up Organisation rät davon ab, den hinteren rechten Beifahrersitz des Toyota Prius Hybrid zu benutzen Diverse KFZ-Hersteller sehen sich derzeit mit gewaltigen Problemen konfrontiert. Immer wieder
CowView Die smarte Art, die Herde mobil zu managen.
 CowView CowView Die smarte Art, die Herde mobil zu managen. engineering for a better world GEA Farm Technologies CowView, das handliche Management. Milchviehherden werden größer, die Milchleistung steigt.
CowView CowView Die smarte Art, die Herde mobil zu managen. engineering for a better world GEA Farm Technologies CowView, das handliche Management. Milchviehherden werden größer, die Milchleistung steigt.
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN
 ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung des Wissens allgemeiner chemischen Grundlagen und Vorstellungen, die für alle Bereiche der Naturwissenschaften notwendig sind; Modellvorstellungen
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung des Wissens allgemeiner chemischen Grundlagen und Vorstellungen, die für alle Bereiche der Naturwissenschaften notwendig sind; Modellvorstellungen
WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999
 WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999 Autor: Michael Houben Kamera: Dieter Stürmer Ton : Jule Buerjes Schnitt: Birgit Köster Abschrift des Filmtextes Teil 3: Vision 0.04 Stellen Sie sich vor, sie fahren
WDR Dschungel: Brennstoffzelle März 1999 Autor: Michael Houben Kamera: Dieter Stürmer Ton : Jule Buerjes Schnitt: Birgit Köster Abschrift des Filmtextes Teil 3: Vision 0.04 Stellen Sie sich vor, sie fahren
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Beginn der Rede!
 Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Große Teleskope für kleine Wellen
 Große Teleskope für kleine Wellen Deutsche Zusammenfassung der Antrittsvorlesung von Dr. Floris van der Tak, zur Gelegenheit seiner Ernennung als Professor der Submillimeter-Astronomie an der Universität
Große Teleskope für kleine Wellen Deutsche Zusammenfassung der Antrittsvorlesung von Dr. Floris van der Tak, zur Gelegenheit seiner Ernennung als Professor der Submillimeter-Astronomie an der Universität
Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet
 Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet Bremen, 5.3.2014 Im Rahmen einer erfolgreichen Forschungsmesskampagne im Auftrag der europäischen Weltraumbehörde
Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet Bremen, 5.3.2014 Im Rahmen einer erfolgreichen Forschungsmesskampagne im Auftrag der europäischen Weltraumbehörde
gute Gründe sprechen für LOTH-HAUS Wir bauen Qualität seit über 100 Jahren.
 gute Gründe sprechen für LOTH-HAUS Wir bauen Qualität seit über 100 Jahren. Wir halten, was wir versprechen. Ein Haus ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es ist Rückzugsort, Kinderspielplatz, Lebensraum
gute Gründe sprechen für LOTH-HAUS Wir bauen Qualität seit über 100 Jahren. Wir halten, was wir versprechen. Ein Haus ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es ist Rückzugsort, Kinderspielplatz, Lebensraum
INDUTEC Reine Perfektion!
 INDUTEC Reine Perfektion! Unsere Vision und unsere Werte Indutec Umwelttechnik GmbH & Co. KG Zeißstraße 22-24 D-50171 Kerpen / Erft Telefon: +49 (0) 22 37 / 56 16 0 Telefax: +49 (0) 22 37 / 56 16 70 E-Mail:
INDUTEC Reine Perfektion! Unsere Vision und unsere Werte Indutec Umwelttechnik GmbH & Co. KG Zeißstraße 22-24 D-50171 Kerpen / Erft Telefon: +49 (0) 22 37 / 56 16 0 Telefax: +49 (0) 22 37 / 56 16 70 E-Mail:
Engineering for the future inspire people Herbst Trinkwasser ein Energieproblem
 Trinkwasser ein Energieproblem Wasser ist Leben. Ohne Wasser wäre unser Planet wüst und tot. Unser Planet besteht auf seiner Oberfläche aus riesigen Mengen von Salzwasser. Dieses Salzwasser kann zum Beispiel
Trinkwasser ein Energieproblem Wasser ist Leben. Ohne Wasser wäre unser Planet wüst und tot. Unser Planet besteht auf seiner Oberfläche aus riesigen Mengen von Salzwasser. Dieses Salzwasser kann zum Beispiel
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN
 ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung der allgemeinen chemischen Grundlagen und Aspekte, die für alle Bereiche der Chemie notwendig sind; Modellvorstellungen Inhaltsübersicht:
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung der allgemeinen chemischen Grundlagen und Aspekte, die für alle Bereiche der Chemie notwendig sind; Modellvorstellungen Inhaltsübersicht:
Fettmoleküle und das Gehirn
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Spezielle "Gehirn Fett Injektion hilft Huntington Mäusen Direktes
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Spezielle "Gehirn Fett Injektion hilft Huntington Mäusen Direktes
Jobs mit Zukunft Neue Ausbildungen und Berufe im Technologiesektor
 Jobs mit Zukunft Neue Ausbildungen und Berufe im Technologiesektor Workshop: Biotechnologie Ausbildungsanforderungen und Erwartungen von Unternehmen an BiotechnologInnen Prof.(FH) Mag. Dr. Bea Kuen-Krismer
Jobs mit Zukunft Neue Ausbildungen und Berufe im Technologiesektor Workshop: Biotechnologie Ausbildungsanforderungen und Erwartungen von Unternehmen an BiotechnologInnen Prof.(FH) Mag. Dr. Bea Kuen-Krismer
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Science4Life Energy Cup. Eine Initiative von
 Science4Life Energy Cup Eine Initiative von 1 Agenda 1 Science4Life 2 3 Science4Life Energy Cup Kooperationspartner 4 Diskussion 2 Agenda 1 Science4Life 2 3 Science4Life Energy Cup Kooperationspartner
Science4Life Energy Cup Eine Initiative von 1 Agenda 1 Science4Life 2 3 Science4Life Energy Cup Kooperationspartner 4 Diskussion 2 Agenda 1 Science4Life 2 3 Science4Life Energy Cup Kooperationspartner
BIOTechnikum. Erlebnis Forschung Gesundheit, Ernährung, Umwelt
 BIOTechnikum Erlebnis Forschung Gesundheit, Ernährung, Umwelt Biotechnologie ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglicht technologischen Fortschritt, höhere Lebensqualität und nachhaltige
BIOTechnikum Erlebnis Forschung Gesundheit, Ernährung, Umwelt Biotechnologie ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglicht technologischen Fortschritt, höhere Lebensqualität und nachhaltige
Kohlendioxid als Ressource
 Kohlendioxid als Ressource Vom Abfall zum Rohstoff Plus-Forschung macht mehr aus Treibhausgas Neue Wege zu einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Die Chemische Industrie ist der Zulieferer für eine große
Kohlendioxid als Ressource Vom Abfall zum Rohstoff Plus-Forschung macht mehr aus Treibhausgas Neue Wege zu einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Die Chemische Industrie ist der Zulieferer für eine große
Weniger CO 2 dem Klima zuliebe Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Der CO 2- Kreislauf wird behandelt und die Beeinflussung des Menschen erarbeitet. Die Schülerberichte (Aufgabe 3) dienen als Grundlage zur Diskussion im Plenum. Ziel
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Der CO 2- Kreislauf wird behandelt und die Beeinflussung des Menschen erarbeitet. Die Schülerberichte (Aufgabe 3) dienen als Grundlage zur Diskussion im Plenum. Ziel
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der Auszeichnung des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig Leibniz-Institut
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der Auszeichnung des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig Leibniz-Institut
Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte
 Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte UNSER STRATEGISCHER RAHMEN Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte Wir haben einen klaren und langfristig ausgerichteten strategischen Rahmen definiert. Er hilft
Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte UNSER STRATEGISCHER RAHMEN Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte Wir haben einen klaren und langfristig ausgerichteten strategischen Rahmen definiert. Er hilft
Video-Thema Begleitmaterialien
 DER NACKTMULL EIN WUNDER DER NATUR Nacktmulle sind besondere Tiere. Sie sehen nicht nur ungewöhnlich aus, sondern sie haben vor allem viele besondere Eigenschaften: Die Tiere empfinden kaum Schmerz, kommen
DER NACKTMULL EIN WUNDER DER NATUR Nacktmulle sind besondere Tiere. Sie sehen nicht nur ungewöhnlich aus, sondern sie haben vor allem viele besondere Eigenschaften: Die Tiere empfinden kaum Schmerz, kommen
Für effiziente Methanproduktion von Bakterien lernen
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/fuer-effizientemethanproduktion-von-bakterien-lernen/ Für effiziente Methanproduktion von Bakterien lernen Seit 25 Jahren
Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/fuer-effizientemethanproduktion-von-bakterien-lernen/ Für effiziente Methanproduktion von Bakterien lernen Seit 25 Jahren
Die 2000-Watt-Gesellschaft
 Die 2000-Watt-Gesellschaft G. Togni 1 Die 2000-Watt-Gesellschaft Giuseppina Togni Dipl. Phys. ETH Präsidentin S.A.F.E. Schw. Agentur für Energieeffizienz Zürich, Schweiz 2 Die 2000-Watt-Gesellschaft G.
Die 2000-Watt-Gesellschaft G. Togni 1 Die 2000-Watt-Gesellschaft Giuseppina Togni Dipl. Phys. ETH Präsidentin S.A.F.E. Schw. Agentur für Energieeffizienz Zürich, Schweiz 2 Die 2000-Watt-Gesellschaft G.
Optische Eigenschaften fester Stoffe. Licht im neuen Licht Dez 2015
 Licht und Materie Optische Eigenschaften fester Stoffe Matthias Laukenmann Den Lernenden muss bereits bekannt sein: Zahlreiche Phänomene lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass die von Atomen quantisiert
Licht und Materie Optische Eigenschaften fester Stoffe Matthias Laukenmann Den Lernenden muss bereits bekannt sein: Zahlreiche Phänomene lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass die von Atomen quantisiert
Auftragskarte 1b Mein kleines Wetter-Retter-Buch der erneuerbaren Energien
 Auftragskarte 1b Mein kleines Wetter-Retter-Buch der erneuerbaren Energien 1) Lies dir in Ruhe die Texte durch und löse die Aufgaben. 2) Tipp: Du musst nicht das ganze Buch auf einmal bearbeiten. Lass
Auftragskarte 1b Mein kleines Wetter-Retter-Buch der erneuerbaren Energien 1) Lies dir in Ruhe die Texte durch und löse die Aufgaben. 2) Tipp: Du musst nicht das ganze Buch auf einmal bearbeiten. Lass
Standortbestimmung / Äquivalenzprüfung. Chemie. Mittwoch, 13. April 2016, Uhr
 Seite 1 von 7 Standortbestimmung / Äquivalenzprüfung Chemie Mittwoch, 13. April 2016, 16.45-18.15 Uhr Dauer der Prüfung: 90 Minuten Erlaubte Hilfsmittel: Eine gedruckte und/oder eine persönlich erstellte
Seite 1 von 7 Standortbestimmung / Äquivalenzprüfung Chemie Mittwoch, 13. April 2016, 16.45-18.15 Uhr Dauer der Prüfung: 90 Minuten Erlaubte Hilfsmittel: Eine gedruckte und/oder eine persönlich erstellte
Medizinische Forschung ist notwendig: Nur bei wenigen Aussagen ist man sich in unserem Land wohl so einig, wie über diese.
 Sperrfrist: 24. Oktober 2014, 14.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des
Sperrfrist: 24. Oktober 2014, 14.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des
Performance steigern mit dem Team Relation Performance Management Survey (TRPM) Anforderungen an ein zeitgemäßes Performance Management
 Performance steigern mit dem Team Relation Performance Management Survey (TRPM) Anforderungen an ein zeitgemäßes Performance Management Performance Management und die jährlichen Gespräche dazu erleben
Performance steigern mit dem Team Relation Performance Management Survey (TRPM) Anforderungen an ein zeitgemäßes Performance Management Performance Management und die jährlichen Gespräche dazu erleben
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können.
 Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können. Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Wissenschaft
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können. Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Wissenschaft
KindeR- UND SChüleruni Kiel 2011
 KindeR- UND SChüleruni Kiel 2011 Für Schülerinnen und Schüler von 8 bis 12 Jahren Wie macht Chemie die Welt bunt? Begleitheft zum Vortrag von Prof. Dr. Ilka Parchmann Wie macht chemie die welt bunt? Prof.
KindeR- UND SChüleruni Kiel 2011 Für Schülerinnen und Schüler von 8 bis 12 Jahren Wie macht Chemie die Welt bunt? Begleitheft zum Vortrag von Prof. Dr. Ilka Parchmann Wie macht chemie die welt bunt? Prof.
Dossier documentaire
 DCL AL 05/11 01 Dossier documentaire Page 1 sur 8 DCL ALLEMAND Diplôme de Compétence en Langue Session du vendredi 27 mai 2011 Dossier documentaire Phase 1: Document 1 Document 2 Document 3 Document 4
DCL AL 05/11 01 Dossier documentaire Page 1 sur 8 DCL ALLEMAND Diplôme de Compétence en Langue Session du vendredi 27 mai 2011 Dossier documentaire Phase 1: Document 1 Document 2 Document 3 Document 4
www.unsichtbarerfeind.de Kinder auf den Spuren des Klimawandels Energiesparen
 www.unsichtbarerfeind.de Blatt 8 Energiesparen Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, sollten wir uns alle überlegen, was wir konkret dagegen unternehmen können. Schließlich wirkt sich beim Klima erst
www.unsichtbarerfeind.de Blatt 8 Energiesparen Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, sollten wir uns alle überlegen, was wir konkret dagegen unternehmen können. Schließlich wirkt sich beim Klima erst
Theory Swiss German (Liechtenstein) Lies die Anweisungen in dem separaten Umschlag, bevor Du mit dieser Aufgabe beginnst.
 Q2-1 Nichtlineare Dynamik in Stromkreisen (10 Punkte) Lies die Anweisungen in dem separaten Umschlag, bevor Du mit dieser Aufgabe beginnst. Einleitung Bistabile nichtlineare halbleitende Komponenten (z.b.
Q2-1 Nichtlineare Dynamik in Stromkreisen (10 Punkte) Lies die Anweisungen in dem separaten Umschlag, bevor Du mit dieser Aufgabe beginnst. Einleitung Bistabile nichtlineare halbleitende Komponenten (z.b.
Mehr Wert(e): Nachhaltige Innovationen für nachhaltigen Konsum. Stephan Füsti-Molnár 31. August 2015
 Mehr Wert(e): Nachhaltige Innovationen für nachhaltigen Konsum Stephan Füsti-Molnár 31. August 2015 Vier übergreifende Trends Nachhaltigkeitsthemen werden immer relevanter für unser Geschäft - 40% BIP
Mehr Wert(e): Nachhaltige Innovationen für nachhaltigen Konsum Stephan Füsti-Molnár 31. August 2015 Vier übergreifende Trends Nachhaltigkeitsthemen werden immer relevanter für unser Geschäft - 40% BIP
INP Greifswald. 4. Sitzung des Forums Ostsee Mecklenburg- Vorpommern. Prof. Klaus-Dieter Weltmann
 INP Greifswald 4. Sitzung des Forums Ostsee Mecklenburg- Vorpommern Prof. Klaus-Dieter Weltmann Plasmatechnologie Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.v. (INP Greifswald) 1.1.1992 formale
INP Greifswald 4. Sitzung des Forums Ostsee Mecklenburg- Vorpommern Prof. Klaus-Dieter Weltmann Plasmatechnologie Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.v. (INP Greifswald) 1.1.1992 formale
Zukünftige Bedeutung der Ressource Energie Torsten Reetz EWE Aktiengesellschaft
 1 Zukünftige Bedeutung der Ressource Energie Torsten Reetz EWE Aktiengesellschaft Energie Relevanz für das unternehmerische Handeln 2 - Energie ist Voraussetzung aller technischen und wirtschaftlichen
1 Zukünftige Bedeutung der Ressource Energie Torsten Reetz EWE Aktiengesellschaft Energie Relevanz für das unternehmerische Handeln 2 - Energie ist Voraussetzung aller technischen und wirtschaftlichen
Welt Lymphom Tag Seminar für Patienten und Angehörige 15. September 2007 Wien
 Welt Lymphom Tag Seminar für Patienten und Angehörige 15. September 2007 Wien Ein Vortrag von Univ. Prof. Dr. Johannes Drach Medizinische Universität Wien Univ. Klinik für Innere Medizin I Klinische Abteilung
Welt Lymphom Tag Seminar für Patienten und Angehörige 15. September 2007 Wien Ein Vortrag von Univ. Prof. Dr. Johannes Drach Medizinische Universität Wien Univ. Klinik für Innere Medizin I Klinische Abteilung
Swantje Eigner-Thiel. Mobilisierungs- und Kommunikationsstrategien. potenziellen Bioenergiedörfern
 Swantje Eigner-Thiel Mobilisierungs- und Kommunikationsstrategien für Bewohner von potenziellen Bioenergiedörfern Schriftenreihe Fortschritt neu denken Heft 3, Göttingen 2011 Inhalt 1. Einführung S. 3
Swantje Eigner-Thiel Mobilisierungs- und Kommunikationsstrategien für Bewohner von potenziellen Bioenergiedörfern Schriftenreihe Fortschritt neu denken Heft 3, Göttingen 2011 Inhalt 1. Einführung S. 3
Was ist Wirkstoffdesign?
 Was ist Wirkstoffdesign? Eine Einführung für Nicht-Fachleute Arzneimittel hat vermutlich schon jeder von uns eingenommen. Vielleicht hat sich der eine oder andere dabei gefragt, was passiert eigentlich
Was ist Wirkstoffdesign? Eine Einführung für Nicht-Fachleute Arzneimittel hat vermutlich schon jeder von uns eingenommen. Vielleicht hat sich der eine oder andere dabei gefragt, was passiert eigentlich
Ihr Partner für die zukunftsweisende Energieversorgung
 Ihr Partner für die zukunftsweisende Energieversorgung Die Energie der Sonne ist nach menschlichem Maßstab unerschöpflich. Geschätzt wird uns der Stern noch fünf Milliarden Jahre seine Energie schenken.
Ihr Partner für die zukunftsweisende Energieversorgung Die Energie der Sonne ist nach menschlichem Maßstab unerschöpflich. Geschätzt wird uns der Stern noch fünf Milliarden Jahre seine Energie schenken.
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER
 NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
Wenn wir denken, wie wir immer gedacht haben, wenn wir so handeln, wie wir immer gehandelt haben, werden wir bewirken, was wir immer bewirkt haben.
 1 Begrüßungsworte für Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld zur Veranstaltung RSGV Kongress Nachhaltigkeit am Dienstag, 04. Juni 2013, 13.00 Uhr Stadthalle *** Wenn wir denken, wie wir immer gedacht haben,
1 Begrüßungsworte für Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld zur Veranstaltung RSGV Kongress Nachhaltigkeit am Dienstag, 04. Juni 2013, 13.00 Uhr Stadthalle *** Wenn wir denken, wie wir immer gedacht haben,
Kontrollaufgaben zur Optik
 Kontrollaufgaben zur Optik 1. Wie schnell bewegt sich Licht im Vakuum? 2. Warum hat die Lichtgeschwindigkeit gemäss moderner Physik eine spezielle Bedeutung? 3. Wie nennt man die elektromagnetische Strahlung,
Kontrollaufgaben zur Optik 1. Wie schnell bewegt sich Licht im Vakuum? 2. Warum hat die Lichtgeschwindigkeit gemäss moderner Physik eine spezielle Bedeutung? 3. Wie nennt man die elektromagnetische Strahlung,
Untersuchung zur Beschleunigung von Prüfungen der. physikalischen Dauergebrauchseigenschaften von Schuhen. und Schuhkomponenten.
 Untersuchung zur Beschleunigung von Prüfungen der physikalischen Dauergebrauchseigenschaften von Schuhen und Schuhkomponenten. (Veröffentlichung) Firma AIF-Forschungsprojekt 13804 N Das Projekt wurde aus
Untersuchung zur Beschleunigung von Prüfungen der physikalischen Dauergebrauchseigenschaften von Schuhen und Schuhkomponenten. (Veröffentlichung) Firma AIF-Forschungsprojekt 13804 N Das Projekt wurde aus
Hören mit High-Tech. HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover Hörzentrum Hannover. Direktor: Prof. Dr. Th. Lenarz
 Hören mit High-Tech HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover Hörzentrum Hannover Direktor: Prof. Dr. Th. Lenarz Mitarbeiter im Ideenpark: Prof. Dr. med. A. Lesinski-Schiedat, Dr. A. Büchner, S.
Hören mit High-Tech HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover Hörzentrum Hannover Direktor: Prof. Dr. Th. Lenarz Mitarbeiter im Ideenpark: Prof. Dr. med. A. Lesinski-Schiedat, Dr. A. Büchner, S.
Spaß & Wissenschaft Fun Science Gemeinnütziger Verein zur wissenschaftlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen
 Spaß & Wissenschaft Fun Science Gemeinnütziger Verein zur wissenschaftlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen www.funscience.at info@funscience.at +43 1 943 08 42 Über uns Spaß & Wissenschaft - Fun
Spaß & Wissenschaft Fun Science Gemeinnütziger Verein zur wissenschaftlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen www.funscience.at info@funscience.at +43 1 943 08 42 Über uns Spaß & Wissenschaft - Fun
Cluster Chemie/Kunststoffe Mitteldeutschland
 Cluster Chemie/Kunststoffe Mitteldeutschland Technologien zur stofflichen Kohlenutzung 03.09.2015, 17. Brandenburger Energietag in Cottbus Dr. Christoph Mühlhaus, Clustersprecher INHALT A B C Das Cluster
Cluster Chemie/Kunststoffe Mitteldeutschland Technologien zur stofflichen Kohlenutzung 03.09.2015, 17. Brandenburger Energietag in Cottbus Dr. Christoph Mühlhaus, Clustersprecher INHALT A B C Das Cluster
UNSER ANTRIEB: KREBS HEILEN
 UNSER ANTRIEB: KREBS HEILEN Unser Antrieb Bild: Gefärbte rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (REM) einer Prostatakrebszelle. Wir sind Takeda Oncology, der Spezialbereich für Krebserkrankungen des Pharmaunternehmens
UNSER ANTRIEB: KREBS HEILEN Unser Antrieb Bild: Gefärbte rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (REM) einer Prostatakrebszelle. Wir sind Takeda Oncology, der Spezialbereich für Krebserkrankungen des Pharmaunternehmens
Energie und Energiesparen
 Energie und Energiesparen Energie für unseren Lebensstil In Deutschland und anderen Industrieländern führen die meisten Menschen ein Leben, für das viel Energie benötigt wird: zum Beispiel Strom für Beleuchtung,
Energie und Energiesparen Energie für unseren Lebensstil In Deutschland und anderen Industrieländern führen die meisten Menschen ein Leben, für das viel Energie benötigt wird: zum Beispiel Strom für Beleuchtung,
Fluch und Segen der Stickstoffdüngung
 Amber Stakeholder Konferenz am 14.12.2011 im IOW Fluch und Segen der Stickstoffdüngung Maren Voß, Frederike Korth, Joachim Dippner Globaler Anstieg der Weltbevölkerung und Düngerverbrauch Weltbevölkerung
Amber Stakeholder Konferenz am 14.12.2011 im IOW Fluch und Segen der Stickstoffdüngung Maren Voß, Frederike Korth, Joachim Dippner Globaler Anstieg der Weltbevölkerung und Düngerverbrauch Weltbevölkerung
Das magnetische Feld. Kapitel Lernziele zum Kapitel 7
 Kapitel 7 Das magnetische Feld 7.1 Lernziele zum Kapitel 7 Ich kann das theoretische Konzept des Magnetfeldes an einem einfachen Beispiel erläutern (z.b. Ausrichtung von Kompassnadeln in der Nähe eines
Kapitel 7 Das magnetische Feld 7.1 Lernziele zum Kapitel 7 Ich kann das theoretische Konzept des Magnetfeldes an einem einfachen Beispiel erläutern (z.b. Ausrichtung von Kompassnadeln in der Nähe eines
BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS. Jan SWITTEN 2014
 BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS Jan SWITTEN 2014 1 Was sind Biokunststoffe Definition European Bioplastics Kunststoffe entstanden aus nachwachsenden Rohstoffen oder Abbaubare oder kompostierbare Kunststoffe
BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS Jan SWITTEN 2014 1 Was sind Biokunststoffe Definition European Bioplastics Kunststoffe entstanden aus nachwachsenden Rohstoffen oder Abbaubare oder kompostierbare Kunststoffe
KZU Bio. KZU Bio. KZU Bio. KZU Bio
 Was wollte van Helmont mit "Weidenzweig-Versuch" herausfinden? Weshalb nahm van Helmont Regenwasser und nicht Leitungswasser? Was war das Resultat des Experimentes von van Helmont? Was konnte er aus seinem
Was wollte van Helmont mit "Weidenzweig-Versuch" herausfinden? Weshalb nahm van Helmont Regenwasser und nicht Leitungswasser? Was war das Resultat des Experimentes von van Helmont? Was konnte er aus seinem
PRESSEINFORMATION. Adapt Pro EMG Prothesensteuerung: Aktive Arm-Orthese mit intelligentem Mensch-Maschine-Interface
 Adapt Pro EMG Prothesensteuerung: Aktive Arm-Orthese mit intelligentem Mensch-Maschine-Interface Seite 1 2 Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA forscht an Sensorik zur
Adapt Pro EMG Prothesensteuerung: Aktive Arm-Orthese mit intelligentem Mensch-Maschine-Interface Seite 1 2 Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA forscht an Sensorik zur
Tinnitus nicht mehr hören. Apotheken-Service für Gesundheit und Wohlbefinden
 Tinnitus nicht mehr hören Apotheken-Service für Gesundheit und Wohlbefinden Das sollten Sie wissen Unter Tinnitus versteht man ein permanentes Ohrgeräusch, das als dauerhaftes Pfeifen oder Summen beschrieben
Tinnitus nicht mehr hören Apotheken-Service für Gesundheit und Wohlbefinden Das sollten Sie wissen Unter Tinnitus versteht man ein permanentes Ohrgeräusch, das als dauerhaftes Pfeifen oder Summen beschrieben
Windenergie als Alternative zum Erdöl
 Windenergie als Alternative zum Erdöl Def.: Windenergie ist eine indirekte Form der Sonnenenergie und zählt zu den erneuerbaren und unerschöpflichen Energieträgern. Wind ist ein umweltfreundlicher, unerschöpflicher
Windenergie als Alternative zum Erdöl Def.: Windenergie ist eine indirekte Form der Sonnenenergie und zählt zu den erneuerbaren und unerschöpflichen Energieträgern. Wind ist ein umweltfreundlicher, unerschöpflicher
UNSERE WELT MUß GRÜN BLEIBEN
 UNSERE WELT MUß GRÜN BLEIBEN DIE GROßEN UMVELTPROBLEME DER TREIBHAUSEFFEKT Der Treibhauseffekt endschted, weil wir Gase produzieren, die zuviel Wärme zurückhalten und deswegen verändert sich unsere Atmosphäre.
UNSERE WELT MUß GRÜN BLEIBEN DIE GROßEN UMVELTPROBLEME DER TREIBHAUSEFFEKT Der Treibhauseffekt endschted, weil wir Gase produzieren, die zuviel Wärme zurückhalten und deswegen verändert sich unsere Atmosphäre.
DIE IDEE. Die Aufgabenstellung. Die Lösung. Zukunftsaussichten
 DIE IDEE IN DER KAFFEEPAUSE EINES IDEEN-MEETINGS KAM DIE ZÜNDENDE IDEE, WIE MAN EINE MÖBELBESCHICHTUNG AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN HERSTELLEN KANN. UND DAS IST ERST DER ANFANG... Die Aufgabenstellung
DIE IDEE IN DER KAFFEEPAUSE EINES IDEEN-MEETINGS KAM DIE ZÜNDENDE IDEE, WIE MAN EINE MÖBELBESCHICHTUNG AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN HERSTELLEN KANN. UND DAS IST ERST DER ANFANG... Die Aufgabenstellung
NanoBioNet, Saarbrücken NanoBioNet Saarland - Rheinhessen-Pfalz e.v. Netzwerk für Nano- und Biotechnologie NanoBioNet, Saarbrücken NanoBioNet, Saarbrü
 deutsch NanoBioNet Saarland - Rheinhessen-Pfalz e.v. Netzwerk für Nano- und Biotechnologie NanoBioNet, Saarbrücken NanoBioNet Saarland - Rheinhessen-Pfalz e.v. Netzwerk für Nano- und Biotechnologie NanoBioNet,
deutsch NanoBioNet Saarland - Rheinhessen-Pfalz e.v. Netzwerk für Nano- und Biotechnologie NanoBioNet, Saarbrücken NanoBioNet Saarland - Rheinhessen-Pfalz e.v. Netzwerk für Nano- und Biotechnologie NanoBioNet,
Thema der vorliegenden Arbeit:
 Hans-und-Hilde- Coppi-Oberschule + METEUM + Orbitall Albert Einstein Jugend forscht- Schüler experimentieren 2 Fachgebiet: Geo-und Raumwissenschaft Stiftung Jugend-Forscht e.v. http://www.jugend-forscht.de
Hans-und-Hilde- Coppi-Oberschule + METEUM + Orbitall Albert Einstein Jugend forscht- Schüler experimentieren 2 Fachgebiet: Geo-und Raumwissenschaft Stiftung Jugend-Forscht e.v. http://www.jugend-forscht.de
Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung: Technologische Lösungen für die Energiewende
 Clusterkonferenz Energietechnik Berlin-Brandenburg 2014, 05.12.2014 Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung: Technologische Lösungen für die Energiewende Dr. Frank Büchner Siemens AG Siemens
Clusterkonferenz Energietechnik Berlin-Brandenburg 2014, 05.12.2014 Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung: Technologische Lösungen für die Energiewende Dr. Frank Büchner Siemens AG Siemens
TOTAL und Linde kooperieren bei Wasserstofftankstelle in Berlin-Mitte
 Anzufordern unter: TOTAL und Linde kooperieren bei Wasserstofftankstelle in Berlin-Mitte München/Berlin, 2. Februar 2011 Im Rahmen der Clean Energy Partnership (CEP) bauen die Partner TOTAL Deutschland
Anzufordern unter: TOTAL und Linde kooperieren bei Wasserstofftankstelle in Berlin-Mitte München/Berlin, 2. Februar 2011 Im Rahmen der Clean Energy Partnership (CEP) bauen die Partner TOTAL Deutschland
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
 138 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 19. Energieförderprogramme in Schleswig-Holstein - bisher kaum Fördermittel aus den EU- und Bundesförderprogrammen in Anspruch
138 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 19. Energieförderprogramme in Schleswig-Holstein - bisher kaum Fördermittel aus den EU- und Bundesförderprogrammen in Anspruch
Proteinbestimmung. Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der Proteinbestimmung mit den folgenden Lehrzielen:
 Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Wir stehen auf Geologie! Schweizer Geologenverband
 Wir stehen auf Geologie! Schweizer Geologenverband Alltäglich die Geologie Keine seriöse Bauplanung ohne Kenntnis des Untergrundes, kaum ein Hausbau ohne Baumaterialien aus dem Erdreich, wenig Raumwärme
Wir stehen auf Geologie! Schweizer Geologenverband Alltäglich die Geologie Keine seriöse Bauplanung ohne Kenntnis des Untergrundes, kaum ein Hausbau ohne Baumaterialien aus dem Erdreich, wenig Raumwärme
Fundamentale Physik. < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie
 Fundamentale Physik > < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie Phänomene Phänomene Schwerkraft Radiowellen Licht Phänomene
Fundamentale Physik > < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie Phänomene Phänomene Schwerkraft Radiowellen Licht Phänomene
Ziele und Leistungskenngrößen
 Ziele und Leistungskenngrößen 2 Klären Sie genau, wo Sie hin möchten Wenn Sie das Gefühl haben, nicht dort zu sein, wo Sie eigentlich sein möchten, kann es daran liegen, dass Sie kein Ziel festgelegt haben.
Ziele und Leistungskenngrößen 2 Klären Sie genau, wo Sie hin möchten Wenn Sie das Gefühl haben, nicht dort zu sein, wo Sie eigentlich sein möchten, kann es daran liegen, dass Sie kein Ziel festgelegt haben.
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Touristische Aspekte der Raumordnung in Mecklenburg-Vorpommern
 Touristische Aspekte der Raumordnung in Mecklenburg-Vorpommern Rostock, den 20.Juli 2016 B. Fischer Geschäftsführer Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. Inhalt 1. Tourismus ist eine Querschnittsbranche
Touristische Aspekte der Raumordnung in Mecklenburg-Vorpommern Rostock, den 20.Juli 2016 B. Fischer Geschäftsführer Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. Inhalt 1. Tourismus ist eine Querschnittsbranche
ENERGIE: OPTIONEN FÜR DIE ZUKUNFT
 5 ENERGIE: OPTIONEN FÜR DIE ZUKUNFT Klaus Heinloth Physikalisches Institut Universität Bonn 6 Zweite Frage: Wieviel Energie werden wir künftig brauchen, und woher werden wir diese Energie nehmen können?
5 ENERGIE: OPTIONEN FÜR DIE ZUKUNFT Klaus Heinloth Physikalisches Institut Universität Bonn 6 Zweite Frage: Wieviel Energie werden wir künftig brauchen, und woher werden wir diese Energie nehmen können?
Kernbotschaften. Sperrfrist: 7. November 2011, Uhr Es gilt das gesprochene Wort.
 Sperrfrist: 7. November 2011, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Statement des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, bei der Eröffnung des Münchner
Sperrfrist: 7. November 2011, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Statement des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, bei der Eröffnung des Münchner
Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehr geizige Ziele für unser Unternehmen gesetzt.
 Vision und Werte 2 Vorwort Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehr geizige Ziele für unser Unternehmen gesetzt. Wir sind dabei, in unserem Unternehmen eine Winning Culture zu etablieren.
Vision und Werte 2 Vorwort Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehr geizige Ziele für unser Unternehmen gesetzt. Wir sind dabei, in unserem Unternehmen eine Winning Culture zu etablieren.
Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache
 Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Baden-Württemberg ist heute besser als früher. Baden-Württemberg ist modern. Und lebendig. Tragen wir Grünen die Verantwortung?
Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Baden-Württemberg ist heute besser als früher. Baden-Württemberg ist modern. Und lebendig. Tragen wir Grünen die Verantwortung?
Geografie, D. Langhamer. Klimarisiken. Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes. Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf.
 Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der gemüsebaulichen Praxis in Hessen
 Europäische Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit EIP Agri Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der gemüsebaulichen Praxis in Hessen Prof. Dr. Jana Zinkernagel
Europäische Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit EIP Agri Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der gemüsebaulichen Praxis in Hessen Prof. Dr. Jana Zinkernagel
Quantifizierung im. Transregio-Partner. Visual Computing. Visionen, Herausforderungen und Aktivitäten des SFB-TRR 161.
 Quantifizierung im Visual Computing Visionen, Herausforderungen und Aktivitäten des SFB-TRR 161 Transregio-Partner Förderung durch Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik Wir suchen Antworten auf
Quantifizierung im Visual Computing Visionen, Herausforderungen und Aktivitäten des SFB-TRR 161 Transregio-Partner Förderung durch Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik Wir suchen Antworten auf
Zusatzstation: Klimalexikon Anleitung
 Anleitung Die Lexikonkarten liegen verdeckt vor euch. Mischt die Karten. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Lest die Begriffe auf den Karten. Erklärt die Begriffe euren Mitspielern mit Hilfe des Bildes.
Anleitung Die Lexikonkarten liegen verdeckt vor euch. Mischt die Karten. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Lest die Begriffe auf den Karten. Erklärt die Begriffe euren Mitspielern mit Hilfe des Bildes.
Sie werden Ihren Teppichboden lieben! Gesünder Wohnen mit duraair.
 Sie werden Ihren Teppichboden lieben! Gesünder Wohnen mit duraair. 7gesunde Vorteile von Teppichboden mit duraair Frische und saubere Luft duraair verbessert die Raumluft in Räumen zum Leben und Arbeiten.
Sie werden Ihren Teppichboden lieben! Gesünder Wohnen mit duraair. 7gesunde Vorteile von Teppichboden mit duraair Frische und saubere Luft duraair verbessert die Raumluft in Räumen zum Leben und Arbeiten.
Applikationsfeld / Industriezweig:
 Applikationsfeld / Industriezweig: Chemie / Polymerindustrie Elektronik Energie Ernährung / Landwirtschaft Geologie / Bergbau Halbleiter-Technologie Klinische Chemie / Medizin / Hygiene / Gesundheitswesen
Applikationsfeld / Industriezweig: Chemie / Polymerindustrie Elektronik Energie Ernährung / Landwirtschaft Geologie / Bergbau Halbleiter-Technologie Klinische Chemie / Medizin / Hygiene / Gesundheitswesen
Modernste 3D Größen- und Formanalysen für Labor und Prozess
 Modernste 3D Größen- und Formanalysen für Labor und Prozess Unter den dynamischen Bildanalysesystemen liefert die patentierte 3D Messverfahren des PartAn die genauesten Korngrößen- und Kornfomverteilungen.
Modernste 3D Größen- und Formanalysen für Labor und Prozess Unter den dynamischen Bildanalysesystemen liefert die patentierte 3D Messverfahren des PartAn die genauesten Korngrößen- und Kornfomverteilungen.
Schau dir das Plakat genau an und werde ein Experte in. Kohle Erdgas
 Schau dir das Plakat genau an und werde ein Eperte in Sachen erneuerbare Energien. 1. AUFGABE: Schreibe die Begriffe Biomasse, Erdgas, Kohle, Sonne, Wasser, Wind in die entsprechenen Spalten: erneuerbare
Schau dir das Plakat genau an und werde ein Eperte in Sachen erneuerbare Energien. 1. AUFGABE: Schreibe die Begriffe Biomasse, Erdgas, Kohle, Sonne, Wasser, Wind in die entsprechenen Spalten: erneuerbare
Stoffliche Nutzung von Biomasse in der chemischen Industrie Perspektiven für Biomethan
 3. Dezember 2015 Stoffliche Nutzung von Biomasse in der chemischen Industrie Perspektiven für Biomethan Dr. Jörg Rothermel, DENA Biogaspartner, Berlin, 3. Dezember 2015 Agenda Rohstoffe in der Chemie Biomasse
3. Dezember 2015 Stoffliche Nutzung von Biomasse in der chemischen Industrie Perspektiven für Biomethan Dr. Jörg Rothermel, DENA Biogaspartner, Berlin, 3. Dezember 2015 Agenda Rohstoffe in der Chemie Biomasse
Akkus des menschlichen Lebens. Was ist Leben? oder: woher schöpfen die Menschen ihre Energie und wie wird sie genährt oder gestört?
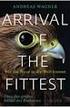 Akkus des menschlichen Lebens oder: woher schöpfen die Menschen ihre Energie und wie wird sie genährt oder gestört? Was ist Leben? Leben ist 1.: Fortpflanzung Leben ist 2.: Ernährung, Ausscheidung Leben
Akkus des menschlichen Lebens oder: woher schöpfen die Menschen ihre Energie und wie wird sie genährt oder gestört? Was ist Leben? Leben ist 1.: Fortpflanzung Leben ist 2.: Ernährung, Ausscheidung Leben
Bedarfsorientiertes Forschen. Von der Information zur Lagebewältigung. Technik in der Luft zur Überwachung der Meere :: Info & News :: Info &
 Info & News Info & News: Technik in der Luft zur Überwachung der Meere Geschrieben 09. Sep 2016-20:47 Uhr Vier Tage, vier Fälle, die für die maritime Sicherheit eine Bedrohung darstellen das Verbundprojekt
Info & News Info & News: Technik in der Luft zur Überwachung der Meere Geschrieben 09. Sep 2016-20:47 Uhr Vier Tage, vier Fälle, die für die maritime Sicherheit eine Bedrohung darstellen das Verbundprojekt
Uran. Uran ist ein silberglänzendes, weiches, radioaktives Metall. Es bildet eine Vielzahl verschiedener Legierungen.
 Uran Uran ist ein silberglänzendes, weiches, radioaktives Metall. Es bildet eine Vielzahl verschiedener Legierungen. Bei Raumtemperatur läuft auch massives Uranmetall an der Luft an. Dabei bilden sich
Uran Uran ist ein silberglänzendes, weiches, radioaktives Metall. Es bildet eine Vielzahl verschiedener Legierungen. Bei Raumtemperatur läuft auch massives Uranmetall an der Luft an. Dabei bilden sich
Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes
 DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen 5 Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Älterwerden und der Einfluss von Kontexten 1996 2002 2008 2011
DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen 5 Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Älterwerden und der Einfluss von Kontexten 1996 2002 2008 2011
FORTSCHRITT IST UNSERE BESTIMMUNG
 FORTSCHRITT IST UNSERE BESTIMMUNG SIMPATEC DIE SIMULATIONSEXPERTEN Our ideas Your future < Herausforderung Maßstäbe setzen. Neues schaffen. Fordern Sie uns heraus. Mit Enthusiasmus und Know-how Herstellungsverfahren
FORTSCHRITT IST UNSERE BESTIMMUNG SIMPATEC DIE SIMULATIONSEXPERTEN Our ideas Your future < Herausforderung Maßstäbe setzen. Neues schaffen. Fordern Sie uns heraus. Mit Enthusiasmus und Know-how Herstellungsverfahren
Kontinentaldrift Abb. 1
 Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica
 Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Ressourcen und ihre Nutzung
 Ressourcen und ihre Nutzung NUTZENERGIE Die Energie, die vom Verbraucher tatsächlich genutzt wird. PRIMÄRENERGIE Energie, die mit den natürlich vorkommenden Energieformen und Energieträgern zur Verfügung
Ressourcen und ihre Nutzung NUTZENERGIE Die Energie, die vom Verbraucher tatsächlich genutzt wird. PRIMÄRENERGIE Energie, die mit den natürlich vorkommenden Energieformen und Energieträgern zur Verfügung
Tierwohl aus Sicht der Tierhygiene und Veterinärmedizin
 Nutztierhaltung: Herausforderungen und Implikationen für die Forschung Tierwohl aus Sicht der Tierhygiene und Veterinärmedizin Prof. Dr. med. vet. Nicole Kemper Institut für Tierhygiene, Tierschutz und
Nutztierhaltung: Herausforderungen und Implikationen für die Forschung Tierwohl aus Sicht der Tierhygiene und Veterinärmedizin Prof. Dr. med. vet. Nicole Kemper Institut für Tierhygiene, Tierschutz und
