Aqua-Schnee im Attersee
|
|
|
- Babette Albert
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Neuhaus, W. (1952): Biologie und Entwicklung von Trichobilharzia szidati n. sp. (Trematoda, Schistosomatidae), einem Erreger von Dermatitis beim Menschen. Z. f. Parasitenkunde 15: Wolf, R; Schäffler, K.; Cerroni, L.; Marth, E. & Kerl, H. (1995): Cercarien-Dermatitis in der Steiermark. H + G 70 (2): Adresse der Autoren: Robert Konecny, Dr. Helmut Sattmann: Naturhistorisches Museum Wien, 3. Zoologische Abteilung, Burgring 7, 1014 Wien Zur Vervollständigung der Dokumentation ersuchen die Autoren um Meldung von Badedermatitis-Fällen an obige Adresse. Österreichs Fischerei Jahrgang 49/1996 Seite Anna-Maria M. Schmid und Ilse Butz Aqua-Schnee im Attersee Im Juli 1995 klagten an die 50 Badegäste des Attersees im Bereich von Unterach, Attersee und Weyregg über»hautverätzungen«und»ausfall von Körperhaaren«nach dem Besuch des kühlen Naß. Diese Symptome sprechen gegen eine Badedermatitis. In der Tagespresse konnte man mit Erstaunen über die im Attersee auf Badende lauernden Gefahren lesen. Anbei werden von den zahlreichen Pressemeldungen nur zwei der kuriosesten herausgegriffen:»juckreiz durch Kieselalgen«in den Salzburger Nachrichten am 22. Juli 1995:»Kieselalgen sind die wahrscheinlichsten Verursacher der Erkrankungen (Hautreizungen und Ausfall von Körperhaaren). Hierbei handelt es sich um ein Phänomen in der Natur, das in dieser Art bisher noch nirgendwo aufgetreten ist. Die Umweltexperten nehmen an, daß durch die Erwärmung des Attersees, die heuer außergewöhnlich schnell erfolgte, die Kieselalgen schnell wuchsen und damit mehr im See sind als sonst. Beim Baden bleiben die Kieselalgen an den Haaren haften. Nach dem Baden trocknen sie ein und setzen dabei Kieselsäure frei.haariges Attersee-Phänomen: Institut bestätigte Seewalchner Arzt«in den Oberösterreichischen Nachrichten am 31. August 1995:»Jetzt dürfte das Rätsel um die Substanz geklärt sein, die bei einigen Badegästen im Attersee zum Bleichen und Abbrechen von Körperhaaren geführt hatte. Es handelte sich um Wasserstoffperoxyd (H2Ö2), einem Stoffwechselprodukt der Kieselalgen. Das Phänomen ist in Deutschland seit Jahren aus der Nordsee bekannt.«derartige, jeglicher Realität barer Behauptungen in Medien führen zur Verunsicherung von Menschen, bringen einen der schönsten und saubersten Seen Österreichs fahrlässig in Verruf und schaden dem Fremdenverkehr in einer äußerst unverantwortlichen Weise. Solche Art der Berichterstattung degradiert sich selbst zu unqualifiziertem Alltagsgewäsch und schadet wesentlich mehr, als sie informativ nützt. Untersuchungsprogramm Diesen Horrormeldungen in der Presse zum Trotz stürzten sich drei todesmutige weibliche Testpersonen am 1. August 1995 vom Strandbad Unterach aus in die Fluten des Attersees. Keine der Testpersonen hatte vor dem Schwimmen Körperlotion oder Sonnencremes verwendet. Nach einem halbstündigen, äußerst vergnüglichen Aufenthalt im Wasser harrten die drei in banger Erwartung während einer 15minütigen Lufttrocknung, ob auch bei ihnen die Piranha-Kieselalgen zugebissen hätten. Dann wurden jeweils vom linken Unterarm der Testpersonen mit einer Pinzette Körperhaare entfernt und diese 85
2 Tabelle 1: Wasserchemismus des Attersees am 13. Juli 1995 an der tiefsten Stelle (Nr. 38) und am 1. August 1995 an der Seeobero> fläche in der Unteracher Bucht im Einflußbereich der Mondseer Ache (Nr. 1), Weyregger Bucht in der Nähe des öffentlichen Bades (Nr. 2) und in der Seemitte auf der Höhe Stockwinkel (Nr. 3) Aus- fahrts- Nr. Datum Stelle, Ortsbezeichnung Sichttiefe m Seefarbe n. FU Seegrund m Witterung ,1995 Tiefste Stelle -3,9 milchig-grün -170,5 heiter 2-08,55 Aus- fahrts- Nr. Datum Tiefe m Temp. C o2 Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter o2 Satt. % ph LF 25 C ßS SBV PO/-P Ks (4,3) mval Ges-P roh Ges-P filt Ges-P part NH+-N NO;-N Lufttemp. C CI Fe2H ,0 22,7 9, ,0 22,7-2,0 22,7 9, , , ,9 0,5-3,0 22,7-4,0 21,5-5,0 19,4 11, , , ,9 0,4-6,0 17,3-7,0 16,3-8,0 14,5 12, ,0 13,3-10,0 12,4 12, , , ,9 1,5-12,0 11,9 12, ,0 9,8 11, , , ,9 1,8-20,0 7,2 11, , , ,9 2,0-40,0 5,5 11,0 93 8, , ,9 2,1-60,0 5,2 11,0 92 8, , ,9 2,2-80,0 5,2 11,0 92 8, , ,9 2,2-100,0 4,9 10,8 90 8, , ,0 2,5-120,0 4,8 10,8 90 8, , ,0 2,6-140,0 4,8 8, , ,0 2,6-160,0 4,6 10,5 87 8, , ,1 2,8-169,6 4,6 10,2 84 8, , ,1 2, , Seemitte~(3), Bucht v. Unterach (1), Bucht v. Weyregg (2) Seefarbe: türkis Witterg.: heiter Uhrzeit: , ,0 24,0 8, , , ,0 23,0 8, , , ,0 23,0 8, , ,1 Bundesamt für Wasserwirtschaft Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde, A-5310 Mondsee, Schärfling 18 SiO Windstärke Uhrzeit Winterdecke cm Ges. Härte dh Extinktionskoeffizient KMnO, 1% Lichttiefe in m
3 Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter sofort staubfrei für die Rasterelektronenmikroskopie fachgerecht montiert. Vom Gen darmerieboot aus wurden innerhalb von 1 m Wassertiefe mit einem Netz (30 /um Ma schenweite) Planktonproben in der Bucht von Unterach, Weyregg und in der Seemitte auf der Höhe von Stockwinkel gezogen. Diese unfixierten Proben wurden im Labor im Lichtmikroskop untersucht, mittels Tusche Gallertbildungen sichtbar gemacht, anioni sche Polysaccharide an fixierten Proben mittels Toluidinblaufärbung nachgewiesen, Präparate für die Rasterelektronenmikroskopie hergestellt und Kalziumkarbonat auf grund seiner Reaktion mit verdünnter Salzsäure nachgewiesen. Ergebnisse Wasserchemismus des Attersees Wasserproben, welche am 13. Juli 1995 im Rahmen einer routinemäßigen Gütekontrolle in der Seemitte gezogen wurden (Tab. 1), wiesen keine Auffälligkeiten auf und bestätigen den oligotrophen Zustand des Attersees (Moog, 1989). Die Sauerstoffübersättigung des Wassers, die höheren ph-werte und die geringere Alkalinität (Gehalt an gelöstem Kalk = Kalziumbikarbonat) in der wärmeren oberen Wasserzone (Epilimnion) gegenüber den Werten der Tiefenzone (Hypolimnion) sind die Folge einer biogenen Entkalkung des Wassers durch die Photosynthese (Assimilationstätigkeit) der Algen. Dazu kommt eine chemische Kalkfällung durch die starke Erwärmung des Wassers. Die in Schwebe befind lichen Kalkpartikel im Wasser bewirken, daß der Attersee im Sommer eine satt-türkise Farbe aufweist. Aus den am 1. August 1995 an der Oberfläche des Attersees gezogenen Proben ist ersichtlich, daß in der Unteracher Bucht das Wasser höhere Mengen an gelöstem und partikulärem Phosphor enthält als jenes der Weyregger Bucht und der Seemitte. Dies ist auf den lokalen Einfluß der aus dem Mondsee abfließenden Seeache zurückzuführen, welche den Hauptteil an Phosphor in den Attersee transportiert (Moog, 1989). Die ange troffenen Algen Oscillatoria rubescens und Botryococcus braunii sind typische Anzeiger für eine erhöhte Trophie der Unteracher Bucht. Abb. 1: Aqua-Schnee in der Seemitte des Atter sees auf der Höhe Stockwinkel am 1. August Rasterelektronenmikroskopie 1 :1000. In der Schleimsubstanz befinden sich Kieselalgen, Kalkpartikel und tierische Reste. Abb. 2: Haar einer Testperson nach dem Baden im Attersee am 1. August Rasterelektronen mikroskopie 1 :2000. Auf dem Haar befinden sich Schleimfäden mit ein gefangenen Kieselalgen und Kalkpartikel. 87
4 Haar un tersuch ung Haardicke und Haarstruktur der 3 Testpersonen unterscheiden sich deutlich. Nur bei Testperson 3 (mit feinen blonden Körperhaaren) waren mehr als 50% der Haare mit Schleimfäden und darin gefangenen Kalkkristallen, koloniebildenden Grünalgen (Botryococcus) und Kieselalgen (Cyclotella) verklebt (Abb. 2). Bei den beiden anderen Testpersonen befanden sich nur vereinzelte Cyclotellen auf den Haaren. Planktonuntersuchung Im Planktonnetz befanden sich zum Überbegriff»Detritus«gehörende Pflanzenreste, Tierreste (Fragmente von Insekten, Kleinkrebsen, Rädertieren...) sowie Pilzfäden, Kalkkristalle und planktische (freischwebende) Algen (Tab. 2, Abb. 1). Im Uferbereich sammelt sich der durch die Photosynthese der benthischen (am Boden lebenden) und epiphytischen (auf Pflanzen lebenden) Algen produzierte Sauerstoff in Form von Gasbläschen im Netzwerk von Gallerten, Schleimen, abgestorbenen Pflanzenresten usw. an. Dadurch steigt dieses Konglomerat organischer und anorganischer Feststoffe mit den darin befindlichen benthischen Algen an die Oberfläche und fängt dabei zusätzlich planktische Organismen ein. Dies erklärt, warum in den Flocken der Seebuchten (Proben 1, 2) im Gegensatz zu den Flocken der Seemitte (Probe 3) neben den planktischen auch benthische und epiphytische Algen vorhanden waren. Mit chinesischer Tusche (Negativ-Kontrastierung) und Toluidinblaufärbung konnten Algen-Gallerten sichtbar gemacht werden, welche am massivsten bei Botryococcus braunii ausgebildet waren. Alle Planktonproben aller Standorte sowie die Haarproben der Testperson 3 zeigten zahlreiche Partikel von unregelmäßig würfeliger Gestalt. Bei Zugabe von l%iger Salzsäure lösten sich die Partikel unter Bläschenbildung auf, ein Indiz dafür, daß es sich bei diesen um Kalk (Kalziumkarbonat = C ac 03) handelte. Zusammenfassung und Diskussion Im Wasser befinden sich mit freiem Auge nicht sichtbare Netzwerke aus Gallerte und Schleimen, hochpolymere Sekretionsprodukte, welche von Algen (vorwiegend Grünalgen) und Tieren (Zooplankton und Fischen) abgestoßen werden. Von Fischen ist mittlerweile bekannt, daß sie durch Schleimabsonderung den Reibungswiderstand reduzieren und somit, ohne erhöhten Energieaufwand, die Schwimmgeschwindigkeit erhöhen können (Coineau und Kresling, 1989). In solchen Netzwerken von Schleimfäden verfangen sich Detritus (abgestorbene Pflanzen- und Tierreste), Bakterien, Pilze, Algen, Einzeller und feine mineralische Partikel (z. B. Kalzit). Diese Schwebflocken werden als»aqua-schnee«bezeichnet. Während in den Meeren die Bedeutung des»marine snow«als Nahrungsressource und schützender Lebensraum für Organismen seit Jahren bekannt ist (siehe Refs. in Iriberri u. Herndl, 1995), fand der»lake snow«des Süßwassers erst kürzlich die ihm zustehende Beachtung am Beispiel Bodensee (Grossart u. Simon, 1993; Grossart, 1996). Berichte über»hautverätzungen und Haarausfall«bei Schwimmern des Bodensees gibt es nicht. Es ist anzunehmen, daß der»aqua-schnee«mosaikartig in Flocken im See verteilt ist, und ein Schwimmer trifft dann mehr oder weniger zufällig auf eine klebrige Gallertwolke, wie unsere Testperson 3. Bei Lufttrocknung bleibt die Gallerte und somit auch die in ihr eingefangenen kleinen Algen und Partikel dann auf den Haaren und der Haut des Schwimmers kleben. Für alle 3 Testpersonen des 1. August 1995 waren diese Ablagerungen auf den Haaren weder makroskopisch sichtbar noch fühlbar, noch lösten sie Haarausfall, Juckreiz oder Hautrötungen aus, kurzum die 3 Testpersonen hatten ein rundum beglückendes Schwimmerlebnis. Die häufigste Alge am 1. August 1995 im Attersee war die Kieselalge Cyclotella sp., wahrscheinlich comensis (Abb. 3). Diese winzige planktische Kieselalge (ihr Durchmesser ist ca. Vioo mm!) produziert weder Chitinfäden noch Schleim. Die für unsere Voralpenseen sonst typischen großen Kieselalgenarten und -kolonien fehlten zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich wird eine Sedimentation der großen Algenformen durch die bio- 88
5 Tabelle 2: Ergebnis der mit dem Planktonnetz gezogenen Proben Entnahmeort Algen Unteracher Bucht, rechts von Seeache Probe 1 Weyregger Bucht vor Seebad Probe 2 Planktische Blaualgen Oscillatoria rubescens Merismopedia + Grünalgen Botryoccus braunii Pediastrum duplex + + Sphaefocystis schröteri + Kieselalgen Cyclotella spp. comensis Fragilaria crotonensis Tabellaría flocculosa + Andere Algengruppen Ceratium cornutum Ceratium hirundinella Cosmarium + Dinobryon divergens + + Mougeotia + Peridinium sp Zygnema + Benthische/epiphytische Kieselalgen Achanthes minutissima + Achanthes spp. + Amphora ovalis + Cymbella cistula + Cymbella lanceolata + Cymbella ventricosa + + Denticula tenuis + Diatoma vulgare + Diatoma hiemale + Gomphonema + Gyrosigma acuminatum + + Navícula cincta + Navícula cryptocephala + + Navícula oblonga + + Nitzschia palea + Rhoicosphenia curvatum + Detritus* Kalkpartikel * abgestorbene Pflanzen und Tierteile (Fragmente von Insekten, Krebschen) usw. Relative Häufigkeit des Vorkommens der Organismen in der Probe: massenhaft + + häufig + vereinzelt Seemitte Höhe Stockwinkel Probe 3 89
6 Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter gene Entkalkung und durch ein Festsetzen der Kalkpartikel auf den Aigen-Ober flächen beschleunigt. Mechanische Be kämpfung von Algen in Karpfenteichen durch Sedimentation mit feinen Schweb stoffen (z. B. Kalkpartikel) gehört seit Jah ren zur allgemeinen Praxis. Die starke bio gene Entkalkung im Attersee ist aus der Literatur bekannt. Schröder (1982) gibt für 1979 eine Entkalkung im Epilimnion im Ausmaß von 16,0 g/m 2 C ac 03 im ober sten Meter und mit 114,5 g/m 2 C ac 03 in den obersten 10 m Wassersäule in der Hauptsaison Juni-September an. Der Kalk sedimentiert, reißt unbewegliche Plank ton-organismen mit sich, während beweg liche Algen (Ceratium) und Zooplankton ausweichen können, und bildet im See Kalkbänke. Abb. 3: Eine Kette von Cyclotella spp. comensis (Kieselalge) in der Planktonprobe des Attersees am 1. August Rasterelektronenmikroskopie 1 :7000. Die Zellen werden von anionischen Polysaccha riden zusammengehalten. Was kann am Aqua-Schnee gefährlich sein für den Menschen? Extrazelluläre Gallerten und Schleime sind für aquatische Pflanzen und Tiere aus vielerlei Gründen lebensnotwendig; eine schädigende Wirkung auf Wirbeltiere inklusive Mensch ist unbekannt. In kleinen stehenden Gewässern (Tümpeln, Teichen) kann es jedoch Vorkommen, daß die extrazel lulären Gallerten mancher Blaualgen (z. B. Mycrocystis-Anen) Bakterien beherbergen, die Toxine produzieren (Viehsterben an Tränken). Kieselsäure natürlicher Gewässer ist auf die Verwitterung von Silikatgesteinen zurückzu führen und liegt in toxikologisch und hygienisch unbedenklicher Form vor. Die Verfüg barkeit der gelösten Kieselsäure steuert Wachstum und Populationsdichte der Kiesel algen. Kieselalgen lagern Silizium als Silikat in hydratisierter und amorpher Form (Si02.nH20 ) in die Zellwand ein und bilden wunderschön ornamentierte, widerstands fähige»schalen«aus Opal (Abb. 3). Im Attersee ist am 13. Juli 1995 der Gehalt an Kie selsäure im Epilimnion (die von Badegästen durchschwommene Region) als Folge der hohen Produktionsrate der Kieselalgen deutlich geringer als im Hypolimnion (Tab. 1). Sowohl lebende als auch luftgetrocknete Kieselalgen enthalten keine freie Kieselsäure, können daher auch keine abgeben, so daß Verätzungen an Haut und Haaren absolut auszuschließen sind. Im Gegenteil, Schalen von Kieselalgen finden als»kieselgur«gemeinsam mit Tonsilikaten vielfach Anwendung in Medizin und Kosmetik. Peroxide entstehen als kurzfristige (Millisekunden!) Zwischenprodukte bei der Photo synthese von allen Pflanzen (auch Gräsern und Bäumen) und werden, da sie auch für die Pflanzen selbst als Zellgifte wirken, sofort von den entsprechenden Enzymen der Zelle (Peroxidasen und Katalasen) in Wasser und Sauerstoff zerlegt. Sie gelangen unter normalen Bedingungen niemals aus einer Zelle in deren Umgebung. Die Informationen, daß»wasserstoffperoxid, ein Stoffwechselprodukt der Kieselalgen (sic!), seit Jahren die gleichen schädigenden Phänomene in der Nordsee hervorruft«(oö. Nachrichten, 31. August 1995), erweckte in Fachkreisen großes Erstaunen. Experten des Alfred Wege ner Instituts für Polar- und Meeresforschung, das bedeutendste Marinbiologische Insti tut Deutschlands, beurteilen dies als unwissenschaftliche Falschmeldung. Auch in Limnologenkreisen wird diese Möglichkeit von Fachleuten verneint. Hinzu kommt, daß 90
7 marine und Süßwasser-Ökosysteme absolut nicht vergleichbar sind. Die Konzentration an Peroxid, die nötig wäre, um eine Hautverätzung beim Menschen hervorzurufen, hätte Organismen vorher längst selbst getötet, d. h. Organismen können diese Menge niemals produzieren. Eine photochemische Reaktion kann allerdings Wasser in geringe Mengen Wasserstoffperoxid (H20 2) und Ozon ( 0 3) zerlegen. Dies nützte man früher zur Rasenbleiche der Wäsche (Römpp, 1993). Deutlich sichtbar ist, daß sonnengetrocknetes Haar durch die Bleiche heller, aber auch spröder wird. Wenn die Verätzungen an Haut und Haaren der Badenden im Attersee tatsächlich durch im Wasser vorhandene Peroxide hervorgerufen worden wäre, hätten Schäden auch an Fischen oder Plankton auftreten müssen. Diesbezügliche Beobachtungen wurden jedoch nicht gemacht. Sollte es sich nicht um»hautverätzungen und Haarausfall«laut eingangs zitierter Medienberichte, sondern um eine mechanische Schädigung der sonnenstrapazierten Haut und Haare in Kombination mit eintrocknendem, kalkinkrustiertem»aqua- Schnee«und dadurch bedingte Hautirritationen handeln, dann wäre wohl die Reaktion und Aufregung der Betroffenen und der Presse doch sehr überzogen. Zusätzlich kann eine besondere, individuelle Sensibilität in Zusammenwirkung mit oben genannten Faktoren genauso wenig ausgeschlossen werden wie die Abgabe von Substanzen aus dem Sekundärstoffwechsel höherer Pflanzen (z. B. Doldenblütler, Primeln etc.), die erst unter UV-Einfluß Hautrötungen hervorrufen, wenn die Badegäste nach dem Schwimmen auf der Badewiese ihr Sonnenbad genießen. Es erscheint uns jedoch als voreilig und äußerst unwissenschaftlich, den»schwarzen Peter«für eine Hautrötung, deren Ursache unbekannt ist, einer kleinen, unschuldigen Kieselalge zuzuschieben, nur weil sie die einzige ist, die man als solche identifizieren konnte. Darüber hinaus hat diese Eskalation der Pressefreiheit einer ganzen Region enormen Schaden zugefügt. Danksagung Wir danken Frau Univ.-Prof. Elsa Kusel und Herrn Dr. Kurt Schwarz für die Bestätigung unserer Identifizierung von Oscillatoria rubescens und Botryococcus braunii, Christine Mayer für Mithilfe in der Dunkelkammer, Ing. Reinhold Truzka für die chemische Analyse der Wasserproben und der Gendarmerie Seewalchen für die Bereitstellung eines Bootes. LITERATUR Coineau, I., Kresling, B. (1989): Erfindungen der Natur. Bionik - die Technik lernt von Tieren und Pflanzen. Tessloff Verlag. Grossart, H.-P. (1996): Auftreten, Bildung und mikrobielle Prozesse auf makroskopischen organischen Aggregaten (Lake Snow) und ihre Bedeutung für den Stoffumsatz im Bodensee. Konstanzer Dissertationen 494, Hartung Gorre Verlag, Konstanz; pp 223. Grossart, H.-P., Simon, M. (1993): Limnetic macroscopic organic aggregates (lake snow): Occurrence, characteristics, and microbial dynamics in Lake Constance. Limnol. Oceanogr. 38 (3): Iriberri, J., Herndl, G. J. (1995): Formation and utilization of amorphous aggregates in the sea: ecological significance. Microbiologia SEM 11: Moog, O. (1989): Attersee. In: Seenreinhaltung in Österreich Fortschreibung , Schriftenreihe»Wasserwirtschaft«, 1989, Römpp (1993): Chemie-Lexikon, 9. Auflg. Schröder, H. G. (1982): Biogene benthische Entkalkung als Beitrag zur Genese limnischer Sedimente. Beispiel: Attersee (Salzkammergut, Oberösterreich). Dissertation, Univ. Göttingen. Anschrift der Verfasserinnen: Univ.-Doz. Dr. Anna-Maria M. Schmid, Institut für Pflanzenphysiologie der Universität Salzburg, 5020 Salzburg, Heilbrunner Straße 34 Dr. Ilse Butz, Bundesamt für Wasserwirtschaft; Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde, 5310'Mondsee, Schärfling 18 91
Lünersee. Letzte Untersuchung Probenahme: Uhrzeit: 09:30 10:00. schwach windig. Lufttemperatur: 10 C Sichttiefe: maximale Tiefe:
 Lünersee Abbildung: Übersichtsplan, Lage der Probenstelle, Naturaufnahme Letzte Untersuchung Probenahme: 28.10.2009 Uhrzeit: 09:30 10:00 Witterung: Wind: heiter Lufttemperatur: 10 C Sichttiefe: maximale
Lünersee Abbildung: Übersichtsplan, Lage der Probenstelle, Naturaufnahme Letzte Untersuchung Probenahme: 28.10.2009 Uhrzeit: 09:30 10:00 Witterung: Wind: heiter Lufttemperatur: 10 C Sichttiefe: maximale
Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften
 Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften www.icbm.de/pmbio Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie
Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften www.icbm.de/pmbio Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie
Aquatische Ökosysteme
 Vortrag am: 26.03.2009 Fach: Geografie Aquatische Ökosysteme Ein Vortrag von Katrin Riemann, Josephin Rodenstein, Florian Sachs und Philipp Sachweh Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg Gliederung 1 Das
Vortrag am: 26.03.2009 Fach: Geografie Aquatische Ökosysteme Ein Vortrag von Katrin Riemann, Josephin Rodenstein, Florian Sachs und Philipp Sachweh Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg Gliederung 1 Das
DOWNLOAD. Vertretungsstunde Biologie 9. 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren. Corinna Grün/Cathrin Spellner
 DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
3.1.2 Oberflächenwasser
 3.1.2 Oberflächenwasser - Die chemische Zusammensetzung hängt vom Untergrund des Einzugsgebietes, von der Zusammensetzung und der Menge des Niederschlages sowie von Zu- und Abfluss ab. - Flusswasser hat
3.1.2 Oberflächenwasser - Die chemische Zusammensetzung hängt vom Untergrund des Einzugsgebietes, von der Zusammensetzung und der Menge des Niederschlages sowie von Zu- und Abfluss ab. - Flusswasser hat
Für effiziente Methanproduktion von Bakterien lernen
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/fuer-effizientemethanproduktion-von-bakterien-lernen/ Für effiziente Methanproduktion von Bakterien lernen Seit 25 Jahren
Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/fuer-effizientemethanproduktion-von-bakterien-lernen/ Für effiziente Methanproduktion von Bakterien lernen Seit 25 Jahren
150 Jahre 23. und 24. Oktober 2008
 Programm: Donnerstag, 23.10.2008 09:00 10:15 Uhr Geringfügige Änderungen im Programm sind möglich! Begrüßung Hunger, H. Abriss zur Biographie von Johann Jakob Heckel Svojtka, M., Salvini-Plawen, L. & Mikschi,
Programm: Donnerstag, 23.10.2008 09:00 10:15 Uhr Geringfügige Änderungen im Programm sind möglich! Begrüßung Hunger, H. Abriss zur Biographie von Johann Jakob Heckel Svojtka, M., Salvini-Plawen, L. & Mikschi,
Biologische Meereskunde
 Ulrich Sommer Biologische Meereskunde 2. iiberarbeitete Auflage Mit 138 Abbildungen 4y Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einfuhrung ^^/^^^^^^^^i^^g^^gg/^^^^g^^^g^^ggg^ 1.1 Biologische Meereskunde - Meeresokologie
Ulrich Sommer Biologische Meereskunde 2. iiberarbeitete Auflage Mit 138 Abbildungen 4y Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einfuhrung ^^/^^^^^^^^i^^g^^gg/^^^^g^^^g^^ggg^ 1.1 Biologische Meereskunde - Meeresokologie
Algenblüten in Binnengewässern. Badegewässerqualität in Schleswig-Holstein. Ministerium für Soziales, Landesamt Gesundheit, für
 Ministerium für Soziales, Landesamt Gesundheit, für Gesundheit Familie, Jugend und Arbeitssicherheit und Senioren des Landes Schleswig-Holstein Badegewässerqualität in Schleswig-Holstein Algenblüten in
Ministerium für Soziales, Landesamt Gesundheit, für Gesundheit Familie, Jugend und Arbeitssicherheit und Senioren des Landes Schleswig-Holstein Badegewässerqualität in Schleswig-Holstein Algenblüten in
Natürliche ökologische Energie- und Stoffkreisläufe
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Initiiert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Initiiert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
Was ist Xylit und warum ist es so wirksam für die Algenbekämpfung und Wasserreinigung in Teichen?
 Was ist Xylit und warum ist es so wirksam für die Algenbekämpfung und Wasserreinigung in Teichen? Ausgangslage: Vielen Gewässern fehlen die Grundlagen für eine vielfältige Strukturiertheit. Nur wenn unterschiedliche
Was ist Xylit und warum ist es so wirksam für die Algenbekämpfung und Wasserreinigung in Teichen? Ausgangslage: Vielen Gewässern fehlen die Grundlagen für eine vielfältige Strukturiertheit. Nur wenn unterschiedliche
Biodiversitätsstudie in alpinen Seen der Niederen Tauern
 Biodiversitätsstudie in alpinen Seen der Niederen Tauern Forschungsprojekt DETECTIVE, Decadal Detection of Biodiversity in Alpine Lakes Institut für Limnologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Biodiversitätsstudie in alpinen Seen der Niederen Tauern Forschungsprojekt DETECTIVE, Decadal Detection of Biodiversity in Alpine Lakes Institut für Limnologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
S Primärproduktion >> Watt für Fortgeschrittene Naturschule Wattenmeer
 Wie funktioniert Primärproduktion im Meer? Aufgabe 1: Beschäftigen Sie sich mit den Steuerungsfaktoren der marinen Primärproduktion. Es gibt fünf Stationen, die Sie in beliebiger Reihenfolge durchlaufen
Wie funktioniert Primärproduktion im Meer? Aufgabe 1: Beschäftigen Sie sich mit den Steuerungsfaktoren der marinen Primärproduktion. Es gibt fünf Stationen, die Sie in beliebiger Reihenfolge durchlaufen
Ökosysteme unter Druck: der Einfluss von Nährstoffen in Gewässern
 Ökosysteme unter Druck: der Einfluss von Nährstoffen in Gewässern Piet Spaak Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs Zu viel Phosphor verursacht Probleme in Seen 2 Zu viel Phosphor verursacht
Ökosysteme unter Druck: der Einfluss von Nährstoffen in Gewässern Piet Spaak Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs Zu viel Phosphor verursacht Probleme in Seen 2 Zu viel Phosphor verursacht
Schwärmen und Gleiten bei Mikroorganismen
 Schwärmen und Gleiten bei Mikroorganismen VerfasserInnen: Betreuerinnen: Bettina Schulthess, s0171291@access.unizh.ch Nadja Weisshaupt, s0170097@access.unizh.ch Alfred Mody Ayieye, s9873317@access.unizh.ch
Schwärmen und Gleiten bei Mikroorganismen VerfasserInnen: Betreuerinnen: Bettina Schulthess, s0171291@access.unizh.ch Nadja Weisshaupt, s0170097@access.unizh.ch Alfred Mody Ayieye, s9873317@access.unizh.ch
Wasserqualität vom Bodensee & Rhein Ein Vergleich
 Wasserqualität vom Bodensee & Rhein Ein Vergleich Worin baden wir im Sommer eigentlich? Fabian Eckert Semira Jawdat Aniela Schafroth Danijel Zivoi Betreuung durch Herrn Thomas Baumann Kantonsschule Kreuzlingen
Wasserqualität vom Bodensee & Rhein Ein Vergleich Worin baden wir im Sommer eigentlich? Fabian Eckert Semira Jawdat Aniela Schafroth Danijel Zivoi Betreuung durch Herrn Thomas Baumann Kantonsschule Kreuzlingen
Leckner See. Letzte Untersuchung. schwach windig Lufttemperatur: maximale Tiefe: Nutzung/Aktivität: Anmerkung:
 Leckner See Abbildung: Übersichtsplan, Lage der Probenstelle, Naturaufnahme Letzte Untersuchung Probenahme: 04.09.2006 Uhrzeit: 11:20 12:30 Witterung: heiter Wind: schwach windig Lufttemperatur: 22 C Sichttiefe:
Leckner See Abbildung: Übersichtsplan, Lage der Probenstelle, Naturaufnahme Letzte Untersuchung Probenahme: 04.09.2006 Uhrzeit: 11:20 12:30 Witterung: heiter Wind: schwach windig Lufttemperatur: 22 C Sichttiefe:
ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen
 ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen ChemikerInnen verwenden den ph-wert um festzustellen, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Man verwendet eine Skala von 0-14:
ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen ChemikerInnen verwenden den ph-wert um festzustellen, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Man verwendet eine Skala von 0-14:
GRUNDWISSEN BIOLOGIE DER 6. JAHRGANGSSTUFE
 Auszug aus dem Lehrplan: Sie verstehen wichtige Beziehungen zwischen Körperbau und Lebensweise bei Wirbeltieren. Sie können die Verwandtschaft der Wirbeltiere anhand ausgewählter e nachvollziehen. Sie
Auszug aus dem Lehrplan: Sie verstehen wichtige Beziehungen zwischen Körperbau und Lebensweise bei Wirbeltieren. Sie können die Verwandtschaft der Wirbeltiere anhand ausgewählter e nachvollziehen. Sie
Synthetische Biologie
 Synthetische Biologie Segen oder Fluch? http://www.kwick.de Science Bridge - SG 19.11.2010 1 Gliederung 2 Was ist Synthetische Biologie? Fortschritt und Potential der synthetischen Biologie Ethische Aspekte
Synthetische Biologie Segen oder Fluch? http://www.kwick.de Science Bridge - SG 19.11.2010 1 Gliederung 2 Was ist Synthetische Biologie? Fortschritt und Potential der synthetischen Biologie Ethische Aspekte
Ökosystem Flusslandschaft
 Naturwissenschaft Philipp Schönberg Ökosystem Flusslandschaft Studienarbeit Das Ökosystem Flusslandschaft Ökologie Informationen zum Ökosystem Flusslandschaft Philipp Schönberg Abgabetermin: 20. Juni
Naturwissenschaft Philipp Schönberg Ökosystem Flusslandschaft Studienarbeit Das Ökosystem Flusslandschaft Ökologie Informationen zum Ökosystem Flusslandschaft Philipp Schönberg Abgabetermin: 20. Juni
Biozide - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen
 Biozide - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen Dr. Carsten Bloch Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 1 Moosbekämpfungsmittel Rodentizide Grünbelagsentfernen Steinreiniger Fungizide Herbizide
Biozide - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen Dr. Carsten Bloch Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 1 Moosbekämpfungsmittel Rodentizide Grünbelagsentfernen Steinreiniger Fungizide Herbizide
winzig aber wichtig Plankton im Neuenburger-, Murten- und Bielersee
 winzig aber wichtig Plankton im Neuenburger-, Murten- und Bielersee Kieselalge [ Asterionella formosa ] Seeplankton Von blossem Auge unsichtbar schweben in jedem Wassertropfen Tausende von winzigen Algen.
winzig aber wichtig Plankton im Neuenburger-, Murten- und Bielersee Kieselalge [ Asterionella formosa ] Seeplankton Von blossem Auge unsichtbar schweben in jedem Wassertropfen Tausende von winzigen Algen.
b) Warum kann man von Konstanz aus Bregenz nicht sehen?
 Der Bodensee ein Arbeitsblatt für Schüler der 5. und 6. Klasse Der Bodensee ist mit einer Gesamtfläche von 571,5 km 2 der zweitgrößte See im Alpenvorland. Er besteht eigentlich aus zwei Seeteilen, dem
Der Bodensee ein Arbeitsblatt für Schüler der 5. und 6. Klasse Der Bodensee ist mit einer Gesamtfläche von 571,5 km 2 der zweitgrößte See im Alpenvorland. Er besteht eigentlich aus zwei Seeteilen, dem
Eutrophierung und Reoligotrophierung in Schweizer Seen: die Folgen für das Plankton
 Eutrophierung und Reoligotrophierung in Schweizer Seen: die Folgen für das Plankton Piet Spaak Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs Zuviel Phosphor verursacht Probleme in Seen In meinem
Eutrophierung und Reoligotrophierung in Schweizer Seen: die Folgen für das Plankton Piet Spaak Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs Zuviel Phosphor verursacht Probleme in Seen In meinem
Sünser See. Letzte Untersuchung Probenahme: Uhrzeit: 9:30 10:30. Lufttemperatur: 19 C. maximale Tiefe: Anmerkung: -
 Sünser See Abbildung: Übersichtsplan, Lage der Probenstelle, Naturaufnahme Letzte Untersuchung Probenahme: 21.09.2006 Uhrzeit: 9:30 10:30 Witterung: Wind: heiter windstill Lufttemperatur: 19 C Sichttiefe:
Sünser See Abbildung: Übersichtsplan, Lage der Probenstelle, Naturaufnahme Letzte Untersuchung Probenahme: 21.09.2006 Uhrzeit: 9:30 10:30 Witterung: Wind: heiter windstill Lufttemperatur: 19 C Sichttiefe:
Welches i st ist der perfekte perfekte Teich?
 Welches ist der perfekte Welches ist der perfekte Teich? 2 verschiedene Grundtypen In der Natur finden wir verschiedene Grundtypen von Gewässern. Zwei dieser Typen werden heute beim Bau von biologischen
Welches ist der perfekte Welches ist der perfekte Teich? 2 verschiedene Grundtypen In der Natur finden wir verschiedene Grundtypen von Gewässern. Zwei dieser Typen werden heute beim Bau von biologischen
Wasserpflanzen in hessischen Badeseen und ihre Auswirkungen auf den Badebetrieb
 Wasserpflanzen in hessischen Badeseen und ihre Auswirkungen auf den Badebetrieb Dr. Egbert Korte BFS-Riedstadt 8. Hessischer Erfahrungsaustausch Badegewässer Donnerstag, den 25. März 2010, Stadthalle Friedberg
Wasserpflanzen in hessischen Badeseen und ihre Auswirkungen auf den Badebetrieb Dr. Egbert Korte BFS-Riedstadt 8. Hessischer Erfahrungsaustausch Badegewässer Donnerstag, den 25. März 2010, Stadthalle Friedberg
Die entsprechenden Untersuchungen wurden im Argos Control Prüflabor durchgeführt (Prüfbericht Nr. 0500/95 vom ).
 Bericht über die Prüfung Nr. 54.01 1. Prüfauftrag Die Arbeitsweise der Sandreinigungsmaschine SRM 605 wurde am 04.05.1995 auf einem durch den Auftragnehmer ausgewählten Spielplatz in Anwesenheit von Herrn
Bericht über die Prüfung Nr. 54.01 1. Prüfauftrag Die Arbeitsweise der Sandreinigungsmaschine SRM 605 wurde am 04.05.1995 auf einem durch den Auftragnehmer ausgewählten Spielplatz in Anwesenheit von Herrn
Skript zur Kinderuni Vorlesung der Universität Kassel
 Skript zur Kinderuni Vorlesung der Universität Kassel Glibbermonster, Giftzwerge und weiße Riesen - Die spannende Welt der Pilze Prof. Dr. Ewald Langer Pilze sind merkwürdige Lebewesen. Sie werden zu den
Skript zur Kinderuni Vorlesung der Universität Kassel Glibbermonster, Giftzwerge und weiße Riesen - Die spannende Welt der Pilze Prof. Dr. Ewald Langer Pilze sind merkwürdige Lebewesen. Sie werden zu den
 Der Kreislauf des Wassers 1/24 2/24 Fließende und stehende Gewässer Zu den fließenden Gewässern zählen der Bach, der Fluss und der Strom. Das größte, durch Österreich fließende Gewässer ist die Donau (der
Der Kreislauf des Wassers 1/24 2/24 Fließende und stehende Gewässer Zu den fließenden Gewässern zählen der Bach, der Fluss und der Strom. Das größte, durch Österreich fließende Gewässer ist die Donau (der
[ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ]
![[ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ] [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ]](/thumbs/54/33253451.jpg) 2012 Hannah Klingener, Natalja Böhm Otto-Hahn-Gymnasium und Katharina Schwander [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM 16.08.2012] Biologie, LK MSS 13, Herr Kohlhepp S e i t e 1 Inhaltsverzeichnis
2012 Hannah Klingener, Natalja Böhm Otto-Hahn-Gymnasium und Katharina Schwander [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM 16.08.2012] Biologie, LK MSS 13, Herr Kohlhepp S e i t e 1 Inhaltsverzeichnis
IWIllllllllllllllllll Biologie: Grundlagen und Zellbiologie. Lerntext, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Zusammenfassungen
 Naturwissenschaften Biologie: Grundlagen und Zellbiologie Lerntext, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Zusammenfassungen Markus Bütikofer unter Mitarbeit von Zensi Hopf und Guido Rutz W^ ;;;^! ;»*'* '^'*..
Naturwissenschaften Biologie: Grundlagen und Zellbiologie Lerntext, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Zusammenfassungen Markus Bütikofer unter Mitarbeit von Zensi Hopf und Guido Rutz W^ ;;;^! ;»*'* '^'*..
aktiv aquarium boden zerlegt - stopt - düngt nanoaquarium aquarium paludarium terrarium
 aktiv aquarium boden zerlegt - stopt - düngt nanoaquarium aquarium paludarium terrarium protected by patent! farbiger aquarien quarz steinboden nanoaquarium aquarium colomi Colomi CoAqua aktiv Aquariumboden
aktiv aquarium boden zerlegt - stopt - düngt nanoaquarium aquarium paludarium terrarium protected by patent! farbiger aquarien quarz steinboden nanoaquarium aquarium colomi Colomi CoAqua aktiv Aquariumboden
Sinn und Unsinn von Raumluftmessungen bei Schimmelpilzproblemen
 Schimmel-Aktionstag, 12.11.2011 Sinn und Unsinn von Raumluftmessungen bei Schimmelpilzproblemen Dipl.-Biol., Dipl.-Ing. Roland Braun Regionalverband Umweltberatung Nord e.v. / Ingenieurbüro ROLAND BRAUN
Schimmel-Aktionstag, 12.11.2011 Sinn und Unsinn von Raumluftmessungen bei Schimmelpilzproblemen Dipl.-Biol., Dipl.-Ing. Roland Braun Regionalverband Umweltberatung Nord e.v. / Ingenieurbüro ROLAND BRAUN
Das Hustedt Herbarium der Übergang eines mikroskopischen Biodiversitäts Archivs ins digitale Zeitalter
 Das Hustedt Herbarium der Übergang eines mikroskopischen Biodiversitäts Archivs ins digitale Zeitalter Dr. Bánk Beszteri Hustedt Zentrum für Diatomeenforschung Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum
Das Hustedt Herbarium der Übergang eines mikroskopischen Biodiversitäts Archivs ins digitale Zeitalter Dr. Bánk Beszteri Hustedt Zentrum für Diatomeenforschung Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum
Chemie, Kapitel 4 : Chemische Reaktionen und Luft
 Lesen Sie aufmerksam das Kapitel 4.4 und lösen Sie die folgenden Aufgaben: a) Definieren Sie die drei Begriffe in jeweils einem Satz b) Geben Sie ein Beispiel aus dem Alltag Exotherme Reaktion: Endotherme
Lesen Sie aufmerksam das Kapitel 4.4 und lösen Sie die folgenden Aufgaben: a) Definieren Sie die drei Begriffe in jeweils einem Satz b) Geben Sie ein Beispiel aus dem Alltag Exotherme Reaktion: Endotherme
Was ist Plankton? Plankton (gr. das Umherirrende) bezeichnet im Wasser treibende und schwebende Organismen (Victor Hensen 1887 Meeresbiologe, Kiel).
 PLANKTON Einführung in Limnologie und Meeresbiologie Was ist Plankton? Plankton (gr. das Umherirrende) bezeichnet im Wasser treibende und schwebende Organismen (Victor Hensen 1887 Meeresbiologe, Kiel).
PLANKTON Einführung in Limnologie und Meeresbiologie Was ist Plankton? Plankton (gr. das Umherirrende) bezeichnet im Wasser treibende und schwebende Organismen (Victor Hensen 1887 Meeresbiologe, Kiel).
Anlagenreinigung Prozesswasser oder Wasser führender Systeme im Durchmesser von DN 15 bis DN 250
 Anlagenreinigung Prozesswasser oder Wasser führender Systeme im Durchmesser von DN 15 bis DN 250 Anlagenreinigung Prozesswasser oder Wasser führender Systeme Die Reinigung kann durch folgende Methoden
Anlagenreinigung Prozesswasser oder Wasser führender Systeme im Durchmesser von DN 15 bis DN 250 Anlagenreinigung Prozesswasser oder Wasser führender Systeme Die Reinigung kann durch folgende Methoden
Helmut Kokemoor, EM-Fachberatung Landwirtschaft, EM-RAKO, Rahden. Vortrag: Welchen Beitrag kann die EM-Technologie zur Sanierung des Dümmers leisten?
 Helmut Kokemoor, EM-Fachberatung Landwirtschaft, EM-RAKO, Rahden Vortrag: Welchen Beitrag kann die EM-Technologie zur Sanierung des Dümmers leisten? 1 x 1 der Mikrobiologie Was ist EM-Technologie EM-Wirkung
Helmut Kokemoor, EM-Fachberatung Landwirtschaft, EM-RAKO, Rahden Vortrag: Welchen Beitrag kann die EM-Technologie zur Sanierung des Dümmers leisten? 1 x 1 der Mikrobiologie Was ist EM-Technologie EM-Wirkung
Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt?
 Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt? Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 32 Welche Stoffe sind im Abwasser, die dort nicht hinein
Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt? Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 32 Welche Stoffe sind im Abwasser, die dort nicht hinein
I feel goo o d! Wissenschaftliche Grundlagen für klares Wasser. in tropischen Süßwasseraquarien
 I feel goo o d! Wissenschaftliche Grundlagen für klares Wasser in tropischen Süßwasseraquarien Philips hat diesen Wasserreiniger für tropische Aquarien in enger Zusammenarbeit mit Aquarien- und Wasserexperten
I feel goo o d! Wissenschaftliche Grundlagen für klares Wasser in tropischen Süßwasseraquarien Philips hat diesen Wasserreiniger für tropische Aquarien in enger Zusammenarbeit mit Aquarien- und Wasserexperten
Analyse der Chemischen Wasseruntersuchungen der mittleren Aisch 2012
 Analyse der Chemischen Wasseruntersuchungen der mittleren Aisch 2012 Meßstellen: Pegel-Birkenfeld Flß/km60,7 ; oberhalb Wehr Pahres Flß/km49,1 ; Trafo vor Dachsbach Flß/km43,1 Anlagen: Diagramme Chem.
Analyse der Chemischen Wasseruntersuchungen der mittleren Aisch 2012 Meßstellen: Pegel-Birkenfeld Flß/km60,7 ; oberhalb Wehr Pahres Flß/km49,1 ; Trafo vor Dachsbach Flß/km43,1 Anlagen: Diagramme Chem.
Fläche in m 2 25 Millionen 4000 kg ,5 Millionen 400 kg g 1
 Information Im Herbst fallen etwa 25 Millionen Blätter auf einen Hektar (1 ha = 10.000 m2) Boden im Buchenwald. Ihr Gesamtgewicht entspricht ungefähr 4 Tonnen (1 t = 1000 kg; Angaben aus: MAREL 1988, S.
Information Im Herbst fallen etwa 25 Millionen Blätter auf einen Hektar (1 ha = 10.000 m2) Boden im Buchenwald. Ihr Gesamtgewicht entspricht ungefähr 4 Tonnen (1 t = 1000 kg; Angaben aus: MAREL 1988, S.
Info: Blütenpflanzen. Narbe. Blütenkronblatt. Griffel. Staubblatt. Fruchtknoten. Kelchblatt
 Info: Blütenpflanzen Pflanzen sind viel unauffälliger als Tiere und Menschen und finden dadurch oft wenig Beachtung. Doch wer sich mit ihnen näher beschäftigt, erkennt schnell, welche große Bedeutung sie
Info: Blütenpflanzen Pflanzen sind viel unauffälliger als Tiere und Menschen und finden dadurch oft wenig Beachtung. Doch wer sich mit ihnen näher beschäftigt, erkennt schnell, welche große Bedeutung sie
Makro- und Mikro-Flora und -Fauna in der Mikrowelt Aquarium
 Makro- und Mikro-Flora und -Fauna in der Mikrowelt Aquarium Wenn das eigene Aquarium ungeeignet für die Ernährung von bestimmten Organismen ist, sollte man aus Respekt vor dem Individuum auf eine Anschaffung
Makro- und Mikro-Flora und -Fauna in der Mikrowelt Aquarium Wenn das eigene Aquarium ungeeignet für die Ernährung von bestimmten Organismen ist, sollte man aus Respekt vor dem Individuum auf eine Anschaffung
Der Egelsee, ein ganz besonderer Wasser-Lebensraum
 Der Egelsee, ein ganz besonderer Wasser-Lebensraum von Prof. Dr. Ferdinand Schanz, Universität Zürich, Institut für Pfl anzenbiologie. Limnologische Station, Seestr. 187, 8802 Kilchberg; e-mail fschanz@limnol.uzh.ch
Der Egelsee, ein ganz besonderer Wasser-Lebensraum von Prof. Dr. Ferdinand Schanz, Universität Zürich, Institut für Pfl anzenbiologie. Limnologische Station, Seestr. 187, 8802 Kilchberg; e-mail fschanz@limnol.uzh.ch
Haften ohne Klebstoff der Geckofuß
 Bodensee-Naturmuseum Konstanz Botanischer Garten Universität Konstanz Haften ohne Klebstoff der Geckofuß Der Gecko (z.b. der Taggecko, Phelsuma) zählt zu den interessantesten und gleichzeitig spektakulärsten
Bodensee-Naturmuseum Konstanz Botanischer Garten Universität Konstanz Haften ohne Klebstoff der Geckofuß Der Gecko (z.b. der Taggecko, Phelsuma) zählt zu den interessantesten und gleichzeitig spektakulärsten
Nahrungsmittelunverträglichkeit und Nahrungsmittelallergie aus ernährungsmedizinischer Sicht
 Ratgeber Sven-David Müller Nahrungsmittelunverträglichkeit und Nahrungsmittelallergie aus ernährungsmedizinischer Sicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien Richtig essen und
Ratgeber Sven-David Müller Nahrungsmittelunverträglichkeit und Nahrungsmittelallergie aus ernährungsmedizinischer Sicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien Richtig essen und
mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
 mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Franz X Stratil, Wolfgang Ruppert, Reiner Kleinert 1. Auflage mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Franz X Stratil, Wolfgang Ruppert, Reiner Kleinert 1. Auflage mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
Biologische und chemische Vorgänge in stehenden Gewässern. Eine zusammenfassende Betrachtung der Zusammenhänge in einem Gewässer
 Eine zusammenfassende Betrachtung der Zusammenhänge in einem Gewässer Der ph-wert Das Karbonathärte-Puffersystem Algen verstehen und bekämpfen Phosphatfrachten Der Teich Symbiose aller Lebewesen In einem
Eine zusammenfassende Betrachtung der Zusammenhänge in einem Gewässer Der ph-wert Das Karbonathärte-Puffersystem Algen verstehen und bekämpfen Phosphatfrachten Der Teich Symbiose aller Lebewesen In einem
Wissenswertes aus der Welt der Robben
 Wissenswertes aus der Welt der Robben Was sind Ohrenrobben? Wie tief tauchen See-Elefanten? Wer frisst Robben? Warum heissen junge Seehunde «Heuler»? Foto: D. Hauenstein / ASMS Oceancare Abstammung Robben
Wissenswertes aus der Welt der Robben Was sind Ohrenrobben? Wie tief tauchen See-Elefanten? Wer frisst Robben? Warum heissen junge Seehunde «Heuler»? Foto: D. Hauenstein / ASMS Oceancare Abstammung Robben
Ei ne P ä r sentati ti on vo n T om D ro t s e, P t e er Haak k und Patrick Schürmann
 Ei P ä tti T D t P t H k d Eine Präsentation von Tom Droste, Peter Haak und Patrick Schürmann Inhaltsverzeichnis Allgemein: Was ist Stickstofffixierung? Welche Arten der Fixierung gibt es? Welchen Zweck
Ei P ä tti T D t P t H k d Eine Präsentation von Tom Droste, Peter Haak und Patrick Schürmann Inhaltsverzeichnis Allgemein: Was ist Stickstofffixierung? Welche Arten der Fixierung gibt es? Welchen Zweck
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Monitoring und Zustand der Seen und Talsperren
 Platzhalter Grafik (Bild/Foto) Monitoring und Zustand der Seen und Talsperren Dr. Karl-Heinz Christmann Wichtige Überwachungsprogramme an stehenden Gewässern gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nach
Platzhalter Grafik (Bild/Foto) Monitoring und Zustand der Seen und Talsperren Dr. Karl-Heinz Christmann Wichtige Überwachungsprogramme an stehenden Gewässern gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nach
Vorläufiger Bericht Deutscher Ringversuch Benthische Diatomeen 2011
 3.1.2 Genfer See, Schweiz, Alpen- bzw. Voralpensee Probe D 1.1 Autoren: Mirko Dreßler, Petra Werner, Sven Adler Die im Ringtest entsprechend ihres Diatomeentyps als D 1.1 bezeichnete Probe (Genfer See,
3.1.2 Genfer See, Schweiz, Alpen- bzw. Voralpensee Probe D 1.1 Autoren: Mirko Dreßler, Petra Werner, Sven Adler Die im Ringtest entsprechend ihres Diatomeentyps als D 1.1 bezeichnete Probe (Genfer See,
Biologie-Projekt. Saurer Regen ATHENE SAKELLARIOU HEIMBERGER HOLGER INA. -Team LANGLOTZ DANIEL VOLLBRECHT
 Biologie-Projekt Saurer Regen AT INA HO VO -Team ATHENE SAKELLARIOU INA HEIMBERGER HOLGER LANGLOTZ DANIEL VOLLBRECHT Präsentationsgliederung Vorversuch Hauptversuch Auswertung Recherche Ina Daniel Daniel
Biologie-Projekt Saurer Regen AT INA HO VO -Team ATHENE SAKELLARIOU INA HEIMBERGER HOLGER LANGLOTZ DANIEL VOLLBRECHT Präsentationsgliederung Vorversuch Hauptversuch Auswertung Recherche Ina Daniel Daniel
Teil 1 - Mittels Wasserauszug die Bodenfruchtbarkeit selbst überprüfen! (nach Univ. Lek. DI Unterfrauner)
 Teil 1 - Mittels Wasserauszug die Bodenfruchtbarkeit selbst überprüfen! (nach Univ. Lek. DI Unterfrauner) Am 9.3.2015 fand in Wiesen in Zusammenarbeit von Bgld. Landwirtschaftskammer und BIO AUSTRIA Bgld.
Teil 1 - Mittels Wasserauszug die Bodenfruchtbarkeit selbst überprüfen! (nach Univ. Lek. DI Unterfrauner) Am 9.3.2015 fand in Wiesen in Zusammenarbeit von Bgld. Landwirtschaftskammer und BIO AUSTRIA Bgld.
Mess- und Beurteilungsmethoden Seen
 Messmethoden Physikalische Parameter Im Rahmen der Akkreditierung als Umweltlabor nach ISO 17025 sind alle Methoden, von der Probenahme über die Probeaufbereitung, Messung und Auswertung der Ergebnisse
Messmethoden Physikalische Parameter Im Rahmen der Akkreditierung als Umweltlabor nach ISO 17025 sind alle Methoden, von der Probenahme über die Probeaufbereitung, Messung und Auswertung der Ergebnisse
1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze
 1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze Die Chemie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Sie befasst sich mit der Zusammensetzung, Charakterisierung und Umwandlung von Materie. Unter Materie
1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze Die Chemie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Sie befasst sich mit der Zusammensetzung, Charakterisierung und Umwandlung von Materie. Unter Materie
Verrechnungspunkte: Gesamtpunkte: Note:
 Säure-Base-Reaktionen: E. 5. 2 Die Base Ammoniak Bearbeitungszeit: zweimal 45 Minuten Hilfsmittel: Taschenrechner Verrechnungspunkte: Gesamtpunkte: Note: Aufgaben 1 Ammoniak wird heute großtechnisch nach
Säure-Base-Reaktionen: E. 5. 2 Die Base Ammoniak Bearbeitungszeit: zweimal 45 Minuten Hilfsmittel: Taschenrechner Verrechnungspunkte: Gesamtpunkte: Note: Aufgaben 1 Ammoniak wird heute großtechnisch nach
Bionik: Das Spinnennetz. Vortrag von: Milena, Tabitha, Lisa und Svenja
 Bionik: Das Spinnennetz Vortrag von: Milena, Tabitha, Lisa und Svenja 1 Inhalt Netzformen Warum bleiben Spinnen nicht an ihren Netzen kleben? Spinnenseide Herstellungsmöglichkeiten von Spinnenseide Anwendungen
Bionik: Das Spinnennetz Vortrag von: Milena, Tabitha, Lisa und Svenja 1 Inhalt Netzformen Warum bleiben Spinnen nicht an ihren Netzen kleben? Spinnenseide Herstellungsmöglichkeiten von Spinnenseide Anwendungen
Phosphate in der Biologie. Von Christian Kappel
 Phosphate in der Biologie Von Christian Kappel Inhaltsverzeichnis 1.Geschichte des Phosphors 2.Natürliches Vorkommen von Phosphaten 3.Verwendung der Phosphate 4.ATP Phosphate im Organismus Geschichte des
Phosphate in der Biologie Von Christian Kappel Inhaltsverzeichnis 1.Geschichte des Phosphors 2.Natürliches Vorkommen von Phosphaten 3.Verwendung der Phosphate 4.ATP Phosphate im Organismus Geschichte des
Ihr seid herzlich eingeladen in unser Labor für naturwissenschaftliche Experimente.
 Naturwissenschaftliche Experimente Übersicht Datum 5. Juli 2007 Willkommen Ihr seid herzlich eingeladen in unser Labor für naturwissenschaftliche Experimente. Wir können viele Dinge ausprobieren, kennen
Naturwissenschaftliche Experimente Übersicht Datum 5. Juli 2007 Willkommen Ihr seid herzlich eingeladen in unser Labor für naturwissenschaftliche Experimente. Wir können viele Dinge ausprobieren, kennen
NICHT-CHOLERA-VIBRIONEN. AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
 NICHT-CHOLERA-VIBRIONEN AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit WAS SIND NICHT-CHOLERA-VIBRIONEN? Vibrionen sind kommaförmige Bakterien, die natürlich im Salz- oder Süßwasser vorkommen können. Nur
NICHT-CHOLERA-VIBRIONEN AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit WAS SIND NICHT-CHOLERA-VIBRIONEN? Vibrionen sind kommaförmige Bakterien, die natürlich im Salz- oder Süßwasser vorkommen können. Nur
Wie Zellmembranen Lipide austauschen
 Prof. Dr. Benedikt Westermann (re.) und Till Klecker, M.Sc. im Labor für Elektronenmikroskopie der Universität Bayreuth. Wie Zellmembranen Lipide austauschen Bayreuther Zellbiologen veröffentlichen in
Prof. Dr. Benedikt Westermann (re.) und Till Klecker, M.Sc. im Labor für Elektronenmikroskopie der Universität Bayreuth. Wie Zellmembranen Lipide austauschen Bayreuther Zellbiologen veröffentlichen in
Licht und Farbe mit Chemie
 Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farben: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farben: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Ket. gegen Schuppen. Jeden Tag!
 Ket hat was gegen Schuppen. Jeden Tag! Art.-Nr.: 012411/07 HEXAL AG Germany Industriestraße 25 83607 Holzkirchen Telefon 0 80 24/908-1632 e-mail: service@hexal.com http://www.hexal.com Schuppen hat jeder.
Ket hat was gegen Schuppen. Jeden Tag! Art.-Nr.: 012411/07 HEXAL AG Germany Industriestraße 25 83607 Holzkirchen Telefon 0 80 24/908-1632 e-mail: service@hexal.com http://www.hexal.com Schuppen hat jeder.
Internet-Akademie. Streifzüge durch die Naturwissenschaften. Serie. Ökologie, Teil 3. Folge 11. Autor: Hans Stobinsky
 Serie Streifzüge durch die Naturwissenschaften Autor: Hans Stobinsky Ökologie, Teil 3 - 1 - Die Grundelemente einer Lebensgemeinschaft 1. Pflanzliche Solaranlagen als Energieversorger Da, wie in der letzten
Serie Streifzüge durch die Naturwissenschaften Autor: Hans Stobinsky Ökologie, Teil 3 - 1 - Die Grundelemente einer Lebensgemeinschaft 1. Pflanzliche Solaranlagen als Energieversorger Da, wie in der letzten
Biodiversität Posten 1, Erdgeschoss 3 Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die SuS erleben am Ausstellungs-Beispiel die Vielfalt in der Natur. Sie erkunden die Ausstellung. Ziel Die SuS kennen Beispiele von und welch wichtige Bedeutung ein
Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die SuS erleben am Ausstellungs-Beispiel die Vielfalt in der Natur. Sie erkunden die Ausstellung. Ziel Die SuS kennen Beispiele von und welch wichtige Bedeutung ein
Blaualgen -Problematik in Stillgewässern. Prof. Dr. Bernhard Surholt Institut für Hygiene
 Blaualgen -Problematik in Stillgewässern Prof. Dr. Bernhard Surholt Institut für Hygiene Publikation der WHO 1999 Blaualgen im Chaohu See China / Süddeutsche Zeitung, 14.06.2012 Münster: Kanonengraben
Blaualgen -Problematik in Stillgewässern Prof. Dr. Bernhard Surholt Institut für Hygiene Publikation der WHO 1999 Blaualgen im Chaohu See China / Süddeutsche Zeitung, 14.06.2012 Münster: Kanonengraben
UNSERE WELT MUß GRÜN BLEIBEN
 UNSERE WELT MUß GRÜN BLEIBEN DIE GROßEN UMVELTPROBLEME DER TREIBHAUSEFFEKT Der Treibhauseffekt endschted, weil wir Gase produzieren, die zuviel Wärme zurückhalten und deswegen verändert sich unsere Atmosphäre.
UNSERE WELT MUß GRÜN BLEIBEN DIE GROßEN UMVELTPROBLEME DER TREIBHAUSEFFEKT Der Treibhauseffekt endschted, weil wir Gase produzieren, die zuviel Wärme zurückhalten und deswegen verändert sich unsere Atmosphäre.
Merkmale der Badewasserqualität
 KAPITEL 9 Merkmale der Badewasserqualität Mikrobiologische, chemische und physikalische Parameter, Plankton, Parasiten Welche Qualitätsmerkmale sind im Einzelnen zu erfüllen, um der Forderung des 37 des
KAPITEL 9 Merkmale der Badewasserqualität Mikrobiologische, chemische und physikalische Parameter, Plankton, Parasiten Welche Qualitätsmerkmale sind im Einzelnen zu erfüllen, um der Forderung des 37 des
Mische einige Stoffe mit Wasser und untersuche die entstandenen Gemischarten.
 Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 3 Wasser, Wasserbestandteile und Wasserreinigung (P754800) 3.4 Lösungen, Kolloide, Suspensionen Experiment von: Seb Gedruckt: 24.03.204 :28:39 intertess
Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 3 Wasser, Wasserbestandteile und Wasserreinigung (P754800) 3.4 Lösungen, Kolloide, Suspensionen Experiment von: Seb Gedruckt: 24.03.204 :28:39 intertess
Überwachung des Alten Rheins: Auswertung der Daten 1996 - August 2006 Beilage 1
 Überwachung des Alten Rheins: Auswertung der Daten 1996 - August 26 Beilage 1 Überwachung des Alten Rheins: Auswertung der Daten 1996 - August 26 Beilage 2 Messprogramm (angepasste Version, gültig ab 1.
Überwachung des Alten Rheins: Auswertung der Daten 1996 - August 26 Beilage 1 Überwachung des Alten Rheins: Auswertung der Daten 1996 - August 26 Beilage 2 Messprogramm (angepasste Version, gültig ab 1.
Bio A 15/04_Online-Ergänzung
 Bio A 15/04_Online-Ergänzung Charakteristika verschiedener Zelltypen DITTMAR GRAF Online-Ergänzung MNU 68/3 (15.5.2015) Seiten 1 7, ISSN 0025-5866, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 DITTMAR GRAF Charakteristika
Bio A 15/04_Online-Ergänzung Charakteristika verschiedener Zelltypen DITTMAR GRAF Online-Ergänzung MNU 68/3 (15.5.2015) Seiten 1 7, ISSN 0025-5866, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 DITTMAR GRAF Charakteristika
Weihnachtliche Experimentalvorlesung im Fachbereich Chemieingenieurwesen
 Weihnachtliche Experimentalvorlesung im Fachbereich Chemieingenieurwesen Folie 1 Licht und Farbe zu Weihnachten - Dank Chemie! Folie 2 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren
Weihnachtliche Experimentalvorlesung im Fachbereich Chemieingenieurwesen Folie 1 Licht und Farbe zu Weihnachten - Dank Chemie! Folie 2 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren
HTBL-PINKAFELD Arbeitsblatt A6/1 Gruppenpuzzle: ERDÖL 1
 HTBL-PINKAFELD Arbeitsblatt A6/1 Gruppenpuzzle: ERDÖL 1 GESCHICHTE Erdöl war schon im alten Ägypten als Dichtungsmittel im Bootsbau und zum Einbalsamieren von Leichen in Verwendung. Eine technische Nutzung
HTBL-PINKAFELD Arbeitsblatt A6/1 Gruppenpuzzle: ERDÖL 1 GESCHICHTE Erdöl war schon im alten Ägypten als Dichtungsmittel im Bootsbau und zum Einbalsamieren von Leichen in Verwendung. Eine technische Nutzung
Natur und Technik. Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik. Datum:
 Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 Joseph Priestley, ein englischer Naturforscher, führte im 18. Jahrhundert
Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 Joseph Priestley, ein englischer Naturforscher, führte im 18. Jahrhundert
Limnologisches Monitoring Senftenberger See 2014
 Schlunkendorfer Straße 2e 14554 Seddiner See Güteprobleme Senftenberger See Dr. Melanie Hartwich melanie.hartwich@iag-gmbh.info 1 Veranlassung Situation Senftenberger See 2013: Sauerstoff-Probleme, Fischsterben
Schlunkendorfer Straße 2e 14554 Seddiner See Güteprobleme Senftenberger See Dr. Melanie Hartwich melanie.hartwich@iag-gmbh.info 1 Veranlassung Situation Senftenberger See 2013: Sauerstoff-Probleme, Fischsterben
Milchschorf und Fischschuppen
 Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung Abschlussbericht Milchschorf und Fischschuppen aus der gkf-info 41 Juni 2015 Abschlussbericht Milchschorf und Fischschuppen Golden Retriever können als
Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung Abschlussbericht Milchschorf und Fischschuppen aus der gkf-info 41 Juni 2015 Abschlussbericht Milchschorf und Fischschuppen Golden Retriever können als
Kapitel 04.14: Ökosystem Wattenmeer
 1 Durch den Einfluss des Mondes entstehen Ebbe und Flut 2 Inhalt...1 Inhalt... 2 Watt und Wattenmeer... 3 Entstehung eines Wattenmeeres...5 Regionen der Wattenmeere... 5 Tiere und Pflanzen im Wattenmeer...6
1 Durch den Einfluss des Mondes entstehen Ebbe und Flut 2 Inhalt...1 Inhalt... 2 Watt und Wattenmeer... 3 Entstehung eines Wattenmeeres...5 Regionen der Wattenmeere... 5 Tiere und Pflanzen im Wattenmeer...6
akafog bietet eine nachhaltige Lösung zur Bekämpfung von Schimmel und penetranten Gerüchen.
 Übersicht akafog bietet eine nachhaltige Lösung zur Bekämpfung von Schimmel und penetranten Gerüchen. Mit akafog können Räume präventiv gegen Schimmel behandelt werden. akafog vernichtet Bakterien, Pilze
Übersicht akafog bietet eine nachhaltige Lösung zur Bekämpfung von Schimmel und penetranten Gerüchen. Mit akafog können Räume präventiv gegen Schimmel behandelt werden. akafog vernichtet Bakterien, Pilze
Mantarochen. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Mantarochen Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Gewicht: Alter: Nahrung:
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Mantarochen Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Steckbrief Grösse: Gewicht: Alter: Nahrung:
Selber Kompost machen
 Selber Kompost machen Die Natur kennt keine Abfälle. Material, das sich zersetzen kann, können Sie weiter verwenden. Das wird Kompost genannt. Kompost ist ein guter Dünger für Blumen und Pflanzen. Selber
Selber Kompost machen Die Natur kennt keine Abfälle. Material, das sich zersetzen kann, können Sie weiter verwenden. Das wird Kompost genannt. Kompost ist ein guter Dünger für Blumen und Pflanzen. Selber
Chemische Evolution. Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007
 Chemische Evolution Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007 Aristoteles lehrte, aus Schlamm entstünden Würmer, und aus Würmern Aale. Omne vivum ex vivo. (Alles Leben entsteht aus Leben.) Pasteur
Chemische Evolution Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007 Aristoteles lehrte, aus Schlamm entstünden Würmer, und aus Würmern Aale. Omne vivum ex vivo. (Alles Leben entsteht aus Leben.) Pasteur
Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten - Seen ( 20)
 BGBl. II - Ausgegeben am 29. März 2010 - Nr. 99 46 von 50 Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten - Seen ( 20) L 1 Temperatur im Hypolimnion ( 20 Abs. 2 Z 1) Anlage L Bandbreite des sehr guten (H)
BGBl. II - Ausgegeben am 29. März 2010 - Nr. 99 46 von 50 Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten - Seen ( 20) L 1 Temperatur im Hypolimnion ( 20 Abs. 2 Z 1) Anlage L Bandbreite des sehr guten (H)
Biofilme und ihre Bedeutung (nicht nur) für die Lebensmittelsicherheit
 Biofilme und ihre Bedeutung (nicht nur) für die Lebensmittelsicherheit Fachtagung der Hauswirtschaft Schwalmstadt, 18. März 2016 Dr. Elke Jaspers mikrologos GmbH Definition Biofilm Ein Biofilm ist eine
Biofilme und ihre Bedeutung (nicht nur) für die Lebensmittelsicherheit Fachtagung der Hauswirtschaft Schwalmstadt, 18. März 2016 Dr. Elke Jaspers mikrologos GmbH Definition Biofilm Ein Biofilm ist eine
Licht und Farbe mit Chemie
 Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farbe: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farbe: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
NEUJAHRSBLATT. Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
 Umschlagbilder 1 2 3 4 5 6 1: Geschichtete Mikrobenmatte in einem Sumpfgebiet (Val Piora, TI) 2: Die Fadenalge Zygnema in einem Dorfbrunnen (Zuoz, GR) 3: Kolonien von Mikroorganismen auf einem Nährboden
Umschlagbilder 1 2 3 4 5 6 1: Geschichtete Mikrobenmatte in einem Sumpfgebiet (Val Piora, TI) 2: Die Fadenalge Zygnema in einem Dorfbrunnen (Zuoz, GR) 3: Kolonien von Mikroorganismen auf einem Nährboden
Erdgas Die freundliche Energie. 03a / Erdgas
 Erdgas Die freundliche Energie 03a / Erdgas Wie entsteht Erdgas? Das heute genutzte Erdgas ist aus organischen Stoffen entstanden. Ausgangsmaterial waren abgestorbene Reste von Plankton und Algen flacher
Erdgas Die freundliche Energie 03a / Erdgas Wie entsteht Erdgas? Das heute genutzte Erdgas ist aus organischen Stoffen entstanden. Ausgangsmaterial waren abgestorbene Reste von Plankton und Algen flacher
Photosynthese 1: Allgemeines und Entstehung
 Photosynthese 1 Allgemeines und Entstehung der Photosynthese 2 Lichtreaktion 3 Dunkelreaktion und Typen der Photosynthese 4 Ursachen für die Entstehung verschiedener Typen 5 Summenformeln 6 Wichtige Photosynthesebilanzen
Photosynthese 1 Allgemeines und Entstehung der Photosynthese 2 Lichtreaktion 3 Dunkelreaktion und Typen der Photosynthese 4 Ursachen für die Entstehung verschiedener Typen 5 Summenformeln 6 Wichtige Photosynthesebilanzen
Infoblatt. Läuse. Vorkommen und Verhalten. Wie stellt man den Befall fest?
 Infoblatt Läuse Vorkommen und Verhalten Weltweit verbreitet, treten zu allen Jahreszeiten auf Leben auf dem behaarten Kopf, auf sauberen wie unsauberen Haaren Ernähren sich durch Saugen von Blut, saugen
Infoblatt Läuse Vorkommen und Verhalten Weltweit verbreitet, treten zu allen Jahreszeiten auf Leben auf dem behaarten Kopf, auf sauberen wie unsauberen Haaren Ernähren sich durch Saugen von Blut, saugen
Leben in Sand und Schlick. Im Sandlückensystem zwischen den Sand kör nern
 zu 4 % aus Sulfat- und Magnesium-Ionen sowie sehr vielen Spuren elementen. Das Wasser gefriert bei 2 C; in vielen Wintern bleiben die Küsten der Nordsee eisfrei. 3,5 % ist eine unvorstellbare Menge Salz
zu 4 % aus Sulfat- und Magnesium-Ionen sowie sehr vielen Spuren elementen. Das Wasser gefriert bei 2 C; in vielen Wintern bleiben die Küsten der Nordsee eisfrei. 3,5 % ist eine unvorstellbare Menge Salz
[Co(NH 3 ) 2 (H 2 O) 2 ] 3+
![[Co(NH 3 ) 2 (H 2 O) 2 ] 3+ [Co(NH 3 ) 2 (H 2 O) 2 ] 3+](/thumbs/33/16366221.jpg) Kap. 7.3 Das Massenwirkungsgesetz Frage 121 Kap. 7.3 Das Massenwirkungsgesetz Antwort 121 Schreiben Sie das Massenwirkungsgesetz (MWG) für die folgende Reaktion auf: Fe 3+ (aq) + 3 SCN - (aq) Fe(SCN) 3
Kap. 7.3 Das Massenwirkungsgesetz Frage 121 Kap. 7.3 Das Massenwirkungsgesetz Antwort 121 Schreiben Sie das Massenwirkungsgesetz (MWG) für die folgende Reaktion auf: Fe 3+ (aq) + 3 SCN - (aq) Fe(SCN) 3
3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch!
 1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
Akkus des menschlichen Lebens. Was ist Leben? oder: woher schöpfen die Menschen ihre Energie und wie wird sie genährt oder gestört?
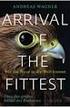 Akkus des menschlichen Lebens oder: woher schöpfen die Menschen ihre Energie und wie wird sie genährt oder gestört? Was ist Leben? Leben ist 1.: Fortpflanzung Leben ist 2.: Ernährung, Ausscheidung Leben
Akkus des menschlichen Lebens oder: woher schöpfen die Menschen ihre Energie und wie wird sie genährt oder gestört? Was ist Leben? Leben ist 1.: Fortpflanzung Leben ist 2.: Ernährung, Ausscheidung Leben
Übungsblatt zu Säuren und Basen
 1 Übungsblatt zu Säuren und Basen 1. In einer wässrigen Lösung misst die Konzentration der Oxoniumionen (H 3 O + ) 10 5 M. a) Wie gross ist der ph Wert? b) Ist die Konzentration der OH Ionen grösser oder
1 Übungsblatt zu Säuren und Basen 1. In einer wässrigen Lösung misst die Konzentration der Oxoniumionen (H 3 O + ) 10 5 M. a) Wie gross ist der ph Wert? b) Ist die Konzentration der OH Ionen grösser oder
