Editorial. unitas Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine UNITAS ISSN-Nr INHALT
|
|
|
- Peter Egger
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 INHALT Einladung zum AHB-/HDB-Tag 2015 in Erfurt > 91 Anmeldeformular zum AHB-/HDB-Tag 2015 in Erfurt > 92 Erfurt liegt am besten Ort Die Stadt der Tagung > 93 AGV-Romseminar: Franziskus & der Aufbruch der Kirche > 94 VOP Moritz Findeisen: Römische Betrachtungen >104 Dr. Burkhard Conrad: Über den wahrheitsliebenden Politiker >106 Von der BDKJ-Hauptversammlung auf Burg Rothenfels > 114 Bbr. Dr. Oliver Wintzek: Bonifatius & die Donar-Eiche > 116 Bbr. Prof. Hubert Braun: Studienbelastung & Bologna-Prozess > 119 Bbr. Dr. Thomas Lohmann: Die Unitas in 10 0der 20 Jahren >120 Mythus & Antimythus: Widerspruch gegen Gewaltmenschen >124 Bbr. Prof. em. Gabriel Adrianyi: Bbr. Wilhelm Neuß > 127 Unternehmensgründer: Altersvorsorge 2.0 >128 Bbr. Pfr. Tobias Spittmann: Tolle. Lege Zwei Worte... >130 Axel Voss MdEP beim Neujahrsempfang von Unitas-Salia > 132 Ad fontes! 25 Jahre Unitas Ostfalia Erfurt > 134 Bbr. Andreas Harter: Der Wahrheit verpflichtet >136 Aus dem Verband > 138 Personalia: Namen & Nachrichten >142 In memoriam: Bbr. Eduard Ackermann >148 Unsere Verstorbenen >150 Geburtstage Juni, Juli, August 2015 > 153 Zuschrift: Non scholae sed vitae... > 157 Medien: Neue Bücher > 158 Einladung: Seminar Gute wissenschaftliche Praxis >160 unitas Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine UNITAS ISSN-Nr Herausgeber und Verlag Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine UNITAS e.v., Jan-van-Werth-Straße 1, Kaarst (Büttgen) Öffnungszeiten: Mo - Do, bis Uhr Verbandssekretärin: Anja Kellermann Tel , Fax , vgs@unitas.org, stiftung@unitas.org Homepage: Vorort: W.K.St.V. Unitas Freiburg, Basler Str. 48, Freiburg Vorortspräsident: Moritz Findeisen Tel , moritz.findeisen@gmx.de, vop@unitas.org Verbandskonto: Pax Bank Köln: BIC: GENODED1PAX, IBAN: DE Veranstaltungskonto: Pax Bank Köln: BIC: GENODED1PAX, IBAN: DE Spendenkonten: Stiftung UNITAS 150plus: Pax Bank Köln: BIC: GENODED1PAX, IBAN: DE Bank für Sozialwirtschaft: BIC: BFSWDE33XXX, IBAN: DE Soziales Projekt: PAX Bank Köln: BIC: GENODED1PAX, IBAN: DE Zentraler Hausbauverein (ZHBV): PAX Bank Köln: BIC GENODED1PAX, IBAN: DE Schriftleitung: Dr. Christof M. Beckmann, Hülsmannstraße 74, Essen-Borbeck, Tel (p), unitas@unitas.org Hermann-Josef Großimlinghaus, Rheinstraße 12, Bonn, Tel (p), (d), H.Grossimlinghaus@DBK.de Sebastian Sasse M.A., Saarbrücker Straße 45, Essen, Tel , SeSa79@web.de Der Bezugspreis der unitas beträgt 3,00 Euro zzgl. Zustellgebühr. Für Mitglieder des UNITAS- Verbandes ist er im jährlichen Verbandsbeitrag von 80,- Euro enthalten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion dar. Fotonachweis: C. Beckmann, H.-J. Großimlinghaus, I. Gabriel, pixabay (Titel), fotoitalia, privat, Archiv Druck: Druckerei Pomp, Bottrop Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/2015: 28. Juni 2015 Unser Titelbild: Die Kolonnaden am Petersplatz in Rom, 367 Säulen, errichtet durch Gian Lorenzo Bernini, Staatsgrenze zwischen der Vatikanstadt und Italien. Editorial Liebe Leser, liebe Bundesschwestern und Bundesbrüder! Sprache ist im Wesentlichen schön. Ihr Gebrauch ist ein Genuss. Aber nicht immer, denn sie ist auch verräterisch: Arbeitnehmer werden nicht gekündigt, sondern freigesetzt. Das längst übliche Wort für Rausschmiss aus welchen Gründen auch immer. Preise werden angepasst oder korrigiert auf Deutsch: Sie steigen. Geht es um Filialen, ist ihre Schließung gemeint. Es gibt Übergriffe statt Angriffe, Deckungslücken und Schuldenbremsen, Mitnahmeeffekte, Schieflagen, Sparpakete und Verhandlungskörbe, Champagnerlaune an den Börsen, Wachstumsbäuche und Tariflandschaften. Man ist in ernsthaften zielführenden Gesprächen, Ruder werden herumgerissen, Tischtücher sind zerschnitten, Fronten verhärtet, Punkte werden implementiert, Schlagzahlen erhöht und während sich Ernüchterung breitmacht und Zeichen auf Sturm stehen, sind die Gespräche dann doch meist vor der Sendung aufgezeichnet. Sprachliche Mülldeponien, lingustische Entsorgungsparks: Wir werden überschüttet von wolkigem Politgeschwurbel, pseudosportivem Wirtschafts- und Börsensprech, unlauteren Euphemismen allenthalben. Medial verstärkten Wortblasen, die für nichts als gähnendes Nichts stehen. Die Folge: Eine zunehmenden Verunklarung, die auch vor der Kirche nicht halt macht. Macht s wie der Chef Der Kölner Blogger Erik Flügge setzte jetzt eine überraschend nachgefragte Philippika gegen eine Zombie-Sprache von Predigern auf seine Internetseite. Vielfach würden nur verschrobene, gefühlsduselnde Wortbilder aneinander gereiht, erklärte er: Ständig diese in den Achtzigern hängen gebliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach dem, wer ich bin und werden könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich schon längst war. Hä? Ach bitte, lasst mich doch mit so was in Ruhe. Er mahnte: Und dann wunderten sich die Verantwortlichen, warum das niemand hören will. Seine Empfehlung: Es wäre doch am Ende recht einfach. Macht s wie der Chef. Jesus hat sich doch auch Mühe gegeben irgendwie verständlich zu sein. Er hat den Leuten etwas mit Bildern und Begriffen erklärt, mit denen sie etwas anfangen konnten. Und nicht zuletzt: Er hat Ansagen gemacht eindeutige Ansagen. Die Wahrheit macht euch frei so steht es schon bei Johannes 8, 31. Und es wäre gut, wenn die Dinge endlich beim Namen genannt werden. Beim richtigen Namen. So wie in der Frage, die während der Drucklegung seltsam breit diskutiert wurde: Mit Völkermord ist klar gesagt, um was es geht. Nicht um Evakuierung oder Verlegung von Volksgruppen. Sondern um Mord, nichts anderes. Wie bei der kaltblütigen Vernichtung von hunderttausenden Armeniern, mit ausreichend Helfern, ausgefeilter Logistik und klarem politischem Vorsatz. Papst Franziskus hat diese Wahrheit ausgesprochen was immer andere davon halten. Und während ich dieses schreibe, kommen über das Internet gerade Bilder von Vorschlaghämmer schwingenden IS- Kämpfern auf syrischen Kirchendächern, es werden Altäre und Gräber geschändet, Kreuze zertrümmert. Geht es etwa nur um die Zerstörung von Kulturgut? Aktuelle Aufnahmen zeigen im Mittelmeer Hunderte leblos treibende Körper, schreiende und an Wrackteile geklammerte Überlebende. Ist das die diabolisch beschworene Asylantenflut oder der Flüchtlingsstrom? Mir kommt das Wort von der unterlassenen Hilfeleistung aus dem Strafgesetzbuch in den Kopf und ich bin wütend über die Unfähigkeit und den Unwillen, endlich zu handeln. Macht s wie der Chef. Nennt die Dinge beim Namen. Einen guten Start ins Sommersemester wir sehen uns bei der GV in Würzburg! semper in unitate, Dr. Christof M. Beckmann, ( M3, B2, M5 ) 90 unitas 2/2015
3 EINLADUNG ZUR HOHE DAMEN- UND ALTHERRENBUNDSTAGUNG DES UNITAS-VERBANDES VOM 16. BIS 18. OKTOBER 2015 IN ERFURT ZUM THEMA 25 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder! Die Vorstände des Hohedamenbundes, des Altherrenbundes und des Altherrenvereins Unitas Ostfalia Erfurt freuen sich, euch zum diesjährigen Hohe Damen- und Altherrenbundstag begrüßen zu können. Wir hoffen, ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt zu haben, und freuen uns auf die gemeinsamen Stunden im unitarischen Kreis. Das Programm der Tagung sieht folgenden Ablauf vor: Freitag, 16. Oktober 2015 Bis Uhr Anreise im ibis Erfurt Altstadt Uhr Begrüßungsabend Wirtshaus Zum Schildchen & Zum Eisernen Handschuh, Schildgasse 3 / 4, Erfurt, Begrüßung der Teilnehmer durch den HDB-/AHB-Vorstand und Einführung in die Tagung durch den HDB-/AH B-Vorstand Samstag, 17. Oktober Uhr Vortrag Die DDR, ein Unrechtsstaat Referent: Andreas Boguslawski, Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU), Außenstelle Erfurt, Petersberg Haus 19, Erfurt Uhr Besuch der G edenk- und Bildungsstätte Andreasstraße Andreasstraße 37a, Erfurt Uhr Mittagspause bis [Individuelle Selbstversorgung in den Restaurants der Altstadt um den Domplatz] Uhr Uhr a) Stadtrundgang Die F aszination einer historischen Stadt erleben bis ca. Besichtigung und Führung durch das Domensemble, Erfurter Altstadt mit der Uhr Krämerbrücke, Rathaus, Universitätsviertel und Bürgerhäusern mit Bbr. Dr. Harald Mittelsdorf Treffpunkt O belisk auf dem Domplatz alternativ b) Stadtführung mit der Straßenbahn mit Bbr. Dr. Olaf Zucht Treffpunkt EVA G-Wendeschleife Domplatz Uhr Unitarische Kneipe [inklusive Abendimbiss] G emeindehaus St. Severi, Severihof 2, Erfurt Sonntag, 18. Oktober Uhr Hl. Messe zum HDB-/AHB-Tag 2015 in St. Severin neben dem Dom Uhr Katholische Kirche in der DDR. Rückblick nach 25 Jahren Deutsche Einheit Referent: Dr. Sebastian Holzbrecher G emeindehaus St. Severi, Severihof 2, Erfurt Uhr Mittagessen Restaurant due angeli, Domplatz 31, Erfurt Uhr Ende der Tagung und Heimreise >> unitas 2/
4 ANMELDEFORMULAR FÜR DIE HOHE DAMEN- UND ALTHERRENBUNDSTAGUNG VOM 16. BIS 18. OKTOBER 2015 IN ERFURT (ANMELDUNG BIS ZUM 01. SEPTEMBER 2015) An UNITAS Verbandsgeschäftsstelle Jan-van-Werth-Str Kaarst oder direkt über unsere Homepage Hier wird im internen Bereich unter Veranstaltungen die Anmeldung online zur Verfügung gestellt. Hiermit melde ich mich verbindlich mit Begleitpersonen an: Name/Teilnehmer 1: Name/Teilnehmer 2: Anschrift: Telefon: Ich habe die vollständigen Tagungskosten (Stadtführungen und sonstige Tagungsunkosten) in Höhe von 50,00 Euro pro Person für die anzumeldende/-n Person/-en auf das Konto des Unitas-Verbandes PAX Bank Köln, BIC: GENODED1PAX, IBAN: DE überwiesen. Mir ist bekannt, dass bei Absage nach dem 01. September 2015 der volle Tagungspreis zu zahlen ist. Ich nehme mit Begleitpersonen an der Stadtführung teil zu Fuß per Straßenbahn Datum/Unterschrift: Zimmerbuchung / Organisatorische Hinweise Im Hotel ibis Erfurt Altstadt, Barfüßerstraße 9, Erfurt, Tel oder F ax ist ein Zimmerkontingent von 30 Zimmern inkl. Frühstück unter dem Stichwort Unitas Ostfalia reserviert worden. Diese sind buchbar als DZ für 105,- Euro pro Nacht oder als EZ für 85,- Euro pro Nacht. Entsprechendes ist bei der Buchung anzugeben. Die Buchung der Zimmer muss eigenständig bis zum 28. August 2015 beim Hotel erfolgen, danach erlischt das Zimmerkontingent. Die Bezahlung hat als Selbstzahler vor Ort zu erfolgen. Das Hotel ibis Erfurt Altstadt, Barfüßerstraße 9, Erfurt, liegt zentral in der historischen Altstadt von Erfurt und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem PKW gut erreichbar. Sämtliche Sehenswürdigkeiten und Führungen sind fußläufig vom Hotel erreichbar. Ansprechpartner der Tagung sind Bbr. Dr. Olaf Zucht, AHV-Vorsitzender, Am Stadtpark 41, Erfurt, Tel , olaf.zucht@freenet.de und B br. Hans Backes, Richard-Wagner-Str. 64, Sömmerda, Tel , s.schneider.soem@t-online.de. Die verbindliche Anmeldung hat bis zum 01. September 2015 über das unitas-online-system oder die Verbandsgeschäftsstelle zu erfolgen. Mit der Anmeldung sind die vollständigen Tagungskosten zu überweisen für Übernachtungskosten siehe oben. 92 unitas 2/2015
5 Erfurt liegt am besten Ort! VON BBR. OLAF ZUCHT Erfurt... liegt am besten Ort. Da muss eine Stadt stehen! So urteilte der große Reformator Martin Luther im 16. Jahrhundert. Erstmals erwähnt wurde Erfurt jedoch schon 742 in einem Brief an Papst Zacharias. Der Missionsbischof Bonifatius erkannte die prädestinierte Lage des Ortes Erphesfurt in der fruchtbaren Gera- Aue und empfahl ihn 742 dem Papst als Sitz eines Bistums. Erfurt wurde zum geistlichen Zentrum Thüringens schon damals als Großsiedlung. Bereits kurz danach entwickelte es sich zum Zentrum des Thüringer Raumes, wenngleich es lange Zeitabschnitte politisch nicht Teil des Landes Thüringen war. Die Stadt liegt im südlichen Thüringer Becken am Fluss Gera. Im Mittelalter hatte die Stadt ein hohes Maß an Autonomie. Das änderte sich mit der gewaltsamen Unterwerfung durch die Mainzer wurde Erfurt Teil Preußens mit Ausnahme der Zeit von 1806 bis 1814, als es als Fürstentum Erfurt direkt unter französischer Herrschaft stand und blieb es bis Die Universität wurde 1392 eröffnet, 1816 geschlossen und 1994 neugegründet. Damit ist sie die dritte Universität, die in Deutschland eröffnet wurde, kann dank eines Gründungsprivilegs von 1379 aber auch als älteste gelten. Martin Luther war ihr bekanntester Student. Bewegte Geschichte Somit schaut Erfurt heute auf fast 1270 Jahre bewegte Geschichte zurück. Viele Unverwechselbarkeiten kennzeichnen die größte thüringische Stadt mit ihrem Wahrzeichen Dom und Severikirche sowie einem fast vollständig erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern. Die bevorzugte Verkehrslage am Kreuzungspunkt alter deutscher und europäischer Handelsstraßen, ein früher und weitreichender Markt- und Handelsverkehr und das Vorhandensein einer Königspfalz begünstigten die frühe Stadtwerdung Erfurts. Die Wirtschaft der Stadt Erfurt ist stark von Verwaltung und Dienstleistung geprägt. Außerdem ist Erfurt Standort verschiedener Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Ferner hat sich auf Grund der niedrigen Lohnkosten und zentralen Lage in Deutschland eine bedeutende Logistik-Branche etabliert. Erfurt ist nach Leipzig die Stadt mit der zweitgrößten Messe in den ostdeutschen Ländern. Des Weiteren ist Erfurt mit dem Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Zentrum Deutschlands, der bis zum Jahr 2017 zum ICE-Knoten ausgebaut wird. Bekannt ist Erfurt auch für seinen Gartenbau (egapark, Saatgutzucht) und als Medienzentrum (Sitz des Kindersenders KiKA und mehrerer Radiostationen sowie Tageszeitungen). Hauptstadt Thüringens Es ist zugleich die größte Stadt Thüringens und neben Jena und Gera eines der drei Oberzentren des Landes. Wichtigste Institutionen neben den Landesbehörden sind das Bundesarbeitsgericht, die Universität und Fachhochschule Erfurt sowie das katholische Bistum Erfurt, dessen Kathedrale der Erfurter Dom ist, der wiederum neben der Krämerbrücke eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt darstellt. Darüber hinaus besitzt die Stadt einen knapp drei Quadratkilometer großen mittelalterlich geprägten Altstadtkern mit etwa 25 Pfarrkirchen und zahlreichen Fachwerk- und Bürgerhäusern. unitas 2/
6 Franziskus und der Aufbruch der Kirche ROM-SEMINAR DER AGV: EIN BEITRAG ZUR HORIZONTERWEITERUNG VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS Im Zentrum der Weltkirche lautete das Motto des Rom-Seminars der Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände (AGV), das vom März stattgefunden hat. Am Grabe Petri konnten die 17 Teilnehmer ein Gespür dafür bekommen, wie vital die Weltkirche wirklich aufgestellt ist, und das farbenfrohe Gesicht der Kirche erleben. Höhepunkt für den AGV-Vorsitzenden und die Vorortspräsidenten von CV, KV und UV war die persönliche Begegnung mit Papst Franziskus am Rande der wöchentlichen Generalaudienz. Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Morgen des 11. März zum Petersplatz zur wöchentlichen Generalaudienz mit Papst Franziskus. Nach der Sicherheitskontrolle fanden die Studenten ihren privilegierten Platz nur etwa zehn Meter neben dem Sitz des Papstes. Der AGV-Vorsitzende und die Vorortspräsidenten von CV, KV und UV durften sogar in der Prima Fila Platz VOP Moritz Findeisen richtet Papst Franziskus die besonderen Grüße des Unitas-Verbands aus. Links daneben: der Geistl. Beirat des Vororts Bbr. Vikar Dr. Oliver Wintzek. Fotografia Felici Papst Franziskus begrüßt den AGV-Vorsitzenden Bbr. Joost Punstein. Links daneben die Vorortspräsidenten von CV, KV und UV, Andreas Heddergott, Michael Baumann und Bbr. Moritz Findeisen. Fotografia Felici nehmen, wo der Heilige Vater sie nach der Audienz kurz persönlich begrüßte und die Grüße der katholischen Studentenverbände entgegennahm. Auftrag an die Alten Herren und Hohen Damen In seiner Katechese bei der Generalaudienz befasste Papst Franziskus sich mit der Wertschätzung des Alters. Als eines der geistlichen Aufgabenfelder für seine Altersgenossen nannte der Papst die Ermutigung, die der Alte dem Jungen zu übermitteln versteht, der den Sinn des Glaubens und des Lebens sucht!. Mit ihrer Erfahrung und Weisheit könnten sie einen wichtigen Beitrag leisten und die jüngeren Generationen unterstützend begleiten. In diesen Worten kommt auch ein besonderer Auftrag an den Lebensbund der katholischen Studentenverbände, am Zusammenleben von Studenten und Alten Herren bzw. Hohen Damen zum Ausdruck: Wir können die ehrgeizigen Jugendlichen daran erinnern, dass ein Leben ohne Liebe ein trockenes Leben ist. Wir können den angsterfüllten Jugendlichen sagen, dass die Angst vor der Zukunft besiegt werden kann. Wir können die zu sehr in sich selbst verliebten Jugendlichen lehren, dass im Geben mehr Freude liegt als im Nehmen, betonte Papst Franziskus. Er wünscht sich eine Kirche, die die Kultur des Aussonderns herausfordert mit der 94 unitas 2/2015
7 Gespräch mit dem Sekretär des Päpstlichen Rates für die Laien, Bischof Josef Clemens. überfließenden Freude einer Umarmung zwischen Jugendlichen und Alten. Papst Franziskus: Die Kultur des Wegwerfens überwinden Am Ende seiner Ansprache begrüßte Franziskus die AGV als einzige deutsche Gruppe namentlich: Mit Freude heiße ich die Gläubigen deutscher Sprache willkommen, besonders die Gruppe der Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände. Liebe Freunde, suchen wir gemeinsam die Kultur des Wegwerfens mit der überfließenden Freude zu überwinden, die entsteht, wenn sich Junge und Alte näherkommen. Gott segne euch. Während der Tage in Rom absolvierten die Seminarteilnehmer ein dichtes Arbeitsprogramm. In zahlreichen Gesprächen und Begegnungen konnten die Studenten mit Vertretern der Kurie, der Orden, der Medien und der Politik die vatikanischen Strukturen von innen und außen kennenlernen und aktuelle Fragen diskutieren. Welt, so auch für die katholischen Verbände in Deutschland und deren Zusammenschluss im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Rund zehn Prozent der weltweit 1,2 Milliarden Katholiken dürften nach Schätzung von Clemens einer der 140 von Rom anerkannten internationalen Verbände und geistlichen Gemeinschaften angehören. Der 67-Jährige kümmert sich vor allem auch um die Vorbereitung der Weltjugendtage, die inzwischen zu den größten Veranstaltungen der katholischen Kirche geworden sind. Derzeit laufen die Planungen für das nächste Weltjugendtreffen 2016 in Krakau. Aber auch die Förderung der Sportseelsorge und die Rolle der Frauen in Kirche und Gesellschaft zählen zu den Aufgaben des Dikasteriums. Bischof Clemens, der dienstälteste Deutsche in einem vatikanischen Leitungsamt, wünscht sich, dass der große Entwurf für einen neuen Aufbruch in der Kirche, der sich durch die Person von Papst Franziskus, seine Authentizität und seine Impulse andeutet, nicht durch innerkirchlichen Gegenwind aufgehalten wird. Es ist vielleicht auf lange Zeit die letzte Chance, aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen, meint der seit über 30 Jahren in Rom lebende Kurienmann. Doch er ist optimistisch: Im Moment stehen die Aktien nicht schlecht. Bischof Clemens sieht in Papst Franziskus ein überzeugendes Vorbild, gerade auch für die Jugend. Er fange als Mahner und Veränderer bei sich selber an und lebe vor, was er verlange, auch gegen Widerstände. Er lehnt jede Art von höfischer Lebensform für sich ab und nimmt als Papst keine Sonderrechte für sich in Anspruch, so Clemens. Er lebe uns allen einen bescheidenen Lebensstil vor. Papst will mehr Verantwortung für Laien Besuch beim Päpstlichen Laienrat Beim Päpstlichen Rat für die Laien erwartete dessen Sekretär Bischof Dr. Josef Clemens die Studenten im Palazzo San Calisto im römischen Stadtteil Trastevere. Neben der generellen Förderung des Laienapostolats ist der Rat zuständig für den Kontakt zu den katholischen Laienorganisationen in aller Bischof Josef Clemens: Jemand, der in ihre Verbindungen und Vereine kommt, muss diesen christlichen Geist kennenlernen und erfahren, warum es sich lohnt, Mitglied zu werden. Bei den Akzenten, die der Papst setzt, betont er auch immer wieder die Bedeutung der Laien. Das Verständnis vom Laienapostolat ist in der deutschen Perspektive allerdings innerkirchlich blockiert, stellte der langjährige Sekretär von Kardinal Ratzinger fest. In Deutschland gehe es vielfach nur um Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsrechte und um synodale Strukturen in der >> unitas 2/
8 Kirche. In anderen Ländern und Kontinenten stehe hingegen das Gemeinschaftserlebnis gerade auch im Gottesdienst im Vordergrund. Während bei uns die Bereitschaft zu einer festen Bindung an eine Gruppe oder einen Verband immer mehr abhanden komme, sei in anderen Regionen der Welt der Aspekt des Miteinanders in der Umsetzung des Glaubens viel stärker. Den frühen christlichen Gemeinden nacheifern In seiner Schrift Evangelii Gaudium fordert Papst Franziskus mehr Verantwortung für die Laien in der Kirche. Dies werde teilweise durch einen ausufernden Klerikalismus verhindert, so das Oberhaupt der katholischen Kirche. Viele Mitbrüder im geistlichen Amt haben noch nicht begriffen, dass wir am Ende einer Epoche sind, mahnte Bischof Clemens. Die Zeit des Schönredens und Aussitzens von Krisen in der Kirche sei vorbei. Die verlorengegangene Glaubwürdigkeit muss durch eine neue überzeugende Ausstrahlung zurück gewonnen werden, forderte der aus dem Erzbistum Paderborn stammende Kurienbischof und erinnerte an die ersten Christengemeinden, die durch ihr vom christlichen Glauben geprägtes Leben das Interesse und die Aufmerksamkeit ihrer heidnischen Umwelt erregt hätten. Dies sei für die heutigen Christen wieder die große Aufgabe für die Zukunft, der christliche Glaube müsse sich im Leben jedes Einzelnen niederschlagen: in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Universität, in der Freizeit. Verbände brauchen neue Ausstrahlungskraft Den katholischen Studenten- und Akademikerverbänden misst Josef Clemens bei dieser Aufgabe eine stützende Funktion zu: Der einzelne Katholik muss motiviert werden und ihm muss geholfen werden, seinen Glauben zu leben. Allerdings bräuchten die Verbände klare Ziele und Projekte, etwa in der Weiterbildung. Jemand, der in ihre Verbindungen und Vereine kommt, muss diesen christlichen Geist kennenlernen und erfahren, warum es sich lohnt, Mitglied zu werden, so Bischof Clemens. Unsere Gemeinschaften müssten eine Ausstrahlungskraft haben wie die frühen christlichen Gemeinden vor Dominikanerpater Max Cappabianca (am Kopfende des Tisches), Mitarbeiter der Kongregation für die Orientalischen Kirchen, beleuchtet die besorgniserregende Situation der Christen im Nahen und Mittleren Osten. Jahren. Dabei sei es notwendig, den eigenen Glauben zu kennen und ihn argumentativ vertreten zu können. Die Bindung an die Glaubensgemeinschaft, deren intensivster Ausdruck die gemeinsame Teilnahme an der Eucharistiefeier ist, müsse sich im eigenen Leben niederschlagen. Humanitätsimpulse geben Großgruppen wie die katholischen Studentenverbände können so die Überzeugung des Bischofs unter den heutigen Lebensbedingungen Humanitätsimpulse geben, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Man muss spüren, wir sind nicht nur ein Zusammenschluss wie viele andere auch, sondern hier liegt eine große Idee zugrunde, stellte der zweite Mann im Päpstlichen Laienrat klar. Papst Franziskus sei der Überzeugung, dass das Christentum einen Auftrag hat, der weit über das Binnenkirchliche hinausgeht. Dem müssten auch die katholischen Studentenverbände in ihrer Arbeit Rechnung tragen. Bischof Clemens bestätigte auch, dass es im Rahmen der Kurienreform Pläne gibt, den Päpstlichen Rat für die Laien durch die Umwandlung in eine Kongregation und die Zusammenlegung mit anderen Einrichtungen, etwa dem Rat für die Familie, aufzuwerten. Exodus der Christen aus dem Nahen Osten stoppen Die besorgniserregende Lage der Christen im Nahen und Mittleren Osten und das Verhältnis zum Islam standen im Mittelpunkt der nächsten Gespräche mit Mitarbeitern der Kongregation für die Orientalischen Kirchen und des Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog. Das orientalische Christentum ist im abendländischen Kulturkreis eine vielfach unbekannte Größe. Dass im Nahen und Mittleren Osten schon seit über 2000 Jahren Christen in einer großen Vielfalt leben, ist vielen Menschen im Westen nicht bewusst, da die Region in erster Linie mit dem Islam in Verbindung gebracht wird. Die Vielzahl von Kirchen mit eigenen Riten, Liturgieformen und Spiritualitäten bleiben dem westlichen Betrachter oft fremd. Von der Orthodoxie haben sich im Lauf der Jahrhunderte Teilkirchen abgespalten und mit Rom verbunden, unter Beibehaltung ihrer eigenen Liturgie und unter Anerkennung des päpstlichen Primats, z. B. die chaldäisch-katholische, die syrisch-katholische, die armenisch-katholische oder die melkitisch-griechisch-katholische Kirche. Sie haben die volle Glaubensund Sakramentengemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche aufgenommen. Die Kongregation für die 96 unitas 2/2015
9 vieler Priester und Bischöfe nachzukommen, die Gläubigen hätten die Pflicht, in ihrer Heimat auszuharren, um das Christentum in der Region zu erhalten, und andererseits dem Bestreben, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und ihnen eine bessere Zukunft zu bieten, stellte Max Cappabianca mit zwiespältigen Gefühlen fest. Eine Kneipe bei der in Rom beheimateten CV-Verbindung Capitolina gehört schon fast zur Tradition der AGV-Rom-Seminare. Orientalischen Kirchen hat den Auftrag, die Verbindung mit diesen katholischen Kirchen zu halten, um deren Wachstum zu fördern, deren Rechte zu sichern und ihre Traditionen lebendig zu halten. Sie ist unter anderem zuständig für Bischofsernennungen und die Organisation der teilkirchlichen Strukturen. Durch die Krisen im Nahen Osten und das grausame Vorgehen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind die orientalischen Christen in jüngerer Zeit stärker ins öffentliche Bewusstsein geraten. Sie gehören zu den Hauptleidtragenden dieser Entwicklungen. Dominikanerpater Max Cappabianca ist Sekretär der ROACO, eines Gremiums der Orientalenkongregation, das die finanzielle Unterstützung für die Gebiete unter der Jurisdiktion der Kongregation koordiniert. Eine herausragende Rolle spielen dabei die kirchlichen Hilfswerke, die im Ausbreitungsgebiet der sieben unierten orientalischen Kirchen tätig sind, etwa aus Deutschland Misereor, Missio, Renovabis und Kirche in Not. Der in Frankfurt geborene Ordensmann mit neapolitanischen Wurzeln zeigte sich im Gespräch mit den Studenten sehr besorgt über die schwierige Lage der Christen im gesamten Nahen Osten. Im Irak und in Syrien seien große Teile der christlichen Minderheiten mit brachialer Gewalt von der Terrormiliz Islamischer Staat vertrieben oder gar getötet worden. Sie seien, so Cappabianca, von der Vernichtung bedroht und mit ihnen sterbe ein Teil der Kultur dieser Länder und eine über 2000-jährige christliche Tradition. Wenn nicht bald etwas zur Befriedung der Region und zur Bekämpfung des grausamen radikal-islamistischen Terrors geschieht, scheint der weitere Exodus der Christen aus der Ursprungsregion des Christentums nicht mehr aufzuhalten zu sein, fürchtet Max Cappabianca. Unter den Flüchtlingen sterbe zunehmend die Hoffnung. So leben von im Jahr ,3 Mio. Christen heute nur noch knapp im Irak. Sie stehen vor dem Dilemma, einerseits der Aufforderung Dr. Michael Weninger (ÖCV) vom Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog sieht fundamentale Unterschiede zwischen dem Menschenrechtsverhältnis islamischer und westlicher Staaten. Aber was kann die Kongregation tun, um den orientalischen Christen zu helfen? Sie kann zunächst moralische Hilfe leisten und mit weltweiter Solidarität den Betroffenen neuen Mut zusprechen. So kündigte Pater Max Cappabianca für die nächsten Wochen Solidaritätsreisen der Kongregationsspitze nach Syrien und in den Irak an. Und sie könne versuchen, materielle Hilfe zu organisieren, die den Christen neue Zukunftsperspektiven in ihrer angestammten Heimat gibt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Bürgerkrieg in Syrien und das politische Chaos, die Unregierbarkeit im Irak so schnell wie möglich beendet werden und den Menschen ein neues Sicherheitsgefühl gegeben wird, sodass sie in Frieden und Gerechtigkeit in einer mehrheitlich von Muslimen bevölkerten Umgebung leben können, so der Dominikaner. Und: Dem Terror des IS müsse ein Ende bereitet werden. Österreichischer Spitzendiplomat als Spätberufener im Rat für Interreligiösen Dialog Nächster Gesprächspartner war Dr. Michael Weninger vom Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog mit einer bemerkenswerten Biografie. Der studierte Theologe und langjährige österreichische Diplomat unter anderem als Botschafter in der Ukraine, in Serbien und Bosnien-Herzegowina, sowie als politischer Berater der EU-Kommission, wo er für den Dialog mit den Religionen, Kirchen und Weltanschauungen zuständig war wurde nach dem Tod seiner Frau als Spätberufener im Alter von 60 Jahren zum Priester der Erzdiözese Wien geweiht. Im November 2012 wurde Michael Weninger dann als Mitarbeiter des Rates für den Interreligiösen Dialog >> unitas 2/
10 nach Rom entsandt, wo er sich vor allem mit dem Islam in Europa befasst. Wir glauben nicht an denselben Gott! Eine wesentliche Aufgabe des Dikasteriums ist, einen Beitrag zur Verständigung zwischen den unterschiedlichen Religionen zu leisten und die Kontakte zu fördern. Als Grundvoraussetzung für ein besseres gegenseitiges Verständnis von Christentum und Islam und für einen wirklichen Dialog sieht der ehemalige österreichische Diplomat eine Verbesserung des theologischen Wissens über die Religion des Gegenübers an. Die vorhandenen Wissenslücken müssten durch Austausch und internationale Tagungen verringert werden. Denn nur, wenn man über den anderen mehr weiß, kann man ihm auch entsprechend begegnen. Der interreligiöse Dialog könne keinen Kuschelkurs gebrauchen. Allein bunte Luftballons steigen zu lassen und zu sagen, wir haben uns alle lieb, wie man das häufig erleben kann, ist absolut zu wenig, so der Islam-Experte. In der Glaubenslehre gebe es sehr große Unterschiede und es sei sehr schwierig, darüber zu sprechen. Wir glauben nicht an denselben Gott und der Jesus im Neuen Testament ist nicht der Jesus im Koran. Deshalb sei auch kein gemeinsames Gebet möglich. Ferner unterscheide sich das Menschenrechtsverständnis einiger islamischer Staaten und Organisationen grundsätzlich von Menschenrechtserklärungen westlicher Länder. Sie räumen dem Koran und dem islamischen Gesetz (der Sharia) vor der Gewährung aller Menschenrechte stets den höheren Rang ein. Menschenrechte können daher in islamischen Ländern eigentlich nur im Rahmen der im Koran und dem islamischen Gesetz festgelegten Gebote gewährt und eingefordert werden, stellte der Kurienmitarbeiter fest. Führungen durch das antike Rom hier im Forum Romanum und im Kolosseum und durch die Vatikanischen Gärten hier vorbei am Kloster Mater Ecclesiae, dem Alterssitz von Papst emeritus Benedikt XVI., und beim Angelus-Gebet vor der Lourdes-Grotte brachten willkommene Unterbrechungen im dichten Gesprächsprogramm. Weninger, der seit seiner Studienzeit in Innsbruck dem ÖCV angehört, nahm auch die großen Herausforderungen in den Blick, die heute in Fragen der Religionskonflikte zu bewältigen sind. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht Christen ermordet und Kirchen im Namen des Islam niedergebrannt werden. Diese Punkte muss man auch auf die Tagesordnung bestimmter interreligiöser Kontakte setzen. Neben der Religionsfreiheit nannte Weninger als weitere Beispiele für heutige Dialogherausforderungen Fragen der Bioethik, der sozialen Gerechtigkeit oder auch spezielle Fragen wie die Beschneidung. Die weibliche Genitalbeschneidung ist ein Verbrechen und muss bestraft Kardinal Müller im Gespräch über aktuelle kirchliche Themen werden, so die klare Forderung Weningers. Kappen der christlichen Wurzeln in Europa ist unvernünftig Der Ausspruch, der Islam gehöre zu Deutschland, sei eine flapsige und unbedachte politische Formulierung gewesen, die falsch sei. Aber es gebe Muslime, die in Deutschland leben. Das aufgrund einer zunehmenden Säkularisierung der europäischen Gesellschaften und aus einer oft falsch verstandenen politischen Korrektheit heraus erfolgte Kappen der christlichen Wurzeln ist aus Weningers Sicht nicht vernünftig. Europa ohne Christentum ist nicht zu denken, sagte der heute 64-jährige gebürtige Wiener. Wir müssen uns bewusst werden, was wir in Europa dem Christentum verdanken, und unser eigenes Profil wieder schärfen und unserer eigenen Identität eingedenk werden. Gespräch mit dem obersten Glaubenshüter der katholischen Kirche 98 Den Höhepunkt der Gespräche in den vatikanischen Ministerien bildete ein Besuch bei der Glaubensunitas 2/2015
11 kongregation im Palazzo Sant Ufficio. Hier trafen die AGV-Seminarteilnehmer den Präfekten, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der sich gut gelaunt über eine Stunde Zeit für den Austausch nahm. Nach der Diskussion um die Frage der Familienpastoral und des Ehesakraments, speziell des Umgangs der Kirche mit wiederverheiratet Geschiedenen befragt, stellte Kardinal Müller klar, dass die Glaubenskongregation in diesem Punkt, aber natürlich auch in allen Fragen der katholischen Lehre die Glaubenswahrheit vertritt. Er trat der Darstellung entgegen, eine Zulassung zu den Sakramenten sei aus Barmherzigkeit zu rechtfertigen. Barmherzigkeit kann nicht ohne Wahrheit existieren, betonte der Präfekt der Glaubenskongregation. Die Lehre der Kirche in diesem Punkt sei ganz klar und in zahlreichen Dokumenten nachzulesen, aber viele Gläubige würden sie gar nicht kennen. Es wäre doch paradox, wenn die Kirche sagen würde: Weil viele die Wahrheit nicht kennen, ist sie für die Zukunft nicht mehr bindend, stellte Kardinal Müller fest. Er wandte sich auch gegen eine Reduzierung der Debatte auf die Frage des Kommunionempfangs und forderte eine umfassendere Pastoral für die Betroffenen. Es geht wesentlich darum, die kirchliche Lehre von Ehe und Familie wieder ganz zentral ins katholische Glaubensbewusstsein zu bringen, sagte der ehemalige Bischof von Regensburg. Die Ehe sei ein Sakrament, das eine unauflösliche Bindung zwischen beiden Ehepartnern schaffe. Sie geben sich das Wort, vollständig zusammenzuleben, im Körperlichen, in der Sexualität, im Geist, im Glauben und in der Gnade Gottes, betonte Müller. Er bemängelte, dass die Eheschließung für viele Katholiken nur noch ein folkloristisches Ritual sei und nicht mehr das eigentliche Sakrament im Mittelpunkt stehe. Nur wenn wir vom Gelingen von Ehe und Der Präfekt der Glaubenskongregation Kardinal Gerhard L. Müller stellt sich nach dem Gespräch mit den Studenten im Innenhof des Palazzo Sant Ufficio zum Gruppenfoto. Familie ausgingen und uns dafür auch einsetzten, könnten wir etwas Positives bewirken. Querdenker in der Mönchskutte Der Abtprimas der Benediktiner Notker Wolf (KV) führt die Studenten durch San Anselmo. Anschließend spricht er über Papst Franziskus, benediktinische Spiritualität, Neuevangelisierung und Ökumene. Auf dem Aventin liegt die Weltzentrale und Hochschule des Benediktinerordens San Anselmo. Hier trafen die Seminarteilnehmer Abtprimas Dr. Notker Wolf. Dem Himmel nah ist er gleich in mehrfacher Hinsicht. Er ist Chef des ältesten Ordens der Christenheit und er bringt locker Flugkilometer im Jahr auf sein Meilenkonto. Der Abtprimas ist der höchste Repräsentant der Benediktiner weltweit und Herr über Klöster und Mönche und Nonnen. Es muss offener miteinander geredet werden An Papst Franziskus schätzt er aus der Sicht des Benediktinerordens am meisten die radikale Rückkehr zum Evangelium. Franziskus steht für eine neue Sicht von Kirche, die ganz vom Evangelium her kommt, so Notker Wolf. Der neue Geist sei aber noch nicht überall zu erkennen. Ohne Namen zu nennen, kritisierte der Freund eines offenen Wortes, das nach wie vor bestehende Intrigantentum in kirchlichen und kurialen Kreisen und die damit verbundenen Lügen. Es sei schlimm, dass häufig nicht offen miteinander geredet werde. Den Begriff Neuevangelisierung mag Notker Wolf nicht. Die Verkündigung des >> unitas 2/
12 Evangeliums sei immer schon eine der wesentlichen Aufgaben der Christen gewesen und müsse in der heutigen schwierigen Situation der Kirche intensiviert werden. Wir müssen davon weg, die Kirche in erster Linie nur als hierarchisch strukturierte Institution zu sehen; denn wir sind kein Verein, sondern Kirche ist die Gemeinschaft aller Gläubigen, forderte der Abtprimas. Die eigentliche Sünde bestehe darin, dass viele Menschen sich von Gott abgewendet haben und sich zu sehr auf sich selbst beziehen. Viele Menschen lassen sich nicht mehr im Herzen von Jesus Christus erfassen. Was Jesus getan hat, müssen wir nur weitertragen und weitertun. Jesuitenpater Bernd Hagenkord (rechts) informiert über die Arbeit von Radio Vatikan. In der Ökumene müsse der Geist der Rechthaberei vertrieben werden, der gerne die jeweils andere Kirche als defizitär beschreibe. Stattdessen schlug der weltweite Sprecher der Benediktiner vor, verstärkt gemeinsam für Christus Zeugnis abzugeben, sich gemeinsam für caritative Projekte und für den Frieden einzusetzen. Zum Schluss des Gesprächs ermunterte Notker Wolf die Studenten, Querdenker zu sein und sich nicht einschüchtern zu lassen. Wir haben schon viel zu viele Duckmäuser in Deutschland, stellte der Ordensmann fest. Er selber lege auch gerne ab und zu ein Bömbchen. Der Sender des Papstes Gespräche mit dem Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, Pater Bernd Hagenkord, und dem Italienund Vatikankorrespondenten der FAZ, Dr. Jörg Bremer, lenkten den Blick auf die Rolle der Medien einmal aus der Innen- und zum anderen aus der Außensicht. Der Jesuit Hagenkord stellte klar, dass Radio Vatikan zwar der Sender des Papstes sei, was aber nicht bedeute, dass alles nur schön geredet werde. Wir bemühen uns um eine nüchterne, sachliche Berichterstattung ohne den Boulevardstil mancher säkularer Medien, so Pater Hagenkord. Zu seiner Einschätzung von Papst Franziskus nach zwei Jahren Pontifikat befragt, sagte der Vatikanexperte, die Erwartungshaltung, die der Papst geweckt habe, müsse man deuten. Ich glaube, Franziskus will die Kirche dynamischer machen. Wenn er von der Nach getaner Arbeit trafen sich die Seminarteilnehmer zu einem kleinen Empfang auf der Dachterrasse des Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo mit einem fantastischen Blick auf den benachbarten Petersdom und seine Kuppel. Gastgeber war der Rektor des Kollegs Dr. Hans-Peter Fischer (CV). Freude des Evangeliums spreche, wolle er, dass wir alle das Evangelium in unserem Leben weitergeben, also ein missionarisches Christsein. Für Hagenkord ist nachvollziehbar, dass sich manche damit überfordert fühlen. Das Projekt, das der Papst mit seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium angestoßen hat, ist sehr anspruchsvoll und nicht in kurzer Zeit umzusetzen. Dies könne natürlich zu Enttäuschungen führen, die sich bereits jetzt andeuteten. Ich bleibe trotzdem bekennender Fan von Franziskus, outete sich der Jesuitenpater. Papst Franziskus ist authentisch Die Art und Weise, wie Franziskus mit den Medien umgehe, sei echt. Deshalb komme er auch authentisch rüber. So etwas kann man nicht planen, meint der Vatikanjournalist. Er wolle die direkte Kommunikation, auch auf die Gefahr hin, dass er dabei Fehler mache. Die Medien mussten sich erst an den neuen Stil von Franziskus gewöhnen, an die neue direkte Art und Weise, wie er auf die Leute zugehe, an die ganz eigene Form von Protokoll, an die starke pastorale Prägung eben ganz anders als sein Vorgänger. Man müsse auch unterscheiden zwischen der medialen Wahrnehmung und der Wirklichkeit. So bewertet der vatikanische Medienexperte den oft beschriebenen Gegensatz zwischen dem Papst und Teilen der Kurie größtenteils als konstruiert. Für die Weltkirche sieht Pater Hagenkord im Pontifikat von Papst Franziskus viel Herausforderndes: 100 unitas 2/2015
13 Europa und speziell Deutschland spielen nicht mehr die erste Geige. Für den ehemaligen Erzbischof von Buenos Aires seien andere Themen wichtig, wie inzwischen schon sehr deutlich geworden sei. Dies zeige sich auch in den Sendeanteilen. Früher sei die Berichterstattung etwa zu einem Drittel über den Papst, zu einem Drittel über weltkirchliche Themen und zu einem Drittel über die Kirche im deutschsprachigen Raum erfolgt. Heute bestehe die Hälfte aus Beiträgen zu Papst und Vatikan, während das Interesse an der deutschsprachigen Kirche fast komplett weggekippt sei. Veränderungen in der medialen Präsenz Als Vatikanbeobachter von außen präsentierte sich FAZ-Korrespondent Jörg Bremer im deutschsprachigen Pilgerzentrum. Auch er wurde nach seiner Einschätzung der ersten zwei Jahre des Pontifikats von Papst Franziskus gefragt. Welche Veränderungen hat es in der medialen Präsenz gegeben? Die Menschen und die Medien haben erst einmal überwiegend positiv darauf reagiert, dass da ein Papst ist, der anders ist, als man das bisher gewohnt ist. Und alles was anders ist, macht natürlich neugierig, berichtete Jörg Bremer. Papst Franziskus sei glaubwürdig und einfach das sei für die Menschen sehr wichtig. Und er habe eine Sprache, die die Menschen verstehen. Man merkt es auch am FAZ-Vatikan- und Italienkorrespondent Dr. Jörg Bremer sieht den Papst aus einer anderen Warte. Schreiben Evangelii gaudium. Das liest sich deutlich flüssiger als alle bisherigen päpstlichen Verlautbarungen, stellte der FAZ-Korrespondent fest. Es werde natürlich sehr wichtig werden, wie seine Anstöße und Impulse dann auch umgesetzt würden. Wie sich jetzt schon zeige, werde es nicht ausbleiben, dass auch kritische Anfragen und Enttäuschungen kommen, wenn Franziskus seinen Worten nicht Taten folgen lasse, etwa bei mehr Transparenz und der Kurienreform. Bremer bezweifelte allerdings, ob die eine oder andere von Franziskus getroffene Personalentscheidung besonders glücklich war. In diesem Zusammenhang griff der erfahrene Journalist auch den scheinbaren Gegensatz zwischen Papst Franziskus und dem Präfekten der Glaubenskongregation bei der Familien- und Ehepastoral auf. Wenn einer so spontan sei und so viel sage wie Papst Franziskus und alles gleich als päpstliches Wort ausgelegt werde, werde übersehen, dass hier der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires oder der Bischof von Rom spreche, also jemand, der ganz normal verstanden werden möchte. Wir sind gewohnt, dass theologische Probleme ausdiskutiert werden müssen. Die reine Lehre muss irgendwie gerettet werden, formulierte der evangelische Christ. Bremer glaubt, dass Fragen wie das Familien und Eheverständnis immer gleich theologisch überhöht werden. Wenn dies nicht der Fall wäre, sondern manche Probleme eher von der pastoralen Warte und von der Notwendigkeit, das Evangelium als eine heilsbringende Botschaft an den Menschen heranzubringen, angegangen würden, wäre die Sache leichter. Jörg Bremer glaubt, das die theologische Debatte mehr und mehr in den Hintergrund treten wird und der Umgang mit den strittigen Fragen personalisiert und in den Diözesen pragmatisch von Fall zu Fall entschieden wird. Sich offen zum Glauben bekennen Auch in der Ökumene sieht Jörg Bremer das erstrangige Ziel nicht in der theologischen Auseinandersetzung, sondern in einer gemeinsamen Pastoral, mit der es gelinge, die Menschen vom christlichen Glauben zu überzeugen. Wir müssen den Christen helfen, zu ihrem Bekenntnis zu stehen, so der Vater von drei Kindern. Als positives Beispiel für ein solches Engagement verwies der langjährige Israel- und Palästina-Korrespondent der FAZ auf das Heilige Land. Hier werde es immer problematischer, sich als Christ offen zu bekennen. Die schwierige Situation zwinge die Christen der verschiedenen Denominationen zusammenzustehen, gemeinsam für ihren Glauben einzutreten und sich zu helfen. In Rom ist es relativ einfach, sein Bekenntnis zu zeigen, im Irak >> unitas 2/
14 führt dies aber häufig zum Tod, mahnte Bremer. Ökumenische Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden sei ein Gebot der Stunde. Deutschland ist ein religionsfreundliches Land Auch die deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl Annette Schavan verwies im Gespräch mit den Seminarteilnehmern auf die besondere Bedeutung der Religionsfreiheit. Deutschland ist ein religionsfreundliches Land, in dem die Kirchen einen großen Gestaltungsspielraum haben, stellte die engagierte Katholikin fest. Diese religiöse Toleranz, die nur auf der Grundlage der Trennung von Staat und Kirche möglich sei, zeige sich auch darin, dass es an mehreren Hochschulen noch von ihr als Bildungs- und Forschungsministerin geförderte Zentren für islamische und zudem noch eines für jüdische Studien gebe. Sie sieht darin die sachgerechte Antwort auf die zunehmende religiöse Vielfalt, denn diese theologisch-wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen seien zugleich Orte für die Reflexion der Aufklärung. Annette Schavan, die seit Juli 2014 die Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl vertritt, empfing die Studenten in ihrer Residenz im noblen römischen Stadtteil Parioli bei Kaffee und Kuchen. Verbindungen herzustellen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl, sieht sie als Kern ihrer Aufgabe in Rom an, auch zwischen zivilgesellschaftlichen Kräften und den Kompetenzen beim Vatikan. Ich glaube, dass der Vatikan der Ort ist, an dem es das größte Wissen über Gott und die Welt gibt, bemerkte die Botschafterin. Darin schließt sie auch die großen Botschafterin Annette Schavan sieht die deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl auch als Plattform zum Austausch zwischen Kirche, Gesellschaft und Wissenschaft Ordenszentralen, Päpstlichen Universitäten und kirchlichen Institute ein. Mit ihrem dichten weltweiten Netzwerk und ohne den Zwang zu schnellen Ergebnissen sei die katholische Kirche der älteste Global Player. Deshalb könne sie in besonderem Maße als friedensstiftende Instanz wirken. Diese Ressourcen will Schavan auch für ihre Zeit als Botschafterin nutzen: Ich möchte die deutsche Botschaft als Plattform anbieten für Gespräche und Begegnungen mit katholischen Persönlichkeiten, aber auch mit Schriftstellern, bildenden Künstlern und Wissenschaftlern. Mit ihrer Biografie sei sie nicht die klassische Chefdiplomatin. Was wir brauchen, ist eine politische Diplomatie, die aus mehr besteht als nur aus Stehempfängen, sagte die erfahrene Politikerin. Sie kennt die katholische Kirche und den Vatikan schon aus ihren früheren Tätigkeiten und kann das Informationsnetz des Heiligen Stuhls ganz anders ausschöpfen als ihre Vorgänger. Weniger abstrakte Reden und mehr Empathie Um das Christentum und die Kirche wieder attraktiver zu machen, bedürfe es weniger abstrakte Reden und mehr Empathie. Man muss spüren, dass die Christen es ernst meinen mit den Menschen, forderte Annette Schavan. Papst Franziskus habe das Schlagwort der Barmherzigkeit im Sinne einer vergebenden, mit offenen Armen auf die Gläubigen zugehenden Kirche zum Programm seiner Amtszeit gemacht. Franziskus hat so Schavans Eindruck eine große Koalition mit dem Volk. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Veränderungsbestrebungen des Papstes. Franziskus werde sich nicht an zu vielen Fronten verzetteln. Das zentrale Anliegen des 78-jährigen Pontifex sei die Kurienreform, die aber nun auch zügig durchgeführt werden müsse. Papst Franziskus ist entschieden und angstfrei. Er will nicht nur aus der Erinnerung erneuern, sondern er ist ein Mensch, der aus dem Gebet lebt, sagte die Botschafterin. Botschafterin Annette Schavan mit der Studentengruppe im Garten ihrer Residenz Annette Schavan vermisst Berlin nicht. Der größte Unterschied zu ihrer früheren Tätigkeit als Ministerin sei ein anderer Umgang mit der Zeit. Es stehe nicht jede Stunde ein neuer Termin an und sie habe so mehr Freiraum, über Dinge intensiver nachzudenken. Dies 102 unitas 2/2015
15 schnell kann er seine Visionen in die Tat umsetzen? Kann er die Kirche zusammenhalten? Und: Wird er die Menschen weiter begeistern können? Kardinal Walter Brandmüller (CV) feierte mit der Studentengruppe am letzten Tag des Seminars in der Kapitelskapelle des Petersdoms die Hl. Messe. Dabei konnten je ein Vertreter von CV, KV und UV chargieren. empfinde ich als hohen Zugewinn an Lebensqualität, bekannte die ehemalige Bundesministerin. Gemeinwesen aktiv mitgestalten Am Ende des eineinhalbstündigen Gesprächs gab Annette Schavan den Studenten noch zwei Ratschläge mit auf den Weg: Egal, was Sie tun, bemühen Sie sich um innere Unabhängigkeit, bleiben Sie innerlich frei und reagieren Sie nicht nur auf Trends und Moden. Und zweitens: Entwickeln Sie Empathie für das Gemeinwesen, gestalten Sie es aktiv mit und übernehmen Sie Verantwortung als Ausdruck der inneren Freiheit. Zum Abschluss des Rom-Seminars feierte Kardinal Walter Brandmüller mit den Teilnehmern eine Messe in der Kapitelskapelle des Petersdoms, bei der auch jeweils ein Vertreter von CV, KV und UV chargierten. An den vorangegangenen Tagen hatte der Geistliche Beirat des Vororts, Bbr. Dr. Oliver Wintzek, jeden Morgen zur gemeinsamen Eucharistiefeier eingeladen. Neben dem dichten Arbeitsteil gab es auch noch Gelegenheit, etwas von Rom und vom Vatikan zu sehen. So bei einem Bummel durch das nächtliche Rom, Führungen durch das antike Rom mit dem Capitol, dem Forum Romanum und dem Kolosseum, den Petersdom und durch die Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle. Bei strahlendem Sonnenschein führte ein Spaziergang durch die Vatikanischen Gärten und ein besonderer Höhepunkt war eine Führung in den Scavi, der Nekropole unter dem Petersdom mit dem Grab des Hl. Petrus. Schließlich war auch altstudentisches Brauchtum mit im Programm. Die in Rom beheimatete CV-Verbindung Capitolina hatte zu einer Kneipe auf ihre Bude in der Nähe der Piazza Navona geladen, die vom stellvertretenden AGV-Vorsitzenden Marius Pentrup (CV) geleitet wurde. Ein gutes Dutzend Capitolinen feierte mit den Seminar-Teilnehmern. Dies war auch eine gute Gelegenheit, der Capitolina für ihre Gastfreundschaft und ihre Begleitung durch die Tage in der Ewigen Stadt herzlich zu danken. Fazit Die Teilnehmer des Seminars konnten in den fünf Tagen in Rom nicht nur einen Einblick in die Arbeit der Kurie bekommen und die katholische Kirche als Global Player besser kennenlernen. Auch der neue Aufbruch, die Hoffnung und die hohen Erwartungen, die mit der Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum Papst begonnen haben, wurden in den vielen Gesprächen greifbar. Aber es blieben auch Fragen: Wie Global denken ein Anspruch, mit dem angehende Akademiker in den letzten Jahren immer stärker konfrontiert werden gilt auch für die Kirche. Das heißt wohl zunächst, die Grenzen der eigenen Perspektive zu erkennen und dann die Bereitschaft, diese Grenzen überwinden zu wollen. Keine einfache Aufgabe. Die Kirche stellt sich ihr seit ihrer Gründung. Sie will schon immer Kirche für die ganze Welt sein und der einzelne Gläubige ist damit Teil der Weltkirche. Theoretisch mag das vielen klar sein, doch was bedeutet das für die Praxis? So war das Rom- Seminar der AGV auch eine Horizonterweiterung für die Teilnehmer. Ich bin noch immer ganz beseelt von den schönen Tagen in fröhlicher Gemeinschaft mit den Bundes- und Farbenbrüdern sowie von den äußerst beeindruckenden und anregenden Gesprächen und Begegnungen allen voran natürlich jene mit dem Heiligen Vater, bekannte der Vorortspräsident des Unitas-Verbands, Bbr. Moritz Findeisen, nach der Rückkehr aus Rom. Neues Heiliges Jahr Papst Franziskus hat am 13. März, dem zweiten Jahrestag seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche, ein neues Heiliges Jahr mit dem Thema Barmherzigkeit angekündigt. Das Jahr solle der Kirche helfen, ihre Mission, Zeuge der Barmherzigkeit zu sein, noch überzeugender zu erfüllen. Am 8. Dezember 2015 soll das Jubiläum der Barmherzigkeit beginnen und am 20. November 2016 enden. Es ist kein Zufall, dass das Jahr ausgerechnet am 8. Dezember, genau 50 Jahre nach dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils ( ), beginnt. In einer ergänzenden Mitteilung des Vatikan heißt es ausdrücklich, das Heilige Jahr sei auch eine Einladung, das mit dem Konzil begonnene Werk fortzusetzen. Der Papst wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass wichtige Anliegen dieser Bischofsversammlung noch nicht verwirklicht seien. unitas 2/
16 Droht die christliche Gotteshoffnung in der Sprachlosigkeit zu versickern? PERSÖNLICHE BEOBACHTUNGEN ZUM ROM-SEMINAR DER AGV VON VORORTSPRÄSIDENT MORITZ FINDEISEN Jeder erlebt Rom anders: Die faszinierende caput mundi durfte sich beim AGV-Seminar im März einmal mehr als Zentrum der Weltkirche darstellen. Die verschiedenen Begegnungen mit deutschsprachigen Stars und Sternchen der römischen Kurie sowie aus der journalistischen und diplomatischen Öffentlichkeit hinterließen bei mir einen nachhaltigen Eindruck und die zum größten Teil äußerst anregenden Gespräche bewegen mich, einige persönliche Beobachtungen festzuhalten. Hohe Erwartungen an Papst Franziskus Das Phänomen Franziskus ist merklich prägend für die gegenwärtige Kirchenwahrnehmung. Fast alle Gespräche nahmen davon ihren Ausgang und aus verschiedenstem Munde wurde dem Heiligen Vater eine atmosphärische Verbesserung der kirchlichen Situation als Verdienst seines bisherigen Pontifikats attestiert. Franziskus ist auf bestem Wege, zu einer weltweiten Ikone des Humanismus zu werden (Abtprimas Notker Wolf OSB) und findet auf diese Weise auch Zugang zu sonst eher glaubensfern stehenden Kreisen. Die katholische Kirche scheint verlorenes Ansehen wiederzugewinnen und sowohl seitens der Gläubigen wie auch von Außenstehenden werden hohe Erwartungen an die Person des Papstes geknüpft. Genau hier aber lauert Gefahr: Seine große Koalition mit dem Volk (Annette Schavan) droht zu zerbrechen, sollten verschiedene Positionen unaufgearbeitet bleiben, welche das Bemühen um eine größere Gegenwartskompatibilität der christlichen Gotteshoffnung unnötig erschweren. So sehr in deutlicher Sprache angemahnt wurde, die Kirche befinde sich gegenwärtig in der prekären, aber glücklichen Lage, für unabsehbare Zeit eine vorerst letzte Chance zu haben, Der Autor dieses Artikels, Vorortspräsident Moritz Findeisen die Kommunikation mit der heutigen Welt nicht nur nicht gänzlich zu verlieren, sondern neu zu gewinnen (Bischof Josef Clemens), so ernüchternd war, dass gerade in höchsten kurialen Kreisen eine deutliche Diskrepanz zu beobachten war zwischen wohlwollender und erwartungsvoller Außenwahrnehmung einerseits und der mangelnden Sensibilität der kirchlichen Wahrheitsbehörden gegenüber den Fragen vieler Christen an die Plausibilität und Lebenstauglichkeit so mancher neuralgischer Thesen andererseits, deren beschworene Ewigkeitspatina vielfach jüngeren Datums sein dürfte. Hier waren bisweilen Antworten katechismusartiger Trivialität zu hören auf Fragen, die kaum einer stellt schablonenhaft richtig, aber ohne Relevanz. Ob 104 unitas 2/2015
17 in einer religiös und säkular ausdifferenzierten Gesellschaft der Kommunikationspflicht der Kirche entsprochen wird, so man anderen Gottesoptionen statt mit differenzierten Analysen und hinreichend theologisch fundiertem Dialog mit jovialem Getöse begegnet, dürfte ebenfalls fraglich sein. Der Lacher mochte man sich mit letzterem Auftreten zwar sicher sein, aber eigentlich ist es zum Weinen. Die angemahnte Kommunikation hat freilich von dem zu leben, was ihr Inhalt ist, als reine Methode endet sie in Phraseologie. Eine um sich greifende Sprachlosigkeit hinsichtlich der christlichen Gotteshoffnung betrifft längst die zum Lebenszeugnis aufgerufenen Christen selbst: So zutreffend es ist, dass die Glaubensüberzeugung das Leben zu prägen hat Warum sehen wir nicht erlöster aus?, so schnell geraten wir ins Stammeln, wenn es auf den Punkt zu bringen gilt, was uns im Innersten unseres Glaubens trägt und bewegt, wie das Proprium des Christlichen auch gegenüber einer säkularen Welt zu bestimmen und zu artikulieren ist. Zunächst gilt es, mit gelassenem Realismus anzuerkennen, dass die kirchliche Medienpräsenz, insbesondere im Bereich der sozialen Netzwerke, trotz allen erfolgreichen Bemühens um fundierte und authentische Berichterstattung in der Regel nur ein verhältnismäßig kleines Binnenspektrum an Konsumenten erreichen wird (P. Bernd Hagenkord SJ, Radio Vatican). Dieser Einsicht möge doch ein verstärktes Sicheinüben in die eigene Übersetzungsfähigkeit folgen, Überzeugungen, die uns in Glaubensgewissheit durch und durch geläufig sind, dergestalt ausdrücken zu können, dass sie auch dem interessierten Außenstehenden verständlich werden ein Anspruch, der jedem Gläubigen nicht nur Pflicht ist, sondern Herzensanliegen sein sollte. Meine Frage, wie es gelingen kann, dem mehrheitlich säkularen Leser jenseits von Folklore-Journalismus (Trägt der Papst rote Schuhe oder nicht?) und Krisen-Berichterstattung (Welcher Kardinal agiert gegen wen?) auch zentrale Kategorien unserer Gotteshoffnung zu vermitteln, parierte Jörg Bremer (FAZ) mit der aufrichtigen Gegenfrage, welches die ersten drei Sätze wären, mit denen ich einen solchen Artikel eröffnen und das Interesse derer wecken wolle, die vom Christentum nichts mehr erwarten: So ich sie ihm liefere, würde er den restlichen Artikel verfassen. Der drohenden Sprachlosigkeit durch eigene Beredsamkeit und Glaubensfreude entgegenwirken Noch sind diese Sätze nicht gefunden, deren Formulierung sich am schmalen Grad zwischen werbender Offenheit und gebotener Prägnanz, zwischen aufrichtigem Bekenntnis und argumentativem Geschick zu orientieren hätten. Noch ist glücklicherweise auch die Titelfrage meiner Überlegungen nicht entschieden obgleich die Aus der AGV: Gegen das Vergessen Zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar hat die Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände (AGV) folgende Erklärung abgegeben: Gefahr des Versickerns kirchlich gebundener Glaubenspraxis zumindest in unseren Breitengraden unbezweifelbar scheint. Ebenfalls wird sie sich gewiss nicht allein in Rom, dem Zentrum der Weltkirche, entscheiden: Für jeden Einzelnen besteht die herausfordernde Gelegenheit der drohenden Sprachlosigkeit durch eigene Beredsamkeit und Glaubensfreude entgegenzuwirken. Die Erfahrungen des zurückliegenden AGV-Seminars haben mir für diese Aufgabe in verschiedener Hinsicht wichtige Anregungen gegeben. Der 27. Januar ist offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus befreite die Rote Armee den KZ-Komplex Auschwitz bei Krakau im deutsch besetzten Polen. Über eine Million Männer, Frauen und Kinder, überwiegend Juden, ermordeten die Nazis allein im Vernichtungslager Birkenau. Die meisten Deportierten erstickten qualvoll in Gaskammern. Auschwitz ist heute ein Synonym für den Massenmord der Nazis an den europäischen Juden, aber auch an Sinti und Roma, Homosexuellen und politisch Andersdenkenden. Wir als katholische Studentenverbände nehmen diesen Gedenktag zum Anlass, dazu aufzurufen, die Vergangenheit nicht zu vergessen und die Lehren daraus für unsere Zukunft zu nutzen. Das Gedenken und Nachdenken über die Vergangenheit schafft Orientierung für die Zukunft. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2012 weiß jeder fünfte Deutsche unter 30 Jahren nichts mit dem Begriff Auschwitz anzufangen. Ein alarmierender Befund, der unsere Verantwortung, den Holocaust zurück in die Köpfe der Jugend zu bringen, deutlich macht. All das Leid und das unvorstellbare Maß an Grausamkeit, was Menschen anderen Menschen jemals angetan haben, dürfen nicht in unserer Vergesslichkeit versanden. Gerade als jüngere Generation müssen wir erinnern und uns erinnern lassen an die furchtbaren Opfer menschlicher Grausamkeit und Gewissenlosigkeit. Wir haben diese schreckliche Zeit nicht selber direkt miterlebt. Umso mehr ist für die junge Generation die Erinnerung an die Gräuel des Nationalsozialismus wichtig. Wir sind Erben unermesslicher früherer Verbrechen und müssen die Folgen der Sünden unserer Vorfahren ernst nehmen, müssen wachsam sein und denen wehren, die auch heute wieder anfangen, Menschen wegen ihrer Religion, Nationalität oder Rasse auszugrenzen und zu verfolgen. Wir setzen uns ein für Frieden, Versöhnung und für einen Geist der Erneuerung für eine Gesellschaft ohne Völkerhass, Totalitarismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Bonn, den 26. Januar 2015 unitas 2/
18 Über den wahrheitsliebenden Politiker VON DR. BURKHARD CONRAD FÜR MICHAEL TH. GREVEN Politisches Handeln und Wahrheit haben nichts miteinander zu tun. So scheint es in der politischen Wissenschaft heutzutage Konsens zu sein. 1 Im Sinne einer Abrüstung politisch-religiöser Rhetorik und der Vermeidung immer wieder aufkeimenden Allmachtsphantasien sind solche Stimmen mehr als nachzuvollziehen. Politische Theologie im Sinne einer parteiischen Inwertsetzung unverfügbarer Wahrheit zur Unterfütterung wankender Ordnungsvorstellungen ist als Projekt gescheitert. Das bedeutet aber nicht, dass die praktische Welt der Politik mit der transzendenten Sphäre der Wahrheit unter keinen Umständen in Berührung kommen darf. Ein solches Denk- und Handlungsverbot geht mit der Gefahr einher, dass jegliche Wahrheitsfrage aus dem politischen Raum herausgedrängt bzw. zur bloß pragmatischen Richtigkeitsfrage relegiert wird. Dass die Frage nach der Wahrheit für das politische Handeln als unwichtig, ja, schädlich erachtet wird. Ganz zu schweigen davon, dass diese Forderung an der Wirklichkeit vorbeigeht, hätte sie praktische und theoretische Konsequenzen. Praktische Konsequenzen, da ein wahrheitsliebender Mensch nur noch mit einem um existenzielle Teile reduzierten Selbstbild sich in die Politik einmischen dürfte. Theoretische Konsequenzen, da einer Anzahl von intellektuellen Anstrengungen im Grenzgebiet von Theologie, politischer Philosophie und politischer Theorie die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit abgesprochen werden würde. Im Folgenden interessiert mich vor allem die praktische Seite des Verhältnisses von Wahrheit und politischem Handeln. Diese behandele ich freilich auf theoretische, besser, ideengeschichtliche Weise. Mir ist es ein Anliegen, dass dem anfangs geschilderten Ansinnen entgegen gesteuert wird. Nicht, weil es nicht opportun wäre, über die Trennung von Wahrheitsglauben und konkretem politischen Tun nachzudenken. In ihrer institutionellen Auskleidung eine mögliche ist jene von Kirche und Staat ist solch eine Trennung in vielen Staaten Wirklichkeit, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Jenseits der institutionellen Sphäre liegen die Dinge aber gänzlich anders. Und zwar: Wahrheit und die Beschäftigung mit ihr sind aus dem politischen Handeln von Menschen nicht wegzudenken. Wahrheitsliebende Menschen taugen als Politiker, in gleicher Weise wie pragmatische Menschen. Sie sind alles andere als das Einfalltor ungewünschter Fundamentalismen. Sie sind aber auch nicht vordringlich das Gewissen der Nation. Dies hieße, Wahrheit mit Moral bzw. Ethik gleichzusetzen. Wahrheitsliebende Politiker wissen vielmehr um das, was jenseits des menschlich Machbaren liegt. Sie ahnen etwas von dem, was unserem Streben nach kollektiver Selbstorganisation mit allen notwendigen Vorbehalten in Richtung der Transzendenz übersteigt. Sie halten das politische Spiel der Mächte für ein wichtiges, aber letztlich eben nur vorläufiges Geschehen. Der eigentliche Ort der Macht ist in ihren Augen nicht im Bereich des menschlichen Handelns zu finden. Diese Überzeugung hält der wahrheitsliebende Politiker (den es selbstverständlich auch in weiblicher Form gibt) für so bedeutsam, dass er sie nicht aus seinem politischen Alltag heraushalten möchte. Wahrheitsfragen und religiöser Glaube überlappen an vielen Stellen miteinander, sind aber nicht identisch. Nicht jede Wahrheitsliebe speist sich aus explizit offengelegten religiösen Quellen. Und der religiöse Glaube garantiert noch lange keinen freien Blick auf die lichten Höhen der reinen Wahrheit, um eine herkömmliche metaphorische Sprache zu benutzen. Um im Folgenden dem Vorwurf aus dem Weg zu gehen, mir ginge es nur darum, der organisierten Religion den Weg in das öffentliche Leben und Nachdenken (zurück) zu bahnen, werden meine drei ideengeschichtlichen Stationen nicht aus einem Terrain stammen, dem man traditionelle Religiosität vorwerfen Der Autor: Dr. phil. Burkhard Conrad OPL, Laiendominikaner in der Ordensprovinz Teutonia, verheiratet und Vater von zwei Töchtern, ist Politikwissenschaftler und persönlicher Referent des Hamburger Erzbischofs Dr. Stefan Heße. Conrad schreibt einen ideengeschichtlichen Blog unter Der Beitrag erschien erstmals am 16. März 2015 auf der Website Philosophie indebate der Stiftung Forschungsinstitut für Philosophie Hannover (fiph) auf weitere Texte von ihm unter BurkhardConrad. Kontakt: rotsinn@gmx.de und über Twitter könnte. Anhand dieser Stationen möchte ich nicht einfach meinem Argument auf die Beine helfen. Dazu finden sich bei meinen Quellen zu viele Widerworte. Vielmehr ist es mein Anliegen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie über Wahrheit und politisches Handeln nachgedacht werden kann. Und wie auf dieser Grundlage eine eigene, durchdachte Stellungnahme aussehen kann. 106 unitas 2/2015
19 Max Weber, Simone Weil und Hannah Arendt sind meine Frage betreffend keine unbelasteten Kandidaten. Sie stellen auch keine überraschende Auswahl dar. Sie sind aber alles andere als Apologeten einer unreflektierten Frömmigkeit bzw. einer emphatischen politischen Theologie. Sie werden sämtlich auch in der theologischen Disziplin rezipiert, lassen sich aber nicht theologisch vereinnahmen. Weber, Weil und Arendt gehen ganz unterschiedliche Wege, um politisches Handeln und Wahrheitsliebe miteinander zu verbinden bzw. die Grenzen einer solchen Verbindung aufzuzeigen. Der eine Weber begründet eine pragmatische, zurückhaltende Position, wie sie auch heute von pragmatischen, zurückhaltenden Politikern vertreten wird. 2 Die zweite Weil treibt eine zugleich areligiöse und mystisch anmutende Wahrheitsliebe voran, die mitunter hart an die Grenze des Zumutbaren geht. Die dritte Arendt scheint zwischen den beiden Polen zu vermitteln, ohne dass dies ihr ausdrückliches Anliegen wäre. Max Weber Der wahrheitsliebende Politiker, wie er von Max Weber, Simone Weil und Hannah Arendt in unterschiedlichen Schattierungen beschrieben wird, ist ein Idealtypus. Dieser Idealtypus inspiriert viele Menschen in der Politik. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich neben den Sachfragen und den pragmatischen Richtigkeitsfragen auch Fragen nach der bleibenden Gültigkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Entscheidungen stellen. Diese Menschen sind sich darüber bewusst, dass ihr öffentliches Handeln mit einer erweiterten Verantwortung einhergeht und sie schuldig machen kann: vor den konkreten Menschen, aber auch vor der Grundverfassung unserer Wirklichkeit, die, folgt man der scholastischen Schuldefinition 3,mitder Wahrheit korrespondiert. Für den wahrheitsliebenden Politiker ist diese Wahrheit und damit komme ich einer Definition von Wahrheit so nahe, wie es mir eben möglich ist eine objektive Sinnwirklichkeit, die transzendent und handlungsanleitend, unanschaulich und wirkmächtig zugleich ist. Dass es eine solche für die alltägliche Politik relevante Grundverfassung bzw. Sinnwirklichkeit gibt, wird von den eingangs erwähnten Stimmen aus der Politikwissenschaft geleugnet. Selbst wenn man diesen Stimmen folgen würde, dann sollte das unbestreitbare Vorhandensein wahrheitsliebender Politiker einen doch wachsam dafür machen, dass politisches Handeln sich auch vor einem außeralltäglichen Horizont abspielt. Und zu diesem Horizont gilt es sich zu verhalten, wissenschaftlich-theoretisch und politisch-praktisch. Max Webers Sehnsucht nach der Wahrhaftigkeit Es ist nicht unüblich, Max Webers bekannte Unterscheidung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik 4 mit dem Hinweis zu zitieren, Weber schlüge sich mit dieser Unterscheidung eindeutig auf die Seite des Verantwortungsethikers und des Pragmatikers, wodurch Webers Position in dieser Angelegenheit ausreichend geklärt sei. Dass Weber eine Vorliebe für Verantwortung und eine Abneigung gegenüber der Gesinnung hat, ist zweifellos richtig. Doch erschöpft sich darin Webers Beitrag zu der Frage nach der Wahrheitsliebe von Politikern? Auf den ersten Blick lautet die Antwort auf die Frage: Ja, die Dinge liegen so einfach. Dem Gesinnungsethiker wirft Weber in seinem Vortrag Politik als Beruf nämlich vor, ohne Rücksicht auf die Folgen seiner Haltung und Handlung an seinen Prinzipien festzuhalten. Nach Folgen fragt eben die absolute Ethik nicht, schreibt Weber unmittelbar bevor er seine berühmte Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik einführt. Gesinnungs- ethiker achten nicht auf die Kontexte ihrer Handlung und auf die sich daraus entwickelnden Verkettungen von weiteren Umständen, Schicksalen und Situationen. Sie sind, um es in der hier gewählten Begrifflichkeit auszudrücken, vollkommen von der Wahrheit eingenommen. Diese Wahrheit legt ihr Handeln fest. Zu Kompromissen sind sie in vielen Fällen gar nicht und in anderen Fällen kaum geneigt. Sie haben die Neigung, alle erdenklichen technischen Detailfragen zu Fragen um das Ganze empor zu stilisieren. In jeder Einzelsache wittern sie einen unwiederbringlichen Dammbruch, nach dem der Unmoral, dem Mord und Totschlag, der Lüge Tür und Tor geöffnet sind. Überall fühlen sie sich der Wahrheit verpflichtet, ohne dass sie den Quellen dieser vermeintlichen Wahrheit nachgehen. 5 Gesinnungsethiker betrachten die Welt durch ein Schema des Entweder- Oder, durch das sich das Wahre von der Lüge eindeutig unterscheiden lässt, wie es auch Avishai Margalit mit Blick auf die Kompromissunfähigkeit eines manichäischen Weltbildes beobachtet: There is no twilight zone, no room for compromise: it is either-or. 6 Einem solchen Gesinnungsethiker spricht Weber die Fähigkeit zu einem verantwortungsvollen Handeln für die Menschen ab. Gerade weil er nach der Ethik des Evangeliums 7 handelt, ist er für den politischen Alltag und die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens ungeeignet. Doch das ist nicht alles, was Max Weber über den wahrheitsliebenden Politiker er nennt ihn natürlich nicht so zu sagen hat. Wer Politik als Beruf genau liest, der wird bemerken, dass Weber einen blanken innerweltlichen Pragmatismus weit hinter sich lässt. Manche würden sagen: Er kann einen Rest an metaphysischem Überschuss in seinem Denken nicht abschütteln. Denn, so Weber, auch der Verantwortungsethiker sucht durchaus den Sinn in seinen Handlungen. Er schreibt: Es ist durchaus wahr und eine jetzt hier nicht näher zu begründende Grundtatsache aller Geschichte, dass das schließliche Resultat politischen Handelns oft, nein: geradezu regelmäßig, in völlig unadäquatem, >> unitas 2/
20 oft in geradezu paradoxem Verhältnis zu seinem ursprünglichen Sinn steht. Aber deshalb darf dieser Sinn: der Dienst an einer Sache, doch nicht etwas fehlen, wenn anders das Handeln inneren Halt haben soll. 8 Also doch ein metaphysischer Einschuss? Es wäre verkehrt, in dieser Referenz an den Sinn einen unweigerlich transzendentalen Bezug in Webers Konzeption des verantwortungsvollen Politikers zu sehen. Dennoch macht Webers Insistieren auf sinnvollem politischem Handeln stutzig. Was hat es mit diesem Sinn auf sich? Dem Zitat folgend ist Sinn gleichzusetzen mit dem Dienst an der Sache. Diese Sache besteht nicht nur aus kurzfristigen politischen Zielen, sondern bezieht sich auf den umgreifenden Rahmen, in dem ein Politiker sein Handeln versteht. Immer muss irgendein Glaube da sein, schreibt Weber, wobei dieser Glaube nur in bestimmten Fällen religiöser Natur sein wird. Auch Ideen, ethische Leitbilder bzw. gesellschaftliche Ideale konstituieren bei Weber einen Glauben. Ein solcher Glaube muss aber immer mit im Spiel sein, denn sonst lastet in der Tat das ist völlig richtig der Fluch kreatürlicher Nichtigkeit auch auf den äußerlich stärksten politischen Erfolgen. 9 Politisch verant- Simone Weil wortliches Handeln ist somit auf einen sinnstiftenden Rahmen angewiesen, der die Politik vor einer nihilistischen (Selbst-)Vernichtung bewahrt, um es in einer etwas existenzialistischen Sprache zu formulieren. Wie der Wissenschaftler, so muss sich auch der Politiker Rechenschaft geben über den letzten Sinn seines eigenen Tuns, wie es Weber in Wissenschaft als Beruf formuliert. 10 Er trägt eine Verantwortung vor der Zukunft 11,von der er sich durch keinen partei- oder machtpolitischen Pragmatismus lösen kann. Folglich fühlt er sich eher einer inneren ( protestantischen ) Haltung verpflichtet als äußeren Forderungen. Diese innere Haltung könnte man im Unterschied zur transzendenten Wahrheit als innerweltliche Wahrhaftigkeit bezeichnen. Eine solche Wahrhaftigkeit muss der Politiker anstreben, um dem eigenen Leben und Handeln innere Ausgeglichenheit und Zielgerichtetheit zu verleihen. Freilich weiß er, dass er auch diese Wahrhaftigkeit immer wieder auf dem Altar der Real- und Machtpolitik wird opfern müssen. Dies tut er aber nicht bereitwillig und endlos. Vielmehr ist er sich seines Verrates an dem letztgültigen Sinn und an der ihm übertragenen Verantwortung bewusst. Er weiß, dass er schuldig wird und versucht es dementsprechend zu vermeiden. Durch Kompromisse. Durch lautstarken Protest. Und gelegentlich durch innere Immigration. In diesem Ansatz Webers wird ein unverhohlener Heroismus des Scheiterns offenbar. Denn wer auf solche Art Politik treibt, der muss in Webers Augen ein Held 12 sein. Er ist einer, der sich mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist, gewappnet hat. 13 Seine Wahrheitsliebe bzw. Wahrhaftigkeit besteht darin, dass er sich der eigenen Grenzen sehr wohl bewusst ist. Dies hält ihn aber nicht davor zurück, sich in das Mächte- und Ränkespiel des tagespolitischen Alltags zu werfen, um der Verantwortung vor der gesellschaftlichen Zukunft willen. Weber lehnt einen wahrheitsabsoluten Dogmatismus und Rigorismus in der Politik ab. Seiner Meinung nach schaden sie dem politischen Gemeinwesen mehr, als dass sie nützen. Wohl auch deshalb wird er von Politikern auch heutzutage wohlmeinend zur Kenntnis genommen. 14 Gleichzeitig sieht Weber in einer nur auf das Nächstliegende schielenden Real- und Interessenspolitik ebenfalls große Gefahren. Zwischen diesen beiden extremen Polen sieht er einen gangbaren Weg: In der Wahrhaftigkeit, der Verantwortung vor der Zukunft und dem Eingeständnis der eigenen Begrenztheit liegen für Max Weber die Merkmale des wahrheitsliebenden Politikers. Simone Weil und die Suche nach einer neuen Wahrheit Wahrheitsliebe und Politik sind für Simone Weil in einem weit größeren Maß als für Max Weber ein eng miteinander verbundenes Paar. Auch schreibt sie die Wahrheit nicht in Richtung der individuellen Wahrhaftigkeit um, wie es der Soziologe vor ihr tut, sondern besteht auf einem nicht verinnerlichten, sondern vielmehr unmittelbaren transzendenten Überschuss in der Politik. Die Texte, in denen sich Simone Weil diese Position zueigen macht, entstehen in der zweiten Hälfte der 1930er bzw. in der ersten Hälfte der 1940er Jahre. Die aufreibenden zeitgeschichtlichen Umstände werden mit dafür verantwortlich sein, dass Simone Weil ihr Anliegen inhaltlich so ausformuliert, wie sie es tut und hierzu oftmals auch auf einen rhetorisch dichten bis dringlichen Ton zurückgreift. Um einem Ergebnis der Lektüre von Weils Texten vorweg zu greifen, kann man sagen, dass das Anliegen der Französin sich mit Begriffen wie Gerechtigkeit, Freiheit, Gehorsam, Reinheit, Schönheit und Wahrheit umschreiben lässt. Diese Begriffe bzw. metaphorisch-semantischen Felder greifen bei ihr ineinander, bilden fast schon eine Symbiose. Simone Weil vermisst in der realgeschichtlichen Situation, in der sie sich befindet, alles, was sie mit diesen Begriffen positiv verbin- 108 unitas 2/2015
21 corbis det; bezogen auf die europäischen Diktaturen in der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, aber auch bezogen auf das besetzte Frankreich. Einzig Großbritannien stellt für sie eine Ausnahme dar. Über dieses Land schreibt sie mit gewissem Pathos: England war für Europa etwas unendlich Wertvolles, das einzige Land, in dem die Freiheit wie eine Pflanze wuchs ( ). Die bloße Existenz eines solchen Landes hat die Welt wertvoller gemacht. 15 Welchen Anmarschweg geht Simone Weil, um zu ihrem starken bzw. emphatischen Wahrheitsgedanken zu gelangen? Ganz offensichtlich ist, dass sie von der Wirkkraft der kollektiven politischen Ideologien von links oder von rechts kommend und deren realpolitischen Ausgestaltung ernüchtert ist. Schon früh, 1934, schreibt sie: Der Mensch ist weder dazu geschaffen, das Spielzeug einer blinden Natur zu sein, noch dazu, das Spielzeug blinder Kollektive, die er mit Seinesgleichen bildet. 15 Dabei schließt Weil nicht aus, dass Menschen sich gemeinschaftlich bzw. genossenschaftlich zusammenschließen, um eine bestimmte gemeinsame Ordnung herzustellen. Jedoch darf es nicht so weit gehen, dass der kollektive Zusammenschluss eine Eigendynamik gewinnt, die letztlich der Natur des Menschen von deren positiver Existenz Simone Weil überzeugt ist zu widersprechen droht. Es geht folglich darum, innerhalb der bestehenden Zivilisation zwischen dem zu unterscheiden, was rechtens dem Menschen als Individuum gehört, und dem, was die Kollektivität gegen ihn zu stärken imstande ist. Jene Elemente müssen auf Kosten der letzteren entwickelt werden. 17 Als Ideal schwebt Simone Weil ein in freier Freundschaft verbundenes politisches Gemeinwesen vor. Darin werden keine kollektiven Interessen vertreten, sondern höchstens persönliche oder familiäre Anliegen. Sie schreibt von ihrer Idealvorstellung im Konjunktiv: Tatsächlich befänden die Menschen sich in kollektiven Bindungen, aber ausschließlich in ihrer Eigenschaft als Menschen, nie würden die einen die anderen als Dinge behandeln. 18 Dem ideologischen Massenwahn ihrer Zeit begegnet sie mit einer um jede kollektiven Interessen beraubten Politikkonzeption. Darin erkennt sie die letzte Chance, im Angesicht der desaströsen zeitgenössischen Politik und deren ideologischen Überbaus ein Mindestmaß an gesellschaftlichem Zusammenleben und Tugend zu retten. Dieses Denken führt Simone Weil letztlich aber zu einem ganz und gar unpolitischen Begriff des Politischen. Denn Weil verachtet alle Tendenzen, die aus der Politik einen kollektiven Interessenswettbewerb machen. Ihre Verachtung macht sie unter anderem an den in den Weltkrieg führenden Antagonismen der Nationen und deren nationale Interessen fest, wie sie 1937 schreibt. 19 Die Fiktion kollektiver Interessen sie schreibt, dass es gemeinsame Interessen gar nicht gäbe 20 macht für sie den Wahn aus, welcher das Individuum tyrannisiert und das Kollektiv zu einer Unterdrückungsmaschine werden lässt. Das ist letztlich der Gehalt ihres kurzen Pamphletes Anmerkungen zur generellen Abschaffung der politischen Parteien aus dem Jahre In der Schrift schreibt Weil gegen die kollektiven Leidenschaften an, die sich in den totalitären Einheitsparteien der Nationalsozialisten bzw. Kommunisten (in der Sowjetunion) zusammenrotteten. 22 In ihren Augen sind diese Einheitsparteien nicht nur das Resultat eines schon bestehenden verbrecherischen Regimes. Sie verweist auch auf die Möglichkeit des umgekehrten Falles: Somit ist der Totalitarismus die Erbsünde der Parteien auf dem europäischen Kontinent. 23 Ihr Urteil ist vernichtend und aus der damaligen Situation heraus mehr als nachzuvollziehen: Parteien sind im Keim und Streben totalitär ; sie betreiben Götzendienst ; sie streben nach totaler Macht und dienen damit der Lüge, die mit dem Totalitarismus ein Bündnis eingegangen ist. 24 Und bezogen auf den Begriff der Wahrheit kommt Weil zu dem Schluss: Die Parteien sind Organismen, die öffentlich, offiziell so konstituiert sind, dass sie in den Seelen den Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit abtöten. 25 Wahrheit und die real existierende (Partei-)Politik stehen sich also diametral gegenüber, ein Urteil, das aus der historischen Situation heraus gedeutet nicht in Zweifel gezogen werden kann. Doch mit welcher Wahrheitsvorstellung vollführt Weil ihren kritischen Handstreich gegen das politische Handeln zu ihrer Zeit? Wahrheit und Gerechtigkeit bei Weil oft in einem Atemzug genannt sind Kriterium des Guten. 26 Das Gute ist wahr und gerecht bzw. Wahrheit und Gerechtigkeit sind gut, noch vor dem Gemeinwohl. Emphatisch ergänzt sie: Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine Gerechtigkeit. 27 Im Weiteren schreckt Simone Weil nicht davor zurück, Sätze zu formulieren, die selbst wieder unter Ideologieverdacht gestellt werden müssen, sollten sie, wie es Weils Intention ist, ohne Wenn und Aber auf die Ebene des politische Handelns angewandt werden: Erkennt man an, dass es eine Wahrheit gibt, darf man nur denken, was wahr ist. 28 Solche markanten Sätze erwecken den Eindruck, als ob die Weilsche Wahrheit vor totalitären Zügen nicht gefeit ist. Wenn Weil eine ausschließliche Treue zum inneren Licht einfordert, dann sucht man als ihr Leser nach einem Kriterium, das vermeintliche vom >> unitas 2/
22 authentischen Licht, den immanenten Wahrheitsanspruch von der transzendenten Wahrheitswirklichkeit zu unterscheiden. Weils Wahrheitsbegriff ist unbestimmt. Sie schreibt: Doch wie der Wahrheit begehren, ohne etwas von ihr zu wissen? Darin liegt das Mysterium der Mysterien. 29 Die Metaphorik vom Mysterium bzw. vom Geheimnis leiht sie sich von der christlichen Glaubenslehre, in der an zentralen Stellen vom mysterium fidei, vom Geheimnis des Glaubens die Rede ist. Auch sonst tauchen die christlich-theologischen Begrifflichkeiten in Weils Schriften an verschiedenen Stellen auf, vor allem dort, wo sie von ihrem politischen Ideal der Schwäche als Gegenbild zur zeitgenössischen Vergötzung der Macht schreibt. 30 Dieses Ideal sieht sie in der Person Jesu Christi verwirklicht. Christus ist für sie die Vollkommenheit, Reinheit, Schönheit in Person 31,wobei Weil sich mit diesem Gedanken weniger als Beinahe-Christin entpuppt, als vielmehr als Verehrerin antiker Ideale, die selektiv weitere ideengeschichtlichen Splitter aufsammelt und in ihre Politikvorstellung einfügt. Hanna Ahrendt Es bleibt unklar, welche Wahrheit es denn ist, die der Politiker nach Weil anstreben soll. Mit großen Begriffen wie Schönheit, Gerechtigkeit, Reinheit und Freiheit lässt sich kaum konkret politisch umgehen bzw. ein gesellschaftlicher Konsens zu einem konkreten Problem gefunden bzw. ein Entscheidungsprozess in Gang gesetzt werden. So ist Weils Ideal auch nicht der handelnde Politiker, sondern schon viel eher der kompromisslose Mystiker bzw. Heilige. Denn in ihnen ist die Wahrheit zum Leben geworden. 32 Weil kennt nur die eine Wahrheit, das eine Gute, das eine Gerechte. Den Gedanken einer Hierarchie der Wahrheiten, der einem nahelegt, dass Wahrheit in verschiedenen Stufen zu erringen und zu verwirklichen ist, sucht man bei ihr vergebens. Dieser Gedanke öffnet zwar den Weg zu einem positiv-konstruktiven Umgang mit der Frage der Wahrheit im konkreten politischen Handeln. Gleichzeitig impliziert er eben aber auch, dass Wahrheitsfragen nicht immer in der Konstellation Entweder-Oder daher kommen, sondern auch in der Konstellation Sowohl-als-auch. Hannah Arendt und die Wahrheit der vita activa Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Simone Weil in den 1930er und 1940er Jahren und schließlich Hannah Arendt in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren thematisieren auf je ihre Weise die Frage der Wahrhaftigkeit bzw. Wahrheit im politischen Handeln bzw. des politischen Handelns. Es wurde schon betont: Der Autor und die zwei Autorinnen können nur vor dem Hintergrund der Umstände verstanden werden, die real- und ideengeschichtlich ihrem Werk zugrunde liegen. Die ideologische Ernüchterung, die Simone Weil zu ihrem etwas fragwürdigen politisch-theologischen Mystizismus verleitete, führte bei der etwas später in den USA auftretenden Hannah Arendt zu einer ausgesprochen pluralismusfreundlichen politischen Philosophie. Auf die Frage Was ist Politik? gibt Arendt in dem gleichnamigen Manuskript die Antwort: Politik beruht auf der Tatsache der Pluralität der Menschen. 33 Eine Aussage, die vor dem Zweiten Weltkrieg noch für große Zweifel in den ideologisch verhärteten Lagern gesorgt hätte, wird nach 1945 von vielen (aber längst nicht von allen) im Westen geteilt. Die Anerkennung des gesellschaftlichen Pluralismus und damit auch die Zustimmung zu demokratischen und rechtsstaatlichen Verfahren der Entscheidungsfindung setzen sich mehr und mehr durch, freilich ohne jemals von allen politischen Gruppierungen und gesellschaftlichen Milieus gleichermaßen anerkannt zu werden. Auffallend ist an Arendt, dass die innere Verbundenheit zu Pluralismus und Demokratie nicht das Ende einer ausdrücklichen Wahrheitsliebe bedeuten muss. Dieser Vorwurf wird immer dann laut, wenn den demokratischen Verfahren der Mitbestimmung per se unterstellt wird, in ihnen käme ein ethisches, religiöses, moralisches oder auch philosophisches Gewissen nicht zum Zuge. Ganz im Gegenteil: In der Liebe zur Demokratie äußert sich auch die Liebe zur Wahrheit, insofern nämlich, dass Demokratie, also Mitbestimmung, zutiefst dem Wesen und der Wahrheit des Menschen entspricht. Auf die Fährte dieses weitreichenden Gedankens setzt einen die Lektüre der Texte von Hannah Arendt. Arendt nimmt die eben formulierte skeptische Anfrage auf, wenn Sie schreibt: Ist politisches Handeln wenigstens in unserer Zeit nicht gerade typisch für das Fehlen aller Prinzipien, so dass es, statt aus einem der vielen möglichen Ursprünge menschlichen Zusammenseins zu stammen und aus seiner Tiefe sich zu nähren, vielmehr opportunistisch an der Oberfläche von täglichem Geschehen haftet ( )? 34 Also auch Arendt ist der Zwiespalt zwischen den (gelegentlich nur vorgeschobenen) Zwängen des politischen Alltags und den politischen Idealen, der Wahrheit, bewusst. Dennoch gibt sie den Gedanken der Wahrheit im politischen Handeln nicht auf. Sie findet fast schon pathetische Worte, wenn sie von der Aufgabe der Politik im Allgemeinen spricht, interessanterweise im Konjunktiv: Es könnte sein, dass es die Aufgabe der Politik ist, eine Welt herzustellen, die für die Wahrheit so transparent ist wie die Schöpfung Gottes. 35 Wenige Zeilen später schreibt sie über diesen Gedanken: Dies ist wahrscheinlich Unsinn. Aber es wäre die einzig mögliche Demonstration und Rechtfertigung des Naturgesetz-Denkens unitas 2/2015
23 Arendt weist hier auf einen Gedanken hin, der bei Max Weber nicht vorkommt und auch von Simone Weil nicht explizit ausformuliert wird: Wer von Wahrheitsliebe in der Politik spricht, der meint mit der Wahrheit einen Standpunkt oder ein Beziehungsgeflecht, das dem menschlichen Handeln entzogen und damit unverfügbar ist. Bei Weber taucht der Gedanke nicht auf, da für ihn Wahrheitsliebe bzw. Gesinnungsethik einem Akt der Entpolitisierung gleichkommen. Sie weisen inmitten der menschlichen Handlungssphären Bereiche des Unverfügbaren und damit auch Unpolitischen aus. Arendt, um die Erfahrung von Nationalsozialismus und Stalinismus reicher, hat zwar eine hohe Meinung vom menschlichen Handeln, der vita activa, weiß aber auch darum, dass Menschen individuell und kollektiv zur Lüge fähig sind. Wer mit der Lüge rechnet, der hofft letztlich darauf, dass sich Wahrheit durchsetzt. Diese Wahrheit lässt sich religiös-theologisch oder auch naturrechtlich-philosophisch ableiten, wobei Arendt mit der von ihr in Ehren gehaltenen griechischen Antike eher zur zweitgenannten Ableitung neigt. Das Wissen um die Gefahr der Ideologisierung von Wahrheit ist Arendt aber eingeimpft. In der Schrift Wahrheit und Politik aus dem Jahr 1967 kommt sie zu der Auffassung, dass Wahrheit und Politik schon immer miteinander im Konflikt liegen. 37 Diesen Konflikt erläutert sie anhand von griechischen (Platon) und US-amerikanischen (Madison) Quellen und folgert: Die eigentlich politische Schärfe des Konflikts liegt in der Entwertung der Meinung, insofern nicht die Wahrheit, wohl aber die Meinung zu den unerlässlichen Voraussetzungen aller politischen Macht gehört. Und weiter: Das aber heißt, dass innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten jeder Anspruch auf absolute Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen unabhängig zu sein vorgibt, die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Legitimität aller Staatsformen legt. 38 Also auch Arendt ist von der entpolitisierenden Wirkung von absoluten Wahrheitsansprüchen überzeugt. Die beiden oben angeführten Ableitungsmuster von Wahrheit religiös-theologisch bzw. naturrechtlich-philosophisch bezeichnet die Philosophin als Vernunftswahrheiten. Arendt kennt aber noch einen zweiten Wahrheitsbegriff. Dabei handelt es sich um den Begriff der Tatsachenwahrheit. Sie ist der Auffassung, das der Konflikt zwischen Wahrheit und Politik heute (d. h. 1967) nicht mehr von dem Ringen um die Vernunftswahrheiten, sondern von dem Ringen um die Tatsachenwahrheiten bestimmt ist: Es hat vielleicht ( ) kaum je eine Zeit gegeben, die Tatsachenwahrheiten, welche den Vorteilen oder Ambitionen einer der unzähligen Interessensgruppen entgegenstehen, mit solchem Eifer und so großer Wirksamkeit bekämpft werden. 39 Hinzukommend stellt Arendt fest, dass je mehr man sich in der Vergangenheit gesellschaftlich von der Vorstellung einer Wahrheitsgewissheit verabschiedet hatte, desto stärker betonte man die Wahrhaftigkeit des Individuums 40,ein Urteil,das auf Max Weber und sein Theorem der Entzauberung der Welt unmittelbar zutrifft. Hannah Arendt scheint sich aber selbst nicht schlüssig darüber zu sein, was sie mit der Wahrheit in der Politik anfangen soll. Zum einen konstatiert sie, dass vom Standpunkt der Politik aus betrachtet die Wahrheit despotisch sei, da sie sich jeder Diskussion und jedem Austausch entziehe, diese aber gerade das Wesen der Politik ausmachten. 41 Liebe zur Wahrheit, so ist Arendt an dieser Stelle zu verstehen, verhindert politisches Denken und Handeln, die gerade dadurch gekennzeichnet seien, dass sie die Positionen und Handlungsoptionen der Anderen in die Ausformulierung der eigenen Positionen und Handlungsoptionen mit einbeziehen. Wer nichts will als die Wahrheit sagen, steht außerhalb des politischen Kampfes, und er verwirkt diese Position und die eigene Glaubwürdigkeit, sobald er versucht, diesen Standpunkt zu benutzen, um in die Politik selbst einzugreifen. 42 Den Schluss, den politische Philosophen heutzutage aus solch einem Urteil ziehen würden, ist eindeutig: Da die Frage nach der Wahrheit und der Transzendenz in der Politik nur diskursiven Schaden anrichten kann, ist die Relevanz dieser Frage für das politische Denken und Handeln zu leugnen. foto italia Diesen Schluss zieht Hannah Arendt aber wiederum nicht. Es ist klar, dass sie eine Determinierung der politischen Optionen durch eine transzendente Ordnung bzw. Wahrheit ablehnt. Gleichzeitig hasst sie aber nichts mehr als politische Regime, die auf der Lüge und auf der Verdunklung der Tatsachen basieren. Ihr Gegenbild hierzu ist aber eben nicht die Rückkehr zur reinen Wahrheit, sondern das Streben nach einer freiheitsliebenden Politik. Eine solche Politik, so Arendt, hat das Potenzial, inmitten des grauen Alltags für Wunder bzw. Offenbarungen eines außeralltäglichen Neuen zu sorgen. Wenn der Sinn von Politik Freiheit ist, so heißt dies, dass wir in diesem Raum ( ) in der Tat das Recht haben, Wunder zu erwarten. Nicht weil wir wundergläubig wären, sondern weil die Menschen, solange sie handeln können, das Unwahrscheinliche und Unerrechenbare zu leisten imstande sind und dauernd leisten, ob sie es wissen oder nicht. 43 Politisches Handeln die >> unitas 2/
24 vita activa sorgt für Wunder, für nicht vorhersehbare Zustände. Diese Wunder unterbrechen den natürlichen Ablauf und stiften Neues, das es der menschlichen Gemeinschaft ermöglicht, die Ketten der Unterdrückung abzuwerfen und die Freiheit zu erringen. Um dies zu erläutern, führt Arendt ein Beispiel an: Daß es in dieser Welt eine durchaus diesseitige Fähigkeit gibt, Wunder zu vollbringen, und daß diese wunderwirkende Fähigkeit nicht anderes ist als das Handeln, dies hat Jesus von Nazareth nicht nur gewußt, sondern ausgesprochen ( ). 44 Jesus Christus ( Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Joh 14, 6) als ein Vorbild der vita activa? Arendts Beispiel macht ihre Ambivalenz nur zu deutlich: Wahrheitsliebe hat das Potenzial, politische Kreativität zu unterdrücken. Wahrheitsliebe kann aber auch die Kraft verleihen, einen neuen Anfang zu initiieren, ein Wunder zu vollbringen, eine Schöpfung in Gang zu setzen. Der wahrheitsliebende Politiker Die Ausführungen von Max Weber, Simone Weil und Hannah Arendt allein reichen nicht aus, um den wahrheitsliebenden Politiker als eine eigene Spezies vollständig zu umreißen. Zu groß ist die Skepsis bei Weber und Arendt, zu groß die Gefahr der Ideologisierung, wie sie das Denken Weils offenbart. Doch die Schriften der Drei machen deutlich, dass die Frage nach der Wahrheitsliebe nicht achtlos zur Seite geschoben werden kann. Welchen Stellenwert hat die Frage nach der Wahrheit für das konkrete Handeln des politischen Personals? Und wie kann mit der Wahrheitsliebe verantwortungsvoll umgegangen werden verantwortungsvoll in Bezug auf den politischen Auftrag für das Ganze eines Volkes und verantwortungsvoll in Bezug auf die persönliche Integrität als Politiker und Mensch. Max Weber legt seinen Schwerpunkt auf den Aspekt der Verantwortung. Ein Politiker steht anders als ein Privatmann, ein Geistlicher oder ein Notar in einer besonderen Verantwortung für das Ganze einer Gesellschaft. Er ist beteiligt an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, die in einer pluralen Welt eine große Bandbreite an schlüssig begründeten Meinungen und Interessen hervorbringen. Zwei Extreme muss der Politiker dabei vermeiden: zum einen die Verabsolutierung der eigenen Meinung zu einer keine Kompromisse zulassenden Wahrheit und zum anderen eine unerbittliche Härte in der Durchsetzung der eigenen, kurzfristigen Partikularinteressen. Der Blick auf das weniger monolithisch, als vielmehr pluralistisch ausgestaltete Gemeinwohl ein Begriff, den Weber selbst nicht benutzt zwingt den Politiker zu Kompromissen. Die Verantwortung des politisch Handelnden weist über die Interessen eines Einzelnen oder einer bestimmten Gruppe hinaus. Verantwortung in der Politik führt zu einem Wissen oder eine Ahnung um das Mehr, das die Gesellschaft und die Welt als solches zusammenhält. Im Gegensatz zu Max Weber besteht Simone Weil auf einem expliziten transzendenten Überschuss im politischen Handeln. Dieser Überschuss legt einem, so Weils Hoffnung, bestimmte Handlungsoptionen nahe, die der Wahrheit entsprechen, kann bei Missbrauch aber auch zum Gegenteil dessen führen, was mit der Wahrheit intendiert war. Ein zentrales Kriterium für die Liebe zu dieser Wahrheit ist die Gerechtigkeit. Wer die Wahrheit tut, der handelt gerecht. Und wer nicht die Gerechtigkeit fördert, der liebt nicht die Wahrheit. Da Weil keinen spezifischen Wahrheitsbegriff definiert, muss sie letztlich auch offen lassen, was sie unter Gerechtigkeit versteht. Doch zwischen den Zeilen zeichnet sich in ihren Schriften ein Wesen der Gerechtigkeit schemenhaft ab. Gerechtigkeit ist nicht totalitär. Gerechtigkeit respektiert das Individuum und entlockt ihm seine besten Begabungen. Sie erfüllt sein privates und berufliches Leben. Gerechtigkeit macht nicht unbedingt reich, aber sie macht glücklich. Gerechtigkeit formt aus vielen Individuen und Familien eine Gesellschaft, in der jeder seiner eigenen Berufung im Ganzen der Menschengemeinschaft gehorsam sein kann, um so ein Abbild der Wahrheit zu formen. Hannah Arendt fügt ein weiteres Kriterium für die politische Wahrheitsliebe hinzu: die Freiheit. Unterdrückung und Tyrannei wurzeln in der Lüge, wie sie auch wieder zur Lüge hin führen. Wahrheit hingegen bringt freie Menschen und freie Gesellschaften hervor, was nicht von ungefähr an den Ausspruch Jesu Christi aus dem Neuen Testament erinnert: Die Wahrheit wird euch frei machen (Joh 8, 32). Was Arendts Freiheitsbegriff mit dem biblischen Freiheitsbegriff gemein hat, ist ihr Streben nach Weite. Es geht nicht um eine ökonomisch verengte Freiheit in der Auswahl zuvor festgelegter Alternativen obwohl jede normale politische Wahl nach diesem Modus abläuft. Freiheit ist deshalb auch mehr als die Teilnahme an einer regelmäßig stattfindenden freien Wahl. Arendts Freiheitsbegriff beinhaltet ein kreatives Moment. Freiheit ist dort, wo Neuschöpfungen und Wunder möglich sind, wo Bürgerinnen und Bürger als Gelegenheitspolitiker einen emergenten Sprung vollführen und so mitunter auch ganz spontan einen neuen Anfang stiften. Solche kontingente Freiheitsmomente offenbaren blitzlichtartig das Potenzial einer wahrheitsliebenden Politik, die von mutigen Frauen und Männern vorangetrieben wird. Es war mein Bestreben zu zeigen, dass die Frage nach dem wahrheitsliebenden Politiker nicht tot zu kriegen ist. Nicht nur, weil die Wahrheit in Gestalt eines verbogenen Funda- 112 unitas 2/2015
25 mentalismus durch die Tagespolitik geistert. Sondern vor allem und meine drei ideengeschichtlichen Stationen stehen dafür gerade weil Wahrheitsliebe die menschliche Sehnsucht nach einem Mehr als Pragmatik wachhält. Diese Sehnsucht nach dem objektiven Sinn kann den Bürgerinnen und Bürgern auch die Kraft und Unterscheidungsgabe verleihen, falschen Wahrheitsvorstellungen zu widerstehen und Wahrheiten zu suchen und lieben zu lernen, die von dem innerweltlichen Machtgefüge unabhängig sind. Diesen Punkt greift auch Rowan Williams auf, wenn er schreibt: To be concerned about truth is at least to recognize that there are things about humanity and the world that cannot be destroyed by oppression and injustice, which no power can dismantle. 45 Wer politisches Handeln nicht despotisch unterdrücken, technokratisch herabkühlen oder diskursiv verwässern möchte, der kommt um ein gehöriges Quäntchen Wahrheitsliebe unter den Politikern nicht herum. Die Bocca della Veritá der Mund der Wahrheit in der Vorhalle der römischen Kirche Santa Maria in Cosmedin Anmerkungen: 1 Beispielsweise Greven, Michael Th. 2000: Kontingenz und Dezision. Beiträge zur Analyse der politischen Gesellschaft, Opladen: Leske & Budrich, S. 61; Rorty, Richard 1999: Religion As Conversation-stopper, in ders.: Philosophy and Social Hope, London: Penguin, S ; Stein, Tine 2009: Die Bergpredigt als das ganz Andere der modernen Politik, in: Zeitschrift für Neues Testament, Jg. 12 Nr. 24, S Vgl. Schmidt, Helmut 2011: Religion in der Verantwortung. Gefährdungen des Friedens im Zeitalter der Globalisierung, Berlin: Propyläen, S. 23ff. 3 Es scheint aber, als sei Wahres ganz dasselbe wie Seiendes. So bei: Thomas v. Aquin 1986: Von der Wahrheit, Hamburg: Meiner, S Vgl. Weber, Max 1992: Politik als Beruf, Stuttgart: Reclam, S Ebd. 6 Margalit, Avishai 2010: On Compromise and Rotten Compromise, Princeton: PUP, S Weber, Max 1992: Politik als Beruf, Stuttgart: Reclam, S Ebd., S. 64f. 9 Beide Zitate ebd., S Weber, Max 1996: Wissenschaft als Beruf, 2. Auflage, Berlin: Duncker & Humblot, S Weber, Max 1992: Politik als Beruf, Stuttgart: Reclam, S Ebd., S Ebd. 14 Vgl. FN Weil, Simone 2011: Krieg und Gewalt. Essays und Aufzeichnungen, Zürich: Diaphanes, S. 81f. 16 in: Simone Weil 1975/1987: Unterdrückung und Freiheit. Politische Schriften, München: Rogner & Bernhard, S Ebd., S Ebd., S Weil, Simone 2011: Krieg und Gewalt. Essays und Aufzeichnungen, Zürich: Diaphanes, S. 41f. 20 Ebd., S Weil, Simone 2009: Anmerkungen zur generellen Abschaffung der politischen Parteien, Zürich: Diaphanes. 22 Ebd., S Ebd., S Ebd., S. 14ff. 25 Ebd., S Ebd., S Ebd., S Ebd., S Ebd., S Weil, Simone 2011: Die Verwurzelung. Vorspiel zu einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegenüber, Zürich: Diaphanes, S. 201f. 31 Ebd., S Ebd., S Arendt, Hannah 2007: Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlass, hrsg. von Ursula Ludz, 3. Auflage, München & Zürich: Piper, S Ebd., S Ebd., S Ebd. 37 Arendt, Hannah 2006: Wahrheit und Politik, Berlin: Wagenbach, S Ebd., S Ebd., S Arendt, Hannah 2006:Vita activa oder Vom tätigen Leben, München: Piper, 4. Auflage, S Vgl. Arendt, Hannah 2006: Wahrheit und Politik, Berlin: Wagenbach, S Ebd., S Arendt, Hannah 2007: Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlass, hrsg. von Ursula Ludz, 3. Auflage, München & Zürich: Piper, S Arendt, Hannah 2006:Vita activa oder Vom tätigen Leben, München: Piper, 4. Auflage, S Williams, Rowan 2012: Faith in the Public Square, London: Bloomsbury, S unitas 2/
26 Flüchtlinge sind willkommen VON DER HAUPTVERSAMMLUNG DES BDKJ AUF BURG ROTHENFELS ROTHENFELS / DÜSSELDORF. Flüchtlinge sind willkommen mit diesem klaren Statement ist am 19. April die viertägige Hauptversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) auf Burg Rothenfels zu Ende gegangen. Rund 100 Delegierte der 17 angeschlossenen katholischen Jugendverbände und -organisationen bestimmten auf der traditionsreichen Jugendburg das neue BDKJ-Leitungsteam: Pfarrer Dirk Bingener, seit 2007 Diözesanpräses des BDKJ Köln, ist zum Nachfolger von Pfarrer Simon Rapp gewählt worden. Rapp wurde nach sechsjähriger Amtszeit als Bundespräses verabschiedet und mit dem Goldenen Ehrenkreuz des DDKJ ausgezeichnet. Der neue Bundespräses Dirk Bingener, geboren am 27. Juni 1972 in Siegen, ist seit 2002 Mitglied der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG), studierte Theologie in Bonn und München und wurde im Jahr 2000 zum Priester geweiht. Anschließend war er Kaplan in Köln und Düsseldorf. Mit deutlicher Mehrheit wurde die Bundesvorsitzende Lisi Maier in ihrem Amt bestätigt. Sie vertritt für weitere drei Jahre die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Berliner Büro des BDKJ. Neu als ehrenamtliche Bundesvorsitzende gewählt wurde Katharina Norpoth, 23-jährige Studentin aus Essen, die bisher im Bundesleitungsteam der Kolpingjugend aktiv war. Zusammen mit dem Bundesvorsitzenden Wolfgang Ehrenlechner bilden die drei den Bundesvorstand. Offene Grenzen für Geflüchtete In ihrer Stellungnahme forderte die Hauptversammlung nachdrücklich, dass Migrantinnen und Migranten endlich ein sicherer, transparenter und fairer Zugang zum Asylsystem in der Europäischen Union gewährleistet wird und die Fluchtwege nach Europa geöffnet werden: Kein Mensch macht sich freiwillig auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer. Der BDKJ fordert die Politik daher auf, nachhaltig Der neue BDKJ-Vorstand: (v.l.) die Bundesvorsitzenden Lisi Meier und Wolfgang Ehrenlechner, Katharina Norpoth (ehrenamtlich) Bundespräses Dirk Bingener aus Köln Foto: BDKJ Bundesstelle/Christian Schnaubelt die vielfältigen Fluchtursachen wie Krieg, humanitäre Krisen und die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Gleichzeitig sprach sich der Dachverband für eine echte Willkommenskultur in Deutschland aus: Aus dem christlichen Menschenbild heraus setzen sich die Jugendverbände und -organisationen für eine solidarische und vielfältige Gesellschaft ein. Hierzu zählt sowohl das konkrete Engagement für Geflüchtete beispielsweise in Form von Unterstützung bei alltäglichen Behördengängen, aber auch das Aufstehen gegen Fremdenfeindlichkeit. Debatte über prekäre Arbeitsverhältnisse Mit Blick auf oftmals prekäre Arbeitsverhältnisse von jungen Menschen erklärten die Delegierten, Befristungen, Leih- und Teilzeitarbeitsverträge und Werkverträge setzten junge Menschen unter wachsenden Druck und behinderten eine freie Lebensgestaltung: Der Dachverband tritt für eine Arbeitswelt ein, in der junge Menschen frei von Angst ihre Entscheidungen wie die Gründung einer Familie treffen können und arbeitsrechtlich geschützt sind. Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche Jugendbischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann würdigte bei der Hauptversammlung die Arbeit der vielen Engagierten im BDKJ für Kirche und Gesellschaft. Es ist wunderbar, dass es sie alle gibt, so der Vorsitzende der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz und hob den Diskussionsbeitrag zur Theologie der Verbände heraus, den eine BDKJ- Arbeitsgruppe in den vergangen drei Jahren entwickelt hatte. Mit der Veröffentlichung eines Beitrags, der den Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche beleuchtet, lädt der BDKJ andere Verbände, Kirchenleitungen, Theologinnen und Theologen ein, das theologische Bild der Verbände aus ihrer jeweiligen Perspektive zu ergänzen und zu bereichern. Der BDKJ ist Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden und -organisationen mit rund Mitgliedern. Auch der Unitas-Verband (UV) und die Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände (AGV) sind vertreten. Mehr Infos unter unitas 2/2015
27 EUROPA BRAUCHT OFFENE GRENZEN STELLUNGNAHME DER BDKJ-HAUPTVERSAMMLUNG 2015 Woche für Woche sterben Menschen im Massengrab Mittelmeer. Im Jahr 2014 überquerten Geflüchtete das Mittelmeer kamen dabei ums Leben. Für das Jahr 2015 liegen bislang dokumentierte Fälle von Mittelmeerüberquerungen nach Italien und Griechenland, den beiden Hauptankunftsländern, vor. Allein in dieser Woche kamen in verschiedenen Unglücken mindestens Menschen vor der lybischen Küste ums Leben. Spätestens nach dem Tod von 366 Flüchtlingen vor Lampedusa im Oktober 2013 war die Bestürzung in der Politik groß und es hieß von allen Seiten, dass sich eine solche Tragödie nicht wiederholen dürfe. Die seit diesem Unglück getroffenen Handlungen der Politik waren sogar eher kontraproduktiv (z. B. fehlende Unterstützung für den italienischen Rettungsdienst Mare Nostrum ) und haben die Lage weiter verschärft. Die Nachfolgemission Triton schützt in erster Linie die europäischen Außengrenzen und nicht die Menschen in Lebensgefahr. Nicht zuletzt deswegen jetzt diese neuen Unglücke. Man hat aus den schrecklichen Ereignissen nichts gelernt. Auch Papst Franziskus bezeichnete den aktuellen Zustand als eine Schande. Jeder Mensch hat ein Grundrecht auf Asyl. Dieses kann er nutzen, wenn in seinem Herkunftsgebiet nicht mehr alle Grundrechte für ihn eingehalten werden. Aber ein Recht auf Asyl bedarf immer auch jemanden, die oder der dem Geflüchteten Asyl gewährt. Sonst ist das Recht auf Asyl letztendlich nichts wert. Wir müssen selbstkritisch hinterfragen, ob wir als fortschrittliches Europa das Recht auf Asyl derzeit wirklich gewähren. Grenzzäune rund um die Festung Europas zwingen Menschen erst in Lebensgefahr und Illegalität, bevor wir ihnen letztendlich das Recht auf Asyl gewähren. Wir fragen uns, wie viele Flüchtlingskatastrophen noch geschehen müssen, bis die Politik einlenkt. Daher bestärken wir aufgrund der aktuellen Ereignisse mit Nachdruck unseren Beschluss der HV Dort heißt es unter anderem bei Punkt 3. Für ein offenes Europa : Jedes Jahr machen sich tausende Menschen auf den Weg nach Europa. Meist nehmen sie ein enormes Risiko auf sich, beispielsweise die so genannten boatpeople. Ebenso ergeht es Menschen, die sich in ihrer Not zu Human Trafficking entscheiden und sich selbst Schlepperinnen und Schleppern überlassen, von denen sie sich dann durch ihre Arbeitskraft oder über Betteldienste über Jahre versuchen freizukaufen. [...] Deshalb fordern wir: [...] für Migrantinnen und Migranten einen sicheren, transparenten und fairen Zugang zum Asylsystem in der Europäischen Union zu gewährleisten, die Öffnung der Fluchtwege nach Europa sowie die Möglichkeiten von Humanitären Visa und Resettlement zu nutzen. Wir wollen den oben beschriebenen menschenverachtenden Missständen aus unserem christlichen Glauben heraus nicht folgen und fordern daher nachdrücklich die Politik auf zu handeln. Weitere Forderungen rund um das Thema Asyl und Flucht können in Bezug auf unsere Vision eines offenen Europas dem o.g. Europa-Beschluss von 2014 und in Bezug auf eine wirksame Innen- und Entwicklungspolitik dem auf der BDKJ-Hauptversammlung 2015 verabschiedeten Beschluss Willkommen! Geflüchteten jetzt Perspektiven öffnen entnommen werden. Papst Franziskus sagt: Wir müssen dem Problem mit der Logik der Gastfreundschaft begegnen! Gastfreundschaft fängt bei einer offenen Tür an. Also lasst uns die Grenzzäune abbauen und Notsuchenden endlich ernsthaft das Recht auf Asyl gewähren. Wer Schutz braucht, die oder der muss ihn bekommen. Also lasst uns groß denken und unsere Grenzen öffnen! unitas 2/
28 GEDANKEN ZUM VEREINSFEST ZU EHREN DES HL. BONIFATIUS Bonifatius und die Donareiche Was würde er heute fällen? VON BBR. DR. OLIVER WINTZEK Der Titel meiner Ausführungen spielt auf die sicherlich bekannte Begebenheit aus dem Leben des Hl. Bonifatius, des Apostels der Deutschen, an, wonach er im Jahre 723 in Hessen, wohl in der Nähe des heutigen Fritzlar, eine dem germanischen Gott Thor geweihte Eiche zu Fall brachte, um augenfällig zu demonstrieren, dass es mit der Macht dieser Gottheit nicht weit her sei: Arborem quandam mirae magnitudinis, quae prisco paganorum vocabulo appellatur robur Jovis [ ] succidere tentavit, so lesen wir in der Vita des Heiligen, wie sie um 760 Willibald, der Bischof von Mainz, verfasste. Thor, der nordische Donnergott möge mithin ebenso ausgespielt haben wie sein römisches Äquivalent Jupiter, dessen kapitolinisches Heiligtum genauso zertrümmert war, wie nun der hölzerne Kultort nach den Axthieben des Bonifatius. Nicht mehr Blitz und Donner sollten als Äußerungen des abgehalfterten Vaters im Himmel angesehen werden immerhin heißt Jupiter genau dieses, vielmehr möge gelten, dass der wahre Vater im Himmel am ersten Pfingsttag wahr gemacht hat, was Christus als Inbegriff seiner Gottesverkündigung im Munde führte: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. (Lk 12,49) Es ist freilich leicht, einen hölzernen Gedenkort zu fällen, ungleich schwieriger ist es, auch falsche Gedanken und Positionierungen zu holzen. So nimmt es nicht wunder, dass es gerade die resistenten Wucherungen heidnischer Vorstellungen waren, denen Bonifatius zum Opfer fiel: Er starb am 5. Juni 754 seinerseits unter den Hieben der Friesen eine Szene, die bis heute sein Grab im Hohen Dom zu Fulda schmückt. Wenn Bonifatius heute aus der Warte des uns bekannten himmlischen Vaters auf sein einstiges Missionsgebiet blickte, würde ihn wohl Bonifatius lässt die Donareiche fällen, um symbolisch die Überlegenheit des Christentums über die alten Götter und heidnischen Kulte zu demonstrieren. Aus dem Holz der Eiche ließ er ein dem hl. Petrus geweihtes Oratorium bauen. Fresko (1731) von Alois Dirnberger das schiere Grausen packen und er nicht nur einen zu fällenden Baum erblicken, sondern einen ganzen Wald wild wachsender Wucherungen. Ich spreche natürlich nicht von haptischen Bäumen, sonst bekäme man gewiss Ärger mit dem Naturschutz, vielmehr spreche ich von einer grassierenden Verkennung dessen, was die Sache mit dem Gott und Vater Jesu Christi bedeuten könnte und den daraus resultierenden eigentümlich ideologischen Ersatzbetätigungsfeldern. Ich spreche von Auswüchsen religiöser Infantilität und Ignoranz, die hier zugrunde liegt, mithin von einer schaudererregenden Sprachlosigkeit in religionibus und einer damit eigentümlich kontrastierenden Omnikompetenz eines jeden, was diese Dinge angeht. Ich spreche auch von einer gewissermaßen wedelnden Hilflosigkeit breiter Schichten der offiziell-offiziösen Verkündigungskaste der Kirche, von der man bisweilen nur hoffen darf, dass sie das, was sie feilbietet, nicht selbst glauben möge. Diese drei Spezies möchte ich benennen, die auf der kirchlich umhegten Scholle zu Fall gebracht werden müssten: inhaltliche Ignoranz, ideologische Ersatzbetätigungsfelder, Hilflosigkeit in der Verkündigung hier die Axt anzusetzen, würde dem Hl. Bonifatius alle Ehre machen und wäre wahrlich wohltuend. Christliche Gottesintuition muss in der Verkündigung deutlicher erkennbar und lebenstauglich sein Ich beginne mit dem Letzten, der Hilflosigkeit in der Verkündigung, mit der die Kirche allzu oft daherkommt und die sie klein und armselig erscheinen lässt. Zunächst machen wir uns nichts vor: Breite Kreise der gegenwärtigen Zeitgenossen erwarten von der Kirche schon längst nichts mehr! 116 unitas 2/2015
29 Szenen aus dem Leben des Hl. Bonifatius: Heidentaufe (oben) und Märtyrertod (unten) aus: Fuldaer Sakramentar, Bamberg, Staatliche Bibl., Ms. Lit. 1, saec. Xex, fol. 126v Anlass dazu sind beileibe nicht nur Protzbadewannen und verbrecherische Triebtäter, nicht nur die anachronistische Verfasstheit eines Altmännerbundes und eine empfundene Blockwartmentalität kirchlicher Verbotslitaneien, nicht nur die Hypotheken einer Kriminalgeschichte des Christentums und die augenzwinkernd unterstellte Doppelmoral der Eunuchen für das Himmelreich. Nein, schwerwiegender so man ernstlich nach sättigender Kost in der Verkündigung verlangt, intellektuell redlich und existenziell relevant, wird man auf breiter Front enttäuscht: Wenn wahr ist um mit Hans Joas zu sprechen, dass der Gottesglaube längst zu einer Option unter vielen geworden ist, muss die christliche Gottesintuition in der Verkündigung um so deutlicher erkennbar und lebenstauglich sein. An beidem mangelt es aber allzu oft. In der Regel wird einem das Christentum als die bessere Lebenstherapie angedient, wonach Gott als Quintessenz einer wohligen Geborgenheitsspiritualität für den Konsumenten fungiert. Verloren gegangen ist damit die Einsicht, dass Gott in biblischer Optik zunächst und grundlegend verzehrendes Feuer ist, drei Mal heilig. Die Definitionshoheit, was diese Heiligkeit meint, ist freilich landauf landab an den Mainstream einer auftankbegierigen Erwartungshaltung delegiert, wenn etwa versucht wird, die sonst eher verwaisten kirchlichen Bildungshäuser durch die in steter Regelmäßigkeit angebotenen Quellenwochen zu füllen. Der längst vollzogene Massenexodus aus der Kirche lässt die bestallten Religionsdiener panisch zurück. Händeringend versucht man mit allen möglichen und unmöglichen niederschwelligen Angeboten die Bude hin und wieder voll zu bekommen. Wenn es schon nicht mit einer anspruchsvollen Erschließung der Erlösungsbotschaft des Kreuzestodes Jesu Christi geht, versucht man es lieber mit einem Arche-Noah-Gottesdienst nebst Segnung von Sittich und Mops, wahlweise auch mit einem Lichtertanz der Kindergartenkinder. Statt sich auch im Kreise der wie man es politisch korrekt sagt Hauptamtlichen zu vergewissern, welche Relevanz die zweitausendjährige theologische Arbeit am Gottesbegriff haben könnte, statt zu erwägen, wie man sich durch diese belehrt das eigentliche Skandalon existenziell aneignen könnte, dass Jesus Christus nicht irgendeine vorbildliche Lebensbewältigungsstrategie feilbot, sondern in seiner Person Gott zu mir bringt und auch ansichtig macht, wer dieser Gott ist, ergeht man sich lieber in nicht enden wollenden Strukturdebatten. Frei von jeglicher Glaubensfreude und -zuversicht arbeitet man stetig jammernd an der eigenen Nachlassverwaltung, denn dass mit dieser wirklich ein Aufbruch zu neuer Gläubigkeit einherginge, glaubt trotz mantrahafter Beschwörung niemand so wirklich. Inhaltliche Unterbeschäftigung und strukturelle Überbeschäftigung gehen in ihrer Hilflosigkeit Hand in Hand und da wundert man sich, dass dies niemand hinter dem Ofen hervorlockt?! Der christliche Glaube hat seine Sprache verloren Ein weiterer Axthieb müsste auf die allenthalben anzutreffende Ignoranz niedergehen, was wirklich Inhalt und die damit einhergehende wirkliche Haltung des christlichen Gottesglaubens ist. Die gerne bei kirchlichen Trauungen gewünschten Texte aus dem Kleinen Prinzen oder von Hildegard Knef statt biblischer Lesungen machen deutlich, dass die Heilige Schrift wohl noch als pietätvoll entstaubtes Familienerbstück von Oma >> unitas 2/
30 ihren Platz in der Schrankwand Eicherustikal haben mag, doch dass sie längst nicht mehr gelesen, geschweige denn verstanden und als unser Buch in- und auswendig bekannt wäre. Auch hier bedeuten die Grenzen der Sprache die Grenzen der Welt, in der man sich verortet und sein Leben davon ausgehend sichtet: Der christliche Glaube hat seine Sprache verloren; zwar werden allerorten zu Floskeln mumifizierte Begrifflichkeiten mitgeschleppt oder gar als Zeichen verbaler Rechtgläubigkeit lautstark perpetuiert, doch dem Gros der Zeitgenossen außerhalb und weitaus schlimmer auch innerhalb der christlichen Semantiken ist der Gehalt dieser Fremdwörter längst abhanden gekommen. Wie anders ist zu erklären, dass ein Großteil nicht weiß, was etwa Inhalt des Pfingstfestes ist, von dem mit dem Heiligen Geist Gemeinten ganz zu schweigen, oder dass sich laut Umfragen keinerlei Bedenken melden, die christliche Auferstehungshoffnung mit Reinkarnationsvorstellungen zu korrelieren. Wie bei Pennälern wäre ein neuerliches Vokabel lernen zu fordern, aber wie sollte man sich für eine vermeintlich tote Sprache interessieren, wenn sie von vornherein als uninteressant eingeschätzt wird, da doch die niederschwellige sit venia verbo Einstiegsdroge mit Sittich und Mops nur ein müdes Kribbeln bewirkt und es auch immer mehr an sprachfähiger und im intellektuellen Diskurs satisfaktionsfähiger Potenz seitens der Kirche mangelt ein Teufelskreis sich inhaltlich zurück kreuzender Belanglosigkeit. Gottes Heiligkeit ist Vergebung Um dieser irgendwie irgendetwas entgegen zu setzen, und dies ist nun der dritte Baum, der wohltuend zu Fall gebracht werden müsste, versucht die Kirche auf breiter Front ihre vermeintliche Unentbehrlichkeit darzutun, indem sie sich auf ideologischen Ersatzbetätigungsfeldern tummelt: Man nimmt dann gern Dostojewskis Diktum, wonach, wenn Gott nicht existiere, alles erlaubt sei, für bare Münze und zeichnet das Horrorszenario einer von der Diktatur des Relativismus entstellten Welt, in der die Menschen in schrankenloser Willkür jeglicher moralischer Sensibilität entsagen. Wie gut, dass es hier die Kirche gibt, die eherne Grundsätze und Werte bereithält zur Rettung des Gemeinwesens, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde seinerzeit suggerierte, oder momentan sehr beliebt zur Rettung der Familie. Unversehens kommt die Kirche hier einmal mehr als biederer Spaßbremser daher, deren beherzigenswerten Einsichten in die personale Würde des Menschen und seine moralisch qualifizierte Verantwortlichkeit in dem Maße ungehört verhallen müssen, als den Menschen prinzipiell unterstellt wird, sie dürften nicht eigenständig urteilen und ihr Leben verantworten. Es ist doch wohl Gedanken zum Vereinsfest zu Ehren des Hl. Bonifatius ein Mythos, dass der Mensch heute weniger moralisch sensibel wäre, nur weil er sich nicht am Gängelband führen lassen will, nur weil er die Vorstellung unveränderlicher gar vom Himmel gesandter Maßstäbe als problematisch erkennt, da er sich auf nichts verbindlich verpflichtet, was er nicht selbst als verbindlich eingesehen hat. Zudem steht es der Kirche nicht gut an, sich gewissermaßen eine Blindenbinde anlegen zu lassen, weil sie nicht sehen will, dass sich das Gefüge dessen, was als unbedingt verbindlich anzusehen ist, je neu justiert und anerkannt sein will. Vergessen ist bei der Reduktion des Christentums zu einer Bundesagentur für Werte nicht nur, dass Jesus Christus keinen himmlischen Code civile verkündete, sondern vor allem, dass es ihm und damit der Kirche um das unverdiente Geschenk der Vergebung geht. Verkannt wird immer noch, dass mithin nicht der Weg von Gott zum Gebot, sondern vielmehr der Weg vom eingesehenen Gebot zu jenem Gott führt, der im wahrsten Sinne des Wortes Gnade vor Recht ergehen lässt: Dies wäre die treffende Fassung von Gottes Heiligkeit seine Staunen und Erschauern machende Güte, die nicht nur paternalistisch barmherzig, sondern in Wahrheit göttlich warmherzig ist! Dies wäre das seiner Heiligkeit entsprechende Feuer, nämlich das Feuer göttlicher Liebe, die Jesus Christus gebracht hat. Wenn die bildhaften Axthiebe an den drei angeführten Wucherungen der Hilflosigkeit, der Ignoranz und der Ersatzbetätigung ausgeführt sind, könnte vielleicht jenes Feuer hier ganze Arbeit leisten, sie in Asche verwandeln und eine phönixgleiche Renaissance des christlichen Gottesglaubens ermöglichen. Ohne ein solches bonifatiusgleiches Holzen dürfte es indes nicht gehen hier wäre in der Tat ein Feld, an dem sich unsere unitarischen Prinzipien realisieren sollten: Die virtus gegen die anbiedernde und angstbesetzte Hilflosigkeit, die scientia gegen die zur Sprachlosigkeit und Irrelevanz führende Unkenntnis, und die amicitia gegen die Ersatzbetätigung des moralischen Reduktionismus eines Gottes, der uns laut den Worten Jesu Christi nicht als unfreie Befehlsempfänger, sondern als sich zu ihm bekennende und sich von ihm bestimmen lassen wollende Freunde bezeichnet Freunde des uns wohlbekannten Gottes, dessen Heiligkeit Vergebung ist. (Überarbeitete Fassung des Vortrags beim Festkommers der Unitas Freiburg zu Ehren des Hl. Bonifatius am 27. Juni 2014.) 118 unitas 2/2015
31 Die Studienbelastung durch die Reformen des Bologna-Prozesses EINE UNTERSUCHUNG DER MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF DAS UNITARISCHE VEREINSLEBEN VON BBR. PROF. DR. HUBERT BRAUN Die im Rahmen des Bologna-Prozesses eingeführten berufsbefähigenden meist sechs- bis siebensemestrigen Bachelorstudiengänge und dreibis viersemestrigen Masterstudiengänge und die damit verbundenen Kreditpoint- und Modulsysteme sowie die empfohlene Wahrnehmung eines Studienaufenthalts im Ausland haben das Studium organisatorisch und inhaltlich so verändert, dass von studentischer Seite vielfach über eine zu hohe Studienbelastung durch zu viele Referate, Hausarbeiten und Klausuren geklagt wird, wodurch die Teilnahme am Vereinsleben und die Wahrnehmung von Chargen beeinträchtigt werden könnte. Der Hochschulpolitische Beirat des UV hat bereits 2006, 2007 und 2008 bei den Aktiventagen Erhebungen angestellt, mit dem Ziel zu klären, ob das Vereinsleben durch die Reformen beeinträchtigt würde. Ein Ergebnis der damaligen Untersuchungen war, dass tatsächlich mit der Einführung der sechs- und dreisemstrigen Studiengängen eine zunehmende Beeinträchtigung der Teilnahme am Vereinsleben gesehen wurde. Gefragt wurde nach dem Maß der Beeinträchtigung: nicht, wenig, sehr. Das Ergebnis: Von 2006 bis 2008 nahm die von den an der Fragebogenaktion Teilnehmenden empfundene Beeinträchtigung und Belastung von 29 Prozent auf 57 Prozent zu... (Vgl. Unitas 2/2009, S.139). Nachdem die Studienreform jetzt im Wesentlichen realisiert ist, fand beim Aktiventag am in Aachen zur Kontrolle eine entsprechende Erhebung mit den gleichen Fragestellungen statt, um zu klären, wie die weitere Entwicklung verlaufen ist. Bei einem Rücklauf von 71 verwertbaren Fragebogen ist das Ergebnis das sich zu rd. 54 Prozent (39 Fragebogen) auf den Bachelor und zu je rd. 23 Prozent (je 16 Fragebogen) auf den Master und die übrigen Studiengänge verteilt beim Bachelor belastbar, bei den übrigen Studiengängen nur eingeschränkt aussagekräftig. Für alle Studiengänge ist zusammenfassend festzustellen, dass rd. 40 Prozent auf die Frage, ob das Studium die Teilnahme am Vereinsleben behindere, mit Ja antworteten. Dieser Prozentsatz über alle Studiengänge liegt beachtliche 20 Prozent unter dem Ergebnis von Etwas (wenig) Behinderung konstatierten knapp 30 Prozent und starke (sehr) Behinderung zehn Prozent. Die Belastung (wenig oder sehr) beträgt bei den Bachelor-Studiengängen nur 33 Prozent. Bei den in der Regel dreisemestrigen Master-Studiengängen beträgt die Belastung (wenig oder sehr) 56 Prozent und bei den übrigen Studiengängen (Diplom u. a.) 60 Prozent. Als zusammenfassendes Ergebnis kann man festhalten, dass jedenfalls bei den Bachelor-Studiengängen die Belastung nicht mehr so gravierend ist wie oft angenommen, während beim Master und den übrigen Studiengängen sie doch als erheblich empfunden wird. Die Erhebung erbrachte drei weitere interessante Ergebnisse: 1. Bei einer Bandbreite von Studierenden vom ersten bis zum 16. Semester liegt die durchschnittliche Studienzeit bei der unitarischen Studierenden, die am Aktiventag teilnahmen, bei ca. sieben Semestern. 2. Die 71 verwertbaren Fragebogen erbrachten, dass diese 71 Studierenden 37 unterschiedliche Studiengänge studieren, davon acht Theologie, sechs Medizin, sechs Maschinenbau und vier Agrarwissenschaften. Alle anderen Fächer liegen zahlenmäßig darunter, wobei es recht neuartige Studiengänge gibt. 3. Zu der Frage Lösungsideen, Vorschläge, Maßnehmen gab es von 20 Teilnehmern, vor allem von solchen die über die Belastung wenig oder sehr klagten, ein breites Spektrum von weniger ernsthaften (mehr Bier trinken) und sehr interessanten Antworten. Eine Mehrzahl verwies darauf, dass es nur eine Frage der Organisation sei, den Anforderungen des Studiums Rechnung zu tragen. Das war schon 2006/2008 ein wesentliches Ergebnis. Einige verwiesen darauf, dass das Studium vorgehe und auch, dass die Bundesgeschwister mehr Verständnis für die z.t. schwierigen Studienbedingungen haben sollten. Bedenkenswert sind auch folgende Hinweise: Verkürzung der Fuxenzeit auf ein Semester, die Wahrnehmung einer Charge auf ein Semester beschränken, vereinsinterne Regelungen, die die jeweilige Studiensituation fachrichtungsbezogen berücksichtigen. Abschließend ist festzuhalten: Die Bologna-Studienreform ist in wesentlichen Teilen umgesetzt, die Studierenden halten sich kürzer am Studienort auf, da die Regelstudienzeiten verkürzt worden sind. Viele Studierende versuchen diese einzuhalten. Dazu kommen Auslandsaufenthalte, die die Zeit vor Ort verkürzen. Die Studieninhalte haben sich verändert, da die Abschlüsse berufsbefähigend sein sollen. Knapp 30 Prozent studieren nur sechs bis sieben Semester und gehen mit dem Bachelor ab, das kurze drei- bis viersemestrige Masterstudium verlangt besonderes Engagement. Damit sind die Freiräume für eine sehr aktive Teilnahme am Vereinsleben u.u z. B. mit dem Verlust eines Semesters erheblich eingeschränkt und ebenso die Bereitschaft, ein weniger gutes Zeugnis zu riskieren, da die Zulassung zum Masterstudium in der Regel nur mit einem guten Bachelor-Abschluss möglich ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Verhältnisse je nach Hochschulart und Studiengang sehr unterschiedlich sein können, die Untersuchung ergab hierzu mittelbar Hinweise. Es empfiehlt sich, dass die Aktivitates, je nach den örtlichen und universitären Gegebenheiten, Regelungen finden, die diesen neuen Randbedingungen, vor allem den verkürzten Studienzeiten, flexibel Rechnung tragen. unitas 2/
32 Wie wird die Unitas in 10 oder 20 Jahren aussehen? Ergebnisse der Feedback-Umfrage BBR. DR. DR. THOMAS LOHMANN, VORSITZENDER DES ALTHERRENBUNDS 1. Ausgangspunkt In den letzten Jahren haben ältere Bundesbrüder zunehmend weniger an Verbands-, Altherrenvereins- und Zirkelveranstaltungen teilgenommen. Auf der anderen Seite sind jüngere Bundesschwestern und Bundesbrüder nur vereinzelt oder selten zu den einzelnen Veranstaltungen gekommen. Das Ziel der von Dezember 2014 bis Februar 2015 stattgefundenen Umfrage bei den Alten Herren und Hohen Damen war, verlässliche Zahlen darüber zu bekommen, wie häufig an Unitas-Veranstaltungen teilgenommen wird, an Unitas-Veran- welche Gründe es gab, nicht staltungen teilzunehmen, und was als Änderungen zu den bisherigen Veranstaltungen gewünscht wird. Der Internet-Beauftragte des Verbands, Bundesbruder Ingo Gabriel, hatte dazu auf der Unitas-Homepage die Möglichkeit installiert, die Umfrage online zu beantworten, was die anschließende Auswertung deutlich vereinfachte. Dafür ganz herzlichen Dank! 2. Rücklaufquote Insgesamt haben sich 509 Bundesschwestern und Bundesbrüder an der Umfrage beteiligt (siehe Grafik 1, aufgeschlüsselt nach Alter). Bezogen auf die Gesamtzahl von 5014 Unitariern ergibt sich damit eine Rücklaufquote von zehn Prozent (siehe Grafik 2). Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern! Um Antworten auf die Frage Wie wird die Unitas in zehn oder 20 Jahren aussehen? zu bekommen, werden im Folgenden immer die Antworten der Teilnehmer bis 70 Jahren mit denen der Gesamtzahl aller Bundesschwestern und Bundesbrüder verglichen. Die Ergebnisse werden als Thesen formuliert, die als Diskussionsgrundlage auf den nächsten Generalversammlungen dienen sollen. 3. Teilnahme an Unitas-Veranstaltungen Die folgenden drei Grafiken geben die Teilnahme an Verbands-, Altherren- oder Hohe-Damen-Vereins- und Zirkelveranstaltungen wieder, aufgeschlüsselt nach Teilnahme pro Jahr, in fünf sowie in zehn Jahren. Grafik 1: Teilnahme aufgeschlüsselt nach Alter Grafik 3: Teilnahme an Verbandsveranstaltungen Grafik 2: Rücklaufquote Grafik 4: Teilnahme an Vereinsveranstaltungen 120 unitas 2/2015
33 den geplanten Themen und Tagungsorten der nächsten Altherrenvereins- und Hohe-Damen-Bundstagungen: Grafik 7, den Wünschen an AHB-/HDB-Tagungen: Grafik 8, und der Frage nach neuen Veranstaltungen: Grafik 9. Grafik 5: Teilnahme an Zirkelveranstaltungen Als Ergebnis erhält man: These 1: Falls keine Maßnahmen ergriffen werden, kann in Zukunft nur mit der Hälfte der Teilnehmer gerechnet werden, bei Vereinsveranstaltungen liegt der Wert etwas höher bei 57 Prozent, bei Zirkelveranstaltungen unter 40 Prozent. Grafik 7: Zukünftige AHB-/HDB-Tagungen Besonders auffällig ist, dass der Anteil der jüngeren Unitarier, die in den letzten zehn Jahren an keiner Zirkelveranstaltung teilgenommen haben, fast drei Viertel aller Nicht-Teilnehmer beträgt. Das bedeutet, dass vor allem jüngere Bundesschwestern und Bundesbrüder keinen Kontakt zum Zirkel haben, was auch in vielen Kommentaren älterer Bundesbrüder beklagt wurde. 4. Verbandsveranstaltungen Im Folgenden werden zunächst die Gründe für das Fernbleiben aufgeschlüsselt (siehe Grafik 6). Grafik 8: Wünsche an AHB-/HDB-Tagungen Grafik 6: Gründe für Fernbleiben von Verbandsveranstaltungen Grafik 9: Neue Veranstaltungen Während für alle Antwortenden die Entfernungen das größte Hindernis darstellten, waren es für die Jüngeren vor allem berufliche, gefolgt von familiären Verpflichtungen. Die Fragen nach Themen der Veranstaltungen, Kosten und Altersunterschied zwischen den Teilnehmern wurden deutlich weniger angekreuzt. Die nächsten Fragen galten: Bzgl. der Tagungsthemen und Tagungsorte in Grafik 7 ergab sich bis auf eine Ausnahme ein relativ gleichmäßiges Feedback: Ungefähr zwei Drittel der Antworten waren dafür und ungefähr ein Drittel war dagegen. Nur beim Thema Caritas waren gleich viele dafür wie dagegen. >> unitas 2/
34 Vergleicht man die jeweiligen Antworten zum Thema AHB-/HDB-Tagungen mit der Gesamtzahl der Teilnehmer, so stellt man fest, dass im Durchschnitt 61 Prozent aller Teilnehmer mit Ja oder Nein geantwortet haben, dass aber 86 Prozent der bis Siebzig-Jährigen Feedback gegeben haben. Bei den abgefragten Wünschen an AHB-/HDB-Tagungen in Grafik 8 kann man feststellen, dass deutlich weniger Teilnehmer als bei den anderen Fragekomplexen ihre Wünsche geäußert haben. Die Abfrage nach neuen Veranstaltungen in Grafik 9 zeigt einen klaren und eindeutigen Sieger. Fasst man die Ergebnisse aus Grafik 7, 8 und 9 zusammen, so ergibt sich These 2: AHB-/HDB-Tagungen haben hinsichtlich Tagungsthema und Tagungsort ein deutlich größeres Potenzial an Teilnehmern als in den letzten Jahren teilgenommen haben. Gewünscht werden aber mehr Familienorientierung, mehr Diskussionen über aktuelle Themen sowie mehr Informationsaustausch, mehr Besichtigungen, aber weniger Vorträge. Zusätzlich werden vor allem regionale Veranstaltungen gewünscht, gefolgt von Einkehrwochenende und Familienwochenende. Kosten werden deutlich weniger als Hindernis für die Teilnahme angesehen. Bzgl. regionaler Veranstaltungen ist geplant, anhand der Wohnorte, Zirkelorte oder falls vorhanden der Namen der Bundesschwestern und Bundesbrüder regionale Schwerpunkte zu identifizieren und mit den Altherren- oder Hohe- Damen-Vereinen dieser Regionen Kontakt aufzunehmen. 6. Zirkelveranstaltungen Hinsichtlich der Zirkel wurden die Gründe für das Fernbleiben (Grafik 11) sowie Wünsche an Zirkelveranstaltungen (Grafik 12) abgefragt. Grafik 11: Gründe für Fernbleiben von Zirkelveranstaltungen 5. Altherrenvereins- und Hohe-Damen- Vereinsveranstaltungen Aus Zeit- und Platzgründen kann an dieser Stelle nur ein Gesamtüberblick über alle Vereine gegeben werden. Dabei wurden jeweils die Antworten für A- und B-Philistervereine zusammengezählt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Altherren- und Hohe-Damenvereine wurde zudem auf detaillierte Fragen wie bei Verbands- und Zirkelveranstaltungen verzichtet. Damit bleibt außer Grafik 4 bzgl. der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen nur Grafik 10 bzgl. der Gründe für das Fernbleiben. Die Antworten bzgl. des Fernbleibens von Zirkelveranstaltungen sind nahezu gleich zu den entsprechenden Antworten zu Verbands- oder Altherren- bzw. Hohe-Damen- Vereinsveranstaltungen bis auf eine wesentliche Ausnahme: Der Altersunterschied zu den übrigen Teilnehmern wird von einem Drittel der antwortenden unter Siebzig-Jährigen als Grund angegeben. Grafik 12: Wünsche an Zirkelveranstaltungen Grafik 10: Gründe für Fernbleiben von Vereinsveranstaltungen Die Gründe für das Fernbleiben von Vereinsveranstaltungen sind im Vergleich zu den Antworten bzgl. des Fernbleibens von Verbandsveranstaltungen nahezu gleich bis auf zwei Ausnahmen: Entfernungen und vor allem Als häufigster Wunsch an Zirkelveranstaltungen wurde mehr Diskussionen zu aktuellen Themen genannt, gefolgt von mehr Familienveranstaltungen und mehr Besichtigungen. Dies ist ähnlich zu den Antworten bzgl. der Verbandsveranstaltungen. Allerdings wurde auch nach eigenen Zirkelveranstaltungen für jüngere im Beruf stehende Bundesbrüder/Bundesschwestern gefragt. Diese Frage beantworteten ein Drittel der an der Umfrage teilnehmenden unter Siebzig-Jährigen mit Ja. 122 unitas 2/2015
35 These 3: Zirkelveranstaltungen können in Zukunft nur mit 40 Prozent der Teilnehmer rechnen. Damit ist absehbar, dass viele Zirkel aussterben werden. Wesentliche Gründe sind berufliche und familiäre Verpflichtungen, aber auch der Altersunterschied zu den übrigen Teilnehmern. Ein Drittel der an der Umfrage teilnehmenden unter Siebzigjährigen befürworten eigene Zirkel für jüngere im Beruf stehende Bundesbrüder/Bundesschwestern. 7. Einladung Die hier formulierten Thesen dienen als Diskussionsgrundlage auf der nächsten Generalversammlung. Darum sei an die Termine der Altherrenbunds- und Hohe- Damenbundstagung am Samstag, 6. Juni 2015 im Congress Centrum Würzburg (CCW), Pleichertorstraße 5, Würzburg, erinnert: die AHB-Tagung beginnt um 9:00 Uhr, die HDB-Tagung um 10:30 Uhr. HOCHSCHULNACHRICHTEN Steigende Zahl ausländischer Studierender BONN. Deutsche Hochschulen werden immer internationaler. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, ist die Zahl der ausländischen Studienanfänger im Studienjahr 2014 um 4,5 Prozent auf gestiegen. Die Zahlen belegen, was ich jeden Tag in meiner Arbeit erfahre: Bildung aus Deutschland hat weltweit einen hervorragenden Ruf, und unsere Hochschulen besitzen eine starke Anziehungskraft für Studierende aus der ganzen Welt, erklärte Prof. Margret Wintermantel, Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), am 4. März: Der DAAD ist dafür verantwortlich, dass die talentiertesten Menschen der Welt unser Wissenschafts- und Forschungssystem kennenlernen. Die steigende Attraktivität von Deutschland als Hochschulstandort bestätigt unsere erfolgreiche Arbeit. Bis 2020 will der DAAD die Zahl der ausländischen Studierenden in Deutschland auf steigern. Dieses Ziel steht auch in der Internationalisierungsstrategie der Wissenschaftsminister von Bund und Ländern sowie im Koalitionsvertrag. Insgesamt sind derzeit mehr als ausländische Studierende in Deutschland eingeschrieben. Erasmus-Mobilität erreicht neuen Höchststand BONN/BERLIN. Rund Studierende und Hochschulangehörige aus Deutschland haben im letzten Hochschuljahr 2013/2014 eine Erasmus-Förderung erhalten. Das geht aus am 24. März veröffentlichten Angaben der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) hervor. Er nimmt seit 1987 in Deutschland diese Aufgabe für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wahr, das die Nationale Agentur im DAAD zusammen mit der EU-Kommission finanziert. Mit rund ging ein Großteil der Erasmus-Zuschüsse an Studierende eine Zunahme von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kamen fast deutsche Hochschulangehörige, die mit einem Erasmus-Stipendium an einer ausländischen Hochschule unterrichten oder an einer Weiterbildungsmaßnahme im Ausland teilnehmen rund acht Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Zuwachs, den Bundesbildungsministerin Johanna Wanka begrüßte: Erasmus steht für den Traum von grenzüberschreitender Begegnung und gemeinsamem Lernen europaweit. Dass in Deutschland Jahr für Jahr mehr Studierende eine Zeitlang im Ausland lernen und leben wollen, zeigt mir: Unsere junge Generation lebt diesen Traum bereits. Sie ist neugierig, wissensdurstig und weltgewandt. Für mich noch immer das beste Mittel, um anti-europäischen Tendenzen vorzubeugen und das Verständnis in Europa füreinander zu stärken. Durch Austausch wachse Europa weiter zusammen und der Zusammenhalt zwischen den Nationen werde gestärkt, betonte DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel: Erasmus ist dafür ein hervorragendes Instrument. Internationale Erfahrungen eröffnen der jungen Generation neue Perspektiven und bessere Karrieremöglichkeiten auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Die Internationalisierung der Hochschulen sei darum ein zentrales Anliegen der deutschen wie auch der europäischen Bildungspolitik. Erasmus+ ist nicht nur das weltweit bekannteste Mobilitätsprogramm, sondern auch eine gute Möglichkeit für die über 350 deutschen und über europäischen Hochschulen, ihr Profil internationaler auszurichten. Die aktivsten Hochschulen im Erasmus-Programm in Deutschland waren im Hochschuljahr 2013/2014 die Technische Universität München (1.071 Geförderte), die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (955) und die Ludwig- Maximilians-Universität München (912). Die beliebtesten Gastländer der deutschen Erasmus-Studierenden für ein Auslandsstudium waren im vergangenen Jahr Spanien (5.339 Geförderte), Frankreich (4.877) und Großbritannien (3.140). Im Durchschnitt verbringen Studierende 5,5 Monate im Ausland, bei Praktikanten sind es 4,4 Monate und bei Hochschulpersonal etwa sieben Tage. Mit dem Programm Europa macht Schule wirbt das BMBF zusätzlich für Erasmus, indem es ausländischen Erasmus-Studierenden ermöglicht, ihr Heimatland an deutschen Schulen vorzustellen. Seit der Programmgründung 2006 haben so rund europäische Gaststudierende ihre Heimat in einer deutschen Klasse präsentiert und mehr als Schülerinnen und Schüler aus allen Schulformen für Erasmus begeistert. Seit 1987 wurden mit Erasmus rund 3,3 Millionen Studierende europaweit gefördert, darunter über deutsche Studierende. Die aktuelle Programmgeneration Erasmus+ ( ) wird mit einem deutlich gesteigerten europäischen Budget nicht nur die Lernmobilität im Hochschulbereich sondern auch im Schul-, Berufs- und Erwachsenenbildungsbereich fördern und Jugendbegegnungen und Freiwilligendienste unterstützen. unitas 2/
36 Mythus und Antimythus: Der Widerspruch gegen Gewaltmenschen und ihre Ideologen Am 31. Dezember 2015 ist ab Mitternacht eines der übelsten Machwerke nicht nur des vergangenen Jahrhunderts wieder frei verkäuflich: Die Urheberrechte von Hitlers Mein Kampf laufen nach 70 Jahren aus. Jeder kann die Hetzschrift nachdrucken und in Umlauf bringen. Das 1924 während Hitlers Gefängnishaft in Landsberg geschriebene Kultbuch der NSDAP, von Propagandaminister Goebbels als Evangelium der neuen Zeit gefeiert, erreichte bis 1945 eine Gesamtauflage von 12,5 Mio. Exemplaren und wurde in 16 Sprachen übersetzt. Die Bayerische Landesregierung, bislang Inhaber der Urheberrechte, gab eine kommentierte Neufassung in Auftrag, gefolgt von nicht wenig kritischen Debatten. Sie zog den Auftrag wieder zurück, nicht aber den Zuschuss von einer halben Million Euro für das nach wie vor mit der Arbeit befasste Institut für Zeitgeschichte (IfZ). Es will die Arbeit 2016 vorlegen und rechnet mit einem Umfang von Seiten bei knapp Anmerkungen die Normalausgabe von Mein Kampf hat 780 Seiten. Unter dem Titel Hitlers Mein Kampf eine kritische Edition soll das Projekt Gegenaufklärung zu Hitlers Propaganda leisten. Ein Mythus des 20. Jahrhunderts Handsignierte Prachtausgaben des Originals erzielten bei Auktionen in den USA in den letzten Jahren Dollar. Und die Diskussionen um Neuveröffentlichungen werden erst noch richtig Fahrt aufnehmen. Denn die Druckwalzen laufen längst, um mit dabei zu sein, wenn es damit und mit weiterem rechtsextrem-esotherischem Geschreibsel viel zu verdienen gibt. Darum ist heute auch erneut der Blick ebenso auf ein anderes Buch zu werfen, das neben der Führer -Schrift als das einflussreichste für das Entstehen des Nationalsozialismus angesehen wird. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit lautet der Titel des politischreligiösen Glaubensbuches von NSDAP-Chefideologe Alfred Rosenberg. Der 1892 unter dem Namen Alfred Woldemarowitsch Rosenberg in Reval (heute Tallin) geborene Deutsch-Balte, ab 1910 aktiv beim Corps Rubonia in Riga, hatte sich an Schopenhauer, Nietzsche und Houston Steward Chamberlain und völkischen Buchprodukten der Zeit begeistert, studierte Bauwesen und schwelgte in Wagner-Opern, war 1917 Zeuge der Revolution in Russland und legte 1918 seine Diplomarbeit über die Architektur eines Krematoriums ab. Er wandelte sich zu einen fanatischen Rassisten und Judenhasser, arbeitete als Zeichenlehrer und legte erste antisemitische Essays vor. Bis 1923 russischer Staatsbürger, sprach er zunächst nur schlecht Deutsch, fand jedoch Gönner in München und entwickelte in Vorträgen und weiteren Schriften seine Theorie einer jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung. Ab 1921 war er Mitglied der NS-Parteizeitung Völkischer Beobachter, ab 1923 deren Chefredakteur und ab 1937 Herausgeber. Er nahm am sogenannten Marsch auf die Feldherrnhalle teil und wurde 1927 von Hitler mit der Gründung eines nationalsozialistischen Kulturverbandes beauftragt erschien sein germanophiles Mythus-Buch, in dem er eine neue Metaphysik der Rasse und eine nordischen Rassenseele entwarf, eine Religion des Blutes, einen Willen ohne Moral, eine eigene Kunsttheorie und eine krude Interpretation eines neuheidnischen nordisch-atlantischen Menschentypus gegen Juda und Rom propagierte. Am setzte der Vatikan das Buch, das bis 1944 eine Auflage von knapp 1,4 Millionen Exemplaren erreichte, auf den Index. Rassentheoretische Umerziehung 1933 wurde Rosenberg zum Leiter des Außenpolitischen Amtes der NSDAP (APA) und zum Reichsleiter ernannt, 1934 zum Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP, in der Literatur als Amt Rosenberg bezeichnet. Sein Einsatzstab begann 1939 die Plünderung jüdischer Archive und Bibliotheken für das Institut zur Erforschung der Judenfrage. Durch Führerbefehl ermächtigt, wurden große Mengen Raubgut an Kunstschätzen aus den besetzten Gebieten mit Eisenbahnwaggons nach Deutschland abtransportiert darunter das Bernsteinzimmer. Ab 1941 übernahm Rosenberg als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete im Baltikum, in Weißrussland und der Ukraine die Leitung der zentralen Verwaltung für die besetzten Ostgebiete in den Reichskommissariaten Ostland und Ukraine. In dieser Funktion war er mitverantwortlich für die Einrichtung von Ghettos und systematische Judenermordung. Als Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg 1945 wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, blieb er zwar bis zuletzt von seiner Rassentheorie überzeugt, schob alle Verantwortung aber auf andere, insbesondere auf die bereits toten Hitler und Himmler wurde er zum Tod durch den Strang verurteilt. Auch wenn sein Gewicht für den NS-Führerstaat in der Forschung schwankend blieb: Einigkeit besteht in seiner maßgeblichen antisemitischen Rassenhetze und Propaganda, die er aus seinen seit 1919 entwickelten und schließlich weit verbreiteten Verschwörungstheorien entwickelte. Eitle Zukunftsvisionen Wie selbstgefällig er sich selbst einschätzte, zeigen seine vom United States Holocaust Memorial Museum Ende 2013 online gestellten Tagebuchaufzeichnungen, 400 lose Blätter aus den Jahren , veröffentlicht als Alfred Rosenberg Diary. Die ab 1936 beginnenden handschriftlichen Notizen sind eine abstruse Mixtur von Betrachtungen zur Außenpolitik, zum Wesen der Kunst und vom banalen internen Machtkampf diverser Parteigrößen unverstellt getragen von eitler Selbstüberschätzung. So vermerkt ein Eintrag vom 19. August 1936 (S.31): Es ist tatsächlich ein sonderbares Gefühl, seine Geisteskinder vorgelegt 124 unitas 2/2015
37 zu erhalten. Ob ich in Baden oder im Rheinland auf Fahrt zu Mittag esse: schon kommt der Besitzer bittet mich um Unterschrift in ein Buch von mir. In Danzig hat mich jemand gesehen, läuft nach Hause, holt den,mythus, treibt mich nochmals auf und bittet um Unterschrift. Der Autoaufseher von Kolberg erzählt, er habe das Buch drei Mal durchgeackert... in allen Buchläden Deutschlands stehen meine Werke neben dem Werk des Führers. Und schliesslich. In Nürnberg wächst die größte Kongresshalle der Welt. In allen kommenden Jahren und Jahrhunderten soll dort das Bekenntnis zum ewigen Deutschland abgelegt werden. Und in den Grundstein dieses Riesenhauses sind für alle Zeiten zwei Werke eingemauert:,mein Kampf und der,mythus. Das können auch jene Neidhammel nicht aus der Welt schaffen, die von meinen Gedanken zehren, aber zu klein sind, das eingestehen zu wollen. Kurz darauf spottet er am 21. August 1936 im gleichen Duktus über das jesuitische Rom, von den Faulhabers und Konsorten, die aufgeblasen wie die Truthähne ihre Unfehlbarkeiten verzapfen, über Ober-Medizinmänner in Rom Ein Mensch in Rom? Fort mit ihm! Vor 80 Jahren: Zentrale Figur des Widerspruchs Erst kurz zuvor war der verhinderte Religionsstifter, den Hitler für einen viel zu komplizierten Intellektuellen hielt, als Zusammenreimer wilder Mythenanalogien ertappt und vor der ganzen wissenschaftlichen Welt der Lächerlichkeit preisgegeben worden. Obwohl seit Jahren die Konzentrationslager eingerichtet waren und seit 1933 sogar ein Priesterblock im KZ Dachau existierte, in dem bis Kriegsende katholische Geistliche aus vielen Ländern bevorzugt für pseudowissenschaftliche Versuche missbraucht wurden. Dass man seinem Mythos -Buch widersprechen musste, war vielen klar. Doch dass es geschah, wirft einen neuen Blick auf eine zentrale Figur dieses Widerspruchs: Vor 80 Jahren erschien in katholischen Zeitungen eine Beilage, die viele staunen ließ: Sie zerpflückte die Blut- und Rassentheorien des unantastbaren NS-Chefideologen nach Strich und Faden. Verbunden bleibt diese Opposition gegen das Regime mit dem Namen eines Bundesbruders, dessen Todestag sich im Dezember 2015 zum 50. Mal jähren wird: Wilhelm Neuß, Professor an der Bonner Universität, schaltete sich 1934 als Herausgeber der Studien zum Mythos des XX. Jahrhunderts" aktiv in die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ein widmete ihm der Unitas-Verband zu seinem 100. Geburtstag einen Festakt. Im vollbesetzten Festsaal des Collegium Albertinum würdigte damals Bbr. Prof. Dr. Gabriel Adrianyi, der Nachfolger von Bbr. Neuß, auf dem Bonner Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, das Lebenswerk des Wissenschaftlers und Menschen als Widerstandskämpfer im 3. Reich. Im Folgenden dokumentieren wir sein Lebensbild des Forschers, Gelehrten und Kirchenmannes, der diesen Mut zum Widerspruch hatte. Bbr. Wilhelm Neuß: Der Patriarch der Universität Bonn VON BBR. PROF. EM. GABRIEL ADRIANYI Der Patriarch der Universität Bonn wie Wilhelm Joseph Maria Neuß aufgrund seiner 52-jährigen Zugehörigkeit zum Bonner Dozentenkollegium von Rektor Hugo Moser genannt wurde, wurde am 20. Juli 1880 in Montabauer/Westerwald als Sohn des Gymnasiallehrers Joseph Neuß und seiner Frau Antonia Glandorff geboren. Beide stammten aus Westfalen. Bald wurde der Vater Direktor des Realgymnasiums in Aachen und so wuchs Wilhelm Neuß in dieser geschichtsträchtigen und kunsthistorisch reichen Kaiserstadt auf. Er besuchte zuerst das Gymnasium seines Vaters, dann das Städtische Kaiser-Karl-Gymnasium, wo er am 1. März 1899 das Reifezeugnis erhielt. Nun entschloss er sich, mit dem Ziel, Priester zu werden, zum Studium der Theologie und Kunstgeschichte. Zu letzterem Fach hatte er eine spezielle Neigung. Er ging nach Münster und belegte dort ab Sommersemester 1899 drei Semester. Dann fuhr er für das Wintersemester 1900/01 nach München. Es folgten zwei Semester in Bonn (SS 1901 und WS 1902/03). An der Bonner Fakultät beeindruckte ihn am meisten die stärkste, meist geachtete, aber gefürchtete Persönlichkeit Heinrich Schrörs, der später sein Mentor und Doktorvater wurde. Das Sommersemester 1902 verbrachte Neuß als Gasthörer in Freiburg. Dieses kurze Sommersemester wurde für ihn insofern von Bedeutung, als er hier Verbindung zu dem Kunsthistoriker Karl Künstle aufnahm und von ihm nachhaltige Impulse erhielt. Zum Wintersemester 1902 trat Neuß ins Priesterseminar zu Köln ein. 1 Acht Monate später, am 24. August 1903, wurde er im Kölner Dom zum Priester geweiht und am 25. September desselben Jahres erhielt er seine erste Kaplanstelle. Diese war in der kleinen, jedoch feinen Pfarrei St. Alban, sie galt seit Priestergenerationen als eine Art Studienstelle. Die erzbischöfliche Behörde erwartete von den Vikaren an St. Alban die Promotion. Statt Weiterstudiums widmete sich Neuß jedoch ganz und gar der Seelsorge. So versetzte ihn die enttäuschte Behörde am 21. Bbr. Wilhelm Neuß ( ) Er trat im SS 1899 der Unitas Münster bei, wurde später aktiv bei Unitas Freiburg (F), Unitas München (Mc) und Unitas-Salia in Bonn (B). Im SS 1912 war er Mitbegründer der Unitas-Carolingia in Bonn (B3), bei deren Publikation er am 24. Juni 1912 die Festrede hielt, die im April 1919 u. a. von ihm als Unitas Rhenania (B3) wiederbegründet wurde. Vom SS 1912 bis WS 1929/30 und vom SS 1948 bis WS 1959/60 war er Ehrensenior der Unitas Rhenania und Ehrenvorsitzender des AHV. >> unitas 2/
38 August 1905 als Rektor und Religionslehrer an das Lyzeum der Ursulininnen zu Köln, wo er bis 1911 blieb. Am 22. Februar 1908 legte er das Staatsexamen für katholische Religionslehrer ab, 1911 erwarb er sich zusätzlich die Fakultas für Mathematik und wechselte als Religions- und Oberlehrer an das Städtische Mädchengymnasium über. 2 Dass Neuß nicht Gymnasiallehrer blieb, war das Werk von Prof. Schrörs. Dieser erfuhr nämlich, dass Neuß sich seit vielen Jahren mit dem Fresken- Zyklus der Doppelkirche zu Schwarzrheindorf bei Bonn beschäftigte. Das Problem dieser Malerei war theologisch wie kunsthistorisch absolut rätselhaft. Schrörs drängte Neuß zur Erstellung einer Dissertation über dieses Thema. Die Lösung dieser ikonografisch und theologisch schweren Aufgabe gelang Neuß hervorragend; der Schwarzrheindorfer Zyklus erhielt eine endgültige und unantastbare Interpretation. Die Bonner Fakultät honorierte die Leistung am 23. November 1911 mit der Promotion summa cum laude. 3 Damit waren für seinen künftigen Lebensweg die Weichen gestellt. Schon am 9. Juni 1913 legte er der Bonner Fakultät seine Habilitationsschrift, die ebenfalls von Schrörs betreut wurde, vor: Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends. Er kam zu der damals unglaublichen Erkenntnis, dass die frühspanische Ikonografie von der älteren syrisch-ägyptischen und der jüngeren koptischen Kunst abhing. Am 29. Oktober 1913 bestand Neuß seine Probevorlesung und erhielt die venia legendi für das Fach Kirchengeschichte und christliche Archäologie. Am 5. November desselben Jahres nahm Neuß seine Lehrtätigkeit in Bonn auf. Sie sollte ganze 35 Jahre dauern. Am 16. September 1917 wurde er vom Berliner Ministerium für Geistliche- und Unterrichtsangelegenheiten zum außerordentlichen Professor ernannt und verpflichtet, Vorlesungen und Übungen außer in Kunst- und Kirchengeschichte auch aus dem Bereich der Archäologie, der Altertumswissenschaft und der kölnischen Kirchengeschichte zu halten. Somit wurde ihm noch ein weiteres, später liebgewonnenes Forschungsfeld zugewiesen: Die Kirchengeschichte des rheinisch-kölnischen Landes. Nach der Emeritierung von Professor Albert Ehrhard ernannte ihn der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung der Preußischen Staatsregierung am 26. Juli 1920 zum ordentlichen Professor für das Fach Kirchengeschichte, christliche Archäologie und Kunstgeschichte. Seine Berufung war also eine Hausberufung. Als 1927 das Fach Kirchengeschichte auf alte und mittlere-neuere Kirchengeschichte aufgeteilt wurde, bekam Neuß den Lehrauftrag, neben Geschichte der christlichen Kunst, Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit vorzutragen. Dies tat er bis zu seiner Emeritierung am 1. April 1949 mit großem Erfolg. Wilhelm Neuß veröffentlichte bis 1959 insgesamt 248 wissenschaftliche Werke und Beiträge. In seiner wissenschaftlichen Forschung setzte er deutlich zwei Schwerpunkte. Der eine galt seinem Lieblingsthema, der christlichen Kunst, besonders der Erforschung der frühspanischen christlichen Kunst, der andere der Geschichte des rheinischen Raumes, vor allem der Stadt Köln. Auf beiden Gebieten leistete Neuß Bahnbrechendes und Bleibendes, das international anerkannt wurde. Seine kirchenhistorischen Bücher und Beiträge zeichneten sich außer durch wissenschaftliche Präzision, durch eine konfessionelle Verständigung, einen Ökumenismus aus. Bbr. Prof. Wilhelm Neuß nahm von dem Mythus des 20. Jahrhunderts erst drei Jahre nach der Veröffentlichung im Zuge des Aufstieges der Partei Kenntnis. Er berichtete selber darüber: Niemand wird es mir verargen, daß ich, mit meinen Facharbeiten beschäftigt und von Anfang an abgestoßen von dem Rowdytum, mit dem die Partei in die Öffentlichkeit getreten war, im Sommer 1933 den Mythus noch nicht gelesen hatte. Da setzten die weltanschaulichen Pflicht-Schulungskurse in den einzelnen Fachschaften auch an der Universität Bonn ein, und ihnen wurde das Buch Rosenbergs zugrunde gelegt. An die katholischen Theologen wagte man sich freilich mit der Verpflichtung zu solchen Kursen nicht heran. Aber von Kursteilnehmern des kunstgeschichtlichen Studiums wurde ich auf die neue Propaganda und ihren Leitfaden aufmerksam gemacht. Ich lieh mir ein Exemplar des Buches, das für die Kursteilnehmer bestimmt war, zunächst von Samstag bis Montag, um es zu überfliegen. Dabei wurde ich mir nicht nur über seinen wissenschaftlichen Unwert, sondern auch darüber klar, daß hier ein vom Hasse gegen das Christentum beseelter systematischer Versuch der Aufpeitschung des nationalen Sinnes durch gewissenloseste Fälschung und Verdrehung vorlag, ein Versuch aber, der durch seine Selbstsicherheit auf den zu eigener Beurteilung nicht fähigen Leser sehr schlimm wirken mußte. Mir war deshalb auch klar, daß es trotz der abschreckenden Unwissenschaftlichkeit des Buches eine Pflicht des katholischen Theologen, besonders des Kirchenhistorikers, war, hier nicht zu schweigen und auch die verantwortlichen Stellen der Kirchenleitung auf das Buch und seine Verwendung aufmerksam zu machen. Denn wie ich alsbald feststellte, an der Kölner Kurie hatte ebenso wenig jemand bis dahin Rosenbergs Mythus die Ehre erwiesen, ihn zu lesen, wie ich. Neuß, Wilhelm. Kampf gegen den Mythus des 20. Jahrhunderts. Ein Gedenkblatt an Clemens August Graf von Galen (Dokumente zur Zeitgeschichte. 4). Köln S. 9 Der sonst sehr irenische Professor Neuß entwickelte zur Zeit des Nationalsozialismus zum Staunen seiner Freunde und im Gegensatz zu seiner Haltung vor 1933 und nach 1945 einen geradezu kämpferischen Geist gegen die verderbliche Ideologie und die noch viel schlimmere Praxis der Nationalsozialisten. Seine anfänglichen Bedenken, später strikte Ablehnung, ja Bekämpfung des Nationalsozialismus, resultierte weniger aus politischen Überlegungen in den früheren Jahren stand er der Zentrumpartei nahe, sondern vielmehr aus der unchristlichen, unmenschlichen Rassenideologie der Partei. Schon 1933 sah er sich genötigt, gegen die unmenschliche 126 unitas 2/2015
39 Judenhetze der Partei zu seinen Freunden zählte er manche Juden, so auch den namhaften Bonner Mediävisten Wilhelm Levison 4 energisch aufzutreten. Am 1. Juni 1933 veröffentlichte er in der Bonner Reichszeitung unter dem Titel Gedanken eines katholischen Theologen zur Judenfrage einen Artikel, in dem er versuchte, das christliche Gewissen gegen die antijüdische Rassenhetze wachzurütteln. Sein Plädoyer war wahrscheinlich der letzte Beitrag eines katholischen Geistlichen, der in der deutschen Presse zugunsten der Juden erscheinen durfte. Sein Kampf gegen den Nationalsozialismus nahm jedoch noch konkretere Formen an. Das bereits 1930 veröffentlichte Machwerk des Chefideologen der Partei, Alfred Rosenberg, Mythus des 20. Jahrhunderts, kam durch Studenten im Sommer 1933 in seine Hände. Sofort war er sich darüber im Klaren, dass es trotz der abschreckenden Unwissenschaftlichkeit des Buches eine Pflicht des katholischen Theologen, besonders des Kirchenhistorikers war, hier nicht zu schweigen. Er ging mit seinem Anliegen nach Köln. Bald hatte am 16. März 1934 Carl Joseph Kardinal Schulte eine kirchliche Abwehrstelle im Erzbischöflichen Generalvikariat gegen die antichristliche Propaganda der Partei errichtet und diese dem ebenso dynamischen wie unerschrockenen Domvikar Joseph Teusch anvertraut. Es wurde unter anderem beschlossen, von verschiedenen Fachleuten einzelner Disziplinen eine Gegendarstellung unter der Bezeichnung Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts erstellen zu lassen. Nach einigem Hin und Her konnten die Verfasser gewonnen werden. Das meiste schrieb Neuß selbst. Die Publikation sollte als Beilage des kirchlichen Anzeigers für die Erzdiözese Köln erscheinen. Kardinal Schulte nahm jedoch am 14. Oktober 1934, zwei Tage vor Beginn der Drucklegung, seine Zustimmung zurück. In einem dramatischen Kampf gegen Zeit Links: Karl Joseph Kardinal Schulte (geboren 14. September 1871 in Haus Valbert bei Oedingen [heute Lennestadt]; gestorben 10. März 1941 in Köln) war von 1910 bis 1920 Bischof von Paderborn und von 1920 bis 1941 Erzbischof von Köln. Rechts: Clemens August Kardinal Graf von Galen (geboren 16. März 1878, Burg Dinklage, gestorben 22. März 1946) war von 1933 bis 1946 Bischof von Münster und widerwärtige Umstände gelang es schließlich Professor Neuß und dem Verleger, Franz Carl Bachem, am 16. Oktober in aller Frühe die Einwilligung und ein Vorwort des Löwen von Münster Bischof Clemens August Graf von Galen zu erlangen. So konnten die Studien trotz späterer Beschlagnahme seitens der Gestapo in mehreren Folgen als Beilage zu allen Bischöflichen Amtsblättern verbreitet werden. Die Gestapo und Rosenberg selbst versuchten vergeblich, die Autoren zu ermitteln. Als dann die Autorenschaft von Neuß feststand, war das Pulver schon verschossen. Es lohnte sich nicht mehr, ihn anzugreifen. Neuß entfaltete jedoch zur selben Zeit und auch noch nachher eine umfangreiche Aktivität gegen die Nationalsozialisten. In Mitarbeit mit der Kölner Abwehrstelle hielt er überall zahlreiche Vorträge und Referate, in denen er die antichristliche Ideologie der Partei bloßlegte. Dies war freilich nicht ohne Gefahr. Die Gestapo überwachte bald seine Korrespondenz, sein Telefon und seine Aktivitäten. Es kam zu verschiedenen Schikanen und 1939 sogar zu einer großen Hausdurchsuchung. 5 Um ihn zu schützen, ernannte ihn Kardinal Schulte am 10. Juli 1936 zum nichtresidierenden Domkapitular. Ende Februar 1940 wurde der angesehene junge Privatdozent der Philosophischen Fakultät Heinrich Lützeler wegen seiner mutigen Haltung gegenüber den Nationalsozialisten ohne Begründung aus dem Dozentenkollegium entlassen. Um gegen dieses schreiende Unrecht zu protestieren, ging Neuß mit vielen Studenten am 29. Februar 1940 zu Lützelers Abschiedsvorlesung. Seine Tat wurde als eine politische Demonstration nach Berlin gemeldet und sollte als Vorwand dazu dienen, ihn später zu entlassen, ja sogar die ganze Katholisch-Theologische Fakultät auffliegen zu lassen, was als nach dem Kriegsende zu verwirklichender Plan schon längst feststand. 6 Wegen seiner Haltung verweigerte das Ministerium das freilich Informationen von den Bonner Stellen einholte Neuß, dass er 1940 und 1941 zu zwei internationalen Konferenzen nach Spanien trotz Einladung von dort reisen durfte. Aus den Akten des Bonner Rektorats geht einwandfrei hervor, dass dies wegen seiner Ablehnung des Nationalsozialismus verweigert wurde. Dass Neuß nicht in ein Konzentrationslager kam, besonders als er im September 1940 einen Geheimkurier zu Bischof von Galen schickte, grenzt an ein Wunder. Seinen Mannesmut würdigte Erzbischof Josef >> unitas 2/
40 Frings schon am 24. Juli , der Bundespräsident 1953 durch die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und der Hl. Vater 1953 durch die Ernennung zum Päpstlichen Hausprälaten. Neuß war nicht nur ein bedeutender Gelehrter, sondern auch einer der populärsten Professoren des Rheinlandes. 19 Jahre hindurch ( ) war er Vorsitzender der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und von 1923 bis zu seinem Tode, also rund 42 Jahre lang, Vorsitzender des Vereins für christliche Kunst im Erzbistum Köln und im Bistum Aachen, zugleich Herausgeber von dessen Publikationen. Menschlich war er außerordentlich liebenswürdig. Seine Güte bestand nicht aus Schwäche und Nachgiebigkeit, sondern aus Geduld, Nachsicht und ungewöhnlicher Hilfsbereitschaft. Seine meist anonyme Spendenfreudigkeit war sprichwörtlich. Auch in dieser Hinsicht war er ein vorbildlicher Universitätsprofessor, wie die Bonner Rundschau anlässlich seines Goldenen Priesterjubiläums feststellte. Mit der Unitas-Rhenania Bonn, den Aktiven und Alten Herren, war er besonders verbunden. Er war nicht nur Gründungsmitglied und langjähriger Ehrensenior der Verbindung, sondern auch jener unerschrockene Mann, der nach 1933 zur geistigen Orientierung der studentischen Mitglieder der Unitas-Vereine beitrug. Ein schönes Zeichen studentischer Dankbarkeit war der Fackelzug, durch den die Unitas Professor Neuß anlässlich seiner lectio aurea am 5. November 1963 ehrte und der von zahlreichen Aktiven und Alten Herren vom Rhenanenhaus in der Bonner Ermekeilstraße bis zur Wohnung des Jubilars, Humboldtstraße 9, durchgeführt wurde. 8 Professor Neuß starb am 31. Dezember 1965 in Bonn und wurde am 5. Januar 1966 auf dem Bonner Südfriedhof zu Grabe getragen. Anmerkungen: 1 Als Theologische Prüfungen gibt er in einem Personalbogen vom 03. July 1955 an: pro introitu, Ostern 1902, pro presbyteratu, Sommer Nach o. Personalbogen: Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen (Religion, Hebräisch, Geschichte) 22. Februar 1908, Erweiterungsprüfung (Mathematik) 2. August Ein Bericht über die feierliche Promotion erschien in der Deutschen Reichszeitung, s. unitas Jg.52., S Im Januar 1919 hatte er mit den Professoren Carl Clemen, Carl Enders, Theodor Erismann, Ernst Küster, Wilhelm Levison, August Pütter, Ludwig Schiedermair, Franz Sioli und Otto Welter das Wissenschaftliche Kränzchen gegründet, zu dem später noch einige Bonner Gelehrte hinzustießen und das monatlich zusammentrat und am 14. Mai 1935, nach dem noch erhaltenen Protokollbuch, sein letztes Treffen abhielt. Dort berichteten die Wissenschaftler über ihre Forschungsvorhaben oftmals vor Veröffentlichung deren Ergebnisse. 5 Vorausgegangen war ein Ereignis, welches ein Sohn des am 1. Mai 1939 aus politischen Gründen aus dem Lehrkörper der Universität Bonn ausgeschiedenen Orientalisten Prof. Dr. Paul Kahle in der Wochenzeitung Die Zeit 1966 schilderte: Als nach der sog. Reichspogromnacht am 9. November 1938 ein Sohn der Familie Kahle einer Bonner jüdischen Geschäftsfrau bei Aufräumungsarbeiten half, begann eine einzigartige Hetzkampagne gegen die Familie. Der Sohn wurde zwangsexmatrikuliert, der Vater musste sein Lehramt niederlegen, die Familie emigrierte nach England, wo Paul Kahle in Oxford eine Lehrkanzel übernahm. Als während der Kampagne Kahle, der seit dem 1. Oktober 1923 ordentlicher Professor für Orientalistik an der Universität Bonn war, an einem der monatlichen Treffen Bonner Professoren teilnehmen wollte, an denen er seit über 15 Jahren regelmäßig teilgenommen hatte, protestierten einige Professoren ohne Widerspruch der anderen gegen die Anwesenheit von Kahle. Als dieser sich anschickte, den Saal zu verlassen, erhob sich Neuß mit den Worten: Wenn Kollege Kahle gehen muss, dann gehe ich auch und begleitete Kahle nach Hause. 6 Über die Frage einer Benennung von Wilhelm Neuß zum Nachfolger des am 11. März 1941 verstorbenen Erzbischofs Kardinal Schulte s. Ulrich von Hehl, Katholische Kirche und Nationalsozialismus im Erzbistum Köln , Diss. Bonn 1976/77, Mainz 1977, S Das Originalschreiben des Erzbischofs ist der Festgabe für Wilhelm Neuss zur Vollendung seines 65. Lebensjahres COLONIA SACRA, Studien und Forschungen zur Geschichte des Erzbistums Köln, im Namen der Kölner Bistumsgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft und in Verbindung mit DDr. Robert Haass dargeboten von DDr. Eduard Hegel, Köln 1945, dessen Originalmanuskripte, zusammengebunden zur Festgabe, noch erhalten sind. 7 Er war außerdem Mitglied des Deutschen archäologischen Instituts (1925), der Mediaeval Academy of America (1934), der Real Academie de la Historia, Madrid (1934), des Consejo Superior de Investigaciones scientificas, Madrid (1948), der Real Academie de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona (1951) und Ehrenmitglied der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Rheinischen Landesmuseums (1947). 8 Ein Foto der Teilnehmer dieses Fackelzuges hängt im Kneipsaal der Unitas Rhenania, Bonn, Ermekeilstr. 26. S. hierzu auch den Bericht in unitas 1964, S. 225f. Literatur: Neuß, Wilhelm: Kampf gegen den Mythus des 20. Jahrhunderts. Ein Gedenkblatt an Clemens August Kard. von Galen, Köln 1947, 44 S. Adrianyi, Gabriel: Professor Dr. Wilhelm Neuß ( ). Sein Leben und Werk, in: unitas, Jg. 121 (1981), H.l, S Bernhards, Mattäus: Bibliographie von Wilhelm Neuß, in: R. Haas J. Hoster (Hrsg.), Zur Geschichte und Kunst im Erzbistum Köln. Festschrift für Wilhelm Neuß, Düsseldorf I960, S Franzen, August: Professor Wilhelm Neuß zum 70. Geburtstag, in: Theologische Revue, Jg. 46 (1950), Sp Hegel, Eduard: Wilhelm Neuß, in: Historisches Jahrbuch, Jg. 87 (1967), S Der Text ist dem von Bbr. Wolfang Burr herausgegebenen Unitas Handbuch I, entnommen. Eine ausführlichere Darstellung: Professor Dr. Wilhelm Neuß, ( ). Sein Leben und Werk. Ein Festvortrag von Bbr. Gabriel Adrianyi in: Unitas, 1981/1, unitas 2/2015
41 Unternehmensgründer I: Altersvorsorge 2.0 von Fairr.de VON BBR. DAVID SCHMIDT-HOFNER Wie wichtig es ist, schon in frühen Jahren an die Altersvorsorge zu denken, sollte inzwischen jedem bekannt sein. Jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, wird, sei es durch Finanzberater oder durch eine Suche auf auf die Möglichkeit eines Riester-Vertrages aufmerksam werden. Altersvorsorge per se und gerade Riester-Verträge haben besonders für junge Menschen oft ein spießiges Image (was interessieren mich die Probleme von morgen oder gar in 40 Jahren). zu beschäftigen und war von dem Konstrukt der Riester-Altersvorsorge schnell überzeugt. Seine Enttäuschung über die schlechte Entwicklung seines Vertrages, die mangelnde Transparenz und die hohen Kosten animierten ihn, einen Riester-Vertrag zu entwickeln, der diese Mängel behebt. Mit zwei Mitstreitern gründete er das Start-up fairr.de. Nach einer gewissen Entwicklungszeit konnte er in Zusammenarbeit mit der Sutor Bank aus Hamburg seine eigene Riesterrente auf den Markt bringen. Fairr.de dient dabei rechtlich gesehen als Vermittler, während sich die Bank um die Verwaltung der Verträge und die Anlage der Kundengelder kümmert. Dabei achtet die Bank darauf, nur in passive Fonds zu Wer sich tiefer mit der Möglichkeit der Altersvorsorge mit einem Riester- Vertrag beschäftigt, wird zudem auf viele negative Aspekte vieler Verträge stoßen: u. a. Intransparenz, hohe Provisionen, kaum Rendite und hohe laufende Kosten (die unter Umständen die staatlichen Zuschüssen aufzehren). Die eigentlichen Vorteile eines Riester-Vertrages (staatliche Zuschüsse, Steuervorteil in der Ansparphase und in der Auszahlphase, langfristige Geldanlage) verlieren durch schlechte und nicht kundenorientierte Riester-Verträge an Glaubwürdigkeit das Vertrauen in ein System geht verloren. Start-up-Gründer Mein Leibfux Jens Jennissen begann früh, sich mich der Altersvorsorge Das nebenstehende Firmen- Portrait ist Start einer Serie, mit der wir junge und junggebliebene Gründer aus dem Verband vorstellen wollen. Wir wollen sie fortsetzen Ideen und Hinweise an die Redaktion sind immer herzlich willkommen! investieren, um so mehr Sicherheit und gleichzeitig geringere Kosten zu generieren. Die Kosten des Riester-Vertrages beschränken sich auf 0,5 Prozenz 1,5 Prozent des angesparten Vermögens und einer monatlichen Depotführungsgebühr in Höhe von 2,25 Euro. Als Kunde besteht jederzeit die Möglichkeit, die Entwicklung seines Vermögens online oder mit Hilfe einer App nachzuverfolgen. Der Vertrag kann online unter abgeschlossen werden. Durch den Verzicht auf teure Mittelsmänner und deren Abschlussprovisionen können die Kosten im Vertrag niedrig gehalten werden, was sich in einer höheren Rente für die Kunden niederschlägt. Wer dennoch die persönliche Beratung bevorzugt, kann diese bei Honorarberatern erhalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Versicherungsvertreten erhalten Honorarberater keine Provision, sondern berechnen ihren Kunden eine Beratungsgebühr. So weiß der Kunde stets, was er bezahlt. Der Berater hat somit keinen Interessenskonflikt, den Vertrag mit der höchsten Provision anzubieten, sondern den für den Kunden besten Vertrag. Zur Person: Jens Jennissen hat mit Fairr.de einen großen Schritt zu mehr Transparenz in der privaten Altersvorsorge gemacht und somit seinen Anteil geleistet, wieder in die Altersvorsorge im Rahmen des Riester-Vertrages vertrauen zu dürfen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stiftung Warentest und die ARD-Börse haben diese innovative Möglichkeit zu riestern ebenfalls entdeckt und würdigen das Angebot dementsprechend. Jens Jennissen ist Geschäftsführer und Gründer von fairr.de. Zuvor war er lange im Finanzbereich tätig, unter anderem als Research Analyst im Investment Banking der Dresdner Bank in London und als Händler im Handelshaus von E.ON. Er studierte Business Administration an der Rotterdam School of Management, Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School und machte seinen Master in Finance an der London Business School. Zudem ist er ein Chartered Alternative Investment Analyst und Mitinitiator des Berliner Alumnivereins der London Business School. Jens Jennissen ist Mitglied des AHV Unitas Rheinfranken und Unitas Berlin. unitas 2/
42 Tolle, lege nimm und lies ZWEI WORTE, DIE EIN LEBEN VERÄNDERN KÖNNEN. VON BBR. PFR. TOBIAS SPITTMANN Es war das Leben von Augustinus, das durch diese zwei kleinen Worte massiv verändert wurde. Bevor er zu dem uns bekannten Kirchenlehrer wurde, war er ein Lebemann, der auf der Suche nach seinem Weg war. Schritt für Schritt näherte er sich der christlichen Botschaft an. Schließlich gab ein von ihm selbst geschildertes Erlebnis den letzten Anstoß zur Entscheidung ein Christ zu werden. Augustinus meditierte im Garten seines Hauses in Mailand in der Nähe seines Freundes Alypius. Da hörte er plötzlich die Stimme eines Kindes, das zu singen schien: Tolle, lege nimm und lies 1.Augustinus schlug das Buch des Heiligen Paulus auf, das er zu dieser Zeit immer bei sich trug und das vor ihm auf dem Tisch lag. Dabei stieß er auf die Stelle im Römerbrief (13,13): Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Ausschweifungen, nicht in Zank und Streit sucht euer Heil. Sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung eurer Lüste. Die Gnade traf ihn, begleitet von Tränenströmen, eine Erleuchtung überkam ihn, die Entscheidung war gefallen! Aus seinen schlimmsten Seelenkämpfen heraus fühlte er sich plötzlich wie durch ein Wunder bekehrt, und so zog er Christus an. Das hieß: Er beschloss, ein neues Leben zu beginnen, in die Kirche einzutreten und sein Leben radikal zu verändern, indem er unter anderem auf weltliche Dinge verzichtete. Später wurde Augustinus dann sogar selber Bischof. Fast 40 Jahre bleibt er an die Kirche von Hippo Regius gebunden. Während dieser Zeit verfasst er die Bekenntnisse, in denen er im Rückblick Gottes Heilsweg mit ihm beschreibt. Die Worte, mit denen Augustinus von Hippo (13. November August 430), einer der vier lateinischen Kirchenlehrer. Er prägte als einer der einflussreichsten Theologen und Philosophen der christlichen Spätantike wesentlich das Denken des Abendlandes. Kam über Karthago und Rom und Mailand, ließ sich unter Bischof Ambrosius von Mailand 387 taufen. Von 395 bis zu seinem Tod 430 Bischof von Hippo Regius. Seine Bekenntnisse (Confessiones) gehören zu den wichtigsten autobiografischen Texten der Weltliteratur. Aypius, Sohn einer vornehmen Familie, wurde wie sein einige Jahre älterer Freund Augustinus zuerst Anhänger des Manichäismus, folgte Augustinus nach Rom und Mailand, wurde dort zusammen getauft, reiste in dessen Auftrag nach Betlehem zu Hieronymus. 394 Bischof von Thagaste. Bildausschnitt: St. Augustinus liest die Briefe des Hl. Paulus, Fresko von Bellozzo Gozzoli ( , Chorkapelle Sant'Agostino, San Gimignano Aurelius Augustinus seine Bekenntnisse, die ehrlichste und eindrucksvollste Autobiografie der Weltliteratur 2,einleitet: Du hastuns,herr,für Dich erschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in Dir kennzeichnen diesen größten Lehrer der Kirche. Unter den zahlreichen Schriften des Augustinus von Hippo Regius ist zu seiner Zeit und über die Jahrhunderte hinweg bis in unsere Tage keine so bekannt gewesen und so häufig gelesen worden, wie die dreizehn Bücher der Bekenntnisse. Alle, deren Herz unruhig fragte, wo es seinen Frieden finden könne, waren auf diese Schriften verwiesen. So haben Hoffende, Enttäuschte, Suchende und Zweifelnde, Mönche und Mystiker, Kleriker und Laien, die Autobiografie des Augustinus zu ihrer Lektüre gemacht. Tolle, lege. Nimm und lies. Augustinus liest die Botschaft und wird so ganz von Gott erfüllt. Das ist jetzt schon über Jahre her. Heute, 2015, sieht die Welt doch etwas anders aus. Warum sollte irgendjemand daran interessiert sein, das Evangelium, die Worte Gottes, in unserer Zeit zu hören, ja vielleicht sogar danach zu leben? In einer Zeit, in der es so viele andere Dinge gibt. In der das Geld regiert und nur der Stärkere überlebt. Ich habe keine Zeit für so etwas. Zeit ist Geld. Was bringt mir das? Ich brauche keinen Gott für mein Leben. So, oder ähnlich, klingt es von den Dächern; in einer Welt, die mit Gott, mit Gotteserfahrungen, immer weniger anfangen kann. Wie können wir heute in unserer säkularisierten Welt aktiv aus dem Evangelium leben? Wie können wir das Gebot der Nächstenliebe umsetzen, wie aus der Schrift Kraft schöpfen für unseren Alltag? Wie kann das Evangelium für uns Lebens-Brot werden, heute und in Zukunft? Ich rede vom Heute, einer Welt, die immer gottloser, die fremdbestimmt wird, die immer noch mit Krieg und Not zu kämpfen hat. Heute meint aber auch die Hoffnung vieler Menschen, die versuchen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Ich will versuchen, mit dem Evangelium zu leben, sagte mir einmal ein jugendlicher Drogenabhängiger in Brasilien, der erst kurze Zeit vorher den ersten Kontakt mit dem Evangelium hatte. Was bedeutet das für diesen Jugendlichen? Das Evangelium leben, klingt eigentlich recht einfach: Ich will versuchen, die frohe Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, zu leben. 130 unitas 2/2015
43 Anders formuliert kann man auch von der frohmachenden Botschaft reden: Ich werde durch seine Worte motiviert, meinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Ich will versuchen, so zu leben, wie Jesus es getan hat. Wie das gehen kann, möchte ich Ihnen an einer kurzen Begebenheit aus meinem Leben zeigen: Mit meinem Seesack kam ich als Missionar auf Zeit im August 1998 in Brasilien auf der Fazenda da Esperanca an. Die Fazenda ist ein christliches Projekt für drogenabhängige Jugendliche, die sich von ihrer Drogensucht befreien wollen. Der Landesprache war ich nicht mächtig und was mich erwarten würde, wusste ich auch nicht so ganz. Ich kam in ein Haus in den Bergen, abgelegen von den anderen Häusern. Warum das Haus weiter von den anderen entfernt war, sollte ich schon in meinen ersten Minuten erfahren: Zwei Jugendliche liefen schreiend durch das Haus und fingen an, sich zu prügeln. Ich verstand natürlich nicht warum, war aber froh, dass mich ein älterer Mann namens Barba zur Seite zog. Er verdeutlichte mir, dass es gut sei, sich bei solchen Auseinandersetzungen fern zu halten, das sei sicherer. Das war ein Einstieg, wie ich ihn nicht erwartet hätte. Nachdem dieser Konflikt gelöst worden war, bekam ich mein Bett zugeteilt. Eine schon etwas durchgelegene Matratze lachte mich an. Ich hatte weder ein Kissen noch eine Decke. Nichts dergleichen hatte ich in Deutschland eingepackt, dachte, es wäre alles vorhanden, da auch niemand etwas gesagt hatte. Nun stand ich also ohne Bettzeug da und stellte mich innerlich schon auf lange, kalte Winternächte ein. Marcello, mein Bettnachbar ein Recuperant beobachtete mich beim Auspacken und merkte, in welcher Situation ich war. Er sprach mich an, und obwohl ich ihn nicht verstand, fanden wir einen Weg zu kommunizieren: Marcello reichte mir ein Laken und ein Kissen herüber und gestikulierte, dass ich es nehmen solle. Ich wollte erst nicht, aber dann zeigte er mir, dass er die Sachen doppelt hatte. Später stellte sich heraus, dass er erst zwei Wochen auf der Fazenda war, und versuchte nach dem Evangelium zu leben. Diese kleine Begegnung zeigte mir, dass die Kraft des Wortes-Gottes keine menschlichen Grenzen kennt. In den letzten Jahren habe ich immer wieder solche kleinen Begegnungen machen dürfen. Entweder, weil ich mich selbst mit in dieses Spiel eingebracht habe, oder weil andere ganz praktisch die Worte im Alltag gelebt haben. Auch heute lohnt es sich das Tolle, lege nimm und lies ernst zu nehmen. Aus dem Evangelium dem Wort zu leben, ist keine Erfindung der Neuzeit, bei z. B. der Frau am Brunnen oder bei dem Kirchenlehrer Augustinus ist es eine Lebensgrundlage und bildet so ein geistiges Fundament für unser Leben aus dem Wort. Tolle, lege. Nimm und lies. Zwei Worte, die bis heute ihre Wirkung nicht verloren haben. Quellen: 1 Joseph Bernhart, Augustinus Bekenntnisse, S. 414; S Wilhelm Schamoni, Das wahre Gesicht der Heiligen, S Der Beitrag erschien am 25. Februar 2015 in der Reihe Zur Mitte auf der Homepage des Unitas-Verbandes Kontakt: Bbr. Pastor Tobias Spittmann, Propsteistr. 3, Höxter, Tel , tobias.spittmann@pv-corvey.de Jeder fünfte hat Wurzeln im Ausland WIESBADEN. In Deutschland leben 16,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Laut Statistik ist damit jeder fünfte Bürger in Deutschland nach 1950 zugewandert oder hat zugewanderte Eltern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben 9,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund ein Drittel der Bürger mit Migrationshintergrund ist in Deutschland geboren. 70 Prozent der Zugewanderten haben ihre Wurzeln in einem europäischen Land. Die wichtigsten Herkunftsländer sind dabei die Türkei (12,8 Prozent), Polen (11,4 Prozent) und Russland (9 Prozent). Die sogenannten ehemaligen Gastarbeiterländer Italien und Griechenland belegen mit vier, beziehungsweise zwei Prozent die Plätze sechs und sieben. Laut Statistik, die sich auf die Daten des Mikrozensus aus dem Jahr 2013 bezieht, leben fast alle Ausländer und Bürger mit Migrationshintergrund in den westdeutschen Ländern oder Berlin. In den ostdeutschen Bundesländern zählten die Statistiker nur 3,4 Prozent aller in der Bundesrepublik lebenden Bürger mit ausländischen Wurzeln. Zahl der Studierenden in Deutschland erreicht erneut Rekordwert WIESBADEN. Die Zahl der Studierenden in Deutschland steht zum siebten Mal in Folge auf einem weiteren Rekordwert: Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden, sind gegenwärtig 2,69 Millionen Studentinnen und Studenten an einer deutschen Hochschule eingeschrieben oder 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Studienanfänger sank jedoch gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent auf Nach den Angaben waren 1,77 Millionen Studierende an wissenschaftlichen Hochschulen und Kunsthochschulen eingeschrieben ein Plus von 1,9 Prozent. An Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen hatten sich Studenten immatrikuliert 5,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die stärkste Zunahme der Zahl der Studierenden verzeichnete Niedersachsen (plus 8,5 Prozent), gefolgt von Hessen (plus 4,5 Prozent) und dem Saarland (plus 4,3 Prozent). Dagegen sank die Zahl der Studierenden in allen ostdeutschen Bundesländern mit Ausnahme von Berlin (plus 3,2 Prozent). >> unitas 2/
44 Europäische Einigung nicht aus den Augen verlieren DER EUROPAPARLAMENTARIER AXEL VOSS SPRACH BEIM NEUJAHRSEMPFANG DER UNITAS-SALIA Das Amt des Altherrenvereinsvorsitzenden ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Dieses geflügelte Wort von Bbr. Dr. Rudolf Hammerschmidt findet auch im unitarischen Alltag von Bbr. Dr. Winfried Gottschlich, AHV-Vorsitzendem der Unitas-Salia Bonn, allzu häufig Bestätigung. Und doch sind da diese Momente, die alles wettmachen. Der Neujahrsempfang 2015 der Mutterkorporation des Unitas-Verbands gehörte sicherlich zu diesen Momenten. Am 17. Januar lockte der Empfang nahezu alle Aktiven und zudem Alte Herren aller Jahrgänge in einer Vielzahl auf das Haus, wie sie sonst allenfalls beim Rasentreffen des Stiftungsfests zu bestaunen ist. Im voll besetzten Konventssaal der Salia warfen zunächst Bbr. Dr. Winfried Gottschlich und der Senior des Wintersemesters 2014/2015, Bbr. Pablo Rodriguez Mira, einen Blick zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2014, ohne allerdings die Glanzleistung der Aktivitas unerwähnt zu lassen, den Besitz der Prunkfahne vorübergehend der Deutschen Bahn AG überlassen zu haben. Nach einem Grußwort des Altherrenbundsvorsitzenden Bbr. Dr. Dr. Thomas Lohmann richtete dann der Referent des Abends Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments und Bezirksvorsitzender der CDU Mittelrhein, das Wort an die Anwesenden. Unter der Überschrift Die Europäische Einigung von Robert Schuman bis heute gelang ihm ein kurzweiliger und fesselnder Brückenschlag von den Anfängen der europäischen Einigung, an der Bbr. Robert Schuman wesentlichen Anteil hatte, bis hin zu modernen Reizthemen wie TTIP und Fluggastdatenschutz. Dabei mahnte er an, die Einmaligkeit der europäischen Einigung nicht aus den Augen zu verlieren und etwa den Umgang mit Griechenland nicht nur unter finanziell-wirtschaftlichen Aspekten zu betrachten, sondern die politische Bedeutung und Auswirkung jedweden Handelns zu berücksichtigen. Anschließend wurde von der Möglichkeit zu Fragen ausgiebig Gebrauch Hier wird der Ehrengast beim diesjährigen Neujahrsempfang der Unitas-Salia, der Europaabgeordnete Axel Voss, vom Senior der Salia, Bbr. Pablo Rodriguez Mira, begrüßt. Axel Voss sprach vor einem vollen Haus zum Thema Die Europäische Einigung von Robert Schuman bis heute. gemacht. Dies schloss geistreiche Anmerkungen ebenso ein wie das unvermeidliche unitarische Koreferat. Festlich umrahmt wurde der Vortrag von Bbr. Pablo Rodriguez Mira am Klavier mit dem Präludium in es-moll von J. S. Bach und dem Orientalischen Tanz von Enrique Granados. Vortrag und Diskussion folgte ein weiterer Höhepunkt des Abends: Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Hausbauvereins im Jahr 2014 war die erfolgreiche Sanierung der über die Jahre zum trostlosen Altpapierlager verkommenen Bibliothek mit dem angrenzenden Gartenzimmer im Haus Luisenstraße 36. Aus der Bibliothek wurde ein schmucker grüner Salon, durch den man nun in das ganz in Weiß gehaltene Robert Schuman-Zimmer gelangt, welches zu Besprechungen genutzt werden kann und Bundesbrüdern, die im Examen stehen, als Ort zum Lernen 132 unitas 2/2015
45 Nach Vortrag und Diskussion stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Der neu gestaltete Grüne Salon, die ehemalige Bibliothek, mit dem benachbarten neuen Robert Schuman-Zimmer. Rechts: Innenarchitektin Anna Baurmann. und konzentrierten Arbeiten dienen soll. Die Räume wurden in Anwesenheit der Innenarchitektin Anna Baurmann feierlich eröffnet. Der Empfang fand sodann nach einem ausgezeichneten Buffet einen geselligen Ausklang im Salia-Keller. Der Neujahrsempfang wurde erstmals im Wintersemester 1998/1999 veranstaltet und ist mittlerweile eine feste Größe und Konstante im Programm der Unitas-Salia in Bonn. Nach der rheinischen Definition ( nach dreimal ) ist er schon seit 2001 Tradition. Die Veranstaltung greift kirchlich und gesellschaftlich relevante Themen auf. Erster Referent war Bbr. Kardinal Reinhard Marx, damals noch Weihbischof in Paderborn, gefolgt von Persönlichkeiten wie u. a. NRW-Integrationsminister Armin Laschet, Bbr. Friedhelm Ost, Philipp Freiherr von Boeselager, Bbr. Dr. Rudolf Seiters, dem vormaligen WDR-Intendanten Friedrich Nowottny und Dr. Rupert Neudeck. Bundesbrüder in der deutschen Fußballschule in Polen OBERSCHLESIEN. Ein unverhofftes Wiedersehen gab es zwischen Bbr. Engelbert Nelle, früherer Abgeordneter im Deutschen Bundestag, langjähriger Vorsitzender des Sportausschusses und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Fußballbundes (DFB), und Bbr. Alfred Theisen (Unitas-Salia Bonn). Theisen war enger Mitarbeiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Herbert Hupka und später in der Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft Schlesien tätig. Ab 1998 baute er in Görlitz den Senfkorn-Verlag auf, gibt die Zeitschriften Schlesien heute und seit 1999 Oberschlesien in St. Annaberg heraus. Für sein Engagement für die deutsch-polnische Verständigung ist der Journalist u. a. mit dem Sonderpreis zum Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 2011 in Goslar ausgezeichnet worden. Anlass des bundesbrüderlichen Zusammentreffens war die Eröffnung der ersten deutschen Fußballschule am 7. Februar 2015 in Chronstau bei der deutschen Minderheit im Oppelner Land: Die gemeinsame Initiative des DFK Chronstau, der Deutschen Bildungsgesellschaft (Oppelner Sportfreunde) sowie des Eigentümers der Firma KREON und Tina Led entstand aus den Fanmeilen, die in Chronstau seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 bei jeder Welt- und Europameisterschaft stattfanden. Die Fußballschule will Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren durch den Fußballunterricht für die deutsche Sprache begeistern. Dabei werden deutsche Trainingsmethoden mit der Vermittlung der deutschen Sprache verbunden. Mit Unterstützung des Regierungsbezirks Oppeln wird dies in enger Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut geschehen. Finanziert wird die Schule aus Beiträgen der Eltern und Sponsorengeldern. Jede Unterstützung ist willkommen. Mehr im Internet: unitas 2/
46 25 Jahre Unitas Ostfalia zu Erfurt Ad fontes! DIE GESCHICHTE EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN GRÜNDUNG VON DEN BUNDESBRÜDERN BENNO BOLZE UND GÁBOR KANT, ÜBERARBEITET VON MARIAN HEFTER Ob in Bonn, Moskau, Budapest oder Rom: Die späten 80er Jahre waren eine Zeit, in der Geschichte geschrieben wurde. Eine Geschichte, die nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, ja die ganze Welt verändert hat getragen von den kleinen Dingen, die von jedem Einzelnen couragiert getan wurden, und den Verantwortlichen, die dafür sorgten, dass diese kleinen Dinge wirklich etwas bewegen konnten. Geschichte ist aber auch immer Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wir dürfen Gott danken. Warum dieser große Einstieg in unsere Erzählung? Weil all diese Veränderungen erst ermöglicht haben, wovon wir hier eigentlich berichten wollen: Von der Gründung der Unitas Ostfalia zu Erfurt, ehedem zu Magdeburg, im Jahre Geschichte wird von Menschen gemacht gestaltet wird sie von leidenschaftlichen Menschen. Wir waren damals Studenten im Norbertinum in Magdeburg, einer in der DDR einmaligen Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft, die angehenden Theologen die Möglichkeit gab, das Abitur zu erwerben, um dann in Erfurt ein Theologiestudium zu beginnen. Auch das Marianum in Neuss hatte ähnliche Strukturen und dessen Rektor, Bbr. Johannes Börsch, gelang es, durch regelmäßige Besuche gemeinsam mit anderen Bundesbrüdern ein erstes zartes Pflänzchen für das Wachstum unitarischen Geistes zu setzen. Zunächst blieb uns aufgrund der Reisebestimmungen der DDR ein Besuch in Neuss verwehrt, sodass also die Bundesbrüder zu uns nach Magdeburg kommen mussten. Doch nach den Ereignissen im Spätherbst 1989 konnten wir plötzlich der Einladung zum Patronatsfest des Marianums im Dezember folgen. Diese herzliche Begegnung im unitarischen Geist war mit Sicherheit grundlegend und bestimmend für alles Weitere. sich während seiner Ausbildung umfassendes Wissen mit Weitblick zu Teil wurde, fand sich doch ein Weg, diese Problematik zu umgehen: Durch einen bundesdeutschen Pass, den wir uns kurzer Hand in Helmstedt holten, rückte Rom innerhalb einer Stunde ein beträchtliches Stück näher. Bis heute sind die Eindrücke aus Rom uns unvergesslich: die ewige Stadt, mit ihren Hauptkirchen und Katakomben sowie natürlich ihren Trattorien mit römischer Küche und köstlichen Weinen. Der Höhepunkt des Rombesuches war es aber, dem Mann, Es war Bbr. Msr. Johannes Börsch, ursprünglich ein Rhenane, der als leidenschaftlicher Unitarier schon vor der Wiedervereinigung erste Kontakte nach Magdeburg knüpfte. Wie bei den Anfängen der Unitas vor 160 Jahren war es ein Theologe, der hier zu anderen Theologen, die die erste Generation der Ostfalia darstellten, eine Verbindung aufbaute. Im Nachhinein klingt das selbstverständlich, tatsächlich aber ist das visionär zu nennen. Bei der Aufnahmefeier in die Unitas Ripuaria Neuss in Rom: (hintere Reihe v.r.n.l.) BbrBbr. Benno Bolze, Hermann-Josef Großimlinghaus, Guido Spieske, Johannes Trei, Gábor Kant, Msgr. Johannes Börsch, Christian Herrlich, (vordere Reihe) Wolfgang Burr, Joachim Bodenberger; nicht im Bild: Thomas Moormann Doch sollte es dabei nicht bleiben; Hans ermöglichte kurz darauf, womit keiner gerechnet hätte. Er versprach: Ostern fahren wir nach Rom. Er hatte seinen Teil für uns getan. Jetzt war es an uns. Wenn auch alle Wege nach Rom führen mögen, so schien uns doch der unsrige besonders weit: Die DDR-Behörden machten Probleme, weil die Visa-Regelungen mit Italien nicht so einfach zu durchschauen waren. Da aber dem Norbertiner an der diesen politischen Wandel in Europa entscheidend mitgestaltet hatte, persönlich begegnen zu dürfen: Papst Johannes Paul II. Bbr. Hermann-Josef Großimlinghaus hat es uns ermöglicht, mit dem Papst in seiner Kapelle gemeinsam die Hl. Messe zu feiern und ihm anschließend im persönlichen Gespräch während einer Privataudienz zu danken. Es war für alle ein erhebender Moment, und wir hatten die Gewissheit, einer 134 unitas 2/2015
47 wirklich großen Persönlichkeit zu begegnen, die die Geschichte noch sehr ehren würde. Vor dem Hintergrund all dieser überwältigenden Eindrücke wurden wir in der Ewigen Stadt in die Unitas Ripuaria Neuss aufgenommen. Somit war der eigentliche Grundstein für die Initialisierung eines Magdeburger Unitas-Vereins gelegt. Ostfalia: A star is born Doch wie sollte unser unitarischer Studentenverein in Magdeburg heißen? Die Ottonen waren schon verpflichtet, ein Magdeburgensis erschien uns im Hinblick auf eine zukünftige Ausweitung nach Erfurt als zu eng. So war eine Ostfalia mehr als adäquat, denn sie implizierte eine Verbundenheit mit Westfalen, hatte also eine gesamtdeutsche Phonetik und umschloss sowohl das Sachsen-Anhaltinische Magdeburg als auch das Thüringische Erfurt. Im Herbst 1990, ein Jahr nach den großen Ereignissen, die uns all dies erst ermöglicht hatten, war es dann soweit: 1. Stiftungsfest der Unitas Ostfalia Magdeburg! Aus allen Teilen Deutschlands hatten sich Bundesbrüder und ihre Begleitung angesagt. Je näher das Stiftungsfest rückte, desto drängender wurden aber auch die Fragen: Wo würden die Gäste übernachten? Wie sieht ein Festkommers überhaupt aus und wie schlägt man ihn ohne Schläger? Hinzu kamen Biernot und Geldnot. Trotzdem waren wir begeistert von der großen Zahl der Anmeldungen zum Stiftungsfest und übten uns in angemessener christlicher Gelassenheit, die uns den Spaß und die Freude bei all dem ermöglichte. Wir begannen das Stiftungsfest mit einer feierlichen Vesper in der Kapelle des Norbertinums. Dann schritten wir zum Gründungskommers: Gründungssenior Bbr. Christian Herrlich hatte aufgrund einer besonderen Reiseerlaubnis die Möglichkeit bekommen, noch vor der Wende die Bundesbrüder der Ripuaria in Neuss zu besuchen und dort eine Kneipe miterlebt, sodass die entsprechenden Fachkenntnisse also vorhanden waren. 10 Minuten vor dem ersten Schlag liehen uns die Bundesbrüder der Ripuaria noch ihre Schläger und bewahrten uns dadurch vor einer Kuba-Kommers-Krise, hatten wir doch inzwischen schon verabredet, dass wir den Kommers mit einem jeweils eigenen Schuh schlagen würden was Chruschtschow konnte, hätten wir schon auch gekonnt! Das aus den Begegnungen im Marianum in Neuss geschätzte Bitburger Bier stand in Magdeburg zum damaligen Zeitpunkt leider nicht zur Verfügung. Es gab allerdings in biernötlicher Reichweite gegenüber dem Norbertinum die Bördebrauerei, deren Pförtner uns aufgrund intensiver früherer nächtlicher Reputationskontakte wohlgesonnen war. Somit kamen wir also doch noch an Bier, wenn auch geschmacklich sehr begrenzt, so doch verdauungsfördernd und mengenmäßig unbegrenzt. Dennoch befanden wir uns trotz Überflusses an commentgemäßen Stoffen in einer weiteren, speziellen Form von Biernot: Denn es gab in der DDR kurz vor der Wiedervereinigung keine Zapfanlagen. Also bedienten wir uns eines Hammers und eines hölzernen Hahnes, um den ohnehin nicht sehr kohlensäurehaltigen Stoff aus den 50- Liter-Fässern zu locken. Das Bier lief dann auch ziemlich motivationslos aus dem Fass in die im Norbertinum reichlich vorhandenen Porzellanmilchkannen. Dies alles tat der Freude an diesem Abend aber keinen Abbruch. Im Rahmen des Gründungskommers wurde der damalige Rektor des Norbertinums und Festredner des Stiftungsfestes, Hans-Joachim Marchio, als Ehrenmitglied in die Unitas aufgenommen. Das Stiftungsfest fand in der gemeinsamen Hl. Messe am folgenden Sonntag in der St. Petri-Kirche seinen Höhepunkt und endete mit einem gemeinsamen Mittagessen im Norbertinum. Einige Zeit danach wurde deutlich: Auch die Ostfalia als gerade erst gegründeter Verein benötigte eine Altherrenschaft. Eine kreative und pragmatische Lösung war gefragt. So luden wir dann auf gut Glück in der Verbandszeitschrift zu einer Gründungsversammlung eines AHV ein. Eine ganze Reihe von AHAH hatte erkannt, dass unser junger Verein von der Erfahrung anderer, älterer Unitarier profitieren sollte, und so fand die Sitzung dann auch tatsächlich statt. Damit waren die Rahmenbedingungen für die kleine, aber entschiedene unitarische Gemeinschaft geschaffen. Dank der Gastfreundschaft der Kirchengemeinde St. Petri hatten wir auch angemessene Räume für unsere wissenschaftlichen Sitzungen, Gottesdienste und weitere unitarische Begegnungen. Nach unserem Wechsel nach Erfurt an das Philosophisch-Theologische Studium, der heutigen Katholisch-theologischen Fakultät, beschlossen wir die Änderung des Vereinsnamens in Unitas Ostfalia Erfurt. So, wie unsere Unitas Ostfalia nicht nur in Gedanken, sondern auch in zugegebenermaßen kleinen Taten Geschichte geschrieben hat, wollen wir als einziger Unitas-Verein auf ehemaligem DDR-Gebiet und einzige katholische Korporation in Erfurt versuchen, dieses noch so junge Erbe weiterzuführen. Vivat, floreat, crescat Unitas Ostfalia! Wir sind nicht klein zu bekommen! schrieben die Bundesbrüder aus Erfurt in ihrer Einladung zum freudigen Silberjubel in der thüringischen Landeshauptstadt. Wie verlautet, war schon vor Redaktionsschluss ihre Hoffnung auf viele Besucher vom Mai 2015 berechtigt. Über den Verlauf des Programms mit Begrüßungsabend im Predigerkeller Meister-Eckehardt-Straße vom Empfang auf dem Aufderbeck-Haus in der Heinrichstraße 11, über die Stadtführung und Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Lorenz bis zum Festkommers im Johannes-Lang-Saal und dem sonntäglichen Angelusgebet im Domkreuzgang wird die Redaktion sicher Mitteilung erhalten. unitas 2/
48 Der Wahrheit verpflichtet eine Prinzipienrede VON BBR. ANDREAS HARTER, KÖLN Die Wahrheit, mein lieber Sohn, die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, wir müssen uns nach ihr richten. So schreibt Matthias Claudius. Dagegen richtet sich so spontan wie provokant die Frage: Was ist Wahrheit? Gibt es so etwas wie Wahrheit überhaupt? Wo stehen wir eigentlich in dieser Welt? Haltlos? Verloren in einem Meer aus Relativität? Dagegen kann man als Akademiker und besonders als katholischer Akademiker nur sagen: Natürlich gibt es Wahrheit, denn gäbe es sie nicht, als was ständen wir dann da? Eine Wissenschaft, die nicht nach Wahrheit sucht, verliert ihre Daseinsberechtigung. Ihr spürt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft: Der Scientia stellt man sich nicht oft und schon gar nicht leicht, wie ich bei der Vorbereitung dieser Rede feststellen durfte. Sie mag oft ein wenig in den Hintergrund treten bei ihren zwei Kameraden Virtus und Amicitia, über die man gemeinhin öfter und leichter reden hört. Und doch hat die Scientia nicht weniger Relevanz, denn nur zu dritt kann man die Prinzipien in ihrer Fülle verstehen. Ich sehe eine tiefe und dringliche Notwendigkeit in der Suche nach der Wahrheit, da wir ohne ihren Halt tatsächlich drohen, in der Gleichgültigkeit dieser Welt unterzugehen. In einer Welt in der alles als wahr gelten darf, wird letztlich alles Unwahrheit, da schon in dieser Annahme nur Unwahrheit steckt. So können schon rein logisch nicht zwei Dinge wahr sein, die sich in ihren Aussagen widersprechen. Eine Haltung, die der Wahrheit gegenüber gleichgültig ist oder sogar sagt, es gäbe sie nicht, ist ganz und gar unchristlich und letzten Endes nicht lebbar, da zerstörerisch. Ohne den Anker der Wahrheit ist man unfrei, man wird in der Tat dadurch in der Welt gefangen gehalten und geknechtet, wenn man nicht versucht, die Wahrheit zu finden und sie zu leben. Auch wenn man nicht unbedingt permanent spürt, dass man gefangen ist, so ist doch derjenige der Klügere und der, der frei handeln und denken kann, der anerkennt, dass es Wahrheit gibt und dass sie nicht mit sich feilschen lässt. Dies erkannte schon Platon und sein Argument wurde mit folgendem Beispiel verdeutlicht: Wer ein falsches Medikament nimmt, in der Annahme, es würde ihm helfen, der hat nicht das getan, was er wollte, denn er wollte gesund werden. Nur der, der die Wirkung des Medikamentes kennt, tut das, was er wirklich will, wenn er das richtige nimmt. Natürlich denkt auch der erstere, der mit dem falschen Medikament, er täte das, was er will, aber nur, weil er nicht um die Wahrheit weiß. Wahrheit und Freiheit Man sieht, um es mit Robert Spaemanns Worten zu sagen: Frei ist der, der weiß, was er tut, denn nur derjenige tut, was er wirklich will. Man kann erst dann frei handeln, wenn man um die Wahrheit weiß. Dann erst kann man sich im Handeln auf den Weg machen, zu dem, was man letztlich will. Die Suche nach der Wahrheit ist also lebensnotwendig, nicht nur im Beispiel mit den zwei Patienten (da ist es ganz konkret), sondern auch im ganzen Leben und Denken und vor allem im Handeln. Wie meine These zu Anfang sagte, hat jede Wissenschaft ihren Auftrag verfehlt, die sich nicht der Wahrheit verpflichtet. Das kann ich als Physikstudent ganz deutlich sagen. Ob Natur-, Geistes- oder sonstige Wissenschaft überall soll und muss mit der dem Menschen verliehenen Vernunft vorgegangen werden. Uns Menschen ist unsere Wirklichkeit gegeben und das, was wir sehen, hören und spüren ist das, was sich uns von der Wirklichkeit mitteilt. Die Wissenschaften fragen unablässig: Was ist die Wirklichkeit? Schon die antiken Wissenschaften der alten Philosophen kannten das Streben nach Erkenntnis der Wirklichkeit als Kernpunkt. Erkenntnis der Wirklichkeit, wie sind die Dinge? Was ist WAHR? Die Wissenschaften helfen uns dabei. Sie sind Teil der Vernunft, dieser Veredelung des Menschen und Gefährtin auf dem Weg zur Wahrheit und wahren Freiheit. Der Mensch steht also auf dem Weg seines Lebens und sucht, oder besser sollte suchen. Und Helferin bei der Suche ist die Vernunft und unser Verstand, der uns vom Schöpfer gegeben wurde, wie wir als Christen wissen. Dieses Geschenk bringt uns weit voran auf dem Weg zur Freiheit, wenn wir es recht zu gebrauchen wissen. Der Herr will uns frei sehen, ganz frei von allem Zwang, ob wir ihn spüren mögen oder nicht. Das bedeutet, er will uns zur Wahrheit führen. Und darum hat der Herr uns auch ein zweites Geschenk in seiner Offenbarung gemacht: Sich selber und mit sich den Glauben, der die Vernunft nicht im Geringsten bedroht und schon gar nicht die Freiheit, die er erst zur Vollkommenheit führt. Erst durch das Annehmen beider Geschenke können wir zur endgültigen Freiheit in der Wahrheit finden. Die Wahrheit wird euch frei machen spricht Jesus im Johannes- Evangelium. Darin sehe ich einen Auftrag. Einen Auftrag zur Suche nach Wahrheit und letzten Endes nach Christus, der selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dieser Auftrag findet in unserer Scientia zutiefst das Verständnis, welches unsere Gründerväter davon besaßen, sogar so tief, dass sie die Scientia zu einem unserer Prinzipien machten. Aber wie es jedem der drei Prinzipien zu eigen ist: ohne die anderen zwei fehlen zwei Drittel. D. h. erst alle drei zusammen bilden die notwendige Einheit, denn die Scientia, so verstanden, führt uns zu einem Leben in echter Tugend und wahrer Freundschaft! Ich hoffe, ich konnte allen Anwesenden ein Stück weit die Augen für die Suche öffnen, auf der wir uns befinden, jeder in seinem Leben und jeder Student an seinem Schreibtisch! (Sciencia bedeutet Suche nach der Wahrheit und Auftrag Christi!) Der vorstehende Text wurde als Prinzipienrede bei der Exkneipe des WS 2014/15 der Unitas Rhenania Bonn gehalten. 136 unitas 2/2015
49 Das Header-Motiv der Verbandshomepage RUNDBRIEF 1/1946 ERZÄHLT VON DEN ANFÄNGEN Aufruf zur Schatzsuche erfolgreich KAARST / KARLSRUHE / MÜNCHEN. Papiermangel, Wiedererwachen unitarischer Arbeit, die Neubesinnung unitarischer Werte, aber auch die Reflexion über die Haarpracht junger Unitarier das und noch vieles mehr findet man in den unitas- Ausgaben, beginnend mit dem 1. Rundbrief 1946, die nach dem Aufruf zur Schatzsuche in unitas 1/2014 gefunden und digitalisiert werden konnten. Diesem Schatzsuche-Aufruf folgten viele Bundesbrüder, die gezielt nach den noch fehlenden Ausgaben in ihrem Archiv gegraben haben. Hierfür ein großes Dankeschön. Die historischen Kostbarkeiten konnten dank der erneuten Unterstützung von Bbr. Dietrich Hofmaier (AHV München) wieder in digitale Form inkl. hinterlegtem Volltext gebracht werden. Diesmal kam aufgrund der gebundenen Form der Ausgaben dazu sogar ein materialschonender Buchscanner zum Einsatz, der zusätzlichen manuellen Aufwand erforderte. Die digitalen Neuerfassungen wurden auf der Unitas- Homepage in die Lücken der bisher schon abrufbaren Ausgaben eingereiht und stehen dem interessierten Leser zum Download zur Verfügung. Das vom Internetbeauftragten, Bbr. Ingo Gabriel (AHV Franco-Alemannia) in Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats für Öffentlichkeitsarbeit, Bbr. Jonas Neckenich (AHV Franco-Alemannia) betreute Projekt konnte mit dem Einfügen der letzten fehlenden Ausgaben nun erfolgreich zu Ende gebracht werden. In Zeiten, wo die Online-Recherche zu einem wichtigen Werkzeug geworden ist, zeigt sich nun auch die Unitas auf einem modernen Stand und bietet historische Einsichten des Verbandsgeschehens zur freien Recherche. Bereits seit einigen Jahren werden die digitalen Druckdaten der jeweils aktuellen unitas-ausgabe auch direkt aus dem Erstellungsprozess abgeleitet und noch vor Verfügbarkeit der Druckausgabe dem Leser auf der Unitas-Homepage zur Verfügung gestellt. Mit der beschlossenen Übertragung des bisher in Eigenregie verwalteten Unitas-Verbandsarchivs in das Bundesarchiv erschließt sich demnächst ein weiterer Baustein für historische Recherchen zum Bild, Selbstverständnis und Außenwirkung des Unitas- Verbandes und seiner Vereine. Es sei allen Unterstützern des Digitalisierungsprojektes nochmals ein herzlicher Dank ausgesprochen. Allen voran Bundesbruder Dietrich Hofmaier für die Bereitstellung der Digitalisierungsdienste, den Münchner Bundesbrüdern für ihre ursprüngliche Initiative, Herrn Dr. Paul Gladen für die Erschließung der allerersten Rundbriefe, allen Bundesbrüdern, die mit ihren eigenen Ausgaben und der Recherche in ihrem Archiv zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. Ingo Gabriel, Internetbeauftragter des UV unitas 2/
50 AUS DEM VERBAND Von Köln nach Münster: Fuxenfahrt der Unitas Landshut KÖLN / MÜNSTER. Im vergangenen Wintersemester hat sich der fast vollständige Fuxenstall der Unitas Landshut mit dem RE7 auf dem Weg in die Stadt des Westfälischen Friedens gemacht. Die Landshuter wurden in der unitarischen Heimat ihres Fuxmajors herzlich empfangen. Nach einer kleinen Mahlzeit bekamen die Kölner von Aktiven der Unitas Winfridia Münster eine Hausführung durch das Dondersheim. Anschließend ging es zum Couleurbummel in Münsters berüchtigtes Kreuzviertel. An Allerheiligen wurde mit einer ausgiebigen Fuxenstunde über die Geschichte der Albertus Magnus Universität zu Köln und der Geschichte der Unitas in Straßburg und Köln in den Tag gestartet. Nachdem der Münsteraner Tatort Satisfaktion gesehen wurde, bekamen die Rheinländer eine Stadtführung von Bbr. Alt-VOP Roman Haupt und Bbr. Marius van den Boom durch die Stadt der Fahrräder. Der Ausklang des Abends fand dann bei westfälischen Spezialitäten in dem urigen Restaurant Drübbelken in Münsters Altstadt statt. An Allerseelen besuchte der Fuxenstall mit seinem Fuxmajor die hl. Messe im Paulusdom zu Münster, ehe sich alle zu einem leckeren Bier bei Stuhlmacher auf dem Prinzipalmarkt wiederfanden. Ich danke der Winfridia für die Gastfreundschaft und freue mich darüber, dass ein Besuch eurerseits in Köln im kommenden Sommersemester schon angekündigt ist. Semper in Unitate. Max Wienandts FM Unitas Landshut Köln Oldies but Goldies: Neuer AHV-X bei Unitas Winfridia MÜNSTER. Drei ehemalige und einen amtierenden Vorsitzenden des Altherrenvereins der Unitas Winfridia zeigt das Foto, das beim jüngsten Stiftungsfest des 1902 in Münster gegründeten Vereins entstanden ist. Im Rahmen eines Cumulativ-Conventes im Dondersheim hatten die Alten Herren am 27. November 2014 Dr. Michael Rauterkus v. Prinz (rechts) ab dem 1. Januar 2015 zum Nachfolger Marcus Baumann-Gretzas (2. von rechts) gewählt, der seit 2007 Vorsitzender gewesen war. Er hatte auf eine Wiederwahl verzichtet. Zu den Gratulanten des neuen Vorsitzenden gehörten auch Heinrich Kröger (links, Vorsitzender von 1990 bis 2000) und Hendrik Koors (2001 bis 2006). Klaus-Peter Lammert 138 unitas 2/2015
51 110 Semester: 55 Jahre Unitas Frankonia Eichstätt EICHSTÄTT. Seit nunmehr 55 Jahren steuert die Unitas mit ihrem Wissenschaftlich-Katholischen Profil etwas zum Leben an der KU und in ganz Eichstätt bei! Mit einem Gottesdienst zelebriert durch unseren Bbr. Prälat Dr. Christoph Kühn in der Borgia-Kapelle gedachte die Unitas Frankonia ihrer Gründung am 27. Januar Nach der Messe machte Bbr. Dr. Kühn den Aktiven die Ehre mit einem Besuch auf dem Haus. Er hatte sich Zeit genommen, den Vereinsmitgliedern in geselliger Runde von seinem Leben im Dienst der Weltkirche zu erzählen, der ihn über Rom, nach Afrika, Kuba und über den Rest der Welt schon wieder zurück nach Eichstätt geführt hat. Wie bereits in der Predigt ging er darauf ein, was es bedeutet, sein Leben als Christ am Willen Gottes auszurichten und als Unitarier seine Lebensprinzipien in die Welt zu tragen. Hierbei bedanken wir uns auch herzlich bei allen, die uns über die vielen Jahre hinweg so treu begleitet haben, denn dort wo Menschen sich gegenseitig beistehen blüht das, was der Verein mit seinem sozialethischen Engagement anstrebt: Tugend Freundschaft Wissenschaft! Wissenschaftliche Sitzung: Sozialstaat Deutschland AACHEN. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, heißt es in Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes, geschützt durch die Ewigkeitsklausel. Seinen Anfang nahm der Sozialstaat aber nicht erst 1949 mit Inkrafttreten des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, sondern weitaus früher, wie Referent Bbr. Tillmann Peitzmeier Ende Januar 2015 bei einer Wissenschaftlichen Sitzung bei Unitas Assindia Aachen betonte. So gab es bereits in der Antike und im Mittelalter Bestrebungen, die Kluft zwischen Arm und Reich zu überbrücken, freilich zuvörderst, um Unruhen und Aufständen vorzubeugen. Eine Weiterentwicklung erfuhr die staatliche Umverteilung bedingt durch die Massenarbeitslosigkeit im 19. Jahrhundert. Ab 1883 führte Reichskanzler Otto von Bismarck die Renten-, Kranken- und Unfallversicherungen ein als Zugeständnisse an die Bevölkerung und zur Schwächung von Gewerkschaften und kirchlichen Arbeiterverbänden, die eigene Versicherungen entwickelt hatten. Weitere Versicherungen kamen 1911 mit der Angestelltenversicherung und 1927 mit der Arbeitslosenversicherung hinzu. Eine Verstärkung der sozialen Leistungen erfuhr das Nachkriegsdeutschland durch von den Besatzungsmächten bereitgestelltes Geld wurde die gesetzliche Rentenversicherung durch eine Umstellung auf ein umlagebasiertes Rentensystem reformiert. Im Jahr 1995 kam hervorgerufen durch den Wandel der Bevölkerungsstruktur die Pflegeversicherung hinzu. Im Alltag beträfen uns Studierende heute die sozialstaatlich motivierten Regelungen des Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und des Mietrechts, stellte Bbr. Peitzmeier fest. In der Sozialen Marktwirtschaft, die auf den Ökonom Armin Müller-Armack zurückgeht und von Ludwig Erhard wirtschaftspolitisch umgesetzt wurde, sieht Bbr. Peitzmeier die wirtschaftliche Bedeutung des Sozialstaatgedankens. Die Veränderung der Sozialstruktur, ausgelöst durch den Wandel der demografischen Struktur der Bundesrepublik Deutschland, und eine erhöhte Arbeitslosigkeit durch nachlassendes Wirtschaftswachstum seien die Ursachen für eine Krise des Sozialstaats zur Jahrtausendwende. Auf diese Krise sei durch höhere Investitionen in Bildung, die Förderung von Teilzeitarbeit und Maßnahmen zur Steigerung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie reagiert worden. Den Anschluss an die lehrreichen Ausführungen von Bbr. Tillmann Peitzmeier bildete eine Diskussion zu den Risiken, die ein Staat birgt, der bestrebt ist, die wirtschaftliche Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und soziale Gegensätze innerhalb der Gesellschaft auszugleichen (Duden). Zudem wurden Vorund Nachteile der umlagebasierten Rentenversicherung gegenüber dem Kapitaldeckungsverfahren erörtert. Johannes Schäfer >> unitas 2/
52 Winterball in Frankfurt VON KONSTANZE JENDEREK FRANKFURT AM MAIN. Rot leuchtet der lange Teppich vor der Villa Bonn, über den zahlreiche Pärchen am Abend des ersten Februarsamstags spazieren. Hier empfängt die Unitas Rheno Moenania ihre Mitglieder und deren Freunde zum traditionellen Winterball des Frankfurter Zirkels der Unitas und des Frankfurter Bundestages des KV. Die Veranstaltung läuft seit vielen Generationen im traditionellen Rahmen. Wir sind einer der wenigen Verbände, die noch einen Winterball durchführen, erläutert Bbr. Carl von Papen, Vorsitzender des Altherrenzirkels Frankfurt. Am traditionellen Veranstaltungsort, der Villa Bonn, gibt es eine besonders elegante, heimelige Atmosphäre. Zentral im Westend Frankfurts gelegen, benötigen Gäste nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof. Die Kaufmannsvilla aus dem 19. Jahrhundert beherbergt mehrere Räume, die für die Tanzveranstaltung vielfältig genutzt werden. So bewegt sich die Festgemeinschaft nach dem Sektempfang im Kaminsaal für das gemeinsame Essen in den so genannten Salon, erklärt Bbr. von Papen: Zum klassischen Winterball gehört immer ein gutes Essen, das wir in einem ausgewählten Drei- Gänge-Menü auftischen. Damit es jeweils eine interessante und ausgewogene Tischordnung gibt, hat er Tischrunden von sechs bis acht Personen erstellt und Wünsche bei Anmeldung berücksichtigt. Vor dem Salon steht auf Augenhöhe ein Sitzplan, der Orientierung zur Platzordnung gibt. Auf den runden Tischen stehen stilvolle Blumengestecke sowohl in Rot-Weiß als auch in den unitarischen Farben Blau-Weiß-Gold. Die geschmackvolle Innenarchitektur mit hohen Decken, prunkvollen Leuchtern inmitten des Stucks passt zum ebenfalls geschmackvollen Menü. Die langen gelben Vorhänge vor hohen Fenstern mit verspielten Spiegeln dazwischen verbreiten eine freundliche Atmosphäre. Nach der Stärkung betritt die Gesellschaft erneut den Kaminsaal. Die Raumdecke reicht bis in den ersten Stock, sodass eine ausgezeichnete Akustik fürs Tanzen entsteht. Der Kamin und eine Bar unter der Treppe verbreiten ein behagliches Flair. Hier schweben die Paare zu langsamen Walzer, Foxtrott, Rumba, Cha Cha Cha und vielem mehr über den glatten Parkettboden. Eine Liveband spielt sämtliche lateinamerikanischen Tänze. Der Ball ist für alle gedacht, die in einem Ambiente mit besonderem Stil gerne einen lustigen Abend verbringen wollen. Anfänger, aber auch Profitänzern erobern die Tanzfläche. Für eine kurze oder lange Pause bieten die runden Tische im Nebensalon eine ruhige Atmosphäre. Hier führen die Gäste Gespräche, genießen ein erfrischendes Getränk und lassen den Abend etwas ruhiger angehen. Natürlich sorgt die Kleiderordnung auf dem Ball für Eleganz und Augenschmaus: Da wir das in der klassischen, alten Tradition der Winterbälle fortführen möchten, bitten wir die männlichen Gäste im dunklen Anzug beziehungsweise Smoking zu kommen, die Damen entsprechend in einem schönen Abend- beziehungsweise Ballkleid. Insgesamt besuchen 55 Personen die Veranstaltung, davon 36 Unitarier. Für Carl von Papen leider ein bisschen wenig: Die ideale Besetzung wäre, wenn wir auf 80 Teilnehmer kämen. Dann wäre der Salon schön belegt und es könnte gewährleistet werden, dass die Tradition dieses Balles weiter fortgeführt würde. Es wäre wunderschön, wenn junge Alte Herren mit ihren Frauen und gerne auch Freunden und Familienangehörigen es wieder als einmalige und sehr schöne Gelegenheit sehen würden, mal etwas Besonderes zu erleben. Wir freuen uns insbesondere, wenn Unitarier aus anderen Städten und Orten den Weg zu uns finden. Die zentrale Lage Frankfurts lädt dazu ein. Da der Ball jedes Jahr am ersten Samstag im Februar stattfindet, bietet sich das Event auch als Weihnachtsgeschenk an, als guter tänzerischer und einfach geselliger Vorsatz fürs neue Jahr oder ganz romantisch als bestimmte Geste mit Blick auf den Valentinstag. Im nächsten Jahr wird der Winterball am Samstag, den 6. Februar 2016 stattfinden. Informationen gibt es ganzjährig beim Altherrenzirkelvorsitzenden Carl von Papen Die Einladungen werden Anfang Dezember verschickt. 140 unitas 2/2015
53 Unitas Westpokal 2015: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel AACHEN. Der liebgewonnenen Tradition folgend, fand der diesjährige Unitas Westpokal am 24. Januar 2015 in der schönen Kaiserstadt zu Aachen statt. Von der neu gestifteten Trophäe gelockt, machten sich Teams von Rhenania, Ruhrania, Reichenstein und Assindia auf in einen heiß umkämpftes Turnier. Die Teams wurden vereinzelt mit erfahrenen Alten Herren verstärkt, die für die notwendige Sicherheit und Abgebrühtheit im Abschluss sorgen sollten. Von der ersten Spielminute an waren die Trainingsbemühungen aller Mannschaften klar erkennbar, nichts sollte hier dem Zufall überlassen werden. Das technische Niveau wurde dadurch im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert. Ähnlich wie auch in den letzten zwei Jahren kristallisierte sich zum Ende der Rückrunde ein Zweikampf zwischen Reichenstein und Assindia heraus, aus dem die Assindia siegreich hervorging. Besonders die stark besetzte Ersatzbank des Titelverteidigers schien dabei ein Garant für den Sieg zu sein. Folglich erreichte die Reichenstein einen respektablen zweiten Platz, gefolgt von dem gemischten Team der Ruhrania, die zur Verstärkung auch turniererfahrene AHAH aus Köln und Bonn in ihren Reihen zählte. Schlusslicht bildete die Rhenania, die mit ihrem jungen Team jedoch Hoffnung für die kommenden Jahre gemacht hat. Das sportliche Großevent fand seine Abrundung bei der anschließenden Stadionwurst mit Semmeln und feinem Kartoffelsalat auf dem Unitas Haus in der Försterstraße. Der kühle Gerstensaft schmeckt uns an solchen Tagen natürlich besonders gut, bekannte ein Turnierteilnehmer in freudiger Erwartung des nächsten UV-Westpokals. Denn wie sagte schon Sepp Herberger: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Kommentar Malte Sievers v/o Scarface (Kapitän Assindia): Ich bin sehr zufrieden mit der sportlichen Leistung meiner Mannschaft. Wir haben das Selbstbewusstsein des letzten Titels bewahrt und haben von der ersten Minute an nichts anbrennen lassen. Aus einer sicheren Defensive heraus konnten wir gerade auch durch unsere Neuverpflichtungen viel Druck auf den Gegner ausüben und ihn so zu Fehlern zwingen. Malte Sievers Neues von der Unitas Rheinfranken in Düsseldorf DÜSSELDORF. Die unitarische Familie in Düsseldorf lädt am Sonntag, 14. Juni, zum Vereinsfest mit Messe um Uhr in St. Aldegundis, Pampusstraße, Kaarst-Büttgen. Ab 13 Uhr steigt anschließend ein Grillfest bei Bbr. Sebastian Johnen, Am Mühlenweg 4, Kaarst-Büttgen. Dass Alt und Jung in der Region stadtübergreifend zusammenarbeiten, zeigt das aktuelle Semesterprogramm: So gibt es am 15. Mai einen Ausflug des AHZ Ratingen zum Dicken Turm mit Führung, Bsr. Brigitte Mehler referiert am 21. Mai bei einer WS zusammen mit dem AHZ Düsseldorf im Restaurant Maredo über Shakespeare in love. Auch ist unter anderem am 22. August ein Familienausflug der AHZ Düsseldorf und Neuss nach Andernach geplant. Am 15. Oktober steht eine Pilger-Fahrt zum Marienwallfahrtsort Kevelaer mit Teilnahme am Hochamt um 10 Uhr in der Basilika und an der Abschlussandacht um Uhr in St. Antonius auf dem Programm. Anmeldung und weitere Informationen bei Bbr. Rüdiger Duckheim oder per bis 11. Oktober. Soweit nicht besonders angegeben, finden Veranstaltungen im Schumacher im Domhof (Germaniastr. 42, Düsseldorf-Bilk) statt. An jedem 3. Donnerstag im Monat trifft sich der Stammtisch des AHZ Düsseldorf im Maredo, Graf- Adolf-Str , Düsseldorf-Mitte, ab Uhr. Kontakt: Bbr. Dipl.-Ing. Jens Hagenkötter, Tel , Nicolaiweg 9, Kamen, oder Bbr. Dipl.- Volksw. Rainer Betten, Geibelstr. 16, Düsseldorf, Tel , Alle Bundesbrüder rund um die NRW- Landeshauptstadt sind zu allen Treffen herzlich eingeladen! unitas 2/
54 PERSONALIA Kardinal Marx behält Vorsitz der EU-Bischöfe BRÜSSEL / MÜNCHEN. BBR. REINHARD KARDINAL MARX (61), SEIT 2007 ERZBISCHOF VON MÜNCHEN UND FREISING, BLEIBT WEITER PRÄSIDENT DER EU-BISCHOFSKOMMISSION COMECE. Die Vertreter der Bischofskonferenzen aus den 28 EU-Mitgliedstaaten bestätigten Bbr. Marx bei ihrer dreitägigen Frühjahrsvollversammlung am 19. März in Brüssel für eine weitere Amtszeit als Vorsitzender bis zum Jahr Marx, der zugleich Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und seit 2013 europäisches Mitglied der Kardinalskommission zur Reform der römischen Kurie (K9) ist, steht seit 2012 an der Spitze der EU-Bischofskommission. Die COMECE wird von einem Sekretariat in Brüssel unter der Leitung von Generalsekretär Patrick Daly unterstützt. Zur Seite stehen Marx künftig nur noch zwei Vizepräsidenten: Jean Kockerols (56), Weihbischof in Mechelen-Brüssel, der wie auch Bischof Gianni Ambrosio (71) von Piacenza-Bobbio erneut im Amt bestätigt wurde. Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Norbert Trelle, hat dem aus dem westfälischen Geseke stammenden Kardinal in einem Glückwunschschreiben zur Wahl gratuliert. Die Deutsche Bischofskonferenz freut sich, dass ihr Vorsitzender für weitere drei Jahre die Geschicke der COMECE leiten wird. Gerade das Brüsseler Pflaster ist sicherlich nicht einfach und die Herausforderungen für die COMECE sind vielfältig, so Bischof Trelle. Dennoch sei es gerade Kardinal Marx in den vergangenen Jahren gelungen, mit klaren Positionen die COMECE als Stimme der katholischen Kirche in Europa sicht- und hörbar zu machen: Dabei denke ich an Deine guten Kontakte zu den politischen Spitzenvertretern der Europäischen Union, aber auch Deinen Einsatz, wenn es um ethische Debatten oder historische Erinnerung geht wie vor einigen Monaten beim Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wir sind Dir dankbar für Dein vielfältiges und selbstloses Engagement auf so vielen Ebenen, schreibt Bischof Trelle. Für Kardinal Marx ist es seine zweite Amtszeit: Er war von 2009 bis 2012 COMECE-Vizepräsident und seit 2006 deutscher Vertreter in dem Bischofsgremium. Mit seiner erneuten Wahl führt er die deutsche Prägung der COMECE fort: Von den bislang sechs Vorsitzenden kamen drei aus Deutschland: außer Marx der Gründungspräsident und Bischof von Essen, Franz Hengsbach ( ), sowie Bischof Josef Homeyer von Hildesheim ( ). Seine Rolle in der vatikanischen Kurienreform wurde im vergangenen Jahr unterstrichen, als ihm Papst Franziskus die Koordination des neu geschaffenen vatikanischen Wirtschaftsrates übertrug. Bei der Frühjahrsvollversammlung der COMECE stand das neue Arbeitsprogramm der EU-Kommission im Mittelpunkt der Beratungen. Dazu trafen sich die Bischöfe zu einem Austausch mit dem Kommissionspräsidenten der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker, und dem EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Die politische Agenda der EU sozialethisch, kritisch und positiv zu begleiten, sieht Marx als wichtigste Aufgabe der COMECE: Vor allem die Frage nach den europäischen Werten muss künftig stärker in den Mittelpunkt der Debatten kommen, damit Europa auch vor dem Hintergrund der Krisen stärker zusammenwächst, so Marx. Dabei wolle die COMECE ein Bild Europas befördern, das die Einheit des Kontinents mit einer gemeinsamen Idee versehe: Wir sollten als Kirche eher die Promotoren einer positiven europäischen Einigung sein und nicht die Bedenkenträger, betont Marx. In den Bemühungen, der Kirche in Brüssel weiter eine starke Stimme zu geben, fordert die COMECE unter seiner Leitung bei den Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) zur Einigung auf eine nachhaltige Handels- und Wirtschaftsstrategie auf.ttip müsse einen Beitrag für eine Weltordnungspolitik leisten und dürfe nicht zu stärkerer Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich führen. Ein Positionspapier der EU-Bischöfe zu TTIP, das den Abgeordneten des EU- Parlaments übergeben werden soll, sei in Arbeit, es werde auch erwogen, mit den US-amerikanischen Bischöfen über die mit TTIP zusammenhängenden Fragen zu sprechen. In seiner kommenden dreijährigen Mandatsperiode will Bbr. Marx vor allem den Dialog der Kirchen mit der EU-Politik voranbringen: Wir spüren, dass die Religion immer wichtiger wird in Europa, auch bei den Diskussionen im Parlament. Migration, Asyl, Klima, Friedenspolitik seien dabei nur einige Themen, zu denen die COMECE Stellung nehmen könne. Die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft war im Zuge der ersten Direktwahlen zum Europaparlament 1979 entstanden. Ihre Konstruktion als Verbindungsstelle zur EU-Politik ist vergleichbar mit den Katholischen Büros in Deutschland. Unter Kommissionspräsident Jacques Delors ( ) entstand ein zunehmend institutionalisierter Dialog zwischen der EU und den Religionsgemeinschaften. In den EU- Verträgen von Amsterdam 1997 und Lissabon 2009 konnten die Kirchen ihre Rechtsstellung in den Mitgliedstaaten sichern legte die COMECE unter Federführung von Bbr. Marx ein Dokument vor, das die EU auffordert, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft zu einer internationalen Solidaritäts- und Verantwortungsgemeinschaft weiterzuentwickeln. 142 unitas 2/2015
55 lat ) und Apostolischer Protonotar ( Prälat ). Seit 1989 ist Bbr. Michael Hofmann B-Philister der Unitas Franko-Palatia und häufiger Gast bei den monatlichen Stammtischen. Er unterstützt die Nürnberger Unitas regelmäßig als Zelebrant bei den Gottesdiensten zu den Vereinsfesten oder den Semesterkneipen und war schon mehrmals als Festredner aktiv. Franz Schwengler, Nürnberg Goldenes Priesterjubiläum von Bbr. Dr. Michael Hofmann FÜRTH. Bundesbruder Prälat Dr. Michael Hofmann feierte am 7. März 2015 in der Fürther Pfarrkirche Sankt Heinrich mit einem festlichen Dankgottesdienst sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Gleich zu Beginn der Eucharistiefeier, an der mehr als zwanzig Konzelebranten aus Nah und Fern, viele Messdiener und ein Chargenteam der Unitas Franko-Palatia Nürnberg et Erlangen teilnahmen, begrüßte der Jubilar zahlreiche Weggefährten, Freunde, Angehörige und über 200 Gemeindemitglieder. Begonnen hatte der 77-Jährige die Messfeier mit einem kurzen Rückblick und dem Hinweis, dass am 7. März 1965 für die Katholische Kirche in Deutschland eine neue Epoche begann. Damit meinte der Jubilar allerdings nicht seine Weihe zum Priester, sondern die erstmalige Möglichkeit eine Heilige Messe in der Landessprache zu feiern. Der festliche Charakter der Messe wurde durch die Singeinlagen des Kirchenchores verstärkt. Die Predigt hat Weihbischof Herwig Gössl vorgetragen, der in Nürnberg aufgewachsen ist und extra aus Bamberg anreiste. Vor einem Jahr wurde er von Papst Franziskus zum Weihbischof im Erzbistum Bamberg ernannt. Nach dem Festgottesdienst waren alle Gemeindemitglieder und Gäste herzlich zu einem Empfang im Pfarrzentrum eingeladen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Jubilars sollten keine Reden gehalten werden. Nur der Gemeindepfarrer Norbert Geyer durfte ein kurzes Grußwort sprechen. Bundesbruder Erzbischof Ludwig Schick hat zum 50-jährigen Priesterjubiläum Glück- und Segenswünsche übermittelt. Bbr. Michael Hofmann wurde 1937 in Bamberg geboren. Während seines Theologie-Studiums wurde er am 01. Juni 1957 bei der damaligen Unitas St. Heinrich in Bamberg recipiert. Im November 1974 promovierte er in Regensburg beim späteren Papst Benedikt XVI., Prof. Dr. Joseph Ratzinger. Von 1977 bis 1989 war er als Regens des Priesterseminars Bamberg für die Ausbildung der angehenden Priester in der Erzdiözese Bamberg verantwortlich. Bereits 1989 wurde Michael Hofmann von Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel der Ehrentitel Erzbischöflicher Geistlicher Rat verliehen, 1997 folgte zunächst die Ernennung zum Päpstlichen Kaplan durch Papst Johannes Paul II. und 2008 die päpstliche Auszeichnung des Ehrenprälaten. In der Katholischen Kirche gibt es drei Päpstliche Ehrentitel, die vom Papst verliehen werden: Päpstlicher Ehrenkaplan (Anrede: Monsignore ), Päpstlicher Ehrenprälat ( Prä- Bbr. Prof. Zmijewski: Goldenes Priesterjubiläum FULDA. Bundesbruder Prälat Prof. Dr. Josef Zmijewski konnte am 11. Februar 2015 sein goldenes Priesterjubiläum feiern. Bundesbruder Prof. Zmijewski wurde am 23. Dezember 1940 in Essen geboren. Nach seinem Abitur studierte er in Bonn, Freiburg und Köln Philosophie und Theologie. Nach seiner Priesterweihe durch Kardinal Joseph Frings im Jahr 1965 war er an verschiedenen Seelsorgestellen in Düsseldorf, Bad Godesberg und Bonn tätig. Nach seiner Promotion im Juni 1972 ging er als wissenschaftlicher Assistent an die Bonner Universität habilitierte sich Bundesbruder Zmijewski und wurde im April 1980 zum Ordentlichen Professor für Neutestamentliche Exegese, Neutestamentliche Einleitungswissenschaft sowie Bibel- >> unitas 2/
56 griechisch an der Theologischen Fakultät in Fulda ernannt. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit war Bundesbruder Zmijewski von 1995 bis 2004 Prior der Fuldaer Komturei des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem und von 2004 bis 2012 Provinzprior des Ordens. Im März 2002 erfolgte seine Ernennung zum Ehrendomkapitular an der Kathedralkirche im Lomza (Polen) in Anerkennung seiner Verdienste um die Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Kirche. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 2003 zum Päpstlichen Ehrenprälaten und Bischof H. J. Algermissen berief ihn 2005 zum Ehrendomkapitular der Fuldaer Kathedralkirche. Nach seiner Emeritierung im Jahr 2006 nimmt Bundesbruder Zmijewski zahlreiche Seelsorgetätigkeiten wahr, unter anderem im Dom zu Fulda. Weiterhin wurde Bundesbruder Zmijewski bekannt durch seine zahlreichen theologischen und geistlichen Veröffentlichungen. Die Bundesschwestern und Bundesbrüder des Altherrenzirkels UNITAS Fulda gratulieren ihrem Bundesbruder sehr herzlich und wünschen ihm noch viele weitere Jahre priesterlichen Wirkens. Altherrenzirkel UNITAS Fulda Ulrich Frei Zum 70. Geburtstag von Bbr. Prof. Zmijewski erschien unter dem Titel In Hoffnung unterwegs. Betrachtungen zum Kirchenjahr eine Festgabe, in der Verkündigungstexte des Neutestamentlers gesammelt sind, die im Hessischen Rundfunk gesendet wurden. Die mit Bildern des Fuldaer Künstlers Norbert Gehring zu Motiven aus der Offenbarung des Johannes illustrierten Texte verweisen auf Jesus Christus als Hoffnung und Wegbegleiter der Menschen. Josef Zmijewski, In Hoffnung unterwegs. Betrachtungen zum Kirchenjahr, herausgegeben von Winfried Engel zum 70. Geburtstag des Autors mit Bildern von Norbert Gehring, Fulda, Parzellers Buchverlag, 2010, ISBN , 14,90 Euro. Kirchenhistoriker Bbr. Gabriel Adrianyi 80 Jahre BUDAPEST/BONN. Bbr. Gabriel Adrianyi, emeritierter Kirchenhistoriker der Universität Bonn, hat am 31. März sein 80. Lebensjahr vollendet. Von 1976 bis 2000 war Adrianyi, der 1981 bei Unitas Rhenania in Bonn philistriert wurde, dort Ordinarius für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte. Seit seiner Emeritierung lebt er in Budapest und in Königswinter bei Bonn. Geboren am 31. März 1935 im westungarischen Nagykanizsa, besuchte Gabriel Friedrich Michael Georg Adriányi das Piaristengymnasiums in Veszprém und studierte nach dem Abitur 1954 in Budapest als Priesteramtskandidat der Diözese Veszprém Theologie an der Katholisch-Theologischen Akademie in Budapest. Dabei weigerte er sich nach dem ungarischen Volksaufstand von 1956, sich der regimetreuen kommunistischen Friedenspriesterbewegung anzuschließen. Auf Weisung des Staatskirchenamtes wurde er 1959 des Seminars verwiesen und am 2. April 1960 geheim zum Priester geweiht. Nach abenteuerlicher Flucht vor drohender Verhaftung floh er noch vor dem Mauerbau im Juni 1961 aus der Volksrepublik Ungarn über Leipzig nach Westberlin, wo ihn der damalige Kardinal Julius Döpfner herzlich empfing. Niemandem erzählte er davon auch nicht seinen Eltern, um sie nicht zu kompromittieren oder zu gefährden. Ab 1961 setzte er am Angelicum in Rom sein Theologiestudium fort und wurde 1963 promoviert. Die St.-Stephans-Basilika, eingeweiht 1905, ist die größte Kirche der ungarischen Hauptstadt Budapest und Konkathedrale des Erzbistums Esztergom-Budapest. Unter den vielen Reliquien der Kirche ist die Heilige Rechte, die einbalsamierte rechte Hand König Stephans in jedem Jahr am 20. August, dem Fest des heiligen Stephan, Ziel von Tausenden Gläubigen. Von 1963 bis 1966 war er als Kaplan in Ransbach in der Diözese Limburg als Gemeindeseelsorger tätig erhielt er als Volksdeutscher die deutsche Staatsbürgerschaft, war Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von 1968 bis 1972 Religionslehrer in Köln. Zugleich bereitete er seine Habilitation bei Bernhard Stasiewski in Bonn vor, die 1971 erfolgte. Anschließend war Bbr. Adrianyi ab 1972 Assistent, ab 1974 Dozent an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Bonn und wurde dort 1976 als Nachfolger von Stasiewski, Eduard Hegel und Bbr. Wilhelm Neuß zum ordentlichen Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte mit Einschluss der Kirchengeschichte Osteuropas berufen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählte neben der ungarischen Kirchen- und Konziliengeschichte auch die sogenannte vatikanische Ostpolitik der 60er und 70er Jahre. Kritisch setzte er sich mit der Haltung des Heiligen Stuhls gegenüber den kommunistischen Regimen Mittelund Osteuropas auseinander und monierte, die widerständigen Katholiken in diesen Ländern würden im Stich gelassen. Von 1974 bis unitas 2/2015
57 war er unter anderem auch Mitglied der Auslandskommission der Universität und betreute für die Fakultät die Kooperationen mit den Universitäten Warschau und Toulouse. Ab 1975 war Bbr. Gabriel Adrianyi Mitglied und Leiter der Senatskommission für das Studium der deutschen Kultur und Geschichte im Osten, Mitglied des Konvents der Universität und Dekan der Fakultät. Seit 1999 ist Bbr. Adrianyi außerordentlicher Professor für Neuere und Neueste Geschichte Ungarns an der Loránd-Eötvös- Universität in der ungarischen Hauptstadt Budapest, zudem hat er einen Forschungsauftrag zur Geschichte der Synoden in Ungarn. Im Jahr 2000 wurde er in Bonn emeritiert. Adrianyi erhielt in seinem Heimatland zahlreiche Auszeichnungen wurde er Ehrendomkapitular der Erzdiözese Veszprém, 1991 Chevalier des Ordens Palmes academiques und ist 1996 mit dem Ehrendoktor der Katholischen Universität Warschau gewürdigt worden. Seit 2003 ist er Korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, war 2005 Träger des Fraknói-Preises (Historikerpreis) des ungarischen Staates und wurde 2006 zum Ehrenmitglied der Internationalen Ungarischen Philologischen Gesellschaft ernannt. Im gleichen Jahr ist Bbr. Adrianyi durch den ungarischen Staatspräsidenten mit der Gedenkmedaille Held der Freiheit für die Teilnahme am Ungarischen Volksaufstand 1956 ausgezeichnet worden. Dem Mitherausgeber des Ungarn-Jahrbuches, Herausgeber der Buchreihe Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae und fruchtbaren Autor sind zwei Festschriften gewidmet worden, die eine ausführliche Bibliografie ausweisen (Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen, Köln 2000; Kirche und Gesellschaft im Wandel der Zeiten, Nordhausen 2012). Erst viele Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erfuhr er, wie sehr das kommunistische Spitzelsystem bis in seine eigene Biografie hineingewirkt hatte: Mitte Januar 2012 bekannte er öffentlich in Köln, dass er bei der Sichtung seiner Stasi-Akte in Ungarn 2007 seinen eigenen Vater als Informanten entdecken musste, einen angesehenen, großbürgerlichen Rechtsanwalt aus der Zips, der selbst über längere Zeit in kommunistischer Haft gesessen hatte. CB Auszeichnung für Dr. Baldur Hermans ESSEN /JERUSALEM. Bbr. Dr. Baldur Hermans (Unitas Stolzenfels Bonn) ist am 24. Januar 2015 in Jerusalem mit dem Ehrenzeichen vom Heiligen Grab in Gold ausgezeichnet worden. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Fouad Twal, überreichte die Auszeichnung und dankte für das langjährige soziale, pädagogische und kirchliche Engagement des Esseners in Palästina, Israel und Jordanien. Seitdem Bbr. Hermans 1949 bei den Salesianern Don Boscos in Essen- Borbeck zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) fand, blieb er in vielen Funktionen der Pfadfinderidee verbunden. Der promovierte Historiker, im Bistum Essen ab 1970 Leiter des Bischöflichen Jugendamtes und bis 2004 als Dezernent für gesellschaftliche und weltkirchliche Aufgaben tätig, war Auslandsbeauftragter der DPSG wurde er vom Weltkomitee der Pfadfinder für seine Verdienste mit dem Bronzewolf ausgezeichnet, die DPSG ehrte ihn durch ihre höchste Auszeichnung mit der St. Georgsmedaille hatte Baldur Hermans die ehrenamtliche Aufgabe des Generalsekretärs der Internationalen Katholischen Konferenz des Pfadfindertums (CICS) mit Sitz in Rom übernommen. Mehrfach im Amt bestätigt, stand er bis 2011 an der Spitze dieses Zusammenschlusses von weltweit mehr als 70 nationalen katholischen Pfadfinderorganisationen in Europa, Afrika, Amerika und Asien/Pazifik. Auch hier setzte er sich intensiv für die grenzüberschreitende Kooperation der Pfadfinder ein, für den Aufbau neuer Verbände in Osteuropa, initiierte Partnerschaftsprojekte mit Organisationen in Afrika und Lateinamerika, nicht zuletzt auch mit arabischen Gruppen in Israel und Jordanien wurde dieses Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt. In der Idee der Pfadfinder stecken zutiefst christliche Werte, erklärte Bbr. Baldur Hermans anlässlich der Auszeichnung im Interview mit dem Nachrichtenbüro des Lateinischen Patriarchats. Es gehe um die wichtige Erfahrung des Lebens in Gemeinschaft, in der Verbindung mit der Natur, um die Entwicklung von Kreativität und das Verständnis für unterschiedliche Kulturen und Traditionen: Nicht zuletzt ist es eben das Tun, das Handeln, für die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung, die hier eingeübt werden. Mehr noch als viele politische Bemühungen trage die ganz praktische Begegnung auf der menschlichen Ebene entscheidend zum Frieden bei, betonte Hermans mit Blick auf die angespannte Lage im Nahen Osten. Baldur Hermans, Jahrgang 1938, gebürtiger Niederländer und aufgewachsen in Essen-Borbeck, ist Autor und Herausgeber einer Vielzahl von Aufsätzen und Büchern. Zuletzt erschien unter seiner Herausgeberschaft u. a. der Band Die Säkularisation im Ruhrgebiet. Ein gewalttätiges Friedensgeschäft. Vorgeschichte und Folgen (Mülheim an der Ruhr 2004). Hermans hatte sich am 13. Juni 1961 bei UNITAS Stolzenfels in Bonn der UNITAS angeschlossen und war 1973 philistriert worden. CB >> unitas 2/
58 1975 berief Joseph Kardinal Höffner den promovierten Erziehungswissenschaftler zum Direktor des Theologenkonvikts Albertinum in Bonn. Von 1983 bis 2000 leitete Vogt den Kölner Caritasverband, anschließend wurde er zum Leiter des Katholischen Büros in Düsseldorf bestellt, der Kontaktstelle der NRW-Bistümer zur Landesregierung, Parteien und Landesbehörden. Im August 2012 wurde Prälat Dr. Karl-Heinz Vogt als engagierter Vermittler zwischen Kirche und Politik durch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit dem Landesverdienstorden von Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Noch heute ist das langjährige Mitglied im Rundfunkrat des WDR Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Gremien kirchlich-caritativer Einrichtungen und Stiftungen, u. a. aktiv im Förderverein des Therapiezentrums für Folteropfer. Statt Geschenken zum Jubiläum bat er um Spenden für die Aktion Prim ( Priester helfen einander in der Mission ). Die von dem Aachener Priester Heinrich Hillers gegründete Initiative unterstützt jährlich rund Priester in Entwicklungsländern mit Zuschüssen zum Lebensunterhalt. CB Vormerken muss man sich jetzt schon Pfingstsamstag 2016: An diesem Tag soll die festliche Priesterweihe von Bbr. Gabor Kant, ebenfalls im Hamburger Mariendom stattfinden. Bis dahin wird Bbr. Kant sich nun mit seelsorgerischen Tätigkeiten in einer Pfarrei am östlichsten Zipfel des flächenmäßig größten Erzbistums Deutschlands befassen, im mecklenburgischen Neubrandenburg (zw. Berlin und Stralsund). Matthias Sacher Bbr. Prälat Dr. Vogt vor 50 Jahren zum Priester geweiht KÖLN. Sein Goldenes Priesterjubiläum feierte am 21. Februar Bbr. Dr. Karl- Heinz Vogt in der St. Dreikönigen- Kirche in Köln-Bickendorf. Seit 2010 ist er in der Gemeinde nach vielen beruflichen Stationen als Subsidiar tätig. 32 Jahre pendelte er von dort aus zu seinen Dienststellen als Sohn eines Schneidermeisters im niederländischen Maastricht geboren, wuchs Bbr. Vogt seit dem sechsten Lebensjahr im rheinischen Porz auf. Während seines Theologiestudiums in Münster und Bonn schloss er sich erst der UNITAS Winfridia und dann der UNITAS Stolzenfels an wurde er zum Priester geweiht. Bbr. Gabor Kant zum Diakon geweiht HAMBURG. Zwei Weihen in zwei Wochen in Hamburg, das könnte gerne so weitergehen, so eröffnete der neue Erzbischof von Hamburg, Dr. Stefan Heße, eine Woche nach seiner eigenen Bischofsweihe die Diakonenweihe von zwei mitteljungen Männern am 21. März in der schönen Freien Hansestadt. Einer davon, Bbr. Gábor Marian Kant, seinerzeit Aktiver der ersten Stunde in der neu gegründeten Aktivitas in Erfurt. Nun, nach einer stattlichen Anzahl von erfolgreichen Berufsjahren in der freien Wirtschaft Hamburgs, kam es zur Professionalisierung seines seinerzeitigen Theologiestudiums, die Weihe zum Diakon. Mit dabei zahlreiche Bundesbrüder, vor allem aus Erfurt und Hamburg, die chargierend den vollbesetzten Hamburger Dom mit blau-weiß-goldenen Fahnen würdevoll bereicherten. Für beide diasporagewöhnten Vereine ein seltenes Ereignis, das mit Stolz erfüllte. In seiner Homilie machte Hamburgs Bischof Stefan zudem deutlich, dass von Gott berührt zu werden keine Frage eines Alters sei und dass die lebenserfahrenen Diakone auch in ihrem Alter von gut 50 Jahren auf Grund ihrer Lebenserfahrung sich in die Seelsorge gut einbringen können werden. Fotos u. a.: Bbr. Fritjof Kelber, Unitas- Zirkelvorsitzender in Hamburg 146 unitas 2/2015
59 Herausragende Masterarbeit ausgezeichnet INFINEON-MASTER-AWARD 2014" FÜR SEBASTIAN ENGELNKEMPER MÜNSTER. Alt-VOS Bbr. Sebastian Engelnkemper (Vorort Unitas Winfridia 2013/2014) ist für seine herausragende Masterarbeit mit dem Infineon- Master-Award ausgezeichnet worden. Die Arbeit verfasste der Physiker bei Prof. Dr. Gernot Münster am Institut für Theoretische Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU). Die mit Euro dotierte Auszeichnung verleihen der Fachbereich Physik und die Infineon AG (Warstein) jeweils für die herausragendste Examensarbeit eines Jahres. Der Preis wurde während der Promotionsfeier des Fachbereichs Physik am 6. Februar in der Universität überreicht. Bbr. Sebastian Engelnkemper hatte sich in seiner prämierten Arbeit mit einem Thema aus der Theorie der Elementarteilchen beschäftigt. Zu den kleinsten bekannten Teilchen zählen die sogenannten Quarks, aus denen auch die Atomkerne zusammengesetzt sind. Sehr starke Kräfte zwischen den Quarks halten diese in kleinen Gruppen zusammen. Ihre theoretische Beschreibung ist für das Verständnis der Grundlagen der Physik wichtig: International wird daran mit Simulationen auf Supercomputern und mit mathematischen Rechnungen gearbeitet. Für deren Auswertung und für die Interpretation der Computerergebnisse werden Formeln gebraucht, die die Abhängigkeit der Massen von zusammengesetzten Teilchen von den Massen der Quarks beschreiben. Hier gibt es in der Frage, wie sich die sehr kleinen Massenunterschiede zwischen den leichtesten Sorten von Quarks auswirken, in der Forschung ein sehr großes Interesse. Bbr. Engelnkemper hat dazu in aufwändigen und schwierigen Rechnungen Formeln entwickelt, in denen diese Effekte berücksichtigt werden. Dabei verließ er sich nicht auf Vorarbeiten anderer Autoren, sondern leitetet alles von Grund auf neu her, berichtet die Westfälische Wilhelms-Universität. Dabei habe er auch Unstimmigkeiten früherer Rechnungen aufklären können. Die Würdigung zeige, so der örtliche AHZ-Vorsitzende Hendrik Koors, dass auch die Übernahme von Vorortschargen während des Studiums kein Hindernis für buchstäblich ausgezeichnete Studienleistungen sein müssen. Gratulor! UNITAS-Zeitschrift als Jahrbuch Die ganzen Unitas-Ausgaben eines Jahres als komplettes Buch? Das ist nun möglich: Die Druckerei Peter Pomp GmbH (Internet: bei der die Verbandszeitschrift in Bottrop gedruckt wird, macht das Angebot, die rund 300 Seiten eines Jahrgangs zwischen zwei Buchdeckel zu bringen. Übriggebliebene überzählige Exemplare werden dazu in Klebebindung zusammengefasst solange der Vorrat reicht. Der Preis reduziert sich nach angeforderter Stückzahl von 14 Euro pro Exemplar (bei Gesamtmindestabnahme von 10 Stück) bis auf 3 Euro (bei Abnahme von 100). Die verwendeten Einzelhefte werden mit 4 Euro zusätzlich berechnet. Bei Interesse: Bitte Mitteilung an die Verbandsgeschäftsstelle, Verbandssekretärin: Anja Kellermann, Jan-van-Werth-Str. 1, Kaarst (Büttgen), Öffnungszeiten: Di, Mi, Do, bis Uhr, Tel , Fax unitas 2/
60 In memoriam: Bbr. Dr. Eduard Ackermann FAST VIER JAHRZEHNTE AN DEN BRENNPUNKTEN DEUTSCHER POLITIK Sie nannten ihn den großen Strippenzieher, Ackerdoktor, Kohls treuen Statthalter. Und kommentierten seine lange Zeit hinter den Kulissen der Macht in der Bonner Repubik mit dem Spruch In Bonn ist jeder einmal dran, nur nicht der Edi Ackermann. Am 10. Februar 2015 ist Bbr. Dr. Eduard Ackermann, einer der engsten Mitarbeiter von Helmut Kohl und nach Meinung vieler Journalisten in den achtziger und frühen neunziger Jahren wichtigster Mann im Kanzleramt, im Alter von 86 Jahren in Bonn gestorben. Über Jahrzehnte kam kein Medienvertreter an ihm vorbei, dessen Tätigkeit seit 1957 auf der Bonner Politikbühne alle Rekorde brach. Viele Journalisten schätzten den Geheimrat, der die CDU-Fraktionsvorsitzenden und den Kanzler im kleinsten Kreis beriet. Nie im Rampenlicht vor laufenden Kameras, nie selbst Darsteller, nie in einem Wahlamt aktiv, bezeichnete er sich selbst allenfalls als Souffleur, Kulissenschieber, gelegentlich auch Ratgeber und Helfer der Akteure. Die große politische Rolle habe er nie spielen wollen. Der Niederrheiner in Bonn Geboren wurde Eduard Ackermann am 1. November 1928 in Geldern als Sohn eines Schreiners in einer sehr politisch aktiven Familie. Der Vater war im dortigen Kreistag Fraktionsvorsitzender der Zentrumspartei und späterer Sozialsekretär der Christlichen Gewerkschaften. Er hatte 1928 erfolglos für einen Sitz im Reichstag kandidiert, bekam Schwierigkeiten mit den Nazi-Machthabern und wurde 1944 vorübergehend von der Gestapo inhaftiert. Nach dem Krieg hatte ihn die Besatzungsmacht in Kapellen als Gemeindedirektor eingesetzt. Eduard Ackermann besuchte ab 1940 das Humanistische Gymnasium seiner Heimatstadt. Nach einer aktiven Zeit bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und dem 1950 abgelegten Abitur ging Bbr. Ackermann mit dem Berufsziel Lehrer zum Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie nach Mainz und dann nach Bonn. Hier wurde er im WS 1951 bei Unitas Stolzenfels rezipiert. Im WS 1952/53 übernahm er in dem 32 Aktive und Inaktive zählenden Verein das Amt des FM, wie der von ihm für die Verbandszeitschrift dort mit Edi Ackermann, FM gezeichnete Semesterbericht ausweist. Bilder: Lothar Schaak, Bundesarchiv September/Oktober 1989 Bei Unitas Stolzenfels kam er in Kontakt mit Bbr. Dr. Heinrich Krone, damals Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, und arbeitete seit 1953 als Redakteur für die von Krone herausgegebene politische Zeitschrift Politisch-Soziale Korrespondenz. Anfang 1953 philistriert, wurde Bbr. Ackermann am 30. Mai 1956 mit seiner Arbeit Die historiografischen Grundlagen der Methodik des Geschichtsunterrichtes an den höheren Schulen in Preußen und anderen deutschen Ländern seit der Jahrhundertwende zum Dr. phil. promoviert. Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Durch Papa Krone, seinen politischen Ziehvater, den er als väterlichen Freund bezeichnete, kam Bbr. Ackermann nun ganz in die Nähe der Schaltstellen der Politik. Bbr. Krone überredete ihn zur Aufgabe seines angestrebten Berufs als Pädagoge und berief ihn am 1. März 1957 zum Stellvertretenden Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Bereits ein Jahr später übernahm Ackermann das Amt des Fraktionssprechers und stand seitdem in dieser Funktion fünf CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden als erfahrener und 148 unitas 2/2015
61 unentbehrlicher Mitarbeiter zur Seite: Nach Bbr. Krone arbeitete er mit den Fraktionsvorsitzenden Heinrich von Brentano, Rainer Barzel, Karl Carstens und schließlich mit Helmut Kohl zusammen. Bbr. Ackermann, der seit der Jugend unter einer starken und zunehmenden Sehbehinderung litt, scheiterte in den 1960er Jahren beim Versuch, ein Bundestagsmandat zu bekommen. Doch in seinen Ämtern hatte der Ministerialdirektor, verheiratet und Vater eines Sohnes, längst eine Schlüsselstellung. Am 1. März 1977 blickte er auf eine 20-jährige Tätigkeit als Pressesprecher der CDU/CSU- Bundestagsfraktion zurück, wie die Unitas unter dem Titel 20 Jahre Treue zur Fraktion berichtete. Ein Jahr später, 1978, würdigte die Verbandszeitschrift den inzwischen wohl am häufigsten zitierten Mann in Bonn zu seinem 50. Geburtstag: Er ist trotz seines jugendlichen Alters der dienstälteste Pressesprecher in Bonn. Sein hauptsächliches Arbeitsgerät war ihm in seiner Tätigkeit vor allem das Telefon: An einem normalen Tag, so bekannte er, waren es rund 80 Telefonate mit in- und ausländischen Korrespondenten, in Krisenzeiten aber auch schon mal hundert. Carbonara im Kanzleramt Als CDU-Fraktionschef Helmut Kohl am 1. Oktober 1982 zum Bundeskanzler gewählt wurde, nahm er Bbr. Eduard Ackermann mit ins Kanzleramt und übertrug ihm dort formal die Leitung der Abteilung 5 Kommunikation und Dokumentation und politische Planung. Tatsächlich blieb Carbonara, wie Kohl ihn wegen dessen Vorliebe für Pasta nannte, in dieser Funktion bis zu seiner Pensionierung vor allem Kohls persönlicher Pressesprecher und Vertrauter, sein Horchposten und Frühwarnsystem mit einem großen Netzwerk. In über 38 Jahren an den Schaltstellen und allen Brennpunkten deutscher Politik erlebte und beeinflusste er den Gang der Geschichte sogar über die deutsche Wiedervereinigung hinaus, die er als das eindrucksvollste Erlebnis bezeichnete. Der Unitas verbunden Über seine Tätigkeit, einen der interessantesten Jobs, die das politische Bonn zu vergeben hat, legte Bbr. Ackermann ein Buch vor, das die Erfahrungen von fast vier Jahrzehnten nachzeichnet ( Mit feinem Gehör vierzig Jahre in der Bonner Politik, Lübbe-Verlag, Bergisch- Gladbach, 416 Seiten). Und blieb auch der Unitas und vielen Bundesbrüdern weiter verbunden: Bei Unitas Stolzenfels berichtete er im Herbst 1996 in einem kleinen Kreis über Mittelfristige Perspektiven der deutschen Politik, schilderte die Hintergründe zum Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt 1972 und die Ereignisse hinter den Kulissen, die 1990 zur deutschen Wiedervereinigung führten. Das Jawort der UdSSR zur deutschen Einheit, so Ackermann damals, sei demnach nicht erst auf der Kaukasus-Reise, sondern schon tags zuvor in Gorbatschows Moskauer Datscha gefallen. Zum 1. Januar 1995, nach Kohls letzter Wiederwahl, trat Bbr. Ede Ackermann in den Ruhestand, 1996 veröffentlichte er sein und Schatten der deutschen Politik: Be- Buch Licht währungsproben". CB Gedenkt unserer Verstorbenen - R.i.P. Bbr. Ltd. Regierungsdirektor a. D. Matthias Braun aus Eschweiler, geboren am , aktiv seit Juni 1950 bei Unitas Freiburg, philistriert zum bei Unitas Stolzenfels, ist am gestorben. Bbr. Ltd. Verwaltungsdirektor a. D. Wilhelm Bruns aus Hamm, geboren am , aktiv seit Januar 1950 bei Unitas Burgundia Münster und AH der Rolandia- Burgundia Münster, ist am gestorben. Bbr. Dipl.-Ing. Rainer Elsing aus Aachen, geboren am und rezipiert zum Dezember 1959 bei Unitas Reichenstein, philistriert am , ist am gestorbben. Bbr. Schulleiter a. D. Klemens Müller aus Geseke, geboren am , aktiv seit Dezember 1958 bei Unitas Hathumar und AH seit , ist am verstorben. Bbr. StD Dipl.-Hdl. Hans-Jürgen Radwan aus Leverkusen, geboren am , rezipiert im Mai 1953 bei Unitas Silesia Aachen, philistriert zum bei Unitas Deutschritter Köln, ist am gestorben. Bbr. StD a. D. Michael Schirling aus Öhringen, geboren am , rezipiert zum Mai 1955 bei Unitas Markomannia Tübingen, ist am gestorben. Dipl.-Ing. agr. Carl Stüber aus Bilshausen, geboren am , aktiv seit Mai 1952 bei Unitas Göttingen, philistriert zum , ist am 22. Februar 2015 verstorben. Bbr. Dr. med. Gerhard Veenker aus Bad Bentheim, geboren am , rezipiert im Juni 1954 bei Unitas Rhenania Bonn und zum philistriert bei Unitas Wiking- Sugambria Münster, ist am verstorben. Bbr. Zahnarzt Walter Vlacek aus Starnberg, geboren am , aktiv seit November 1954 bei Unitas Ostland- Monachia München, philistriert zum , ist am gestorben. unitas 2/
62 " IN MEMORIAM Bbr. Pfr. i. R. Geistlicher Rat Friedrich Spiekermann ENSE-BREMEN. In den späten Abendstunden des 9. Oktobers 2014 verstarb Bbr. Pfarrer i. R. Friedrich Spiekermann am Tage nach seinem 89. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit. Bbr. Spiekermann wurde am 9. Oktober 1925 in Lüttringen als 13. Kind des Landwirts Karl Spiekermann und seiner Ehefrau Elisabeth geboren. Nach dem Besuch der 1940 von den Nationalsozialisten geschlossenen Missionsschule der Franziskaner in Warendorf besuchte er das Gymnasium Laurentianum in Arnsberg zur Kriegsmarine einberufen, kehrte er nach überstandener Soldatenzeit im Sommer 1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurück bestand er sein Abitur und studierte in Bad Driburg Philosophie und Theologie. In Freiburg schloss er sich im Dezember 1949 der Unitas Rheno- Danubia an. Kurz vor Weihnachten 1951 wurde Bbr. Friedrich Spiekermann zum Diakon und am 6. August 1952 vom damaligen Erzbischof Dr. Lorenz Jäger zum Priester geweiht. Seit 1952 war Spiekermann A-Philister bei Unitas Hathumar Paderborn und wechselte nach seiner ersten Vikarstelle in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis 1957 nach Wickede/Ruhr, 1958 nach Remblinghausen bei Meschede. Im Juni 1962 wurde er zum Pfarrer in Eppe/Kreis Waldeck ernannt. Im Juni 1969 übernahm er die Pfarrstelle an der alten Pfarrpropstei St. Pankratius in Belecke/Möhne. Hier war Spiekermann von auch Dechant des Dekanates Rüthen. Zu seinem 40-jährigen Priesterjubiläum 1992 äußerte er: Ich habe es nicht bereut, Priester geworden zu sein. Heute würde ich mich wieder so entscheiden vielleicht noch ein wenig freudiger! Bis Bbr. Spiekermann im Juli 1993 in den Ruhestand und als Krankenhauspfarrer an das Karolinenhospital in Neheim-Hüsten wechselte, prägte er fast 25 Jahre lang nicht nur die Seelsorge: So wurde er im Mai 1994 anlässlich des 546. Belecker Sturmtages in Anerkennung und Würdigung seines langjährigen heimatkundlichen und kulturgeschichtlichen Wirkens und seines großen Einsatzes bei der Verwirklichung des Stadtmuseums Schatzkammer Propstei Belecke mit dem Bürgermeister-Wilke-Preis ausgezeichnet. Von einem tiefen überzeugten und überzeugendem Glauben, waren Sie in all den Jahren für die Menschen da, haben ihnen geholfen, haben ihnen die Frohe Botschaft des Evangeliums verkündet, hieß es in der damals gehaltenen Laudatio. In vielfacher Weise habe sich Bbr. Spiekermann um das Miteinander bemüht, im Vorleben des Dienstes des Helfens, bei der Betreuung der Aussiedler und Asylanten im Arbeitskreis Asyl. Auch in der Erhaltung historischer Bauwerke habe er sich Verdienste erworben und für den ganzen Raum des nördlichen kurkölnischen Sauerlandes die einstige Verbundenheit der Propstei mit dem Mutterkloster Grafschaft bewahrt. Intensiv stellte er sich als Pastor und Priester in den Dienst der kirchlichen Verbände und Gemeinschaften, war aber auch langjähriges Mitglied bei den Belecker Bürgerschützen, dem Verkehrsund Heimatverein Belecke, dem Sauerländer Gebirgsverein, der Belecker Musikvereinigung, der Kolpingfamilie und dem Belecker Männerchor. Bis Dezember 2002 war Bbr. Spiekermann als Subsidiar in Belecke tätig und zog in das Josefshaus in Ense-Bremen. Von dort unterstützte er bis zu seiner Erkrankung die Geistlichen bei der Feier der Hl. Messe. Seit 2009 lebte er im Haus Pro-Vita. 150 unitas 2/2015
63 Das Requiem in der Pfarrkirche St. Lambertus am Samstag, 18. Oktober 2014 feierte Erzbischof Hans Josef Becker von Paderborn mit zahlreichen Priestern. Anschließend wurde Bbr. Pfarrer Friedrich Spiekermann in der Priestergruft auf dem katholischen Friedhof in Bremen bestattet. Bbr. Dipl.-Ing. agr. Alfons Peine WARENDORF. Bbr. Alfons Peine aus Warendorf, geboren am 9. April 1947, aktiv seit Dezember 1967 bei Unitas Cheruskia Gießen, A-Philister bei Unitas Rhenania Bonn seit 1972, Vorsitzender des Unitas-Zirkels Warendorf im Münsterland, ist am 16. März 2015 nach langer Krebserkrankung friedlich verstorben. Am 20. März wurde er in St. Laurentius Warendorf zur letzten Ruhe getragen. Bbr. Prof. Theo van Bernem DÜSSELDORF. Am 26. Mär 2015 ist unser Bundesbruder Prof. Dr. Theo van Bernem im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hat seit der Wiedergründung die Geschicke der Unitas Rheinfranken zu Düsseldorf ganz maßgeblich mitgestaltet. Seinen beruflichen Lebensweg begann er als Dipl.-Handelslehrer und beendete ihn als Professor für Wirtschaftsanglistik an der Bergischen Universität Wuppertal. Neben seiner Sprachlehrtätigkeit für Ökonomen und Lehramtsstudenten für das berufsbildende Schulwesen widmete er sich intensiv dem integrierten Auslandsstudium und gewann dafür als Partner die Aston University, die University of Birmingham in England und die Université de Paris I, Pantheon Sorbonne in Frankreich. An der Sorbonne hatte er von eine Gastprofessur inne. Außerdem lehrte er an der Edinburgh Language Foundation, einem internationalen Postgraduierten Zentrum. Für seine Verdienste um den Ausbau der integrierten Auslandsstudien verlieh ihm die University of Birmingham den Titel eines Honorary Fellow war Theo van Bernem in die Unitas Rheinfranken Düsseldorf rezipiert worden. Er war Consenior und der 5. Senior der 1957 wiederbegründeten Korporation. Seine hartnäckige und ausdauernde, vor allem aber überzeugende Keilarbeit hat in den sechziger Jahren zum Wiederaufbau der Aktivitas geführt, die er jahrelang als Senior und Ehrensenior geprägt hat. Nach seiner aktiven Zeit hat er als Vorsitzender des Altherrenzirkels und als Ehrenvorsitzender das Vereinsleben über Jahre geschickt und erfolgreich gestaltet: Ab 1992 war er für zehn Jahre Vorsitzender des AHZ Düsseldorf. So hat er auch mich für die Unitas begeistert und ist als Biervater seinen väterlichen Pflichten jahrzehntelang nachgekommen. Dass 1998 die Generalversammlung in Düsseldorf ein großer Erfolg war, ist vor allem Theo van Bernem zu verdanken, der mit unermüdlichem Einsatz und Hunderten von Telefongesprächen die Alten Herren aktiviert und die Aktiven bei der Vorbereitung unterstützt hat. Es war schier unmöglich, seinen Bitten und Argumentationen zu widerstehen. So hat er Bundesbruder Bischof Reinhard Marx als Zelebranten gewonnen und bei der SPD-Oberbürgermeisterin einen Sektempfang durchgesetzt, gegen alle Widerstände. Auch danach stand er stets mit Rat und Tat der Aktivitas und der Altherrenschaft zur Seite. Wir haben es alle sehr bedauert, dass er in den letzten Jahren aufgrund seiner schweren Erkrankung nicht mehr aktiv am unitarischen Leben teilnehmen konnte. Mit seinem Hinscheiden hinterlässt er eine große Lücke, die nur sehr schwer, wenn überhaupt, zu füllen sein wird. Aktivitas und Altherrenschaft der Unitas Rheinfranken Düsseldorf sind ihm zu ewigem Dank verpflichtet. Sie werden Bundesbruder Theo van Bernem nie vergessen. Ferdinand Schmidt, Unitas Rheinfranken Bbr. Dr. Robert Bosch MANNHEIM. Die Bundesbrüder in Mannheim trauern um ihren langjährigen Ehrensenior Bbr. Dr. Robert Bosch. Er ist am 12. März 2015 einen Tag vor seinem 88. Geburtstag gestorben. Er war bei Unitas Rheno-Danubia Freiburg im Oktober 1947 aktiv geworden, wurde philistriert zum 1. Juli 1954 und war B-Philister der Unitas Rheno- Palatia Mannheim. Jeder, der unseren Robert kannte, weiß, was er alles für die Unitas getan hat und was unsere Unitas-Familie für Ihn bedeutete. Er hat stets den unitarischen Gedanken gelebt und verkörpert und freute sich immer, wenn er Unitariern helfen oder mit ihnen zusammenarbeiten konnte. Zuletzt war Robert zur Kur in Triberg und war erst einige Wochen wieder zu Hause. Unser Mitgefühl gilt allen voran seiner lieben Frau Gisela, sowie seinen Kindern und Enkeln mit Familie. Lieber Robert, wir werden Dich vermissen, RIP!!! Tobias Kloiber, Mannheim OStR a. D. Fritz Schmieder HEIDELBERG. Bundesbruder OStR a. D. Fritz Schmieder ist am 15. März 2015 nach schwerer Krankheit im 86. Lebensjahr gestorben. Bbr. Fritz Schmieder, geboren am 14. September 1929 in Schapbach, wurde im SS 1952 bei Unitas Reichenau rezipiert und am 10. Februar 1958 dort philistriert. Dem AHV Unitas Kurpfalz Heidelberg schloss er sich am 6. Dezember 1996 als B-Philister an und besuchte häufig die Veranstaltungen. Bei den Konventen trug er durch kritische Anmerkungen zu lebhaftem Nachdenken bei. Er wurde am 20. März in Nußloch zur letzten Ruhe getragen. >> unitas 2/
64 Prof. Dr. Manfred Pütz PADERBORN. Bbr. Ministerialdirigent i. R. Prof. Dr. Manfred Pütz aus Paderborn, geboren am 25. August 1933, rezipiert im Dezember 1953 bei Unitas Reichenstein und philistriert zum 1. Dezember 1959, ist am 21. März 2015 verstorben. Die von ihm mitherausgegebene Zeitschrift Immissionsschutz Zeitschrift für Luftreinhaltung, Lärmschutz, Anlagensicherheit, Abfallverwertung und Energienutzung informierte seit 1994 detailliert zu aktuellen Themen aus diesen Bereichen, Informationen zur aktuellen Rechtsprechung, aus der LAI (Bund-Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz), der UMK (Umweltministerkonferenz) und der Europäischen Union. Bbr. Dr. Georg Roche MÖNCHENGLADBACH/GIESSEN. Georg ( Schorsch ) Roche wurde am 13. Juni 1927 als erster Sohn des Studienrates Otto Roche (sen.) und dessen Ehefrau Hedwig, geb. Buchmann, in Oberglogau (heute Gl ogówek) in Schlesien geboren. Seine Jugend und Schulzeit verlebte er nach dem Umzug der Familie in Neisse (heute Nysa). Dort besuchte er das altsprachliche Gymnasium Carolinum, an dem auch sein Vater unterrichtete. 1943, schon zwei Jahre vor dem Abitur, wurde er mit vielen seiner Klassenkameraden für einige Monate Luftwaffenhelfer, kam dann zum Reichsarbeitsdienst und Ende 1944 als Offiziersanwärter zur Wehrmacht, ohne an die Schule zurückkehren zu können. Nach der Grundausbildung in Breslau wurde er an der Westfront eingesetzt. Dort geriet er gegen Ende des Krieges im Harz in amerikanische Kriegsgefangenschaft, wurde aber bald an die Franzosen überstellt. Nach Monaten in Gefangenenlagern musste er in der Normandie drei Jahre lang auf verschiedenen Bauernhöfen Knechtsdienste verrichten, wobei es ihm als Angehöriger der verhassten deutschen Wehrmacht zunächst recht schlecht erging. Nach seiner Heimkehr 1948 musste Georg Roche das Abitur nachholen, das er 1949 bestand. Während seiner Kriegsgefangenschaft auf den Bauernhöfen hatte er sich schon für seinen zukünftigen Beruf entschieden: Er begann im SS 1949 in Gießen mit dem Studium der Veterinärmedizin. Schnell hatte er Anschluss an die dortige Unitas Cheruskia gefunden und wurde wie sein Vater und später auch sein jüngerer Bruder Otto ( ) Unitarier. Während der Gefangenschaft hatte er sich gute französische Sprachkenntnisse angeeignet, und so erhielt er ein Stipendium für ein Jahr Studium an der École Nationale Vétérinaire d Alfort in Paris beendete er in Gießen sein Studium mit dem Staatsexamen; ein Jahr darauf wurde er dort zum Dr. med. vet. promoviert. Nach tierärztlicher Tätigkeit in verschiedenen Praxen erhielt Georg Roche 1956 seine erste Anstellung als Stadttierarzt in Mönchengladbach heiratete er Elisabeth Franken und gründete mit ihr seine Familie, aus der später drei Kinder hervorgingen. Zunächst weilte das junge Paar 1958 aber ein Jahr lang in Berlin, wo er an der Freien Universität ein Zusatzstudium mit zweitem Staatsexamen (das sog. Kreisexamen ) absolvierte. Bald wurde er von der Stadt Mönchengladbach ins Keine UOS-Aktualisierungen mehr ab Juni 2015 Neue Mitgliederverwaltung kommt Beamtenverhältnis übernommen und stieg im Lauf der Jahre bis zum Städtischen Veterinärdirektor auf. Viele Jahre lang pflegte er im Altherrenzirkel die unitarischen Kontakte, aus denen manche Familienfreundschaft hervorging. Schon als Junge war Georg Roche immer gerne mit seinem Vater, einem begeisterten Biologen, in den Schlesischen Bergen gewandert. Dies tat er auch seinerseits als Familienvater am Niederrhein und in Familienferien in den Alpen. Auch das in der Jugend gepflegte Skifahren nahm er gerne wieder auf. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1992 unterrichtete er zusätzlich zu seiner tierärztlichen Tätigkeit wöchentlich einige Stunden an der Meisterschule für Metzger in Mönchengladbach; auch an einem Gymnasium war er einige Jahre lang zur Zeit der Lehrerknappheit samstags als Biologielehrer eingesprungen. Ein schwerer Schicksalsschlag war für Georg Roche der Tod seiner geliebten Ehefrau im Jahr 2007, wenige Wochen nach der Goldenen Hochzeit. Sieben Jahre lang wohnte er noch im Eigenheim, das nach dem längst erfolgten Auszug seiner erwachsenen Kinder leer geworden war. Seine Kräfte schwanden langsam, vor allem das Gehen fiel ihm immer schwerer verließ er sein Haus und verlebte, unterbrochen durch einige Krankenhausaufenthalte, seine letzten Monate in einem Seniorenheim. Dort ist er am 31. März 2015 verstorben. Er hinterlässt eine Tochter und zwei Söhne sowie drei Enkelinnen. R.I.P. Johannes Wagner Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder, Anfang Juni werden die Mitgliederdaten aus dem bisherigen System der Verbandsgeschäftsstelle in das neue Mitgliederverwaltungssystem übertragen. Ab diesem Zeitpunkt können die Übertragungsfunktionen zur Aktualisierung des Unitas Online-Systems (UOS) aus dem internen System nicht mehr genutzt werden. Damit erfahren die Daten im UOS ab Anfang Juni keine Änderung und Aktualisierung mehr. Dennoch können und sollen Datenänderung weiterhin über das UOS oder alternativ per an die Verbandsgeschäftsstelle gemeldet werden. Diese werden dann im neuen System aktualisiert. Im UOS bleibt es bei der Darstellung der veralteten Daten. Voraussichtlich noch im Lauf des Jahres erhalten alle Bundesschwestern und Bundesbrüder einen Zugang zum neuen Mitgliederverwaltungssystem, dem neuen Unitas Online-System. In diesem können zukünftig Datenänderungen dann direkt vorgenommen werden. Ingo Gabriel, Internetbeauftragter 152 unitas 2/2015
65 zu: Titelblatt Unitas 2015/1... non vitae, sed scholae... Liebes Team der Schriftleitung, ich habe zwar nichts gegen den immer wieder falsch wiedergegebenen Satz des Philosophen Seneca non scholae sed vitae discimus. Er sollte schon ganze Schülergenerationen dazu anstacheln, das Schulpensum ordentlich zu absolvieren, da ja schon Seneca so klug gesprochen habe. Im 106. Brief an Lucillius heißt es aber zum Schluss:... non vitae sed scholae discimus und meint, dass wir in vielen Bereichen unseren Verstand mit möglichst viel Wissen überlasten. Seneca meint dazu auch:... dergleichen macht nicht tugendhaft, sondern höchstens gelehrt. Um mich richtig zu verstehen, gegen viel Wissen ist nichts, aber auch gar nichts einzuwenden, nur der Satz des Seneca ist nun mal verkehrt zitiert, wenn er auch an vielen Schulen in Deutschland so in Stein gemeißelt steht. Semper in unitate Wilm Böcker, Essen Antwort der Schriftleitung: Wir haben drauf gewartet: Danke für die Anmerkung zu der Sentenz auf dem Titelblatt der letzten Unitas- Ausgabe! Umso mehr, als es sich hier nicht um die aufmerksame Beobachtung eines Sophisten, sondern eines ganz handfesten Ingenieurs handelt. In der Tat hatte schon das Seufzen der antiken Scholaren über ein aufgezwungenes Übermaß an Gelehrsamkeit ihren Grund: Der Politik und Staatskunst mochte sie dienen, zur Not der Aneignung eines rhetorischen Instrumentariums für die Karriere in der Staatsverwaltung. Vor allem aber der Auseinandersetzung mit den ungeliebten Philosophen. Für das Leben draußen blieb zur Not das Leben selbst als beste Schule. Und doch brachte gerade das alte Rom höchst innovative technische Leistungen zustande, die uns bis heute Staunen machen. Da trifft sich, dass die Schule mithin auch die Universität in den letzten Wochen erneut in die öffentliche Debatte geraten ist. So rechneten etwa Christoph Asche und Jan David Sudhoff in ihrem Artikel Zwölf Beweise, dass die Schule uns auf alles vorbereitet nur nicht aufs Leben in THE HUF- FINGTON POST am 4. März 2015 ab: Für das Leben lernen wir, nicht für die Schule. Seltsam, dass uns das ausgerechnet die Schule weismachen wollte. Denn in Wahrheit ist das natürlich Blödsinn. Für die Schule lernen wir und für sonst nichts. Genüsslich zogen sie Unterrichtsinhalte durch den Kakao, Prüfungsaufgaben an deutschen Schulen, die mancher durchschnittliche Abiturient unmittelbar nach dem Abfragen wieder vergisst. So könne er zwar eventuell die Funktion der Sprach- und Darstellungsmittel sowie die grammatikalischen Erscheinungen und das Dialogprinzip aus Platons frühen Werken benennen. Doch Reden von Politikern höre er sich gar nicht erst an. Hochkomplexe Rechenaufgaben seien wohl durchaus Gegenstand der Betrachtung, doch bei der Frage, wie eine gute Altersvorsorge aussehen müsse, seien Jugendliche und junge Erwachsene schlicht überfordert, zitierten sie aus einer Studie der Hertie School of Governance. Und machten auf noch weitere Ungereimtheiten aufmerksam: Trotz geomorphologischer Studien zu europäischen Glaziallandschaften seien wir heute ohne Navigationsgerät aufgeschmissen, trotz Untersuchungen zu angepasster intensiver Landwirtschaft im Amazonasgebiet in vorkolonialer Zeit überlebe bei uns eine Zimmerpflanze nur maximal zwei Wochen. Wir seien in der Lage, assoziativ angelegte poetische Schaffensprozesse in Gedichten zu analysieren, viele aber könnten nicht einmal die eigene Meinung zum Ausdruck bringen. Die Erörterung chemischer Prozesse gelinge zur Not, aber Kochen könne kaum jemand ganz zu schweigen von elementaren Wissenslücken deutscher Studienanfänger in Rechtschreibung, Grammatik und Lesekompetenz. Wir können das Volumen eines Dreiecksprismas berechnen. Aber die Steuererklärung überfordert uns, so die Autoren: Wir können die auf eine sehr kleine negativ geladene Kugel wirkenden Kräfte in einer Skizze darstellen, wenn die Kugel im homogenen Feld eines Plattenkondensators mit der Ladung q und mit der Masse m an einem Faden hängt, an dem Plattenkondensator die Gleichspannung U anliegt und sich der Auslenkwinkel einstellt. Zumindest dann, wenn vereinfachend angenommen wird, dass die Kugel die Platten niemals berührt, keine Selbstentladung stattfindet und der Faden masselos ist. Aber die Tür im Pax-Regal hängt trotzdem schief, weil wir die Aufbau-Skizze nicht verstanden haben. Non scholae sed vitae natürlich ist der Titel einer Unitas-Ausgabe genau so gemeint, wie er da steht: Lasst uns für das Leben lernen! Denn das fordert allemal. Wie komplex heute allein das Leben an der Hochschule ist, war in der vergangenen Ausgabe ja zu lesen. Doch in einer Sache wird man sicher zustimmen: In einem Unitas- Verein kann man mehr Dinge zwischen Himmel und Erde lernen, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt CB unitas 2/
66 Karl Vater Europas Karl der Große 1200 Jahre Mythos und Wirklichkeit. Herausgegeben vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt, bearbeitet von Bernhard Pinsker und Annette Zeeb, Imhof- Verlag 2014, ISBN: , Preis 29,95 Euro Spätestens zu Christi Himmelfahrt am 14. Mai schaut die Welt wieder nach Aachen. Mit dem Internationalen Karls-Preis 2015 wird diesmal der Präsident des Europäischen Parlaments, Dr. h.c. Martin Schulz geehrt. Die Jury sieht ihn als herausragenden Vordenker des Vereinten Europas, der sich um die Stärkung des Parlaments, des Parlamentarismus und der demokratischen Legitimation in der EU bedeutende und nachhaltige Verdienste erworben hat, so die Begründung. Hintergrund ist die 2014 getroffene Entscheidung über die neue Kommission und die Rolle des Europäischen Parlamentes für das Karlspreis-Direktorium ein historischer Meilenstein für die Demokratisierung der EU. Dass der ursprüngliche Namensgeber für einen der sicher bedeutendsten Preise auf dem Kontinent damit wenig im Sinn hatte, dürfte klar sein. Sein merowingischer Stammbaum steht für eine ganze Reihe von Eigenschaften die Förderung demokratischer Prinzipien gehört nicht gerade dazu. Und doch wird Europa diesen Karl nicht los: Diesen Sachsenschlächter und Gewaltmenschen, Lebemann und rastlosen Reiter, der zu leben wusste und doch zugleich unter einem fortwährenden Legitimierungsdruck stand. Zum einen vor der Geschichte und den zum Vorbild genommenen Caesaren Roms, viel mehr aber noch vor seinem Schöpfer, dem er in apokalyptischer Zeit eine wohlgefällige Welt geordnet hinterlassen wollte. Anlässlich des Todesjahres Karls des Großen 2014 hatte sich das Hessische Landesmuseum Darmstadt in seiner ersten Sonderausstellung nach der Wiedereröffnung dem bedeutenden Karolinger gewidmet. Sie war vom 18. November 2014 bis 25. Januar 2015 Teil einer Reihe nationaler und internationaler Ausstellungen zu Carolus Magnus in seinem Jubiläumsjahr. Vier inhaltlich und chronologisch aufbauende und miteinander verbundene Themenbereiche zeichneten eine Abfolge der Rezeption Karls des Großen vom Kunsthandwerk über Reformen, über verschiedene Literaturauffassungen in Frankreich und Deutschland, über den Historismus, die Kaiserzeit, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis heute den Kult um seine Person als Vater Europas nach. Denn schon seine anhaltende Wirkungsgeschichte als Person, Idee oder Mythos durch die Jahrhunderte macht ihn zu einer faszinierenden Persönlichkeit an der Schwelle einer neuen Zeit. Gekennzeichnet ist sie durch seine Wirkung auf das Recht und auf ein einheitliches Münzsystem, nicht zuletzt aber auf die erste einheitliche Buch- und Verwaltungsschrift, die karolingische Minuskel: Sie verbreitete sich bis zum 12. Jahrhundert über ganz Europa und führte zuletzt zu unserer noch heute gebräuchlichen Schrift. Zahlreiche Exponate vom Jagdmesser des Kaisers bis zum Bierkrug für das Carolus-Weihnachts-Doppelbock warfen ein Licht ins Dunkle der Geschichte und präsentierten vor allem die Rhein- Main-Region als eines der karolingischen Machtzentren. Der im Verlag von Bbr. Thomas Imhof in Petersberg bei Fulda erschienene Ausstellungskatalog besteht aus einem Essayund Katalog-Teil. In 13 Aufsätzen setzt sich der reich bebilderte Band auf 320 Seiten mit der Wirkungsgeschichte des großen Karl auseinander nicht nur für notorische Liebhaber solcher Kataloge ist er ein wunderbarer Zugriff zum Thema. CB GenderGaga Birgit Kelle: GenderGaga. Wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will, 192 Seiten, 2015 Adeo, ISBN , Preis 18,50 Euro Es fing ganz harmlos an: Warum soll mit Pilot immer ein Mann gemeint sein?, fragte einst Ober-EMMA-Frau Alice Schwarzer in ihren besten Talkshow-Tagen. Schließlich heiße es ja auch Enterich und Ente, erklärte sie publikumswirksam und plädierte mannhaft für den neuen Begriff des Piloterich. Am Anfang war der Scherz. Aber der kostet inzwischen Millionen. Denn so lächerlich er klang er war blutig ernst gemeint. Nun galt es, koste es, was es wolle: Weg mit dem frauenhassenden, diskriminierenden Männersprech, alles auf den Müll der Geschichtin. Oder wie heißt es noch mal richtig? Dass es bei der Einführung des Studierendenausweises nicht blieb, ist klar. Denn die Unis waren ganz vorne mit dabei. Ungezählte Türschilder, Briefköpfe sind inzwischen ausgewechselt. Den /die Gleichstellungsbeauftragt(inn)en trifft man überall, alles wird durchforstet. Und das sorgt nicht nur bei der Rechtschreibung schon für einigermaßen Unsicherheit. Nur in Leipzig gab es klare Kante: Dort ist jeder Professor und mag er noch so einen Bart haben automatisch und offiziell eine Professorin. Ganz geschlechtsneutral also. Die fast schlimmsten Orwellschen Fantasien sind damit inzwischen Realität. Was er in seinem Roman 1984 prophezeite, wurde bittere Wirklichkeit. Während kaum jemand begreift, was da alles im Namen von Gender Mainstreaming geschieht, oder gar in zwei, drei vernünftigen Sätzen erklären kann, was das alles soll, hat es sich als Handlungsmaxime in unserer 158 unitas 2/2015
67 Politik festgemauert, erklärt die Autorin Birgit Kelle in ihrem neuen Buch. Ohne gesellschaftliche Diskussion und Legitimation, ohne Parlamentsbeschluss. Da sitzt es jetzt, gekommen, um zu bleiben und wir zahlen alle fleißig mit. Orwell, vermutet sie, würde angesichts der Sprachkreativität verbissener Diskriminierungsjäger in der Stuhlkreis-Gesellschaft von heute nur neidvoll erblassen. Dass der Irrsinn planmäßig um sich greift, ist nicht nur an einer von evangelischen Theologinnen gefertigten geschlechtsneutralen Bibelübersetzung abzulesen: Er hat längst Methode. So beschreibt Journalistin Birgit Kelle eine ganze Gender- Industrie mit Tausenden Beschäftigten, die sich über das Gender Mainstreaming jedoch nicht nur der Sprache bemächtigt, sondern überall auf die Suche nach genderunsensiblen Strukturen fündig wird. 200 Gender-Lehrstühle und -Zentren fahnden inzwischen im deutschsprachigen Raum nach immer mehr als den jetzt schon leidlich bekannten Geschlechtern, Lehrpläne lassen schon die Jüngsten im Land rechtzeitig ihre persönliche sexuelle Vielfalt entdecken. Natürlich alles im Namen von Frauenförderung, Gleichstellung und Toleranz. Da macht man nicht einmal vor Fußgängerampeln halt: Während das Verkehrsministerium Autofahrer und Fußgänger abschaffte sie heißen jetzt gendersensibel Autofahrende und zu Fuß Gehende sollten Ampelmädchen statt Ampelmännchen diskriminierungsfrei über die Straße helfen. Ein Berliner Projekt, über das man sich schließlich ordentlich in die Zöpfe kriegte. Schließlich gibt es ja auch nichts Diskriminierenderes als Röcke. Zwei Jahrzehnte lang hat sich nun diese absurde Ideologie unbeobachtet durch alle Hierarchieebenen gearbeitet. Jetzt wird alles gegendert. Von Spielplätzen über Ampeln bis zu Uni-Sex-Toiletten für Birgit Kelle, Vorsitzende des Vereins Frau 2000plus sowie Vorstandsmitglied des EU-Dachverbandes New Women For Europe, eine zielsichere Vernichtung von Steuergeldern und eindeutig kompatibel als Ersatzreligion. Doch es gibt auch positive Aspekte, betont die 1975 in Heltau/Siebenbürgen geborene Kolumnistin beim Meinungs- und Debattenportal The European, verheiratet und Mutter von vier Kindern: Selten hatte eine Ideologie mit Weltverbesserungsanspruch einen derart großen Unterhaltungsfaktor. Deswegen hat Gender Mainstreaming es verdient, als das betrachtet zu werden, was es ist: eine große Satireshow. Der von ihr zitierte Zeuge ist Sigmund Freud: Der Verlust des Schamgefühls ist das erste Anzeichen von Schwachsinn. Hoch amüsant zu lesen ist ihre fröhliche Wissenschaft von der Einstiegsdroge Pink über zahlreiche Beispiele für den schleichenden und inzwischen exzessiven Übergriff in unser aller Privatleben. Wer die köstliche Unterhaltung genießt, spürt jedoch auch den ernsthaften und nachdenklichen politischen Beitrag der Autorin, die in zahlreichen Medienbeiträgen (u. a. Die Welt, Focus) für einen neuen Feminismus streitet ganz abseits von Gender-Irrsinn und Quotendebatten. CB Am Heiligen Grab Michael Ragsch: Am Heiligen Grab. Die Christen Jerusalems. Mit Fotografien von Sebastian Reith, Geleitwort von Paul Badde, 136 Seiten, durchgehend farbig. echter Verlag, Würzburg 2015, ISBN , Preis 19,90 Euro Der Autor ist professioneller Frühaufsteher, tätig für eine Zunft, die berechtigt oder nicht vielen als reines Unterhaltungsmedium gilt: Seit vielen Jahren ist Michael Ragsch, Frühplaner, Morgen- und Sportmoderator beim NRW-Lokalsender 98,5 Radio Bochum, jedoch in Gedanken allzu oft in einem Sehnsuchtsland : Für ihn ist es das 5. Evangelium, ein maßlos faszinierender Ort, an dem die Zivilisationen aufeinanderzustoßen. Nach Sterne von Bethlehem. Die verlassenen Kinder einer heiligen Stadt und An Seinem See. Geschichten vom See Genezareth hat sich der Wattenscheider Autor und Rundfunkjournalist diesmal der heiligsten aller heiligen Städte gewidmet: Jerusalem. Ganz im Mittelpunkt seines neuen Buches stehen die Christen dieser Stadt, die sie seit 2000 Jahren prägen. Und doch sind die Nachfolger der Apostel inzwischen eine winzige Minderheit zwischen Juden und Moslems. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichsten Konfessionen um ihren Platz in der Heiligen Stadt kämpfen die Auseinandersetzungen um den sogenannten Status quo in der Grabeskirche sind legendär. Michael Ragsch aber hat festgestellt, wie sehr Christen aller Denominationen in Jerusalem im Bemühen um das christliche Erbe in der Stadt des Heiligen Grabes Jesu vereint sind. Die Christen Jerusalems bewahren heilige Stätten, die jeder Leser des Neuen Testaments kennt. Mir war wichtig, im Buch auch die Orte darzustellen, ohne die viele meiner Gesprächspartner heute nicht in Jerusalem zu Hause wären, so der Autor. Und so ist sein Buch Am Heiligen Grab. Die Christen Jerusalems nicht nur ein Ausflug in die Gegenwart einer der aufregendsten Städte der Welt, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit auf den Spuren der allerersten Christen Jerusalems. Mehrfach ist Ragsch dorthin gereist, um ganz unterschiedliche Christenmenschen zu besuchen: Die Pastorin aus Deutschland, die einen Selbstmordanschlag überlebt hat. Einen deutschen Freiwilligen in Yad Vashem. Die äthiopische Nonne, die auf dem Dach der Grabeskirche wohnt. Den österreichischen Franziskaner, den sein Orden in die Grabeskirche geschickt hat. Einen Juden, der Jesus begegnet ist. Den Vorsteher der syrisch-orthodoxen Gemeinde. Einen ehemaligen hohen Kirchendiplomaten, der heute als Weißer Vater in Jerusalem lebt, und viele andere. Neben den präzise beschriebenen Beobachtungen machen zahlreiche außergewöhnliche Fotos des Schwerter Journalisten Sebastian Reith das Buch zu einem eindrucksvollen Zeugnis des Lebens der Christen am Heiligen Grab. Das Geleitwort hat Bestsellerautor Paul Badde ( Heiliges Land. Auf dem Königsweg aller Pilgerreisen ) beigesteuert. Ich werde es wieder lesen. CB unitas 2/
68 Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen kath. Studentenvereine UNITAS Unitas, Jan-van-Werth-Straße 1, Kaarst (Büttgen), PVSt; DPAG, Entgelt bezahlt. Jan-van-Werth-Straße Kaarst (Büttgen) ISSN Seminar Gute wissenschaftliche Praxis an deutschen Hochschulen Einführung in die Grundprinzipien des methodischen, systematischen und nachprüfbaren wissenschaftlichen Arbeitens Oktober 2015 in Königswinter Veranstalter: Stiftung Unitas 150plus Tagungsleitung: B br. Prof. Dr. Hubert Braun, Vorsitzender des Hochschulpolitischen B eirats Auf Grund des Erfolgs des Seminars im letzten Jahr (vgl. Unitas 4/2014) und auf N achfrage, ob das Seminar nicht nochmals stattfinden könnte, hat sich die Stiftung Unitas 150plus bereiterklärt, auch 2015 das Seminar zu finanzieren. Wir laden Bundesschwestern und Bundesbrüder ein, am 2./3. Oktober 2015 im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (häufiger Tagungsort der Krone-Seminare) an dem 1 1 /2-tägigen Seminar zur Einübung der Technik und Praxis wissenschaftlicher Arbeit teilzunehmen. Anreise am Freitag, 2. Oktober, bis Uhr / Ende am Samstag, 3. Oktober 2015, ca Uhr Das Seminar richtet sich an Studentinnen und Studenten der Unitas in B achelor- und Masterstudiengängen, die ihr Wissen über Grundprinzipien wissenschaftlichen Arbeitens vertiefen wollen. Dies soll vor allem auch anhand von F allübungen, Problemen und Erfahrungen der Teilnehmer geschehen. Die bewährten Referenten des letzten Jahres werden wieder das Seminar gestalten. Es stehen 20 Ü bernachtungsplätze für 20 Teilnehmer/innen zur Verfügung. Es wird kein Kostenbeitrag erhoben. Das heißt, es wird eine umfassende vorzügliche kulinarische Versorgung geboten. Die F ahrtkosten sind sofern nicht der örtliche A HV oder H DV sie übernehmen kann in der Regel vom Teilnehmer zu tragen. Zur Klärung der Frage, ob genügend Interesse an einer Teilnahme besteht, werden Interessenten gebeten, sich bis Freitag, 15. Mai 2015, an die Verbandsgeschäftsstelle vgs@unitas.org unter Angabe der Adresse und der Fachrichtung anzumelden. Wir benötigen bis zu diesem Z eitpunkt wenigstens zehn verbindliche Anmeldungen. Dann findet das Seminar statt. Also entscheidet Euch rasch! Semper in unitate Euer Bbr. Hubert Braun 160 unitas 2/2015
Franziskus und der Aufbruch der Kirche
 Franziskus und der Aufbruch der Kirche ROM-SEMINAR DER AGV: EIN BEITRAG ZUR HORIZONTERWEITERUNG VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS Im Zentrum der Weltkirche lautete das Motto des Rom-Seminars der Arbeitsgemeinschaft
Franziskus und der Aufbruch der Kirche ROM-SEMINAR DER AGV: EIN BEITRAG ZUR HORIZONTERWEITERUNG VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS Im Zentrum der Weltkirche lautete das Motto des Rom-Seminars der Arbeitsgemeinschaft
I. Begrüßung Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Begrüßung auch im Namen von MPr Seehofer
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 10.03.2012, 19:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Jahresempfangs des Erzbischofs
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 10.03.2012, 19:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Jahresempfangs des Erzbischofs
Weihbischof Wilhelm Zimmermann. Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus
 Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Thomas-Akademie Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch EINLADUNG
 Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Berufung. Aufbruch. Zukunft. Beiträge des Erzbischofs (13) Hirtenbrief des Erzbischofs zum Diözesanen Forum 2014
 Beiträge des Erzbischofs (13) Berufung. Aufbruch. Zukunft. Hirtenbrief des Erzbischofs zum Diözesanen Forum 2014 Das Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn Berufung. Aufbruch. Zukunft. Das Zukunftsbild
Beiträge des Erzbischofs (13) Berufung. Aufbruch. Zukunft. Hirtenbrief des Erzbischofs zum Diözesanen Forum 2014 Das Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn Berufung. Aufbruch. Zukunft. Das Zukunftsbild
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017
 Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
O Seligkeit, getauft zu sein
 Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr die Zeit, in der die Freude
Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr die Zeit, in der die Freude
A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5)
 A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Fest Peter und Paul am 29. Juni 2013 in der Frauenkirche in München
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Fest Peter und Paul am 29. Juni 2013 in der Frauenkirche in München Wir feiern heute das Fest Peter und Paul. Die beiden großen Apostel stehen
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Fest Peter und Paul am 29. Juni 2013 in der Frauenkirche in München Wir feiern heute das Fest Peter und Paul. Die beiden großen Apostel stehen
Der Erzbischof von Berlin
 Der Erzbischof von Berlin Hirtenwort zum Papstbesuch 2011 Der Erzbischof von Berlin Hirtenbrief des Erzbischofs von Berlin, Dr. Rainer Maria Woelki, aus Anlass des Besuchs S.H. Papst Benedikt XVI. im Erzbistum
Der Erzbischof von Berlin Hirtenwort zum Papstbesuch 2011 Der Erzbischof von Berlin Hirtenbrief des Erzbischofs von Berlin, Dr. Rainer Maria Woelki, aus Anlass des Besuchs S.H. Papst Benedikt XVI. im Erzbistum
R U F B E R U F B E R U F U N G
 R U F B E R U F B E R U F U N G Im Dienst Jesu Als Kind war ich mir sicher, dass ich später einmal als Lehrerin arbeiten wollte. Ich hatte große Freude daran, Wissen und Fähigkeiten mit anderen zu teilen
R U F B E R U F B E R U F U N G Im Dienst Jesu Als Kind war ich mir sicher, dass ich später einmal als Lehrerin arbeiten wollte. Ich hatte große Freude daran, Wissen und Fähigkeiten mit anderen zu teilen
R u F B e R u F B e R u F u n g
 R u F B e R u F B e R u F u n g Im Dienst Jesu gottes Liebe im Alltag ein gesicht geben: Ich arbeite seit über 16 Jahren am Berufskolleg St. Michael in Ahlen als Religionslehrer und Schulseelsorger. Dort
R u F B e R u F B e R u F u n g Im Dienst Jesu gottes Liebe im Alltag ein gesicht geben: Ich arbeite seit über 16 Jahren am Berufskolleg St. Michael in Ahlen als Religionslehrer und Schulseelsorger. Dort
Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst in der Frauenkirche zum Papstsonntag am 22. April 2007
 Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst in der Frauenkirche zum Papstsonntag am 22. April 2007 Auf dem Fries der Kuppel und der Apsis der Peterskirche in Rom sind die beiden
Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst in der Frauenkirche zum Papstsonntag am 22. April 2007 Auf dem Fries der Kuppel und der Apsis der Peterskirche in Rom sind die beiden
Erzbischof Dr. Ludwig Schick. O Seligkeit, getauft zu sein
 Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Liebe Schwestern und Brüder! Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr
Erzbischof Dr. Ludwig Schick O Seligkeit, getauft zu sein Wort an die Pfarrgemeinden des Erzbistums Bamberg zum Beginn der Fastenzeit 2015 Liebe Schwestern und Brüder! Die Fastenzeit ist im Kirchenjahr
Gottesdienst Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14, Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat
 Gottesdienst 22.5.16 Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14,1-7.16-17.26.27 Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat es in sich. Seit uralten Zeiten ist sie die Zahl der
Gottesdienst 22.5.16 Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14,1-7.16-17.26.27 Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat es in sich. Seit uralten Zeiten ist sie die Zahl der
Menschenwürde - Sendung und Auftrag aller Christen
 Menschenwürde - Sendung und Auftrag aller Christen Brief des Bischofs von St. Gallen an die Gläubigen 2015 Bitte am Samstag/Sonntag 10./11. Januar 2015 im Gottesdienst vorlesen Schrifttexte Fest der Taufe
Menschenwürde - Sendung und Auftrag aller Christen Brief des Bischofs von St. Gallen an die Gläubigen 2015 Bitte am Samstag/Sonntag 10./11. Januar 2015 im Gottesdienst vorlesen Schrifttexte Fest der Taufe
Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW
 Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
1. Johannes 4, 16b-21
 Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Predigt zum Silbernen Priesterjubiläum 2017
 Predigt zum Silbernen Priesterjubiläum 2017 Schrifttexte: Ex 3,1-8a.13-15 / Lk 4,16-21 Thema: Rede und Antwort geben, dem, der nach eurer Hoffnung fragt 1 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Jedem Rede und
Predigt zum Silbernen Priesterjubiläum 2017 Schrifttexte: Ex 3,1-8a.13-15 / Lk 4,16-21 Thema: Rede und Antwort geben, dem, der nach eurer Hoffnung fragt 1 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Jedem Rede und
Hirtenwort des Erzbischofs
 Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs zur Veröffentlichung des Pastoralen Orientierungsrahmens Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs
Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs zur Veröffentlichung des Pastoralen Orientierungsrahmens Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Hirtenwort des Erzbischofs
+ die Kirche. Eine Einführung. M.E., September Alle Bilder selbst produziert oder Gemeingut/Public Domain.
 + die Kirche Eine Einführung. M.E., September 2012. Alle Bilder selbst produziert oder Gemeingut/Public Domain. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist allmächtig er kann alles tun, was er will. Er
+ die Kirche Eine Einführung. M.E., September 2012. Alle Bilder selbst produziert oder Gemeingut/Public Domain. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist allmächtig er kann alles tun, was er will. Er
Die Heilige Taufe. St. Antonius von Padua Pfarrei Wildegg. Liebe Eltern
 Die Heilige Taufe Liebe Eltern St. Antonius von Padua Pfarrei Wildegg Sie möchten Ihr Kind taufen lassen. Damit treffen Sie eine wichtige Entscheidung: Ihr Kind soll ein Christ, konkret ein Katholik /
Die Heilige Taufe Liebe Eltern St. Antonius von Padua Pfarrei Wildegg Sie möchten Ihr Kind taufen lassen. Damit treffen Sie eine wichtige Entscheidung: Ihr Kind soll ein Christ, konkret ein Katholik /
Fürbitten für den ÖKT in Berlin
 Fürbitten für den ÖKT in Berlin Beigesteuert von Christina Falk Mittwoch, 04 Dezember 2002 Das Forum Ökumene des Katholikenrates Fulda veröffentlicht seit dem 17. November 2002 bis Mitte Mai, in der Bistumszeitung,
Fürbitten für den ÖKT in Berlin Beigesteuert von Christina Falk Mittwoch, 04 Dezember 2002 Das Forum Ökumene des Katholikenrates Fulda veröffentlicht seit dem 17. November 2002 bis Mitte Mai, in der Bistumszeitung,
2 Im Evangelium hörten wir, wie ihr der Engel die Botschaft brachte, dass sie die Mutter des Erlösers, des Gottessohnes werden solle. Sie hört, erschr
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Abschluss der Novene zur Unbefleckten Empfängnis am 09. November 2013 in St. Peter in München Das Bild der Kirche in unserem Land bereitet uns
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Abschluss der Novene zur Unbefleckten Empfängnis am 09. November 2013 in St. Peter in München Das Bild der Kirche in unserem Land bereitet uns
bindet Gott Maria unlösbar an Jesus, so dass sie mit ihm eine Schicksalsgemeinschaft bildet.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER
 ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
Röm 9, >>> später Wort islamistisch Gedanken um Terror und Opfer AFD antisemitische (also gegen Juden gerichtete) Äußerungen
 "Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht Röm 9,1-8+14-16 >>> später." Gebet: "Gott, gib uns deinen Heiligen Geist und leite uns nach deiner Wahrheit. AMEN." Liebe Gemeinde! Das Wort islamistisch
"Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht Röm 9,1-8+14-16 >>> später." Gebet: "Gott, gib uns deinen Heiligen Geist und leite uns nach deiner Wahrheit. AMEN." Liebe Gemeinde! Das Wort islamistisch
Religiöse Minderheiten in der Türkei und in Deutschland - am Beispiel der katholischen Kirche in der Türkei
 Religiöse Minderheiten in der Türkei und in Deutschland - am Beispiel der katholischen Kirche in der Türkei Peter Wehr Zunächst danke ich für die Einladung zu diesem Workshop nach Ankara, um über die Katholische
Religiöse Minderheiten in der Türkei und in Deutschland - am Beispiel der katholischen Kirche in der Türkei Peter Wehr Zunächst danke ich für die Einladung zu diesem Workshop nach Ankara, um über die Katholische
Leitbild der Deutschen Seemannsmission
 Leitbild Leitbild der Deutschen Seemannsmission von der Mitgliederversammlung der Deutschen Seemannsmission e.v. am 28. März 2003 beschlossen. Die Deutsche Seemannsmission Seemannsmission beginnt mit der
Leitbild Leitbild der Deutschen Seemannsmission von der Mitgliederversammlung der Deutschen Seemannsmission e.v. am 28. März 2003 beschlossen. Die Deutsche Seemannsmission Seemannsmission beginnt mit der
Walter Kardinal Kasper. Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive. Patmos Verlag
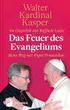 Walter Kardinal Kasper Martin Luther Eine ökumenische Perspektive Patmos Verlag Meiner Schwester Ingeborg von Gott am 28. Januar 2016 heimgerufen Inhalt Die vielen Lutherbilder und der fremde Luther 7
Walter Kardinal Kasper Martin Luther Eine ökumenische Perspektive Patmos Verlag Meiner Schwester Ingeborg von Gott am 28. Januar 2016 heimgerufen Inhalt Die vielen Lutherbilder und der fremde Luther 7
25. Sonntag im Jahreskreis A Gerechtigkeit oder: Worauf es ankommt
 25. Sonntag im Jahreskreis A 2017 Gerechtigkeit oder: Worauf es ankommt Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch ungerecht! Das kann Jesus doch nicht so gemeint haben! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
25. Sonntag im Jahreskreis A 2017 Gerechtigkeit oder: Worauf es ankommt Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch ungerecht! Das kann Jesus doch nicht so gemeint haben! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Päpstliche Missionswerke in Österreich. Gebete
 Päpstliche Missionswerke in Österreich Gebete 2 Noch nie hatte die Kirche so wie heute die Möglichkeit, das Evangelium durch das Zeugnis und das Wort allen Menschen und allen Völkern zukommen zu lassen.
Päpstliche Missionswerke in Österreich Gebete 2 Noch nie hatte die Kirche so wie heute die Möglichkeit, das Evangelium durch das Zeugnis und das Wort allen Menschen und allen Völkern zukommen zu lassen.
Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit 2016 Emsbüren Thema: Papst Franziskus und Über die Liebe in der Familie
 Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit 2016 Emsbüren Thema: Papst Franziskus und Über die Liebe in der Familie Liebe Schwestern und Brüder, 1. Petrus und Papst Franziskus Im Evangelium geht es um Petrus.
Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit 2016 Emsbüren Thema: Papst Franziskus und Über die Liebe in der Familie Liebe Schwestern und Brüder, 1. Petrus und Papst Franziskus Im Evangelium geht es um Petrus.
32. Sonntag im Jahreskreis A 9. November 2014
 32. Sonntag im Jahreskreis A 9. November 2014 Patrozinium St. Martin - Lektionar I/A, 426: Ez 47,1 2.8 9.12; 1 Kor 3,9c 11.16 17; Joh 2,13 22 Muss ich meinen Mantel zerteilen um dem Vorbild des hl. Martin
32. Sonntag im Jahreskreis A 9. November 2014 Patrozinium St. Martin - Lektionar I/A, 426: Ez 47,1 2.8 9.12; 1 Kor 3,9c 11.16 17; Joh 2,13 22 Muss ich meinen Mantel zerteilen um dem Vorbild des hl. Martin
Ich, der neue Papst! II
 Ich, der neue Papst! II 3 Jeder Papst hat sein eigenes Wappen. Gestalte dein eigenes Wappen. Denke dabei an die Dinge, die du in deinem Profil geschrieben hast. 4 Was möchtest du mit der Gestaltung deines
Ich, der neue Papst! II 3 Jeder Papst hat sein eigenes Wappen. Gestalte dein eigenes Wappen. Denke dabei an die Dinge, die du in deinem Profil geschrieben hast. 4 Was möchtest du mit der Gestaltung deines
Mittwoch, 7. Februar 2018 Maternushaus, Köln
 Globale Zivilgesellschaft unter Druck? Auftrag und Rolle der Weltkirche Festakademie zum 70. Geburtstag von Hubert Tintelott, Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerks a. D. Mittwoch, 7. Februar
Globale Zivilgesellschaft unter Druck? Auftrag und Rolle der Weltkirche Festakademie zum 70. Geburtstag von Hubert Tintelott, Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerks a. D. Mittwoch, 7. Februar
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 29 Karl Lehmann Gemeinde Franz-Xaver Kaufmann / Heinrich Fries / Wolfhart Pannenberg / Axel Frhr. von Campenhausen / Peter Krämer Kirche Heinrich Fries
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 29 Karl Lehmann Gemeinde Franz-Xaver Kaufmann / Heinrich Fries / Wolfhart Pannenberg / Axel Frhr. von Campenhausen / Peter Krämer Kirche Heinrich Fries
Lehrplan Katholische Religionslehre. Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt
 Klasse 5 Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt Bereiche Sprache der Religion Altes Testament Kirche und ihr Glaube Ethik/ Anthropologie Religion und Konfession Zielsetzungen/Perspektiven
Klasse 5 Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt Bereiche Sprache der Religion Altes Testament Kirche und ihr Glaube Ethik/ Anthropologie Religion und Konfession Zielsetzungen/Perspektiven
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1
 2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
Was soll und möchte ich mit meinem Leben machen? Was ist mir dabei wichtig? Was bedeutet es (mir) Christ zu sein?
 Jahrgang 5 Themen im katholischen Religionsunterricht Klasse 5 Wir fragen danach, an wen wir glauben (das Gottesbild im Wandel der Zeit), wie wir diesen Glauben ausüben (das Sprechen von und mit Gott),
Jahrgang 5 Themen im katholischen Religionsunterricht Klasse 5 Wir fragen danach, an wen wir glauben (das Gottesbild im Wandel der Zeit), wie wir diesen Glauben ausüben (das Sprechen von und mit Gott),
Predigt am 2. Adventssonntag 2015 Thema: Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit
 Predigt am 2. Adventssonntag 2015 Thema: Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit Liebe Schwestern und Brüder, 1. Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit An diesem Dienstag, am Fest der Unbefleckten Empfängnis
Predigt am 2. Adventssonntag 2015 Thema: Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit Liebe Schwestern und Brüder, 1. Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit An diesem Dienstag, am Fest der Unbefleckten Empfängnis
Wo Himmel und Erde sich berühren
 Einführung: Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema: Wo Himmel und Erde sich berühren Was bedeutet Wo Himmel und Erde sich berühren? Nun, unser Leben ist ein ewiges Suchen nach Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
Einführung: Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema: Wo Himmel und Erde sich berühren Was bedeutet Wo Himmel und Erde sich berühren? Nun, unser Leben ist ein ewiges Suchen nach Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli )
 ( grüne Farbe: ALLE ) WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli ) KREUZZEICHEN - LITURGISCHER GRUSS Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und das
( grüne Farbe: ALLE ) WORTGOTTESDIENST IM JULI 2016 Fest Mariä Heimsuchung ( 2. Juli ) KREUZZEICHEN - LITURGISCHER GRUSS Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und das
Glaube der berührt. Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen!
 Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! Liebe, Annahme echtes Interesse an der Person Anteilnahme geben erzählen, wie Gott mich selbst berührt einladen Unser Gegenüber,
Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! Liebe, Annahme echtes Interesse an der Person Anteilnahme geben erzählen, wie Gott mich selbst berührt einladen Unser Gegenüber,
Domvikar Michael Bredeck Paderborn
 1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
Predigt (1.Joh 4,16-21): Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
 Predigt (1.Joh 4,16-21): Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese Worte aus dem 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes: 16 Gott ist die
Predigt (1.Joh 4,16-21): Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese Worte aus dem 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes: 16 Gott ist die
Predigtgedanken zum Gemeindejubiläum am in der Fuyin Kirche
 Predigtgedanken zum Gemeindejubiläum am 23.10.2011 in der Fuyin Kirche Liebe Schwestern und Brüder, Mai 2004, an einem frühen Nachmittag auf meinem Look-andsee-trip lande ich von Seoul kommend zusammen
Predigtgedanken zum Gemeindejubiläum am 23.10.2011 in der Fuyin Kirche Liebe Schwestern und Brüder, Mai 2004, an einem frühen Nachmittag auf meinem Look-andsee-trip lande ich von Seoul kommend zusammen
Trier-Wallfahrt Hl. Messe am Vorabend von Christi Himmelfahrt (24. Mai)
 Hl. Messe am Vorabend von Christi Himmelfahrt (24. Mai) P: Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Segen spendende Gegenwart tragen wir dir unsere Anliegen vor: V: Hilf uns, Wege des Glaubens zu finden,
Hl. Messe am Vorabend von Christi Himmelfahrt (24. Mai) P: Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Segen spendende Gegenwart tragen wir dir unsere Anliegen vor: V: Hilf uns, Wege des Glaubens zu finden,
Predigtmanuskript. Thema: Wer ist Jesus für dich?
 Predigtmanuskript Thema: Wer ist Jesus für dich? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias
Predigtmanuskript Thema: Wer ist Jesus für dich? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29.
 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald. Click here if your download doesn"t start automatically
 Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald Click here if your download doesn"t start automatically Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald Benedikt XVI., Peter Seewald Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald Benedikt
Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald Click here if your download doesn"t start automatically Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald Benedikt XVI., Peter Seewald Letzte Gespräche: Mit Peter Seewald Benedikt
Diözese von Lausanne, Genf und Freiburg Hirtenbrief 2015 : Kommt und seht!
 Diözese von Lausanne, Genf und Freiburg Hirtenbrief 2015 : Kommt und seht! Bischof Charles MOREROD OP Januar 2015 In meinem Hirtenbrief vom März 2013 stellte ich eine Frage und bat um die Meinung aller
Diözese von Lausanne, Genf und Freiburg Hirtenbrief 2015 : Kommt und seht! Bischof Charles MOREROD OP Januar 2015 In meinem Hirtenbrief vom März 2013 stellte ich eine Frage und bat um die Meinung aller
Der Heilige Vater im Gespräch mit Präsident Albert Ritter. Foto: Photographic Service of L Osservatore Romano.
 ESU-Informationen Grazie! Grazie! Grazie! Der Heilige Vater bedankt sich bei Europas Schaustellern Pilgerfahrt zur Sonderaudienz im Vatikan Der Heilige Vater im Gespräch mit Präsident Albert Ritter. Foto:
ESU-Informationen Grazie! Grazie! Grazie! Der Heilige Vater bedankt sich bei Europas Schaustellern Pilgerfahrt zur Sonderaudienz im Vatikan Der Heilige Vater im Gespräch mit Präsident Albert Ritter. Foto:
Rede beim Iftar-Empfang der World Media Group AG und des Hamle e. V. 5. August 2013
 Seite 1 von 9 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung Zweite Bürgermeisterin Rede beim Iftar-Empfang der World Media Group AG und des Hamle e. V. 5. August 2013 Es gilt das
Seite 1 von 9 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung Zweite Bürgermeisterin Rede beim Iftar-Empfang der World Media Group AG und des Hamle e. V. 5. August 2013 Es gilt das
GRUNDSÄTZE DER ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN
 Grundsätze der ACK in NRW ACK-NRW 174 GRUNDSÄTZE DER ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN Zusammengestellt nach den Grundsatzbeschlüssen der Vollversammlungen 1. Anfang und Name
Grundsätze der ACK in NRW ACK-NRW 174 GRUNDSÄTZE DER ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN Zusammengestellt nach den Grundsatzbeschlüssen der Vollversammlungen 1. Anfang und Name
Christentum. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Christentum 1
 Christentum Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ingrid Lorenz Christentum 1 Das Christentum hat heute auf der Welt ungefähr zwei Milliarden Anhänger. Sie nennen
Christentum Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ingrid Lorenz Christentum 1 Das Christentum hat heute auf der Welt ungefähr zwei Milliarden Anhänger. Sie nennen
TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG WARUM TAUFEN WIR: MT 28,16-20
 GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014
 Wortgottesdienst März 2014 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014 2. Sonntag der Fastenzeit Lesejahr A (auch an anderen Sonntagen in der Fastenzeit zu gebrauchen)
Wortgottesdienst März 2014 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014 2. Sonntag der Fastenzeit Lesejahr A (auch an anderen Sonntagen in der Fastenzeit zu gebrauchen)
MEHR ALS DU SIEHST HIRTENWORT. Ein Leitwort für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg
 MEHR ALS DU SIEHST Ein Leitwort für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg HIRTENWORT zur Österlichen Bußzeit 2018 von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg 1 Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg!
MEHR ALS DU SIEHST Ein Leitwort für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg HIRTENWORT zur Österlichen Bußzeit 2018 von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg 1 Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg!
Aus der Hoffnung leben
 Aus der Hoffnung leben 1 Liebe Schwestern, liebe Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens! An diesem ersten Fastensonntag findet in Freiburg etwas besonderes statt: Mit einem Gottesdienst im Münster eröffnen
Aus der Hoffnung leben 1 Liebe Schwestern, liebe Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens! An diesem ersten Fastensonntag findet in Freiburg etwas besonderes statt: Mit einem Gottesdienst im Münster eröffnen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen. Erwartete Kompetenzen. 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang
 KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
Sehr geehrter Herr Erzbischof, sehr geehrter Herr Nuntius, meine sehr geehrten Damen und Herren,
 Bischofsweihe und Amtseinführung von Erzbischof Dr. Stefan Heße am 14. März 2015 Sehr geehrter Herr Erzbischof, sehr geehrter Herr Nuntius, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute bekommen die Katholiken
Bischofsweihe und Amtseinführung von Erzbischof Dr. Stefan Heße am 14. März 2015 Sehr geehrter Herr Erzbischof, sehr geehrter Herr Nuntius, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute bekommen die Katholiken
Mit Jesus Christus den Menschen nahe sein
 Leitbild, Leitziele und strategische Ziele für den Weg der Evangelisierung und Stärkung der Katholischen Kirche in Kärnten Jänner 2012 AUSGABE 3 Auf die Frage, was sich in der Kirche ändern muss, sagte
Leitbild, Leitziele und strategische Ziele für den Weg der Evangelisierung und Stärkung der Katholischen Kirche in Kärnten Jänner 2012 AUSGABE 3 Auf die Frage, was sich in der Kirche ändern muss, sagte
Grußwort. Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal. Es gilt das gesprochene Wort!
 Grußwort Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Teilnehmerinnen und
Grußwort Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Teilnehmerinnen und
Vernetzung der Bereiche, Schwerpunkte (*) und Kompetenzen (+) in Ich bin da 4
 Vernetzung der Bereiche, Schwerpunkte (*) und Kompetenzen (+) in Ich bin da 4 Ich, die anderen, 1. Gemeinschaft erleben +beschreiben die Einmaligkeit jedes Menschen mit seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten
Vernetzung der Bereiche, Schwerpunkte (*) und Kompetenzen (+) in Ich bin da 4 Ich, die anderen, 1. Gemeinschaft erleben +beschreiben die Einmaligkeit jedes Menschen mit seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten
BEGLEITHEFT STATIO IN DEN KIRCHEN STATIO IN KALK ABSCHLUSSMESSE IM DOM GOTTES GERECHTIGKEIT IST SEINE BARMHERZIGKEIT.
 BEGLEITHEFT STATIO IN DEN KIRCHEN STATIO IN KALK ABSCHLUSSMESSE IM DOM GOTTES GERECHTIGKEIT IST SEINE BARMHERZIGKEIT. (NACH TOBIT 3,2) Samstag 5. April 2014 Männerwallfahrt und Schweigegang nach Kalk 22.15
BEGLEITHEFT STATIO IN DEN KIRCHEN STATIO IN KALK ABSCHLUSSMESSE IM DOM GOTTES GERECHTIGKEIT IST SEINE BARMHERZIGKEIT. (NACH TOBIT 3,2) Samstag 5. April 2014 Männerwallfahrt und Schweigegang nach Kalk 22.15
Gottes Gnade genügt - 1 -
 Gottes Gnade genügt Gott schenkt uns seine Liebe, das allein ist der Grund unseres Lebens und unseres Glaubens. Wir glauben, dass wir Menschen mit dem, was wir können und leisten, uns Gottes Liebe nicht
Gottes Gnade genügt Gott schenkt uns seine Liebe, das allein ist der Grund unseres Lebens und unseres Glaubens. Wir glauben, dass wir Menschen mit dem, was wir können und leisten, uns Gottes Liebe nicht
Papst Benedikt XVI. über den Sonntag - Teil 1 -
 Papst Benedikt XVI. über den Sonntag - Teil 1 - Den Sonntag respektieren Ansprache an den neuen Botschafter vom Luxemburg, 18. Dezember 2009 Der ökonomische Kontext lädt paradoxerweise dazu ein, den wahren
Papst Benedikt XVI. über den Sonntag - Teil 1 - Den Sonntag respektieren Ansprache an den neuen Botschafter vom Luxemburg, 18. Dezember 2009 Der ökonomische Kontext lädt paradoxerweise dazu ein, den wahren
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen. Erwartete Kompetenzen. 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang
 KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
Leitziele unseres Handelns in den Gemeinden St. Johannes der Täufer, Leonberg und St. Michael, Höfingen-Gebersheim
 Leitziele unseres Handelns in den Gemeinden St. Johannes der Täufer, Leonberg und St. Michael, Höfingen-Gebersheim Unser Menschen- und Gottesbild Gott und Mensch stehen in enger Beziehung Gott hat den
Leitziele unseres Handelns in den Gemeinden St. Johannes der Täufer, Leonberg und St. Michael, Höfingen-Gebersheim Unser Menschen- und Gottesbild Gott und Mensch stehen in enger Beziehung Gott hat den
«Ich will wissen, was ich glaube!»
 «Ich will wissen, was ich glaube!» Kursaufbau Teil I: You Belong Erschaffen Erlöst Erfüllt Teil II: You Believe Die Bibel Der Bund Das Bekenntnis Teil III: You Behave Freiheit Friede Fülle Kursablauf Begrüssung
«Ich will wissen, was ich glaube!» Kursaufbau Teil I: You Belong Erschaffen Erlöst Erfüllt Teil II: You Believe Die Bibel Der Bund Das Bekenntnis Teil III: You Behave Freiheit Friede Fülle Kursablauf Begrüssung
Wiederverheiratete Geschiedene. Für einen offenen Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten in der Kirche. Seite 3
 Katholischer Deutscher FRAUENBUND Wiederverheiratete Geschiedene Für einen offenen Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten in der Kirche Seite 3 1. Ehe zwischen Frau und Mann Leben und Glaube in
Katholischer Deutscher FRAUENBUND Wiederverheiratete Geschiedene Für einen offenen Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten in der Kirche Seite 3 1. Ehe zwischen Frau und Mann Leben und Glaube in
Das ist der Kirchen-Tag Infos in Leichter Sprache
 Das ist der Kirchen-Tag Infos in Leichter Sprache Inhalt Liebe Leserin, lieber Leser! Seite 3 Kirchen-Tag ist ein Fest mit guten Gesprächen Seite 5 Das ist beim Kirchen-Tag wichtig Seite 7 Gott danken
Das ist der Kirchen-Tag Infos in Leichter Sprache Inhalt Liebe Leserin, lieber Leser! Seite 3 Kirchen-Tag ist ein Fest mit guten Gesprächen Seite 5 Das ist beim Kirchen-Tag wichtig Seite 7 Gott danken
Allerheiligen Heilig sein heilig werden. Allerheiligen Heiligkeit für alle?! Es gibt einige Worte der religiösen Sprache, die für
 Allerheiligen 2007 Heilig sein heilig werden Liebe Schwestern und Brüder, Allerheiligen Heiligkeit für alle?! Es gibt einige Worte der religiösen Sprache, die für manche Christen in einer Schamecke gelandet
Allerheiligen 2007 Heilig sein heilig werden Liebe Schwestern und Brüder, Allerheiligen Heiligkeit für alle?! Es gibt einige Worte der religiösen Sprache, die für manche Christen in einer Schamecke gelandet
Gedanken zu den Terroranschlägen von Paris Hunteburg & Bohmte 2015
 Gedanken zu den Terroranschlägen von Paris Hunteburg & Bohmte 2015 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Was geschehen ist Die Ereignisse von Paris schockieren uns: 2 islamistische Terroristen dringen in die
Gedanken zu den Terroranschlägen von Paris Hunteburg & Bohmte 2015 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Was geschehen ist Die Ereignisse von Paris schockieren uns: 2 islamistische Terroristen dringen in die
Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern
 ACK-Richtlinie MV ACKMVRL 1.304-501 Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern Vom 14. April 1994 (ABl. S. 97) 15.12.2017 Nordkirche 1 1.304-501 ACKMVRL ACK-Richtlinie
ACK-Richtlinie MV ACKMVRL 1.304-501 Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern Vom 14. April 1994 (ABl. S. 97) 15.12.2017 Nordkirche 1 1.304-501 ACKMVRL ACK-Richtlinie
Fürbitten I. (W. Schuhmacher) Fürbitten II
 Fürbitten I Befreie unsere Erde von allen Formen des Terrors - und stärke alle, die sich für den Frieden einsetzen. Tröste alle Opfer von Terror und Krieg - und verwandle allen Hass der Herzen in Gedanken,
Fürbitten I Befreie unsere Erde von allen Formen des Terrors - und stärke alle, die sich für den Frieden einsetzen. Tröste alle Opfer von Terror und Krieg - und verwandle allen Hass der Herzen in Gedanken,
Wenn wir das Váray-Quartett so wunderbar musizieren hören, spüren wir, wie uns Kunst und Kultur berühren.
 Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Symbol: Weg/Fußspuren. Was mir heilig ist
 2017/18 September Anfangsgottesdienst Oktober Erntedank Kompetenz 1 Das eigene Selbstund Wertverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und im Gespräch zum Ausdruck bringen. Lebensfragen 9 Andere
2017/18 September Anfangsgottesdienst Oktober Erntedank Kompetenz 1 Das eigene Selbstund Wertverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und im Gespräch zum Ausdruck bringen. Lebensfragen 9 Andere
leben gestalten 1 Unterrichtswerk fü r den Katholischen Religionsunterricht am Gymnasium 5. und 6. Jahrgangsstufe
 leben gestalten 1 Unterrichtswerk fü r den Katholischen Religionsunterricht am Gymnasium 5. und 6. Jahrgangsstufe Herausgegeben von Dr. Markus Tomberg Erarbeitet von Edeltraud Gaus, Dr. Ralf Gaus, Peter
leben gestalten 1 Unterrichtswerk fü r den Katholischen Religionsunterricht am Gymnasium 5. und 6. Jahrgangsstufe Herausgegeben von Dr. Markus Tomberg Erarbeitet von Edeltraud Gaus, Dr. Ralf Gaus, Peter
Katholische Theologie
 Katholische Theologie Modul 1: Einführungs- und Grundlagenmodul Turnus Arbeitsauf- 14 jährlich 10 420 2 Beispiele gelebter Religion und gelebten Glaubens, Biblische Grundlagen, Geschichte der Kirche und
Katholische Theologie Modul 1: Einführungs- und Grundlagenmodul Turnus Arbeitsauf- 14 jährlich 10 420 2 Beispiele gelebter Religion und gelebten Glaubens, Biblische Grundlagen, Geschichte der Kirche und
Gedanken zur Jahreslosung 2013 zur Erarbeitung von Andachten für Mitarbeiter und Teilnehmer
 Gedanken zur Jahreslosung 2013 zur Erarbeitung von Andachten für Mitarbeiter und Teilnehmer Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen
Gedanken zur Jahreslosung 2013 zur Erarbeitung von Andachten für Mitarbeiter und Teilnehmer Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen
1 B Kloster: Gelübde. 1 A Kloster: Mönch. Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters?
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? 1 C Kloster: Nonne Wie nennt
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? 1 C Kloster: Nonne Wie nennt
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Grußwort des Evangelischen Militärbischof Dr. Martin Dutzmann zur Einführung von Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck am 06. Mai 2011 in Berlin
 Grußwort des Evangelischen Militärbischof Dr. Martin Dutzmann zur Einführung von Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck am 06. Mai 2011 in Berlin Sehr geehrter Herr Bundesminister de Maizière, sehr geehrter
Grußwort des Evangelischen Militärbischof Dr. Martin Dutzmann zur Einführung von Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck am 06. Mai 2011 in Berlin Sehr geehrter Herr Bundesminister de Maizière, sehr geehrter
Texte für die Eucharistiefeier III. Thema: Geistliche Berufe
 Texte für die Eucharistiefeier III (zusammengestellt P. Lorenz Voith CSsR) Thema: Geistliche Berufe 15. März Hl. Klemens Maria Hofbauer Ordenspriester Begrüßung: Im Namen des Vaters... Die Gnade unseres
Texte für die Eucharistiefeier III (zusammengestellt P. Lorenz Voith CSsR) Thema: Geistliche Berufe 15. März Hl. Klemens Maria Hofbauer Ordenspriester Begrüßung: Im Namen des Vaters... Die Gnade unseres
Gottesdienst für Juni Suche Frieden auch das Thema des nächsten Katholikentages in Münster 2018
 Gottesdienst für Juni 2017 Suche Frieden auch das Thema des nächsten Katholikentages in Münster 2018 Vorbereiten Lektor/in soll Lesung vorbereiten (also: erstmal selbst verstehen) Fürbitten verteilen (wenn
Gottesdienst für Juni 2017 Suche Frieden auch das Thema des nächsten Katholikentages in Münster 2018 Vorbereiten Lektor/in soll Lesung vorbereiten (also: erstmal selbst verstehen) Fürbitten verteilen (wenn
Gottesdienst für April 2016 Der reiche Fischfang
 Gottesdienst für April 2016 Der reiche Fischfang Eröffnung L: Zu unserem Gottesdienst ich darf Euch herzlich begrüßen. Wir den Gottesdienst beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Gottesdienst für April 2016 Der reiche Fischfang Eröffnung L: Zu unserem Gottesdienst ich darf Euch herzlich begrüßen. Wir den Gottesdienst beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden. A Mönch C Nonne D Augustiner-Orden
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
seit dem 1. Juli 2014 hat der Seelsorgebereich Neusser Süden keinen leitenden
 Sperrfrist bis 18. Mai 2016 An alle Gemeindemitglieder der Pfarreien in den Seelsorgebereichen Neusser Süden und Rund um die Erftmündung sowie die Pastoralen Dienste und die kirchlichen Angestellten Köln,
Sperrfrist bis 18. Mai 2016 An alle Gemeindemitglieder der Pfarreien in den Seelsorgebereichen Neusser Süden und Rund um die Erftmündung sowie die Pastoralen Dienste und die kirchlichen Angestellten Köln,
Hans-Josef Vogel Bürgermeister der Stadt Arnsberg. Wenn du gerufen wirst, musst du gehen.
 Hans-Josef Vogel Bürgermeister der Stadt Arnsberg Wenn du gerufen wirst, musst du gehen. Empfang der Stadt Arnsberg zum 50-jährigen Jubiläum des Franz-Stock-Komitee für Deutschland am 20. September 2014
Hans-Josef Vogel Bürgermeister der Stadt Arnsberg Wenn du gerufen wirst, musst du gehen. Empfang der Stadt Arnsberg zum 50-jährigen Jubiläum des Franz-Stock-Komitee für Deutschland am 20. September 2014
1 Lukas 2, Weihnachtstag 2000 Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist uns sehr geläufig und fast jeder von könnte ihn zitieren.
 1 Lukas 2, 15-20 2. Weihnachtstag 2000 Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist uns sehr geläufig und fast jeder von könnte ihn zitieren. Es begab sich aber zu der Zeit als ein Gebot von dem Kaiser Augustus
1 Lukas 2, 15-20 2. Weihnachtstag 2000 Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist uns sehr geläufig und fast jeder von könnte ihn zitieren. Es begab sich aber zu der Zeit als ein Gebot von dem Kaiser Augustus
Programm der Apostolischen Reise von Papst Benedikt XVI. nach Deutschland 22. - 25. September 2011
 PAPSTBESUCH 2011 Programm der Apostolischen Reise von Papst Benedikt XVI. nach Deutschland 22. - 25. September 2011 Die 21. Auslandsreise führt Papst Benedikt XVI. in das Erzbistum Berlin, in das Bistum
PAPSTBESUCH 2011 Programm der Apostolischen Reise von Papst Benedikt XVI. nach Deutschland 22. - 25. September 2011 Die 21. Auslandsreise führt Papst Benedikt XVI. in das Erzbistum Berlin, in das Bistum
Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog
 Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog 50 Jahre "Nostra aetate": Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption von Dr. Andreas Renz 1. Auflage Kohlhammer 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog 50 Jahre "Nostra aetate": Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption von Dr. Andreas Renz 1. Auflage Kohlhammer 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
nähern, wie die Hirten, wie die drei Könige, die spüren: Hier ist Gott. Und sie fallen nieder und beten an.
 Liebe Schwestern, liebe Brüder, ist das nicht eigenartig? Da feiert die Christenheit auf der ganzen Welt ein Fest, das so konkret ist, wie nur irgend möglich. Ein Kind in einer Krippe wird gefeiert. Und
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ist das nicht eigenartig? Da feiert die Christenheit auf der ganzen Welt ein Fest, das so konkret ist, wie nur irgend möglich. Ein Kind in einer Krippe wird gefeiert. Und
WAS IST SOULDEVOTION?
 ÜBER UNS WAS IST SOULDEVOTION? SoulDevotion ist eine Jüngerschaftsbewegung, die Menschen generationsübergreifend aus verschiedenen christlichen Gemeinden, Organisationen und Konfessionen verbindet. Unser
ÜBER UNS WAS IST SOULDEVOTION? SoulDevotion ist eine Jüngerschaftsbewegung, die Menschen generationsübergreifend aus verschiedenen christlichen Gemeinden, Organisationen und Konfessionen verbindet. Unser
Predigt zu Lukas 14,
 Predigt zu Lukas 14, 1.12-24 Liebe Gemeinde, Jesus war bereit, die Einladung eines angesehenen Pharisäers anzunehmen, obwohl die Atmosphäre dieses Essens für ihn nicht sonderlich angenehm gewesen sein
Predigt zu Lukas 14, 1.12-24 Liebe Gemeinde, Jesus war bereit, die Einladung eines angesehenen Pharisäers anzunehmen, obwohl die Atmosphäre dieses Essens für ihn nicht sonderlich angenehm gewesen sein
Als meine Tochter sehr klein war, hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis mit ihr.
 1 Predigt Du bist gut (4. und letzter Gottesdienst in der Predigtreihe Aufatmen ) am 28. April 2013 nur im AGD Als meine Tochter sehr klein war, hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis mit ihr. Ich war
1 Predigt Du bist gut (4. und letzter Gottesdienst in der Predigtreihe Aufatmen ) am 28. April 2013 nur im AGD Als meine Tochter sehr klein war, hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis mit ihr. Ich war
... Grundwissen: über wichtige christliche Feste Auskunft geben können. Meine eigenen Einträge:
 Weihnachten Ostern Pfingsten 25. Dezember 1. Sonntag nach dem Frühjahrsvollmond 50 Tage nach Ostern Geburt Christi vor über 2000 Jahren in Bethlehem Tod und Auferstehung Jesu um 30 n. Chr. in Jerusalem
Weihnachten Ostern Pfingsten 25. Dezember 1. Sonntag nach dem Frühjahrsvollmond 50 Tage nach Ostern Geburt Christi vor über 2000 Jahren in Bethlehem Tod und Auferstehung Jesu um 30 n. Chr. in Jerusalem
