Immunologie in Deutschland
|
|
|
- Walther Neumann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Immunologie in Deutschland
3 DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR IMMUNOLOGIE (HG.) Immunologie in Deutschland FESTSCHRIFT ZUM 50. JUBILÄUM DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR IMMUNOLOGIE Geschichte einer Wissenschaft und ihrer Fachgesellschaft
4 Wir danken unseren DGfI-Mitgliedern und folgenden Sponsoren für ihre großzügige finanzielle Unterstützung, ohne die diese Festschrift zum 50. Geburtstag unserer Gesellschaft niemals zustande gekommen wäre. Inhalt Prof. Dr. med. Frank Emmrich, Theracur-Stiftung e. V., Leipzig Abbvie Deutschland Chugai Pharma Ltd. CSL Behring GmbH Euroimmun AG Roche Das Redaktionskomitee 7 Vorwort 9 I. Geschichte der Immunologie in Deutschland Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen. be.bra wissenschaft verlag GmbH Berlin-Brandenburg, 2017 KulturBrauerei Haus 2 Schönhauser Allee 37, Berlin post@bebraverlag.de Lektorat: Astrid Volpert, Berlin Umschlag und Satz: typegerecht, Berlin Titelillustration: Janusz Giniewski, Schrift: Minion Pro 10/14 pt Druck und Bindung: Finidr, Český Těšín ISBN Die Geburtsstunde der Immunologie (bis 1920) 13 Axel Hüntelmann Immunologie in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 79 Annette Hinz-Wessels Entwicklung der Immunologie in der Bundesrepublik Deutschland ( ) 127 Annette Hinz-Wessels Entwicklung der Immunologie in der Deutschen Demokratischen Republik ( ) 223 II. Die Gründung der immunologischen Fachgesellschaften in Ost und West und ihre Zusammenführung Florian Neumann, Diethard Gemsa und Joachim R. Kalden Der Immunologen-Verband der Bundesrepublik Deutschland bis Der Immunologen-Verband in der Deutschen Demokratischen Republik bis Der deutsche Immunologen-Verband nach
5 Weitere Entwicklung der DGfI 291 Im Rampenlicht: DGfI-Mitglieder und Preisträger 305 III. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie heute Agnes Giniewski, Ulrike Meltzer, Ottmar Janßen und Carsten Watzl Mitglieder 321 Forschung und Vernetzung 323 Nachwuchsförderung 328 Öffentlichkeitsarbeit 334 IV. Die Bedeutung der Immunologie für die heutige Gesellschaft Hans-Hartmut Peter, Reinhold E. Schmidt, Hans-Martin Jäck und Stefan H. E. Kaufmann Das Redaktionskomitee»Festschrift 50 Jahre DGfI«, Berlin, 22. Juni 2017 Von links nach rechts: A. Hüntelmann, M. Röllinghoff, J. Kalden, F. Neumann, D. Gemsa, G. van Zandbergen, S. Meuer, L. Jäger, J. Kaden, A. Giniewski, F. Melchers, A. Hinz-Wessels, U. Meltzer, H.-H. Peter, H.-M. Jäck Anfänge und Grundlagen der modernen Immunologie 341 Großer Nutzen einer vielfältigen immunologischen Diagnostik 343 Explosion immunologischer Therapieverfahren in der Klinik 344 Neue Sequenziertechniken und Zell- und Gen-Therapien auf dem Vormarsch 349 Neu und wieder auftretende Infektionskrankheiten und Impfstoffentwicklung 350 Anhang 355 Vorsitz Prof. Dr. Hans-Martin Jäck, Erlangen Redaktion Prof. Dr. Herwart Ambrosius, Leipzig Prof. Dr. Klaus Eichmann, Freiburg Prof. Dr. Frank Emmrich, Leipzig Prof. Dr. Diethard Gemsa, Marburg Dr. Agnes Giniewski, Erlangen Prof. Dr. Volker Hess, Berlin Dr. Annette Hinz-Wessels, Berlin Jaqueline Hirscher, Berlin Theresa Hoppe, Berlin Dr. Axel Hüntelmann, Berlin Prof. Dr. Lothar Jäger, Jena Prof. Dr. Ottmar Janßen, Kiel PD Dr. Jürgen Kaden, Berlin Prof. Dr. Joachim R. Kalden, Erlangen Prof. Dr. Stefan H. E. Kaufmann, Berlin Prof. Dr. Fritz Melchers, Berlin Dr. Ulrike Meltzer, Berlin Prof. Dr. Stefan Meuer, Heidelberg Dr. Sophie Meyer, Berlin Dr. Florian Neumann, München Prof. Dr. Hans-Hartmut Peter, Freiburg Prof. Dr. Martin Röllinghoff, Erlangen Prof. Dr. Reinhold E. Schmidt, Hannover Prof. Dr. Carsten Watzl, Dortmund Prof. Dr. Ger van Zandbergen, Langen DAS REDAKTIONSKOMITEE 7
6 Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Immunologie, am 7. Juli 1967 fand in der Höchster Jahrhunderthalle in Frankfurt eine denkwürdige Veranstaltung statt. Auf Initiative von Hans G. Schwick trafen sich 18 Wissenschaftler und gründeten die Gesellschaft für Immunologie, die 2007 in Deutsche Gesellschaft für Immunologie (DGfI) umbenannt wurde feiert die DGfI ihren 50. Geburtstag, den wir während der Jahrestagung in Erlangen gebührend feiern werden. In diesen 50 Jahren hat sich die DGfI zur weltweit viertgrößten immunologischen Fachgesellschaft mit hoher internationaler Anerkennung entwickelt. Die Geschichte der Immunologie in Deutschland beginnt aber schon vor über hundert Jahren in Berlin mit der Entdeckung der Antikörper und der mit dem ersten Nobelpreis gewürdigten ersten Immuntherapie zur Behandlung von an Diphtherie erkrankten Kindern. Das 50-jährge Jubiläum ist ein geeigneter Zeitpunkt, sowohl den Fortschritt der Immunologie in Forschung und Klinik in Deutschland als auch die Entwicklung der beiden deutschen immunologischen Fachgesellschaften in einer Festschrift zu würdigen. Zur Realisierung dieses ambitionierten Projektes traf sich am 6. Juni 2016 eine kleine Gruppe von Immunologen inklusive Kollegen aus der ehemaligen DDR mit Historikern des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Charité Berlin und dem Verlag Neumann & Kamp Historische Projekte am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. Am Ende des Tages war das Projekt»Festschrift Immunologie in Deutschland«geboren. Mit dieser Festschrift möchten wir Sie zuerst auf eine Reise in die Vergangenheit entführen und die Entwicklung des Faches Immunologie in der deutschen Forschungslandschaft von der Entdeckung und der ersten klinischen Anwendung der Antikörper durch Emil v. Behring, Shibasaburō Kitasato und Paul Ehrlich, über den beispiellosen Niedergang der Immunologie mit dem Exodus hervorragender Immunologen nach 1930, bis hin zu der nobelpreisgekrönten Etablierung der Hybridomtechnik durch Georges Köhler und César Milstein im Jahre 1975 beleuchten. Allein dieses Kapitel hat drei Historiker der Charité über ein Jahr lang beschäftigt. Die Weiterentwicklung und der rasante Fortschritt der immunologischen Forschungslandschaft in Deutschland nach 1975 ist ein weiteres und noch viel ehrgeizigeres Forschungsprojekt, das wir in Zusammenarbeit mit unseren Freunden vom Institut für Geschichte der Medizin und Ethik an der Charité und DGfI-Mitgliedern in den nächsten Jahren in Angriff nehmen wollen. VORWO R T 9
7 Das zweite Kapitel beschreibt die Entwicklung der immunologischen Fachgesellschaften in den ehemaligen beiden deutschen Staaten (BRD und DDR) nach 1945 und deren Zusammenführung nach der Wiedervereinigung. Im dritten Kapitel geben wir ihnen einen Überblick über unsere Fachgesellschaft heute mit all ihren gegenwärtigen Aktivitäten und fassen schließlich im vierten Kapitel die Bedeutung der Immunologie für die heutige Medizin und Volksgesundheit zusammen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitgliedern des Redaktionskomitees für ihren Enthusiasmus und die in dieses Vorhaben investierte Zeit bedanken. Das Projekt»Festschrift«wurde aber erst durch äußerst großzügige Spenden einiger DGfI-Mitglieder sowie verschiedener mit unserer Gesellschaft eng verbundener Firmen ermöglicht. Auch ihnen gebührt unser herzlichster Dank für diese bedeutsame Unterstützung. Zu guter Letzt möchte ich Dr. Agnes Giniewski, die Koordinatorin für das DGfI-Projekt»Immunologie für Jedermann«, erwähnen. Ohne ihre unermüdliche Unterstützung hätte diese Publikation niemals bis zur Jahrestagung fertig gestellt werden können. Das bisher durch die DGfI Erreichte ist dem Einsatz aller unserer Mitglieder zu verdanken, die so lebhaft zu den Aktivitäten der Gesellschaft und zum hohen internationalen Ansehen der deutschen Immunologie beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist hier der Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen, die während der letzten 50 Jahre die DGfI in ehrenamtlicher Funktion unterstützt haben. Gemeinsam werden wir unsere Führungsposition innerhalb der Familie der immunologischen Gesellschaften stärken und uns den wissenschaftlichen und forschungspolitischen Herausforderungen der Zukunft stellen können. Mit den Worten»Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten«von Wilhelm von Humboldt wünsche ich Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre unserer Festschrift! Prof. Dr. Hans-Martin Jäck Vorsitzender des Redaktionskomitees 10 VORWO R T
8 I. Geschichte der Immunologie in Deutschland Axel Hüntelmann Annette Hinz-Wessels
9 Die Geburtsstunde der Immunologie (bis 1920) 1 Axel Hüntelmann Schwangerschaft und internationale Geburtshelfer Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte und jeder Geburt geht eine Schwangerschaft voraus. Als Geburtsstunde der Immunologie wird seit vielen Jahrzehnten der Dezember 1890 terminiert, als Emil Behring ( ) und der Japaner Shibasaburo Kitasato ( ) ihren gemeinsamen Artikel»Ueber das Zustandekommen der Diphtherie- Immunität und der Tetanus-Immunität bei Thieren«in der Deutschen Medicinischen Wochenschrift (DMW) veröffentlichten. 2 Doch gehen, um im Bild der Geburt zu bleiben, der Geburtsstunde eine längere Schwangerschaft und eine kurze Zeit der Wehen voraus. Als Geburtshelfer und Paten waren neben Behring und Kitasato eine Reihe von Wissenschaftlern beteiligt. Drei maßgebliche Paten der Immunologie waren der Engländer Edward Jenner ( ), der Franzose Louis Pasteur ( ) und Robert Koch ( ). Aus dem praktischen medizinischen Handeln heraus hatten Jenner und andere beobachtet, dass die absichtlich herbeigeführte Infektion mit Kuhpocken die so Behandelten vor einer späteren Infektion mit menschlichen Pocken schützt. Jenner war nicht der einzige und erste, der diese Beobachtung gemacht und diese Praxis ausgeübt hatte. Durch seine Publikation und sein Engagement beförderte er wesentlich die Popularisierung und praktische Durchsetzung dieser Methode, obgleich die von Jenner als Vakzination bezeichnete Methode der Impfung von seinen medizinischen Kollegen stark kritisiert wurde. In Schleswig hatte bspw. Peter Plett schon 1791 einige Kinder mit Kuhpockenlymphe geimpft, jedoch geriet diese einmalige Aktion in Vergessenheit. 3 Ebenso wie die 1 Für die Diskussion des Kapitels möchte ich den Mitgliedern der Redaktion danken. Für die Durchsicht und Kommentierung des Kapitels und die hilfreichen Kommentare danke ich besonders Hans-Martin Jäck, Stefan H. E. Kaufmann, Ger van Zandbergen, Diethard Gemsa und Hans-Hartmut Peter. Für den Scan von Abbildungen danke ich Klaus von Fleischbein-Bringschulte. 2 Vgl. Emil Behring/Shibasaburo Kitasato: Ueber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus-Immunität bei Thieren, in: DMW 16 (1890), S f. 3 Vgl. Peter C. Plett: Peter Plett und die übrigen Entdecker der Kuhpockenimpfung vor Edward Jenner, in: Sudhoffs Archiv 90 (2006), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 13
10 Robert Koch in seinem Laboratorium in Kimberley, Südafrika, 1896 Emil Behring und Shibasaburo Kitasato: Ueber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus-Immunität bei Thieren, in DMW 1890 Vorläufer waren auch Nachahmer wie Samuel Thomas von Soemmerring 4 wichtig, die Jenners Verfahrensweise in deutschen Territorien übernahmen, praktizierten und die Erfolge propagierten, so dass sich das Prinzip der Kuhpockenimpfung rasch durchsetzte. Ein weiterer Pate der Immunologie war der Franzose Louis Pasteur. Seit den 1850er- Jahren hatte er sich mit Gärung und der Versäuerung von Wein, Bier und Milch beschäftigt. Pasteur war davon überzeugt, dass an beiden Prozessen unterschiedliche Mikroorganismen beteiligt sein müssten. Er versuchte zu beweisen, dass der allgegenwärtige Staub in der Luft ebenfalls Mikroorganismen enthielt und Gärungsprozesse über den Kontakt mit der Luft ausgelöst wurden. Überdies vertrat Pasteur die Ansicht, dass Fäulnis ebenfalls einen Prozess der Gärung darstelle, der aus der Umwandlung und Zersetzung organischer Substanzen durch Mikroorganismen entstehe. Aus diesen Überlegungen entwickelte er die Keimhypothese. In den folgenden Jahren verlagerte sich der Arbeitsschwerpunkt des studierten Chemikers Pasteur zunehmend von der organischen Chemie zur Mikrobiologie, als deren Begründer er gilt. Mitte der 1860er-Jahre wurde Pasteur von der französischen Regierung beauftragt, die pébrine genannte Fleckenkrankheit der Seidenraupen zu untersuchen, die die französische Seidenindustrie bedrohte. Ohne den verschlungenen Pfaden seiner Forschung nachzugehen, soll hier festgehalten werden: Pasteur kam nach mehreren Jahren der Forschung zu dem Schluss, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handeln müsse. Diese Erklärung, die er in Vorträgen über die theórie des germes in den 1870er-Jahren weiter ausführte, stützte die damals umstrittene Erregerlehre, wonach Krankheiten durch Mikroorganismen verursacht würden. 5 Pasteurs Pendant und Gegenspieler in Deutschland war Robert Koch. Koch hatte in den 1860er-Jahren Medizin in Göttingen studiert und anschließend an verschiedenen Orten als Arzt praktiziert. Am Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 nahm er 4 Vgl. Friedrich Jännicke: Sömmerring, Samuel Thomas von, in: Allgemeine Deutsche Biographie 34 (1892), S Zu Pasteur und seinen Forschungen s. Gerald L. Geison: The Private Science of Louis Pasteur, Princeton DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 15
11 als Sanitätsarzt teil. Nach Kriegsende arbeitete Koch als Kreisphysikus in Wollstein, in der preußischen Provinz Posen. In der ländlich geprägten Gegend war Koch sporadisch mit dem Ausbruch von Milzbrand konfrontiert, einer Infektionskrankheit, die Tier und Mensch gleichermaßen befallen konnte und in der Landwirtschaft große Schäden verursachte. Geprägt durch Jakob Henle ( ), bei dem Koch studiert hatte, und beeinflusst durch die Publikation»Untersuchungen über Bakterien«des Botanikers und Mikrobiologen Ferdinand Julius Cohn ( ), forschte Koch in einem kleinen Laboratorium in seiner Praxis zur Verursachung und Ätiologie der Erkrankung und er beschrieb die Entwicklungsgeschichte und Biologie des Milzbrand-Erregers. Dieser war bereits 1849 durch F. A. Aloys Pollender (1799/ ) dargestellt und der Zusammenhang zwischen dem Erreger und der Erkrankung durch den Franzosen Casimir Davaine ( ) bestätigt worden. Gleichwohl wurde den Beobachtungen Davaine s von verschiedener Seite widersprochen. Koch gelang es, den Milzbrand-Erreger (Anthrax) im Kammerwasser von Rinderaugen zu kultivieren und zu beobachten, wie die Erreger Sporen bildeten, welche sich wiederum in Bakterien zurückverwandelten, die typische Krankheitssymptome des Milzbrandes hervorriefen. Diese Sporen erwiesen sich im Versuch gegen äußere Einflüsse wie Hitze oder Trockenheit auch über einen längeren Zeitraum als äußerst widerständig und keimfähig. Durch die Sporen-Bildung konnte Koch erklären, warum Tiere auch nach dem Ausklingen einer Viehseuche zu einem späteren Zeitpunkt erneut erkrankten und die Seuche immer wieder ausbrach. 6 In einer weiteren Publikation erläuterte Koch umfassend seine Arbeitstechniken und die Praktiken, durch die es ihm gelungen war, Krankheitserreger in Reinform zu kultivieren, unsichtbare Mikroorganismen durch Färbung sichtbar zu machen und zu fotografieren. 7 Die Entwicklung technischer Geräte wie das Mikroskop, vor allem die Verbesserung der chromatischen Aberration, und die Praktiken der Sichtbarmachung zur Darstellung der Beweiskette und zur Herstellung»objektiver«Beweise wurden bald wichtiger als der Gegenstand selbst. 8 Eine weitere Krankheit, die Koch genauer untersuchte, war die Wundinfektion. Erste Erfahrungen zur Wundinfektion hatte der Forscher, so Andrew Mendelsohn, auf den Schlachtfeldern des Deutsch-Französischen Krieges sammeln können. 9 Die Ausgangssituation war dafür weitaus schwieriger als beim Milzbrand: Zwar hatten verschiedene Wissenschaftler in entzündeten Wunden Mikroorganismen beobachtet, aber der Zusammenhang zwischen einem Erreger und den Krankheitserscheinungen ließ sich nicht zweifelsfrei nachweisen. Koch differenzierte verschiedene Formen von Organismen, die er in Reinform züchtete. Er definierte den Untersuchungsgegenstand völlig neu: nicht mehr die Erkrankung stand im Fokus der Untersuchung, sondern die Mikroorganismen. Koch injizierte die kultivierten Kleinstlebewesen in unterschiedliche Versuchstiere, um die symptomatischen Krankheitserscheinungen hervorzurufen und zu beobachten, wobei er feststellte, dass es sich um unterschiedliche Wundinfektionskrankheiten handelte. 10 Dabei erzeugte er durch die Infektion von Versuchstieren jeweils eine künstliche Laborinfektion, die zwar nicht mit der Sepsis bzw. der Septicämie des Menschen identisch, aber mit ihr vergleichbar war. Mit seinen Versuchen zur Wundinfektion installierte Koch das Versuchstier als Modellorganismus und übertrug die Ergebnisse anschließend auf den Menschen. 11 Für seine Publikation zur»aetiologie der Wundinfectionskrankheiten«konnte Koch erstmals die zu diesem Thema veröffentlichte Literatur in der Bibliothek des Instituts von Ferdinand Julius Cohn in Breslau auswerten. Zudem befinden sich in Kochs Aufzeichnungen längere Zusammenfassungen von Pasteurs Arbeiten. 12 Dieser hatte sich ebenfalls mit Milzbrand beschäftigt. Während Koch am Ende seiner Publikation zur»ätiologie der Milzbrand-Krankheit«sanitätspolizeiliche Vorschläge machte, um eine Ausbreitung der Viehseuche zu unterbinden, 13 ging Louis Pasteur in den folgenden Jahren einen Schritt weiter. Nachdem es Henry Toussaint ( ) gelungen war, den Erreger der Geflügelcholera zu identifizieren und er Pasteur 1878 Erregerkulturen zugesandt hatte, arbeiteten Pasteur und seine Mitarbeiter an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Geflügelcholera, 14 wobei sie das Prinzip der Impfung gegen Pocken durch Kuh- 6 S. Robert Koch: Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus Anthracis (OA 1876), in: ders.: Gesammelte Werke, Bd. 1, hg. von Julius Schwalbe, Leipzig 1912, S. 5 26; Christoph Gradmann: Krankheit im Labor. Robert Koch und die medizinische Bakteriologie, Göttingen 2005, S ; Bernhard Möllers: Robert Koch. Persönlichkeit und Lebenswerk, , Hannover 1950, S S. Robert Koch: Verfahren zur Untersuchung, zum Konservieren und Photographieren der Bakterien (OA 1877), in: ders: Gesammelte Werke, Bd. 1, hg. von Julius Schwalbe, Leipzig 1912, S Vgl. Thomas Schlich:»Wichtiger als der Gegenstand selbst«. Die Bedeutung des fotographischen Bildes in der Begründung der bakteriologischen Krankheitsauffassung durch Robert Koch, in: ders./martin Dinges (Hg.): Neue Wege in der Seuchengeschichte (= Beihefte MedGG 6), Stuttgart 1995, S S. J. Andrew Mendelsohn: Two Cultures of Bacteriology. Formation and Transformation of a Science in France and Germany, , Diss. Phil. Princeton Vgl. Robert Koch: Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfectionskrankheiten, Leipzig S. Gradmann, Krankheit im Labor, S Ebd., S. 84 f. 13 Koch schlug vor, die Kadaver von an Milzbrand verstorbenen Tieren nicht zu vergraben, sondern diese an der Oberfläche auskühlen zu lassen oder in acht bis zehn Meter tiefen Gruben zu versenken, wo die Temperatur so niedrig ist, dass sich keine oder kaum Sporen bilden können, s. Koch: Ätiologie der Milzbrand- Krankheit, S Vgl. Geison, Private Science, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 17
12 pockenlymphe aufgriffen. 15 Weder Edward Jenner um 1800 noch Louis Pasteur achtzig Jahre später konnten die exakte Wirkweise des Prinzips erklären oder die im Impfstoff wirkenden Agentien benennen es handelte sich um eine Behandlungsmethode, die sich in der Praxis bewährt hatte. Bei der Pockenimpfung wurde den Impflingen der für Menschen unschädliche Kuhpocken-Erreger injiziert, also ein weniger schädlicher avirulenter Erreger sollte vor dem eigentlichen Verursacher schützen. 16 Bei Fortzüchtung der von Toussaint erhaltenen Cholera-Kulturen beobachtete Pasteur, dass sich die Keime in einer Nährbouillon stärker vermehrten und besser gediehen als nach der von Touissant beschriebenen Methode. Über einen längeren Zeitraum versuchte Pasteurs Mitarbeiter Émile Roux ( ) die Cholera-Erreger abzuschwächen. 17 Nachdem man Hühner mit frischen und verschieden alten Cholera-Kulturen infiziert hatte, stellte man fest, dass von denen, die mit der ältesten Kultur behandelt worden waren, elf von zwölf Versuchstieren überlebt hatten. 18 Offensichtlich waren die Erreger während des Alterungsprozesses bzw. durch den länger ausgesetzten Kontakt mit der Umgebungsluft abgeschwächt worden. 19 Auf Grundlage dieser Annahme versuchten Pasteur und seine Mitarbeiter, den Erreger über unterschiedlich lange Zeiträume abzuschwächen und Stämme mit unterschiedlicher Virulenz fortzuzüchten. 20 Der ältere Stamm mit geringer Virulenz sollte bei Hühnern, denen die Bakterienkulturen injiziert wurden, eine Grundimmunisierung mit leichten Krankheitserscheinungen auslösen. Nach Abklingen etwaiger Krankheitssymptome wurden die Hühner ein weiteres Mal mit einem stärker virulenten Erregerstamm geimpft, ohne dass die Tiere im Gegensatz zu den nicht vorgeimpften Hühnern größeren Schaden nahmen. Gegebenenfalls wurden die Hühner ein drittes Mal geimpft, bevor ihnen am Ende ein hochvirulenter Erregerstamm injiziert wurde. Die derart präparierten Hühner sollten nun keine Krankheitssymptome mehr zeigen und gegen den Erreger immun sein Vgl. Louis Pasteur: Die Hühnercholera, ihr Erreger, ihr Schutzimpfstoff, Leipzig 1923 [OA fr. 1880], S. 38 und Zur Pockenimpfung bei Jenner und die im 19. Jahrhundert ausgeführte Praxis s. Eberhard Wolff: Einschneidende Maßnahmen. Pockenschutzimpfung und traditionelle Gesellschaft im Württemberg des frühen 19. Jahrhunderts (= Beihefte MedGG 10), Stuttgart S. Antonio Cadeddu: Pasteur et le choléra des poules. Révision critique d un récit historique, in: History and Philosophy of the Life Sciences 7 (1985), S S. Hervé Bazin: Vaccination a History. From Lady Montagu to Genetic Engineering, Esher 2011, S S. Pasteur, Hühnercholera, S , insbes. S S. Pasteur, ebd.; Geison, Private Science, S ; Bazin, Vaccination, S Vgl. Pasteur, ebd., S ; Geison, ebd., S. 33, 39 40, 182, 245; Bazin, ebd., S ; zur Bedeutung der Geflügelcholera s. Axel C. Hüntelmann/Klaus Cussler: Die Geflügelcholera um Eine Epizootie im Schnittpunkt von Biopolitik, Landwirtschaft, Tierheilkunde und Humanmedizin, in: Johann Schäffer Das unter Laborbedingungen als wirksam beschriebene Verfahren erwies sich jedoch in der Praxis als wenig brauchbar. Zum einen variierten die Bakterienkulturen, so dass Tiere nach der Impfung starben. Weiterhin erkrankten zahlreiche Tiere, einhergehend mit einer starken Beeinträchtigung des Allgemeinzustands und einer Chronifizierung von Krankheitserscheinungen. Insbesondere erwies sich die mehrfache Impfung der Tiere in der Praxis als schwierig, aufwendig und teuer. Schließlich bot die aktive Impfung keinen endgültigen Schutz, wie Pasteur angenommen hatte: Die geimpften Hühner waren nur für einen begrenzten Zeitraum immun. 22 Gleichwohl war es Pasteur und seinen Mitarbeitern erstmals gelungen, systematisch einen Impfstoff im Labor zu entwickeln und herzustellen. In ähnlicher Weise entwickelten Henry Toussaint sowie Louis Pasteur und dessen Mitarbeiter einen Impfstoff gegen Milzbrand. Die Bakterienkulturen wurden durch Sauerstoff, Hitze, Phenol oder andere Chemikalien abgeschwächt und anschließend Versuchstieren injiziert, die daraufhin leichte Krankheitserscheinungen aufwiesen. Nach einer späteren Injektion mit nicht abgeschwächten, vollvirulenten Bakterienkulturen zeigten die vorbehandelten Tiere ebenfalls nur geringe Krankheitserscheinungen, während unbehandelte starben. Die Demonstration der Versuche und Bestätigung der Ergebnisse gerieten zu einem öffentlichkeitswirksamen Medienereignis. Nachdem der Tierarzt J. Hippolyte Rossignol ( ) die Wirksamkeit des vermeintlichen Milzbrand-Impfstoffes angezweifelt hatte und der Landwirtschaftsverein von Melun einen Beweis für die Wirksamkeit forderte, behandelte man im Mai 1881 auf Rossignols Initiative hin auf dem Anwesen des Barons La Rochette in Pouilly-le-Fort 25 Schafe mit abgeschwächten Kulturen des Milzbrand-Erregers. Am 31. Mai wurde fünfzig Tieren, den 25 behandelten und weiteren 25 unbehandelten Schafen, eine Dosis mit vollvirulenten Bakterienkulturen verabreicht und zwei Tage später nahmen Pasteur und eine breite Öffentlichkeit aus Politikern, Veterinärmedizinern, Landwirten und Reportern die Ergebnisse in Augenschein: von den vorbehandelten Schafen befanden sich mit einer Ausnahme alle bei guter Gesundheit, von den unbehandelten Schafen hingegen waren zahlreiche gestorben oder schwer erkrankt. Die Wirksamkeit der von Pasteur und sei- (Hg.): Mensch Tier Medizin. Beziehungen und Probleme in Geschichte und Gegenwart, Gießen 2014, S Vgl. R. Manninger: Geflügelcholera (Cholera avium. Pasteurellosis avium), in: Wilhelm Kolle et al. (Hg.): Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, Bd. 6, Teil 1, 3. Aufl., Jena 1929, S , hier S. 550; R. Klett: Die Serumtherapie der Geflügelcholera, in: M. Klimmer/A. Wolff-Eisner (Hg.): Handbuch der Serumtherapie und Serumdiagnostik in der Veterinär-Medizin, Leipzig 1911, S , hier S. 244; Hüntelmann/Cussler, Geflügelcholera um DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 19
13 nen Mitarbeitern entwickelten Impfmethode schien damit bewiesen und die öffentliche Erprobung des Impfstoffs wurde als medizinischer Durchbruch gefeiert. 23 Jenner, Pasteur und Koch stehen stellvertretend Pate für Entwicklungen, Methoden und Prinzipien, die das Aufkommen der Immunologie Ende des 19. Jahrhunderts ermöglicht haben: Jenner sorgte für die Verwissenschaftlichung und Verbreitung der präventiv ausgerichteten volksmedizinischen Pockenschutzimpfung. Pasteur machte sich diese Maxime zu Eigen und entwickelte einen Impfstoff gegen Geflügelcholera und Milzbrand im Labor. Er zeigte, dass sich das Prinzip der Schutzimpfung auch auf andere Krankheiten übertragen ließ. Allerdings konnte er weder die wirksamen Agentien genau beschreiben noch die exakte Wirkungsweise und die immunologischen Prozesse erklären. An der Durchsetzung der Erregerlehre hatte Koch maßgeblich Anteil. (Das Vorhandensein von Mikroorganismen als Ursache einer Erkrankung wurde zwar seit Jahrzehnten ernsthaft diskutiert und einzelne Erreger waren bereits bekannt. Beschreibung und Nachweis der Erreger waren jedoch ungenau und unspezifisch, so dass deren Veröffentlichung von Diskussionen über ihre Aussagekraft begleitet war.) Kochs besonderes Verdienst bestand darin, methodische und praktische Neuerungen in die Medizin eingeführt zu haben. Durch den notwendig aufeinander folgenden Dreischritt der Identifizierung spezifischer Erreger im erkrankten Organismus, die Reinzüchtung dieser Erreger und die erneute Auslösung von Symptomen dieser bestimmten Krankheit konnte Koch nachweisen, dass die identifizierten Mikroorganismen in Verbindung mit der Krankheit standen und verursachendes Agens waren. Darüber hinaus führte er neue Praktiken der Züchtung, Kultivierung und Fixierung der Bakterien ein, um diese dauerhaft im Präparat und mikrofotografisch darstellen zu können. Dadurch und dank ihrer detaillierten Beschreibung konnte Koch spezifische Mikroorganismen als Ursache des Milzbrands und der Wundinfektionen objektiv 24 und unabhängig von Zeit, Ort und ausführender Person nachweisen. 25 Die Identifikation eines spezifischen Erregers, der eine bestimmte Erkrankung verursachte und entsprechende Symptome auslöste, hatte 23 Der kurze Überblick beteiligt sich nicht an der von verschiedenen Publikationen diskutierten Frage, welchen Anteil an der Entwicklung des Impfstoffes Henry Toussaint, Louis Pasteur, Émile Roux oder Charles Chamberland hatten. Hier soll nur umrissen werden, wie sich das Prinzip der Impfung aus der Praxis entwickelt hat, s. Antonio Cadeddu: Pasteur et la vaccination contre le charbon. Une analyse historique et critique, in: History and Philosophy of the Life Sciences 9 (1987), S ; Geison, Private Sciene, S ; Bazin, Vaccination, S Bei der späteren praktischen Anwendung kam es immer wieder zu Schwierigkeiten, weil der gegen Milzbrand hergestellte Impfstoff in seiner Wirkung stark variierte. 24 Lorraine Daston und Peter Galison sprechen in diesem Zusammenhang von einer»mechanischen Objektivität«, s. Lorraine Daston/Peter Galison: Objektivität, Frankfurt a. Main 2007, Kap S. hierzu auch die Beiträge in Thomas Schlich/Christoph Gradmann (Hg.): Strategien der Kausalität. Konzepte der Krankheitsverursachung im 19. und 20. Jahrhundert, Pfaffenweiler Das Areal der ca errichteten Bakteriologischen Abteilung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes bzw. Reichsgesundheitsamtes, ca. 1920er-Jahre jedoch weitere Implikationen, die mit dem Begriff»Spezifität«beschrieben wurden. Es lag nicht nur ein kausaler Zusammenhang zwischen Erreger und Krankheit vor, sondern jede (Infektions-)Krankheit wurde durch einen spezifischen Erreger ausgelöst, der eben nur diese, aber keine anderen Erkrankungen verursachen konnte. 26 Die Erregerlehre und die Methode zum Nachweis von Bakterien als Krankheitsverursacher setzten sich in den folgenden Jahren endgültig durch, insbesondere nachdem Robert Koch zum Regierungsrat im 1876 gegründeten Kaiserlichen Gesundheitsamt (KGA) ernannt worden war. 27 Die Erreger zahlreicher Krankheiten wurden in kurzer Zeit beschrieben; es begann eine regelrechte»jagd«auf Mikroben. 28 Nachdem es Koch 26 Vgl. zur Spezifität Pauline M. H. Mazumdar: Species and Specificity. An Interpretation of the History of Immunology, Cambridge Zum KGA s. Axel C. Hüntelmann: Hygiene im Namen des Staates. Das Reichsgesundheitsamt , Göttingen Eine solche Jagd suggeriert Paul de Kruif: Mikrobenjäger, 9. Aufl. (OA engl. 1926), Zürich DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 21
14 1882 gelungen war, den Erreger der Tuberkulose zu identifizieren, entbrannte zwischen seiner und Pasteurs Forschergruppe ein Wettstreit darum, wer als erster den Erreger der Cholera isolieren und beschreiben würde. 29 Von der Lösung dieser Aufgabe erhofften sich die Wissenschaftler natürlich auch Ruhm, vor allem aber legte die Erstbeschreibung den Grundstock für eine genaue Darstellung des Erregers, seiner Biologie, der Übertragungsweise und der Verbreitungswege. Kenntnisse hierüber waren notwendig, um geeignete sanitätspolizeiliche Maßnahmen zur Eingrenzung und Eindämmung einer ansteckenden Krankheit vornehmen zu können. Die auf die Abtötung des Erregers abzielende Desinfektion und Sterilisation als Form der Seuchenbekämpfung wurde vor allem in Deutschland erforscht und praktiziert. In Frankreich bildeten die Kenntnisse über die Mikrobiologie des Erregers die Grundlage, um präventiv wirkende Impfstoffe zu entwickeln. 30 Schließlich lassen sich an den Arbeiten von Jenner, Pasteur und Koch einige Merkmale aufzeigen, die nicht nur für Behring und Kitasato, sondern für die Geschichte der Immunologie im 20. Jahrhundert maßgebend sind: Jenner und Pasteur und die Rezeption ihrer Arbeiten in Deutschland offenbaren, wie international die Forschung bereits im (frühen) 19. Jahrhundert war. Deshalb kann die Geschichte der Immunologie in Deutschland immer nur einen Teilausschnitt einer Geschichte der Immunologie darstellen. 31 Die gegenseitige Konkurrenz und Referenz zwischen dem Chemiker Pasteur und dem Mediziner Koch zeigen ferner, dass Immunologie von Beginn an interdisziplinär war. Darüber hinaus verweist Kochs Veröffentlichung zu den technischen Verfahren bei der Untersuchung von Bakterien 32 darauf, dass Apparate und technische Verfahren von Beginn an eine Voraussetzung für immunologische Forschung waren. Zur Standardausstattung im Labor gehörte sowohl bei Pasteur als auch bei Koch das Mikroskop. Seit den 1860er-Jahren hatte sich die Untersuchung auf die Mikroebene verlagert. Eine Limitierung der Forschung ergab sich aus den technischen Bedingungen, die bis zum Ende des Jahrhunderts stetig verbessert wurden. Überdies war in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die laboratory revolution 33 so weit fortgeschritten, dass immunologische Forschung in einer artifiziellen Umgebung, im Labor, losgelöst von Klinik und Praxis, 29 Vgl. Annick Perrot/Maxime Schwartz: Robert Koch Louis Pasteur. Duell zweier Giganten, Darmstadt Zu den unterschiedlichen Kulturen der Bakteriologie Mendelsohn, Two Cultures of Bacteriology. 31 S. hierzu maßgeblich Arthur M. Silverstein: A history of immunology, San Diego Vgl. Koch, Verfahren. 33 Vgl. die Beiträge in Andrew Cunningham/Perry Williams (Hg.): The laboratory revolution in medicine, Cambridge betrieben werden konnte. Gleichzeitig waren die ersten Impfstoffe aus der Praxis heraus entwickelt worden. Mit dem Begriff»Impfung«beschrieb man nicht nur die Verabreichung eines Schutzstoffes, darunter wurde allgemein botanisch das»einschneiden«oder Pfropfen verstanden, das Einbringen eines Stoffes: So beschreibt Koch mit»impfversuchen«das Einbringen von Bakterienkulturen bzw. genauer das Einschneiden der Haut des Versuchstieres und das Einbringen von Blut oder anderen Krankheitsstoffen, die er als Impfmaterial bezeichnete. 34 Ebenso hatte der Begriff»Immunität«noch eine andere Bedeutung. Zwar impliziertete er, wie auch späterhin, dass man frei von Symptomen, das heißt, unempfindlich gegen eine Krankheit blieb oder widerstandsfähig war. Wie diese Immunität wirkte, darüber gab es jedoch unterschiedliche Meinungen. So wähnte Pasteur Stoffe im Körper des erkrankten Organismus, die den Bakterien als Nahrung dienten und nachdem diese durch abgeschwächte Mikroorganismen aufgezehrt war und die Quelle versiegte, sei der Körper immun. Den in komprimierter Darstellung hier aufgezeigten internationalen Kontext der Entstehung und Entwicklung der deutschen Immunologie gilt es weiterhin mitzudenken. Nachfolgend konzentriert sich der Beitrag auf die Entwicklungen in Deutschland. Geburtsstunde der Immunologie Dem Artikel»Ueber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus- Immunität bei Thieren«und den in diesem dargestellten Forschungsergebnissen gingen drei Arbeitsschritte voraus: erstens die Identifizierung des Diphtherie-Erregers durch Friedrich Löffler ( ), zweitens die durch Émile Roux und Alexandre Yersin ( ) beschriebene Beobachtung, dass die für Diphtherie typischen Krankheitserscheinungen nicht durch den Erreger, sondern durch die giftigen Stoffwechselprodukte der Bakterien ausgelöst werden, und drittens die Arbeiten von Emil Behring zur inneren Desinfektion im Vorfeld der Forschungen zur Immunität. Auf knapp achtzig Seiten fasste der an das Kaiserliche Gesundheitsamt (KGA) abkommandierte preußische Stabsarzt Friedrich Löffler im Dezember 1883 seine Arbeiten über den Einfluss der Mikroorganismen auf die Entstehung der Diphtherie zusammen. Als Mitarbeiter Robert Kochs hatte er im Bakteriologischen Labor des KGA gearbeitet. Löffler referierte alle bisherigen Studien zur Diphtherie und folgerte, dass es zwar Unter- 34 Vgl. Koch, Ätiologie, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 23
15 Links: Friedrich Löffler als Sanitätsoffizier, ca. 1880er-Jahre Rechts: Friedrich Löffler und Robert Koch, ca. 1880er-Jahre suchungen gebe, in denen über Mikroorganismen im erkrankten Gewebe berichtet würde, allerdings seien diese bisher in keiner Arbeit in ihrem Zusammenhang als Ursache der Diphtherie-Erkrankung dargestellt worden. 35 Ausführlich beschrieb Löffler die»mit Hülfe der neuesten Untersuchungsmethoden«durchgeführten Arbeiten, wobei er in seiner Beweisführung Koch folgte und erstmals die als»postulate«36 bezeichneten notwendig zu erfüllenden Bedingungen beschrieb, damit ein Mikroorganismus eindeutig als Ursache einer Erkrankung gelten konnte. Löffler untersuchte pathologisches Gewebematerial von 26»Fällen«nach übereinstimmenden, gehäuft auftretenden Mikroorganismen deren Existenz mit dem erkrankten Gewebe korrelierte. In den Gewebeproben fand er sowohl»mikrokokken«als auch»stäbchen«, die er getrennt voneinander isolierte und in Reinkultur nach der Koch schen Kulturmethode auf festem Nährboden züchtete. Die Isolierung der Kulturen erwies sich bei diesem Vorgang als schwierig: Die Organproben mussten von äußerlichen bakteriellen Verunreinigungen gesäubert werden und auch bei der Übertragung des Gewebes auf den Nährboden musste man vorsichtig vorgehen. Mit den Reinkulturen der gehäuft auftretenden Mikroorganismen wurden im nächsten 35 Vgl. Löffler, Untersuchungen, S. 436 f. 36 Die als Koch sche Postulate bezeichneten Bedingungen wurden zwar von Robert Koch als Bedingung für den Nachweis spezifischer Krankheitserreger formuliert, aber von ihm selbst nicht als solche bezeichnet. Erstmals fasste Löffler diese Abfolge der Bedingungen in seinem Artikel über die Erreger der Diphtherie zusammen, s. Friedrich Löffler: Untersuchungen über die Bedeutung der Mikroorganismen für die Entstehung der Diphtherie beim Menschen, bei der Taube und beim Kalbe, in: MKGA 2 (1884), S , hier S. 424 zusammen; s. auch Christoph Gradmann: Alles eine Frage der Methode. Zur Historizität der Koch schen Postulate, , in: Medizinhistorisches Journal 43 (2008), S Schritt verschiedene Tierspezies infiziert, um festzustellen, ob sich eine der menschlichen Diphtherie ähnliche Erkrankung erzeugen lässt. Gleichzeitig wollte Löffler herausfinden, ob bestimmte Tierarten besonders für Diphtherie empfänglich sind. In zahllosen Versuchsanordnungen wurden die Reinkulturen auf Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Kaninchen, Tauben, Hühner, ein Hund und vier Affen übertragen, wobei sich das Meerschweinchen als besonders anfällig für Diphtherie erwies. 37 Am Ende seiner Untersuchung äußerte Löffler den Verdacht, dass die Krankheitserscheinungen und der Tod der Versuchstiere nicht durch die Bakterien selbst verursacht werden, sondern durch von»den Bacillen producirt[e] chemische Körper «. Er regte abschließend an,»die wirksame Bekämpfung der durch das bacilläre Gift hervorgerufenen Intoxication ins Auge«zu fassen. 38 Einige Jahre später bestätigten Émile Roux und Alexandre Yersin die Vermutung Löfflers. Sie hatten beobachtet, dass Versuchstiere, denen man Kulturen des Diphtherie- Erregers injiziert hatte, schwere Schädigungen der inneren Organe erlitten, in denen sich allerdings keine Erreger nachweisen ließen. Daraus schlossen sie, dass die Bakterien einen Giftstoff produzieren müssten, der sich im Körper verteilt und an Stellen jenseits der Injektionsstelle bzw. der Eintrittspforte des Erregers in den Körper die Organschädigungen auslöst. 39 Ihnen war es am 1887 gegründeten Institut Pasteur in Paris gelungen, aus Diphtherie-Bakterienkulturen einen Stoff mit toxischen Eigenschaften zu filtrieren, mit dessen Hilfe die für Diphtherie typischen Krankheitssymptome ausgelöst werden konnten. 40 Ludwig Brieger ( ) und Carl Fraenkel ( ), Mitarbeiter am Institut für Hygiene der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, untersuchten den Bakteriengiftstoff näher und wiesen durch Fällungsreaktionen nach, dass es sich um einen Eiweißkörper, ein Albumin oder Pepton, handeln müsse. Sie bezeichneten die Substanz als»toxalbumine«. 41 Mit der Identifizierung von Bakterien als Krankheitsursache begann die Erforschung ihrer Entwicklung und deren Verbreitungs- und Übertragungswege. Die wissenschaft- 37 Vgl. Löffler, Untersuchungen, S ; zusammengefasst in Hüntelmann, Hygiene, S Vgl. ebd., S. 482 und S. Friedrich Löffler: Der gegenwärtige Stand der Frage nach der Entstehung der Diphtherie, in: DMW 16 (1890), S , Vgl. Émile Roux/Alexandre Yersin: Contribution à l étude de la diphthérie, in: Annales de l Institut Pasteur 2 (1888), S ; dies.: Contribution à l étude de la diphthérie (2e mémoire), in: Annales de l Institut Pasteur 3 (1889), S ; sowie dies.: Contribution à l étude de la diphthérie (3e mémoire), in: Annales de l Institut Pasteur 4 (1890), S Vgl. Ludwig Brieger/Carl Fraenkel, Untersuchungen über Bakteriengifte, in: BKW 27 (1890), S. 246, , ; Carola Throm: Das Diphtherieserum. Ein neues Therapieprinzip, seine Entwicklung und Markteinführung, Stuttgart 1995, S. 34 f. 24 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 25
16 lichen Untersuchungen zielten u. a. darauf ab, die Übertragung der Bakterien präventiv zu vermeiden. Während Louis Pasteur in Frankreich mit Hilfe der Bakterien zu Impfstoffen forschte, die präventiv den geimpften Organismus an den Erreger gewöhnen sollten, zielten die Arbeiten Robert Kochs und seiner Mitarbeiter darauf ab, die Erreger zu bekämpfen und abzutöten. 42 Als Regierungsrat und Mitglied des KGA testete Koch, nachdem eine Reihe von Krankheitserregern identifiziert worden waren, Verfahren zur Abtötung von Bakterien durch verschiedene Chemikalien wie»schwefelige Säure«oder Carbolsäure, Wasserdampf oder heißer Dampf. 43 Bezeichnete»Infektion«das Eindringen oder Hineintun von krankheitsübertragenden Stoffen oder mikroskopisch kleiner Lebewesen, gemeinhin als Ansteckung durch Krankheitserreger benannt, so zielte die Des-Infektion auf die Negierung dieser Ansteckung, meistens als Entkeimung bezeichnet; sie sollte die Übertragung und das Eindringen der pathogenen Mikroorganismen unterbinden. Selbst wenn in den 1880er-Jahren noch nicht alle Krankheitserreger bekannt waren, galt es, vermeintliche Ansteckungs- und Infektionsstoffe unschädlich zu machen und zu vernichten, um eine Verbreitung der krankmachenden Stoffe zu verhindern. 44 Dies sollte durch das Abwaschen von Oberflächen oder Wänden mit schwefeliger oder Carbolsäure, per Versprühen von heißem Wasserdampf geschehen, wobei beklagt wurde, man könne Krankheitserreger im Wasser oder in der Luft nur schwer abtöten. In den folgenden Jahren wurden zahlreiche Chemikalien auf ihre desinfizierende Wirkung hin getestet. In dieser Zeit prüfte Emil Behring, damals Militärarzt in Posen, ausführlich chemische Substanzen zur antiseptischen Wundbehandlung. Im Unterschied zu Koch beabsichtigte Behring aber nicht, alle Bakterien abzutöten, was ihm nur schwer möglich schien. Vielmehr sollte der Körper durch die Behandlung mit Chemikalien»konserviert«und vor infektiösen Stoffen bewahrt werden, so wie»man einen Schinken durch Räuchern gegen Verwesung schützt«. 45 Jodpräparate schienen ihm besonders geeignet und im Tierversuch untersuchte er den Einfluss von Jodverbindungen auf den lebenden Organismus. Zwar konnte das verabreichte Jodoform die Versuchstiere dahingehend schützen, dass die Bakterien ihre Wirkung nicht voll entfalteten und abstarben, Behring 42 Vgl. Mendelsohn, Two Cultures of Bacteriology. 43 S. hierzu zahlreiche Beiträge in den ersten beiden Bänden der MKGA. 44»Das Ziel, in allen Fällen mit Sicherheit desinficiren zu können [ ]«, s. Robert Koch: Ueber Desinfection, in: MKGA 1 (1881), S Vgl. Emil Behring: Ueber Jodoform und Jodoformwirkung, in: DMW 8 (1882), S , hier S. 146; sowie ders.: Die Bedeutung des Jodoforms in der antiseptischen Wundbehandlung, in: DMW 8 (1882), S , 336 f. S. auch Heinz Zeiss/Richard Bieling: Emil von Behring. Gestalt und Werk, Berlin 1941, S , 56. stellte allerdings auch fest, dass die chemischen Substanzen den Organismus schädigen und Vergiftungserscheinungen hervorrufen konnten. 46 Nach seiner Versetzung als Militärarzt und der zwischenzeitlichen Ausbildung und Prüfung als Kreisarzt setzte Behring seine wissenschaftlichen Arbeiten 1887 für ein Jahr unter der Leitung von Carl Binz ( ) am Pharmakologischen Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn fort. Dort prüfte er die spezifisch antitoxischen und bakteriziden Eigenschaften chemischer Substanzen wie Silberlösungen, Quecksilbersublimat und Creolin. 47 Überdies hatte Behring beobachtet, dass analog zu anderen Desinfektionsmitteln das Blut bzw. Serum von Ratten in der Lage war, das Wachstum von Milzbranderregern stark zu hemmen oder die Erreger in vitro abzutöten. 48 Nach einem kurzen Intermezzo am Militärärztlichen Friedrich-Wilhelm-Institut wurde Behring im Juli 1889 an das Koch sche Institut für Hygiene abkommandiert. Hier machte er die Bekanntschaft mit Shibasaburo Kitasato, mit dem er 1890 den Artikel»Ueber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus-Immunität bei Thieren«verfassen sollte. Der japanische Bakteriologe war 1885 zur medizinischen Fortbildung nach Deutschland gekommen und im Institut für Hygiene mit der Erforschung des Tetanus-Erregers betraut worden gelang es Kitasato, den Erreger zu isolieren und in Reinform zu züchten. Am Institut für Hygiene in Berlin vereinigte Emil Behring die beiden in Bonn verfolgten bzw. begonnenen Forschungslinien. Er setzte zum einen die Studien zur»inneren Desinfektion«fort und vertiefte weiterhin die Arbeiten zur bakteriziden Wirkung bestimmter Blutsera. Behring bekämpfte Krankheitserreger, indem er den Versuchstieren vor oder nach der Injektion von Bakterienkulturen chemische Substanzen injizierte, deren desinfizierende Wirkung bekannt war. Durch die»innere Desinfektion«gelang es ihm, den Tod der mit Bakterien infizierten Tiere hinauszuzögern oder sogar zu ver- 46 Vgl. Emil Behring: Ueber Jodoformintoxication, in: DMW 8 (1882), S. 278 f., 297 f.; ders.: Ueber Jodoformvergiftungen und ihre Behandlung, in: DMW 10 (1884), S Vgl. z. B. Emil Behring: Der antiseptische Werth der Silberlösungen und Behandlung von Milzbrand mit Silberlösungen, in: DMW 13 (1887), S ; ders.: Ueber den antiseptischen Werth des Creolins und Bemerkungen über die Giftigkeit antiseptischer Mittel, in: Deutsche militärärztliche Zeitschrift 8 (1888), S ; ders.: Ueber Quecksilbersublimat in eiweißhaltigen Flüssigkeiten, in: Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde 3 (1888), S , 64 66; ders.: Ueber die Bestimmung des antiseptischen Werthes chemischer Präparate mit besonderer Berücksichtigung einiger Quecksilbersalze, in: DMW 15 (1889), S , 869 f., Vgl. Zeiss/Bieling, Behring, S. 45 f.; Throm, Diphtherieserum, S ; ausführlich Derek S. Linton: Emil von Behring. Infectious Disease, Immunology, Serum Therapy, Philadelphia 2005, S ; Axel C. Hüntelmann: Diphtheriaserum and Serumtherapy Development, Production and Regulation in fin de siècle Germany, in: Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 27 (2007), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 27
17 hüten, wobei er nur bei lokaler Behandlung nahe der Stelle, an der die Bakterienkulturen»überimpft«wurden, sichere Erfolge erzielte. Es steht zu vermuten, dass chemische Substanzen, die nahe der Applikationsstelle der Bakterienkulturen verabreicht wurden, diese abschwächten und die Tiere deshalb überlebten. Weiterhin stellte Behring fest, dass Tiere, die die Tortur der inneren Desinfektion und die Krankheit überlebt hatten, anschließend unempfänglich gegen eine weitere Infektion waren. 49 Die Versuche zur»inneren Desinfektion«hatte Behring vor allem mit Milzbrandund Diphtherie-Bakterien-Kulturen ausgeführt. Zum einen, weil die Bakterien als Erreger bekannt waren und in Reinform kultiviert werden konnten, zum anderen, weil sich die verwendeten Versuchstiere Mäuse, Ratten, Meerschweinchen als besonders empfänglich erwiesen. 50 Dabei hatte Behring bereits in Bonn beobachtet, dass Ratten gegen Milzbrand-Erreger unempfindlich waren, quasi eine natürliche Immunität gegen Milzbrand besaßen, und Rattenblut in vitro in der Lage war, Milzbrand-Erreger abzutöten. Er übertrug diese Versuche auch in vivo und zeigte somit die bakterizide Eigenschaft des Blutserums im lebenden Tier. 51 Auch Meerschweinchen waren gegen Cholera-Erreger relativ unempfindlich; so konnte deren Serum Cholera-Erreger unschädlich machen. 52 Im Unterschied zur bakteriziden Wirkung chemischer Substanzen beschränkte sich die Unempfänglichkeit gegen bestimmte Krankheitserreger und die keimtötende Wirkung von Seren jedoch auf spezifische Erkrankungen und einzelne Tierarten und war kein allgemeines Phänomen. Ebenso wurden Tiere, die ursprünglich für Milzbrand empfänglich und dagegen immunisiert worden waren, nur gegen Milzbrand und keine andere Erkrankung immun. Diese schützende Aktivität müsse, so vermuteten Behring und Franz Nissen im Mai 1890, durch spezifische, im Blutserum lösliche»stoffe«bzw.»substanzen«bewirkt werden. 53 Behring beobachtete zudem, dass in Versuchstieren, die mit dem Serum immunisierter Tiere behandelt und vor- oder nachher mit Bakterienkulturen infiziert worden waren, die Lebensfähigkeit der Bakterien nicht eingeschränkt wurde: Diese Tiere zeigten trotzdem keine Krankheitssymptome und blieben gesund. 49 Vgl. Emil Behring: Ueber Desinfection, Desinfectionsmittel und Desinfectionsmethoden, in: ZHI 9 (1890), S ; zur»inneren Desinfektion«s. Zeiss/Bieling: Behring, S. 55; Throm: Diphtherieserum, S. 37 f.; Linton: Emil von Behring, S ; Jonathan Simon: Emil Behring s Medical Culture: From Disinfection to Serotherapy, in: Medical History 51 (2007), S ; Hüntelmann, Diphtheriaserum. 50 Vgl. Zeiss/Bieling, Behring, S Vgl. Emil Behring: Über die Ursache der Immunität von Ratten gegen Milzbrand, in: Centralblatt für Klinische Medicin 38 (1888), S ; ders.: Beiträge zur Aetiologie des Milzbrandes, in: ZHI 6 (1889), S sowie 7 (1889), S ; Throm, Diphtherieserum, S. 34 f. 52 Vgl. Emil Behring/Franz Nissen: Ueber bacterienfeindliche Eigenschaften verschiedener Blutserumarten. Ein Beitrag zur Immunitätsfrage, in: ZHI 8 (1890), S , hier S Vgl. Behring/Nissen, Ueber bacterienfeindliche Eigenschaften. Erich Wernicke (links), Paul Frosch (Mitte) und Emil Behring (rechts) im Institut für Hygiene, Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, ca Daraus schloss Behring, dass die im Blutserum immunisierter Tiere enthaltenen Stoffe nicht die Bakterien selbst bekämpften, sondern deren Giftstoffe neutralisierten. Seine These bestätigte sich, nachdem er den mit dem Blutserum immunisierter Tiere vorbehandelten Versuchstieren statt Bakterienkulturen nur das Gift verabreichte und diese ebenfalls keine Krankheitssymptome ausbildeten. Kitasato, der im Rahmen seiner Experimente zur Züchtung der Reinkultur von Tetanus-Erregern ähnliche Versuche mit Kaninchen angestellt hatte, erzielte vergleichbare Ergebnisse für Tetanus. 54 Die im Blut immunisierter Tiere wirksamen Stoffe bezeichnete Behring als Antitoxine. Paul Ehrlich ( ) prägte 1891 in seiner Publikation»Experimentelle Untersuchungen über Immunität«für diese Stoffe den Begriff»Antikörper« Zusammenfassend Zeiss/Bieling, Behring, S ; Throm, Diphtherieserum, S. 38 f.; Linton, Emil von Behring, S ; Hüntelmann, Diphtheriaserum. 55 Vgl. Paul Ehrlich: Experimentelle Untersuchungen über Immunität. I. Ueber Ricin, in: DMW 17 (1891), S , hier S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 29
18 Die Ergebnisse ihrer Arbeiten über das Zustandekommen der Diphtherie- und Tetanus-Immunität fassten Behring und Kitasato in einem zweiseitigen Artikel zusammen, in dem sie verkündeten: Es sei ihnen gelungen, sowohl bereits infizierte Tiere zu heilen, als auch gesunde Tiere so vorzubehandeln, dass diese nach einer künstlich herbeigeführten Infektion mit Tetanus-Erregern nicht erkranken würden. Die Immunität beruhe auf der Fähigkeit des Blutserums, die von den Bakterien produzierten toxischen Substanzen unschädlich zu machen. Keine der bisher bekannten Theorien könne die beschriebene Wirkungsweise und die Immunität der Tiere erklären. Aufgrund ihrer Versuche könne man folgende Schlüsse ziehen,»die an Beweiskraft nichts zu wünschen übrig lassen [ ]: 1. Blut des tetanusimmunen Kaninchens besitzt tetanusgiftzerstörende Eigenschaften. 2. Diese Eigenschaften sind auch im extravasculären Blut und in dem daraus gewonnenen zellenfreien Serum nachweisbar. 3. Diese Eigenschaften sind so dauerhafter Natur, dass sie auch im Organismus anderer Thiere wirksam bleiben, so dass man imstande ist, durch die Blut- bzw. Serumtransfusion hervorragende therapeutische Wirkungen zu erzielen. 4. Die tetanusgiftzerstörenden Eigenschaften fehlen im Blut solcher Thiere, die gegen Tetanus nicht immun sind, und wenn man das Tetanusgift nicht immunen Thieren einverleibt hat, so lässt sich dasselbe auch noch nach dem Tode der Thiere im Blut und in sonstigen Körperflüssigkeiten nachweisen.«56 Eine Woche später publizierte Behring einen weiteren Artikel, in dem er die von ihm ausgeführten»untersuchungen über das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität bei Thieren«detailliert darstellte und die Methoden beschrieb, durch die Versuchstiere gegen Diphtherie immunisiert werden konnten: 57 Immunisierung mit sterilisierten Diphtherie-Bakterienkulturen; Verwendung von mit Jodtrichlorid abgeschwächten Bakterienkulturen; Anwendung von Toxinen aus den Körpersäften von an Diphtherie verstorbener Tiere; Infektion von Versuchstieren mit Diphtherie-Bakterienkulturen und anschließende Behandlung mit chemischen Substanzen; sowie umgekehrt erst Behandlung der Tiere mit Wasserstoffperoxid und danach Infektion mit Diphtherie-Erregerkulturen. Die Injektion zuvor mit Jodtrichlorid abgeschwächten Bakterienkulturen war am erfolgreichsten und wirkte am zuverlässigsten. Diese Prozedur wurde mehrfach mit abnehmender Dosis Jodtrichlorid wiederholt, so dass die derart behandelten Versuchstiere am Ende eine mehrfach tödliche Dosis vertrugen und als immun galten. Überdies habe man auch Mäuse, bei denen Tetanus bereits ausgebrochen sei, durch die Verabreichung von Serum heilen können. Behring betonte allerdings, dass die derzeitigen Methoden zur Behandlung kranker Menschen sich nicht eigneten, da die chemischen Substanzen selbst organische Schädigungen hervorrufen würden. 58 Die Publikation von Behrings und Kitasatos Forschungen über die Immunität bei Tieren gilt als Nukleus, als Geburtsstunde der Immunologie (in Deutschland), da es den Autoren gelang, erstmalig Antitoxine und die Prinzipien der passiven Immunisierung zu beschreiben. Medizinhistorische Einordnung der Behring schen Immunitätsforschung Die Forschungsergebnisse Behrings und Kitasatos waren eingebettet in eine Reihe wei terer in Berlin, München und andernorts durchgeführter Studien, auf die sich die Autoren bezogen bzw. die sie in ihre wissenschaftliche Arbeit einbezogen. 59 Zugleich arbeiteten zahlreiche Lebenswissenschaftler zu ähnlichen Problemen und Fragestellungen. So wurde Behring kurz nach der Veröffentlichung seines Textes mit Ansprüchen konfrontiert, die die Priorität der Erkenntnisse für sich reklamierten. Professor Ogata aus Tokio beanspruchte bspw., die immunisierende und heilende Wirkung des Blutes immuner Tiere knapp ein Jahr vor Behring und Kitasato beobachtet und in einer deutschen Zeitschrift publiziert zu haben. Und Rudolf Emmerich ( ) reklamierte für sich, die»möglichkeit der Blutserumtherapie«und Gewinnung und therapeutische Verwendung immunisierender Substanzen aus dem»gewebssaft«schon einige Jahre vorher erkannt zu haben. Weitere Diskussionen ergaben sich mit dem oben erwähnten Carl Fraenkel aus dem Berliner Institut für Hygiene, der zur Zusammensetzung und Konstitution der Diphtheriegifte gearbeitet hatte. Vor allem die Prioritätsansprüche von Ogata und Emmerich parierte Behring mit einer schriftlichen Erwiderung, in der er seine eigenen Ansprüche verteidigte. 60 Grundsätzlich lassen sich drei Forschungsfelder benennen, die in diesem Zeitraum und nach der Veröffentlichung über Diphtherie-Immunität für die Geburt der Immunologie relevant waren. Erstens wurde auf dem Gebiet der Bakteriologie zur Ätiologie und Epidemiologie verschiedener Erreger geforscht. Mit Ausbruch der Cholera im Sommer 1892 in Hamburg und den von Koch organisierten Maßnahmen zur Bekämpfung 56 Behring/Kitasato, Ueber das Zustandekommen, S f. 57 Emil Behring, Untersuchungen über das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität bei Thieren, in: DMW 16 (1890), S Vgl. Behring, Untersuchungen; Throm, Diphtherieserum, S. 39 f. 59 Vgl. als Überblick Silverstein, History Immunology. 60 Vgl. Zeiss/Bieling, Behring, S ; Throm, Diphtherieserum, S. 45 f.; Linton, Emil von Behring, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 31
19 der Epidemie avancierte die Bakteriologie zur Leitwissenschaft. Zweitens forschten eine Reihe von Lebenswissenschaftlern zur Konstitution und Zusammensetzung der Toxine und Antitoxine und versuchte, die mikrobiologische und biochemische Wirkungsweise immunologischer Prozesse theoretisch zu erklären. Und drittens griffen einige Wissenschaftler die Arbeiten von Pasteur, Behring und Kitasato auf und bemühten sich, weitere Impfstoffe und Seren zu entwickeln. Nachdem Louis Pasteur Anfang der 1880er-Jahre einen Impfstoff gegen Milzbrand entwickelt hatte, übertrug er das Konzept auch auf andere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Rotlauf. Auch bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Tollwut arbeitete Pasteur mit einem Verfahren, das den noch nicht identifizierten Erreger abschwächen sollte. Der Impfstoff wurde aus dem Rückenmark an Tollwut erkrankter Tiere als Versuchtstier hatte Pasteur das Kaninchen installiert gewonnen, in dem man den Erreger vermutete, und die Abschwächung erfolgte über Tierpassagen und die längere Lagerung und Trocknung an der Luft. Bei Joseph Meister ( ), einem der ersten Menschen, der nach dem Biss eines tollwütigen Hundes mit dem Impfstoff behandelt wurde, wurden im Juli 1885 mehrere Dosen des Impfstoffs mit steigender Virulenz injiziert. 61 Nachdem Meister bis Ende August keine Krankheitsanzeichen zeigte, wurde der Versuch von Pasteur als Erfolg gewertet. Die Veröffentlichung des Falles im Oktober 1885 feierte man als nationales Ereignis. In den Folgemonaten reisten mehr als Menschen, die von tollwütigen Tieren angefallen worden waren, zu Pasteur nach Paris, um sich impfen zu lassen. Um die Behandlung der Patienten zu finanzieren, warb man in Tageszeitungen für öffentliche Spenden. Durch»Subscriptionen«wurde genügend Kapital gesammelt, um ein Forschungs- und Behandlungsinstitut das 1887 gegründete Institut Pasteur zu errichten. Dies war anfangs allein für die Erforschung und Behandlung der Tollwut gedacht, dann aber realisierte man es als breiter angelegte mikrobiologische Forschungsund Lehreinrichtung, in der die Sektion zur Herstellung des Tollwut-Impfstoffs und der Behandlung von Patienten nur eine von sechs Abteilungen war. 62 Obwohl die Arbeiten von Pasteur in Deutschland sehr kritisch diskutiert und die Wirksamkeit der Impfstoffe angezweifelt wurden, 63 nahm man auch hier die praktische Entwicklung von Impfstoffen auf. Und für die Idee, ein vornehmlich der Forschung gewidmetes Institut zu gründen, konnte sich Koch ebenfalls erwärmen. Nachdem er 61 Die Virulenz des Impfstoffes wurde an der Dauer der Inkubationszeit der Tiere bemessen. 62 Ausführlich Geison, Private Science, S ; Bazin, Vaccination, S S. z. B. den kritischen Artikel zum Milzbrand-Impfstoff von Friedrich Löffler: Zur Immunitätsfrage, in: MKGA 1 (1881), S ; die Rivalität zwischen Pasteur und Koch in Perrot/Schwartz: Robert Koch, S ; K. Codell Carter, The Koch-Pasteur dispute on establishing the cause of Anthrax, in: Bulletin of the History of Medicine 62 (1988), S zum Professor für Hygiene an der Friedrich-Wilhelms-Universität ernannt worden war, blieb ihm neben Lehre und der Organisation bakteriologischer Kurse nur wenig Zeit für Forschung. Christoph Gradmann wies nach, dass Koch in der zweiten Hälfte der 1880er-Jahre die Wirkung chemischer Substanzen auf den Tuberkulose-Erreger nach dem Prinzip der»inneren Desinfektion«testete, wie dies bereits für Emil Behring beschrieben wurde. Erst ab Februar 1890 intensivierte Koch seine Forschungsarbeiten und im August kündigte er auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress in Berlin ein Heilmittel gegen Tuberkulose an. Bei dem als Tuberkulin bekannt gewordenen Mittel handelte es sich um einen in Glyzerin gelösten Extrakt aus Tuberkulosebazillenkulturen, wie Koch erst auf Drängen des Preußischen Kultusministeriums bekannt gab und nachdem klinische Versuche mit dem Mittel ungünstig verlaufen waren. Der Forscher hatte die Wirkung des Mittels, dessen genaue chemische Zusammensetzung ihm nicht bekannt war, als Heilung für die Versuchstiere interpretiert, allerdings konnten nur wenige Wissenschaftler diese Wirkung im Tierversuch reproduzieren. Zahlreiche klinische Versuche ließen eher das Gegenteil vermuten: das Mittel beschleunigte sogar den Verlauf der Tuberkulose. 64 Nach Nebenwirkungen und Todesfällen, die man mit der Verabreichung des Tuberkulins in Verbindung brachte, wurde öffentlich kritisiert, dass Koch das Mittel im Vorfeld der Ankündigung nicht hinreichend im Tierversuch getestet, klinisch geprüft und Informationen über dessen Zusammensetzung zurückgehalten habe. Über den so genannten Tuberkulin-Skandal, dessen Auswirkung und die Motivation Kochs wurde viel publiziert. Für die Geschichte der Immunologie in Deutschland ist die (Fehl-)Entwicklung des Tuberkulins aus drei Gründen bedeutsam: Erstens hatte Koch dahingehend Erfolg, dass der preußische Staat ein außeruniversitäres Forschungsinstitut ähnlich dem Institut Pasteur schuf, das ursprünglich dazu gedacht war, das Tuberkulin zu verbessern bzw. ein Heilmittel gegen Tuberkulose zu entwickeln. Das Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten (PII), nach dem Tod des Gründungsdirektors um den Namenszusatz Robert Koch ergänzt, hatte allerdings bereits seit der Eröffnung einen Aufgabenkreis, der das gesamte Gebiet der Bakteriologie und Epidemiologie umfasste. Zweitens verweist die Verwendung von extrahierten Tuberkulose-Kulturen als Grundlage für das Tuberkulin darauf, dass Koch die Methode Pasteurs, Bakterienkulturen zu modifizieren und als Grundlage für Heilmittel zu verwenden, adaptierte und akzeptierte. Biologicals galten nun auch in Deutschland als ernstzunehmende Option und Grundlage für Arzneimittel. In diesem Umfeld sind Behrings Versuche zur Serumtherapie einzuordnen. Ende der 1890er-Jahre wurde, in Anlehnung an das Institut Pasteur, 64 Ausführlich Gradmann, Krankheit im Labor, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 33
20 eine Abteilung zur Herstellung und Erforschung des Tollwut-Impfstoffes eingerichtet. 65 Drittens führte der Tuberkulin-Skandal dazu, dass man aufgrund der kritischen Öffentlichkeit bei der Entwicklung späterer Therapeutika größte Vorsicht walten ließ. Mit der Entwicklung des Diphtherie-Heilserums wurden zugleich alle notwendigen Schritte der modernen Arzneimittelentwicklung vorweg genommen bzw. als obligatorisch festgeschrieben: die Abfolge von in vitro Versuchen, im Anschluss daran ausgedehnte Tierversuche zur toxikologischen, dosologischen und therapeutischen Prüfung, darauf folgend die klinisch-therapeutische Prüfung und die öffentliche Diskussion der Ergebnisse sowie die staatliche Regulation der Produktion, Distribution (über Apotheken) und Abgabe des Arzneimittels. Von der passiven Immunisierung zur Serumtherapie Neubau des Königlich Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin, ca. 1901, heute Robert-Koch-Institut Während man Ende 1890 mit der klinischen Prüfung des Tuberkulins begann, setzte Behring seine Arbeiten zur Immunisierung von Meerschweinchen gegen Diphtherie im Labor fort. In den folgenden Monaten arbeitete Behring zusammen mit Erich Wernicke ( , Abb. S. 29), einem ebenfalls an das Hygiene-Institut abkommandierten Militärarzt, an der Verbesserung der Methode zur Immunisierung von Labortieren. Die 65 S. hierzu Georg Gaffky: Das Königliche Institut für Infektionskrankheiten in Berlin, in: Medizinische Anstalten auf dem Gebiete der Volksgesundheitspflege in Preußen, hg. vom Preußischen Minister der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, Jena 1907, S , hier S. 29. Aufklärung der Struktur und Konstitution der Antitoxine bzw. der Immunität verleihenden Körper erklärte er für nachrangig. 66 Nachdem Labortiere sicher immunisiert und ihr Serum zur passiven Immunisierung für andere Tiere verwendet werden konnte, galt es in einem weiteren Schritt, die Qualität und Quantität des Serums zu verbessern, um dessen mögliche therapeutische Anwendung auch für den Menschen ins Auge zu fassen. 67 Die Infektion von zwei Schafen mit Diphtherie-Bakterienkulturen hatte noch im Dezember 1890 gezeigt, dass diese für Diphtherie anfällig waren und an den typischen Krankheitssymptomen starben. Im Sommer 1891 übertrugen Behring und Wernicke die Ergebnisse auf größere Tiere. Schafe wurden mit durch Jodtrichlorid oder Hitze abgeschwächten Bakterienkulturen oder direkt mit Diphtheriegift immunisiert, wobei die Bakterienkulturen bei der mehrfach wiederholten Behandlung immer weniger abgeschwächt bzw. die Giftdosen erhöht wurden. In regelmäßigen Abständen entnahm man den Schafen Serum, um dessen Potenz und Wirkungsgrad an Meerschweinchen zu messen, die mit unterschiedlich wirksamen Bakterienkulturen geimpft wurden. Im Februar 1892 fassten Behring und Wernicke die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit in einer ausführlichen Publikation zusammen: Neben den einzelnen Versuchsergebnissen und technischen Informationen über die Konservierung des Serums durch 0,5 prozentige Carbolsäure hoben sie die Vergleichbarkeit der Giftigkeit der Bakterienkulturen bzw. des Giftes hervor, um den Wirkungsgrad eines Serums bemessen zu können. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Verwendung von abgeschwächten Diphtherie-Bakterienkulturen dem Diphtheriegift vorgezogen, da die Versuchsergebnisse sich zahlenmäßig durch Verdünnung oder Abschwächung mit chemischen Substanzen besser berechnen ließen. In den Folgemonaten versuchten Behring und Wernicke, den Wirkungswert des Serums durch die Injektion von Bakterienkulturen mit einer zunehmenden Giftdosis zu steigern. 68 Anfang 1892 wurden erste orientierende Versuche an diphtheriekranken Kindern an der Chirurgischen Universitätsklinik und der Charité durchgeführt. Zwar zeigten die Versuche keine eindeutigen Heil-Resultate, jedoch konnte die Unschädlichkeit des Serums festgestellt werden. 69 Trotz ausgedehnter Tierversuche und finanzieller Unterstützung durch die Farbwerke Meister Lucius & Brü- 66 Vgl. Throm, Diphtherieserum, S Vgl. Emil Behring: Ueber Desinfection am lebenden Organismus, in: DMW 17 (1891), S Vgl. Emil Behring/Erich Wernicke: Ueber Immunisierung und Heilung von Versuchsthieren bei der Diptherie, in: ZHI 12 (1892), S ; Erika Schulte: Der Anteil Erich Wernickes an der Entwicklung des Diptherieantitoxins. Eine medizinhistorische Untersuchung zur Entwicklung der Serumtherapie am Beispiel des Diphtherieantitoxins unter Berücksichtigung der Bioergographie des Geheimen Medizinalrates Professor Dr. Erich Wernicke, Diss. med. Freie Universität Berlin 2000, S S. Throm, Diphtherieserum, S. 50 f.; sowie die Diskussion zwischen Emil Behring und Ernst von Bergmann ( ) in der DMW 20 (1894), Heft 50, S. 943 und Heft 51, S. 964; Emil Behring/Oscar Boer/ 34 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 35
21 ning in Hoechst (FWH) gelang es Behring auch im Verlauf des Jahres 1892 nicht, Serum in so hochwertiger Qualität herzustellen, dass sich damit auch Menschen heilen ließen. 70 In seinem pragmatischen Vorgehen, wie Carola Throm die Arbeitsweise von Behring charakterisiert, 71 glich er Pasteur und Koch. Das Experiment und die dabei erzielten Ergebnisse waren für Pasteur und Koch der allein gültige Maßstab. Christoph Gradmann hebt hervor, dass Kochs wissenschaftliche Arbeit und experimentelle Praxis durch ihre Theorieabstinenz gekennzeichnet sei. 72 Doch erwies sich die Fokussierung auf experimentelle Praxis und eine vernachlässigte theoretische Auseinandersetzung über die Struktur und Wirkungsweise der immunitätsverleihenden und heilenden Körper des Blutes als problematisch, da Behring die immunologischen Prozesse zwar beobachten, aber nicht erklären und geplant beeinflussen konnte. Während Emil Behring im Juli 1891 an das von Koch dirigierte PII wechselte, blieb Wer nicke am Institut für Hygiene der Berliner Universität, das jetzt von dem Hygieniker Max Rubner ( ) geleitet wurde. Im Herbst 1892 endete die Zusammenarbeit von Behring und Wernicke. Am PII machte Behring die Bekanntschaft von Paul Ehrlich ( ), mit dem er ab 1893 zusammenarbeiten und der die Serumtherapie entscheidend voranbringen sollte. Ehrlich war Koch seit vielen Jahren bekannt, 1882 hatte er eine verbesserte und einfachere Methode zur Färbung des Tuberkulose-Erregers vorgeschlagen. Seit seiner Dissertation hatte Ehrlich zur Histologie und Färbung von Gewebe, zur Farbenchemie gearbeitet und über die Affinität bestimmter Farbstoffe zu verschiedener Gewebestrukturen und Zellarten geforscht. Überdies arbeitete Ehrlich zur Morphologie und Pathologie des Blutes und der Blutkörperchen. Anfang der 1890er- Jahre galt er als herausragender Experte auf diesem Gebiet. Bis 1888 war Ehrlich knapp zehn Jahre als Stationsarzt an der Inneren Klinik der Charité tätig gewesen. Nach einer Tuberkulose-Erkrankung und einer längeren Erholungsreise nach Ägypten arbeitete er 1889/90 in seinem Privatlabor, bevor er sich an der klinischen Erprobung des Tuberkulins beteiligte. Die unterschiedlichen Strömungen von Ehrlichs Forschung wurden Ende der 1880er bzw. Anfang der 1890er-Jahre auf dem Gebiet der Immunologie vereinigt. 73 Aufgrund seiner histologischen und färbetechnischen Arbeiten war Ehrlich zu dem Schluss gekommen, dass vitale Prozesse auf chemischen Reaktionen basieren müssten, Hermann Kossel: Zur Behandlung diphtheriekranker Menschen mit Diphtherieheilserum, in: DMW 19 (1893), S Vgl. Behring/Wernicke: Immunisierung und Heilung; Throm, Diphtherieserum, S ; Schulte, Anteil. 71 Vgl. Throm, Diphtherieserum, S Vgl. Gradmann, Krankheit im Labor, S Zu Ehrlich s. Ernst Bäumler: Paul Ehrlich. Forscher für das Leben, Frankfurt a. Main 1979; sowie Axel C. Hüntelmann: Paul Ehrlich. Leben, Forschung, Ökonomien, Netzwerk, Göttingen Paul Ehrlich, ca was sich als das Leitmotiv seiner Forschung erweisen sollte und wodurch er zu den frühen Vertretern der Biochemie zählt. 74 Ehrlich war, wie auch Behring aufgrund seiner Arbeiten zur»inneren Desinfektion«, davon überzeugt, dass Immunität an chemisch wirksame Bestandteile gebunden sei. Ehrlichs Versuche zur vitalen Färbung von Gewebe und die angezeigte mikrochemische Affinität zwischen Farbstoff und organischer Zelle sollte Aufschluss über die Beziehung geben, die zwischen der Konstitution des jeweiligen Farbstoffes und der Verteilung im Organismus bestand. Ehrlich stellte bspw. fest, dass Methylenblau»eine auffallende Verwandtschaft zum Nervensystem, vor allem zu den Axencylindern der sensiblen und sensorischen Nerven«zeigt. 75 Aus dieser Beobachtung folgten Versuche zur»praktische[n] Ausmittelung der schmerzbeeinflussenden Wirkung des Methylenblau«im Gefängnis Moabit. Die Versuche ergaben, dass der Farbstoff überraschend wirksam war. In Versuchen im städtischen Krankenhaus Moabit stellten Ehrlich und der dort tätige Arzt Paul Guttmann ( ) fest, dass der Farbstoff auch bei Malaria eine positive therapeutische Wirkung zeigte. 76 In dem Forschungskontext der 74 S. zum Leitmotiv Ernst Jokl: Paul Ehrlich Man and Scientist, in: Bulletin of the New York Academy of Medicine 30 (1954), S ; Cay-Rüdiger Prüll: Part of a Scientific Master-Plan? Paul Ehrlich and the Origins of his Receptor Concept, in: Medical History 47 (2003), S ; und Arthur M. Silverstein: Paul Ehrlich s Receptor Immunology: The Magnificent Obsession, San Diego Vgl. Paul Ehrlich/Arnold Leppmann: Ueber schmerzstillende Wirkung des Methylenblau, in: Paul Ehrlich. Gesammelte Arbeiten. Bd. 1: Histologie, Biochemie und Pathologie, hg. von Fred Himmweit, Berlin 1956 (OA: DMW 1890), S , hier S Vgl. Paul Ehrlich/Paul Guttmann: Ueber die Wirkung des Methylenblau bei Malaria, in: Paul Ehrlich. Gesammelte Arbeiten. Bd. 3: Chemotherapie, hg. von Fred Himmelweit, Berlin 1960 (OA: BKW 1891), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 37
22 »Constitution, Vertheilung und Wirkung chemischer Körper«77 (Zitat des Titels des von Ehrlich publizierten Aufsatzbands), waren Arbeiten angesiedelt, die sich einerseits mit der therapeutischen Wirkung, andererseits mit der giftigen Wirkung von chemischen Substanzen auf den Organismus befassten. An diese knüpfen die therapeutisch-klinische Prüfung des Tuberkulins einerseits und andererseits die Versuche zur Gewöhnung des lebenden Organismus an die pflanzlichen Giftstoffe Abrin und Ricin an, mit dem Unterschied, dass sich Ehrlich nun nicht mehr mit künstlich synthetisierten chemischen Substanzen beschäftigte, sondern sich Stoffen biologischen Ursprungs zuwandte. Während die Konstitution der von ihm verwendeten Farbstoffe hinreichend bekannt war, waren die im Blut zirkulierenden und im Tuberkulin enthaltenen wirksamen Stoffe (noch) unbekannt. Bereits bei den klinisch-therapeutischen Versuchen zum Methylenblau war es darum gegangen, die Dosis zu ermitteln, ab der eine therapeutische Wirkung zu erkennen war bzw. die vom Organismus vertragen werden konnte. Diese so genannte dosologische Forschung übertrug Ehrlich einerseits auf das Tuberkulin, um die therapeutische Dosis herauszufinden, 78 und andererseits auf das Pflanzengift Ricin und Abrin, um die toxikologische Dosis festzustellen. Die Forschungen zielten darauf ab, die therapeutische Dosis des Tuberkulins zu verbessern sowie die letale Dosis der pflanzlichen Giftstoffe zu erhöhen. 79 Letzteres erreichte Ehrlich, indem er Versuchstiere durch anfangs minimale und später immer größere Gaben an das Gift gewöhnte, bis die Tiere eine tausendfach tödliche Dosis vertrugen. Ehrlich bemängelte, man könne die giftigen Stoffwechselprodukte der Bakterien zwar aus dem Kulturmedium herausfiltern, jedoch waren 1891»die von den pathogenen Bacterien producierten Toxalbumosen noch nicht in absolut reinem Zustand isolirt«. 80 Die Versuche zu den Giftstoffen Abrin und Ricin stellten insofern eine Hilfsvariable dar, als dass eine Verbindung zwischen den nur ungenügend herstellbaren Bakteriengiften sowie den mess- und wägbaren synthetisierten Farbstoffen mit bekannter Konstitution (Abrin und Ricin waren in»genügender Reinheit«vorhanden) wäg- und messbar sowie die toxische Wirkung auf den lebenden Organismus skalierbar, also die Gewöhnung des Organismus an den Giftstoff ebenso quantifizierbar war. Ehrlich ordnete daher die 77 Vgl. Paul Ehrlich: Constitution, Vertheilung und Wirkung chemischer Körper. Aeltere und Neuere Arbeiten, Leipzig Vgl. Paul Ehrlich/Paul Guttmann: Ueber die Wirksamkeit kleiner Tuberkulindosen gegen Lungenschwindsucht, in: Paul Ehrlich. Gesammelte Arbeiten. Bd. 2: Immunitätslehre und Krebsforschung, hg. von Fred Himmelweit, Berlin 1967 (OA: DMW 1891), S Vgl. Paul Ehrlich: Ricin; ders.: Experimentelle Untersuchungen über Immunität. II. Ueber Abrin, in: DMW 17 (1891), S f. 80 Vgl. Ehrlich: Ricin, S. 976.»Experimentelle Untersuchung über Immunität«ein in den Kontext seiner bisherigen Untersuchungen zu»einer größeren Zahl von Körpern«und den»beziehungen, die zwischen der chemischen Constitution, der Vertheilung in den einzelnen Organen und der physiologischen Wirkung«bestehen. 81 Es ging ihm zunächst darum, die Versuchstiere»ricinfest«zu machen: Erst sollte eine Immunität über die Bei-Fütterung von Ricin- Cakes und später durch subkutane Injektion von Ricin-Verdünnungen hergestellt werden, dann erst in einem nächsten Schritt»in exacter Weise zahlenmässig«der Gang der Immunisierung verfolgt werden, um den zu- oder abnehmenden Grad der Immunität zahlenmäßig beschreiben und mathematisch berechnen zu können, um etwaige Gesetzmäßigkeiten zu erfassen. Zudem hatte Ehrlich Versuche unternommen, um zu prüfen, ob erworbene Immunität auf die Nachkommen übertragen wird. Sie ergaben, dass eine erworbene Immunität nicht»vererbt«, sondern durch die Muttermilch auf Nachkommen übertragen wird und diesen für einen bestimmten Zeitraum eine passive Immunität gegen die Krankheit verleiht, gegen die bereits das Muttertier immun war. 82 Zunächst in Konkurrenz zu Behring gelang es Ehrlich am PII zusammen mit Ludwig Brieger, August Wassermann ( ) und Hermann Kossel ( ) Ziegen gegen Tetanus zu immunisieren. In langen Versuchsserien hatten Ehrlich und seine Kollegen beobachtet, dass der Antitoxinspiegel nicht gleichmäßig, sondern erst Tage nach Verabreichung des Giftes sprunghaft anstieg. Bei der Untersuchung von Milch immunisierter Ziegen bestimmte Ehrlich über Monate hinweg jeden zweiten Tag den Antitoxingehalt. Dabei entdeckte er einen wellenförmigen Verlauf der Immunisierung: Nach einem verzögerten hohen Anstieg sank der Antitoxinspiegel, um anschließend wieder langsam auf ein Maximum zu steigen. Erst nach einem Monat stellte sich ein konstanter Antitoxintiter ein. Der Kurvenverlauf war für den Zeitpunkt der Immunitätsbestimmung wichtig: Zu frühe Prüfungen konnten zu niedrige oder zu hohe Werte ergeben. Eine erneute Toxininjektion sollte erst dann erfolgen, wenn der Antitoxinspiegel sein Maximum erreicht hatte. 83 Auf Basis dieser Beobachtungen war es Ehrlich gelungen, Ziegen gegen eine vielfach tödliche Dosis Tetanusgift zu immunisieren und Milch mit einem entsprechend hohen Antitoxinwert zu erhalten. 84 Behring blieb der Erfolg, Dipththerieserum im gleichen Maß hoch zu skalieren, versagt, so dass Koch und die FWH eine Kooperation zwischen ihm und Ehrlich vermittelten. 81 Ebd. 82 Vgl. Paul Ehrlich: Ueber Immunität durch Vererbung und Säugung, in: ZHI 12 (1892), S ; ders./ Ludwig Brieger: Ueber die Uebertragung von Immunität durch Milch, in: Gesammelte Arbeiten, Bd. 2 (OA: DMW 1892), S Vgl. Throm, Diphtherieserum, S. 52 f. 84 Vgl. Ehrlich/Brieger, Uebertragung von Immunität. 38 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 39
23 Im Oktober 1893 schlossen Behring und Ehrlich einen Vertrag über die entstehenden Kosten für Versuchstiere sowie über die Aufteilung etwaiger aus dem Serum erzielter Gewinne. Die Versuchstiere wurden entsprechend Ehrlichs Vorgaben mit Diphtherietoxin behandelt und regelmäßig zur Ader gelassen, um den Wirkwert des Serums prüfen. Im Verbund gelang es relativ schnell, Serum in ausreichender Menge und Potenz herzustellen, so dass im Frühjahr 1894 eine umfassende klinisch-therapeutische Prüfung des Serums an 220 an Diphtherie erkrankten Kindern in sechs Krankenhäusern in Berlin durchgeführt werden konnte. 85 Im Vergleich zu früheren Versuchen fallen drei Unterschiede auf: Bei der Gewinnung von Serum hatte man erstens auf Pferde als Wirtstiere zurückgegriffen. 86 Diese erwiesen sich nicht nur für Diphtherie anfällig, sondern sie ließen sich aufgrund ihrer Größe leichter immunisieren und es konnte eine größere Menge Serum gewonnen werden. Zweitens wurden jetzt nicht mehr durch Jodtrichlorid abgeschwächte Bakterienkulturen zur Immunisierung verwendet, sondern filtriertes Diphtherietoxin. (Behring hatte festgestellt, dass man sowohl filtriertes Gift als auch Bakterienkulturen verwenden konnte, die durch die Injektion von Jodtrichlorid abgeschwächt wurden.) Zumindest bis Herbst 1892 favorisierte Behring die Bakterienkultur-Methode bei der Entwicklung und Herstellung von Serum, da er die Erhöhung der Giftdosis im fortschreitenden Immunisierungsprozess über die Verdünnung des Desinfektionsmittels regulieren konnte. 87 Ein Nachteil der Immunisierung mit Diphtherie-Kulturen war, dass sich die Wirkung der Bakterienkultur nicht genau abschätzen ließ, da neben dem Gift auch die Bakterienkörper und andere, teilweise noch nicht spezifizierte Bestandteile enthalten waren. Sollte ein Serum von konstant gleicher Qualität entwickelt und später standardisiert produziert werden, war es unabdingbar, auch ein konstant gleich wirkendes Bakteriengift und keine Bakterienkultur zu haben. Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, sei es für die Dauer des Versuchs unabdingbar, konstantes Giftmaterial zu verwenden und gleiche Versuchsbedingungen zu gewährleisten. 88 Über die Herstellung von Diphtherietoxin schlossen Ehrlich und die FWH im Frühjahr 1894 einen gesonderten Vertrag, in 85 Vgl. Paul Ehrlich/August Wassermann/Hermann Kossel, Ueber Gewinnung und Verwendung des Diptherieheilserums, in: DMW 20 (1894), S Pferde zur Diphtherie-Antitoxin-Herstellung wurden erstmals von Émile Roux am Institut Pasteur verwendet, vgl. Stefan H. E. Kaufmann: Remembering Emil von Behring. From tetanus treatment to antibody cooperation with phagocytes, in: MBio 8 (2017), S Vgl. die Protokolle in Behring/Wernicke: Immunisierung; Schulte, Anteil, S Vgl. Paul Ehrlich/Ludwig Brieger, Beiträge zur Kenntniss der Milch immunisierter Thiere, in: Gesammelte Arbeiten, Bd. 2 (OA: ZHI 1893), S , hier S. 49. August von Wassermann, 1890er-Jahre dem Ehrlich ein prozentualer Anteil aus dem Verkaufserlös für Diphtherieserum zugesichert wurde. 89 Drittens wurde, um die Wirkung und den Wirkungsgrad des Diphtherietoxins und des Serums bemessen und beurteilen zu können, ein komplexes Referenzsystem mit dem Meerschweinchen als Bioindikator installiert. Dessen Grundlage war vorerst das Bakteriengift. Einen sicheren Maßstab zur Bestimmung einer erhöhten Giftfestigkeit könne nur die minimale absolut tödliche Giftdosis zu liefern. Willkürlich wurde die Dosis des Bakterientoxins als Basiswert 1 gesetzt bzw. als»einfache tödliche Dosis«bezeichnet, die ausreichte, um ein 250 Gramm schweres Meerschweinchen binnen vier Tagen soeben zu töten (»Ehrlich sche physiologische Gifteinheit«). Die Steigerung der Immunität wurde in einem Multiplum dieser einfachen tödlichen Dosis ausgedrückt: als 1 Immunisierungseinheit definierte man jene Menge Serum, die die 100fache Menge der Gifteinheit»so absättigte, daß nach Injektion dieses Gemisches auch nicht die geringste Spur von Krankheit (lokaler und allgemeiner Reaktion) 90 eintrat«. 91 Durch die Kooperation von Behring und Ehrlich im PII sowie dank der Finanzierung der FWH war es gelungen, den Immunisierungsgrad der Serumpferde zu erhöhen und Serum in ausreichender Menge herzustellen. Auch die klinisch-therapeutischen Ver- 89 Vgl. Bäumler, Paul Ehrlich, S. 107 f. 90 Als Krankheitssymtome wurde Apathie, Fressunlust, Gewichtsabnahme oder eine Infiltration an der Einstichstelle gewertet. 91 S. Richard Otto: Die staatliche Prüfung der Heilsera (= Arbeiten aus dem Königlichen Institut für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. 2), Jena 1906, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 41
24 Das Königlich Preu ßische Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt (vormals Institut für Serumforschung und Serumprüfung, Berlin, ), heute ist dort das Georg Speyer Haus unter gebracht. Darstellung der Serumproduktion Intoxikation der Pferde (links) und Aderlass zur Blutabnahme (rechts) und Serumherstellung in den Behringwerken, Fritz Gehrke 1906 suche erbrachten zufriedenstellende Ergebnisse. Die an Diphtherie erkrankten Kinder, denen das Serum verabreicht wurde, vertrugen das neue Heilmittel ohne Nebenwirkung und die Sterblichkeitsrate reduzierte sich um die Hälfte, sie sank von 50 auf 25 Prozent (75 Prozent wurden geheilt). Die grundlegende klinische Studie bestätigte nicht nur die Wirksamkeit des neuen Therapeutikums, sondern sie zeigte auch, dass die Behandlung besonders dann erfolgreich war, wenn das Diphtherieserum möglichst schnell nach Diagnose der Erkrankung verabreicht wurde. 92 Behring, Ehrlich und Kollegen hatten ihre Forschungsergebnisse in medizinischen Fachzeitschriften publiziert, so dass sie der Fachwelt frei zugänglich waren und die Versuche reproduziert werden konnten. In Konkurrenz zur Gruppe am PII hatten Émile Roux und Louis Martin ( ) am Institut Pasteur in Paris und Hans Aronson ( ), ein ehemaliger Mitarbeiter Kochs und Ehrlichs, finanziert durch die Berliner Firma Schering, ebenfalls ein Serum gegen 92 Vgl. Ehrlich/Wassermann/Kossel, Gewinnung. Diphtherie entwickelt und in verschiedenen Kliniken auf seine therapeutische Wirkung und etwaige Nebenwirkungen prüfen lassen. Ab August 1894 war erstmals Diphtherieserum in Apotheken im Deutschen Reich erhältlich. Auf dem Achten Internationalen Hygiene Kongress wurde die Entwicklung des Diphtherieserums als Meilenstein der Medizin gefeiert. Es gilt als erstes Arzneimittel, das nicht die Symptome bekämpfte, sondern die Ursache einer Krankheit. Für die Beschreibung des Prinzips der passiven Immunität wurde Emil Behring der erste Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen. Darüber hinaus war das Diphtherieserum ein enormer wirtschaftlicher Erfolg für die FWH, die die Entwicklung der Serumtherapie finanziell ermöglicht hatten; und für Behring, der zur Hälfte an den aus dem Verkaufserlös des Serums erzielten Gewinnen beteiligt war. Aus diesem Grund drängten weitere Unternehmen auf den lukrativen Serummarkt. Die wissenschaftlichen Arbeiten aus den Instituten waren in Fachzeitschriften veröffentlicht worden, frei zugänglich und jeder in bakteriologischen Techniken versierte Mediziner konnte die Versuche reproduzieren und Serum herstellen. Doch vier Jahre nach dem Tuberkulin-Skandal war die preußische Medizinalverwaltung skeptisch: 42 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 43
25 Auch wenn in klinischen Versuchen keine gravierenden Nebenwirkungen festgestellt worden waren, blieb die Zahl der Probanden klein. Über langfristige Auswirkungen der neuen Therapie war nichts bekannt! Zudem hatte man noch keine hinreichenden Kenntnisse über die genaue Wirkungsweise des Serums! Schließlich stand auch zu befürchten, dass aufgrund fehlenden Patentschutzes und den Gewinnaussichten bei der Herstellung von Serum auch zwielichtige oder skrupellose Hersteller angelockt werden könnten, die jedwede Sicherheitsmaßnahmen bei der Serumproduktion außer Acht lassen würden. Verunreinigtes oder wirkungsloses Serum war nicht nur eine Gefahr für die Bevölkerung oder die öffentliche Gesundheit, sondern es drohte auch eine vielversprechende Therapie zu diskreditieren. Aufgrund der Novität der Serumtherapie beschloss man, Serumproduktion und -distribution umfassend staatlich zu regulieren: Diphtherieserum war rezeptpflichtig und musste über Apotheken bezogen werden, es wurde eine Preisobergrenze festgelegt, abgelaufenes oder wirkungsloses Serum musste von den Herstellern kostenlos zurückgenommen werden. Die Serumproduktion wurde durch einen Beamten vor Ort kontrolliert und die Errichtung einer zentralen Prüfeinrichtung beschlossen: die»controlstation für Diphtherieheilserum«, zuerst als Abteilung des PII, ab 1896 als selbständiges»königlich Preußisches Institut für Serumforschung und Serumprüfung«(ISS). Jedes auf dem deutschen Markt veräußerte Serumfläschchen war in der staatlichen Einrichtung zuvor auf Reinheit und Wirksamkeit geprüft worden. Der Kindheit rasch entwachsend Ausweitung der Serumtherapie Die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung des Diphtherieserums markiert einen großartigen Schlusspunkt, gleichzeitig bildet sie auch den Auftakt zu ausgedehnten immunolo gischen Forschungen in Deutschland. Man könnte nun in extenso jedes weitere Serum darstellen, nachfolgend sollen allerdings nur die hauptsächlichen Entwicklungen skizziert werden: Erstens die Entwicklung zahlreicher weiterer Seren und Impfstoffe und zweitens die Versuche zur Erklärung immunologischer Prozesse. In einem weiteren Kapitel wird dann die Ausdifferenzierung und Institutionalisierung der Immunologie in Deutschland dargestellt. Mit der Identifizierung spezifischer Krankheitserreger konnte man ihre Biologie, Entwicklung und Verbreitung erforschen und über Desinfektion deren Ausbreitung hemmen oder verhindern, indem man die Übertragungswege der Bakterien unterbrach. Pasteur war es ohne genauere Kenntnisse über den Erreger gelungen, nach dem Jenner schen Muster Impfstoffe gegen einzelne Erkrankungen zu entwickeln, die mal mehr und mal weniger wirksam waren. Zudem hatten Pasteur und seine Mitarbeiter Impfstoffe vor allem für Viehseuchen entwickelt, die teilweise von schweren Erkrankungen und Nebenwirkungen betroffener Tiere begleitet waren, bevor der Impfschutz zu greifen begann. Eine solche Behandlung ist für Menschen nur schwer vorstellbar, vor allem, wenn man sich die öffentlichen Proteste und Widerstände gegen die 1874 gesetzlich erlassene obligatorische Pockenschutzimpfung im Deutschen Reich in Erinnerung ruft. Mit dem Impfstoff gegen Tollwut wurden zwar Menschen behandelt, aber die Tollwut war eine selten auftretende Erkrankung mit damals nur wenigen Hundert Fällen in den einzelnen Ländern. Zudem hatte diese Erkrankung eine so hohe Sterblichkeit und ihr Krankenbild war so schrecklich, dass die mit der Vakzination verbundenen Risiken grosso modo als vertretbar erachtet wurden. Auch hier stellte sich die Frage, inwieweit der Impfstoff (immer) wirkte oder ob Patienten nicht erst durch den Impfstoff erkrankten. Die Serumtherapie bot den Vorteil, die mit der Impfung der Bakterienkultur bzw. des Bakteriengiftes verbundenen Risiken und Nebenwirkungen auf das Tier zu verlagern und die im Tierkörper stimulierten Antitoxine einfach auf den Menschen zu übertragen. Noch während Behring, Wernicke und Ehrlich an der Entwicklung des Diphtherie- und Tetanusserums arbeiteten, wurde die Methode aufgegriffen und auf andere Infektionskrankheiten übertragen. Eine Besonderheit stellte die Forschung des Veterinärmediziners Gustav Lorenz ( ), seit 1881 Medizinalrat im Innenministerium des Großherzogtums Hessen, zum Rotlaufserum dar. Er verband Vakzination und Serumtherapie miteinander. Lorenz knüpfte an Forschungen von Louis Pasteur an, der analog zum Milzbrand-Impfstoff einen Impfstoff gegen Rotlauf entwickelt hatte. Dieser Impfstoff bestand ebenfalls aus abgeschwächtem Krankenmaterial, wobei die Veränderung durch Tierpassagen herbeigeführt worden war. Die Impferfolge waren nur mäßig. Zwar sank die Mortalitätsrate, andererseits erkrankten einige Schweine überhaupt erst nach der Impfung. 93 Nachdem der Erreger des Rotlaufs eindeutig von Friedrich Löffler beschrieben worden war, 94 modifizierte Lorenz Ende der 1880er-Jahre das Verfahren von Pasteur und verknüpfte dies mit den Forschungsergebnissen von Behring. Versuche hatten gezeigt, dass das Blut immunisierter Kaninchen Rotlauf-Erreger in vitro abtöten konnte. Lorenz behandelte Kaninchen mit sukzessiv steigenden Dosen von Rotlauftoxin, bis sie immun waren und die Injektion mit vollvirulenten Bakterienkulturen und eine 93 Vgl. Bazin, Vaccination, S. 211 f.; zur Prüfung des Impfstoffes gegen Schweinerotlauf s. Wilhelm Schütz: Ueber den Rothlauf der Schweine und die Impfung derselben, in: AKGA 1 (1886), S ; sowie August Lydtin/Wilhelm Schütz: Der Rothlauf der Schweine, seine Entstehung und Verhütung (Schutzimpfung nach Pasteur). Nach amtlichen Ermittlungen im Grossherzogtum Baden im Auftrage des Grossherzogl. Ministeriums des Innern, Wiesbaden Vgl. Friedrich Löffler: Experimentelle Untersuchungen über den Schweine-Rothlauf, in: AKGA 1 (1886), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 45
26 mehrfach tödliche Dosis Rotlauftoxin ohne Beeinträchtigung der Gesundheit vertrugen. Das Blutserum dieser erfolgreich immunisierten Kaninchen wurde erneut unbehandelten Kaninchen injiziert, die man mit Rotlauferregern infiziert hatte. Wie beim Diphtherieserum war das Rotlaufserum in der Lage, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern und eine bereits ausgebrochene Erkrankung zu heilen. Diese passive Immunisierung währte allerdings nur wenige Wochen, bis die Antitoxine im Organismus der immunisierten Tiere abgebaut waren. In den 1890er-Jahren wurde die Methode weiterentwickelt und aktive und passive Immunisierung miteinander verbunden. Als Wirtstiere zur»serum-herstellung«dienten vorerst Schweine. Das aus dem Blut gewonnene Serumsediment wurde mit Wasser und Glycerin gemischt und den zu schützenden Tieren hinter die Ohren oder auf die Innenfläche der Beine injiziert. Da die passive Immunisierung nur eine kurze Zeit wirkte, wurden die Schweine nach drei bis fünf Tagen mit schwächeren und erneut nach ca. zwei Wochen mit vollvirulenten Rotlaufkulturen infiziert, woraufhin die Schweine eine aktive Immunisierung ausbilden konnten. Durch die kombinierte Immunisierung, auch Serovakzination genannt, waren die Tiere vier bis fünf Monate vor einer Infektion geschützt. 95 In den 1890er-Jahren und im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden im Deutschen Reich zahlreiche weitere Seren und Impfstoffe entwickelt. Im Wesentlichen folgten die Arbeiten den oben beschriebenen Methoden und sollen nur skizziert werden. Zusätzlich zu den FWH investierten die Chemische Fabrik Schering in Berlin und die Farbwerke Merck in Darmstadt in die neue Therapie, gründeten Bakteriologische Abteilungen und finanzierten und kooperierten mit Wissenschaftlern. Die Lage wurde schnell unübersichtlich. In den nächsten Jahren kamen eine Reihe weiterer Unternehmen hinzu oder gründeten sich neu, die teilweise ausschließlich Seren und Impfstoffe herstellten: die Firma Ruete und Enoch in Hamburg, in Dresden die Sächsischen Serumwerke, in Köln die Rheinischen Serumwerke, Ludwig Wilhelm Gans in Hoechst, die Serum-Gesellschaft in Landsberg, die Serum-Gesellschaft in Heilsberg und das Serum-Institut in Thorn. Kurzzeitig gab es auch ein Pasteur-Institut in Stuttgart und 1904 gründete Emil von Behring die nach ihm benannten Behringwerke in Marburg, um dort Seren und die von ihm entwickelten Tuberkulose-Präparate herzustellen. Am PII in Berlin arbeitete man an der Verbesserung des Tuberkulins, das allerdings weniger als Therapeutikum denn als Diagnostikum erfolgreich war. Behring, Ehrlich, Brieger, Wassermann und Kossel waren mit den Arbeiten zur Entwicklung des Diphtherieheilserums beschäftigt. Seitdem das Serum auf dem pharmazeutischen Markt angeboten wurde, arbeiteten Kossel und Wassermann in der»controlstation«und prüften die für das Deutsche Reich produzierten Serumchargen und Ehrlich war mit der Verbesserung der Serumqualität beschäftigt. Richard Pfeiffer, August Wassermann und Ludwig Brieger arbeiteten in unterschiedlichen personellen Konstellationen zur Immunität von Cholera und an einem Kombinationsimpfstoff gegen Typhus und Cholera. Zudem wurde am Institut zur Ätiologie zu verschiedenen Infektionskrankheiten gearbeitet. Mitarbeiter des Instituts nahmen 1897 und 1900 an Expeditionen nach Indien und Portugal zur Erforschung der Pest teil, um die Ätiologie und Epidemiologie der Epidemie zu beobachten und, nach ihrer Rückkehr, ein Serum gegen Pest zu entwickeln. Darüber hinaus eröffnete 1898 eine Abteilung zur Herstellung und Behandlung von Tollwut. 96 Die verschiedenen Serumhersteller boten neben dem Diphtherie- und Tetanusserum um 1900 eine Reihe weiterer Seren an: gegen Rotlauf, Milzbrand, die Schweineseuche und Schweinepest, Geflügelcholera, Dysenterie und Streptokokken. 97 Die Entwicklung dieser Seren beruhte im Wesentlichen auf den oben beschriebenen Methoden: Nach Isolierung und Kultivierung eines Erregers wurde den Versuchstieren abgeschwächte Bakterienkul turen oder stark verdünntes Bakteriengift injiziert, um die körperliche Abwehrreaktion der Versuchstiere zu stimulieren. Diese Behandlung wiederholte man mit langsam steigenden Giftdosen oder immer geringer abgeschwächten Bakterienkulturen, bis die Versuchstiere auch eine vielfach tödliche Dosis eines Bakteriengiftes oder virulente Bakterienkulturen vertrugen, ohne Krankheitssymptome zu zeigen. Das Blutserum der immunisierten Tiere sollte wiederum nicht immunisierte Tiere schützen, denen man mit dem Serum zugleich virulente Bakterienkulturen oder -gifte verabreicht hatte, so dass die unbehandelten Tiere nicht oder nur leicht erkrankten. In einem nächsten Schritt galt es, ein geeignetes, für den Krankheitserreger empfängliches Großtier zu finden, um Serum im großen Maßstab herstellen und verkaufen zu können. Schließlich musste für jedes Serum eine Methode zur Bestimmung der Wirkung entwickelt werden, um die Versuchsresultate zu bewerten und verschiedene Seren vergleichen zu können. 95 Zusammenfassend Carl Dammann: Die Bekämpfung des Schweinerothlaufs mit den Lorenz schen Impfstoffen und mit Susserin, Hannover 1901; Max Geddert: Geschichte der Schutzimpfung gegen den Rotlauf der Schweine mit besonderer Berücksichtigung der Simultanimpfung nach Lorenz, Berlin 1934; Dorothee Besse: Die Hessische Rotlaufimpfanstalt und das Staatliche Veterinäruntersuchungsamt in Giessen, Giessen Vgl. Gaffky, Institut für Infektionskrankheiten, S Vgl. Otto: Staatliche Prüfung, dargestellten Seren. Zu dem von Georg Sobernheim entwickelten Milzbrandserum s. Georg Sobernheim: Untersuchungen über die Wirksamkeit des Milzbrandserum, in: BKW 34 (1897), S ; ders.: Experimentelle Untersuchungen zur Frage der activen und passiven Milzbrandimmunität, in: ZHI 25 (1897), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 47
27 Behring hatte in seinem umfassenden Artikel zu Desinfektionsmitteln und zu deren Methoden, in dem er seine Erfahrungen zur»inneren Desinfektion«bündelte, den chemischen Substanzen bakterienfeindliche und bakteriengiftvernichtende Eigenschaften zugeschrieben. 98 Ähnlich verhielt es sich auch mit Seren: Bei antitoxischen Seren wurden bei der Immunisierung des Wirtstieres Bakteriengifte verwendet und das Serum war nur gegen die von den Bakterien produzierten Gifte wirksam bzw. neutralisierte diese und hatte dadurch bakteriengiftvernichtende Eigenschaften. Antibakterielle bzw. bakterizide Seren wurden hergestellt, indem man die Wirtstiere durch die Injektion von Bakterienkulturen immunisierte. Das so produzierte Serum wirkte gegen die Bakterien selbst und hatte entsprechend bakterienfeindliche Eigenschaften. 99 Bei einem Großteil der Seren handelte es sich um antibakterielle Seren. Bei diesen war die Wertbestimmung weitaus schwieriger, weil es nicht nur um die Neutralisierung von Toxinen und Antitoxinen ging, sondern komplexe mikrobiologische Prozesse mit einer Reihe von zu dieser Zeit noch nicht näher bekannten Einflussfaktoren abliefen. Die Bakterien waren ein wesentlicher Einflussfaktor und die Beobachtung, dass nicht jeder Bakterienstamm eines Krankheitserregers in gleicher Weise reagierte, machte die Entwicklung von Seren und deren Wertbestimmung noch komplizierter und aufwendiger. Beim Schweineseuchenserum entwickelte man bspw. mono- und polyvalente Seren. Bei ersterem verwendete man zur Immunisierung des Wirtstieres die Kulturen eines bestimmten Bakterienstammes. In der Bekämpfung einer auftretenden Schweineseuche war dieses Serum sehr wirksam, wenn die Epizootie auch durch diesen Bakterienstamm verursacht wurde, andernfalls wirkte es nur sehr schwach oder gar nicht. Bei polyvalenten Seren wurden die Wirtstiere mit Kulturen von möglichst vielen Bakterienstämmen immunisiert, so dass das Serum breitenwirksam angewendet werden konnte, aber eine geringere Wirksamkeit gegen einen bestimmten Bakterienstamm aufwies. Bei der Wertbestimmung eines monovalenten Serums musste man Kenntnis über den jeweiligen Bakterienstamm haben, um überhaupt die Wirkung zu bemessen und dadurch die Seren miteinander vergleichen und bewerten zu können. 100 Für manche Seren konnte keine Wertbestimmungsmethode entwickelt werden, da die Meßergebnisse zu unterschiedlich ausfielen. 101 Trotz intensiver Bemühungen gelang es bspw. nicht, eine Methode zur Wertbestimmung des Milzbrandserums zu entwickeln Vgl. Behring, Desinfection, S Vgl. Otto, Staatliche Prüfung, S. 22 f., Zur Bakteriolyse s. weiter unten. 100 Vgl. Otto, Staatliche Prüfung, S Vgl. ebd., S Vgl. Bernhard Schubert: Versuche über Wertbemessung des Sobernheim schen Milzbrandserums, Diss. Vet.-Med. Universität Giessen, Borna-Leipzig Eine valide und stabile Wertbestimmungsmethode, die erlaubte, die Ergebnisse eindeutig und unabhängig von der ausführenden Person und dem Ort zu reproduzieren, war aber notwendig, wenn Seren staatlich geprüft werden sollten. Beim Milzbrandserum schien dies aus Sicht der Medizinalverwaltung nicht zwingend erforderlich, da das Serum vor allem in der Tiermedizin eingesetzt wurde. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass für Menschen bestimmte Impfstoffe und Seren wie die gegen Pocken, Tollwut, Cholera und Typhus entweder in staatlichen Einrichtungen oder in nicht-kommerziellen Anstalten des öffentlichen Rechts hergestellt wurden; Seren wie das Diphtherie-, Tetanus- oder später das Streptokokkenserum unterlagen zwingend der staatlichen Prüfung und Regulation. Die Suche und Entwicklung stabiler Wertbestimmungsverfahren führte auch zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den jeweiligen Seren und ihrer Zusammensetzung. Von der Praxis zur Theorie der Immunologie Behring und seine Arbeitsgruppe legten den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die praktische Entwicklung des Diphtherie- und Tetanusserums. Die genaue Zusammensetzung und Konstitution der Toxine oder Antitoxine, ihre exakte mikrobiologische und biochemische Wirkungsweise waren für ihn von zweitrangiger Bedeutung. Und nachdem es Ehrlich gelungen war, den Grad der Immunisierung so weit zu erhöhen, dass man Serum auch für die Behandlung von Menschen gewinnen konnte, war man mit der Verbesserung der Serumqualität und der klinisch-therapeutischen Prüfung beschäftigt. Fraenkel und Brieger ordneten die Bakteriengifte der Gruppe der Eiweiße zu. Ihre Ent stehung erklärten sie dadurch, dass die Toxalbumine von den Bakterien aus dem Gewebseiweiß aufgebaut und abgespalten und dadurch ihre giftigen Eigenschaften ausbilden würden. 103 Diese Giftstoffe konnten nun durch die im Immunisierungsprozess gebildeten Anti-Toxine neutralisiert werden. Bei den antibakteriell wirkenden Sera rückte auch die Reaktion der Bakterien in den Fokus der Aufmerksamkeit, um die immunologischen Prozesse verstehen und beeinflussen zu können. Wie Josef von Fodor ( ) hatte auch Hans Buchner ( ) festgestellt, dass Blutserum eine Bakterien abtötende Wirkung unabhängig von der Art des Erregers hatte, diese allerdings nach Erhitzung auf 56 bis 60 Grad vernichtet wurde. Buchner vermutete 1892, dass diese im Blutserum enthaltenen bakteriziden Stoffe, die er Alexine nannte, labil seien und sich bei Erhitzung auflösen würden, so dass ihre Wirkung verloren ginge. 104 Im Berliner PII 103 Vgl. Throm, Diphtherieserum, S Vgl. Karl Kisskalt: Buchner, Hans Ernst August, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 2 (1955), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 49
28 hatte 1894 Richard Pfeiffer indes beobachtet, dass einige Bakteriengifte hitzebeständig waren. Im Rahmen seiner Arbeiten zu einem Cholera-Impfstoff hatte Pfeiffer festgestellt, dass der Erreger nicht nur einen Giftstoff absonderte, der thermolabil war (heute bekannt als Choleratoxin), sondern dass nach Abtöten der Bakterien ein weiterer Giftstoff freigesetzt wurde, der hitzestabil war (heute bekannt als Lipopolysaccharid). Er schloss daraus, dass dieser Giftstoff nicht aktiv ausgeschieden, sondern beim Absterben freigesetzt wurde. Da Pfeiffer denselben in den Bakterienzellen eingeschlossen wähnte, nannte er sie Endotoxine. 105 Weiterhin hatte Pfeiffer beobachtet, dass Cholera-Erreger sich auflösten, wenn man sie in die Bauchhöhle eines immunisierten Meerschweinchens injizierte. Er bezeichnete diesen Vorgang als Bakteriolyse und äußerte die Vermutung, dass die im Serum des Meerschweinchens enthaltenen inaktiven Substanzen eine entwicklungshemmende Eigenschaft besäßen, die im Fall einer Infektion bzw. der erfolgten künstlichen Injektion von Bakterien durch die Körperzellen in eine spezifisch wirksame Form überführt würde. Dieser Vorgang werde so lange fortgesetzt, wie der durch die Anwesenheit der Bakterien gesetzte Reiz andauere. Vergleichbare Beobachtungen hatte Jules Bordet in Paris bei Kaninchen gemacht, denen Serum von Meerschweinchen injiziert wurde, die zuvor mit Kaninchenblut behandelt worden waren. Das Serum von behandelten Meerschweinchen bewirkte die Auflösung der roten Blutkörperchen. Die sogenannte Hämolyse konnte durch Erhitzen auf 56 Grad aufgehoben und durch eine erneute Zufuhr von frischem Meerschweinchenserum reaktiviert werden. In beiden Fällen wurden gegen körperfremde Substanzen Prozesse aktiviert, die diese aufzulösen in der Lage waren und die, wie bei der Hämolyse, gegenständlich auf einen fremden Körper übertragen werden konnten. 106 Ehrlich wird Pfeiffers Beobachtungen mit großem Interesse zur Kenntnis genommen haben. Zeigten sich Bakterien als veränderliche Größe, so basierte die Methode der Wertbestimmung des Diphtherieserums in den Anfangsjahren auf einem komplexen Beziehungssystem mit einem Standardgift als Bezugsgröße, ausgehend von der Annahme, dass ihre Wirkung sich nicht veränderte und konstant blieb. Dies sollte sich als Trugschluss erweisen. Die im Zusammenhang mit der Revision der Wertbestimmungsmethode angestellten Überlegungen sollten die immunologischen Prozesse in toto erklären und mündeten in der Seitenkettentheorie, für die Ehrlich 1908 der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin (zusammen mit Elias Metchnikoff) verliehen wurde. 105 Vgl. Richard Pfeiffer: Weitere Untersuchungen ueber das Wesen der Choleraimmunität und ueber specifisch baktericide Processe, in: ZHI 18 (1894), S Vgl. Hüntelmann, Paul Ehrlich, S Richard Pfeiffer (stehend) und Robert Koch im Institut für Infektionskrankheiten, 1892 Seit 1896 kam es bei der Bemessung des Immunisierungswertes gelegentlich zu Unstimmigkeiten zwischen dem zentralen Prüfinstitut und den Serumherstellern, so dass Ehrlich die gesamte Methode einer Revision unterzog. Bei einer Überprüfung älterer Testgifte stellte er fest, dass sich diese abgeschwächt hatten. In einem ausführlichen Bericht an das Preußische Kultusministerium erläuterte Ehrlich notwendige Veränderungen der Wertbestimmungsmethode. 107 Weiterhin versuchte er, die Abschwächung des Diphtheriegiftes theoretisch zu begründen. Ehrlich hatte die Wirkung zahlreicher Gifte unterschiedlicher Herkunft über einen längeren Zeitraum untersucht und die Veränderungen des Giftspektrums von der neutralen zur letalen Dosis experimentell geprüft. Aufgrund der Versuche kam er zu dem Resultat, dass Teile des Giftstoffes sich in dem 107 S. Paul Ehrlich: Die Wertbemessung des Diphtherieheilserums und deren theoretische Grundlagen, in: Klinisches Jahrbuch 6 (1897), S Als Bezugsgröße sollte zukünftig ein vakuumgetrocknetes Standardserum mit einer genau bestimmten Wirkung verwendet werden, von dem Ehrlich ausging, dass das in einem luftdicht verschlossenen Röhrchen aufbewahrte Serum unveränderlich sei. Weiterhin wurde das Wertbestimmungsverfahren dahingehend geändert, dass die Mischung von Serum und Toxin nach vier Tagen den Tod des Bioindikators bewirken sollte und nicht mehr wie bisher das Ausbleiben von Krankheitserscheinungen. 50 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 51
29 Toxin in ähnliche, aber ungiftige Toxoide umwandelten. Diese Toxoide vermochten die Antitoxine genauso zu binden wie die Toxine, nur die Wirkung des Diphtheriegiftes wurde schwächer. 108 Grundlegender als seine Arbeit zur Konstitution des Diphtheriegiftes waren seine theoretischen Annahmen zur Wirkung des Giftstoffes und zum Verhältnis von Toxin und Antitoxin. Seine Überlegungen fasste er zu einer»theorie der Immunität«der sogenannten Seitenkettentheorie zusammen. Diese wurde skizzenhaft in der Publikation über die»wertbemessung des Diphtherieheilserums und deren theoretischen Grundlagen«und ausführlicher einige Jahre später in der Croonin Lecture»On immunity with special reference to cell life«dargestellt. 109 Ehrlich und Behring stimmten darin überein, dass sich Gift und Serum bzw. Toxin und Antitoxin gegenseitig chemisch neutralisieren würden, vergleichbar wie eine chemische Reaktion von Säure und Lauge. 110 Die Vereinigung, so Paul Ehrlich, erfolge in einem bestimmten Verhältnis, so dass ein Molekül Gift eine entsprechende Menge Antikörper binde.»man wird annehmen müssen, dass diese Fähigkeit, Antikörper zu binden, auf Anwesenheit einer specifischen Atomgruppe des Giftkomplexes zurückzuführen ist, die zu einer bestimmten Atomgruppe des Antitoxinkomplexes eine maximale, specifische Verwandtschaft zeigt und sich an sie leicht einfügt, wie Schlüssel und Schloss nach einem bekannten Vergleich von Emil Fischer.«111 Die Verankerung der körperfremden Substanz an die Zelle stelle die Voraussetzung für die Einwirkung der Substanz auf das Protoplasma dar. Diesen leitenden Gedanken der Seitenkettentheorie hat Ehrlich auf die kurze Formel»corpora non agunt, nisi fixata«gebracht. 112 Bezugnehmend auf seine Arbeit über»das Sauerstoff-Bedürfniss des Organismus«113 erklärte Ehrlich am Beispiel einer Tetanusvergiftung, wie man sich den Prozess vorzustellen habe. Im»Sauerstoff-Bedürfniss«hatte er angenommen, dass jedes Protoplasma aus einem Leistungskern besteht, an dem als Seitenketten bezeichnete Atomkomplexe 108 Vgl. Ehrlich: Wertbemessung; ders.: Ueber die Constitution des Diphtheriegiftes, in: DMW 24 (1898), S ; Paul Th. Müller: Vorlesungen über Infektion und Immunität, 2. Aufl., Jena 1909, S ; Hüntelmann, Paul Ehrlich, S Vgl. Ehrlich: Wertbemessung des Diphtherieheilserums; ders.: On Immunity with special reference to cell life, in: Proceedings of the Royal Society 66 (1900), S Vgl. Paul Ehrlich: Zur Kenntniss der Antitoxinwirkung, in: Gesammelte Arbeiten, Bd. 2, S. 84 f. (OA: Fortschritte der Medizin 1897). 111 Vgl. Ehrlich, Wertbemessung, S. 94 (in GA II). 112 S. Adolf Lazarus: Paul Ehrlich, Wien 1922, S. 39 f.; August von Wassermann, Die Seitenkettentheorie, in: Hugo Apolant et al. (Hg.): Paul Ehrlich. Eine Darstellung seines wissenschaftlichen Wirkens. Festschrift zum 60. Geburtstage des Forschers, Jena 1914, S , hier S. 135; bereits beschrieben in Hüntelmann, Paul Ehrlich, S. 120 f. 113 Vgl. Paul Ehrlich: Das Sauerstoff-Bedürfniss des Organismus. Eine farbenanalytische Studie, Berlin mit spezifischen Funktionen angefügt waren, über die die Zelle versorgt wurde. Das Tetanusgift müsse eine den Seitenketten der Nervenzelle entsprechende Atomgruppierung aufweisen, so dass sich das Tetanusgift mittels der Seitenketten fest an die Zelle verankere. Die Bindung der Seitenkette an das Tetanusgift sowie die einsetzende dauerhafte Funktionsstörung führe zum Defekt der Seitenkette. Die Prozesse seien jedoch nicht rein chemisch, sondern biologisch regenerativ. Carl Weigert habe mit seiner»schädigungstheorie«nachgewiesen, dass die ausgefallene Gruppe neu gebildet und ersetzt würden. Bei einer weiteren Zuführung von Gift werde die neugebildete Gruppe durch dieses ebenfalls gebunden, was eine erneute Regeneration hervorrufe.»im Verlaufe des typischen Immunisierungsverfahrens wird die Zelle sozusagen trainiert, die betreffende Seitenkette in immer ausgedehnterem Masse zu erzeugen.«bei diesem Vorgang würden mehr Seitenketten reproduziert als notwendig und der Überschuss in das Blut abgegeben. Diese»überschüssigen«und von der Zelle abgestoßenen Seitenketten stellten die Antitoxine dar, die wiederum zum Gift eine spezifische Verwandtschaft haben und dieses zu binden vermögen. 114 Diese theoretischen Annahmen waren das Grundgerüst seiner Seitenkettentheorie, die Paul Ehrlich in den nächsten Jahren auch und gerade in der Auseinandersetzung mit Kritikern weiter ausdifferenzierte. Der Ausbau der Theorie war umso wichtiger, da es sich nicht um sichtbare wissenschaftliche Objekte handelte, sondern um hypothetische Annahmen und Analogieschlüsse. Zur Beweisführung waren umfangreiche Serien von Tierexperimenten notwendig, um die Theorie empirisch zu fundieren und ihr nach dem damaligen Verständnis der Bakteriologie den Status einer wissenschaftlichen Tatsache zu verleihen. 115 In zwei weiteren Veröffentlichungen zur»lysinwirkung«und über»haemolysine«griff Ehrlich die oben erwähnten Arbeiten von Jules Bordet und Richard Pfeiffer zur Bakte rioloyse auf. Die temperaturbedingte Aufhebung und Reaktivierung dieses Vorganges erklärte Ehrlich mit Bezug auf seine Seitenkettentheorie dahingehend, dass es eine verbindende Substanz zwischen dem Fremdkörper und dem Antikörper geben müsse. Insgesamt seien drei Körper beteiligt: neben dem Antigen zudem der durch die Immunisierung entstehende spezifische widerstandsfähige Wirkstoff, von Pfeiffer als Immunkörper bezeichnet, sowie ein hitzeempfindlicher unspezifischer Ergänzungsstoff, von Ehrlich als Additiv bzw. später als Komplement bezeichnet. Bei Buchner tauchte ein solcher temperaturabhängiger verbindender Körper als Alexin auf. Der Immunkörper müsse zwei haptophore Komplexe haben: zum einen mit einer größeren Verwandtschaft zum 114 Vgl. Ehrlich, Wertbemessung, S. 95 (GA II). 115 Ausführl. Hüntelmann, Paul Ehrlich, S. 121 f. 52 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 53
30 Antigen und zum anderen zu dem Komplement. Dieses bewirke fermentative Prozesse, vergleichbar mit denen der Verdauung, die die Bakterien oder Erythrozyten in kleinere Einheiten zerlegen und auflösen würden. Das Komplement werde während des Immunisierungsvorganges verbraucht; durch den Zusatz von»frischem«komplement könne man den Prozess allerdings fortsetzen. Durch die Immunisierung würde»die ganze Seitenkette mit ihren beiden functionirenden Gruppen«produziert und freigesetzt, wobei die Gruppen völlig unterschiedlich seien, abhängig vom Erregungsreiz, vom Organismus, von der Ernährung oder von der Spezies. 116 Den hitzestabilen, bei der Immunisierung entstehenden spezifischen Wirkstoff nannte Ehrlich Ambozeptor. In den weiteren Mitteilungen differenzierte er die Seitenketten weiter aus, daher führte Ehrlich in der dritten Mitteilung über Hämolysine den Begriff»Rezeptor«anstelle von»seitenkette«ein. 117 Dieser Begriff schien besser zur Gruppierung der Körper geeignet. Seitenketten, die an ihrer Oberfläche sowohl Komplemente als auch Immunkörper binden konnten (zwei Haft- bzw. haptophore Gruppen, die man sich als Andockstellen denken kann), hatte er zuvor als»riesenmoleküle«beschrieben. Nun unterschied Ehrlich Rezeptoren der I. Ordnung mit einer haptophoren Gruppe zur Bindung von Nahrungsmolekülen, der II. Ordnung mit einer haptophoren Gruppe zur Bindung von Nahrungsmolekülen und einer weiteren Gruppe zur Bindung von Komplementen (wie die oben beschriebenen Riesenmoleküle) sowie Rezeptoren der III. Ordnung, die eine haptophore Gruppe für das Nahrungsmolekül und noch eine haptophore oder komplementophile Gruppe für die Verankerung der Komplemente hatte. Je nach Ordnung der Rezeptoren lieferten diese nach Ehrlich Antitoxine, Anti-Komplemente, Anti-Fermente, Agglutinine, Präzipitine oder Ambozeptoren bzw. Immunkörper. Ehrlich ergänzte weitere Gruppen von Rezeptoren: Triceptoren oder Quatriceptoren konnten drei oder vier, Polyceptoren eine Vielzahl von Komplementen binden. 118 Widerspruch gegen Ehrlichs Theorie wurde insbesondere von Elias Metschnikoff ( ) und seinen Schülern aus dem Institut Pasteur geäußert, wo man mit der Phagozytoselehre eine andere Auffassung zu den Immunitätsvorgängen vertrat. 119 In 116 Vgl. Paul Ehrlich/Julius Morgenroth: Zur Theorie der Lysinwirkung, in: Gesammelte Arbeiten, Bd. 2 (OA: BKW 1899), S , das Zitat S. 149; dies.: Ueber Hämolysine. Zweite Mitteilung, in: Gesammelte Arbeiten, Bd. 2 (OA: BKW 1899), S ; Cay-Rüdiger Prüll/Andreas-Holger Maehle/Robert Francis Halliwell: A short history of the drug receptor concept, Basingstoke 2009; Silverstein: Paul Ehrlich s Receptor Immunology. 117 Vgl. Paul Ehrlich/Julius Morgenroth: Ueber Hämolysine. Dritte Mitteilung, in: Gesammelte Arbeiten (OA: BKW 1900), S Zusammenfassend Müller, Vorlesungen, S ; Prüll, Part of a Scientific Masterplan? S. 345 f. 119 Da der Fokus der Darstellung auf der Immunologie in Deutschland liegt, wird an dieser Stelle nur kurz auf die internationalen Kritiker eingegangen. Bordet kritisierte die von Ehrlich angenommene Verbin- Bildliche Darstellung der Ehrlich schen Seitenkettentheorie Deutschland wurde Ehrlich von Hans Buchner angegriffen, der die Antitoxine als Umwandlungsprodukte der Toxine beschrieb. 120 Ehrlich hat die von ihm durchgeführten und veranlassten Studien 1904 in den»gesammelten Arbeiten zur Immunitätsforschung«publiziert. 121 Die Veröffentlichung der»arbeiten zur Immunitätsforschung«markiert auch einen Wendepunkt in der Forschung Ehrlichs: seit 1903 wandte er sich chemotherapeutischen Problemen zu. dung von Komplement und Ambozeptor. Seiner Meinung zufolge würde das Komplement den Ambozeptor nur für die Verbindung präparieren Zur Kritik von Elias Metschnikoff, Karl Landsteiner oder Svante Arrhenius gibt es zahlreiche Literatur, s. als Überblick: Prüll: Part of a Scientific Master-Plan; Prüll/Maehle/Halliwell, Short History; Silverstein: Paul Ehrlich s Receptor Immunology; Alfred I. Tauber/ Leon Chernyak: Metchnikoff and the Origins of Immunology, Oxford 1991; Eileen Crist/Alfred I. Tauber: Debating Humoral Immunity and Epistemology: The Rivalry of the Immunochemists Jules Bordet and Paul Ehrlich, in: Journal of the History of Biology 30 (1997), S ; Lewis P. Rubin: Styles in Scientific Explanation: Paul Ehrlich and Svante Arrhenius on Immunochemistry, in: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 35 (1980), S ; Franz Luttenberger: Arrhenius vs. Ehrlich on Immunochemistry. Decisions about Scientific Progress in the Context of the Nobel Prize, in: Theoretical Medicine 13 (1992), S Vgl. Prüll, Part of a Scientific Masterplan? So auch beschrieben in Hüntelmann, Paul Ehrlich, S Vgl. Paul Ehrlich: Gesammelte Arbeiten zur Immunitätsforschung, Berlin 1904; zur Seitenkettentheorie und ihrer Bedeutung für die Medizin: Ludwig Aschoff: Ehrlich s Seitenkettentheorie und ihre Anwendung auf die künstlichen Immunisierungsprozesse. Zusammenfassende Darstellung, Jena 1902; Paul Römer: Die Ehrlichsche Seitenkettentheorie und ihre Bedeutung für die medizinischen Wissenschaften, Wien DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 55
31 Ausdifferenzierung und Institutionalisierung der Immunologie Der Umzug von Berlin nach Frankfurt und die Umbenennung des Instituts für Serumforschung und Serumprüfung in Königlich Preußisches Institut für experimentelle Therapie im Sommer 1899 markiert nicht nur für das Institut selbst eine Ausweitung der Arbeitsaufgaben und des institutionellen Selbstverständnisses. Um die Jahrhundertwende formierte sich die Immunologie bzw. die Immunitätslehre als eigene Forschungsdisziplin innerhalb der Medizin. Dies macht sich einerseits an der steigenden Zahl von Publikationen bemerkbar, die im Titel den Begriff»Immunität«tragen. Zum anderen gibt es seit der Jahrhundertwende erste Abteilungen an Instituten, die allein der Forschung zu immunologischen und serologischen Fragestellungen und Problemen gewidmet waren. Schließlich hatte sich der Gegenstand der Immunologie selbst ausdifferenziert: Mit Formulierung der Seitenkettentheorie erschienen zahlreiche Publikationen, die sich mit Ehrlichs Theorie auseinandersetzten die Vielzahl der sie ablehnenden oder bestätigenden Arbeiten kann hier nicht im einzelnen erörtert werden, zumal ein Großteil der Kritik auch aus dem Institut Pasteur mit Bezug auf Metchnikoffs Phagozyten-Lehre und der von ihm vertretenen zellulären Immunität geäußert wurde. Konnte die Geschichte der Immunologie bis dato kaum ohne internationalen Bezug gefasst werden, wurden nach 1900 die Themen so umfangreich und vielfältig, dass nunmehr eine Fokussierung auf Deutschland, zumindest für einige Jahrzehnte, möglich ist (wobei wissenschaftliche Arbeit stets international ausgerichtet ist). Immunologische Themen behandelten in den 1890er-Jahren vor allem die Entwicklung und Verbesserung von Seren und Impfstoffen, Serologie und Immunologie waren nahezu identisch. Nach 1900 trennte sich die Serologie von der Immunologie; erstere beinhaltete zunehmend diagnostische Verfahren, Eiweiß- und Blutgruppenforschung, letztere weitete sich auf Virusforschung, Krebsforschung und auf Fragen aus, die die körperliche Reaktion und Abwehr auf äußere Reize erörterte, wobei die Abwehr sich, wie sich bald herausstellte, selbstzerstörerisch auch gegen den eigenen Körper richten konnte. Anaphylaxie, Überempfindlichkeit Im Frühjahr 1896 verstarb unmittelbar nach einer Injektion mit Diphtherieserum der knapp zweijährige Ernst Langerhans. Der Junge war nach Aussage der Eltern eigentlich gesund gewesen und sollte präventiv mit dem Serum behandelt werden, weil die Köchin der Familie über Halsschmerzen geklagt hatte. Die Verabreichung des Serums war durch den Vater des Jungen erfolgt, den renommierten Mediziner Robert Langer- hans ( ). In einer veröffentlichten Todesanzeige behauptete der Vater, dass sein Sohn durch das Behring sche Heilserum vergiftet worden sei. Der Fall erregte großes öffentliches Aufsehen und es wurde eine offizielle Untersuchung des Todesfalls und eine Autopsie des Jungen eingeleitet. Da man im Laufe der Untersuchung einen Fehler bei der Applikation des Serums ausschloss, das Serum sich im Tierversuch als unschädlich erwies, und keine weiteren Besonderheiten bei der Verabreichung von Serum mit der gleichen Chargennummer gemeldet wurden, beurteilte der Abschlussbericht den Tod des Jungen als Unglücksfall. Der Gerichtsarzt bemerkte in dem Obduktionsbericht, dass der Junge in Folge»Idiosyncrasie«gegenüber den natürlichen Bestandteilen des Serums gestorben sei. 122 Heute kann der Tod von Ernst Langerhans als der erste dokumentierte Fall eines anaphylaktischen Schocks angesehen werden, denn die Mutter des Jungen bemerkte während der Untersuchung, dass ihr Sohn empfindlich auf Pferde reagiert habe. Mit Nachprüfungen zur Überempfindlichkeit, zur Idiosynkrasie gegen bestimmte Stoffe beschäftigte man sich erst am Ende des Untersuchungszeitraums eingehender, da es vorerst schwierig war, entsprechende Reaktionen im Tierversuch zu modellieren. Überreaktionen wie die Bildung von Erythemen und Exanthemen nach der Verabreichung von Serum wurden bereits 1896 von dem Berliner Sozialhygieniker Adolf Gottstein ( ) als»serumkrankheit«bezeichnet. Die akute, überempfindliche Reaktion des gesamten Organismus nach wiederholter Einverleibung körperfremder Eiweiße beschrieben 1902 erstmals Charles R. Richet ( ), Professor für Physiologie in Paris, und Paul Portier ( ) als»anaphylaxie«. Hiervon unterschied der Wiener Pädiator Clemens von Pirquet ( ) eine veränderte Abwehrreaktion des Körpers gegen fremde, normalerweise harmlose Substanzen aus der Umwelt als»allergie«. Anaphylaktische Reaktionen häuften sich experimentell durch die mehrfache Injektion von Blutserum bei den zahlreichen Tier versuchen zur Seitenkettentheorie. Richard Otto ( ), abkommandierter Stabsarzt an das IET und das PII, bezeichnete 1907 die Übertragbarkeit der Anaphylaxie durch das Serum sensibilisierter Tiere als»passive Anaphylaxie«. Der Fall Langerhans verdeutlichte, wie Pirquet erstmals erkannte, dass die Abwehr reaktionen des Körpers dann problematisch waren, wenn die durch die Antikörper ausgelöste Immunreaktion den Organismus nicht mehr schützte, sondern schädigte. Der von Ehrlich geprägte Begriff des horror autoxicus drückt dieses Unbehagen der Immunitätsforscher aus, wenn sich die körpereigene Abwehr gegen den Organismus selbst richtet (und später zur Erforschung von Autoimmunerkrankungen führt). Im Licht der Seitenkettentheorie und immunologischer Arbeiten wurde Anaphylaxie als 122 Vgl. Axel C. Hüntelmann: Das Diphtherie-Serum und der Fall Langerhans, in: MedGG 24 (2005), S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 57
32 Antigen-Antikörper-Reaktion interpretiert. Im deutschsprachigen Raum forschten in den 1900er-Jahren weiterhin Ernst Friedberger ( ), Ulrich Friedmann ( ) und Robert Doerr ( ) zur Anaphylaxie auf Basis der sich etablierenden serologischen Forschung. 123 Eiweiß-Forschung und Serologie Bereits 1896 hatte Max Gruber ( ), damals Direktor des Hy gienischen Instituts der Universität Wien und nach 1902 Professor für Hygiene in München, mit seinem Mitarbeiter Herbert E. Durham ( ) beobachtet, dass Cholera- oder Typhus- Bakterien in einem Kulturmedium nach Zugabe von Serum von Tieren, die man gegen die entsprechende Krankheit zuvor immunisiert hatte, kleine Häufchen bildeten, die Eigenbewegung einstellten und verklumpten. Gruber nannte diese im Serum enthaltenen Schutzstoffe, die eng mit der Schutzwirkung der Immunseren verbunden seien, Agglutinine. Das Substantiv Agglutination bezeichnete charakteristisch den Prozess der Verklumpung. Gruber erkannte schnell das diagnostische Potential der Beobachtung, denn aufgrund der spezifischen Natur trat Agglutination nur ein, wenn der Bakterienkultur ein entsprechendes Serum zugegeben wurde. Bei Seren von Tieren, die gegen andere Erkrankungen immunisiert worden waren, kam es nicht zur Verklumpung, so dass mit Hilfe von Antigenen bekannter Bakterien spezifische Antikörper nachgewiesen werden konnten und sich dieser Prozess zur Differentialdiagnose eignete. 124 Ein Jahr später erweiterte Rudolf Kraus ( ), Mitarbeiter am Institut für Allgemeine und Experimentelle Pathologie der Univer sität Wien, diese Beobachtung, dass sich diese Ausfällungserscheinungen nicht auf Bak terien bzw. ihre Stoffwechselprodukte beschränkte, sondern dass eine immunologische Reaktion allgemein durch die Verbindung 123 Vgl. Silverstein, History, S , ; Ulrich Meyer: Steckt eine Allergie dahinter? Die Industrialisierung von Arzneimittel-Entwicklung, -Herstellung und -Vermarktung am Beispiel der Antiallergika, Stuttgart 2002, insbes. S , 22; Mark Jackson: Allergy. The History of a Modern Malady, London 2007; sowie die Beiträge in dem Themenheft Allergy and History der Studies in History and Philosophy of Science, Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, Heft 3, Vol. 34 (2003). 124 Vgl. Adolf Dieudonné: Schutzimpfung und Serumtherapie. Zusammenfassende Übersicht über die Immunitätslehre, 2. Aufl. (OA 1895), Leipzig 1900, S ; Bäumler, Paul Ehrlich, S. 120; Hanspeter Mochmann/Werner Köhler: Meilensteine der Bakteriologie. Von Entdeckungen und Entdeckern aus den Gründerjahren der medizinischen Mikrobiologie, 2. Aufl., Frankfurt a. Main 1997, S Auf die gleichzeitige Beschreibung dieses Phänomens durch Fernand Widal ( ) und den sich daran anknüpfenden Prioritätsstreit gehe ich nicht ein. von Antigenen mit den entsprechenden Antikörpern ausgelöst wurde, die sich in der Verklumpung der beiden Körper zeigte. In einer Flüssigkeit aufgelöst bildeten die Antigen-Antikörper-Komplexe Flocken, die zu Boden sanken (Fällung bzw. Präzipitation) und eine Klärung der vormals trüben Flüssigkeit bewirkten. Rudolf Kraus beschrieb die Präzipitation am Beispiel eines Kaninchens, das mit Pferdeeiweiß behandelt wurde und entsprechende Antikörper dagegen entwickelt hatte. In Folge der neuerlichen Mischung von Pferdeeiweiß und Kaninchenserum kam es zur Agglutination und zur Ausfällung des Pferdeeiweißes und des so genannten Präzipitins bzw. des Anti-Pferdeeiweißes. Nach Ehrlichs Seitenkettentheorie bildeten die Agglutinine und die Präzipitine Rezeptoren der zweiten Ordnung. 125 Agglutination und Präzipitation stellten fortan die Grundlage der Serumdiagnostik und der biologischen Eiweißdifferenzierung dar. Solch eine spezifische Komplementbindungsreaktion wurde bspw. von August Wassermann, Albert Neisser ( ) und Carl Bruck ( ) entwickelt; sie diente als diagnostischer Nachweis von Syphilis und wurde als Wassermann-Test bekannt. 126 Bleiben wir im Hygienischen Institut in Wien. Dort hatte Karl Landsteiner 1900 bzw beobachtet, dass sich das Blut von zwei Menschen oder auch Blut und Blutserum unterschiedlicher menschlicher Provenienz verklumpte, sobald man die beiden Flüssigkeiten mischte. Bei seinen Versuchen zur Agglutination des Blutes bzw. zur Hämagglutination ging es Landsteiner vornehmlich um den Nachweis, dass Agglutination keinen genuin pathologischen Prozess beschrieb. Diese Zuschreibung lag nahe, da das Verfahren in Ver bindung mit Bakteriengiften und zur Differentialdiagnostik von Erkrankungen verwendet wurde. Aus diesem Grund untersuchte er das Blut von gesunden Männern und Frauen sowie von Plazenten bzw. das Nabelschnurblut. Die unterschiedlich ausfallenden Reak tionen ließen ihn erstens vermuten, dass es sich um eine individuell abhängige Reaktion handeln müsse, um bestimmte, agglutinierende Erscheinungen»des normalen menschlichen Blutes«. Entsprechend der Reaktionen teilte er die Probanden entsprechend der Merkmalsausprägung in drei Gruppen A, B und C ein. Bei zahlreichen weiteren Versuchen konnte er die unterschiedlichen Ergebnisse dahingehend deuten, dass eine Hämagglutina tion eintrat, wenn man das Blut unterschiedlicher Blutgruppen-Typen mischte bzw. dass man das Blut von Menschen mit der gleichen Blutgruppe vermengen konnte und somit eine Transfusion von Blut 125 Vgl. Bäumler, Paul Ehrlich, S Vgl. August Wassermann/Albert Neisser/Carl Bruck: Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis, in: DMW 32 (1906), S. 745 f. S. auch die als Sachs-Georgi-Test bekannte gewordene Präzipitin-Reaktion zur Diagnose von Syphilis. 58 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 59
33 möglich wurde. 127 Als früherer Mitarbeiter Ehrlichs am IET in Frankfurt arbeitete Emil von Dungern ( ) seit 1906 am Institut für experimentelle Krebsforschung in Heidelberg. Dort arbeitete er zusammen mit Ludwik Hirszfeld ( ) zur Sero- Diagnostik von Krebserkrankungen. In diesem Zusammenhang untersuchten sie systematisch das Blut und die Blutgruppen von Hunden und Menschen über mehrere Generationen und postulierten bezugnehmend auf die seinerzeit wiederentdeckten Vererbungsgesetze von Gregor Mendel ( ), dass sich Blutgruppen nach dem Muster der Mendel schen Gesetze vererben würden. Auf Grundlage ihrer ausführlichen Arbeiten schlugen sie eine veränderte Klassifizierung der Blutgruppen in A, B, AB und 0 (statt Landsteiners Gruppe C) vor, die sich in den 1920er-Jahren als internationale Nomenklatur durchsetzte. 128 Karl Landsteiners Publikation wurde lange Zeit nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Myriam Spörri zufolge lag dies daran, dass man Agglutination nach wie vor mit krank haften Prozessen in Verbindung brachte und Landsteiners Arbeit dieser Wahrnehmung zuwider lief und daher kaum rezipiert wurde. Den Hinweis, dass man die Unterscheidung der Blutgruppen auch zur Identifikation von Blutproben und für forensische Zwecke verwenden könne, wurde von Paul Uhlenhuth ( ) in Greifswald verfolgt. 129 Uhlenhuth hatte am Friedrich-Wilhelm-Institut, der späteren Kaiser-Wilhelm-Akademie für das Militärärztliche Bildungswesen, in Berlin Medizin studiert und nach Ableistung seines Militärdienstes wurde er 1897 an das PII abkommandiert. Dort publizierte Uhlenhuth zur Serumdiagnose des Typhus und der Hämolyse sowie zu den giftigen Eigenschaften des Serums bzw. dessen Bestandteilen wurde er nach Greifswald abkommandiert, wo er Friedrich Löffler bei seinen Arbeiten zur Maul- und Klauenseuche unterstützte. Daneben führte Uhlenhuth eigene Versuche zum Präzipitin-Verfahren durch. Allgemeiner Konsens war, dass es sich sowohl bei den Antigenen und Antikörpern als auch beim Blut um Proteine, um Eiweiße handelte. Uhlenhuth erforschte, welche Form des Eiweißes Antikörper ausbilde und ob man Tiere auch mit Eiweiß derart vorbehandeln könne, so dass diese spezifische Präzipitine entwickeln würden und 127 S. Karl Landsteiner: Ueber Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 46 (1901), S ; Paul Speiser/Ferdinand G. Smekal: Karl Landsteiner. Entdecker der Blutgruppen und Pionier der Immunologie. Biographie eines Nobelpreisträgers aus der Wiener Medizinischen Schule, Berlin 1990; Myriam Spörri: Reines und gemischtes Blut. Zur Kulturgeschichte der Blutgruppenforschung, , Bielefeld 2013, S Vgl. Emil Freiherr von Dungern/Ludwik Hirszfeld, Über Vererbung gruppenspezifischer Strukturen des Blutes, in: ZIET 6 (1910), S ; Spörri, Reines und gemischtes Blut, S Vgl. Spörri, Reines Blut, S Links: Emil von Dungern, ca. 1910er-Jahre Rechts: Ludwik Hirszfeld, 1917 inwieweit man diese Eiweiß-Stoffe weiter differenzieren könne. Ein einfacher Versuch brachte Klarheit: Einem Kaninchen wurden größere Mengen Hühnerei-Eiweiß in die Bauchhöhle injiziert, das daraufhin spezifische Hühnerei-Eiweiß-Antikörper bzw. Präzipitine entwickelte. Hühnerei-Eiweiß in Verbindung mit dem Serum des Kaninchens löste die typische Trübung und Präzipitation aus. In der Folge führte Uhlenhuth zahlreiche Versuche zur Differenzierung aus: zum einen wurden Eiweiß und Serum verdünnt oder das Eiweiß mit chemischen Substanzen behandelt, um zu prüfen, bis zu welchem Verdünnungsgrad die Fällungsreaktion noch erfolgt. Kontrollversuche sollten belegen, dass diese Reaktion nur durch Hühnerei-Eiweiß und nicht ebenfalls durch anderes Eiweiß ausgelöst wurde bzw. vice versa wurde das Eiweiß mit zahlreichen weiteren unbehandelten Seren vermischt, bei denen die Reaktion ausblieb.»somit war der Beweis erbracht, dass die in dem Serum des immunisierten Kaninchens gebildeten Antikörper höchstspezifisch nur auf Hühnereiweiß reagierten.«130 Uhlenhuth hatte gezeigt, dass man über die Präzipitin-Methode verschiedene Tierspezies, aber auch Tier und Mensch voneinander differenzieren konnte. In einem nächsten Schritt untersuchte Uhlenhuth die Reaktion von Eiweiß verschiedener Vogeltypen, wobei die Reaktion nur bei Tauben stärker ausfiel. In späteren Versuchen bestätigte sich, dass bei verwandten Tierspezies die Reaktion positiv, aber unterschiedlich stark ausfiel, woraus Uhlenhuth schloss, dass die Fällungsreaktion Rückschlüsse über den Verwandtschaftsgrad einer Tierspezies erlaube. Schließlich verfeinerte Uhlenhuth seine Ergebnisse und sicherte diese ab: er prüfte einer- 130 Vgl. Herbert A. Neumann: Paul Uhlenhuth. Ein Leben für die Forschung, Berlin 2004, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 61
34 seits, in welchem Zustand das zu prüfende Blut sein konnte, d. h. ob auch getrocknetes, verunreinigtes Blut oder in den Zustand der Fäulnis übergegangenes Blut noch eine Reaktion auslöste; und andererseits, bis zu welcher Verdünnung des Blutes noch eine Reaktion hervorgerufen wurde. 131 Krebsforschung Paul Uhlenhuth, Ende 1920er-Jahre Die sich nach 1900 etablierende experimentelle Krebsforschung stand Pate für die Interdisziplininarität der Immunologie, wie sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennzeichnend werden sollte. In den ersten beiden Jahrzehnten (und danach) arbeiteten Biologen, Chirurgen, Pathologen, Histologen, Internisten, Bakteriologen, Hygieniker, Statistiker und Serologen Hand in Hand auf diesem Gebiet. Doch bis zur Jahrhundertwende war die Geschwulst- und Krebsforschung dominiert von Chirurgen, Pathologen und Histologen, die die Entstehung von Geschwulsten auf krankhafte Veränderungen von Gewebe und Zellen zurückführten. 132 Während die Gewebelehre die Zellen beschrieb und klassifizierte, erforschte die Zellularpathologie mögliche Ursachen, Verlaufsformen und die pathologischen Veränderungen im Unterschied zur normalen Morphologie der Zelle. Ende des 19. Jahrhunderts gab es unterschiedliche Meinungen zur Histogenese der 131 Vgl. Neumann, Paul Uhlenhuth, S Vgl. Ulrike Bode: Frühe histologische Krebsforschung in Deutschland, Frankreich und Österreich, Köln Tumore und zur Tumorätiologie: Rudolf Virchow ( ) nahm an, dass Geschwülste erblich bedingt waren oder durch innere und äußere Reize ausgelöst würden; Hugo Ribbert ( ) wähnte ein selbständiges Wachstum von Gewebekeimen, die sich aus dem Zellverband gelöst hatten, als Ursache; Julius Cohnheim ( ) vertrat die Position, dass sich Geschwülste aus den embryonalen Anlagen der Zellen bildeten; und der Virchow-Schüler David von Hansemann ( ) erachtete eine asymmetrische Zellteilung (Anaplasie) von Tumoren. Zudem wurde um 1900 eine bakterielle (oder virale) Ursache von Tumoren erörtert. 133 Während sich die Histologie und die Pathologie vornehmlich theoretisch mit Geschwulsten, der Morphologie, Entstehung, Entwicklung und ihrer Klassifikation auseinandersetzten, oblag der Chirurgie die praktische Aufgabe, Patienten mit Geschwulsten zu behandeln bzw. Zellwucherungen chirurgisch zu entfernen. Mit Verbesserung der chirurgischen Technik, der Einführung von Anästhesie und Antisepsis waren der Chirurgie zumindest auf den ersten Blick Erfolge beschert, doch oft starben die Patienten nach einer vermeintlich erfolgreichen Entfernung der Wucherung an Folgeerkrankungen oder weil das Gewebe erneut zu wuchern begann. Einzig eine radikale Operation im Frühstadium des Tumors brachte Erfolg. 134 Mit dem Rückgang der Infektionskrankheiten Ende des 19. Jahrhunderts rückten tödliche Erkrankungen wie Krebs in den Vordergrund des öffentlichen Fachinteresses. Mit Etablierung der Medizinalstatistik konnte die Bakteriologie zwar ihre Erfolge bei der Bekämpfung der Infektionskrankheiten belegen, aber den Pocken und der Cholera folgten andere Krankheiten als Haupttodesursachen. 135 Mit der fatalen Erkrankung des Kaisers Friedrich III. ( ) 1888 an Kehlkopfkrebs sowie seiner Ehefrau Victoria ( ), die 1898 an Brustkrebs erkrankte, rückte Krebs auch in die politische Öffentlichkeit. Nach dem Tod der Kaiserin-Witwe, die ihre letzten Lebensjahre in Kronberg im Taunus verbracht hatte, stifteten Frankfurter Bürger im Herbst 1901 finanzielle Mittel, die für die Krebsforschung verwendet werden sollten. Um Aufschluss über das genaue Ausmaß der»krebssterblichkeit«und einen Überblick über die Krebsforschung zu erhalten und wissenschaftliche Aktivitäten anzuregen, wurde in Berlin im Februar 1900 das Comité für Krebsforschung gegründet. Initiatoren waren unter anderen der Bakteriologe Martin Kirchner ( ), Ministerialdirektor im Preußischen Kultusministerium, und Ernst Viktor von Leyden ( ), Direk- 133 Vgl. Birgit Hellmann-Mersch: Institutionen zur Krebsforschung und Krebsbekämpfung in Deutschland. Historischer Überblick und Analyse, Diss. med. Aachen, 1994, S Ebd., S. 15 f. 135 S. Gustav Wagner/Andrea Mauerberger: Krebsforschung in Deutschland. Vorgeschichte und Geschichte des Deutschen Krebsforschungszentrums, Berlin 1989, S. 3 f. 62 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 63
35 tor der I. Medizinischen Klinik der Charité. Das Comité wurde mehrfach umbenannt und firmierte ab 1911 als»deutsches Zentralkomitee zur Erforschung Bekämpfung der Krebskrankheit e. V.«(kurz: Komitee für Krebsforschung). Das Komitee sollte eine breite Öffentlichkeit für die Anliegen der Krebsforschung herstellen und finanzielle Ressourcen mobilisieren. Im Wesentlichen stellte das Komitee ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Gesundheitspolitikern dar, die auf dem Gebiet der Krebsforschung tätig waren und als deren Sprachrohr sich ab 1903 die»zeitschrift für Krebsforschung«etablierte. 136 Ziel des Komitees war erstens die Sammlung von Daten über Krebserkrankungen im Deutschen Reich und die Erstellung einer entsprechenden Morbiditätsstatistik; Aufklärungsschriften für Ärzte und Broschüren für Laien sollten zweitens die Früherkennung von Krebs fördern, um den Tumor möglichst früh zu entfernen. Zu diesem Zweck wurde 1906 in Berlin auch eine»fürsorgestelle für Krebskranke und Krebsverdächtige«eröffnet. Darüber hinaus veranstaltete das Komitee für Krebsforschung regelmäßig Konferenzen. 137 Ein erklärtes Ziel des Komitees war die Förderung der Krebsforschung, die durch die Gründung neuer Einrichtungen auf diesem Gebiet Auftrieb erhielt: Bereits 1901 wurde, finanziert durch die Stiftung Frankfurter Bürger, am IET eine Abteilung für experimentelle Krebsforschung eingerichtet. Der Direktor des Instituts, Paul Ehrlich, warnte jedoch vor zu hohen Erwartungen hinsichtlich verwertbarer Ergebnisse. Leiter der Abteilung wurde später Hugo Apolant ( ), als weitere Mitarbeiter wurden unter anderem Gustav Embden ( ) und Anton Sticker ( ) angestellt. Am IET arbeitete man in den nächsten Jahren vor allem daran, ein geeignetes Tiermodell für die Krebsforschung zu installieren und an methodischen Verbesserungen bei der Fortzüchtung der Tumore, um die verschiedenen Geschwulstformen, deren Morphologie und histologischen Bau, Entwicklung und Wachstum sowie die Virulenz der Tumore systematisch zu beobachten. Vor allem Sticker bemühte sich (erfolglos), Tumore zu übertragen und auf andere Tiere zu verpflanzen. 138 In Berlin wurde 1903 an der von Leyden geführten I. Medizinischen Klinik der Charité eine Abteilung für Krebsforschung eingerichtet, an der unter anderen Ferdinand Blumen thal ( ) und Leonor Michaelis ( ) beschäftigt waren wurde die Einrichtung verselbständigt und 1910 in»königliches Institut für Krebsfor- 136 Vgl. Thorsten Kohl: Ernst von Leyden und die Institutionalisierung der Krebsforschung zwischen 1896 und 1911, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 24 (2016), S Ausführl. bei Wagner/Mauerberger, Krebsforschung, S. 3 20; 138 Ebd., S ; Hüntelmann, Paul Ehrlich, S. 141, schung«umbenannt, die fortan Leydens Mitarbeiter Georg Klemperer ( ) leitete. Hinsichtlich der Ätiologie der Krebserkrankung lag ein Schwerpunkt des Instituts auf dem Nachweis von Parasiten im Tumorgewebe als verursachendes Agens. In der Abteilung für Chemo therapie wurde der Einfluss von Chemikalien auf das Tumorgewebe geprüft. In den Ab teilungen für Immunitätsforschung sowie derjenigen für Histologie und Serologie wurden die»erfahrungen der Immunitätsforschung«auf die Krebsforschung angewandt: Tumore wurden auf Parasiten hin untersucht und der Nachweis spezifischer Krebsreaktionen im Blut erforscht. In der klinischen Abteilung wurden inoperable Patienten mit Radium und mit Röntgenstrahlen behandelt. 139 Zuletzt sei das»institut für experimentelle Krebsforschung«in Heidelberg genannt (siehe Abb. S. 85), das 1906 auf Grundlage von privaten Spenden von dem Chirurgen Vinzenz Czerny ( ) gegründet wurde. Im Rahmen der ersten internationalen Konferenz für Krebsforschung, die teilweise im IET in Frankfurt und in Heidelberg stattfand, wurde das Institut für Krebsforschung feierlich eingeweiht. Das besondere am Heidelberger Institut war, das es mit dem so genannten Samariterhaus, einer speziell für Krebskranke errichteten Klinik, eine organisatorische Einheit bildete und quasi den experimentellen Unterbau für die klinisch-therapeutische Behandlung lieferte. Über die Krankenabteilung (Samariterhaus) hinaus hatte das Institut für experimentelle Krebsforschung eine Biologisch-Chemische und eine Histo-Parasitologische Abteilung. In der letztgenannten Abteilung wurde die Frage dis kutiert, ob bösartige Geschwulste durch Parasiten erzeugt oder beeinflusst würden. Außerdem forschten die Mitarbeiter der Abteilung zum Aufbau und zur Biologie von Geschwulstzellen. Leiter der Biologisch- Chemischen Abteilung war Emil Freiherr von Dungern, der zur Malignität von Tumoren und zur Krebsdiagnostik forschte. Zu deren Mitarbeitern gehörte Ludwik Hirszfeld (siehe Abb. S. 61). Analog zur serologischen Diagnostik bei Infektionskrankheiten und Bakteriengiften zielten die Forschungen in der Abteilung darauf ab, ob durch die Krebszellen eine vergleichbare Immunreaktion im Blutserum ausgelöst wurde, über die man wiederum die Krebserkrankung nachweisen konnte. Nachfolger von Dungern, der 1913 als Direktor des neu gegründeten Instituts für Krebsforschung nach Hamburg wechselte, wurde 1920 Hans Sachs ( , siehe Abb. S. 86). 140 Nach 1900 entlehnte die Krebsforschung Methoden, Praktiken und die Sprache aus der Bakteriologie: Tumoren wurden wie Bakterien im Tierversuch passagiert, Gewebe eingeimpft, die experimentellen Krebsforscher sprachen analog zur Bakteriologie von Virulenz, Resistenz oder einer Immunität. So gelang es Mitarbeitern des 139 Vgl. Wagner/Mauerberger, Krebsforschung, S Ebd., S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 65
36 IET bspw. durch Injektion von abgeschwächtem Krebsgewebe bei Mäusen eine»resistenz«gegen»virulente«geschwülste zu erzeugen. Diese»Immunität«bewirke nicht nur einen Schutz gegen verschiedene Karzinomstämme, sondern auch gegen Sarkome. Diese durch die Injektion von»avirulenten«oder abgeschwächten Krebszellen erzeugte Widerstandsfähigkeit bezeichnete Ehrlich als Geschwulstimmunität, die er von der»atreptischen Immunität«, einem gehemmten Wachstum der Tumoren durch den Entzug von Nährstoffen, abgrenzte. 141 Institutionen und Institutionalisierung Immunologische Forschungen wurden bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Berlin insbesondere am KGA, am PII und dem ISS bzw. dem späteren IET in Frankfurt ausgeführt. Am KGA wurde in den 1880er-Jahren grundlegend zur Ätiologie verschiedener Krankheiten und zur Ausbreitung von Krankheitserregern geforscht, zur Desinfektion und zur Entwicklung und Verbesserung von Seren und Impfstoffen. Neben den bereits erörterten Arbeiten Löfflers zur Diphtherie, zum Schweinerotlauf und zur Schweineseuche wären noch Arbeiten zum Rotz (AKGA 1/1886) zu erwähnen. Ebenso enthielten die Publikationen des Gesundheitsamts die Tätigkeitsberichte der Pockenimpfstoff-Hersteller. Das extra für Robert Koch 1880 eingerichtete bakteriologische Laboratorium wurde Ende des Jahrhunderts, zusammen mit dem serotherapeutischen und anderen Forschungslaboratorien zu einer großräumigen bakteriologischen Abteilung umstrukturiert. Auf dem Areal in Berlin-Dahlem (siehe Abb. S. 21) war auch die Veterinärmedizinische Abteilung untergebracht. Seit den 1890er-Jahren verlagerten sich die experimentellen Arbeiten vom KGA an das PII. Dieses wurde ebenfalls zur Jahrhundertwende umstrukturiert und erhielt einen Neubau (siehe Abb. S. 34). Die Einrichtung der Tollwut-Abteilung wurde bereits erwähnt, darüber hinaus gab es eine»in erster Linie der Immunitätsforschung dienende Serumabteilung «, in der die Untersuchungen zum Cholera- und Typhus-Impfstoff und zum Pestserum vorgenommen wurden. Weiterhin gab es noch das IET (siehe Abb. S. 43). Das Ziel des Instituts war nicht, Seren und Impfstoffe zu entwickeln, sondern die Wertbestimmungsmethoden für Seren, die staatlich geprüft werden sollten, zu stabilisieren. In diesem Zusammenhang erfolgten auch die Arbeiten zur Theorie der Immunität. Ebenfalls außerhalb der Universität angesiedelt 141 Vgl. Hugo Apolant: Ergebnisse der experimentellen Geschwulstforschung (mit Ausschluß der athrepischen Immunität), in: ders. u. a. (Hg.), Paul Ehrlich. Eine Darstellung seines wissenschaftlichen Wirkens, S , hier S und allein für Forschungszwecke bestimmt waren das 1895 von Emil Behring gegründete private Institut für experimentelle Therapie sowie das 1913 geschaffene und von August von Wassermann geleitete Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie in Berlin. Weiterhin wurde am oben erwähnten Institut für experimentelle Krebsforschung in Heidelberg zu immunologischen Fragestellungen gearbeitet. Darüber hinaus gab es zahlreiche Lehrstühle für Hygiene, doch ein Großteil von ihnen war originär hygienischen Themen gewidmet und weniger an Fragen der Immunitätsforschung ausgerichtet. Forschungen zur Immunität erfolgten vor allem in Königsberg und Breslau vom Lehrstuhlinhaber Richard Pfeiffer sowie in München durch Hans Buchner und dessen Lehrstuhl-Nachfolger Max Gruber. Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden als kurze, thesenhafte Zusammenfassungen wie die Publikation von Behring und Kitasato in wöchentlich erscheinenden medizi nischen Fachzeitschriften veröffentlicht: allen voran der»deutschen Medizinischen Wochenschrift«und der»berliner Klinischen Wochenschrift«. Umfangreichere Ergebnisse publizierte man anfangs in den Zeitschriften der jeweiligen Institutionen, bspw. den»mittheilungen«bzw.»arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte«, der 1886 erstmals von Robert Koch herausgegebenen»zeitschrift für Hygiene«(ab 1892: für Hygiene und Infektionskrankheiten) oder dem 1887 gegründeten»centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde«, in denen die meisten der genannten Arbeiten erschienen sind. Nach dem Umzug und der Umbenennung des Instituts für experimentelle Therapie gründete der Direktor eine eigenen Zeitschriftenreihe: die»arbeiten aus dem Königlichen Institut für experimentelle Therapie«. Weiterhin sind die»fortschritte der Medizin«oder die»therapeutischen Monatshefte«zu nennen, und da viele Bakteriologen Medizinalbeamte oder Militärärzte waren, sei noch das»klinische Jahrbuch«erwähnt. Überdies wurde mit»die Naturwissenschaften«1913 eine Zeitschrift aus der Taufe gehoben, in der Chemiker und Biologen publizierten und die für Immuno logen relevante Forschung enthielt. Die in Deutschland und weltweit edierte Literatur nahm derart zu, dass Wolfgang Weichardt ( /1945) den Versuch unternahm, die auf dem Gebiet der Immunitätsforschung verstreut erschienenen internationalen Aufsätze in einem Jahresbericht in kurzen Referaten herauszugeben. Der erste Band für das Berichtsjahr 1905 erschien 1906 und umfasste bereits mehr als zweihundert Seiten. Den Artikel- Zusammenfassungen hatte Weichardt eine orientierende Einleitung über den aktuellen Stand der Immunitätsforschung vorausgeschickt. Die Jahresberichte erschienen bis 1912 jährlich, danach wurde das Periodikum umbenannt. Der geänderte Titel 1914 bzw zeigt vor allem die enge Beziehung zwischen Immunitätsforschung und Bakteriologie. Um die Jahrhundertwende kam es mit Ausdifferenzierung der Medizin und Aufgliederung in zahlreiche Subdisziplinen und Gesellschaften zu einer Vielzahl neuer Zeit- 66 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 67
37 schriftengründungen. Für die Immunologie war die 1908/1909 gegründete»zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie«von großer Bedeutung. Für das umfangreiche»material neuer Beobachtungen und Forschungen«müsse»ein junger Forschungszweig«an»verschiedenen literarischen Stätten«publizieren,»bis er soweit erstarkt ist, daß er die von ihm ausgehenden Früchte in einem eigenen Publikationsorgan sammeln und damit seine kraftvolle umfassende Entfaltung auch literarisch zum Ausdruck bringen kann«. 142 Erstmals erschien der Begriff»Immunitätsforschung«auch im Titel der Zeitschrift, in der die auf dem Gebiet führenden Wissenschaftler ihre Ergebnisse publizierten und die wenige Jahre später (1916) Vorbild und Modell für das US-amerikanische Pendant, das Journal of Immunology, wurde. Herausgegeben wurde die»zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie«von Ernst Friedberger, Rudolf Kraus, Hans Sachs und Paul Uhlenhuth (siehe Abb. S. 62). Die Herausgeber deckten verschiedene Arbeitsgebiete der Immunologie und entsprechender Institutionen ab. Sie waren, korrespondierend zur neuen Forschungsrichtung, alle jüngerer Jahrgänge und machen so den sich abzeichnenden Generationswechsel deutlich. Friedberger verbrachte nach seiner Promotion zum Doktor der Medizin in Gießen einige Zeit am PII bevor er (als Assistent von Pfeiffer) nach Königsberg wechselte wurde er Leiter der Abteilung für experimentelle Therapie am Institut für Pharmakologie der Friedrich-Wilhelms-Universität. Zum einen wird Friedberger diesen Teil des Forschungsgebiets abgedeckt haben, zum anderen arbeitete er zur Anaphylaxie. Der an der Wiener Universität beschäftigte Rudolf Kraus repräsentierte den Bereich der Labordiagnostik, die nach dem so genannten Wassermann-Test eine immer größere Rolle spielte. Hans Sachs hatte direkt im Anschluss an sein Medizinstudium 1901 in Frankfurt als Assistent von Paul Ehrlich angefangen und setzte im Institut die immunologischen Arbeiten fort. Paul Uhlenhuth war der einflussreichste der vier Herausgeber hatte man ihn zum Direktor der bakteriologischen Abteilung des KGA ernannt, 1911 wechselte er an die so genannte Reichsuniversität Straßburg, wo er den Lehrstuhl für Hygiene besetzte. Die Hefte der»zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie«erschienen in den ersten Jahren im Abstand von zwei bis vier Wochen; die Einzelbände hatten einen Umfang von mehr als siebenhundert Seiten gab es bereits 21 Bände. Ziel war die Bündelung der Arbeiten zur Immunitätsforschung in einer Zeitschrift. Sie spiegelt das rasant wachsende Interesse an immunologischen Fragestellungen in der Medizin jenseits der oben genannten Institutionen wieder. Stand den dort tätigen 142 Paul Ehrlich: Zur Einführung, in: ZIET 1 (1908/1909), Heft 1, S. 1 f., Zitat S. 1. Wissenschaftlern stets die eigene Zeitschriftenreihe zur Verfügung, fehlte der Vielzahl der überall im deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet forschenden Wissenschaftler eine das Forschungsgebiet repräsentierende Zeitschrift. Zudem zeichnete sich ab, dass immunologische Probleme von neuen Forschungszweigen inkorporiert wurden oder, imperialistischer formuliert, dass die Immunitätslehre sich auf immer mehr lebenswissenschaftliche Bereiche ausdehnte und diese okkupierte, und später quasi ein Querschnittfach der Medizin darstellte. In den ab 1908/09 erschienenen Bänden publizierten namhafte internationale Lebenswissenschaftler, die auf verschiedensten Gebieten der Immunitätsforschung tätig waren. Durch sie formulierte man den Anspruch als führendes Publikationsorgan: Mitarbeiter und Ehemalige aus dem PII und dem KGA wie Robert Koch, Georg Gaffky und Friedrich Löffler, Ludwig Brieger, Paul Frosch ( ), Richard Pfeiffer, August Wassermann, Robert Ostertag ( ), Ulrich Friedemann ( ), Fred Neufeld ( ), Wilhelm Kolle ( ) und Claus Schilling ( ); aus dem IET Paul Ehrlich, Max Neisser ( ) sowie Hugo Apolant ( ). Weitere Autoren aus Deutschland waren zum Beispiel Max von Gruber und Adolf Dieudonné ( ) aus München, Emil von Dungern (Heidelberg), Leonor Michaelis (Berlin). Aus dem Ausland waren bspw. vertreten Shibasaburo Kitasato, Ernest F. Bashford ( ) und Almroth Wright ( ) aus London, Thorvald Madsen ( ) und Carl Julius Salomonsen ( ) aus Kopenhagen, Constantin Levaditi ( ) und Elias Metchnikoff aus Paris, Ludvig Hektoen (Chicago, ), Simon Flexner (New York, ), Theobald Smith (Boston, ), Anton Breinl ( ), Jules Bordet (Brüssel), Karl Landsteiner (Wien), Albert Calmette (Lille, ) um nur einige aus dem illustren Kreis zu nennen. Die Autoren aus Frankreich, Großbritannien, den USA, Skandinavien und osteuropäischen Ländern illustrieren das internationale Forschungsnetzwerk zumal viele der ausländischen Wissenschaftler in einem der obigen Institute als Gastwissenschaftler tätig waren. In den ersten Ausgaben wurden Themen behandelt, die die Bandbreite des Forschungsgebietes abdeckten: von der Anaphylaxie über die Wirkungszusammenhänge von mikrobiologischen und biochemischen Prozessen bei der Serumdiagnose bis zur Übertragung von Poliomyelitis; auf dem Gebiet der experimentellen Krebsforschung Arbeiten zur Geschwulstimmunität und Tumorwachstum, weiterhin chemotherapeutische Arbeiten sowie allgemeinere Arbeiten zur Phagozytose von Tuberkelbazillen Vgl. bspw. aus Bd. 2 (1909) zu Antifermenten: über die synthetische Wirkung der Antifermente (Arthur F. Coca sowie H. Beitzke/Carl Neuberg). Zur Anaphylaxie (Auswahl): durch Organ- und Tumorextrakte (Egon Ranzi); zum Zusammenhang zwischen toxischer, sensiblisierender und präzipitogener Substanz bei der Anaphylaxie (Leonor Michae- 68 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 69
38 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, Bd. 1 (1908/1909), Heft 1 70 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 71
39 Nach dem Immunologen und Wissenschaftsphilosophen Ludwik Fleck ( ) bildet sich ein Denkkollektiv über einen gemeinsamen Denkstil und Forschungsgegenstand aus, über den das Gremium sich austauscht und letztlich definiert und vergewissert. Die Wahrnehmung ist dabei auf den Forschungsgegenstand gerichtet und gleichzeitig auch reduziert. Dieser gedankliche Austausch findet auf Konferenzen und in Fachzeitschriften statt und institutionalisiert sich in eigenen Fachgesellschaften und Institutionen. Ebenso manifestiert sich das von sozialen, kulturellen und politischen Faktoren und Akteuren beeinflusste Wissen über den Forschungsgegenstand, das nach der Diskussion in Fachzeitschriften und der Validierung durch das Denkkollektiv allgemein als Faktum und»wahrheit«anerkannt wird und als»objektiv«und»gesichert«gilt, in Hand- und Lehrbüchern. Innerhalb der sich herausbildenden Immunologie war der wissenschaftliche Gegenstand bereits vor der Jahrhundertwende erstmals in Publikationen benannt und danach in weiteren Veröffentlichungen umfassender diskutiert und definiert worden; erste Handbücher kompilierten dieses Wissen. Zum einen veränderte sich die Begrifflichkeit. Mit»Impfung«brachte man im 19. Jahrhundert gemeinhin die Pockenschutzimpfung in Verbindung, sichtbar zum Beispiel in den Kampagnen gegen die Impfpflicht bezüglich der obligatorischen Schutzimpfung gegen Pocken (»Reichsimpfgesetz«). Doch innerhalb der Medizin konnte man mit dem Begriff»impfen«auch das Einpflanzen oder das pflanzliche Pfropfen bezeichnen, bspw. wenn Koch oder Pasteur den Versuchstieren Krankheitsstoffe verimpften oder in der experimentellen Krebsforschung Geschwulstlis), zur Identität der anaphylaktisierenden und toxischen Substanz artfremder Sera (Robert Doerr/V. K. Russ); zur Serumhypersensibilität (J. G. Sleeswijk); zur Theorie (Ernst Friedberger, sowie E. P. Pick/T. Yamanouchi) und zum Mechanismus der Anaphylaxie (Ulrich Friedemann). Zur Sero-Diagnostik (Auswahl): zur toxischen Substanz und zur Agglutination der Streptokokken (Willy Pfeiler); zur Diagnose des Rotzes durch Komplementablenkung (Egidio Valenti); über die Technik der Wassermannschen Reaktion (Valentino Facchini, sowie J. J. Liebermann/P. P. Maslakowetz); über die Beziehungen der Bakterienpräzipitine zu den Agglutininen sowie über hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien (Y. Fukuhara). Zur experimentellen Krebsforschung (Auswahl): über Hasensarkome und das Wesen der Geschwulstimmunität (Emil v. Dungern/Arthur F. Coca); Beziehung zwischen Ernährung und Tumorwachstum (C. Moreschi). Zur experimentellen Therapie (Auswahl): zur intrastomachalen Behandlung trypanosomeninfizierter Mäuse (Lewis H. Marks); Ausscheidung des Atoxyls im Pferdeharn (M. Nierenstein). Allgemeinere Arbeiten (Auswahl): über Phagozytose von Tuberkelbazillen (M. Löhlein); über Agressine der Pneumokokken (Martin Zade); zur Übertragung der Poliomyelitis auf Affen (Karl Landsteiner/Erwin Popper); über die Einwirkung von Giften auf die Antikörperbildung (Thorvald Madsen); über die Einwirkung des Sublimats auf Leukozyten (Sh. Dohi); über Antikörperbildung bei parabiotischen Tieren (Ernst Friedberger/Nassetti); über die Einwirkung von Blutserum auf Trypanosomen (Martin Jacobi); und die Beziehung des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu dessen Heilwert (Rudolf Kraus/J. Schwoner). gewebe eingeimpft wurden, also Material eingepflanzt, eingeritzt wurde, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Die Impfung als eine präventive medizinische Handlung und Maßnahme des Schutzes gegen eine Erkrankung setzte sich erst nach 1900 eindeutig durch. Dies betraf auch den»stoff«der Impfung. Impfstoff und Serum wurden in der Öffentlichkeit oft in Unkenntnis des genauen Arzneimittels synonym als Impfstoff oder Serum bezeichnet, wobei die Entwicklung der Serovakzination die begriffliche Ungenauigkeit erhöht haben dürfte. Ebenso veränderte sich durch die Entwicklung der Serumtherapie und die Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen das Verständnis von Immunität. Erst jetzt gab es eine Immunologie als Lehre von der Immunität. Anfang der 1880er-Jahre verstand man unter Immu nität noch ganz allgemein die Abwehr des Organismus vor bestimmten Bakterien. Behring grenzte 1890 die von ihm beschriebene, auf einer»giftzerstörenden Wirkung des Blutes«basierende Immunität von einer bloßen Gewöhnung des Körpers ab definierte Adolf Dieudonné in einer Überblicksdarstellung Immunität als die»bekannte und alltäglich zu beobachtende Erscheinung, dass sich gewisse Individuen oder ganze Tierklassen unter genau denselben Bedingungen schädlichen Einflüssen gegenüber widerstandsfähig zeigen, welche für andere verderblich sind«. 145 Dieudonné unterschied zwischen natürlicher Resistenz bzw. angeborener Immunität gegen Bakterien oder deren Gifte; zweitens zwischen natürlich erworbener Immunität gegen Bakterien oder Gifte; und drittens die künstlich erworbene Immunität über die Schutzimpfung, wobei das dritte und das vierte Kapitel über Blutserumtherapie und die Beschreibung der einzelnen Seren und Impfung drei Viertel des Buches ausmachen. In einem anderen Überblickswerk von Paul Th. Müller wird der Zusammenhang zwischen Bakteriologie und Immunologie noch einmal deutlich: Ausgehend von den Infektionskrankheiten und Bakteriengiften erläutert er das Verhalten der Mikroorganismen und ihre Verteilung und Wirkung bzw. die ihrer Gifte im Körper, und beschreibt die natürliche und künstliche Abwehrreaktion, die Bildung von Antikörpern, er diskutiert die verschiedenen Theorien die Seitenkettentheorie und die Phagozytose, die diese Abwehrreaktionen erklären sowie die aus der künstlich erzeugten Abwehrreaktion entwickelten Seren und Impfstoffe. 146 Neben den Einführungsbüchern von Dieudonné und Müller erschienen die ersten Handbücher, die das Wissen und den Forschungsstand zur Immunität bündelten: Zum 144 Vgl. Behring/Kitasato, Ueber das Zustandekommen, Anm Vgl. Dieudonné, Schutzimpfung und Serumtherapie, S Vgl. Müller, Vorlesungen. 72 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 73
40 einen und vor allem das von Rudolf Kraus und Constantin Levaditi 1908 und im renommierten Gustav Fischer Verlag herausgegebene»handbuch der Technik und Methodik der Immunitätsforschung«, dass in zwei Bänden knapp Seiten umfasste. Unter den Autoren befinden sich viele der bereits oben genannten Wissenschaftler. Im ersten Band»Antigene«wurde der Wissensbestand zu den bekannten Bakteriengiften und Giften pflanzlichen wie tierischen Ursprungs in je einem Kapitel zusammengefasst. Darüber hinaus enthielt dieser Band auch Abschnitte zu den verschiedenen Impfmethoden, zum Beispiel für Typhus, Pest, Cholera oder Milzbrand. Der zweite Band»Antikörper«erfasste die Kapitel zu den Antitoxinen, wobei vor allem die Techniken der Serumproduktion durchdekliniert wurden. Die Behandlung tierischer Gifte, die Herstellung von Schlangenserum im Handbuch der Immunitätsforschung oder auch die Beiträge zur Wirkung chemisch hergestellter Gifte auf Blutserum, Leukozyten und Bakterien in der Zeitschrift für Immunitätsforschung 148 verdeutlichen, dass man um 1910 unter Immunität eine Abwehrreaktion des Organismus auf zellulärer Ebene gegen spezifische, externe Körper und Stoffe wie Krankheitserreger und deren zellulären Bestandteile, (bio-)chemische (Umwelt-)Gifte oder körperfremde biologische Stoffe wie das Serum eines fremden Organismus verstand. Die Abwehrreaktion des Körpers war nicht allgemein, sondern richtete sich in der Regel gegen einen bestimmten Fremdkörper, so dass die Reaktion auf diesen Fremdkörper begrenzt war. Das monumentale»handbuch der pathogenen Mikroorganismen«, erstmals von Wilhelm Kolle und August Wassermann herausgegeben und dessen 1903 erschienener erster Band 149 enthielt alle Informationen zu den jeweiligen Krankheitssymptomen und Diagnose, zur Ätiologie und Epidemiologie der Krankheit, zur Biologie und Besonderheiten des Erregers, aber eben auch zur Immunität, zu Schutzimpfungen und zur Serumtherapie. Im Titel des»handbuchs der Technik und Methodik der Immunitätsforschung«und in den Beiträgen beider Handbücher wird deutlich, dass es vor allem um Technik, Methodik und praktische Anwendung ging; die Arbeiten zur Immunität fan erschien ein weiterer Ergänzungsband. Die zweite Aufl. des Handbuchs erschien 1914, erweitert im Titel um»experimentelle Therapie«. 148 Vgl. die Beiträge in der ZIET, Bd. 2 (1909) von G. Izar: Einfluß des Blutserums auf die Hämolyse durch Schwermetalle, S ; Sh. Dohi: Ueber die Einwirkung des Sublimats auf die Leukocyten, S Ein Atlas erschien bereits Bd. 1 bis 3 folgten 1903, der zweiteilige Bd. 4 erschien 1904, ein erster Ergänzungsband 1907, ein zweiter Die zweite Aufl. mit insgesamt acht Bänden folgte 1912/1913. Die dritte Aufl., herausgegeben 1929/1930 von Wilhelm Kolle, Rudolf Kraus und Paul Uhlenhuth, umfasste bereits zehn, teils mehrteilige Bände mit weit über Seiten. Der Titel schloss jetzt nicht nur die pathogenen Mikroorganismen, sondern auch die»immunitätslehre und Epidemiologie sowie der mikrobiologischen Diagnostik und Technik«mit ein. den zwischen Krankenbett, Großtierstall und Labor statt und die Immunitätsforschung entwickelte sich aus der Praxis heraus. Und aus dieser Perspektive ergaben sich theoretische Fragestellungen zur Wirkungsweise und Konstitution der Antigene und Antikörper. 150 Paul Ehrlich konstatiert in der Einleitung zum Handbuch:»Die Stoffe, mit denen die Immunitätsforschung arbeitet, Antigene und Antikörper, sind übereinstimmend negativ charakterisiert durch den Umstand, daß sie chemisch völlig unbekannte Gebilde darstellen.«151 In den folgenden Jahrzehnten sollte die Aufklärung der chemischen Konstitution sowie der biochemischen Wirkungsweise der Antigene und Antikörper geschehen, wie dem nachfolgenden Beitrag von Annette Hinz-Wessels zu entnehmen ist. Schwierige Jahre Nach der Geburt der Immunologie folgte, um in diesem Bild zu bleiben, in der Kindheit rasches Wachstum: Institutionalisierung, theoretische und praktische Ausdifferenzierung der Immunologie und ein enormer Zuwachs an Publikationen. Doch auf diese Phase folgten schwierige Jahre. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden die Arbeiten größtenteils unterbrochen. Die mannigfachen Gründe können abschließend nur skizziert werden. Für das IET in Frankfurt lassen sich die Folgen des Kriegsausbruchs und des Krieges exemplarisch beschreiben: Ein Teil der Mitarbeiter wurde als Soldaten eingezogen, so dass im Institut aufgrund des Arbeitskräftemangels Tätigkeiten reduziert werden mussten. Das die Serumprüfung verantwortende Mitglied des Instituts war seit Gründung der Einrichtung ein dorthin abkommandierter Militärarzt, der jetzt abgezogen wurde. Praktikanten, die während ihres Medizinstudiums im Institut gearbeitet oder junge Mediziner, die ihre Doktorarbeit angefertigt hatten, waren eingezogen worden. Im Militärdienst starb bereits im August 1914 der Chemiker Alfred Bertheim ( ) und ein Jahr später Hugo Apolant, Leiter der Abteilung für experimentelle Krebsforschung, an den Folgen eines Unfalls sowie im August 1915 der Institutsdirektor Paul Ehrlich. Sein Assistent Hans Sachs war nun das einzige verbliebene Mitglied des Instituts, das sich mühte, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Er wurde unterstützt von einigen technischen Assistentinnen und einem Schweizer Gastwissenschaftler, dem späte- 150 Was sich kaum besser ausdrücken lässt als in dem Titel des Sammelbands»Crafting Immunity«, s. Kenton Kroker, Pauline H.M. Mazumdar/Jennifer Keelan: Crafting Immunity. Working Histories of Clinical Immunology, Aldershot Paul Ehrlich: Einleitung. Über Antigene und Antikörper, in: Rudolf Kraus/Constantin Levaditi (Hg.): Handbuch der Technik und Methodik der Immunitätsforschung, Bd. 1: Antigene, Jena 1908, S DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 75
41 ren Nobelpreisträger Paul Karrer ( ). Der Personalmangel hatte zur Folge, dass ein großer Teil der Tumorzüchtungen unterging. Zudem wurden die Standards bei der Wertbestimmung von Tetanusserum gesenkt, um den hohen Bedarf an Serum zu decken und vermutlich auch, um den Personalengpass abzufedern. Außerdem war das Institut, wie andere staatliche Einrichtungen auch, mit der Herstellung eines Cholera-Typhus- Impfstoffes beauftragt. Forschung war nur noch in als kriegswichtig geltenden Bereichen möglich und erwünscht. So wurde an der Entwicklung eines Gasödem-Serums gearbeitet, ansonsten war die wissenschaftliche Tätigkeit eingestellt. Arbeiten außerhalb der Serumprüfung und Impfstoffherstellung auszuführen, war auch deshalb schwierig, weil hierfür die finanziellen Ressourcen fehlten. Klagen über steigende Preise für Futter, für Versuchs- und Prüftiere oder andere Belange des Instituts waren steter Bestandteil der Institutskorrespondenz mit dem vorgesetzten Ministerium. Der Tod des Institutsdirektors steht stellvertretend für eine Reihe von Bakteriologen und Immunologen der ersten Stunde, die in diesen Jahren starben: Robert Koch (1910), Ernst von Leyden (1910), Paul Ehrlich und Friedrich Löffler (1915), der Bakteriologe und Dermatologe Albert Neisser (1916), Vincenz Czerny (1916) Emil von Behring (1917) und Georg Gaffky (1918). Der Generationswechsel fand unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen statt, zumal die internationalen Kontakte der jüngeren Generation durch den Krieg ebenfalls stark gelitten hatten und die internationale scientific community insbesondere in den ersten Jahren nach dem Krieg die Isolation Deutschlands und der deutschen Wissenschaft betrieb. 152 Die Schwierigkeiten Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen oder die Einschränkung internationaler Kontakte waren mit Ende des Krieges nicht behoben, sondern blieben bis Anfang der 1920er-Jahre bestehen. So klagte der neue Direktor des In stituts für experimentelle Therapie, Wilhelm Kolle, über den hohen Investitionsbedarf. Notwendige Reparaturarbeiten, die Erneuerung von Apparaten seien seit Jahren unterlassen worden, so dass er das Institut erst 1922, nach dem Abschluss größerer Umbaumaßnahmen, Renovierungsarbeiten und der Ausstattung mit moderneren Geräten sowie dem Ausbau der Wasser-, Gas- und Stromversorgung, als arbeitsfähig erachtete. 153 Ähnliche komplizierte Arbeitsbedingungen in der Nachkriegszeit wurden gleichfalls im 152 Vgl. z. B. Margaret Macmillan: Paris Six Months that changed the World, New York Vgl. Wilhelm Kolle: Das Staatsinstitut für experimentelle Therapie und das Chemotherapeutische Forschungsinstitut»Georg Speyer-Haus«in Frankfurt a. M. Ihre Geschichte, Organisation und ihre Arbeitsgebiete, nebst vollständigem Verzeichnis der in den Jahren veröffentlichten Arbeiten, in: Arbeiten aus dem Staatsinstitut für experimentelle Therapie und dem Georg Speyer-Hause zu Frankfurt a. M. 16 (1926), S Wilhelm Kolle, 1920er-Jahre Reichsgesundheitsamt oder im PII beklagt, 154 wo sich die Abteilungsleiter allgemein über mangelnde Zukunftsperspektiven beschwerten. Mit der Renovierung von Arbeitsräumen war es indes nicht getan. Von der schwierigen Wiedereingliederung in die internationale Forschungsgemeinschaft abgesehen hatte sich die gesamte Forschungslandschaft verändert. Die Seitenketten- bzw. Rezeptortheorie galt international seit den 1920er-Jahren als überholt und wurde nur noch in Deutschland dis kutiert. 155 Die einstmals innovative Immunitätslehre und experimentelle Therapie geriet Anfang der 1920er-Jahre gegenüber neuen Forschungsrichtungen wie der Vererbungslehre, der Hygiene vor allem als Sozial- und Rassenhygiene oder der Hormon- und Vitaminforschung ins Hintertreffen. Dies wird bspw. in der Änderung des Titels der von Weichardt herausgegebenen»ergebnisse der Immunitätsforschung, experimentellen Therapie, Bakteriologie und Hygiene«sichtbar, die ab dem zweiten Band als»ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentelle Therapie«firmierte und Hygiene und Bakteriologie an den Anfang, die Immunitätsforschung und die experimentelle Therapie an das Ende des Titels rückte und die Bedeutungsverschiebung deutlich machte. Die schwierige Lage der immunologischen Forschungslandschaft zeigt sich auch darin, dass nach dem Tod Wassermanns 1925 dessen Institut, das Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie, geschlossen bzw. in das Institut für Biochemie umgewidmet wurde. Zusammenfassend waren die Jahre 154 Vgl. Hüntelmann, Hygiene im Namen des Staates, S Ab den 1960er-Jahren erlebte sie eine Renaissance, vgl. Prüll/Maehle/Halliwell, Short History. 76 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920) 77
42 zwischen 1914 und 1924 äußerst schwierig für die Immunologie in Deutschland und stellten keine gute Ausgangsbasis für die weitere Forschung dar. 78 DIE GEBURTSSTUNDE DER IMMUNOLO GIE (BIS 1920)
43 Immunologie in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1 Annette Hinz-Wessels Nach der Epocheneinteilung, die der Wissenschaftshistoriker und Immunologe Arthur Silverstein zur Charakterisierung der immunologischen Entwicklung vorschlägt, folgt dem goldenen Zeitalter der Bakteriologie repräsentiert durch herausragende Wissenschaftler wie Louis Pasteur, Robert Koch oder Emil von Behring das dunkle Zeitalter der Immunchemie. 2 In diese»dark ages of immunochemistry«, die für Silverstein eine rund fünfzigjährige Phase zwischen 1910 und 1960 umfasst, fällt auch die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus in Deutschland. Im Folgenden wird die Entwicklung der immunologischen Forschung in Deutschland während der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus am Beispiel der sie repräsentierenden Einrichtungen und Personen nachgezeichnet. Die Darstellung konzentriert sich vornehmlich auf die wissenschaftlichen Institute, die in der Kaiserzeit auf dem Gebiet der Immunitätsforschung gegründet wurden und diese Arbeitsrichtung auch in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit beibehielten. Dabei steht neben der Beschreibung ihrer Forschungsschwerpunkte die Frage im Vordergrund, wie sich die politischen Umwälzungen 1918/19 und 1933 sowie der 1939 von Hitler entfesselte Weltkrieg auf diese Einrichtungen und ihre Arbeitsgebiete auswirkten. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Vertreibung zahlreicher Immunologen jüdischer Herkunft durch das NS-Regime. Ferner wird der Umgang mit Paul Ehrlich und Emil von Behring als den Gründungsvätern 1 Ich danke den Mitgliedern des Redaktionskomitees für die kritische Durchsicht des Manuskripts und wichtige Hinweise, insbes. Diethard Gemsa für die Bereitstellung von Material aus der Zeitschrift für Immunitätsforschung. Darüber hinaus möchte ich allen Archiven, Bibliotheken und Privatpersonen danken, die mich durch die Darreichung von Dokumenten, Fotografien und Informationen unterstützt haben. Besonders erwähnen möchte ich Frank Boblenz, Manfred Dietrich, Susanne Doetz, Dagmar Drüll-Zimmermann, Werner Fasolin, Sören Flachowsky, Klaus von Fleischbein, Nikolaus von Gayling-Westphal, Christian George, Mirjam Gerber, Kornelia Grundmann, Bernd Hoffmann, Ulrich Hunger, Karin Kaiser, Kristina Klatt, Eveline Klein, Fritz Melchers, Stefan Müller, Thomas Notthoff, Walter Pietrusziak, Ina Pichlmayr, Ernst Th. Rietschel, Erwin Rüde, Florian Schmaltz, Michael Schwarz, Kristina Starkloff, Bodo Teichmann, Susanne Uebele, Hedwig Wegmann, Christine Wolters und Sabrina Zinke. 2 Arthur M. Silverstein: A History of Immunology, 2. erw. Auflage, Amsterdam 2009, S. 455 ff. WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 79
44 der deutschen Immunologie und die Beteiligung der Immunologie an den Verbrechen des NS-Regimes thematisiert. Schließlich sollen die immunchemischen Arbeiten näher untersucht werden, die nicht nur generell die immunologische Forschung dieser Zeit dominierten, sondern in Deutschland auch den Ausgangspunkt für den Wiederaufbau einer immunologischen Forschungslandschaft nach 1945 bildeten. Äußere Rahmenbedingungen: Förderung und Einbindung in die internationale Scientific Community Zwar hinterließ die militärische Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg keine äußerlich sichtbaren Spuren in Form von zerstörten Instituten oder Laboratorien, doch hatten der Zusammenbruch des Kaiserreichs, die Novemberrevolution 1918 und die Beschlüsse des 1919 unterzeichneten Versailler Vertrages auch erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Forschungslandschaft. Gewalttätige Unruhen, Hungersnot, Grippeepidemien und soziales Elend prägten die Anfangsjahre der Weimarer Republik und belasteten überdies die Situation an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die zudem unter der wissenschaftlichen Isolation vom Ausland litten. Als Reaktion auf die wirtschaftliche Notlage wurde im Oktober 1920 die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft als Selbstverwaltungsorgan der deutschen Forschungseinrichtungen gegründet. Formaljuristisch handelte es sich um einen eingetragenen Verein, dem fast alle Universitäten, Technischen Hochschulen, die meisten wissenschaftlichen Akademien sowie die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Mitglieder angehörten. 3 Zunächst gewährte die Notgemeinschaft Unterstützung lediglich bei Einzelanträgen, ab 1926 standen auch Mittel für sogenannte Gemeinschaftsaufgaben zur Verfügung, in denen ähnlich den heutigen Schwerpunktprogrammen umfangreichere Forschungsthemen von mehreren Einrichtungen parallel und gemeinschaftlich, zum Teil interdisziplinär bearbeitet wurden. 4 Auch die während des Ersten Weltkrieges zum Erliegen gekommene Immunitätsforschung profitierte von der Förderung der Notgemeinschaft, wenngleich sich der Umfang aufgrund von Aktenverlusten heute nicht mehr genau beziffern lässt. 5 Teilbereiche wie die Syphilis-Serologie fanden offensichtlich ebenso Unterstützung wie die sich daraus 3 Lothar Mertens:»Nur politisch Würdige«Die DFG-Forschungsförderung im Dritten Reich , Berlin 2004, S. 42 (künftig zit.: Mertens,»Nur politisch Würdige«). 4 Zierold, Forschungsförderung, S. 36, 576 ff. 5 In der NS-Zeit wurden Einzelfallakten von Forschern jüdischer Herkunft anlässlich des Umzugs der DFG- Geschäftsstelle systematisch vernichtet, vgl. Mertens,»Nur politisch Würdige«, S. 19. entwickelnden Untersuchungen von Hans Sachs»über Antigene und Antikörper«. 6 Weiterhin wurden die innovativen Forschungen am Robert Koch-Institut auf dem Gebiet der Allergologie unterstützt. 7 Eine besondere Förderung als Gemeinschaftsaufgabe war mit der programmatischen»denkschrift über Blutgruppenanalyse vom Standpunkt der Serologie«offensichtlich in Vorbereitung, 8 die Realisierung fiel jedoch mutmaßlich der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise zum Opfer. 9 Weitere Unterstützung erhielt die Immunitätsforschung durch die Rockefeller Foundation stellte sie bspw. für Fred Neufelds Pneumokokken-Forschungen und Claus Schillings Immunisierungsversuche gegen Malaria jeweils RM zur Verfügung. 11 Deutsche Forscher waren im Zuge alliierter Boykottmaßnahmen nach Kriegsende zumeist von internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen. 12 Insofern stellte die internationale Zusammenarbeit im Hygienekomitee des 1920 gegründeten Völkerbundes eine der wenigen Ausnahmen in den zunächst dominierenden Isolations- und Abgrenzungsstrategien dar, 13 von denen insbesondere die Immunitätsforschung profitierte. Den ersten Anlass für ein internationales Engagement deutscher Bakteriologen und Serologen bot das von dem Hygienekomitee unter seinem Präsidenten Thorvald Madsen ( ) verfolgte Programm zur Standardisierung von Heilseren, serologischen Reaktionen und Impfstoffen, 14 in das das Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt 6 Rückblick auf die fünfjährige Betätigung der Notgemeinschaft in den verschiedenen Wissenschaftszweigen, in: Fünfter Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, 1926, S , hier S. 224 f; Siebenter Bericht, S. 107, Zehnter Bericht, S Annette Hinz-Wessels, Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus, 2. Aufl., Berlin 2012, S. 19 (künftig zit.: Hinz-Wessels, RKI im NS). 8 Hans Sachs: Denkschrift über Blutgruppenanalyse vom Standpunkt der Serologie, in: Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (Hrsg.): Deutsche Forschung, H. 2: Denkschriften über Gemeinschaftsaufgaben, Berlin 1928, S , hier S Zehnter Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (Deutsche Forschungsgemeinschaft), umfassend ihre Tätigkeit vom 1. April 1930 bis zum 31. März 1931, S Paul Weindling: The Rockefeller Foundation and German Biomedical Sciences, : from Educational Philantrophy to International Science Policy, in: Nicolaas A. Rupke (Hrsg.): Science, Politics and the Public Good. Essays in Honour of Margaret Gowing, S Hinz-Wessels, RKI im NS, S. 19 f. 12 Der Völkerbund und die deutsche Wissenschaft, in: Mitteilungen des Verbandes der deutschen Hochschulen, 3. Jg., Dezember 1923, Heft 7, S ; W. Kiesel: Deutsche Wissenschaft und Auslandsboykott, in: Mitteilungen des Verbandes der deutschen Hochschulen, 4. Jg., Oktober 1924, Heft 7, S Iris Borowy: Wissenschaft, Gesundheit, Politik. Das Verhältnis der Weimarer Republik zur Hygieneorganisation des Völkerbundes, in: Sozial. Geschichte, 20 (2005), S , S. 30; Paul Weindling: The Divisions in Weimar Medicine: German Public Health and the League of Nations Health Organization, in: Sigrid Stöckel/Ulla Walter (Hrsg.): Prävention im 20. Jahrhundert. Historische Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in Deutschland, Weinheim, München 2002, S , S Carl Prausnitz: Die Standardisierung von Heilseren, serologischen Reaktionen und Impfstoffen. Bericht über die Arbeiten und Vorschläge der permanenten Standardisierungskommission der Hygieneorganisa- 80 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 81
45 und das Robert Koch-Institut aufgrund ihrer unbestreitbaren Fachkompetenz einbezogen wurden. 15 Bereits an der ersten Tagung der vom Hygienekomitee eingesetzten permanenten Standardisierungskommission im Dezember 1921 in London nahmen als offizielle Vertreter Deutschlands Wilhelm Kolle ( ), sowie Hans Sachs teil. 16 Fred Neufeld fehlte zwar 1921 in London, gehörte jedoch neben Julius Morgenroth, Wilhelm Kolle, August von Wassermann und Hans Sachs zu den Teilnehmern der zweiten Serum- Konferenz in Paris nahmen Richard Otto, Hans Sachs und Ernst Meinicke ( ) mit einem großen Mitarbeiterstab an einer 14tägigen Arbeitskonferenz zur Prüfung der verschiedenen Methoden der Syphilis-Serodiagnostik in Kopenhagen teil. 18 Besonders stark war die Fraktion deutscher Wissenschaftler unter den internationalen Blutgruppenexperten, die die permanente Standardisierungskommission der Hygienekommission des Völkerbundes berieten. An einer Arbeitstagung der wichtigsten Blutgruppenlaboratorien im Juli 1930 in Paris nahmen Werner Fischer, Wilhelm Kolle, Kurt Laubenheimer (alle Institut für exp. Therapie, Frankfurt), ferner Hans Sachs und Ernst Witebsky (Institut für exp. Krebsforschung, Heidelberg) sowie der Berliner Blutgruppenforscher Fritz Schiff und der Göttinger Mathematiker Felix Bernstein ( ) teil. Letzterer hatte 1924 die Vererbungsgesetze der Blutgruppen entdeckt. Institut für experimentelle Therapie»Emil von Behring«in Marburg Nach Behrings Tod ruhten die wissenschaftlichen Arbeiten in seinem privaten Laboratorium auf dem Marburger Schlossberg, bis 1921 Paul Uhlenhuth das Laboratorium sowie die wissenschaftliche Leitung der Behringwerke übernahm, die im Jahr zuvor in eine tion des Völkerbundes, in: Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentelle Therapie 10 (1929), S Axel Hüntelmann: Die Globalisierung der serologischen Wertbestimmung. Das preußische Institut für experimentelle Therapie und die ständige Standardisierungskommission der Hygieneorganisation des Völkerbundes in der Zwischenkriegszeit (Vortrag auf der 90. Jahrestagung der DGGMNT in Wuppertal). 16 Internationale Konferenz des Völkerbundes zur Standardbestimmung der Heilsera und der serologischen Reaktionen, in: Klinische Wochenschrift 1 (1922), S Pauline Mazumdar: The State, the Serum Institutes and the League of Nations, in: Christoph Gradmann/ Jonathan Simon: S Hans Sachs: Von der Kopenhagener Konferenz über den serologischen Luesnachweis, in: Klinische Wochenschrift 3 (1924), S. 174 f. Vgl. auch Hans Sachs: Von der zweiten Kopenhagener Laboratoriumskonferenz über den serologischen Luesnachweis, in: Klinische Wochenschrift 8 (1929), S ; Pauline Mazumdar:»In the Silence of the Laboratory«: The League of Nations Standardizes Syphilis Tests, in: Social History of Medicine 16 (2003), S Aktiengesellschaft umgewandelt worden waren. 19 Zugleich erhielt das Privatlaboratorium den Namen Institut für experimentelle Therapie»Emil von Behring«. Unter Uhlenhuths rund zweijähriger Leitungstätigkeit konzentrierte sich die Forschung vorrangig auf die Rindertuberkulose, die experimentelle Syphilis sowie die Virusschweinepest. Für die Erforschung der Virusschweinepest sowie für die Gewinnung eines Schutzserums wurde 1923 ein eigenes Institut in Eystrup an der Weser eingerichtet. Nach Uhlenhuths Ruf an die Universität Freiburg übernahm sein früherer Schüler Hermann Dold ( ) die Institutsleitung. Dold richtete ein serobakteriologisches Untersuchungsamt ein und entwickelte die Vaccinetherapie sowie die unspezifische Reiztherapie mittels Yatren zum Hauptarbeitsgebiet. Darüber hinaus arbeitete er an verschiedenen Testverfahren, unter anderem zum Nachweis der Tuberkulose per Harnprobe sowie an einem Syphilis-Test. Weitere Schwerpunkte waren die Herstellung eines Scharlach-Heilserums sowie die Entwicklung einer aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie auf der Grundlage von Toxin- Antitoxin-Flocken (T.A.F.). Unter Dold wurde die räumliche Trennung von Produktion und Forschung aufgehoben und das Institut in den Gebäudekomplex der Behringwerke verlegt. 1928, nach Dolds Wechsel an das Reichsgesundheitsamt, übernahm der bisherige Abteilungsleiter Hans Schmidt ( ) die Leitung des Instituts, die er bis in die 1950er-Jahre innehielt wurden die Behringwerke von der 1925 gegründeten IG Farbenindustrie AG als dem damals größten deutschen Chemie-Konzern übernommen. 20 Institut für experimentelle Krebsforschung in Heidelberg Nach der Berufung des Ehrlich-Schülers Hans Sachs ( ) zum Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung des Instituts für experimentelle Krebsforschung im Jahr 1920 entwickelte sich diese zum Zentrum der immunologischen Forschung in der Weimarer Republik. Mit der Übernahme der Leitung war auch seine Ernennung zum etatmäßigen außerordentlichen Professor mit der Amtsbezeichnung eines ordentlichen Professors an der Medizinischen Fakultät der Heidelberger Universität verbunden. 21 Zudem wurde 19 Vgl. Hans Schmidt: Das Institut für experimentelle Therapie»Emil von Behring«in Marburg an der Lahn, in: Ludwig Brauer/Albrecht Mendelssohn-Bartholdy/ Adolf Meyer: Forschungsinstitute und ihre Geschichte, Organisation und Ziele, Hamburg 1930, 2. Band, S Wolfram Döpp: Die Behringwerke in Marburg. Entwicklung und internationale Beziehungen, in: Alfred Pletsch (Hrsg.): Marburg. Entwicklungen Strukturen Funktionen Vergleiche (mit Routenvorschlag für eine Stadtexkursion) (= Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 32), Marburg 1990, S , hier S. 200 (künftig zit.: Döpp, Behringwerke). 21 Schriftl. Auskunft von Dr. Dagmar Drüll-Zimmermann. Die zweite Aufl. des von ihr bearbeiteten Heidelberger Gelehrtenlexikons erscheint 2017 im Springer Verlag. 82 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 83
46 die Wissenschaftliche Abteilung mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung, das Ende 1929 als interdisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut seine Arbeit aufnahm, assoziiert und Sachs am 15. Mai 1930 zum Wissenschaftlichen Mitglied ernannt. 22 Zu seinen wichtigsten Mitarbeitern zählten Alfred Klopstock ( ) und Ernst Witebsky ( ). Ausgehend von ihren praktischen Aufgaben führten Sachs und sein Mitarbeiterstab zahlreiche experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Immunitätsforschung durch. Im Rahmen der allgemeinen Bemühungen zur Entwicklung einer zuverlässigen Serodiagnostik des Krebses konnte Sachs Anfang der 1920er-Jahre bspw. zeigen,»dass die bisher als diagnostisch relevant eingeschätzten Blutveränderungen zweifellos unspezifisch waren«. 23 Ernst Witebsky befasste sich insbesondere mit der Art-, Gruppen- und Organspezifität in der Immunitätslehre und habilitierte sich 1928 über die Spezifität alkohollöslicher Carcinombestandteile. 24 Bereits im Frankfurter Institut für experimentelle Therapie hatte Sachs angesichts der komplizierten Technik der Wassermann Reaktion an einem leicht zu handhabenden Syphilis-Nachweis gearbeitet, der als»ausflockungsreaktion von Sachs-Georgi«25 oder»sachs-georgi-reaktion«schnell Zustimmung fand. 26 In Heidelberg arbeitete Sachs mit seinen Assistenten weitere Verfahren aus, wie die Sachs-Klopstock-Reaktion 27 oder die gemeinsam mit Ernst Witebsky entwickelte Citocholreaktion. 28 Diese wurden ebenso Institut für experimentelle Krebsforschung, Heidelberg, Feldpostkarte, gelaufen Wolfgang U. Eckart: Das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. In: Peter Gruss und Reinhard Rürup (Hrsg.): Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten , Dresden 2010, S Rahel Friedrich: Das Institut für experimentelle Krebsforschung Heidelberg von den Anfängen 1906 bis zur Neugründung Diss. Med (künftig zit.: Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung), S. 96 f. 24 Die Habilitationsarbeit publizierte Witebsky unter dem Titel Disponibilität und Spezifität von Organen und bösartigen Geschwülsten, in Zeitschrift für Immunitätsforschung 62 (1929), S Hans Sachs/Walther Georgi: Zur Serodiagnostik der Syphilis mittels Ausflockung durch cholesterinierte Extrakte, in: Medizinische Klinik 14 (1918), S ; dies. Zur Kritik des serologischen Luesnachweises mittels Ausflockung, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 66 (1919), S Vgl. bspw. W. Gaethgens: Über die Ausflockungsreaktionen von Sachs-Georgi und Meinicke (D.M.) zur Serodiagnostik der Syphilis, in: Archiv für Dermatologie und Syphilis 129 (1921), S ; Marta Schulz: Über die Spezifität der Sachs-Georgischen Reaktion bei Syphilis, in: Archiv für Dermatologie und Syphilis 135 (1921), S Hans Sachs/Alfred Klopstock: Über die Verwendbarkeit gewisser Serumveränderungen, unter besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift (DMW) 49 (1923), S ; Hans Sachs/Alfred Klopstock/T. Ohashi: Neuere Versuche zur Serodiagnostik der Syphilis mittels Ausflockung, in: Klinische Wochenschrift 3 (1924), S ; F. Weigmann: Vergleichende Untersuchungen der neuen von Sachs, Klopstock und Ohashi angegebenen Ausflockungsreaktion auf Syphilis mit der Wassermannschen und der Sachs-Georgischen Reaktion, in: Klinische Wochenschrift 4 (1925), S Hans Sachs/Ernst Witebsky: Zur Serodiagnostik der Syphilis mittels Ausflockung cholesterinierter Extrakte. (Citocholreaktion und Lentocholreaktion), in: Klinische Wochenschrift 7 (1928), S wie andere in Deutschland (Meinicke-Trübungsreaktion) und im Ausland verfügbaren Nachweismethoden in zwei 14tägigen Arbeitskonferenzen der Hygiene-Kommission des Völkerbundes umfassend überprüft. Die Serodiagnostik der Syphilis bildete darüber hinaus den Ausgangspunkt theoretischer Arbeiten von Sachs und seinen Mitarbeitern auf dem Gebiet der Immunitätslehre. Landsteiner hatte Anfang der 1920er-Jahre entdeckt, dass alkoholische Organextrakte, die eigentlich keine Antikörperbildung bewirkten, antigene Eigenschaften entwickelten, sobald man sie gemischt mit einem Proteinstoff fremder Herkunft injizierte. 29 Für diese»nur bei der Kombinationsimmunisierung zusammen mit Eiweißsubstanzen antigen wirkenden Stoffe, die für sich allein nur Antikörper binden«, schlug Landsteiner die Bezeichnung»Haptene«vor. 30 Auf dem Landstei- 29 E. Moro/W. Keller: Tuberkulöse Hautallergie nach intrakutaner Simultanimpfung von Tuberkulin und Kuhpockenlymphe, in: DMW 51 (1925), S , hier S Karl Landsteiner: Über heterogenetisches Antigen und Hapten. XV. Mitteilung über Antigene, in: Biochemische Zeitschrift 119 (1921), S ; Karl Landsteiner/ S. Simms: Production of heterigenetic antibodies with mixture oft he binding part oft he antigen and protein, in: Journal of Experimental Medicine 38 (1923), S ; Richard Otto/Georg Blumenthal: Über den augenblicklichen Stand der Serodiagnostik 84 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 85
47 Hans Sachs, o. D. nerschen Prinzip der Kombinationsimmunisierung aufbauend konnte Sachs mit seinen Mitarbeitern zeigen,»daß man von Kaninchen durch Vorbehandlung mit alkohollöslichen Gewebsbestandteilen fast beliebiger Herkunft Antikörper gewinnen kann, wenn man die Alkoholextrakte mit artfremden Eiweißstoffen (z. B. Serum) kombiniert. Auf diese Weise ergab sich, daß die Extrakte, die zu den Methoden des serologischen Lues- Nachweis dienen, Antigene bzw. Haptene sind, und es besteht seither kein kritisches Hemmnis, die besonderen, bei der syphilitischen Infektion reaktionsfähigen Serumstoffe als Antikörper zu betrachten.«31 Aus den allgemeinen Beobachtungen, dass die Komplettierung und Antigenität nur mit artfremden Eiweiß gelang und den Kontakt zwischen den alkohollöslichen Stoffen der Zellen und Gewebe, die er als Lipoide bezeichnete, und dem artfremden Eiweiß im Reagenzglas erforderte, entwickelte Sachs eine sogenannte Schleppertheorie. Er ging davon aus, dass die Lipoidkomponente bei einer getrennten Einspritzung nur deshalb keine Antikörperbildung bewirkte, weil sie von körpereigenen Säften umhüllt und so»biologisch maskiert«wurde:»der Führer ist dann das umhüllende körpereigene Eiweiß, und die Körpereigenheit bringt es mit sich, daß der adäquate Reiz für den der Lues, in: Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentelle Therapie 13 (1932), S , hier S Hans Sachs, Das Heidelberger Institut für Krebsforschung, S Vgl. hierzu S. Sachs/A. Klopstock/ A.J. Weil: Die Entstehung der syphilitischen Blutveränderung, in: DMW 51 (1925), ; H. Sachs/ A. Klopstock/A.J. Weil: Die Reaktionsfähigkeit des Organismus gegenüber Lipoiden, ebd., S ; Hans Sachs/Alfred Klopstock: Lipoidantikörperbildung und syphilitische Blutveränderung, in: DMW 52 (1926), S Immunisierungseffekt fehlt. Wenn das richtig ist, so kommt dem artfremden Eiweiß die Funktion zu, gewissermaßen als Schlepper oder als Schiene zu wirken. Selbstverständlich muß diese Schlepperfunktion wegfallen, wenn Lipoid und Eiweiß getrennt injiziert werden. Denn in diesem Falle wird eben das Lipoid sofort von dem körpereigenen Eiweiß der Blutflüssigkeit maskiert und hat keinerlei Gelegenheit, mit dem an anderer Stelle gleichzeitig injiziertem artfremden Eiweiß zusammenzutreffen. Zugleich wird man dem Schienensystem, das die artfremde Eiweißkomponente darstellt, die Rolle zuerteilen dürfen, das Lipoid an den Ort der Antikörperbildung heranzuführen.«32 Sachs Schleppertheorie wurde in der Folgezeit in der deutschsprachigen Wissenschaftsliteratur kontrovers diskutiert. 33 Der Leiter des Institut für experimentelle Therapie»Emil von Behring«, Hans Schmidt, bezeichnete sie 1933 erstmals als»hapten-schlepper-theorie«und verwies 1940 während der Behringfeier in Marburg auf die große Bedeutung des Haptenbegriffs und der sogenannten Schleppertheorie für die systematische Erforschung der immunbiologischen Spezifität. 34 Hermann Rudy schrieb 1937 in seinem Überblick über neuere Ergebnisse der Immunchemie:»Sicher ist, daß die Proteine als Träger oder Schlepper (H. Sachs) für die Haptene zur Bildung von Antikörpern bei Infektionen auf natürlichem Wege meist unentbehrlich sind.«35 Felix Haurowitz rezipierte 1939 die Schleppertheorie:»Die artfremde Eiweißkomponente, die das Hapten zum Antigen macht, wurde als Schlepper bezeichnet, da sie offenbar für den Transport des Haptens im Organismus des immunisierten Tieres notwendig ist (Sachs).«36 Auch nach dem Zweiten Weltkrieg verwiesen deutschsprachige Immunologen wie der Schweizer Robert Doerr auf Hans Sachs als Urheber der Schleppertheorie. 37 In den folgenden Jahrzehnten verblasste diese Kenntnis jedoch. Zwar bürgerte sich der Begriff»Schlepper«bzw.»Carrier«32 Hans Sachs: Antigenstruktur und Antigenfunktion, in: Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentelle Therapie 9 (1928), S. 1 53, hier S Hans Schmidt: Fortschritte der Serologie, Berlin, Heidelberg 1933, S. 4ff (künftig zit.: Schmidt, Fortschritte 1933); Pascual Jordan: Über die Spezifität von Antikörpern, Fermenten, Viren, Genen, in: Die Naturwissenschaften, S. 90; vgl. auch Robert Doerr: Die Antigene, Wien 1948, S. 51f (künftig zit.: Doerr, Antigene); Otto Westphal: Immunchemie, in: Der Stoffwechsel, 2. Teil, Bandteil b (= B. Flaschenträger/E. Lehnartz (Hrsg.): Physiologische Chemie. Ein Lehr- und Handbuch für Ärzte, Biologen und Chemiker, 2. Band, 2. Teil, Bandteil b), Berlin, Göttingen, Heidelberg 1957, S , hier S. 935 (künftig zit.: Westphal, Immunchemie). 34 Schmidt, Fortschritte der Serologie, S. 4; ders.: Über Antigene und Antikörper, in: Philipps-Universität Marburg an der Lahn (Hrsg.): Behring zum Gedächtnis. Reden und wissenschaftliche Vorträge anlässlich der Behring-Erinnerungsfeier Marburg an der Lahn, 4. bis 6. Dezember 1940, Berlin 1942, S , hier S Hermann Rudy: Neuere Ergebnisse der Immunchemie, in: Angewandte Chemie 50 (1937), S Felix Haurowitz: Chemie der Antigene und der Antikörper, in: Paul Kallós (Hrsg.): Fortschritte der Allergologie (Forschung und Klinik), Basel/New York 1939, S , hier S Doerr, Antigene, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 87
48 ein und Begriffskombinationen wie Hapten-Carrier-Prinzip, Hapten-Carrier-Konjugate usw. fanden Eingang in die immunologische Fachsprache, bei Klärung ihres historischen Ursprungs wurde jedoch nur noch auf Landsteiner verwiesen. 38 Das Staatliche Institut für experimentelle Therapie und das Chemotherapeutische Forschungsinstitut»Georg Speyer-Haus«in Frankfurt a. M. Unter Wilhelm Kolle, der seit 1917 den beiden Instituten in Personal union vorstand, führte Wilhelm Caspari ( ) umfassende Studien zur Krebsimmunität durch. Dabei gelangte er zu der Auffassung,»daß die gleichen Maßnahmen, die unspezifische Immunität hervorrufen, auch mehr oder weniger gegen das Angehen von Impftumoren schützen«. 39 Seine in den 1920er-Jahren entwickelte»nekrohormonhypothese«wurde breit und kontrovers diskutiert. Caspari ging davon aus, dass zwischen der Virulenz eines Tumors und der durch ihn hervorgerufenen Resistenzsteigerung im Organismus ein indirekter Zusammenhang bestünde. Dieser beruhe»auf der der Proliferationsenergie des Tumors parallel gehenden Nekrotisierung des Tumorgewebes, dessen Abbauprodukte (Nekrohormone) in den Kreislauf gelangen und Immunitätsreaktionen im Wirtsorganismus auslösen«. 40 Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildeten Forschungen zur Syphilisdiagnostik und Überprüfungen neuer Nachweismethoden auf ihre praktische Anwendung. Neben der Blutgruppenforschung etablierte man als weiteres neues Forschungsgebiet die Konstitutionsserologie. In diesem Zusammenhang führten mehrere Wissenschaftler (Kurt Laubenheimer, Hans Schlossberger, Werner Fischer) Blutgruppenuntersuchungen in hessischen Gemeinden durch, die Teil einer von der Deutschen Gesellschaft für Blutgruppenforschung geplanten reichsweiten Prüfung der Bevölkerung auf ihre Blutgruppenzugehörigkeit war Vgl. z. B. Edward S. Golub: The cellular basis of the immune response. An Approach to Immunobiology, Sunderland, Mass. 1977, S. 5, 81 f. 39 Wilhelm Kolle/Erwin Stilling: Staatliches Institut für experimentelle Therapie und das Chemotherapeutische Forschungsinstitut»Georg Speyer-Haus«in Frankfurt a. M., in: Ludwig Brauer/Albrecht Mendelssohn-Bartholdy/ Adolf Meyer: Forschungsinstitute und ihre Geschichte, Organisation und Ziele, Hamburg 1930, 2. Band, S , hier S. 70. (künftig zit.: Kolle/Stilling, Staatliches Institut). 40 Wilhelm Caspari/E. Schwarz: Studien über Geschwulstimmunität VI. Die Vorgänge bei Doppelimpfungen, in: Zeitschrift für Krebsforschung 24 (1926), S , hier S Kolle/Stilling, Staatliches Institut, S. 69 f. Wilhelm Kolle und seine Mitarbeiter, 1931 Das Institut für Infektionskrankheiten»Robert Koch«Mit dem seit 1917 amtierenden Direktor Fred Neufeld ( ), der das Institut bis 1933 leiten sollte, trat ein Wissenschaftler an die Spitze des Instituts, der sich zuvor insbesondere mit seinen Pneumokokken-Forschungen einen Namen gemacht hatte. Gemeinsam mit Ludwig Händel hatte Neufeld im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhundert mittels Agglutinations- und Präzipitationsreaktionen gezeigt, dass sich Pneumokokken serologisch unterscheiden lassen, und für die Differenzierung eine nach ihm benannte Serodiagnostik (Kapselquellungsreaktion nach Neufeld) entwickelt. 42 Darüber hinaus zeigte sich Neufeld auch neuen Forschungsrichtungen gegenüber aufgeschlossen und etablierte die Allergieforschung im Robert Koch-Institut. Im Anschluss an eine USA-Reise, auf der er sich mit den Untersuchungen Arthur F. Cocas über Überempfindlichkeitskrankheiten und dessen Ambulatorium am New York Hospital befasst hatte, richtete er 1927 am Robert Koch-Institut nach dem New Yorker Vorbild und mit Cocas persönlicher Unterstützung ein bis dahin in Europa einzigartiges Ambulatorium für Überempfindlichkeiten ein. Für dessen Betrieb sicherte sich Neufeld 42 Klaus Eichmann/Richard M. Krause: Fred Neufeld and pneumococcal serotypes: foundations for the discovery of the transforming principle, in: Cellular and Molecular Life Sciences 70m (2013), S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 89
49 Fred Neufeld, o. D. die Mitarbeit von Lucie Adelsberger ( ), die sich in ihrer internistischen und kinderärztlichen Praxis auf allergische Krankheiten spezialisiert hatte. 43 Das Ambulatorium auch Beobachtungsstelle für Überempfindlichkeitskrankheiten genannt war an die serologische Abteilung unter Richard Otto ( ) angebunden und fand in der Bevölkerung großen Zuspruch. 44 Darüber hinaus traten in den 1920er-Jahren mehrere junge Wissenschaftler in das RKI ein, die sich in den folgenden Jahren durch ihre Arbeiten auch international einen Namen machten. Dazu zählte Walter Levinthal ( ), der nicht nur den nach ihm benannten Levinthal-Agar entwickelte, sondern 1930 auch als Erster den Psittakose-Erreger beschrieb. Fritz Kauffmann ( ) arbeitete an einem Klassifizierungssystem der Salmonella-Gruppe auf serologischer Basis, das seit 1933 nach seinen Urhebern als Kauffmann-White-Schema bezeichnet wurde. Forschungs-Institut für Hygiene und Immunitätslehre in Berlin-Dahlem Zu den in der Weimarer Republik neuerrichteten Einrichtungen, die sich mit Fragen der Immunitätsforschung befassten, gehörte das Forschungs-Institut für Hygiene und Immunitätslehre in Berlin-Dahlem. Es wurde 1926/27 für Ernst Friedberger ( ) 43 Neufeld an Min. für Volkswohlfahrt vom , in: GStA I HA Rep 76 VIII B Nr. 2936; Coca an Sawyer vom , in RAC, RF RG 1.1. series 717 A box 2 Nr. 69; Eduard Seidler (Hrsg.), Lucie Adelsberger. Auschwitz. Ein Tatsachenbericht, Bonn 2001, S. 138 ff. 44 Lucie Adelsberger, Anaphylaxie und Atopie. III. Mitteilung: Anaphylaxieversuche mit Atopenen, in: Zeitschrift für Hygiene der Infektionskrankheiten 111 (1930), S auf dem Gelände der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in unmittelbarer Nähe zum KWI für experimentelle Therapie/für Biochemie errichtet, unterstand jedoch dem Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Die Errichtung eines eigenen Instituts hatte Friedberger seinem Fehlverhalten als Professor für Hygiene der Universität Greifswald gegenüber Mitarbeitern und ausländischen Gastwissenschaftlern zu verdanken, das zu einem Disziplinarverfahren geführt hatte. 45 Das Verfahren gegen Friedberger wurde zwar eingestellt, er selbst jedoch mit seinem Einverständnis beurlaubt. Für die Dauer der Beurlaubung erklärte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für eine gastweise Aufnahme bereit. Zu Friedbergers Forschungsschwerpunkten zählten unter anderem die Anaphylaxie und später auch epidemiologische Fragen. Darüber hinaus befasste er sich mit der Grundlagenforschung und hier unter anderem mit der Antikörperbildung. Mehrfach berichteten Friedberger und seine Mitarbeiter in den 1920er- Jahren in der von ihm mitherausgegebenen Zeitschrift für Immunitätsforschung über Versuche, die»für eine Beteiligung nervöser Einflüsse bei der Antiköperbildung und ihrer Spezifität«sprachen. So konnten sie beobachten, dass»auf Injektionen von Antigen sub- oder intrakutan in die Ohrspitze eines Kaninchens und nachherige Entfernung des Antigendepots durch Abschneiden des betreffenden Ohres an der Basis die Antikörperbildung in gleicher Weise, ja vielfach noch intensiver erfolgt, als wenn das Antigendepot beim Tier bleibt.«46 Parallel hatte der seit 1919 am Institut Pasteur in Paris forschende Exilrusse Sergej Ivanovitsch Metalnikow ( ) die Lehren des russischen Nobelpreisträgers Ivan Petrowitsch Pawlow ( ) auf das Gebiet der Immunität übertragen und versucht, die Bildung von Antikörpern durch die Auslösung eines bedingten Reflexes hervorzurufen. 47 Metalnikow gilt heute aufgrund seiner Pionierarbeit als Begründer der Neuroimmunologie. 48 Seine damaligen Versuche konnten von zeitgenössischen Forschern nur bedingt bestätigt werden. Nach einer Wiederholung von Metalnikows Versuchen hielt Friedberger den Beweis,»daß ein gewisser Reiz in Form des bedingten Reflexes beim Kaninchen allein die Antikörperbildung anregen kann, in dem er die schon im Schwinden begriffene Antikörperbildung wieder anfacht, nicht für 45 Vgl. Sachbericht für den Preußischen Landtag 1925, Gegenstand Prof. Dr. Friedberger von der medizinischen Fakultät der Universität Greifswald, in: Geheimes Preußisches Staatsarchiv (künftig: GStA) VI. HA NL Carl Heinrich Becker Nr Ernst Friedberger/Itta Gurwitz: Sind bedingte Reflexe im Sinne von Pawlow befähigt, die Bildung von Immunantikörpern anzuregen? Ein Beitrag zur Frage der Bildung spezifischer Antikörper, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 73 (1931), S , hier S. 174 (künftig zit.: Friedberger/Gurwitz, bedingte Reflexe). 47 Vgl. u. a. S. Metalnikov/V. Chorine: Rôle des réflexes conditionnels dans l immunité, in: Ann l Institute Pasteur 40 (1926), S ; 48 Debra Jan Bibel: Milestones in Immunology. A Historical Exploration, Madison 1988, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 91
50 Ernst Friedberger, o. D. Preußisches Forschungs-Institut für Hygiene und Immunitätslehre in Berlin-Dahlem sicher erbracht«. 49 Metalnikow reagierte umgehend mit einer Replik, in der er die negativen Resultate auf eine falsche Anwendung der Pawlowschen Forschungsprinzipien und Arbeitsmethoden zurückführte. 50 Eine Forschungskontroverse konnte sich jedoch nicht entwickeln, da Friedberger bereits Anfang 1932 verstarb. Seine Arbeiten über die nervösen Grundlagen der Antikörperbildung und die Rolle von bedingten Reflexen in der Immunologie fanden als frühe deutsche Beiträge zur Neuroimmunologie internationale Beachtung. 51 In Deutschland wurden Friedbergers neuroimmunologische Forschungen nicht aufgegriffen. Mit seiner Ablehnung einer aktiven Typhus- und Diphtherie-Immunisierung hatte sich Friedberger in den 1920er-Jahren fachlich isoliert. 52 Anlässlich seines Todes würdigte die Schriftleitung der von Friedberger mitherausgegebenen Zeitschrift für Immunitätsforschung zwar seine Impulse für die Entwicklung der experimentellen Wissenschaft, stellte zugleich aber kritisch fest:»von Begeisterung für die Forschung und für die ihm vorschwebenden Ziele getragen, konnte er zur Kampfnatur werden, die das von ihm erschlossene Gebiet, die von ihm geltend gemachten Auffassungen mit größter Hingabe und mit den ihm eigenen scharfen Waffen des Geistes zu verteidigen suchte.«53 Mit Friedbergers Tod endete auch die kurze Episode des für ihn persönlich errichteten Forschungsinstituts, dessen Räumlichkeiten von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft übernommen wurden. 54 Die bisherige Aufzählung von wissenschaftlichen Instituten auf dem Gebiet der Immunitätsforschung und ihrer inhaltlichen Schwerpunkte darf nicht den Blick dafür verstellen, dass in zahlreichen weiteren Einrichtungen in staatlicher, privater oder kommunaler Trägerschaft grundlegende Beiträge für die Immunitätsforschung erarbeitet wurden, die international beachtet wurden oder gar als Meilensteine der Immunologie betrachtet werden 49 Friedberger/Gurwitz, bedingte Reflexe, S J. Metalnikow: Über die Rolle bedingter Reflexe bei der Immunität. Antwort an E. Friedberger und J. Gurwitz, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 73 (1931/32), S N. Kopeloff/L.M. Kopeloff/M.E. Raney: The nervous system and antibody production, in: Psychiatric Quarterly 7 (1933), S ; George H. Smith/Robert Salinger: Hypersensitivity and the conditioned reflex, in: Yale S. Journal of Biology and Medicine 1933, S ; G. H. S. Razran: Conditioned responses in animals other than dogs, in: Psychological Bulletin 30 (1933), S ; George Freeman Solomon: The emerging field of psychoneuroimmunology, in: Behavioral and Brain Sciences 8 (1985), S. 411 ff. 52 Vgl. Ernst Friedberger: Zur Frage der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie, in: Klinische Wochenschrift 7 (1928), S ; ders.: Zur Frage der Zweckmässigkeit der Typhusimpfung auf der Höhe einer Epidemie, in: Klinische Wochenschrift 9 (1930), S Ernst Friedberger (17.V I.1932), in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 73 (1931/32), S. I IV.; vgl auch Nachruf in Klinische Wochenschrift 11 (1932), S Eckart Henning/Marion Kazemi: Dahlem Domäne der Wissenschaft, Berlin 2002, S ; Lothar Mertens:»Nur politisch Würdige«Die DFG-Forschungsförderung im Dritten Reich , Berlin 2004, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 93
51 können. Hierzu zählen zweifellos die Entdeckung der Übertragbarkeit einer allergischen Reaktion am Hygienischen Institut der Universität Breslau, die serologischen Forschungen von Fritz Schiff ( ) an der Bakteriologischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses im Friedrichshain in Berlin oder die Arbeiten von Ludwig Aschoff ( ) am Pathologischen Institut in Freiburg über das Retikuloendotheliale System. Fritz Schiff hatte 1913 bei Ernst Friedberger in Berlin über Beiträge zur Frage der heterogenetischen Antikörper promoviert und Anfang der 1920er-Jahre zwei Jahre lang als Friedbergers Assistent am Hygienischen Institut der Universität Greifswald gearbeitet. Nach gegen ihn gerichteten antisemitischen Angriffen kehrte er 1922 nach Berlin zurück, wo er als Leiter der Bakteriologischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses im Friedrichshain die»blutgruppenserologie«zu seinem Hauptarbeitsgebiet machte. Schiff sind einige grundlegende Entdeckungen zu verdanken wie»die Anwesenheit des heterogenetischen lipiden Antigens in den Gruppen A und AB, [ ] die Natur des Antigens O; die Vererbung der Gruppenspezifität des Speichelsekrets; die gruppenspezifischen Speichelfermente; die neuen Antigene G und H«. 55 Größere Aufmerksamkeit fand er jedoch vor allem durch seinen Einsatz für eine gerichtsärztliche Verwendung der Blutgruppendiagnose. 56 Insbesondere warb er für ihre Anwendung zur Klärung von strittigen Paternitätsfragen, wobei er gleichzeitig vor übertriebenen Erwartungen warnte. 57 Sein Vorschlag stieß zunächst auf unterschiedliche Resonanz: Bei einem Teil der Gerichtsmediziner und Juristen fand er Gehör, andere mahnten zur Zurückhaltung. 58 Trotz kritischer Äußerungen wurden bereits 1924 erstmals serologische Vaterschaftsgutachten von deutschen Gerichten zur Beweisführung angefordert. Schon 1926 waren angeblich rund 100 gerichtliche Beweisbeschlüsse zu Vaterschaftsgutachten ergangen, so dass Schiff 1927 befriedigt feststellen konnte, dass Deutschland das erste Land war,»in dem praktisch vor Gericht die Landsteinersche Reaktion bei strittiger Abstammung angewendet wurde«. 59 Seine zum Teil gemeinsam mit Lucie Adelsberger 60 durchgeführten Forschungen sowie sein Zit. nach Mathias Okroi: Der Blutgruppenforscher Fritz Schiff ( ). Leben, Werk und Wirkung eines jüdischen Deutschen, Diss. med. Lübeck 2004 (künftig zit.: Okroi, Fritz Schiff), S Vgl. hierzu G. Geserick/I. Wirth: Über die Anfänge der blutgruppenserologischen Abstammungsbegutachtung, in: Rechtsmedizin 21 (2011), S (künftig zit.: Geserick/Wirth, Über die Anfänge). 57 Vgl. bspw. Fritz Schiff/Lucie Adelsberger: Die Blutgruppendiagnose als forensische Methode, in: Ärztliche Sachverständigen-Zeitung 30 (1924), S ; Fritz Schiff: Wie häufig lassen sich die Blutgruppendiagnosen in Paternitätsfragen heranziehen, ebd., S Geserick/Wirth, Über die Anfänge, S Zit. nach Geserick/Wirth, Über die Anfänge, S Vgl. bspw. Fritz Schiff/Lucie Adelsberger: Über blutgruppenspezifische Antikörper und Antigene, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 40 (1924), S Fritz Schiff, o. D. erstmals veröffentlichtes Standardwerk»Die Technik der Blutgruppenuntersuchung für Kliniker und Gerichtsärzte«fanden schnell internationale Beachtung 61 und waren ausschlaggebend für seine Berufung in die Standardisierungskommission der Hygienekommission des Völkerbundes zur Bezeichnung der Blutgruppen oder seine Ernennung zu einem der obersten Sachverständigen für die Vaterschaftsgutachten durch den Reichsgesundheitsrat. 62 Aus kultur- und medizinhistorischer Perspektive werden Schiffs Engagement für den serologischen Vaterschaftsnachweis sowie seine anthropologischen Blutgruppenstudien, in denen er bspw. der Frage nach Unterschieden in der Blutgruppenformel von Juden und Nichtjuden nachging, 63 durchaus zwiespältig gesehen. So verweist Myriam Spörri darauf, dass»dem Diskurs des Vaterschaftsnachweises durch Fritz Schiff und seine Kollegen bereits zuvor eine Rassenkomponente eingeschrieben worden war«. Außerdem, so Spörri, habe gerade die von Fritz Schiff und anderen»vorangetriebene Biologisierung der Vaterschaft letztlich, wenn auch gänzlich unbeabsichtigt, den Nationalsozialisten in die Hände gespielt.« berichteten die am Hygienischen Institut der Universität Breslau tätigen Carl Prausnitz ( ) und Heinz Küstner ( ) in einem Beitrag für das Zen- 61 In der Zeitschrift Journal of Immunology wird in zahlreichen Beiträgen auf die Forschungen von Fritz Schiff verwiesen. 62 Okroi, Fritz Schiff, S. 50f, F. Schiff/H. Ziegler: Blutgruppenformel in der Berliner Bevölkerung, in: Klinische Wochenschrift 3 (1924), S Myriam Spörri: Reines und gemischtes Blut. Zur Kulturgeschichte der Blutgruppenforschung , Bielefeld 2013, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 95
52 tralblatt für Bakteriologie 65 über ihre erfolgreichen Selbstversuche zur passiven Übertragung einer»überempfindlichkeit«. Hierfür hatten sie zunächst das Serum einer Person (Heinz Küstner) mit diagnostizierter Fischempfindlichkeit einem gesunden Menschen (Prausnitz) intrakutan am Unterarm injiziert und 24 Stunden später in die gleiche Stelle Fischextrakt als Antigen eingespritzt, woraufhin sich positive Hautreaktionen zeigten. Andere Autoren aus dem In- und Ausland, die die Versuchsanordnung in eigene Studien übernahmen, konnten die Ergebnisse schon bald bestätigen. 66 Bereits in den 1920er- Jahren setzte sich die von Prausnitz und Küstner beschriebene Versuchsanordnung als Prausnitz-Küstner-Test, bzw. Reaktion oder Methode in der Allergiediagnose trotz einzelner Einwände auch international durch. 67 Heute gilt er als»startpunkt des Studiums der Natur hautsensibilisierender Antikörper und ihrer den Patienten schonenden Nachweismethoden«und damit als»meilenstein in der Allergieforschung«. 68 Vertreibung jüdischer Immunologen im Nationalsozialismus Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und die Machtübernahme der Nationalsozialisten bedeutete für die immunologische Forschung in Deutschland einen erheblichen Einschnitt. Infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, das die Entlassung aufgrund der»nicht arischen«herkunft oder der politischen Einstellung ermöglichte, verloren zahlreiche immunologisch interessierte Wissenschaftler ihre Beschäftigung an universitären, kommunalen und staatlichen Einrichtungen. Die Institute mit immunologischen Forschungsgebieten waren ganz unterschiedlich von dem Berufsbeamtengesetz betroffen. Im Robert Koch-Institut in Berlin waren jüdische Wissenschaftler vereinzelt bereits kurz nach der nationalsozia listischen Machtübernahme Opfer antisemitischer Repression und vorübergehend in Haft genommen worden. 69 Aufgrund des»arierparagraphen«des Berufsbeamtengesetzes erhielten die planmäßigen Assistenten bzw. Oberassistenten Walter Levinthal ( ), Georg Blumenthal ( ), Hans Munter ( ), Hans Loewenthal ( ), 65 Carl Prausnitz/Heinz Küstner: Studien über die Überempfindlichkeit, in: Zentralblatt für Bakteriologie, I. Abt. Originale 86 (1921), S Vgl. hierzu insb. Hans-Dieter Göring: Die passive Übertragung der Sofort-Typ-Allergie im Selbstversuch durch Carl Prausnitz und Heinz Küstner ein Meilenstein in der Allergieforschung, in: Akt Dermatol 33 (2007), S (künftig zit.: Göring, passive Übertragung). 67 Arthur F. Coca: A critical review of investigations of allergic diseases, in: Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentelle Therapie 14 (1933), S , hier S. 546 ff. 68 Göring, passive Übertragung. 69 Hinz-Wessels, RKI im NS, S. 22 f. Werner Silberstein ( ), Fritz Kauffmann ( ) sowie das nebenamtliche wissenschaftliche Institutsmitglied Ulrich Friedemann ( ) ihre Kündigung zum 30. Juni Auch die mit Drittmitteln beschäftigten jüdischen Wissenschaftler wie bspw. Lucie Adelsberger mussten ihre Tätigkeit aufgeben. Am Institut für experimentelle Krebsforschung konnte Hans Sachs nach kurzer Beurlaubung aufgrund von greifenden Sonderregelungen die Institutsleitung zunächst behalten. 70 Auf eine staatliche Unterstützung seiner Forschungen durfte er aber nicht mehr hoffen. Schon ab Juni 1933 bewilligte die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (ab 1935 Deutsche Forschungsgemeinschaft) im vorauseilenden Gehorsam keine Stipendienanträge von jüdischen Wissenschaftlern mehr; erst drei Monate später erging eine entsprechende Aufforderung seitens des Reichsinnenministeriums. 71 Auch Alfred Klopstock konnte aufgrund seiner Weltkriegsteilnahme zunächst verbleiben, entschied sich jedoch noch 1933 zur Emigration nach Palästina, wo er in Tel Aviv ein mikrobiologisches Labor gründete und in den 1950er-Jahren das Ordinariat für Immunologie an der neugegründeten Universität bekleidete. 72 Witebsky bemühte sich nach seiner Beurlaubung 1933 zunächst erfolglos um eine Anstellung in der Schweiz. Nach seiner Emigration in die USA konnte er ab 1936 seine wissenschaftliche Karriere als Immunologe an der Universität Buffalo fortsetzen. 73 Im Oktober 1935 wurde Hans Sachs aufgrund des Reichsbürgergesetzes zunächst beurlaubt und anschließend zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Auch die Herausgeberschaft der Zeitschrift für Immunitätsforschung, die er 1909 mitbegründet hatte, musste er offensichtlich niederlegen. 74 Seine Bemühungen, in Großbritannien, Schweden oder den USA eine seiner Qualifikation und Reputation entsprechende Anstellung zu erhalten, scheiterten jedoch, nicht zuletzt, weil ihm aufgrund seines Alters keine innovative Forschung mehr zugetraut wurde. 75 Nach der Reichspogromnacht 1938 gelang Sachs und seiner Ehefrau Charlotte mit Unterstützung des Assistenten am Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung, Otto Westphal, die Emigration. 76 Sachs ging zunächst nach London und später nach 70 Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung, S. 123 ff. 71 Patrick Wagner: Forschungsförderung auf der Basis eines nationalen Konsenses. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft am Ende der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, in: Michael Grüttner/Rüdiger Hachtmann/Konrad H. Jarausch/Jürgen John/Matthias Midell (Hrsg.): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010, S Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung, S. 117 f. 73 Ebd., S. 122 f. 74 Ab 1936 war Uhlenhuth (zunächst) alleiniger Herausgeber. 75 Vgl. Horst Dickel: Hans Sachs, in: Gisela Holfter (Hrsg.): German-speaking Exiles in Ireland , Amsterdam/New York 2006, S Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 97
53 Lucie Adelsberger, um 1930 Mitteilung Hans Sachs an den Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft über seine Beurlaubung, Dublin, wo er ab Mai 1939 mit einem gut ausgestatteten Forschungsstipendium am Department of Bacteriology an der School of Pathology des Trinity College in Dublin arbeitete. Hier publizierte er vor allem Beiträge über Blutgruppen und Syphilis. Er starb am 23. März 1945 nach einer Operation infolge akuten Herzversagens. Die Zeitschrift Lancet würdigte ihn als einen der Pioniere der Serologie aus der Schule Paul Ehrlichs. 77 Am Staatsinstitut für experimentelle Therapie bzw. Georg-Speyer-Haus in Frankfurt a. Main wurden aufgrund des Reichsbürgergesetzes insgesamt vier Wissenschaftler 78 zum 31. Dezember 1935 zwangspensioniert, und zwar der Leiter der Abteilung für Krebsforschung, Wilhelm Caspari ( ), der Leiter des Chemischen Labors Hugo Bauer ( ), der Chemiker Eduard Strauß ( ) sowie der Leiter 77 Obituary: Hans Sachs, in: The Lancet vom , S der gemeinsamen Bibliothek der beiden Institute, Erwin Stilling ( ). Der auf Lebenszeit zum Direktor des Biologischen Instituts ernannte Ferdinand Blum ( ) musste 1939 aufgrund seiner jüdischen Herkunft die Leitung des Instituts niederlegen und emigrierte in die Schweiz. Auch der Blutgruppenforscher Fritz Schiff, der seine Weiterbeschäftigung als Leiter der Bakteriologischen Abteilung am Krankenhaus Moabit nach dem Erlass des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums auch seiner langjährigen freundschaftlichen Beziehung zum damaligen Staatskommissar des Berliner Gesundheitswesens, Wilhelm Klein, zu verdanken hatte, wurde zum 31. Dezember 1935 zwangsweise in den Ruhestand versetzt. 79 Zugleich mit seiner Zwangspensionierung wurde ihm auch die Lehrbefugnis an der Berliner Universität entzogen. 80 Insgesamt verloren die deutschen Universitäten des sogenannten Altreiches zwischen 1933 und 1945 durch die Säuberungspolitik der Nationalsozialisten rund 20 Prozent ihres Lehrkörpers (ohne nichthabilitierte Assistenten). 81 In staatlichen Instituten wie dem Robert Koch-Institut lag der Anteil der Entlassenen vereinzelt noch deutlich höher. Hier verloren sechs von acht planmäßigen Assistenten- bzw. Oberassistenten ihre Anstellung. 82 Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft entließ rund elf Prozent ihrer Mitarbeiter, 79 Okroi, Blutgruppenforschung, S. 72 f. 80 Schriftl. Mitteilung von Susanne Doetz vom Michael Grüttner/Sven Kinas: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten , in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007), S , hier S Hinz-Wessels, RKI im NS, S. 21 ff. 98 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 99
54 d. h. insgesamt 126 Männer und Frauen, von denen 104 als Wissenschaftler gearbeitet hatten. 83 Für die Betroffenen bedeutete die Entlassung eine tiefgreifende Zäsur ihres bisherigen Lebensweges. Ihr weiteres Schicksal gestaltete sich unterschiedlich. Die in Deutschland verbliebenen Wissenschaftler wurden verfolgt, deportiert und zum Teil ermordet. Letzteres gilt für Wilhelm Caspari, der im Januar 1944 im Ghetto Lodz (Litzmannstadt) verstarb, sowie für seinen Kollegen, Ernst Stilling, der im Oktober 1941 im selben Transport wie das Ehepaar Caspari in das Ghetto Lodz verschleppt wurde, und dort im April 1942 verstarb. 84 Lucie Adelsberger, die aus Sorge um ihre Mutter Arbeitsangebote aus den USA verwarf, wurde im Mai 1943 nach Auschwitz deportiert. Sie überlebte die Hölle von Auschwitz und emigrierte ohne Deutschland nochmals zu betreten 1946 in die USA, wo sie über 20 Jahre lang im New Yorker Montefiore Hospital und Medical Center in der Abteilung Pathologie arbeitete. 85 Aufgrund des Arbeitsplatzverlusts und der mangelnden Aussichten auf eine weitere wissenschaftliche Beschäftigung entschieden sich die meisten entlassenen Wissenschaftler zur Emigration, wobei Palästina, Europa oder die USA die bevorzugten Auswanderungsziele darstellten. Dieser Schritt war in vielen Fällen trotz des bereits erworbenen wissenschaftlichen Renommees mit einem»deutlichen Karrierebruch und persönlichen Verlusten«verbunden. 86 Nur zum Teil konnten die vertriebenen Wissenschaftler, sei es aufgrund ihres Alters, persönlicher Lebensumstände oder der weiteren Kriegsentwicklung, ihre wissenschaftlichen Karriere im Ausland fortsetzen. Durch die Entlassung und erzwungene Emigration von immunologisch interessierten Forschern wie Hans Sachs, Ernst Witebsky, Wilhelm Ehrich, Alfred Klopstock, Fritz Schiff, Lucie Adelsberger u. a. gingen wesentliche Impulse für die experimentelle, aber auch für die klinische Immunologie verloren. Darüber hinaus bedeutete die Vertreibung die Unterbrechung bzw. Einstellung von bisher erfolgreich betriebenen Projekten, fruchtbaren wissenschaftlichen Kooperationen und innovativen Forschungsrichtungen wie beispielsweise der Allergologie am RKI. Die größten Veränderungen unter den einschlägig ausgewiesenen Forschungseinrichtungen erlebten zweifellos das Robert Koch-Institut in Berlin sowie das Institut für experimentelle Krebsforschung in Heidelberg. Letzteres wurde nach der Zwangspensionierung von Hans Sachs vertretungsweise von dem Serologen Werner Fischer geleitet und verlor mit der Angliederung an das von Ernst Rodenwaldt ( ) geleitete Hygiene-Institut seine Selbständigkeit. 87 Auch die Assoziierung mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung bot keine Rettung. Als sich der Heidelberger Internist und Direktor am Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung, Ludolf von Krehl ( ) im Herbst 1935 für Hans Sachs beim Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Max Planck ( ), einsetzte und diesen fragte, ob»professor Sachs als Mitarbeiter in unser großes Institut übersiedeln kann oder ob das aus politischen Gründen nicht geht«, 88 empfahl Planck,»in der Angelegenheit Sachs [ ] zur Zeit nichts zu veranlassen und sich irgendwelchen Wünschen gegenüber möglichst zurückzuhalten.«auch das Schicksal des von Sachs geleiteten Instituts war Planck gleichgültig:»was das Institut von Herrn Prof. Sachs anbelangt, das ja eigentlich entgegen den ursprünglichen Abmachungen niemals in den Kreis der Kaiser-Wilhelm-Institute de facto überführt worden ist, so glaube ich, daß es das Beste wäre, in Zukunft diese Beziehung als gelöst zu betrachten.«89 Das Profil des Robert Koch-Instituts hatte sich schon durch die Entlassung der jüdischen Wissenschaftler erheblich verändert. Darüber hinaus kam es zwischen 1933 und 1937 zu einem fast vollständigen Austausch der Führungsriege sowie zur Unterstellung des Instituts unter das Reichsgesundheitsamt und einer Neustrukturierung der Forschungsgebiete beider Institutionen. Am Staatlichen Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt wurde Richard Otto, der seit mehr als zwei Jahrzehnten als Serologe am Robert Koch-Institut gearbeitet hatte, nach dem plötzlichen Tod Kolles im August 1935 mit der kommissarischen Leitung beauftragt und im April 1936 zu dessen Direktor ernannt. Unter seiner Leitung wurden die Arbeiten Paul Ehrlichs aus der Institutsbibliothek entfernt und 1938 das Georg-Speyer-Haus in Forschungsinstitut für Chemotherapie umbenannt. 90 Während des Zweiten Weltkriegs zählte insbesondere die Chemotherapie von Tuberkulose, Lepra und Fleckfieber zum Forschungsprogramm. Zugleich führten die Wissenschaftler auch ; Michael Schüring: Minervas verstoßene Kinder. Vertriebene Wissenschaftler und die Vergangenheitspolitik der Max-Planck-Gesellschaft, Göttingen 2006, S. 52 f. 84 Vgl. Online-Gedenkbuch des Bundesarchivs 85 Ihre Erfahrungen in Auschwitz beschrieb sie 1946 in Lancet und 1956 in einem Erinnerungsbericht, vgl. Lucie Adelsberger: Medical observations in Auschwitz concentration camp, in: The Lancet 247 (1946), S ; Lucie Adelsberger: Auschwitz. Ein Tatsachenbericht. Das Vermächtnis der Opfer für uns Juden und für alle Menschen, Berlin Hubenstorf, Aufbruch und Abbruch, S Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung, S. 139 ff. 88 Ludwig von Krehl an Präsident Planck, , in: Archiv der MPG, I. Abt. Rep 1A Nr. 540/1. 89 Präsident Planck an Ludwig von Krehl, , in: Archiv der MPG, I. Abt. Rep 1A Nr. 540/ WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 101
55 kriegswichtige Arbeiten durch wie die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Fleckfieber oder eines Heilmittels gegen Giftgas und Gasbrand. 91 Das mit den Behringwerken eng verbundene Institut für experimentelle Therapie»Emil von Behring«, das im Wesentlichen aus Hans Schmidt und wenigen Assistenten bestand, war von der nationalsozialistischen Machtübernahme anscheinend wenig berührt trat der Chemiker und Mediziner Richard Haas ( ) in das Institut ein und übernahm 1938 dessen diagnostische Untersuchungsabteilung. 92 In seinen wissenschaftlichen Arbeiten befasste sich Haas insbesondere mit Endo- und Exotoxinen verschiedener Bakterien sowie gemeinsam mit dem Chemiker und Krebsforscher Hans Lettré ( ) mit der Darstellung chemisch markierter Antigene. 93 In den späten 1930er-Jahren wurde das Institut auch als An-Institut der Universität geführt. 94 Erst der 1939 von Hitler entfesselte Eroberungskrieg gab den Anstoß, die Aufgaben des Instituts neu zu definieren. Die Öffentlichkeit erfuhr von den weitreichenden Planungen zumindest in Ausschnitten während der prunkvollen Behring-Feier, die die Philipps-Universität Marburg anlässlich des 50. Jahrestages der ersten Veröffentlichung Behrings über die Serumtherapie im Dezember 1940 in Anwesenheit des Reichserziehungsministers Bernhard Rust und weiterer prominenter Ehrengäste ausrichtete. Hier kündigte Carl Lautenschläger als Vorstandsmitglied der I.G. Farbenindustrie sowie Aufsichtsratsmitglied der Behringwerke den Entschluss der I.G. Farbenindustrie an,»zum Zeichen des Dankes an den großen Forscher [ ] an der Hauptstätte des einstigen Wirkens Emil von Behrings«ein neues Institut errichten zu wollen, das den Namen»Forschungsinstitut für experimentelle Therapie Emil von Behring«tragen sollte. 95 Vordergründig sollte die Einrichtung wissenschaftlichen Zwecken auf dem immunbiologischen Gebiet dienen. Tatsächlich verband die I.G. Farbenindustrie mit dem Neubau noch viel weiter reichende Ziele, nämlich die Neuordnung des Serumgeschäftes»zum mindesten [ ] in dem von Deutschland in Zukunft wirtschaftlich beeinflussten europäischen Großraum«. 96 Das Institut sollte in der Lage sein,»den Einfluss des Pasteur-Instituts, der vielen Institute der Rockefeller Foundation und ähnlicher grosser staatlicher Angaben aus Munzinger-Archiv. 93 Vgl. Abschnitt Immunchemie. 94 Schriftl. Auskunft von Dr. Kornelia Grundmann, Marburg vom Prof. Dr. C.L. Lautenschläger, Frankfurt am Main, in: Philipps-Universität Marburg an der Lahn (Hrsg.): Behring zum Gedächtnis. Reden und wissenschaftliche Vorträge anlässlich der Behring-Erinnerungsfeier Marburg an der Lahn, 4. bis 6. Dezember 1940, Berlin 1942, S. 16 f. 96 Denkschrift»Vorschlag zur Neuordnung des Serumgeschäftes«, verfasst von Wilhelm Rudolf Mann (Vorstandsmitglied der IG Farbenindustrie) vom , in: BArch R 4901 Nr , Bl Urkunde der I.G. Farbenindustrie AG über die Stiftung eines neuen Forschungsinstituts anlässlich der Behring-Feier im Dezember 1940 Institute mit eigener Serum- und Impfstoffproduktion auszuschalten.«97 Zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen kam es angesichts der Kriegsentwicklung nicht. Auch das Projekt»Institutsneubau«wurde zunächst auf die Zeit nach Kriegsende verschoben und später nicht mehr realisiert. 98 Paul Ehrlich und Emil von Behring im Nationalsozialismus Unter der»beseitigung des jüdischen Einflusses«auf die deutsche Wissenschaft verstanden die Nationalsozialisten nicht nur die Vertreibung von Menschen jüdischer Herkunft aus den universitären und außeruniversitären Einrichtungen des Deutschen Reiches, sondern auch eine Unterdrückung und Leugnung von Leistungen, die jüdische Wissenschaftler in der Vergangenheit erbracht hatten. Auf dem Gebiet der Immunitätsforschung bedeutete dies vor allem der Versuch, die Person Paul Ehrlichs als einem ihrer Gründungsväter zu ignorieren. Bereits auf der vom Frankfurter Institut für experimen- 97 I.G. Farbenindustrie an Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, , ebd., Bl Kornelia Grundmann, Esther Krähwinkel, Helmut Remschmidt und Gerhard Aumüller, Die Medizinische Fakultät während des Krieges, in: Gerhard Aumüller, Kornelia Grundmann, Esther Krähwinkel, Hans H. Lauer, Helmut Remschmidt (Hrsg.), Die Marburger Medizinische Fakultät im Dritten Reich, München 2001, S , hier S. 647 f. 102 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 103
56 telle Therapie unter Wilhelm Kolle organisierten und von zahlreichen ausländischen Forschern besuchten Wissenschaftlichen Woche im September 1934 blieb er in den Ansprachen und Grußworten der Vertreter staatlicher und kommunaler Einrichtungen unerwähnt. Auch die goldene Paul-Ehrlich-Medaille und die Paul-Ehrlich-Geldpreise, die die 1929 errichtete Paul-Ehrlich-Stiftung für besonders verdiente Forscher und Urheber wichtiger Arbeiten auf Ehrlichs Forschungsarbeiten seit 1930 verlieh, konnten nach 1934 nicht mehr vergeben werden. Das Vermögen fiel der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.v zu, die schon zuvor die treuhänderische Verwaltung des Stiftungsvermögens übernommen hatte. 99 Auch in wissenschaftlichen Beiträgen fand Paul Ehrlich immer weniger Erwähnung. Im Besonderen zeigt sich dies im Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt, dem Paul Ehrlich als erster Direktor bis zu seinem Tod 1915 vorgestanden hatte. Richard Otto ließ seine Schriften aus der Institutsbibliothek entfernen erhielt die noch zu Lebzeiten Paul Ehrlichs nach ihm benannte Straße den Namen des Chirurgen Ludwig- Rehn, 101 und die Stiftung»Georg-Speyer-Haus«wurde in Stiftung»Forschungs-Institut für Chemotherapie zu Frankfurt a. M.«umbenannt. 102 Paul Ehrlichs Witwe Hedwig ( ) musste 1939 aus Nazi-Deutschland fliehen. 103 Im Kontrast zur Negierung der Leistungen Paul Ehrlichs entfachte das NS-Regime um den zweiten Gründungsvater Emil von Behring geradezu einen Kult, wenngleich erst mit einiger Verzögerung. Zunächst war Behring wegen der»verunreinigung germanischen Blutes durch das Tierblut-Serum«sogar verleumdet worden und das nationalsozialistische Hetzblatt Der Stürmer hatte Behring vorgeworfen, er habe sogar sein eigenes Blut jüdisch versaut. 104 Hintergrund dieser Anfeindungen war Behrings Ehe mit Else Spinola ( ), die aus einer jüdischen Familie stammte. Erst nach ihrem Tod kam es zu einer zunehmenden Vereinnahmung Behrings. Insbesondere mit der pompös begangenen Behring-Feier im Jahr 1940 anlässlich des 50. Jahrestages der entscheidenden Veröffentlichung Behrings über die Entdeckung der Serumtherapie verfolgte das NS-Regime eine»opportune Korrektur der Ideologie«. 105 Behring wurde nun als»wohltäter der Menschheit«und»Retter der Kinder«gefeiert und mit der Enthüllung eines Behring-Denkmals, einer Gedenkbriefmarke sowie einem Festakt mit Ansprachen des Reichserziehungsministers Rust und des Reichsgesundheitsführers Conti und einer wissenschaftlichen Tagung geehrt. Dieser Wandel in der Behring-Rezeption entging zeitgenössischen Beobachtern wie dem Bonner Dermatologen Erich Hoffmann ebenso wenig wie das gänzliche Totschweigen der Verdienste Paul Ehrlichs»während der gesamten Feier«. 106 Mit dieser Ehrung und der weiteren Förderung des Behring-Kultes in Form von populärwissenschaftlichen Publikationen, 107 Zeitungsartikeln und Rundfunksendungen 108 verband das NS-Regime im Wesentlichen zwei Motive: Zum einen war sie Teil einer reichsweiten Propaganda für die aktive Schutzimpfung gegen Diphtherie, deren Erkrankungsfälle trotz massiver Impfkampagnen auf einen bedrohlichen Umfang angewachsen war. 109 Zum anderen spielte der Behring-Kult eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung der deutschen Wissenschaft für Hitlers Eroberungskrieg im Osten. 110 Behring wurde nicht nur als»retter der Kinder«, sondern unter Hinweis auf»das von ihm und Kitasato geschaffene Tetanus- Antitoxin sowie das auf der Grundlage der Behringschen Lehre entstandene Gasbrand- Serum«auch als»retter der Soldaten«gefeiert, und zwar nicht nur des vergangenen Weltkrieges, sondern auch des»gegenwärtigen Kriege[s]«. 111 Dass die Vertreter der Im war der von der Witwe Paul Ehrlichs, Hedwig Ehrlich ausgestattete Fonds in Höhe von RM in eine Paul-Ehrlich-Stiftung überführt worden wurde die goldene Paul-Ehrlich-Medaille erstmals vergeben. Mit der Auszeichnung wurde Karl Landsteiner geehrt, weil»er durch die Entdeckung der menschlichen Blutgruppen und durch die Begründung der Haptentheorie der Immunitätsforschung neue Gebiete erschlossen«habe, vgl. Klinische Wochenschrift 7 (1930), S Zur Paul-Ehrlich-Stiftung vgl /portal01/portal01.php?ziel=t_ak_oberrad_judenvertreibung01., hier: Stiftungen jüdischer Bürger Frankfurts für Bildung, Wissenschaft und Kunst Übersicht und Geschichte nach Richard Otto: Bericht über die Tätigkeit des Forschungs-Instituts für Chemotherapie zu Frankfurt a. M. in der Zeit vom August 1935 bis Ende Februar 1939, in: Arbeiten aus dem Staatlichen Institut für experimentelle Therapie und dem Forschungsinstitut für Chemotherapie zu Frankfurt a. M., Heft 38, S. 1 24, hier S Sie emigrierte zunächst in die Schweiz und 1941 in die USA, wo sie 1948 verstarb. 104 Günter Rehme/Konstantin Haase: Mit Rumpf und Stumpf ausrotten...: Zur Geschichte der Juden in Marburg und Umgebung nach 1933 (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 6), Marburg 1982, S Ebd. 106 Hoffmann, zit. nach Grundmann, Medizinische Fakultät, Vgl. Hellmuth Unger: Unvergängliches Erbe. Das Leben Emil von Behrings, Oldenburg i.o./berlin Zu Hellmuth Unger vgl. Claudia Sybille Kiessling: Dr. med. Hellmuth Unger, , Dichterarzt und ärztlicher Pressepolitiker in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, Husum Vgl. hierzu die zahlreichen abgedruckten Presseartikel und Rundfunksendungen in: Behring-Archiv (Hrsg.): Die Welt dankt Behring, Berlin Zwischen 1938 und 1943 stieg die Zahl der Diphtheriefälle von rund auf fast an. Vgl. Hinz-Wessels, RKI im NS, S. 88 ff., hier S Paul Weindling: Behring, Emil von, in: Arne Hessenbruch (Hrsg.): Readers Guide to the History of Science, London/Chicago 2000, S. 72 f.; Paul Weindling: Epidemics and Genocide in Eastern Europe, , Oxford 2000, S Behring-Archiv (Hrsg.): Bildbericht für die Teilnehmer der Behring-Erinnerungsfeier Dezember 1940 Marburg-Lahn, Marburg-Lahn o. D. [ca. 1941], S. 3; Rede des Reichsgesundheitsführers Leonardo Conti bei der Behring-Feier, in: Philipps-Universität Marburg an der Lahn (Hrsg.): Behring zum Gedächtnis. Reden und wissenschaftliche Vorträge anlässlich der Behring-Erinnerungsfeier Marburg an der Lahn, 4. bis 6. Dezember 1940, Berlin 1942, S , hier S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 105
57 zu schirmen, ist besonders nach dem siegreichen, aber männermordenden Kriege für die Gesundheitsführung heiligste Pflicht und höchstes Gebot. Wir deutschen Ärzten und Forscher die alten und die jungen geloben, unsere ganzen Kräfte einzusetzen, um das dazu notwendige Rüstzeug zu liefern und stehen als Pioniere der Volksgesundheit in der Erfüllung dieser Aufgaben für die Gegenwart und Zukunft eines glücklichen Europas geschlossen hinter unserem Führer.«113 Wie weit»die deutschen Ärzte und Forscher«zu gehen bereit waren, sei es aus Überzeugung, Opportunismus oder eigenen Forschungsinteressen, zeigt exemplarisch die Fleckfieberforschung im Zweiten Weltkrieg. Immunologie im Zweiten Weltkrieg Kranzniederlegung am Behring-Denkmal an der Elisabethkirche, Marburg/Lahn anlässlich der Behring-Feier 1940 munitätsforschung ihren Teil zum deutschen Endsieg beizutragen gewillt waren, zeigt sich beispielhaft in der Behring-Preis-Vorlesung, die Paul Uhlenhuth als Träger des am 11. Juli 1942 erstmalig durch die Philipps-Universität Marburg verliehenen Emil von Behring-Preises hielt. 112 Am Ende seines Vortrags über»immunitätsforschung und experimentelle Therapie«äußerte Uhlenhuth den Wunsch, der jungen Forschergeneration möge es in dem geplanten neuen Forschungsinstitut gelingen,»im Geiste von Behring neue Waffen zu schmieden im Kampf gegen die kleinsten und doch größten Feinde des Menschengeschlechtes«und er beschloss ihn mit dem Hinweis:»Der größte Reichtum eines Volkes sind die Menschen. Ihre Gesundheit, dieses kostbare Gut, zu schützen und 112 Am 30. Januar 1942 gab der Rektor der Marburger Universität die Stiftung des Emil von Behring-Preises bekannt, den die Universität mit Unterstützung der Behringwerke geschaffen hatte. Er bestand aus einer Medaille sowie einem Geldbetrag von 5000 RM und sollte alle zwei Jahre für besondere wissenschaftliche Leistungen auf (veterinär)-medizinischem und naturwissenschaftlichem Gebiet mit besonderer Bevorzugung der Immunbiologie und Seuchenbekämpfung verliehen werden, vgl. Tagesgeschichte, in: Klinische Wochenschrift 21 (1942), S Der durch den Überfall auf Polen im September 1939 von Deutschland ausgelöste Zweite Weltkrieg hatte erhebliche Auswirkungen auf die Immunitätsforschung. Zum Teil waren die Institute aufgrund ihrer Arbeitsschwerpunkte schon in die Kriegsvorbereitungen des NS-Regimes involviert. Der Oberarzt der Militärärztlichen Akademie, Hermann Eyer ( ), wurde beispielsweise zur wissenschaftlichen Sonderausbildung an das RKI abkommandiert. 114 Darüber hinaus waren mehrere Wissenschaftler während des Krieges als Beratende Hygieniker des Militärs tätig. Die Behringwerke waren spätestens ab 1937 in die Kriegsvorbereitungen eingebunden durch umfangreiche Planungen zur Bereitstellung ausreichender Mengen an Impfstoffen und Seren für den militärischen und zivilen Bedarf sowie Forschungsarbeiten über Gasbrand und Ruhr. 115 Nach Kriegsausbruch wurde die Forschungstätigkeit zunächst stark gedrosselt, die Hauptaufgabe bestand in der Ausführung praktischer Arbeiten, also vorrangig in der Herstellung von Impfstoffen und Sera für Wehrmachtszwecke oder in der Prüfung der von der Industrie hergestellten Impfstoffe und Sera. Doch schon bald traten neben diese praktischen Arbeiten auch wieder Forschungsaufgaben, insbesondere mit kriegsrelevanter Bedeutung. Im Bereich der Immunitätsforschung konzentrierte man sich insbesondere auf die (Weiter-)Entwicklung von Impfstoffen oder Heilsera gegen Infektionskrankheiten. Im Zentrum dieser Arbeiten stand aufgrund der deutschen Kriegsführung in Ost- und 113 Paul Uhlenhuth: Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 103 (1943), S , hier S Vgl. zu Uhlenhuth: Hans-Peter Schmiedebach: Paul Uhlenhuth ( ) Forscher im Dienste des Vaterlandes, in: Rechtsmedizin 11 (2001), S Vgl. hierzu Dokumente in BArch R 86 Nr (Personalakte Hermann Eyer). 115 Thomas Werther: Fleckfieberforschung im Deutschen Reich Untersuchungen zur Beziehung zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik unter besonderer Berücksichtigung der IG Farben. Diss. phil. Marburg 2004, S. 172 (künftig zit.: Werther, Fleckfieberforschung). 106 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 107
58 Südosteuropa die Entwicklung eines wirksamen Impfschutzes gegen das dort endemisch verbreitete Fleckfieber. Dabei handelt es sich um eine durch die Kleiderlaus übertragene und vom dem Erreger Rickettsia prowazeki verursachte akute Infektionskrankheit, die vor Einführung der Antibiotika in 10 bis 20 Prozent der Fälle tödlich verlief. Aus der Entdeckung, dass im Serum von Fleckfieberkranken Agglutinine gegen Proteus X 19 Bakterien gebildet werden, hatten Edmund Weil und Arthur Felix während des Ersten Weltkriegs eine Methode zur Fleckfieberdiagnose erarbeitet (Weil-Felix-Reaktion). Nach 1918 hatte man sich im Deutschen Reich kaum mit Fleckfieber befasst, während im Ausland insbesondere in Polen und in den USA intensiv und mit Erfolg entsprechende Arbeiten vorangetrieben wurden. Zu den wenigen deutschen Experten zählte Richard Otto, der in der Zwischenkriegszeit gemeinsam mit seinen Mitarbeitern erfolgreiche Züchtungsversuche mit Erregerstämmen des wesentlich milder verlaufenden, durch Rattenflöhe übertragenen murinen Fleckfiebers unternommen hatte. Tatsächlich setzte erst kurz vor Kriegsbeginn eine intensivere Forschungstätigkeit ein, zunächst in dem von Otto geleiteten Institut in Frankfurt, in dem man sich nach vergleichenden Impfstoffprüfungen aus pragmatischen Gründen auf die in den USA entwickelte Dottersackmethode konzentrierte, 116 sowie in den Marburger Behringwerken, die 1938 mithilfe einer aus dem polnischen Institut für Hygiene in Warschau beschafften rickettsieninfizierten Maus ihre Arbeiten aufnahmen. Das im Oktober 1939 in Krakau errichtete»institut für Fleckfieber- und Virusforschung des Oberkommandos des Heeres (OKH)«unter der Leitung von Hermann Eyer begann mit der Produktion von Fleckfieberimpfstoff nach dem von dem polnischen Biologen Rudolf Weigl ( ) Anfang der 1930er-Jahren entwickelten Verfahren, bei dem abgetötete Erreger verwendet wurden, die zuvor in Läusedärmen herangezüchtet worden waren. Zudem nahmen das Robert Koch-Institut sowie das Hamburger Tropeninstitut, das zusätzlich eine Fleckfieberforschungsstelle im Staatlichen Hygienischen Institut im besetzten Warschau errichtete, Arbeiten zur Gewinnung eines wirksamen Impfstoffes auf Massenbasis auf. Weitere Fleckfieberarbeiten wurden vereinzelt auch an Universitäten durchgeführt, unter anderem ab 1942 an der Universität Göttingen durch Otto Westphal (vgl. unten). Mit der weiteren Expansion nach Osten nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 geriet das Fleckfieber aus deutscher Sicht zu einem immer dringlicheren Problem. Angesichts des ständig steigenden Bedarfs von zivilen und militärischen Stellen herrschte Beschreibung der Herstellung von Fleckfieberimpfstoff aus infizierten Läusen, abgedruckt in der Dokumentation der Reden und wissenschaftlichen Vorträge anlässlich der Eröffnung der Fleckfieber-Forschungsstätte am 10./11. Dezember 1942 in Lemberg eine erhebliche Knappheit an Fleckfieberimpfstoff vor. Über die Wirksamkeit der angewandten Herstellungsverfahren lagen mit Ausnahme des Weigl-Impfstoffes keine Erfahrungen im praktischen Einsatz vor. 117 In dieser Situation kam es am 29. Dezember 1941 zu zwei folgenschweren Sitzungen in Berlin, bei denen unter anderem der Beschluss gefasst wurde, die Fleckfieberimpfstoffe des Robert Koch-Instituts, des Instituts des OKH und der Behringwerke auf ihre Wirksamkeit im Menschenversuch zu überprüfen. Darüber hinaus wurde die umgehende Errichtung einer neuen, von den Behringwerken betriebenen Herstellungsstätte von Weigl-Impfstoff in Lemberg beschlossen, dessen Aufbau der Mitarbeiter am Institut für experimentelle Therapie Emil von Behring«, Richard Haas, übernehmen sollte. 118 Im KZ Buchenwald wurde daraufhin eine Versuchsabteilung der Waffen SS eingerichtet und im Januar 1942 mit der ersten Versuchsreihe begonnen. 116 Vgl. hierzu Richard Otto/ R. Wohlrab: Über die Auswertung von Rickettsia mooseri-impfstoffen im Mäuseversuch, in: Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten 122 (1939/1940), S ; Richard Otto/R Bickhardt: Über das Gift der Fleckfieberricketsien, in: Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten 123 (1941), S Hermann Eyer/Z. Przybylkiewicz/H. Dillenberg: Das Fleckfieber bei Schutzgeimpften, in: Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten 122 (1940), S Werther, Fleckfieberforschung, S. 195 ff. 108 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 109
59 Seitens des Robert Koch-Instituts waren vor allem der Präsident Eugen Gildemeister ( ) sowie im weiteren Verlauf auch der Vizepräsident Gerhard Rose ( ) in diese tödlichen Humanexperimente involviert, seitens der Behringwerke insbesondere der Leiter der Produktion, Albert Demnitz ( ), aber auch Richard Haas als Leiter des Lem berger Fleckfieberinstituts. 119 Bereits vor dessen offizieller Eröffnung am 10/11. Dezember 1942 in Anwesenheit des Generalgouverneurs Hans Frank ( ) 120 übersandte Haas Impfstoffe zu Prüfzwecken sowie Läuse und Läusekäfige an das KZ Buchenwald. 121 Wie viele andere NS-belastete Wissenschaftler konnte er jedoch seine Karriere in der späteren Bundesrepublik fortsetzen. 122 Ein 1960 unter anderem gegen Richard Haas, Hermann Eyer und Heinrich Ruge ( ) eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde 1961 mit der Begründung eingestellt, dass sich über das tatsächliche Zustandekommen der Menschenversuche»heute nach 19 Jahren kein eindeutiges Bild mehr gewinnen«ließe. 123 Die Fleckfieberversuche zählen zu den am besten erforschten Humanexperimenten, an denen sich Immunitätsforscher im Dienste des NS-Regimes beteiligten. Ähnliches gilt für die Malariaversuche der Tropenmediziner Gerhard Rose und Claus Schilling ( ). 124 Letzterer führte seine Versuche zur aktiven Malaria-Immunisierung ab 1942 im KZ Dachau durch. Dabei infizierte er mutmaßlich etwa Menschen mit Malaria, von denen 300 bis 400 an den Folgen der Versuche starben. 125 Der Medizinhistoriker Paul Weindling beziffert die Zahl der bestätigten und unbestätigten Opfer von nationalsozialistischen Menschenversuchen und Zwangsforschung auf insgesamt (Stand seiner Recherchen: August 2016). 126 I.G. Farbenindustrie AG Behringwerke an den Lagerarzt des KZ Buchenwald, Waldemar Hoven, betr. Übersendung von Fleckfieberimpfstoff für Versuche, Vgl. hierzu insbesondere Werther, Fleckfieberforschung; Ulrich Schneider Harry Stein: IG-Farben, Abt. Behringwerke Marburg KZ Buchenwald. Menschenversuche. Ein dokumentarischer Bericht, Kassel 1986 (künftig zit.: Schneider/Stein, IG-Farben); Ernst Klee: Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer, 2. Aufl., Frankfurt a. Main 2002 (künftig zit.: Klee, Auschwitz). 120 Vgl. Heinrich Teitge (Hrsg.): Behring-Institut Lemberg. Reden und wissenschaftliche Vorträge anlässlich der Eröffnung der Fleckfieber-Forschungsstätte Lemberg, den 10. und 11. Dezember 1942, Krakau Werther, Fleckfieberforschung, S. 201; Schneider/Stein: IG Farben, S. 45 f.; Klee, Auschwitz, S. 295 ff. 122 Im April 1945 war Richard Haas wegen seiner SS-Zugehörigkeit (ab 1943) interniert worden. Nach seiner Einstufung als»mitläufer«wurde er Ende 1946 entlassen übernahm er die Leitung der humanmedizinischen Forschung der Behringwerke erhielt einen Ruf auf den Lehrstuhl für Hygiene an die Universität Freiburg. vgl. Klee, Auschwitz, S. 342; Die Marburger Medizinische Fakultät im»dritten Reich«, S. 645 f. 123 Zit. nach Werther, Fleckfieberforschung, S Vgl. grundlegend Hana Vondra: Malariaexperimente in Konzentrationslagern und Heilanstalten während des Nationalsozialismus, Diss. med. Hannover Vgl. Hinz-Wessels, RKI im NS, S Paul Weindling:»Ressourcen für humanmedizinische Zwangsforschung , in: Sören Flachowsky/Rüdiger Hachtmann/Florian Schmaltz (Hrsg.): Ressourcenmobilisierung. Wissenschaftspolitik und Forschungspraxis im NS-Herrschaftssystem, Göttingen 2016, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 111
60 Immunchemie Der Leiter des Behring- Instituts in Lemberg, Richard Haas, und der Generalgouverneur Reichsminister Hans Frank anlässlich der Einweihung des Fleckfieberinstituts am 11./ Die Immunchemie beschäftigt sich mit den stofflichen Grundlagen und biochemischen Vorgängen der Immunität. 127 Der Begriff Immunchemie oder Immunochemie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem schwedischen Nobelpreisträger für Chemie, Svante August Arrhenius ( ), eingeführt. 128 Ihre Grundlagen als moderne Naturwissenschaft wurden wesentlich in den 1920er und 1930er-Jahren am Rockefeller-Institut in New York durch Karl Landsteiner, Oswald T. Avery, Walther F. Goebel und Michael Heidelberger gelegt. Mit ihren Forschungen wiesen sie erstmals die stoffliche Existenz von Antigenen und Antikörpern nach, die bisher nur als hypothetische Begriffe zur Erklärung experimentell beobachteter Immunphänomene existierten. Durch die Synthese zahlreicher sogenannter künstlicher, chemospezifischer Antigene konnte Karl Landsteiner wesentliche Grundbedingungen der Antigenität und der antigenen Spezifität klären. 129 Oswald T. Avery und Walther F. Goebel gelang die Herstellung hochgereinigter Pneumokokken-Typ III-Antigene sowie der Nachweis, dass das jeweilige Kapselmaterial die serologischen Unterschiede der verschiedenen Pneumokokkentypen bedingt. Ferner konnten sie mit der Identifizierung der determinanten Gruppe des Pneumococcen-Typ- III-Polysaccharids als Cellobiuronsäure und dem Aufbau eines künstlichen Antigens mit 127 Westphal, Immunchemie, S Svante August Arrhenius: Immunochemie, in: L. Asher und K. Spiro (Hrsg.): Ergebnisse der Physiologie 7, Wiesbaden 1908, S Vgl. Otto Westphal: Über die Grundlagen und künftigen Aufgaben des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie, in: Mitteilungen aus der MPG, Jg. 1963, H. 6, S (künftig zit.: Westphal, Über die Grundlagen). hoher Impfstoffwirkung gegen virulente Typ-III-Pneumokokken den praktischen Nutzen immunchemischer Arbeiten demonstrieren. Michael Heidelberger gelang erstmals durch Dissoziationen von Antigen-Antikörper-Komplexen die Darstellung hochgereinigter Antikörper und der Nachweis ihrer Proteinnatur. In Europa waren es vor allem André Boivin ( ) am Pasteur-Institut in Paris und Walter Morgan ( ) am Lister-Institut in London, die mit ihren Arbeiten über die O-Antigene der Typhusund Ruhrerreger wichtige immunchemische Kenntnisse beisteuerten. Die Einführung der modernen Immunchemie in Deutschland geht wie Otto Westphal rückblickend 1963 analysierte auf den Professor für Chemie an der Universität Heidelberg und»führenden Stereochemiker«in Deutschland, Karl Freudenberg ( ) zurück, der Karl Landsteiners Blutgruppenarbeiten sehr bewunderte und diesen 1931 während einer Gastprofessur in den USA persönlich kennengelernt hatte. 130 Unter dem Eindruck dieser Forschungen nahm Freudenberg in den 1930er-Jahren in Heidelberg eigene Arbeiten über die Chemie der Blutgruppensubstanzen auf. Zu seinen Mitarbeitern zählte unter anderem Otto Westphal, der die deutsche Immunologie in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich prägen sollte. Die von Freudenberg und Westphal angefertigten Arbeiten fanden auch internationale Beachtung. 131 Otto Westphal ( ) war seit Oktober 1936 als Assistent am Chemischen Institut der Universität Heidelberg beschäftigt und promovierte hier 1937 mit einer Arbeit»Über die gruppenspezifische Substanz A (Untersuchungen über die Blutgruppe A des Menschen)«. Im selben Jahr trat er nach Aufhebung der Mitgliedersperre in die NSDAP ein, nachdem er bereits im November 1933 im Alter von 20 Jahren als Student in Berlin Mitglied der SS geworden war. 132 Von April 1938 bis Mai 1941 arbeitete er als Assistent in dem von Richard Kuhn geleiteten Institut für Chemie am Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Wenige Monate nach seinem 130 Karl J. Freudenberg, Rückblicke auf ein langes Leben. Lebenserinnerungen des Chemikers Karl Johann Freudenberg , Heidelberg 1999, S Karl Freudenberg/Otto Westphal/Ph. Groenewoud: Über die gruppenspezifische A-Substanz in Menschenharn und tierischem Gewebe, in: Naturwissenschaften 24 (1936), S. 522; Karl Freudenberg/Otto Westphal: Über die gruppenspezifische Substanz A (Untersuchungen über die Blutgruppe A des Menschen) (= Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, 1938, 1. Abhandlung), Heidelberg Karl Landsteiner/ R. A. Harte: On Group Specific A Substances. The Substance from Hog Stomach, in: Journal of Experimental Medicine 71 (1940), S Laut Mitgliedskartei (Mitgliedsnummer ) beantragte er die Aufnahme am , die rückwirkend zum genehmigt wurde, Bundesarchiv (BArch), NSDAP-Mitgliederkartei, Gaukartei. Angaben zu SS-Zugehörigkeit (SS-Nr ) aus: Barch R 9361/III Nr Darüber hinaus war er Mitglied im NS Bund Deutscher Technik (Angabe aus Universitätsarchiv Göttingen, Kur PA Otto Westphal). 112 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 113
61 Otto Westphal, Winter 1940/41 Institutseintritt war Westphal dem wissenschaftlichen Mitglied der Kaiser-Wilhelm- Gesellschaft, Hans Sachs, bei der Emigration behilflich. 133 Wissenschaftlich beteiligte sich Westphal bis August 1939 an der Vitamin B6-Synthese. 134 Mit Kriegsbeginn wurde er»mit heereswichtigen Aufgaben betraut«und»uk«(unabkömmlich) gestellt. 135 Am 27. Juni 1941 habilitierte sich Westphal in Heidelberg mit seinen Arbeiten über Hydrazin-Derivate. 136 Am 17. Februar 1942 erfolgte die Ernennung zum Dozenten mit der Lehrbefugnis für organische Chemie und Biochemie. 133 Aussage von Charlotte Sachs vom , in: Niedersächsisches Landesarchiv Hannover (NLH HA), 171 Hildesheim Nr ; Otto Westphal an Frank Moraw von , in: Frank Moraw: Die nationalsozialistische Diktatur ( ), in: Geschichte der Juden in Heidelberg, Heidelberg 1996, S , hier S. 513 f. 134 Richard Kuhn/Kurt Westphal/Gerhard Wendt/Otto Westphal: Synthese des Adermins, in: Die Naturwissenschaften 27 (1939), S Weitere gemeinsame Beiträge von Kuhn und Westphal: Über Invertseifen V; quartäre Salze von stellungsisomeren 0xy-chinolinäthern, in: Ber. dtsch. chem. Ges. 73 (1940), S ff.; dies.: Über Invertseifen VI: Triazoliumsalze, in: Ber. dtsch, chem. Ges. 73 (1940), S ff. Nach dem Krieg tauchte der Verdacht auf, dass Menschenversuche mit Invertseifen durchgeführt worden seien, wofür es jedoch keine Belege gibt. Vgl. Florian Schmaltz: Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus. Zur Kooperation von Kaiser-Wilhelm-Instituten, Militär und Industrie Göttingen 2005, S. 573 (künftig zit.: Schmaltz, Kampfstoff-Forschung). Ich danke Florian Schmaltz für diesen und weitere Hinweise. 135 Lebenslauf Otto Westphal vom , in: BArch R 9361/III Nr Lebenslauf Otto Westphal vom , in: Universitätsarchiv Göttingen, Kur PA Otto Westphal. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Forschungen von Kuhn und seinen Mitarbeitern über Invertseifen, die unter anderem als Desinfektions-, Konservierungs-, Emulgier- und Waschmittel Einsatz fanden. Vgl. Otto Westphal/Dietrich Jerchel: Invertseifen, in: Kolloid-Zeitschrift 101 (1942), S An der Arbeit der im Januar 1941 eingerichteten Kampfstoffabteilung des KWI für medizinische Forschung, in der Giftgasforschung betrieben wurde, war Otto Westphal offensichtlich nicht beteiligt, vgl. Schmaltz, Kampfstoff-Forschung, S. 423 ff. 136 Ernst Th. Rietschel: Nachruf auf Otto Westphal ( ), in: immunologische nachrichten 2/2004 Nr. 141, S. 3 7 (künftig zit.: Rietschel, Nachruf Otto Westphal). Zu Ostern 1941 hatte Westphal die Berufung zum etatmäßigen Assistenten und Leiter der Biochemischen Abteilung am Allgemeinen Chemischen Universitätslaboratorium Göttingen erhalten. Hier führte er mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und weiterer staatlicher Einrichtungen insbesondere Untersuchungen zur Aufklärung der Struktur menschlicher Blutgruppen und über das Proteus X 19-Bakterium durch. Seine Forschungsanträge wurden aufgrund der positiven Gutachten seines ehemaligen Vorgesetzten Richard Kuhn, der als Leiter der Fachgliederung»Organische Chemie«im Reichsforschungsrat zugleich die Genehmigung der Sachbeihilfe verantwortete, regelmäßig als»kriegswichtig«bewilligt. 137 Ziel seiner Blutgruppen- Untersuchungen, an denen sich auch Ernst Krah (Serodiagnostische Abteilung des Instituts für Experimentelle Krebsforschung in Heidelberg) beteiligte, war der Aufbau eines künstlichen Vollantigens der menschlichen Blutgruppe A. Dies gelang durch die Kupplung von hoch gereinigter A-Substanz, einem Kohlenhydrathapten, an Eiweiß unter Verwendung der von Landsteiner entwickelten Azomethode. Durch Immunisierungen von Kaninchen mit dem aufgebauten A-Vollantigen, die Westphal gemeinsam mit dem Leiter des Instituts für experimentelle Therapie»Emil Behring«in Marburg, Hans Schmidt, durchführte, konnten hochwirksame,»künstliche«anti-a-seren gewonnen werden. 138 Darüber hinaus nahm Westphal gemeinsam mit dem Leiter des Blutgruppenlaboratoriums am Reichsgesundheitsamt, Peter Dahr ( ), 139 ein damals brandaktuelles Thema der Blutgruppenforschung in Angriff: Nach der Entdeckung des Rhesus-Faktors Ende der 1930er-Jahre durch Karl Landsteiner und Alexander Wiener hatte Landsteiners früherer Assistent Philip Levine ( ) den Zusammenhang zwischen dem Rhesus-Faktor und der gefürchteten Neugeborenen-Erythroblastose erkannt. 140 Dahr korrespondierte seit 1937 mit Karl Landsteiner und hatte von diesem im August 1941 eine noch nicht veröffentlichte Anleitung zur Herstellung von Anti-Rh-Serum erhalten. 141 Mit 137 Wissenschaftliches Gutachten von Richard Kuhn, , in: BArch R 73 Nr Otto Westphal/Elisabeth Reiche/Ernst Krah: Aufbau eines künstlichen Vollantigens der menschlichen Blutgruppe A, in: Naturwissenschaften 32 (1944), S Peter Dahr: Meine Lebenserinnerungen (»Blut ist ein ganz besonderer Saft«, Goethe: Faust I), Bensberg 1980, S. 59, 66f (künftig zit.: Dahr, Lebenserinnerungen); Dahr führte darüber hinaus serologische Blutanalysen für Westphal durch, versorgte ihn mit Blutproben und bildete seine Mitarbeiter in der»blutgruppentechnik«aus, vgl. Dahr, Lebenserinnerungen. S. 59; Westphal an DFG, , in: BArch R 73 Nr Vgl. u. a. Philip Levine/Rufus E. Stetson: An Unusual Case of Intra-group Agglutination, in: JAMA 113 (1939), S ; Philipp Levine/P. Vogel/E.M.Katzin/L. Burnham: Pathogenesis of erythroblastosis fetalis: statistical evidence, in: Science 94 (1941), S Dahr, Lebenserinnerungen, S. 194 ff. Karl Landsteiner/Alexander S. Wiener: Studies on an agglutinogen (Rh) in human blood reacting with anti-rhesus sera and with human human isoantibodies, in: Journal of Experimental Medicine 74 (1941), S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 115
62 Landsteiners Angaben konnte Dahr tatsächlich ein Anti-Rh-Serum durch die Immunisierung von Meerschweinchen mit Rhesusaffen-Blutkörperchen gewinnen. Über dieses Verfahren sowie erste Untersuchungen über Häufigkeit und Erblichkeit des Rh-Faktors anhand von 700 Blutproben berichtete Dahr bereits 1942 nach eigenen Angaben als erster außerhalb den USA in einer deutschen Fachzeitschrift. 142 Im März 1945 informierte Otto Westphal die DFG über gemeinsame Rh-Arbeiten mit Dahr, die»bereits zu ersten Anreicherungen dieses Faktors aus menschlichem Rh- Blutkörperchen geführt«hätten, und ergänzte seine Ausführungen mit dem Hinweis:»Es erscheint möglich, mit geeigneten, gereinigten Rh-Präparaten die meist tödlich verlaufenden Neugeborenen-Erythroblastosen zu heilen.«143 Welche Forschungsansätze Westphal und Dahr damals verfolgten, wurde erst 1949 deutlich, als Dahr während der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in der Diskussion über die Erythroblastose-Prophylaxe auf die Möglichkeiten einer Desensibilisierung mit einem Rh- Hapten hinwies:»wir haben mit der Gewinnung eines Rh-Haptens aus Rh-positivem Blut schon 1944 in Zusammenarbeit mit Westphal begonnen. Diese Versuche wurden aber aus grundsätzlichen Erwägungen heraus aufgegeben, und zwar deshalb, weil damit zu rechnen ist, daß eine Substanz, die sich einer bestimmten Personen gegenüber als nicht antigen erwiesen hat, einem anderen Organismus gegenüber antigene Wirkung aufweisen kann.«144 Ab 1942 erhielt Westphal zudem Fördermittel der DFG für Forschungen über das zur Fleckfieber-Diagnose (Weil-Felix-Reaktion) genutzte Proteus X 19-Bakterium. Mit dem Fernziel eines einsatzfähigen Fleckfieberimpfstoffes plante Westphal zunächst, das Antigen aus Proteus X 19 zu isolieren und hoch zu reinigen. Anschließend sollte es auf seine Bausteine analysiert und sein immunologisches Verhalten studiert werden. Er orientierte er sich dabei an den Arbeiten von Lydia Mesrobeanu ( ) und Alexandru Ciucă ( ), die in den 1930er-Jahren das für die Weil-Felix-Reaktion verantwortliche Vollantigen durch Extraktion mit Trichloressigsäure isolieren konnten, sowie an der von Maximiliano Ruiz Castaneda 1935 gemachten Entdeckung, dass die 142 Dahr, Lebenserinnerungen, S. 96; ders.: Untersuchungen über eine neue erbliche agglutinable Blutkörpercheneigenschaft beim Menschen, in: DMW 68 (1942), S Weitere Publikationen Peter Dahr: Die bisherigen Untersuchungen über die Vererbung der neuen agglutinablen Blutkörperchenmerkmal»Rh«, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 102 (1943), S ; ders./h. Knüppel: Einige Erfahrungen bei der Gewinnung von Testserum für das erbliche Blutkörperchenmerkmal»Rh«, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 105 (1945), S Westphal an DFG vom , in: BArch R 73 Nr Peter Dahr, in: Aussprache zum IV. Hauptbericht und zu den Vorträgen auf der 27. Tagung der der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie Karlsruhe, April 1949, in: Archiv für Gynäkologie 178 (1950), S Richard Kuhns Gutachten zu den geplanten Fleckfieber-Arbeiten von Otto Westphal, Kohlenhydrathaptene des Proteus X 19 Bakteriums für die immunologische Verwandtschaft verantwortlich waren und sich mittels Aufschluss mit Antiformin gewinnen ließen. Tatsächlich gelang es Westphal und seinen Mitarbeitern, das für die Weil-Felix- Reaktion verantwortliche Vollantigen zu isolieren. Diese Versuche führten nicht nur zur Entwicklung eines neuen Isolierungsverfahren, sondern durch einen zufälligen Arbeitsunfall auch zu neuen Erkenntnissen über das fiebererzeugende Prinzip von Proteus- Bakterien, die wegweisend für Westphals wissenschaftliche Karriere nach 1945 werden sollten. 145 Seine weiteren Fleckfieberversuche zielten darauf, durch Kupplung des spezifischen Proteus-Kohlenhydrats an Eiweiß künstliche Antigene zu synthetisieren, die die Bildung von Antikörpern gegen Fleckfieber auslösten Rietschel, Nachruf Otto Westphal, S Vortrag»Die Bedeutung des O-Antigens von Bac. Proteus X 19 für das Fleckfieberproblem«. Bericht über die Vorträge der Göttinger Chemischen Gesellschaft am , in: Die Chemie 56 (1943), S , hier S. 220; Vortrag»Die Struktur der Antigene«im Verein Deutscher Chemiker, Münchner Vortragsveranstaltung 15. und 16. Oktober 1943, in: Die Chemie 56 (1943), S , hier S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 117
63 Auch Westphals Fleckfieberarbeiten wurden von Richard Kuhn umgehend als»kriegswichtig«begutachtet und genehmigt. Weitere Fördermittel stammten von der Heeres-Sanitätsinspektion in Verbindung mit dem Reichsamt für Wirtschaftsausbau. Letzteres ließ Westphals Forschungen im Mai 1943 durch die Heeres-Sanitätsinspektion für kriegswichtig und»u.u. kriegsentscheidend«erklären und übernahm im Frühjahr 1944 ihre vollständige Finanzierung. 147 Zwar hatte Westphal gegenüber der DFG eine Zusammenarbeit mit den Behringwerken in Aussicht gestellt,»welche bereit sind, gegebenenfalls größere Immunisierungsversuche durchzuführen«, 148 es liegen jedoch keinerlei Hinweise für ihre Realisierung vor. Trotzdem ist Otto Westphal durchaus Teil des sehr weitgefassten Fleckfieber-Netzwerkes, in dessen Rahmen der Austausch verschiedener Erregerstämme, aber auch die tödlichen Impfversuche mit KZ-Insassen stattfinden. Westphal bezog seine Proteus X 19-Stämme unter anderem durch Vermittlung des Flottenarztes Heinrich Ruge vom Bukarester Bakteriologischen Institut. 149 Derselbe Heinrich Ruge hatte auch die Vermittlung des im Bukarester Institut entwickelten Fleckfieberimpfstoffs aus Mäuse- und Hundelungen an Gerhard Rose übernommen, der diesen im KZ Buchenwald an Menschen testen ließ. 150 Ferner übersandte Westphal zur Prüfung des serologischen Verhaltens Fleckfieberserum an das Fleckfieber-Institut in Krakau (Hermann Eyer) und stand mit Hans Schmidt und Richard Haas in Kontakt. 151 Weitere Arbeiten im Bereich Immunchemie Neben den hier dokumentierten Arbeiten Otto Westphals zeigen auch andere immunchemische Untersuchungen und theoretische Überlegungen über Antigene und Antikörper, dass sich deutsche Forscher in den 1930er-Jahren und während des Zweiten Weltkrieges am internationalen Forschungsstand orientierten. Vor allem die Pionierarbeiten Karl Landsteiners über künstliche, chemospezifische Antigene, die durch die Einführung von chemisch definierten Gruppen in natürliche Proteinantigene entstanden, und die Entdeckung, dass durch die Immunisierung mit diesen Antigenen neue und andere, spezifisch auf die eingeführten Gruppen abgestimmte Antikörper entstanden, stießen bei deutschen Forschern auf Interesse. Angeregt von den Arbeiten Landsteiners über künstliche Antigene arbeitete Hans Lettré als Leiter der Chemischen Abteilung des Allgemeinen Instituts gegen die Geschwulstkrankheiten im Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin mit Unterstützung der DFG an einer neuen Methode zur Darstellung chemisch markierter Antigene. Im Gegensatz zu dem klassischen, weitgehend von Landsteiner entwickelten Verfahren, bei denen Proteine mit Diazoverbindungen gekuppelt werden, verwendete Lettré gemeinsam mit seinen Mitarbeitern für den Aufbau künstlicher Antigene substituierte Oxazolone. 152 In einem zweiten Schritt konnte Lettré mit seinen Mitarbeitern zeigen, dass sich die Oxazolonmethode zur Kupplung vielkerniger aromatischer Ringsysteme wie bspw. cancerogenen Kohlenwasserstoffen an Proteine eignete. 153 Ausgangspunkt von Lettrés Untersuchungen war die Frage,»ob Proteine, die cancerogene Stoffe enthalten, durch ihren Antigencharakter die Bildung von Antikörpern veranlassen, die sich nicht nur gegen das Antigen (Protein + cancerogener Stoff) richten, sondern auch gegen den cancerogenen Stoff selbst.«lettré setzte seine Arbeiten auch nach ersten Ergebnissen mit Unterstützung der DFG fort. Als er zum Professor für Chemie an die Universität Göttingen berufen wurde, trat Richard Kuhn im Oktober 1942 als Leiter der Fachsparte Organische Chemie im Reichsforschungsrat vehement für eine Verlängerung seiner uk- Stellung ein. Kuhn bezeichnete Lettrés Arbeiten am Krebsproblem mit chemisch markierten Antigenen als kriegswichtig und behauptete kühn:»in USA wird dieses Problem sehr eifrig bearbeitet und es sind dort auch schon verschiedene Vorschläge für den Einsatz krebserregender Substanzen im Kriege gemacht worden.«154 Eine Theorie der Antikörperbindung entwickelte der wegen seiner Haltung zum NS- Regime umstrittene Physiker Pascual Jordan ( ), der als einer der Begründer der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie über internationales Ansehen verfügte. Ausgangspunkt von Jordans Überlegungen war die Feststellung, dass die von Ehrlich vertretene Auffassung, wonach»die nach Einspritzung von Antigenen auftretenden Antikörper schon unabhängig von der Antigenzufuhr im Organismus vorhanden seien«, angesichts der zahllosen künstlich hergestellten Komplexantigene als widerlegt an- 147 Westphal an DFG, , in: BArch R 73 Nr Westphal an DFG, , ebd. 149 Ebd. 150 Werther, Fleckfieberforschung, S. 116 f. 151 Otto Westphal/Dorothea von Gontard/Fritz Bister/Anneliese Winkler: Die immunchemische Beziehung von Bacterium proteus X 19 zu den Erregern des Fleckfiebers, in: Zeitschrift für Naturforschung 2b (1947), S , hier S. 27 Anm. 18, Hans Lettré/Richard Haas: Über chemisch markierte Antigene, I. Mitteilung: Eine neue Methode zur Darstellung chemisch markierter Antigene, in: Hoppe-Seyler s Zeitschrift für physiologische Chemie 266 (1940), S Hans Lettré/Karl Buchholtz/Marie-Elisabeth Fernholz: Über chemisch markierte Antigene. III. Mitteilung: Zur Einführung von vielkernigen Ringsystemen in Proteine, in: Hoppe-Seyler s Zeitschrift für physiologische Chemie 267 (1941), S Richard Kuhn an den Präsidenten des Reichsforschungsrates, , in: BArch 73 Nr WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 119
64 gesehen werden müsste:»für alle diese einen passenden, im allgemeinen hochgradig spezifischen Rezeptor als im Organismus bereits vorhanden anzusehen, ist offenbar unmöglich, vielmehr muß nach Einführung eines Antigens gebildete Antikörper im allgemeinen durchaus als eine Neubildung angesehen werden, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ.«155 Mit dieser Begründung hatten schon andere Wissenschaftler diesen Gedanken der Seitenkettentheorie abgelehnt. Auch der tschechische Biochemiker Felix Haurowitz ( ) an der Deutschen Universität Prag, der nach der Besetzung Prags durch die Wehrmacht zunächst nach Istanbul emigrierte und 1948 in die USA auswanderte, hatte 1937 in der Klinischen Wochenschrift unter Hinweis auf Landsteiners Untersuchungen erklärt:»man kann nicht gut annehmen, daß der Organismus präformierte Receptoren gegen Nitro-, Arsen- Sulfonsäuregruppen und andere Kunstprodukte des Laboratoriums enthält.«156 Diese Auffassung hatte Haurowitz bereits 1930 vertreten, als er die gemeinsam mit dem Hygieniker Friedrich Breinl ( ) entwickelte instruktive Theorie der Antikörperbildung in Hoppe Seyler Zeitschrift für Physiologische Chemie publizierte. Breinl und Haurowitz gingen aufgrund der weitgehenden Ähnlichkeit der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Antikörpers und des Serumglobulins von einer ähnlichen Entstehung beider Substanzen in den Zellen des Reticuloendothels aus. Sie vermuteten, dass»die Antigene schon in einem früheren Stadium des Globulinbildungsprozesses störend eingreifen, in jenem Stadium in dem die unspezifischen Bausteine (Aminosäuren, Peptide) zum spezifischen Globulinmolekül zusammentreten. Unter dem Einfluß des Antigens werden sich die Bausteine des Globulins in neuartiger Weise verknüpfen und an Stelle des normalen Globulins wird ein Globulin besonderen Baues, der Antikörper, entstehen.«157 Unabhängig von Haurowitz Vorstellungen, die breite Akzeptanz in der chemisch orientierten Immunologie finden sollten, 158 und angeregt von einer Bemerkung des Genetikers Timoféeff-Ressovsky,»wonach der erfahrungsgemäß bestehende Überschuß der gebildeten Antikörpermenge über die benutzte Antigenmenge vielleicht mit autokatalytischen Vorgängen zu tun haben könnte, wie wir sie bei der Vermehrung von Genen und 155 Zitate in: Pascual Jordan: Heuristische Theorie der Immunisierungs- und Anaphylaxie-Erscheinungen, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 97 (1940), S ; ders.: Über die Spezifität von Antikörpern, Fermenten, Viren, Genen, in: Die Naturwissenschaften 29 (1941), S Felix Haurowitz: Antigene, Antikörper und Immunität. Versuche mit chemisch markierten Antigenen, in: Klinische Wochenschrift 16 (1937), Friedrich Breinl/Felix Haurowitz: Chemische Untersuchung des Präzipitats aus Hämoglobin und Antihämoglobin-Serum und Bemerkungen über die Natur der Antikörper, in: Hoppe Seyler s Zeitschrift für Physiologische Chemie 192 (1930), S , hier S Silverstein, History of Immunology, S. 51 f. Viren vor uns haben«, entwickelte Pascual Jordan 1939 seine eigene Theorie. 159 Jordan ging von der Eiweißnatur der Antigene aus und betrachtete die autokatalytische Vermehrungsfähigkeit als Grundphänomen alles organischen Lebens, die er sich im Hinblick auf die Antikörperbildung als zweistufigen Vorgang vorstellte. Zunächst erfolgte unter Mitwirkung des Antigens bzw. seiner fermentativen Abbauprodukte durch Anlagerung geeigneter Eiweißstoffe - die Bildung nur weniger Antikörpermoleküle und in einem zweiten Schritt die autokatalytische Vermehrung dieser Antikörper, deren Gleichheit nach seiner Auffassung durch die Struktur des Eiweißes selbst gewährleistet war. Jordans Rückführung der Antikörperbildung auf einen autokatalytischen Vermehrungsvorgang fand sofort Widerspruch, allerdings nicht im Inland, sondern auf internationaler Ebene. Während der US-amerikanische Chemiker und spätere Nobelpreisträger für Chemie, Linus Pauling ( ), und der in die USA emigrierte Biophysiker Max Delbrück ( ) sie aufgrund theoretischer Überlegungen ablehnten, 160 führte Felix Haurowitz eigene Experimente durch, deren Ergebnisse der von Jordan aufgestellten Hypothese widersprachen. 161 Später wurde Jordans Theorie als interessante und auf die weitere Forschung anregend wirkende Theorie der Antikörperbildung gewertet, die jedoch auf Voraussetzungen aufbaute,»die den Tatsachen nicht gerecht werden«. 162 Forschungen über künstliche Antikörper 163 Linus Pauling hatte 1940 nicht nur Jordan widersprochen, sondern parallel eine eigene Hypothese veröffentlicht, die als»instruktive Theorie«der Antikörperbildung neben der zehn Jahre zuvor von Breinl und Haurowitz formulierten Theorie großen Einfluss auf die 159 Pascual Jordan: Zum Problem der spezifischen Immunität, in: Fundamenta Radiologica 5 (1939), S ; ders.: Heuristische Theorie der Immunisierungs- und Anaphylaxie-Erscheinungen, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung (1940), S ; ders.: Über die Spezifität von Antikörpern, Fermenten, Viren, Genen, Die Naturwissenschaften 29 (1941), S ; ders.: Zum Problem der Eiweiß-Autokatalysen, in: Die Naturwissenschaften 32 (1944), S Linus Pauling/Max Delbrück: The nature of the intermolecular Forces operative in Biological processes, in: Science 92 (1940), S Vgl. auch Silverstein, History of Immunology, S. 58 f. 161 Felix Haurowitz/Muzaffer Vardar/Paula Schwerin: The Specific Groups of Antibodies, in: Journal of Immunology 43 (1942), S Hans Schmidt: Fortschritte der Serologie, 2. vollständig umgearbeitete und bedeutend erweiterte Auflage, Darmstadt 1955, S Die folgende Darstellung beruht auf den Forschungen von Ute Deichmann sowie auf eigenen Recherchen, vgl. Ute Deichmann: Proteinforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten von 1930 bis 1950 im internationalen Vergleich (= Ergebnisse 21 des Forschungsprogramm»Geschichte der Kaiser-Wilhelm- Gesellschaft im Nationalsozialismus«), Berlin 2004, S. 23 ff. (künftig zit.: Deichmann, Proteinforschung). 120 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 121
65 Immunologie und die Molekularbiologie ausüben sollte. 164 Pauling verortete die Bildung von Antikörpern und normalen Serumglobulinen ebenfalls in den Zellen des reticuloendothelialen Systems. Er ging davon aus, dass Antikörper und normale Globuline über dieselben Polypeptidketten verfügen und sich voneinander nur durch die unterschiedliche Knäuelung dieser Ketten unterscheiden. Diese und die komplementäre Anpassung der Globulinoberfläche entstanden nach Paulings Auffassung unter dem Einfluss des in der Zelle anwesenden Antigens. Um seine Theorie experimentell zu belegen, unternahm Pauling mit Unterstützung der Rockefeller Foundation gemeinsam mit Dan Campbell und David Pressman verschiedene Versuche zur künstlichen Umwandlung von normalen Serumglobulinen in Antikörper. Im März 1942 informierte er die Öffentlichkeit über eine Pressemitteilung 165, dass es erstmals gelungen sei, im Labor künstliche Antikörper zu gewinnen. Eine kurze wissenschaftliche Beschreibung seiner Experimente, für die er unter anderem γ-globuline vom Rind und als Antigen Methylblau und Pneumokokken-Polysaccharid Typ III verwendet hatte, folgte Ende April 1942 in Science 166 und ein ausführlicher Beitrag Anfang August 1942 im Journal of Experimental Medicine. 167 Während Paulings Entdeckung in der US-amerikanischen Tagespresse angesichts ihrer prinzipiellen Bedeutung insbesondere für die klinische Praxis ausführlich rezipiert wurde, verhielt sich die Scientific Community zurückhaltend. Nur im Einzelfall wurde eine Reproduzierbarkeit der Versuche bestätigt, 168 während Nachprüfungen durch Karl Landsteiner, Felix Haurowitz und seine Mitarbeiterinnen sowie durch russische Forscher mit negativen Ergebnissen endeten. 169 Paulings Experimente wurden auch im Deutschen Reich wahrgenommen referierte der Berliner Pharmakologe Manfred Kiese ( ) den Inhalt der Science-Mitteilung im Chemischen Zentralblatt. 170 Pascual Jordan verwarf zwar Paulings 164 Linus Pauling: A Theory of the Structure and Process of Formation of Antibodies, in: Journal of the American Chemical Society 62 (1940), S Linus Pauling/Dan H. Campbell: The Production of Antibodies, in: Science 95 (1942), S Linus Pauling/Dan H. Campbell: The Manufacture of Antibodies in vitro, in: Journal of Experimental Medicine 76 (1942), S Donald K. Bacon: Preparation of synthetic immune serum and nature of immunity, in. Arch. Intern. Med. 72 (1943), S Vgl. hierzu Deichmann, Proteinforschung; Lily E. Kay: The Molecular Vision of Life, New York 1993, S ; Robert Doerr: Antikörper, Zweiter Teil (= Die Immunitätsforschung. Ergebnisse und Probleme in Einzeldarstellungen, Bd. IV), Wien 1949, S. 2 8, Felix Haurowitz/Paula Schwerin/Saide Tunç: The mutual precipitation of proteins and azoproteins, in: Archives of Biochemistry 11 (1946), S ; Chemisches Zentralblatt 1943 I, S theoretisches Konzept, dem er seine»grundsätzliche These der autokatalytischen Vermehrungsfähigkeit der in vivo gebildeten Antikörpern«entgegenstellte. Paulings»Darstellung von Antikörpern in vitro«hielt er allerdings für»eine bedeutungsvolle neue Methode«und»wertvolle Modellversuche«. 171 Otto Westphal würdigte die Leistungen der Immunchemie am Beispiel der Theorie Paulings und der kürzlich erbrachten eindrucksvollen Belege vor der Medizinischen Gesellschaft in Göttingen. 172 Tatsächlich blieb es seitens deutscher Wissenschaftler nicht bei Diskussionen oder Berichten über die Paulingschen Befunde nahm Adolf Butenandt ( ) am KWI für Biochemie eigene Untersuchungen zur Herstellung von künstlichen Antikörpern in Angriff, die als Forschungsauftrag»Eiweißstruktur und Antikörperdarstellung in vitro«die höchste Dringlichkeitsstufe DE und großzügige finanzielle Unterstützung erhielten. Im April 1944 bewilligte der Reichsforschungsrat RM für die Anschaffung eines Elektronenmikroskops. Laut Butenandt dienten die Untersuchungen der»förderung der Kenntnisse über die Feinstruktur von Eiweißstoffen, insbesondere von Viren und Antikörpern.«173 Zugleich verwies er darauf, dass sich daraus»grundsätzlich neue Wege zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Seuchen ergeben«würden. Die Durchführung der Experimente übernahmen Butenandts Mitarbeiter Hans Friedrich-Freksa ( ) und Gerhard Ruhenstroth-Bauer ( ). Dabei wurde»die amerikanische Mitteilung bestätigt, nach der aus normalen Serumglobulinen bei Verwendung von Methylblau als Antigen Antikörper in vitro dargestellt werden können.«zugleich gab Butenandt an, dass derzeit die»übertragung dieser Methode auf die Darstellung von Antikörpern, die gegen pathogen wirksame Proteine gerichtet sind«, bearbeitet würde. Die Wissenschaftshistorikerin Ute Deichmann geht davon aus, dass Butenandt unter pathogenen Proteinen mutmaßlich Viren verstand und dass das Ziel der Forschungen letztlich die Herstellung von Antiserum gegen bekannte und bisher unbekannte Krankheitserreger war. Auch dem Butenandt-Mitarbeiter Ulrich Westphal (1901?) gelang es im Winter 1944/45 angeblich, bei eigenen Versuchen zur Antikörperbildung in vitro, diese»in allen Versuchsproben leicht und spezifisch nach[zu]weisen«. 174 Nicht nur die Arbeitsgruppe um Butenandt sah sich aufgrund der Ergebnisse Paulings und Campbells zu eigenen Forschungen veranlasst. Auch Otto Westphal berichtete der DFG im Februar 1944 über ähnliche Experimente im Rahmen seiner Blutgruppen- 171 Pascual Jordan: Zum Problem der Eiweiß-Autokatalysen, Die Naturwissenschaften 32 (1944), S Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften, hier Medizinische Gesellschaft Göttingen, Sitzung vom 1. Juni 1943, in: Klinische Wochenschrift 23 (1944), S. 185 f. 173 Zit. nach Deichmann, Proteinforschung, S Ulrich Westphal an Butenandt vom , zit. nach Deichmann, Proteinforschung, S. 26 f. 122 WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 123
66 forschung:»gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. H. Schmidt (Behring-Institut in Marburg) haben wir an Hand hochgereinigter A-Präparate geprüft, ob die Darstellung von A-Antikörpern in vitro nach dem Verfahren von L. Pauling u. D.H. Campbell (1942) gelänge. Die Versuche sind noch im Gange, haben jedoch bisher negative Resultate ergeben.«175 Nach dem Zweiten Weltkrieg bestätigte Friedrich-Freksa unter Hinweis auf ein unveröffentlichtes, von ihm selbst und Ruhenstroth-Bauer erarbeitetes Manuskript die gelungene Reproduzierbarkeit der Paulingschen Versuche unter der Verwendung von γ-globulin vom Rind und Methylblau. 176 Zwar wurde das Manuskript später nicht mehr publiziert, es lag jedoch offensichtlich Hans Schmidt und Otto Westphal bei der Abfassung ihrer Übersicht über die immunchemischen Arbeiten in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges vor. 177 Sie gaben an, dass Friedrich-Freksa und Ruhenstroth-Bauer»die wichtigen Ergebnisse von Pauling und Campbell über die Gewinnung von Immunglobulinen aus Normalglobulinen in vitro [ ] bestätigen«konnten, und referierten die erfolgreiche Versuchsanordnung ausführlicher, als Friedrich-Freksa sie selbst zuvor publiziert hatte. Ihre eigenen, mit Blutgruppen A-Präparaten unternommenen Versuche verschwiegen sie dagegen. Nicht alle Butenandt-Mitarbeiter bestätigten nach 1945 ihre Äußerungen während des Krieges. Ulrich Westphal, der im Winter 1944/45 angeblich erfolgreiche Versuche zur künstlichen Antikörperherstellung durchgeführt hatte, vollzog eine 180-Grad-Wende berichtete er in der Zeitschrift für Naturforschung, dass in»eigenen, schon 1944 im Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem durchgeführten gleichartigen Versuchen mit γ-globulinen aus Pferdeserum [ ] in zahlreichen Ansätzen kein positives Resultat erhalten werden«konnte. 178 Zugleich zeigte er sich über die wenigen bisher veröffentlichten Bestätigungen überrascht, angesichts»der großen Bedeutung«, die man den Versuchen Paulings»vom biologischen, chemischen und praktisch-medizinischen Standpunkt zumessen«müsse. In diesem Zusammenhang wies Ulrich Westphal sowohl auf die positiven Resultate von Friedrich-Freksa und Ruhenstroth-Bauer als auch auf die erfolglose Nachprüfung durch russische Autoren hin und zog daraus den Schluss:»Man gewinnt den auch mit unseren eigenen Experimenten übereinstimmenden Eindruck, Hans Friedrich-Freksa, ca daß sich bis heute noch nicht mit Sicherheit Antikörper aus γ-globulinen erzeugen lassen; zum mindesten, daß man die Bedingungen noch nicht unter Kontrolle hat.«wie lassen sich die unterschiedlichen Aussagen der Butenandt-Mitarbeiter vor und nach 1945 deuten? Möglicherweise, so Ute Deichmann, verbanden diese mit der Bestätigung der Paulingschen Befunde während des Krieges die Hoffnung auf eine weitere Förderung und eine Verlängerung der uk-stellung. 179 In diesem Sinne ließe sich Ulrich Westphals Widerruf aus dem Jahr 1949 dahingehend interpretieren, dass diese Beweggründe nun fortgefallen und in der Zwischenzeit weitere erfolglose Nachprüfungen publiziert worden waren. Dies erklärt jedoch noch nicht, warum Friedrich-Freksa auch nach 1945 bei seinen früheren Aussagen blieb. Die Übersicht von Sachs und Westphal legt nahe, dass Friedrich-Freksa die Versuche Paulings tatsächlich hatte reproduzieren können. 175 Westphal an DFG, , in: BArch R 73 Nr Hans Friedrich-Freksa: Arbeiten von L. Pauling und Mitarbeitern über die Bildung von Antikörpern in vitro und über Haptene mit 2 und mehr Haftgruppen, in: Zeitschrift für Naturforschung 1 (1946), S Sachs/Westphal, Immunchemie, S. 96 ff. 178 Ulrich Westphal: Zur Frage der Antikörperbildung außerhalb tierischen Organismus, in: Zeitschrift für Naturforschung 4b (1949), S Deichmann, Proteinforschung, S WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS WEIMARER REPUBLIK UND N ATIONAL SOZIAL ISMUS 125
67
68 Entwicklung der Immunologie in der Bundesrepublik Deutschland ( ) 1 Annette Hinz-Wessels Im Folgenden soll vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus der Forschung in der deutschen Nachkriegsgeschichte aufgezeigt werden, wie sich die Immunologie als eigenes Fachgebiet nach dem verlorenen Weltkrieg und der Befreiung vom Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) etablierte. Welche Etappen der Institutionalisierung lassen sich in West- und Ostdeutschland erkennen? Welche Personen, Institutionen und welche wissenschaftlichen, gesellschaftlichen oder (forschungs)politischen Entwicklungen (Strukturen, Einflussnahmen) prägten und unterstützten den Neuaufbau einer immunologischen Forschungslandschaft in den beiden deutschen Nachkriegsstaaten? Welche Anstrengungen unternahm die deutsche Wissenschaft, um Anschluss an die internationale immunologische Forschung zu gewinnen, und welche Unterstützung und Förderung erhielten ihre Bemühungen? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen den vertriebenen und den in Deutschland verbliebenen Wissenschaftlern? Welche Stellung nahm die Immunologie in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit ein? Welche Forschungsbereiche standen beim Wiederaufbau im Vordergrund, und welche auch international beachteten Forschungsergebnisse konnten deutsche Immunologen in den ersten Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges erzielen? 1 Ich danke den Mitgliedern des Redaktionskomitees für die kritische Durchsicht des Manuskripts, wichtige Hinweise und geeignetes Bildmaterial. Mein besonderer Dank gilt Joachim Kalden, Hans-Hartmut Peter, Diethard Gemsa und Hans-Martin Jäck für ihre fachliche Unterstützung und wertvolle Ergänzungs- und Kürzungsvorschläge. Darüber hinaus möchte ich allen Archiven, Bibliotheken und Privatpersonen danken, die mich durch die Bereitstellung von Dokumenten, Fotografien und Informationen unterstützt haben. Besonders erwähnen möchte ich Frank Boblenz, Manfred Dietrich, Susanne Doetz, Dagmar Drüll-Zimmermann, Werner Fasolin, Sören Flachowsky, Klaus von Fleischbein, Nikolaus von Gayling-Westphal, Christian George, Mirjam Gerber, Kornelia Grundmann, Bernd Hoffmann, Ulrich Hunger, Karin Kaiser, Kristina Klatt, Eveline Klein, Fritz Melchers, Stefan Müller, Thomas Notthoff, Walter Pietrusziak, Ina Pichlmayr, Ernst Th. Rietschel, Erwin Rüde, Florian Schmaltz, Michael Schwarz, Kristina Starkloff, Bodo Teichmann, Susanne Uebele, Hedwig Wegmann, Christine Wolters und Sabrina Zinke. ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 127
69 Mit dem Zusammenbruch des NS-Regimes und der staatlichen Verwaltung übernahmen die alliierten Siegermächte die oberste Regierungsgewalt in Deutschland und teilten es in vier Besatzungszonen auf. Ihre Politik war in der Folgezeit zum einen auf den Aufbau neuer demokratischer Strukturen, zum anderen auf die Verhinderung einer deutschen Wiederaufrüstung gerichtet. Infolge alliierter Bombenangriffe und militärischer Kampfhandlungen zwischen Wehrmacht und alliierten Truppen waren Gebäude und Infrastruktur auf deutschem Boden weitgehend zerstört. Dies betraf auch viele Hochschulen 2 und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Trotzdem wurden die Universitäten im ehemaligen Deutschen Reich von allen alliierten Besatzungsmächten im Rahmen ihrer Demokratisierungs- und Umerziehungspolitik (»Reeducation«) bereits im Wintersemester 1945/46 wiedereröffnet. Weitaus stärker als der universitäre Unterricht war die wissenschaftliche Tätigkeit von den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der Nachkriegszeit und der alliierten Besatzungspolitik betroffen. Dies galt sowohl für die Hochschulen als auch für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie die bei Kriegsende zumeist in den Westen verlegten Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die zunächst drohende Auflösung der Gesellschaft konnte jedoch mit Unterstützung der britischen Besatzungsmacht abgewendet und ein Zusammenschluss der früheren Kaiser-Wilhelm-Institute zur»max-planck-gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.v.«erreicht werden. Als offizielles Gründungsdatum dieser Nachfolgeorganisation der früheren Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, an deren Spitze bis 1960 als Gründungspräsident der Physiker und Nobelpreisträger Otto Hahn ( ) stand, gilt der 26. Februar Die Forschungseinrichtungen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) litten insbesondere unter der Reparationspolitik der Sowjetunion, die als Wiedergutmachung auch wertvolle wissenschaftliche Geräte und Forschungsanlagen demontieren und abtransportieren ließ. Darüber hinaus zwangsrekrutierten die Siegermächte insbesondere die Sowjetunion und die USA zahlreiche deutsche Naturwissenschaftler, um sie als 2 Nur wenige Universitäten wie die in Heidelberg, Erlangen, Tübingen, Marburg und Göttingen hatten das Kriegsende weitgehend unbeschädigt überstanden, vgl. Gabriele Metzler, Internationale Wissenschaft und nationale Kultur. Deutsche Wissenschaftler in der internationalen Community , Göttingen 2000, S. 231; Wilhelm Krull: Grußwort anlässlich der Festveranstaltung, in: Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen/Universitätsbund Göttingen e.v. (Hrsg.):»Ein Vorsprung, der uns tief verpflichtet«. Die Wiedereröffnung der Universität Göttingen vor 70 Jahren, Göttingen 2016, S , hier S. 16, Kornelia Grundmann: Zusammenbruch und Neubeginn ein Ausblick, in: Aumüller, G./Grundmann, K./Krähwinkel, E./Lauer, Hans H./Remschmidt, H. (Hrsg.): Die Marburger Medizinische Fakultät im»dritten Reich«(Academia Marburgensis Band 8), München 2001, S , hier S. 652 f. 3 Reinhard Rürup: Einleitung, in: Peter Gruss/Reinhard Rürup (Hrsg.): Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten , Dresden 2010, S Senatssitzung der Max-Planck-Gesellschaft, , v. l. n. r.: Adolf Windaus, Otto Hahn, Friedrich Schmidt-Ott, Erich Regener, Adolf Butenandt, Richard Kuhn, Werner Heisenberg Arbeitskräfte in eigenen Forschungslaboratorien einzusetzen. Zu dieser Form von»intellektuellen Reparationen«zählte auch der Verlust von Patentschutzrechten (und von Lizenzgebühren) infolge des Londoner Abkommens vom 27. Juli Dieses von der Alliierten Reparationsstelle in Brüssel angestoßene Abkommen legte die unentgeltliche Zugänglichmachung aller ehemaligen deutschen Patente in den Unterzeichnerstaaten fest. 4 Zudem litt der Lehr- und Forschungsbetrieb unter der alliierten Entnazifizierungspolitik, da zahlreiche Hochschullehrer ihre Stellung zumindest zeitweise verloren. 5 Ein weiteres Hemmnis stellte die alliierte Gesetzgebung dar, die vor allem eine Wiederaufrüstung Deutschlands verhindern sollte. Zwar richtete sich die im April 1945 erlassene 4 Thomas Stamm: Zwischen Staat und Selbstverwaltung. Die deutsche Forschung im Wiederaufbau , Köln 1981, S. 48 f. (künftig zit.: Stamm, Staat und Selbstverwaltung). 5 Zur Entnazifizierungspolitik der alliierten Siegermächte, die sich auf die einzelnen Hochschulen ganz unterschiedlich auswirkte, liegt mittlerweile eine Vielzahl von Einzelstudien vor. Vgl. bspw. mit weiteren Literaturhinweisen: Barbara Wolbring: Trümmerfeld der bürgerlichen Welt. Universitäten in den gesellschaftlichen Reformdiskursen der westlichen Besatzungszonen, Göttingen ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 129
70 Direktive JCS 1067, die die Grundlage für die US-amerikanische Besatzungspolitik unmittelbar nach Kriegsende bildete, vor allem gegen den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Deutschlands, doch enthielt sie in diesem Zusammenhang auch weitreichende Verbote für die Forschung, sofern diese nicht lebensnotwendig für das Gesundheitswesen war. Das für alle Besatzungszonen geltende Kontrollratsgesetz Nr. 25 zur Regelung und Überwachung der naturwissenschaftlichen Forschung vom 29. April machte die Aufnahme des Forschungsbetriebs genehmigungspflichtig und forderte von den Instituten eine regelmäßige Berichterstattung. Ferner legte es den Umfang fest, in dem grundlegende und angewandte naturwissenschaftliche Forschung betrieben werden durfte, und verbot explizit bestimmte Forschungsbereiche wie bspw. die Kernphysik. Das Kontrollratsgesetz wurde in den einzelnen Zonen unterschiedlich restriktiv ausgelegt und blieb für das Gebiet der 1949 gegründeten Bundesrepublik in veränderter Form bis zum Erlöschen des Besatzungsstatuts am 5. Mai 1955 in Kraft. Die zumeist kriegsbeschädigten Forschungslaboratorien wurden zur Eindämmung der Seuchen auch im Interesse der Besatzungsmächte vordringlich für die Produktion von Impfstoffen genutzt. Insbesondere tierexperimentelle Untersuchungen waren in den Nachkriegsjahren nur schwer durchzuführen. 7 Zugleich trug der Einsatz in der Seuchenbekämpfung aber auch zur Existenzsicherung von Einrichtungen bei, deren Wiederaufbau und Weiterbestehen nach Kriegsende aufgrund der Auflösung der staatlichen Strukturen und aufgrund von Entnazifizierungsmaßnahmen der Siegermächte durchaus zunächst zweifelhaft war. Unabhängig von der unterschiedlichen Situation der einzelnen Einrichtungen lag das Hauptproblem in»der jahrelangen Absperrung von der ausländischen Forschung und der einseitigen Ausrichtung auf die Erfordernisse der Autarkie und des Krieges ohne Anschluss an die Weltforschung«. 8 Was die konkrete Nachkriegssituation der in der NS-Zeit auf dem Gebiet der Immunologie forschenden Institute in Deutschland anbelangt, so stellten die Entnazifizierungsmaßnahmen der Alliierten ihre Arbeitsfähigkeit nicht grundsätzlich in Frage, zumal der tief in die nationalsozialistischen Medizinverbrechen verstrickte Präsident des Robert Koch-Instituts, Eugen Gildemeister, im Mai 1945 verstarb. Der Vizepräsident und Leiter der Tropenabteilung, Gerhard Rose, wurde im August 1947 im Nürnberger /kr-gesetz25.htm. 7 Vgl. bspw. Richard Otto: Bericht über die Tätigkeit des Staatlichen Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. in der Zeit vom 1. Januar 1944 bis 31. Dezember 1946, Wiesbaden 1948, S. 13. Das RKI musste seine Versuchstiere dem sowjetischen Militär aushändigen, vgl. Hinz-Wessels, RKI im NS, S. 115 f. 8»Materialien zum Vortrag in der Sitzung des Forschungsrates«, erarbeitet im Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, , zit. nach Stamm, Staat und Selbstverwaltung, S. 41. Hans Schmidt, 1952 Ärzteprozess wegen seiner Beteiligung an den Fleckfieberversuchen im Konzentrationslager Buchenwald zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, kam jedoch 1955 bereits wieder frei. 9 Die Leiter des Instituts für experimentelle Therapie»Emil von Behring«in Marburg sowie der Staatlichen Anstalt für experimentelle Therapie in Frankfurt, Hans Schmidt und Richard Otto, durften auf ihren Posten verbleiben. Das 1942 zur selbständigen Reichsanstalt aufgewertete Robert Koch-Institut konnte seinen Betrieb unter dem Dach der Berliner Gesundheitsverwaltung fast umgehend wiederaufnehmen und wurde 1952 in das neu gegründete Bundesgesundheitsamt eingegliedert. Seine Aufgaben bestanden jedoch zunächst vor allem in der Versorgung der Bevölkerung mit Impfstoffen sowie der Gesundheitsaufklärung und Politikberatung. 10 Die wissenschaftlichen Arbeiten des Staatlichen Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt am Main, das im März 1944 zu zwei Dritteln zerstört worden war 11 und 9 Christine Wolters: Gerhard Rose:»Das bürgerliche Leben hat nun einmal viele Seiten.«Humanexperimente und Hohlglasbehälter aus Überzeugung, in: Frank Werner (Hrsg.), Schaumburger Nationalsozialisten: Täter, Komplizen, Profiteure, Bielefeld 2009, S Darüber hinaus wurde der frühere Leiter der Abteilung für Virusforschung am Robert Koch-Institut, Eugen Haagen, der 1941 an die Universität Straßburg berufen worden war, in Frankreich verurteilt, vgl. Christian Bonah/Florian Schmaltz: From Witness to Indictee: Eugen Haagen and his Court Hearings from the Nuremberg Medical Trial ( ) to the Struthof Medical Trials ( ), in: Paul Weindling (Hrsg.): From Clinic to Concentration Camp: Reassessing Nazi Medical and Racial Research, (The History of Medicine in Context), London/New York 2017, S Hinz-Wessels, RKI im NS, S. 115 ff. 11 Richard Prigge: Zum 100. Geburtstage Paul Ehrlichs und zum Wiederaufbau des Paul-Ehrlich-Instituts (= Arbeiten aus dem Paul-Ehrlich-Institut, dem Georg Speyer-Haus und dem Ferdinand Blum-Institut zu Frankfurt a. M., Heft 51), Stuttgart 1954, Vorwort (künftig zit.: Prigge, 100. Geburtstag Paul Ehrlichs). 130 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 131
71 teilweise nach Marburg verlagert werden musste, konnten durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse zunächst nur beschränkt fortgeführt werden. Im März 1947 anlässlich des 93. Geburtstages von Paul Ehrlich verlieh die Hessische Staatsregierung dem Institut offiziell auf Antrag seines Direktors Richard Otto den Namen»Paul-Ehrlich- Institut«(PEI). 12 Darüber hinaus erhielt das Biologische Institut, dessen Leitung der 1939 aus dem Amt vertriebene Ferdinand Blum nach dem Zweiten Weltkrieg wieder übernommen und bis 1949 ausgeübt hatte, 1950 den Namen Ferdinand-Blum-Institut für experimentelle Therapie. Bereits Ende 1949 wurde das Biologische Institut organisatorisch mit dem PEI bzw. dem Georg-Speyer-Haus verbunden, nachdem der Biologische Verein als Träger beschlossen hatte, die Institutsleitung dem jeweiligen Direktor des Georg-Speyer-Hauses zu übertragen. Fortan unterstanden die drei Institute einem einzigen Direktor. Als solcher fungierte seit 1949 Richard Prigge ( ), nachdem Richard Otto 1948 altersbedingt in den Ruhestand getreten war. 13 Seinen Erhalt als Forschungsinstitut verdankt das PEI seiner Übernahme in das Königsteiner Abkommen der Westdeutschen Finanz- und Kultusminister. 14 Das Institut für experimentelle Therapie»Emil von Behring«in Marburg, das nach Angaben eines früheren Mitarbeiters in der Nachkriegszeit eher den Status eines Privatlaboratoriums mit lediglich drei Assistenten besaß, 15 wurde mit dem altersbedingten Ausscheiden Hans Schmidts aus dem aktiven Dienst bei den Behringwerken 16 und der Übernahme der Behringwerke durch die Farbwerke Hoechst AG als eigenständiges Institut aufgelöst. Seine bisherigen Forschungsaufgaben übernahmen die Behringwerke. 17 Diese hatten den Zweiten Weltkrieg ohne Bombenschäden überstanden und waren 1945 von der US-amerikanischen Militärregierung beschlagnahmt worden. 18 Unter alliierter 12 Richard Otto: Bericht über die Tätigkeit , S. 17; Rudolf Siegert ( ), 50 Jahre»Paul- Ehrlich-Institut«zu Frankfurt a. M., in: (= Arbeiten aus dem Paul-Ehrlich-Institut, dem Georg Speyer- Haus und dem Ferdinand Blum-Institut zu Frankfurt a. M, Heft 48), Jena 1950, S , hier S. 17. Die Umbenennung ging offensichtlich auf die Initiative eines Enkels Paul Ehrlichs zurück (Günther K. Schwerin), der sich bei der Militärverwaltung und den zuständigen Regierungsstellen für die Namensänderung eingesetzt hatte, vgl Bericht über die Tätigkeit der Staatlichen Anstalt für experimentelle Therapie Paul-Ehrlich-Institut, des Chemotherapeutischen Forschungsinstituts Georg-Speyer-Haus und des Ferdinand-Blum-Instituts für experimentelle Biologie zu Frankfurt a. Main in der Zeit vom 1. Januar 1947 bis 31. Dezember 1951 (=Arbeiten aus dem Paul-Ehrlich-Institut, dem Georg-Speyer-Haus und dem Ferdinand-Blum-Institut zu Frankfurt a. M., Heft 50), Jena 1952, S Prigge, 100. Geburtstag Paul Ehrlichs, Vorwort. 15 Hanns Hippius: Nachkriegsdeutschland: Mein Weg in die Psychiatrie, in: Frank Schneider (Hrsg.): Irgendwie kommt es anders. Psychiater erzählen, Berlin, Heidelberg 2012, S , hier S Schmidt gehörte nach seinem Ausscheiden 1952 bis 1967 dem Aufsichtsrat der Behringwerke an. 17 Schriftliche Auskunft von Dr. Kornelia Grundmann, Emil-von-Behring-Archiv, Marburg vom Wolfram Döpp: Die Behringwerke in Marburg. Entwicklung und internationale Beziehungen, in: Alfred Kontrolle entwickelten und produzierten sie in der Nachkriegszeit vor allem verschiedene Virusimpfstoffe, unter anderem gegen Maul- und Klauenseuche. 19 Im Zuge der Entflechtung des früheren I.G.-Farbenkonzerns und der Neuorganisation seiner früheren Betriebe wurden die Behringwerke mit Wirkung vom 1. Januar 1952 von der Farbwerke Hoechst AG als Tochtergesellschaft übernommen. 20 Säckingen Wiege der westdeutschen Immunologie nach 1945 Die Keimzelle einer neuen immunologischen Forschungslandschaft in der Bundesrepublik bildete jedoch nicht eine der über viele Jahrzehnte tonangebenden Einrichtungen, sondern eine der Nachkriegsentwicklung geschuldete Institutsneugründung an der südwestdeutschen Peripherie durch ein prosperierendes Schweizer Nahrungsmittelunternehmen. Treibende Kraft bei der Neuformierung der immunologischen Forschung war Otto Westphal, der in der Nachkriegszeit von der Universitätsstadt Göttingen als Leiter dieses neugegründeten Instituts in die Kleinstadt Säckingen an der deutsch-schweizerischen Grenze wechselte und hier fast nahtlos an seine immunchemischen Arbeiten während des Krieges anknüpfen konnte. Als erste Hochschule hatte die kaum kriegsbeschädigte Universität Göttingen in der britischen Besatzungszone am 17. September 1945 den Vorlesungsbetrieb wieder aufgenommen. 21 Auch Otto Westphal war für den studentischen Unterricht eingeteilt. 22 Im Januar 1946 wurde er jedoch auf Befehl der britischen Militärregierung mit sofortiger Wirkung als politisch unerwünscht entlassen. 23 Umgehend bat er unter Vorbringung zahlreicher Entlastungsgründe um Überprüfung der Entscheidung. Wissen- Pletsch (Hrsg.): Marburg. Entwicklungen Strukturen Funktionen Vergleiche (= Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 32), Marburg 1990, S , hier S. 200 (künftig zit.: Döpp, Behringwerke)., S. 142 f. 19 Klaus Munk: Virologie in Deutschland. Die Entwicklung eines Fachgebietes, Basel et al. 1995, S. 142 f. (künftig zit.: Munk, Virologie). 20 Döpp, Behringwerke, S Geoffrey C. Bird: Wiedereröffnung der Universität Göttingen, in: Manfred Heinemann (Hrsg.): Umerziehung und Wiederaufbau. Die Bildungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich, Stuttgart 1981, S ; Bernd Weisbrod:»Ein Vorsprung, der uns tief verpflichtet«. Die Wiedereröffnung der Universität Göttingen im Wintersemester 1945/46, in: Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen/Universitätsbund Göttingen e.v. (Hrsg.):»Ein Vorsprung, der uns tief verpflichtet«. Die Wiedereröffnung der Universität Göttingen vor 70 Jahren, Göttingen 2016, S Georg-August-Universität Göttingen, Verzeichnis der Vorlesungen Winterhalbjahr 1945/46, S. 58 f. ( gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?pid=ppn _1945_1946_ws LOG_0005&physid= PHYS_0029). 23 Westphal an die brit. Militärregierung vom , in: Niedersächsisches Landesarchiv Hannover (NLH 132 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 133
72 schaftler wie der Physiker Werner Heisenberg oder der Theologe Helmut Thielecke, die Otto Westphal gegen nationalsozialistische Angriffe verteidigt hatten, sowie die Witwe des aus Deutschland vertriebenen Immunologen Hans Sachs äußerten sich positiv über sein früheres Verhalten. 24 Westphals Mitarbeiter Friedrich Bister, Otto Lüderitz, Botho Kickhöfen und Hans-Hermann Rüggeberg, die als sogenannte jüdische Mischlinge unter dem NS-Regime gelitten und zum Teil durch seinen Einsatz vor der Zwangsarbeit in der»organisation Todt«bewahrt worden waren, sowie zahlreiche Chemiestudenten setzten sich nachdrücklich für seinen Verbleib ein. Die eingereichten Schriftstücke fanden zunächst jedoch keine einheitliche Bewertung. 25 Während Otto Westphal Ende Oktober 1946 seinen Wohnsitz nach Schloß Ebnet bei Freiburg den Familiensitz seiner Ehefrau verlegte, zog sich das offizielle Entnazifizierungsverfahren weiter hin. Erst im März 1948 bescheinigte der Entnazifizierungshauptausschuss, dass Otto Westphal nach den Bestimmungen der Militärregierung entlastet sei. 26 Dieser hatte noch 1946 durch die Vermittlung des Chefredakteurs der Zeitschrift»Angewandte Chemie«, William Forst, das Angebot der Wander AG erhalten, in der Kleinstadt Säckingen an der deutsch-schweizerischen Grenze ein Forschungsinstitut aufzubauen. 27 Hier wollte das durch»ovomaltine«weltweit bekannte Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz Bern die Produktion des bisher von der Hoechst AG hergestellten Syphilis- HA), 171 Hildesheim Nr Hier auch sämtliche Entlastungschreiben, darunter die Abschrift seines Ende November 1938 eingereichten Austrittsgesuchs aus der SS, das nicht angenommen worden war. 24 Erklärung von Charlotte Sachs vom , in: NLH HA, 171 Hildesheim Nr Weitere Entlastungsschreiben stammten unter anderem von dem nach Großbritannien emigrierten Pädagogen Kurt Hahn, dem Heidelberger Historiker Fritz Ernst, dem Heidelberger Zoologen E. von Holst sowie dem Leiter des Instituts für experimentelle Therapie»Emil von Behring«, Hans Schmidt. 25 Während der Entnazifizierungsunterausschuss für den Lehrkörper der Universität mehrheitlich Westphal einstweilen keine Lehrtätigkeit gestatten wollte, stellte der Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Göttingen im Oktober 1946 weitere Ermittlungen anheim, und auch die Militärbehörde äußerte»keine Bedenken«hinsichtlich einer Wiedereinsetzung. 26 Endgültig abgeschlossen wurde das Verfahren erst im März 1949 mit der formellen Zustellung der Entscheidung des Entnazifizierungshauptausschusses des Kreises/der Stadt Göttingen, der Westphal für entlastet (Kategorie V) erklärte. Westphal hatte bereits im März 1948 um eine Kategorisierung gebeten, da von der Vorlage eines derartigen Schriftstückes»einige wichtige berufliche Angelegenheiten, vor allem meine Genehmigung als Universitätsdozent an der Univ. Freiburg [ ] abhängen.«westphal hatte ein Gesuch auf Umhabilitierung an die Universität Freiburg gestellt, das von der Fakultät einstimmig gebilligt und anschließend der französischen Militärregierung zur Entscheidung vorgelegt worden war, vgl. Gesuch der Dr. A. Wander GmbH Osthofen Zweigniederlassung Säckingen vom um Genehmigung zur Durchführung pharmazeutisch-diätetischer Arbeiten (Kopien dieses Schriftstücks sowie weiterer Dokumente stellte mir Werner Fasolin zur Verfügung. Die Originale befinden sich im Staatsarchiv Freiburg und werden hier als Material Werner Fasolin bezeichnet). 27 Otto Westphal (1993): Rede an seine Schüler und Mitarbeiter anläßlich eines Empfanges zu Ehren seines 80. Geburtstages versandt an alle Teilnehmer [Typoscript] (Material Werner Fasolin). Lebenslauf in Archiv der MPG, III. Abt./084/2 (Nachlass Adolf Butenandt), Nr Das Dr. Wander-Forschungsinstitut war ab 1947 im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Holzspulenfabrik Meyer in Säckingen untergebracht, Aufnahme aus den 1920er-Jahren Mittels Salvarsan aufnehmen, nachdem die Alliierten den Schutz aller deutschen Patente aufgehoben hatten. Stattdessen gelang es Westphal, die Verantwortlichen der Wander AG für die Unterstützung seiner Arbeiten über bakterielle Pyrogene zu gewinnen zählte das Institut bereits 22 Beschäftigte, darunter auch Botho Kickhöfen und Otto Lüderitz, die Otto Westphal nach Süddeutschland gefolgt waren. Während in der organischen Abteilung unter der Leitung des Chemikers Fritz Kröhnke ( ) Grundlagenforschung zu therapeutisch wirksamen Pyridin-Verbindungen betrieben wurde, arbeitete man in der von Otto Westphal geleiteten biochemischen Abteilung vor allem mittels eines eigens entwickelten Spezialverfahrens an der Gewinnung hochgereinigter Lipopolysaccharide gramnegativer Bakterien, die anschließend 28 Werner Fasolin: Säckingen Mekka der Pyrogenforschung. Das Dr. A.-Wander-Institut in Säckingen , in: Vom Jura zum Schwarzwald. Blätter für Heimatkunde und Heimatschutz 78 (2004), S , hier S. 68 (künftig zit.: Fasolin, Säckingen). 134 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 135
73 kommen waren, 31 unternahm Otto Westphal obwohl früheres SS-Mitglied im April 1962 eine zehntägige Israel-Reise, während der er nach eigenen Angaben wissenschaftliche Gespräche»mit vielen ausgezeichneten Kollegen in Rehovoth, Jerusalem und Haifa«führte. 32 Die Initiative zu diesem Besuch war anscheinend von Westphal selbst ausgegangen. 33 Er hatte sich zunächst schriftlich an den Bakteriologen Leo Olitzki ( ) an der Hebrew University in Jerusalem gewandt, der wiederum Kontakt zu dem Immunologen Michael Sela (*1924) am Weizmann-Institut in Rehovoth aufnahm. 34 Aus diesem ersten Israel-Aufenthalt Westphals, der auf Einladung der beiden israelischen Wissenschaftler stattfand, entwickelte sich umgehend eine intensive Zusammenarbeit zwischen Otto Westphal und seinen Mitarbeitern und der Abteilung Immunologie am Weizmann-Institut unter der Leitung von Michael Sela. 35 Bereits 1966/67 hielt sich Erwin Rüde für ein Jahr in Rehovoth auf. 36 Diese Kooperation, die sich nach Selas Angaben zu einer persönlichen Freundschaft zwischen ihm und Westphal entwickelte, bezeichnete die Wissenschaftshistorikerin Ute Deichmann jüngst als eine der beiden Säulen der frühen deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen, 37 wenngleich nicht alle Mitarbeiter des Weizmann-Instituts für die enge Verbindung zwischen Westphal und Sela Verständnis aufbrachten. 38 Otto Westphal und Otto Lüderitz, 1949 für den Einsatz in der Fiebertherapie pharmakologisch und klinisch getestet wurden. 29 Schon früh knüpfte das Forschungsinstitut Kontakte zu Wissenschaftlern in Freiburg (Elfriede Husemann, Ludwig Heilmeyer), in Göttingen (Theodor J. Bürgers), in Marburg (Hans Schmidt) sowie an den (noch) Kaiser-Wilhelm- bzw. Max-Planck-Instituten (Th. Wieland, Georg Schramm). Zwischen dem US-amerikanischen Immunchemiker Michael Heidelberger ( ) und Otto Westphal und seinen Mitarbeitern kam es zu einem engen wissenschaftlichen und freundschaftlichen Austausch. 30 Nachdem die deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen Ende 1959 durch den historischen Besuch einer Delegation der Max-Planck-Gesellschaft in Israel in Gang ge- 29 Dies geschah unter anderem mittels Tierversuchen in der Wander AG in Bern sowie durch Versuche an gesunden Personen insbes. an Studenten der Freiburger Universität, aber auch an Patienten der Heidelberger Hautklinik, vgl. Jahres-Übersicht 1949 des Wander Forschungsinstituts vom , in: Material Fasolin. 30 Michael Heidelberger: Reminiscenses. A»pure«organic chemist s downward path: 3. Retirement, in: Immunological Reviews Nr. 83, S Dietmar K. Nickel: Wolfgang Gentner und die Begründung der deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen, in: Dieter Hoffmann, Ulrich Schmidt-Rohr (Hrsg.), Wolfgang Gentner. Festschrift zum 100. Geburtstag, Berlin, Heidelberg 2006, S ; Steinhauser, Thomas/Gutfreund, Hanoch/Renn, Jürgen: A Special Relationship. Turning Points in the History of German-Israeli Scientific Cooperation (= Ergebnisse des Forschungsprogramms Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Preprint 1), Berlin Westphal an Kauffmann vom , in: Kauffmann, Erinnerungen, S. 309 f. Nach Angaben gegenüber Kauffmann traf Westphal die deutschstämmigen Bakteriologen Aryeh Leo Olitzki und Willy Hirsch ( ). Olitzki war bereits 1924 nach Palästina ausgewandert, während Hirsch 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft als Assistent am Institut für Hygiene in Königsberg entlassen worden war. Gegenüber Kauffmann gab Westphal an, dass ihn als Deutschen die kollegiale Aufnahme besonders berührt habe. 33 Ute Deichmann: Collaborations between Israel and Germany in Chemistry and Other Sciences a Sign of Normalization?, in: Israel Journal of Chemistry 55 (2015), S , hier S. 1194, 1212 (künftig zit.: Deichmann, Collaborations). 34 Interview von Ute Deichmann mit Michael Sela am , ebd. S Unter anderem wurde 1967 Michael Sela (neben der französischen Immunologin Anne Marie Staub) zum Auswärtigen Wissenschaftlichen Mitglied des von Otto Westphal geleiteten Max-Planck-Instituts für Immunbiologie berufen, vgl. Archiv der MPG, Niederschriften von Sitzungen des Senates der MPG, hier: Niederschrift der 56. Sitzung des Senats vom , S Schriftliche Auskunft von Erwin Rüde vom Vgl. u. a. E. Rüde/O. Westphal/E. Hurwitz/S. Fuchs/M. Sela: Synthesis and antigenic properties of sugar-polypeptide conjugates, in: Immunochemistry 3 (1966) S Die zweite Säule war die Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen unter Manfred Eigen (*1927), vgl. Deichmann, Collaborations, S Deichmann, Collaborations, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 137
74 Michael Sela und Erwin Rüde bei einem Ausflug in der Nähe von Freiburg, 1968/69 Neubau des Dr. Wander- Forschungsinstituts in Freiburg, 1957 Vom Dr. Wander-Forschungsinstitut zum MPI für Immunbiologie Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bot der Besitzer der Wander AG in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre einen Standortwechsel des Forschungsinstituts an. 39 Man entschied sich für Freiburg, wo Westphal seit 1949 zunächst als Dozent und ab 1952 als außerplanmäßiger Professor an der naturwissenschaftlichen Fakultät Lehrveranstaltungen abhielt. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Immunologie in den Biowissenschaften und der wissenschaftlichen Reputation Westphals gab es seit Anfang der 1960er-Jahre Bestrebungen in der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Otto Westphal als wissenschaftliches Mitglied zu gewinnen. 40 Mit dem Hinweis,»Westphal sei ein ganz ausgezeichneter Biochemiker und sein eigentliches Gebiet, die Immunchemie und Immunbiologie, habe größte wissenschaftliche Bedeutung«, trat auch der Präsident der MPG, Adolf Butenandt, lebhaft hierfür ein. 41 Am 6. Dezember 1961 beschloss der Senat der MPG einstimmig, Westphal als Direktor eines neu zu errichtenden Max-Planck-Ins- 39 Fasolin, Säckingen, S. 79 f. 40 Vgl. hierzu Otto Westphal: About the History of the MPI for Immunobiology, in: Klaus Eichmann (Hrsg.): The Biology of Complex Organisms Creation and Protection of Integrity, Basel 2003, S ; Schriftwechsel zwischen Butenandt und Westphal, in: Archiv der MPG, III. Abt./084/2 (Nachlass Adolf Butenandt), Nr. 7701; ebd., Niederschriften von Sitzungen des Senates der Max-Planck-Gesellschaft, hier: Niederschrift der 38. Sitzung des Senats der MPG am , S ; Niederschrift der 39. Sitzung am , S. 9 f. 41 Archiv der MPG, Niederschriften von Sitzungen des Senates der Max-Planck-Gesellschaft, hier: Niederschrift der 38. Sitzung am , S tituts (MPI) für Immunbiologie und Wissenschaftliches Mitglied der MPG zu berufen. 42 Das Institut nahm bereits 1962 seine Arbeit auf, die offizielle Einweihungsfeier fand am 13. März 1963 im Beisein zahlreicher in- und ausländischer Gäste statt und im Sommer 1963 konnte die von Frankfurt nach Freiburg gewechselte Arbeitsgruppe um Herbert Fischer ( ) einen neuerrichteten Anbau beziehen. 43 Förderung der immunologischen Forschung Die Gründung des MPII in Freiburg 1963 war ein erstes deutlich sichtbares Zeichen der Etablierung der Immunologie als wissenschaftliche Disziplin in der Bundesrepublik. Weitere wichtige Impulse gingen von dem nahezu zeitgleich bewilligten Schwerpunktprogramm»Immunbiologie«der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus, dessen Initiierung und Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden. Eine wesentliche Unterstützung der Forschung im weitgehend zerstörten Nachkriegsdeutschland bedeutete die Neugründung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und die Konstituierung eines Deutschen Forschungsrates im Jahr 1949, die 1951 zur DFG fusionierten. Durch die Bereitstellung größerer Bundesmittel konnte diese ab 42 Archiv der MPG, Niederschriften von Sitzungen des Senates der MPG, hier Niederschrift der 40. Sitzung des Senats der MPG am , S Vgl. hierzu Feier zur Einweihung des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie in Freiburg am 13. März 1963, in: Mitteilungen aus der MPG, Jg. 1963, Heft 6, S ; Tätigkeitsbericht der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.v. für die Zeit vom bis , in: Die Naturwissenschaften 51 (1964), S , hier S. 599 f. 138 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 139
75 Festrede von Adolf Butenandt anlässlich der Einweihung des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie, erste Reihe von links: Anne-Marie Staub, Otto Hahn, Olga Westphal, Otto Westphal, März neben den üblichen Normalverfahren gezielt Schwerpunktprogramme zur Förderung besonderer Wissenschaftsgebiete entwickeln. 44 Die erhofften oder erwarteten Erfolge dieser Fördermaßnahmen blieben jedoch zunächst aus. Die zu Beginn der 1960er- Jahre erarbeitete DFG-Denkschrift»Stand und Rückstand der Forschung in Deutschland in den Naturwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften«bezeichnete u. a. auch die Bereiche Immunbiologie und Immunchemie als besonders förderungswürdig und notleidend. Für die mangelnde Weiterentwicklung nach den nobelpreisgekrönten Erkenntnissen von Emil von Behring, Robert Koch und Paul Ehrlich machte man seitens der DFG im Wesentlichen zwei Gründe verantwortlich: Zum einen die Vertreibung von immunologisch arbeitenden Wissenschaftlern durch das NS-Regime, zum anderen die Entwicklung von Sulfonamiden und Antibiotika, die die Immunologie als eine mit der 44 Karin Orth: Autonomie und Planung der Forschung. Förderpolitische Strategien der Deutschen Forschungsgemeinschaft , Stuttgart 2011, S. 131ff (künftig zit.: Orth, Autonomie). Aufklärung körpereigener Abwehrmechanismen befasste Disziplin vorübergehend weniger interessant erscheinen ließen. 45 Nachdem Ende 1961 erste Anregungen zu einem Schwerpunktprogramm»Immunbiologie«an den DFG-Präsidenten Gerhard Hess ( ) herangetragen worden waren, fand zu Beginn des neuen Jahres mit den Initiatoren dem Internisten Fritz Hartmann ( , Universität Marburg, ab 1965 Medizinische Hochschule Hannover), dem Pathologen Erich Letterer ( , Universität Tübingen), dem Mikrobiologen Paul Klein ( , Universität Mainz) sowie dem Immunchemiker Otto Westphal eine erste Besprechung über den Stand der Immunologie in Deutschland im internationalen Vergleich und geeignete Maßnahmen zu ihrer Förderung bei der DFG in Bad Godesberg statt. Die beim ersten Treffen in Bad Godesberg Anwesenden beschlossen eine zweite Beratung in einem größeren Kreis, zu der auch im Ausland tätige Forscher Einladungen erhielten. An dieser Besprechung, die am 4. Juli 1962 erneut in der DFG-Geschäftsstelle stattfand, nahmen die deutschen Forscher Herbert Fischer, Hans Friedrich-Freksa ( , MPI für Virusforschung, Tübingen), Richard Haas (Hygiene-Institut der Universität Freiburg), Hermann E. Schultze ( , Behringwerke, Marburg), Erich Letterer und Otto Westphal teil. Aus Übersee reisten der aus Rumänien stammende Henry Zoltan Movat ( , Department of Pathology, University of Toronto), der Schweizer Peter A. Miescher (* 1923, Department of Medicine, New York University School of Medicine), der deutschstämmige Georg F. Springer ( , William Pepper Laboratory of Clinical Medicine, University of Pennsylvania) sowie der in den 1930er-Jahren aus Deutschland vertriebene Wilhelm (später William) Ehrich ( , Department of Pathology, University of Pennsylvania) an. 46 Um geeignete Nachwuchswissenschaftler für das geplante Schwerpunktprogramm zu gewinnen, entschied man sich, jüngere, an immunologischen Fragestellungen interessierte Forscher zu einem Rundgespräch mit Kurzvorträgen und anschließender Diskussion einzuladen. Ein erstes Kolloquium mit 28 Teilnehmern fand im Februar 1963 in Rüdesheim unter der Leitung von Hans Friedrich-Freksa statt. Während der dreitägigen Veranstaltung gründeten die anwesenden etablierten Wissenschaftler Hans Erhard Bock ( , Medizinische Klinik der Universität Tübingen), Herbert Fischer, Hans Friedrich-Freksa, Richard Haas, 45 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Jahresbericht 1963, S. 62 f. Zur»Rückstandsdebatte«vgl. ausführlich Orth, Autonomie, S. 96 ff. 46 DFG-Präsident Gerhard Hess an Fischer, und Liste der Eingeladenen sowie Letterer/Friedrich- Freksa an den Präsidenten der DFG, Anfang März 1963, in: Archiv der MPG, III. Abt./ZA 3 (Nachlass Herbert Fischer) Nr. 48. Eingeladen war auch der in den USA arbeitende deutsche Wissenschaftler Müller- Eberhard sowie möglicherweise Ernest Witebsky, vgl. Witebsky an Fischer, , ebd. 140 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 141
76 Herbert Fischer, Anfang der 1960er-Jahre Fritz Hartmann, Paul Klein, Erich Letterer, Hermann E. Schultze und Otto Westphal eine Arbeitsgemeinschaft für Immunbiologie, die den organisatorischen Rahmen für das weitere Vorgehen bilden sollte. Die Leitung dieser Arbeitsgemeinschaft übernahmen Hans Friedrich-Freksa und Erich Letterer. Bereits im folgenden Monat baten diese im Namen der Arbeitsgemeinschaft die DFG nicht nur um die Durchführung eines weiteren Rundgesprächs, das im Oktober 1963 mit rund 20 immunologisch interessierten Nachwuchswissenschaftlern im Glottertal/Schwarzwald stattfand, sondern auch um die Aufnahme der Immunbiologie in das Schwerpunktprogramm der DFG. In dem noch im Jahr 1963 vom Senat der DFG bewilligten Schwerpunktprogramm stand zwar die Förderung immunologischer Grundlagenforschung im Vordergrund, doch fanden auch stärker angewandte bzw. klinisch-immunologische Vorhaben ihre Berücksichtigung. Zu den zunächst bewilligten 39 Projekten zählten bspw. verschiedene Arbeiten über das Komplementsystem (Paul Klein, Hans-Jobst Wellensiek und Ernst Kuwert), die Immunpathologie chronischer Krankheiten (Helmuth Deicher), die Immunologie der Tuberkulose (Günther Heymann, Heinz Micke), die Rolle des Thymus bei der Transplantationsimmunität (Friedrich Scheiffarth), die Charakterisierung des Myelinhaptens und der entsprechenden Antikörper (Barbara Niedeck), Untersuchungen über die AB0-Erythroblastose bei Neugeborenen (Konrad Fischer) oder die Beziehungen zwischen serologischen und physikalisch-chemischen Eigenschaften der Geißelproteine von Salmonellen (Richard Haas) Bericht der DFG über ihre Tätigkeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1964, S Nachdem die DFG 1970 eine positive Zwischenbilanz der bisherigen Förderung gezogen und die breite thematische Ausrichtung des Programms und seine wertvollen Impulse für die immunologische Forschung gelobt hatte, wurde es nochmals für drei Jahre verlängert. 48 Damit gehörte das Schwerpunktprogramm»Immunbiologie«zu den wenigen dieser Vorhaben, die die DFG über einen Zeitraum von zehn Jahren und länger gefördert hatte. 49 In ihrem Resümee hob die DFG insbesondere die hohe Zahl an Stipendiaten (insgesamt 33) und die zahlreichen im Programm erarbeiteten Publikationen hervor, die zum Teil internationale Beachtung gefunden hatten. Erstere hätten nach ihrer Rückkehr aus vorwiegend US-amerikanischen Forschungszentren wesentlich dazu beigetragen, dass in der Bundesrepublik»in den meisten Teilbereichen der Immunologie der Anschluß an die Weltspitze erreicht werden konnte«. 50 Zu den international stark beachteten Forschungsergebnissen zählte bspw. die Entdeckung des T-cell replacing factor (TRF) als einem Stoff zur Regulierung von Zellwachstum und Zelldifferenzierung durch Anneliese Schimpl und Eberhard Wecker. 51 Der Senat der DFG erklärte sich daher im Herbst 1974 bereit, umgehend ein Nachfolgeprogramm unter dem Titel»Physiologie und Pathophysiologie des Immunsystems«einzurichten. Dieses neue Schwerpunktprogramm sollte auf den Ergebnissen seines Vorläufers aufbauend nicht nur solche Bereiche der Grundlagenforschung fördern, die bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden waren, sondern auch neue Erkenntnisse»für die Prophylaxe, Früherkennung und die Immuntherapie chronisch-entzündlicher, autoaggressiver und neoplastischer Erkrankungen«liefern. Letzteres schien der DFG besonders notwendig,»weil zu befürchten ist, daß ohne besondere Förderungsmaßnahmen die von der experimentellen Forschung gewonnenen Erkenntnisse weitgehend ungenutzt bleiben und ihre praktischen Anwendungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden«. 52 Koordinator des neuen, auf fünf Jahre angelegten Schwerpunktprogramms war der Mainzer Immunologe Paul Klein, der parallel auch als Sprecher des 1973 eingerichteten Sonderforschungsbereichs 107»Immunologie«(ab 1975»Vollzugsmechanismen der Immunre- 48 Jahresbericht der DFG 1970, Bd. I: Tätigkeitsbericht, S Orth, Autonomie, S. 142 f. Zwischen 1952/53 und 1968 schrieb die DFG insgesamt 144 Schwerpunktprogramme aus, von denen 19 über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren gefördert wurden. 50 Jahresbericht der DFG 1974, Bd. I: Tätigkeitsbericht, S Anneliese Schimpl/Eberhard Wecker: Replacement of T-Cell Function by a T-Cell Product, in: Nature New Biology 237 (1972), S Vgl. auch Edward J. Moticka: A Historical Perspective on Evidence-Based Immunology, Amsterdam et al. 2016, S. 221, Wecker, Virologie, S. 460 f. 52 Jahresbericht der DFG 1975, Bd. I: Tätigkeitsbericht, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 143
77 aktion«) fungierte. Dieser Sonderforschungsbereich 53 bearbeitete unter Beteiligung der Fachrichtungen Medizinische Mikrobiologie und Innere Medizin»die Voraussetzungen und Mechanismen der immunologischen Abwehrleistung insbesondere im Hinblick auf das Zusammenwirken der antigenspezifischen Reaktion mit unspezifischen Amplifikations- und Aktivierungssystemen«. 54 Darüber hinaus waren immunologische Fragestellungen zentraler Bestandteil weiterer Sonderforschungsbereiche wie bspw. des bereits seit 1969 geförderten Sonderforschungsbereichs 37»Restitution und Substitution innerer Organe«, zu dem unter anderem Teilprojekte zur Immunsuppression, zur Physiologie und Immungenetik der Histokompatibilitätssysteme und zur Rezeptorenimmunologie gehörten. 55 Auch der 1973 an der Universität Kiel eingerichtete Sonderforschungsbereich 111»Lymphatisches System und experimentelle Transplantation«befasste sich schwerpunktmäßig mit der Erforschung von Transplantationsreaktionen. 56 Die Immunologie profitierte zudem von einem weiteren, neu geschaffenen Instrument der Forschungsförderung, nämlich der Einrichtung von Forschergruppen. Bis 1968 konnten vier DFG-Forschergruppen aufgebaut werden, von denen drei in Freiburg angesiedelt waren. Dazu zählte die 1963 gegründete Forschergruppe Präventivmedizin unter der Leitung des Krebsforschers Hermann Druckrey ( ), der Toxikologen, Pathologen, Biochemiker und Chemiker angehörten bewilligte die DFG eine ebenfalls dort angesiedelte Forschergruppe Immunbiologie, für die mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk ein Erweiterungsbau am MPI für Immunologie errichtet wurde. Die Forschergruppe nahm nach Fertigstellung der Räumlichkeiten 1968 unter der Leitung von Klaus Rother ( ) ihre Arbeit auf. Sie stand in enger Verbindung zum DFG-Schwerpunktprogramm und untersuchte die Mechanismen immunologischer Gewebeschädigung insbesondere die Mediatorrolle des Komplementsystems. Mit der Berufung Klaus Rothers an die Universität Heidelberg wechselte die Forschergruppe in das dortige Institut für Immunologie und Serologie. Zur Förderung der bisher vernachlässigten klinischen Immunologie diente unter anderem die formell am 1. April 1974 konstituierte Forschergruppe Tumorimmunologie, 57 die aus der Forschergruppe Präventivmedizin hervorging und die Untersuchungen der 53 Auf Empfehlung des Wissenschaftsrates wurden ab den späten 1960er-Jahre an den Hochschulen Sonderforschungsbereiche durch die DFG errichtet. Mit dieser»dritten Säule«des Förderverfahrens sollten an den Universitäten leistungsfähigere Forschungseinheiten geschaffen werden, die mit den außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen konkurrieren konnten, vgl. Orth, Autonomie, S. 182 ff. 54 Jahresbericht der DFG 1975, Bd. II: Programme und Projekte, S Jahresbericht der DFG 1975, Bd. II: Programme und Projekte, S. 545 f. 56 Jahresbericht der DFG 1973, Bd. II: Programme und Projekte, S. 528 f. 57 Jahresbericht der DFG 1974, Bd. I: Tätigkeitsbericht, S. 95. von Druckrey geleiteten Forschergruppe über karzinogene Substanzen fortsetzen und auf das Gebiet der Tumorimmunologie ausdehnen sollte. Ihre Leitung übernahm der in Köln geborene, ab 1958 in den USA forschende Herbert F. Oettgen (* 1923), der als Spezialist für Tumorimmunologie 1973 einem Ruf an die Universität Freiburg gefolgt war. Ebenfalls 1973 wurde eine in Tübingen und Stuttgart arbeitende Forschergruppe»Biochemische und immunologische Grundlagen der Leukämie- und Tumortherapie«mit dem Sprecher Gert Riethmüller (*1934) etabliert, die experimentelle und theoretische»grundlagen zur Verbesserung der therapeutischen Möglichkeiten bei Leukämien und malignen Tumoren«erarbeiten sollte. 58 Weitere Unterstützung erhielt die Immunologie durch Stiftungen zur Wissenschaftsförderung wie bspw. die im Zuge der Privatisierung des Volkswagenwerkes am 19. Mai 1961 gegründete Stiftung Volkswagenwerk. Auch hier begründete man die Mitte der 1960er-Jahre aufgenommene Förderung mit der zunehmenden Bedeutung der Immunologie für die medizinische Forschung. 59 Zunächst stellte die Stiftung Mittel zur Unterbringung der DFG-Forschergruppe Immunologie am MPI bereit. Weitere Zuschüsse im Bereich der Immunologie erhielten das Pathologische Institut der Universität Freiburg für Untersuchungen immunpathologischer Erscheinungen ( DM) sowie die Chirurgische Universitätsklinik Köln für die Errichtung eines Laboratoriums, in dem an spezifisch pathogenfreien Versuchstieren die bei Organtransplantationen auftretenden Immunreaktionen untersucht werden sollten ( DM). Darüber hinaus unterstützte die Stiftung Volkswagenwerk 1966 die Arbeit des Heinrich-Pette-Instituts für experimentelle Virologie und Immunologie an der Universität Hamburg (siehe unten) mit einem Zuschuss von 2,3 Millionen DM für den Bau eines Seuchenlaboratoriums, in dem Virologen, Immunologen, Biochemiker etc. interdisziplinär bestimmte Viruskrankheiten erforschen sollten. 60 Weitere Schritte der Institutionalisierung Zwar war der erste, deutlich sichtbare Schritt zur Etablierung der Immunologie mit der Gründung des MPII für Immunologie in Freiburg und seinem Schwerpunkt auf der immunologischen Grundlagenforschung getan, doch vollzog sich die weitere Institu- 58 Jahresbericht der DFG 1976, Bd. II: Programme und Projekte, S Bericht 1966 der Stiftung Volkswagenwerk zur Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre, Göttingen 1967, S Ebd., S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 145
78 tionalisierung in Form von eigenen Abteilungen, Instituten oder Lehrstühlen an den bundesdeutschen Hochschulen und außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen nur zögerlich. Die Gründe hierfür liegen vor allem in den vielfältigen Zuordnungsmöglichkeiten der Immunologie als Querschnittgebiet und der nach Behring und Ehrlich etwas in Vergessenheit geratenen Anerkennung ihrer klinischen Relevanz. Der 1957 als wissenschaftspolitisches Beratungsgremium für Bund und Länder gegründete Wissenschaftsrat hatte in seinen ersten Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik, die er 1960 zunächst für die wissenschaftlichen Hochschulen vorlegte, weder einen Lehrstuhl noch ein Institut für Immunologie, Immunbiologie oder Immunchemie gefordert. Lediglich im Bereich der veterinärmedizinischen Mikrobiologie hatte er eine Abteilung für Immunbiologie als eine mögliche Form der Untergliederung von Instituten angeregt, abhängig von der speziellen fachlichen Ausrichtung der Lehrstühle. 61 Erst in seinen acht Jahre später im März 1968 vorgelegten Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten bezeichnete der Wissenschaftsrat die Immunologie als eines von vier selbständigen Teilgebieten, die in Zukunft in einem (humanmedizinischen) Institut für Medizinische Mikrobiologie vorgesehen werden sollten. 62 Eine konkrete Forderung nach Errichtung von Lehrstühlen oder zumindest Extraordinariaten enthielten die Empfehlungen von 1968 jedoch nicht. An der Universität Mainz hatte sich die Medizinische Fakultät nach längeren internen Diskussionen bereits seit 1963 um die Errichtung eines Lehrstuhls für Immunologie bemüht. Einen solchen erachtete sie sogar für notwendiger als die vom Wissenschaftsrat schon 1960 empfohlene Errichtung eines humangenetischen Lehrstuhls. Sie berief sich dabei auf die ebenfalls schon 1960 ausgesprochene Empfehlung, Mainz zu einem Schwerpunkt für Rheumatologie zu entwickeln. Die Wünsche der Fakultät ließen sich jedoch nicht realisieren und auch ein 1965 eingerichtetes Extraordinariat blieb unbesetzt. Treibende Kraft der Mainzer Bemühungen war der dort als Professor für Medizinische Links: Paul Klein, o. D. Rechts: Klaus Rajewsky, o. D. Mikrobiologie lehrende Paul Klein, 63 der sein Institut bereits zu einer immunologischen Forschungsstätte ausgebaut hatte. Schließlich konnte 1969 ein Lehrstuhl für Immunologie ausgeschrieben werden, für den die Mainzer Fakultät im Januar 1970 eine Berufungsliste mit Hans J. Müller- Eberhard ( ), Norbert Hilschmann ( ) und Hans Gerhard Schwick ( ) aufstellte. Nachdem Müller-Eberhard und Hilschmann den an sie ergangenen Ruf abgelehnt hatten, wurde der Lehrstuhl in einem zweiten Berufungsverfahren 1976 mit dem Chemiker Erwin Rüde (*1930) besetzt. 64 Einen Lehrstuhl für Immunologie im Bereich der Fakultät für Theoretische Medizin verbunden mit einer Abteilung für klinische Immunologie sowie eine Sektion Immunchemie und -biologie im geplanten Zentrum für klinische Grundlagenforschung sah auch der im Juli 1965 vorgelegte Bericht des Gründungsausschusses über eine Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule in Ulm vor. 65 Möglicherweise war auch 61 Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen, Teil I: Wissenschaftliche Hochschulen, Tübingen 1960, S Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Struktur und zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten, vorgelegt im März 1968, o. D., o. O., S. 26. Zudem hatte er für das Fachgebiet»Pathologische Anatomie«als wünschenswerte Spezialgebiete»Immunpathologie«aufgelistet und für das Fach»Kinderheilkunde«als eines der Spezialgebiete, deren Verselbständigung im Laufe der Zeit an einigen Hochschulen anzustreben»klinische Immunologie/Hämatologie«definiert. Im Bereich der inneren Medizin hatte er eine Verselbständigung des Spezialgebietes»Hämatologie, Rheumatologie, Allergologie«vorgeschlagen, ebd., S.24, 46 f. 63 Schriftliche und mündliche Informationen des Leiters des Universitätsarchivs Mainz, Dr. Christian George, vom Schriftliche und mündliche Informationen des Leiters des Universitätsarchivs Mainz, Dr. Christian George, vom Hilschmann hatte nicht nur den Ruf auf den Mainzer Lehrstuhl abgelehnt, sondern auch auf das neugegründete Ordinariat für Immunologie der Universität. Stattdessen nahm er den Ruf zum Wissenschaftlichen Mitglied und Direktor einer selbständigen Abteilung»Immunchemie«am Max- Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen an, vgl. Jahresbericht 1971 der Max-Planck- Gesellschaft, in: Mitteilungen aus der MPG, Jg. 1972, Heft 4, S , hier S Bericht des Gründungsausschusses über eine Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule in Ulm, Ulm 1965, S. 26, ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 147
79 hier der Mainzer Immunologe Paul Klein geistiger Urheber dieser Forderung, da er den Gründungsausschuss unter dem Vorsitz des Freiburger Internisten Ludwig Heilmeyer ( ) bei der Konzeption der neuen Hochschule beraten hatte. 66 Tatsächlich wurde diese Konzeption nicht realisiert, vielmehr etablierte sich die immunologische Forschung in der von Otto Haferkamp ( ) geleiteten Abteilung für Pathologie I am Zentrum für Klinische Grundlagenforschung. Eine Sektion für klinische Immunologie im Zentrum für Innere Medizin und Kinderheilkunde wurde von Konrad Federlin (* 1928) geleitet. 67 Eine ebenfalls stärker an der theoretischen Medizin ausgerichtete Etablierung der Immunologie erfolgte an der Universität Bonn. Hier wurde 1967 neben dem klassischen Lehrstuhl für Hygiene ein weiterer Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie eingerichtet, der von dem Mikrobiologen Henning Brandis ( ) vertreten wurde. 68 An der Universität Hamburg wurde das 1955 gegründete Institut für klinische Bakteriologie und Serologie unter der Leitung von Gerd B. Roemer ( ) Mitte der 1960er-Jahre zunächst in ein Institut für Medizinische Mikrobiologie und Serologie und wenige Jahre später in ein Institut für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie umbenannt. 69 Darüber hinaus institutionalisierte man die Immunologie im Einzelfall wie in dem 1961 von dem Biophysiker Max Delbrück ( ) gegründeten Institut für Genetik der Universität Köln auch an einer Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Hier begann Klaus Rajewsky (* 1936) nach einem Post-Doc-Aufenthalt am Institut Pasteur in Paris, in dem er sich vor allem mit der Charakterisierung von LDH-Isoenzymen mittels Antikörper befasst hatte, 1964 nach eigenen Angaben als»einzelkämpfer«mit dem Aufbau einer immunologisch ausgerichteten Abteilung zeitigten seine Bemühungen schließlich Erfolg mit der offiziellen Umbenennung der früheren Abteilung für Biophysik in eine Abteilung für Immunbiologie sowie seiner Berufung zum Abtei- 66 Ebd., S. 69 f. 67 Universität Ulm (Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule): Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Studienjahr 1969/70, 2. Studienabschnitt (Sommer-Semester), S , 33; dies., Personal- und Veranstaltungsverzeichnis, Studienjahr 1970/71, Winter-Halbjahr, S. 23, 28, Heinz Schott (Hrsg.): Universitätskliniken und Medizinische Fakultät Bonn Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des Neuanfangs auf dem Venusberg, Bonn 2000, S. 176; Munk, Virologie, S P. Naumann/Klaus Mai/F.-J. Pothmann: Professor Dr. med. Dr. jur. Gerd B. Roemer zum 65. Geburtstag, in: Infection. Zeitschrift für Klinik und Therapie der Infektionen 2 (1974), Nr. 1, S Vgl. ferner Angaben in wissenschaftlichen Publikationen. 70 Klaus Rajewsky: Years in Cologne, in: Annual Review 31 (2013), S (künftig zit.: Rajewsky, Years); lungsvorsteher und Professor. 71 Rajewsky leistete unter anderem in Kooperation mit dem britischen Zoologen Nicholas Avrion Mitchison (* 1928) wesentliche Beiträge zur Erforschung des Carrier-Effekts und seiner Bedeutung für die Antikörperbildung. 72 Seit 1965 existierte zudem ein»heinrich-pette-institut für experimentelle Virologie und Immunologie an der Universität Hamburg«. Dieses Institut war 1948 als Stiftung zur Erforschung der spinalen Kinderlähmung und der multiplen Sklerose von dem Neurologen Heinrich Pette ( ) und dem Hamburger Mäzen und Kaufmann Philipp Reemtsma gegründet worden. Tatsächlich war das Institut keine universitäre Einrichtung, sondern zählte seit 1955 zu den durch Bund und Länder nach dem»königsteiner Abkommen«geförderten Forschungsanstalten, die 1977 in die»blaue Liste«der von Bund und Ländern gemeinsam grundfinanzierten Wissenschaftseinrichtungen aufgenommen wurden und heute die Leibniz-Gemeinschaft bilden. Überwiegend wurde die Immunologie in den 1960er-Jahren allerdings in Form von Abteilungen für klinische Immunologie mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten innerhalb von Universitätskliniken institutionalisiert, wenn auch nicht in dem vom Wissenschaftsrat und von der DFG gewünschten Ausmaß. In der Mehrheit entstanden diese Abteilungen in Anbindung an die Transfusionsmedizin, zum Teil aber auch mit Blick auf die Erfordernisse der Transplantationsmedizin in Anbindung an die Chirurgie oder die Pädiatrie. Erste Hinweise auf eine derartige Abteilung finden sich noch vor Etablierung des MPI für Immunbiologie ebenfalls in Freiburg. Der damalige Oberarzt der Medizinischen Universitätsklinik, Helmut Schubothe ( ), gab bereits 1958 eine Abteilung für Klinische Immunologie und seit 1960 eine»abteilung für Immunhämatologie und klinische Immunologie«als Entstehungsort in Publikationen 73 an, die 71 Vgl. Vorlesungsverzeichnis der Universität Köln für das WS 1968/1969, S. 66, 94 sowie für das SS 1969, S. 63, 95. Rajewsky gibt in seinen Erinnerungen an, dass die Gründung der Abteilung Immunologie nach seiner Rückkehr aus London im Oktober 1969 erfolgte, vgl. Rajewsky, Years, S. 7. Andere Angaben im Vorlesungsverzeichnis für das SS Vgl. u. a. Klaus Rajewsky: The Significance of the Carrier Effect for the Induction of Antibodies, in: Otto Westphal/Hans Erhard Bock/Ekkehard Grundmann: Current Problems in Immunology (Bayer-Symposium I) Berlin/Heidelberg/New York 1969, S ; N. Avrion Mitchison/Klaus Rajewsky/R.B. Taylor: Cooperation of antigenic determinants and of cells in the induction of antibodies, in: Jaroslav Šterzl/I. Říha (Hrsg.): Developmental Aspects of Antibody Formation and Structure. Proceedings of a symposium held in Prague and Slay on June 1 7, 1969, Prag 1970, Bd. 2, S ; vgl. auch: David C. Parker: The Carrier Effect and T Cell/B Cell Cooperation in the Antibody Response, in: Journal of Immunology 191 (2013), ; Debra Jan Bibel: Milestones in Immunology. A Historical Exploration, Madison/Berlin et al. 1988, S Helmut Schubothe: Serologie und klinische Bedeutung der Autohämantikörper, Basel, New York 1958; H.J. Kaehler/H. Franz, Helmut Schubothe: Atypische Corpuskuläre nichtsphärocytäre hämolytische Erkrankungen: hämatologische und klinische Untersuchungen von 9 Fällen, in: Klinische Wochenschrift 38 (1960), S ; Helmut Schubothe/Marianne Haenle: Serologische Studien über die nichtphilitische 148 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 149
80 tatsächlich jedoch erst 1965 als»abteilung für klinische Immunpathologie«ihre offizielle Selbständigkeit unter Schubothes Leitung erhielt entstand an der Medizinischen Klinik der Universität Erlangen eine Abteilung für Klinische Immunologie, die 1975 zu einem Institut für Klinische Immunologie und Poliklinik aufgewertet wurde. Ihre Leitung hatte der Internist Friedrich Scheiffarth ( ) inne, der am 1. April 1966 seine Ernennung zum außerordentlichen Professor für Klinische Immunologie und 1969 zum ordentlichen Professor erhielt. 75 Bereits 1966 konnte der Direktor der I. Chirurgischen Universitätsklinik in Köln, Georg Heberer ( ), unter Hinweis auf ein attraktives Lehrstuhlangebot aus Wien, die Errichtung einer immunologischen Abteilung bzw. eines immunologischen Labors erreichen. 76 Die Leitung übertrug er dem bei Pierre Grabar 77 am Institut Pasteur und am Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer sowie in der Abteilung für Immunpathologie der New York University ausgebildeten Günther Hermann (* 1924). 78 Rund zwei Jahre später erfolgte an der Universität Köln die Gründung einer weiteren Abteilung für Immunbiologie, und zwar innerhalb der von Rudolf Gross ( ) geleiteten Medizinischen Klinik. Als Abteilungsvorsteher fungierte der zuvor an der Abteilung für Tumorforschung und experimentelle Pathologie des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Köln-Lindenthal beschäftigte Gerhard Uhlenbruck (* 1929). 79 In Frankfurt übernahm der Leiter des Blutspendedienstes in den Universitätskliniken der Stadt Frankfurt a. Main und außerplanmäßige Professor für Hygiene und Bakteriologie Willi Spielmann ( ) 1966 den neugegründeten Lehrstuhl für Immunhämatologie und Transfusionskunde sowie die Leitung einer Immunhämatologischen Abteilung, die zunächst zur Abteilung für Immunhämatologie und Transfusionskunde und 1969/70 zum Institut für Immunhämatologie und Transfusionskunde aufgewertet wurde. 80 Bereits 1965 war in Hamburg auf Betreiben des Lehrstuhlinhabers Karl-Heinz Schäfer ( ) erstmals eine Immunpathologische Abteilung in einer Universitäts-Kinderklinik eingerichtet worden. Ihr stand der bei dem Blutgruppenforscher Peter Dahr ausgebildete Konrad Fischer (* 1924?) vor. 81 Nach Fischers Berufung zum ordentlichen Professor erhielt sie Ende 1973 die Bezeichnung Abteilung für Klinische Immunpathologie und Perinatale Immunologie. An der 1965 neugegründeten Medizinischen Hochschule Hannover richtete man 1968 am Department Innere Medizin eine Abteilung für Klinische Immunologie und Bluttransfusionswesen unter der Leitung von Helmuth Deicher ( ) ein. 82 Anfang 1969 wurde eine Abteilung für Immunologie und Transfusionsmedizin auf Beschluss der Medizinischen Fakultät Gießen an der Medizinischen Klinik gegründet. Sie ging aus der Blutbank der Chirurgischen Klinik hervor und wurde von Christian Mueller-Eckhardt geleitet. 83 Variante des Donath-Landsteinerschen Hämolysind, in: Vox Sanguinis 6, 1961, S ; Helmut Schubothe: Die Autoimmunerkrankungen des Blutes, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 68. Kongress (1962), S Eduard Seidler/Karl-Heinz Leven: Die Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Grundlagen und Entwicklungen, vollst. überarb. und erw. Neuauflage, Freiburg, München 2007, S. 649, erfolgte die Umbenennung des Lehrstuhl in Innere Medizin II und Klinische Immunologie, vgl. Renate Wittern (Hrsg.): Die Professoren und Dozenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen , Teil 2: Medizinische Fakultät, bearbeitet von Astrid Ley, Erlangen 1999: S. 160 f.; Karl-Heinz Leven/Philipp Rauh: Chronologisches A Z des Universitätsklinikums Erlangen, in: Karl-Heinz Leven/ Andreas Plöger (Hrsg.): 200 Jahre Universitätsklinikum Erlangen , Köln et al. 2016, S , hier S. 515; Mitteilung von Hans-Hartmut Peter. 76 Georg Heberer: Die chirurgische Schule im Wandel der Zeit, in: In Memoriam Georg Heberer , Heidelberg 2000, S , hier S. 216 f.; F.W. Eigler/F.W. Schildberg: In memoriam Prof. Dr. med. Dr. h.c. Georg Heberer, ebd.: S , hier S. 45 f. In den Vorlesungsverzeichnissen der Universität ist keine Abteilung, sondern lediglich ein immunologisches Labor unter der Leitung von Günther Hermann ausgewiesen. 77 Vgl. u. a. Günther Hermann/Pierre Grabar: Organantigene und Autoantikörperbildung, in: Der Internist 6 (1965), S Hermann arbeitete als Stipendiat des DAAD von 1960 bis 1962 am Institut Pasteur und von 1962 bis 1967 am Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer, unterbrochen von einem einjährigen Aufenthalt an der Abteilung für Immunpathologie an der New York University; vgl. Kürschners Deutscher Gelehrten- Kalender 1976; S sowie Archiv der MPG, III. Abt. ZA 4 (Nachlass Friedrich-Freksa), Ordner Mit der Emeritierung von Wilhelm Tönnis zum wurde die in Köln ansässige Abteilung für Tumorforschung und experimentelle Pathologie des MPI für Hirnforschung nicht weitergeführt, da der Senat der MPG bereits 1959 beschlossen hatte, die Abteilungen des MPI für Hirnforschung zukünftig wieder an einem Ort zu konzentrieren. Zwei Arbeitsgruppen der Abteilung konnten ihre Forschungen an der Universität Köln fortsetzen, die auch das Institutsgebäude übernahm, vgl. Jahresbericht 1968, in: Mitteilungen aus der MPG, Jg. 1969, Heft 4, S , hier S. 235 f. 80 Personen- und Vorlesungsverzeichnis der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für das WS 1966/67, S. 20, 51; Angaben zu Willi Spielmann in wissenschaftlichen Beiträgen. 81 Annett Rambow: Eine Vorreiterin der Spezialisierung in der deutschen Pädiatrie. Die Universitäts-Kinderklinik in der Nachkriegszeit und unter Karl-Heinz Schäfer (1945 bis 1979), Diss. med. Hamburg 2006, S. 67 ff. Prof. Dr. Konrad Fischer, in: Deutsches Ärzteblatt 101 (2004), S. 2841; Eintrag von»konrad Fischer«im Hamburger Professorinnen- und Professorenkatalog, URL: resolve/id/cph_person_ (abgerufen am ) 82 Helmuth Deicher: Immunologie und Transfusion, in: Rektor der Medizinischen Hochschule Hannover (Hrsg.), Medizinische Hochschule Hannover , Hannover 1985, S , hier S Zur offiziellen Bezeichnung siehe: B. Adelsberger, A. Sinios, H. Deicher, Supression der Transplantationsreaktion durch gleichzeitige Gabe von Azathioprin und Prednisolon, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung, Allergie und klinische Immunologie, Bd. 139 (1970), S Christian Mueller-Eckhardt: Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin, in: Gießener Geschichtsblätter 15 (1982), Heft 3, S. 72 f.; Gregor Bein: Institut für Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin, in: Volker Roelcke (Hrsg.): Die Medizinische Fakultät der Universität Gießen. Von der Wiedergründung 1957 bis zur Gegenwart, Gießen 2007, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 151
81 Auch im Bereich der Veterinärmedizin entstand bereits 1965 ein Institut für Bakteriologie und Immunologie an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Gießen unter der Leitung des ordentlichen Professors Hans-Georg Blobel (* 1929). 84 Die Etablierung von Lehrstühlen für Immunologie gelang mit wenigen Ausnahmen erst in den 1970er-Jahren, wobei das Bundesland Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle übernahm wurde der außerordentliche Professor für innere Medizin an der Universität Freiburg und Leiter einer Forschungsgruppe am MPI für Immunbiologie, Klaus Rother, auf den neuerrichteten Lehrstuhl für Immunologie und Serologie an der Universität Heidelberg berufen. 85 Hier hatte sich die Medizinische Fakultät beim zuständigen Kultusministerium bereits in den 1950er-Jahren für das»wiederaufleben des Lehrstuhles, der 1920 als Extraordinariat für Immunitäts- und Serumforschung für Professor Dr. H. Sachs geschaffen worden war und bis 1937 bestanden hat«, in Form eines Extraordinariats für Serologie eingesetzt. 86 Dieses wurde 1958 mit dem seit 1937 an der Serologischen Abteilung des Krebsforschungsinstitutes bzw. der Serodiagnostischen Abteilung des Hygiene-Instituts tätigten Ernst Krah ( ) besetzt und seine Abteilung als Serologisches Institut verselbständigt wurde es in»institut für Immunologie und Serologie«umbenannt und 1971 seit der Übernahme des Lehrstuhles für Immunologie und Serologie von Klaus Rother geleitet. 88 In Freiburg erhielt der von der Universität Köln beurlaubte, in den USA lehrende Tumorimmunologe Herbert F. Oettgen (* 1923) im August 1971 einen Ruf auf den neuerrichteten Lehrstuhl 84 Hans-Georg Blobel hatte seit 1955 an der Universität von Wisconsin gearbeitet, zuletzt in der Position eines Full Professors lehnte er einen Ruf an seine frühere Wirkungsstätte in den USA ab. Sein Bruder Günter Blobel erhielt 1999 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Vgl. Karl-Heinz Habermehl, Hermann Goller (1982): Veterinärmedizin und Tierzucht, in: Gießener Universitätsblätter 15 (1982), Heft 2, S , hier S. 72; Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Justus-Liebig-Universität Gießen für das WS 1965/66, S. 48, 71; Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender 1970, 11. Ausgabe, A M, Berlin, S. 236; Gießener Universitätsblätter Dez. 1981, S DMW 1970, S Prodekan der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg an Kultusministerium, , zit. nach Rahel Friedrich: Das Institut für experimentelle Krebsforschung Heidelberg von den Anfängen 1906 bis zur Neugründung 1948, Diss. med. Heidelberg 2009, S. 154 (künftig zit.: Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung). 87 Krah wurde am zum a.o. Prof. für Serologie und am zum o. Professor ernannt, vgl. Drüll, Gelehrtenlexikon , S. 355 f. 88 Friedrich, Institut für exp. Krebsforschung, S Klaus Rother nahm für sich in Anspruch, dass aufgrund der von ihm vorgenommenen organisatorischen und thematischen Neuausrichtung des Instituts und der Einführung der Immunologie mit den Teilaspekten Immunchemie, Immunbiologie, Immunpathologie, zelluläre Immunologie und vor allem Transplantation nun erstmals an einer deutschen Universität ein Institut für Immunologie eingerichtet worden sei, vgl. Klaus Rother: Institut für Immunologie und Serologie, in: Gotthard Schettler (Hrsg.): Das Klinikum der Universität Heidelberg und seine Institute, Berlin, Heidelberg et al. 1986, S , hier S. 57. für Immunbiologie. Seine Berufung stand in engem Zusammenhang mit der von allen beteiligten Institutionen gewünschten Fortführung der organisatorisch an das MPI für Immunbiologie angeschlossenen DFG-Forschergruppe Präventivmedizin mit dem neuen Schwerpunkt»Tumorimmunologie«. Der Freiburger Lehrstuhl konnte jedoch erst im Januar 1974 besetzt werden, da Oettgen die Annahme des Rufes immer wieder hinaus gezögert hatte. 89 Bereits zwei Jahre später kehrte er in die USA zurück. Die endgültige Lehrstuhlbesetzung erfolgte 1978 mit der Berufung von Sabine von Kleist (* 1933), die zuvor am Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer in Villejuif gearbeitet hatte. An der Ruhruniversität Essen wurde die Ende der 1960er-Jahre eingerichtete Abteilung für Virologie und Immunologie des Instituts für Medizinische Mikrobiologie im Jahr 1972 zu einem Lehrstuhl und Abteilung für Medizinische Virologie und Immunologie umgewandelt und der Abteilungsvorsteher Ernst Kuwert ( ) zum Ordinarius ernannt. 90 In einem weiteren Schritt wurde die Abteilung 1973/74 zu einem eigenständigen Institut für Medizinische Virologie und Immunologie aufgewertet. 91 In Marburg war bereits 1970 eine Berufungsliste der Medizinischen Fakultät für die Besetzung des neugegründeten Lehrstuhls für Immunologie aufgestellt worden. 92 Der an erster Stelle des Berufungsvorschlags stehende Norbert Hilschmann lehnte den an ihn ergangenen Ruf jedoch im Juli 1971 ab, um seine Forschungen am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen fortzuführen. 93 Nach einer erneuten Ausschreibung im Jahr 1973 setzte die Fakultät Klaus-Ulrich Hartmann (* 1932) auf die erste Stelle ihrer Berufungsliste, der den an ihn ergangenen Ruf 1975 annahm. 94 An der Universität Würzburg sollte 1974 ein Lehrstuhl für Immunologie besetzt werden. Die Initiative hierzu ging auf den damaligen Inhaber des Lehrstuhls für Virologie, Eberhard Wecker ( ) zurück, der sich bereits in den 1960er-Jahren in den Verhandlungen mit der Bayerischen Staatsregierung über einen Institutsneubau mit dem Hinweis,»daß Virologie und Immunologie für eine Pathogenitätsforschung als gleichberechtigte Partner essentiell seien«, für die Etablierung eines weiteren Lehrstuhls 89 Vgl. hierzu die Korrespondenz von Herbert Fischer mit Herbert F. Oettgen im Nachlass Herbert Fischer im Archiv der MPG. 90 Verstorben Prof. Dr. med. Dr. med. vet. Ernst Kuwert, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 37 vom , 82. Jg., Ausgabe A, S. 2654; Munk, Virologie, S Vgl. hierzu die Angaben in den Beiträgen von Kuwert und Mitarbeitern im Lancet vom 25. August 1973 (S. 441) und vom 22. Juni 1974 (S. 1287). 92 Dekan der Medizinischen Fakultät Marburg an Hessischen Kultusminister vom , in: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStaW) Abt. 504 Nr Hilschmann an Hessischen Kultusminister vom , in: HHStaW Abt. 504 Nr ; Jahresbericht 1971, in: Mitteilungen aus der MPG, Jg. 1972, Heft 4, S , hier S Vgl. hierzu Schriftwechsel in HHStaW Abt. 504 Nr ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 153
82 im Institut für Virologie eingesetzt hatte. 95 Im Rahmen des Berufungsverfahrens entschied sich die medizinische Fakultät, Eberhard Wecker den neugegründeten Lehrstuhl für Immunologie zu übertragen und Volker ter Meulen (* 1933) auf den Lehrstuhl für Virologie zu berufen. Die Einrichtung eines zweiten Lehrstuhls wirkte sich auch auf die Bezeichnung des Instituts aus. Nach der Übernahme des Ordinariats durch ter Meulen 1975 erhielt es den Namen»Institut für Virologie und Immunbiologie«. An der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität war bereits 1972 ein Berufungsverfahren für einen Lehrstuhl für Immunologie eingeleitet worden, in dem die Medizinische Fakultät den Schweizer Immunologen und Allergologen Alain de Weck ( ) an die erste Stelle ihrer Berufungsliste gesetzt hatte. Dieser lehnte den Ruf nach München nach eigenen Angaben jedoch nach zweijährigen Verhandlungen ab und blieb an der Universität Bern nahm der Tumorimmunologe Gert Riethmüller den Ruf auf den neugeschaffenen Lehrstuhl an. 96 Die hier nachgezeichnete Institutionalisierung der Immunologie als neues Fachgebiet in das bundesdeutsche Wissenschaftssystem mit dem Focus auf die Etablierung von Klinikabteilungen, Extraordinariaten und Lehrstühlen mit entsprechenden Bezeichnungen darf nicht den Blick dafür verstellen, dass parallel auch an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen immunologische Forschung betrieben wurde, wenn auch häufig unter anderem offiziellen Namen. 97 Das signifikanteste Beispiel hierfür ist die Anfang 1966 erfolgte Berufung des dänischen Immunologen und späteren Nobelpreisträgers Niels Jerne ( ) auf den Lehrstuhl für experimentelle Therapie an der Medizinischen Fakultät Frankfurt a. Main, die mit seiner gleichzeitigen Bestellung zum Direktor des Paul-Ehrlich-Instituts und des Georg-Speyer-Hauses verbunden war. 98 Nicht zuletzt aufgrund der»miserablen Arbeitsbedingungen«am Paul-Ehrlich-Institut verließ Jerne bereits Mitte 1969 die Mainmetropole wieder, um die Leitung eines neugegründeten Forschungsinstituts der Hoffmann-La Roche AG in Basel zu übernehmen Munk, Virologie, S Vgl. auch Eberhard Wecker: Von der Virologie zur Immunbiologie und dann beides zusammen, in: Deutsche Forschungsgemeinschaft: Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Beispiele, Kritik, Vorschläge, Weinheim 1983, S (künftig zit.; Wecker, Virologie). 96 Hochschulnachrichten, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 102 (1977), S Dies trifft bspw. auch auf das Hygiene-Institut in Kiel zu, in dem Wolfgang Müller-Ruchholtz (* 1928) ab den 1960er-Jahren mit einer Arbeitsgruppe immunologische Arbeiten durchführte. 98 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom FAZ vom Vgl. auch Hans Dieter Brede: Das Paul-Ehrlich-Institut Tradition und Aufgabe, in: Hoechst (Hrsg.): Paul Ehrlich. Forscher für das Leben. Dr. Wolfgang von Pölnitz, Ernst Bäumler, Professor Dr. Hans Dieter Brede. Reden zum 125. Geburtstag des Forschers, o. D., o. O. [1979], S , hier 43 f. Rückkehr in die internationale Scientific Community Nach der Niederlage in dem von Hitler entfesselten Zweiten Weltkrieg war das von den Alliierten besetzte Deutschland zunächst weitgehend isoliert. Dies gilt auch für die deutsche Wissenschaft, die darüber hinaus schon nach 1933 in vielen Disziplinen ihre internationalen Verbindungen verloren hatte. In den ersten Nachkriegsjahren stieß die Teilnahme von deutschen Wissenschaftlern an internationalen Kongressen vielfach auf Bedenken und Ablehnung. 100 So wurden die deutschen Physiker bspw. von den ersten großen Nachkriegskonferenzen ihres Fachgebietes 1946 in Cambridge, 1947 auf Shelter- Island und 1948 erneut in Cambridge ausgeschlossen. 101 An dem ersten Internationalen Kongress für Biochemie im August 1949 in Cambridge durften nur vier persönlich eingeladene Wissenschaftler aus Deutschland teilnehmen. 102 Seit den 1950er-Jahren wurden die westdeutschen Wissenschaftler vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts weitgehend reibungslos in die internationale Scientific Community integriert, wenngleich diese durchaus eine»reserviertheit gegen Deutsche«verspürten. 103 Der direkte Austausch abgesehen von den innerdeutschen Wissenschaftskontakten 104 beschränkte sich allerdings zumeist auf das eigene, westliche Bündnissystem. 105 Unterstützend wirkte in diesem Zusammenhang auch, dass nicht wenige Wissenschaftler, die in der NS-Zeit in die Emigration gezwungen worden waren, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Kontakt zur (west)deutschen Wissenschaftsgesellschaft aufnahmen. So folgten immunologisch interessierte Emigranten wie Erwin Neter ( ), Fritz Kauffmann, Wilhelm (William) Ehrich und Ernst (Ernest) 100 Dies gilt nicht generell. So wurde der Internist und Hämatologe Ludwig Heilmeyer schon 1948 zum Kongress der Internationalen Hämatologischen Gesellschaft in Paris eingeladen und während der Tagung in den Vorstand der Europäischen Gesellschaft für Hämatologie gewählt. Vgl. Ludwig Heilmeyer: Lebenserinnerungen (hg. von Ingeborg Heilmeyer), Stuttgart, New York 1971, S. 103 f. (künftig zit.: Heilmeyer, Lebenserinnerungen). 101 Metzler, Internationale Wissenschaft, S. 218 f. 102 Paul J. Weindling: Verdacht, Kontrolle, Aussöhnung. Adolf Butenandts Platz in der Wissenschaftspolitik der Westalliierten ( ), in: Wolfgang Schieder/Achim Trunk (Hrsg.): Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Wissenschaft, Industrie und Politik im»dritten Reich«, Göttingen 2004, S , hier S Erst an dem 2. Internationalen Kongress 1952 in Paris konnten deutsche Biochemiker auch ohne persönliche Einladung teilnehmen, vgl. Ernst Auhagen: Ursprung und Geschichte der Gesellschaft für Biologische Chemie, in: Biological Chemistry Hoppe-Seyler, Bd. 368, September 1987, S , hier S Vgl. hierzu Fritz Melchers im Interview mit Ute Deichmann am , in: Deichmann, Collaborations, S Vgl. hierzu den Beitrag von Sophie Meyer. Sammelbeitrag. 105 Jens Niederhut: Wissenschaftsaustausch im Kalten Krieg. Die ostdeutschen Naturwissenschaftler und der Westen, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 151, ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 155
83 Witebsky Einladungen zu wissenschaftlichen Kongressen in Deutschland. Sie wurden geehrt und leisteten als Experten Unterstützung bei der Entwicklung der Immunologie in der Bundesrepublik. 106 Als der frühere Rostocker Pathologe Wilhelm Ehrich 1954 auf der 98. Versammlung der Deutschen Naturforscher und Ärzte in Freiburg nach seiner Emigration wieder als Redner in Deutschland auftrat, hob er in seinem Vortrag über»die cellulären Bildungsstätten der Antikörper«einleitend hervor, dass er der Einladung gerne gefolgt sei,»weil ich das Bedürfnis hatte, den deutschen Schulen und Universitäten für meine Erziehung und Ausbildung meinen schönsten Dank auszusprechen«. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der mit dem Tagungsthema»100 Jahre Cellularpathologie«geehrte Rudolf Virchow»als Mensch [ ] den Gedanken der persönlichen Freiheit über den des Staates gestellt«habe, was durchaus als Anspielung auf die Selbstgleichschaltung der deutschen Wissenschaft im Nationalsozialismus verstanden werden kann. 107 Als Indizien für die Reintegration der deutschen Wissenschaft in die internationalen Scientific Community lassen sich auch die von deutscher Seite verliehenen Ehrungen und Auszeichnungen an vertriebene und ausländische Forscher heranziehen. So wurde Ernst Witebsky 1958 die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg verliehen, diese hatte bereits im Vorjahr Wilhelm Ehrich mit dieser Auszeichnung geehrt. Beide Wissenschaftler wurden zudem auf Antrag westdeutscher Mitglieder 1960 bzw in die gesamtdeutsch agierende Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina aufgenommen. 108 Einen besonderen Stellenwert aus immunologischer Sicht nehmen die dreitägigen Feierlichkeiten vom 14. bis 16. März 1954 anlässlich der 100. Wiederkehr der Geburtstage von Paul Ehrlich und Emil von Behring ein, die die Verleihung des Paul-Ehrlich-(und Ludwig- Darmstädter-)Preises in der Frankfurter Paulskirche an Ernst Boris Chain ( ), die Verleihung der Emil von Behring-Preise für die Jahre 1948, 1952 und 1954 in der Philipps-Universität in Marburg an Hans Schmidt, Frank Macfarlane Burnet ( ) und Michael Heidelberger sowie die Ausrichtung einer internationalen Tagung in Höchst umfasst. 106 Vgl. u. a. William Ehrich: Dynamik der Reizbeantwortung; Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 62. Kongress, hg. von Fr. Kauffmann, München 1956, S ; Ernest Witebsky, Immunologie und klinische Bedeutung der Autoantikörper, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, hg. von B. Schlegel, 68. Kongress in Wiesbaden , S Fritz Kauffmann nahm schon im Februar 1947 Kontakt zu seinem früheren Abteilungsleiter im RKI, Eduard Boecker auf, vgl. Kauffmann, Erinnerungen, S. 15 f. 107 William E. Ehrich: Die cellulären Bildungsstätten der Antikörper, in: Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, 98. Versammlung zu Freiburg i. Br. vom September 1954, Berlin et al. 1955, S , hier S Vgl. hierzu die Mitgliedsakten im Leopoldina-Archiv, M1, MM 5412 (Ernest Witebsky) und (Leopoldina- Archiv), M1, MM 5080 (William Ehrich). Hans Schmidt, Frank Macfarlane Burnet und Michael Heidelberger anlässlich der Verleihung der Emil von Behring-Preise 1948, 1952 und 1954, Marburg/Lahn, 15. März 1954 In zunehmendem Maße traten deutsche Wissenschaftler auch aktiv als Referenten auf internationalen Tagungen auf, wurden zu Vortragsreisen ins Ausland eingeladen oder richteten selbst Kongresse in internationalem Rahmen aus. Auch die immunologisch interessierten Forscher profitierten von dieser Entwicklung. Einer der ersten großen internationalen wissenschaftlichen Kongresse, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in der Bundesrepublik stattfanden, war der 5. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Hämatologie, der sich im September 1955 in Freiburg unter der Leitung von Ludwig Heilmeyer mit aktuellen Problemen des Transfusionswesens und der Immunhämatologie befasste. Zu den mehr als 300 Teilnehmern aus 31 Ländern zählten mehrere international renommierte Immunologen wie Jean Dausset und Pierre Grabar sowie zahlreiche deutsche Referenten, darunter auch Otto Westphal. 109 Das erste Inter- 109 Herbert Begemann (Schriftleitung): Fünfter Kongress der Europäischen Gesellschaft für Hämatologie. Freiburg i.br., 20. bis 24. September Colloquium über aktuelle Probleme des Transfusionswesens und der Immun-Hämatologie, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1956, S. XVII ff. 156 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 157
84 nationale Symposion für Immunpathologie richteten Peter Miescher (Basel) und Pierre Grabar (Paris) im Juni 1958 auf Bitten der US-amerikanischen Hilfsorganisation Unitarian Service Committee in Basel und am Vierwaldstättersee aus. Zu den rund 50 aktiven Teilnehmern gehörten die deutschen Wissenschaftler Gerhard Erdmann (Rostock), Gert Haberland (Bayer, Elberfeld), Ludwig Heilmeyer (Freiburg), Erich Letterer (Tübingen), Helmut Schubothe (Freiburg), Hans Schmidt (Freiburg), Karl Otto Vorlaender (Bonn) und Otto Westphal sowie der aus Deutschland vertriebene Ernest Witebsky. 110 Zahlreiche westdeutsche Wissenschaftler erhielten in den 1950er-Jahren zudem die Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung im Ausland, insbesondere in den angelsächsischen Ländern. Die DFG und andere Organisationen und Stiftungen unterstützten diese wissenschaftliche Nachwuchsförderung durch Reisebeihilfen und Stipendien. Die Teilnehmer dieser Förderprogramme hatten bei ihrer Rückkehr nicht nur neue wissenschaftliche Methoden im Gepäck, sie waren auch beeinflusst von den US-amerikanischen Wissenschafts- und Organisationsstrukturen und wirkten anschließend vielfach als Multiplikatoren der im Gastland erfahrenen Arbeitsweisen. 111 Zudem blieben die im Ausland geknüpften Kontakte zu Fachkollegen in der Regel auch nach der Rückkehr der Stipendiaten bestehen oder wurden gar ausgebaut und trugen so zum andauernden, wissenschaftlich fruchtbaren Austausch mit der internationalen Scientific Community bei. Auch zahlreiche immunologisch interessierte Forscher wie Herbert Fischer, Paul Klein, Klaus Rother oder Hans J. Müller-Eberhard, die später das Fachgebiet in Deutschland wesentlich prägen sollten, hatten ihre immunologische Ausbildung in den 1950er- Jahren in den USA erhalten. Herbert Fischer arbeitete 1952 als Stipendiat am Biochemical Department des Tuft s College Medical School in Boston und nahm 1956/57 am Austauschprogramm der Universitäten Frankfurt und Chicago teil 112 Hans J. Müller- Eberhard forschte ab 1954 für drei Jahre am Rockefeller-Institut in New York bei dem US-amerikanischen Immunologen Henry G. Kunkel ( ) und konnte mit dessen Arbeitsgruppe wesentliche Beiträge zur Autoimmunpathogenese der rheumatischen Arthritis leisten. 113 Die Idee zu dem Forschungsaufenthalt hatte Kunkel selbst entwickelt, 110 Pierre Grabar/Peter Miescher (Hrsg.): Immunopathology. I st International Symposium, Basel/Seelisberg 1958, Basel, Stuttgart 1959, S. IXf. Vgl. auch: Peter Anton Miescher, Secrets of Autoimmunity. From Experimental Research to Treatment of Autoimmune Diseases. 80 Years of a serene Dreamer, a passionate Scientist and a clinical Immunologist: A Life Story. Dedicated to Family and Friends, Urbino, July 2005, pdf. 111 Vgl. hierzu Paulus, Vorbild USA, S. 317 f. 112 Werdegang Herbert Fischer, , in: Archiv der MPG, II. Abt. Rep. 67, PA Herbert Fischer. 113 Edward C. Franklin/Halsted R. Holman/Hans.J. Müller-Eberhard/Henry G. Kunkel: An unusual protein component of high molecular weight in the serum of certain patients with rheumatoid arthritis, in: Journal of experimental Medicine 105 (1957), S als ihn der Lehrer Müller-Eberhards, Fritz Hartmann, in New York während einer Studienreise aufsuchte. 114 Paul Klein hielt sich von 1956 bis 1959 als Gastwissenschaftler an der Cornell-University in Ithaka (New York) auf. 115 Klaus Rother arbeitete 1957/58 mit einem DFG-Ausbildungsstipendium bei Myron Leon am St. Luke s Hospital bzw. an der Case Western Reserve University in Cleveland. 116 Der spätere Begründer der Klinischen Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Helmuth Deicher, forschte ab 1957 für zwei Jahre als wissenschaftlicher Assistent bei Henry G. Kunkel am Rockefeller-Institut über den Lupus erythematodes und beschrieb erstmals Anti-DNA- Antikörper. 117 Trotz der zunehmenden Einbindung in die internationale immunologische Forschungslandschaft waren die westdeutschen Immunologen als Experten zunächst wenig gefragt. Unter den fünf Wissenschaftlergruppen, die sich im Laufe des Jahres 1962 auf Einladung der WHO in Genf trafen, um den gegenwärtigen Kenntnisstand in der Immunologie zusammenzufassen und Vorschläge für die weitere Forschung zu entwickeln, befand sich als einziger Deutscher der bereits 80jährige Hans Schmidt. 118 Auch in den verschiedenen Expertengruppen, die die Vereinheitlichung der Nomenklatur im Bereich der Immunologie vorbereiteten, waren deutsche Wissenschaftler in den 1960er- Jahren nur vereinzelt vertreten. 119 In welchem Umfang hier aktuelle politische Gründe (Ost-West-Konflikt) oder eine allgemeine Zurückhaltung aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit eine Rolle spielten, kann hier nicht weiter verfolgt werden. 114 Alexander G. Bearn: Hans Joachim Müller-Eberhard , in: Biographical Memoirs, Bd. 79 (2001), Washington f a2d5-c9267dfb5ce Dagmar Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon , Berlin, Heidelberg 2009, S. 505 f. (künftig zit.: Drüll, Gelehrtenlexikon ). 117 MHHinfo, Heft 3/2014 (= Gemeinsam zum Erfolg: Die Gründerjahre der MHH), S. 12f; Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1976, A M, New York 1976, S Vgl. Helmuth R. Deicher/Halsted R. Holman/Henry G. Kunkel: The precipitin reaction between DNA and a serum factor in systemic lupus erythematosus, in: Journal of experimental Medicine 109 (1959), S ; dies.: Anti-Cytoplasmic Factors in the Sera of Patients with Systemic Lupus Erythematosus and certain Other Diseases, in. Arthritis and Rheumatism III (1960), Nr. 1, S World Health Organization (Hrsg.): Research in Immunology. Report by Five Scientific Groups convened by the Director-general of the World Health Organization (= WHO Technical Report Series Nr. 286), Genf Vgl. hierzu Komplementforschung. 158 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 159
85 Schritte zur eigenen Fachgesellschaft Vor Gründung der Gesellschaft für Immunologie 1967 waren die immunologisch interessierten Wissenschaftler entsprechend ihrer fachlichen Herkunft als Chemiker, Internisten, Hämatologen etc. in ganz unterschiedlichen Fachgesellschaften organisiert. Zu diesen zählte auch die Deutsche Gesellschaft für Allergieforschung, an deren Gründung am 17. Juni 1951 in der Frankfurter Universitäts-Augenklinik bereits immunologisch interessierte Wissenschaftler wie Hans Schmidt, Richard Haas oder Hans Schlossberger beteiligt waren. 120 Auch Otto Westphal trat nach einer entsprechenden Aufforderung noch Anfang der 1950er-Jahre dieser Gesellschaft bei. 121 Doch erst seit Anfang der 1960er- Jahre im Zuge der wachsenden Bedeutung der Immunologie für die gesamte Medizin, und gerade auch für die Allergologie diskutierte man in der Gesellschaft eine stärkere Öffnung zu den Immunologen. Damals hoffte man, die noch»heimatlosen Immunbiologen und Immunpathologen«mit einer Namensänderung in»deutsche Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung«für eine Mitgliedschaft gewinnen zu können. Mit der Begründung, dass die Allergie ihre Wurzeln in der Immunologie habe, und dass es zwar Immunologie ohne Allergie geben könne, jedoch keine klinische Allergie ohne Immunologie, wurde die Namensänderung auf der 9. Tagung der Gesellschaft im Oktober 1963 durch die Mitglieder beschlossen. 122 Zu diesem Zeitpunkt gab es offensichtlich bereits Immunologen, die für die Gründung einer eigenen Gesellschaft eintraten. Gegen diese Stimmen warb der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allergie, Erich Letterer, der zugleich Koordinator der Arbeitsgemeinschaft der Immunologen war, in seiner Ansprache zur Eröffnung der Tagung eindringlich für eine gemeinsame Gesellschaft von Allergologen und Immunologen:»Wir dürfen Allergie und Immunologie nicht trennen, sondern wir müssen sie verbunden halten; denn das eine gehört zum anderen. Die Immunologie ist zu einem großen Teil die naturwissenschaftliche Grundlage dessen, was wir Allergie und allergische Krankheit nennen. Und aus diesem Grunde sollen und müssen sie zusammenbleiben.«123 Diese Namensänderung stieß jedoch bei einer Reihe von Immunologen auf Widerspruch. Otto Westphal z. B. sah diese Vereinigung nicht 120 Hans Schadewaldt: Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung , München 1984, S. 50f (künftig zit.: Schadewaldt, Geschichte). Hans Schmidt war von 1954 bis 1957 sogar Vorsitzender der Gesellschaft, ebd. S. 75 ff. 121 Ebd., S. 64; Adressbuch Deutscher Chemiker 1953/54, S Erich Letterer/Wilhelm Gronemeyer: Vorwort, in: dies. (Hrsg.): Allergie- und Immunitätsforschung. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung, Bd. 1, Stuttgart Erich Letterer: Eröffnungsansprache des Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung, in: ebd., S. 1 6, hier S. 5. als repräsentatives Gremium einer deutschen Immunologie einer zu modernisierenden immunologischen Forschung in der Bundesrepublik an. Auch weitere Gespräche, die Immunologie und Allergologie in einer gemeinsamen wissenschaftlichen Gesellschaft zu vereinigen, blieben erfolglos wurde die Gesellschaft für Immunologie gegründet. Popularisierung der Immunologie in Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft In den 1960er-Jahren erfuhr die Immunologie aufgrund ihrer Fortschritte in der Aufklärung von Abwehrprozessen des Körpers, der damit verbundenen Hoffnungen auf die Entwicklung neuer Krankheitstherapien sowie erster Erfolge in der praktisch-klinischen Anwendung eine bisher nicht gekannte Aufmerksamkeit, nicht nur in Kreisen hochspezialisierter Experten, sondern auch in der medizinischen Alltagspraxis und in der allgemein interessierten Öffentlichkeit. Zur verstärkten Wahrnehmung in der Bundesrepublik trugen auch die Gründung des MPI für Immunbiologie und die Einrichtung des DFG-Schwerpunktprogramms bei, die in Presseartikeln thematisiert wurden. 124 Zahlreiche medizinische Fachgesellschaften machten nun immunologische Fragestellungen zu einem Hauptthema ihrer Jahreskongresse. In seiner Eröffnungsansprache zum 68. Kongress der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin im Jahr 1962 beschrieb der Vorsitzende Ferdinand Hoff ( ) das Tagungsthema»Autoantikörper«als»eines der erregendsten Gebiete der heutigen Forschung«und hob seine große praktisch-klinische Bedeutung vor. 125 Zugleich erreichte die Immunologie ausweislich des Stichwortregisters des Deutschen Ärzteblattes 126 und der zahlreichen Fortbildungsangebote die medizinische Alltagspraxis, die sich in der Vergangenheit kaum mit immunologischen Problemen befasst hatte. 127 Auch für die Pharmaindustrie gewannen die neuen Erkennt- 124 Fruchtbare Wissenschaft Immunbiochemie, in: FAZ vom , S Ferdinand Hoff: Eröffnungsansprache des Vorsitzenden, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 68. Kongress (1962), S. 1 12, hier S Bis 1966 gibt es in den Registerbänden des Deutschen Ärzteblattes keine Stichworte»Immunologie«oder»Immunbiologie«oder»Immunchemie«. 127 In ihrem Bericht über den Internationalen Fortbildungskongress der Bundesärztekammer in Davos und Badgastein 1966 betonten die Autoren»die harte Kost was vor allem den älteren Kollegen unter uns serviert wurde«und zeigten sich über die Redundanz verschiedener Vorträge erleichtert,»sind doch den meisten von uns Ärzten während des Studiums mit den modernen Konzeptionen immunbiologischer Forschung und immunpathologischer Krankheitslehre nicht konfrontiert worden«, vgl. E. Heinz Graul/ Heino Ital: Grundfragen der Immunpathologie. Vom Internationalen Fortbildungskongreß der Bundesärztekammer in Davos und Badgastein, in: Deutsches Ärzteblatt Nr. 17 vom , S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 161
86 Alain de Weck (links) und Erwin Rüde auf der Titisee-Konferenz 1971 nisse in der immunologischen Forschung und die damit verbundenen Perspektiven eines therapeutischen Einsatzes immer mehr an Bedeutung. 128 In den 1952 von der Hoechst AG übernommenen Behringwerken wurden bereits kurz nach Kriegsende Arbeiten zur Reinigung von menschlichen Plasmaproteinen aufgenommen und 1946 ging hier die erste Plasmafraktionierungsanlage in Europa in Betrieb. 129 Der Einsatz unterschiedlicher Immunglobulin-Präparate erfolgte insbesondere zur Prophylaxe und Therapie bei Infektionskrankheiten sowie beim Antikörpermangelsyndrom. 130 Die wachsende Bedeutung immunologischer Forschung für die Industrie zeigte sich auch darin, dass sich das erste der seitdem regelmäßig in Grosse Ledder bei Köln veranstalteten Bayer Symposien im Oktober 1968 unter der Leitung von Otto Westphal, Hans-Erhard Bock und Ekkehard Grundmann dem Thema»Current Problems in Immunology«widmete. 131 Auch die vom Boehringer Ingelheim Fonds seit 1962 organisierten internationalen Titisee-Konferenzen thematisierten mehrfach aktuelle immunologische Forschungsgebiete. Ein besonderes, weltweites Presseecho fanden die ersten Organtransplantationen, die die Bedeutung von immunologischen Prozessen gerade für Laien offensichtlich und 128 P. Gronski/Friedrich Robert Seiler/Hans Gerhard Schwick: Discovery of Antitoxins and Development of Antibody Preparations for Clinical Uses from 1890 to 1990, in: Molecular Immunology 28 (1991), No. 12, S Prof. Dr. Hermann E. Schultze zum 60. Geburtstag, in: Behring-Archiv (Hrsg.): Behringwerk-Mitteilungen Heft 37 (1959), S. 6 9; Ebd.; Fritz Koch, Erste Erfahrungen mit Gamma-Venin, einem intravenös injizierbaren Gammaglobulin-Präparat, in der Kinderheilkunde, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 88 (1963), Otto Westphal/Hans-Erhard Bock/Ekkehard Grundmann (Hrsg.): Current Problems of Immunology (= Bayer Symposium I), Berlin et al nachvollziehbar machten. 132 Auch die sich allmählich herausbildende Tumorimmunologie geriet angesichts der Bedeutung der Volkskrankheit Krebs zum medialen Tagesthema. 133 Vielfach schien die Immunologie den Weg zur Lösung bisher rätselhafter Lebensund Krankheitsprozesse zu weisen. 134 Dies trug ebenso zur weiteren Popularisierung der Immunologie bei wie einschlägige öffentliche Kolloquien wie bspw. das 1974 unter dem Motto»Immunologie und Gesellschaft«135 stehende Marburger Forum Philippinum, das die Universität Marburg und der Universitätsbund seit 1959 in Erinnerung an das erste Marburger Religionsgespräch 1529 regelmäßig zur Stärkung des Austauschs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft veranstalteten. Damit stellt sich auch die Frage nach der Selbstwahrnehmung der Wissenschaftler, die die Immunologie in der Bundesrepublik aufbauten. Tatsächlich betrachteten sie sich als Avantgarde, 136 als Vertreter eines neuen, insbesondere in den angelsächsischen Ländern entwickelten Fachgebiets. Kennzeichnend sind ihre Abgrenzung zur traditionellen Bakteriologie und Hygiene sowie die starke Orientierung an der internationalen Scientific Community, die es erlaubten, sich nicht mit der nationalsozialistischen Vergangenheit der deutschen Mikrobiologie auseinandersetzen zu müssen Nora Wyss: Organverpflanzung und Körperabwehr, in: FAZ vom , S. 31; Das verpflanzte Herz hat Spielraum, in: FAZ vom , S. 7; Eberhard Greiser: Abwehr überlistet. Neue Wege der Immunbiologie, in: Die Zeit vom Biologische Abwehr gegen Krebs, in: FAZ vom , S. 9; Immunabwehr gegen Krebs, in: FAZ vom , S Altern immunologischer Selbstmord?, in: FAZ vom , S. 21; W. Cyran, Alterstod durch Auto- Immunreaktion?, in: FAZ vom , S. 38; Schizophrenie: Krieg im Körper, in: Der Spiegel vom , S. 150 f. 135 Hans Gerhard Schwick (Hrsg.): Immunologie und Gesellschaft. Impfung Allergie Autoaggression Transplantate Tumorimmunologie. Marburger Forum Philippinum November 1974, Stuttgart, Frankfurt/Main Vgl. hierzu bspw. Westphal an Mothes vom , in: Archiv der MPG, III. Abt./084/2 (Nachlass Adolf Butenandt), Nr Tatsächlich blickten mehrere Mitglieder der 1963 gegründeten Arbeitsgemeinschaft für Immunbiologie durchaus auf eine»nationalsozialistische Vergangenheit«zurück: Hans Erhard Bock, Richard Haas, Erich Letterer und Otto Westphal gehörten der NSDAP an, die drei letztgenannten auch der SS. Richard Haas war darüber hinaus durch die Übersendung von Fleckfieberimpfstoffen an das KZ Buchenwald an den dort durchgeführten Menschenversuchen beteiligt (vgl. Kapitel Weimar und NS). 162 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 163
87 Immunologische Forschung in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er-Jahre eine Auswahl Fritz Kauffmann, 1962 Mit Peter Medewars Beobachtung, dass die Abstoßung von Hauttransplantaten auf genetisch kontrollierten immunologischen Mechanismen beruhte, und mit der darauf aufbauenden Entdeckung der immunologischen Toleranz als Schlüsselprinzip des Immunsystems durch Medewar, Frank Macfarlane Burnet und andere erlebte die Immunbiologie in den 1940er-Jahren eine Renaissance. 138 Weitere grundlegende Anstöße erhielt sie durch neue konzeptionelle Erklärungsansätze wie die 1955 von Niels Jerne postulierte natürliche Selektionstheorie der Antikörperbildung, die von Burnet zur Klon-Selektionstheorie weiterentwickelt wurde. Auf der Grundlage dieser neuen Theorien und verbesserter Labormethoden explodierten das Fachgebiet und das von ihm generierte Wissen in den 1960-Jahren. Antigene: das Beispiel Endotoxine Zu den Entdeckern der Endotoxine in den 1890er-Jahren gehört unter anderem der Koch- Schüler Richard Pfeiffer ( ), der 1892 einen spezifischen Giftstoff mit außerordentlich intensivem toxischem Effekt in gezüchteten Cholerabakterien beschrieb. 139 Pfeiffer ging davon aus, dass»dieses primäre Choleragift [ ] in sehr enger Zusammengehörigkeit zu den Bacterienleibern«[steht] und [ ] vielleicht ein integrierender Bestandtheil derselben [ist]«. 140 Der Begriff»Endotoxin«wurde in der wissenschaftlichen Literatur unter anderem auch von Pfeiffer erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts benutzt. 141 Ab den 1950er-Jahren lieferte die Arbeitsgruppe um Otto Westphal und Otto Lüderitz am Dr. Wander-Forschungsinstitut und nach dessen Übernahme durch die Max- Planck-Gesellschaft am MPI für Immunbiologie in Säckingen bzw. Freiburg wesentliche Beiträge zur Isolierung der Endotoxine sowie zur detaillierten Aufklärung ihrer chemischen Struktur, die zum Teil in Zusammenarbeit mit weiteren Wissenschaftlern, insbesondere mit Erwin Neter, Fritz Kauffmann und Anne-Marie Staub, entstanden Arthur M. Silverstein: A History of Immunology, 2. überarb. und erw. Auflage, S. 455 ff. 139 Ernst Th. Rietschel/Jean-Marc Cavaillon: Richard Pfeiffer and Alexandre Besredka: creators of the concept of endotoxin and anti-endotoxin, in: Microbes and Infection 5 (2003), S , hier S (künftig zit.: Rietschel/Cavaillon, Richard Pfeiffer). 140 Richard Pfeiffer: Untersuchungen über das Choleragift, in: Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten 11 (1892), S , hier S Rietschel/Cavaillon, Richard Pfeiffer, S Vgl. hierzu insbes. Ernst T. Rietschel, Otto Westphal: Endotoxin: Historical Perspectives, in: Helmut Bra- Das hochgereinigte und hochmolekulare Lipopolysaccharid bestanden zu 60 Prozent aus Zuckerbausteinen und zu 40 Prozent aus Lipoiden. Nach der Erprobung im Tierexperiment und an gesunden Versuchspersonen (Studenten) kam es ab 1953 zunächst unter dem Namen»Pyrogen Wander«und ab 1956 unter dem Namen»Pyrexal Wander«143 in verschiedenen Kliniken im Rahmen der Reiztherapie zum Einsatz. 144 Antikörper Zunächst waren Antikörper mehr als Phänomene oder Wirkungsmechanismen und weniger als stoffliche Substanzen betrachtet worden. Insbesondere die Forschungen Michael Heidelbergers seit den 1920er-Jahren hatten jedoch gezeigt, dass sich durch Fraktionierung des Serums Antikörper gewinnen ließen, die chemisch gesehen zu der Gruppe der Proteine gehören. 145 de/steven M. Opal/Stefanie N. Vogel/David C. Morrison: Endotoxin in Health and Disease, New York, Basel 1999, S Neue Spezialitäten, in: Klinische Wochenschrift 34 (1956), S K. Voit/W. Tilling: Klinische Erfahrungen mit einem hochgereinigten Bakterienpyrogen, in: Ärztliche Wochenschrift 9 (1954), S ; G. Berg/W. Brichzy/J. Braunhofer/K. Th. Schricker: Vorläufige Erfahrungen mit pyrogenen Lipo-Polysacchariden, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 81 (1956), S Pierre Grabar: Grundbegriffe der Immunologie, in: Peter Miescher/Karl Otto Vorlaender (Hrsg.): Immunopathologie in Klinik und Forschung und das Problem der Autoantikörper, 2. verb. Aufl., Stuttgart 1961, S. 1 61, hier S. 6 ff. 164 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 165
88 Arne Tiselius erhielt 1937 bei der elektrophoretischen Trennung von Serumproteinen neben Albumin weitere drei Fraktionen mit unterschiedlicher Mobilität, die er als α-, β-, und γ-serumglobuline bezeichnete. 146 Kurz darauf konnte er gemeinsam mit Elvin A. Kabat zeigen, dass die meisten Antikörper den γ-serumglobulinen zuzuordnen waren. 147 Die in den 1950er-Jahren entwickelten verfeinerten immunologischen Bestimmungsmethoden ermöglichten eine weitere Auftrennung und Lokalisierung von Globulinen mit Antikörperaktivität auch in anderen Serumfraktionen. Wesentliche Beiträge zur Isolation und Charakterisierung von Serumproteinen lieferte die Arbeitsgruppe von Henry G. Kunkel am Rockefeller Institut in New York, zu der auch Hans J. Müller-Eberhard gehörte. Gemeinsam mit Kunkel und Edward C. Franklin ( ), der 1939 als Kind jüdischer Eltern aus Nazideutschland geflüchtet und in die USA emigriert war, 148 führte Müller-Eberhard nicht nur umfangreiche immunchemische Untersuchungen am»normalen«gammaglobulin (γ-globulin) vor, 149 sondern isolierte und charakterisierte auch den»rheumafaktor«. Aufgrund ihrer Untersuchungen äußerten die Forscher die Vermutung, dass es sich um einen Antikörper handele, der im rheumatischen Prozess eine Rolle spiele. 150 Der wissenschaftliche Leiter der Behringwerke, Hermann E. Schultze, konnte 1959 gemeinsam mit dem belgischen Forscherehepaar Joseph F. ( ) und Marie-Thérèse Heremans das β2a-globulin (später IgA) isolieren und charakterisieren. 151 Neben zahlreichen weiteren immunchemischen Analysen, 152 die er häufig gemeinsam mit Gerhard Schwick ausführte, verfasste Schultze 1966 zusammen mit Joseph Heremans das 900 Seiten umfassende Standardwerk»The Molecular Biology of Human Proteins«. 153 Die Bezeichnung»Immunglobulin«findet sich in deutschsprachigen Publikationen bereits vor Einführung der Elektrophorese, 154 wenngleich sich der Begriff in der heutigen Bedeutung erst ab Ende der 1950er-Jahre etablierte fasste der Schweizer Pädiater Walter H. Hitzig ( ) unter dem Begriff»Immun- oder Antikörperglobuline«all diejenigen Serumglobuline zusammen, die bei Menschen mit mangelnder Fähigkeit zur»normalen«antikörperproduktion fehlen. 155 Zwei Jahre später schlug Heremans vor, alle Serumglobuline mit Antikörperaktivität Immunglobuline zu nennen. 156 Auf diesen Vorschlag griff die 1964 von Immunologen aus Italien, USA, Tschechoslowakei, Schweiz, Frankreich, Sowjetunion, Belgien und England entworfene»nomenclature for Human Immunoglobulins«157 zurück und definierte Immunglobuline als»proteins of animal origin endowed with known antibody activity, and certain proteins related to them by chemical structure and hence antigenic specificity«. 158 Auch die uneinheitliche Schreibweise der größeren Immunglobulin-Klassen wurde in der Nomenklatur vereinfacht. Sie sollten nun wahlweise mit der Abkürzung Ig oder dem griechischen Buchstaben gamma (γ) gekennzeichnet werden. 159 Zu diesem Zeitpunkt waren die drei Immunglobulin-Klassen IgG (oder γg), IgA (oder γa) und IgM (oder γm) bekannt. Bis 1967 erhöhte sich die Anzahl der Klassen durch die Entdeckung des IgD (oder γd) durch David S. Rowe und 146 Arne Tiselius: Electrophoresis in serum globulin. II. Electrophoretic analysis of normal and immune sera, in: Biochemical Journal 31 (1937), S Arne Tiselius/Elvin A. Kabat: Electrophoresis of immune serum, in: Science 87 (1938), S ; dies.: An electrophoretic study of immune sera and purified antibody preparations, in: Journal of Experimental medicine 119 (1939), Henry G. Kunkel: Tribute to Edward C. Franklin, in: Clinical Immunology and Immunopathology 25 (Heft 3) (1982), V VI; Henry Metzger: Edward C. Franklin, April 14, 1928 February 20, 1982, in: Biographical Memoirs 78 (2000), S Edward C. Franklin war der Entdecker der nach ihm benannten Franklin disease oder heavy chain disease (Schwerketten-Krankheit). 149 Vgl. u.a. Hans J. Müller-Eberhard/Henry G. Kunkel/Edward C. Franklin: Two types of gamma-globulin differing in carbohydrate content, in: Proc. Soc. Exptl. Biol. Med. 93 (1956), S Hans J. Müller-Eberhard/Henry G. Kunkel/Edward C. Franklin: Das Vorkommen eines ungewöhnlichen Gamma-Globulin-Komplexes in Seren Rheumakranker, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 63. Kongress (1957), S ; Edward C. Franklin/Halsted R. Holman/Hans J. Müller-Eberhard/Henry G. Kunkel: An Unusual Protein Component of High Molecular Weight in the Serum of Certain Patients with Rheumatoid Arthritis, in: J. Exp. Med. 105 (1957), S ; Henry G. Kunkel/Edward C. Franklin/Hans J. Müller-Eberhard: Studies on the Isolation and Characterization of the»rheumatoid Factor«, in: Journal Clinical Investigation 38 (1959), Joseph F. Heremans/Marie- Thérèse Heremans/Hermann E. Schultze: isolation and description of a few properties of the β2a-globulin of human serum, in: Clinica Chimica Acta 4 (1959), S Vgl. bspw. Hermann E. Schultze: The synthesis of antibodies and proteins, in: Clinica Chimica Acta 4 (1959), S ; Hermann E. Schultze/Gerhard Schwick: Quantitative immunologische Bestimmung von Plasmaproteinen, in: Clinica Chimica Acta 4 (1959), S Hermann E. Schultze/Joseph F. Heremans: The Molecular Biology of Human Proteins. Nature and Metabolism of Extracellular Proteins, Amsterdam Hans Schmidt; Fortschritte; L. Hirzfeld/W. Halber/Z. Szojnicka: Über spezifische und unspezifische Reaktionen bei Flecktyphus, Krebs und Tuberkulose, in: Klinische Wochenschrift 14 (1935), S W.H. Hitzig: Die physiologische Entwicklung der»immunglobuline«(gamma- und Beta2-Globuline), in: Helvetica Paediatrica Acta 12 (1957), S Joseph F. Heremans: Immunochemical studies on protein pathology. The immunoglobulin concept, in: Clinica Chimica Acta 4 (1959), S Der Nomenklatur-Vorschlag war das Ergebnis eines WHO-Meetings über die Human-Immunglobuline am 29./30. Mai 1964 in Prag im Vorfeld des Internationalen Symposiums on the Cellular and Molecular Basis on Antibody Formation. Dieses hochkarätig besetzte Symposium mit 82 Teilnehmern fand ohne deutsche Beteiligung statt. Vgl. List of Participants, in: J. Šterzl (Hrsg.): Cellular and Molecular Basis on Antibody Formation. Proceedings of a Symposium held in Prague on June I 5, 1964, Prag 1965, S Bulletin der WHO 30 (1964), S ; vgl. auch S. Cohen: Nomenclature of the human immunoglobulins, in: Immunology 8 (1965), S Das Memorandum sah auch die Gründung eines WHO Reference Centre for Immunoglobulins vor beschloss das Nomenklatur-Komitee der International Union of Immunological Societies, alle Immunglobuline nur noch mit den Buchstaben Ig zu bezeichnen. Vgl. Nomenclature for Human Immunoglobulins, in: Bulletin of the World Health Organization 48 (1973), S. 373 f. 166 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 167
89 J. L. Fahey 160 sowie des IgE (oder γe) durch S.G.O. Johansson und H. Bennich 161 auf fünf; darüber hinaus konnten weitere Unterklassen beschrieben werden. 162 Zeitgleich befassten sich seit Ende der 1950er-Jahre verschiedene Arbeitsgruppen insbesondere um den Briten Rodney R. Porter ( ) und den US-Amerikaner Gerald M. Edelman ( ) mit der Aufklärung der Antikörperstruktur. Wesentliche Voraussetzung hierfür war die Entwicklung neuer Methoden zur Zerlegung des hochmolekularen Immunglobulins in kleinere Fragmente, die eine Sequenzanalyse erst ermöglichte. Porter gelang 1959 mit Hilfe des Enzyms Papain die Aufspaltung eines Kaninchen-IgG in zwei kleinere, chemisch und biologisch gleichartige Teile sowie einen dritten in der Struktur abweichenden größeren Abschnitt. 163 Ebenfalls 1959 konnte Edelman zeigen, dass humanes Gammaglobulin aus mehreren, durch Disulfidbrücken verbundenen Untereinheiten bestand, die sich durch ein Reduktionsmittel (Mercaptoäthanol) voneinander trennen ließen. 164 Innerhalb weniger Jahre konnten mehrere Arbeitsgruppen klären, dass sich das Antikörpermolekül aus vier Polypeptidketten zusammensetzte, und zwar aus zwei identischen leichten Ketten (L chain) mit einem Molekulargewicht von Da und zwei identischen schweren Ketten (H chain) mit einem Molekulargewicht von Da, die durch Disulfidbrücken Y-förmig miteinander verbunden sind. 165 Die von Porter zunächst als Fraction I, II und III bezeichneten Abschnitte erhielten 1964 die heute noch gültigen Bezeichnungen Fab (antigen binding) sowie Fc (crystallizable). 166 Anfang der 1960er-Jahre hatte sich zudem gezeigt, dass die nach ihrem Entdecker 167 benannten, im Urin bei Patienten mit multiplen Myelomen vorkommenden Bence- Jones-Proteine in ihrem Aufbau den Immunglobulinen stark ähnelten bzw. die gleiche 160 D.S. Rowe/J.L. Fahey: A new class of human immunoglobulins. II. Normal serum IgD, in: J. exp. Medicine 121 (1965), S Die neue Ig-Klasse war schon 1967 beschrieben worden, der Name»IgE«wurde erstmals 1968 in der Literatur verwendet, vgl. H.H. Bennich/K. Ishizaka/S.G.O. Johansson/D.R. Stanworth/W.D. Terry: Immunoglobulin E: A New Class of Human Immunoglobulin, in: Immunology 15 (1968), S Vgl. hierzu die Angaben bei S.G.O. Johansson/H. Bennich: Immunological Studies of an Atypical (Myeloma) Immunoglobulin, in: Immunology 13 (1967), S R.R. Porter: The Hydrolysis of Rabbit γ-globulin and Antibodies with Crystalline Papain, in: Biochem. J.73 (1959), S G. M. Edelman: Dissociation of γ-globulin, in: Journal of American Chemical Society 81 (1959), S Norbert Hilschmann: Das Antikörperproblem, ein Modell für das Verständnis der Zelldifferenzierung auf molekularer Ebene: in: Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Vorträge Nr. 262, Opladen 1977, S , hier S. 36 (künftig zit.: Hilschmann, Antikörperproblem). 166 Nomenclature for Human Immunglobulins, in: Bulletin of the WHO 30 (1964), S Der britische Arzt Henry Bence-Jones ( ) hatte 1848 erstmals Eiweißkörper als typische Bestandteile des Urins bei Patienten mit multiplen Myelomen beschrieben. Struktur wie die L-Ketten der Immunglobuline besaßen. 168 Da sie aus vergleichsweise kurzen Polypeptidketten bestehen, eine homogene Struktur aufweisen und einfacher zu isolieren waren als»normale«immunglobuline 169, führten zahlreiche Wissenschaftler ihre Untersuchungen zur Antikörperstruktur und zur Entschlüsselung der genetischen Grundlagen der Antikörperspezifität bevorzugt mit Bence-Jones-Proteinen durch. 170 Hierzu gehörte auch Norbert Hilschmann ( ), der von 1959 bis 1962 als Stipendiat am Max-Planck-Institut für Biochemie in der Arbeitsgruppe von Gerhard Braunitzer ( ) an der Strukturaufklärung der Eiweißkomponente des Hämoglobins beteiligt gewesen war. 171 Anschließend hatte er als Gastwissenschaftler am Rockefeller Institut in New York bei Lyman C. Craig ( ) Forschungen über Bence-Jones- Proteine aufgenommen. 172 Durch vergleichende Strukturuntersuchungen an zwei Bence-Jones-Proteinen konnten Hilschmann und Craig 1965 zeigen, dass Antikörper unterschiedlicher Spezifität zwar eine unterschiedliche Aminosäuresequenz aufwiesen, die Unterschiede jedoch auf die vordere, variable Hälfte des Moleküls beschränkt waren, während die hintere Hälfte für jeden Ketten-Typ eine identische Aminosäuresequenz aufwies, also konstant war. 173 Mit diesem Befund hatten Hilschmann und Craig»ein fundamentales Prinzip des Immunsystems entschlüsselt«. 174 Wie Hilschmann später schrieb, war mit der entdeckten 168 Frank N. Putnam: Structural relationships among normal human γ-globulin, myeloma globulins, and Bence-Jones proteins, in: Biochimica et Biophysica Acta 63 (1962), S ; G. M. Edelman/J. A. Gally: The nature of Bence-Jones Proteins. Chemical similarities to Polypeptide chains of Myeloma globulins and normal γ-globulins, in: Journal of Experimental Medicine 116 (1962), S Vgl. Auch Alfred Nisonoff: Early Investigations on Antibody Structure and Idiotypy, in: Immunology. The Making of a modern science, S , hier S. 122f; Frank W. Putman: Immunoglobulins I. Structure, in: ders.: The Plasma Proteins. Structure, Function and Genetic Controll, Second Edition, Volume III, New York/San Francisco/London 1977, S , hier: S Ahmad Fateh-Moghadam: Paraproteinämische Hämoblastosen, in: Paraproteinämische Hämoblastosen, in: Handbuch der inneren Krankheiten, Zweiter Band: Blut und Blutkrankheiten, Teil 5: Krankheiten des lymphocytären Systems, 5. völlig neu bearb. und erw. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York 1974, S , hier 250 (künftig zit.: Fateh-Moghadam, Paraproteinämische Hämoblastosen); Felix Haurowitz: Struktur und Wirkungsweise der Antikörper, in: Die Naturwissenschaften 56 (1969), S O. Wetter/W. Braun/Ch. Hertenstein: Zur Struktur des Bence-Jones-Proteins, in: Acta Haematologica 38 (1967), S Vgl. u. a. G. Braunitzer/N. Hilschmann/V. Rudloff/K. Hilse/B. Liebold/R. Müller: The Haemoglobin Particles. Chemical and Genetic Aspects of their Structure, in: Nature 190 (1961), S Lebenslauf Norbert Hilschmann, November 1969, in: HHStaW Abt. 504 Nr Norbert Hilschmann/Lyman C. Craig: Amino Acid Sequence Studies with Bence-Jones-Proteins, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 53, Nr. 6 (15. Juni 1965), S Jürgen Wienands: Nachruf auf Norbert Hilschmann 8. Februar Dezember 2012, in: Jahrbuch der Göttinger Akademie der Wissenschaften, Bd. 2013, Heft 1 (Sep 2014), S (künftig zit.: Wienands, Nachruf Hilschmann). 168 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 169
90 Links: Norbert Hilschmann, ca Rechts: Georges Köhler, o. D. Zweiteilung der Struktur das bisher postulierte»ein-gen-ein-protein-dogma«so nicht mehr haltbar. 175 Vielmehr ließ sich daraus folgern, dass sich die Antikörper-Spezifität bzw. -vielfalt allein auf den variablen Teil des Proteins gründet, während der hintere Teil als für alle Antikörper charakteristisches fixes Gerüst anzusehen war kehrte Norbert Hilschmann in die Bundesrepublik zurück, um seine Forschungen am Max- Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen fortzusetzen. Hier arbeitete er weiterhin an der immunchemischen Aufklärung der Antikörperstruktur, unter anderem publizierte er 1967 die erste vollständige Aminosäurenfolge für die ϰ-kette. 177 Darüber hinaus befasste er sich auf der Grundlage eigener Untersuchungsergebnisse mit der damals wissenschaftlich heiß umstrittenen Frage der Genese der Antikörpervielfalt, für deren Erklärung im Wesentlichen die Keimbahntheorie und die somatische Mutationstheorie diskutiert wurden. 178 Die vollständige Entschlüsselung des chemischen Aufbaus eines Antikörper-Moleküls (IgG) verkündete Gerald M. Edelman im April 1969 und entschied damit einen dreieinhalbjährigen Wettlauf mit Rodney R. Porter für sich. 179 Beide Forscher erhielten nur drei Jahre später für ihre Entdeckungen im Bereich der chemischen Struktur von Antikörpern den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Hilschmann, dessen Leistung beide Preisträger im Dezember 1972 in ihren Nobel Lectures würdigten, 180 wurde trotz seiner fulminanten wissenschaftlichen Entdeckung nicht bedacht, möglicherweise auch, weil er sich mit seinem Verhalten bei der Erstpräsentation seiner noch nicht publizierten Befunde während eines hochkarätig besetzten Antibody-Workshops in Kalifornien im Februar 1965 zahlreiche Feinde gemacht hatte. 181 Knapp zehn Jahre nach den für die Klärung der Antikörper-Variabilität so wichtigen Beschreibungen Hilschmanns sollte dem damals ebenfalls am»antikörper-problem«forschenden Georges Köhler ( ) am Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology in Cambridge ein Experiment gelingen, das in der Folgezeit dann als nobelpreiswürdig erachtet wurde. Köhler hatte nach einem Biologie-Studium in Freiburg 1974 bei Fritz Melchers am Institut für Immunologie in Basel bzw. an der Universität Freiburg mit einer»analyse der Heterogenität von Antikörpern gegen das Enzym β-galactosidase aus Escherichia coli«promoviert. 182 Zur Fortsetzung seiner Mutationsforschungen insbesondere wollte er die Mutationsraten von Antikörpergenen messen und den Einfluss von Genen auf die Antikörperbindungsstelle untersuchen 183 wechselte Köhler als Post-Doc zu dem immungenetisch arbeitenden Caesar Milstein ( ) in Cambridge, in dessen Laboratorium die Kultivierung und Klonierung von Myelomzellen aus Mäusen bereits gelungen war. Für seine eigenen Forschungen benötigte Köhler allerdings normale B-Zellen, die sich in Gewebekultur vermehren ließen und zugleich einen einzigen Antikörpertyp produzierten. Diese Anforderung hatte schon viele Forscher vor ihm angesichts der kurzen Überlebenszeit von Lymphozyten außerhalb des Körpers vor unlösbare Probleme gestellt. Nach anfänglichen Rückschlägen kam Köhler wie er später berichtete der entscheidende Einfall im Bett, kurz vor dem Einschlafen. 184 Seine Idee war so einfach wie 175 Hilschmann, Antikörperproblem, S Wienands, Nachruf Hilschmann, S. 199 f. 177 Fateh-Moghadam: Paraproteinämische Hämoblastosen, S. 252; Norbert Hilschmann: Die Struktur von zwei Bence-Jones-Proteinen (Roy und Cum) vom ϰ-typ, in: Hoppe-Seylers Z. Physiol. Chemie 348 (1967), S ; ders: Die vollständige Aminosäuresequenz des Bence-Jones-Proteins Cum (Kappa- Typ), in: Hoppe-Seylers Z. Physiol. Chemie 348 (1967), S Norbert Hilschmann: Zum Mechanismus der Antikörperbildung, in: Hoppe-Seylers Z. Physiol. Chemie 348 (1967), S ; Norbert Hilschmann: Die molekularen Grundlagen der Antikörperbildung, in: Die Naturwissenschaften 56 (1969): Amok im Blut, in: Der Spiegel 17/1969, S. 184; Gute Ware, in: Der Spiegel 48/1972, S. 189 f. 180 Rodney R. Porter: Structural Studies of Immunoglobulins, medicine/laureates/1972/porter-lecture.pdf; Gerald M. Edelman: Antibody Structure and Molecular Immunology, Vgl. Bericht Fritz Melchers als Teilnehmer des Workshops und Zeugen der Präsentation, Fritz Melchers: Remembering antibodies coming of age, in: European Journal of Immunology 46 (2016), S (künftig zit.: Melchers, Remembering antibodies). 182 Vgl. zu Köhlers Werdegang und Experimenten die grundlegende Monographie Klaus Eichmann: Köhler s Invention, Basel Vgl. Köhlers eigenen Bericht, zit. bei Melchers, Rembering antibodies, S. 48 f. 184 Annelies Furtmayr/Günter Haaf:»Im Bett kam mir dann eine Idee«. Georges Köhler löste eine medizi- 170 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 171
91 genial: die Verschmelzung einer vorselektierten B-Zelle mit einer unbegrenzt teilungsfähigen Myelomzelle zu einem Zellhybrid, der die besonderen Eigenschaften beider»elternteile«in sich vereinigt und damit zur unbegrenzten Produktion gleichförmiger (monoklonaler) Antikörper befähigt ist. Für seine im Herbst 1974 begonnenen Versuche griff Köhler auf den von Niels Jerne und Albert Nordin 1963 beschriebenen hämolytischen Plaque-Test zurück, 185 den andere Autoren später weiterentwickelten. Dabei wurde eine Suspension von Milzzellen eines gegen Schaferythrozyten immunisierten Kaninchens mit Schaferythrozyten in Weich-Agar vermischt und als dünne Schicht ausgestrichen. Nach einstündiger Inkubation der Platten bei 37 Grad wurde Meerschweinchenkomplement zugegeben und die Platten wurden nochmals inkubiert. Das Komplement lysierte die Erythrozyten, die Antikörper gebunden hatten, so dass anschließend auf der Platte mit bloßem Auge Hämolysezonen (Plaques) mit einer lymphoiden Zelle im Zentrum zu erkennen waren. Mit der sogenannten Jerne-Plaque-Technik war es möglich, auf ganz einfache Weise die Anzahl antikörperbildender Zellen in einer Zellsuspension zu bestimmen und die Vorgänge der zellularen Immunantwort im Tierversuch nach Injektion von Schaferythrocyten genauer zu studieren. 186 Köhler gewann zunächst B-Zellen aus dem Milzgewebe von zuvor mit Schafserythrozyten immunisierten Mäusen und mischte diese mit den im Milstein-Labor kultivierten Myelomzellen, wobei er zur Unterstützung der Zellfusion Sendai Virus zusetzte. 187 Nach sieben Wochen, kurz vor Weihnachten, entschied sich Köhler, die Fähigkeit der in der Nährlösung entstandenen und sich vermehrenden Zellhybride zur Produktion von monoklonaler Antikörpern zu überprüfen. Als er die Testplatten gemeinsam mit seiner Ehefrau kontrollierte, konnte er feststellen, dass sich um zahlreiche der zuvor erzeugten Zellhybride helle Höfe gebildet hatten. Später beschrieb Köhler diese Entdeckung mit den Worten:»Das war unglaublich! Ich jubelte, küßte meine Frau, ich war völlig außer mir. Es war das beste Ergebnis, das ich mir vorstellen konnte.«188 Im Mai 1975 reichten Köhler und Milstein ihre Beschreibung des Versuchsaufbaus bei der Zeitschrift Nature ein und beendeten den Aufsatz mit dem untertriebenen Fazit»Such cultures could be valuable for medical and industrial use«. 189 Nur neun Jahre nach Georges Köhler und Niels Jerne bei der spontanen Feier anlässlich der Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin in Georges Köhlers Labor im Institut für Immunologie in Basel, 15. Oktober 1984 der Veröffentlichung im August 1975 erhielten die beiden Autoren für die Entdeckung des Prinzips zur Herstellung monoklonaler Antikörper gemeinsam mit Niels Jerne 1984 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Jerne bekam die Ehrung für seine Theorien über den spezifischen Aufbau und die Steuerung des Immunsystems, auf denen auch die Überlegungen Köhlers für die Entwicklung monoklonaler Antikörper aufbauten. Innerhalb kurzer Zeit revolutionierte die erst später so bezeichnete Hybridomtechnik, die Köhler und Milstein nicht hatten patentieren lassen, 190 die biomedizinische Forschung in Industrie und Wissenschaft. Monoklonale Antikörper waren nicht nur in der immunologischen Grundlagenforschung oder der Gentechnologie als technisches Hilfsmittel vielseitig einsetzbar, sondern auch in der medizinischen Diagnostik und Therapie wurde mit Muromonab CD3, einem Mittel zur Suppression akuter Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantationen, der erste monoklonale Antikörper weltweit von der U.S. Food and Drug Administration für therapeutische Zwecke zugelassen. 192 Die Nachricht des Nobelpreis-Komitees erreichte Köhler und Jerne am nische Revolution aus, in: Die Zeit vom (künftig zit.: Furtmayr-Schuh/Haaf:»Im Bett «). 185 Niels K. Jerne/Albert A. Nordin: Plaque Formation by Single Antibody-Producing Cells, in: Science 140, 26. April 1963, S Elvin A. Kabat: Einführung in die Immunchemie und Immunologie (=Heidelberger Taschenbücher, Bd. 79), Heidelberg/New York 1971, S. 199 f. 187 Vgl. hierzu Köhlers Bericht in Melchers, Remembering antibodies, S. 48 f. 188 Furtmayr-Schuh/Haaf:»Im Bett «. 189 Georges Köhler/César Milstein: Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity, in: Nature 256, 7. August 1975, S Caesar Milstein hatte den britischen Behörden offensichtlich die Patentierung des Verfahrens vorgeschlagen, jedoch keine Antwort auf seinen Anfrage erhalten, vgl. Nicholas Wade: Hybridomas: The Making of a Revolution, in: Science 215 (1982), S , S Friedrich Robert Seiler/Peter Gronski/Roland Kurrle/Gerhard Lübes/Hans-Peter Harthus Wolfgang Ax/ Klaus Bosslet/Hans-Gerhard Schwick: Monoklonale Antikörper: Chemie, Funktion und Anwendungsmöglichkeiten, in: Angewandte Chemie 97 (1985), S Holger Neye: Monoklonale Antikörper: Ximab, Zumab und Umab als Arzneimittel, in: Pharmazeutische Zeitung Ausgabe 43/ ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 173
92 15. Oktober 1984 im Institut für Immunologie in Basel. 193 Kurz darauf wechselte Köhler als Direktor an das MPI für Immunbiologie in Freiburg, starb jedoch bereits 1995 im Alter von nur 48 Jahren an Herzversagen. Komplement Das Komplement als eine neben Antikörper und Antigen an den Immunreaktionen beteiligte hitzelabile Serumkomponente wurde ab den 1880er-Jahren von verschiedenen Wissenschaftlern insbesondere von Jules Bordet beschrieben. Als allgemein verbindliche Bezeichnung setzte sich später der von Paul Ehrlich verwendete Begriff»Komplement«durch. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war lediglich bekannt, dass es sich um eine Serumfunktion handelt, die beim Erhitzen auf 56 C erlischt. 194 In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass es sich bei Komplement um keinen einheitlichen Wirkstoff handelte, sondern um mehrere aufeinander abgestimmte Komponenten, die sich mit entsprechenden Verfahren serologisch und chemisch trennen ließen. Zwischen 1907 und 1926 wurden insgesamt vier Komponenten beschrieben. Zunächst gelang es Adolpho Ferrata und Erwin Brand, das Komplement in zwei Fraktionen aufzuteilen, die in der Folgezeit als Mittel- und Endstück bezeichnet wurden. Vor dem Ersten Weltkrieg deckten Leonid Omorokow (1911), Hans Ritz (1912) und Arthur Coca (1914) in Beiträgen für die Zeitschrift für Immunitätsforschung die Existenz einer dritten Komponente auf und 1926 folgte die Erstbeschreibung einer vierten Komponente durch eine Arbeitsgruppe um John Gordon. 195 Die Bezeichnung C 1 bis C 4 für diese vier»klassischen«komponenten geht auf einen Vorschlag der an der Western Reserve University in Cleveland forschenden Immunologen Louis Pillemer ( ) und Enrique E. Ecker ( ) zurück, den diese im November 1941 nach Diskussion mit Michael Heidelberger und mit seiner Zustimmung in der Zeitschrift Science veröffent- 193 Melchers, Remembering antibodies, S. 50. Der Leiter des Instituts, Fritz Melchers, hatte sich im Vorfeld nicht nur im Karolinska Institut in Stockholm für eine Auszeichnung Georges Köhler eingesetzt, sondern auch den Science-Journalisten Nicholas Wade mobilisiert. Dieser publizierte im Februar 1982 unter der Überschrift»Hybridomas. The Making of a Revolution»einen Beitrag mit dem deutlichen Hinweis im Untertitel:»Scientific prize committees sometimes skimp on their homework. The awards for the hybridoma technique may be a case in point«, vgl. Science 215 (1982), S Herbert Fischer/I. Haupt: Serumkomplement: Übersicht und aktuelle Probleme, ebd., S Peter Lachmann: Complement before molecular biology, in: Molecular Immunology 43 (2006), S , hier S. 497 (künftig zit.: Lachmann, Complement); Edward J. Moticka: A historical perspective on evidence-based immunology, Amsterdam et al. 2016, S. 97 (künftig zit.: Moticka, A historical perspective). lichten. 196 Die Arbeitsgruppe um Pillemer und Ecker konnte zudem durch chemische Fraktionierung von Meerschweinchenserum die Komponenten C 1, C 2 und C 4 hochangereichert und teilweise physikalisch-chemisch homogen erhalten und ihren schon zuvor vermuteten Proteincharakter bestätigen. 197 Ähnliche Studien unternahm zeitgleich in New York Michael Heidelberger mit seinen Assistenten, zu denen auch Manfred M. Mayer ( ) zählte, der Ende 1933 als Jugendlicher gemeinsam mit seinen Eltern aus dem nationalsozialistischen Deutschland emigrieren musste. 198 Letzterer leitete mit seiner Arbeitsgruppe durch die Verwendung kinetischer Methoden der Enzymanalyse in den 1950er-Jahren eine neue Ära der Komplement-Forschung ein, die ihn unter anderem zur Entwicklung seiner»ein-treffer-theorie«führte entdeckte die Arbeitsgruppe um Louis Pillemer bei dem Versuch, eine Komponente des Komplements (C 3) zu isolieren, ein neues Serumprotein (Properdin), dem sie eine wichtige Rolle bei der natürlichen, unspezifischen Immunität zuschrieben. 200 In den 1960er-Jahren trugen mehrere Forschergruppen in den USA sowie in der Bundesrepublik zur weiteren Entschlüsselung des Komplementsystems und zur physikochemischen Isolierung der C -Komponenten und Klärung der molekularen Vorgänge während der Komplement-Reaktion bei. Irwin Lepow ( ) konnte 1963 mit seinen Kollegen an der Western Reserve University in Cleveland C 1 in drei Aktivitäten auftrennen, die die Bezeichnung C 1q, C 1r und C 1s erhielten. 201 Der aus der Bundesrepublik Deutschand stammende Hans J. Müller-Eberhard, der bei seinem zweiten USA- Aufenthalt ab 1959 zunächst erneut am Rockefeller-Institut und ab 1963 an der Scripps Clinic and Research Foundation in La Jolla (California) forschte, hatte bereits 1961 das am Beginn der Komplement-Reaktionskette stehende 11S-Globulin entdeckt, das sich 196 Louis Pillemer/Enrique E. Ecker: The terminology of the Components of Complement, in: Science 94 (November 7, 1941), S Louis Pillemer/Enrique E. Ecker/J.L. Oncley, E.J. E.J. Cohn: The preparation and physikochemical characterization of the serum protein components of complement, in: Journal of Experimental Medicine 74 (1941), S ; vgl. auch Otto Westphal, Immunchemie (1957), S. 970 ff. 198 Zu Forschungskontroversen zwischen diesen beiden Gruppen vgl. Lachmann, Complement, S Ulrich Hadding: Komplement und Komplement-Reaktion, in: Klaus Rother/Ulrich Hadding/Gerd Till: Komplement. Biochemie und Pathologie, Darmstadt 1974, S. 3 93, hier S. 3, 90 (künftig zit.: Hadding, Komplement). 200 Louis Pillemer/Livia Blum/Irwin H. Lepow/Oskar A Ross/Earl W. Todd/Alastair C. Wardlaw: The Properdin System and Immunity: I. Demonstration and Isolation of a New Serum Protein, Properdin, and Its Role in Immune Phenomena, in: Science 120 (1954), S Später sollte sich das von ihnen beschriebene Properdinsystem als alternativer, antikörperunabhängiger Weg zur Komplementaktivierung erweisen. 201 Irwin H. Lepow/G.B. Naff/Earl W. Todd/J. Pensky/C.F. Hinz: Chromatographic resolution of the first component of human complement into three activities, in: Journal of Experimental Medicine 117 (1963), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 175
93 später als identisch mit dem C 1q erweisen sollte. 202 Ferner gelang es ihm, nicht nur verschiedene Komplementfaktoren in hochgereinigter Form zu gewinnen, sondern auch die molekularen Vorgänge beim Ablauf der Reaktionskette weitgehend aufzuklären. 203 Zugleich arbeitete er ebenso wie die Arbeitsgruppe um Robert A. Nelson in Florida sowie die Arbeitsgruppe um Paul Klein am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Mainz an der Auftrennung des klassischen C 3 in weitere Einzelkomponenten, wobei Müller-Eberhard seine Untersuchungen mit Humanserum durchführte, während die beiden anderen Arbeitsgruppen Meerschweinchenserum nutzten. 204 Während Robert Nelson und seine Mitarbeiter in Florida 1962/63 die Auftrennung des klassischen C 3 in vier Komponenten beschrieben, gelang der Arbeitsgruppe um Paul Klein in Mainz nahezu zeitgleich eine Aufschlüsselung in fünf Komponenten. 205 Schließlich konnte Nelson 1966 zeigen, dass C 3 sogar aus sechs Komponenten besteht. 206 Die verschiedenen Forschergruppen hatten für die von ihnen beschriebenen neuen Einzelkomponenten jeweils eigene Bezeichnungen gewählt. 207 Im Mai 1964 war dieses Nomenklatur-Wirrwarr Thema ausführlicher Diskussionen auf einem Symposium in London, zu dem die CIBA Foundation 24 renommierte Komplementforscher darunter Paul Klein und Hans J. Müller-Eberhard geladen hatte. 208 Auf einem weiteren, 1966 in La Jolla abgehaltenen Komplement-Workshop wurde dann der bereits mehrfach 202 Hans J. Müller-Eberhardt/Henry G. Kunkel: Isolation of the thermolabile serum protein which precipitates gamma-globulin aggregates and participates in immune hemolysis, in: Proc. Soz. Exp. Biol. Med.106 (1961), S Vgl. mit weiteren Hinweisen Müller-Eberhard, Chemie; ferner Hans J. Müller-Eberhard/Agustin P. Dalmasso/Mary Ann Calcott: The reaction mechanism of β1c-globulin (C 3) in immune hemolysis, in: Journal of Experimental Medicine 123 (1966), S Moticka, A historical perspective, S. 98; Neil R. Cooper: in: Molecular Immunology 43 (2006), S , hier S R. Sauthoff/H.J. Wellensiek/Paul Klein: Über die multiple Natur der 3. Komponente des Meerschweinchenkomplements, in: International Archives of Allergy and Applied Immunology 22 (1963), S ; vgl. Fischer/Haupt, Serumkomplement, S Kozo Inoue/Robert A. Nelson: The Isolation and Characterization of a ninth Component of Hemolytic Complement, C 3f, in: The Journal of Immunology 96 (1966), S Paul Klein bezeichnete 1964 die von ihm gewählten Begriffe als vorläufig und in keinem Zusammenhang mit den von Linscott, Nelson oder Müller-Eberhardt gewählten stehend, vgl. Paul Klein: Faktorenanalyse der dritten Komplementkomponente, in: Otto Westphal (Bearbeiter): Immunchemie (= 15. Colloquium der Gesellschaft für Physiologische Chemie am 22./25. April 1964 in Mosbach/Baden), Berlin et al. 1965, S , hier S Auf demselben Kolloquium berief sich Müller-Eberhard auf eine Übereinkunft mit Lepow in Cleveland, nach der»wir die Aktivitäten der ersten Komponente als C 1q, C 1r und C 1s [bezeichnen]. Ferner schlagen wir vor, die übrigen Faktoren einfach C 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 zu nennen.«vgl. Hans J. Müller-Eberhard: Chemie der Komplement-Faktoren, ebd., S , hier S. 309 f. 208 Discussion Nomenclature and fixation of C 3 Components, in: G.E.W. Wolstenholme/Julie Knight (Hrsg.): Ciba Foundation Complement, London 1965, S Hans J. Müller-Eberhard, 1980er-Jahre von Müller-Eberhardt eingebrachte Vorschlag einer fortlaufenden Nummerierung als Grundlage für die weiteren Forschungen angenommen und auf dem dritten, 1968 in Boston durchgeführten Workshop die vereinfachte Schreibweise C1, C2 etc. beschlossen. 209 Auf der Grundlage dieser Workshop-Beratungen entwarf ein elfköpfiges Sachverständigengremium, dem auch Müller-Eberhard angehörte, ein Memorandum zur Nomenklatur des Komplements, das 1968 im Bulletin der WHO veröffentlicht wurde. 210 Dieses WHO-Memorandum sanktionierte auch die bisher gebräuchliche Bezeichnung der Einzelkomponenten in Anlehnung an die Chronologie ihrer Entdeckung, die nicht ihrer Position im Ablauf der Reaktionskette entspricht. Tatsächliche erfolgt die Komplementreaktion in der Abfolge: C1 C4 C2 C3 C5 C6 C7 C8 C Wesentliche Beiträge zur Komplementforschung erarbeiteten darüber hinaus Klaus und Ursula Rother, die ihre wissenschaftliche Karriere in Freiburg starteten entdeckten sie einen angeborenen Komplementdefekt bei Kaninchen, wobei sie zunächst von einer Störung des klassischen C 3 ausgingen. 212 Mit der Weiterzucht dieser natürlich komplementdefekten Tiere (Freiburg-R 3-Stamm) hofften sie, die Rolle des Komplements bei verschiedenen allergischen Reaktionen und der Immunhämolyse besser 209 J. M. Weiler: Introduction, in: Keith Whaley (Hrsg.): Complement in Health and Disease, 2. Aufl., Dordrecht 1993, S 1 37, hier S Nomenclature of Complement, in: Bull WHO 39 (1968), S Paul Klein wurde in dem Memorandum ebenfalls namentlich erwähnt, offensichtlich als ein an den Diskussionen beteiligter Wissenschaftler. 211 Ulrich Hadding/Dieter Bitter-Suermann: das Komplementsystem und seine Funktionen, Deutsches Ärzteblatt, Heft 13 vom , S , hier: S. 932 f. 212 Ursula Rother/Klaus Rother: Über einen angeborenen Komplementdefekt bei Kaninchen, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 121 (1964), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 177
94 bestimmen zu können. Die von ihrer Freiburger Arbeitsgruppe durchgeführten Versuche zeigten unter anderem, dass das Serum dieser Kaninchen keine bakterizide Wirkung auf einen als C -empfindlich bekannten Salmonellenstamm ausübte. 213 Zudem gelang es nicht bzw. nur in minimaler Ausprägung, eine passive Arthus-Reaktion bei den komplementdefekten Kaninchen auszulösen. 214 Die Untersuchungen der Freiburger Arbeitsgruppe stießen in den USA auf großes Interesse. 215 Das Ehepaar Rother erhielt das Angebot, seine Komplementforschungen an einer US-amerikanischen Universität weiterzuführen. 216 Hier stellte sich nach der gelungenen Auftrennung des klassischen C 3 in sechs Einzelkomponenten bei gemeinsamen Untersuchungen mit Hans J. Müller-Eberhard und Ulf R. Nilsson heraus, dass der von ihnen als Freiburg R-3 Stamm bezeichnete Kaninchenstamm nicht an einem C3-, sondern an einem C6-Defekt litt. 217 Nachdem ein ebenfalls C6-defekter Kaninchenstamm in Mexiko-City aufgefunden worden war, konnten sie zudem durch einen Versuchstiertausch das bisher einschränkende Inzuchtproblem lösen. 218 Die Beobachtung der ebenfalls C6-defekten Nachkommen der gekreuzten Stämme in Verbindung mit den neuesten Ergebnissen der Komplementforschung veranlasste Klaus Rother zum einen zu der Interpretation, dass alle C-Faktoren an der bakteriziden Wirkung des Komplements beteiligt seien. Zum anderen äußerte er angesichts der Tatsache, dass die zur Bakterizidie unfähigen komplementdefekten Tiere keine höhere Infektanfälligkeit als normale Kaninchen und eine ähnliche Lebenserwartung aufwiesen, die Vermutung, dass die Bakterizidie nur einer von mehreren Faktoren sei,»die zur Resistenz gegen Infektionen beitragen«. Offensichtlich könne das Fehlen 213 Klaus Rother/Ursula Rother/Kurt Friedrich Petersen/Diethard Gemsa/Frank Mitze: Immune bacterial activity of complement. Separation and description of intermediate steps, in: Journal of Immunology 93 (1964), S Klaus Rother/Ursula Rother/ Frank Schindera: Passive Arthus-Reaktion bei Komplement-defekten Kaninchen, in: Zeitschrift für Immunitäts- und Allergieforschung 126 (1963), S ; Klaus Rother: Die Bedeutung des Komplements für allergische Reaktionen in vivo, in: International Archives of Allergy and Applied Immunology 22 (1963): Vgl. bspw.: Manfred M. Mayer: Mechanism of Haemolysis, in: Ciba Foundation Symposium, S Infolge der im Journal of Immunology publizierten Ergebnisse bot die New York City University Klaus Rother eine Professur an. Der an den Experimenten beteiligte Doktorand Diethard Gemsa erhielt ein dreijähriges Stipendium an der University of Washington in Seattle. Ausschlaggebend war das Interesse der US-amerikanischen Wissenschaftler an dem besonderen Kaninchenstamm mit angeborenem Komplementdefekt, vgl. von Diethard Gemsa vom Klaus Rother/Ursula Rother/Hans J. Müller-Eberhard, Ulf R. Nilsson: Deficiency of the sixth component of complement in rabbits with an inherited complement defect, in: Journal of Experimental Medicine 124 (1966), S Klaus Rother: Serumkomplement als möglicher Resistenzfaktor: Opsonierung und Bakterizidie, in: G. Mösner/R. Thomssen: IV. Internationaler Kongreß für Infektionskrankheiten vom 26. Bis 30. April 1966 in München. Verhandlungsbericht, Stuttgart 1967, S , hier S. 338 (künftig zit.: Rother, Serumkomplement). Ursula und Klaus Rother, o. D. eines einzelnen Mechanismus, so Rother, durch einen anderen wie hier durch die intakte Immunopsonierung für Phagozytose kompensiert werden. 219 Während ihres USA-Aufenthalts führten Ursula und Klaus Rother zahlreiche weitere Untersuchungen mit dem komplementdefekten Kaninchenstamm durch, unter anderem über die Beteiligung des Komplementsystems an der Abstoßung von Transplantaten. 220 Auf diesem Gebiet forschten sie auch nach ihrer Rückkehr aus den USA im Rahmen der DFG-Forschergruppe»Immunbiologie«in Freiburg weiter. 221 Weitere Beiträge lieferte Herbert Fischer, zunächst als Mitarbeiter von Ferdinand Hoff in Frankfurt und ab 1962 am MPI für Immunbiologie in Freiburg. Fischer verfasste unter anderem Arbeiten zum Properdin und zur Beteiligung des Komplementsystems an der Eliminierung geschädigter und alternder Zellen. Seine Untersuchungen über die Komplementwirkungen führten ihn zu dem Schluss, dass die»cytolysierende«wirkung von Serumkomplement auf der Bildung von Lysolecithin beruhe, das enzymatisch aus Zellmembranlecithin durch Komplementaktivierung erzeugt wurde. 222 Seine Lysoleci- 219 Rother, Serumkomplement, S Ursula Rother/Donald L. Ballantyne/Carl Cohen/Klaus Rother: Allograft rejection in C 6 detective rabbits, in: Jornal of Experimental Medicine 126 (1967), S Diese Versuche hatten sie bereits in Freiburg aufgenommen, vgl. Heinz Volk, Detlef Mauersberger/Klaus Rother/Ursula Rother: Prolonged survival of skin homografts in rabbits detective in the third component of complement, in: Annals of the New York Academy of Sciences 120 (1964), S Bericht der DFG über ihre Tätigkeit vom 1.1. bis zum , S. 106; Bericht der DFG über ihre Tätigkeit vom 1.1. bis zum , S. 68; Tätigkeitsbericht der DFG 1970, S. 83 f. 222 Herbert Fischer/I. Haupt: Das cytolysierende Prinzip von Serumkomplement, in: Zeitschrift für Naturforschung B, 16. Jg. (1961), S ; Peter Lachmann, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 179
95 thin-hypothese trug Fischer große internationale Aufmerksamkeit ein, 223 doch traf sie schon bald auf Widerspruch 224 und ließ sich später durch elektronenmikroskopische Untersuchungen nicht bestätigen. 225 Autoimmunkrankheiten Der US-amerikanische Immunologe und Wissenschaftshistoriker Arthur M. Silverstein bezeichnete es als ein Kuriosum in der Wissenschaft, dass bestimmte, bereits gutbelegte Erkenntnisse nicht Bestandteil der gängigen Lehrmeinung wurden, so dass sie viele Jahre später erst neu entdeckt werden mussten, um allgemein akzeptiert zu werden. 226 Als Beispiel hierfür nannte er neben der Beschreibung der Immunkomplexkrankheit durch Clemens von Pirquet (1910) die von Julius Donath und Karl Landsteiner 1904 gemachte Entdeckung, 227 dass es sich bei der paroxysmalen Kältehämoglobinurie um eine autoimmune Krankheit handele. 228 Tatsächlich wurden schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Autoimmunkrankheiten erstmals beschrieben. Diese Veröffentlichungen fanden jedoch keine nachhaltige Beachtung, vielmehr folgten diesen Entdeckungen, so Silverstein,»dark ages of autoimmunity«, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg erwachte das Interesse neu. Erst mit ihrer erneuten Beschreibung wurden die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts publizierten Erkenntnisse als»wissenschaftliche Tatsachen«(Ludwik Fleck) akzeptiert und in das kollektive wissenschaftliche Gedächtnis übernommen. In seiner Aufzählung der»wiederentdecker«von bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 223 Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Biol.-Med. Sektion in Hamburg am , in: Archiv der MPG, Mitgliedsakte Herbert Fischer. 224 Vgl. Diskussion zum Beitrag von Herbert Fischer: Lysolecithin and the action of complement, in: Annals of the New York Academy of Sciences 116 (1964), S Lachmann, Complement, S Arthur M. Silverstein: Autoimmunity. A History of the Early Struggle for Recognition, in: Noel R. Rose/ Ian R. Mackay (Hrsg.): The Autoimmune Diseases, 5. Aufl. Amsterdam et al. 2014, S (künftig zit.: Silverstein, Autoimmunity. 227 Julius Donath/Karl Landsteiner: Über paroxysmale Hämoglobinurie, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 51 (1904), S Gegen diese Auffassung argumentiert Dietlinde Goltz, dass es sich hierbei um einen Mythos handele, der»im Zusammenhang mit der ersten großen Phase der Autoimmunitätsforschung ab etwa 1950«entstanden sei und durch Helmut Schubothes unzureichende Nachforschungen»Ende der 1950er-Jahre seine endgültige Prägung«erfahren habe. Tatsächlich hätten Donath und Landsteiner nur die Reaktionsweise eines Hämolysins beschrieben,»das sie nicht nur 1904, sondern auch noch 1925 für ein Toxin hielten und nie als Antikörper charakterisiert hatten«. Vgl. Dietlinde Goltz: Das Donath-Landsteiner-Hämolysin. Die Entstehung eines Mythos in der Medizin des 20. Jahrhunderts, in: Clio Medica 16 (1981), S , hier S. 207, 209 (künftig zit.: Goltz, Donath-Landsteiner-Hämolysin). bekannten Autoimmunkrankheiten führt Silverstein u. a. den aus Deutschland geflüchteten Emigranten Ernest Witebsky an, der in den 1950er-Jahren durch die erfolgreiche Erzeugung und Übertragung einer Autoimmunopathie im Tierversuch gemeinsam mit seinen Mitarbeitern als erster zeigen konnte, dass die chronische Schilddrüsenentzündung (Hashimoto-Thyreoditis) auf autoimmunen Prozessen beruht. 229 Die Gründe für die langjährige Stagnation in der Erforschung der Autoimmunkrankheiten lagen nach Auffassung der Medizinhistorikerin Dietlinde Goltz zum einen in ihrem seltenen Auftreten, das in großem Gegensatz zum hohen zeitlichen und materiellen Aufwand für entsprechende experimentelle Arbeiten und klinische Beobachtungen stand, zum anderen im mangelnden Problembewusstsein und der nicht ausreichend exakten zielgerichteten Fragestellung sowie in den fehlenden technischen Verfahren,»um die Art der Antikörper, de[n] Ort und Modus ihrer Entstehung, ihrer chemischen Reaktionsweise und vor allem die Art des den Ablauf einer [Antigen-Antikörper-Reaktion] kausal bedingten Antigens«zu klären. 230 Zudem vertraten sowohl deutsche als auch ausländische Wissenschaftler vielfach die Ansicht, dass Paul Ehrlich mit seinem»horrorautotoxicus-gesetz«die Forschungen über autoallergische Vorgänge über Jahrzehnte behindert habe. 231 Diese Auffassungen beruhen jedoch, so Dietlinde Goltz, auf einem Missverständnis von Ehrlichs Konzeption, die keinesfalls eine Autoantikörperbildung als generelle Unmöglichkeit ausgeschlossen habe. Insbesondere die Interpretationen Ernest Witebskys, der von Beginn der 1950er-Jahre bis zur Mitte der 1960er-Jahre zu den einflussreichsten Vertretern der Autoimmunitätsforschung gehörte, seien»maßgeblich für derartige Fehldeutungen«geworden. 232 Eine wesentliche Voraussetzung für den allgemeinen Aufschwung der Erforschung von Autoimmunphänomen waren die Fortschritte in der immunologischen Grundlagenforschung sowie die Entwicklung spezifischer Methoden in den 1940er- und 1950er- Jahren (Fluoreszenztechnik, Antiglobulin- bzw. Coombstest, Immunelektrophorese, Freunds Adjuvans etc.) Vgl. hierzu Literaturangaben in Ernest Witebsky: Immunologie und klinische Bedeutung der Autoantikörper, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 68. Kongress (1962), S Dietlinde Goltz, Horror Autotoxicus. Ein Beitrag zu Geschichte und Theorie der Autoimmunpathologie im Spiegel eines vielzit.en Begriffs, Diss. med. Münster 1980, S. 153 ff., Zitat S. 155 (künftig zit.: Goltz, Horror autotoxicus). 231 Goltz, Horror autotoxicus, S. 57 ff. Vgl. u. a. Ferdinand Hoff: Klinische Physiologie und Pathologie, 6. völlig neubearb. Aufl., Stuttgart 1962, S Goltz, Horror autotoxicus, S. 56, Ebd., S. 153 ff. 180 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 181
96 Auch für Deutschland lassen sich die von Silverstein beschriebenen»dark ages of autoimmunity«belegen. So fehlt bspw. jeglicher Hinweis auf Autoimmunität oder Autoimmunkrankheiten in der Darstellung der Bakteriologie und Immunitätsforschung in Deutschland zwischen 1939 und 1946, die Hans Schmidt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg anfertigte. 234 Schon in der Nachkriegszeit wurden in Westdeutschland im Bereich der inneren Medizin jedoch Untersuchungen zu Autoimmunkrankheiten aufgenommen. Im Vordergrund der insbesondere an den Universitäten in Freiburg, Bonn und Frankfurt a. Main betriebenen Forschungen stand der Nachweis von Auto-Antikörpern bei verschiedenen Erkrankungen, wobei sich das Interesse zunächst vor allem auf hämolytische Anämien sowie Nieren- und Lebererkrankungen konzentrierte. Helmut Schubothe, o. D. Autoimmune Krankheiten des Blutes Mit dem autoimmunen Charakter von Blutkrankheiten befasste sich schon kurz nach Kriegsende der international hochgeachtete Internist und Hämatologe Ludwig Heilmeyer ( ). 235 Gemeinsam mit dem bei Hans Sachs serologisch ausgebildeten Pharmakologen Fritz Hahn 236 ( ) in Düsseldorf und dem zuvor am Institut für Luftfahrtmedizinische Pathologie des Reichsluftfahrtministeriums am Pathologischen Institut in Freiburg 237 forschenden Helmut Schubothe hatte Heilmeyer serologische Untersuchungen 234 Hans Schmidt: Bakteriologie und Immunitätsforschung (= Naturforschung und Medizin in Deutschland , Bd. 64), Wiesbaden Vgl. auch Goltz, Horror autotoxicus, S. 160 Anm Aktuell wird Ludwig Heilmeyers Verhalten vor und nach 1945 am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Ulm untersucht. Im November 2016 stimmte der Freiburger Gemeinderat auf Empfehlung einer Expertenkommission in einem Grundsatzbeschluss für eine Umbenennung des Ludwig-Heilmeyer-Weges. Vgl. u. a. Heilmeyer: Lebenserinnerungen, S. 28 f., 55 ff.; 67 f.; Eröffnungsansprache des Vorsitzenden, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 70. Kongress (1964), S. 1 12; Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt/Main 2003, S. 238; Peter Voswinkel: Der schwarze Urin. Vom Schrecknis zum Laborparameter. Urina Nigra; Alkaptonurie, Hämoglobinurie, Myoglobinurie, Porphyrinurie, Melanurie, Berlin 1993, S ; Susanne Zimmermann: Die Medizinische Fakultät der Universität Jena während der Zeit des Nationalsozialismus, Berlin 2000, S. 87, Fritz Hahn wird als einer der Väter der modernen Immunpharmakologie bezeichnet, vgl. Klaus Starke, Geschichte des Pharmakologischen Instituts der Universität Freiburg, Berlin, 2. Aufl., Heidelberg 2007, S Das Institut für Luftfahrtmedizinische Pathologie des Reichsluftfahrtministeriums war an das Pathologische Institut der Universität Freiburg angegliedert. Die Leitung beider Einrichtungen lag bei dem Freiburger Ordinarius für Pathologie, Franz Büchner ( ). Eine Verbindung zu den luftfahrtmedizinischen Menschenversuchen im KZ Dachau lässt sich nicht belegen. Vgl. Karl-Heinz Leven: Der Freiburger Pathologe Franz Büchner 1941 Widerstand mit und ohne Hippokrates, in: Bernd Grün/Hans-Georg Hofer/Karl-Heinz Leven (Hrsg.): Medizin im Nationalsozialismus. Die Freiburger Medizinische Fakultät und das Klinikum in der Weimarer Republik und im»dritten Reich«, Frankfurt/Main 2002, S Schubothe arbeitete hier als Stabsarzt an Unterdruckexperimenten im Tierversuch, vgl. Hans-Werner Altmann/Helmut Schubothe: Funktionelle und organische Schädigungen des Zentralnervensystems der bei erworbenen hämolytischen Anämien durchgeführt. Dabei hatten sie bei den Patienten Hämolysine und Agglutinine vorgefunden, die sie als Fälle von»autoagglutination«und»autohämolysin«charakterisierten und für die Ursache der gesteigerten Hämolyse hielten. 238 Ohne Kenntnis des ausländischen Schrifttums der Kriegs- und Nachkriegszeit konnten sie zeigen, dass»autoantikörper mit differentem Wirkungsmodus als Ursache verschiedener erworbener hämolytischer Erkrankungen anzusprechen sind.«239 Heilmeyer, der nach kurzer Tätigkeit an der Düsseldorfer Akademie im Mai 1946 an die Universität Freiburg gewechselt war, setzte nach eigenen Angaben seinen Freiburger Mitarbeiter Helmut Schubothe auf diese Fährte, der»mit bewundernswerter Konsequenz und mit höchstmöglicher Exaktheit dieses Gebiet der Immunhämatologie weiterentwickelt«habe:»es gelang ihm, die Eigenschaften der dabei wirksamen Autoantikörper scharf zu charakterisieren. Eine schöne Studie befasste sich mit den Kälteagglutininen, deren Wirkung auf die roten Blutkörperchen er auch im mikrophotographischen Film ausgezeichnet zur Darstellung bringen konnte. In seinen Arbeiten konnte er durch Langzeitbeobachtungen von Fällen mit Autoantikörperbildung gegen rote Blutkörperchen eine Vermehrung von lymphoiden Zellen im Knochenmark nachweisen, was die Annah- Katze im Unterdruckexperiment, in: Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie. 107 (1942), S Heilmeyer, Lebenserinnerungen, S. 72 f., 78. Vgl. Ludwig Heilmeyer, Fritz Hahn, Helmut Schubothe, Hämolytische Anämien auf der Basis abnormer serologischer Reaktionen, in: Klinische Wochenschrift, 24./25. Jg., Heft 13/16, 1. und 15. Januar 1947, S Helmut Schubothe: Serologie und klinische Bedeutung der Autohämantikörper, Basel, New York 1958, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 183
97 me zulässt, dass diese Krankheit auf einer Neoplasie bestimmter Zellklone beruht.«240 Anfang der 1950er-Jahre verfasste Schubothe erstmals im deutschen Sprachraum eine Übersicht über die antikörperbedingten hämolytischen Anämien, ohne jedoch eine Klassifizierung und Bezeichnung der Erkrankungen vorzunehmen. 241 Bei seinem Ende der 1950er-Jahre unternommenen Versuch einer Klassifizierung hämolytischer Erkrankungen unterschied er drei Gruppen der durch Autohämantikörper bedingte hämolytische Erkrankungen, 242 die er 1971 in je drei weitere Untergruppen unterteilte. 243 Diese Einteilung ist noch heute gültig. 244 I. Wärmeautoantikörperanämien (IgG) 1. idiopathische chronische Wärmeautoantikörperanämien 2. symptomatische chronische Wärmeautoantikörperanämien 3. symptomatische akute passagere (postinfektiöse) Wärmeautoantikörperanämien II. Kälteagglutininkrankheiten (IgM) 1. idiopathische chronische Kälteagglutininkrankheit 2. symptomatische chronische Kälteagglutininkrankheit (selten) 3. symptomatische akute passagere (postinfektiöse) Kälteagglutininkrankheit III. Bithermische IgG Autoantikörper (Erythrotenbindung in Kälte, Hämolyse in Wärme) 1. nichtsyphilitische chronische Kältehämoglubinurie durch Donath-Landsteiner (DL)-Hämolysine des Erwachsenen 2. syphilitische chronische Kältehämoglobinurie durch DL-Hämolysine 3. akute symptomatische passagere nichtsyphilitische AIHA durch DL-Hämolysine (Hoff/Wendlberger, Frick, Pfeiffer/Bruch, Vorlaender) Auto-Antikörper in Nierengewebe beschreiben. 246 Doch während die amerikanischen Wissenschaftler»in der Reaktion eines gegen normale Nieren gerichteten Antikörpers mit dem Nierengewebe die eigentliche Ursache der diffusen Glomerulonephritis«sahen, zeigten sich viele deutschen Autoren in ihrer Interpretation wesentlich zurückhaltender und diskutierten die»auto-antikörperreaktion«eher»als Ursache progedienter, chronischer Krankheitsverläufe«. 247 In der Folge entwickelte sich ein langjähriger Streit unter deutschen Wissenschaftlern über die Frage, ob es sich bei den gegen die eigene Niere gebildeten Autoantikörpern um ein sekundäres Phänomen oder um die kausale Ursache für die Nephritis handelte. 248 Protagonisten dieser Auseinandersetzung waren die Freiburger Arbeitsgruppe um Hans Sarre und Klaus Rother und die Frankfurter Arbeitsgruppe um Ernst Friedrich Pfeiffer ( ), wobei letztere mit dem US-amerikanischen Nephrologen John P. Merrill ( ) zusammenarbeitete, der 1954 die erste erfolgreiche Nierentransplantation durchgeführt hatte. Der Streit erlebte 1962 seinen Höhepunkt, als Sarre und Rother berichteten, dass sie im Tierversuch einseitige akute Glomerulonephritiden erzeugen konnten, die ohne einen Nachweis von Autoantikörpern oder eine Schädigung der anderen gesunden Niere in die Chronizität bis zur Entwicklung einer Schrumpfniere übergingen. 249 Für Pfeiffer und Merrill sprachen dagegen nicht nur ihre gelungenen Tierversuche, sondern die klinische Beobachtung von vier Fällen einer Nephritis, die sich nach der Transplantation von gesunden Nieren bei Patienten mit chronischer Glomerulonephritis und sekundärer Schrumpfniere entwickelt hatten, für ihre Autoimmunhypothese. 250 Die Auseinandersetzung wurde erst in der zweiten Hälf- Autoimmune Krankheiten der Niere Ebenfalls noch in den 1940er-Jahren setzten in Westdeutschland Forschungen zu autoimmunen Prozessen bei Nierenerkrankungen ein. Parallel zu einer US-amerikanischen Arbeitsgruppe um den 1938 aus Deutschland geflüchteten Kurt Lange ( ) 245 konnten Ende der 1940er/Anfang der 1950er-Jahre auch verschiedene deutsche Autoren 240 Heilmeyer, Lebenserinnerungen, S. 194 f. 241 Helmut Schubothe: Antikörperbedingte hämolytische Anämien, in: Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 58. Kongress (1952), S Helmut Schubothe: Abgrenzung und Klassifizierung hämolytischer Erkrankungen, in: ders. (Hrsg.): Hämolyse und hämolytische Erkrankungen. Siebentes Freiburger Symposion an der Medizinischen Universitäts-Klinik vom 22. Bis 24. Oktober 1959 (zugleich Symposion der Gesellschaft Deutscher Hämatologen, Berlin et al. 1961, S Schubothe/Maas, Autoimmunkrankheiten. 244 Mitteilung von Hans Hartmut Peter. 245 Kurt Lange/Michael M.A. Gold/David Weiner/Vera Simon: Autoantibodies in human glomerulonephritis, in: J. Clin. Invest 28 (1949), S Ferdinand Hoff: Medizinische Klinik. Ein Fortbildungskurs für Ärzte, Stuttgart 1948, S ; Ernst Friedrich Pfeiffer/H. Bruch: Autoantikörper gegen menschliches Nierengewebe, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 56. Kongress (1950), S ; Ewald Frick: Nephritis durch Nierenautoantikörper, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie 107 (1950), S ; K. O. Vorlaender: Über den Nachweis komplementbindender Auto-Antikörper bei Nieren- und Lebererkrankungen, in: Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin 118 (1952), S ; 247 K. O. Vorlaender, Die Bewertung von Auto-Immunisierungsnachweisen bei klinischen Erkrankungen und ihre Abhängigkeit von der Methodik, in: Klinische Wochenschrift 31 (1953), S Hans Erhard Bock: Die Bedeutung der allergischen Pathogenese bei der Arteriitis, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 60. Kongress (1954), S , hier S Klaus Rother/Hans Sarre: Untersuchungen zur pathogenetischen Bedeutung der Autoantikörper: Einseitige experimentelle chronische Glomerulonephritis, in: Klinische Wochenschrift 40 (1962), S Ernst Friedrich Pfeiffer/John P. Merrill: Die Autoaggression in der Pathogenese der diffusen Glomerulonephritis, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 87 (1962), S ; Hans Sarre/Klaus Rother: Die Autoaggression in der Pathogenese der diffusen Glomerulonephritis. Bemerkungen zur Interpretation unserer Arbeiten durch E. F. Pfeiffer und J. P. Merrill in dieser Wochenschrift 87 [1962] 934, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 88 (1963), S ; Ernst Friedrich Pfeiffer: Nachweis, Natur und klinische Bedeutung eines nephritisauslösenden Faktors bei Nierenerkrankungen, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 68. Kongreß (1962), S , Aussprache, ebd. S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 185
98 te der 1960er-Jahre aufgrund ähnlicher Forschungsergebnisse einer US-amerikanischen Arbeitsgruppe um Richard A. Lerner und Frank A. Dixon 251 entschieden, die Klaus Rother als Beweis für die Pathogenität der Autoantikörper bei Glomerulonephritis anerkannte. 252 Internationale Rezeption Die Arbeiten deutscher Forscher über Autoimmunkrankheiten fanden schon früh auch international Beachtung. Als Heilmeyer auf dem Zweiten Internationalen Kongress für Hämatologie im September 1949 in Montreux über hämolytische Anämien referierte, war der renommierte US-amerikanischen Hämatologe William Dameshek ( ) als nachfolgender Redner 253 nach Heilmeyers Darstellung»davon angetan, dass wir in Europa zu denselben Ergebnissen wie seine amerikanische Arbeitsgruppe gekommen waren«, wobei Heilmeyer in seinen Erinnerungen zugab, dass»die Amerikaner eine bessere Methodik entwickelt und die Lehre von den autoimmun-hämolytischen Anämien bis zur Vollendung ausgebaut«hatten. 254 Heilmeyer konnte zudem aufgrund seiner internationalen Reputation 1953 erreichen, dass die Europäische Hämatologische Gesellschaft ihre fünfte Tagung im September 1955 in Freiburg abhielt. 255 Zentrale Themen dieser Veranstaltung mit 2000 Teilnehmern aus über 30 Nationen waren aktuelle Probleme des Transfusionswesens sowie der Immunhämatologie. Auch am ersten internationalen Symposion für Immunpathologie, zu dem Peter Miescher (Basel) und Pierre Grabar (Paris) im Juni 1958 nach Basel/Seelisburg eingeladen hatten, waren deutsche Wissenschaftler in namhafter Zahl beteiligt. Zu den rund 50 aktiven Teilnehmern zählten Gerhard Erdmann (Rostock), Gert Haberland (Bayer, Elberfeld), Ludwig Heilmeyer (Freiburg), Erich Letterer (Tübingen), Helmut Schubothe (Freiburg), Hans Schmidt (Freiburg), K. O. Vorlaender (Bonn) und Otto Westphal (Freiburg) sowie der aus Deutschland vertriebene Ernest Witebsky. 256 Schließlich ist auf das erste, gemeinsam von dem Schweizer 251 Richard A. Lerner/R.J. Glassock/Frank J. Dixon: The role of anti-glomerular basement membrane antibody in the pathogenesis of human glomerulonephritis, in: Journal of Experimental Medicine 126 (1967), S ; Richard A. Lerner/Frank J. Dixon: The Induction of Acute Glomerulonephritis in Rabbits with Soluble Antigens Isolated from Normal Homologous and Autologous Urine, in: The Journal of Immunology 100 (1968), S Klaus Rother: Autoaggression gegen Niere, in: Medizinische Welt vom , S Dabei ging Rother aber mit keinem Wort auf die früheren Auseinandersetzungen mit Pfeiffer ein. 253 British Medical Journal vom , S Heilmeyer, Lebenserinnerungen, S Eröffnungsrede Ludwig Heilmeyers, in: Fünfter Kongress der Europäischen Gesellschaft für Hämatologie. Freiburg i. Br., 20. Bis 24. September Colloquium über aktuelle Probleme des Transfusionswesens und der Immun-Hämatologie (Schriftleitung: Herbert Begemann), Berlin, Göttingen, Heidelberg 1956, S. 1 9; Heilmeyer, Lebenserinnerungen, S Pierre Grabar, Peter Miescher (Hrsg.): Immunopathology. I st International Symposium, Basel/Seelisberg Peter Miescher und dem Bonner Internisten Karl-Otto Vorlaender 1957 im Thieme- Verlag 257 herausgegebene Lehrbuch»Immunpathologie in Klinik und Forschung und das Problem der Autoantikörper«zu verweisen, an dem mit Klaus Rother (Freiburg), Hans Sarre (Freiburg), Adolf Schrader (München), Helmut Schubothe (Freiburg) und Karl-Otto Vorlaender (Bonn) insgesamt fünf bundesdeutsche Autoren beteiligt waren. Das Lehrbuch, das 1961 eine zweite, verbesserte und erweiterte Auflage erlebte, wurde weltweit rezipiert und in weitere Sprachen übersetzt erschien eine französische und 1963 eine polnische Ausgabe. 258»Autoantikörper«und»Autoimmunkrankheiten«bzw.»Autoaggressionskrankheiten«Den deutschen Autoren, die in der Nachkriegszeit über autoimmune Prozesse bei Blutund Nierenerkrankungen berichteten, war der Begriff»Autoantikörper«durchaus geläufig. Er wurde 1907 von Edmund Weil ( ) und Hugo Braun ( ) in die wissenschaftliche Literatur eingeführt und auch von anderen Forschern wie bspw. Hans Sachs vor dem Zweiten Weltkrieg benutzt. 259 Der Begriff»Autoimmunkrankheit«bzw.»Autoaggressionskrankheit«stammt dagegen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde zuerst von Hämatologen verwendet, die wie Heilmeyer durchaus mit Recht sagen konnte»als erste die Aufmerksamkeit auf diese Vorgänge gelenkt haben«. 260 Der Mitte der 1950er-Jahre durch Helmut Schubothe und den österreichischen Immunologen Carl Steffen in die deutschsprachige Wissenschaftsliteratur eingeführte und im deutschen Sprachraum zunächst gängige Terminus»Autoaggressionskrankheiten«geht auf den französischen Immunologen und Hämatologen Jean Dausset zurück, der 1951 erstmals diesen Ausdruck im Zusammenhang mit dem Begriff»Immunhämato- 1958, Basel, Stuttgart 1959, S. IX f. Vgl. auch: Peter Anton Miescher, Secrets of Autoimmunity. From Experimental Research to Treatment of Autoimmune Diseases. 80 Years of a serene Dreamer, a passionate Scientist and a clinical Immunologist: A Life Story. Dedicated to Family and Friends, Urbino, July 2005, pdf. 257 Peter A. Miescher und K.O. Vorlaender (Hrsg.), Immunopathologie in Klinik und Forschung und das Problem der Autoantikörper, Stuttgart Peter Miescher schreibt hierzu in seinen Erinnerungen:»In 1955, the Thieme publishing company asked me if I would compile a textbook on Immunopathologie in Klinik und Forschung. I accepted to prepare the textbook in collaboration with Karl Otto Vorlaender and together we started to correspond with the leading experts in this vast new domain. The book was published in 1957, was translated into French and Spanish, and proved to be a great success«. 258 K. Chlud, Professor Karl-Otto Vorlaender zum 70. Geburtstag, in: Akt. Rheumatol. 14 (1989), S. 212 f. 259 Vgl. Goltz, Donath-Landsteiner-Hämolysin, S. 209; Edmund Weil/Hugo Braun: Über Antikörperbefunde bei Lues, Tabes und Paralyse, in: Berliner Klinische Wochenschrift 44 (1907), S ; Hans Sachs: Antigene und Antikörper, in: Bethe/von Bergmann/Embden/Ellinger (Hrsg.): Handbuch der normalen und der pathologischen Physiologie, Bd. 13, Berlin 1929, S , hier S. 410, 425, 428. Vgl. auch Goltz, Horror autotoxicus, S. 58 f. 260 Heilmeyer, Lebenserinnerungen. S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 187
99 logie«verwendete. 261 Im anglo-amerikanischen Wissenschaftsraum war ab Mitte der 1950er-Jahre der Ausdruck»autoimmune disease«gebräuchlich. Wegbereiter war der US-amerikanische Hämatologe Lawrence E. Young, der 1951 den Begriff»autoimmune hemolytic disease«in die wissenschaftliche Literatur eingeführt hatte. 262 Bis Ende der 1960er-Jahre wurde in Deutschland bevorzugt der Begriff»Autoaggressionskrankheiten«verwendet und dann zunehmend in Anlehnung an den anglo-amerikanischen Terminus»autoimmune disease«durch die Bezeichnungen»Autoimmunkrankheiten«und»Autoimmunopathien«ersetzt. 263 Ernst (später Ernest) Witebsky, o. D. Autoimmunkrankheiten ein weites Feld Trotz der zahlreichen Beschreibungen von Autoantikörpern und autoimmunen Prozessen stellte Dietlinde Goltz 1980 nach Durchsicht der neueren immunologischen Standardwerke fest, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zwar bei rund 80 Krankheiten»Autoimmunphänomene nachgewiesen, vermutet, diskutiert und auch wieder negiert wurden«, jedoch höchstens bei 10 bis 15 diese»ätiologisch und pathogenetisch als so bedeutsam erachtet werden, daß man von einer Autoimmunopathie spricht«. Ihr nüchternes Resümee ihrer Recherchen lautete, dass»als eindeutig nachgewiesen autoimmunbedingt [ ] heute wohl nur einige der [autoimmunhämolytischen Anämien]«gelten würden. 264 Wie lässt sich diese Vorsicht bei der Feststellung einer autoimmunen Krankheit erklären? Für die deutsche Forschung ist hier sicherlich zunächst auf Ernest Witebsky zu verweisen, der zu den einflussreichsten Forschern über Autoimmunkrankheiten zählte und als deutschstämmiger Wissenschaftler ab den 1950er-Jahren häufiger Gast in der Bundesrepublik war. Witebsky, der sich noch 1954 skeptisch gegenüber der Interpretation der erworbenen hämolytischen Anämie als einer autoimmunen Erkrankung gezeigt hatte, 265 änderte seine bisherige Überzeugung aufgrund eigener Forschungsergebnisse nur wenige Jahre später grundlegend formulierte er zunächst vier Bedingungen, die nach seiner Auffassung für das Vorliegen einer Autoimmunkrankheit erfüllt sein müssten. 266 Als solche definierte er 1) den Nachweis freier, zirkulierender Antikörper, die bei Körpertemperatur reagieren, oder den Nachweis zellgebundener Antikörper, 2) die Identifizierung des spezifischen Antigens, gegen das sich der Antikörper richtet, 3) die Erzeugung von Antikörpern gegen dasselbe Antigen im Versuchstier, 4) das Auftreten pathologischer Veränderungen in den entsprechenden Geweben eines aktiv immunisierten Tieres, die denen bei derselben Erkrankung des Menschen grundsätzlich gleichen. Diese vier Forderungen, die in Analogie zu den bekannten Kochschen Postulaten auch als Witebksysche Postulate bezeichnet wurden, 267 ergänzte er Anfang der 1960er- Jahre noch um das Kriterium einer erfolgreichen passiven Übertragung der Erkrankung entweder durch antikörperhaltiges Serum oder durch immunologisch kompetente Lymphocyten von aktiv immunisierten Tieren auf normale. 268 Witebskys Postulate übten einen nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Forschung aus. 269 So sah Friedrich Scheiffarth unter Hinweis auf Witebsky im November 1964 ein 261 Vgl. Goltz, Horror autotoxicus, S. 250 f. mit Verweis auf Jean Dausset: La immuno-hematologia y las enfermedades de auto-agresión, in: Revista Sociedad Argentina de Hematología 3 (1951), S. 249 ff. Zeitgenössische Forscher beriefen sich zumeist auf den wesentlich bekannten Artikel von Arnault Tzanck/ Jean Dausset: Immuno-hématologie et clinique: les maladies d auto-aggression, in: Sem. Hôp. Paris 28 (1952), S Lawrence E. Young/Gerald Miller/Richard M. Christian: Clinical and laboratory observations on auto immune hemolytic disease, in: Annals of Internal Medicine 35 (1951), S Goltz, Horror autotoxicus, S. 251 f. 264 Ebd., S Ernest Witebsky: Ehrlich s side-chain theory in the light of present immunology, in: Annals of the New York Academy of Science 59 (1954), S , hier: S Ernest Witebsky/Noel R. Rose/Kornel Terplan/John R. Paine/RichardW. Egan: Chronic Thyroiditis and Autoimmunization, in: Journal of American Medical Association 164 (1957), S , hier S A: Marmont. Aktuelle Probleme antikörperbedingter hämolytischer Erkrankungen, in: Helmut Schubothe: Hämolyse und Hämolytische Erkrankungen. Siebentes Freiburger Symposion an der Medizinischen Universitäts-Klinik vom 22. bis 24. Oktober 1959, Berlin et al. 1961, S. 223f; Keesey/Aarli, Autoimmune Hypothesis, S Ernest Witebsky: Immunologie und klinische Bedeutung der Autoantikörper, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 68. Kongress (1962), S. 349 hier: S. 355 f. 269 Joachim Kalden bezeichnete sie 1975 als»auch noch heute begrenzt gültigen Kriterien«. Vgl. Joachim R. Kalden: Autoimmunerkrankungen des Skelettsystems. Eine Betrachtung immunologischer Befunde und immunpathogenetischer Mechanismen bei der Myasthenia gravis und Polymyositis, in: Infektion 188 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 189
100 pathogenetisches Prinzip der Autosensibilisierung vorerst nur in wenigen Fällen als erwiesen an:»gesichert ist heute die Existenz pathogener Autoantikörper für bestimmte Erkrankungen des Blutes (erworbene hämolytische Anämie), der Schilddrüse (Hashimoto-Thyreoiditis) und der Spermatozoen (Azoospermie). Bei zahlreichen anderen Erkrankungen wird sie auf Grund experimenteller Ergebnisse diskutiert (Enzephalomyelitis, chronische Glomerulonephritis und Hepatitis, Kollagenkrankheiten).«270 Auch in der Folgezeit blieben deutsche Autoren hinsichtlich ihrer Einschätzung einer nachweislich autoaggressiven Krankheit zurückhaltend, wie die Vorträge namhafter Immunologen auf einer Fortbildungstagung für klinische Immunologie im Juni 1969 in Erlangen zeigen. So hielt Otto Haferkamp bspw. in seinem Überblicksreferat nur beim Lupus erythematodes, beim Goodpasture-Syndrom und bei der Immun- oder Hashimoto-Thyreoditis eine Autoaggression für gesichert, 271 ohne auf die verschiedenen autoimmunen Bluterkrankungen einzugehen. Zwei Jahre später reduzierten Helmut Schubothe und Dieter Maas Witebskys Forderungen zwar augenscheinlich auf zwei, ihrer Auffassung nach entscheidende Kriterien, nämlich auf den»nachweis der Autotropie von Immunglobulinen oder immunaktiven Zellen gegen Substrate des erkrankten Organs«sowie den»nachweis ihrer Pathogenität«. 272 Diese scheinbare Verkürzung des strengen Forderungskatalogs Witebskys spiegelte sich jedoch keineswegs in der von ihnen vorgenommenen Klassifikation autoimmuner Erkrankungen. Zu den Krankheiten, für die sie eine Autoimmunpathogenese als erwiesen ansahen, zählten sie lediglich»die bisher 9 verschiedenen Repräsentanten autoimmunhämolytischer Erkrankungen«. Zu den Krankheiten, für die eine Autoimmunpathogenese aufgrund immunologischer und anderer Indizien wahrscheinlich ist, gehörten ihrer Auffassung nach die Hashimoto-Thyreoditis, die idiopathische Thrombozytopenie, Varianten der Oligo- und Azoospermie, die sympathische Ophthalmie sowie die Enzephalitis nach Impfungen mit ZNS-haltigen Präparationen. Zu den Krankheiten, für die eine Autoimmunpathogenese aufgrund immunologischer und und Infektion 3 (1975), S , hier S. 108 (künftig zit.: Kalden, Autoimmunkrankheiten). Inwieweit Witebskys Postulate seinerzeit in den USA als rezipiert wurden, kann hier nicht weiterverfolgt werden. Arthur Silverstein erwähnt sie in seiner Geschichte der Immunologie bzw. Geschichte der Autoimmunität mit keinem Wort. Vgl. Arthur Silverstein: A History of Immunology, 1. Auflage, San Diego et al. 1989, S. 190 ff., 2. erw. und überarb. Auflage 2009, S. 153ff; Silverstein, Autoimmunity. 270 Friedrich Scheiffarth: Einführung, in: Hellmuth Kleinsorge (Hrsg.): Fortschritte der klinischen Immunologie, Jena 1966, S. 9, hier S. 3 f. 271 Otto Haferkamp: Morphologie und Pathogenese der Autoaggressionskrankheiten, in: Medizinische Welt Nr. 22/70, S (künftig zit.: Haferkamp, Morphologie). 272 Helmut Schubothe/Dieter Maas: Autoimmunkrankheiten, in: Therapiewoche 21 (1971), S , hier S anderer Indizien diskutiert wird, gehörten nach Auffassung von Schubothe und Maas die atropische Gastritis (perniziöse Anämie), chronische»aggressive«hepatitis, die primär biliäre Leberzirrhose, Myasthenia gravis, phakogene Uveitis, Pemphigus gravis, bullöses Pemphigoid, idiopathische Nebennierenrindeninsuffizienz, idiopathische Hypoparathyreoidismus, Thyreotoxikose, idiopathische Hypoparathyreoidismus, einzelne Varianten von Hemmkörperkoagulopathien, Colitis ulcerosa und die multiple Sklerose. Und unter die Kategorie»Krankheiten, für die eine komplexe Immunpathogenese möglicherweise von Autoimmuncharakter wahrscheinlich ist oder diskutiert wird«fassten sie den generalisierten Lupus erythematodes, die rheumatoide Arthritis, das Felty-Syndrom, die Stillsche Erkrankung, das Sjögren-Syndrom, die progressive Sklerodermie sowie die Panarteriitis nodosa. Wie Dietlinde Goltz herausstellt, überrascht in dieser Klassifikation vor allem die Charakterisierung des Lupus erythematodes angesichts der Tatsache, dass dieses Krankheitsbild»damals schon seit fast 20 Jahren als die Autoimmunopathie par excellence galt«. 273 Ihr Resümee nach der Analyse von 45 Arbeiten deutscher und internationaler Autoren ist bemerkenswert. Nur wenige Wissenschaftler nahmen eine eindeutige Kategorisierung vor, die meisten machten ihre qualifizierenden Aussagen durch das Hinzufügen von Adverbien wie»möglicherweise«,»offenbar«,»wahrscheinlich«,»fraglich«nachträglich uneindeutig:»so dürfte der erste flüchtige Eindruck beim Lesen auch wohl der sein, daß auf dem Gebiet der Autoimmunpathien überhaupt nichts bewiesen und gesichert ist. Die einzige Krankheitsgruppe, die von keinem der hier zitierten Autoren bezüglich ihrer Autoimmunpathogenese bezweifelt worden ist, sind die autoimmunhämolytischen Anämien. Bei rigoroser Betrachtung des status quo von heute läßt sich somit nur konstatieren, daß die Autoimmunitätsforschung bzgl. der Pathogenese seit Ende der fünfziger Jahre nicht zu weiteren, eindeutig gültigen Ergebnissen gekommen ist.«274 Die Zurückhaltung gegenüber eindeutigen Aussagen hatte mehrere Gründe. So waren Autoantikörper auch bei Gesunden festgestellt worden bzw. selbst bei nachweisbaren Autoantikörpern hatte man keine pathogene Wirkung nachweisen können. Zudem hatte man beobachtet, dass Autoantikörper nicht unbedingt dort Schäden verursachte, wo sie aufgefunden worden waren (Erythematodes-Nephritis). 275 Ähnlich argumentierten Scheiffarth und Baenkler 1975 in ihrem Lehrbuch der klinischen Immunologie:»Heute sind zahlreiche Krankheitserscheinungen bekannt, die unter den Zeichen einer Autosensibilisierung ablaufen. Da diese Zustände allerdings nicht ausschließlich pathogen sind, 273 Goltz, Horror autotoxicus, S Ebd., S. 241 f. 275 Haferkamp, Morphologie, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 191
101 herrscht Unsicherheit in der Beurteilung, inwieweit die dabei beobachteten Immunphänomene zugleich auch krankheitsauslösend sind, oder nur Begleiterscheinungen darstellen. Um einen Immunprozeß als pathogen zu charakterisieren, ist die Forderung erhoben worden, daß der Mechanismus lückenlos verfolgt werden kann womit die Darstellung des Antigens ebenso gemeint ist wie die Aufklärung des pathologischen Prinzips und daß es sich im Tierversuch reproduzieren lassen müsse. Dies ist bei der vergleichsweise großen Zahl von Autosensibilisierungsprozessen nur in wenigen Fällen einwandfrei gelungen.«276 Die bundesdeutsche Forschung zu Autoimmunkrankheiten ist enorm und kann hier nicht dargestellt werden. Als Beispiele werden im Folgenden die Myasthenia gravis und die Therapie der Autoimmunkrankheiten in Form einer Behandlung mit Antilymphozytenserum (ALS) bzw. Antilymphozytenglobulin (ALG) behandelt. Myasthenia gravis 1960 stellte der schottische Neurologe John A. Simpson aufgrund klinischer Untersuchungsbefunde die Hypothese auf, dass es sich bei der durch Muskelschwäche und schnelle Ermüdung gekennzeichneten Myasthenia gravis um eine autoimmune Krankheit handele. 277 Zu demselben Ergebnis kamen zeitgleich auch die US-amerikanischen Mediziner William L. Nastuk und Arthur J. L. Strauss und ihre Mitarbeiter aufgrund labortechnischer Ergebnisse. 278 In der Folgezeit wurde die These einer Immunpathogenese durch klinische und immunserologische Untersuchungsbefunde weiter erhärtet. So wiesen die pathologischen Veränderungen starke Ähnlichkeiten zu anderen Autoimmunkrankheiten auf, zudem ließen sich Antikörper gegen quergestreifte Muskulatur im Serum von Myasthenia-gravis-Patienten nachweisen. 279 Eine zusätzliche Bestätigung fand die These in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre und zu Beginn der 1970er-Jahre durch tierexperimentelle Untersuchungen, die Gideon Goldstein 280 in Australien sowie 276 Scheiffarth/Baenkler, Klinische Immunologie, S Allison J. Riggs/Jack E. Riggs:»Guessing it right,«john A. Simpson and myasthenia gravis. The role of analogy in sciences, in: Neurology 62 (2004), S Bereits 1959 hatte der britische Radiologe David Waldron Smithers»die Möglichkeit eines immunologischen Mechanismus in der Pathogenese der Myasthenia gravis [ ] zur Diskussion gestellt«, vgl. Kalden, Autoimmunkrankheiten, S Joachim R. Kalden: Die Pathogenese der Myasthenia gravis als immunologisches Problem, in: Klinische Wochenschrift 48 (1970), S. 4 13, hier S. 4. (künftig zit.: Kalden, Pathogenese); John Keesey/Johan Aarli: Something in the Blood? A History of the Autoimmune Hypothesis regarding Myasthenia Gravis, in: Journal of the History of the Neurosciences 16 (2007), S Kalden, Pathogenese, S. 4 ff. 280 Gideon Goldstein/Senga Whittingham: Experimental autoimmune thymitis, in: Lancet 1966 II, S ; dies.: Histological and serological features of experimental autoimmune thymitis in guinea-pigs, in: Clinical and Experimental Immunology 2 (1967), S Joachim Kalden 281 zunächst in Edinburgh und später in Hannover durchführten. 282 Dabei gelang es, bei Meerschweinchen durch Sensibilisierung mit Thymus- und Skelettmuskulaturextrakten ähnliche Reaktionen histopathologische Thymusveränderungen, Störung der neuromuskulären Erregungsübertragung sowie Erzeugung von Serumantikörpern wie bei Myasthenie-Patienten zu erzeugen. Zugleich verwiesen die Ergebnisse auf die enge Korrelation von Thymusveränderung und Manifestation der neuromuskulären Symptomatik. Da die Befunde von Goldstein nicht von allen Forschergruppen bestätigt werden konnten, hielt die Diskussion über die Reproduzierbarkeit des beschriebenen Tiermodells allerdings an. 283 In Hannover unternahm Kalden in Zusammenarbeit mit der Universitäts-Nervenklinik Marburg Untersuchungen zur genauen Bindungsstelle des Skelettmuskelantikörpers im Bereich der Muskelsarkomere, die ebenfalls in der Forschung umstritten war. Dabei griff er auf aktuelle Forschungserkenntnisse zur Bindung des muskelspezifischen Enzyms Kreatinkinase im Myosin zurück und konnte bei 60 Prozent der untersuchten Myasthenia-gravis-Patienten einen Kreatinkinase-spezifischen Antikörper nachweisen. 284 Aufgrund seiner eigenen Untersuchungen sowie der Beiträge anderer Autoren kam Kalden 1975 zu dem Schluss, dass für die Myasthenia gravis»im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts nahezu alle fünf Punkte«der Witebsky schen Postulate erfüllt werden konnten, wobei er als Krankheitsursache entsprechend den damals diskutierten Hypothesen auch eine Virusinfektion in Betracht zog. 285 ALS-Therapie gegen Autoimmunkrankheiten Die in den 1960er-Jahren an der Münchener Universität vorangetriebene Entwicklung eines Antilymphozytenserums eröffnete aus Sicht der Protagonisten nicht nur neue Möglichkeiten der Immunsuppression in der Organtransplantation, vielmehr zählte 281 Joachim R. Kalden/William J. Irvine: Experimental Myasthenia gravis, in: Lancet, 1969, S ; Joachim R. Kalden: Thymuspathologie bei Erkrankungen mit gestörten Immunitätsreaktionen (eine Übersicht), in: Zeitschrift für Immunitätsforschung, Allergie und klinische Immunologie 139 (1970), S ; Joachim R. Kalden/W.G. Williamson/Willaim J. Irvine: Experimental Myasthenia gravis, myositis and myocarditis in guinea-pigs immunized with subcellar fractions of calf Thymus or calf skeletal muscle in Freund s complete adjuvant, in: Clinical and Experimental Immunology 13 (1973), S ; Joachim R. Kalden: Untersuchungen zur Pathogenese des partiellen neuromuskulären Blocks bei experimenteller Myasthenia gravis, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 79. Kongress (1973), S ; Joachim R. Kalden, T. O. Kleine: Kreatinkinasehemmende Faktoren im Serum von Myasthenia-gravis-Patienten, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 80. Kongress (1974), S (künftig zit.: Kalden/Kleine, Kreatinkinasehemmende Faktoren); Kalden, Autoimmunkrankheiten. 282 Vgl. auch Keesey/Aarli, Autoimmune Hypothesis, S Kalden, Autoimmunerkrankungen, S Kalden/Kleine, Kreatinkinasehemmemde Faktoren; Kalden, Autoimmunerkrankungen, S Kalden, Autoimmunerkrankungen, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 193
102 die Arbeitsgruppe um Rudolf Pichlmayr ( ) und Walter Brendel ( ) auch zu den Vorreitern eines ALS-Einsatzes in der Behandlung von Autoimmunkrankheiten. Vereinzelt war in den 1960er-Jahren auch von deutschen Autoren bereits über Therapieerfolge bei experimentell erzeugten Autoimmunopathien berichtet worden. 286 Brendel und Pichlmayr testeten die therapeutische Wirksamkeit ihres ALS jedoch nicht nur am Modell der experimentellen allergischen Encephalomyelitis erfolgreich im Tierversuch, 287 sondern parallel in verschiedenen Münchener Kliniken auch seine klinische Anwendung bei den Diagnosen Dermatomyositis, Myasthenia gravis, zeitweilige Arteriitis, chronische Hepatitis, rheumatische Arthritis und multiple Sklerose publizierten sie den weltweit mutmaßlich ersten Beitrag über»therapieversuche mit Antilymphozytenserum bei Autoaggressionskrankheiten des Menschen«. 288 Zwar handelte es sich zunächst nur um wenige Einzelfälle, doch verliefen die ersten Versuche aus Sicht Brendels ermutigend. 289 Die klinische Erprobung von ALS in der Therapie der Autoimmunkrankheiten wurde in der Folgezeit fortgesetzt, worüber die Münchener Arbeitsgruppe auch in der Zeitschrift Lancet und auf der Tagung der Gesellschaft für Immunologie berichtete. 290 Hinweisen auf die unter einer ALS-Behandlung auftretenden Nebenwirkungen wie anaphylaktische Reaktionen und gesteigerte Infektanfälligkeit sowie dem Verdacht einer tumorauslösenden Wirkung 291 hielt man entgegen, dass die 286 Vgl. u. a. H.L.F. Currey/Morris Ziff: Suppression of experimentally induced polyarthritis in the rat by heterologous anti-lymphocyte serum, in: Lancet, 22. Oktober 1966, S ; A.M. Denman/ E.J. Denman/ E.J. Holborow: Suppression of Coombs-positive haemolytic anaemia in NZB mice by antilymphocyte globulin, in: Lancet, 20. Mai 1967, S ; J. Kalden/K. James/W. G. Williamson/W. J. Irvine: The suppression of experimental thyroiditis in the rat by heterologous anti-lymphocyte globulin, in: Clinical and experimental Immunology 3 (1968), S erschien ferner: H. Warnatz/F. Scheiffarth/H. Wagner: Untersuchungen zur Wirkung von Antilymphozytenglobulin bei der experimentellen Hepatitis der Maus, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 140 (1970), S W. Land/E. Frick/R. Roscher/W. Brendel/A. Baethmann: Wirkung eines heterologen Antilymphocytenserums auf die experimentelle allergische Encephalomyelitis, in: Klinische Wochenschrift 47 (1969): S F. Trepel/Rudolf Pichlmayr/J. Kimura/Walter Brendel/Herbert Begemann: Therapieversuche mit Antilymphocytenserum bei Autoaggressionskrankheiten des Menschen, in: Klinische Wochenschrift 46 (1968), S Walter Brendel: Grundlagen des Antilymphocytenglobulins und seine therapeutischen Möglichkeiten, in. Arzneimittel-Forschung 20 (1970), S J. Ring/J. Seifert/G. Lob/K. Coulin/H. Angstwurm/E. Frick/B.Brass/J. Mertin/H. Backmund/W. Brendel: Intensive immunosuppression in the treatment of multiple sclerosis, in: Lancet 304 (1974), S ; J. Ring/J. Seifert/G. Lob/K. Coulin/B. Brass/J. Mertin/H. Backmund/H. Angstwurm/E. Frick/W. Brendel: Behandlung der Multiplen Sklerose mit Antilymphozytenglobulin und/oder Drainage des Ductus thoracicus, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 147 (1974), S Vgl. bspw. Hans-Günther Sonntag: Funktion, experimentelle und klinische Bedeutung des Antilymphozytenserums, in: Klinische Wochenschrift 49 (1971), S ALG-Therapie»trotz gelegentlicher Komplikationen [ ] in der immunsuppressiven Therapie von Organempfängern und Autoimmunopathien eine wesentliche Bereicherung«darstelle. 292 Sowohl die Münchener Arbeitsgruppe, die hierüber auch auf der ersten Tagung der Gesellschaft für Immunologie berichtete, 293 als auch die Behringwerke arbeiteten intensiv an einer verbesserten Verträglichkeit und stärkeren therapeutischen Wirkung des ALS bzw. ALG und konnten hierbei auch Erfolge verbuchen. 294 Trotzdem blieb die Therapie zunächst umstritten. In ihrem 1975 publizierten Lehrbuch»Klinische Immunologie«stellten Scheiffarth und Baenkler fest, dass»versuche, mit ALS auch Autoaggressionsprozesse zu bessern, [ ] fast ausnahmslos fehlgeschlagen [seien], da Nebenwirkungen eintreten, bevor sich ein therapeutischer Effekt zeigt. 295 Perinatale Immunologie die Entwicklung der Anti-D-Prophylaxe Nach der Entdeckung des Rhesusfaktors 1937 (bzw. 1940) durch Karl Landsteiner und Alexander Wiener erkannten Landsteiners ehemaliger Assistent, der US-amerikanische Immunologe Philipp Levine ( ), und seine Mitarbeiter Ende der 1930er/Anfang der 1940er-Jahre dessen Bedeutung für die gefürchtete Neugeborenen-Erythroblastose (Morbus haemolyticus neonatorum). 296 Diese zählte noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den häufigsten Todesursachen in der Perinatalmedizin. 297 Aufgrund seiner Beobachtungen bei Ehepaaren mit mehreren Totgeburten entwickelte Levine die Theo- 292 J. Ring/J. Seifert/G. Lob/W. Land/K. Coulin/W. Brendel: Zum Risiko einer ALG-Therapie. Mögliche Nebenwirkungen, Prophylaxe und Behandlung, in: Klinische Wochenschrift 51 (1973), S W. Land/J. Seifert/U. Hopf/A. Fateh-Moghadam/W. Brendel: Untersuchungen zur Induktion einer Immuntoleranz gegen Pferde-Gammaglobulin beim erwachsenen Hund, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 141 (1970), S K. Heide/F.R. Seiler/H.G. Schwick: Herstellung von Anti-Lymphocytenglobulin, in: Langenbecks Archiv für Chirurgie 327 (1970), S ; Walter Land/Walter Brendel/U. Hopf/J. Seifert: Versuch zur Induktion einer immunologischen Toleranz gegen Pferde-IgG am Menschen, in: Klinische Wochenschrift 48 (1970), S ; Walter Land, Immunsuppressive Therapien, S. 196ff; Vgl. beispielsweise: Walter Brendel/J. Ring/J. Krumbach/R. Zink/G. Lob/J. Seifert: Verbesserung der Pferde-ALG-Therapie bei Hund und Mensch durch Induktion immunologischer Unresponsiveness gegen Pferde IgG, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung, experimentelle und klinische Immunologie 147 (1974), S. 360; J. Seifert/J. Ring/W. Brendel: Transplantationsüberlebenszeit allogener Rattenhaut nach oraler Applikation von Antilymphozytenserum (ALS), ebd. S Scheiffarth/Baenkler, Klinische Immunologie, S Vgl. u. a. Philipp Levine/P. Vogel/E.M.Katzin/L. Burnham: Pathogenesis of erythroblastosis fetalis: statistical evidence, in: Science 94 (1941), S Kornélia Fruzsina Böhmerle: Die Entwicklung der Perinatalmedizin in Berlin aus geburtshilflicher Perspektive, Diss. med. Berlin 2015, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 195
103 rie einer Rhesusinkompatibilität als Ursache. Er ging davon aus, dass ein Rh-positiver Fötus bei seiner eigenen rh-negativen Mutter die Bildung von Antikörpern provoziert, die bei weiteren Schwangerschaften durch die Plazenta auf den Fötus übergehen und bei ihm die Zerstörung der Erythrozyten bewirken. 298 Der Nachweis, dass die Plazenta für korpuskuläre Elemente des Blutes keine unüberwindliche Schranke zwischen Frucht und Mutter darstellt, gelang jedoch erst rund zehn Jahre später durch den Göttinger Gynäkologen Werner Bickenbach ( ) und seinen Doktoranden Fritz Kivel. 299 Anhand der von ihnen untersuchten Erythroblastoseplacenten konnten sie zeigen, dass die Sensibilisierung der Mutter durch den Übertritt fetaler roter Blutzellen in den mütterlichen Kreislauf möglich ist entwickelten Enno Kleihauer, Hildegard Braun und Klaus Betke an der Universität Freiburg ein weltweit als Kleihauer-Betke-Test rezipiertes Verfahren zum Nachweis fetaler Erythrozyten im mütterlichen Blutausstrich, das auf der unterschiedlichen Löslichkeit von fetalem (HbF) und Erwachsenen-Hämoglobin (HbA) im sauren Milieu beruhte. 300 Zu diesem Zeitpunkt bestand die gängige Therapie der Erythroblastose in einer Blutaustauschtransfusion nach der Geburt, sofern sich Rh-Antikörper im Blut des Neugeborenen mittels Coombs-Test nachweisen ließen führte der neuseeländische Arzt Albert W. Liley ( ) erstmals eine Blutaustauschtransfusion intrauterin durch. 302 Parallel zu der Entwicklung einer wirksamen Therapie wurde weltweit auch nach einer Erythroblastose-Prophylaxe geforscht. In den 1950er-Jahren erprobte man mit allerdings enttäuschenden Ergebnissen in der Bundesrepublik sowohl die bereits von Dahr und Westphal aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnte Behandlung von Zweit- 298 Peter Dahr/Manfred Kindler: Erkenntnisse der Blutgruppenforschung seit der Entdeckung des Rhesusfaktors, 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl., Stuttgart 1961, S. 10 (künftig zit.: Dahr/Kindler, Erkenntnisse). 299 Werner Bickenbach/Fritz Kivel: Mikroskopische Untersuchungen an Erythroblastoseplacenten, in: Archiv für Gynäkologie 177 (1950), S ; Fritz Kivel, Die Plazenta bei der Erythroblastosis fetalis, Diss. med. Münster Enno Kleihauer/Hildegard Braun/Klaus Betke: Demonstration von fetalem Hämoglobin in den Erythrozyten eines Blutausstrichs, in: Klinische Wochenschrift 35 (1957), S. 637 f.; Heinz Radzuweit: Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Immunprophylaxe der Rh-Sensibilisierung, in: Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 64 (1970), S , S Vgl. u. a. Rhesus haemolytic disease. Selected papers and extracts. Commentaries by Cyril A. Clarke, Lancaster 1975, S Hier lautet der Kommentar:»Before this paper it had not been possible to demonstrate individual fetal erythrocytes in an adult red cell population, although there had been several ways of detecting fetal haemoglobulin by chemical means.«301 Dahr/Kindler, Erkenntnisse, S Albert W. Liley: Intrauterine Transfusion of Foetus in Haemolytic Disease, in: British Medical Journal 2 (1963), S In der Bundesrepublik führte Hartmut Hoffbauer 1966 in der Frauenklinik Charlottenburg in Westberlin erstmals eine intrauterine Bluttransfusion nach der von Liley beschriebenen Methode durch, vgl. Böhmerle, Perinatalmedizin, S. 61 f. DFG Forschungsbericht Rhesusfaktor negativ. Zur Prophylaxe der Rhesus- Sensibilisierung mit Anti-D, Gemeinschaftsstudie , Boppard 1973 gebärenden mit Rh-Haptenen 303 als auch eine von Fritz Bergdörfer beschriebene Methode, bei der während der Schwangerschaft mittels dauerhafter Injektion eines niedermolekularen Kollodins (Periston-N) eine Senkung des Antikörpertiters erreicht werden sollte. 304 Anfang der 1960er-Jahre nahmen weltweit drei Arbeitsgruppen Experimente zur Entwicklung einer Rh-Prophylaxe auf, mit der die Sensibilisierung rh-negativer Personen durch Rh-positiven fetalen Erythrozyten mittels Injektion von Rh-Antikörperhaltigen Seren verhindert werden sollte. 305 Dabei handelte es sich um eine Arbeitsgruppe um Ronald Finn und Cyril Clark in Liverpool, 306 eine Arbeitsgruppe um Vincent Freda, 303 Vgl. hierzu Kap. Weimar und NS. 304 Dahr/Kindler, Erkenntnisse, S ; Willi Spielmann: Über das Rh-Hapten: Natur, serologisches Verhalten und klinische Anwendung, in: Klinische Wochenschrift 30 (1952), S ; Fritz Berghöfer: Zur Erythroblastose-Prophylaxe, in: Die Medizinische, Nr. 7 (1954), S Jörg Schneider et al.: DFG-Forschungsbericht Rhesusfaktor negativ. Zur Prophylaxe der Rhesus-Sensibilisierung mit Anti-D, Gemeinschaftsstudie , Boppard 1973, S. 10 (künftig zit.: Schneider, DFG-Forschungsbericht). 306 Vgl. u. a. R. Finn/C.A. Clarke/W.T.Donohue/R.B.Mc Connell,/P. M. Sheppard/D. Lehane/W. Kulke: Experimental Studies on the prevention of Rh haemolytic disease, British Medical Journal 1 (1961), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 197
104 John Gorman und William Pollack in New York 307 sowie eine Arbeitsgruppe um Jörg Schneider an der Universitätsfrauenklinik in Freiburg. 308 Das von allen drei Gruppen angewandte Prinzip beruhte auf der bereits 1909 von Theobald Smith beschriebenen Beobachtung, wonach die gleichzeitige Gabe von Antigen und spezifischen Antikörpern im Überschuss die Antikörperbildung bremsen oder gar unterdrücken kann. 309 In Freiburg nutzte Jörg Schneider die von Kleihauer beschriebene Technik zunächst zur quantitativen Bestimmung fetaler Erythrozyten im mütterlichen Kreislauf und modifizierte die von britischen und US-amerikanischen Forschern gewählte Versuchsanordnung. 310 Bei seinen Experimenten mit rh-negativen, nicht schwangeren Frauen, denen er verschiedene Mengen von Rh-positivem blutgruppengleichem Nabelschnurblut in unterschiedlichen Zeitintervallen injizierte, konnte Schneider ermitteln, dass für die Verhinderung der Sensibilisierung eine schnelle Elimination der Erythrocyten durch eine hohe Dosis von Anti-Rh-Serum in mindestens 20fachem Überschuss notwendig war. 311 Nachdem sich das von Schneider angewandte Verfahren experimentell als erfolgreich erwiesen hatte, führte er am 9. August 1963 in Freiburg die erste weltweit beschriebene Rhesusprophylaxe mit Anti-D-Serum bei einer Patientin nach der Geburt durch. 312 Ein Jahr später konnte er bereits über neun rh-negative Frauen berichten, die nach einer derartigen Anti-D-Behandlung bei einer nachfolgenden Schwangerschaft keine Antikörper gegen das Rh-positive Kind entwickelt hatten. 313 Auf diesen und den Forschungsergebnissen in New York und Liverpool aufbauend initiierte Schneider eine Arbeitsgemeinschaft und 307 Vincent J. Freda/John G. Gorman/William Pollack: Successful Prevention of Experimental Rh Sensitization in Man with an Anti-Rh Gamma 2 -Globulin Antibody Preparation. A Preliminary Report, in: Transfusion 4 (1964), S Später kam noch eine Arbeitsgruppe in Canada hinzu. 309 Theobald Smith: Active Immunity produced by so-called balanced or neutral mixtures of Diphtheria Toxin and Antitoxin, in: Journal of Experimental Medicine 11 (1909), S Jörg Schneider: Die quantitative Bestimmung von Erythrozyten im mütterlichen Kreislauf und deren beschleunigter Abbau durch Antikörperseren, in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde 23 (1963), S ; Jörg Schneider/Otto Preisler: Die Prophylaxe der Rhesus-Sensibilisierung mit Immunglobulin-anti-D, in: Ärztliche Forschung 21 (1967), S Jörg Schneider/Otto Preisler, Untersuchungen zu Verhinderung der Rhesus-Sensibilisierung unter der Geburt, Archiv für Gynäkologie 202, 1965, S ; dies.: Untersuchungen zur serologischen Prophylaxe der Rh-Sensibilisierung, in: Blut XII (1965), S Oliver Behrens/Ralph J. Lellé: Die Rhesusprophylaxe Geschichte und aktueller Stand, in: Zentralblatt für Gynäkologie 119 (1997), S , hier: S. 206 (künftig zit.: Behrens/Lellé, Rhesusprophylaxe). 313 Behrens/Lellé, Rhesusprophylaxe, S Vgl. auch Clarke, Rhesus haemolytic disease, S Dort heißt es:»the West Germans, who have maintained close contact with the Liverpool group throughout the research, were very quick [ ] to begin experimental studies and clinical trials. [ ] Their clinical trial was the first to be reported on in any country. eine Studie zur Prophylaxe der Rhesus-Sensibilisierung mit Immunglobulin, an der sich Kliniker, Serologen und Immunologen 314 aus mehr als 60 Einrichtungen beteiligten. 315 Diese Studie wurde von 1965 bis 1970 von der DFG als Gemeinschaftsarbeit im Rahmen des Normalverfahrens gefördert. 316 Parallel hatte sich auch eine Expertentagung der WHO 1967 in Genf unter Schneiders Beteiligung mit den bisherigen Forschungsergebnissen zur Rh-Prophylaxe befasst und Empfehlungen zur Anwendung ausgesprochen. 317 Diese Empfehlungen und die DFG-Studie bildeten die Grundlage für die Ende der 1960er-Jahre in die allgemeine klinische Praxis und die Schwangerenvorsorge übernommene Anti-D-Prophylaxe in der Bundesrepublik. Mit der Einführung konnte die fetale Morbiditäts- und Mortalitätsziffer bei Rhesusinkompatibilität von Mutter und Kind um 90 Prozent gesenkt werden. 318 Immundefektkrankheiten Die wissenschaftliche Erforschung der Immundefektkrankheiten setzt zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein veröffentlichten der Schweizer Pädiater Eduard Glanzmann ( ) und der Pathologe Paul Riniker zwei Berichte über zwei Säuglinge mit Bronchopneumonie, Fieberschüben, Exanthemen, Soormykose und starker Lymphopenie sowie einer bei der Obduktion festgestellten starken Atrophie des lymphatischen Gewebes und bezeichneten das vorgefundene, zum Tode führende neue Krankheitsbild im Säuglingsalter als»essentielle Lymphocytophthise«. 319 Kurz darauf wurden vereinzelt weitere Fälle mit ähnlichen klinischen und pathologischen Befunden publiziert, unter anderem auch von Mitarbeitern der Kinderklinik und des Pathologischen Instituts der 314 Die Abteilung Klinische Immunologie und Bluttransfusionswesen der Medizinischen Hochschule Hannover wirkte mit an dem Beitrag Helmuth Deicher/H. H. Hoppe/G. Schellong/J. Schneider/H. Welsch: Vermeidung von Zwischenfällen bei Erythroblastose-Prophylaxe mit Immungammaglobulin (IgG) Anti D, in: Münchener Medizinische Wocheneschrift 111 (1969), S Schneider, DFG-Forschungsbericht, S. 7, Reimar Hartge: Jörg Schneider und die verbindliche klinische Einführung der Anti-D-Prophylaxe in die Bundesrepublik Deutschland, in: ders.: Geburtshilfe : Entscheidungssuche im Spannungsraum zwischen Theorie und Praxis. Eine historische Studie, Essen 2012, S The suppression of Rh immunization by passively administered human immunoglobulin (IgG) Anti-D (Anti-Rh0), in: Bulletin WHO 36 (1967), S Behrens/Lellé, Rhesusprophylaxe, S Eduard Glanzmann/Paul Riniker: Essentielle Lymphophtise: Ein neues Krankheitsbild aus der Säuglingspathologie (vorläufige Mitteilung), in: Wiener Medizinische Wochenschrift 100 (1950), S ; dies.: Essentielle Lymphophtise: Ein neues Krankheitsbild aus der Säuglingspathologie, in: Annales paediatrici 175 (1950), S. 1 32). 198 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 199
105 Universität Münster. 320 Parallel beschrieb der US-amerikanische Pädiater Ogden Carr Bruton ( ) 1952 unter der Bezeichnung»Agammaglobulinämie«erstmals bei einem achtjährigen Jungen ein Krankheitsbild, das sich durch eine hochgradigen Infektanfälligkeit sowie ein weitgehendes Fehlen der für die Immunabwehr verantwortlichen Gammaglobuline im Serum auszeichnete. 321 Für diesen Symptomenkomplex prägte die Arbeitsgruppe um den Schweizer Immunologen Silvio Barandun ( ) in den 1950er-Jahren den Begriff»Antikörpermangelsyndrom«, 322 wobei nicht nur eine Verminderung der Gammaglobuline, sondern auch der Beta 2 -Globuline beobachtet wurde. 323 Auf der Grundlage von 41 Fällen führten die Schweizer Wissenschaftler umfangreiche klinische, serologische, immunologische, chemische und histologische Untersuchungen durch 324 und konnten zeigen, dass sich verschiedene Formen dieses Syndroms voneinander abgrenzen ließen. 325 So unterschieden sie zwischen einer primär idiopathischen und einer sekundär symptomatischen Form und trennten erstere in eine kongenital, rezessiv vererbbare Form und eine erworbene idiopathische, wobei sie bei letzteren nochmals Früh- und Spätmanifestationen voneinander abgrenzten. Zur Diagnostik setzten sie die neuentwickelte Immunoelektrophorese ein und beschrieben darüber hinaus ihre Erfahrungen mit der prophylaktischen und therapeutischen Verwendung von Gammaglobulin-Präparaten. Die von Glanzmann und Riniker als»essentielle Lymphocytophthise«bezeichnete tödliche Erkrankung charakterisierten sie als Antikörpermangelsyndrom mit ausgesprochener Lymphopenie. 326 Im Zuge weiterer Forschungserkenntnisse verfeinerten die Schweizer Wissenschaftler ihre Konzeption zunehmend durch die Unterscheidung von zell- und humoralgebundenen Immunreaktionen. 327 Eine von der WHO eingesetzte Nomenklaturkommission unter 320 Wilhelm Kosenow/Norbert Schümmelfeder: Allgemeiner Lymphocytenschwund (Lymphophthise),. Ein Beitrag zur Pathologie des frühen Kindesalters, in: Klinische Wochenschrift 31 (1953), S Ogden Carr Bruton, Agammaglobulinemia, in: Pediatrics 1952; 9; S S. Barandun/H. Büchler/A. Hässig: Agammaglobulinämie, in: Helvetica Medica Acta 22, (1955) S ; S. Barandun/H.J. Huser/A. Hässig: Das Antikörpermangelsyndrom. Agammaglobulinämie, in: Schweiz. Med. Wochenschrift 86 (1956), S ; S. Barandun/R. Kipfer; G. Riva/ A. Nicolet: Über die therapeutische Verwendung von Gammaglobulinen bei bakteriellen Infektionen: Schweiz. Medizinische Wochenschrift 86 (1956), S, David Gitlin/Walter H. Hitzig/Charles Janeway: Multiple serum protein deficiencies in congenital and aquired agammaglobulinemia, in: Journal of Clinical Investigation 35 (1956), S ; Walter H. Hitzig: Die physiologische Entwicklung der»immunglobuline«(gamma- und Beta2-Globuline), in: Helvetica Paediatrica Acta 12 (1957), S S. Barandun, H. Cottier, A. Hässig, C. Riva,»Antikörpermangelsyndrom«, Basel 1959 (künftig zit.: Barandun et al., Antikörpermangelsyndrom). 325 W.H. Hitzig/J.J. Scheidegger/R. Bütler/E. Gugler/A. Hässig: Zur quantitativen Bestimmung der Immunglobuline, in: Barandun et al., Antikörpermangelsyndrom, S Barandun et al., Antikörpermangelsyndrom, S W.H. Hitzig, Hereditäre Formen zellulärer und humoraler Abwehrschwäche im Kindesalter, in: Die gel- Beteiligung von US-amerikanischen, britischen französischen und Schweizer Medizinern entwickelte 1971 eine Klassifikation der primären Immundefekte. 328 Als solche definierte sie Krankheitszustände, die auf einer kongenitalen Insuffizienz der spezifischen humoralen und/oder zellulären Immunantwort beruhen«. 329 Zugleich führte sie den Begriff»Severe combined immunodeficiency«für das schwerste, durch einen vollständigen oder nahezu vollständigen Defekt der zellulären und humoralen Immunfunktion gekennzeichnete Immunmangelsyndrom ein. Bei einem erneuten Expertentreffen im Februar 1973 in Florida erfolgte auf der Grundlage neuester Erkenntnisse eine Aktualisierung und Modifizierung dieser Klassifizierung. 330 So wurde das sogenannte Wiskott-Aldrich-Syndrom, über das der Münchner Pädiater Alfred Wiskott 1936 erstmals berichtete, 331 nicht mehr mit einer vorliegenden T- und B-Zellstörung, sondern nur noch mit einer T-Zellstörung charakterisiert. In der Bundesrepublik stieß das Antikörpermangelsyndrom ebenfalls bereits in den 1950er-Jahren auf wissenschaftliches Interesse, und zwar zunächst bei Pädiatern, die klinisch mit derartigen Krankheitsbildern bei Kindern und Jugendlichen konfrontiert waren. Sie publizierten nicht nur verschiedene Kasuistiken, sondern nahmen wie der Braunschweiger Pädiater Johannes Oehme 332 eigene immunologische Forschungen auf oder arbeiteten mit Immunologen zusammen. 333 Darüber hinaus befassten sich Pädiater und Vertreter anderer Fachdisziplinen mit der therapeutischen Verwendung von ben Hefte. Immunbiologische Informationen der Behringwerke AG Nr. 9 (August 1965), S ; S. Barandun/M.W. Hess/H. Cottier: Defekte der Immunantwort, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 78. Kongress (1972), S H. Fudenberg/R.A. Good/H.C. Goodman/W. Hitzig/I.M. Roitt/F.S.Rosen/D.S. Rowe/M. Seligmann/J.R. Soothill: Primary Immunodeficiencies. Report of a World Health Organization Committee, in: Pediatrics, Bd. 47, Nr. 5, May 1971, S Stursberg, Immuninsuffizienz, S M.D. Cooper/W.P. Faulk/H.H. Fudenberg/R.A. Good/W. Hitzig/H.G. Kunkel/I.M. Roitt/F.S. Rosen/ M. Seligmann/J.F. Soothill: Meeting Report of the Second International Workshop on Primary Immunodeficiency Diseases in Man, held in St. Petersburg, Florida, February, 1973, in: Clinical Immunology and Immunopathology 2 (1974), S Vortrag auf der Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde am 23. Juli 1936 in Würzburg, abgedruckt unter Alfred Wiskott: Familiärer, angeborener Morbus Werlhof, in: Monatsschrift für Kinderheilkunde 68 (1937), S Das von Wiskott bei drei noch im Säuglings- bzw. Kleinkindalter verstorbenen Brüdern beobachtete Krankheitsbild zeichnete sich durch Blutungsneigung (hauptsächlich im Darmtrakt), Infektanfälligkeit und Ekzembildung aus. 332 Johannes Oehme führte mehrere Projekte im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes»Immunbiologie«durch. 333 Vgl. u. a. Fr. Koch/G.-W. Schmidt/E. Doll: Beitrag zur Agammaglobulinämie im Kindesalter, in: Monatsschrift für Kinderheilkunde 105 (1957), S ; U. Willenbockel: Transitorisch-protrahiertes Antikörpermangelsyndrom bei zweieiigen Zwillingen, in: Zeitschrift für Kinderheilkunde 84 (1960), S ; Johannes Oehme: Beiträge zur Klinik und Immunologie des Antikörpermangelsyndroms, in: Monatsschrift für Kinderheilkunde 111 (1963), S ; H. Olbing: Angeborene, permanente Agranucytose mit Antikörpersyndrom, in: Zeitschrift für Kinderheilkunde 90 (1964), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 201
106 Gammaglobulinen bei Antikörpermangel. 334 Eine erfolgreiche langfristige Kooperation bestand zwischen der Universitätskinderklinik in Gießen und den Marburger Behringwerken, deren Gammaglobulin-Präparate in der Therapie von Antikörpermangelsyndromen zum Einsatz kamen. 335 Die Mitarbeiter der Behringwerke, Hermann E. Schultze und (Hans) Gerhard Schwick nutzten die in der Kinderklinik Gießen beobachteten Fälle schon 1961, um aktuelle immunologische Theorien über die humorale und zelluläre Abwehr zu diskutieren. 336 Seit Ende der 1950er-Jahre führten Friedrich Scheiffarth und seine Mitarbeiterin Hilde Götz ( ) an der Universität Erlangen auf der Grundlage einer ähnlich hohen Patientenzahl wie die Schweizer Arbeitsgruppe ebenfalls klinische, papier- und immunoelektrophoretische sowie serologische Untersuchungen zur Diagnostik und Abgrenzung der verschiedenen Formen des Antimangelsyndroms durch. 337 In seinem 1975 gemeinsam mit Hanns-Wolf Baenkler publizierten Lehrbuch»Klinische Immunologie«entwarf Scheiffarth eine eigene Klassifikation der primären und sekundären Immundefektkrankheiten, die durchaus von aktuellen Klassifizierungsvorschlägen abwich. 338 Auch der stark immunpathologisch interessierte Karl-Otto Vorlaender befasste sich in den 1960er-Jahren an der Universität Bonn mit den klinischen, serologischen sowie 334 Theodor-Otto Lindenschmidt/Karlgeorg Erdmann: Die Bedeutung des Antikörpermangelsyndroms für die Chirurgie, in: Langenbecks Arch. Klin. Chirurgie 299 (1962), S ; W. Lang: Die intravenöse Gammaglobulin-Therapie, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 89 (1964, S. 2374; F. Bläker/G. Landbeck/K. Fischer: Antikörper-Mangel infolge langfristiger cytostatischer Behandlung bei malignen Tumoren und akuten Leukosen im Kindesalter Indikationen zur Gammaglobulin-Therapie, in: Monatsschrift für Kinderheilkunde 115 (1967), S Friedrich Koch: Erste Erfahrungen mit Gamma-Venin, einem intravenös injizierbaren Gamma-Globulin-Präparat in der Kinderheilkunde, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 88 (1963), S ; ders.: Prophylaxe und Therapie des Antikörpermangelsyndroms, in: Die gelben Hefte. Immunbiologische Informationen der Behringwerke AG Nr. 9 (August 1965), S Eine Recherche in PUBMED ergab, dass Friedrich Koch mit Gerhard Schwick zwischen 1954 und 1970 mindestens 16 wissenschaftliche Publikationen gemeinsam veröffentlichten. 336 Friedrich Koch/H.E. Schultze/G. Schwick: Über angeborene Defekte humoraler und cellulärer Abwehr. Antikörpermangelsyndrom-Plasmocytopenie, Lymphocytopenie, Neutrocytopenie, in: Zeitschrift für Kinderheilkunde 85 (1961), S Friedrich Scheiffarth/Hilde Götz: Immunelektrophoretische Untersuchungen bei einem Antikörpermangelsyndrom, in: Acta. Haemat. 22 (1959), S ; dies.: Die Bedeutung der Immunelektrophorese bei der Differenzierung pathologischer Seren, in. International Archives of Allergy and Applied Immunology, 1960, Bd. 16, Teil 1: S , Teil 2: S ; Friedrich Scheiffarth/Hilde Götz/H. Warnatz: Zur Immunologie des Antikörpermangelsyndroms, in: Medizinische Welt vom 23. August 1960, S Scheiffarth/Baenkler, Klinische Immunologie, S. 68 ff. Da das Lehrbuch keine Literaturhinweise enthält, lässt sich nicht nachprüfen, auf welchen Erkenntnissen diese Einteilung beruht. Links: Hermann E. Schultze, ca Rechts: Gamma-Venin, 1960er-Jahre papier- und immunoelektrophoretischen Befunden und der Therapie der verschiedenen Formen des Antikörpermangelsyndroms. 339 An der Medizinischen Hochschule Hannover nahm Helmuth Deicher in den 1970er- Jahren mit seinen Mitarbeitern systematische Forschungen sowohl zu angeborenen als auch zu erworbenen Immundefekten auf. 340 Im Vordergrund standen auch hier Beschreibungen und Einteilungen der beobachteten Immundefekte als Folge unterschiedlicher Erkrankungen oder immunsuppressiver Therapien sowie geeignete Untersuchungsmethoden zu ihrer Differenzierung. 341 Zunächst enthielten die für die Substitution der fehlenden humoralen Antikörper verwendeten intramuskulär applizierten Immunglobulin-Präparate zumeist nur die IgG-Fraktion. Anfang der 1960er-Jahre konnten die Mitarbeiter der Behringwerke, 339 Karl-Otto Vorlaender: Das Antikörpermangelsyndrom, in: Medizinische Welt 1962, S. 9 16; ders., M. Grenzmann, Die Therapie des Antikörpermangel-Syndroms, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 92 (1967), S ; ders., Antikörpermangel, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 94 (1969), S Helmuth Deicher: Immunologie und Transfusionsmedizin, in: Medizinische Hochschule Hannover , S Helmuth Deicher: Erworbene Antikörpermangel-Syndrome, in: Medizinische Welt 23/Heft 36 (1972), S ; P. Krull/Helmuth Deicher: Primäre Antikörperbildung bei Patienten mit malignen lymphoretikulären Systemerkrankungen und metastasierenden Tumoren, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 145 (1973), S ); Gisela Krull/J. Bahlmann/Helmuth Deicher/P. Krull: Differenzierung sekundärer Immunglobulinmangelsyndrome des Erwachsenen durch quantitative IgM-Bestimmung im Serum, in: Klinische Wochenschrift 52 (1974), S ); Gisela Krull: Über Verteilungsmuster des Serum-IgM bei sekundären Immunglobulinmangelsyndromen, Diss. med. Hannover ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 203
107 H. E. Schultze und (Hans) Gerhard Schwick,»durch Einwirkung von Pepsin bei schwach saurer Reaktion ein desaggregiertes Gammaglobubin«gewinnen, das aufgrund seiner fehlenden komplementbindenden Wirkung besser verträglich war und sich für die intravenöse Verabreichung eignete. 342 Tatsächlich handelte es sich um das durch Verdauung mit Pepsin freigesetzte F(ab ) 2 -Fragment eines IgG-Moleküls, das unter dem Namen Gamma-Venin in den Handel kam. 343 Ab 1967 vertrieben die Behringwerke auch Immunglobulin-Präparate mit einem 20prozentigen Anteil an IgA oder IgM, was die Anwendungsmöglichkeiten bei Antikörpermangelzuständen (und Infektionen) erweiterte. 344 Neben der Immunglobulin-Therapie ergänzt durch eine symptomatische Behandlung mit Antibiotika kamen ab Ende der 1960er-Jahre zur Behandlung zellulärer und schwerer kombinierter Immundefekte neue Methoden wie die Transplantation von Thymusgewebe oder Knochenmark sowie die Gabe von Lymphozyten bzw. Transfer-Faktoren zum Einsatz. Bei Letzteren handelt es sich um eine von Henry Sherwood Lawrence ( ) entdeckte niedermolekulare Substanz aus thymusabhängigen Lymphozyten eines gesunden Spenders, die beim Empfänger die zellvermittelte Immunabwehr stimulieren sollte. Die von US-amerikanischen und Schweizer Wissenschaftlern beim Wiskott-Aldrich-Syndrom beobachteten Resultate einer Transfer-Faktor-Therapie 345 veranlassten den Hamburger Pädiater Felix Bläker ( ) in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre unter Hinweis auf die augenscheinlich geringen Nebenwirkungen dieser Therapie zu weiteren klinischen Versuchen in Kooperation mit Schweizer Forschern gelang es erstmals in den USA und Europa (Leiden), Kinder mit schweren an- 342 H.E. Schultze/G. Schwick: Über neue Möglichkeiten intravenöser Gammaglobulin-Applikation, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 87 (1962), S Die Terminologie der Immunglobuline wurde 1964 bei einem von der Immunologie-Sektion der WHO organisierten Treffen von Vertretern aus Italien, USA, Tschechoslowakei, Schweiz, Frankreich, Sowjetunion, Belgien und England festgelegt und im Bulletin der WHO 30 (1964), S. S. 447 publiziert. Vgl. auch S. Cohen Nomenclature of the human immunoglobulins, in: Immunology 8 (1965), S K.-D. Tympner/I. Strauch/W. Marget/I. Patet: Quantitaive Bestimmungen der IgG, IgA und IgM in Seren eines A-Gammaglobulinämie-Patienten vor und nach der Gammaglobulin-Substitution, in: Klinische Wochenschrift 48 (1970), S Vgl. u. a. Lynn E. Spitler/Alan S. Levin/Daniel P. Stites/h. Hugh Fudenberg/Bernard Profsky/Charles S. August/E. Richard Stiehm/Walter H. Hitzig/Richard A. Gatti: The Wiskott-Aldrich-Syndrome. Results of transfer factor therapy, in: Journal of Clinical Investigation 51 (1972), S Felix Bäker, P.J. Grob/H.H. Hellwege/K.H. Schulz: Immunabwehr und Transfer-Faktor-Therapie bei chronischer granulomatöser Candidiasis, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 98 (1973), S ; P.J. Grob/F. Bläker/ K.H. Schulz: Immunfunktion und Transfer-Faktor, ebd. S ; Felix Bläker: Immunmangelkrankheiten, in: G.-A. Harnack (Hrsg.): Therapie der Krankheiten des Kindesalters, Berlin, Heidelberg 1976, S geborenen Immundefekten durch eine Knochenmarktransplantation zu heilen. 347 Bei früheren Transplantationsversuchen waren sämtliche Patienten an Infektionen bzw. an den Folgen der Immunreaktion verstorben, wobei die Hauptrisiken bei der Knochenmarktransplantation im Unterschied zur Organtransplantation weniger in der Host-versus Graft-Reaktion als vielmehr wegen der Übertragung immunkompetenter Zellen in der Graft-versus-Host-Reaktion lagen. 348 An dem damals weltweit größten Zentrum für Immundefektkrankheiten an der University of Minnesota in Minneapolis arbeitete ab 1966 Ernst-Martin Lemmel (* 1935) 349 unter Robert A. Good ( ), in dessen Team Richard A. Gatti 1968 die erste erfolgreich verlaufende Knochenmarktransplantation unter eineiigen Zwillingen durchführte. 350 Lemmel konnte bei den gemeinsam mit Good unternommenen Versuchen zeigen, dass immunkompetente Zellen, die zur Vermeidung einer Graft-versus Host-Reaktion in vitro mit dem Antibiotikum Mitomycin C behandelt worden waren, nach Übertragung auf einen allogenetischen Wirt überlebten und hier ihre Reaktionsfähigkeit gegen Antigene von dritter Seite behielten. 351 Ebenfalls 1968 pflanzten US-amerikanische Ärzte erstmals einem Säugling mit Di- George-Syndrom den Thymus eines menschlichen Fötus in die Bauchmuskulatur ein und konnten Monate später die Herstellung der immunologischen Funktionen verkünden. 352 Die erste Transplantation von fetalem Thymusgewebe und Knochenmark in der Bundesrepublik wurde im Herbst bzw. im Dezember 1969 im Zentrum für Innere Medizin und Kinderheilkunde an der Universität Ulm zwecks Heilung eines Immundefektes durchgeführt. 353 Bei den Patienten handelte es sich um zweieiige, im Februar 347 A. Rubinstein: Die Knochenmarktransplantation beim Immundefekt, in: Schweiz. Med. Wochenschrift 102 (1972), S J. de Koning/L.J.Dooren/D.W. van Bekkum/J.J. van Rood/K.A. Dicke/J. R. Rádl: Transplantation of bonemarrow cells and fetal thymus in an infant with lymphopenic immunological deficiency, in: Lancet vom , S Vgl. auch Stefan Thierfelder: Immunologische Probleme bei der Knochenmarktransplantation, in: Langenbecks Archiv für Chirurgie 329 (1971), S J. Mattar: Prof. Dr. med. Ernst-Martin Lemmel zum 80. Geburtstag. Arzt Wissenschaftler Lehrer Mensch, in: Zeitschrift für Rheumatologie 74 (2015), S Mitteilung von Hans-Hartmut Peter. 351 Ernst-Martin Lemmel/Robert A. Good: Probleme und Möglichkeiten immunologischer Rekonstitutionstherapie, in: S ; dies. Tolerance of cell-mediated immune responses after in vitro treatment of competent cells, in: Fed. Proc. 27 (1968), S. 686; dies.: Immunosuppressive action of mitomycin C on lymphoid cells. I. Effect on cell mediated immunity after in vitro treatment, tolerance induction, and recovery in vivo, in: International archives of allergy and applied immunology 36 (1969); S ; dies.: Tolerance of cell Mediated Immune Responses after in Vitro Treatment of Competent Cells with Mitomycin c, in: Nature 221 (1969), S Geglückte Thymustransplantation, in: FAZ vom , S. 11; W.W. Cleveland/B.J. Fogel/W.T. Brown/ H.E.M. Kay: Foetal thymic transplant in a case of DiGeorge s Syndrome, in: Lancet vom , S Erste deutsche Knochenmark-Transplantation, in: Selecta 3 vom , S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 205
108 1969 geborene Zwillinge mit der Diagnose»Lymphopenische Hypogammaglobulin ämie mit beeinträchtigter, aber nicht fehlender zellulärer und humoraler Immunität«. 354 Beide Kinder wurden ab der sechsten Lebenswoche zur Verhinderung von Infektionen in keimfreier Umgebung in eigens für Säuglinge bzw. Kleinkinder mit angeborener Immuninsuffizienz an der Universität Ulm entwickelten Plastikisolierbetten mit Schleusenund Filtersystem versorgt. 355 Während bei einem Zwilling eine zweimalige Implantation von fetalem Thymusgewebe vorgenommen wurde, erhielt sein Bruder ein Knochenmarktransplantat von seiner HLA-teilkompatiblen Mutter. 356 Bei der Transplantation des Knochenmarks orientierten sich die Ulmer Mediziner an den neuesten Forschungsergebnissen: Sie behandelten das Kind vor der Übertragung zunächst fünf Tage lang mit Antilymphozytenserum, um der Gefahr einer Sekundärkrankheit vorzubeugen. Anschließend wandten sie gemeinsam mit ihren anwesenden niederländischen Kollegen Dick van Bekkum ( ) und Karel A. Dicke ein von letzteren entwickeltes Verfahren an, bei dem die Stammzellen aus dem mütterlichen Knochenmarktransplantat durch Fraktionierung im Albumin- Gradienten von den immunkompetenten Zellen getrennt und dem Patienten injiziert wurden. 357 Tatsächlich traten postoperativ keine Anzeichen einer Graft-versus-Host- Krankheit aus. Während bei dem mit fetalem Thymusgewebe behandelten Kind nur ein vorübergehender Anstieg des Immunglobulinspiegels beobachtet werden konnte, verbesserten sich die immunologischen Werte seines knochenmarktransplantierten Bruders spontan. Im August 1971 wurden die Zwillinge nach zweieinhalbjähriger Isolation 354 Gerhard Stursberg: Variable kombinierte Immunsuffizienz Studien über die körperliche Entwicklung und den Krankheitsverlauf von Zwillingen in konventioneller Umgebung nach zweieinhalbjähriger gnotobiotischer Aufzucht, Diss. med. Ulm 1978, S. 43 (künftig zit.: Stursberg, Immunsuffizienz). 355 Auch für Erwachsene hatte an der Universität Ulm etablierte DFG-Forschergruppe für Experimentelle und Klinische Leukämieforschung ein keimfreies Plastikisolierbettensystem entwickelt, das als sogenanntes Ulmer Bett bezeichnet wurde, vgl. U. Genscher/Manfred Dietrich: Möglichkeiten und Ergebnisse der Behandlung im keimfreien Milieu, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 81. Kongress (1975), S ; Jahresbericht der DFG 1972, Bd. I: Tätigkeitsbericht, S. 111 f.; U. Genscher/M. Dietrich/D. Krieger/W. Teller/H.D. Flad/G. Hochapfel/F. Trepel/T.M. Fliedner: Lymphopenische Hypogammaglobulinämie bei zweieiigen Zwillingen: Aufzucht während des ersten Lebensjahres unter keimfreien, gnotobiotischen Bedingungen, in; Monatsschrift für Kinderheilkunde 119 (1971), S. 421; 356 H.D. Flad/U. Genscher/M. Dietrich/D. Krieger/F.W.Trepel/G. Hochapfel/W. Teller/T.M. Fliedner: Immunological deficiency syndrome in non-identical twins: maintainance in a gnotobiotic state and attempts at treatment with transplants of bone marrow and foetal thymus, in: Rev. Europ. Études clin. et. biol. XVI (1971), S Ebd.; Rainer Flöhl: Angeborene Abwehrschwäche. Knochenmarktransplantation gegen Schäden des Immunsystems, in: FAZ vom , S. 33. Gnotobiotische Aufzucht von zweieiigen Zwillingen mit angeborener Immuninsuffizienz im eigens hierfür entwickelten»ulmer Bett«ausgeschleust, ihre weitere ärztliche Überwachung erfolgte in konventioneller Umgebung. 358 Robert A. Good leitete den Sammelband mit Beiträgen für einen Workshop über Immundefektkrankheiten im Februar 1967 in Florida mit dem Hinweis ein, dass seit der Entdeckung der Agammaglobulinämie durch Bruton im Jahr 1952 weltweit mehr als 1000 Fälle von Immundefektkrankheiten unterschiedlicher Art in Kliniken und Laboratorien registriert worden seien. 359 Angesichts dieser geringen Zahl wundert es nicht, dass diese Krankheiten in der Bevölkerung und mutmaßlich auch im ärztlichen Alltag kaum eine Rolle spielten. In den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerieten sie erst 358 Während der anschließenden langjährigen Fortsetzung der Beobachtung und Behandlung in konventioneller Umgebung verstarb ein Zwilling 16 Monate nach seiner Ausschleusung an einer Masernpneumonie, vgl. Stursberg, Immuninsuffizienz, S Robert A. Good: Introduction, in: Daniel Bergsma (Hrsg.): Immunologic Deficiency Diseases in Man, o. O. 1968, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 207
109 in den 1980er-Jahren mit der Beobachtung einer neuen, bisher unbekannten Form der Immunschwäche, die 1982 die Kurzbezeichnung AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) erhalten sollte. Transplantationsimmunologie Die Entwicklung von Immunität, also die Fähigkeit fremde Proteine als fremd und möglicherweise gefährlich zu erkennen und eine spezifische Abwehr gegen sie zu entwickeln, ist ein lebenswichtiger Prozess für jedes Individuum. In bestimmten Fällen sind diese immunologischen Grundphänomene allerdings unerwünscht und sogar gefährlich, wie beispielsweise bei autoimmunen Prozessen, bei denen sich die Abwehrreaktion des Immunsystems gegen den eigenen Körper wendet oder bei der Transplantation von Organen oder Gewebe. Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bildete die Immunabwehr ein entscheidendes Hindernis in der Entwicklung der Transplantationsmedizin. Der Begriff»Transplantationsimmunität«stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatte der Chirurg Georg Schöne ( ) bei Hauttransplantationsversuchen mit Kaninchen beobachtet, dass sich autologe Transplantationen (»Autoplastiken«)»in fast beliebigem Umfange leicht ablösen [ließen] und wieder anheil[t]en«, während beim Tausch von Hautstücken zwischen verschiedenen Kaninchen nur in einem von 92 Fällen eine»anheilung«gelang. In einem weiteren Immunisierungsversuch, in dem er einen Teil der Kaninchen mit artgleicher Haut von Kaninchenembryos vorbehandelte, konnte er feststellen, dass diese im Gegensatz zu nicht vorbehandelten Kontrolltieren mit einer»ungewöhnlich starke[n] und schnell verlaufende[n] Schädigung des fremden Gewebes«reagierten, während»autoplastische Hautlappen«auch hier»auf allen Tieren tadellos«anheilten. Schöne zog aus seinen Beobachtungen den Schluss,»dass es eine Transplantationsimmunität gibt, welche nichts mit Geschwulstgewebe zu tun hat und welche auch auf normale Gewebe des Erwachsenen einwirkt«. 360 Mit seinem Bericht in der Münchener Medizinischen Wochenschrift hatte Schöne nicht nur den Begriff»Transplantationsimmunität«in die wissenschaftliche Literatur eingeführt, sondern bereits wesentliche Phänomene der Abstoßungsreaktion beschrieben. Doch erst die Arbeiten des britischen Biologen Peter Medawar und des australischen Mediziners Francis Macfarlane Burnet konnten ihre theoretischen Grundprinzipien erklären. Medawar und seine Arbeitsgruppe wiesen in den 1940er-Jahren durch die Entdeckung der 360 Georg Schöne: Über Transplantationsimmunität. In: Münchener Medizinische Wochenschrift 59 (1912), S second-set-reaction nach, dass immunologische Vorgänge ursächlich für die Zerstörung des Transplantats waren. Das 1949 von Francis Macfarlane Burnet formulierte und 1953 experimentell von Peter Medawar bestätigte Prinzip der immunologischen Toleranz in der Embryonalentwicklung, für deren Entdeckung beide Wissenschaftler 1960 den Nobelpreis erhielten, eröffnete zudem Wege zur Überwindung der Körperabwehr. Zugleich zog man aus der Beobachtung, dass Transplantate besser vertragen wurden, je enger Spender und Empfänger mit einander verwandt waren, den Schluss, dass die für die Gewebeverträglichkeit verantwortlichen Faktoren vererbt wurden. 361 Grundlegend für die Erkenntnis, dass die Abstoßungsreaktion auch von der genetischen Differenz zwischen Spender und Empfänger abhängig ist, waren die Arbeiten des französischen Hämatologen Jean Dausset ( ) beschrieb er erstmals ein Histokompatibilitätsantigen (HLA) an der Oberfläche menschlicher Leukozyten und wies seine genetische Festlegung nach. Für ihre Entdeckungen genetisch bestimmter zellulärer Oberflächenstrukturen, von denen immunologische Reaktionen gesteuert werden, erhielten die US-Amerikaner George D. Snell und Baruj Benacerraf sowie Jean Dausset 1980 den Nobelpreis. Sie können damit auch als Väter der»immungenetik«gelten, die sich mit den erblich bedingten Grundlagen der Immunologie befasst. Die Entdeckung des genetisch festgelegten HLA-Systems des Menschen bildete den Ausgangspunkt für zahlreiche Studien und internationale Workshops zur Histokompatibilitätstestung und Gewebetypisierung, die schließlich den Anstoß zur Gründung der transnationalen Organaustauschorganisation Eurotransplant 1967 im niederländischen Leiden gaben. 362 In der Bundesrepublik Deutschland hatte man dem HLA-System zunächst kaum wissenschaftliches Interesse entgegengebracht und seine Bedeutung insbesondere für die Transplantationsmedizin anscheinend unterschätzt. An den ersten Konferenzen zur Histokompatibilitätstestung (Juni 1964 in Durham/USA; 1965 in Leiden; Juni 1967 in Turin und Saint Vincent, Januar 1970 Los Angeles) waren keine deutschen Wissenschaftler beteiligt. 363 Die Histokompatibilitätssysteme und ihre Testung waren allerdings Thema 361 Walter Brendel: Entwicklung und Ergebnisse seit 1963, in: Francis D. Moore: Transplantation. Geschichte und Entwicklung bis zur heutigen Zeit, Berlin Heidelberg, New York 1970, S , hier S. 163f (künftig zit.: Brendel, Entwicklung). 362 Daniel Galden: Geschichte und Ethik der Verteilungsverfahren von Nierentransplantationen durch Eurotransplant, Diss. med. Tübingen Der erste internationale Workshop zur Histokompatibilitätstestung fand 1964 in Durham (North Carolina, USA) mit 23 Teilnehmern statt. Auf dem dritten internationalen Workshop 1967 in Turin/Saint Vincent wurde ein Nomenklatur Komitee benannt, das eine international akzeptierte Nomenklatur der Leukozyten-Antigene entwickelte, die in der Folgezeit auf der Grundlage neuer Erkenntnisse mehrmals überarbeitet wurde, vgl. PMC /pdf/bullwho pdf. 363 Vgl. hierzu die Teilnehmerlisten in den publizierten Tagungsberichten. 208 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 209
110 auf einer internationalen Klausurtagung über Probleme der Transplantationsimmunologie im April 1967 in Titisee/Schwarzwald. An dieser Tagung, die sich darüber hinaus mit den Methoden zur Unterdrückung von Immunreaktionen, dem Mechanismus der Transplantatabstoßung sowie den rechtlichen Fragen zur Beschaffung von Transplantaten befasste, nahmen rund 40 Mediziner insbesondere Immunologen, Internisten und Chirurgen teil, 364 darunter auch als Referent der Immunhämatologe und spätere Eurotransplant-Initiator Jon van Rood (* 1926) aus Leiden. 365 Im März 1970 bildete sich auf einer von den Immunhämatologen Willi Spielmann und Siegfried Seidl in Frankfurt a. Main organisierten Tagung über aktuelle Probleme der Histokompatibilitätstestung eine gleichnamige Arbeitsgemeinschaft, die unter Beteiligung zahlreicher Immunologen in der Folgezeit regelmäßig Jahrestagungen mit wissenschaftlichem Programm abhielt. 366 Auf der zweiten Sitzung dieser Arbeitsgemeinschaft im Oktober 1970 wurde Willi Spielmann der Aufbau des nationalen Referenzlaboratoriums für Untersuchungen auf Gewebeverträglichkeit vor Organtransplantationen in Frankfurt übertragen. 367 Praxisrelevante Untersuchungen für die Histokompatibilitätstestung erfolgten in der Abteilung für klinische Immunologie in Erlangen in Form von tierexperimentellen Prüfungen der in der Forschungsliteratur beschriebenen Testmethoden zur Bestimmung der Histokompa- 364 Zu den Teilnehmern zählten u. a. H.E. Bock (Tübingen), E.S. Bücherl (Berlin), H. Fischer (Freiburg); M. Hašek (Prag), G. Hermann (Köln), Meyer zum Büschenfelde (Mainz), P. O. Miescher (New York), R. Pichlmayr (München), G. Riethmüller (Tübingen), R.N. Taub (London), S. Thierfelder (München), J.J. van Rood (Leiden); I. Zeiss (Freiburg), vgl. Gabl F. Gabl/G. Riethmüller/K. Schuhmacher/I. Zeiss: Probleme der Transplantationsimmunologie, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 133 (1967), S (künftig zit.: Gabl et al, Transplantationsimmunologie). 365 Zu den Tagungsreferenten zählte auch der Bundesanwalt Max Kohlhaas ( ), der einleitend in seinem Vortrag über rechtliche Fragen zur Beschaffung von Transplantaten darauf verwies, dass»man in Deutschland nach den Erfahrungen besonders vorsichtig«wäre. In seinem Referat befasste sich Kohlhaas auch mit der von Diskussionsteilnehmern vorgebrachten Frage»Darf ein Mensch mit Leukocytenantigenen zur Gewinnung von Antiseren immunisiert werden?«, ebd. S Willi Spielmann/Siegfried Seidl: Tagungsbericht Arbeitsgemeinschaft für Histokompatibilitätstestung, in: Blut 20 (1970), S. 393; Vgl. Vgl. Tagungsbericht über die Dritte Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für Histokompatibilitäts-Testung in der Bundesrepublik (Bonn, ), in: Blut 24 (1972), S ; Bericht über die 5. Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Histokompatibilitätstestung in Gießen am 6. Oktober 1973, in: Zeitschrift für Immunitätsforschung 147 (1974), S Die Themen der Arbeitsgemeinschaft orientierten sich an der Relevanz des HLA-System für ganz unterschiedliche medizinische Themen wie bspw. Krankheitsdisposition oder forensische Paternitätsserologie, vgl. bspw. Willi Spielmann/Siegfried Seidl: Zur Anwendung des HL-A-Systems in der Paternitätsserologie, in: Zeitschrift für Rechtsmedizin 74 (1974), S Kleine Mitteilungen: Nationales Referenzlaboratorium Frankfurt a. M., in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 95 (1970), S Das Referenzlaboratorium sollte im Neubau des Zentralinstituts vom DRK-Blutspendedienst Hessen untergebracht werden, in dem sich auch das Institut für Immunhämatologie und Transfusionskunde der Universität Frankfurt befand. tibilität zwischen Spender und Empfänger. 368 Darüber hinaus führten Ernst Kuwert und Jörg Bertrams an der Ruhruniversität Essen umfangreiche Untersuchungen an mehr als 500 Seren erst- und mehrgebärender Frauen durch und konnten dabei 15 monospezifische HLA-Antiseren bestimmen, die sie Eurotransplant für die Histokompatibilitätstestung zur Verfügung stellten. 369 Neben der Überprüfung der Gewebeverträglichkeit von Spender- und Empfänger bildete die Unterdrückung bzw. Abschwächung der Immunabwehr die wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Transplantation. In den 1960er-Jahren wurden verschiedene Möglichkeiten einer immunsuppressiven Therapie diskutiert und in der klinischen Praxis angewandt. Dazu zählten physikalische Maßnahmen wie die Ganzkörperröntgenbestrahlung oder die extrakorporale Bestrahlung des Blutes, um die kreisenden Lymphozyten zu dezimieren. Diese Methoden überprüfte Heinz Pichlmaier (* 1930) an der Abteilung für Experimentelle Chirurgie der Chirurgischen Universitätsklinik München ausführlich im Rahmen seiner Habilitationsarbeit und konnte im Tierversuch deutliche Lymphzellverminderungen erzielen. 370 Im Vordergrund stand jedoch die Erprobung verschiedener Medikamente (Zytostatika, Antimetabolite, Antibiotika, Antimitotika, Glukokortikoide) auf ihre immunsuppressive Wirkung. 371 Anfang der 1960er-Jahre entdeckten Forscher in den USA bei ihrer Suche nach pharmakologischen Immunsuppressiva das bis heute eingesetzte Azathioprin. Parallel setzte der schottische Chirurg Michael Woodruff 1960 in Edinburgh erstmals bei Hauttransplantationen bei Ratten ein Antilymphozytenserum (ALS) ein, um die Abstoßungsreaktion zu unterdrücken. 372 An- 368 H. Warnatz/F. Scheiffarth/G. Bruhn: Vergleichende tierexperimentelle Untersuchungen über zwei Methoden zur Bestimmung der Histokompatibilität, in: Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie 315 (1966), S ; H. Warnatz/F. Scheiffarth/M. Donné: Vergleichende tierexperimentelle Untersuchungen über den Cutantest an bestrahlten Hamstern und den Mixed Lymphocyte Culture Test, in. Zeitschrift für Immunitätsforschung 133 (1967), S Jörg Bertrams/Ernst Kuwert/G. Linzenmeier: Leukozyten-Isoantikörper. I. Vorkommen agglutinierender und zytotoxischer Antikörper gegen weiße Blutzellen im Serum erst- und mehrgebärender Frauen, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 95 (1970), S ; Jörg Bertrams/Ernst Kuwert: Leukozyten-Isoantikörper. II. Ausbildung, Spezifitätsänderungen und Persistenz der Antikörper bei Frauen (in Abhängigkeit von Schwangerschaft und Geburt, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 112 (1970), S ; Jörg Bertrams/Ernst Kuwert/K. Noll: Leukocyten-Isoantikörper. III: Identifizierung und Charakterisierung monospezifischer HL-A-Antiseren zur Histokompatibilitäts-Testung, in: Zeitschrift für medizinische Mikrobiologie und Immunologie 156 (1971), ; E. Kuwert/J. Bertrams: Transplantationsantigene des Menschen: das HL-A-System, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 95 (1970), S Heinz Pichlmaier: Die Bedeutung der Lymphozyten für die Homotransplantation, in: Langenbecks Arch. Klein. Chirurgie 315 (1966), S Rudolf Pichlmayr: Immunsuppression und Organtransplantation, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 109 (1967), S Michael Woodruff: The transplantation of tissues and origins, Springfield, Oxford 1960, S. 100 f. 210 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 211
111 geregt von Woodruffs Experimenten, nahmen mehrere Forschergruppen in Europa und in den USA unabhängig voneinander Untersuchungen zur Entwicklung eines eigenen ALS auf. Darüber hinaus wurden in den 1960er-Jahren tierexperimentelle Studien zur Immunsuppression mittels Thymektomie durchgeführt, die in geringem Umfang auch bei Patienten zur Verhinderung einer Abstoßungsreaktion bei Nierentransplantationen vorgenommen wurden. 373 In der Bundesrepublik war es insbesondere Rudolf Pichlmayr, der in der von Walter Brendel geleiteten Abteilung für Experimentelle Chirurgie an der Chirurgischen Klinik (Direktor Rudolf Zenker) der Universität München die Arbeit entscheidend vorantrieb. Zunächst entnahm Pichlmayr bei einem Hund Lymphozyten, die er einem Pferd injizierte. Nach mehrwöchiger Behandlung mit hoher Dosis gewann er so ein Hochimmunserum, das die Lymphozyten beim Hund zerstörte. Bei Nieren- und Lebertransplantationen beim Hund konnte Pichlmayr mit diesem ALS, dessen Herstellung und Wirkung er in einer weltweit beachteten Habilitationsschrift dokumentierte, eine deutlich längere Überlebenszeit von Organtransplantaten erzielen als bei bisher gebräuchlichen Methoden. 374 Nach erfolgreicher Erprobung im Tierexperiment, über die Pichlmayr auch auf der bereits erwähnten internationalen Klausurtagung»Probleme der Transplanta tionsimmunologie«im April 1967 in Titisee/Schwarzwald berichtete, 375 begann er mit der Herstellung eines beim Menschen wirksamen ALS durch die Immunisierung von Pferden mit menschlichen Lymphozyten, 376 die durch die Drainage des Ductus thoracicus von Patienten gewonnen wurden, die mit dem ALS behandelt werden sollten. Anschließend wurden die Gammaglobuline mit Hilfe der Behringwerke aus den gewonnenen Immunseren extrahiert und so ein hochkonzentriertes Antilymphozytenglobulin (ALG) gewonnen. 377 Parallel nahm Stefan Thierfelder ( ) am Institut für Hämatologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in München tierexperimentelle Untersuchungen zur Anwendung eines von ihm selbst hergestellten ALS bei der Knochenmarktrans- 373 Gabl et al, Transplantationsimmunologie, S Rudolf Pichlmayr: Herstellung und Wirkung heterologer Antihundelymphozytenseren, in: Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin 143 (1967), S (künftig zit.: Pichlmayr, Herstellung und Wirkung); Rudolf Pichlmayr/Walter Brendel/Rudolf Zenker: Production and effect of heterologous anticamine lyphocyte serum, in: Surgery 61 (1967), S ; Walter Brendel: Erste Kontakte mit der Herztransplantation, in: Fortschritte der Medizin 101 (1983), 44, S , Gabl et al., Transplantationsimmunologie, S. 436 ff. 376 Rudolf Pichlmayr/Walter Brendel/Gg Beck/E. Schmittdiel/I. Pichlmayr/S. Thierfelder/A. Fateh-Moghadam/Walter Land: Gewinnung von heterologen Immunseren gegen menschliche Lymphocyten, in: Klinische Wochenschrift 46 (1968), S Walter Brendel/Walter Land: Überraschende Ergebnisse durch intravenöse Therapie mit Antilymphozytenserum bei Organtransplantationen, in: Deutsche Medizinische Wissenschaft 1968, S (künftig zit.: Brendel/Land, Überraschende Ergebnisse). Rudolf Pichlmayr, o. D. plantation auf, in denen er dessen immunsuppressive Wirkung insbesondere durch die Behandlung der Knochenmarkspender im Vorfeld der Transplantation demonstrieren konnte. 378 Das für die Anwendung beim Menschen hergestellte Münchener ALG kam in Kombination mit immunsuppressiven Medikamenten zunächst bei einzelnen Nierentransplantationen zum Einsatz. 379 Parallel begann das Münchener»ALG-Team«380 in Kooperation mit anderen medizinischen Einrichtungen nach erfolgreicher Demonstration im Tierversuch mit der klinischen Erprobung des ALG in der Therapie von Autoaggressionskrankheiten (vgl. dort), sowie bei chronischer lymphatischer Leukämie S. Thierfelder/D. Möller/I. Kimura/P. Dörner/M. Eulitz/W. Mempel: Die Wirkung von heterologem Antilymphozytenserum auf die homologe und heterologe Knochenmarksübertragung bei supra letal bestrahlten Mäusen, in: Blut XV (1967), S ; S. Thierfelder/D. Götze/M. Eulitz: Die Wirkung von Kaninchen-anti-Maus-Lymphocyten-γ-Globulin auf die chronische Sekundärkrankheit bei gegen Kaninchen-Normal-γ-Globulin-toleranten Knochenmarkspendern, in: Klinische Wissenschaft 48 (1970), S ; S. Thierfelder: Immunologische Probleme bei der Knochenmarktransplantation, in: Langenbecks Arch Chir 329 (1971), S Rudolf Pichlmayr/Walter Brendel/Rudolf Zenker: Erfahrungen mit heterologen Antilymphozytenseren beim Menschen, in: Münchener Medizinischen Wochenschrift 110 (1968), S So bezeichnet von Walter Land unter einem Foto, das Rudolf Pichlmayr, Christa Schülgen, Walter Brendel und Walter Brand zeigt, vgl. Walter Gottlieb Land: Immunsuppressive Therapie, Stuttgart, New York 2006, S. 195 Abb A.D. Tsirimas/R. Pichlmayr/B. Hornung/H. Pfisterer/S. Thierfelder/W. Brendel/W. Stich: Therapeutische Wirkungen von heterologem Antihumanlymphocytenserum (AHLS) bei chronischer lymphatischer Leukämie, in: Klinische Wochenschrift 46 (1968), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 213
112 Einen aufsehenerregenden Erfolg erzielte das Münchener ALG durch seinen Einsatz bei den ersten spektakulären Herztransplantationen des südafrikanischen Herzchirurgen Christiaan Barnard ( ). 382 Walter Brendel hatte sich bereits im Dezember 1967 bei Barnard in Kapstadt aufgehalten, um sich ausführlich über die erste erfolgreiche Herztransplantation bei einem Menschen zu informieren. Kurz darauf am 2. Januar 1968 führte Barnard seine zweite Herztransplantation durch. Zunächst wurde der Patient Philip Blaiberg zur Unterdrückung der Immunabwehr mehrere Monate mit Nebennierenrindenhormonen und Azathioprin behandelt. Das Medikament musste jedoch wegen seiner starken Nebenwirkungen abgesetzt werden, was bei Blaiberg zu einer heftigen Abstoßungsreaktion führte. In dieser dramatischen Situation entschied sich Barnard im Juli 1968 zur Verabreichung hoher Dosen des Münchener ALG, die zu einer relativ schnellen Erholung des Patienten führte. Noch im selben Jahr wurde das Münchener ALG bei drei weiteren Herztransplantationen in Santiago de Chile, in Sao Paulo und erneut in Kapstadt sowie bei drei Nierentransplantationen in München mit Erfolg eingesetzt. Trotz umfangreicher klinischer Erprobung bzw. Anwendung war man sich über die Wirkungsweise des ALS keineswegs im Klaren. Die Frage nach dem zugrunde liegenden Mechanismus beschäftigte nicht nur immunologisch interessierte Chirurgen auf der Suche nach einer besseren Beherrschung der Abstoßungsreaktionen, sondern auch Immunologen, die sich von der Klärung der Wirkungsweise auch neue Einblicke in grundsätzliche immunologische Prozesse versprachen. 383 Insbesondere Peter Medewar und seine Mitarbeiter in London stellten auf der Basis eigener tierexperimenteller Forschungen verschiedene Theorien auf, die sie teilweise schon nach kurzer Zeit wieder verwarfen. Am weitesten verbreitet war die zuerst geäußerte Auffassung eines zytotoxischen Effekts des ALS. Dieser Vorstellung hingen auch die Münchener Forscher aufgrund ihrer eigenen Untersuchungsergebnisse an. 384 Eine entgegengesetzte Hypothese besagte, dass das ALS als Antigen die Proliferation immunologisch inkompetenter Lymphozyten bedinge (»sterile activation«). 385 Ferner wurde die Vermutung geäußert, dass das ALS die Lymphozyten umhülle und durch eine Blockierung von Rezeptoren das Erkennen von Antigenen verhindere (»blindfolding«). Auch die Möglichkeit der Hemmung eines»immunologisch wirksamen Thymusfaktors«durch das ALS oder einer Immobilisierung 382 Brendel, Entwicklung, S. 171 f.; Brendel/Land, Überraschende Ergebnisse. 383 Land, Immunsuppressive Therapie, S. 197 ff. 384 Pichlmayr, Herstellung und Wirkung, S. 195 ff.; W. Land/R. Rudolph/W. Brendel: In-vitro-Wirkung eines heterologen Antiserums auf Lymphozyten der Ratte: Eine elektronenmikroskopische Studie, in: Blut XVIII (1968), S (künftig zit.: Land/Rudolph/Brendel, In-vitro-Wirkung). 385 Vgl. Rudolf Pichlmayr: Die Bedeutung von Antilymphozytenseren für die Immunsuppression, in: Langenbecks Arch. Chir. 322 (1968), S , hier S. 491 (künftig zit.: Pichlmayr, Bedeutung). der Lymphozyten im lymphatischen Gewebe wurde diskutiert. 386 In der Bundesrepublik war es neben der Münchener Arbeitsgruppe insbesondere der Tübinger Immunologe Gert Riethmüller, dessen Forschungen zur Wirkungsweise des ALS und den dahinter stehenden immunologischen Prozessen auch international Beachtung fanden. 387 Riethmüller konnte in verschiedenen Versuchen unter anderem zeigen, dass Antilymphozyten-Globuline nicht mehr immunsuppressiv wirken, wenn durch Behandlung mit einer Proteinase (Papain, Pepsin) das die Komplementbindung und die cytophile Aktivität bestimmende Fc-Fragment entfernt wurde. 388 Einen anderen Weg 389 verfolgte Hans-Hartmut Peter (*1942), der 1968 im Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer (Paris) bei Pierre Grabar und später von 1970 bis 1972 bei Joseph D. Feldman ( ) am Scripps Research Institut (La Jolla, USA) über»immunological enhancement«in Allotransplantmodellen forschte.»enhancing sera«sind hyperimmune IgG Präparate, die Alloantigene im Transplantat maskieren 390 und dadurch zu einer Verzögerung der Effektor-T-Zell-Sensibilisierung und Transplantatabstossung führen. Peter untersuchte die zellulären Abstoßungsvorgänge in einem Hauttransplantatmodell (BN auf Lewis Ratte) mit Hilfe des 51 Cr-Release Testes. 391 Embryonale Spender (BN)-Fibroblasten dienten als Targets für Lymphknoten- und Milz- Lymphozyten von BN-Haut transplantierten Lewis-Ratten. Peter konnte zeigen, dass allo-spezifische, thymus-abhängige Killer-Lymphozyten zum Zeitpunkt der Allotrans- 386 Pichlmayr, Bedeutung, S. 491; Land/Rudolph/Brendel, In-vitro-Wirkung, S Gert Riethmüller: Antilymphocyte serum, in: Lancet vom 2. Dezember 1967, S. 1210; G. Riethmüller/P. Rieber/D. Riethmüller: First International Congress of Transplantation Society, Abstracts, S. 155; Gert Riethmüller/Doris Riethmüller/Hans Stein/Peter Hausen: In vivo and in vito properties of intact and pepsin-digested heterologous anti-mouse thymus antibodies, in: Journal of Immunology 100 (1968), S ; G. Riethmüller/P. Rieber/D. Riethmüller: Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von heterologen Antilymphocyten-Globulinen, in: Klinische Wochenschrift 46 (1968), S ; Gert Riethmüller/Doris Riethmüller/Peter Rieber/Hans Stein: In vitro Stimulation of Lymphoid Cells by Antilymphocytiec Globulins, in: Otto Westphal/ H.-E. Bock/E. Grundmann (Hrsg.) Current Problems of Immunology (Bayer-Symposium I), Berlin/Heidelberg/New York 1969, S Gert Riethmüller setzte seine Versuche fort und berichtete hierüber auch auf dem ersten Internationalen Kongress für Immunologie im August 1971 in Washington. Vgl. Gert Riethmüller/Ernst-Peter Rieber: Antiimmunglobulin Antibody as Antigen. A Functional Approach to Receptor Immunoglobulin of Thymus Cells, in: Bernard Amos (Hrsg.): Progress in Immunology. First International Congress of Immunology, New York, London 1971, S Die folgenden beiden Textabschnitte wurden in Zusammenarbeit mit Hans-Hartmut Peter verfasst. 390 Joe M. Jones/Hans-Hartmut Peter/Joseph D. Feldman: Binding in vivo of enhancing antibodies to skin allografts and specific allogeneic tissue. Journal of Immunology 108 (1972), S Brunner KT, Mauel J, Cerottini JC, Chapuis B. Quantitative assay of the lytic action of immune lymphoid cells on 51-Cr-labelled allogeneic target cells in vitro; inhibition by isoantibody and by drugs, in: Immunology 14 (1968), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 215
113 plantat-abstoßung in drainierenden Lymphknoten und Milz ein Maximum erreichen und danach rasch in den Backgroundbereich absinken. 392 Eine überraschende Nebenbeobachtung war eine von der Allotransplantation unabhängige nicht unerhebliche spontane Killer-Zell-Aktivität von Blut-, Lymphknotenund Milz-Lymphozyten gegen die embryonalen Fibroblasten. Dieses spontane, nichtallo-spezifische Killing wurde von thymus-unabhängigen Lymphozyten vermittelt. Es lag nahe, dass diese»spontanenous or natural killer cells«etwas mit der natürlichen Tumor abwehr zu tun haben könnten. Nach seiner Rückkehr nach Hannover in die Abteilung von Helmuth Deicher begann Peter 1973 in Zusammenarbeit mit Francois Kourilsky ( ) und J. P. Cesarini (Paris, *1937) sowie J. R. Kalden (* 1937) Killer- Zell-Funktionen im humanem Melanom-Modell zu untersuchen. Der Befund bestätigte sich beim Menschen: spontane Killer-Zell-Aktivität war bei Kontrollpersonen und im Melanom Stadium I am höchsten und nahm mit Ausbreitung des Tumors ab. 393 Ähnliche Beobachtungen waren inzwischen unabhängig von Ron Herbermanns Gruppe in Bethesda 394 und Rolf Kiessling in Hans Wigzells Labor in Stockholm 395 gemacht worden, die das Phänomen als»natural killing«(nk) und die Effektorzellen als NK-Zellen bezeichneten. Im Frühjahr 1974 ging Peter für vier Monate nach Paris, um im Kourilsky Labor die neue Killer-Zelle mit den damaligen technischen Möglichkeiten umfassend zu charakterisieren. 396 Die»spontaneous or natural killer cells«machen 5 bis 7 Prozent der Blutlymphozyten aus. Sie exprimieren Fc-Rezeptoren und vermitteln auch»antibodydependent cellular cytotoxicity«(adcc). Sie finden sich unter den tumorinfiltrierenden Zellen im primären Melanom. 397 Die NK-Zelle, die ihre Zielzellen nicht MHC-restrin- 392 Hans-Hartmut Peter/Joseph D. Feldman: Cell-mediated cytotoxicity during rejection and enhancement of allogeneic skin grafts in rats, in: Journal of Experimental Medicine 135 (1972), S Hans-Hartmut Peter/Joachim R. Kalden/P. Seeland/V. Diehl/G. Eckert: Humoral and cellular immune reactions in vitro against allogeneic and autologous human melanoma cells, in: Clin Exp Immunol. 20 (1975), S R.K. Oldham/ J.Y. Djeu/G.B. Cannon/D. Siwarski/R.B. Herberman: Cellular microcytotoxicity in human tumor systems: analysis of results, in: J Natl Cancer Inst. 55 (1975), S Rolf Kiessling/G. Petranyi/K. Kärre/M. Jondal/D. Tracey/H. Wigzell: Killer cells: a functional comparison between natural, immune T-cell and antibody-dependent in vitro systems, in: Journal of Experimental Medicine 143 (1976), S Hans-Hartmut Peter/J. Pavie-Fischer/W.H. Fridman/C. Aubert/J.P. Cesarini/R. Roubin/F.M. Kourilsky: Cell-mediate cytotoxicity in vitro of human lymphocytes against a tissue culture melanoma cell line (igr3), in: Journal of Immunology 115 (1975), S Regine Roubin/J.P. Césarini/ W.H. Fridman/J. Pavie-Fischer/H.-H. Peter: Characterizationof the mononuclear cell infiltrate in human malignant melanoma, in: International Journal of Cancer 16 (1975), S giert erkennt, erlangte in der Folge als Teil der innate Immunity eine große Bedeutung in der Virus- und Tumorabwehr. 398 Tumorimmunologie Obwohl schon Paul Ehrlich von»zauberkugeln«träumte, die Krebszellen im Körper aufspüren und vernichten können, und obwohl während der gesamten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Forschungen zur Tumorimmunität unter anderem auch von deutschen Wissenschaftlern betrieben wurden, bildete sich die Tumorimmunologie als eigenständige Disziplin erst in den 1950er-Jahren heraus. Wegweisend hierfür waren zum einen die Weiterentwicklung der Transplantationsimmunologie, zum anderen die im Experiment gelungene Immunisierung gegen chemisch induzierte Tumore durch Ludwik Gross (1943) 399, die Edward Foley (1953), 400 Richmond Prehn und Joan Main (1957) 401 bestätigen konnten. Die Untersuchungen auf dem Gebiet der Tumorimmunologie befassten sich in der Folgezeit mit der Entwicklung geeigneter Methoden zur Identifizierung von tumorspezifischen Antigenen, ferner mit dem tierexperimentellen Nachweis spezifischer Antigene bei chemisch und virusindizierten Tumoren sowie mit den Fragen, wie sich spezifische Antigene in menschlichen Tumoren nachweisen lassen und welche Erkenntnisse aus der experimentellen Tumorimmunologie für eine erfolgreiche Immuntherapie beim Menschen gezogen werden können. 402 Wesentliche Beiträge zu diesen Themen lieferte der von der Universität Köln beurlaubte, ab 1958 mit Unterbrechungen am Sloan Kettering Institute for Cancer Research and Memorial Hospital in New York forschende Herbert Oettgen. Er gehörte zu der Arbeitsgruppe um Lloyd Old und Edward Boyse, die mit Immunpräzipitationsmethoden ein mit dem Burkitt Tumor und dem Karzinom des Nasopharyx assoziiertes Antigensystem nachweisen konnten. Oettgen konnte zudem erstmals zeigen, dass Antigene che- 398 Klas Kärre/H.G. Ljunggren/G. Piontek/R. Kiessling: Selective rejection of H-2-deficient lymphoma variants suggests alternative immune defence strategy, in: Nature 319 (1986), S Ludwik Gross: Intradermal immunization of C3H mice against a sarcoma that originated in an animal of the same line, in: Cancer Research 3/5 (1943), Edward J. Foley: Antigenic properties of methylcholanthrene-induced tumors in mice of the strain of origin, in: Cancer Research 13/12 (1953), Richmond T. Prehn/Joan M. Main:Immunity to methylcholanthrene-induced sarcomas, in: Journal of the National Cancer Institute 18/6 (1957), Herbert.F. Oettgen/W.M. Gallmeier, Tumorimmunologie, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 93 (1968), S ; Hilde Götz: Wesen und klinische Bedeutung der Tumorimmunologie, in: Medizinische Klinik 68 (1973), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 217
114 misch induzierter Tumore beim Meerschweinchen sowohl tumorspezifische Transplantationsimmunität als auch tumorspezifische delayed hypersensitivity auslösen. 403 Dies gelang sowohl mit dem Hauttest in vivo als auch mit dem Makrophageninhibitionstest in vitro. 404 Auch in Untersuchungen am Menschen werden nunmehr die delayed hypersensitivity Reaktionen einbezogen. Aufgrund seiner international stark beachteten Forschungen am Sloan Kettering Institute war Oettgen nicht nur regelmäßig Gast auf wissenschaftlichen Tagungen in der Bundesrepublik, sondern wurde auch von einschlägigen Institutionen umworben verhandelte er sowohl mit den Farbenfabriken Bayer, die ihm die Leitung eines Instituts für Immunologie und Cancerologie angeboten hatten, als auch mit der Universität Freiburg. 405 Oettgen entschied sich schließlich, den Ruf auf den neuerrichteten Lehrstuhl für Immunbiologie an der Universität Freiburg anzunehmen und zugleich die mit dem MPI für Immunbiologie assoziierte DFG-Forschergruppe»Tumorimmunologie«zu übernehmen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern des MPI führte Oettgen Experimente zur Wirkung bakterieller Lipopolysaccharide auf das Tumorwachstum durch. 406 Ferner unternahmen sie erfolgreiche Versuche, mittels unspezifischer Stimulierung des Immunsystems durch»adjuvantien«und»immunpotentiatoren«wie Lysolecithin die immunologische Abstoßung transplantierter Tumore zu steigern. 407 Dabei griffen sie auf die Ergebnisse früherer, insbesondere von Paul Munder und Herbert Fischer betriebenen Forschungen am MPI für Immunbiologie über die biologischen Wirkungen von Lysolecithin zurück. 408 Die mit Oettgens Berufung verbundene Hoffnung auf langfristige Impulse für die tumorimmunologische Forschung in der Bundesrepublik erfüllten sich jedoch nicht, da Oettgen bereits zwei Jahre nach seinem Amtsantritt in Freiburg wieder 403 Herbert F. Oettgen/Lloyd J. Old/Elisabeth P. McLean/Elizabeth A. Carswell: Delayed Hypersensitivity and Transplantation Immunity elicited ba Soluble Antigens of Chemically Induced Tumours in Inbred Guinea-pigs, in: Nature 220 (1968), S Barry R. Bloom/Boyce Bennett/Herbert F. Oettgen/Elisabeth P. McLean/Lloyd J. Old: Demonstration of delayed hypersensitivity to soluble antigens of chemically induced tumors by inhibition of macrophage migration, in: Proc Natl Acad Sci U.S.A. 64 (1969), S Vgl. auch»wissenschaftlicher Werdegang«Herbert F. Oettgen, o.d., in: Archiv der MPG, III. Abt./ZA 3 (Nachlass Herbert Fischer) Nr Oettgen an Julius Speer (DFG-Präsident) vom , in: Archiv der MPG, III. Abt./ZA 3 (Nachlass Herbert Fischer), Nr DFG Tätigkeitsbericht 1974, Jahresbericht Band I, S DFG Tätigkeitsbericht 1975, Jahresbericht Band I, S. 119 f.; DFG Tätigkeitsbericht 1976, Jahresbericht Band I, S ; Paul G. Munder/Herbert Fischer/Hans U. Weltzien/Herbert F. Oettgen/Otto Westphal: Lysolecithin analogs: a new class of immunopotentiators with antitumor activity, in: Proceedings of the American Association of Cancer Research 17 (1976), S Paul Gerhard Munder/Otto Westphal: Antitumoral and Other Biomedical Activities of Synthetic Ether Lysophospolipids, in: Chemical Immunology 49 (1990), (= B.H. Waksman (Hrsg.): : Fifty Years Progress in Allergy. A Tribute to Paul Kallós), S an das Sloan Kettering-Institut zurückkehrte. Die Versuche mit Lysolecithin und synthetischen Antitumorlipiden (bzw. Lysolecithinanaloga) wurden am MPI für Immunbiologie erfolgreich fortgesetzt auch in Kooperation mit dem Sloan Kettering Institut. 409 Auch an anderen bundesdeutschen Wissenschaftseinrichtungen wurden in den 1960er-Jahren Forschungen zur Tumorimmunologie aufgenommen, wobei der Schwerpunkt auf Studien zur Antigenität verschiedener Tumore sowie auf tierexperimentellen Untersuchungen zur Entwicklung einer immunologischen Therapie lagen. Der in den 1960er-Jahren am MPI für Hirnforschung und an der Universität Köln tätige Gerhard Uhlenbruck arbeitete u. a. zur Antigenität von Hirntumoren. 410 Zunächst in Erlangen und später in Berlin im Forschungslaboratorium für Transplantations- und Tumorimmunologie an der Chirurgischen Universitätsklinik der Freien Universität führte Hilde Götz ( ) 411 seit Anfang der 1960er-Jahre mittels immunologischer und serologischer Untersuchungsmethoden tierexperimentelle und klinische Studien zur Aufklärung des Antigencharakters von Tumorproteinen durch. 412 Gemeinsam mit Friedrich Scheiffarth unternahm sie zudem tierexperimentelle Untersuchungen mit Tumor-Transferrin-Komplexen als Modell einer erfolgreichen immunologischen Tumorbehandlung. 413 Eine Arbeitsgruppe um Gert Riethmüller (* 1934) an der Abteilung für experimentelle Chirurgie und Immunologie der Medizinischen Universitätsklinik in Tübingen befasste sich als Teil der DFG-Forschergruppe»Biochemische und Immunologische Grundlagen der Leukämie- und Tumortherapie«in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre mit der Entwicklung von immunstimulatorischen Therapien am malignen Melanom als Modelltumor. 409 George S. Tarnowski/Isabel M. Mountain/C. Chester/Stock/Paul M. Munder/Hans U. Weltzien/Otto Westphal: Effect of Lysolecithin and Analogs on Mouse Ascites Tumors, in: Cancer Research 38 (1978), S Vgl. auch DFG Tätigkeitsbericht 1975, Jahresbericht Band I, S. 119 f. 410 Gerhard Uhlenbruck/W. Gielen: Hirntumorcharakteristische Glykolipoide, in: Medizinische Welt, 1967, Nr. 7, S ; dies., Immunbiologie der Neuraminsäure: ein Beitrag zur Antigenität der Hirntumoren, in: Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie und ihrer Grenzgebiete 38 (1970), S Hilde Götz ( ) promovierte 1955 über»das Verhalten der Serumeiweißkörper unter Sensibilisierung sowie in Abhängigkeit vom Nebennieren-Rinden-System«an der Universität Erlangen und habilitierte sich 1968 über»antigenität von Tumorproteinen«und publizierte diese Arbeit 1972 in erweiterter Form als Monographie. Mutmaßlich 1970 nahm sie eine Stelle als Leiterin des neugegründeten Forschungslaboratoriums für Transplantations- und Tumorimmunologie an der von Emil Sebastian Bücherl geleiteten Chirurgischen Universitätsklinik der Freien Universität Berlin an. Gemeinsam mit Bücherl organisierte sie am 17./ in Berlin das erste internationale Symposium für angewandte Tumorimmunologie wechselte sie an die von Norbert Hilschmann geleitete Abteilung Immunchemie des Max-Planck-Instituts für experimentelle Therapie in Göttingen. 412 Hilde Götz: Antigenität von Tumorproteinen, Berlin, New York Friedrich Scheiffarth, Hilde Götz, H.W. Herbst: Tierexperimentelle Untersuchungen mit Tumor-Transferrin-Komplexen, in: Medicina experimentalis: International Journal of experimental medicine 19 (1969), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 219
115 Diese Arbeiten standen im Verbund mit einer von U. Veronesi in Mailand koordinierten internationalen WHO-Arbeitsgruppe die u. a. eine multizentrische adjuvante BCG-Studie beim Melanom im Stadium II durchführte, 414 an der auch die Hannoveraner Melanom- Ambulanz von Hans-Hartmut Peter teilnahm. 415 Im Rahmen ihrer Forschungen konnte die Arbeitsgruppe einen Test entwickeln,»mit dem die zytolytische Aktivität von Lymphozyten gegen Tumorzellen quantitativ gemessen werden kann, und mit dem auch aktivierende und blockierende Faktoren im Serum von Tumorpatienten erfaßt werden können«. 416 Weitere tumorimmunologische Forschungen wurden in den 1970er-Jahren auch im DFG-Schwerpunktprogramm»Krebsforschung«durchgeführt wie bspw. in Ulm durch Otto Haferkamp über immunpathologische Untersuchungen an Carcinomen des Magen- und Darmtrakts. 417 In dem 1970 eingerichteten Forschungslaboratorium für Transplantations- und Tumorimmunologie an der Chirurgischen Universitätsklinik der Freien Universität Berlin war die Tumorimmunologie erstmals in einer bundesdeutschen Einrichtung institutionalisiert worden, 418 während sich das 1964 in Heidelberg gegründete Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) mit einem derartigen Schritt Zeit ließ. Zwar hatte das Kuratorium des DKFZ im März 1969 die Errichtung eines Instituts für Tumorimmunologie und -genetik beschlossen, 419 die Planungen wurden jedoch 1971 zugunsten der Ansiedlung eines Laboratoriums der European Molecular Biology Organization (EMBO) zunächst zurückgestellt und erst in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre wieder aufgenommen. 420 An der Ruhruniversität Essen führten Ernst Kuwert und seine Mitarbeiter seit Beginn der 1970er-Jahre mehrere Studien zur Korrelation zwischen den HLA-Antigenen und bestimmten Tumorarten durch. Derartige Untersuchungen waren auf internationaler Ebene in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre aufgenommen worden, wobei Unterschiede im HLA-Antigenmuster zwischen der Normalbevölkerung und den Trägern verschiedener Tumorerkrankungen festgestellt wurden. 421 Die Arbeitsgruppe um Ernst Kuwert und Jörg Bertrams konnte zeigen, dass bei Patienten mit Morbus Hodgkin, Multiplem Myelom und Retinoblastom bestimmte HLA-Antigene signifikant häufiger bzw. seltener auftraten als bei der Normalbevölkerung. 422 Schon 1970 hatte Kuwerts Arbeitsgruppe anhand eines Falles von Chorionepithelioms die mögliche Bedeutung von starken Antigendifferenzen im HLA-System für die erfolgreiche Tumorbehandlung hervorgehoben. 423 Schließlich wurden in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre auch in der Pharmaindustrie neue Wege in der Tumor-Immuntherapie beschritten. In den Marburger Behringwerken entwickelte eine Arbeitsgruppe um Hans-Harald Sedlacek, Friedrich Robert Seiler und Hans Gerhard Schwick einen Impfstoff aus zuvor mit dem Enzym Neuraminidase behandelten, d. h.»demaskierten«tumorzellen, mit dem bei krebskranken Versuchstieren eine Aktivierung der körpereigenen Immunabwehr und in der Folge eine Reduktion der Tumormasse erzielt werden konnte Veronesi U, Adamus J, Aubert C, Bajetta E, Beretta G, Bonadonna G, Bufalino R, Cascinelli N, Cocconi G, Durand J, De Marsillac J, Ikonopisov RL, Kiss B, Lejeune F, MacKie R, Madej G, Mulder H, Mechl Z, Milton GW, Morabito A, Peter H, Priario J, Paul E, Rumke P, Sertoli R, Tomin R.: A randomized trial of adjuvant chemotherapy and immunotherapy in cutaneous melanoma. N Engl J Med Oct 7; 307(15): Mitteilung von Hans-Hartmut Peter. 416 DFG Tätigkeitsbericht 1975, Jahresbericht Band 1, S DFG Tätigkeitsbericht 1972, Band 2: Programme und Projekte, S Die Angabe bei Wikipedia zu Gerhard Uhlenbruck, wonach im MPI für Hirnforschung 1963 eine Abteilung für Biochemie und Tumorimmunologie eingerichtet worden sei, ließ sich nach Durchsicht der Publikationen Uhlenbrucks und der Jahresberichte der MPG nicht verifizieren. Uhlenbruck war vielmehr an der von Wilhelm Tönnis geleiteten Abteilung für Tumorforschung und experimentelle Pathologie tätig, die 1969 nach Tönnis Emeritierung geschlossen wurde, vgl. Tätigkeitsbericht der Max-Planck- Gesellschaft vom , in: Die Naturwissenschaften 57 (1970), Heft 12, S Erst mit seinem Wechsel an die Medizinische Universitätsklinik Köln 1968 entstand dort eine Abteilung für Immunbiologie. 419 Gustav Wagner/Andrea Mauerberger: Krebsforschung in Deutschland. Vorgeschichte und Geschichte des Deutschen Krebsforschungszentrums, Berlin et al. 1989, S Ebd., S Erst 1976 bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestages 35 zusätzliche Stellen für den Aufbau des Instituts für Tumorimmunologie und -genetik, ebd. S Ernst Kuwert/Jörg Bertrams: Die Bedeutung des HL-A-Antigensystems für die Tumorforschung, in: Zeitschrift für Krebsforschung 78 (1972), S Jörg Bertrams/H.E. Reis/W.M. Gallmeier/ C.G. Schmidt: HL-A antigens in Hodgkin s disease and Multiple Myeloma: Increased frequency of W 18 in both diseases, in: Tissue Antigens 2 (1972), S ; Peter Schildberg/Jörg Bertrams/Wolfgang Hopping/Ernst Kuwert: Histokompatibilitäts (HL-A)-Antigene beim Retinoblastom, in: Albrecht von Graefes Archiv für klinische und experimentelle Ophthalmologie 186 (1973), S W.M. Gallmeier/J. Bertrams/E. Kuwert/C.G. Schmidt: Regression des Chorionepithelioms: Zytostatikawirkung und/oder Immunreaktion?, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 95 (1970), S Hans-Harald Sedlacek/Friedrich Robert Seiler/Hans Gerhard Schwick: Neuraminidase und Tumor Immunotherapy: Klinische Wochenschrift 55 (1977), S ; vgl. auch Mantel zerstört, in: Der Spiegel 23/1975 ( ), S. 137 f. 220 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER BRD ( ) 221
116
117 Entwicklung der Immunologie in der Deutschen Demokratischen Republik ( ) 1 In diesem Beitrag soll die Entwicklung der Immunologie in der Klinik und Grundlagenforschung in der DDR kurz umrissen werden. Wenngleich die Verflechtung von Forschung und Politik dabei nicht im Vordergrund steht, soll doch eingangs daran erinnert werden, dass es in der DDR keinen Bereich der Gesellschaft gab, der sich dem rigiden politischen Einfluss des SED-Regimes hätte entziehen können. Die Tatsache impliziert auch das gesamte Spektrum an möglichen Verhaltensweisen, die der einzelne Wissenschaftler unter diesen Umständen einnehmen konnte. 2 Zudem soll nicht vergessen werden, dass einige Kollegen aus der DDR geflohen sind und anschließend ihre Karriere als Immunologen in der BRD fortgesetzt haben. Um zu einem ausgewogenen Urteil über den Stellenwert und die Bedeutung der immunologischen Forschung in der DDR zu kommen, sollten die realen Möglichkeiten des Handelns und seine Grenzen nicht aus dem Auge verloren werden. Die Immunologie, wie wir sie heute kennen, entwickelte sich aus verschiedenen Wissensbereichen wie der Allergologie, der Mikrobiologie, der Serologie bzw. Immunchemie, der Krebsforschung und der Genetik. Der neue Begriff wurde vermehrt ab 1900 verwendet, in deutschsprachigen Ländern als Immunitätsforschung oder Immunitätslehre bezeichnet 3 und dementsprechend tauchte er im angelsächsischen Sprachraum ab 1911 als»immunology«auf. 4 In den beiden deutschen Staaten dauerte es bis in die 1 Dieser Text ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit von Mitgliedern der Redaktionskommission auf Grundlage eines Textes von Sophie Meyer sowie Kommentaren von Lothar Jäger, Jürgen Kaden und Diethard Gemsa. Ergänzende Informationen, verfasst von Lothar Jäger, zur»geschichte der Immunologie in Ostdeutschland«(künftig zit.: Jäger, Immunologie in Ostdeutschland) können im Archiv der DGfI eingesehen werden. 2 Ausführlich dazu Sophie Meyer: Immunologie im kleinen Staat DDR. Die tumorimmunologische Grundlagenforschung in Berlin-Buch , Diss. Berlin S. hierzu den Beitrag von Axel Hüntelmann. 4 Vgl. David W. Talmage: The acceptance and rejection of immunological concepts, in: Annual Review of Immunology, Vol. 4 (1986), S oder auch: Anne Maria Moulin: Le dernier langage de la médicine. Histoire de l immunologie de Pasteur au Sida, Paris ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 223
118 1960er-Jahre, ehe man von»immunologie«sprach. Das zeigt sich an der Benennung der immunologischen Fachgesellschaften. Die Gründung der ersten immunologischen Arbeitsgemeinschaft in der DDR im August 1954, aus der später die Fachgesellschaft hervorging, trug die Immunologie bzw. Immunitätsforschung noch nicht im Namen. Sie wurde gegründet als»arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung von Allergie und Asthma«. Ihr westdeutsches Pendant, bereits 1951 entstanden, hieß»deutsche Gesellschaft für Allergieforschung«. Erst Anfang der 1960er-Jahre tauchte die Immunitätsforschung bzw. Immunologie in den Namen der Gesellschaften auf: 1962 bzw in der westdeutschen Vereinigung»Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung«bzw.»Gesellschaft für Immunologie«(Vorläuferin der jetzigen Deutschen Gesellschaft für Immunologie) und 1965 in der DDR. Dort wurde vier Jahre nach dem Mauerbau auch im Namen der Gesellschaft die Abgrenzung der beiden deutschen Staaten deutlich gemacht: Die ostdeutsche Fachgesellschaft hieß nun»gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung der Deutschen Demokratischen Republik«. Nimmt man die Umbenennungen der beiden Fachgesellschaften als Maßstab für die Etablierung der Immunologie als neues Fachgebiet, so kann man deren Entwicklungsschritte in der DDR zwischen den 1960er und 1970er-Jahren grobmaschig wie folgt einteilen: In den 1960er-Jahren dominierten in der experimentellen Forschung Transplantationen als Methode. In der medizinischen Klinik herrschten neben der traditionellen Mikrobiologie empirische Untersuchungen vor, insbesondere zu Allergien und Autoimmunerkrankungen sowie an den Universitätskliniken und Blutbanken die Transfusionsmedizin und Serologie. Ab Ende der 1960er-Jahre wurden auch Organtransplantationen zu einem wichtigen klinischen Arbeitsfeld. In den 1970er-Jahren erweiterte sich das Spektrum an verfügbaren Methoden. Nicht zuletzt durch die neuen Möglichkeiten der monoklonalen Antikörpertechnik näherten sich ab Mitte der 1970er-Jahre Klinik und experimentelle Forschung weiter an. Die 1960er-Jahre: erste immunologische Arbeitsgruppen Transplantationsforschung Die Transplantationsforschung spielte eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung der Immunologie nach Wesentliche immunologische Prozesse wie Immuntoleranz und Abstoßung körperfremden Gewebes wurden zuerst bei Transplantationen beobachtet und in der Folge zum Gegenstand experimenteller immunologischer Forschung im Tierversuch erhoben. Die ersten beiden Wissenschaftler in der DDR, die sich auf Titelblatt der populärwissenschaftlichen Schrift von Herwart Ambrosius: Vom Kampf in unserem Körper, Leipzig 1969 die experimentelle Immunologie spezialisierten, waren der Mediziner Günter Pasternak (* 1932) in Berlin und der Zoologe Herwart Ambrosius (* 1925) in Leipzig. Anders als für Günter Pasternak, der in der Krebsforschung arbeitete und sich der Immunologie von dort annäherte, kam für Herwart Ambrosius die Verbindung zur Immunologie über die Evolutionsforschung zustande. So baute er an der Universität Leipzig bereits 1963 eine Arbeitsgruppe zur vergleichenden Immunologie auf. Ambrosius veröffentlichte 1969 im Leipziger Urania-Verlag auch das erste populärwissenschaftliche Buch zur Immunologie. 5 Das Interesse von Ambrosius an immunologischen Fragen wurde auch beeinflusst von der in den 1940er-Jahren durch Lyssenko in der Sowjetunion und der später auch in der DDR erneut entfachten und stark politisierten Debatte um die Vererbbarkeit von durch die Eltern erworbenen Fähigkeiten direkt auf die nachfolgende Generation. 6 Ambrosius erinnerte sich zu Beginn seiner Forschungsarbeiten außerdem an die Versuche eines 5 Herwart Ambrosius: Vom Kampf in unserem Körper, Leipzig Vgl. dazu Ekkehard Höxtermann:»Klassenbiologen«und»Formalgenetiker«. Zur Rezeption Lyssenkos unter den Biologen in der DDR, in: Acta Historica Leopoldina 36 (2000), S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 225
119 anderen bekannten Vertreters dieser Denkrichtung, des österreichischen Biologen Paul Kammerer. Kammerers Ergebnisse wurden jedoch von seinen Fachkollegen angezweifelt, nicht zuletzt, weil es niemandem gelang, dessen Versuchsergebnisse zu wiederholen. 7 Ambrosius führte zwischen 1955 und 1961, wie seinerzeit Kammerer, viele Organtransplantationen an Schwanzlurchen durch und verglich diese mit den bis dahin vorliegenden Ergebnissen aus der medizinischen Forschung, speziell im Hinblick auf die Transplantationsimmunität. Links: Herwart Ambrosius mit Ulrich Schneeweiß, 1972 Rechts: Günter Pasternak (* 1932), 1990 Tumorimmunologie Für die Forschungen der Arbeitsgruppe Tumorimmunologie von Günter Pasternak am Institut für Krebsforschung in Berlin-Buch stellte die Arbeit mit ingezüchteten, also genetisch identischen Versuchstieren (in der Regel Mäusen), eine unabdingbare Voraussetzung dar. 8 Bereits 1962 konnte Pasternak bei Tieren aus seiner eigenen Mäusezucht tumorassoziierte Transplantationsantigene bei zwei bis dahin immunologisch noch nicht untersuchten Tumorarten nachweisen. Dadurch wurde das Spektrum der tumorimmunologisch bekannten und aussagekräftigen Experimentaltumore erweitert. 9 Bis zum Ende der 1960er-Jahre waren auch die Nachweistechniken von Tumorantigenen auf der Zellmembran in der Arbeitsgruppe Tumorimmunologie schon sehr ausgereift, wodurch weitere Aussagen über den Charakter von zum Beispiel virusinduzierten Tumorantigenen möglich wurden. In den 1960er-Jahren tat sich der Biologe Burkhard Micheel, seit 1967 Mitarbeiter Günter Pasternaks, auf diesem Gebiet hervor. 10 Weiterhin gab es in den 1960er-Jahren einige Naturwissenschaftler, die sich neben ihrer regulären Arbeit in der labormedizinischen Überwachung von Tumorpatienten auch 7 Zur tragischen Geschichte um Paul Kammerer siehe: Arthur Koestler: Der Krötenküsser. Der Fall des Biologen Paul Kammerer, Wien Am Pathologischen Institut der Medizinischen Akademie»Carl Gustav Carus«in Dresden baute der Pathologe Martin Müller (*1935) ab Mitte der 1960er-Jahre eine eigene Mäusezuchtlinie zur Untersuchung des virusinduzierten murinen Mammatumors auf und konnte schon früh seine Untersuchungsergebnisse auch außerhalb der DDR veröffentlichen, s. z. B. Martin Müller: Immunologic interactions between isologous or F1 hybrid hosts and spontaneous mammary tumors in CBA/Bln mice, in: Cancer Research, 27 (1967), S Vgl. Günter Pasternak, in: Luise Pasternak (Hrsg.): Wissenschaftler im biomedizinischen Forschungszentrum Berlin-Buch , Frankfurt a. Main 2004, S (künftig zit. G. Pasternak, Kurzbiografie), hier S. 104 f. 10 Z. B. Burkhard Micheel/Dieter Bierwolf: Demonstration of Graffi virus-induced surface antigens of leukemia cells by indirect immunoferritin technique, in: Experimental Cell Research, Vol. 54, No. 2 (1969), S der Forschung widmeten. So führte Bodo Teichmann (*1932) an der Robert-Rössle-Klinik in Berlin-Buch unter dem Klinikdirektor Hans Gummel ( ) frühe Versuche mit Gewebe- oder Diffusionskammern an Ratten durch. 11 Dabei wird die Abstoßung des transplantierten Gewebes dadurch verhindert, dass sich das Gewebe in einer Diffusionskammer befindet und somit keinen direkten Kontakt zum Empfängerorganismus erhält, eine Methode, die zuerst von drei amerikanischen Forschern publiziert und in Berlin-Buch nachexperimentiert wurde. 12 Getestet wurden mit dieser Methode an der Robert-Rössle-Klinik unter anderem neue Möglichkeiten der Gewebezüchtung in vivo. Bodo Teichmann reiste Ende 1964 zu einem mehrwöchigen Forschungsaufenthalt an das Max-Planck-Institut für Immunbiologie nach Freiburg im Breisgau, um dort weitere Arbeitstechniken wie die Flavozonmethode zur»schonenden Vernetzung von niedermolekularen Polysacchariden zu hochmolekularen, antigenwirksamen Komplexen unter Erhaltung der determinanten Gruppen«zu erlernen. 13 Den Freiburger Institutsdirektor Otto Westphal, der ihn dorthin eingeladen hatte, hatte er zuvor in Berlin-Buch kennengelernt. 11 Bodo Teichmann/Gunter Wittig: Tumor cells in chambers implanted into immunized rats, in: Nature 200 (1963) No. 4904, S Ebd. Mit Verweis auf Glenn H. Algire/James M. Weaver/Richmond T. Prehn: Growth of cells in vivo in diffusion chambers. I. Survival of homografts in immunized mice, in: Journal of the National Cancer Institute 15 (1954), No. 3, S Zu dieser Reise befindet sich im Bundesarchiv ein Reisebericht Teichmanns: BArch SAPMO/DY 30/ IV A 2/9.04/362: Abt. Wissenschaften beim ZK der SED : AdW, Tätigkeit des medizinisch-biologischen Forschungszentrums der AdW in Berlin-Buch ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 227
120 Versuchstiere in der experimentellen Immunologie Während die meisten immunologischen Forschungsgruppen in der DDR mit genetisch identischen Mäusen experimentierten, untersuchten Herwart Ambrosius und seine Mitarbeiter in Leipzig die Immunsysteme niederer Wirbeltiere und Fische. Beispielsweise zählten Schildkröten und Karpfen zu ihren Versuchstieren. Diese Testtiere waren ein Alleinstellungsmerkmal der Leipziger Arbeitsgruppe, nicht nur, was die Klassen-, Gattungs- und Artenvielfalt, sondern auch, was die experimentelle Verwendbarkeit und Langlebigkeit betrifft. So forschten Ambrosius und seine Mitstreiter im Falle der Schildkröten teilweise zwölf Jahre lang an denselben Tieren. 14 In Bezug auf die Immunreaktivität stellten sich verschiedene Reptilien wegen ihrer phylogenetischen Stellung als ideale Versuchstiere heraus, um Immunmechanismen zu klären, die sowohl bei Säugetieren als auch bei Vögeln eine Rolle spielen. Seit 1965 konzentrierte sich Ambrosius vermehrt auf immunchemische Fragestellungen, das heißt die Struktur und Funktion von Immunglobulinen sowie den Vergleich zwischen Immunglobulinen unterschiedlicher phylogenetischer Herkunft. 15 Die in Zusammenarbeit mit Frank Emmrich und Roland Richter erhaltenen Ergebnisse konnte Ambrosius auch in renommierten westlichen Zeitschriften publizieren. 16 Durch eine Kooperation mit den wissenschaftlichen Partnern in der Sowjetunion konnten die Berlin-Bucher Krebsforscher ihre Versuche gelegentlich auch an anderen Tieren als an Mäusen durchführen. Im abchasischen Suchumi existierte seit den 1920er- Jahren eine Affenversuchsstation. 17 Mit den Primaten des dortigen Instituts für Experimentelle Pathologie und Therapie wurden Versuche im Bereich der Leukämieforschung durchgeführt. Die vermuteten virusinduzierten Antigene konnten die DDR-Immunologen mit ihrer Fluoreszenzmethode jedoch nicht entdecken. Erst Jahre später gelang es dem Direktor des Instituts in Suchumi, Boris Lapin, in Zusammenarbeit mit Lawrence A. Falk, Friedrich Deinhardt und später Robert C. Gallo, zwei Retroviren bei Affen zu entdecken Persönl. Mitteilung Herwart Ambrosius im Interview mit Sophie Meyer am 14. März Vgl. Frank Emmrich: Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der DGfI an Professor Dr. Herwart Ambrosius in Düsseldorf 2000, in: Immunologische Nachrichten, Jg. 128 (2001), Heft 1 (künftig zit.: Emmrich, Laudatio), S. 4 f. 16 Frank Emmrich/Roland F. Richter/Herwart Ambrosius: Immunoglobulin determinants on the surface of lymphoid cells of carps, in: European Journal of Immunology 5 (1975) No. 1, S Vgl. Nikolai Krementsov: Hormones and the bolsheviks: From organotherapy to experimental endocrinology, , in: Isis 99 (2008), S Lawrence A. Falk et al.: Properties of Baboon Lymphotropic Herpes Virus Related to Epstein-Barr Virus, in: International Journal of Cancer 18 (1976), S Hellmuth Kleinsorge (links) und Lothar Jäger auf einem internationalen Allergiekongress in Madrid, 1964 Die Frage nach geeigneten Versuchstieren, die auch in Ambrosius Arbeitsgruppe immer im Hintergrund der Versuche stand, flammte Anfang der 1970er-Jahre wieder auf und führte zu einer stärkeren Hinwendung zur klinisch orientierten humoralen und zellulären Immunologie und dem Aufbau eines breiteren methodischen Spektrums an in-vitro-tests, Gewebezüchtungen, Messgeräten etc. Klinische Immunologie: Allergien, Asthma und Autosensibilisierung Neben diesen Arbeitsgruppen zur experimentellen Immunologie bildeten sich anfangs in Jena eine und in Berlin eine Vielzahl klinisch-immunologischer Arbeitsgruppen heraus. An der Berliner Charité untersuchte eine Mitarbeitergruppe in der von Hans Alois Hackensellner ( ) geleiteten Abteilung für Transfussions- und Transplantationswesen die Immunogenität unterschiedlich konservierter Haut im Tiermodell, während sich Niels Sönnichsen (* 1930) und andere in der dortigen Hautklinik mit der Autoimmundia gnostik beschäftigten. An der 1. Medizinischen Klinik der Charité gab es die Arbeitsgruppe Hermann, die sich mit der Rheumaserologie beschäftigte. Am Berliner Hygieneinstitut hatte Berthold Adamczyk eine Gruppe zur Virusimmunologie aufgebaut, und am Staatlichen Institut für Immunpräparate und Nährmedien war die Arbeitsgruppe zur Infektions- und Immunchemie angesiedelt. Eine besondere Rolle spielte die Allergologie zeitweise auch Namensgeber der ostdeutschen Fachgesellschaft. Weiterhin gab es am Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose eine Arbeitsgruppe zur Allergologie (Paul Steinbrück [ ] und Karl-Christian 228 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 229
121 Bergmann). 19 Außerhalb Berlins waren es hauptsächlich die beiden Vorsitzenden der Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung, Hellmuth Kleinsorge ( ), der die DDR 1968 verließ, und Lothar Jäger (* 1934), die sich beide auf dem Gebiet der Allergologie und Autoimmunisierung engagierten. In der Zeitschrift humanitas plädierten Kleinsorge und Jäger schon frühzeitig für eine noch engere Kooperation der experimentellen und klinischen immunologischen Forschung. Bereits Mitte der 1960er-Jahre sprachen sie sich für die Festlegung der Forschungsschwerpunkte Transplantationsimmunologie sowie Immunhistologie und Immunpathologie aus. 20 In Jena wurde deshalb an der Medizinischen Universitätspoliklinik schon Ende der 1960er-Jahre eine zentrale Allergiediagnostik aufgebaut. Auch das III. Internationale Symposium der Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung, das im November 1968 in Halle/Saale stattfand, beschäftigte sich mit zwei Schwerpunkten aus der Grundlagenforschung und der klinischen Immunologie: der Struktur und Funktion der Immunglobuline sowie mit Autoimmunkrankheiten. Bei diesem Treffen kam es hauptsächlich auf Initiative von Günter Pasternak zur Gründung einer Sektion Immunologie innerhalb der Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der experimentellen Forscher und der Kliniker enger zu gestalten. 21 Klinische Immunologie: Organtransplantationen, HLA-Serologie und Immunsuppression Mit chirurgischen und biochemischen Fragestellungen befasste sich die Abteilung für experimentelle Organtransplantation der Charité, die von dem Urologen Moritz Mebel (* 1923) geleitet wurde und die im Krankenhaus am Friedrichshain untergebracht war. Mebel führte im Februar 1967 zusammen mit Harald Dutz ( ) und Otto Prokop ( ) die erste erfolgreiche allogene Nierentransplantation in der DDR beim Menschen durch. 22 Stärker als die technischen Probleme während einer Organverpflan- 19 S. Jäger, Immunologie in Ostdeutschland, S Vgl. Hellmuth Kleinsorge/Lothar Jäger: Erfolge gemeinsamer Forschungsarbeit: Arbeits- und Perspektivplan auf dem Gebiet der Allergie- und Immunitätsforschung, in: humanitas 6 (1966), Heft BArch DQ1/6443: MfG: Medizinische Wissenschaft und Forschung: Medizinisch-wissenschaftliche Gesellschaften, Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung S. auch den Brief von Lothar Jäger an Günter Pasternak vom Darin heißt es:»ich danke Ihnen sehr für Ihre Aktivität hinsichtlich der Konstituierung der Sektion Immunologie und hoffe, daß auf diese Weise eine Zersplitterung dieses so wichtigen Fachgebietes verhindert wird.«22 Moritz Mebel: Möglichkeiten und Grenzen der Transplantation lebenswichtiger Organe [= Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 1], Berlin 1979 (künftig zit. Mebel, Transplantation), S. 8. zung drängten dabei die immunologischen Komplikationen nach einer Lösung. Eines der zu dieser Zeit prominentesten klinischen Ziele der immunologischen Forschung bestand in der Verbesserung der Spender-Empfänger-Auswahl bei der Vergabe von Organtransplantaten. Ab Ende der 1960er-Jahre sah man auf diesem Gebiet erste Erfolge. In den Blutspendezentren der DDR ging es neben der täglichen Blutspende, Blutkonservierung und -transfusion nun verstärkt um die HLA-Typisierung, das heißt die Bestimmung der individuellen HLA-Antigene. Neben der Forschung war hier auch eine gut funktionierende Datenbank notwendig. Analog zu der zentralen Organvermittlungsstelle»Eurotransplant«, die 1967 unter anderen von dem niederländischen Hämatologen Jon van Rood ins Leben gerufen wurde, 23 richteten die Staaten des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 1972 ihrerseits das Pendant»Intertransplant«ein, das die Spenderorganvergabe innerhalb der sozialistischen Staaten organisieren sollte. 24 An den Transplantationszentren in Berlin, Rostock, Halle/Saale und Jena konzentrierte man sich auch auf eine Verbesserung der Immundiagnostik nach der Transplantation, um eine sich abzeichnende Transplantatabstoßung frühzeitig zu erkennen. 25 Bereits 1967 wurde an den Instituten für Biologie und Medizin (Direktor: L.-H. Kettler, ) der Deutschen Akademie der Wissenschaften (AdW) die»arbeitsgruppe Transplantation«mit Sitz am Institut für Pathologie der Charité gegründet. Sie wurde von Gerhard Biege ( ) unter Mitarbeit von Bodo von Broen ( ) geleitet. Später (1968 bzw. 1969) kamen die Biologin Karin Kaden (*1943) und der Mediziner Jürgen Kaden (*1942) dazu. Diese Arbeitsgruppe pflegte intensive Kontakte zum Institut für Klinische und Experimentelle Medizin in Prag (Inzuchtmäuse). Die 1970er-Jahre: Zentralisierung und methodische Vielfalt Institutionalisierung der Immunologie und der Aus- und Weiterbildung der DDR Die naturwissenschaftliche Forschung in der DDR wurde zentral geplant, organisiert und finanziert. Zuständig für die Finanzierung der immunologischen Forschung waren das Ministerium für Gesundheitswesen, das Ministerium für Hochschulwesen und die Akademie der Wissenschaften (AdW). 26 Den Anträgen auf Forschungsfinanzierung 23 Vgl. Jon van Rood: HLA and I, in: Annual Review of Immunology 11 (1993), S Peter Niecke: Intertransplant im Aufbau, in: humanitas 14 (1972). 25 Zum Stand Ende der 1970er-Jahre s. Mebel, Transplantation. 26 Vgl. Jäger, Immunologie in Ostdeutschland, S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 231
122 gingen eingehende aufgabenbezogene und kritische Diskussionen in den Arbeitsgruppen später in Forschungsverbänden voraus. Die Forschungsergebnisse wurden auf den jährlichen wissenschaftlichen Veranstaltungen der Forschungsprojekte vorgestellt. Nach der dritten Hochschul- und der zeitgleich durchgeführten Akademiereform Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre wurden in der DDR an verschiedenen Orten die bis dahin vorhandenen Arbeitsgruppen zu Abteilungen und Instituten für Immunologie aufgewertet bzw. ausgebaut. 27 Zunächst entstand 1969 am Zoologischen Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig innerhalb der Sektion Biowissenschaften eine Professur für Tierphysiologie und Immunbiologie, auf die Herwart Ambrosius berufen wurde. Leipzig war auch Vorreiter bei der Aus- und Weiterbildung im Bereich Immunologie. Schon seit 1965 konnten die Leipziger Biologiestudenten eine Vorlesung und ein Praktikum Immunologie absolvieren. Ab 1969 stand das gleiche Programm auch den Studierenden der Humanmedizin zur Verfügung. Das Curriculum der Weiterbildung wurde mit der Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung abgestimmt. 28 Als nächste Einrichtung folgte 1971 die Forschungsabteilung Immunologie am Institut für Physiologische Chemie der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, 29 die der Mediziner Helmut Friemel (* 1938) bis 1992 leitete. In Berlin hatten sich in den 1960er-Jahren verschiedene Arbeitsgruppen mit Bezug zur Immunologie gebildet wurde aus der Arbeitsgruppe Tumorimmunologie an der AdW in Berlin-Buch eine selbständige Abteilung Immunbiologie, als deren Leiter Günter Pasternak berufen wurde. Kurze Zeit später, 1973, wurde der Gerichtsmediziner und Immunologe Gerhard Bundschuh ( ) Leiter der neu gegründeten Abteilung Immunologie am Institut für Medizinische und Allgemeine Mikrobiologie an der Humboldt Universität in Berlin. Hier setzte Jürgen Kaden nach Auflösung der zuletzt von ihm geleiteten»arbeitsgruppe Transplantation«an der Akademie seine transplantationsimmunologischen Arbeiten fort, bis er 1976 das Labor für Transplantationsimmunologie an der Urologischen Klinik in Berlin-Friedrichshain übernahm. 30 Schwerpunkte der Arbeit waren die immunologische Überwachung Transplantierter (Rejektionsdiagnostik, Immunsuppression [antilymphozytäre Antikörper], HLA-Sensibilisierung), die Erprobung neuer diagnostischer Verfahren und die Begleitung tierexperimenteller Forschung (PUVA-Therapie, passives Enhancement u. ä.). 27 Die Biologieprognose im Bundesarchiv: BArch DF4/19858: MWT: Planung, Planerfüllung und Prognosen: Entwicklungsprognosen, Entwicklung der biologischen Forschung einschließlich der technischen Mikrobiologie , Vgl. Jäger, Immunologie in Ostdeutschland, S Vgl. Neues Deutschland vom Vgl. Jäger, Immunologie in Ostdeutschland, S. 11. Die Abteilung Klinische Immunologie an der Charité wurde nach Übernahme der Leitung durch Stephan Schnitzler ( ) im Jahr 1981 eine selbständige Abteilung im Bereich Medizin der Humboldt-Universität zu Berlin. Aus dieser Abteilung entstand später das Institut für medizinische Immunologie der Charité (Rüdiger v. Baehr [ ], Dieter Volk [* 1953], Thomas Porstmann [* 1948]). Weitere Abteilungen bzw. Institute für Immunologie wurden erst nach 1975 eingerichtet, so 1978 das Institut für Klinische Immunologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 31 Jürgen Kaden wurde 1974 mit Genehmigung des Ministers für Gesundheitswesen der erste Facharzt für Immunologie. Ein verbindliches Rahmenausbildungsprogramm zur Weiterbildung zum Facharzt für Immunologie wurde 1982 gesetzlich verankert. Foren des wissenschaftlichen Austauschs innerhalb der DDR sowie O st-west-kooperationen Im Zuge der Reform der AdW wurde für die kurze Dauer von zwei Jahren auch eine»problemorientierte Klasse Grundlagen der Immunbiologie«gegründet. Sie bestand von 1971 bis 1973 und bot den Immunologen der DDR ein gemeinsames Forum, um einander einmal monatlich ihre Forschungsergebnisse vorzustellen und sie im kleinen Fachkreis zu diskutieren. 32 Bald darauf kehrte man jedoch zu den alten Klassen der Akademie zurück, so dass die Einrichtung der»problemgebundenen Klassen«eine Episode blieb. Ebenfalls 1971 wurde vom Ministerium für Gesundheitswesen der DDR der Forschungsverband»Immunologie und Infektionsschutz«eingerichtet, in dem Herwart Ambrosius die Leitung des Themenkomplexes Immunologie übernahm. 33 Drei Jahre später erreichte man mit der sogenannten Hauptforschungsrichtung (HFR) Immunologie einen noch umfassenderen Zusammenschluss der DDR-Immunologen. Die HFR 10, wie sie kurz genannt wurde, leitete ebenfalls Herwart Ambrosius; ihre Haupttätigkeit fällt jedoch aus dem zeitlichen Rahmen dieses Artikels heraus, da sie erst 1976 einsetzte. Neben all diesen temporären Einrichtungen der zentralisierten Forschungsplanung der DDR war die Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung der DDR ein stän- 31 Vgl. ebd., S Die Protokolle der problemgebundenen Klasse befinden sich im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: ABBAW/1009: Akademieleitung , Sitzungsprotokolle der problemgebundenen Klasse»Grundlagen der Immunbiologie« Herwart Ambrosius et al.: Die Sektion Biowissenschaften der Karl-Marx-Universität Rückblick auf 25 Jahre Forschung und Wissenschaftsentwicklung, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung, 23 (1974), Heft 4, S , hier S ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 233
123 diges Forum für die unterschiedlichen Forschungsrichtungen in der Immunologie. Die von der Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift Allergie und Asthma (ab 1971 Allergie und Immunologie) gibt einen Einblick in die Bandbreite der Forschung und in die Aktivitäten der Gesellschaft. Von besonderer Bedeutung waren die wissenschaftlichen Tagungen, die von der Gesellschaft organisiert wurden und an denen bereits vor der ersten gemeinsam von Mitgliedern der ost- und westdeutschen Gesellschaft für Immunologie organisierten Konferenz 1977 im thüringischen Reinhardsbrunn häufig auch Gäste aus der Bundesrepublik teilnahmen. 34 Besonders der Forschungsstandort Berlin profitierte von Kontakten zu bundesdeutschen Kollegen. An der Charité hatte sich bereits unter Otto Prokop am Gerichtsmedizinischen Institut eine enge Zusammenarbeit mit dem Immunologen Gerhard Uhlenbruck (* 1929) an der Universität Köln entwickelt, die allein bis 1975 in mehr als zwanzig gemeinsamen Publikationen mündete. 35 Weiterhin sei der gute Kontakt zwischen Günter Pasternak (AdW) sowie Herwart Ambrosius (Uni Leipzig) und Klaus Rajewsky (* 1936) an der Universität Köln erwähnt. 36 Einige DDR-Immunologen, wie Lothar Jäger und Herwart Ambrosius, waren auch Mitglieder internationaler Gremien. So gehörte Jäger bereits seit 1964 der Europäischen Akademie für Allergie und Klinische Immunologie (EAACI) an. Ambrosius vertrat von 1974 bis 1977 und Jäger von 1977 bis 1979 die Gesellschaft im Council der International Union of Immunological Societies (IUIS). Beide waren auch in WHO-Arbeitsgruppen tätig. Immunologische Lehrbücher Zu Beginn der 1970er-Jahre wurden etliche Lehrbücher, teilweise auch Lizenzausgaben in der Bundesrepublik, von Immunologen in der DDR verfasst erschienen sowohl Günter Pasternaks und Ulrich Schneeweiß Buch»Transplantations- und Tumorimmunologie«, 37 als auch Helmut Friemels und Josef Brocks»Grundlagen der Immunologie«, das bis 1976 drei Auflagen zählte. 38 Das ebenfalls von Helmut Friemel herausgegebene Buch»Immunologische Arbeitsmethoden«, das 1976 in Jena erschien, fasste die in diesen Jahren neu entstandenen und alten Techniken zusammen, insgesamt eine beachtliche Zahl von 23 Methoden, die bis zur zweiten Auflage 1980 um ein Vielfaches anstieg. 39 Noch umfassender konzipiert war das in demselben Jahr in Stuttgart erschienene Werk zur Klinischen Immunologie von Lothar Jäger. 40 Darin waren die Erkrankungen, denen eine immunologische Ursache zugrunde lag, ebenso aufgeführt wie die geeigneten Methoden zu ihrer Diagnose und Therapie. Außerdem befand sich im allgemeinen Teil ein ausführlicher Überblick über das immunologische Grundwissen der Zeit. Zwei Jahre vor der Gründung des Instituts für Klinische Immunologie an der Friedrich-Schiller- Universität Jena umriss Lothar Jäger im Abschnitt»Das klinisch-immunologische Labor«hier auch bereits dessen Aufgaben und das notwendige Methodenspektrum, das von den klassischen Bluttests (Agglutination, Präzipitation) über komplexe Blutgruppenbestimmung und Histokompatibiliätstestung bis zur Radioimmundiagnostik und Nachweismethoden der zellgebundenen Sensibilisierung und Zytotoxizitätstests reichte. 41 Zusammenfassung und Ausblick Der große Aufschwung, den die Immunologie seit 1975 durch die von Cesar Milstein und Georges Köhler entwickelte Hybridomtechnik erlebte, war auch in der DDR zu spüren. Durch die gute Zusammenarbeit mit bundesdeutschen Kollegen erhielt bspw. Günter Pasternak am Zentralinstitut für Krebsforschung (ZIK) in Berlin-Buch von Klaus Rajewsky in Köln die für die Herstellung von Hybridomen notwendige Fusions- Mausplasmazytomlinie. 42 Auch an den anderen immunologischen Einrichtungen in der DDR setzte man ab 1978 monoklonale Antikörper in Klinik und Forschung ein war bereits eine so beträchtliche Fülle an Hybridom-Zelllinien entstanden, dass sich die Herausgabe einer Überblicksbroschüre über die Zelllinien und die sie vertreibenden Institutionen in den sozialistischen Staaten lohnte Federführend waren bei der Organisation der Tagung 1977 in Reinhardsbrunn auf DDR-Seite Herwart Ambrosius und auf bundesdeutscher Seite Klaus Rajewsky, vgl. Emmrich, Laudatio. 35 Z. B. Otto Prokop et al.: Die Reaktion von A3-Blutkörperchen mit Helix-Agglutininen, in: Deutsche Zeitschrift für Gerichtliche Medizin 61 (1967), S Zu Otto Prokop s. auch Mark Benecke: Seziert. Das Leben von Otto Prokop, Berlin Dazu muss bemerkt werden, dass die Kooperationen zwischen einzelnen Personen aus Ost- und Westdeutschland von staatlicher Seite in der DDR allenfalls geduldet, aber keinesfalls direkt gefördert wurden. 37 Günter Pasternak/Ulrich Schneeweiß (Hrsg): Transplantations- und Tumorimmunologie, Jena Helmut Friemel/Josef Brock: Grundlagen der Immunologie, Berlin Helmut Friemel (Hrsg): Immunologische Arbeitsmethoden, 1. Aufl. Jena In der 2. Aufl waren bereits 53 Methoden aufgeführt. 40 Lothar Jäger: Klinische Immunologie und Allergologie, 1. Aufl. Stuttgart Ebd., S. 212 f. 42 Pasternak, Kurzbiografie, S Council of Mutual Economic Assistance: Catalogue of Monoclonal Antibodies available from institutions of the CMEA member countries, , hrsg. vom Staatlichen Institut für Immunpräparate und Nährmedien des Ministeriums für Gesundheitswesen, Berlin ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( ) 235
124 Die Grundlagen für die aufstrebende immunologische Forschung in der DDR waren in den 1960er und 1970er-Jahren gelegt worden. Obgleich die immunologische Forschung wie andere Forschungsbereiche in der DDR auch durch widrige Rahmenbedingungen wie mangelnde Devisen und fehlende technische Voraussetzungen eingeschränkt war, und Beeinträchtigungen gegebenenfalls dadurch entstehen konnten, dass man für Publikationen in internationalen Zeitschriften erst eine Genehmigung der Parteileitung einholen musste, gelang es vielen DDR-Immunologen dennoch, gelegentlich ihre Forschungsergebnisse in international bekannten Zeitschriften zu veröffentlichen. Die klinische Immunologie war besonders aktiv in Berlin, Leipzig, Dresden, Magdeburg und Jena. Für die Dermatologie seien Jena erwähnt und in Berlin die Kinderklinik in der Charité sowie das Krankenhaus am Friedrichshain. Das Forschungsinstitut für Tuberkulose und Lungenkrankheiten in Berlin-Buch war eine Keimzelle der Allergologie. Die Virusimmunologie fand besonders Einzug in das Hygiene-Institut der Charité, die allgemeine Infektionsimmunologie und Immunchemie in das Staatliche Institut für Immunpräparate und Nährmedien. Die universitären Aktivitäten waren oft die Keimzentren der späteren Abteilungen bzw. Institute für Immunologie. Eine Sonderstellung nahm das Jenaer Institut für Klinische Immunologie ein, welches allerdings erst 1978 gegründet wurde. Entsprechend den Empfehlungen der WHO umfasste es neben dem Forschungslabor ein immunologisches Routinelabor für die gesamte Fakultät, eine Ambulanz und eine Bettenstation. 44 Der Aufbau der Immunologie in Ostdeutschland unterschied sich in zweierlei Hinsicht von der Entwicklung in Westdeutschland: Erstens waren die klinischen Einrichtungen von Beginn an stärker eingebunden und zweitens spielten die Fachgesellschaften früh eine große Rolle bei der inhaltlichen Ausrichtung des Faches, der Institutionalisierung sowie der Aus- und Weiterbildung. Die Institutionalisierung und Disziplinierung des Forschungsfeldes Immunologie an den Hochschulen zeigte sich nicht nur in der Ausdifferenzierung oder Gründung von Abteilungen und Instituten an den medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten, sondern auch mit der obligatorischen Einführung des Faches»Immunologie«in das Curriculum des Medizinstudiums. Darüber hinaus gab es seit 1982 die Berufsbezeichnung Facharzt bzw. Fachnaturwissenschaftler für Immunologie (siehe Kapitel II). Somit konnte sich die Immunologie in der DDR den Umständen entsprechend gut entwickeln und sich als neue Disziplin in Grundlagenforschung, Klinik und Lehre etablieren. 44 Ausführlich Jäger, Immunologie in Ostdeutschland. 236 ENTWICKLUNG DER IMMUNOLO GIE IN DER DDR ( )
125 II. Die Gründung der immunologischen Fachgesellschaften in Ost und West und ihre Zusammenführung Florian Neumann Diethard Gemsa Joachim R. Kalden
126 Die Gründung der immunologischen Fachgesellschaften in Ost und West und ihre Zusammenführung 1 Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie (DGfI), die bis 1995 Gesellschaft für Immunologie (GfI) hieß, kann auf eine 50-jährige Geschichte zurückblicken. Ihre Ursprünge hat sie in zwei medizinisch-naturwissenschaftlich orientierten immunologischen Gesellschaften, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989 etwa zeitgleich in den beiden deutschen Staaten entwickelten. Aufgrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontexte, in denen sie heranwuchsen und trotz einiger wissenschaftlicher Kontakte unter ihren Mitgliedern bildeten sie ganz eigenständige Profile aus. Ein halbes Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung trat ein Teil der Mitglieder des ostdeutschen Immunologen-Verbands der westdeutschen»gesellschaft für Immunologie«bei. Unter dem neuen, gemeinsamen Dach der seit 1995»Deutschen Gesellschaft für Immunologie«gelang es, die charakteristischen Unterschiede der ost- und westdeutschen Mediziner und Naturwissenschaftler für eine produktive Weiterentwicklung der Immunologie in Forschung und klinischer Praxis fruchtbar zu machen. Der Immunologen-Verband der Bundesrepublik Deutschland bis 1989 Die Idee zu einer Gesellschaft für Immunologie Der entscheidende Anstoß, in der Bundesrepublik Deutschland einen Dachverband für Forschende und Lehrende im Bereich der Immunologie zu gründen, kam aus dem Ausland. Die Initiative ging 1966 von Bernhard Cinader aus, damals Professor für Immun- 1 Die Autoren bedanken sich ganz herzlich bei Reinhold E. Schmidt (Hannover), Lothar Jäger (Jena), Hans- Martin Jäck (Erlangen), Ulrike Meltzer (Berlin), Anja Glanz (Erlangen) und Agnes Giniewski (Erlangen) für Korrekturen und äußerst hilfreiche Kommentare. DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 239
127 Hans Gerhard Schwick,»Spiritus Rector«und 1. Sekretär der Gesellschaft für Immunologie (GfI) chemie in Toronto (Kanada). 2 Während einem internationalen Colloquium für Immunpathologie im italienischen Punta Ala war er dem umtriebigen deutschen promovierten Biologen und Chemiker Hans Gerhard Schwick begegnet, der wenig später Vorsitzender des Vorstands der Behringwerke AG werden sollte, einer Tochter der damals noch existierenden Hoechst AG. 3 Ihm trug Cinader die Idee vor, internationale Kongresse für Immunologie zu veranstalten. Deren Organisation und Gelingen, erklärte er, hingen jedoch davon ab, dass jede Nation mit einer eigenen Gesellschaft für Immunologie vertreten wäre. Alle zusammen sollten sie die internationalen Kongresse finanzieren und Mitglieder zu ihnen entsenden. 4 Bis dahin gab es weltweit in nur drei Ländern entsprechende Vereinigungen: Die älteste, die US-amerikanische American Association of Immunologists (AAI), bestand bereits seit Und über vier Jahrzehnte später erst, 1956 und 1957, waren der britische 6 2 Zu Bernhard Cinader vgl. N.N.: Obituary Bernhard Cinader ( ), in: Immunology Letters 7 (2001), S. V VI. 3 Zu Hans Gerhard Schwick vgl. Jochen R. Kalden: Nachruf Hans Gerhard Schwick ( ), in: Immunologische Nachrichten / Immunological News, Heft 155 / 2015, S. 10 f.; zum Treffen in Punta Ala: Brief Hans Georg Schwick an G. Springer, 9. Juni 1967, Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«. 4 Rundschreiben an 23 in Deutschland lehrende Professoren von Hans Gerhard Schwick, Marburg, 7. Juni 1967, Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«; vgl. Liste von H. G. Schwick»Eingeladen zur Besprechung über die Gründung einer Deutschen Gesellschaft für Immunologie«, Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«. 5 The American Association of Immunologists (AAI); dazu: 6 British Society for Immunology; dazu: und Download der Publikation zu 60 Years British Society for Immunology: bsi-60-report.pdf Anfrage von H. Schwick an O. Westphal zur Gründung einer Deutschen Gesellschaft für Immunologie, 7. Juni DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 241
128 Otto Westphal, 1. Präsident der Gesellschaft für Immunologie ( ) daher kritisch gegenüber. Viele der jüngeren Wissenschaftler, die inzwischen im Ausland positiv aufgenommen worden waren, sahen die Idee eines deutschen Fachverbands deutlich positiver. Die Gründung und der australische 7 Immunologen-Verband ins Leben gerufen worden. Durch Cinaders Initiative kamen nun zahlreiche neue Gesellschaften hinzu allen voran 1966 in Kanada 8 und Frankreich 9 und in den folgenden Jahren in vielen weiteren europäischen und außereuropäischen Ländern. Hans Gerhard Schwick nahm sich der Sache in der Bundesrepublik sofort mit großem Enthusiasmus an. Er kannte viele der einschlägigen Forscher persönlich und setzte sich umgehend mit ihnen in Verbindung. 10 Die Resonanz war jedoch verhalten. 11 Viele der älteren Wissenschaftler erinnerten sich gut an die Vorbehalte und die kühle Zurückhaltung, die deutschen Forschern auch lange nach 1945 international entgegengebracht worden waren; erst langsam waren sie einer freundschaftlich-kollegialen Zusammenarbeit gewichen. 12 Der Idee eines dezidiert deutschen Immunologen-Verbands standen sie 7 Australian Society for Immunology; dazu: ASI_history.pdf 8 Zur Geschichte der Canadian Society for Immunology / Société Canadienne D Immunologie: csi-sci.ca/about_us.html 9 Zur Geschichte der Société Française d Immunologie: pages/?page=611&idl=21 10 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Rundschreiben Hans Gerhard Schwick an 23 immunologisch forschende Professoren in Deutschland, Marburg, den 7. Juni Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief Hans Gerhard Schwick an Bernhard Cinader, Marburg, 2. März Zeitzeugengespräch Erlangen, den mit Klaus Eichmann, Joachim R. Kalden, Fritz Melchers, Lothar Jäger. Analog dazu die Erfahrungen der Allergologen: Hans Schadewaldt, Erich Fuchs: Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung , München-Deisenhofen 1984, S. 41. (künftig zit.: Schadewaldt: Geschichte). Am 7. Juli 1967 war es schließlich soweit. Auf Initiative von Hans Gerhard Schwick traf sich eine Gruppe von 18 Wissenschaftlern zur Gründungsversammlung einer deutschen»gesellschaft für Immunologie«in einem Konferenzraum der Höchster Jahrhunderthalle, 13 was angesichts der erwähnten Vorbehalte als großer Erfolg galt. Das nationale Etikett wurde bei der Benennung der neuen Gesellschaft bewusst vermieden. Der damals zum ersten Vorsitzenden der Gesellschaft gewählte Freiburger Immunologe Otto Westphal erklärte wie viele andere Mitglieder der Gesellschaft noch Jahre später, dass sich die Gesellschaft für Immunologie nicht als deutsche, sondern»eigentlich als eine eher mitteleuropäische Gesellschaft«verstehe. 14 Der Gedanke, den Vorstand ganz in diesem Sinne durch ein oder zwei ausländische Immunologen aus der Schweiz, Italien, Schweden oder der Tschechoslowakei zu erweitern, wurde zwar bald aufgegeben, 15 aber der Vorstand der»gesellschaft für Immunologie«pflegte die Kontakte zu anderen nationalen Immunologen-Verbänden besonders in Frankreich, der Schweiz und Österreich von Anfang an sehr intensiv. Die ersten Aktivitäten Die neu gegründete Gesellschaft startete 1967 mit einem kleinen Team. 16 Neben Otto Westphal als erstem Vorsitzenden waren in der Gründungsveranstaltung der Gesellschaft der Göttinger Biochemiker Norbert Hilschmann und der Kölner Genetiker Klaus Rajewsky zu seinen Stellvertretern gewählt worden. 17 Hans Gerhard Schwick wurde zum 13 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Hans Gerhard Schwick: Niederschrift der Gründungs- und 1. Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie in Frankfurt a. M.-Hoechst am 7. Juli Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Otto Westphal, Freiburg, den , an Frederick Aladjem; entsprechend: Zweite Generalversammlung der Gesellschaft für Immunologie, , Protokoll, S. 1:»Von der wissenschaftlichen Organisation her ist sie [die Gesellschaft für Immunologie] darüber hinaus umfassender als mitteleuropäisch zu bezeichnen.«15 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief H. G. Schwick, Marburg, den ,.an O. Westphal. 16 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief H. G. Schwick, Marburg, den , an Georg F. Springer. 17 Interview Florian Neumann mit Klaus Rajewsky, Berlin, DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 243
129 Niederschrift der Gründungsversammlung in Frankfurt 244 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 245
130 Schriftführer und Schatzmeister bestimmt. Dieser Vorstand wurde im Oktober 1969 auf der ersten Mitgliederversammlung im Rahmen der ersten Jahrestagung der Gesellschaft in Freiburg im Breisgau 18 bestätigt. Die Rechtsabteilung der Farbwerke Hoechst AG empfahl den Wissenschaftlern, einen gemeinnützigen, eingetragenen Verein zu gründen. 19 Dementsprechend wurde die»gesellschaft für Immunologie«am 20. März 1968 ins Vereinsregister des Amtsgerichts von Marburg, dem Wohnort des Schriftführers und Schatzmeisters Schwick, eingetragen. 20 Der Zweck der Gesellschaft war in Statuten niedergelegt, die im Sinne ihrer beabsichtigten internationalen Öffnung auf Deutsch, Französisch und Englisch abgefasst waren. Die»Gesellschaft für Immunologie«, heißt es dort,»dient der Entwicklung der Immunologie als Forschungsgebiet der Naturwissenschaften und Medizin. Besonderes Anliegen der Gesellschaft ist 1. die Förderung der immunologischen Grundlagenforschung, 2. die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Forschung und Lehre. Dies soll erreicht werden durch a) Veranstaltung von Kongressen, Kolloquien und Vorträgen; b) Zusammenarbeit mit Immunologen der Grundlagen- und der klinischen Forschung auf internationaler Basis, c) Zusammenarbeit mit andernorts bestehenden immunologischen Vereinigungen, d) Förderung des Publikationswesens auf Gebieten immunologischer Forschung und verwandter Richtungen und e) Pflege von Kontakten zu interessierten Institutionen des öffentlichen Rechts, wiederum auf internationaler Basis.«21 Dass sich die Gesellschaft für Immunologie in den Statuten auf immunologische Grundlagenforschung konzentrierte und weniger klinisch orientiert war, hatte einen Grund. Bereits 1951 war in der Bundesrepublik eine»gesellschaft für Allergie-Forschung«gegründet worden, die vorwiegend Mediziner zu ihren Mitgliedern zählte. 22 Sie hatte sich 1963 in»deutsche Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung«umbenannt, um der Bedeutung immunologischer Fragestellungen in der Allergologie Rechnung zu tragen und auch um in Ergänzung zu den Medizinern naturwissenschaftliche Forscher auf dem Gebiet der Immunologie als Mitglieder zu gewinnen. 23 Doch die Resonanz der Naturwissenschaftler auf das Angebot des Mediziner-Verbands war gering. Sie sollten nun von der»gesellschaft für Immunologie«angesprochen werden, die sich von Anfang an von der»deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung«abhob: Sie wollte primär den immunologisch forschenden Naturwissenschaftlern ein Forum bieten, ohne jedoch interessierte Mediziner etwa aus dem Bereichen der Transplantationsforschung, Autoimmunität, Entzündungsforschung oder Onkologie auszuschließen. 24 Dies zeigte sich auch bei der Rekrutierung von Mitgliedern, der sich Hans Gerhard Schwick persönlich annahm. Er sammelte von allen ihm bekannten Forschern Hinweise auf Wissenschaftler, die im Bereich der Immunologie tätig waren, um diese dann persönlich anzuschreiben und für die neue Gesellschaft zu gewinnen. 25 Besonders wertvoll war dabei eine Aufstellung, die Schwick von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erhielt. Nachdem die DFG 1963 das Schwerpunktprogramm»Immunbiologie«aufgestellt hatte, waren viele Institutionen gegründet worden, in denen immunologisch geforscht wurde. Mit ihnen unterhielt die DFG enge Beziehungen. Zu den Einrichtungen zählten unter anderem das bereits 1961 gegründete Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg im Breisgau, das Institut für Medizinische Mikrobiologie in Mainz, das Institut für Genetik in Köln, das Institut für Virologie und Immunologie in Würzburg und der Lehrstuhl für Klinische Immunologie in Erlangen. Darüber hinaus gab es zahlreiche Wissenschaftler, die unabhängig von diesen Einrichtungen im Bereich der Immunologie forschten und die DFG im Hinblick auf Fördermitteln oder Stipendien kontaktiert hatten. Die DFG verfügte daher über die wohl besten Informationen zu einschlägigen Forschern und konnte Schwick eine Liste mit 62»auf immunologischem Gebiet arbeitenden Wissenschaftlern»von Biochemikern und Mikrobiologen über Virologen, Serologen und Pathologen bis hin zu Internisten, experimentellen Chirurgen und Pharmakologen«zur Verfügung stellen. 26 Viele von ihnen traten der neuen Gesellschaft für Immunologie bei und begannen, die in den Statuten gesetzten Ziele mit Leben zu füllen. 18 Ebd. 19 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief Rechtsabteilung der Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt a. Main, den 4. Juli 1967 an Hans Gerhard Schwick. 20 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts Marburg, 20. März 1968, Nr Satzung der Gesellschaft für Immunologie / Statutes of the»gesellschaft für Immunologie«/ Statuts de la»gesellschaft für Immunologie«(L Association d Immunologie), S Schadewaldt: Geschichte, S. 49 f. 23 Ebd., S Zeitzeugengespräch Erlangen, den mit Klaus Eichmann, Joachim R. Kalden, Fritz Melchers, Lothar Jäger. 25 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Korrespondenz von Hans Gerhard Schwick. 26 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief Bruns, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn, den 21. Dezember 1967 an Hans Gerhard Schwick, in: Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«. 246 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 247
131 Erste internationale Kontakte und die Gründung der International Union of Immunological Societies (IUIS) Es war ein weiteres Mal Hans Gerhard Schwick, der zunächst vor allem die internationalen Kontakte der Gesellschaft intensivierte. Bernhard Cinader hatte sich 1968 an Otto Westphal als neuen Vorsitzenden der Gesellschaft für Immunologie gewandt, um ihm seine Idee nahezubringen, ein international besetztes Komitee zu gründen, das einen internationalen Immunologen-Kongress vorbereiten sollte. 27 Dann könnte, schrieb er, gleich auch eine International Union of Immunological Societies gegründet werden, für die sich besonders die US-amerikanische American Association of Immunologists und die von ihm geleitete Canadian Society for Immunology stark machten. Otto Westphal war jedoch skeptisch. Er schrieb Cinader, dass er sich nicht sicher sei, ob die Gründung eines Weltdachverbandes für Immunologische Gesellschaften zu diesem Zeitpunkt günstig wäre. Überhaupt zeigten seine Erfahrungen mit anderen internationalen Verbänden, dass sie nach erstem Enthusiasmus zur Tagesordnung übergingen und bald den ursprünglichen Pioniergeist vermissen ließen. Außerdem würden erfahrungsgemäß»bestimmte Länder oder ihre Vertreter«politisch Probleme machen. 28 Doch weder Bernhard Cinader noch Hans Gerhard Schwick ließen sich von ihrem Vorhaben abbringen. Schwick fuhr Anfang Mai 1969 nach Brügge in Belgien. Dort trafen sich die Vertreter der inzwischen zahlreichen neu gegründeten nationalen immunologischen Gesellschaften, um die von Bernhard Cinader intensiv beworbene Inauguration der»international Union of Immunological Societies»zu begehen. Dem Aufruf waren neben Schwick als Vertreter der Gesellschaft für Immunologie Repräsentanten aus Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, den Niederlanden, Polen, Skandinavien und den USA gefolgt. 29 Am Tag der Gründung der IUIS, dem 5. Mai 1969, wurde der Spiritus rector der Union, Bernhard Cinader, zum Vorstand gewählt. Als Sekretär wurde Hans Gerhard Schwick auserkoren, als Schatzmeister Norbert Hilschmann (Göttingen). Beide waren die ersten in einer langen Reihe von Deutschen, die sich im Weltdachverband der immunologischen Gesellschaften IUIS in führender Position engagieren sollten. 30 So stellte die Gesellschaft für Immunologie mit Fritz Melchers ( ) und Stefan H. E. Kaufmann ( ) zwei IUIS-Präsidenten und mit Otto West- 27 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Bernhard Cinader, Toronto, , an Otto Westphal. 28 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Otto Westphal, Freiburg im Breisgau, den an Bernhard Cinader. 29 Zur Geschichte der International Union of Immunological Societies (IUIS): index.php?option=com_content&view=article&id=49&itemid=56 30 Zur Geschichte der International Union of Immunological Societies (IUIS) und ihrer Vorsitzenden ebd. phal ( ), Klaus Rother ( ), Holger Kirchner ( ), Joachim R. Kalden ( ), Martin Röllinghoff ( ), Stefan H. E. Kaufmann ( ), Reinhold E. Schmidt ( ) und Dieter Kabelitz ( ) acht Mitglieder im IUIS Council. Das sehr frühe Engagement von deutschen Immunologen in der IUIS war eines der entscheidenden Argumente für die Vergabe des 7. IUIS Kongresses 1989 an Berlin. Die ersten nationalen Jahrestagungen der Gesellschaft In der Bundesrepublik stand einige Monate nach der Gründung der IUIS die erste Jahrestagung der Gesellschaft für Immunologie an. Sie fand vom 16. bis 18. Oktober 1969 in Freiburg im Breisgau statt. Um sie durchführen zu können, hatte Hans Gerhard Schwick die Behringwerke zu einer wesentlichen finanziellen Beihilfe bewegt. 31 Selbst wenn die Immunologie in der Bundesrepublik an Universitäten und Forschungseinrichtungen damals noch keineswegs als etabliert gelten konnte, fanden sich ca. 315 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu der Tagung ein und nahmen an den Veranstaltungen engagiert und diskussionsaktiv teil. 32 Der Schwerpunkt des ersten Jahrestreffens lag auf dem Gebiet der Antikörperforschung. In rund 70 Vorträgen, die ohne Parallelveranstaltungen über sieben Sektionen verteilt waren, wurden die Themenkomplexe Antikörper, Immungenetik, Immunantwort, Immunpathologie, Lymphozyten, Zelluläre Immunität und Antigene behandelt. Ein breit angelegtes»kolloquium über Immunsuppression«schloss die Tagung ab. Die Abstracts der Referate wurden anschließend in einer Pilotnummer des zwei Jahre später 1971 begründeten European Journal of Immunology (EJI) veröffentlicht. 33 Die Jahrestagungen der Gesellschaft (siehe folgende Tabellen) fanden von nun an jeden Herbst statt und dies wiederholt im europäischen Ausland und in Zusammenarbeit mit der jeweiligen immunologischen Gesellschaft des Gastgeberlandes. Enge Kontakte ergaben sich dadurch vor allem mit der Schweiz und mit Österreich Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Programm, 1. Tagung der Gesellschaft für Immunologie, Vorbemerkung im Innendeckel. 32 Joachim R. Kalden: Geschichte und Entwicklung der deutschen Gesellschaft für Immunologie, in: Jahre Deutsche Gesellschaft für Immunologie, o. O. o. J., S. 9 13, hier: S Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Sonderdruck European Journal of Immunology. Erste Tagung der Gesellschaft für Immunologie in Freiburg/Brsg., 16. bis 18. Oktober Jahrestagungen 1970 in Wien, 1972 in Bern, 1976 in Basel, 1979 in Innsbruck, 1981 in Luzern, 1984 in Baden bei Wien usw.; eine Liste der Jahrestagungen und der Tagungsorte bis 1998 in: Jahre Deutsche Gesellschaft für Immunologie, S. 9 13, hier: S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 249
132 Jahrestagungen der Gesellschaft für Immunologie und der späteren Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI) * Jahr Ort Organisator(en) der betreffenden Tagung 1969 Freiburg Otto Westphal 1970 Wien Carl Steffen 1971 Marburg H. Gerhard Schwick 1972 Bern Alain L. de Weck Ankündigung der 1. Jahrestagung in Freiburg 1973 Straßbourg Raymond Minck 1974 Hannover Helmuth Deicher 1975 Mainz Martin Röllinghoff, Hermann Wagner 1976 Basel Fritz Melchers 1977 Heidelberg Klaus Rother 1978 Freiburg Otto Westphal, Herbert Fischer 1979 Innsbruck Georg Wick 1980 Garmisch- Gert Riethmüller Partenkirchen 1981 Luzern Alain L. de Weck 1982 Münster Egon Macher 1983 Berlin Tibor Diamantstein 1984 Baden/Wien Othmar Förster 1985 Göttingen Otto Götze 1986 Straßbourg Laurent Degos, Klaus Eichmann 1987 Ulm Hermann Wagner 1988 Düsseldorf Ernst Gleichmann 1989 Berlin Klaus Eichmann, Fritz Melchers, Joachim R. Kalden, 7 th International Congress of Immunology ICI 1990 Aachen Matthias Cramer together with the Society of Allergology 1991 Lübeck Holger Kirchner 1992 Mainz Erwin Rüde 1993 Leipzig Gerhardt Metzner 1994 Konstanz Ulrich Krawinkel 1995 Wien ÖGAI/DGfI, joint meeting with the Austrian Society 1996 Hamburg Bernhard Fleischer 1997 Würzburg Thomas Hünig 1998 Freiburg Hans-Hartmut Peter 1999 Hannover Reinhold E. Schmidt 2000 Düsseldorf Ernst Gleichmann, joint meeting with the Dutch Society 2001 Dresden Ernst Peter Rieber 2002 Marburg Diethard Gemsa, Klaus Heeg 2003 Berlin Stefan H. E. Kaufmann, joint meeting with the Polish Society 250 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 251
133 Jahr Ort Organisator(en) der betreffenden Tagung 2004 Maastricht Martin Krönke, joint meeting with the Dutch Society 2005 Kiel Dieter Kabelitz, joint meeting with the Scandinavian Society 2006 Paris 1 st European Congress of Immunology, ECI 2007 Heidelberg Stefan Meuer 2008 Wien Stefan Meuer, joint meeting with the Austrian Society 2009 Berlin Reinhold E. Schmidt, 2 nd European Congress of Immunology, ECI 2010 Leipzig Frank Emmrich 2011 Riccione Andreas Radbruch, joint meeting with the Italian Society 2012 Glasgow 3 rd European Congress of Immunology, ECI 2013 Mainz Hansjörg Schild, Ari Waisman 2014 Bonn Christian Kurts, Gunther Hartmann 2015 Wien 4 th European Congress of Immunology, ECI 2016 Hamburg Gisa Tiegs, Bernhard Fleischer 2017 Erlangen Hans-Martin Jäck (50 Jahre DGfI) * Internationale Beteiligung in Blau Einen weiteren Höhepunkt in der jährlichen Agenda der Gesellschaft für Immunologie bildeten die seit 1969 im Frühjahr veranstalteten»leukozytenkultur-konferenzen«, die ab 1985 als»frühjahrstagungen der Gesellschaft für Immunologie«fortgeführt wurden. 35 Diese Tagungen dienten explizit als Diskussionsforum vor allem für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wurden bis 2004 durchgeführt. Leukozytenkultur-Konferenzen der Gesellschaft für Immunologie und der späteren Deutschen Gesellschaft für Immunologie * Jahr Ort Organisator(en) der betreffenden Tagung Marburg Klaus Havemann/Hans-Dieter Flad Essen Günter Brittinger Tübingen Gert Riethmüller Innsbruck Heinz Huber Erlangen Hermut Warnatz Jahr Ort Organisator(en) der betreffenden Tagung Basel Peter Dukor Ulm Hans-Dieter Flad Berlin Tibor Diamantstein Mainz Martin Röllinghoff/Hermann Wagner Marburg Klaus Havemann Erlangen Heidelberg Joachim R. Kalden Holger Kirchner/Klaus Resch (14. Int. Leucocyte Con.) Wien Othmar Förster Hannover Helmuth Deicher/Klaus Resch Hamburg Heinz-Günter Thiele * Internationale Beteiligung in Blau Frühjahrstagungen der Gesellschaft für Immunologie und der späteren Deutschen Gesellschaft für Immunologie * Jahr Ort Organisator(en) der betreffenden Tagung Tübingen Wolfgang G. Bessler Erlangen Martin Röllinghoff Lübeck Hans-Dieter Flad Hannover Reinhold E. Schmidt Freiburg Hans-Hartmut Peter Marburg Diethard Gemsa Berlin Rüdiger von Baehr/Reinhard Burger München Hermann Wagner Erlangen Martin Röllinghoff Heidelberg G. Maria Hänsch/Michael D. Kramer Regensburg Daniela Männel Jena Lothar Jäger Binz/Rügen Christine Schütt Frankfurt Dieter Kabelitz Stuttgart Klaus Pfizenmeier/Peter Scheurich Köln Martin Krönke Innsbruck Manfred P. Dierich Leipzig Frank Emmrich * Internationale Beteiligung in Blau 35 Eine Auflistung der Leukozytenkultur-Konferenzen ( ) und der Frühjahrstagungen der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ( ) in: Jahre Deutsche Gesellschaft für Immunologie, S. 71 u DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 253
134 Gründung des europäischen Immunologie-Dachverbands Links: 10. Leukozytentagung 1979 in Marburg (Gestaltung: D. Gemsa) Rechts: Frühjahrstagung 1991 in Berlin Einige Jahrestagungen fanden außerdem im Rahmen größerer europäischer Treffen statt, zum Beispiel während des ersten Joint Meeting of European Societies for Immunology, das im September 1973 in Straßburg abgehalten wurde. Veranstalter waren die Immunologischen Gesellschaften der Bundesrepublik, Frankreich, Israel, Rumänien, der Schweiz und Jugoslawien und eine Studiengruppe für Immunologie des Europäischen Rats. 36 Es waren diese Gesellschaften, die zwei Jahre darauf einen neuen europäischen Dachverband, EFIS (European Federation of Immunological Societies), aus der Taufe heben sollten, den ebenfalls eine Reihe deutscher Immunologen wie Klaus Eichmann (EFIS-Präsident ), Stefan H. E. Kaufmann (EFIS Generalsekretär , EFIS-Präsident ), Reinhold E. Schmidt (EFIS Treasurer ) und Andreas Radbruch (Präsident-elect, wird EFIS-Präsident ) durch ihre Mitgliedschaft im Council zum erfolgreichsten kontinentalen Immunologenverbund der IUIS machten. Während dieser Zeit konnten v. a. auf Initiative von Reinhold E. Schmidt Elemente wie die EFIS lecturer, Reisestipendien im Rahmen von European Congresses of Immunology (ECIs), das Symposium für Translationale Immunologie in Paris sowie regelmäßig stattfindende Host-Symposien in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Gesellschaften, z. B. der EFIS mit EULAR (European League Against Rheumatism), eingeführt werden. 36 Archiv der DGfI, Otto Westphal: Gesellschaft für Immunologie, Gründung und Geschichte: Programm»Joint Meeting of European Societies for Immunology Strasbourg, France, September 4 7, Entwicklung der Immunologie als eigenständiges Fach in Klinik und Forschung Über die Förderung des wissenschaftlichen Austauschs im Rahmen von nationalen Fachtagungen hinaus war es ein zentrales Anliegen der Gesellschaft für Immunologie, die Eigenständigkeit des von ihr vertretenen Fachs in der deutschen Forschungslandschaft zu stärken. Es galt dabei, deutlich zu machen, dass aufgrund der hohen Komplexität des Forschungsbereichs eine bloße Mitbehandlung immunologischer Themen im Rahmen anderer naturwissenschaftlicher und medizinischer Fachgebiete weder ausreichend noch zielführend ist. Dies erwies sich als eine Herausforderung besonderer Art. Die Schwierigkeiten, die Selbständigkeit des medizinisch-naturwissenschaftlichen Querschnittfachs Immunologie anerkannt zu bekommen, zeigten sich schon 1971 bei dem Versuch Otto Westphals, bei der DFG einen Fachgutachter für Immunologie zu installieren.»ich meine«, schrieb er an den damaligen Präsidenten der DFG, Julius Speer,»es wäre dringend an der Zeit, daß man in der DFG das Fach Immunologie als solches etabliert und hierfür entsprechend auch eigene Fachgutachter wählt. Das Fach hat sich, nicht zuletzt dank der Aktivitäten der DFG, so sehr entwickelt (dies natürlich auch weltweit), daß es als eigenes Fach in vielen Ländern schon existiert. Immer mehr Lehrstühle werden z. Zt. in der Bundesrepublik geschaffen, und es ist zu erwarten, daß das Fach in Zukunft einen weiteren Auftrieb und praktisch und theoretisch immer größeres Interesse gewinnen wird. So bitte ich Sie dringend, dieses Anliegen dem zuständigen Gremium vorzulegen. Die Gesellschaft für Immunologie ist bereit, der DFG mit Rat zur Verfügung zu stehen.«37 Der Stimme der Immunologen wurde jedoch kein Gehör geschenkt. Über Jahre hinweg vertröstete man sie mit verschiedenen Argumenten. Auch zehn Jahre später musste Klaus Rother (Heidelberg), Vorsitzender der Gesellschaft für Immunologie von 1977 bis 1982, feststellen, dass bei der DFG zwar»langfristig eine Sektion Immunologie anzustreben«sei, dass hierfür jedoch Initiativen»zunächst nicht möglich«seien. 38 Und nach vier weiteren Jahren berichtete der damalige Präsident der Gesellschaft, Joachim R. Kalden (Erlangen), dass die Anfrage an den Präsidenten der DFG über eine verbesserte Repräsentation der Immunologie in den Entscheidungsgremien der DFG»nun endlich beantwortet«sei: der Präsident der DFG sei der Meinung, dass genügend immunologische Fachkompetenz aus anderen medizinischen Fachgesellschaften vorhanden sei Archiv der DGfI, Otto Westphal: Gesellschaft für Immunologie, Gründung und Geschichte: Otto Westphal, Freiburg, den 21. April 1971, an den Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herrn Julius Speer. 38 Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Münster, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Marburg, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 255
135 Klaus Rother ( ) 2. Präsident der GfI ( ) Die zögerliche Anerkennung der Immunologie als ein eigenständiges Fach hatte unter anderem institutionelle Gründe. Als Clemens Sorg (Münster) für die Gesellschaft für Immunologie 1983 eine schriftliche Umfrage bei 27 Universitäten der Bundesrepublik durchführte, musste er feststellen, dass das Fach an den naturwissenschaftlichen Fakultäten nur unzureichend vertreten war. Die Gesellschaft für Immunologie sandte daraufhin eine Denkschrift an die Dekane der entsprechenden Fakultäten, mit der dringenden Bitte, hier Abhilfe zu schaffen. 40 Nicht anders stellte sich die Lage an den medizinischen Fakultäten dar. Hierzu verfasste die Gesellschaft für Immunologie ein Situationspapier. Mit ihm warb sie bei den Medizinischen Fakultäten der Universitäten, bei den Landesärztekammern, den Kultusministerien und dem damaligen Bundesministerium für Familie und Gesundheit für das von ihr vertretene Fach. 41 Angesicht dieser Reaktionen wurde auf den Mitgliederversammlungen immer wieder kontrovers die Frage diskutiert, wie stark sich die Gesellschaft für Immunologie für klinische Immunologie einsetzen sollte oder ob diese eher die Interessen der immunologisch forschenden Naturwissenschaftler zu vertreten habe. So war es bereits im Herbst 1974 im Plenum der Mitgliederversammlung zu einer regen Diskussion über eine Denkschrift des Vorstands zur Förderung der klinischen Immunologie in der Bundesrepublik gekommen, die ein Teil der Mitglieder nicht guthieß. 42 Dies hatte schließlich die Frage aufs Tapet gebracht, welche Immunologie eine»theoretische«oder»klinische«die Gesellschaft eigentlich vertrete, ohne dass eine endgütige Antwort gefunden wurde. 43 Das Thema wurde vertagt, blieb aber virulent. Diese Diskussion kam mit der Wahl von Joachim R. Kalden zum Präsidenten der Gesellschaft 1982 zu einem Ende. Mit Joachim Kalden, dem Direktor der Erlanger Universitätsklinik für Innere Medizin, Schwerpunkt Klinische Immunologie und Rheumatologie, wurde zum ersten Mal ein praktizierender Internist zum Präsidenten gewählt. Kalden war es auch, der der Gesellschaft eine Struktur gab, in der festgesetzte Amtszeiten eines Präsidenten-Elect, eines Präsidenten und eines Past-Präsidenten jeweils für zwei Jahre eingeführt wurden. Trotz immer wieder aufkommender, wenn auch nur kurzer Diskussionen über den Schwerpunkt der Gesellschaft im naturwissenschaftlichen oder klinischen Bereich wurden in den nachfolgenden Jahren bis heute sowohl immunologisch tätige Kliniker als auch Naturwissenschaftler zu Präsidenten der Gesellschaft gewählt. Wiederholt wurde die Gesellschaft für Immunologie bei den universitären und amtlichen Stellen für ihr Fach vorstellig. Teil des Bemühens um die klinische Immunologie war der Versuch, das Fachgebiet bei Lehrstoff- und Prüfungsfragen in der medizinischen Ausbildung zu positionieren. Dafür wurde in der Gesellschaft eigens eine Kommission gebildet, der Joachim R. Kalden vorstand. Allerdings scheiterten die anfänglichen Bemühungen der Gesellschaft, ihrem Fach seinem Rang gemäß in der Approbationsordnung der Ärzte mehr Gewicht zu verleihen, am Widerstand anderer medizinischer Fachgesellschaften. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Immunologie 1987 aus einer Novelle zur Approbationsordnung wieder gestrichen wurde. 44 Auch ein Protestschreiben der Gesellschaft an die damalige Bundesministerin für Gesundheit, Rita Süßmuth, konnte daran nichts ändern. Die Immunologie sollte erst Jahre später als Prüfungsfach in den Kanon des medizinischen Staatsexamens aufgenommen werden. In den 1990er-Jahren gelang es Reinhold E. Schmidt (Hannover) schließlich, sie als eigenen Fachbereich in der Labormedizin und bei der Akkreditierung von diagnostischen Laboren durchzusetzen. Raschere Erfolge verzeichnete die Gesellschaft für Immunologie nicht zuletzt aufgrund der AIDS-Epidemie der 1980er-Jahre bei der DFG und beim damaligen Bundesministerium für Forschung und Technologie 45 hinsichtlich der Einrichtung eines Schwerpunkts»Autoimmunität«. 46 Die Zulassungskommission für den humanmedizi- 40 Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S Ebd., S Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie in der Medizinischen Hochschule Hannover, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung in Heidelberg, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Ulm, den , Protokoll, S Das Bundesministerium für Forschung und Technologie wurde 1994 aufgelöst. 46 Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Straßburg, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 257
136 nischen Bereich der Arzneimittelkommission am damaligen Bundesgesundheitsamt 47 nahm 1986 erstmals»immunologie«als eigenständigen Bereich auf. 48 Als Vertreter der Gesellschaft wurden hierfür Holger Kirchner (Lübeck) und Joachim R. Kalden (Erlangen) benannt. Etablierung eigenständiger immunologischer Einrichtungen (eine Auswahl) Mit der Zeit setzte sich schließlich auch die Bezeichnung»Immunologie«bei der Benennung von Lehrstühlen und Instituten durch. 49 Den Anfang hatte bereits 1965 die Medizinische Hochschule Hannover gemacht, an der von Anbeginn die Immunologie als eigenständige Fachrichtung geführt wurde. Helmut Deicher stand hier der Abteilung für Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin vor. Die ersten ausschließlich der Immunologie gewidmeten Institute und Abteilungen wurden 1973 in Heidelberg (Klaus Rother), 1976 in Mainz (Erwin Rüde), 1977 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München (Gert Riethmüller) und 1980 in Kiel (Wolfgang Müller-Ruchholz) gegründet, wobei letzteres aus dem Institut für Hygiene und Mikrobiologie herausgelöst wurde wurde in Heidelberg am Deutschen Krebsforschungszentrum das Institut für Immunologie und Genetik gegründet (jetzt Forschungsschwerpunkt Tumorimmunologie), mit den Abteilungen Immungenetik (Klaus Eichmann), Zelluläre Immunologie (Volker Schirrmacher), Immunchemie (Wulf Dröge) und der 1979 hinzugekommenen Abteilung Molekulare Immunologie (Günter J. Hämmerling) und 1989 folgten die Institute für Immunologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen (Erich Letterer) und Lübeck (Holger Kirchner), wo das Institut um den Themenbereich»Transfusionsmedizin«erweitert worden war. Eine neue Welle von rein immunologischen Institutsgründungen verschiedentlich mit weiteren Spezialisierungen wie Transfusionsmedizin (1994 in Leipzig, Frank Emmrich) und Transplantationsmedizin (1996 in Greifswald, Christine Schütt) erfolgte nach der deutschen Wiedervereinigung. So wurde 1993 an der Medizinischen Fakultät Carl 47 Das Bundesgesundheitsamt (BGA) wurde am aufgelöst. Seine Aufgaben wurden von drei Nachfolgeorganisationen übernommen: dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesministerium für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin. 48 Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Straßburg, den , Protokoll, S Dazu z. B. N.N.: Die Immunologische Landschaft im Jahr 2005, in: Deutsche Gesellschaft für Immunologie (Hrsg.). Immunologie in Deutschland 2005, S Gustav Carus der Technischen Universität Dresden ein Institut für Immunologie (Ernst Peter Rieber) eingerichtet. Unterhalb der Institutsebene kam es darüber hinaus in den Naturwissenschaften und in der Medizin zur Gründung immunologischer Lehrstühle und Abteilungen, die maßgeblich dazu beitrugen, dass das immunologische Netzwerk in Deutschland immer dichter und komplexer wurde. So wurde der Lehrstuhl für Immunologie an der Universität Konstanz gleich bei der Gründung der Universität im Jahr 1967 im Fachbereich Biologie eingerichtet. Der Gründungsausschuss der Universität hielt es für wichtig, dass Disziplinen wie die Immunologie, die traditionell an medizinischen Fakultäten angesiedelt waren, aber biologische Methoden anwenden, auch in einem großen biologischen Fachbereich prominent vertreten sind. 50 Bereits im Gründungsjahr 1967 wurde Eberhardt Weiler als Lehrstuhlinhaber berufen. Seine Nachfolger waren der 1999 im Alter von 50 Jahren verstorbene Ulrich Krawinkel ( ) und seit 2002 ist es Marcus Groettrup. Es folgten die 1975 eingerichtete Abteilung Immunologie am Institut für Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums Freiburg (Leitung: Arnold Vogt, und seit 1995 Hanspeter Pircher) 51, der Lehrstuhl für Immunologie an der Biologischen Fakultät in Freiburg (1995, Michael Reth) und unabhängige Abteilungen für Immunbiologie bzw. Immunologie in den Naturwissenschaften in Bonn (1990, Norbert Koch), Leipzig (1995, Sunna Hauschildt) und an der Medizin in Erlangen (1997, Hans-Martin Jäck). Eine Nennung aller immunologischen Einrichtungen an deutschen Universitäten bedürfte einer eigenen Publikation und würde den Rahmen dieser Festschrift sprengen. Preise und Ehrungen Forschungspreis für renommierte Immunologen Neben diesen fachpolitischen Aktivitäten stärkte die Gesellschaft für Immunologie ihre Position durch eine Reihe von Maßnahmen, die sowohl eine hohe Außen- wie Innenwirkung garantierten: Preise und Ehrenmitgliedschaften verliehen der Gesellschaft Reputation und stärkten ihren Zusammenhalt, indem sie die Mitglieder motivierten und inspirierten. Früh schon hatte Hans Gerhard Schwick die Bedeutung erkannt, die das Ausloben von Preisen für wissenschaftliche Fachgesellschaften hatte. Aufgrund seiner Bemühungen stellte der Vorstand der Behringwerke ein Preisgeld in Höhe von Persönliche Mitteilung, Markus Groettrup, Juni Persönliche Mitteilung, Hans-Hartmut Peter, Juni DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 259
137 DM bereit, mit dem die Gesellschaft für Immunologie in zweijährigem Rhythmus Forscher für hervorragende Leistungen auszeichnen konnte. 52 Der Preis, der zum ersten Mal 1973 vergeben wurde, wurde nach dem US-Amerikaner Oswald Avery ( ) und dem gebürtigen Österreicher Karl Landsteiner ( ) Avery-Landsteiner- Preis genannt, abermals, um nicht das Deutsche in den Vordergrund zu stellen, sondern Internationalität zu demonstrieren. Oswald Avery gelang es, DNA als ein Typ-transformierendes Prinzip von Pneumokokken zu identifizieren; und zusammen mit Michael J. Heidelberger konnte er in den 1920er-Jahren zudem nachweisen, dass Polysaccharide Antikörperantworten auslösen. Er gilt somit als einer der Mitbegründer der Immunchemie und der modernen Molekulargenetik. Karl Landsteiner entdeckte 1900 das AB0-Systems der menschlichen Blutgruppen, zeigte den kausalen Zusammenhang zwischen Polioviren und der Kinderlähmung und identifizierte 1940 zusammen mit Alexander Solomon Wiener den Rhesus-Faktor. Für seine Leistungen erhielt Karl Landsteiner 1930 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Die Behringwerke AG finanzierte den Avery-Landsteiner-Preis bis zu ihrer Auflösung im Jahre Die gute Tradition wurde ab 1998 von der Centeon Pharma GmbH als einer Nachfolgegesellschaft der Behringwerke AG weitergeführt, ab 2006 von der ZLB Behring GmbH und von 2008 bis 2014 von der CSL Behring GmbH unterstützt. Der Preis wurde alle zwei Jahre an Immunologen für eine wegweisende Entdeckung verliehen, einige davon erhielten später auch den Nobelpreis. Im Rahmen der Jahrestagung 2014 in Bonn wurde der letzte Avery-Landsteiner-Preis an Andreas Radbruch (Berlin) verliehen. Die Tradition eines großen DGfI-Wissenschaftspreises wurde aber in Kooperation mit der Celgene GmbH aus München fortgeführt. So konnte während der Jahrestagung 2016 in Hamburg der erste»deutsche Immunologie-Preis«durch den damaligen DGfI-Präsidenten Jürgen Wienands (Göttingen) und Simone Grätz (München) an Hans-Reimer Rodewald aus Heidelberg überreicht werden. Zum neuen Namen des Preises gab es viele Ideen, der Vorschlag von Jürgen Wienands»Deutscher Immunologie-Preis«setzte sich aber letztendlich durch. Erster Forschungspreis für Nachwuchswissenschaftler Während der Avery-Landsteiner Preis bereits akademisch arrivierten Forschern vorbehalten war, rief die Gesellschaft für Immunologie 1976 einen Preis ins Leben, der sich gezielt an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtete den»preis der Gesellschaft für Immunologie für die beste Dissertation«. Er wurde 1976 und 1977 verliehen. 1978, anlässlich des 65. Geburtstags von Otto Westphal, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie in Freiburg und langjähriger Präsident der Gesellschaft, wurde er in»otto-westphal-promotionspreis«umbenannt. Dieser seit 2001 von der Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen gesponserte Preis wurde seit 1978 zunächst alle zwei Jahre und seit 1997 jährlich vergeben. In den folgenden Jahren gelang es, mit dem Georges-Köhler-Preis (seit 1998), dem Hans-Hench-Promotionspreis für Klinische Immunologie (seit 2001), dem Fritz-und-Ursula-Melchers-Postdoktorandenpreis (seit 2004) und dem Herbert-Fischer-Preis für Neuroimmunologie (seit 2013) weitere Preise für Nachwuchswissenschaftler und Junior-Arbeitsgruppenleiter zu etablieren (siehe S. 333). Ehrenmedaille und Ehrenmitglieder Der Inspiration durch Vorbilder dienen ebenfalls die Ehrenmitgliedschaften und die Ehrenmedaille, die die Gesellschaft für Immunologie seit 1973 in unregelmäßigen Abständen vergibt. Sie sind Persönlichkeiten vorbehalten, die sich im Fach Immunologie außerhalb und innerhalb der Gesellschaft verdient gemacht haben. Die Idee zu forschungsorientierten Arbeitskreisen innerhalb der Gesellschaft Um die inhaltliche Arbeit in der Gesellschaft zu intensivieren, wurde ab 1986 in den Vorstands- und Beiratssitzungen unter den Präsidentschaften von Joachim R. Kalden (Erlangen), Hermann Wagner (München) und Fritz Melchers (Basel) erstmals über die Einrichtung von»sektionen«zu bestimmten Themenbereichen diskutiert Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief Hans Gerhard Schwick, Marburg, den 20. März 1968 an Otto Westphal. 53 Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Marburg, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 261
138 Die Idee wurde dann aber zugunsten von»studiengruppen«fallen gelassen, die sich bestimmten Forschungskomplexen innerhalb der Immunologie widmen sollten. Nach dem Vorbild eines bereits seit etwa 1970 außerhalb der Gesellschaft existierenden»arbeitskreises Klinische Immunologie«54 sollten die Gruppen Kleinkonferenzen zu Schwerpunktthemen veranstalten. 55 Zunächst war an Studiengruppen zu den Themen»Immunpharmakologie«und»Infektionsimmunologie«gedacht. 56 Die beiden Pilotgruppen sollten, wenn sie zustande kämen, den Mitgliedern der Gesellschaft als Beispiel für weitere Gründungen präsentiert werden. Vorstand und Beirat der Gesellschaft versprachen sich von der Einrichtung dieser wissenschaftlichen Diskussionszirkel nicht zuletzt auch eine intensivere Kooperation mit Immunologen außerhalb der DGfI und einen Austausch zwischen Institutionen, die an gleichen wissenschaftlichen Projekten arbeiten. Die Idee»Arbeitskreise«sollte aber erst Anfang der 1990er-Jahre umgesetzt werden (siehe Abschnitt 3). Zeitschriften und Gesellschaftsnachrichten Um der wissenschaftlichen Außenwirkung der Gesellschaft mehr Gewicht zu verleihen, diskutierten die Leitungsgremien auch wiederholt die Frage, ob ein offizielles Journal der Gesellschaft etabliert werden sollte. 57 Bereits 1968 hatten Hans Gerhard Schwick und Otto Westphal mit verschiedenen Verlagen Kontakt aufgenommen, waren jedoch mit keinem handelseinig geworden. 58 Als die Frage 1988 in Vorstand und Beirat wieder aufgebracht wurde, fiel die Entscheidung, die Idee endgültig zu verwerfen. 59 Selbst wenn die in der Welt älteste immunologische Zeitschrift mit»immunität«im Titel, die»zeitschrift für Immunitaetsforschung, Experimentelle und Klinische Immunologie«, später»zeitschrift für Immunitätsforschung«und schließlich»immunobiology«von Diethard Gemsa (Marburg), einem Mitglied der ersten Stunde der Gesellschaft für Immunologie, betreut wurde, war sie doch nie offizielles Organ der bundesdeutschen Fachgesellschaft. Über Jahre hinweg erschienen hier aber regelmäßig die Abstracts der Jahrestagungen 54 Mitteilung von Hans-Hartmut Peter an die Verfasser, Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Marburg, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Hannover, den , Protokoll, S U.a. Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Marburg, den , Protokoll, S Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Brief von Otto Westphal, Freiburg im Breisgau, den über Kontakte zum Karger Verlag, Basel, zum Fischer Verlag, Frankfurt und zum De Gruyter Verlag, München. 59 Archiv der DGfI, Ordner»Gründung«: Aktennotiz Hans Gerhard Schwick, Marburg, den : Kontakt zum Schlattauer Verlag. der bundesdeutschen Gesellschaft. Für die Mitglieder wurde stattdessen die Informationsbroschüre»Immunologische Nachrichten«redaktionell weiterentwickelt. In den Anfangsjahren hatte die Publikation vor allem der Information über Stellenausschreibungen und bevorstehende Tagungen gedient. Ab den späten 1980er-Jahren kamen dann vermehrt Berichte über Aktivitäten der Gesellschaft, Protokolle von Mitgliederversammlungen und diverse Fachinformationen hinzu. Die Professionalisierung der Mitgliederbetreuung wurden im Laufe der Jahre durch die Gründung einer Geschäftsstelle in Berlin im Jahre 2007 und unter der Ägide der Generalsekretäre Werner Solbach (Lübeck, DGfI-Generalsekretär ) und Carsten Watzl (Dortmund, Generalsekretär seit 2013) weiter ausgebaut (siehe unten, Abschnitt 4). Der VII. Internationale Immunologie-Kongress in Berlin (1989) Ab 1984 und bis 1989 rückte ein Thema in den Vorstands- und Beiratssitzungen sowie den Mitgliederversammlungen der Gesellschaft für Immunologie immer stärker in den Vordergrund: Der VII. Internationale Immunologie-Kongress, der im Sommer 1989 in Berlin stattfinden sollte. Für die Gesellschaft für Immunologie war es eine große Ehre und ein Beweis ihrer internationalen Wertschätzung, als ihr die IUIS 1977 den Auftrag erteilte, 60 dieses weltweit wichtigste Treffen von Immunologen auszurichten. Für die gewaltige Aufgabe, den Großkongress mit mehreren tausend Teilnehmern zu organisieren, engagierte sich eine Vielzahl von Mitgliedern der Gesellschaft. Sie wurden im Frühjahr 1984 zunächst vier Ressorts zugeordnet. 61 Klaus Eichmann (Freiburg) zeichnete für die Allgemeine Organisation verantwortlich, Fritz Melchers (Basel) oblag die wissenschaftliche Programmgestaltung, Hans Gerhard Schwick (Marburg) und Joachim R. Kalden (Erlangen) kümmerten sich um die Finanzierung, und Gert Riethmüller (München) war für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Ressortleiter standen je einem Komitee vor, dem wiederum mehrere Unterkomitees zugeordnet waren. Allein 14 Untergruppen arbeiteten mit Fritz Melchers an der Programmgestaltung. 62 Und auch sonst war an alles gedacht: an ein»fund Raising- Comittee«(Klaus Eichmann, Holger Kirchner, Joachim R. Kalden, Gert Riethmüller) 60 Zum Zeitpunkt des Auftrags vgl. Klaus Eichmann, Opening Speech, in: Fritz Melchers u.a. (Hrsg.): Progress in Immunology, Vol. VII: Proceedings of the 7th international Congress of Immunology Berlin 1989, Berlin/Heidelberg/New York 1989, S. XXII. (künftig zit.: Melchers (Hrsg.) Progress in Immunology) 61 Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Marburg, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Straßburg, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 263
139 genauso wie an ein»bursary and Hospitality Committee«(Tibor Diamantstein, Berlin) und ein»program Book and Abstract Book Committee«(Diethard Gemsa, Marburg). 63 Ein besonders sensibles Thema stellte dabei schon allein der Veranstaltungsort»Berlin (West)«dar. Im geteilten Deutschland war 1971 im»vier-mächte-abkommen über Berlin«(kurz: Berlinabkommen) festgelegt worden, dass die drei Westsektoren von Berlin kein»konstitutiver Teil«der Bundesrepublik waren, auch wenn sie faktisch seit 1949 von den Westalliierten und der deutschen Bundesregierung wie ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland angesehen wurden. Die Deutsche Demokratische Republik und alle Staaten des Warschauer Pakts erkannten diese Praxis jedoch nicht an. Für die Kongressveranstalter bedeutete dies, dass auf dem Kongress jegliches Anzeichen einer Präsenz von offiziellen Vertretern der Bundesrepublik Deutschland vermieden werden musste. 64 An die bei vergleichbaren Großveranstaltungen üblichen Schirmherrschaften von Seiten des Bundespräsidenten oder eines Ministers war angesichts dessen nicht zu denken. Wie kompliziert die Lage war, zeigte sich dem Organisationskomitee unter anderem in einem Brief, den Fritz Melchers (Basel) von Herwart Ambrosius aus Leipzig erhalten hatte. Er enthielt detaillierte Angaben über zu verwendende Formulierungen für die Einladungsschreiben an die DDR-Wissenschaftler. 65 In ähnlicher Weise war dem damaligen Präsidenten Joachim R. Kalden auf einer Sitzung des IUIS von Seiten der Vertreter der DDR klar und deutlich mitgeteilt worden, dass eine Vertretung der Bonner Regierung in der Eröffnungsfeier nicht akzeptiert werden könnte. In diesem Fall würde man dafür Sorge tragen, dass nur sehr wenige Teilnehmer aus dem damaligen Ostblockstaaten den Kongress in Berlin besuchen würden. 66 Am 30. Juli 1989 konnte der VII. Internationale Kongress für Immunologie schließlich unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Walter Momper damals vertreten durch Bürgermeisterin Ingrid Stahmer eröffnet werden. Über die Vorbereitungsjahre hinweg hatte sich der Kongress zu einer Mammutveranstaltung entwickelt, in der thematisch die Komplexe»Grundlagenforschung«,»Klinische Immunologie«und»Industrielle Immunologie«Berücksichtigung fanden. 67 Die Beiträge der Teilnehmer verteilten sich auf 27 Symposien und 130 Workshops, bei denen Dank einer vorausblickenden Kongressplanung noch aktuellste fachliche Entwicklungen berücksichtigt werden konnten. Wie der Programmverantwortliche Fritz Melchers in Umschlag des Programm-Bandes und ein von Jean Tinguely gestaltetes Plakat des VII. Internationalen Immunologie-Kongresses 1989 in Berlin seiner einführenden Rede erläuterte, war in jedem Symposium von vornherein mindestens eine halbe Stunde den latest news vorbehalten worden, über deren Inhalt die jeweiligen Sektionsvorsitzenden noch in letzter Minute entscheiden konnten. 68 Eine besondere logistische Herausforderung stellten auf dem Kongress die über Poster dar, die während der Tagungswoche präsentiert und mit den Poster-Ausstellern diskutiert werden sollten. 69 An jedem Morgen und Mittag mussten 400 bis 600 Poster auf- und abgehängt werden. Die Vielfalt und Größe des Weltkongresses stand den Teilnehmern aber vor allem mit dem Abstract-Band vor Augen, der Beiträge von über Autoren enthielt. 70 Allein die Auswahl der eingereichten Abstracts war eine 63 Ebd., S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 1 f. 65 Ebd., S Mitteilung Joachim R. Kalden. 67 Dazu: Fritz Melchers: Opening Speech, in: Melchers (Hrsg.) Progress in Immunology. 68 Ebd. 69 Ebd. 70 7th International Congress of Immunology, Abstracts, Berlin (West), July 30 - August 5, 1989, organized by Gesellschaft für Immunologie, Stuttgart/New York DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 265
140 Die Hauptorganisatoren des VII. Internationalen Immunologie-Kongresses 1989 in Berlin: Melchers (links) Joachim R. Kalden (rechts) beim Empfang (linkes Bild) und Klaus Eichmann bei der Eröffnung (rechtes Bild), beide Male mit Berlins Bürgermeisterin I. Stahmer Herausforderung, da diese im noch weitgehend»vorelektronischen Zeitalter«per pigeon holes sortiert werden mussten. 71 Dass der VII. Weltkongress der Immunologen zu einem vollen Erfolg wurde, lag nicht nur an den hochkarätigen Vorträgen und der durchdachten Organisation, sondern auch am Rahmenprogramm. Zu dessen Erfolg trug nicht zuletzt die Geigerin Anne Sophie Mutter bei, die in einer exklusiven Veranstaltung für die Kongressteilnehmer das Violinkonzert von Antonín Dvořák spielte. Happy Hours, die am Ende eines jeden Kongresstages mit Jazz-Kapellen, Snacks und Bier stattfanden, dienten zu weiteren wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Gesprächen und wurden von den Teilnehmern mit großer Begeisterung aufgenommen. Am Ende des Kongresses konnten die Veranstalter eine positive Bilanz ziehen. Anstoß erregte schließlich nur der Vortrag des Ehrenvorsitzenden Otto Westphal. In seiner Darstellung der frühen Entwicklung der Immunologie in Deutschland hatte er die Verfolgung jüdischer Forscher durch die Nationalsozialisten und den dadurch ausgelösten»brain Drain«mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen hatte er den Rückgang immunologischer Forschung in Deutschland auf das geringere Interesse zurückgeführt, dass der 71 Mitteilung von Fritz Melchers. Immunologie in den 1930er und 1940er -ahren entgegengebracht wurde und war zur jüngsten Vergangenheit der Fachgeschichte übergegangen. 72 Die für viele Forscher aus dem In-, aber vor allem auch aus dem Ausland verletzende Darstellung wurde unter anderem von dem in den USA lehrenden Charles Dinarello dem damaligen Vorstand gegenüber scharf kritisiert. Noch im Rahmen des Kongresses und später wurden von Vertretern des Vorstands der Gesellschaft für Immunologie mit Wissenschaftlern besonders aus den USA, so auch mit Dinarello, klärende Gespräche geführt. 73 Westphal erwähnte auch nicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Immunologie der Bundesrepublik im Bereich der Naturwissenschaften wie auch der Klinik durch Länder wie die USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Frankreich und viele andere substantiell unterstützt wurde, indem sie jungen deutschen Klinikern und Naturwissenschaftlern die Möglichkeiten gaben, sich an den führenden Institutionen in den unterschiedlichen Ländern in Immunologie auszubilden. Diese»Entwicklungshilfe«war ohne jeden Zweifel später der Motor für die hervorragende Entfaltung dieses Fachgebiets. Auf diese großartige Hilfe wies Joachim R. Kalden (Erlangen) in seinem Grußwort der Eröffnungsveranstaltung hin. 74 Zu Beginn des Kongresses hatte Klaus Eichmann noch von der geradezu idealen Lage der Stadt Berlin zwischen Ost und West gesprochen, die den Kontakt zwischen den beiden»welten«ermögliche; von den Anstrengungen, die das Organisationskomitee des Kongresses auf sich genommen hatte, um es den Immunologen aus der DDR möglichst leicht zu machen, an dem Kongress teilzunehmen; von den Zeitumständen, die den Wunsch nährten, dass es bald mehr Freiheit zum Austausch zwischen West und Ost geben werde politisch, ökonomisch und vielleicht auch in der Wissenschaft. 75 Keiner der Kongressteilnehmer konnte damals ahnen, dass dieser Wunsch schon drei Monate später erfüllt werden sollte. 72 Otto Westphal: Immunology and the»belle Epoche«in Berlin. Adding Some Personal Memories, in: Melchers (Hrsg.) Progress in Immunology, S. XXXV-LIX, hier: S. LVII. 73 Zeitzeugengespräch u.a. mit Klaus Eichmann, 10. Februar 2017, Erlangen. 74 Joachim R. Kalden: Opening Speech, in: Melchers (Hrsg.) Progress in Immunology, S. XXVIII. 75 Klaus Eichmann, Opening Speech, in: Melchers (Hrsg.) Progress in Immunology, S. XXII f. 266 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 267
141 Der Immunologen-Verband in der Deutschen Demokratischen Republik bis 1989 Diether Gotthold Roland Findeisen (links) und Lothar Jäger (rechts), 1958 Die Geschichte des Immunologen-Verbandes der Deutschen Demokratischen Republik weist charakteristische Unterschiede zur Historie der bundesdeutschen Gesellschaft für Immunologie auf. 76 Das zeigt bereits seine Entstehungsgeschichte: Während die Gesellschaft für Immunologie 1967 primär als Verband immunologisch forschender Naturwissenschaftler gegründet wurde und sich dadurch von der bereits existierenden Deutschen Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung (DGAI) abhob, entwickelte sich die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR aus der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung, dem ostdeutschen Pendant der Deutschen Gesellschaft für Allergie-Forschung und späteren Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinischen Immunologie (DGAKI). Die Geschichte dieses Medizinerverbands reicht bis in die frühen 1950er-Jahre zurück und damit in die ersten Jahre der 1949 gegründeten DDR. Am Anfang standen zwei Kongresse: Im Frühjahr 1950 veranstalteten französische Mediziner erstmals einen Europäischen Allergie-Kongress. 77 Im Herbst des darauffolgenden Jahres fand der erste internationale Allergie-Kongress in Zürich statt. 78 Die Veranstalter hatten in beiden Fällen die gleiche Absicht: Mit Allergien befasste Ärzte sollten mit einander in Kontakt gebracht werden und ihr Fachwissen zusammentragen. Die Initiativen waren von Erfolg gekrönt: Den Teilnehmern der Kongresse hatten Sinn und Bedeutung eines gegenseitigen fachlichen Austauschs auf nationaler wie internationaler Ebene nur allzu deutlich vor Augen gestanden. 79 Im Zuge der Kongresse kam 76 Karl-Christian Bergmann, I. Bergmann: Geschichte der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR, in: Allergologie. Immunbiologische Grundlagen Diagnostik und Therapie für Praxis und Klinik 33 (2010), S (künftig zit.: Bergmann: Geschichte). 77 Schadewaldt: Gesschichte, S. 40. Der Kongress fand vom 31. Mai bis 1. Juni 1950 statt. 78 Die Kongressakten: Arthur Samuel Grumbach (Hrsg.): Premier Congrès international d allergie. First international congress for allergy. Erster internationaler Allergiekongress, Zürich Septembre 1951, Comptes rendus, Proceedings. Kongressbericht. Publiés pour le Comité d organization par A.S. Grumbach avec l assistance de Anne Rivokine, Basel, New York D.G.R. Findeisen: Entstehung, Ziele und Aufgaben der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung in der DDR, in Allergie und Asthma 1 (1955), S (künftig zit.: Findeisen: Entstehung) es daher zur Gründung von zahlreichen nationalen Allergologie-Verbänden. So hatten auch einige der einschlägigen westdeutschen Mediziner am 17. Juni 1951 in Frankfurt am Main die Deutsche Gesellschaft für Allergie-Forschung die spätere DGAI und heutige DGAKI ins Leben gerufen. 80 Etwa drei Jahre später, am 24. August 1954, zogen die DDR-Mediziner mit einem eigenen Verband nach und riefen die Arbeitsgemeinschaft für Allergie und Asthmaforschung ins Leben. 81 Die Anregung zu ihrer Gründung war von dem Asthmaforscher Diether G. R. Findeisen ausgegangen. 82 Auf einer ersten Tagung der Arbeitsgruppe, zu der sich über 320 Ärzte und Wissenschaftler aus der DDR, aus Westberlin, der Bundesrepublik und dem Ausland im Plenarsaal der Akademie der Wissenschaften zu Berlin einfanden, wurde am 4. Dezember 1954 die Arbeitsgruppe in die neu gegründete»gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung«(GAA) überführt. 83 Dem damals zum Vorstand gewählten D.G.R. Findeisen und seinen Mitstreitern in der Gesellschaft war es ein Anliegen, dass mit der Förderung der Allergieforschung nicht einer weiteren Zersplitterung der Medizin Vorschub geleistet werden sollte. Vielmehr gehe mit ihr eine»zusammenschau unter dem Blickwinkel eines nahezu alle Fachdisziplinen umfassenden pathologischen Prinzips«einher Schadewaldt: Geschichte, S. 49 f. 81 Bergmann: Geschichte, S Ebd., S Findeisen: Entstehung, S Ebd., S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 269
142 Links : Herwart Ambrosius (* 1925) Rechts: Heinz-Egon Kleine-Natrop ( ) diagnostischen und therapeutischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Allergologie Rechnung getragen. Außerdem wollte die Gesellschaft mit dem Namen unterstreichen, dass sie die immunologische Fachkompetenz in ihrer Organisation zentrieren und deren Abdriften in viele andere Fachgesellschaften entgegenwirken wollte. 90 Wie diese Mediziner-Verbände war sie wie zuvor eine selbständige Organisation unter dem Dach der seit 1962 bestehenden Gesellschaft für Klinische Medizin der DDR. 91 Drei Jahre nach der Umbenennung wurde in der Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung eigens eine Sektion»Immunologie«gegründet, deren Leitung der in Leipzig tätige Zoologe und Immunologe Herwart Ambrosius übernahm. 92 Stärkere Identifizierung mit der Immunologie Von Anfang an bemühte sich die GAA unter ihrem Vorstand D.G.R Findeisen um eine enge Zusammenarbeit mit anderen nationalen Vereinigungen für Allergologie, wobei vor allem der Austausch mit den Kollegen aus der Bundesrepublik intensiv gepflegt wurde. 85 Die Tagungsberichte der jährlichen Tagungen wurden in der 1955 gegründeten Zeitschrift»Allergie und Asthma«veröffentlicht, dem offiziellen Organ der Gesellschaft wurde die GAA in»gesellschaft für Allergie und Asthmaforschung in der DDR«umbenannt. 87 Die stärkere Betonung ihrer staatlichen Zugehörigkeit tat den guten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Allergie-Gesellschaften keinen Abbruch. Selbst nach dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 kam es zu keiner Trennung der»schwestergesellschaften«. 88 Mediziner aus der Bundesrepublik nahmen weiterhin an den Tagungen der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung in der DDR teil. Nach Umbenennung des westdeutschen Verbandes Mitte der 1960er-Jahre in»deutsche Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung«trat auch die ostdeutsche Vereinigung ab 1965 als»gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung der DDR«auf. 89 Mit dem Ersetzen von Asthma durch Immunitätsforschung wurde den 1971 wurde die Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung zur»gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR«umbenannt. Die noch stärkere Hinwendung zur Immunologie kam fast einer Neugründung gleich und schlug sich in einem eigens ausgearbeiteten Statut nieder. In ihm waren Aufgaben und Zielsetzung der Gesellschaft festgeschrieben. 93»Die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der Deutschen Demokratischen Republik«, hieß es da,»stellt sich zur Aufgabe, die wissenschaftliche Tätigkeit, den Erfahrungsaustausch, die Weiterbildung und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der klinischen und experimentellen Immunologie zu fördern und zu koordinieren sowie eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen«. Der Vorsitzende und der Sekretär der mit neuen Konturen versehenen Gesellschaft, Heinz-Egon Kleine-Natrop (Dresden) und Lothar Jäger (Jena), begründeten den Schritt der Neuausrichtung ausführlich in einem Rundbrief an die Mitglieder:»Hinter diesem Vorschlag, schrieben sie, steht das Bestreben, das Profil unserer Gesellschaft der Entwicklung in der immunologischen Forschung anzupassen. Unter großen Mühen ist es uns gelungen, die vor Jahren drohende Zersplitterung der bescheidenen experimentellimmunologischen Kapazitäten auf eine Vielzahl von Gesellschaften zu verhindern. Die 85 Vgl. z. B. G. Stüttgen: 2. Tagung der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung in der DDR am 10. und 11. Juni in Dresden, in: Allergie und Asthma 1 (1955), S ; G. Stüttgen: 3. Tagung der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung vom 14. bis 16. Juni 1956 in Dresden, in: Allergie und Asthma 2 (1956), S ; H. Michel: 4. Tagung der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung in der DDR vom 19. bis 21. Juni 1959 in Weimar, in: Allergie und Asthma 6 (1960), S Bergmann: Geschichte, S. 526 und die vorige Anmerkung. 87 Bergmann: Geschichte, S Der Begriff»Schwestergesellschaften«bei Findeisen: Entstehung, S R. Staupe: Kongress zum zehnjährigen Bestehen der Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung der DDR vom 18. bis 20. Juni 1965 in Dresden, in: Allergie und Asthma 11 (1965), S , hier: S Bergmann: Geschichte, S. 526 f. 91 Zur Deutschen Gesellschaft für klinische Medizin: Konstantin Pritzel: Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1978, S. 109 (künftig zit.: Pritzel: Gesundheitswesen) und: Lothar Rohland, Horst Spaar: Die medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften der DDR. Geschichte, Funktion und Aufgaben. Berlin (Ost) Mitteilung Lothar Jäger:»Entwicklung der Gesellschaft«. 93 Statut der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR. 270 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 271
143 Umbenennung drückt das Bemühen aus, eine ähnliche Konzentration auch auf dem Gebiet der klinischen Immunologie herbeizuführen, als deren Teilgebiet die Allergologie in der bisherigen Form anzusehen ist. Wir gehen dabei nicht von einem Prioritätsanspruch aus, sondern suchen die enge Zusammenarbeit mit allen sich an immunologischen Problemen interessierenden Gesellschaften und Kollegen.«94 Ganz in diesem Sinne hatte bereits eine Gemeinschaftstagung mit der Gesellschaft für Dermatologie stattgefunden 95 und weitere Treffen mit anderen medizinischen Gesellschaften waren geplant. 96 Hauptanliegen der neuen Immunologen-Gesellschaft war es nach den Worten von Kleine-Natrop und Jäger,»durch Standardisierungsempfehlungen wie auch Informationen über neue Entwicklungen einen Beitrag zur Qualifizierung auch der klinisch-immunologischen Diagnostik zu bringen.«97 In einem ersten Schritt sahen es beide als notwendig an, in Sachen Immunologie Bilanz zu ziehen. Deshalb riefen sie mit ihrem Rundschreiben bei den Mitgliedern der Gesellschaft sogleich Informationen darüber ab, wo abgesehen von den bekannten Forschungsprojekten»Immunologie und Infektionsschutz«,»Onkologie«,»Chronischrheumatische Erkrankungen«sowie»Transplantation«klinisch-immunologische Forschungen durchgeführt wurden oder in Zukunft geplant waren. 98 Im Bemühen, die Immunologie ihrem Rang gemäß im Forschungs- und Gesundheitssystem der DDR zu positionieren, galt es zu berücksichtigen, dass für diesen Zweig wie für alle medizinischen und nichtmedizinischen Wissenschaftsbereiche die Forderung der Kader- und Staatspartei SED nach größtmöglicher Praxisnähe bestand. 99 Entsprechend hatte die Gesellschaft in ihrem Statut mehrfach darauf hingewiesen, dass sie bemüht sei, eine»enge Beziehung zwischen Wissenschaft und Praxis«herzustellen. 100 Facharzt für Immunologie und Fach-Immunologen Der Einsatz der Gesellschaft für das Fach Immunologie im Ensemble der medizinischen Fächer konzentrierte sich zunächst darauf, einen»facharzt für Immunologie«und einen»fachwissenschaftler Immunologie«oder»Fach-Immunologen«zu etablieren setzten sich die Initiativen der Gesellschaft für den»facharzt für Immunologie«ein, kurz bevor es 1976 in der DDR zu einer generellen Reform des Medizinstudiums kam. 101 Seit 1977 war eine Vorlesungsreihe»Grundlagen der Immunologie und der Klinischen Immunologie«im dritten Studienjahr fester Bestandteil des allgemeinen humanmedizinischen Curriculums. 102 Dies war ein erster Schritt, mit dem die Bedeutung der Immunologie offiziell anerkannt worden war. Darüber hinaus galt es, einen»facharzt für Immunologie«zu schaffen. Die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie arbeitete zu diesem Zweck ein komplettes Lehrprogramm aus. 103 Eine zentrale Frage betraf dabei den Status des neu zu schaffenden Facharztes. Die Gesellschaft trat hier entschieden für einen eigenständigen Facharzt ein. Diese Position war zum einen gegen die Absichten zu verteidigen, den Facharzt für Immunologie zu einer Subspezialisierung im Rahmen vieler verschiedener medizinischer Disziplinen zu machen. 104 Zum anderen war der Idee entgegenzutreten, Doppelfachärzte auszubilden. 105 Und die Option, den Facharzt für Immunologie»einfach zuzuerkennen«lehnte die Gesellschaft als vollkommen indiskutabel ab war es soweit: Das von Hartmut Franz (Berlin), Leiter der Akademie für Ärztliche Fortbildung, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie mehrfach überarbeitete Rahmenausbildungsprogramm für den Facharzt für Immunologie wurde vom Vorstand der Gesellschaft einstimmig bestätigt und 1982 von ministerieller Seite gebilligt Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR]: Brief (Rundschreiben) von Heinz-Egon Kleine-Natrop und Lothar Jäger an die Mitglieder der Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung, den Ebd. und Bergmann, S Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR]: Brief (Rundschreiben) von Heinz-Egon Kleine-Natrop und Lothar Jäger an die Mitglieder der Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung, den Ebd. 98 Ebd. 99 Pritzel: Gesundheitswesen, S Statut: Paragraph 2: Aufgaben und Zielsetzung (1). 101 Pritzel: Gesundheitswesen, S. 71 f. 102 Bergmann: Geschichte, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Dresden, den , Protokoll, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Rostock, den , Protokoll, S. 1. Der Vorschlag der Doppelfachärzte war von der Akademie für Ärztliche Fortbildung vorgebracht worden. 106 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Dresden, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 273
144 Parallel zur Regelung der Facharztausbildung bemühte sich die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie um die Fortbildung von Naturwissenschaftlern zum Fachimmunologen. Die Vorstellungen dazu skizzierte abermals Hartmut Franz in einem Entwurf zu einem Lehrprogramm:»Auf dem Gebiet der Immunologie hat die Weiterbildung von naturwissenschaftlichen Hochschulabsolventen das Ziel, Fachkader heranzubilden, die im Rahmen einer interdisziplinären sozialistischen Gemeinschaftsarbeit selbständige schöpferische Beiträge zur immunologischen Forschung und zur Immundiagnostik leisten können. Sie tragen damit zur Sicherung und zum weiteren Ausbau des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung bei und sind im Rahmen dieser Tätigkeit als Fachwissenschaftler Partner des klinisch tätigen Immunologen.«108 Um ein entsprechendes Weiterbildungs-Curriculum zu entwickeln, wurde im Ministerium für Gesundheitswesen eine»fachkommission Immunologie«gegründet, in der Vertreter der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie mitarbeiteten. 109 Die Kommission entwickelte nicht nur das letztlich vierjährige Ausbildungsprogramm, sondern regelte auch, dass Naturwissenschaftlern die Zusatzausbildung erlassen werden konnte, wenn sie bereits über zehn Jahre im Bereich der Immunologie tätig gewesen waren. Das Weiterbildungsprogramm für Naturwissenschaftler wurde Ende 1981 von der Fachkommission Immunologie verabschiedet und vom Minister für Gesundheitswesen bestätigt. 110 Die Ausbildung konnte 1983 aufgenommen werden. 111 Neben einer Qualifizierung an ihrem Arbeitsplatz sollten die Kandidatinnen und Kandidaten spezielle Immunologie-Lehrgänge in Jena, Leipzig und Berlin besuchen. Dort waren inzwischen immunologische Institute eingerichtet worden, allen voran 1977 das Institut für Klinische Immunologie an der Universität Jena. Unter der Leitung von Lothar Jäger standen dort immunologisch-allergologische Forschung, Autoimmunisierung und klinische Versorgung im Mittelpunkt. 112 Das wenig später gegründete Immunologische Institut der Universität Leipzig, dem Herwart Ambrosius vorstand, befasste sich mit immunologischer Grundlagenforschung. 113 In Berlin war der Lehrstuhl für Immunologie von Hartmut Franz an der Akademie für Ärztliche Fortbildung Anlaufstelle für künftige Fachimmunologen. Das Curriculum für den»fachwissenschaftler für Immunologie«114 umfasste den Erwerb von theoretischen und praktischen Kenntnissen der Immunologie und angrenzender Disziplinen wie Biologie, Biochemie, Mikrobiologie, Pharmakologie, Virologie, Genetik und Labormedizin. Preise und Ehrungen Um die fertigen Immunologen zu herausragenden Arbeiten zu animieren, beschloss die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie 1979, einen Preis auszuloben. 115 Er sollte für»hervorragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen und klinischen Immunologie (einschließlich Promotionen)«vergeben werden, für»vorbildliche Leistungen bei der Einführung und Anwendung neuer Forschungsergebnisse in der Praxis«, für»herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen einer von der Gesellschaft erfolgten Ausschreibung von Themen und Fragestellungen«und für»hervorragende Leistungen bei der Weiterentwicklung der Immunologie in der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen gemeinsamer Publikationen«. 116 Im Abstand von jeweils zwei Jahren sollten je zwei Wissenschaftler ausgezeichnet werden. 117 Die erste Preisverleihung erfolgte 1983 an Helmut Fiebig für seine Untersuchung auf experimentell-immunologischem Gebiet und an Jürgen Kaden für seine Arbeit im Bereich der klinischen Immunologie. 118 Ab 1984 vergab die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in unregelmäßigen Abständen auch Ehrenmitgliedschaften an herausragende Immunolo- 108 Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Hartmut Franz: Lehrprogramm der Fachrichtung»Immunologie«. 109 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 1; auch: Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Leipzig, den , Protokoll, S. 1; Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Leipzig, den , Protokoll, S. 3 und öfter. 110 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 1; Bergmann: Geschichte, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Erfurt, den , Protokoll, S Bergmann: Geschichte, S Ebd. 114 Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Hartmut Franz: Lehrprogramm der Fachrichtung»Immunologie«, 115 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Rostock, den , Protokoll, S. 2. Auf Anregung von Lothar Jäger; dazu: Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S Ebd., S. 2 f.: Genehmigte Statuten zum Preis der Gesellschaft. 117 Ebd., S. 2: Statuten zum Preis, Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Erfurt, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 275
145 gen, darunter an den Kanadischen Initiator der International Union of Immunological Societies, Bernhard Cinader. 119 Arbeitsgemeinschaften Das Ausarbeiten von Curricula für die Ausbildung des medizinischen und naturwissenschaftlichen Nachwuchses in der Immunologie war lange Zeit ein wichtiger Arbeitsbereich der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie. Das Statut der Gesellschaft sah aber auch die Weiterentwicklung des Fachs, die Verbindung von Forschung und klinischer Praxis, die Ausrichtung wissenschaftlicher Veranstaltungen, das Publizieren von Forschungsergebnissen und die Mitarbeit in internationalen medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften vor. Es waren diese Arbeitsbereiche, die auch Herwart Ambrosius (Leipzig) 1982 in einem»langfristigen Arbeitsprogramm«benannte. 120 Eine forschungsstrategisch detailliertere Ausarbeitung einer»entwicklungskonzeption Immunologie«legte Lothar Jäger (Jena) zwei Jahre später vor. Als»Schwerpunkte und Entwicklungstendenzen«des Faches wurden von ihm dabei Immuntechnik, Tumorimmunologie, Immunologie von Zelldifferenzierung und -proliferation, Klinischimmunologische Forschung und Immunologie der Entzündung benannt. 121 Im Rahmen dieser Arbeitsprogramme kam den Arbeitsgemeinschaften der Gesellschaft eine zentrale Rolle zu. Seit 1978 gab es eine»ag für Klinisch-Immunologische Diagnostik«und eine»ag Asthma bronchiale«. 122 Außerdem suchten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften den Kontakt zu thematisch verwandten Arbeitskreisen anderer medizinischer Fachgesellschaften. So wurde die AG Asthma bronchiale schließlich zu einer interdisziplinären AG, die von der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR und der Gesellschaft für Bronchopulmonologie und Tuberkulose der DDR getragen wurde. 123 Zahlreiche Mitglieder der Gesellschaft beteiligen sich zudem in der AG Infektionsimmunologie der Gesellschaft für Mikrobiologie und Epi- 119 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Halle, den , Protokoll, S Bergmann: Geschichte, S. 527 f. 121 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Halle, den , Protokoll, S. 1 und Anlage»Entwicklungskonzept Immunologie«. 122 Bergmann: Geschichte, S Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Berichterstattung über die Tätigkeit der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR an die Gesellschaft für Klinische Medizin der DDR, OMR Dr. Kürzinger, Generalsekretär, Berlin, den , S. 2. Vertragsabschluss zwischen den ostdeutschen und ungarischen Gesellschaften für Immunologie, ca Von links: W. Wiltner (Sekretär der ungarischen Gesellschaft), L. Jäger (Sekretär der ostdeutschen Gesellschaft), A. Hamori (Präsident der ungarischen Gesellschaft), D. Findeisen (Vorsitzende der ostdeutschen Gesellschaft), und A. Leövey (Mitglied im Vorstand der ungarischen Gesellschaft) demiologie der DDR 124 oder arbeiteten mit der Gesellschaft für Geschwulstbekämpfung der DDR zusammen. 125 Mit einigen dieser Gesellschaften führte die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie auch Immunologische Symposien durch, die sie seit den späten 1960er-Jahren alljährlich zusätzlich zu ihren Jahrestagungen veranstaltete. 126 Die Berichte dieser Veranstaltungen wurden in der Zeitschrift der Gesellschaft veröffentlicht, die 1977 von»allergie und Asthma«in»Allergie und Immunologie«umbenannt wurde. Wie Lothar Jäger, der damalige Vorsitzende der Gesellschaft, in einem 124 Ebd., S. 2. Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Görlitz, den , Protokoll, S. 2 (Beschluss); Bergmann: Geschichte, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 4: Vorbereitung eines gemeinsamen Symposiums über»immundiagnostik und Immuntherapie des Krebses 1980«. 126 Bergmann: Geschichte, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 277
146 Geleitwort darlegte, war die Veränderung des Titels nur konsequent, weil in der Zeitschrift in zunehmendem Maße Publikationen Aufnahme gefunden hatten, die bis in die immunologische Grundlagenforschung hineinreichten. Gut 50 Prozent der in der Zeitschrift veröffentlichten Original-Beiträge kamen aus der DDR, die andere Hälfte aus dem sozialistischen Ausland. 127 Internationale Kontakte Die hohe Beitragsquote von ausländischen Immunologen zur Zeitschrift der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie hing mit den engen Beziehungen zusammen, die die Gesellschaft zu anderen nationalen Immunologen-Verbänden unterhielt. Besonders enge Kontakte bestanden hier zu den Fachgesellschaften in Ungarn, 128 Polen 129 und der Tschechoslowakei 130. Nach Möglichkeit nahmen Vertreter der Gesellschaften an Veranstaltungen ihrer Partnervereinigungen teil. Dies war jedoch nicht immer im gewünschten Maße möglich, weil die Bildung von entsprechenden Reisekadern nicht allein von den Fachgesellschaften, sondern vor allem von höheren staatlichen Stellen abhing. 131 Ungeachtet dessen war es der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie möglich, sich auch im nichtsozialistischen Ausland bei internationalen Gesellschaften einzubringen bei der International Union of Immunological Societies (IUIS), der European Federation of Immunological Societies (EFIS), der International Association of Allergology, und der European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Eine besondere Bedeutung kam den Kontakten zu westdeutschen Fachkollegen zu. Viele bestanden seit den frühen Tagen der Gesellschaft für Allergie und Asthmaforschung, und viele neue kamen hinzu. Es erwies sich dabei als Vorteil, dass die west- 127 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Leipzig, den , Protokoll, S Zum Vertrag mit der ungarischen Gesellschaft für Immunologie: Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S Zum Vertrag mit der Polnischen Gesellschaft für Immunologie: Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Leipzig, den , Protokoll, S Zum Vertrag mit der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Immunologie: Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie, den , Protokoll, S Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 1, Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 4; Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S. 1. Rüdiger von Baehr am Institut für Medizinische Immunologe an der Berliner Charité, 1987 deutsche Gesellschaft für Immunologie 1967 auf eine nationale Nomenklatur verzichtet hatte. 132 So konnte sie gegenüber den offiziellen Stellen der DDR als internationale oder zumindest nicht rein bundesrepublikanische Gesellschaft erscheinen. Dies erleichterte die Kontakte zwischen den beiden deutschen Immunologischen Gesellschaften erheblich. Forscher aus der Bundesrepublik waren häufig in der DDR, und es kam zu verschiedenen wissenschaftlichen Kooperationen, etwa zwischen Fritz Melchers vom Baseler Institut für Immunologie und dem Institut von Herwart Ambrosius in Leipzig oder dem Westberliner Immunologen Tibor Diamantstein und Rüdiger von Baehr an der Charité in Ostberlin. 133 Insbesondere Rüdiger von Baehr wurde in den letzten Jahren vor dem Fall der Mauer beim Aufbau einer modernen Immunologie von Alexander Schalck-Golodkowski, dem ehemaligen Leiter für Kommerzielle Koordinierung (Ko-Ko 132 Zeitzeugengespräch Erlangen, den mit Klaus Eichmann, Joachim R. Kalden, Fritz Melchers, Lothar Jäger. 133 Ebd. 278 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 279
147 genannt) im Ministerium für Außenhandel der DDR, mit erheblichen Summen unterstützt. Ein Teil dieser Gelder stammte aus dem westdeutschen Freikauf von Häftlingen. 134 In Anbetracht der Ost-Kontakte waren die Immunologen der Bundesrepublik auch sehr darum bemüht, im Sommer 1989 ihren Kollegen aus der DDR die Teilnahme am VII. Internationalen Kongress für Immunologie in Westberlin zu erleichtern: Sieben von ihnen wurden die Kongressgebühren komplett erlassen und weitere 12 DDR-Wissenschaftler nahmen zu reduzierten Gebühren teil. 135 Die DDR-Forscher richteten dafür im Gegenzug das Post-Kongress-Symposium aus, das im Herbst 1989 in Schwerin stattfand. Wenige Wochen später fiel die Berliner Mauer. Der deutsche Immunologen-Verband nach 1989 Aufnahme ostdeutscher Immunologen in die westdeutsche Gesellschaft für Immunologie Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 eröffnete den Immunologen im Osten und Westen Deutschlands neue Chancen für eine produktive Zusammenarbeit. Sie nutzten sie in vielfältiger Weise und bauten so gemeinsam die heutige Deutsche Gesellschaft für Immunologie zu einem äußerst aktiven und international hoch anerkannten Verband aus. In der ostdeutschen Gesellschaft standen nach dem November 1989 schwierige Entscheidungen an, die mit lebhaften Diskussionen in der Gesellschaft verbunden waren. Sie betrafen den Zusammenschluss beider Gesellschaften aus Ost und West, den Themenkomplex Klinische Immunologie und die Zukunft der DDR-Abschlüsse des Facharztes für Immunologie und des Fachimmunologen. Eine Vereinigung der beiden immunologischen Fachgesellschaften aus Ost und West unter einem Dach stellte eine besondere Herausforderung dar, denn die ostdeutsche Immunologen-Gesellschaft zählte nicht nur experimentell und klinisch tätige Immunologen zu ihren Mitgliedern. Aus historischen Gründen waren ein Fünftel der rund 500 Mitglieder 136 Allergologen. 137 Die Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie war also hinsichtlich der Mitgliederstruktur passfähig für beide in der Bundesrepublik bestehenden fachnahen medizinischen Gesellschaften für die Gesellschaft für Immunologie (GfI) und für die Deutsche Gesellschaft für Allergie- und Im- 134 Persönl. Mitteilung von Baehr an Diethard Gemsa. 135 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin, den , Protokoll, S Bergmann: Geschichte, S Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR, Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Beratungen der drei Vorstände [der Gesellschaft für Immunologie, der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung und der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] am in Aachen, Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 281
148 munitätsforschung (DGAI). 138 Lothar Jäger, der von den Mitgliedern der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR zum Verhandlungsführer mit den westdeutschen Verbänden bestimmt wurde, 139 hoffte, über seinen Verband einen Zusammenschluss aller drei Gesellschaften herbeiführen zu können. 140 Doch er musste schon bald feststellen, dass dies nicht möglich war. Die Gründe dafür waren vielfältig. In dem Sitzungsprotokoll einer gemeinsamen Vorstandssitzung der drei Gesellschaften aus dem Frühjahr 1990 heißt es dazu:»die Vorstände der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung und der Gesellschaft für Immunologie waren sich einig, daß sich die Trennung beider Gesellschaften durch die historische Entwicklung wie auch in den angelsächsischen Ländern als sachlich gerechtfertigt erwiesen hat. Dennoch wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt.... Die Vorzüge einer gemeinsamen Gesellschaft für Immunologen und Allergologen wurden von Prof. Jäger eingehend dargestellt. Die Diskussion ergab jedoch, daß eine derartige Struktur spezifisch auf die bisherigen Bedingungen in der Deutschen Demokratischen Republik zugeschnitten ist und bei Änderung der Struktur der ärztlichen Versorgung in der Deutschen Demokratischen Republik (vermehrte Niederlassungen) als auch in der Struktur der Forschung (verstärkte Förderung von Grundlagenforschung) in gleicher Weise problematisch sein würde, wie dies in der Bundesrepublik Deutschland bereits in der Vergangenheit der Fall war.«141 Kurz: ein Zusammenschluss der drei Gesellschaften unter einem Dach war ausgeschlossen. 142 Am 14. Februar 1991 fand während der Frühjahrstagung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie in Berlin die letzte Mitgliederversammlung statt. Auf ihr stimmte die überwältigende Mehrheit der damals nur 57 anwesenden Mitglieder 138 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR in Berlin, den , Protokoll, S Ebd., S. 4 f. Auch: Archiv der DGfI, Ordner Gesellschaft für Immunologie 1990 Wahl Verhandlungsführer Vorstandswahl 1991: Brief J. Kaden an L. Jäger, : Bestimmung der Verhandlungsführer Aachen durch die Mitglieder der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR; dazu auch: Ordner»Wahl Verhandlungsführer«. 140 Vorstandssitzung der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR in Berlin, den , Protokoll, S. 4 und öfter. Auch: Archiv der DGfI: Brief L. Jäger an W. Schmutzler (DGAI), Jena, Archiv der DGfI, Ordner Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie - Kaden: Kurzgefasstes Protokoll der Beratungen der Vorstände der Gesellschaften Betr. Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung, der Gesellschaft für Immunologie und der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR; hier: Beratung der Vorstände der Gesellschaften, Berlin, , S Archiv der DGfI, Ordner Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie - Kaden: OMR L. Jäger, Vorsitzender; Doz. J. Kaden, Sekretär, Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR: Rundschreiben an die Mitglieder, Berlin, den , S. 2. für die Auflösung der Gesellschaft. 143 Wenig später schlossen sich 133 Mitglieder des liquidierten Verbands der Gesellschaft für Immunologie und 46 der DGAI an. 144 Fachimmunologe und Facharzt in Immunologie Bei der Entscheidung für die eine oder andere der beiden westdeutschen Gesellschaften spielte die Frage, welchen Stellenwert der Klinischen Immunologie beigemessen wurde, eine untergeordnete Rolle. Lothar Jäger und seine Kollegen hatten bei ihren Verhandlungen mit beiden bundesdeutschen Gesellschaften feststellen müssen, dass sie die Klinische Immunologie bei Weitem nicht in dem Maße pflegten, wie dies in der DDR der Fall gewesen war. Beide Gesellschaften signalisierten jedoch, entsprechende Arbeitsgruppen einzurichten. 145 Von großem Gewicht war für die Mitglieder der aufgelösten Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie vor allem die Frage nach der Anerkennung ihrer Abschlüsse»Facharzt für Immunologie«und»Fachimmunologe«. Entsprechend nachdrücklich drang Lothar Jäger bei der Gesellschaft für Immunologie und der Deutschen Gesellschaft für Allergie und Immunitätsforschung (DGAI) darauf, dass diese sich bei den zuständigen Ministerien oder sonstigen Behörden und Einrichtungen in der Bundesrepublik für die Etablierung eines Facharztes für Immunologie und eines Fachimmunologen einsetzten. 146 Für das Gebiet der DDR hatte der Minister für Gesundheitswesen 143 Archiv der DGfI, Ordner Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie - Kaden: Mitgliederversammlung während der Frühjahrstagung der Gesellschaft für Klinische und experimentelle Immunologie ( ) in Berlin, Charité, Großer Hörsaal, Protokoll: 57 abgegebene Stimmen: 50 für Auflösung, 1 gegen Auflösung, 6 Stimmenthaltungen. 144 Archiv der DGfI, Ordner [Deutsche Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Brief J. Kaden an W. Schneider, Klinikum Buch, den Die Restfinanzen der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologen der DDR wurden entsprechend in einem Schlüssel 74,3 % zu 25,7 % auf die Gesellschaft für Immunologie und die DGAI aufgeteilt. 145 Archiv der DGfI, Ordner [Deutsche Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Beratungen der Vorstände der Gesellschaften, Betr. Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung, der Gesellschaft für Immunologie und der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR; hier: Beratung der Vorstände der Gesellschaften, Berlin, , Kurzgefasstes Protokoll, S. 3; Brief W. Schmutzler (DGAI) an L. Jäger, : Angebot, eine Arbeitsgruppe für»klinische Immunologie«in der DGAI zu gründen und Hinweis auf vergleichbare Pläne bei der Gesellschaft für Immunologie. 146 Archiv der DGfI, Ordner [Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR, Protokolle der Vorstandssitzungen ab 1981: Beratungen der drei Vorstände [der Gesellschaft für Immunologie, der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung und der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] am in Aachen, Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 283
149 bereits Mitte 1990 mitgeteilt, dass die entsprechenden Titel auch nach dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Wiedervereinigung, auf dem Gebiet der DDR»ihre Gültigkeit unbegrenzt behalten«würden. 147 Was die Bundesrepublik anbelangte, begrüßte Joachim R. Kalden den Facharzt für Immunologie nachdrücklich und sprach sich für seine Weiterführung und Etablierung in ganz Deutschland aus. Schon im Vorfeld ihrer Gründung hatte Kalden jedoch darauf hingewiesen, dass über Fachärzte für Immunologie und über ihr Niederlassungsrecht in den Ärztekammern entschieden werde und hier mit langen Prozessen zu rechnen sei. 148 Angesichts dessen machte er seinen ostdeutschen Kollegen keine großen Hoffnungen, dass sich der Facharzt für Immunologie und der Fachimmunologe in naher Zukunft bundesweit etablieren lassen würden. Und er sollte Recht behalten: Bis heute gelten die 1990 getroffenen Regelungen. Allein der Fachimmunologe wird seit September 2001 bundesweit als»fachimmunologe DGfI«von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie verliehen (siehe S. 293). 149 Einführung und Ausbau forschungsorientierter Arbeitskreise Als die ostdeutschen Immunologen im Frühjahr 1991 der Gesellschaft für Immunologie beitraten, erlebten sie eine äußerst dynamische und prosperierende forschungsorientierte medizinische Fachvereinigung. Die Gesellschaft zählte damals weit über aktive und gut miteinander vernetzte Mitglieder. 150 Einen wesentlichen Anteil daran hatte die gute finanzielle Ausstattung der Gesellschaft. Die beachtlichen Überschüsse, die die Gesellschaft für Immunologie 1989 mit dem VII. Immunologischen Weltkongress erwirtschaftet hatte, mussten einer satzungskonformen Nutzung zugeführt werden. 151 Sie kamen einer Vielzahl von Projekten zugute, von denen die Gesellschaft bis heute profitiert. Neben einem Stipendienprogramm und Internationalen Workshops wurde nun vor allem die in den späten 1980er-Jahren bereits gedanklich entwickelte Einrichtung von Arbeitsgruppen oder Arbeitskreisen forciert. Von der Konzeption her handelte es sich 147 Ebd., S Archiv der DGfI, Ordner: DGfI Protokoll MV und V+B: Beratungen der drei Vorstände [der Gesellschaft für Immunologie, der Deutschen Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung und der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR] am in Aachen, Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Aachen, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Frankfurt am Main-Flughafen (Sheraton Hotel), den , Protokoll, S. 1 f. Einladung zum 1. Treffen der Mitglieder des zukünftigen Arbeitskreises Veterinärimmunologie, das 1993 von B. Kaspers in Hannover organisiert wurde. In seinem Einladungsschreiben verweist Bernd Kaspers darauf, dass»kosten für Fahrt und evtl. Übernachtung nicht übernommen werden«, ein Prinzip, das bis heute bei allen Arbeitskreistreffen beibehalten wird. 284 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 285
150 hier um Zusammenschlüsse von mindestens 20 Mitgliedern der Gesellschaft für Immunologie, die sich auf einen Teilaspekt der Forschung am Immunsystem konzentrierten und alle drei Jahre aus ihren Reihen einen Sprecher und einen stellvertretenden Sprecher wählten. Die Arbeitskreise sollten sich mindestens einmal im Jahr zwischen zwei Jahrestagungen treffen und/oder mindestens einen Workshop bei der Jahrestagung der Gesellschaft organisieren. 152 Im Gegenzug förderte die Gesellschaft für Immunologie auf Antrag die Arbeitskreise über einen vorgegebenen finanziellen Verfügungsrahmen mit einem Gesamtvolumen von je bis DM pro Jahr. 153 Die Gesellschaft versprach sich von den Arbeitskreisen nicht nur einen intensiveren fachlichen Austausch zwischen ihren Mitgliedern, sondern auch die Einbindung führender Wissenschaftler aus ihren jeweiligen Arbeitsgebieten in die Gesellschaft. Die Arbeitskreise verstand die Gesellschaft für Immunologie also als»wissenschaftliches Zentrum des jeweiligen Arbeitsgebiets in der Gesellschaft«. 154 Die ersten Arbeitskreise befassten sich mit den Themenkomplexen»Adhäsion«(Alf Hamann, Münster, später Berlin) und»veterinärimmunologie«(wolfgang Leibold, Hannover). 155 Außerdem wurde der bereits seit etwa 1970 bestehende Arbeitskreis»Klinische Immunologie«in die Gesellschaft für Immunologie integriert. Er war von Konrad Federlin (Gießen) begründet worden und traf sich alljährlich mit Unterstützung der Behringwerke in Frankfurt-Höchst zum wissenschaftlichen Austausch. Seine Tagungsakten veröffentlichte der»aki«, wie er kurz genannt wurde, in der Zeitschrift»Immunität und Infektion«. 156 Dem AKI stand ab 1993 Hans-Hartmut Peter (Freiburg), danach Reinhold E. Schmidt (Hannover) vor. 157 Zu diesen Arbeitskreisen sollten im Lauf der Jahre bis zu zehn weitere hinzukommen. 158 Themen wie Adhäsionsmoleküle, Infektionsimmunologie, Neuroendokrino- Immunologie, Signaltransduktion, Transplantationsimmunologie, Tumorimmunologie, 152 Archiv der DGfI: Ordner DGfI: Protokolle MV und V+B: Vorschlag zur Definition der Arbeitskreise und ihrer Vertretung im Beirat der Gesellschaft für Immunologie, den Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Leipzig, den , Protokoll, Anlage»Arbeitskreise«; ergänzt durch: Vorstands und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Wien, den , Protokoll, S Ordentliche Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie anlässlich der 26. Jahrestagung in Wien, den , Protokoll, S Ebd., S Mitteilung von Hans-Hartmut Peter an die Verfasser, Ordentliche Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie anlässlich der 26. Jahrestagung in Wien, den , Protokoll, S Die folgenden Ausführungen zu den Arbeitskreisen beruhen auf dem ausführlichen Bericht von Ottmar Janßen: Arbeitskreise der DGfI. Thematische Fokussierung, gerne über den Tellerrand hinaus. Zeitschiene Die Arbeitskreise in der DGfI. Folgende Arbeitskreise bestehen nicht mehr: Adhäsion ( ), Makrophagen ( ), Zytokine & Rezeptoren ( ), Vakzine ( ) und Vergleichende Immunologie (bis 2006) aber auch Vakzine, Vergleichende Immunologie, Veterinärimmunologie oder Zytokine und Rezeptoren waren zwar regelmäßig im Workshop-Programm der Jahrestagungen vertreten, es kamen aber in den kurzen Zeitfenstern nur selten alle Arbeitsgruppen zu Wort. Einige Gruppenleiter wollten es nicht dabei belassen und nutzten die Möglichkeit zur Gründung entsprechender Arbeitskreise, die von Vorstand und Beirat der DGfI finanziell und ideell unterstützt wurde. Schließlich war den Führungsgremien der DGfI sehr daran gelegen, die immunologische Fachkompetenz in der Gesellschaft zu halten und eine Gründung neuer Fachverbände oder ein Abwandern in andere, bereits bestehende naturwissenschaftliche und medizinische Fachorganisationen zu vermeiden. 159 So wurde dann auch zum Beispiel die Gesellschaft für Immunologie der Reproduktion e.v. im Frühjahr 2000 als Arbeitskreis Reproduktionsimmunologie»AKRI«in die DGfI aufgenommen. Im darauffolgenden Jahr wurde der Arbeitskreis»T-Zellen: Subpopulationen und Funktion«eingerichtet, der auf Initiative von Michael Lohoff (Marburg) bereits seit 1995 regelmäßige Treffen in Marburg veranstaltete. Auf dem ersten von Hans-Martin 159 So die Argumentation in der Mitgliederversammlung der DGfI am : Protokoll der Mitgliederversammlung, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 287
151 Jäck (Erlangen), Andreas Radbruch (Berlin) und Michael Reth (Freiburg) organisierten B-Zellforum 2003 in Titisee kam sodann die Idee auf, auch einen Arbeitskreis mit der Thematik»B-Lymphozyten«einzurichten. Erster Sprecher des 2004 gegründeten Arbeitskreises war Hans-Martin Jäck (Erlangen). In ähnlicher Weise formierte sich der AK»NK-Zelle«von der Idee 2006 auf dem ersten NK-Zell-Symposium in Heidelberg bis zur Gründung des Arbeitskreises durch Carsten Watzl (damals Heidelberg, heute Dortmund) im Jahr Im Jahr 2010 wurde mit Tim Niehues (Krefeld) als 1. Sprecher der Arbeitskreis»Pädiatrische Immunologie«ins Leben gerufen, der sich mit der translationalen Forschung von immunologischen Grundlagen bis hin zur klinischen Versorgung bei primären angeborenen Immundefekten beschäftigt. Der jüngste Arbeitskreis»Dendritische Zellen«wurde auf der DGfI-Jahrestagung 2016 in Hamburg eingerichtet, und Diana Dudziak (Erlangen) und Björn Clausen (Mainz) wurden als Sprecher gewählt. Um die Arbeitskreise in den Vorstands- und Beiratssitzungen zu vertreten, wurde bereits 1993 das Amt des Koordinators der Arbeitskreise eingeführt. Es wurde bis 1998 von Klaus Heeg (Heidelberg), bis 2004 von Rainer Straub (Regensburg) und bis 2011 von Hans-Martin Jäck (Erlangen) bekleidet, bevor Ottmar Janßen (Kiel) 2012 die aktuelle Koordination übernahm. Heute ist diese für die Forschung wichtige Brücke zwischen Arbeitskreisen und DGfI-Exekutive nicht mehr aus den Vorstands-und Beiratssitzungen wegzudenken. Im Jahr 2010 entwarfen die damaligen AK-Sprecherinnen und Sprecher unter der Ägide von Hans-Martin Jäck und Ottmar Janßen ein Richtlinienkonzept für die Arbeitskreise, das wenig später von Vorstand und Beirat als»arbeitskreis-satzung«beschlossen wurde. Die Arbeitskreise stehen seitdem allen Studierenden, Doktoranden, Postdocs und Dozenten offen, deren Forschungsinteressen thematisch zu dem Forschungsschwerpunkt des jeweiligen Arbeitskreises passen. Bilaterale internationale Kooperationen Finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Gesellschaft für Immunologie fanden auch verschiedene internationale Initiativen, allen voran die von Hans-Hartmut Peter (Freiburg) mit Unterstützung von Reinhold E. Schmidt (Hannover) organisierten Baltischen Sommerschulen. Die von 1993 an stattfindenden Veranstaltungen dienten vor allem dem Aufbau der Immunologie in Litauen, Estland und Lettland. 160 Teilnehmer am EFIS John Humphrey Course»Autoimmunity«in Tartu, Juni 2001 Vordere Reihe v. l.: F. Melchers, K. Krohn, D. Gemsa, R. Uibo, G. Riethmüller, A. Sochnew, I. Förster, K. Pfeffer; Mitte: M. von Herrath; Obere Reihe v.l.: P. Brandtzaeg, H.-H. Peter, A. Wijk, V. Tamosuinas, HU. Weltzien, M. Röllinghoff, KV. Kisand Weitere Initiativen beförderten den internationalen wissenschaftlichen Austausch und gingen auf persönliche Beziehungen einzelner Mitglieder der Gesellschaft für Immunologie zu ausländischen Fachwissenschaftlern zurück. So kamen bspw. die deutschjapanischen Kontakte aufgrund einer Initiative von Fritz Melchers (Basel), Martin Röllinghoff (Erlangen) und Günter J. Hämmerling (Heidelberg) zustande. 161 Auf japanischer Seite war und ist die treibende Kraft Takehiko Sasazuki. Die erste bilaterale Tagung zwischen der DGfI und JSI fand 1996 in Bamberg statt. Diese deutsch-japanischen Treffen sind sehr erfolgreich und finden in diesem Format bis heute statt fand in Kraków (Polen) ein Freundschaftstreffen zwischen deutschen und polnischen Immunologen statt, das federführend von Janusz Marcinkiewicz (Kraków) und Günter J. Hämmerling (Heidelberg) organisiert wurde. Bereits 2005 hat die DGfI ihre internationalen Beziehungen weiter ausgebaut und unter der Koordination von Stefan H. E. Kaufmann, Santosh Kar und Kanury Rao in Suraj Kund, Faridabad, bei Delhi (In- 160 Deutsche Gesellschaft für Immunologie (Hrsg.): Immunologie in Deutschland 2005, Berlin 2005, S Ebd., S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 289
152 dien) das erste Indo-German Collaboration Meeting on the Immune System in Health and Diseases organisiert. 162 Hervorzuheben sind auch die von Othmar Förster (Wien) und Walter Knapp ( ), damalige Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Allergie und Immunologie (ÖGAI), begonnenen und bis heute andauernden Kooperationen, die sich in vielen gemeinsamen Jahrestagungen und Mitgliedschaften in beiden Fachgesellschaften widerspiegeln. Weitere bilaterale Tagungen und internationale Kooperationen, die bis heute andauern, wurden im Laufe der nächsten Jahre etabliert und werden in Kapitel III präsentiert. Die GfI wird zur»deutschen«gesellschaft für Immunologie (DGfI) Mit den vermehrten Kontakten ins Ausland stieg die nationale wie internationale Reputation der Gesellschaft für Immunologie. Unter den Mitgliedern kam der Wunsch auf, im Namen der Gesellschaft nun endlich auch die nationale Zugehörigkeit kenntlich zu machen. Ein entsprechender Antrag wurde auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung im September 1995 unter dem Präsidenten Martin Röllinghoff (Erlangen) bewilligt. 163 In der gleichen Versammlung fiel auch die Entscheidung, in den Statuten die»klinisch-immunologische Forschung«als ein»besonderes Anliegen«der nunmehr»deutschen Gesellschaft für Immunologie«zu fixieren. 164 Weitere Entwicklung der DGfI In den 1990er-Jahren wurden bestehende internationale Kooperation ausgebaut, zusätzliche Arbeitskreise gegründet und neue Programme im Bereich der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Öffentlichkeitsarbeit etabliert. Initiativen zur Aus- und Weiterbildung in der Immunologie Neben dem wissenschaftlichen Austausch auf den jährlichen Frühjahrs- und Herbsttagungen und in den spezialisierten Arbeitskreisen stand die Ausbildung des fachlichen Nachwuchses im Fokus der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Faches war es unabdingbar, Medizinern und Naturwissenschaftlern eine qualifizierte Fachausbildung in Immunologie anzubieten. Darauf zu dringen war für die Gesellschaft umso mehr geboten, als Mitte der 1990er- Jahre zu befürchten stand, dass die Immunologie bei der Neufassung der Approbationsordnung für Ärzte übergangen werden könnte und in der Ausbildung von Medizinern so gut wie keine Rolle mehr spielen sollte. Daher wandte sich Martin Röllinghoff (Erlangen), damaliger Präsident der DGfI, im März 1996 an den damaligen Bundesminister für Gesundheit, Horst Seehofer, um ihn auf die verheerenden Folgen einer Unterdrückung immunologischer Inhalte in der Medizinerausbildung hinzuweisen. 165 Da die Antwort aus dem Ministerium wenig konkret ausfiel und in ihr auf weitere Diskussionen von Fachkommissionen verwiesen wurde, in denen das Anliegen der Immunologen»geprüft und in die weitere Überarbeitung des Entwurfs einbezogen«werden könne, 166 entschloss sich der Vorstand der DGfI, unabhängig von den Fachgremien selbst aktiv zu werden. Er setzte, wie schon von Joachim R. Kalden 1990 vorgeschlagen, zwei Kommissionen ein, die sich mit den Problemen und Zielen der Weiterbildung in der Immunologie für Naturwissenschaftler und Mediziner beschäftigten. 167 Die beiden Expertengruppen zielten 162 Ebd. 163 Ordentliche Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie anlässlich der 26. Jahrestagung in Wien, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung der Gesellschaft für Immunologie in Wien, den , Protokoll, S. 2; Ordentliche Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Immunologie anlässlich der 26. Jahrestagung in Wien, den , Protokoll, S Martin Röllinghoff für den Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Immunologie an den Bundesminister für Gesundheit Horst Seehofer, den 4. März 1996, in: Immunologische Nachrichten Immunological News, 109. Rundschreiben der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, II. Quartal 1996, S Antwortschreiben von Wanner (Bundesministerium für Gesundheit, Bonn) vom 21. März 1996, in: Immunologische Nachrichten Immunological News, 109. Rundschreiben der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, II. Quartal 1996, S Reinhold E. Schmidt: Stand der»weiterbildung Immunologie«in der Medizin, in: Immunologische 290 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 291
153 darauf ab, die Immunologie in den jeweiligen naturwissenschaftlichen und medizinischen Fakultäten besser zu positionieren, Curricula für Weiterbildungen zu entwickeln und auf diese Weise für Immunologen qualifizierende Berufsbilder zu schaffen. 168 Da die Entscheidungsprozesse der Bundesärztekammer (BÄK), sich bei den zuständigen Stellen in Bund und Ländern für einen Facharzt für Immunologie einzusetzen, in die Länge zogen, 169 einigte sich die DGfI-Kommission»Weiterbildung«unter der Leitung von Reinhold E. Schmidt (Hannover) darauf, in der Medizin zunächst nur eine»zusatzbezeichnung für Immunologie für Naturwissenschaftler mit Schwerpunkten in theoretischen Fächern wie Mikrobiologie, Transfusionsmedizin und Labormedizin als auch für Mediziner in klinischen Fächern wie Innere Medizin, Rheumatologie, Pädiatrie oder Dermatologie«zu verfolgen. 170 Ein entsprechender Antrag wurde bei der Bundesärztekammer bereits 1995 gestellt, führte aber nur zu einer Anhörung. 171 Bei ihr wurde immerhin die Notwendigkeit einer besseren Etablierung der Immunologie in der Medizin anerkannt. Danach vertagte die BÄK das Thema wegen einer grundsätzlichen Änderung der medizinischen Weiterbildungsordnung allerdings wieder. Auch im Hinblick auf die Einführung eines naturwissenschaftlichen Fachimmunologen war Mitte der 1990er-Jahre keine Fortentwicklung abzusehen. Weiterhin gab es lediglich die Fachimmunologen der ehemaligen DDR, die ihre Bezeichnung wie 1990 vereinbart nur in den so genannten Neuen Bundesländern weiterführen durften. Um Bewegung in die festgefahrenen Entscheidungsprozesse zu bringen, beschloss die DGfI, selbst Weiterbildungsrichtlinien für Naturwissenschaftler und Mediziner zu entwickeln. Unter der Leitung von Christine Schütt (Greifswald) und Frank Emmrich (Leipzig) fand dazu im Juni 1998 ein Workshop über»perspektiven für Lehre und Weiterbildung im Fach Immunologie«statt. 172 Dafür waren mittels Fragebögen die Meinungen der Mitglieder der DGfI zur Gestaltung der immunologischen Weiterbildung abgefragt worden. 173 Auf Grundlage der eingesandten Antworten erarbeitete eine eigens eingerichtete Kommission unter Leitung von Klaus Resch (Hannover) die Weiterbildungsrichtlinien, die dann in verschiedenen Entwicklungsstufen nicht zuletzt über das Informationsor- Nachrichten Immunological News, 117. Rundschreiben der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, II. Quartal 1998, S Ebd. 169 Ebd. 170 Ebd. 171 Ebd. 172 Christine Schütt, Frank Emmrich: Kurzbericht: Workshop»Perspektiven für Lehre und Weiterbildung im Fach Immunologie«, in: Immunologische Nachrichten Immunological News, 118. Rundschreiben der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, III. Quartal 1998, S Ebd. gan»immunologische Nachrichten«allen Mitgliedern der Gesellschaft vorgelegt und zur Diskussion gestellt wurden. 174 Die letzte Fassung der gemeinschaftlich erarbeiteten Richtlinien wurde vom Vorstand und Beirat der DGfI sowie von der Mitgliederversammlung der Gesellschaft Ende September 2001 genehmigt und beschlossen. 175 Grundvoraussetzung für den Erwerb des Weiterbildungs-Zertifikats in Immunologie war demnach, dass die Kandidaten nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium der Medizin oder der Naturwissenschaften mindestens fünf Jahre immunologischer Tätigkeit nachweisen konnten. Diese Arbeiten mussten sie als Vollzeittätigkeit in einem Hochschulinstitut oder in einer anderen gleichwertigen, von der DGfI als Weiterbildungsstätte anerkannten Einrichtung (Forschungslaboratorium) erbracht haben. 176 Außerdem waren von den Kandidaten in einer Prüfung profunde Kenntnisse in einem zwölf Positionen umfassenden»gegenstandskatalog Immunologie«nachzuweisen. 177 Da von Seiten der BÄK und der zuständigen Stellen von Bund und Ländern keine Entscheidung über das immunologische Weiterbildungszertifikat für Ärzte getroffen wurde, beschloss die DGfI, es in eigener Regie und als solches ausgewiesen - zu vergeben. Seit Herbst 2001 verleiht die DGfI daher den Titel»Fachimmunologe DGfI«an all jene Kandidaten, die die strengen Kriterien der Gesellschaft erfüllen und die erforderlichen Prüfungen bestanden haben. Obwohl das Weiterbildungszertifikat von Anfang an rege nachgefragt wurde, bewegten sich Bundesärztekammer sowie Bund und Länder weiterhin nicht auf die Immunologen zu. Da auch ein weiterer Brief des damaligen DGfI-Präsidenten Hans-Hartmut Peter, an den Vorsitzenden der Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer (BÄK), H. Hellmut Koch, 178 keinen Erfolg zeigte, verlieh die Deutsche Gesellschaft für Immunologie das Zertifikat»Fachimmunologe DGfI«weiterhin in eigener Regie allein bis Ende 2004 ganze 212 Mal Z.B. F. R. Seiler: Vorwort, in: Immunologische Nachrichten Immunological News, Nr. 129, 2/2000, S. 2 und Diskussionsbeiträge ebd. S. 15 ff. 175 Kurzfassung der vorgestellten Antragsformalitäten für den Fachimmunologen. Beschlüsse von Vorstand und Beirat sowie der Mitgliederversammlung vom 26. und , in: Immunologische Nachrichten Immunological News, Nr. 131, 4/2001, S Weiterbildungsrichtlinien für den Fachimmunologen DGfI/Fachimmunologin DGfI, in: Immunologische Nachrichten Immunological News, Nr. 129, 2/2001, S Ebd., S. 13 f. 178 Hans-Hartmut Peter (Past-Präsident der DGfI): Brief an die Bundesärztekammer, abgedruckt in: Immunologische Nachrichten, Nr. 136, 1/2003, S. 10 f. 179 Vorstands- und Beiratssitzung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie in Kiel, den , Protokoll, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 293
154 Seit 2014 arbeitet die Bundesärztekammer erneut an einer grundsätzlichen Reform der ärztlichen Weiterbildung. Aus diesem Anlass hat Reinhold E. Schmidt (Hannover) im Namen der Deutschen Gesellschaft für Immunologie abermals die Initiative ergriffen und sich für eine Zusatzweiterbildung Immunologie eingesetzt, die gegenwärtig mit der Bundesärztekammer und den entsprechenden anderen, ggf. einzubindenden Fachgesellschaften, diskutiert wird. Nicht nur für die Qualitätssicherung immunologischer Diagnostik und Therapie, sondern auch für die langfristige Sicherung des Ausbildungsfaches Immunologie im Bereich medizinischer Fakultäten, ist diese Aktivität für das von der DGfI vertretene Fach von höchster Bedeutung. Gründung der DGfI-Schulen Der Vorstand der DGfI blieb bei seinen Ausbildungskonzepten nicht bei den Weiterbildungsmaßnahmen stehen, denn mit neuen Bachelor- und Masterstudiengängen, die im Zuge des Bologna-Prozesses an den Universitäten eingeführt wurden, stellte sich das Thema»immunologische Ausbildung«mit neuer Dringlichkeit. Barbara Bröker (Greifswald) präsentierte daher bereits im Herbst 2005 dem Vorstand der Gesellschaft ein von ihr ausgearbeitetes Curriculum»Immunologie für Naturwissenschaftler«, das als Leitlinie für die Bachelor- und Masterstudiengänge dienen konnte. 180 Im Jahr darauf wurde vom Vorstand der Gesellschaft die Einrichtung eines»aus- und Weiterbildungsausschusses (Educational Committee)«beschlossen. 181 Dieses Gremium sollte zunächst sämtliche Bachelor-, Master- und Promotions-Studiengänge zur Immunologie in Deutschland erfassen, um dann gezielt Programme für Promotions-Studiengänge und Graduiertenschulen zu entwickeln.»spring School on Immunology«, Gründung der 1. DGfI Immunologie-Schule Die Idee, eine DGfI-interne Immunologie-Schule zu gründen, entstand aus wiederholten Klagen der Veranstalter der damals noch existenten Frühjahrstagungen über die sehr schlechten Besucherzahlen, weshalb bei der Jahrestagung 2003 in Berlin beschlossen 180 Beschlussprotokoll Klausur-Tagung von Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Immunologie am Dienstag, den , Queens Hotel, Hannover, S Ebd. Gründungsmitglieder der Spring School on Immunology. Von links nach rechts: F. Melchers (Berlin), A. Radbruch (Berlin), M. Lohoff (Marburg), B. Bröker (Greifswald), R. Jack (Greifswald), Ottmar Janßen (Kiel), T. Durez (Berlin) und B. Happel (Marburg) wurde, diese Tagungen einzustellen. 182 Da diese aber den Anspruch hatten, eine Plattform für junge Immunologen zu bieten, überlegten sich Michael Lohhoff (Marburg) und Andreas Radbruch (Berlin), die Frühjahrtagung durch eine Frühjahrsschule in kleinerem Rahmen zu ersetzen, mit dem Ziel, einer kleineren Gruppe von jungen Wissenschaftlern auf jährlicher Basis die Gelegenheit zu geben, sich im Fach Immunologie weiterzubilden. 183 Diese Idee wurde von Michael Lohoff in der Mitgliederversammlung als Antwort auf das Verkünden der Einstellung der Frühjahrstagung vorgeschlagen und er erhielt darauf vom damaligen Präsidenten, Stefan H. E. Kaufmann (Berlin) den Auftrag, zusammen mit Andreas Radbruch ein Konzept für eine derartige Schule zu erarbeiten. Nach vielen Sitzungen und der Bildung eines Organisationsteams wurde ein Konzept präsentiert, 182 Hierzu und zum Folgenden: Mitteilung von Michael Lohoff, Persönliche Mitteilung an die Autoren von H.M. Jäck, M. Lohoff und A. Radbruch, Juni DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 295
155 das in der Vorstands- und Beiratssitzung im Oktober 2004 bestätigt wurde 184. Am 28. Februar 2005 war es dann soweit: Die 1. Spring School on Immunology fand unter der Federführung von Michael Lohoff und Andreas Radbruch und der tatkräftigen Unterstützung des Organisationsteams, bestehend aus Barbara Bröker (Greifswald), Ottmar Janßen (Kiel), Hendrik Schulze-Koops (München) und Fritz Melchers (Berlin) sowie Tanja Durez, Christine Raulfs (beide Berlin) und Bettina Happel (Marburg) im Kloster Ettal, einem malerischen, abgeschiedenen Ort am Rande der bayerischen Alpen, mit 54 Studenten und Doktoranden und 22 nationalen und internationalen Gastrednern statt. In diesem Rahmen präsentierten die Vortragenden, alles ausgewiesene Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet, ihre Forschungsergebnisse, und die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, ihre Promotionsprojekte mit den Experten in sehr lebendigen Poster-Abenden in kleinem Rahmen zu diskutieren. Plakate der drei Schulen Die 2. DGfI Schule Autumn School»Current Concepts of Immunology«Enthusiastische Rückmeldungen aller Teilnehmer der ersten Spring Schools zeigten den großen Erfolg und die Akzeptanz dieser Idee. Allerdings überstieg die Zahl der Bewerbungen bei weitem die maximale Anzahl an Plätzen, und die»schüler«hatten doch ein sehr unterschiedliches Niveau hinsichtlich ihrer Immunologie-Kenntnisse. Auf Initiative des damaligen Präsidenten-elect Andreas Radbruch 185 wurde deshalb in der Vorstands- und Beiratssitzung im Frühling 2007 eine Kommission unter Vorsitz von Barbara Bröker (Greifswald) gebildet, mit der Aufgabe, ein Konzept für weitere Schulen zu erarbeiten. In zwei Sitzungen im Oktober 2007 und im Frühling 2008 wurden entsprechende Ideen für zwei weitere Schulen finalisiert, eine für Anfänger (die spätere Autumn School»Current Concepts in Immunology«) und eine für schon etablierte Immunologen mit klinischer Ausrichtung (die spätere Translational Immunology School). Hans-Martin Jäck (Erlangen) wurde dann von der Kommission gebeten, ein Organisationkomitee (OK) aus jungen und erfahreneren Immunologen zu bilden, ein entsprechendes Konzept für die»anfängerschule«zu erarbeiten und einen Tagungsort in den neuen Bundesländern zu suchen. In der Vorstands- und Beiratssitzung im Mai 2008 wurde zudem eine einmalige Anschubfinanzierung für beide neue Schulen in Höhe von Euro genehmigt. Ein vom OK der Autumn School, bestehend aus Hans-Martin Jäck (Erlangen), Sandra-Beer Hammer (Tübingen), Ria Baumgrass (Berlin), Joachim R. Kalden (Erlangen), Hermann Wagner (München) und Jürgen Wienands (Göttingen) sowie Elisabeth Lang (Erlangen) und Bettina Happel (Marburg), erarbeitetes Konzept wurde vom Vorstand & Beirat 2008 auf der gemeinsamen Jahrestagung mit der österreichischen ÖGAI in Wien genehmigt. Am 4. Oktober 2009 eröffnete Hans-Martin Jäck die 5-tägige 1. Autumn School»Current Concepts in Immunology«im malerischen Kurort Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz mit 25 Dozenten und 64»Schülern«. Im Gegensatz zur Spring School hatten die meisten»schüler«(doktoranden) der Autumn School keine großen immunologischen Vorkenntnisse. Folglich präsentierten die Dozenten die Konzepte der Immunologie und beschränkten sich auf 1 2 Dias mit eigenen Forschungsdaten. Komplementiert wurde die Schule durch interaktive Veranstaltungen ähnlich denen der Spring School (Poster-Präsentationen, Meet-the-speaker sessions, Small group Questions & Answer sessions). 184 Vorstands- und Beiratssitzung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie 2/2004, Maastricht, den , Protokoll, S Beschlussprotokoll Klausur-Tagung von Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Immunologie am Dienstag, den , Queens Hotel, Hannover, S DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 297
156 Die 3. Schule Translational Immunology School (TIS) Unter der Schirmherrschaft der EFIS hatte Reinhold E. Schmidt (Hannover) zusammen mit Catherine Sautès-Fridman (Paris) bereits eine Veranstaltung mit klinischem Fokus in Paris organisiert. Andreas Radbruch war der Meinung, dass zur Vervollständigung eines kompletten Weiter- und Fortbildungspakets den Mitgliedern der DGfI auch eine Translationale Schule mit mehr klinischer Fokussierung angeboten werden sollte. So überzeugte er Reinhold E. Schmidt während einer Busfahrt von einem Kongress in Nizza (Frankreich) zurück nach München, als dritte Ausbildungskomponente eine»translational Immunology School«zu organisieren. Mit Hilfe der tatkräftigen Unterstützung seines Organisationsteams, bestehend aus Jan Buer (Essen), Dirk Jäger (Heidelberg), Dieter Kabelitz (Kiel), Thomas Kamradt (Jena), Stefan Meuer (Heidelberg), Hans-Hartmut Peter (Freiburg) und Birgit Sawitzki (Berlin) sowie Ulrike Meltzer (Berlin), Elvira Schürmann und Sabine Maaß (beide Hannover) eröffnete Reinhold E. Schmidt am 22. März 2012 im Resort Schwielowsee bei Potsdam die 1. Translational Immunology School (TIS). Eröffnung des ECI 2009 in Berlin durch den Kongresspräsidenten R. Schmidt (Hannover) Der 2. European Congress of Immunology (ECI) 2009 in Berlin Seit 1975 wurden EFIS-Kongresse durch ausgewählte europäische Fachgesellschaften an wechselnden Orten in Europa durchgeführt. Im gleichen Jahr fanden allerdings auch die nationalen Tagungen statt. Während des EFIS-Kongresses 2000 in Poznań (Polen) kam dann vor allem auf Initiative von Reinhold E. Schmidt (Hannover) und Richard Kroczek (Berlin), die Frage auf, ob die EFIS-Tagungen zusätzlich zu nationalen Veranstaltungen noch der realen Situation in Europa entsprach. Einerseits referierten hervorragende europäische Wissenschaftler, andererseits nahmen jedoch nur wenige und meist auch nur lokale Postdocs und Studenten am Kongress teil. Vor diesem Hintergrund wurde von Reinhold E. Schmidt die Idee eines European Congress of Immunology (ECI) geboren. Im Unterschied zu den bisherigen EFIS-Tagungen sollte dieser alle drei Jahre stattfinden, und die nationalen Gesellschaften sollten im jeweiligen Jahr auf ihre Jahrestagungen verzichten. Trotz einiger starker Gegenstimmen gelang es Reinhold E. Schmidt, die Deutsche Gesellschaft für Immunologie davon zu überzeugen, die Idee auch im EFIS- Board durchzusetzen. Schließlich konnte er Catherine Sautès-Fridman (Paris), die den nächsten EFIS-Kongress in alter Form bereits geplant hatte, für diese Idee gewinnen. Mit Ausnahme der British Society for Immunology (BSI) schlossen sich fast alle nationalen Gesellschaften diesem Konzept an und entschieden, dass der jeweilige nationale Kongress aller drei Jahre durch den gemeinsamen European Congress of Immunology (ECI) ersetzt werden sollte. Mit komplexen rechtlichen Formen wurde schließlich der ECI geboren und erstmals im Jahr 2006 in Paris durchgeführt. Der überragende Erfolg dieses Kongresses ebnete den Weg zu dem zweiten ECI 2009 in Berlin. Dieser erforderte eine umfangreiche sechsjährige Planungs- und eine höchst intensive dreijährige Vorbereitungsphase und verlangte die Mithilfe vieler Mitglieder unserer Gesellschaft. Unter der Tagungs-Präsidentschaft von Reinhold E. Schmidt, der EFIS-Präsidentschaft von Stefan H. E. Kaufmann und der Ehrenpräsidentschaft von Fritz Melchers konnte dieser erste»echte«eci in der Zeit vom 13. bis 16. September 2009 in Berlin unter dem Motto»Immunity for Life, Immunology for Health«mit hervorragenden Kritiken umgesetzt werden. Andreas Radbruch (Berlin) als Vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees hatte ein exzellentes und bezüglich der EFIS-Mitglieder ausgewogenes wissenschaftliches Programm zusammengestellt. EFIS vergab für diesen Kongress mehr als 300 Stipendien, insbesondere an Osteuropäer, Afrikaner und Südamerikaner sowie Iraner. An dem Berliner ECI-Kongress nahmen mehr außereuropäische Immunologen teil als an den bisher durchgeführten EFIS/ECI-Kongressen. Während der Veranstaltung wurden auch erstmals der Ita Askonas-Preis an Fiona Powrie (Oxford, UK) und der EFIS Schering- 298 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 299
157 Weitere Forschungspreise Einband der Broschüre»The Birth of Immunology«und die dazu gehörende Ausstellung im Rahmen des ECI 2009 in Berlin Plough-Prize an Michael Reth (Freiburg) verliehen. Der Eröffnungsvortrag wurde vom Nobelpreisträger Harald zur Hausen (Heidelberg) gehalten. Ein weiteres besonderes Highlight war der Auftritt der Berlin Comedian Harmonists im Rahmenprogramm Teilnehmer mit über eingesandten Abstracts weltweit erfreuten sich auf diesem größten ECI-Kongress der bisherigen Geschichte neben dem exzellenten wissenschaftlichen Program und einer Ausstellung»Birth of Immunology«über die Anfänge der Immunologie auch an sozialen Aktivitäten. Insbesondere die Kongress-Party bei Spindler & Klatt oder auch das großartige Speakers Dinner in der Deutschen Zentralbank, direkt am Pariser Platz am Brandenburger Tor, blieben dabei unvergesslich. Der Kongress verschaffte der Deutschen Gesellschaft für Immunologie erneut eine hohe Anerkennung in der europäischen Immunologie-Szene, zumal viele der älteren Teilnehmer den internationalen Immunologie-Kongress im Jahre 1989 noch in der geteilten Stadt erlebt hatten. Mit diesen zahlreichen Aktivitäten und Initiativen ihrer Mitglieder von Jahrestagungen und Schulen über Arbeitskreistreffen bis hin zum wissenschaftlichen Austausch mit thematisch nahen Fachgesellschaften im In- und Ausland verschaffte sich die DGfI über die Jahre hinweg international ein hohes wissenschaftliches Renommee. In den kommenden Jahren kamen zum Avery-Landsteiner-Preis und dem Otto Westphal-Promotionspreis weitere, von verschiedenen Privatpersonen und Unternehmen gestiftete und finanzierte Forschungspreise hinzu. So stellt die Hans-Hench-Stiftung zur Förderung der Rheumatologie e.v. aus Freiburg im Breisgau seit 2001 das Preisgeld für den Hans-Hench-Promotionspreis für Klinische Immunologie zur Verfügung. Mit ihm wird alljährlich die beste in Deutschland durchgeführte Dissertation auf dem Gebiet der Rheumatologie Schwerpunkt Entzündungsforschung, Autoimmunität und Immundefizienz vergeben. 186 Der Fritz-und-Ursula-Melchers-Postdoktorandenpreis wurde von den beiden Namensgebern 2004 gestiftet, die ihn bis heute finanzieren. 187 Als Gründungs- und Ehrenmitglied der DGfI unterstützt Fritz Melchers zusammen mit seiner Frau damit alljährlich»bis zu 35 Jahre alte Postdoktorandinnen und Postdoktoranden für ihre bisher geleisteten Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie«. 188 Die Rosa Laura und Hartmut-Wekerle-Stiftung in Planegg bei München steuert seit 2013 den jährlich vergebenen Herbert-Fischer-Preis für Neuroimmunologie bei. 189 Der Preis erinnert an den ehemaligen Direktor ( ) des Max-Planck-Institutes für Immunbiologie in Freiburg und wird an bis zu 35 Jahre alte Doktorandinnen oder Doktoranden verliehen, die in Deutschland richtungsweisende Arbeiten auf dem Gebiet der Neuroimmunologie durchgeführt haben. Der Georges-Köhler-Preis, 190 den die DGfI alljährlich an Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler bis zum Alter von 40 Jahren verleiht, erinnert an eines der bekanntesten Mitglieder der Gesellschaft den bereits 1995 mit nur 49 Jahren verstorbenen Biologen und Immunologen Georges J. F. Köhler, der 1984 zusammen mit César Milstein und Niels K. Jerne den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt. Grundvoraussetzung für die Auszeichnung sind Arbeiten, die»zum besseren Verständnis des Immunsystems herausragend beigetragen oder daraus resultierende Anwendungen geschaffen haben«. Der Preis wird seit 1998 verliehen und von der Dr.-Ing. h.c. Ferdinand Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen, gesponsert. 186 Dazu: Dazu: Ebd. Dort auch das Folgende. 189 Dazu und zum Folgenden: Dazu und zum Folgenden: DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 301
158 Professionalisierung der Sichtbarkeit und Mitgliederbetreuung Die zahlreichen, weit gestreuten Aktivitäten und ein gut sichtbares Gesellschafts-Logo erweckten die Aufmerksamkeit der DGfI in Fachkreisen. Der DGfI war es aber auch wichtig, die Bedeutung der Immunologie für die Behandlung und Diagnose vieler Krankheiten von der Infektion, über Krebserkrankungen bis zu chronischen Entzündungen der breiten Bevölkerung und politischen Entscheidungsträgern zu vermitteln. Einen ersten Schritt dazu erkannte der Vorstand der Gesellschaft in einer Professionalisierung seiner Verwaltung mit einer eigenen Geschäftsstelle. Waren die Verwaltungsvorgänge zunächst von den Sekretariaten der jeweiligen Präsidenten und Sekretäre der Gesellschaft mitbetreut worden, 191 wurden sie im Mai 2000 versuchsweise in einer»externen«geschäftsstelle zentralisiert. 192 Das Unternehmen Service Systems in Dreieich bei Frankfurt, das bis dato die DGfI-Tagungen organisiert hatte, übernahm nun auch den arbeitsintensiven Teil der Geschäftsführung: 193 Zwei Bürokräfte arbeiteten dort dem jeweiligen Sekretär der Gesellschaft zu und bereiteten die Artikel für das Informationsorgan der Gesellschaft, die»immunologischen Nachrichten (IN) «vor. Über die Einrichtung einer eigenen Geschäftsstelle wurde erstmals auf der Vorstands- und Beiratssitzung im Dezember 2004 beraten. 194 Im Idealfall sollte die Geschäftsstelle mit einer Person besetzt werden. Diese sollte»im Auftrag und nach Absprache mit dem jeweiligen Präsidenten und Generalsekretär insbesondere die Verwaltung der Mitglieder, die Interessenvertretung bei Wissenschaftsförderorganisationen, der Politik, für die Pressearbeit mit den Immunologischen Nachrichten (IN) und auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ausschüssen der DGfI sowie den Corporate-Mitgliedern und die Zusammenarbeit mit der Industrie organisieren«. 195 Es dauerte aber bis zum Frühjahr 2007, bis die Geschäftsstelle der DGfI in den Räumen des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie eingerichtet wurde zog sie im gleichen Gebäudekomplex in das Deutsche Rheumaforschungszentrum (DRFZ) um, wo sie heute mit der großzügigen Unterstützung des DRFZ noch immer untergebracht ist. Wie vom damaligen 191 Interview von F. Neumann mit R. E. Schmidt, Hannover, den Fritz Seiler: Vorwort, in: Immunologische Nachrichten / Immunological News, Nr. 219, 2/2001, S Immunologische Nachrichten, 2/2000, S Vorstands- und Beiratssitzung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Berlin, den , Protokoll, S Vorstands- und Beiratssitzung, Hannover, den , Protokoll, S Protokoll der Vorstands- und Beiratssitzung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Berlin, , S. 1 f. Entwicklung des DGfI Logos von der Gründung bis zur Gegenwart Das erste Logo (links) wurde von Herbert Jungfer (Heidelberg) entworfen und im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Präsi denten der DGfI, Stefan Meuer (Heidelberg) vorgesehen, 197 unterstützen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle seitdem die Profilstärkung mit verstärkter Sichtbarkeit nach innen (Mitglieder, andere Fachgesellschaften) und außen (Firmen, Zuwendungsgeber, Politik)«, kümmern sich um die Mitglieder- und Finanzverwaltung, organisieren die Öffentlichkeitsarbeit und besorgen die redaktionellen Arbeiten für die Broschüren und Publikationen der DGfI. Eine der ersten waren Rundschreiben, die nur Angaben zu Stellenausschreibungen und Kongresshinweisen enthielten. Das erste Mitteilungsorgan, die Immunologischen Nachrichten (IN), wurde auf Initiative des damaligen Generalsekretärs Fritz Seiler ( ) erstellt 198 und erschien anfangs mehrmals pro Jahr mit Nachrichten über verschiedenen Aktivtäten der Gesellschaft. Aufgrund der gestiegenen Druck- und Versandkosten gab es in den letzten Jahren aber nur noch eine Ausgabe pro Jahr. Die Idee eines mehrmals im Jahr erscheinenden Journals nicht nur mit Nachrichten aus der Gesellschaft sondern auch mit Fachartikeln über aktuelle und historische Ereignisse auf dem Gebiet der Immunologie wurde weiterhin diskutiert, mit dem Ergebnis, dass sich auf Initiative von Gunther Hartmann (Bonn) und Hans-Martin Jäck (Erlangen) der Vorstand und Beirat der DGfI in seiner Sitzung im Frühling 2017 entschied, ein neues Gesellschafts-Journal mit dem medizinischen Fachverlag Trillium in München zu starten. Die erste Auflage soll im Rahmen des 50. Geburtstags der Gesellschaft in Erlangen präsentiert werden. 197 Protokoll der Vorstands- und Beiratssitzung 1/2007 der Deutschen Gesellschaft für Immunologie in Berlin, , S. 1 f. 198 Fritz Seiler, Vorwort, Immunologische Nachrichten Nr. 6, Archiv der DGfI, Berlin. 302 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 303
159 Öffentlichkeitsarbeit»Immunologie für Jedermann«2010 startete die Deutsche Gesellschaft für Immunologie, auf Anregung und unter der Federführung des damaligen Präsident-elect, Hans-Martin Jäck (Erlangen), die Initiative»Immunologie für Jedermann«. Diese hat zum Ziel, die breite Bevölkerung, politische Entscheidungsträger, Studenten, Schüler und Lehrer sowie Fachkollegen aus der Forschung und Klinik über aktuelle Themen aus der Immunologie aufzuklären. Schwerpunktthemen sollten dabei vorerst die Vermittlung der Notwendigkeit von Schutzimpfungen für die Volksgesundheit und die Bedeutung von Tiermodellen in der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente darstellen. Zur Realisierung dieser Idee konnte Hans-Martin Jäck eine großzügige Spende einer privaten Stiftung im fünfstelligen Bereich, überwiegend für die Einrichtung einer neuen Webplattform (www. das-immunsystem.de) und für die Schaffung einer Koordinationsstelle einholen. Heute stellt die Webplattform»Immunologie für Jedermann«Informationen zur populärwissenschaftlichen Sensibilisierung von Kindern für das Immunsystem, über universitäre und außeruniversitäre Ausbildungsprogramme und immunologische Forschungseinrichtungen bis hin zu Informationen für Patienten zur Verfügung. Im Rampenlicht: DGfI-Mitglieder und Preisträger In diesem Kapitel wollen wir alle DGfI-Präsidenten (bis 2005 GFI-Präsidenten) und Generalsekretäre, Ehrenmitglieder, Träger der DGfI-Ehrenmedaille und alle Kollegen, die einen unserer Preise erhalten haben, würdigen. Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ( ) (bis 2005 Gesellschaft für Immunologie) Logo der Initiative Immunologie für Jedermann Prof. Dr. rer. nat. Otto Westphal eh. Direktor am Max-Planck- Institut für Immunbiologie Freiburg Prof. em. Dr. med. Klaus Rother eh. Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Heidelberg Prof. em. Dr. med., Dr. h.c. mult. Joachim R. Kalden eh. Direktor der Medizinischen Klinik III am Universitätsklinikum Erlangen Prof. Dr. med., PhD., Dr. h.c. mult. Hermann Wagner eh. Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene an der TU München Prof. Dr. rer. nat. Fritz Melchers eh. Direktor des Basel Institute of Immunology Prof. em. Dr. med. Martin Röllinghoff eh. Leiter des Instituts für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene an der Universität Erlangen 304 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 305
160 Prof. Dr. rer. nat. Günter J. Hämmerling Prof. em. Dr. med. Christine Schütt Prof. em. Dr. med. Hans- Hartmut Peter Prof. Dr. rer. nat. Andreas Radbruch Prof. Dr. med. Dieter Kabelitz Prof. Dr. rer. nat. Hans-Martin Jäck eh. Leiter der Abteilung für Molekulare Immunologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg eh. Leiterin der Abteilung Immunologie am Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald eh. Ärztlicher Direktor der Abteilung Rheumatologie und Klinische Immunologie und des Centrums für Chronische Immundefizienz am Universitätsklinikum Freiburg Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums (DRFZ) Berlin Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel Leiter der Abteilung für Molekulare Immunologie am Universitätsklinikum Erlangen Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan H. E. Kaufmann Prof. Dr. med. Reinhold E. Schmidt Prof. Dr. med. Stefan Meuer Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Wienands Prof. Dr. med. Michael Lohoff Prof. Dr. med. Thomas Kamradt Leiter der Abteilung Immunologie und Direktor am Max-Planck- Institut für Infektionsbiologie Berlin Direktor der Klinik für Immunologie und Rheumatologie an der Medizinischen Hochschule Hannover Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Heidelberg Direktor des Instituts für Zelluläre und Molekulare Immunologie der Universitätsmedizin Göttingen Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, Universität Marburg Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Jena 306 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 307
161 Präsidenten der Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Immunologie der ehemaligen DDR ( ) Generalsekretäre der DGfI ( ) Prof. Dr. Dieter Gotthold Roland Findeisen an der eh. Pädagogischen Hochschule Potsdam Prof. Dr. Hellmuth Kleinsorge eh. Direktor der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Jena Prof. Dr. Heinz-Egon Kleine-Natrop eh. Direktor der Hautklinik an der Medizinischen Akademie Dresden Prof. Dr. phil. Dr. med. h.c. H. Gerhard Schwick eh. Leiter der Forschung und Vorstand der Behringwerke Marburg Prof. em. Dr. med. Holger Kirchner eh. Direktor des Instituts für Immunologie und Transfusionsmedizin an der Universität zu Lübeck Dr. rer. nat. Fritz Seiler eh. Forschungsleiter der Behringwerke, Marburg / / Prof. em. Dr. med. Lothar Jäger Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. med. h.c. Herwart Ambrosius Prof. Dr. Helmut Friemel Prof. Dr. med. Werner Solbach Prof. Dr. rer. nat. Carsten Watzl eh. Direktor des Instituts für Klinische Immunologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena eh. Professor für Tierphysiologie und Immunbiologie an der Universität Leipzig eh. Direktor des Instituts für Immunologie an der Universität Rostock eh. Direktor des Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität zu Lübeck Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz- Institut für Arbeitsforschung IfADo Dortmund 308 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 309
162 Generalsekretäre der Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Immunologie der ehemaligen DDR ( ) Ehrenmitglieder der DGfI 1973 Prof. Dr. Hans Schmidt Prof. Dr. Michael Heidelberger 1991 Prof. Dr. Otto Westphal Prof. Dr. Paul Kallós 1988 Prof. Dr. Paul Klein Prof. Dr. Herwart Ambrosius 2001 Prof. Dr. Fritz Melchers Prof. Dr. Gert Riethmüller 2002 Prof. Dr. Klaus Eichmann Prof. Dr. Joachim R. Kalden Prof. em. Dr. med. Lothar Jäger eh. Direktor des Instituts für Klinische Immunologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Träger der Ehrenmedaille der DGfI Dr. med. Wolfgang Schneider eh. Oberarzt am Institut für Pathologie an der der Charité, Berlin Dr. med. Jürgen Kaden eh. Leiter der Labore der Vivantes Kliniken im Friedrichshain und Am Urban, Berlin 1991 Prof. Dr. Michael Sela 1993 Prof. Dr. Hans Gerhard Schwick Prof. Dr. Klaus Rother Prof. Dr. Brigitta A. Askonas Prof. Dr. Walter H. Hitzig 2012 Sir Gustav Nossal, MD, Ph.D Dr. Friedrich R. Seiler Prof. Dr. Walter Knapp Prof. Dr. Martin Röllinghoff Prof. Dr. Takehiko Sasazuki Prof. Dr. Hermann Wagner 2007 Prof. Dr. Foo Yoo Liew 2002 Prof. Dr. Diethard Gemsa, Dr. Kay Grossmann 2005 Prof. Dr. Holger Kirchner 2007 Gabriele Gründl 2008 Prof. Dr. Michael Seyfarth 2012 Prof. Dr. Werner Solbach 1996 Prof. Dr. Nicholas Avrion Mitchison Prof. Dr. Hans J. Müller-Eberhard Prof. Dr. Eberhard Wecker Prof. Dr. Rolf Zinkernagel Prof. Dr. Alain de Weck Prof. Dr. Jacques. F. A. P. Miller Prof. Dr. Stuart F. Schlossman 2008 Prof. Dr. Stefan H. E. Kaufmann 2009 Prof. Dr. Michel D. Kazatchkine 2011 Prof. Dr. Hans-Hartmut Peter 2012 Prof. Dr. Andreas Radbruch Ehrenmedaille der DGfI, nach einem Entwurf des berühmten Berliner Medailleurs Wilfried Fitzenreiter. 310 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 311
163 DGfI-Preisträger Preisträger des von der DGfI verliehenen Avery-Landsteiner-Preises Avery-Landsteiner-Preis (bis 2014) Der Avery-Landsteiner-Preis wurde von 1973 bis 2014 für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Immunologie mit Unterstützung der Behringwerke AG, Marburg bzw. der CSL Behring GmbH verliehen. Bisherige Preisträger 1973 Walther F. Goebel Rockefeller University, NY (USA) Jaques Oudin Institut Pasteur, Paris (Frankreich) 1975 Henry G. Kunkel Rockefeller University, NY (USA) 1977 Klaus Rajewsky, Institut für Genetik der Universität Köln (Deutschland) 1979 César Milstein, Medical Research Council, Cambridge (Großbritannien) 1981 Susumo Tonegawa, Basel Institute for Immunology, Basel (Schweiz) 1983 Ion Gresser, Institute de Recherche Scientifique sur le Cancer, Villejuif (Frankreich) 1985 Peter Perlmann University of Stockholm (Schweden) 1987 Joe Oppenheim NIH Washington (USA) 1990 Harald von Boehmer, Basel Institute for Immunology, Basel (Schweiz) 1992 Hans Georg Rammensee, MPI für Biologie, Tübingen (Deutschland) 1994 Tim Mosmann University of Alberta, Edmonton (Canada) 1996 Tadamitsu Kishimoto University of Osaka (Japan) 1998 Peter Krammer, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Deutschland) 2000 Hidde Ploegh, Harvard Medical School, Boston (USA) 2002 Charles A. Janeway, Yale University School of Medicine, New Haven (USA) 2004 Klas Kärre, Karolinska Institutet, Stockholm (Schweden) 2006 Philippa Marrack, University of Colorado in Denver, Colorado (USA) 2008 Max Cooper, University of Alabama at Birmingham (USA) 2010 Shizuo Akira, WPI Immunology Frontier Research Center, Osaka University (Japan) 2012 Alain Fischer, Unité d Immunologie et d Hématologie Pédiatriques, INSERM, und University Hôpital Necker- Enfants Malades Paris (Frankreich) 2014 Andreas Radbruch, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (Deutschland) 312 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 313
164 Deutscher Immunologie-Preis (ab 2016) Der Deutsche Immunologie-Preis ist die höchste wissenschaftliche Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie e.v. Er wurde 2016 zum ersten Mal verliehen und ist mit , EUR dotiert. Geehrt wird eine international angesehene Persönlichkeit, die mit herausragenden Forschungsleistungen zur Aufklärung immunologischer Grundprinzipien und/oder Translation der Grundlagenforschung in die klinische Anwendung beigetragen hat. Der Deutsche Immunologie-Preis wird durch die großzügige Unterstützung der Celgene GmbH ermöglicht und im zweijährigen Turnus vergeben. Bisheriger Preisträger 2016 Hans-Reimer Rodewald (Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg) Für seine herausragende wissenschaftliche Lebensleistung zur Erforschung der Organogenese und Immunologie des Thymus sowie zur Differenzierung hämatopoietischer Zelltypen. DGfI-Nachwuchspreise Otto-Westphal-Promotionspreis Preis der DGfI für die beste Dissertation 1976 Michael Schneider, Göttingen 1977 Annegret Starzinski-Powitz, Mainz Otto-Westphal-Promotionspreis 1978 Stefan Becker, Mainz 1980 Bernhard Liesegang, Köln / Andreas Radbruch, Köln 1982 Anton Rolink, Basel 1984 Marianne Brüggemann, Köln 1986 Robert Strohal, Innsbruck 1989 Ulrich Pessara, Heidelberg 1991 Ulrich E. Schaible, Pforzheim 1993 Kirsten Falk, Tübingen / Harald Kropshofer, Heidelberg /Ralf Kühn, Köln / Olaf Rötzschke, Tübingen 1995 Daniel Graf, London 1997 Mario Assenmacher, Köln 1998 Christina Berndt, Heidelberg 1999 Andreas Hutloff, Berlin 2000 Max Löhning, Berlin 2001 A. K. Nussbaum, La Jolla (USA) / M. Kraus, Boston (USA) 2002 Karsten Fischer, Berlin 2003 Melanie Laschinger, Bad Nauheim 2004 Markus Feuerer, Berlin 2005 Jan C. Dudda, Freiburg/Seattle (USA) 2006 Niklas Feldhahn, Düsseldorf 2007 Tim Worbs, Hannover 2008 Marcus Lettau, Kiel 2009 Michaela Gack, Boston (USA) 2010 Tim Lämmermann, NIH, NIAID, Bethesda (USA) 2011 Swantje Hammerschmidt, Hannover 2012 Lesly Calderón Dominguez, Freiburg 2013 Elina Kiss, Freiburg 2014 Eva Bär, Zürich, Schweiz 2015 Alexander Ulges, Mainz 2016 Veit Buchholz, München Hans-Hench-Promotionspreis für Klinische Immunologie 2001 Tanja Heller, Hannover 2002 Alla Skapenko, Erlangen 2003 Stephanie Krützmann, Freiburg 2004 Julia Skokowa, Hannover 2005 Anne Schaefer, Berlin/New York (USA) 2006 Stefan Heinen, Jena 2007 Georg Bohn, Hannover 2008 Richard Taubert, Heidelberg/Hannover 2009 Kirsten Neubert, Erlangen 2010 Kai Kessenbrock, University of California (USA) 2011 Henrik Mei, Berlin 2012 Lucas Kimmig, Philadelphia (USA) 2013 Paula Romer Roche, Würzburg 2014 Fabian Hauck, München 2015 Inessa Schwab, Erlangen 2016 Katharina Gerlach, Erlangen Herbert-Fischer-Preis für Neuroimmunologie 2013 Katrin Kierdorf, Freiburg 2014 Johannes vom Berg, Zürich (Schweiz) 2015 Tilman Schneider-Hohendorf, Münster 2016 Julia Bruttger, Mainz 314 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN 315
165 Fritz-und-Ursula-Melchers-Postdoktorandenpreis 2004 Markus Müschen, Düsseldorf 2005 Christina Nassenstein, Hannover 2006 Jochen Mattner, Erlangen/Chicago (USA) 2007 Max Warnke, Freiburg 2008 Petra Langerak, Amsterdam (Niederlande) 2009 Bastian Opitz, Berlin 2010 Tobias Bopp, Mainz 2011 Daniel Engel, Bonn 2012 Van Trung Chu, Berlin 2013 Vera C. Martins, Ulm 2014 Christian T. Mayer, New York (USA) 2015 Katrin Busch, Heidelberg 2016 Martin Väth, New York (USA) Georges-Köhler-Preis 1998 Ralf Küppers, Köln 1999 Christian Bogdan, Erlangen 2000 Hans-Jörg Schild, Tübingen 2001 Matthias von Herrath, La Jolla (USA) 2002 Anne B. Vogt und Harald Kropshofer, Basel (Schweiz) 2003 Michael P. Schön, Magdeburg 2004 Hassan Jumaa, Freiburg 2005 Özlem Türeci und Ugur Sahin, Mainz 2006 Ruth Ganss, Perth (Australien) und Bodo Grimbacher, Freiburg 2007 Stefan Feske, Boston (USA) 2008 Sven Burgdorf, Bonn und Diana Dudziak, Erlangen 2009 Adelheid Cerwenka, Heidelberg 2010 Max Löhning, Berlin 2011 Marcel F. Nold, Melbourne (Australien) 2012 Daniel Pinschewer, Genf (Schweiz) 2013 Gerhard Krönke, Erlangen 2014 Markus Feuerer, Heidelberg 2015 Dietmar Zehn, Lausanne (Schweiz) 2016 Andreas Bergthaler, Wien (Österreich) 316 DIE GRÜNDUNG DER IMMUNOLO GISCHEN FACHGESELLSCH A F TEN
166 III. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie heute Agnes Giniewski Ulrike Meltzer Ottmar Janßen Carsten Watzl
167 Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie heute 1 Seit ihrer Gründung im Jahre 1967 ist die Deutsche Gesellschaft für Immunologie stetig gewachsen, nicht nur im Hinblick auf die Anzahl der Mitglieder, sondern auch in ihren Aktivitäten zur Unterstützung der Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses und in ihrer Sichtbarkeit in der nationalen und internationalen Wissenschaftslandschaft. Die DGfI bleibt seit ihrer Gründung drei zentralen Hauptanliegen treu: (1) die Förderung der immunologischen Forschung auf nationaler und internationaler Ebene, (2) die Unterstützung des naturwissenschaftlichen und medizinischen Nachwuchses in Forschung und Weiterbildung und (3) die Verbesserung der Sichtbarkeit des Faches Immunologie in der Bevölkerung, bei politischen Entscheidungsträgern und innerhalb anderer klinisch-orientierter Forschungsdisziplinen. Die Mission der DGfI 1 Wir danken Hans-Martin Jäck (Erlangen), Michael Lohoff (Marburg), Thomas Kamradt (Jena), Jürgen Wienands (Göttingen), Theresa Hoppe (Berlin) und Anja Glanz (Erlangen) für die kritische Durchsicht und die hilfreichen Kommentare. DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 319
168 Mitglieder Übersicht DGfI-Mitglieder findet man weltweit in 28 Ländern und deutschlandweit auf über 200 Städte verteilt (in der Karte sind nur Orte mit mindestens fünf Mitgliedern dargestellt). Organisationsstruktur der DGfI Mit knapp 2400 Mitgliedern ist die DGfI aktuell weltweit die viertgrößte nationale Fachgesellschaft für Immunologie. Die Mitglieder wählen alle zwei Jahre den Generalsekretär und den Präsident-elect, der dann automatisch zwei Jahre nach der Wahl das Amt des Präsidenten übernimmt; die Mitglieder des Beirats werden für vier Jahre gewählt, wobei jedes DGfI-Mitglied entsprechende Kandidaten vorschlagen kann. Die Arbeit von Vorstand und Beirat sowie der diversen Kommissionen wird durch drei Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle in Berlin und in Erlangen unterstützt. 320 DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 321
169 Zusätzlich hat die DGfI auch Firmenmitglieder, die die Gesellschaft teilweise seit vielen Jahren in ihren diversen Aktivitäten unterstützen. editoren Gunther Hartmann (Bonn) und Hans-Martin Jäck (Erlangen) präsentierten die erste Ausgabe als Jubiläumsheft im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Gesellschaft in Erlangen. Forschung und Vernetzung Die gegenwärtige immunologische Forschung in Deutschland ist hervorragend positioniert. So belegte die deutsche Immunologie 2015 unter 163 Ländern in Bezug auf die Anzahl zitierbarer Publikationen Platz 4, kurz hinter Großbritannien, China und den USA. 2 Publikationen von Immunologen aus Deutschland, die in herausragenden Zeitschriften veröffentlicht werden, konzentrieren sich auf angeborene Immunität, T-Zellund B-Zellbiologie, Infektion und Tumorimmunität. Zur Unterstützung der immunologischen Forschung in Deutschland hat die DGfI in den letzten Jahren etliche Aktivitäten entwickelt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Arbeitskreise Firmenmitglieder der DGfI Professionalisierung der Mitglieder-Betreuung Titelblatt der vorerst letzten IN-Ausgabe Neben den Jahrestagungen, den zwei Webseiten (www. dgfi.org und und dem E- Mail-Newsletter waren bisher die Immunologischen Nachrichten (IN) das wichtigste Instrument, um unsere Mitglieder über DGfI-Aktivitäten und Neuigkeiten aus der Forschung und Klinik zu informieren. Zukünftig werden die IN nun durch eine neue Verbandszeitschrift, die die DGfI zusammen mit dem medizinischen Fachverlag Trillium GmbH herausgibt, abgelöst. Das Journal»Trillium Immunologie«soll vierteljährlich erscheinen und neben Nachrichten aus der Gesellschaft auch Fachartikel über aktuelle und historische Ereignisse aus dem Gebiet der Immunologie enthalten. Die Haupt- Die Arbeitskreise (AK) sind ein zentraler Pfeiler zur Unterstützung der immunologischen Forschung. Die zurzeit 13 Arbeitskreise repräsentieren die in Deutschland bearbeiteten immunologischen Forschungsthemen. Sie werden von der Gesellschaft durch einen jährlichen Zuschuss in Höhe von Euro unterstützt und von einem auf drei Jahre gewählten Team aus Sprecher und Stellvertreter geleitet. Die Arbeitskreise bestehen aus 30 bis zu 200 Mitgliedern und treffen sich jährlich meist außerhalb der Jahrestagungen zu einem»ak-retreat«. Diese AK-Treffen werden teilweise auch mit Kollegen aus anderen Arbeitskreisen der DGfI oder aus anderen Fachgesellschaften aus dem In- und Ausland veranstaltet. Im Vordergrund steht nach wie vor ein interdisziplinärer Informationsaustausch, aber auch der Austausch von Reagenzien und Methoden, z. B. über arbeitskreisinterne -Verteiler. Ein Grundprinzip fast aller Arbeitskreise ist, dass neben wenigen eingeladenen Gast- Sprechern das Programm der Arbeitskreistreffen wesentlich von den Mitgliedern der jeweiligen Arbeitskreise gestaltet wird, um ihre Projekte und Daten zu präsentieren und zu diskutieren. Erfreulicherweise haben die zahlreichen Arbeitskreis-Veranstaltungen zu 2 SCJ 2015; only Immunology. 322 DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 323
170 Jahrestagungen Seit der 1. Jahrestagung der Gesellschaft für Immunologie im Oktober 1969 in Freiburg mit knapp über 300 Teilnehmern, ca. 70 eingegangenen Kurzreferaten (Abstracts) und etwa fünfzig 15-minütigen Vorträgen entwickelte sich die Jahrestagung zu einem Kongress mit über Teilnehmern, mit bis zu 650 Abstracts, einer alleinstehenden Plenary Session, 3-4 parallelen Symposien und 25 Workshops mit je 6 8 Präsentationen, die aus den eingereichten Abstracts ausgewählt werden. Die gegenwärtigen DGfI-Arbeitskreise einer enormen Zahl neuer Kooperationen und in bestimmten Bereichen zur Etablierung neuer extern geförderter Forschungsverbünde oder Konsortien geführt. Eine weitere Aufgabe der Arbeitskreise ist die aktive Beteiligung an den Jahrestagungen der Gesellschaft. Die Themen der Arbeitskreise bilden inzwischen das Grundgerüst der angebotenen Workshops und Poster-Sessions und damit die Basis für ein themenspezifisches Networking in der Gesellschaft. Die Arbeitskreise unterstützen die Veranstalter bei der Gestaltung und Ausrichtung der Workshops, indem sie Chairs vorschlagen und sich an der Auswahl der Beiträge beteiligen. Darüber hinaus bieten die lokalen Organisatoren den Arbeitskreisen die Möglichkeit zur Veranstaltung von individuellen oder gemeinsamen Satellitensymposien im Rahmen der Jahrestagungen. Die Anmeldung zu einem oder zu mehreren Arbeitskreisen erfolgt online mit wenigen Klicks über die Webseite der Gesellschaft und ist kostenlos und primär nicht an die DGfI-Mitgliedschaft gebunden. Wir sind aber sicher, dass, wer sich einmal aktiv an einem AK-Treffen beteiligt hat, schnell über eine Mitgliedschaft in der DGfI nachdenken wird. Um die internationale Zusammenarbeit zu fördern, werden diese Tagungen gelegentlich als gemeinsame Treffen mit immunologischen Gesellschaften aus angrenzenden europäischen Ländern (z. B. mit Italien, Österreich, Skandinavien, Polen, den Niederlanden und der Schweiz) organisiert. Um die nationale Vernetzung zu begünstigen, sind der Jahrestagung Satelliten-Symposien und Gastsymposien mit fachnahen Gesellschaften vorgeschaltet. Alle drei Jahre verzichtet die Gesellschaft zu Gunsten des durch EFIS organisierten»european Congress of Immunology«auf eine eigene Jahrestagung. Sämtliche bisher durchgeführten Jahrestagungen sind in Kapitel II aufgelistet. Auf Initiative des damaligen Präsidenten Hans-Martin Jäck ( ) wird seit der Jahrestagung in Mainz 2013 die Eröffnungsveranstaltung durch das»president s Symposium«erweitert. Neben dem Vortrag eines durch den aktuellen Präsidenten der DGfI eingeladenen Keynote Speakers findet im Rahmen dieses Programmpunktes auch die feierliche Preisverleihung der DGfI-Preise statt, bei der alle Preisträger zudem kurz ihre Forschung präsentieren. Da die Gesellschaft großen Wert auf die Förderung ihrer Nachwuchswissenschaftler legt, wurde 2014 in Bonn, ebenfalls eine Initiative von Hans-Martin Jäck, das»young Immunologists Symposium«etabliert, das es fünf bis sechs jungen DGfI-Nachwuchswissenschaftlern ermöglicht, ihre Forschung vor einem großen Publikum vorzustellen. Zu den gesellschaftlichen Veranstaltungen der Jahrestagung zählen eine Reception zum Beginn der Tagung und ein die Jahrestagung abschließender Gesellschaftsabend, der sicher schon für den ein oder anderen unvergesslichen Moment gesorgt hat. Bilaterale Workshops und Gastsymposien Die DGfI unterhält hervorragende Verbindungen zu immunologischen Verbünden auf der ganzen Welt. Zur Förderung dieser Beziehungen richtet die DGfI zusammen mit befreundeten ausländischen Fachgesellschaften bilaterale Workshops aus und beteiligt sich 324 DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 325
171 an der Organisation des alle drei Jahre stattfindenden»international Congress of Immunology«(ICI) der IUIS und des»european Congress of Immunology«(ECI) der EFIS. Zudem werden im Rahmen der Jahrestagungen befreundeter Fachgesellschaften Gastsymposien veranstaltet, für die ausschließlich DGfI-Mitglieder als Sprecher vorgesehen sind. Bilaterale Workshops Dies sind kleine, teilweise thematisch fokussierte Treffen mit ausgewählten Partnergesellschaften. Sie finden meist im zweijährigen Turnus mit dem Ziel statt, in zwangloser Atmosphäre die neuesten Ergebnisse und Trends in der Immunologie in einer überschaubaren Runde zu diskutieren. Die Tagungen mit jeweils ca. 15 deutschen und 15 Teilnehmern aus der entsprechenden ausländischen Fachgesellschaft finden abwechselnd in Deutschland und im Partnerland statt. Die Ausschreibung zur Teilnahme erfolgt offen über den Newsletter der DGfI. Zahlreiche international führende Immunologen, die den aktuellsten Forschungs- und Entwicklungsstand im jeweiligen Bereich aufzeigen, konnten bereits für die Teilnahme an diesen Tagungen gewonnen werden. Das gewählte Format ermöglicht den intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern und bietet beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg. Die Idee der bilateralen Workshops hat ihren Ursprung in den von Fritz Melchers, Martin Röllinghoff und Günter Hämmerling initiierten langjährigen Beziehungen zwischen deutschen und japanischen Immunologen (siehe Kapitel II). Der Vorstand der DGfI beschloss deshalb, alle zwei bis drei Jahre zusammen mit der Japanischen Gesellschaft für Immunologie (JSI) eine bilaterale Tagung zu veranstalten, ein Konzept, das bis heute andauert. Ein weiterer bilateraler Workshop kam 2010 hinzu, als sich auf der Burg Wanzleben bei Magdeburg zum ersten Mal eine Delegation der Chinesischen Gesellschaft für Immunologie (CSI) mit Vertretern der DGfI traf, um Perspektiven für eine konkrete Zusammenarbeit in der Zukunft auszuloten. Die Kooperation wurde von Stefan Meuer (Heidelberg) und Dieter Kabelitz (Kiel) angeregt und auf chinesischer Seite von Xuetao Cao mitorganisiert. Seitdem finden diese bilateralen Workshops in ein- bis zweijährigem Abstand statt. Der erste bilaterale Workshop mit der Italienischen Gesellschaft für Immunologie (SIICA) wurde 2012 von Hans-Martin Jäck und Andreas Radbruch auf deutscher Seite und Massimiliano Pagani und Flavia Bazzoni auf italienischer Seite am Gardasee in Desenzano del Garda mit dem Thema»Non-coding RNA and immunity«organisiert. Auf Initiative von Tim Sparwasser (Hannover) und Adriana Gruppi (Córdoba) fand 2014 das erste, erfolgreiche bilaterale Treffen mit der Argentinischen Gesellschaft für Immunologie (SAI) in Córdoba statt. Der intensive Austausch zwischen diesen Gruppierungen führte zur erfolgreichen Etablierung eines dualen bi-nationalen Masterprogramms»Infection Biology«in Hannover und Córdoba. Übersicht über die gegenwärtigen bilateralen Workshops und Gastsymposien Schließlich folgte 2015 der 1. DGfI ASI Joint Workshop mit der Australischen Gesellschaft für Immunologie (ASI) in Canberra zum Thema»Immunregulation bei Infektionen und immun-vermittelten Erkrankungen«. Dieser Workshop wurde auf deutscher Seite von Christian Kurts (Bonn) und auf australischer Seite von Dale Goodfrey (Melbourne) organisiert und von den DGfI-Mitgliedern Sammy Bedoui (Melbourne), Anselm Enders (Canberra) und Susanne Heinzel (Parkville) unterstützt. 3 Gastsymposien In Form von Gastsymposien nimmt die DGfI zudem an den Jahrestagungen anderer immunologischer Gesellschaften teil. Dabei stellen bis zu fünf DGfI-Mitglieder einen der Schwerpunkte der immunologischen Forschung in Deutschland vor. Der erste Beitrag in Form eines solchen Gastsymposiums wurde auf Initiative von Hans-Martin Jäck und Dieter Kabelitz im Rahmen der Jahrestagung der American Association of Immunologists (AAI) 2012 in Boston zum Thema B-Zelle organisiert. 3 Kurts, C., Gottschalk, C., Bedoui, S., Heinze,l S., Godfrey, D., Enders, A. (2016). German Society for Immunology and Australasian Society for Immunology Joint Workshop 3(rd) 4(th) December 2015 Meeting report. Eur J Immunol Feb;46(2): DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 327
172 Seither wiederholt die DGfI bei den AAI-Jahrestagungen diese Gastsymposien mit jeweils wechselndem wissenschaftlichen Fokus. Seit 2016 wird das Konzept regelmäßiger Gastsymposien auch mit der Französischen Gesellschaft für Immunologie (SFI) umgesetzt. Das erste Gastsymposium der DGfI wurde von Jürgen Wienands (Göttingen) zum 50-jährigen Jubiläum der SFI in Paris organisiert und befasste sich, auf expliziten Wunsch der SFI hin, ebenfalls mit dem Thema B-Zelle. Akademie für Immunologie: Aus- und Weiterbildungsmodule der DGfI DGfI Senatoren Um ehemalige Präsidenten und Generalsekretäre nach Ablauf ihrer Amtszeiten weiterhin wissenschaftlich in unsere Gesellschaft einzubinden und um ihre Expertisen für die Gesellschaft zu bewahren, hat der Vorstand und Beirat auf Initiative des damaligen Präsidenten Jürgen Wienands beschlossen 4, hierfür ein neues Forum zu bilden. Damit diese Idee mit Leben gefüllt wird, trafen sich im Rahmen der Jahrestagung 2016 in Hamburg neun ehemalige Präsidenten und Generalsekretäre zur konstituierenden Sitzung des Forums»DGfI-Senatoren«. Die DGfI-Senatoren werden sich, ähnlich wie die Mitglieder eines DGfI-Arbeitskreises, regelmäßig im Rahmen der Jahrestagungen treffen. Die Sitzungen werden immer vom zuletzt ausgeschiedenen Past-Präsidenten für eine Amtszeit von zwei Jahren organisiert. Dieser vertritt das Forum auch als kooptiertes, beratendes Mitglied bei Vorstands- und Beiratssitzungen. Während der 1. Sitzung haben sich als Hauptaufgaben die Beratung des Vorstands bei problematischen Situationen, die Ausrichtung von Jahrestagungen, die Etablierung neuer Programme und die Richtungsänderung vorhandener Aktivitäten herauskristallisiert. Nachwuchsförderung Auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird in der Gesellschaft sehr großer Wert gelegt. Deshalb hat die DGfI mehrere Programme zur Aus- und Weiterbildung in der»akademie für Immunologie«gebündelt und etliche Plattformen und Aktivitäten zur Karriereförderung für Doktoranden, Postdocs und klinische Wissenschaftler aus Deutschland und den Nachbarländern etabliert. 4 Protokoll der DGfI-Vorstands- und Beiratssitzung Schule Inhalt Zielgruppen Seit Autumn School»Current Concepts in Immunology«(CCII) Spring School on Immunology (SSOI) Translational Immunology School (TIS) Studenten, Doktoranden, Ärzte und Naturwissenschaftler mit Interesse an der klinischen Anwendung immunologischer Forschungsergebnisse Fachimmunologe DGfI Dozentenvorträge über immunologische Grundlagen, aktuelle Themen und Erkrankungen Diskussion aktueller Themen in kleinen Fokusgruppen Poster-Präsentationen der»schüler«vorträge zu speziellen immunologischen Forschungsthemen und Techniken Demonstrationen aktueller Methoden Interaktive Poster Präsentationen der»schüler«vorträge zu speziellen Themen aus der klinischen Immunologie und zu State-of-the-art Techniken Interaktive Poster Präsentationen der Teilnehmer Bescheinigt die Kompetenz, selbständig immunologische Forschung durchzuführen, diagnostische Laborbefunde zu interpretieren oder Behandlungsmethoden zu empfehlen Studenten, Doktoranden, Wissenschaftler mit geringem immunologischen Grundwissen Etablierte Wissenschaftler, die ihre immunologischen Kenntnisse auffrischen wollen Studenten, Doktoranden und Wissenschaftler mit gutem immunologischen Grundwissen Etablierte Wissenschaftler, die ihre immunologischen Kenntnisse auffrischen wollen Ärzte und Naturwissenschaftler mit nachgewiesener langjähriger Erfahrung in Forschung, Klinik oder Diagnostik mit Schwerpunkt Immunologie DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 329
173 Akademie für Immunologie Nach dem erfolgreichen Start der 1. Frühjahrsschule 2005 wurde 2006 zum ersten Mal die Einrichtung einer»akademie«als Langzeitziel der Bestrebungen der DGfI im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung diskutiert. Das von Barbara Bröker (Greifswald) 2008 vorgestellte Konzept für eine»akademie für Immunologie«nahmen sodann Vorstand und Beirat einstimmig an. Unter der Leitung der ersten Sprecherin Barbara Bröker sollte die»akademie für Immunologie«als Ausbildungsplattform bestehende und zukünftige Ausbildungskonzepte der DGfI unter einem Dach vereinigen und den großen Aus- und Weiterbildungsbedarf im Fach Immunologie inner-, aber auch außerhalb Deutschlands abdecken. Zurzeit besteht die Akademie aus der Autumn School»Current Concepts in Immunology«, der Ettal Spring School on Immunology und der Translational Immunology School sowie dem Weiterbildungsmodul»Fachimmunologe DGfI«. Immunologie-Schulen Zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat die DGfI mittlerweile drei unterschiedliche Schulen eingerichtet, die jährlich stattfinden (siehe auch Kapitel II). Zu den durchgehend englischsprachigen Schulen lädt die DGfI renommierte Immunologen aus Deutschland und dem Ausland ein. Durch verschiedene Programmpunkte ermöglichen die Schulen den Teilnehmern einen einzigartig intensiven und persönlichen Austausch mit den Vortragenden. Jedes Jahr nehmen so rund 180 Studenten an den drei verschiedenen Schulen teil darunter viele Promovierende, die im Rahmen ihres Promotionsprogramms zu den Schulen der DGfI entsendet werden. Zertifikat Fachimmunologe DGfI Auch wenn es immer noch keine medizinische Zusatzbezeichnung oder einen Facharzt für Immunologie gibt, so hat die DGfI 2001 ein Curriculum für eine spezialisierte Ausbildung in der Immunologie eingerichtet. Mit dem Abschluss dieses Curriculums kann das Zertifikat "Fachimmunologe DGfI" (Certified Immunologist DGfI) erreicht werden. Es wird auf Antrag und nach einer Prüfung durch eine mit DGfI-Experten besetzte Kommission unter der derzeitigen Leitung von Michael Kirschfink (Heidelberg) vergeben. initiative ihrer nationalen immunologischen Gesellschaften mit der DGfI die Spring School in Ettal. 5 Zudem ermöglicht es die DGfI in Kooperation mit der IUIS alljährlich drei weiteren Promovierenden aus Entwicklungsländern, mit Hilfe von Stipendien an der Spring School teilzunehmen. 6 Die Bewerberzahlen für diese Stipendien für Promovierende aus Entwicklungsländern zur Teilnahme an unseren Schulen sind jedes Jahr so hoch, dass IUIS in Zusammenarbeit mit der DGfI 2016 zum ersten Mal unter der Federführung von Dieter Kabelitz und fünf weiteren Immunologen aus Deutschland eine Immunologie-Schule zum Thema»Immunology of Infectious Diseases«mit Unterstützung der Volkswagen-Stiftung direkt vor Ort in Gambia (West-Afrika) organisiert hat. Dieter Kabelitz wird ab Dezember 2017 als neuer Vorsitzender des Education Committee (EDU) der IUIS diese Aktivitäten auch in Zukunft zusammen mit unserer Gesellschaft organisieren. Karriereförderung Neben der Aus- und Weiterbildung im Fach Immunologie bietet die DGfI vielen jungen Mitgliedern auch Möglichkeiten an, Führungserfahrungen zu sammeln und Kontakte zu erfahrenen Immunologen im Hinblick auf karrierespezifische Fragen aufzubauen. Sowohl die Kommission Gleichstellung & Karriereförderung als auch die»young Immunologists«offerieren eine solche Option. Kommission Gleichstellung & Karriereförderung Die 2014 in Bonn gegründete Kommission Gleichstellung & Karriereförderung ist aus der ehemaligen Kommission»Stand der Frau«hervorgegangen, die besonders die Förderung von Immunologinnen im Blick hatte. Wissenschaft profitiert jedoch von den Beiträgen und unterschiedlichen Sichtweisen vieler. Daher ist es ein Ziel der DGfI, alle Talente zu sehen, einzubeziehen und zu fördern. Frauen und Männer sollten gleiche Chancen für ihre Karriere in der Wissenschaft haben, egal ob sie Familie haben oder nicht. Dass hier noch Handlungsbedarf besteht, wissen viele Mitglieder aus eigener Erfahrung, aber auch Statistiken und Studien zum Thema zeigen dies deutlich auf. Internationale Kooperationen Die Schulen der DGfI ziehen auch immer mehr internationale Teilnehmer an. Je zwei Promovierende aus Japan und China absolvieren dank einer gemeinsamen Stipendien- 5 Japan: Japanisch-deutscher Studentenaustausch, in: Immunologische Nachrichten / Immunological News, Heft 155/2015, S. 40; China: Immunology in Germany, 2016, S Stipendien für Studenten aus Entwicklungsländern, in: Immunologische Nachrichten / Immunological News, Heft 155/2015, S. 38 f. 330 DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 331
174 In der Kommission Gleichstellung und Karriereförderung, unter der Leitung von Charlotte Esser (Düsseldorf) und Johannes vom Berg (Zürich), kommen vor allem engagierte DGfI-Mitglieder zusammen, die sich in der herausfordernden Phase nach der Promotion bis hin zur ersten Professur befinden. Entsprechend richten sich die Aktivitäten der Kommission an Frauen UND Männer und sollen zur akademischen Karriere ermutigen, Wissen und praktische Tools vermitteln und beim»netzwerken«helfen. Neben der Organisation von Informationsveranstaltungen wie z. B. dem»career Lunch«während der Jahrestagungen bietet die Kommission Treffen an, um karrierespezifische Fragen mit erfahrenen Kollegen auszutauschen. Forum»Young Immunologists«Mit dem 2015 von Vorstand und Beirat neu eingerichteten Forum»Young Immunologists«sollen Nachwuchswissenschaftler noch stärker in die DGfI eingebunden werden und eine Möglichkeit erhalten, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Die Gründungsveranstaltung während der Jahrestagung 2016 in Hamburg wurde von einer überwältigenden Menge an Interessenten besucht. Das Forum arbeitet seither an der Festlegung der internen Strukturen, mit dem Ziel, den wissenschaftlichen Austausch, eine frühe berufliche Vernetzung, den Austausch von Methoden und die Karriereentwicklung zu fördern. Weitere Aktivitäten in der Nachwuchsförderung Preise Neben dem Deutschen Immunologie-Preis (siehe Kapitel II) für renommierte Wissenschaftler vergibt die DGfI jährlich fünf verschiedene Preise für herausragende wissenschaftliche Leistungen an junge Forscher in verschiedenen Phasen ihrer Karriere. Promotionspreise Otto-Westphal-Preis (Promotionsarbeit, Immunologie) Hans-Hench-Preis für Klinische Immunologie (Promotionsarbeit, klinische Immunologie)»Early Career«-Preise Fritz-und-Ursula-Melchers-Preis (Postdoktoranden, Immunologie) Herbert-Fischer-Preis (Postdoktoranden, Neuroimmunologie) Georg-Köhler-Preis (Nachwuchsgruppenleiter, Immunologie) Tabelle: Nachwuchspreise der DGfI (Bewerbungen können als PDF per bis zum 31. Januar jeden Jahres bei der DGfI-Geschäftsstelle eingereicht werden) Konstituierende Sitzung des DGfI-Forums»Young Immunologists«Verleihung des Otto-Westphal-Promotionspreises im Rahmen der Jahrestagung 2016 in Hamburg. Von links: C. Watzl (Dortmund, Generalsekretär der DGfI), V. Buchholz (München, Preisträger), K. Grossmann (Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen) und C. Falk (Hannover, Preispatin) 332 DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 333
175 Auf Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für Immunologie vergibt zudem die Robert- Koch-Stiftung jährlich einen Robert-Koch-Postdoktorandenpreis (Themenbereich Immunologie) für herausragende Arbeiten an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Broschüre»Immunology in Germany«wurde bei der Jahrestagung 2014 in Bonn vom damaligen Past-Präsidenten D. Kabelitz vorgestellt. Reisekostenunterstützungen Die DGfI vergibt jährlich Reisebeihilfen in Höhe von insgesamt ca Euro. Diese Gelder werden an junge DGfI Mitglieder/Nachwuchsforscher für Reisen zu DGfI- Jahrestagungen, zu nationalen oder internationalen Kongressen oder zur Unterstützung von Laboraufenthalten vergeben. Dieses Programm wird seit einigen Jahren durch eine großzügige Spende der EUROIMMUN AG in Lübeck unterstützt. Die DGfI unterstützt auch anteilig die Teilnahme von zwei Doktoranden aus Deutschland an der RCAI RIKEN Summer School in Japan bzw. am Jahreskongress der Chinesischen Gesellschaft für Immunologie. Die Teilnehmer an diesen internationalen Aktivitäten werden nach offener Ausschreibung vom Vorstand unserer Gesellschaft ausgewählt. Öffentlichkeitsarbeit Auf Initiative von Hans-Martin Jäck etablierte die DGfI im März 2012 unter dem Motto»Immunologie für Jedermann«ein Programm, um die interessierte Öffentlichkeit und Entscheidungsträger aus Wissenschaft und Politik für die wichtige Rolle der Immunologie in der modernen Biomedizin zu sensibilisieren. 7 Zudem will die Initiative über für uns Immunologen wichtige Themen wie»schutzimpfung«und, zusammen mit der DGfI-Kommission»Artgerechte Tierversuche«, auch über die Bedeutung von Tierexperimenten für die Entwicklung neuer Diagnose- und Therapieverfahren aufklären. Immunologie für Jedermann Um die Initiative»Immunologie für Jedermann«auf den Weg zu bringen, schaffte die DGfI eine neue Koordinationsstelle für Öffentlichkeitsarbeit. Unter Leitung des damaligen Präsidenten, Dieter Kabelitz, entstand 2013 zunächst die englischsprachige Imagebroschüre»Immunology in Germany«. Sie wurde bei der 7 Protokoll der Vorstands- und Beiratssitzung 1/2012 am Jahrestagung 2014 in Bonn präsentiert und gibt internationalen Kollegen eine Übersicht über die gegenwärtigen Aktivitäten der DGfI und über die immunologische Forschungslandschaft in Deutschland. Um die Wahrnehmung der Immunologie in der Öffentlichkeit zu erhöhen sowie deren komplexes Fachgebiet wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig verständlich aufbereitet zu präsentieren, wurde die Webplattform»Immunologie für Jedermann«(www. das-immunsystem.de) erstellt. Neben allgemeinen Informationen zu unserem Abwehrsystem werden mit der Plattform außerdem Lehrer, Schüler, Studenten und Lehrende an Universitäten sowie betroffene Patienten angesprochen. Zudem kann Informationsmaterial in Form von Vorträgen und Postern, das in Kooperation mit Erlanger Doktoranden und Gymnasiasten ins Deutsche übersetzte Kinderbuch»Das faszinierende Immunsystem«und die Zusatzbroschüre»Transplantation rettet Leben!«abgerufen werden. Darüber hinaus werden Journalisten oder Privatpersonen Kontakte zu Themen-relevanten Experten im Fachbereich Immunologie vermittelt. Kampagnen Auch vor sensiblen Themen, wie z. B. Schutzimpfung und der Bedeutung von Tierversuchen in der Biomedizin, schreckt die DGfI nicht zurück. So hat es sich die neugegründete DGfI-Kommission»Artgerechte Tierversuche«zur Aufgabe gemacht, die breite Masse der Bevölkerung und politische Entscheidungsträger über die Bedeutung von 334 DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 335
176 Einband der Broschüre mit Informationen zur Transplantation (links) und des Buches»Das faszinierende Immunsystem«Deutschlandweite Aktivitäten für die Öffentlichkeit im Rahmen des Internationalen Tages der Immunologie Tierversuchen in der biomedizinischen Forschung aufzuklären und transparent zu informieren. Unsere Kommission unterstützt zudem die Informationsinitiative»Tierversuche verstehen«der Allianz der Wissenschaftsorganisationen (ein Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland). Dabei war die DGfI die erste Fachgesellschaft, die zu diesem Thema mit der Forschungsallianz zusammenarbeitet und diese wissenschaftlich betreut. Die Kommission, bestehend aus Michael Lohoff (Marburg), Thomas Kamradt (Jena), Sandra Beer-Hammer (Tübingen), Florian Hohnstein (Tübingen), Matthias Gunzer (Essen) und Manfred Lutz (Würzburg), hat unter anderem eine Punkt-für-Punkt-Auseinandersetzung mit den häufigsten Argumenten von Tierversuchsgegnern erarbeitet und setzt sich für die Sensibilisierung von Entscheidungsträgern im politischen Umfeld ein. Darüber hinaus liegt der DGfI auch die Aufklärung zum Thema Impfung sehr am Herzen und so werden entsprechende für die breite Bevölkerung organisierte Aktivitäten im Rahmen der jährlich weltweit stattfindenden Veranstaltung»Tag der Immunologie«unterstützt. Tag der Immunologie Mit diesem Tag, möchte die DGfI die Aufmerksamkeit auf die Immunologie als Forschungsdisziplin lenken und einer breiten Öffentlichkeit deutlich machen, welche große Bedeutung die Immunologie für die Gesundheit, aber auch für zahlreiche Krankheitsprozesse des Menschen hat. Diese Aktivität wurde 2005 auf Initiative des damaligen EFIS-Präsidenten, Stefan H. E. Kaufmann 8, von EFIS ins Leben gerufen 9 und findet seit 2007 auch weltweit statt Kaufmann, S.H.E., Bade, K., and Englich, S. (2005). European day of immunology. Nat Immunol. 6: Kaufmann, S.H.E., Grossman M.L., Englich S. (2007). The Day of Immunology 2007 goes global. European Journal of Immunology 37(5): DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE DIE DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE 337
177 Wer an einem Strang zieht, kann Großes erreichen Das bisher durch die Gesellschaft Erreichte ist dem Einsatz aller Mitglieder zu verdanken, die so lebhaft zu den Aktivitäten der Gesellschaft und zum hohen internationalen Ansehen der deutschen Immunologie beigetragen haben. Dabei ist der Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen, die während der letzten 50 Jahre die DGfI in ehrenamtlicher Funktion als Präsident, Generalsekretär, Beiratsmitglied, Sprecher von DGfI-Kommissionen, Koordinatoren von Schulen oder AK-Sprecher unterstützt haben, hervorzuheben. Gemeinsam werden wir unsere Führungsposition innerhalb der Familie der immunologischen Gesellschaften stärken und uns auch den wissenschaftlichen und den forschungspolitischen Herausforderungen der Zukunft stellen können. 338 DEU TSCHE GESELLSCH A F T FÜR IMMUNOLO GIE HEU TE
178 IV. Die Bedeutung der Immunologie für die heutige Gesellschaft Hans-Hartmut Peter Reinhold E. Schmidt Hans-Martin Jäck Stefan H. E. Kaufmann
179 Die Bedeutung der Immunologie für die heutige Gesellschaft Die letzten fünf Jahrzehnte haben dem Fachgebiet der Immunologie einen enormen Wissenszuwachs beschert. Zwar kennt man das Immunsystem heute in groben Zügen, aber die große Herausforderung liegt, wie so häufig, im genauen Verständnis der Zusammenhänge. Nur dann können klinisch-immunologische Probleme mit Erfolg angegangen werden. Hierzu gehören Autoimmunerkrankungen wie z. B. die Volkskrankheiten Rheuma und Diabetes, die stetig zunehmenden allergischen Erkrankungen, die Abstoßung von Organtransplantaten und die Bekämpfung von Krebs durch die körpereigene Abwehr. So wurde 2013 die Krebsimmuntherapie vom Fachjournal Science zum Durchbruch des Jahres erklärt. Diesen erfolgversprechenden Therapieansatz im Kampf gegen Krebs gilt es nun weiter auszubauen. Aber auch auf dem Gebiet, auf dem die Immunologie ihre größten Erfolge erzielen konnte, nämlich der Bekämpfung von Infektionen wie Polio (Kinderlähmung) und Masern, ist intensive Forschung weiterhin notwendig. Neben den noch immer ungelösten Problemen, um mit Malaria nur eines zu nennen, stellen uns neu auftretende Erreger immer wieder vor Herausforderungen wie die Beispiele der Ebola- und Zika-Infektionen überdeutlich zeigen. Anfänge und Grundlagen der modernen Immunologie Im 19. Jahrhundert prägte Louis Pasteur ( ) erstmals den Begriff»biologische Immunität«im übertragenen Sinne von erworbener Widerstandkraft gegen mikrobielle Erreger, d. h. Schutz vor und Überwindung von Infektionskrankheiten. 1 Zusammen mit Edward Jenner ( ) und Robert Koch ( ) gehörte er zu den Ge- 1 Debré P (1995). Louis Pasteur. Edition Flammarion. Paris, France; Silverstein AM (2009). A history of Immunology Elsevier/Academic Press 2nd Edition.; Pasteur L, Roux E, Chamberland C (1881): Comptes rendus sommaires des Experiences faites à Pouilly-le Fort sur la vaccination charbonneuse. Ct. rendus de L Academie des Sciences t.xci. DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T 341
180 burtshelfern und Paten der modernen Immunologie (siehe Kapitel I). Emil von Behring ( ), Shibasaburo Kitasato ( ), Elias Metchnikoff ( ), Emile Roux ( ) und Paul Ehrlich ( ) war es dann vorbehalten, dem neugeborenen Fach Immunologie sein bis heute prägendes Gesicht einer Grundlagenwissenschaft mit klinischer Anwendungsoption zu geben. Als Emil von Behring die erworbene Immunität (»Giftwiderständigkeit, erworbenes Desinfektans«) gegen Diphtherietoxin durch Serumgaben von immunisierten auf nicht immunisierte Individuen übertragen konnte, wurde der Begriff der serologischen Immunität geprägt. 2 Paul Ehrlich, ein Kollege Behrings, titrierte die Immunseren bis zur effektiven Dosis und lieferte mit der»seitenkettentheorie«ein erstes Modell für die erworbene serologische Immunität gegen bakterielle Toxine. 3 Beide arbeiteten als wissenschaftliche Assistenten in Berlin und waren gleichzeitig Kollegen und Konkurrenten von Emile Roux, einem Mitglied der Pasteur Gruppe in Paris. Dort hatte damals Elias Metschnikoff den Makrophagen als zentralen Akteur der zellulären, angeborenen Immunität entdeckt und Jules Bordet ( ) die wichtige Rolle des Komplement-Systems für zytotoxische Effekte von Seren gegen Bakterien und Zellen aufgeklärt. 4 Paul Ehrlich wiederum zeigte, dass Antikörper die Komplement-Aktivierung regulieren. Später breitete sich dieser produktive Wettstreit um das Verstehen der erworbenen Immunität weltweit aus und wurde zu einer großen Erfolgsgeschichte der Biomedizin mit nicht weniger als 24 Nobelpreisen. Es dauerte noch ca. 70 Jahre, bis die Immunologie auf breiter Front in die klinische Medizin eindrang und sie grundlegend veränderte. Zunächst waren es in den 1920er bis 1940er-Jahren die Blutgruppenserologie und neue Impfstrategien, die den Klinikern wichtige Fortschritte bescherten. Mit der Entdeckung der Opsonisierung durch Almroth Wright ( ) kamen die neutrophilen Granulozyten in den Fokus und mit ihnen der Verstärkereffekt zwischen angeborener Immunität (Phagozytose) und erworbener serologischer Immunität (Antikörper). 5 In den 1940er- bis 1960er-Jahren wurde die Bedeutung von B-Lymphozyten (Max Cooper, *1930) und Plasmazellen (Astrid Fagraeus, ) als Antikörper produzierende Zell-Population und die Thymus-abhängigen T-Lymphozyten als Träger der erworbenen zellulären Immunität (James L. Gowans, 2 Kaufmann, SHE (2017) Emil von Behring: Translational medicine at the dawn of immunology. Nature Rev Immunol 17: Aschoff L (1902). Ehrlichs Seitenkettentheorie und ihre Anwendung auf die künstlichen Immunisierungsprozesse, Fischer Verlag Jena. 4 Kaufmann SH (2008) Immunology's foundation: the 100-year anniversary of the Nobel Prize to Paul Ehrlich and Elie Metchnikoff. Nat Immunol. 7: Matthews, J Rosser (2002), "Almroth Wright, vaccine therapy, and British biometrics: disciplinary expertise versus statistical objectivity", Clio medica (Amsterdam, Netherlands), 67, pp *1924; Jaques Miller *1931; Henry Claman, *1930) identifiziert. 6 Die Begriffe B-Lymphozyt und T-Lymphozyt wurden zum ersten Mal von Ivan Roitt im ersten Übersichtsartikel über die Dichotomie der zellulären Immunantwort erwähnt. 7 Parallel hierzu gelangen dramatische, durch etliche Nobelpreise honorierte Fortschritte bei der Aufklärung der Antikörperstruktur. 8 Maßgeblich daran beteiligt waren Rodney Porter ( ), Gerald Edelman ( ), Alfred Nisonoff ( ) und Norbert Hilschmann ( ), einer der Gründungsväter der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Ergänzt wurde diese Entwicklung durch ein zunehmendes Verständnis der Immungenetik mit der Aufklärung der Funktion des MHC-Lokus durch George Snell ( ), Peter Gorer ( ), Jean Dausset ( ), Baruj Benacerraf ( ), Rolf Zinkernagel (*1944), Peter Doherty (*1940) und Beiträgen vieler anderer Gruppen. Daraus resultierte ein fundamentaler Erkenntniszugewinn im pathogenetischen Verständnis und klinischen Management vieler Autoimmunkrankheiten sowie der Organ- und Stammzelltransplantation. 9 Großer Nutzen einer vielfältigen immunologischen Diagnostik Parallel hierzu entwickelte sich ein ständig größer werdendes Repertoire an immundiagnostischen Methoden wie Immunelektrophorese, Radioimmunoassay, enzyme-linked immune Assay (ELISA), Immunhistologie, zytotoxische Tests, Immunfluoreszenz, Zytofluorometrie u. a. m. Mit Hilfe dieser Techniken ließen sich qualitative und quantitative Eiweißveränderungen im Blut nachweisen, pathogen- und allergen-spezifische Antikörper wurden detektierbar, und das Tor zur Autoantikörper-Diagnostik wurde weit aufgestoßen. Daneben entwickelte sich auch die unspezifische Entzündungsdiagnostik mit der quantitativen Messung von Akut-Phase-Proteinen wie C-reaktives Protein, Serum- Amyloid A, Pro-Calcitonin, Fibrinogen, Komplement-Komponenten u. a. zu einer wichtigen Stütze der klinischen Medizin. Seit der HIV-Pandemie in den 1980er-Jahren wurde die zytofluorimetrische Analyse von Leukozyten-Subpopulationen zu einem integralen Bestandteil jedes immunologischen Labors. Dank eines stetig wachsenden Sortiments an monoklonalen Antikörpern mit Spezifität für Zelloberflächen-, Zytoplasma- und Kern- 6 Silverstein AM (2009). A history of Immunology Elsevier/Academic Press 2nd Edition. 7 Roitt IM et al. (1969). The cellular basis of immunological responses. Lancet Aug 19, p ; Jonathan Sprent J (2017). T cell B cell collaboration. Nat. Rev. Immunol. Published online 30 May 2017, doi: / nri Eichmann K. (2005) Köhler s Invention. Birkhäuser Basel. DOI / Silverstein AM (2009). A history of Immunology Elsevier/Academic Press 2nd Edition. 342 DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T 343
181 strukturen ist diese Technik heute unverzichtbar in Pathologie und zahlreichen klinischen Disziplinen wie Hämatologie, Immundefektforschung, Rheumatologie, Pädiatrie, Transplantationsmedizin, Neurologie und Dermatologie, um nur einige der wichtigsten Fächer zu erwähnen. Explosion immunologischer Therapieverfahren in der Klinik Einen signifikanten klinischen Bedeutungszuwachs erlangte die Immunologie erst mit der Verfügbarkeit von Medikamenten, mit denen sich das Immunsystem beeinflussen ließ. So revolutionierten Philipp S. Hench ( ) und Kollegen in den frühen 1950er-Jahren die Therapie der rheumatoiden Arthritis (RA) und anderer Autoimmunkrankheiten sowie von Allergien und lympho-proliferativer Erkrankungen durch die Einführung synthetischer Kortikosteroide in die jeweiligen Therapieprotokolle. 10 Es wurde jedoch rasch klar, dass Steroide mittel- und langfristig unerwünschte Nebenwirkungen verursachen. Auf der Suche nach steroidsparenden Medikamenten setzten die Rheumatologen erstmals erfolgreich Antimetaboliten (Azathioprin, Methotrexat) und Alkylanzien (Cyclophosphamid) ein, die zuvor nur in der Hämatologie angewendet wurden. Später profitierten Rheumatologen und klinische Immunologen von einer Reihe von Immunsuppressiva, die speziell für die Transplantationsmedizin entwickelt wurden (Cyclosporin A, Tacrolimus, Sirolimus, Everolimus, Mycophenolat, Anti-Lymphozytenserum), sich aber auch bei Autoimmunkrankheiten als wirksam erwiesen. In der Allergologie ist die Methylprednisolon-Puls-Therapie noch für den schweren allergischen Schock reserviert, ansonsten ersetzen Antihistaminika, Leukotrien-Antagonisten und die spezifische Immuntherapie (»Desensibilisierung«) die Steroide. Die Hämatologen nutzen den leukozytoklastischen Effekt von Kortikosteroiden weiterhin in fast allen Therapieprotokollen der chronisch lymphatischen Leukämie und der Lymphome. Auch in der Neurologie spielt die Methylprednisolon-Pulse-Therapie noch eine wichtige Rolle bei der Unterbrechung akuter neuroimmunologischer Schubsituationen (u. a. bei der multiplen Sklerose (MS) oder dem Guillain-Barré Syndrom). In den frühen 1970er-Jahren wurden polyvalente Immunglobuline von gesunden Blutspendern zur intravenösen (IVIG) und später subkutanen Immunglobulin-Ersatztherapie (SCIG) verfügbar und bei einer stetig steigenden Zahl von primären und sekundären Immundefekt-Syndromen eingesetzt. Bald wurde klar, dass diese Präparate 10 Kyle RA, Shampo MA (1983); Philip S. Hench. JAMA. 9; 250(22):3058. nicht nur ein defektes Antikörper-Repertoire ersetzen können, sondern auch potente immunmodulatorische und anti-entzündliche Effekte bei Autoimmunkrankheiten bewirken können. 11 Heute gibt es zehn bis zwölf weltweit anerkannte, evidenz-basierte, immunmodulatorische Indikationen für IVIG, z. B. die idiopathische bzw. autoimmune Thrombozytopenie (ITP) im Kindesalter und mehrere neuroimmunologische Krankheitsbilder (multifokale motorische Neuropathie, chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie, Myasthenia Gravis, Guillain-Barré-Syndrom). Nach der Etablierung der monoklonalen Antikörper-Technologie im Jahre 1975 durch Georges Köhler ( ) und César Milstein ( ) 12, die beide dafür 1984 den Nobelpreis für Medizin erhielten, begann Ende der 1990er-Jahre eine epochale Entwicklung mit der erfolgreichen Einführung monoklonaler Antikörper in die Diagnostik und Therapie zahlreicher immunologischer und hämatologischer Krankheitsbilder. Den Anfang machten die großartigen Erfolge einer monoklonalen Anti-TNF-α Therapie bei der RA und die Anti-CD20 Therapie bei B-Zell-Malignomen. Seitdem steigen Anzahl und empfohlene Indikationen therapeutisch wirksamer monoklonaler Antikörper auch»biologika«genannt stetig an. Einige Beispiele neuer Therapieoptionen bei Autoimmunkrankheiten sind in der auf der nächsten Seite dargestellten Tabelle zusammengefaßt. Ein differenzierteres immunpathologisches Verständnis vieler Krankheitsbilder, in Verbindung mit der rasanten Zunahme und Anwendungsbreite krankheitsspezifischer Biologika und innovativer immunologischer Biomarker hat die Bedeutung der Immunologie dramatisch befördert. Dies spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass seit den 1970er-Jahren in allen westlichen Ländern neben den Textbüchern der Grundlagen-Immunologie 13 auch umfängliche Lehrbücher der»klinischen Immunologie«14 11 Perez EE et al (2017). Update on the use of immunoglobulin in human disease: A review of evidence. J Allergy Clin Immunol. 139(3S):S1-S46 12 Köhler G, Milstein C (1975). Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature. 7; 256(5517): Samter M, Talmage DW, Rose B, Austen KF, Vaughan JH (1971). Immunological Diseases. 3rd Edition Liile, Brown & Co. USA; Paul, WE (1984). Fundamental Immunology. Raven Press, New York; Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M eds. (1997). Immunology. 5th Edition. Garland Publishing, New York; Kaufmann, S.H.E.: Basiswissen Immunologie, Springer-Lehrbuch, Springer Verlag (2014); Miescher P, Vorländer KO Eds.(1957) Immunpathologie in Klinik und Forschung, und das Problem der Autoantikörper. Georg Thieme Verlag Stuttgart; Gemsa D, Kalden JR, Resch K (Eds) (1997) Immunologie-Grundlagen, Klinik, Praxis. 4. überarbeitete Auflage. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York. 14 Bellanti JA (2012). Immunology IV Clinical applications in Health and Disease. 4th Edition, and I Press, Washington (1st editiion in 1971 W.B. Saunders Publishers); Guillevin L, Meyer O, Sibilia J eds. (2008) Traité des Maladies et Syndromes Systemiques. 5th Edition Flammarion, Paris (1st Edition 1982); Peter HH (1991) Klinische Immunologie. Urban& Schwarzenberg Verlag München, Wien, Baltimore. (3rd edition 2012, Elsevier, Amsterdam); Rich RR, Fleisher T, Schwartz BD, Strober W (1996). Clinical Immuno- 344 DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T 345
182 Biologika TNF α -blocker anti-il6 anti-il17 anti-cd20 anti-integrin α4ß7 anti-ige anti-il5 anti-c5a (complement inhibitor) Autoimmunerkrankungen RA* Spondyloarthritis (SPA) Psoriasis (Ps) Psoriasis-Arthritis (PsA) entzündliche Darmerkrankungen (IBD) Uveitis RA Riesenzellarthritis Ps PsA MS RA Vasculitis systemischer Lupus erythematodes (SLE) MS MS IBD schweres therapierefraktäres Asthma chronische Urtikaria Churg-Strauss Syndrom paroxysmal hemolytic anemia (PNH) atypischem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) * Smolen et al. (2017). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs:2016 update. Ann Rheum Dis. 76(6): erschienen sind, die große Teile des pädiatrischen, internistischen, neurologischen und dermatologischen Wissens unter dem Blickwinkel eines immunologischen Pathogenese- Verständnisses und der zunehmenden Therapieoptionen beschreiben: Die Immunologie wird neben Anatomie, Physiologie, Pathologie und Biochemie zur unverzichtbaren 5. Wissenssäule für organpathologische Veränderungen und wichtige Grundlage einer allgemeinen Krankheitslehre. Dennoch gibt es trotz vieler Bemühungen in vielen Ländern, so auch in Deutschland, kein definiertes Facharztcurriculum oder Teilgebiet für logy- Principles and Practice. Mosby, St. Louis, Baltimore; Chapel H, Haeney M, Misbah S, Snowden N (2006) Essentials of Clinical Immunology. 5th Edition (1st edition in 1986), Blackwell Publishing. klinische Immunologie (s.u.). Hierdurch variiert der klinische Standort des Faches von Ort zu Ort: mal findet man die klinische Immunologie in der Inneren Medizin assoziiert mit der Rheumatologie, Gastroenterologie, Hämatologie, Nephrologie oder Pulmologie. Entsprechend wechseln die krankheitsspezifischen Forschungsschwerpunkte. Ähnliches gilt für Pädiatrie, Dermatologie, Neurologie und Transplantationsmedizin. In der universitären Inneren Medizin hat sich in den letzten 30 Jahren, zumindest in Deutschland, eine sehr erfreuliche Symbiose der klinischen Immunologie mit der Rheumatologie ergeben. Die Rheumatologie ließ sich auf die Immunologie als Ideengeber ein und profitiert davon enorm, in dem sie beim Einsatz von Biologika in der Therapie systemischer Autoimmunkrankheiten klarer Vorreiter vor anderen internistischen Fächern wie Gastroenterologie, Nephrologie und Pneumologie wurde. Angespornt durch die großen therapeutischen Erfolge der Biologika in der Rheumatologie gehen Neurologie und Dermatologie inzwischen auch eigene innovative Wege in der immunsuppressiven Behandlung ihrer fachspezifischen Autoimmunkrankheiten (z. B. bei Multipler Sklerose oder Psoriasis). Wiederum war es die Rheumatologie, die zuerst die in der Hämato-Onkologie bei B-Zell-Malignomen so durchschlagende anti-cd20 Therapie (Rituximab) erfolgreich in die Behandlung diverser rheumatischer Systemkrankheiten (RA, Sjögren-Syndrom) übernommen hat. Gleiches gilt für den Proteasom-Inhibitor Bortezomib: Bisher als Standardtherapeutikum beim Multiplen Myelom eingesetzt, wird es nun bei systemischem Lupus erythematodes (SLE) zu einem vielversprechenden Medikament, das vor allem die Autoantikörper-produzierende Plasmazellen zerstört. 15 Die Rheumatologie entwickelte sich also zum Vorreiter für B-Zell-gerichtete Therapien bei nicht-malignen Indikationen. Inzwischen beschreiten auch die Neurologie (anti-cd20 bei MS) und die Transplantationsmedizin (anti-cd20 zur Verhinderung von Allotransplantat-Abstoßung) ähnliche therapeutische Wege. Angesichts der wachsenden Vielfalt der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten erfährt die klinische Immunologie seit den 90er-Jahren eine zunehmende Diversifizierung in Subspezialitäten wie Autoimmunität, T-Zell Defizienz, Antikörpermangel, Anti-virale Immunologie, Allergien, Transplantationsimmunologie, Granulom- Immunologie, Inflammations-Immunologie, Tumorimmunologie, Vakzinologie u. a Alexander et al, (2015).The proteasome inhibitior bortezomib depletes plasma cells and ameliorates clinical manifestations of refractory systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 74(7): Eibl MM, Huber C, Peter HH, Wahn U eds. ( ) Symposium in: Immunology I to VIII. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, New York. 346 DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T 347
183 Besonders für die Tumorimmunologie und die Immunpharmakologie ist in den letzten Jahren eine neue Therapie-Ära angebrochen. Mit den sog. Immuncheckpoint- Inhibitoren, den Immunotoxinen (bestehend aus einem monoklonalen Antikörper gekoppelt an ein Zelltoxin), den bispezifischen Antikörpern und den CAR-T-Zellen (zytotoxische T-Zellen mit einem chimären Rezeptor, der aus einem tumor-spezifischen Antikörperfragment und der Signaleinheit des T-Zellrezeptors besteht) entstanden völlig neue immunbiologische Therapieprinzipien für Autoimmunkrankheiten, therapierefraktäre B-Zell Malignome (chronische lymphatische Leukämie, CLL, und Non-Hodgkin Lymphom, NHL) und solide Tumoren. 17 Die Immun-Checkpoint-Inhibitoren stehen für ein neues Therapieprinzip bei Subformen verschiedener solider Tumoren: z. B. malignes Melanom, Bronchial-Karzinom, Mamma-Karzinom, Urothelcell-Karzinom, Hodgkin-Lymphom und Plattenepithel- Karzinom des Kopf-Halsbereiches. 18 Die Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren basiert auf der Blockade von inhibitorischen Rezeptor-Liganden-Wechselwirkungen zwischen regulatorischen bzw. zytotoxischen T-Zellen mit antigen-präsentierenden Zellen. Jim Allison (*1942) konnte als erster über die Blockade des inhibitorischen cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) -Rezeptors auf T-Zellen mittels eines monoklonalen Antikörpers das Tumorwachstum in einem Mausmodell erfolgreich bekämpfen. 19 Ausgehend von diesem Ergebnis wurde Ipilimumab, ein monoklonaler Antikörper gegen menschliches CTLA-4, 2011 von der Food and Drug Administration (FDA) als erster Checkpoint-Inhibitor zur Behandlung des metastasierenden Melanoms zugelassen. 20 Einen anderen Wirkmechanismus involviert das von Tasuku Honjo (*1942) entdeckte programmed cell death receptor protein PD-1 (24) auf T-Zellen. 21 Nach Bindung des Liganden PD-L1 oder PD-L2 werden tumor-infiltrierende Lymphozyten (vorwiegend T-, Treg- und NK-Zellen, aber auch Monozyten, B- und dendritische Zellen) in ihrer Aktivierung gedämpft bis abgeschaltet. Krebszellen können PD-L1 oder PD-L2 exprimieren und damit zytotoxische Antitumoraktivität von tumor-infiltrierenden Lymphozyten ausbremsen. Neue monoklonale Antikörper gegen PD-1 (Nivolumab, Pembrolizumab) und PD-L1 (Atezolizumab, Avelumab) blockieren die Rezeptor-Ligand Interaktion und aktivieren somit zytotoxische Immunantworten von tumor-infiltrierende Lymphozyten gegen Tumorgewebe. Leider wird dabei aber auch in wechselndem Ausmaß Normalgewebe geschädigt. Nach den großen Erfolgen beim malignen Melanom entwickeln sich Immun-Checkpoint-Inhibitoren heute für Subformen solider Tumoren mit hohem Anteil an tumor-infiltrierenden Lymphozyten und gesteigerter mrna Expression für PD-1, PD-L1/2 und CTLA-4 zur Standard-of-care Therapie mit hohen Remissions-und Überlebensraten. 22 Die unerwünschten Autoimmunreaktionen gegen normale Organe und Gewebe auf (z. B. Schilddrüse, Muskel, Gelenke, Knochenmark u. a.) bedürfen gegebenenfalls einer immunsuppressive Zusatzbehandlung. 23 Neue Sequenziertechniken und Zell- und Gen-Therapien auf dem Vormarsch Dramatisch neue Entwicklungen ergeben sich auch in der Diagnostik von Autoimmunund Immundefekt-Erkrankungen durch den Einsatz moderner molekulargenetischer Technologien wie der Next Generation Sequencing (NGS) Technik (whole exome sequencing, WES; whole genome sequencing, WGS). Mit diesen Techniken lassen sich neue pathogenetische Zusammenhänge (z. B. Typ 1-Interferon Signatur bei SLE) erschließen und neue Biomarker definieren, die hilfreich sein können für eine zunehmend personalisierte Medizin (Welcher Patient profitiert von welchem Medikament/ Biologikum am meisten und hat dabei die wenigsten Nebenwirkungen zu erwarten?). Eine zügige Hinwendung zur Molekulargenetik in enger Verbindung mit der klinischen Immunologie wird einige Zentren in die Lage versetzen, eine bevorzugte Anlaufstelle für die zunehmend häufiger aufgeklärten, genetisch determinierten Immundefekte und Immundysregulations-Syndrome zu werden. Dies wird umso relevanter als offensichtlich bei Autoimmunerkrankungen und Immundefekt-Syndromen vielfach die gleichen Gene involviert sein können. 24 Auch bestimmte Immunsuppressiva, die in der Rheumatologie eingeführt sind, wie z. B. Abatacept und m-tor-inhibitoren Larkin et al, (2015) Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med ; 373(13):1270-1; Yoshiko et al, (2017). Cancer immunotherapies targeting the PD-1 signaling pathway. J Biomed Sci. 24:26. Published online 2017 Apr 4. doi: /s Leach et al, (1996) Science 271(5256): Enhancement of antitumor immunity by CTLA-4 blockade Ishida et al, (1992) Induced expression of PD-1, a novel member of the immunoglobulin gene superfamily, upon programmed cell death. EMBO J Yoshiko et al, (2017). Cancer immunotherapies targeting the PD-1 signaling pathway. J Biomed Sci. 24:26. Published online 2017 Apr 4. doi: /s Diesendruck Y, Benhar I. (2017) Novel immune check point inhibiting antibodies in cancer therapy-opportunities and challenges. Drug Resist Updat. 2017; 30: Grimbacher et al, (2016). The crossroads of autoimmunity and immunodeficiency: Lessons from polygenic traits and monogenic defects. J Allergy Clin Immunol. 137(1):3-17. Review. Schmidt et al, (2017). Schmidt RE, Grimbacher B, Witte T. (2017). Autoimmunity and primary immunodeficiency: two sides of the same coin? Nature Rev Rheum (in press). 348 DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T 349
184 (Everolimus, Rapamycin), zeigen günstige Therapieeffekte bei den kürzlich beschriebenen Immundysregulations-Syndromen mit CTLA-4-Defizienz 25 oder PI3Kinase gain-offunction-mutanten. 26 Die Fortschritte in der Molekulargenetik werden nicht bei einer verbesserten Diagnostik immunologischer Krankheitsbilder stehen bleiben, sondern sich auch auf den Therapiebereich ausdehnen. Hier sind bereits jetzt die ersten zell- und gentherapeutischen Studien bei primären Immundefekten und HIV in vollem Gange. 27 Verbesserte allogene Stammzell-Transplantationsprotokolle für angeborene Immundefekt und Immundysregulations-syndrome werden wohl bald durch gezielte Genreparatur-Verfahren ergänzt bzw. ersetzt. Von ihrer wissenschaftlichen Positionierung und Innovationsfähigkeit wird es also in Zukunft abhängen, welche Fächer der modernen Medizin privilegierte Partner der klinischen Immunologie sein werden. Klar ist, dass gegenwärtig keine andere biomedizinische Disziplin mehr innovative diagnostische und therapeutische Verfahren/Patente generiert als die Immunologie. Sie stellt somit einen wichtigen Ideen- und Anreizgeber für die moderne biopharmazeutische Industrie dar und bildet eine wesentliche Voraussetzung für eine intelligente, personalisierte Medizin der Zukunft. Neu und wieder auftretende Infektionskrankheiten und Impfstoffentwicklung Begünstigt durch die Globalisierung kam es in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu bedrohlichen Ausbreitungen neuer Seuchenerreger, sogenannter»emerging infections«(z. B. HIV, SARS, Ebola, Zika u. a.). Gleichzeitig flackern bereits besiegt geglaubte Seuchen wie die Tuberkulose wieder auf. 28 Nicht nur im Rahmen ihrer Diagnostik, sondern auch bei der entsprechenden Impfstoffherstellung sind modernste immunologische Methoden erforderlich. Wichtige Beiträge leistet die Immunologie auch bei der Therapie neuer Infektionen, z. B. durch Bereitstellung von Rekonvaleszentenplasma und Erregerspezifischen monoklonalen Antikörpern (Biologika) zur Eindämmung der Erregerausbreitung im Körper und in der Population, bis wirksame Impfstoffe greifen. Als aktuelle Beispiele seien Zmapp, eine Mischung neutralisierender monoklonaler Antikörper gegen Ebola Virus 29, Pavilizumab zur Behandlung der akuten RS-Virus Infektion des Kleinkindes und Raxibacumab, ein neutralisierender monoklonaler Antikörper gegen Anthrax-Toxin, erwähnt. Die passive und aktive Impfstoffherstellung ist eng verknüpft mit der Entwicklung der Immunologie (s. o.). Für die Hühnercholera, Anthrax, Tollwut und Tuberkulose erwies sich die Verwendung attenuierter Erreger-Impfstoffe als erfolgreich. Emil von Behring beschritt eine molekulare Strategie für die Impfung gegen Toxine der Diphtherie- und Tetanus-Bakterien. Er schaffte zunächst einen therapeutischen Durchbruch durch die Übertragung heterologer Anti-Diphtherie und Anti-Tetanus Immunseren auf den Menschen (passive Immunisierung). Später gelang ihm auch eine aktive Immunisierung im Menschen durch die Verwendung von Toxin-Antikörper-Komplexen. Es blieb jedoch Gaston Ramon ( ) vorbehalten, durch chemische Behandlung von Toxinen deren toxische Wirkung aufzuheben, ohne ihre Immunogenität zu beeinträchtigen. 30 Neben diesen Toxoid-Impfstoffen (Diphtherie, Pertussis, Tetanus) gibt es heute inaktivierte Impfstoffe (gegen Polio nach Salk) und attenuierte Erreger (z. B. BCG, Gelbfieber, Polio nach Sabin u. a.), Konjugat-Impfstoffe aus bakteriellen Membranglykosiden und Proteinträgermolekülen (z. B. Pneumokokken-Vakzine Prevenar ) sowie rekombinante Virus-Impfstoffe, bestehend aus immunogenen viralen Peptiden (Hepatitis B, Grippe, u. a.), gekoppelt an Adjuvantien (Impfverstärker). Für die Entwicklung einer ersten Anti- Tumorvakzine (Portio-Carcinom) durch Verwendung von immunogenen HPV Peptide erhielt Harald zur Hausen 2008 einen Nobelpreis. Heute zeigt sich gerade im Bereich der Adjuvans-Forschung der große Nutzen der tieferen Einblicke in die immunologischen Mechanismen. Für die Entdeckung der Toll-like-Rezeptoren erhielt Christiane Nüsslein- Volhard (*1942) im Jahre 1995 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin und Jules Hoffmann (*1941) sowie Bruce Beutler (*1957) bekamen diese Auszeichnung im Jahr 25 Schubert et al. (2014) Autosomal dominant immune dysregulation syndrome in humans with CTLA4 mutations. Nat Med. 20(12): Lucas et al. (2014). Dominant-activating germline mutations in the gene encoding the PI(3)K catalytic subunit p110δ result in T cell senescence and human immunodeficiency. Nat Immunol: 15(1): Aiuti et al. (2009). Gene therapy for immunodeficiency due to adenosine deaminase. N. Engl. J. Med. (2009) 360: ; Hoxie JA, June CH (2012) Novel cell and gene therapy for HIV. Cold Spring Harbor Persp Med Kaufmann, S.H.E.: Wächst die Seuchengefahr? Globale Epidemien und Armut: Strategien zur Seucheneindämmung in einer vernetzten Welt (Klaus Wiegand, ed.), 2. Aufl., Frankfurt PREVAIL II Writing Group; Multi-National PREVAIL II Study Team, Davey RT Jr, Dodd L, Proschan MA, Neaton J, Neuhaus Nordwall J, Koopmeiners JS et al (2016). A Randomized, Controlled Trial of ZMapp for Ebola Virus Infection. N Engl J Med. ;375(15): Ramon G Sur le pouvoir floculant et sur le propriétés immunisantes d une toxine diphthérique rendue anatoxique (anatoxine). C R Acad Sci Paris 177: Panisset M. (1949); Gaston Ramon découvrait les anatoxines. Can J Comp Med Vet Sci Mar;13(3): DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T 351
185 Sie erklärten mit ihren Arbeiten, wie mikrobielle Strukturen über definierte Rezeptoren die Immunantwort regulieren können. Heute gelten Impfstoffe als eine der kosteneffektivsten Maßnahmen der Medizin. Durch nur eine auf den modernsten immunologischen Erkenntnissen aufbauende rationale Impfstoffentwicklung können auch zukünftig präventive Erfolge für das Individuum und die Gesellschaft erzielt werden. Dies gilt besonders für die»großen«seuchen AIDS, Tuberkulose, Malaria und Hepatitis C, die wir noch immer nicht im Griff haben. 31 Wagner H (2012). Innate immunity s path to the Nobel Prize 2011 and beyond. Eur. J. Immunol. 42: DIE BEDEU T UNG DER IMMUNOLO GIE FÜR DIE HEU TIGE GESELLSCH A F T
186 V. Anhang
187 Abkürzungsverzeichnis AAI AdW AIDS AIHA AK AKGA AKI AKRI ASI BÄK BArch BCG Ber. dtsch. chem. Ges BGA BKW BRD BSI CCII CLL CSI DDR DFG DGAI DGAKI DGfI DKFZ DM DMW DRFZ EAACI ECI EFIS EJI ELISA EULAR FDA FWH GAA GfI HFR HIV HLA HPV HUS IBD ICI IET IN American Association of Immunologists Akademie der Wissenschaften Acquired Immune Deficiency Syndrome Autoimmunhämolytische Anämie Arbeitskreis Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte Arbeitskreis Klinische Immunologie Arbeitskreis Reproduktionsimmunologie Australische Gesellschaft für Immunologie Bundesärztekammer Bundesarchiv Bacillus Calmette-Guérin Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft Bundesgesundheitsamt Berliner Klinische Wochenschrift Bundesrepublik Deutschland British Society for Immunology Current Concept in Immunology Chronische Lymphatische Leukämie Chinesische Gesellschaft für Immunologie Deutsche Demokratische Republik Deutsche Forschungsgemeinschaft Deutsche Gesellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung Deutsche Gesellschaft für Allergie und Klinische Immunologie Deutsche Gesellschaft für Immunologie Deutsches Krebsforschungszentrum Deutsche Mark Deutsche Medizinische Wochenschrift Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin European Academy of Allergy and Clinical Immunology European Congress of Immunology European Federation of Immunological Societies European Journal of Immunology Enzyme-linked immune Assay European League Against Rheumatism Food and Drug Administration Farbwerke Meister Lucius & Brüning in Höchst Gesellschaft für Allergie- und Asthmaforschung Gesellschaft für Immunologie Hauptforschungsrichtung Humanes Immundefizienz-Virus Humanes Leukozytenantigen Humane Papillomaviren Hämolytisch-Urämisches Syndrom entzündliche Darmerkrankungen (inflammatory bowl disease) International Congress of Immunology Königlich Preußisches Institut für experimentelle Therapie (Frankfurt am Main), später in Paul-Ehrlich-Institut umbenannt Immunologische Nachrichten ANH ANG 355
188 ISS Königlich Preußisches Institut für Serumforschung und Serumprüfung ( Berlin-Steglitz) ( ) ITP autoimmune Thrombozytopenie IUIS International Union of Immunological Societies IVIG intravenöse Infusion von Immunglobulinen JSI Japanese Society for Immunology KGA Kaiserliches Gesundheitsamt (Berlin) KWG Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft KWI Kaiser-Wilhelm-Institut MKGA Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte MPG Max-Planck-Gesellschaft MPI Max-Planck-Institut mrna messenger Ribo Nucleic Acid MS Multiple Sklerose NGS Next Generation Sequencing NHL Non-Hodgkin-Lymphom NK-Zellen Natürliche Killer-Zellen NLH HA Niedersächsisches Landeshauptarchiv Hannover OA Original-Ausgabe o. D. ohne Datum ÖGAI Österreichische Gesellschaft für Allergie und Immunologie OK Organisationkomitee PEI Paul-Ehrlich-Institut PII/RKI Königlich Preußisches Institut für Infektionskrankheiten, später Umbenennung in Robert-Koch-Institut PNH Paroxysmal Hemolytic anemia Ps Psoriasis PsA PsoriasisArthritis PUVA Psoralen plus UV-A (auch Photochemotherapie) RA Rheumatoide Arthritis RCAI Research Center for Allergy and Immunology RGW Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe RKI Robert Koch-Institut SAI Argentinische Gesellschaft für Immunologie SARS Severe Acute Respiratory Syndrome SCIG Subkutane Infusion von Immunglobulinen SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SFI Französische Gesellschaft für Immunologie SIICA Italienische Gesellschaft für Immunologie SLE Systemischer Lupus Erythematodes SPA Spondyloarthritis SSOI Spring School on Immunology TIS Translational Immunology School TNF Tumornekrosefaktor Treg regulatorische T-Zellen WES Whole Exome Sequencing WGS Whole Genome Sequencing WHO World Health Organization ZHI Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten ZIET Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie ZIK Zentralinstitut für Krebsforschung Kurzviten der Redaktionsmitglieder Herwart Ambrosius, Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. med. h. c., Studium der Biologie und Chemie an der Universität Leipzig. Professor für Tierphysiologie und Immunbiologie der Sektion Biowissenschaften der Universität Leipzig Vorsitzender der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR. Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI). Klaus Eichmann, Prof. em. Dr. med. Dr. med. h. c., Studium der Medizin in Marburg und München. Forschungsaufenthalt in der Immunologie an der Rockefeller University, New York, USA. Immunologische Forschung mit Schwerpunkt zelluläre Immunologie am Institut für Genetik, Universität Köln und am Deutschen Krebsforschungszentrum, Heidelberg bis 2004 Direktor am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg im Breisgau bis 1995 Präsident der European Federation of Immunological Societies (EFIS). Frank Emmrich, Prof. Dr. med., Humanmediziner, Professor für Klinische Immunologie; Stationen: DKFZ Heidelberg, MPI Immunbiologie Freiburg, Universität und MPI Erlangen, Direktor des Instituts für Klinische Immunologie der Universität Leipzig (bis 2016), Deutscher Ethikrat ( ); seit 2005 Institutsleiter Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) Leipzig; Schwerpunkte: zelluläre Immunologie, immunologische Toleranz; Zellbiologie, Regenerative Medizin. Diethard Gemsa, Prof. em. Dr. med., Medizinstudium in Berlin und Freiburg. Tätigkeiten in Seattle, Mainz, San Francisco, Heidelberg, Hannover und Marburg. Fächer: Innere Medizin, Immunologie, Transfusionsmedizin, Immunpharmakologie. Habilitation 1974 in Heidelberg Leiter des Instituts für Immunologie der Universität Marburg Editor-in-Chief von»immunobiology« Mitglied des DFG-Senats-und Bewilligungsausschusses für SFBs. Agnes Giniewski, Dr. rer. nat., Studium der Biologie in Erlangen und Karlsruhe. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Erlangen und Koordinatorin der Initiative»Immunologie für Jedermann«der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Volker Hess, Prof. Dr., Studium der Philosophie und Medizin in Konstanz und Berlin. Promotion 1991, Habilitation (1999) im Fach Geschichte und Theorie der Medizin, 2000 Karl Schädler Research Fellow am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Seit Sommer 2004 Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité Berlin, ERC Advanced Investigator Grantee. Annette Hinz-Wessels, Dr. phil., Studium der Geschichte, der Politikwissenschaft und des Staatsrechts in Heidelberg und Bonn. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Charité (Universitätsmedizin Berlin). Jacqueline Hirscher, seit 2001 im Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin als Assistentin der Geschäftsstelle des Kompetenznetzes Rheuma Wechsel in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit am DRFZ. Theresa Hoppe, bis 2013 Assistenz der Geschäftsleitung verschiedener Firmen im Bereich Wirtschaft und Marketing. Seit 2013 Assistenz der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Axel C. Hüntelmann, Studium der Betriebswirtschaft (FH) in Vechta und der Neueren Geschichte, Mediävistik und Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Dissertation an der Universität Bremen zum Reichsgesundheitsamt. Publikationen zur Geschichte der Versuchstiere, der öffentlichen Gesundheitspflege in Europa und Verfasser einer Biographie zu Paul Ehrlich. Derzeit Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin an der Charité in Berlin mit einem Projekt zur Buchführung in der Medizin. 356 ANH ANG ANH ANG 357
189 Hans-Martin Jäck, Prof. Dr. rer. nat., Biochemiestudium an der Universität Tübingen, Doktorand am MPI Tübingen, Basel Institute of Immunology und an der University of California San Francisco von , Postdoc an der University of California San Francisco, Professor für Immunologie an der Loyola University of Chicago und seit 1997 Leiter der Abteilung für Molekulare Immunologie am Universitätsklinikum Erlangen Präsident der DGfI. Lothar Jäger, Dr. med. habil. Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Immunologie. Medizinstudium an der Universität Jena. Studienaufenthalte in Moskau, Basel, London und La Jolla Berufung zum Ordinarius für Innere Medizin an der Med. Univ.-Poliklinik Gründungsdirektor des Instituts für Klinische Immunologie an der FSU. Schwerpunkte: Allergologie, rheumat. Erkrankungen, Immundefekte. Drei Wahlperioden Vorsitzender der Gesellschaft für klinische und experimentelle Immunologie der DDR. Nach der Wende eine Wahlperiode im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Mitglied der Leopoldina. Emeritierung Ottmar Janßen, Prof. Dr. rer. biol. hum., Biologiestudium an der Universität Ulm, Doktorand in der Abt. Medizinischen Mikrobiologie und Immunologie der Universität Ulm, Postdoc am Institut für Immunologie in Heidelberg Von 1992 bis 1994 Postdoc und Research Associate in der Abt. Tumor Immunology am Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston Laborleitung Biochemie in der Abteilung Immunologie am Paul-Ehrlich-Institut in Langen Laborleitung Biochemie im Institut für Immunologie am UKSH in Kiel, seit 2006 Professor für Molekulare Immunologie ebendort. Seit 2012 Koordinator der DGfI-Arbeitskreise. Jürgen Kaden, Dr. med., Facharzt für Immunologie (1974), Doctor scientiae medicinae (Dr. sc. med., 1982) Honorardozent für Immunologie (Humboldt-Universität zu Berlin, 1990). Ab 1971 Forschungsaufgaben an der Charité, ab 1976 bis zur Pensionierung Laborleiter in den Berliner Krankenhäusern im Friedrichshain und Am Urban. Spezialgebiete: Transplantationsimmunologie, Autoimmun- und Infektionsdiagnostik. Sekretär der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie der DDR ( ). Gründungsmitglied der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Seit 2008 im Aufsichtsrat der Euroimmun AG. Joachim R. Kalden, Prof. em. Dr. med. Dr. h. c. mult., Facharzt für Innere Medizin. Nach dem Studium vier Jahre Aufenthalt als Research Fellow am Department of Therapeutics, University of Edinburgh and the Medical Research Council`s Clinical Endocrinology Univ, University of Edinburgh, Scotland sowie wiederholte Forschungsaufenthalte am NIH, Bethesda, Washington. Von 1983 bis 1990 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Präsident der European League against Rheumatism (EULAR), Direktor der Medizinischen Klinik 3 und des Instituts für Klinische Immunologie. Forschungsschwerpunkte: Pathogenese und Therapieoptionen bei Autoimmunerkrankungen. Stefan H.E. Kaufmann, Dr. rer. nat., Dr. h. c., Professor für Mikrobiologie und Immunologie am Universitätsklinikum Charité. Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie, Leiter der Abteilung Immunologie. Früherer Präsident von DGfI, EFIS und IUIS; Ehrenmitglied der DGfI; Vorsitzender des Stiftungsbeirats der Schering Stiftung und Mitglied des Vorstands der Robert-Koch-Stiftung; Mitglied zahlreicher Akademien, u. a. EMBO und Leopoldina. Forschungsinteresse: Infektionsimmunologie mit Schwerpunkt auf Impfstoff- und Biomarker-Entwicklung bei der Tuberkulose. Fritz Melchers, Prof. Dr. rer. nat., Doktorand an der Universität Köln, Postdoktorand am Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA und am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Berlin; ehemaliges Mitglied und späterer Direktor des Instituts für Immunologie Basel, Schweiz; Max Planck Fellow am Max Planck Institut für Infektionsbiologie. Früherer Präsident der DGfI und der IUIS. Seit 2017 Senior Scientist am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum. Ulrike Meltzer, Dr. rer. nat., Studium der Genetik/Mikrobiologie und Promotion/Postdoc Immunologie in London. Seit 2008 Führung der Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Stefan Meuer, Prof. Dr. med., Internist, Med. Mikrobiologe, Zusatzbezeichnung Bluttransfusionswesen, Fachimmunologe DGfI Prof. für»angewandte Immunologie«, Deutsches Krebsforschungszentrum, seit 1995 Ordinarius für»allgemeine Immunologie«Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Direktor des Instituts für Immunologie, Präsident der DGfI. Sophie Meyer, Dr. phil, Studium der Geschichte und Romanistik in Bamberg, Palermo, Berlin und Budapest. Freiberufliche Dozentin. Florian Neumann, Dr. phil., Studium der Geschichte, Philosophie und Romanistik in Frankfurt am Main, Padua, Rom und München. Nach Lehrtätigkeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München 2001 Gründung des Unternehmens Neumann & Kamp für Dienstleistungen rund um das Thema Geschichte (Recherchen, Publikationen, Ausstellungen, Filme, Aufbau und Verwaltung von Archiven). Als Geschäftsführer von Neumann & Kamp selbständiger Unternehmer und freier Autor. Hans-Hartmut Peter, Prof. em. Dr. med., Studium der Medizin in Marburg, Paris, Heidelberg, Promotion 1967 am DKFZ Heidelberg, Postdoktorate im frz. Tumorzentrum Villejuif und in Scripps Clinic, La Jolla Ca. USA. Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie. Habilitation 1976 an der Med. Hochschule Hannover über Formen Zellulärer Zytotoxizität Ärztl. Direktor der Abt. Rheumatologie und Klinische Immunologie am Universitätsklinikum Freiburg. Sprecher des SFB620»Immundefizienz«und Mitbegründer des Centrums für Chronische Immundefizienz. DGfI Präsidentschaft Martin Röllinghoff, Prof. Dr. med., Studium der Medizin in Freiburg, Wien und Tübingen; wissenschaftl. Arbeit in Mainz, Melbourne und Erlangen über Complement, T-Zellen, Interleukine und Zellvermittelte Infektionsimmunologie, Leiter des Erlanger Instituts für klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene und Präsident der DGfI. Reinhold Schmidt, Prof. Dr. med., Dipl.-Psych., Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, Allergologie, Infektiologie, Fachimmunologe, seit 1976 in der Gesellschaft für Immunologie, seit 1996 Direktor der Klinik für Immunologie und Rheumatologie, Medizinische Hochschule Hannover, Dekan der Hannover Biomedical Research School (HBRS) EFIS Board, Präsident der DGfI, seit 2007 Vorsitzender des Gemeinsamen Wissenschaftlichen Beirats (GWB) der Institute des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), seit 2007 Mitglied der Nationalen Akademie der Naturforscher Leopoldina, seit 2007 Council Member IUIS, seit 2010 Chair Clinical Immunology Committee der IUIS. Carsten Watzl, Prof. Dr. rer. nat., Biologiestudium an der Universität Heidelberg, Doktorand am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg, Postdoc am National Institutes of Health, USA. Nachwuchsgruppenleiter am Institut für Immunologie Heidelberg und seit 2011 Professor und wissenschaftlicher Direktor am Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo). Seit 2013 Generalsekretär der DGfI. Ger van Zandbergen, Prof. Dr., Studium der Biologie an der Universität Groningen und Promotion in Leiden/Niederlande. Mit Fokus auf Infektionen menschlicher Immunzellen ab 2000 Tätigkeit am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck und ab 2007 am Universitätsklinikum Ulm Übernahme der Leitung der Abteilung Immunologie des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen und 2014 zusätzlich Professur für Infektionsimmunologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 358 ANH ANG ANH ANG 359
190 Abbildungsnachweis Akira, Shizuo S. 313 (Rh. 5, Bd. 2) Albert and Mary Lasker Foundation S. 313 (Rh. 2, Bd. 1) Ambrosius, Herwart Vom Kampf in unserem Körper, Urania-Verlag Leipzig, 1969 S. 225 Arbeiten aus dem Staatsinstitut für experimentelle Therapie und dem Georg Speyer-Hause zu Frankfurt a. M., Bd. 21, 1928 S. 77 Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin S. 92, 98, 125, 129, 140, 142, 170 l. (Foto: Peter Blachain), 242 Archiv der Pressestelle der Medizinischen Hochschule Hannover S. 213 Archiv Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband; Bernd-Rendel-Stiftung S. 256, 305 o. Mi. Archiv DGfI S. 240, 241, 244, 245, 250, 254, 265, 295 (Foto: Jens Riedel), 285 (Foto: M. Kirschfink, Heidelberg), 287, 289, 297, 299 (Foto: Guido Rottmann), 300 (Foto: Guido Rottmann), 303, 304, 305 o. r. (Foto: Guido Rottmann), 305 u. l., 305 u. Mi., 305 u. r., 306 o. l., 306 o. Mi., 306 o. r. (Foto: J. Hirscher), 306 u. r. (Foto: J. Hirscher), 306 u. Mi., 306 u. r., 307 o. Mi., 307 o. r., 307 u. l., 307 u. Mi., 307 u. r., 309 o. l., 309 o. Mi., 309 o. r., 309 u. l., 309 u. Mi., 309 u. r., 310, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 329 (Foto: Jacqueline Hirscher), 332 (Foto: Conventus), 333 (Foto Conventus), 335, 336, 337 (Fotos: J. Hirscher, DRFZ Berlin; J. Brandel, Universitätsklinikum Freiburg; G. Griffante, GK1660;»Medizinische Hochschule Hannover«; Plakat: GK1660) Archiv DRFZ S. 307 o. l., 313 (Rh. 7, Bd. 1) Archiv Yale University S. 313 (Rh. 4, Bd. 1) Behring, Emil von: Therapeutische Tierexperimente im Dienste der Seuchenbekämpfung, in: Der Mensch und die Erde, Bd. 2, 1906 S. 42 Behring-Archiv, Marburg S. 103, 106 (Signatur / U-I/Nr II, Nachlass Engelhardt), 131 Behringwerk-Mitteilungen, Heft 37, Prof. Dr. Hermann E. Schultze zum 60. Geburtstag, Marburg 1959 S. 203 l. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, Hamburg S. 177 Bundesarchiv S. 114 (R 9361/III Nr ), 117 (R 73 Nr ), 279 (Foto: Peter Grimm) Cooper, Max S. 313 (Rh. 5, Bd. 1) CSL Behring S. 203 r. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Forschungsbericht Rhesusfaktor negativ, 1973, Boldt S. 197 Deutsche Medicinische Wochenschrift, 1890 S. 14 Dietrich, Manfred S. 207 Ehrlich, Paul: On Immunity with Special Reference to Cell Life, in: Proceedings of the Royal Society, Band 66, 1900 S. 55 Fischer, Alain S. 313 (Rh. 6, Bd. 1) Friedrich-Loeffler-Institut, Fotoarchiv S. 24 Gayling-Westphal, Nikolaus von (Sohn) S. 136 Georg-Speyer-Haus, Frankfurt/Main S. 89 Henry Kunkel Society S. 313 (Rh. 1, Bd. 3) Hirszfeld, Ludwik: The Story of One Life, Rochester 2010 S. 61 r. Howard Hughes Medical Institue, University of Colorado School of Medicine S. 313 (Rh. 4 Bd. 3, Foto: Beth Woods) Humboldt-Universität Berlin, Universitätsarchiv, Bestand DGKJ (Seidler 18) S. 99 Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charité Universitätsmedizin Berlin S. 86, 95 Istituto Superiore di Sanità S. 313 (Rh. 4, Bd. 3) Jäger, Lothar S. 229, 269, 270, 277, 308 o. l., 308 o. Mi., 308 o. r., 308 u. l., 308 u. Mi., 308 u. r., 310 o. l., 310 o. Mi. Kaden, Jürgen S. 310 o. r. Karolinska Institutet S. 313 (Rh. 2, Bd. 4, Rh. 4, Bd. 2, Foto: Frederik Persson) Kauffmann, Fritz: Erinnerungen eines Bakteriologen, Kopenhagen 1969 S. 165 Krammer, Peter S. 313 (Rh. 3, Bd. 5) Landesarchiv Thüringen Hauptstaatsarchiv Weimar, Konzentrationslager und Haftanstalten Buchenwald S. 110 (Nr. 62, Bl. 5r) Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin S. 147 r., 313 (Rh. 1, Bd. 4) Max-Planck-Institut für Immunbiologie, Freiburg S. 170 r. Melchers, Fritz S. 173 Möllers, Bernhard: Robert Koch. Persönlichkeit und Lebenswerk, , Hannover 1950 S. 15, 51 Mosmann, Tim S. 313 (Rh. 3, Bd. 3) Neumann, Herbert A.: Paul Uhlenhuth, Ein Leben für die Forschung, Berlin 2004 S. 62 ANH ANG 361
191 Oppenheim, Joe S. 313 (Rh. 2, Bd. 5) Pasternak, Günter S. 227 l. Paul-Ehrlich-Institut S. 43 Peter, Hans-Hartmut S. 183 Ploegh, Hidde S. 313 (Rh. 3, Bd. 6) Preußischer Minister der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten (Hrsg): Medizinische Anstalten auf dem Gebiete der Volksgesundheitspflege in Preußen, Jena 1907 S. 34 Privatbesitz S. 85, 227 r., 266 (Fotos: Werner Weitzel, Frankfurt), 305 o. l. Rammensee, Hans Georg S. 313 (Rh. 3, Bd. 2) Reichsgesundheitsamt (Hrsg.), Das Reichsgesundheitsamt , Berlin 1926 S. 21 Robert Koch-Institut, Berlin S. 90 Rockefeller Archive Center, Paul Ehrlich Collection (650 Eh 89) S. 37 Rockefeller University records, Photographs, Record Group 1100, Box 8, Folder 3, Image #450G55-28 S. 313 (Rh. 1, Bd. 1) Rüde, Erwin S. 138, 162 Société Française d Immunologie S. 313 (Rh. 1, Bd. 2) Stadtarchiv Bad Säckingen S. 135 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.v., Essen S. 179 Teitge (Hrsg), Behring-Institut Lemberg. Reden und wissenschaftliche Vorträge anlässlich der Eröffnung der Fleckfieber-Forschungsstätte. Lemberg, den 10./11. Dezember 1942, Krakau 1944 S. 109, 112 U.S. National Library of Medicine, The Michael Heidelberger Papers (Fundort) S. 157 Universitätsarchiv Heidelberg S. 61 l., S. 189 Universitätsarchiv Mainz S. 147 l. Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Porträtsammlung S. 93 Wander AG, Bern S. 139 (Foto: Photo-Stober) Wellcome Library London, Wellcome Images S. 41 Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), Lisa von Boehmer 2008, S. 313 (Rh. 3, Bd. 1) Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), User S. 313 (Rh. 2, Bd. 2) Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0), Holger Motzkau 2010, S. 313 (Rh. 3, Bd. 4) Zeiss, Heinz/Bieling, Richard: Emil von Behring. Gestalt und Werk, Berlin 1941 S. 29 Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, Bd /1909, Heft 1 S. 70, 71 trillium immunologie 362 ANH ANG
192
Die Impfung Quelle: wikipedia.de
 Die Impfung Quelle: wikipedia.de Die Impfung ist eine vorbeugende Maßnahme gegen verschiedene Infektionskrankheiten und wird deshalb auch Schutzimpfung genannt. Man unterscheidet aktive Impfung und passive
Die Impfung Quelle: wikipedia.de Die Impfung ist eine vorbeugende Maßnahme gegen verschiedene Infektionskrankheiten und wird deshalb auch Schutzimpfung genannt. Man unterscheidet aktive Impfung und passive
NDB-Artikel. Deutsche Biographie Onlinefassung. Frosch, Paul Max Otto Tiermediziner, * Berlin, Berlin.
 Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Frosch, Paul Max Otto Tiermediziner, * 15.8.1860 Berlin, 2.6.1928 Berlin. (lutherisch) Genealogie V Leopold Otto (* 1838), Rechtsanwalt u. Notar in B., Kaufm.-S;
Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Frosch, Paul Max Otto Tiermediziner, * 15.8.1860 Berlin, 2.6.1928 Berlin. (lutherisch) Genealogie V Leopold Otto (* 1838), Rechtsanwalt u. Notar in B., Kaufm.-S;
Deutsche Biographie Onlinefassung
 Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Morgenroth, Julius Bakteriologe, Immunologe, Mitbegründer der Chemotherapie, * 19.10.1871 Bamberg, 20.12.1924 Berlin. (israelitisch) Genealogie V Herz, dann
Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Morgenroth, Julius Bakteriologe, Immunologe, Mitbegründer der Chemotherapie, * 19.10.1871 Bamberg, 20.12.1924 Berlin. (israelitisch) Genealogie V Herz, dann
Im Kampf gegen Erreger unser Immunsystem
 IV Der Mensch Beitrag 8 Unser Immunsystem (Klasse 7/8) 1 von 26 Im Kampf gegen Erreger unser Immunsystem Gerd Rothfuchs, Etschberg Unser Immunsystem schützt uns jeden Tag zuverlässig vor Schädigungen durch
IV Der Mensch Beitrag 8 Unser Immunsystem (Klasse 7/8) 1 von 26 Im Kampf gegen Erreger unser Immunsystem Gerd Rothfuchs, Etschberg Unser Immunsystem schützt uns jeden Tag zuverlässig vor Schädigungen durch
Wurdest du schon einmal geimpft?
 Wurdest du schon einmal geimpft? Unsere Immunabwehr ist ein ausgeklügeltes System, das sich darauf versteht, verschiedenste Arten von Erregern zu eliminieren. Wenn gefährliche Bakterien oder Viren unseren
Wurdest du schon einmal geimpft? Unsere Immunabwehr ist ein ausgeklügeltes System, das sich darauf versteht, verschiedenste Arten von Erregern zu eliminieren. Wenn gefährliche Bakterien oder Viren unseren
Wie überlebt Helicobacter pylori im Magen?
 Wie überlebt Helicobacter pylori im Magen? Menschen könnten ohne Mikroorganismen nicht existieren. A. Richtig B. Falsch Kao et al., Biomed J. 39:14-23, 2016 Kapitel 1:1 Menschen könnten ohne Mikroorganismen
Wie überlebt Helicobacter pylori im Magen? Menschen könnten ohne Mikroorganismen nicht existieren. A. Richtig B. Falsch Kao et al., Biomed J. 39:14-23, 2016 Kapitel 1:1 Menschen könnten ohne Mikroorganismen
Neue und alte Infektionskrankheiten
 Neue und alte Infektionskrankheiten Markus Fischer (Hrsg.) Neue und alte Infektionskrankheiten Herausgeber Markus Fischer Hamburg, Deutschland ISBN 978-3-658-04123-6 DOI 10.1007/978-3-658-04124-3 ISBN
Neue und alte Infektionskrankheiten Markus Fischer (Hrsg.) Neue und alte Infektionskrankheiten Herausgeber Markus Fischer Hamburg, Deutschland ISBN 978-3-658-04123-6 DOI 10.1007/978-3-658-04124-3 ISBN
Ratgeber Parkinson Leplow-RFdP-Titelei.indd :15:28
 Ratgeber Parkinson Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 16 Ratgeber Parkinson von Prof. Dr. Bernd Leplow Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Prof.
Ratgeber Parkinson Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 16 Ratgeber Parkinson von Prof. Dr. Bernd Leplow Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Prof.
Prävention, was ist das? Zur Prävention gehören:
 Prävention, was ist das? Im engeren Sinne der Praxis-Hygiene verstehen wir unter Prävention vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten. Zur Prävention gehören: Aufklärung über gesunde Lebensführung
Prävention, was ist das? Im engeren Sinne der Praxis-Hygiene verstehen wir unter Prävention vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten. Zur Prävention gehören: Aufklärung über gesunde Lebensführung
Stephan Schwingeler. Die Raummaschine. Raum und Perspektive im Computerspiel
 3 Stephan Schwingeler Die Raummaschine Raum und Perspektive im Computerspiel S. Schwingeler: Die Raummaschine Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
3 Stephan Schwingeler Die Raummaschine Raum und Perspektive im Computerspiel S. Schwingeler: Die Raummaschine Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
VORTRÄGE N 441. Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften HERBERT PALME STEFAN H. E. KAUFMANN
 Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften VORTRÄGE N 441 HERBERT PALME Meteorite und die Bildung der inneren Planeten des Sonnensystems STEFAN H. E. KAUFMANN Immunität und Infektion Westdeutscher
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften VORTRÄGE N 441 HERBERT PALME Meteorite und die Bildung der inneren Planeten des Sonnensystems STEFAN H. E. KAUFMANN Immunität und Infektion Westdeutscher
Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung
 Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung Reingard.grabherr@boku.ac.at Traditionelle Impfstoffentwicklung Traditionelle Impfstoffentwicklung Louis Pasteur in his laboratory, painting by A. Edelfeldt
Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung Reingard.grabherr@boku.ac.at Traditionelle Impfstoffentwicklung Traditionelle Impfstoffentwicklung Louis Pasteur in his laboratory, painting by A. Edelfeldt
TETANUS RATGEBER. Alles zum Thema Tetanus Impfung
 TETANUS RATGEBER Alles zum Thema Tetanus Impfung Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile
TETANUS RATGEBER Alles zum Thema Tetanus Impfung Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile
Felix Huth. Straßenkinder in Duala
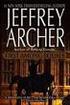 Felix Huth Straßenkinder in Duala VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten
Felix Huth Straßenkinder in Duala VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten
CLAUDE BERNARD. Einführung in das Studium der experimentellen Medizin (Paris 1865) Ins Deutsche übertragen. von
 CLAUDE BERNARD Einführung in das Studium der experimentellen Medizin (Paris 1865) Ins Deutsche übertragen von PAUL SZENDRÖ und biographisch eingeführt und kommentiert von KARL E. ROTHSCHUH Mit einem Anhang
CLAUDE BERNARD Einführung in das Studium der experimentellen Medizin (Paris 1865) Ins Deutsche übertragen von PAUL SZENDRÖ und biographisch eingeführt und kommentiert von KARL E. ROTHSCHUH Mit einem Anhang
Hygiene. Lernfeld 3. Hygiene ist die Lehre von der Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Definition des Wortes Hygiene
 Lernfeld 3 Hygiene Definition des Wortes Hygiene Hygiene ist die Lehre von der Erhaltung und Förderung der Gesundheit Definition des Wortes Gesundheit? Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen,
Lernfeld 3 Hygiene Definition des Wortes Hygiene Hygiene ist die Lehre von der Erhaltung und Förderung der Gesundheit Definition des Wortes Gesundheit? Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen,
Erkenntnisse und Irrtümer in Medizin und Naturwissenschaften
 Erkenntnisse und Irrtümer in Medizin und Naturwissenschaften Hans R. Kricheldorf Erkenntnisse und Irrtümer in Medizin und Naturwissenschaften Hans R. Kricheldorf Institute for Technical and Makromolekular
Erkenntnisse und Irrtümer in Medizin und Naturwissenschaften Hans R. Kricheldorf Erkenntnisse und Irrtümer in Medizin und Naturwissenschaften Hans R. Kricheldorf Institute for Technical and Makromolekular
Bettina Heberer. Grüne Gentechnik. Hintergründe, Chancen und Risiken
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Mit Tieren leben im Alter
 Marianne Gäng, Dennis C. Turner (Hg.) Mit Tieren leben im Alter Mit Beiträgen von Hans-Peter Gäng, Marianne Gäng, Antoine F. Goetschel, Christian Große-Siestrup/ Sabine Dittrich, Barbara Grunder, Jürg
Marianne Gäng, Dennis C. Turner (Hg.) Mit Tieren leben im Alter Mit Beiträgen von Hans-Peter Gäng, Marianne Gäng, Antoine F. Goetschel, Christian Große-Siestrup/ Sabine Dittrich, Barbara Grunder, Jürg
UNIVERSITÄTS- UND LANDESBIBLIOTHEK DÜSSELDORF KATALOGE DER HANDSCHRIFTENABTEILUNG. Herausgegeben von Irmgard Siebert. Band 3
 UNIVERSITÄTS- UND LANDESBIBLIOTHEK DÜSSELDORF KATALOGE DER HANDSCHRIFTENABTEILUNG Herausgegeben von Irmgard Siebert Band 3 2012 Harrassowitz Verlag Wiesbaden 186792-OHV-Titelei.indd 2 17.09.12 12:10 Die
UNIVERSITÄTS- UND LANDESBIBLIOTHEK DÜSSELDORF KATALOGE DER HANDSCHRIFTENABTEILUNG Herausgegeben von Irmgard Siebert Band 3 2012 Harrassowitz Verlag Wiesbaden 186792-OHV-Titelei.indd 2 17.09.12 12:10 Die
PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG IM KRANKHEITS- VERLAUF
 Reha-Psychologie Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation BDP (Hrsg.) PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG IM KRANKHEITS- VERLAUF Beiträge zur 30. Jahrestagung des Arbeitskreises Klinische Psychologie
Reha-Psychologie Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation BDP (Hrsg.) PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG IM KRANKHEITS- VERLAUF Beiträge zur 30. Jahrestagung des Arbeitskreises Klinische Psychologie
Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion
 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion Fortschritte der Psychotherapie Band 39 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion von Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel und Dipl.-Psych. Sybille Hubert Herausgeber
Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion Fortschritte der Psychotherapie Band 39 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion von Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel und Dipl.-Psych. Sybille Hubert Herausgeber
VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES LESETEXTES
 VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES LESETEXTES Justus Liebig einer der bedeutendsten deutschen Chemiker 1 2 3 4 5 6 Die deutsche Regierung und wichtige Chemieorganisationen haben das Jahr 2003 zum Jahr der
VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES LESETEXTES Justus Liebig einer der bedeutendsten deutschen Chemiker 1 2 3 4 5 6 Die deutsche Regierung und wichtige Chemieorganisationen haben das Jahr 2003 zum Jahr der
Hygiene in Kindertagesstätten
 Hygiene in Kindertagesstätten Ronald Giemulla Sebastian Schulz-Stübner Hygiene in Kindertagesstätten Fragen und Antworten Mit 43 Abbildungen 123 Ronald Giemulla Deutsches Beratungszentrum für Hygiene Außenstelle
Hygiene in Kindertagesstätten Ronald Giemulla Sebastian Schulz-Stübner Hygiene in Kindertagesstätten Fragen und Antworten Mit 43 Abbildungen 123 Ronald Giemulla Deutsches Beratungszentrum für Hygiene Außenstelle
Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.) Jahrbuch zur Mittelstandsforschung 1/2007
 Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.) Jahrbuch zur Mittelstandsforschung 1/2007 GABLER EDITION WISSENSCHAFT Schriften zur Mittelstandsforschung Nr. 115 NF Herausgegeben vom Institut für Mittelstandsforschung
Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.) Jahrbuch zur Mittelstandsforschung 1/2007 GABLER EDITION WISSENSCHAFT Schriften zur Mittelstandsforschung Nr. 115 NF Herausgegeben vom Institut für Mittelstandsforschung
Neuropsychologie der Alkoholabhängigkeit
 Neuropsychologie der Alkoholabhängigkeit Fortschritte der Neuropsychologie Band 8 Neuropsychologie der Alkoholabhängigkeit von Dr. Armin Scheurich und Dr. Barbara Brokate Herausgeber der Reihe: Prof. Dr.
Neuropsychologie der Alkoholabhängigkeit Fortschritte der Neuropsychologie Band 8 Neuropsychologie der Alkoholabhängigkeit von Dr. Armin Scheurich und Dr. Barbara Brokate Herausgeber der Reihe: Prof. Dr.
Die deutsch-französischen Beziehungen von der Wiedervereinigung zum Maastrichter Vertrag
 Bachelorarbeit Johannes Müller Die deutsch-französischen Beziehungen von der Wiedervereinigung zum Maastrichter Vertrag Die Rolle Helmut Kohls und François Mitterrands Bachelor + Master Publishing Müller,
Bachelorarbeit Johannes Müller Die deutsch-französischen Beziehungen von der Wiedervereinigung zum Maastrichter Vertrag Die Rolle Helmut Kohls und François Mitterrands Bachelor + Master Publishing Müller,
Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien
 Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Zur Darstellung und Wirkung eines
Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Zur Darstellung und Wirkung eines
Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft
 Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft Herausgegeben von G. Bentele, Leipzig, Deutschland H.-B. Brosius, München, Deutschland O. Jarren, Zürich, Schweiz Herausgeber und Verlag streben mit
Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft Herausgegeben von G. Bentele, Leipzig, Deutschland H.-B. Brosius, München, Deutschland O. Jarren, Zürich, Schweiz Herausgeber und Verlag streben mit
Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden
 Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Bernd Nitzschke (Hrsg.) Die Psychoanalyse Sigmund Freuds
 Bernd Nitzschke (Hrsg.) Die Psychoanalyse Sigmund Freuds Schlüsseltexte der Psychologie Herausgegeben von Helmut E. Lück Dem Lebenswerk und den Originalschriften der großen Psychologen wie Wundt, Freud,
Bernd Nitzschke (Hrsg.) Die Psychoanalyse Sigmund Freuds Schlüsseltexte der Psychologie Herausgegeben von Helmut E. Lück Dem Lebenswerk und den Originalschriften der großen Psychologen wie Wundt, Freud,
Egbert Jahn. Frieden und Konflikt
 Egbert Jahn Frieden und Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) Bernhard Frevel (Fachhochschule
Egbert Jahn Frieden und Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) Bernhard Frevel (Fachhochschule
Dr. Christophe LAMBERT ZSVA Centre Hospitalier Métropole Savoie, Frankreich. JSSH, 17. & 18. Juni 2015, Biel
 Dr. Christophe LAMBERT ZSVA Centre Hospitalier Métropole Savoie, Frankreich JSSH, 17. & 18. Juni 2015, Biel «Eine Wissenschaft kennt man nur dann gut, wenn man auch ihre Geschichte kennt.» Auguste Comte
Dr. Christophe LAMBERT ZSVA Centre Hospitalier Métropole Savoie, Frankreich JSSH, 17. & 18. Juni 2015, Biel «Eine Wissenschaft kennt man nur dann gut, wenn man auch ihre Geschichte kennt.» Auguste Comte
Matthias Perkams Selbstbewusstein in der Spätantike
 Matthias Perkams Selbstbewusstein in der Spätantike Quellen und Studien zur Philosophie Herausgegeben von Jens Halfwassen, Dominik Perler, Michael Quante Band 85 Walter de Gruyter Berlin New York Selbstbewusstein
Matthias Perkams Selbstbewusstein in der Spätantike Quellen und Studien zur Philosophie Herausgegeben von Jens Halfwassen, Dominik Perler, Michael Quante Band 85 Walter de Gruyter Berlin New York Selbstbewusstein
Carl Schmitts Rolle bei der Machtkonsolidierung der Nationalsozialisten
 Carl Schmitts Rolle bei der Machtkonsolidierung der Nationalsozialisten Stefan Hermanns Carl Schmitts Rolle bei der Machtkonsolidierung der Nationalsozialisten Ein Engagement auf Zeit Stefan Hermanns Düsseldorf,
Carl Schmitts Rolle bei der Machtkonsolidierung der Nationalsozialisten Stefan Hermanns Carl Schmitts Rolle bei der Machtkonsolidierung der Nationalsozialisten Ein Engagement auf Zeit Stefan Hermanns Düsseldorf,
Wirtschaft und Sprache
 forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 23 Wirtschaft und Sprache Kongreßbeiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.v. Herausgegeben von Bernd Spillner PETER LANG Frankfurt
forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 23 Wirtschaft und Sprache Kongreßbeiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.v. Herausgegeben von Bernd Spillner PETER LANG Frankfurt
Der Landsknecht avec phrase
 Der Landsknecht avec phrase Kirsten Braselmann Der Landsknecht avec phrase Reaktionen von Linksintellektuellen und Republikanern zu Zeiten der Weimarer Republik auf Ernst Jüngers Frühwerk Bibliografische
Der Landsknecht avec phrase Kirsten Braselmann Der Landsknecht avec phrase Reaktionen von Linksintellektuellen und Republikanern zu Zeiten der Weimarer Republik auf Ernst Jüngers Frühwerk Bibliografische
Gesammelte Werke. - Bd. 2,1
 Koch, Robert Gesammelte Werke. - Bd. 2,1 Thieme Leipzig 1912 ebooks von / from Digitalisiert von / Digitised by Humboldt-Universität zu Berlin Gesammelte Werke von isl ROBERT KOCH Zweiter Band Erster Tei
Koch, Robert Gesammelte Werke. - Bd. 2,1 Thieme Leipzig 1912 ebooks von / from Digitalisiert von / Digitised by Humboldt-Universität zu Berlin Gesammelte Werke von isl ROBERT KOCH Zweiter Band Erster Tei
Michael Rufer, Susanne Fricke: Der Zwang in meiner Nähe - Rat und Hilfe für Angehörige zwangskranker Menschen, Verlag Hans Huber, Bern by
 Rufer/Fricke Der Zwang in meiner Nähe Aus dem Programm Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Dieter Frey, München Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg Prof. Dr. Meinrad
Rufer/Fricke Der Zwang in meiner Nähe Aus dem Programm Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Dieter Frey, München Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg Prof. Dr. Meinrad
VORWORT DES VERLAGS...10 VORWORT DES AUTORS DIE URSPRÜNGE DES IMPFENS... 19
 Inhaltsverzeichnis VORWORT DES VERLAGS...10 VORWORT DES AUTORS... 12 DIE URSPRÜNGE DES IMPFENS... 19 VORBETRACHTUNG: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE LEHREN ZUR ENTSTEHUNG VON Krankheiten... 19 Edward Jenner und
Inhaltsverzeichnis VORWORT DES VERLAGS...10 VORWORT DES AUTORS... 12 DIE URSPRÜNGE DES IMPFENS... 19 VORBETRACHTUNG: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE LEHREN ZUR ENTSTEHUNG VON Krankheiten... 19 Edward Jenner und
Gerhard Danzer. Identität. Über die allmähliche Verfertigung unseres Ichs durch das Leben
 Identität Über die allmähliche Verfertigung unseres Ichs durch das Leben Identität Identität Über die allmähliche Verfertigung unseres Ichs durch das Leben Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik
Identität Über die allmähliche Verfertigung unseres Ichs durch das Leben Identität Identität Über die allmähliche Verfertigung unseres Ichs durch das Leben Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik
Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie
 Hans Weiß Gerhard Neuhäuser Armin Sohns Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie Mit 5 Tabellen und 9 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. phil. Hans Weiß, Pädagogische
Hans Weiß Gerhard Neuhäuser Armin Sohns Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie Mit 5 Tabellen und 9 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. phil. Hans Weiß, Pädagogische
Beruf: Soziologe?! Studieren für die Praxis. Bearbeitet von Katrin Späte
 Beruf: Soziologe?! Studieren für die Praxis Bearbeitet von Katrin Späte 1. Auflage 2007. Taschenbuch. 192 S. Paperback ISBN 978 3 8252 2902 3 Format (B x L): 15 x 21,5 cm Weitere Fachgebiete > Philosophie,
Beruf: Soziologe?! Studieren für die Praxis Bearbeitet von Katrin Späte 1. Auflage 2007. Taschenbuch. 192 S. Paperback ISBN 978 3 8252 2902 3 Format (B x L): 15 x 21,5 cm Weitere Fachgebiete > Philosophie,
Gentechnik geht uns alle an!
 Oskar Luger Astrid Tröstl Katrin Urferer Gentechnik geht uns alle an! Ein Überblick über Praxis und Theorie 2. Auflage Gentechnik geht uns alle an! Oskar Luger Astrid Tröstl Katrin Urferer Gentechnik geht
Oskar Luger Astrid Tröstl Katrin Urferer Gentechnik geht uns alle an! Ein Überblick über Praxis und Theorie 2. Auflage Gentechnik geht uns alle an! Oskar Luger Astrid Tröstl Katrin Urferer Gentechnik geht
Verhaltenstherapeutische Hypnose bei chronischem Schmerz
 Verhaltenstherapeutische Hypnose bei chronischem Schmerz Ein Kurzprogramm zur Behandlung chronischer Schmerzen von Stefan Jacobs und Ines Bosse-Düker 2., aktualisierte Auflage Göttingen Bern Wien paris
Verhaltenstherapeutische Hypnose bei chronischem Schmerz Ein Kurzprogramm zur Behandlung chronischer Schmerzen von Stefan Jacobs und Ines Bosse-Düker 2., aktualisierte Auflage Göttingen Bern Wien paris
EMDR und Biofeedback in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen
 EMDR und Biofeedback in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen EMDR und Biofeedback in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen Ein neuropsychotherapeutisches Behandlungsprogramm
EMDR und Biofeedback in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen EMDR und Biofeedback in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen Ein neuropsychotherapeutisches Behandlungsprogramm
Grundkurs Theorien der Sozialen Arbeit
 Philipp Sandermann Sascha Neumann Grundkurs Theorien der Sozialen Arbeit Mit Online-Zusatzmaterial Ernst Reinhardt Verlag München In der Reihe Soziale Arbeit studieren bereits erschienen: Walter, Uta M.:
Philipp Sandermann Sascha Neumann Grundkurs Theorien der Sozialen Arbeit Mit Online-Zusatzmaterial Ernst Reinhardt Verlag München In der Reihe Soziale Arbeit studieren bereits erschienen: Walter, Uta M.:
Bibliotheca Zelteriana
 Bibliotheca Zelteriana Thomas Richter Bibliotheca Zelteriana Rekonstruktion der Bibliothek Carl Friedrich Zelters Alphabetischer Katalog Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar Die Deutsche Bibliothek -
Bibliotheca Zelteriana Thomas Richter Bibliotheca Zelteriana Rekonstruktion der Bibliothek Carl Friedrich Zelters Alphabetischer Katalog Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar Die Deutsche Bibliothek -
Karin Sanders Andrea Kianty. Organisationstheorien
 Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Eine Einführung Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Eine Einführung Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Gideon Botsch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute
 Gideon Botsch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute Geschichte kompakt Herausgegeben von Kai Brodersen, Martin Kintzinger, Uwe Puschner, Volker Reinhardt Herausgeber für den
Gideon Botsch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute Geschichte kompakt Herausgegeben von Kai Brodersen, Martin Kintzinger, Uwe Puschner, Volker Reinhardt Herausgeber für den
Deutsche Biographie Onlinefassung
 Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Schmidt, Paul Hans Karl Constantin Bakteriologe, Immunologe, * 31.8.1882 Düsseldorf, 1.3.1975 Wabern (Kanton Bern). (evangelisch) Genealogie V Ernst (1831
Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Schmidt, Paul Hans Karl Constantin Bakteriologe, Immunologe, * 31.8.1882 Düsseldorf, 1.3.1975 Wabern (Kanton Bern). (evangelisch) Genealogie V Ernst (1831
Vorgänge beim Impfen Postenblätter
 Lehrerinformation 1/12 Arbeitsauftrag Ziel Die Sch bearbeiten in Gruppen eine Werkstatt mit den folgenden Posten: Posten 1: Wer hat das Impfen erfunden? Posten 2: Was passiert im Körper beim Impfen? Posten
Lehrerinformation 1/12 Arbeitsauftrag Ziel Die Sch bearbeiten in Gruppen eine Werkstatt mit den folgenden Posten: Posten 1: Wer hat das Impfen erfunden? Posten 2: Was passiert im Körper beim Impfen? Posten
Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft
 UTB M (Medium-Format) 3104 Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft Bearbeitet von Stefan Jordan 1. Auflage 2010. Taschenbuch. 228 S. Paperback ISBN 978 3 8252 3104 0 Format (B x L): 15 x 21,5
UTB M (Medium-Format) 3104 Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft Bearbeitet von Stefan Jordan 1. Auflage 2010. Taschenbuch. 228 S. Paperback ISBN 978 3 8252 3104 0 Format (B x L): 15 x 21,5
Margret Johannsen. Der Nahost-Konflikt
 Margret Johannsen Der Nahost-Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart Bernhard Frevel Klaus Schubert Suzanne S. Schüttemeyer Die ELEMENTE DER POLITIK sind eine politikwissenschaftliche
Margret Johannsen Der Nahost-Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart Bernhard Frevel Klaus Schubert Suzanne S. Schüttemeyer Die ELEMENTE DER POLITIK sind eine politikwissenschaftliche
Restauration und Vormärz in Deutschland
 Seminarbuch Geschichte 2894 Restauration und Vormärz in Deutschland 1815-1847 Bearbeitet von Alexa Geisthövel 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 250 S. Paperback ISBN 978 3 8252 2894 1 Format (B x L): 15 x
Seminarbuch Geschichte 2894 Restauration und Vormärz in Deutschland 1815-1847 Bearbeitet von Alexa Geisthövel 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 250 S. Paperback ISBN 978 3 8252 2894 1 Format (B x L): 15 x
Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! Aus Becker, R., H.-P.
 Wie wirkt Psychotherapie? Forschungsgrundlagen für die Praxis Herausgegeben von Reinhold Becker Hans-Peter Wunderlich Mit Beiträgen von Reinhold Becker Thomas Elbert Andreas K. Engel Dirk H. Hellhammer
Wie wirkt Psychotherapie? Forschungsgrundlagen für die Praxis Herausgegeben von Reinhold Becker Hans-Peter Wunderlich Mit Beiträgen von Reinhold Becker Thomas Elbert Andreas K. Engel Dirk H. Hellhammer
Impressum. Zarenga GmbH, Bonn Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, Bonn. Alle Rechte sind vorbehalten.
 BORRELIOSE RATGEBER Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich geschützt.
BORRELIOSE RATGEBER Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Andrej Vizjak. Gewinnen gegen die Größten
 Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Erfolgsformeln krisengeschützter Unternehmen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Erfolgsformeln krisengeschützter Unternehmen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Für Oma Christa und Opa Karl. Ihr seid die Besten - Danke.
 Weber, Stefanie: Kreative Wege zum literarischen Text im Spanischunterricht: Enrique Paez: Abdel. Beispiele zum Themenschwerpunkt movimientos migratorios, Hamburg, Bachelor + Master Publishing 2016 Originaltitel
Weber, Stefanie: Kreative Wege zum literarischen Text im Spanischunterricht: Enrique Paez: Abdel. Beispiele zum Themenschwerpunkt movimientos migratorios, Hamburg, Bachelor + Master Publishing 2016 Originaltitel
Video-Marketing mit YouTube
 Video-Marketing mit YouTube Christoph Seehaus Video-Marketing mit YouTube Video-Kampagnen strategisch planen und erfolgreich managen Christoph Seehaus Hamburg Deutschland ISBN 978-3-658-10256-2 DOI 10.1007/978-3-658-10257-9
Video-Marketing mit YouTube Christoph Seehaus Video-Marketing mit YouTube Video-Kampagnen strategisch planen und erfolgreich managen Christoph Seehaus Hamburg Deutschland ISBN 978-3-658-10256-2 DOI 10.1007/978-3-658-10257-9
Das Leibniz-Institut. Beispiele für Natur-Stoffe sind zum Beispiel Zucker oder Proteine. Ein modernes Wort für Natur-Stoff ist: Bio-Molekül.
 Das Leibniz-Institut Das Leibniz-Institut wurde im Jahr 1992 gegründet. 11 Jahre später wurde es in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Dieses Leibniz-Institut nennt man auch: Hans-Knöll-Institut. Die
Das Leibniz-Institut Das Leibniz-Institut wurde im Jahr 1992 gegründet. 11 Jahre später wurde es in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Dieses Leibniz-Institut nennt man auch: Hans-Knöll-Institut. Die
Die konfessionelle Kriegskrankenpflege im 19. Jahrhundert. MedGG-Beiheft. von Annett Büttner. MedGG-Beiheft 47. Franz Steiner Verlag Stuttgart
 MedGG-Beiheft Die konfessionelle Kriegskrankenpflege im 19. Jahrhundert von Annett Büttner MedGG-Beiheft 47 Die konfessionelle Kriegskrankenpflege im 19. Jahrhundert Franz Steiner Verlag Stuttgart ISBN
MedGG-Beiheft Die konfessionelle Kriegskrankenpflege im 19. Jahrhundert von Annett Büttner MedGG-Beiheft 47 Die konfessionelle Kriegskrankenpflege im 19. Jahrhundert Franz Steiner Verlag Stuttgart ISBN
Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 5 Ratgeber Bluthochdruck von Prof. Dr. Dieter Vaitl
 Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 5 Ratgeber Bluthochdruck von Prof. Dr. Dieter Vaitl Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Klaus Grawe, Prof. Dr. Kurt Hahlweg,
Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 5 Ratgeber Bluthochdruck von Prof. Dr. Dieter Vaitl Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Klaus Grawe, Prof. Dr. Kurt Hahlweg,
Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit
 Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Shih-cheng Lien Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Eine Analyse für West-
Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Shih-cheng Lien Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Eine Analyse für West-
Ludger Pries. Transnationalisierung
 Ludger Pries Transnationalisierung Ludger Pries Transnationalisierung Theorie und Empirie grenzüberschreitender Vergesellschaftung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Ludger Pries Transnationalisierung Ludger Pries Transnationalisierung Theorie und Empirie grenzüberschreitender Vergesellschaftung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Klassische Texte der Wissenschaft
 Klassische Texte der Wissenschaft Die Reihe bietet zentrale Publikationen der Wissenschaftsentwicklung der Mathematik und Naturwissenschaften in sorgfältig editierten, detailliert kommentierten und kompetent
Klassische Texte der Wissenschaft Die Reihe bietet zentrale Publikationen der Wissenschaftsentwicklung der Mathematik und Naturwissenschaften in sorgfältig editierten, detailliert kommentierten und kompetent
Bernhard Schmidt. Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer
 Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive
Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive
Ulrike Röttger (Hrsg.) Theorien der Public Relations
 Ulrike Röttger (Hrsg.) Theorien der Public Relations Ulrike Röttger (Hrsg.) Theorien der Public Relations Grundlagen und Perspektiven der PR-Forschung III SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH - + III vs
Ulrike Röttger (Hrsg.) Theorien der Public Relations Ulrike Röttger (Hrsg.) Theorien der Public Relations Grundlagen und Perspektiven der PR-Forschung III SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH - + III vs
Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule
 Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule Schule und Gesellschaft Band 54 Herausgegeben von Franz Hamburger Marianne Horstkemper Wolfgang Melzer Klaus-Jürgen Tillmann Philipp
Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule Schule und Gesellschaft Band 54 Herausgegeben von Franz Hamburger Marianne Horstkemper Wolfgang Melzer Klaus-Jürgen Tillmann Philipp
Der Autor Prof. Erich F. Elstner
 Der Autor Prof. Erich F. Elstner wurde 1939 geboren. Er studierte Chemie, Biologie und Geographie in München und promovierte 1967 in Göttingen zum Dr. rer. nat. (Biochemie). Sein Hauptarbeitsgebiet war
Der Autor Prof. Erich F. Elstner wurde 1939 geboren. Er studierte Chemie, Biologie und Geographie in München und promovierte 1967 in Göttingen zum Dr. rer. nat. (Biochemie). Sein Hauptarbeitsgebiet war
Braumann Information und ihre Bedeutung bei Harninkontinenz. Projektreihe der Robert Bosch Stiftung
 Braumann Information und ihre Bedeutung bei Harninkontinenz Projektreihe der Robert Bosch Stiftung Reihe Multimorbidität im Alter Seit Mitte 2004 eröffnet das Graduiertenkolleg «Multimorbidität im Alter»
Braumann Information und ihre Bedeutung bei Harninkontinenz Projektreihe der Robert Bosch Stiftung Reihe Multimorbidität im Alter Seit Mitte 2004 eröffnet das Graduiertenkolleg «Multimorbidität im Alter»
Reinhardts Gerontologische Reihe Band 33
 a Reinhardts Gerontologische Reihe Band 33 Wilhelm Stuhlmann Demenz braucht Bindung Wie man Biographiearbeit in der Altenpflege einsetzt 2., überarbeitete Auflage Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst
a Reinhardts Gerontologische Reihe Band 33 Wilhelm Stuhlmann Demenz braucht Bindung Wie man Biographiearbeit in der Altenpflege einsetzt 2., überarbeitete Auflage Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst
Markus M. Müller Roland Sturm. Wirtschaftspolitik kompakt
 Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Demenz wie man Bindung und Biographie einsetzt
 Wilhelm Stuhlmann Demenz wie man Bindung und Biographie einsetzt Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. med. Wilhelm Stuhlmann, Erkrath, Diplom-Psychologe und Arzt für
Wilhelm Stuhlmann Demenz wie man Bindung und Biographie einsetzt Mit 3 Abbildungen und 11 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. med. Wilhelm Stuhlmann, Erkrath, Diplom-Psychologe und Arzt für
Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie Grundlagen, Anwendungen in Astrophysik und Kosmologie sowie relativistische Visualisierung
 Sebastian Boblest Thomas Müller Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie Grundlagen, Anwendungen in Astrophysik und Kosmologie sowie relativistische Visualisierung Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie
Sebastian Boblest Thomas Müller Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie Grundlagen, Anwendungen in Astrophysik und Kosmologie sowie relativistische Visualisierung Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie
Behandlungsschwerpunkte in der somatischen Rehabilitation
 Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation Fachgruppe der Sektion Klinische Psychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) e. V. (Hrsg.) Behandlungsschwerpunkte
Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation Fachgruppe der Sektion Klinische Psychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) e. V. (Hrsg.) Behandlungsschwerpunkte
Martin Sebaldt. Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie
 Martin Sebaldt. Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie Martin Sebaldt Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie counterinsurgency als normative und praktische Herausforderung III VSVERLAG
Martin Sebaldt. Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie Martin Sebaldt Alexander Straßner (Hrsg.) Aufstand und Demokratie counterinsurgency als normative und praktische Herausforderung III VSVERLAG
Manfred Velden. Hirntod einer Idee. Die Erblichkeit der Intelligenz. Mit 4 Abbildungen. V& R unipress
 Manfred Velden Hirntod einer Idee Die Erblichkeit der Intelligenz Mit 4 Abbildungen V& R unipress Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Manfred Velden Hirntod einer Idee Die Erblichkeit der Intelligenz Mit 4 Abbildungen V& R unipress Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
brauchen starke Wurzeln Thomas Köhler-Saretzki Wegweiser für den Umgang mit bindungsbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen
 RATGEBER für Angehörige, Betroffene und Fachleute herausgegeben vom Deutschen Verband der Ergotherapeuten e.v. Sichere Kinder brauchen starke Wurzeln 2. überarbeitete Auflage Wegweiser für den Umgang mit
RATGEBER für Angehörige, Betroffene und Fachleute herausgegeben vom Deutschen Verband der Ergotherapeuten e.v. Sichere Kinder brauchen starke Wurzeln 2. überarbeitete Auflage Wegweiser für den Umgang mit
David Reichel. Staatsbürgerschaft und Integration
 David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration VS RESEARCH David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration Die Bedeutung der Einbürgerung für MigrantInnen VS RESEARCH Bibliografische Information der
David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration VS RESEARCH David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration Die Bedeutung der Einbürgerung für MigrantInnen VS RESEARCH Bibliografische Information der
Deutsch für Ärztinnen und Ärzte
 Deutsch für Ärztinnen und Ärzte Ulrike Schrimpf Markus Bahnemann Deutsch für Ärztinnen und Ärzte Trainingsbuch für die Fachsprachprüfung und den klinischen Alltag 4., aktualisierte und erweiterte Auflage
Deutsch für Ärztinnen und Ärzte Ulrike Schrimpf Markus Bahnemann Deutsch für Ärztinnen und Ärzte Trainingsbuch für die Fachsprachprüfung und den klinischen Alltag 4., aktualisierte und erweiterte Auflage
Wolfgang Luthardt. Sozialdemokratfsche Verfassungstheorie in der Weimarer Republik
 Wolfgang Luthardt. Sozialdemokratfsche Verfassungstheorie in der Weimarer Republik Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung Band 78 Wolfgang Luthardt Sozialdemokratische Verfassungs theorie in der
Wolfgang Luthardt. Sozialdemokratfsche Verfassungstheorie in der Weimarer Republik Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung Band 78 Wolfgang Luthardt Sozialdemokratische Verfassungs theorie in der
Labortests für Ihre Gesundheit. Warum und wann Antibiotika? 07
 Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? 07 01IPF Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? Infektionskrankheiten und ihre Behandlung heute und morgen Heutzutage ist
Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? 07 01IPF Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? Infektionskrankheiten und ihre Behandlung heute und morgen Heutzutage ist
Hans Zehetmair (Hrsg.) Politik aus christlicher Verantwortung
 Hans Zehetmair (Hrsg.) Politik aus christlicher Verantwortung Hans Zehetmair (Hrsg.) unter Mitarbeit von Philipp W. Hildmann Politik aus christlicher Verantwortung Bibliografische Information Der Deutschen
Hans Zehetmair (Hrsg.) Politik aus christlicher Verantwortung Hans Zehetmair (Hrsg.) unter Mitarbeit von Philipp W. Hildmann Politik aus christlicher Verantwortung Bibliografische Information Der Deutschen
Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel
 Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel Ulrike Schäfer Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie: Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz
Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel Ulrike Schäfer Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie: Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz
Gradle. Ein kompakter Einstieg in modernes Build-Management. Joachim Baumann. Joachim Baumann, Gradle, dpunkt.verlag, ISBN
 D3kjd3Di38lk323nnm Joachim Baumann Gradle Ein kompakter Einstieg in modernes Build-Management Joachim Baumann joachim.baumann@codecentric.de Lektorat: René Schönfeldt Copy Editing: Sandra Gottmann, Münster-Nienberge
D3kjd3Di38lk323nnm Joachim Baumann Gradle Ein kompakter Einstieg in modernes Build-Management Joachim Baumann joachim.baumann@codecentric.de Lektorat: René Schönfeldt Copy Editing: Sandra Gottmann, Münster-Nienberge
Birgit Baur-Müller. Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin. Von der Musterdiagnose zur Rezeptur
 Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose zur Rezeptur Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose
Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose zur Rezeptur Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Matthias Moßburger. Analysis in Dimension 1
 Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Sport. Silke Hubrig. Afrikanischer Tanz. Zu den Möglichkeiten und Grenzen in der deutschen Tanzpädagogik. Examensarbeit
 Sport Silke Hubrig Afrikanischer Tanz Zu den Möglichkeiten und Grenzen in der deutschen Tanzpädagogik Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information
Sport Silke Hubrig Afrikanischer Tanz Zu den Möglichkeiten und Grenzen in der deutschen Tanzpädagogik Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information
Assessments in der Rehabilitation
 Gesundheitsberufe Physiotherapie Peter Oesch Roger Hilfiker Sonja Keller Jan Kool Hannu Luomajoki Stefan Schädler Amir Tal-Akabi Martin Verra Colette Widmer Leu mit cd-rom Assessments in der Rehabilitation
Gesundheitsberufe Physiotherapie Peter Oesch Roger Hilfiker Sonja Keller Jan Kool Hannu Luomajoki Stefan Schädler Amir Tal-Akabi Martin Verra Colette Widmer Leu mit cd-rom Assessments in der Rehabilitation
Schriftspracherwerb. Iris Füssenich Cordula Löffler. Einschulung, erstes und zweites Schuljahr. Ernst Reinhardt Verlag München Basel
 Iris Füssenich Cordula Löffler Schriftspracherwerb Einschulung, erstes und zweites Schuljahr Mit 42 Abbildungen und 21 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. Iris Füssenich, Professorin für
Iris Füssenich Cordula Löffler Schriftspracherwerb Einschulung, erstes und zweites Schuljahr Mit 42 Abbildungen und 21 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. Iris Füssenich, Professorin für
Standardisierte Diagnostik
 Standardisierte Diagnostik 1. Gute Therapeut-Patient-Beziehung aufbauen 2. Kategorien des ICD-10 verwenden 3. Leitfaden benutzen 4. Fragebogen spezifisch einsetzen, insbesondere Depressivität erfassen
Standardisierte Diagnostik 1. Gute Therapeut-Patient-Beziehung aufbauen 2. Kategorien des ICD-10 verwenden 3. Leitfaden benutzen 4. Fragebogen spezifisch einsetzen, insbesondere Depressivität erfassen
Kirsten Büsing Anne Büsing. Alumnen und ihre Exlibris
 Kirsten Büsing Anne Büsing Alumnen und ihre Exlibris Kirsten Büsing Anne Büsing Alumnen und ihre Exlibris 600 Jahre Universität Leipzig Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die
Kirsten Büsing Anne Büsing Alumnen und ihre Exlibris Kirsten Büsing Anne Büsing Alumnen und ihre Exlibris 600 Jahre Universität Leipzig Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die
Experimente in der Politikwissenschaft
 Experimente in der Politikwissenschaft Ina Kubbe Experimente in der Politikwissenschaft Eine methodische Einführung Ina Kubbe Institut für Politikwissenschaft Leuphana Universität Lüneburg Lüneburg Deutschland
Experimente in der Politikwissenschaft Ina Kubbe Experimente in der Politikwissenschaft Eine methodische Einführung Ina Kubbe Institut für Politikwissenschaft Leuphana Universität Lüneburg Lüneburg Deutschland
Frauen im Schwangerschaftskonflikt
 Geisteswissenschaft Susanne Kitzing Frauen im Schwangerschaftskonflikt Die Rolle der Schwangerschaftskonfliktberatung, die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch und seine Folgen Diplomarbeit Bibliografische
Geisteswissenschaft Susanne Kitzing Frauen im Schwangerschaftskonflikt Die Rolle der Schwangerschaftskonfliktberatung, die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch und seine Folgen Diplomarbeit Bibliografische
Die Epidemiologie der Pest
 Hugo Kupferschmidt Die Epidemiologie der Pest Der Konzeptwandel in der Erforschung der Infektionsketten seit der Entdeckung des Pesterregers im Jahre 1894 1993 Verlag Sauerländer Aarau Frankfurt am Main
Hugo Kupferschmidt Die Epidemiologie der Pest Der Konzeptwandel in der Erforschung der Infektionsketten seit der Entdeckung des Pesterregers im Jahre 1894 1993 Verlag Sauerländer Aarau Frankfurt am Main
